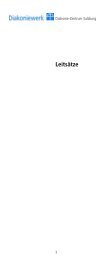MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
MS-Bro 2005_Kern - Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
33. Martinstift-Symposion<br />
<strong>2005</strong><br />
Herbstzeit<br />
Lebensqualität für<br />
Menschen mit Behinderung<br />
im Alter
Herbstzeit<br />
Lebensqualität für Menschen mit<br />
Behinderung im Alter<br />
Vorträge<br />
33. Martinstift-Symposion<br />
<strong>2005</strong><br />
veranstaltet vom<br />
Evangelischen <strong>Diakoniewerk</strong> <strong>Gallneukirchen</strong><br />
in Zusammenarbeit mit der<br />
Fachgruppe Behindertenhilfe<br />
der DIAKONIE Österreich<br />
in der Gusenhalle<br />
<strong>Gallneukirchen</strong><br />
Freitag, 7. Oktober <strong>2005</strong>
Inhalt<br />
Seite<br />
Begrüßung und Eröffnung<br />
Dr. Heinz Thaler, Vorstandsmitglied <strong>Diakoniewerk</strong> 5<br />
Dr. Karl Heinz Bierlein<br />
„Die begrenzte Zeit – Spielraum der Freiheit?“ 7<br />
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker<br />
„Lebenserwartung und Erwartung an das Leben“ 25<br />
Dr. med. Christina Ding-Greiner<br />
Begegnung zweier Welten – Was Altenhilfe und Behindertenhilfe<br />
voneinander lernen können 51<br />
Prof. Mag. Rudolf Sotz<br />
Neue Wege gehen – Die Ausbildungsreform der<br />
Sozialbetreuungsberufe in Österreich 61<br />
Dr. Karl Winding<br />
Diplom- und Fach-SozialbetreuerIn als neu geregelte Sozialberufe 61<br />
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker<br />
KompAs – Kompetentes Altern sichern 65<br />
Dr. med. Christina Ding-Greiner<br />
Lebensqualität im Alter bei Menschen mit geistiger Behinderung 69<br />
Mag. Harry F. J. Urlings<br />
Respektvolle und methodische Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit einer intellektuellen Behinderung 75<br />
2<br />
Aussteller und Mitwirkende<br />
■ Bücherinsel<br />
■ Werkstätte <strong>Gallneukirchen</strong><br />
■ Gärtnerei Friedenshort<br />
■ LifeTool<br />
■ Band „Together“<br />
Medieninhaber und Herausgeber:<br />
<strong>Evangelisches</strong> <strong>Diakoniewerk</strong> <strong>Gallneukirchen</strong><br />
A-4210 <strong>Gallneukirchen</strong><br />
Martin Boos-Straße 4<br />
Telefon 07235 / 63251-0<br />
www.diakoniewerk.at<br />
E-Mail: oea@diakoniewerk.at<br />
3
4<br />
Dr. Heinz Thaler, Vorstandsmitglied<br />
Begrüßung und Eröffnung<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Sie erinnern sich an das Bild auf der Einladung. Ein junger, alter Mann mit Behinderung,<br />
zufrieden lächelnd – er ist 58 Jahre. Was braucht es, dass sein Leben<br />
lebenswert bleibt?<br />
In der Sozialforschung und speziell in der Psychotherapie-Forschung gibt es<br />
mittlerweile zahlreiche Untersuchungen mit dem Ansatz, dass sie vom „zufriedenen<br />
Menschen“ ausgehen.<br />
Abraham Maslow war der erste, der diese Methode verwendete und ist dabei<br />
auf die „basic needs“ gekommen. Was braucht der Mensch, um zufrieden zu<br />
sein? Hierarchisch geordnet stehen körperliche Bedürfnisse an erster und unterster<br />
Stelle: Das sind Nahrung, Kleidung und körperliche Gesundheit. Darauf aufbauend<br />
Geborgenheit/Sicherheit, Zugehörigkeit/soziale Kontakte, Wertschätzung/Prestige.<br />
Und an oberster Stelle die Verwirklichung des Selbst.<br />
Im Alter steht der Körper mit all seinen Begleiterscheinungen wieder im Mittelpunkt<br />
und beeinflusst den Menschen in seiner Ganzheit, manchmal dominiert er<br />
ihn auch.<br />
Wir als Mitarbeiter sind gefordert, diese alten Menschen mit Behinderung, die<br />
in Zukunft verstärkt auf uns zukommen, zu begleiten, dass sie mit all ihren<br />
Besonderheiten des Alterns in Würde und Zufriedenheit ihren Lebensabend verbringen.<br />
Das heutige 33. Martinstift-Symposion wird im Laufe des Tages Antworten<br />
geben, aber auch neue Fragen aufwerfen.<br />
Ich wünsche uns eine gute Auseinandersetzung zum Thema<br />
„Herbstzeit“ – Lebensqualität für Menschen mit Behinderung im Alter.<br />
5
6<br />
Dr. Karl Heinz Bierlein, Rummelsberg<br />
„Die begrenzte Zeit –<br />
Spielraum der Freiheit?“<br />
Philosophisch-theologische Betrachtungen<br />
zum Leben im Alter<br />
„Die verliebte Alte“ so lautet der Titel eines eindrucksvollen Ölgemäldes aus<br />
der Schule von Lucas Cranach d.Ä. (1472–1553). Es zeigt eine schön herausgeputzte,<br />
aber hässliche alte Frau, die einem gut aussehenden jungen Mann mit<br />
der linken Hand einen prallen Geldbeutel reicht, mit der rechten streichelt sie<br />
ihm die Wange. Eine bildhübsche junge Frau bietet der reichen, alten Frau ein<br />
Glas Wein an.<br />
Ist das die Zukunft des Alters?<br />
Frank Schirrmacher beschreibt in seinem Buch „Das Methusalem-Komplott“<br />
einen Krieg der Generationen als ältesten und modernsten Krieg, einerseits weil<br />
er biologisch programmiert sei, andererseits weil er seit Jahrtausenden in der<br />
Menschheit nur als psychologischer Krieg, als Krieg mit Worten und Demütigungen<br />
geführt wird. Diese Kriegsführung zerstört das Selbstbewusstsein des Menschen,<br />
indem sie dem Alternden das Vertrauen in die Schönheit, seine fünf Sinne<br />
und vor allem seinen Verstand raubt. Dahinter verberge sich ein Konflikt von<br />
Alter und Ökonomie, wie es schon bei Hesiod vor 2700 Jahren heißt: Die Jungen<br />
verfluchen die Alten, sie fahren sie mit hässlichen Worten an, geben dann auch<br />
nicht ihren greisen Erzeugern das Entgelt für die Aufzucht zurück.<br />
Solange allerdings der Generationenvertrag funktionierte, hat man die brutale<br />
ökonomische Substanz des Kampfes von Jung und Alt vergessen. Heute sind die<br />
über 65 Jährigen nicht aus dem ökonomischen Kreislauf ausgeschieden. Sie können<br />
sehr aktiv und produktiv sein und heute die Gesellschaft in einem hohen<br />
Maße mitgestalten.<br />
Das Alter hat dann Zukunft, wenn das Leben nicht von einem unseligen „Immer-<br />
Weiter“ bestimmt ist, vielmehr geht es darum, die Möglichkeiten und Grenzen<br />
wahrzunehmen und selbstverantwortlich sein Leben zu gestalten. Das Alter wird<br />
dann zur Chance, wenn man offen ist für die Zukunftspotentiale. Krisen entste-<br />
7
hen durch Abbrüche und Umbrüche im Lebenslauf. Kritische Ereignisse sind<br />
das Ende des Erwerbslebens, Verlust von sozialen Beziehungen, Gesundheitsprobleme,<br />
Veränderung der Wohnsituation und Verlust materieller Ressourcen.<br />
Gelingt es, bei Brüchen im Lebenslauf sich neu zu orientieren und aufzubrechen?<br />
Immer mehr weicht die Biographie des einzelnen von einem Normalverlauf ab.<br />
Dadurch wächst das Bedürfnis, sich der Vergangenheit und der Zukunft selbst<br />
zu vergewissern: „Haben sich die Mühen gelohnt? Wozu bin ich (noch) da?<br />
Habe ich es richtig gemacht, um auch später glücklich und zufrieden sein zu können?“<br />
Alter ist nicht von vornherein mit Störfall und Defizit zu charakterisieren, denn<br />
Alternsprozesse verlaufen nicht einheitlich. So können für ein und dieselbe<br />
Person sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe erkennbar werden. Es läßt<br />
sich manchmal aus körperlicher Sicht viel stärker ein Abbau beobachten,<br />
während in seelischer und sozialer Perspektive Wachstum und Fortschritt möglich<br />
sind. Deshalb ist es notwendig, das Altern zu differenzieren und aus philosophischer,<br />
psychologischer, sozialer und theologischer Sichtweise zu beschreiben.<br />
1. Ewig leben?<br />
Ewig leben – wer möchte das schon? Die Sehnsucht nach ewiger Jugend steckt<br />
in jedem Menschen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Lebenserwartung des<br />
Menschen durch Eingriff in den genetischen Bereich immer weiter hinausschieben<br />
läßt. Schwere chronische oder generative Erkrankungen können dann durch<br />
Beeinflussung der genetischen Information gelindert oder gar vermieden werden.<br />
Die biologische Erforschung der Alternsprozesse beschäftigt sich vor allem mit<br />
der Frage, ob sich die genetischen Faktoren des Älterwerdens substantiell beeinflussen<br />
lassen oder ob die biologische Uhr des Menschen einfach abläuft. Wie<br />
rasch wir altern, mit welcher Intensität, mit wie viel Defiziten, welche Risikofaktoren<br />
und Krankheiten im Alter auftreten, das ist offensichtlich schon durch die<br />
Genetik in einer bestimmten Folge festgelegt.<br />
Biologen sagen, dass die Art und Weise, wie wir altern, entscheidend mit dem<br />
Lebensstil verknüpft ist. Gene können durch schädliche Substanzen geschädigt<br />
werden. Durch einen ungesunden Lebensstil schwächen wir die biologische Konstitution.<br />
Ja, manche Forscher sagen, dass der Lebensstil in der zweiten Lebens-<br />
8<br />
hälfte immer wichtiger für das biologische Altern wird. Ein gesundes Leben<br />
wirkt sich erheblich auf die Faktoren der Genetik aus.<br />
Eine besondere Herausforderung, die das hohe Lebensalter mit sich bringt, ist<br />
die Gefahr der dementiellen Erkrankung. Ab dem 80. Lebensjahr liegt die Häufigkeit<br />
der Demenz zwischen 18 % bis 23 %, bei über 90-Jährigen zwischen<br />
37 % und 39 %. Ob dies auf eine Überforderung des Gehirngewebes aufgrund<br />
eines langen Lebens zurückzuführen ist oder ob ungünstige biologisch-genetische<br />
Faktoren auftreten, ist derzeit noch nicht sicher. Entscheidend ist, dass es<br />
ein hohes Demenz-Risiko im hohen Alter gibt. Das Wissen um dieses Risiko beeinflusst<br />
das Lebensgefühl im 7. und 8. Lebensjahrzehnt erheblich, die Sorge,<br />
selbst einmal an Demenz zu leiden, wächst.<br />
2. Psychologische Perspektiven<br />
Die Krise des Alters bedeutet für nicht wenige eine Minderung der Leistungsund<br />
Veränderungsfähigkeit. Das Zentrale Nervensystem ist Veränderungen ausgesetzt.<br />
Die Verarbeitung aktueller Informationen im Arbeitsgedächtnis wird<br />
schwächer.<br />
Doch das Zentrale Nervensystem ist selbst nach schweren Störungen immer<br />
wieder zu neuen Anpassungen fähig. Ein schönes Beispiel ist die Rehabilitation<br />
von Schlaganfallpatienten. Zwar sind durch den Schlaganfall bestimmte Gewebe<br />
unwiederbringlich zerstört, aber ein Nachbargewebe kann nach und nach Funktionen<br />
des geschädigten Gewebes übernehmen. So gelingt es durch gezielte Behandlung,<br />
das Sprachvermögen teilweise wieder herzustellen. Was viele Organe<br />
unseres Körpers vermissen lassen, trifft auf unser Gehirn nicht zu: Es kann sich<br />
in einem erstaunlichen Maße regenerieren.<br />
Mentales und motorisches Training tragen erheblich dazu bei, dass Kompetenz<br />
und Selbständigkeit auch im hohen Lebensalter erhalten bleiben. „Was Hänschen<br />
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ – dieser traditionelle Grundsatz hat<br />
seine Gültigkeit verloren.<br />
Es ist zwar eine Binsenweisheit: Junge Menschen lernen schneller, ältere benötigen<br />
mehr Zeit. Doch entscheidend ist das Wissen, das tiefer als im aktuellen Arbeitsspeicher<br />
sitzt. Es gibt Wissenssysteme in Bezug auf berufliche Tätigkeiten,<br />
biographisches Wissen im sicheren Umgang mit Lebensfragen und Expertenwissen,<br />
das wir im Lauf des Lebens für ganz bestimmte Lebensbereiche erworben<br />
haben. Die Chance des Alters liegt – relativ unabhängig vom Zentralen Nerven-<br />
9
system – im Aufbau von Erfahrungswissen, im Aufbau von Lernstrategien, die<br />
einem helfen, auch komplizierte Situationen zu meistern.<br />
Der römische Philosoph Cicero meint: „Alte Leute wissen alles, worum sie<br />
sich Sorgen machen: anberaumte Gerichtstermine, ihre Schuldner und ihre<br />
Gläubiger. Nur eifriges Interesse braucht weiterzuwirken, dann bleiben die<br />
Geisteskräfte im Alter erhalten.“<br />
Die Lernfähigkeit im Alter ist im Wesentlichen vom Interesse an der Welt und an<br />
den Dingen, die einen persönlich betreffen, abhängig. Wer in Sorge steht für andere<br />
Menschen oder für eine persönlich bedeutsame Sache, kann seine seelischen<br />
und geistigen Kräfte besser erhalten als einer, der das Gefühl hat, all sein<br />
Tun und Lassen ist für niemanden mehr von Bedeutung.<br />
Das höhere Lebensalter ist an sich kein Gewinn, das Mehr an Jahren ergibt aber<br />
eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich bewusst und verantwortlich mit Lebensaufgaben<br />
auseinandergesetzt zu haben. Diese Kompetenz ist Ausdruck eines seelischen<br />
Reifeprozesses.<br />
Die Konfrontation mit der begrenzten Zeit legt ein neues, ein existentielles Gewicht<br />
in die noch verbleibende Lebenszeit. Zeit wird intensiver erlebt und<br />
genützt. Aufgaben erhalten eine neue Dringlichkeit. Die Hoffnung auf das<br />
„kleine Glück“ am morgigen Tag zählt mehr als die großen Hoffnungen einer<br />
ungewissen Zukunft. Maßstäbe verändern sich durch die Konfrontation mit<br />
Grenzen.<br />
Entscheidend für einen positiven Verlauf des Älterwerdens ist das Maß an Ressourcen,<br />
mit dem man Verluste kompensieren kann und offen ist für Entwicklungen,<br />
die aufgrund von tiefgreifenden Veränderungen körperlicher, seelischer,<br />
geistiger und materieller Konstitutionen angestoßen werden.<br />
3. Sozialkontakte im Alter<br />
Es ist ein beliebtes Klischee, dass Menschen im Alter grundsätzlich vereinsamt,<br />
krank, hilflos und gar trottelig seien. In stereotypen Altersbildern werden Eigenschaften,<br />
Erwartungshaltungen und Verhaltensweisen älteren Menschen zugeschrieben.<br />
Die Folge ist, man nimmt nur das wahr, was man immer schon als<br />
negatives Bild sich vorgestellt hat und übersieht die positiven Seiten. Vorurteile<br />
verfestigen sich und wirken sich auf das Selbstbild älterer Menschen aus.<br />
Auch Angehörige und Mitarbeitende in der Altenarbeit verhalten sich dann so,<br />
wie es dem Altersbild entspricht.<br />
10<br />
Welche Rollen, welche Aufgaben, welche Funktionen weist die Gesellschaft<br />
Menschen im höheren Lebensalter zu? Gibt es neue Rechte und Pflichten wie in<br />
jüngeren Lebensjahren? Oder ist das Alter die Zeit der Entpflichtung durch die<br />
Gesellschaft?<br />
Das Alter wird immer länger. Die maximale Lebensspanne erreichen immer mehr<br />
Menschen und das Lebensalter, mit dem wir aus dem Erwerbsleben ausscheiden,<br />
wird immer weiter nach vorne gezogen. So gilt bereits ein 45-Jähriger aus der<br />
Sicht der Arbeitsvermittlung als „älterer“ Mensch. Wann das Alter beginnt, legt<br />
die Gesellschaft fest.<br />
Viele Menschen definieren sich über die Maßstäbe des Erwerbslebens. Nach der<br />
Pensionierung stellt sich die Frage: Was trägt meine Existenz?<br />
Man muss rechtzeitig beginnen, sich ein Nebenamt zu suchen, das einem Raum<br />
für sinnerfülltes Engagement bietet. Dabei geht es nicht um die bloße Fortsetzung<br />
gewohnter Tätigkeiten, so dass man selbst den Eindruck hat, die Berufstätigkeit<br />
geht durch die Ehren- und Nebenämter einfach weiter. Bürgerschaftliches,<br />
ehrenamtliches Engagement ist von anderen Maßstäben geleitet: Freiwilligkeit<br />
der Beziehung, selbst gewählter Zeiteinsatz, Anerkennung statt Entlohnung,<br />
persönliche Sinnerfüllung, kein Hierarchiegefälle wie in einem Arbeitsverhältnis,<br />
Entdecken neuer Kommunikationsmöglichkeiten.<br />
Wie gestalten sich die Sozialkontakte im höheren Alter? Vereinsamung droht bei<br />
allen, die nicht mehr in der Lage sind, sich zu engagieren. Pensionierung, Verlust<br />
von Angehörigen und Bekannten, mangelnde Mobilität führen zu tiefgreifenden<br />
Veränderungen in den Sozialkontakten. Es ist richtig, dass familiäre Beziehungen<br />
durch die räumliche Distanz zu Kindern und Enkelkindern leiden können. Die<br />
Partnerbeziehung verändert sich mit dem Ende des Berufslebens: Der berufsbedingte<br />
Rhythmus von Nähe und Distanz entfällt, die Aufgabenverteilung im<br />
Haushalt und im Freizeitbereich erhält eine neue Akzentuierung. Ein neuer Zeitrhythmus<br />
entsteht. Der Bekanntenkreis bildet sich neu, es entfallen die beruflichen<br />
Kontakte.<br />
Entscheidend ist, dass Sozialkontakte nicht so sehr durch ihre Quantität, sondern<br />
durch ihre Qualität bestimmt werden. Einsamkeitsgefühle entstehen dann,<br />
wenn die Erwartungen an Kontakte mit bestimmten, vertrauten Personen nicht<br />
erfüllt werden. Einsamkeit ist von sozialer Isolation zu unterscheiden:<br />
In einem Pflegeheim klagt eine 82-jährige Frau dem Seelsorger, dass sie den<br />
ganzen Tag noch keinen einzigen Menschen gesehen habe. Nachfragen ergeben<br />
aber, dass im Laufe des Tages zahlreiche Kontakte durch Bekannte<br />
11
12<br />
und Mitarbeitende stattgefunden haben. Allerdings wartet die Bewohnerin<br />
seit Tagen auf einen Anruf ihres Sohnes. Es ist verständlich, dass trotz zahlreicher<br />
Kontakte das Gefühl der Einsamkeit entsteht, weil die Erwartung an<br />
den besonders wichtigen Kontakt nicht erfüllt worden ist.<br />
Bei der innerfamiliären Kontaktpflege sind die Erwartungen häufig höher als sie<br />
im Alltag realisiert werden können. Gravierende Belastungspunkte sind der<br />
Mangel an Kommunikation und an Verständnis für die Lebenswelt jüngerer Familienmitglieder.<br />
Besonders bereichernd erleben es ältere Menschen, wenn sie<br />
sich mit dem Ergehen und den Leistungen der Kinder und Enkelkinder identifizieren<br />
können. Die Kontinuität von Lebensgeschichte wird vor allem im Weitergehen<br />
von Familiengeschichte gesehen.<br />
Außerfamiliäre Kontaktpflege mit Freunden und Bekannten gewinnt einen höheren<br />
Stellenwert. Häufig ist es die Gruppe der Gleichaltrigen, der man sich zugehörig<br />
fühlt. Der Austausch von Erfahrungen, gegenseitige Anregungen für das<br />
Alltagsleben, die Pflege gemeinsamer Interessen, die Identifikation mit einer<br />
gemeinsamen Geschichte und wechselseitige Hilfeleistung sind Ausdruck gelingender<br />
Beziehungen.<br />
4. Theologische Aspekte des Alters<br />
4.1 Konfrontation mit der Endlichkeit<br />
Im Alten Testament finden sich viele Erzählungen, die von großer Ehrfurcht vor<br />
dem Alter sprechen. Der Segen der Alten ist höchstes Gut. Weisheit und Lebenskenntnis<br />
der Alten stehen hoch im Kurs. Altwerden konnte damals auch heißen:<br />
„Graue Haare sind eine Krone der Ehre; auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie<br />
gefunden“ (Sprüche 16,31). Ein langes irdisches Leben wird als Gottesgeschenk<br />
und als Ausdruck von besonderem Segen verstanden. Von den Patriarchen heißt<br />
es: „Er starb alt und lebenssatt.“ Man konnte getrost auf das Ende des Lebens<br />
warten. „Lebenssatt“ war nicht mit Lebensüberdruss, sondern mit erfülltem<br />
Leben gleichzusetzen.<br />
Das Alter ist aber auch die Zeit zunehmender Schwäche: Die Arme zittern, der<br />
Rücken wird krumm, Zähne fallen aus, die Augen werden schwach, man hört<br />
schlecht, die Stimme wird brüchig, das Gehen macht Mühe, kein Potenzmittel<br />
hilft mehr – kurzum: Es sind die bösen Tage, „da wirst du sagen: Sie gefallen mir<br />
nicht mehr" (Prediger 12, 1-7). Diese Sicht steht unter dem Bilanzsatz „Alles ist<br />
vergeblich“, der Mensch erfährt sich als Gefangener der Zeit, für den die Vergangenheit<br />
und die Zukunft entwertet ist.<br />
Und heute? Viele fliehen vor der Erkenntnis, dass alles, was wir in unserem<br />
Leben anfangen und betreiben, erleben und gestalten, ein Ende haben muss.<br />
Denn dem Lebendigen soll das Lob gesungen werden, nicht dem Morbiden.<br />
Das Ende bedeutet schließlich den Verlust der Möglichkeit, sich zu entwickeln. Es<br />
schreibt das Gelebte, das Erreichte, aber auch das Ungelebte und Unerreichte im<br />
Lauf des Lebens fest. Wer möchte schon am Ende sein, wenn alles um einen<br />
herum zu neuen Ufern aufbricht? Kein Wunder also, wenn man das Ende hinauszögert,<br />
verlängert, verdrängt und verleugnet, solange es nur geht. Man kann<br />
sich leicht der Notwendigkeit entziehen, etwas zu Ende zu bringen. Und: es<br />
bleibt oft nicht viel Platz, sich der Endlichkeit des Lebens zu stellen.<br />
Indes man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass unser Ende uns nichts<br />
angeht, so wie einmal der Philosoph Epikur gewitzelt hat: Das schauerlichste<br />
Übel, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir sind, ist der Tod nicht da,<br />
und wenn er da ist, sind wir nicht da.<br />
Heute ist heute, morgen ist morgen – diese Einstellung entspringt dem Bedürfnis,<br />
sich die Gegenwart weder durch quälende Vergangenheitsanalyse noch<br />
durch ängstliche Zukunftsprognose verderben zu lassen.<br />
Dem steht das biblische Wort entgegen:<br />
„Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss.“ (Psalm 39, 5)<br />
Die Worte aus dem Psalm gehen von der Erfahrung aus, dass die Endlichkeit des<br />
Lebens den Menschen auf sich selbst zurückwirft, ihn ausweglos mit sich selbst<br />
konfrontiert und ihn in die Einsamkeit treibt.<br />
Es macht nachdenklich, dass der Mensch, der die Zeichen der Endlichkeit an Leib<br />
und Seele trägt, Gott trotzdem noch um die Erkenntnis bittet, ihn das Ende zu<br />
lehren. Offenbar spürt der Beter des Psalms, während er sich seiner Endlichkeit<br />
erschreckend bewusst wird, dass er vor Gott nicht anonym verendet, sondern<br />
dass Gott ihm in seinem Ende noch einmal auf neue Weise begegnen kann und<br />
seinem Leben ein Ziel schenkt.<br />
Nur in der Gewissheit, dass ich das Leben nicht selbst abschließen und zu einem<br />
guten Ziel führen kann, läßt sich die Endlichkeit des Lebens annehmen.<br />
Wer von Endlichkeit spricht, weckt zunächst negative Gefühle, der christliche<br />
Denkhorizont verstärkt diese Tendenz. Deshalb ist vor einem grundlegenden<br />
und beliebten Missverständnis zu warnen.<br />
13
Die Beschäftigung mit der Endlichkeit darf nicht dazu führen, dass die Vitalität,<br />
das Schöne und das Kraftvolle, die Lust am Entdecken, der Aufbruch zu Neuem<br />
verächtlich gemacht wird. „Alles hat ein Ende“ – die Allerweltsweisheit darf<br />
nicht zu schulmeisterlicher Belehrung oder gar zur pfäffischen Weltverachtung<br />
ausarten, die der Lebensfreude einen Sack der Traurigkeit überstülpt und den<br />
Keim des neuen Lebens erstickt.<br />
Wir müssen wieder neu buchstabieren lernen, dass das Leben auf ein Ende<br />
zuläuft, das im Zeichen der Vollendung steht. Das scheint alles andere als<br />
selbstverständlich zu sein. In der Bibel wird dasselbe Wort für „Ende“ und „Ziel“<br />
gebraucht: Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.<br />
Dann ist das Ende nicht Abbruch oder Ergebnis des Verendens, vielmehr gewinnt<br />
es als Ziel in der Zukunft gestaltende Kraft für die Gegenwart.<br />
„Alles hat sein Ende und sein Ziel“ – das ist die geistliche Erkenntnis, die aus<br />
dem Glauben an Gott, den Schöpfer und Souverän über die Zeit entspringt.<br />
Dann ist es tröstlich zu wissen, dass das Leben nicht unendlich ist und dass<br />
unser Drang nach immer mehr Leben von Gott gnädig begrenzt ist. Wer die Endlichkeit<br />
annehmen kann, wird inmitten noch so großer Unruhe entdecken, wie<br />
das Leben an Tiefe und an Dynamik gewinnt.<br />
4.2 Verantwortung der Generationen<br />
Das Neue Testament ermahnt die Jungen zur Achtung vor den Alten, umgekehrt<br />
heißt es aber auch: „Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn“ (Eph. 6, 1-<br />
4). Es wird erinnert an das 4.Gebot: „Du sollst deinen Vater und deine Mutter<br />
ehren“ – das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat: ‘auf dass dir’s<br />
wohlgehe und du lange lebst auf Erden (5. Mose 5,16)’“. Dies meint nicht nur<br />
die Autorität vor den Älteren, sondern die Aufforderung zur Fürsorge und Schutz<br />
der schwächer werdenden Eltern. Sonst legt sich Fluch über das Leben. In dieser<br />
gegenseitigen Zuordnung von Jungen und Alten beginnt sich das Schema von<br />
Unter- und Überordnung zugunsten einer gemeinsamen, partnerschaftlichen<br />
Verantwortung vor Gott aufzulösen.<br />
Eine einseitige Wertschätzung des Alters findet sich jedoch nicht: Vielmehr<br />
wird die Kraft des Vertrauens bei den „Kindern“ von Jesus besonders betont:<br />
Das Vertrauen ungeteilt dem „Reich Gottes“ zuzuwenden, ist wichtiger als die<br />
Autorität der Alten (Mk 10,15).<br />
14<br />
5. Zukunftsperspektive im Alter<br />
Es hat einer einmal gesagt: Wir müssen das Leben nach rückwärts gewandt<br />
verstehen und nach vorwärts gewandt leben. Biographisches Arbeiten gehört<br />
heute zu den Standards in der Altenarbeit, in der Seelsorge, Pflege und Betreuung<br />
älterer Menschen. In der Lebensgeschichte geht es um Vergewisserung der<br />
Gegenwart und um Orientierung für die Zukunft.<br />
Viele ältere Menschen betrachten die Frage nach der Zukunft als Zumutung:<br />
„Was kann man im Alter noch von der Zukunft erwarten? Der Jugend gehört die<br />
Zukunft, dem Alter die Vergangenheit!“ Differenzierte Nachfragen lassen jedoch<br />
häufig eine Vielfalt von Hoffnungen und Erwartungen erkennen. Ein wichtiges<br />
Indiz für die Offenheit gegenüber der Zukunft ist das Ausmaß der Zukunftspläne<br />
(die nächste Reise, der Besuch bei Angehörigen) und der Hoffnung auf kommende<br />
Ereignisse (Jubiläen, Geburt eines Enkels).<br />
Im Gegensatz zu jüngeren Menschen kann die zeitliche Ausdehnung der Zukunftsperspektive<br />
geringer sein, aber das Zeiterleben verändert sich qualitativ:<br />
Die verbleibende Zeit soll intensiv genützt werden, Aufgaben erhalten eine neue<br />
Dringlichkeit, die Hoffnung auf das „kleine“ Glück am morgigen Tag zählt mehr<br />
als die großen Hoffnungen einer ungewissen Zukunft. Die Maßstäbe verändern<br />
sich, weil die Zeit begrenzt ist. Man will die Spielräume nutzen, die das Leben<br />
noch bietet.<br />
Entscheidend für die Bildung einer Zukunftsperspektive ist die Fähigkeit, sich mit<br />
einem „Machtvollen“ jenseits der eigenen Endlichkeit zu identifizieren: Kraft<br />
überträgt sich, wenn man sich mit dem Tun und Ergehen von emotional nahestehenden<br />
Menschen identifiziert. Die Gewissheit, dass ein „Lebenswerk“ weiterbesteht<br />
und man über das eigene Ende in der nachfolgenden Generation<br />
weiterlebt, weitet enge Spielräume. Das Vertrauen in eine göttliche Macht, durch<br />
die man ewig geborgen bleibt, befreit von dem Gefühl der Endgültigkeit der<br />
eigenen Existenz.<br />
Viele ältere Menschen an der Grenzlinie zwischen der 3. und 4. Lebensphase befürchten<br />
in der Zukunft einen Bruch der Lebenskontinuität, drohende Abhängigkeit,<br />
Veränderung des vertrauten Lebenskreises und den Verlust von Alltagskompetenz<br />
und Sozialkontakten.<br />
Das gewaltige Interesse an Patientenverfügungen gegen medizinische Überbehandlung<br />
und Sterbensverlängerung ist ein Indiz für diese Ängste, engt aber die<br />
soziale Dimension dieses Problems (wie die Vereinsamung) auf die medizinischbiologische<br />
Perspektive ein. Der Tod hingegen wird meistens als natürliche<br />
15
Gegebenheit akzeptiert, nur: Es soll schnell gehen. Denn man möchte keinem<br />
zur Last fallen. Besonders ausgeprägt ist die Furcht vor einer dementiellen<br />
Erkrankung, die – so denken viele – zu einer Zerstörung der lebensgeschichtlichen<br />
Identität führt.<br />
6. Die religiöse Biographie<br />
Ein besonderer Reichtum, dessen man sich im Alter bewusst werden kann, ist die<br />
religiöse Biographie. Um sie sich zu erschließen, versuchen wir drei Lebensabschnitte<br />
und deren Berührungen zu der Entwicklung der Glaubensgeschichte zu<br />
beschreiben:<br />
6.1 Ursprungssituation: der Glaube der Kindheit<br />
Der Glaube in der Kindheit ist geprägt von Erfahrungen des Vertrauens, der Geborgenheit<br />
und anderen grundlegenden Gefühlserfahrungen. Gottesbild und<br />
Gotteserfahrungen prägen bei dem Kind eine Art „privaten Gott“, der mit zwischenmenschlichen<br />
Gefühlserfahrungen korrespondiert. Gefühle von Abhängigkeit<br />
und Hilflosigkeit gegenüber einer höheren, manchmal unheimlichen Macht<br />
entstehen auch in dem Erleben der religiösen Beziehung der Eltern. Wenn die<br />
Eltern zum Beispiel im Gebet Ehrerbietung vor einem noch größeren Wesen zeigen,<br />
bildet sich die Vorstellung, dass es eine noch höhere Instanz und Macht<br />
geben muss.<br />
Auf der anderen Seite ist Gott auch die Begegnung mit der christlichen Tradition,<br />
die sich vor allem im Erzählen von biblischen Geschichten und im Erleben<br />
von christlichen Symbolen ereignet, dies prägt den Glauben der Kindheit. Einen<br />
wesentlichen Beitrag für die religiöse Entwicklung leisten Persönlichkeiten, die<br />
neben den Eltern die Traditionen des Glaubens vermitteln und die für die älter<br />
werdenden Kinder durch den praktizierten Glauben im Alltag und in besonderen<br />
Krisensituationen zum Garanten des eigenen Glaubens werden.<br />
Um den Reichtum religiöser Biographie zu entdecken, können folgende Impulsfragen<br />
zur Anregung dienen:<br />
16<br />
Was ist meine erste Erinnerung? Mit welchen Bildern und Sinneseindrücken<br />
ist diese Erinnerung verbunden? An welche frühesten religiösen Erlebnisse<br />
kann ich mich erinnern? Mit welchen Orten ist diese Erinnerung verbunden?<br />
Was war davon prägend und zukunftsweisend? Welche religiösen Traditio-<br />
nen, welche Konventionen waren in der frühen Kindheit wichtig? Habe ich<br />
heute unangenehme Gefühle dabei oder denke ich gerne daran zurück?<br />
Wie habe ich heilige Zeiten, heilige Räume, heilige Gegenstände erlebt?<br />
Erinnere ich mich an besondere Gebete? Was erzählen mir andere von meiner<br />
Taufe?<br />
Welche Rolle haben Vater und Mutter in meiner religiösen Erziehung<br />
gespielt? Kann ich meine religiöse Welt beschreiben? Erinnere ich mich an<br />
bestimmte Situationen, in denen mir Gott besonders nahe war, oder auch<br />
besonders fern? Welche alltäglichen Rituale waren für mich wichtig? Welche<br />
religiösen Anteile gab es dabei?<br />
Wie habe ich die religiöse Gemeinschaft erlebt? Welche Persönlichkeiten<br />
sind mir dabei besonders wichtig gewesen? Erinnere ich mich an Worte,<br />
Gesten, Verhalten, die mich besonders beeindruckt haben? Gab es irgendwelche<br />
kuriosen Begebenheiten, an die ich mich erinnere? Wodurch war die<br />
religiöse Praxis bestimmt? Wer war mir Vorbild? Wo sind Widersprüche deutlich<br />
geworden? Welche besonderen Höhepunkte sind mir in Erinnerung?<br />
Wenn ältere Menschen auf den Glauben der Kindheit zurückschauen, lassen sich<br />
folgende Beobachtungen machen: Der Glaube der Kindheit wird als religiöse<br />
und gesellschaftliche Selbstverständlichkeit erinnert, die nicht hinterfragt wird.<br />
Hohe Bedeutsamkeit wird religiösen Konventionen wie Kirchgang, kirchliche<br />
Feste, gemeinsame Gebete, das Halten der Gebote (vor allem 4., 6. und 7.Gebot)<br />
zugesprochen. Entscheidend ist aber, dass die Vorstellung von Gott als „Weltenlenker“<br />
und als Geheimnis einer höheren Macht auch den Glauben älterer Menschen<br />
stark bestimmt. Dem „Kinderglauben“ wird großes Gewicht zugemessen,<br />
es ist das Gefühl einer umfassenden Geborgenheit und eine selbstverständliche<br />
Grundbeziehung, die mit dem Gefühl einer fraglosen Hingabe verbunden ist. Der<br />
Glaube ist dann wie die „wiedergefundene Kindheit“, es wird dem älteren Menschen<br />
eine Art „zweite Naivität“ geschenkt, in dem es gelingt, sich selbst als<br />
Kind und den Gott der eigenen Kindheit wiederzufinden.<br />
Der Kinderglaube ist zudem für viele ältere Menschen die Kontinuität in der<br />
Lebensgeschichte. Er muss erhalten werden, um sich der eigenen Herkunft und<br />
Biographie gewiss zu bleiben.<br />
6.2 Der Glaube beim Erwachsenwerden:<br />
Widerspruch und Glaubwürdigkeit<br />
Im Mittelpunkt der religiösen Entwicklung in diesem Lebensabschnitt steht die<br />
Profilierung der eigenen Glaubenspraxis gegenüber der Religiosität des Eltern-<br />
17
hauses. Das Verlassen des Elternhauses, die Berufsfindung, die Begründung von<br />
Ehe, Familie und Partnerschaft sind wichtige biographische Einschnitte, die zu<br />
einer Auseinandersetzung mit anderen Wertsystemen und religiösen Grundhaltungen<br />
Anlass geben. Epochale Krisenzeiten wie Kriege, Arbeitslosigkeit, Nationalsozialismus<br />
führen darüber hinaus zur Infragestellung vertrauter Ordnungen.<br />
In solchen Situationen können auch Glaubenshaltungen zerbrechen, die Theodizeefrage<br />
(„Warum lässt Gott Leiden zu?“) stellt sich weniger als theoretisches<br />
Problem der Rechtfertigung Gottes, sondern als fundamental-biographische<br />
Frage wie bei Hiob angesichts seines Leidens: „Warum bin ich nicht gestorben<br />
bei meiner Geburt?" (Hiob, 3,11).<br />
Der Glaube in diesem Lebensabschnitt ist weiter geprägt von der Frage nach der<br />
Glaubwürdigkeit der Kirche und deren Beitrag für die eigene biographische Entwicklung.<br />
Nicht selten kommt es zu Kontinuitätssprüngen im Hinblick auf die<br />
Wertschätzung religiöser Konventionen. Die religiöse Entwicklung wird beeinflusst<br />
von der eigenen Verpflichtung gegenüber religiöser Praxis, dem Ausmaß<br />
an ethischer Orientierung für die eigene Lebensgeschichte und die Bindung an<br />
eine religiöse Gemeinschaft.<br />
Impulsfragen:<br />
Wie habe ich das Verlassen des Elternhauses erlebt, welche Belastungen,<br />
welche Chancen haben sich mit dem Ortswechsel verbunden? Meine ersten<br />
Berufserfahrungen: Komplikationen, Praxisschock? Wie habe ich Krisenzeiten<br />
durchstanden? Wann sind mir Zweifel am Kinderglauben gekommen?<br />
Welche Widersprüche habe ich in meinem Glauben entdeckt? Wofür habe<br />
ich mich in der Kirche engagiert? Was hat mir ein Engagement schwer gemacht?<br />
Haben Krankheiten mein Leben verändert? Hat mir mein Berufsleben<br />
Zeit für den Glauben gelassen? Welche Rolle hat der Glaube in meiner<br />
Partnerschaft und bei der Gründung der Familie gespielt? Wie wurde der eigene<br />
Glaube an die Kinder weitergegeben? Welche Bedeutung haben die<br />
kirchliche Feste? Welche epochalen Ereignisse haben den Glauben beeinflusst?<br />
6.3 Das höhere Erwachsenenalter:<br />
Individualisierung und Harmonisierung des Glaubens?<br />
In dem Lebensabschnitt nach dem Arbeitsleben dominieren individuelle Glaubensbilder.<br />
Die Gottesbeziehung ist in hohem Maße verinnerlicht, biographisch<br />
geprägt; Abhängigkeit von Gott wird auch positiv empfunden, Gott ist der Hel-<br />
18<br />
fer, bei dem man Schutz und Geborgenheit erwartet, der Wunsch nach Harmonisierung<br />
von existentiellen Widersprüchen kommt auf, konfessionelle und dogmatische<br />
Gegensätze treten dahinter zurück. Religiöse Konventionen finden<br />
neue Wertschätzung, weil dadurch biographische Kontinuität erwartet wird. Leer<br />
gewordene Symbole können neu sprechen, scheinbar vergessene Geschichten<br />
oder Leitworte religiöser Tradition gewinnen tragende Kraft, sofern sie mit religiösen<br />
Ursprungssituationen verbunden sind.<br />
Angesichts des Erlebens von Endlichkeit des Lebens tauchen Fragen der Lebensbilanz<br />
auf, der Zukunftsbezug wird neu qualifiziert: Die nahe Zukunft tritt in den<br />
Vordergrund, dadurch erhält die Zeiterfahrung und Zeitplanung existentielles<br />
Gewicht. Man wägt die Möglichkeiten ab und verspürt die Furcht vor Leiden und<br />
Einschränkungen, die Verwirklichung von unerledigten Aufgaben wird dringlicher,<br />
Ordnung im Lebenshaus soll geschaffen werden, Termine wie bevorstehende<br />
Jubiläen und Ereignisse (Geburt des Enkelkindes) strukturieren die Gegenwart,<br />
die Frage nach der Vergänglichkeit drückt sich vor allem in dem Erleben<br />
der Alltagskompetenz aus. Der Tod wird als natürliche Gegebenheit betrachtet:<br />
man hofft auf einen schnellen, leidlosen Tod.<br />
Impulsfragen:<br />
Welche Empfindungen habe ich an die Zeit der Pensionierung? Welche Belastungen<br />
sind auf mich zugekommen? Welche Chancen haben sich eröffnet?<br />
Welche Pläne habe ich gefasst? Welche Einsichten habe ich im Blick auf<br />
das vergangene Leben gewonnen? Was ist meine Lebensphilosophie? Was<br />
möchte ich an andere weitergeben? Welche Zukunftswünsche habe ich?<br />
Wie gehe ich mit Erfahrungen der Endlichkeit um? Im Rückblick auf mein<br />
Leben: „Haben sich die Mühen gelohnt? Womit habe ich dieses Schicksal<br />
verdient? Wozu bin ich (noch) da?“ Welche Pläne habe ich für die nächste<br />
Zeit? Was möchte ich unbedingt noch erleben? Welche religiösen Geschichten<br />
und Konventionen tragen mich weiter? Wovon zehre ich in geistlicher<br />
Hinsicht?<br />
7. Anregungen für die Praxis<br />
Zum Schluss wollen wir Anregungen für einen seelsorgerlichen und diakonischen<br />
Umgang mit älteren Menschen geben.<br />
7.1 Seelsorge<br />
Eine seelsorgerliche Situation entsteht dann, wenn ältere Menschen – auf der<br />
19
Suche nach dem „roten Faden“ ihrer Lebensgeschichte – einen anderen Menschen<br />
brauchen, der mit ihnen die Geschichten entwickelt, ordnet, zum Abschluss<br />
bringt, wieder neu öffnet und auf die tragende Geschichte Gottes hinweist.<br />
Entscheidend ist die Einstellung des Seelsorgers zu seinem Gegenüber.<br />
Wer sich auf Lebensgeschichten einlässt, muss offen sein für Begegnung mit<br />
dem Reichtum, aber auch mit der Last der Biographie. Das wichtigste Mittel in<br />
der Gesprächsführung ist eine beziehungsstiftende und beziehungsfördernde<br />
Grundhaltung. Es bildet sich eine „Erzählgemeinschaft“, die vom Geben und<br />
Nehmen geprägt ist. Wer in einer biographisch orientierten Seelsorge mit alten<br />
Menschen tätig ist, muss die Bereitschaft aufbringen, den Umgang mit der eigenen<br />
Lebensgeschichte zu reflektieren.<br />
Außerdem ist eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlich normierten und<br />
biographisch geformten Vorstellungen von alten Menschen notwendig, um die<br />
Offenheit und Wechselseitigkeit des Gesprächs nicht zu behindern.<br />
Folgende Ziele sind wichtig:<br />
Die autobiographische Kompetenz stärken<br />
Zunächst soll der Seelsorger die Barrieren gegenüber dem Erzählen abbauen.<br />
Den Vorurteilen „Meine Geschichte interessiert niemanden“, „wer hat schon<br />
Zeit zum Zuhören“, „der andere lebt in einer anderen Zeit“ ist entgegenzutreten.<br />
Wenn der Einstieg in eine Erzählung schwerfällt, sind öffnende Fragen hilfreich,<br />
damit der ältere Mensch einen Anfang findet. Motivierend wirkt häufig der<br />
Hinweis, dass in den Geschichten des Lebens verborgene Schätze liegen, die für<br />
die nachfolgenden Generationen entdeckt werden können. Wenn die autobiographische<br />
Kompetenz gestärkt wird, wächst das Selbstwertgefühl.<br />
Lebensgeschichte revitalisieren<br />
Biographisches Arbeiten soll auch zur Revitalisierung von Geschichten führen, in<br />
denen die Hintergrundgeschichte neue Kraft gewinnt, um neue Geschichten zu<br />
entwickeln. Die Erkenntnis „Es war gut so“ befreit von dem Zwang, sich ständig<br />
neu produzieren zu müssen oder das Vergangene nur als Vergängliches zu betrachten.<br />
Lebensgeschichte rekonstruieren<br />
Wer biographisch arbeitet, kann das Alter nicht von vornherein als Störfall festlegen.<br />
In der Rekonstruktion von Lebensgeschichte leistet die Seelsorge einen<br />
20<br />
Beitrag zum ganzheitlichen Verständnis älterer Menschen. Die Fixierung des<br />
Menschen auf dessen Grenzsituationen ist eine Untugend.<br />
Dietrich Bonhoeffer schreibt: „Ich möchte von Gott nicht an den Grenzen,<br />
sondern in der Mitte, nicht an den Schwächen, sondern in der Kraft, nicht<br />
also bei Tod und Schuld, sondern im Leben und im Guten des Menschen<br />
sprechen.“<br />
Ein wichtiges Element der Rekonstruktion ist die Zeitperspektive, das bewusste<br />
Bezogensein auf Zukünftiges und Vergangenes. Handeln, Gefühle und moralisches<br />
Verhalten hängen von der Zeitperspektive ab. Die Vergangenheit ist deshalb<br />
nie etwas endgültig Abgeschlossenes, genaussowenig wie die Zukunft<br />
ein ganz offenes als reine Möglichkeit ist. Zwar lassen sich Ereignisse der Vergangenheit<br />
in ihrer Faktizität nicht mehr rückgängig machen, aber die sich aus<br />
diesen Ereignissen entwickelnde Wirkungsgeschichte. Die Einstellung zu dem<br />
Vergangenen kann sich wandeln. Damit ist es möglich auf die Folgen des Vergangenen<br />
Einfluss zu nehmen.<br />
Lebensgeschichte integrieren<br />
Wer sich auf die Lebensgeschichte eines anderen einlässt, wird auch mit den<br />
Brüchen, Widersprüchen und dem Scheitern von Geschichten konfrontiert. Spannungen<br />
werden durch konkurrierende Geschichten erzeugt, Unversöhnlichkeit<br />
legt sich über das Leben, man zerbricht am ungelebten Leben.<br />
Wie viele Frauen hätten gerne in der Nachkriegszeit einen Beruf erlernt?<br />
Wie viel mussten auf eine beglückende Partnerschaft verzichten? Welche<br />
Auswirkungen hat der nicht in Erfüllung gegangene Kinderwunsch? Gescheiterte<br />
Berufspläne, verwirkte Partnerbeziehungen, Verlusterfahrungen<br />
sind als ungelebtes Leben im gegenwärtigen Erleben wirksam.<br />
Deshalb ist die Integration auch dieser Geschichten in das Gesamte der Lebensgeschichte<br />
eine wichtige Aufgabe der Seelsorge. Die übergreifende Geschichte<br />
Gottes nimmt die unvollendeten Geschichten des Menschen auf. Mit Gott soll<br />
das Vergangene aufgesucht werden. Bei alledem braucht man ein Gegenüber,<br />
um zu einer versöhnten Lebensgeschichte zu kommen.<br />
Das heißt doch wohl, „dass nichts Vergangenes verloren ist, dass Gott mit<br />
uns unsere Vergangenheit, die zu uns gehört, wieder aufsucht. Wenn also<br />
die Sehnsucht nach einem Vergangenen uns überfällt, … dann können wir<br />
wissen, dass es nur eine der vielen Stunden ist, die Gott für uns immer bereit<br />
hält und dann sollen wir wohl nicht auf eigene Faust, sondern mit Gott<br />
das Vergangene wieder aufsuchen. (Bonhoeffer)“<br />
21
Die Furcht vor medizinischer Überbehandlung und dem Verlust der Selbstverantwortung<br />
in der letzten Lebensphase ist ein beherrschendes Thema im Alter. Viele<br />
verbinden mit der Aussicht auf ein langes Leben drohende Behinderung und<br />
sinnlose lebensverlängernde Maßnahmen bei schwerster Krankheit. Eine christliche<br />
Patientenverfügung wurde entwickelt, die eine Überbehandlung durch die<br />
sogenannte „Apparatemedizin“ ausschließen sollte. Hingegen sind weitgehende<br />
Linderung von Schmerzen, das Verbleiben in der vertrauten Umgebung und<br />
der Beistand durch eine Person des Vertrauens die wichtige Option für ein Sterben<br />
in Würde.<br />
Aus kirchlicher Sicht ist ebenso eine klare Absage gegenüber der sogenannten<br />
aktiven Sterbehilfe notwendig. Der Sinn einer christlichen Patientenverfügung<br />
liegt in der seelsorgerlichen Zielrichtung. Es soll ein Anstoß gegeben werden,<br />
sich in guten Tagen mit drohender Behinderung, Schmerzen und Sterben auseinanderzusetzen<br />
und eine Vertrauensperson zu gewinnen. Leitsatz der christlichen<br />
Patientenverfügung ist: „Ich glaube, dass meine Zeit in Gottes Händen steht“.<br />
7.2 Diakonische Perspektiven<br />
Die Zunahme von Lebenserwartung und die Tendenz zur Singularisierung stellen<br />
die Kirche und Diakonie vor neue Aufgaben:<br />
Kirche und Diakonie ist ein Ort, an dem<br />
– die Freundschaft der Generationen besonders gepflegt werden kann<br />
– die Entwicklung von freiwilligem Engagement älterer Menschen einen guten<br />
Nährboden findet<br />
– vom christlichen Geist geprägte, verlässliche Hilfen für Krisen und Belastungen<br />
des Alters angeboten werden.<br />
Eine der wichtigsten Fragen ist: Wo möchte ich wohnen, wenn ich einmal alt<br />
werde? So lange wie möglich in der vertrauten Umgebung bleiben, ist bestimmt<br />
die häufigste Antwort. Das klassische Altenheim scheint ausgedient zu haben.<br />
Beweglich, selbstständig, unabhängig und doch geborgen sein – das sind die<br />
wichtigen Ziele. Ambulante Pflegedienste durch die Diakonie- und Sozialstation,<br />
Essen auf Rädern, Mobilitätshilfen, barrierefreie Wohnungen mit Aufzügen, Telefonketten<br />
oder ein Selbsthilfe Telefonring bringen Hilfen ins Haus.<br />
Und doch: Verwandte und gute Bekannte sind auch nicht immer greifbar, die<br />
Kontakte nehmen ab, Nachbarn nehmen wenig Notiz. Wie steht es mit meiner<br />
Sicherheit, wenn ich allein wohne? Wohnanlagen für ältere Menschen, Altenheime<br />
und Wohnstifte sind oft eine Alternative, wenn ich in Gemeinschaft mit<br />
22<br />
anderen leben will. Wichtig bleibt, dass sowohl eine individuelle Wohnung als<br />
auch angemessene Räume für Geselligkeit zur Verfügung stehen. Geistige Anregungen,<br />
seelsorgerlicher Beistand, Ausübung von interessanten Freizeitbeschäftigungen,<br />
fachgerechte Pflege im Krankheitsfall – und Menschen in unmittelbarer<br />
Rufweite, wenn es einmal nicht so gut geht: darauf kommt es an. Hier gibt<br />
es ein breites Angebot von Möglichkeiten, und man merkt es oft einem Haus für<br />
ältere Menschen an, welche Atmosphäre dort herrscht. Auf jeden Fall sollte man<br />
sich rechtzeitig damit beschäftigen, wo man im Alter wohnen möchte.<br />
Schließen möchte ich mit einem Wort von Vincent van Gogh:<br />
„Mancher hat ein großes Feuer in seiner Seele und niemand kommt jemals, sich<br />
daran zu wärmen, und die Vorübergehenden gewahren nur ein klein wenig<br />
Rauch oben über dem Schornstein, und sie gehen ihres Wegs von dannen. Nun,<br />
was beginnen, diese Glut im Inneren unterhalten, sein Salz in sich verschließen,<br />
geduldig warten, gleichwohl mit viel Ungeduld, die Stunden erwarten, da es<br />
irgendjemand beliebt, sich dort niederzulassen, und dabeibleiben wird, was<br />
weiß ich?“<br />
23
24<br />
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker<br />
„Lebenserwartung und Erwartung<br />
an das Leben“<br />
Was Menschen mit Behinderung im Alter wünschen<br />
„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“ –<br />
„Das hängt zum großen Teil davon ab, wohin du möchtest.“<br />
Soweit – meine sehr verehrten Damen und Herren – ein Dialog zwischen der<br />
Katze und Alice in Lewis Carolls „Alice im Wunderland“ (1865).<br />
Wenn Sie also mit Ihrem Symposion nach der Lebensqualität in der „Herbstzeit“<br />
der Menschen mit Behinderung fragen, geben Sie schon Signale, wohin<br />
Sie möchten.<br />
Ich will heute morgen und heute Nachmittag gerne versuchen, ein paar Navigationspunkte<br />
für Richtungsentscheidungen zu geben – auch wenn ich nur stellvertretend<br />
spreche für den Personenkreis, der als Experten in eigener Sache auch<br />
Gehör finden muss: Die Menschen, die man behindert nennt und die nun in die<br />
Lebensphase Alter kommen. Denn die beste Antwort geben sie sicher selbst –<br />
verbal oder nonverbal – und sie wird sich von den Intentionen nicht wesentlich<br />
unterscheiden, die uns durch den Kopf gehen, wenn wir über gelingendes Altern<br />
nachdenken.<br />
Wie kann Altern gelingen?<br />
Das will ich in vier Schritten näher bedenken und dabei einige Aspekte verdeutlichen,<br />
die mit Lebensqualität im Alter gemeint sein können:<br />
1. People first<br />
„When I get older losing my hair many years from now,<br />
will you still be sending me a valentine,<br />
birthday greetings, bottle of wine?<br />
If I’d been out till quarter to three, would you lock the door?<br />
Will you still need me,<br />
Will you still feed me,<br />
When I’m sixtyfour?<br />
25
I could be handy mending a fuse when your lights have gone,<br />
you can knit a sweater by the fireside,<br />
Sunday mornings, go for a ride.<br />
Doing the garden, digging the weeds;<br />
Who could ask for more?<br />
Will you still need me,<br />
Will you still feed me,<br />
When I’m sixtyfour?”<br />
John Lennon, Paul McCartney<br />
„Will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bootle of wine?<br />
Will you still need me, will you still feed me, when I’m sixty four?“<br />
So sangen einst die Liverpooler Pilzköpfe – und brachten als junge Leute ihre<br />
Vision von Lebensqualität im Alter „unters Teeny-Volk“.<br />
Worauf kam es ihnen an?<br />
Es ging darum, in sozialen Netzen bedeutsam zu sein.<br />
Es ging um Achtsamkeit und Toleranz im Umgang miteinander.<br />
Es ging darum, zu etwas nütze zu sein.<br />
Es ging einfach um einen guten Alltag: mit Pflichten und Freiräumen.<br />
Umworben, geliebt, versorgt zu sein und gebraucht zu werden – dies wünschen<br />
alle Menschen, die ins höhere Alter kommen – mit und ohne Behinderung.<br />
Es geht um Partizipation am Leben in der Gesellschaft, die sich aus vielen<br />
alltäglichen Elementen zusammensetzt:<br />
• aus der Inklusion im großen politischen Rahmen,<br />
• im Netzwerk der Gemeinde,<br />
• der Nachbarschaft,<br />
• der Freunde,<br />
• der Familie und Lebenspartner.<br />
• …<br />
Denn Teilhabe kennt keine Altersgrenze.<br />
Sie ist unabtrennbar vom Leben eines Menschen.<br />
Und sie ist im Versorgungsfall nicht an eine spezifische Institution gekoppelt –<br />
einerlei ob Familie, Nachbarschaft, Sozialstation, Pflegedienst, Alten- oder Behindertenhilfe<br />
auf dem Firmenschild steht.<br />
26<br />
Teilhabe ist ebenso unabtrennbar vom Leben wie das Altern.<br />
Denn zu Altern ist Teil des Lebens – ohne diesen Prozess ist Leben nicht<br />
möglich.<br />
Sie alle haben sicher bereits viel gehört von der steigenden Lebenserwartung der<br />
Menschen in den prosperierenden Wirtschaftsländern, und dass sich dieses<br />
demographische Phänomen auch bei Menschen zeigt, die als behindert bezeichnet<br />
werden.<br />
Aber das sagt noch nichts darüber, wann Menschen alt sind. Denn:<br />
Alter ist das Ergebnis eines biologischen, psychologischen und sozialen Prozesses<br />
und daher mehr als nur die Folge vieler durchlebter Jahre.<br />
Wie, wo, mit wem und unter welchen Umständen das Leben verbracht wurde, ist<br />
daher mindestens so bedeutsam, wie Dispositionen, die sich aus der biologischen<br />
Ausstattung einzelner Personen ergeben.<br />
Das gerät bei der aktuellen Diskussion um das alt sein und vor allem die älter<br />
werdende Bevölkerung zu leicht aus dem Blick.<br />
Und es hat Konsequenzen für Menschen mit Behinderungserfahrung.<br />
Menschen, die ihr Leben mit Behinderung führen, altern einerseits gleich wie<br />
alle Bevölkerungsmitglieder.<br />
Sie altern aber auch verschieden, wenn und weil ihre Lebenserfahrungen und Lebenschancen,<br />
ihre sozialen oder materiellen Kontexte verschieden sein können.<br />
Denn diese Lebensumstände bestimmen Behinderung mit, wie die Weltgesundheitsorganisation<br />
zur Jahrtausendwende in ihrer neuen und aktuell gültigen<br />
Definition von Behinderung deutlich zeigt (vgl. WHO 2001).<br />
Danach entsteht Behinderung im Zusammenspiel von Fähigkeiten, Begrenzungen,<br />
Umweltvariablen und gesellschaftlichen Erwartungen, die in einer Person<br />
aufeinandertreffen und dort Chancen der Teilhabe bestimmen.<br />
Konsequenterweise kann man also nicht einfach von „alten Menschen mit Behinderung“<br />
sprechen. Vielmehr sind sie Männer, Frauen, Geschwister, Singles,<br />
RuheständlerInnen, WählerInnen, Reisende, KonsumentInnen, BesucherInnen<br />
von Freizeit- oder Bildungsangeboten, PatientInnen oder NachbarInnen, je nachdem,<br />
welchen Aspekt man in ihrem Leben betrachten will.<br />
Von ihrer Behinderungserfahrung muss dabei allerdings insofern die Rede sein,<br />
als sie relevant ist für ihre Chancen, relevant zu sein,<br />
27
– eine Rolle – ihre Rolle –<br />
im Leben zu spielen.<br />
Denn der soziale Tod tritt ein, wenn Menschen<br />
• „nicht der Rede wert sind“, wenn sie<br />
• „nicht zählen“, wenn sie<br />
• „totgeschwiegen“ werden.<br />
Zur Teilhabe gehört, Teil der Kommunikation zu sein.<br />
Was kommuniziert wird, hängt aber davon ab, was erwartet wird.<br />
Wenn mit Herbst des Lebens nur fallende Blätter und mühselige Einschränkungen<br />
verbunden werden, so schafft dies eine andere Realität als die Sicht auf<br />
Lebenserfahrungen und Bewältigung der Aufgaben im Herbst des Lebens.<br />
Von wem nichts erwartet wird, der ist nicht der Rede wert.<br />
Wer aber kommunizieren kann, hängt damit zusammen, wer Zugang hat zu<br />
sozialen Systemen:<br />
• Wer beispielsweise ein Kunde der Wirtschaft ist, ist umworben.<br />
• Wer ein Wähler in der Politik ist, dessen Stimme ist gefragt.<br />
• Wer in den Medien zu Wort kommt und sich über die Medien Gehör<br />
verschafft, macht Meinung.<br />
Kurz gesprochen: Teil der Kommunikation ist – wer inkludiert ist.<br />
Das sind Merkmale unserer modernen differenzierten Gesellschaft.<br />
Daran gemessen erscheint die aktuelle Lebensweise von Menschen mit Behinderung<br />
im Alter oft als ein Anachronismus:<br />
Wie der einfachen Bevölkerung in vorindustrieller Zeit weist man ihnen oft nur<br />
„einen Ort zum Leben“ zu:<br />
• die Herkunftsfamilie – solange sie existiert und Unterstützung leisten kann<br />
und will – oder<br />
• das Heim!<br />
Dort finden alle Lebensäußerungen statt:<br />
• Wohnen und Beschäftigung,<br />
• Konsum und medizinische Versorgung,<br />
• Geselligkeit und Entspannung,<br />
• Sterben und Tod.<br />
28<br />
Das alles wird meist „all inclusive“ organisiert, gemanaged und prädisponiert –<br />
nach bestem Wissen und Gewissen der Angehörigen oder der Behinderungsfachleute.<br />
Die Frage: „Wer bin ich“ erübrigt sich für Menschen mit Behinderung damit<br />
weitgehend.<br />
Und zu fragen „Wozu werde ich gebraucht?“ unterbleibt besser – wenn man<br />
nicht antworten will, es ginge um Arbeitplätze für professionelle HelferInnen.<br />
Aber wie soll die Frage nach Individualität formuliert werden, wenn sich die<br />
Antwort auf Sinnfragen nur im Versorgungssystem findet?<br />
Teilhabe zu erlangen, so formuliert dies der Soziologe NIKLAS LUHMANN, bedeutet<br />
„als Individuum zugelassen zu sein“ (zit. nach WACKER ET AL. <strong>2005</strong>).<br />
Daraus lässt sich ableiten, dass es nicht alleine darum geht, Teil der Kommunikation<br />
zu sein, sondern auch darum, wie man kommuniziert.<br />
Die Frage nach der Lebensqualität älterer behinderter Menschen sollte sich also<br />
nicht richten<br />
• auf HeimbewohnerInnen – weil man sie im Heim antrifft,<br />
• auf die Klientel der Behindertenhilfe – weil sie nun als solche erkannt<br />
werden,<br />
• auf Pflegefälle – als die man sie antizipiert<br />
• oder gar auf Kostenfaktoren, als die man sie – mit steigender Sorge – identifiziert.<br />
Es genügt auch nicht<br />
• von Hospitalisierten zu sprechen, auch wenn die Folgen eines oft langen<br />
Lebens in „stationärer Versorgung“ sich so ausdrücken können, oder<br />
• von Marginalisierten – weil wir ihnen mitten in der Gesellschaft nicht begegnen.<br />
Auch wenn wir sie<br />
• Benachteiligte – nennen, weil sie viele Chancen eigener Lebensgestaltung<br />
und Lebensführung kaum nutzen konnten oder gar als<br />
• Überlebende bezeichnen – denn sie sind die Generation, die dem Vernichtungswahn<br />
des Nationalsozialismus entkommen ist,<br />
so charakterisiert dies jeweils nur Aspekte eines Menschenlebens.<br />
29
Zuerst sind sie Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft!<br />
People first – so sprechen sie selbst über sich. Das könnte Anreiz genug sein,<br />
dies auch zu tun und zu denken. Denn dann gilt, sie haben gleichen Anteil an<br />
Rechten und Pflichten.<br />
Dies will ich als zweiten Aspekt näher ausführen.<br />
2. No man is an island<br />
Nicht als Insel, sondern als wesentlichen Teil eines Ganzen beschreibt der<br />
Renaissancepoet JOHN DONNE 1 , die Menschen.<br />
„No man is an island, entire of itself;<br />
every man is a piece of the continent, a part of the main.“<br />
Sie gehören zu einer Gemeinschaft, leben in einem Gemeinwesen.<br />
Wenn „das Ganze“ nun ein Gemeinwesen ist, in dem man sein Leben führt, welchen<br />
Platz können Menschen, die behindert genannt werden, im Alter dort einnehmen?<br />
Wo gehören sie dazu?<br />
Welche Rollen stehen ihnen offen?<br />
Welchen Anforderungen müssen und können sie sich stellen?<br />
Es geht also nicht darum, eine schlichte Versorgungsaufgabe zu lösen, sondern<br />
aus dem Bemühen um Teilhabe an der Gesellschaft und um Respekt in der<br />
Gemeinschaft, leitet sich die Identität eines Menschen ab.<br />
Ihre Zugehörigkeit zu formulieren und deren Bedeutung zu begreifen fällt uns<br />
gerade bei alten Menschen mit kognitiven Einschränkungen besonders<br />
schwer.<br />
Zu leicht werden sie wahrgenommen als Gegenbild des modernen Menschen<br />
• der rational handelt,<br />
• der seine Lebensgeschichte verfertigt,<br />
• der seine Position im Leben erringt und<br />
• der autonom entscheidet.<br />
Zu schnell erscheinen sie als Problem, weil sie häufig bereits ein Leben als besonders<br />
Versorgte durchlebt haben:<br />
1) John Donne, Meditationes XVII (1624)<br />
30<br />
• Wenn sie am Bildungssystem teilnehmen konnten, dann in Sonderschulen.<br />
• Wenn sie am Arbeitsleben beteiligt waren, dann im Sonderarbeitsmarkt der<br />
Werkstätten für behinderte Menschen.<br />
Damit blieben ihnen wichtige lebenspraktische und soziale Erfahrungen verschlossen.<br />
Viele von ihnen wurden lange Zeit ihres Lebens als „Sorgen-Kinder“ betrachtet<br />
und behandelt:<br />
• So wurden ihr Selbstwertgefühl geschwächt und<br />
• ihre Kompetenzen zur Selbstsorge unterhöhlt.<br />
Viele Rollen blieben ihnen verschlossen: beispielsweise<br />
• die Eltern-Rolle,<br />
• die Konsumenten-Rolle,<br />
• selbst Rollen wie SportteilnehmerInnen oder Reisende,<br />
um nur einige Beispiele zu nennen. Mit diesen Handicaps an Erfahrung und Anerkennung,<br />
an Mit- und Selbstbestimmung war ihr Leben oft verbunden.<br />
Am Rande der Gesellschaft verborgen, wurden sie selbst von Fachleuten als<br />
zukünftig „Alte“ erst in den 80er Jahren entdeckt.<br />
Inzwischen sind sie – so vermitteln es die Medien in Deutschland derzeit – als<br />
neue soziale Last gefürchtet.<br />
Aber:<br />
• Menschen mit Behinderung im Alter sind nicht deswegen ein Problem, weil<br />
ihre Lebenserwartung stetig steigt. Das muss man vielmehr als erfreuliches<br />
Resultat verbesserter Lebensumstände begrüßen.<br />
• Die Sorge wächst daher, weil Konzepte fehlen, dieser erstarkenden Bevölkerungsgruppe<br />
gerecht zu werden.<br />
Auch deswegen haben Menschen mit Behinderung im Alter viele Probleme:<br />
• Denn sie sitzen zwischen den Stühlen der Versorgungssysteme und der Leistungsansprüche.<br />
• Und die Hilfeanbieter müssen noch Wege finden, „gelingendes Altern“ zu<br />
unterstützen.<br />
• Ebenso wie die behinderungserfahrenen SeniorInnen erst lernen dürfen<br />
müssen, eigene Lebenspläne zu schmieden.<br />
31
Dies alles geschieht derzeit unter erschwerten Bedingungen,<br />
• weil Ressourcen auch in der Wohlstandsgesellschaft knapper werden und<br />
• weil die Rede von der „alten Welt“ neue Dimensionen bekommt<br />
Denn: Europa ergraut.<br />
Und zweifellos wird sich die Veränderung der Bevölkerungsstruktur auf alle Elemente<br />
des gesellschaftlichen Miteinanders auswirken, wie ich als dritten Aspekt<br />
ansprechen möchte.<br />
3. Lebenserwartung und Erwartungen an das Leben<br />
Älter zu werden erscheint also erstmals in der Geschichte als Gesellschaftsproblem<br />
und nicht schlicht als erfreuliche Tatsache.<br />
In dem Szenario eines generell drohenden „Kampfs der Generationen“ (vgl.<br />
GRONEMEYER 2004), der heraufbeschworen wird, sind Bevölkerungsgruppen zu<br />
erwarten, die besonders „schlechte Karten“ haben.<br />
Dies sind die Armen, die Arbeitslosen, Personen mit Migrationshintergrund und<br />
weitere Gruppen mit geringer gesellschaftlicher Akzeptanz, sei dies aus Gründen<br />
der Religionszugehörigkeit, sei dies wegen besonderer sexueller Vorlieben, wegen<br />
der Hautfarbe, wegen des Geschlechts oder aber wegen ihrer Behinderung.<br />
Und es sind die<br />
• Alten.<br />
Viele dieser „Handicaps“ bündeln sich in der Lebenslage von Menschen mit<br />
Behinderung im Alter.<br />
Dazu kommen weitere belastende Faktoren wie<br />
• eine oft langjährige Heimerfahrung,<br />
• viele Lebensjahre unter unzureichender medizinischer Versorgung oder dauernder<br />
Medikation und<br />
• besonders fragile soziale Netze, weil keine eigene Familie gegründet wurde.<br />
Diese belastenden Rahmenbedingungen ergänzen physische, psychische oder<br />
kognitive Einschränkungen, die sich im Lebensverlauf ohnehin als vielfach hinderlich<br />
erwiesen haben.<br />
Manche dieser erschwerenden Lebensumstände lassen sich nicht beeinflussen<br />
(beispielsweise, dass man eben älter wird). Aber die jeweilige Relevanz solcher<br />
Fakten für die individuellen Lebenschancen und die Lebensführung ist variabel.<br />
32<br />
Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Alter zu wahren und zu<br />
verbessern ist also eine eigene Aufgabe. Im Sozialstaat, wie er in Deutschland<br />
gewachsen ist, kann sie aber nicht nur abstrakt an „die Gesellschaft“ ergehen.<br />
Sie richtet sich vielmehr konkret an „das System der Rehabilitation“. Es ist aktuell<br />
für diesen Personenkreis meist die verantwortliche Instanz. Bei noch genauerem<br />
Hinsehen richtet sich der Auftrag dann an die Kommunen, in denen<br />
Menschen jeweils anzutreffen sind, weil sie dort ihr Leben führen und altern.<br />
Es ist also nicht damit getan, Unterstützungsbedarfe in Pflege, Lebensführung<br />
und Alltagsgestaltung eines bestimmten Personenkreises zu erfassen und die<br />
Problemlösung einer Institution – etwa der Alten- oder Behindertenhilfe – zuzuweisen.<br />
Es geht vielmehr darum, Bedarfe und Bedürfnisse von Menschen zu<br />
decken. Und das meint, Hilfe individuell und nach Maß zu gestalten: also genau<br />
dort und in der Weise, in der es den jeweiligen Bürgerinnen und Bürgern mit Unterstützungsbedarf<br />
zuträglich ist.<br />
Das erscheint zunächst als Selbstverständlichkeit.<br />
In der Planungsdebatte der vergangenen Jahre, wie ich sie aus deutscher Sicht<br />
verfolgt habe, ging es aber zunächst darum,<br />
wer nun zuständig sei (und ab welchem Zeitpunkt):<br />
• Alten- oder Behindertenhilfe,<br />
• örtliche oder überörtliche Träger,<br />
• das Pflege- oder das Eingliederungssystem,<br />
• die Kommune oder überregionale Versorger,<br />
• die Angehörigen oder die öffentliche Hand.<br />
Und es ging darum, wer fachlich kompetent sei:<br />
• alle Sparten des gegliederten Rehabilitationssystems oder die<br />
Sozialstationen,<br />
• die Angehörigen oder die Fachleute etc.<br />
Diese Überlegungen – die bisweilen noch verknüpft wurden mit Fragen der<br />
Übergangsgestaltung und -finanzierung zwischen einzelnen Fürsorgern – sind<br />
wichtig, aber sie setzen beim System an – nicht bei den Menschen.<br />
Kein Wunder, dass eine ältere Dame, die wir nach Jahrzehnten des Lebens in<br />
einer Einrichtung der Behindertenhilfe nach ihren Wünschen für das Alter fragten,<br />
antwortete:<br />
„Solche Utopien träume ich nicht!“<br />
33
Wir sollten also lernen, die Frage nach der Lebensqualität ernsthaft zu stellen.<br />
Denn sie schärft die Wahrnehmung für<br />
• die objektiven Lebensbedingungen in einer Gesellschaft,<br />
• die subjektiven Möglichkeiten, das Gebotene wahrzunehmen und<br />
• die Chancen, Lebensaufgaben zu bewältigen.<br />
Denn Leistungen zur Versorgungs- und Lebensqualität sind für das deutsche<br />
Rehabilitationssystem die Messlatten, die politisch gesetzt sind:<br />
Es geht nicht mehr alleine darum,<br />
• dass Versorgung gewährleistet wird, sondern auch um die Frage<br />
• wie diese wirkt.<br />
Und wenn laut dem 2001 in Kraft getretenen Neunten Sozialgesetzbuch (SGB<br />
IX) Teilhabe an der Gesellschaft das Ziel der Rehabilitation ist, dann kann sie<br />
Menschen mit Behinderung dann nicht vorenthalten werden, wenn sie „in die<br />
Jahre kommen“.<br />
Darauf sind die Denkweisen und Strukturen bei Leistungsträgern und -anbietern<br />
allerdings derzeit nicht hinreichend ausgerichtet. Gerade beim Personenkreis,<br />
der aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, komplizieren zahlreiche Zuständigkeits-Schnittstellen<br />
die Unterstützungsleistungen.<br />
Lösungen erwarte ich von einem grundlegenden Richtungswechsel:<br />
Es geht um einen Perspektivenwechsel von der Angebotsorientierung zur<br />
personenbezogenen Unterstützung.<br />
Das ist nicht einfach, aber unumgänglich, sollen knappe Ressourcen gut genutzt<br />
werden, ohne Standards abzusenken. Die passende Unterstützung bei der Verwirklichung<br />
individueller Lebenspläne ist die Hilfe nach Maß. Sie bietet zugleich<br />
die Chance auf den effektivsten und effizientesten Mitteleinsatz.<br />
Auch für Menschen mit Behinderung im Alter liegt hier ein Schlüssel zur Lebensqualität.<br />
Denn<br />
• nicht alleine das kalendarische Alter oder<br />
• der Behindertenstatus<br />
dürfen die Auslöser oder Grenzen für bestimmte Unterstützungsleistungen und<br />
-angebote sein. Es geht um die Individualisierung der Hilfen – wie sie beispielsweise<br />
mit einem Persönlichen Budget gelingen kann.<br />
34<br />
Denn Menschen mit Behinderung im Alter sind nicht einfach eine Versorgungsgruppe,<br />
vielmehr können sich<br />
• ihr Gesundheitszustand,<br />
• ihre Lebensgewohnheiten,<br />
• ihre Fähigkeiten,<br />
• ihre regionale Verankerung und Vernetzung und<br />
• ihre Vorlieben erheblich unterscheiden<br />
– so wie Menschen eben verschieden sind.<br />
Bei der Hilfeplanung und -gestaltung muss also immer von Gleichheit und Verschiedenheit<br />
der gewünschten und benötigten Unterstützung ausgegangen<br />
werden.<br />
Zwar hat sich im internationalen Wissenschaftsgebrauch bezogen auf Behinderung<br />
und Alter eine Schwelle von etwa 55+ Lebensjahren eingespielt, aber dennoch<br />
ist selbst der Zeitpunkt, wann Menschen mit Behinderung als alt gelten<br />
sollten, eine Unbekannte.<br />
Unterschiede finden sich im Lebensort:<br />
• Schon heute wohnen in Schweden nur ca. 40 % der über 65jährigen Personen<br />
mit geistiger Behinderung in Heimen bzw. in Wohngruppen.<br />
• In Irland sind dies hingegen 70 % der Älteren.<br />
• 15 % der älteren sog. geistig behinderten Männer und Frauen in Schweden<br />
leben selbstständig ohne institutionellen Kontext.<br />
• In den Niederlanden trifft man knapp 5 % der alten Menschen mit geistiger<br />
Behinderung noch in ihren Herkunftsfamilien an, in Irland sind dies viermal so<br />
viele: nämlich 22 %.<br />
Planungen müssen also beispielsweise mit der Frage beginnen:<br />
Wo treffen wir diesen Personenkreis heute?<br />
Aber ebenso muss man die Betroffenen fragen, wo sie morgen wohnen möchten!<br />
Statistisch gesehen richtet sich diese Frage in Deutschland an ca. 7 Millionen<br />
sogenannte schwerbehinderte Menschen, von denen gut die Hälfte, also ca. 3,5<br />
Mio., 65 Jahre und älter sind.<br />
Das ist aber nicht bereits die Zielgröße, von der ich spreche. Denn die bundesdeutsche<br />
Behindertenstatistik bezieht alle Personen ein, die erst in einer fortgeschrittenen<br />
Lebensphase schwere Behinderungen erworben haben, dies sind<br />
35
dann vor allem auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Einschränkungen des<br />
Bewegungsapparates.<br />
Wie viele der lebenslang behinderten Menschen in den kommenden Jahrzehnten<br />
in einer deutschen Kommune in der Altersphase sein werden, kann derzeit nur<br />
regional erschlossen werden. Denn auch wenn der Zugewinn an Jahren eine stabile<br />
statistische Größe scheint und die Lebenserwartung relativ gut vorhersagbar<br />
ist, so bestehen dennoch viele Unbekannte, die kommunale Planungen erschweren.<br />
Dazu zählen<br />
• sog. Pull- oder Push-Faktoren, also beispielsweise die Attraktivität oder Unattraktivität<br />
mancher Regionen für bestimmte Personenkreise,<br />
• die bestehenden gewachsenen Versorgungsstrukturen, also z.B. wenn sich<br />
traditionelle große Anbieter von Hilfen in einer Region finden,<br />
aber vor allem auch Faktoren, die mit der Zielsetzung der Unterstützung zusammenhängen.<br />
Eine Fortschreibung 2 eigener bundesweit repräsentativ erhobener Daten lässt<br />
vermuten, dass in der deutschen Behindertenhilfe<br />
• derzeit ca. 20 % der ca. 150.000 Bewohner traditioneller Einrichtungen zur<br />
Gruppe der Älteren zählen.<br />
• Bis 2010 wird die Zahl auf ca. 30 % steigen.<br />
Es könnten aber zukünftig auch weit mehr Personen im höheren Lebensalter<br />
dort anzutreffen sein, nämlich dann, wenn zusätzlich ältere Menschen mit Behinderung<br />
aufgenommen werden, die derzeit noch in ihrer Herkunftsfamilie<br />
leben.<br />
Ein Kennzahlenvergleich der BAG der überörtlichen Träger der Sozialhilfe aus<br />
dem Jahr 2000 macht deutlich, dass dies ein nennenswerter Faktor ist.<br />
• Im Jahr 2010 könnten dann bereits mehr als jeder dritte stationär in der Behindertenhilfe<br />
Versorgte älter als 65 bzw. jeder zweite 55 Jahre und älter sein.<br />
Erst um das Jahr 2020 – also in 15 Jahren – ist mit einer Stagnation dieser Entwicklung<br />
zu rechnen, auch wenn Einrichtungen der Behindertenhilfe ab sofort<br />
nur noch jüngere Personen aufnähmen und wenn der Usus, lebenslang im Heim<br />
zu verbleiben, außer Kraft träte.<br />
Auch neuere regionale deutsche Studien erhärten diesen Trend. 3<br />
Zweifellos „ergraut“ auch die stationäre Behindertenhilfe unaufhaltsam.<br />
2) Fortschreibung berechnet von WETZLER 2003.<br />
3) Vgl. u.a. Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern 2004.<br />
36<br />
Es ist also allerhöchste Zeit, von einer quantifizierenden zu einer qualitativen<br />
Debatte zum Leben im Alter überzugehen, wie sie in der „European Social Charter“<br />
angelegt ist.<br />
Demnach ist es europäischer Konsens, allen Menschen mit Behinderung Selbstbestimmung,<br />
Teilnahme und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zuzusichern<br />
(vgl. Council of Europe 1996) 4 – unabhängig von Alter, Geschlecht oder<br />
der Behinderungsausprägung.<br />
Für die Unterstützung gelingenden Alterns lautet die europäische Marschroute<br />
dann:<br />
• zur Teilhabe befähigen,<br />
• über Unterstützung informieren,<br />
• individuelle Lebensführung und Selbstbestimmung respektieren.<br />
So könnte sich das Ziel verdeutlichen lassen, vom dem die Wunderlandkatze 5<br />
eingangs gesprochen hat.<br />
4) Vgl. Preamble Part I, 15: „Disabled persons have the right to independence, social integration<br />
and participation in the life of the community“ verbunden mit Part I, 23: "Every elderly person<br />
has the right to independence, social integration and participation in the life of the community”<br />
und Part I, 30: „Everyone has the right to protection against poverty and social exclusion.” In<br />
Part II, Article 15 verpflichten sich die Unterzeichner ausdrücklich, dass die Selbstbestimmungs-,<br />
Integrations- und Teilhaberechte gelten sollen unabhängig von Alter, Art und Ursache einer Behinderung<br />
(„irrespective of age and the nature and origin of their disabilities“) und dass die volle<br />
Teilhabe das Ziel ist, das mit allen möglichen Mitteln erreicht werden soll (Art. 15 (3): „to promote<br />
their full social integration and participation in the life of the community in particular<br />
through measures, including technical aids, aiming to overcome barriers to communication and<br />
mobility and enabling access to transport, housing, cultural activities and leisure.“)<br />
Den älteren Personen wird zugesichert, dass sie so unterstützt werden, „to remain full members<br />
of society for as long as possible, by means of: a) adequate resources enabling them to lead a decent<br />
life and play an active part in public, social and cultural life; b) provision of information<br />
about services and facilities available for elderly persons and their opportunities to make use of<br />
them; to enable elderly persons to choose their life-style freely and to lead independent lives in<br />
their family surroundings for as long as they wish and are able“.<br />
5) LEWIS CAROLL: Alice im Wunderland (1865)<br />
37
Darum möchte ich im letzten Teil versuchen, genauer das Ziel erfolgreichen<br />
Alterns zu bestimmen und nach dem Weg dorthin fragen.<br />
4. Balanced Aging – Alter und Lebensqualität<br />
Meine abschließende Frage nach der Operationalisierung von Alter und Lebensqualität<br />
will ich mit Hilfe Ihrer – vermutlich teils leid- teils freudvollen – Erfahrungen<br />
mit Qualitäts- und Managementinstrumenten zu beantworten versuchen.<br />
Ich orientiere mich dabei an der Systematik der sog. „Balanced Scorecard“.<br />
Sie ist ein multiperspektivisches Verfahren für Unternehmen, um widersprüchliche<br />
Aufgaben unter einen Hut zu bekommen. Ziel ist es, eine Balance zu finden<br />
zwischen<br />
• dem Ziel des wirtschaftlichen Erfolges,<br />
• dem Ziel, die Kunden zufrieden zu stellen,<br />
• dem Ziel, „den Laden“ effektiv und effizient am Laufen zu halten und<br />
• dem Ziel, zukunftsfähig - also auch Morgen noch erfolgreich – zu sein.<br />
Den einzelnen Perspektiven kann man dann jeweils<br />
• Strategische Ziele,<br />
• Kennzahlen,<br />
• Vorgaben und<br />
• Maßnahmen<br />
zuordnen. Die Kunst des Unternehmens besteht schließlich darin, die verschiedenen<br />
Perspektiven möglichst in Balance zu bringen.<br />
Etwa so komplex kann man sich die Aufgabe, gelingendes Altern zu gestalten,<br />
vorstellen.<br />
Wie kann man dabei vorgehen?<br />
Vor der Umsetzung irgendwelcher Aktivitäten steht die Vision oder Mission –<br />
also das Ziel, das die Katze von Alice erfragt. Denn auf dieses Ziel sollte die Strategie,<br />
der man folgt, abgestimmt werden.<br />
In meinen ersten drei Teilen habe ich versucht, die Grundlinien der Zielorientierung<br />
zu zeichnen.<br />
Die Mission und Vision soll lauten: gesellschaftliche Teilhabe von Menschen<br />
mit Behinderung im Alter. Offen sind allerdings noch die Strategie und die Umsetzung.<br />
38<br />
Hierfür will ich Fragen formulieren, um klarer zu sehen, was wir wissen und in<br />
welche Richtung man denken kann.<br />
Ich glaube, es ist in der aktuellen Lage nicht falsch, mit den Finanzfragen zu<br />
beginnen. Denn dies sind in der Regel die Fragen, an denen sich „die Geister“<br />
scheiden.<br />
1. Was ist wirtschaftlicher Erfolg?<br />
Erfolg ist, ohne qualitative Einbußen (d.h. mit den angemessenen Standards) die<br />
Unterstützungen für Menschen im Alter so zu gestalten, dass ihre Teilhabe am<br />
Leben in der Gemeinschaft gesichert ist.<br />
2. Wie geht das?<br />
Im Rahmen der gegebenen Finanzleistungen (beispielsweise der Ressourcen für<br />
stationäre Unterstützung) müssen Hilfen so gestalten werden, dass die subjektiv<br />
gewünschte und die objektiv erforderliche Unterstützung zur Teilhabe gegeben<br />
ist.<br />
3. Wer sollte das tun?<br />
Die zuständigen Leistungsträger und -anbieter in Kooperation mit den Angehörigen<br />
und bürgerschaftlich Engagierten wie aus einer Hand.<br />
Für dieses zunächst einfach klingende Vorgehen müssten allerdings in Deutschland<br />
einige „heilige Kühe“ – wie beispielsweise die Grenzen zwischen stationärer<br />
und ambulanter Hilfe – geschlachtet werden, die einen ressourcenorientierten<br />
Ansatz derzeit erschweren. Eine tragbare Lösung könnte beispielsweise in<br />
der Konzeption des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets liegen, das bis<br />
2008 im Modell erprobt wird.<br />
Damit wende ich mich der Kundenperspektive zu:<br />
Wieder stellen sich drei Fragen:<br />
1. Wer ist Kunde?<br />
Kundinnen und Kunden sind all die Menschen einer Kommune/Gemeinde/Region,<br />
die ihr gesamtes Leben oder viele Jahrzehnte davon mit Behinderung<br />
gelebt haben und nun in die Altersphase kommen. Sie sind insbesondere dann<br />
Kunden, wenn sie infolge ihrer Behinderung besonderen Unterstützungsbedarf<br />
haben (z.B. bei den Übergängen aus dem Arbeitsleben, der Gestaltung ihrer<br />
Wohnumgebung, der gesundheitlichen Versorgung, der Teilnahme an Bildungsangeboten<br />
etc.)<br />
39
2. Wie lernt man die Kundenwünsche kennen?<br />
Zunächst sollte man diese Wünsche erfragen. Da wegen der besonderen kognitiven<br />
und kommunikativen Möglichkeiten, aber auch wegen eingeschränkter<br />
Lebenserfahrungen es gerade bei Menschen mit sog. geistiger Behinderung<br />
schwierig sein kann, Wünsche zu erfragen, sollte zusätzlich eine Analyse der<br />
Lebenslage und Lebensverläufe erfolgen. Diese berücksichtigt mehr als nur die<br />
Fragen medizinischen oder pflegerischen Bedarfs. Vielmehr geht es um<br />
• materielle, psychische, physische und soziale Aspekte, um<br />
• Kontakte und Rollen, um<br />
• Statuszuschreibungen und soziale Anerkennung ebenso wie um<br />
• die jeweiligen Biografien.<br />
Wie in einem Kaleidoskop können so die Lebenssegmente beleuchtet werden, in<br />
denen Menschen jeweils Bedeutung zukommt und denen sie Bedeutung beimessen,<br />
die also ihre Lebensqualität ausmachen.<br />
3. Wie kann man die Kundenwünsche erfüllen?<br />
Indem man die Verschiedenheit der Menschen berücksichtigt und individuelle<br />
Bedarfe, Bedürfnisse und Kontexte, fehlende und vorhandene Ressourcen einbezieht.<br />
Mit den Verfahren der individuellen Hilfeplanung lassen sich dann die notwendigen<br />
Unterstützungsdimensionen und deren konkrete Umsetzungswege im<br />
Einzelfall finden, vereinbaren und ausgestalten.<br />
Gute auf diese Erkenntnisse aufbauende Konzepte berücksichtigen, die<br />
• Gesundheitslage und -versorgung, aber auch<br />
• die Selbstsicht und Zukunftswünsche sowie<br />
• die Kompetenzen zur Selbstsorge und Selbstbestimmung<br />
der Menschen mit Behinderung.<br />
Damit verbindet sich automatisch die Frage, wer bei der Hilfegestaltung im Boot<br />
sein muss. Die Antwort ist gleichermaßen einfach wie umfassend:<br />
Alle teilhaberelevanten Teilsysteme in einer Kommune/Gemeinde/Region. Zwischen<br />
diesen und innerhalb dieser müssen sich dann Unterstützungsprozesse<br />
gestalten.<br />
Das führt mich zum nächsten Frageaspekt: der Perspektive der jeweiligen<br />
Dienstleister – einerlei ob es sich um private, öffentliche oder nachbarschaftliche<br />
Hilfen handelt.<br />
40<br />
Auch hier stelle ich wieder drei Fragen:<br />
1. Welche Prozesse sind relevant?<br />
Hier sind alle Abläufe zur Finanzierung, Planung, Differenzierung und Umsetzung<br />
geeigneter Hilfen wichtig. Für Lebensqualität ist eine unentgeltliche Familienstunde<br />
nicht weniger wert als eine teure Fachleistungsstunde. Dies gilt im<br />
Binnenbetrieb der Leistungsträger und -anbieter ebenso wie in den Kooperationsfeldern<br />
des gegliederten Hilfesystems.<br />
2. Wie sollten die Prozesse laufen?<br />
Sie sollten schnell, zuverlässig und zielgenau laufen. Es gilt Abschied zu nehmen<br />
von Wagenburgmentalitäten zwischen Anbietern der Pflege-, Behinderten- oder<br />
Altenhilfe, der verschiedenen Rehabilitationsträger, der Bildungs- oder Medizinisch-therapeutischen<br />
Dienste. Dies gelingt dann am besten, wenn Schnittstellen,<br />
Zuständigkeitsfragen und Informationen nicht dazu zwingen, gegen spezifische<br />
Eigeninteressen zu handeln. Insofern ist es auch ein Strukturentwicklungsthema.<br />
3. Wie kann man das umsetzen?<br />
Es genügt nicht, vorhandene Angebote der Behindertenhilfe nur zu intensivieren<br />
oder um Aspekte der Pflege oder Geriatrie anzureichern. Vice versa gilt dies<br />
ebenso für Pflege- oder Altenhilfedienste.<br />
Aber es kann sich lohnen, Methoden des Care- und Casemanagements vermehrt<br />
zum Tragen kommen zu lassen, um so Hilfe nach Maß im Einzelfall zu gestalten.<br />
Denn wenn „Balanced Aging“ altern mit Lebensqualität bedeutet, dann kann es<br />
nicht darum gehen, Menschen mit Unterstützungsbedarf den vorhandenen Hilfesystemen<br />
anzupassen, sondern die Organisationen müssen ihre Perspektive<br />
und teilweise wohl auch ihre Angebotsformen und -intensionen so wandeln,<br />
dass sie die jeweilig passende Unterstützung bieten können.<br />
Damit sind wir bei der vierten, der Lern- und Entwicklungsperspektive angelangt,<br />
die ich mit dem fünften Aspekt, der Suche nach weiteren relevanten Fragen,<br />
verbinden will.<br />
Ich fasse zunächst zusammen:<br />
Wir haben gesehen, dass Konzepte bei den Kompetenzen, Bedarfen und Bedürfnissen<br />
ansetzen müssen, die heute alte Menschen mit Behinderung haben und<br />
artikulieren. Sie müssen sich aber zugleich auf die nächsten Generationen, also<br />
41
auf zukünftig notwendige Angebote geeigneter Unterstützung beziehen und<br />
auf Lebensqualität zielen.<br />
Denn die in einer Generation und in einem Individuum jeweils vorhandenen,<br />
benötigten und verfügbaren materiellen, bio-psychischen und sozialen Ressourcen<br />
sind die Mittel, die auf dem Weg zum gelingenden Altern eingesetzt werden<br />
können.<br />
Sie zu finden, ist allerdings keine leichte Aufgabe.<br />
Behilflich wird auch hier sein, die richtigen Fragen zu stellen und daraus Leitlinien<br />
für die Aufgaben der Rehabilitation abzuleiten.<br />
Dass sich diese Leitlinien zunächst nicht unterscheiden können von den Zielen<br />
und Aufgaben der Altenpolitik insgesamt – das gebietet der Aspekt der Gleichberechtigung<br />
aller BürgerInnen. Die Kenntnis der national und international<br />
entwickelten Pläne und Konzepte ist also der Ausgangspunkt (vgl. Madridplan<br />
der UNO 2002; POHLMANN 2002; UNECE 2002). Er wird markiert vom Ziel der<br />
gesellschaftlichen Teilhabe, das an konkreten Aufgabenfeldern realisiert werden<br />
muss.<br />
Aus den dort gefundenen Einzelaufgaben lässt sich dann der Weg ableiten und<br />
aus der erreichten Umsetzung die Qualität der Hilfen beurteilen.<br />
Aus meinen bisherigen Erwägungen lassen sich vor allem fünf Teilhabebereiche<br />
erkennen, mit denen sich erfolgreiches Altern für Menschen mit Behinderung<br />
– Balanced Aging – genauer bestimmen lässt:<br />
1. Gesundheitsversorgung und Prävention<br />
2. Förderliche soziale Netze<br />
3. Gewünschter Lebensort und (barrierefreie) Umgebung<br />
4. Bildung und Freizeit<br />
5. Anerkennung und Respekt<br />
Aus diesen lassen sich dann die strategischen Ziele ableiten, die man vorrangig<br />
erreichen will.<br />
Leider bleibt hier nicht die Zeit, dies näher auszuführen. Manches verdeutlicht<br />
sich vielleicht heute Nachmittag, wenn ich ein Projekt vorstelle, das sich auf den<br />
Aufgabenbereich 1: Gesundheitsversorgung und Prävention bezieht.<br />
Jetzt gebe ich nur einen groben Rahmen dazu zur Einstimmung:<br />
Man sagt zu recht, wer erfolgreich altern will, solle rechtzeitig damit anfangen.<br />
42<br />
Am Beispiel der Teilhabe am Gesundheitssystem konkretisiert bedeutet das:<br />
Förderliche Lebensbedingungen entstehen beispielsweise dann, wenn<br />
• die gesundheitliche Vor- und Fürsorge eine Rolle spielt bei der individuellen<br />
Hilfeplanung und -gestaltung, aber auch in der Ausbildung der UnterstützerInnen<br />
und bei der Information der Angehörigen und Betreuer 6 . Dazu<br />
erproben wir unter dem Titel KompAs: „Kompetentes Altern sichern!“ ein<br />
Programm zur Gesundheitssicherung und -förderung für ältere Menschen mit<br />
geistiger Behinderung.<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• der Zugang zu medizinischen, therapeutischen und präventiven Programmen<br />
unabhängig von Status und Lebensalter gewährleistet ist und die jeweils<br />
relevanten Professionen Hand in Hand arbeiten.<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• die Gesundheitsversorgung für alle durch niedrigschwellige Angebote gewährleistet<br />
wird, wenn auch Grenzüberschreitungen zwischen den Leistungsträgern<br />
möglich sind, wenn individuell zugeschnitten agiert und schnell reagiert<br />
wird.<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• individuelle Hilfeplanung, Qualitätsmanagement und -sicherung und Nutzerschutz<br />
die Qualität der Angebote ebenso erhöhen wie eine gesteigerte Durchgängigkeit<br />
der Versorgungsstrukturen (wenn z.B. Prävention, Pflege, Kuration<br />
und Rehabilitation gleichzeitig erfolgen können).<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• Menschen mit Behinderung selbst geübter werden dabei, ihren Gesundheitsstatus<br />
einzuschätzen und Veränderungen zu erkennen, indem auch die für sie<br />
jeweils geeigneten Kommunikationsmittel gefunden werden und zugänglich<br />
6) Dafür wird derzeit beispielsweise von der Universität Dortmund gemeinsam mit der Technischen<br />
Universität München unter dem Titel KompAs: „Kompetentes Altern sichern!“ ein Modellversuch<br />
zur Gesundheitssicherung und -förderung durchgeführt, in dem ein Verfahren entwickelt und erprobt<br />
wird, um Menschen an der Schwelle zum Alter, die in einer Einrichtung der Behindertenhilfe<br />
leben, mit eigenen Gesundheitsprogrammen zu unterstützten. In diesem „Programm zur gesundheitlichen<br />
Prävention für Erwachsene“ (ProPEr) gehen die entscheidenden Impulse für<br />
geeignete gesundheitsförderliche Maßnahmen von den Menschen mit Behinderung selbst aus.<br />
43
44<br />
sind, mit denen sie mehr über ihr Befinden lernen und mitteilen können (z.B.<br />
<strong>Bro</strong>schüren in einfacher Sprache, nonverbale Kommunikationshilfen, aber<br />
auch Unterstützung durch Experten wie Gebärdendolmetscher etc.).<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• behinderungserfahrene Menschen individuelle Potentiale besser erschließen<br />
können und auch kompetenter mit Einschränkungen umgehen lernen 7 .<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• professionelle Helfer ebenso wie engagierte Laien lernen zu unterscheiden,<br />
ob sich hinter Veränderungen im Verhalten und der Befindlichkeit biologische<br />
Alternsprozesse verbergen (z.B. Veränderungen im Seh-, Hör- oder Verarbeitungsvermögen)<br />
oder ob eher an Demenzen, Alzheimererkrankungen oder<br />
auch an Spätfolgen jahrelanger Medikation mit Psychopharmaka zu denken<br />
ist.<br />
Förderliche Bedingungen entstehen, wenn<br />
• spezielle Interventionen in besonderen Aufgabenfeldern, beispielsweise der<br />
Biografiearbeit oder dem Umgang mit Demenzerkrankungen ebenso zielgerecht<br />
entwickelt werden wie spezielle Interventionen bei besonderen Risikogruppen<br />
(wie Hochbetagten, MigrantInnen, aber auch unterstützenden Angehörigen).<br />
Eine individuelle Gesundheitsplanung, die nicht nur präventive, rehabilitative<br />
oder therapeutische Interventionen vorsieht, sondern in der auch die jeweilige<br />
Zuständigkeit geklärt und abgestimmt wird, flankiert solche Maßnahmen und<br />
zwar unabhängig davon, ob der jeweilige Lebensort in oder außerhalb eines professionellen<br />
Hilfesystems liegt.<br />
7) Hier setzt ein internationales Schulungsprogramm „Selbstbestimmt Älterwerden“ an, in dem<br />
Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt werden beim Übergang in die Altersphase<br />
(vgl. HAVEMAN ET AL. 2000; HAVEMAN, STÖPPLER 2004).<br />
Ausblick<br />
Wie wird es weitergehen?<br />
Mehr und mehr Initiativen befassen sich mit den anstehenden Aufgaben:<br />
• Regionen machen sich auf den Weg,<br />
• Haupt- und ehrenamtliche 8 SeniorenbegleiterInnen werden geschult,<br />
• Konzepte für den Umgang mit Demenz erprobt 9 oder<br />
• Wege zur Integration älterer Menschen mit Behinderung in die Freiwilligenarbeit<br />
beschritten.<br />
Dies sind nur einige Beispiele aus dem bunten Strauß von Initiativen, die gelingendes<br />
Altern stützen wollen. Daraus schließe ich, dass sich die wachsende Anzahl<br />
an behinderungserfahrenen Menschen im Alter zwar zur gesellschaftlichen<br />
Aufgabe entwickelt, dass aber auch Lösungen entstehen und möglich sind.<br />
Wie es von diesem Punkt aus weitergeht hängt tatsächlich zum großen Teil<br />
davon ab, wohin man möchte.<br />
Dem Recht auf Teilhabe kann vor allem in der Begegnung zur Realisierung verholfen<br />
werden. In der konkreten Erfahrung miteinander werden negative Behinderungs-<br />
und Altersbilder abgebaut, im respektvollen Miteinander, im gemeinsamen<br />
Planen und Handeln entstehen Wege zur Teilhabe und Teilhabe.<br />
8) Vgl. www.tandem-seniorenbegleitung.de für Schleswig-Holstein.<br />
9) Vgl. das Projekt Kunststücke Demenz in NRW: www.erinnern-vergessen.de<br />
45
LITERATUR:<br />
BADER, INES (1986): Alte geistig behinderte Menschen im Heim. Lebensgeschichte, Bedürfnisse<br />
und Möglichkeiten zur individuellen Lebensgestaltung im Alter. In: Geistige Behinderung 25,<br />
271-279.<br />
BAG – Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (2000): Benchmarking<br />
Werkstätten für Behinderte. Münster.<br />
BALTES, M.M.; KOHLI, M.; SAMES, K. (Hrsg.) (1989): Erfolgreiches Altern: Bedingungen und Variationen.<br />
Bern.<br />
BALTES, M.M., MONTADA, L. (1996): Produktives Leben im Alter. Frankfurt/M.<br />
BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2001): Alter und Gesellschaft.<br />
Dritter Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Berlin.<br />
BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2002): Risiken, Lebensqualität<br />
und Versorgung Hochaltriger – unter Berücksichtigung dementieller Erkrankungen. Vierter<br />
Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin.<br />
BRADDOCK, DAVID (1999): Aging and Developmental Disabilities: Demographic and Policy Issues<br />
Affecting American Families. In: Mental Retardation 37, 155-161.<br />
BUCHKA, MAXIMILIAN (2003): Ältere Menschen mit geistiger Behinderung. Bildung, Begleitung,<br />
Sozialtherapie. München.<br />
CONCLIFF, CHRIS; WALSH, PATRICIA NOONAN (1999): An International Perspective on Quality. In:<br />
Stanley Herr; Germain Weber: Aging, Rights, and Quality of Life. Prospects for Older People with<br />
Developmental Disabilities. Baltimore; London; Toronto; Sydney, 237-252.<br />
Council of Europe – CETS no. 163 (1996): European Social Charter (revised). Straßbourg. 3. Mai<br />
1996.<br />
Deutscher Bundestag (2002): Enquete-Kommission Demographischer Wandel. Herausforderungen<br />
unserer älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik. Schlussbericht. Paderborn.<br />
DIETZEL-PAPAKYRIAKOU, M.; OLBERMANN, E. (1996): Soziale Netzwerke älterer Migranten. Zur Relevanz<br />
familiärer und innerethischer Unterstützung. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie<br />
29/1, 34-41.<br />
EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (2001): Proceedings<br />
of the conference ‘Looking to a positive future: the best quality of life for ageing people with intellectual<br />
disabilities’. Held on the 4th and 5th of October 2001 in Verona, Italy. Brussel, Belgium.<br />
(www.easpd.org)<br />
ECARIUS, JUTTA (1996): Individualisierung und soziale Reproduktion im Lebensverlauf. Konzepte der<br />
Lebenslaufforschung. Opladen.<br />
FLEISCHHAUER, KURT (1999): Altersdiskriminierung bei der Allokation medizinischer Leistungen. Kritischer<br />
Bericht zu einer Diskussion. In: L. Honnefelder; C. Streffer: Jahrbuch für Wissenschaft und<br />
Ethik. Bd. 4. Berlin, 195-252.<br />
FUCHS, CHRISTOPH (1999): Ethische Aspekte der Mittelknappheit im Gesundheitswesen: Die Bedeutung<br />
von Leitlinien. In: L. Honnefelder, C. Streffer (Hrsg.): Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik.<br />
Bd. 4. Berlin, 175-186.<br />
GRONEMEYER, REIMER (2004): Kampf der Generationen. München.<br />
46<br />
HÄUSSLER, MONIKA; WACKER, ELISABETH; WETZLER, RAINER (1996): Lebenssituation von Menschen<br />
mit Behinderung in privaten Haushalten. Bericht zu einer bundesweiten Untersuchung im<br />
Forschungsprojekt „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“. Im Auftrag des<br />
Bundesministeriums für Familie und Senioren (BMFuS), hrsg. v. Bundesministerium für Gesundheit<br />
(BMG). Baden-Baden (Schriftenreihe des BMG Bd. 65).<br />
HAVEMAN, MEINDERT J. (1990): Erhöhte Lebenserwartung für Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
Erfahrungen aus den Niederlanden. In: Geistige Behinderung 29, 197-206.<br />
HAVEMAN, MEINDERT J. (1997): Alt werden mit geistiger Behinderung: Zur Epidemiologie von psychischen<br />
Störungen und Verhaltensstörungen. In: Germain Weber (Hrsg.): Psychische Störungen<br />
bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung. Bern; Göttingen; Toronto; Seattle, 27-40.<br />
HAVEMAN, M. J.; MAASKANT, M.A.; STURMANS, F. (1989): Older Dutch Residents of Institutions, with<br />
and without Down Syndrome: Comparisons of Mortality and Morbidity Trends and Motor/Social<br />
Functioning. In: Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities 15, 241-255.<br />
HAVEMAN, MEINDERT J. (2001): Perspektiven der Integration älterer Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
In: Hessisches Sozialministerium; Landeswohlfahrtsverband Hessen; Bundesvereinigung<br />
Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Lebensräume älterer Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg,<br />
157-180.<br />
HAVEMAN, MEINDERT J.; MICHALEK, SABINE; HÖLSCHER, PETRA; SCHULZE, M. (2000): Selbstbestimmt<br />
Älterwerden. Ein Lehrgang für Menschen mit geistiger Behinderung zur Vorbereitung auf<br />
Alter und Ruhestand. Marburg.<br />
HAVEMAN, MEINDERT; STÖPPLER, REINHILDE (2004): Altern mit geistiger Behinderung. Grundlagen<br />
und Perspektiven für Begleitung, Bildung und Rehabilitation. Stuttgart.<br />
Health Research Board, Ireland (Ed.)(2003): National Intellectual Disability Database. Annual Report<br />
of the National Intellectual Disability Database Committee 2001. Fiona Mulvany. Dublin, Ireland.<br />
HEDDERICH, INGEBORG; LOER, HELGA (2003): Körperbehinderte Menschen im Alter. Lebenswelt und<br />
Lebensweg. Bad Heilbrunn.<br />
HELLER, TAMAR ET AL. (1996): Impact of Personal-Centered Later Life Planning Training Program of<br />
Older Adults with Mental Retardation. In: Journal of Rehabilitation Jan.–Mar., 77-81.<br />
HERR, STANLEY; WEBER, GERMAIN (Eds.) (1999): Aging, Rights, and Quality of Life. Prospects for<br />
Older People with Developmental Disabilities. Baltimore. London. Toronto. Sydney.<br />
HÖLSCHER, PETRA; WACKER, ELISABETH; WANSING, GUDRUN (2003): Maß nehmen und Maß halten<br />
– in einer Gesellschaft für alle (2). Das „Persönliche Budget“ als Chance zum Wandel der Rehabilitation.<br />
In: Geistige Behinderung 42, 198-209.<br />
KAPLAN, ROBERT S; NORTON, DAVID, P. (1997): Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen.<br />
Stuttgart.<br />
KNEER, G.; NASSEHI, A. (2000): Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme: München (4. Aufl.).<br />
KRUSE, ANDREAS (2001): Aus-, Fort- und Weiterbildung: Neue Anforderungen an MitarbeiterInnen<br />
der Behindertenhilfe. In: Hessisches Sozialministerium; Landeswohlfahrtsverband Hessen; Bundesvereinigung<br />
Lebenshilfe e.V. (Hrsg.): Lebensräume älterer Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
Marburg, 205-228.<br />
KRUSE, A.; DING-GREINER, C.; GRÜNER, M. (2002): Den Jahren Leben geben. Lebensqualität im Alter<br />
bei Menschen mit Behinderungen. Projektbericht. Stuttgart: Diakonisches Werk Württemberg.<br />
Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern (Hrsg.)(2004): Geistig behinderte erwachsene<br />
Menschen in den Stadt- und Landkreisen. Angebotsentwicklung und Bedarfsvorausschätzung für<br />
Tagesstruktur und Wohnen. Stuttgart.<br />
47
MEIER-BAUMGARTNER, HANS PETER; DAPP, ULRIKE; ANDERS, JENNIFER (2004): Aktive Gesundheitsförderung<br />
im Alter. Ein neuartiges Präventionsprogramm für Senioren. Stuttgart.<br />
METZLER, HEIDRUN; WACKER, ELISABETH (2001): Behinderung. In: H.-U. Otto, H. Thiersch (Hrsg.):<br />
Handbuch Sozialarbeit. Sozialpädagogik. Neuwied, 118-139 (2. Aufl.).<br />
PACK, J.; BUCK, H.M.; KISTLER, E.; MENDIUS, H.G.; MORSCHHÄUSER, M.; WOLFF, H. (1999): Zukunftsreport<br />
demografischer Wandel. Meckenheim.<br />
PATJA, K.; LIVANAINEN, M.; VESALA H.; Oksanen, H.; Ruoppila, I. (2000): Life Expectancy with<br />
People with Intellectual Disability: A 35 Year Follow Up Study. In: Journal of Intellectual Disability<br />
Research 44, 591-599.<br />
POHLMANN, STEFAN (Hrsg.) (2001): Das Altern der Gesellschaft als globale Herausforderung – deutsche<br />
Impulse. Band 201. Stuttgart.<br />
POHLMANN, STEFAN (Ed.) (2002): Facing an Ageing World – Recommendations and Perspectives.<br />
Regensburg.<br />
POHLMANN, STEFAN (Hg.) (2003): Der demografische Imperativ. Hannover.<br />
POHLMANN, STEFAN (2004): Das Alter im Spiegel der Gesellschaft. Idstein.<br />
RAWLS, J. (1993): Political Liberalism. New York.<br />
RILEY, M.W.; RILEY, J.W. (1992): Individuelles und gesellschaftliches Potential des Alterns. In: P.B.<br />
Baltes, J. Mittelstraß, U.M. Staudinger (Hrsg.): Alter und Altern: ein interdisziplinärer Studientext<br />
zur Gerontologie. Berlin, 437-460.<br />
ROSENMAYR, LEOPOLD (1989): Altern und Handeln. In: A. Weymann (Hrsg.): Handlungsspielräume.<br />
Untersuchungen zur Individualisierung und Institutionalisierung von Lebensläufen in der Moderne.<br />
Stuttgart, 151-162.<br />
SCHUMACHER, NORBERT (2000): Soziale Sicherung für alternde und alte Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung (Hrsg.):<br />
Persönlichkeit und Hilfe im Alter: Zum Alterungsprozess bei Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
Marburg, 100-121 (2. Aufl.).<br />
SGB IX - SOZIALGESETZBUCH – Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen<br />
– Vom 19. Juni 2001. Bundesgesetzesblatt I, 1046.<br />
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (2003): Hrsg. v. Statistisches Bundesamt<br />
Wiesbaden (www.destatis.de).<br />
STAUDINGER, U.M.; GREVE, W. (2001): Resilienz im Alter. In: Deutsches Zentrum für Altersfragen<br />
(Hrsg.): Expertise zum Dritten Altenbericht der Bundesregierung. Band 1: Personale, gesundheitliche<br />
und Umweltressourcen im Alter. Opladen, 95-144.<br />
STÖPPLER, REINHILDE (2004): „Eisiger Winter“ oder „Goldener Herbst“? Menschen mit geistiger<br />
Behinderung im Alter. In: Pflegezeitschrift 3/2004 161-164.<br />
TROST, RAINER; METZLER, HEIDRUN (1995): Alternde und alte Menschen mit geistiger Behinderung<br />
in Baden-Württemberg. Zur Situation in Werkstätten für Behinderte und in Wohneinrichtungen.<br />
Hrsg. v. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden-Württemberg. Stuttgart.<br />
UNECE - United Nations Economic Commission for Europe (2002): Regional Implementation of the<br />
International Plan of Action on Ageing. Geneva.<br />
UNO - UNITED NATIONS (1982): International Plan of Action on Ageing. New York.<br />
UNO - UNITED NATIONS (1999): Human Rights and Older Persons. Geneva.<br />
UNO - UNITED NATIONS (2002): Madrid International Plan of Action on Ageing. New York.<br />
WACKER, ELISABETH (1993): Alte Menschen mit Behinderung. Forschungsstand und Forschungsbe-<br />
48<br />
darf. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. (Hrsg.): Alt und geistig behindert.<br />
Ein europäisches Symposium. Marburg, 97-123.<br />
WACKER, ELISABETH (1999): Altern in der Lebenshilfe – Lebenshilfe beim Altern. Lebenslagen und<br />
Unterstützungsformen. In: Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit Geistiger Behinderung<br />
(Hrsg.): Persönlichkeit und Hilfe im Alter. Zum Alterungsprozess bei Menschen mit geistiger<br />
Behinderung. Marburg, 23-45.<br />
WACKER, ELISABETH (2001a): Alter hat Zukunft – demographische Entwicklung älter werdender<br />
Menschen mit Behinderung und ihre Konsequenzen. In: Hessisches Sozialministerium, Landeswohlsfahrtsverband<br />
Hessen und Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.): Lebensräume älterer<br />
Menschen mit Behinderung. Hessische Erfahrungen. Marburg, 57-77.<br />
WACKER, ELISABETH (2001b): Wohn-, Förder- und Versorgungskonzepte für ältere Menschen mit<br />
geistiger Behinderung – ein kompetenz- und lebensqualitätsorientierter Ansatz. In: Deutsches<br />
Zentrum für Altersfragen (Hrsg.): Expertisen zum Dritten Altenbericht der Bundesregierung. Band<br />
5. Versorgung und Förderung älterer Menschen mit geistiger Behinderung. Opladen, 43-121.<br />
WACKER, ELISABETH (2003a): Behinderungen und fortgeschrittenes Alter als geragogische Herausforderungen.<br />
In: Annette Leonhardt, Franz B. Wember (Hrsg.): Grundfragen der Sonderpädagogik.<br />
Bildung. Erziehung. Behinderung. Weinheim; Basel; Berlin, 875-888.<br />
WACKER, ELISABETH (2003b): Residential needs and residential planning for elderly persons with<br />
mental handicap in Germany – a question of avoiding dependence. In: Networking in Practice.<br />
Connecting Partners in Rehabilitation. 8th European Regional Conference of Rehabilitation International<br />
2002.<br />
WACKER, ELISABETH (2003c): Die Rehabilitation im Wind des Wandels. Die Situation behinderungserfahrener<br />
Menschen im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen. In: Blätter der<br />
Wohlfahrtspflege 150, 45-51.<br />
WACKER, ELISABETH (2003d): Lebenslage und Lebensläufe älterer behinderter Frauen. Annäherung<br />
an ein unerforschtes Thema. In: Monika Reichert; Nicole Maly-Lukas; Christiane Schönknecht<br />
(Hrsg.): Älter werdende und ältere Frauen heute. Wiesbaden. 35-76.<br />
WACKER, ELISABETH; WANSING, GUDRUN; HÖLSCHER, PETRA (2003): Maß nehmen und Maß halten<br />
– in einer Gesellschaft für alle (1). Von der Versorgung zur selbstbestimmten Lebensführung.<br />
In: Geistige Behinderung 42, 108-118.<br />
WACKER, ELISABETH (2004a): „Bei der Versorgung von älteren Menschen mit Behinderung gibt es<br />
viel zu verbessern“. In: ProAlter. Fachmagazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe 37/2, 8-14.<br />
WACKER, ELISABETH (2004c): „Ist dabei sein alles? Dürfen alle dabei sein? Inklusion älterer Menschen<br />
mit Behinderung auf dem Prüfstand. In: Helmut Berghaus; Heike Bermond; Marcella Knipschild<br />
(Hrsg.): Aufeinander zugehen – miteinander umgehen – voneinander lernen. Köln, 85-105.<br />
WACKER, ELISABETH (<strong>2005</strong>a): Alter und Teilhabe. Grundsatzfragen und Aufgaben der Rehabilitation.<br />
In: Elisabeth Wacker et al. (Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg, 337-<br />
366.<br />
WACKER, ELISABETH (<strong>2005</strong>b): Selbst Teilhabe bestimmen? Von Duisburg nach Dortmund – eine fachliche<br />
Einstimmung. In: Elisabeth Wacker et al. (Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei<br />
sein. Marburg, 11-19.<br />
WACKER, ELISABETH ET AL. (<strong>2005</strong>): Teilhabe. Wir wollen mehr als nur dabei sein. Marburg.<br />
WACKER, ELISABETH; WETZLER, RAINER; METZLER, HEIDRUN; HORNUNG, CLAUDIA (1998): Leben<br />
im Heim. Angebotsstrukturen und Chancen selbständiger Lebensführung in Wohneinrichtungen<br />
der Behindertenhilfe. Bericht zu einer bundesweiten Untersuchung im Forschungsprojekt „Möglichkeiten<br />
und Grenzen selbständiger Lebensführung in Einrichtungen“. Im Auftrag des Bundes-<br />
49
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), hrsg. v. Bundesministerium für<br />
Gesundheit (BMG). Baden-Baden (Schriftenreihe des BMG Bd. 102).WALLER, HEIKO (2002):<br />
Gesundheitswissenschaft. Eine Einführung in Grundlagen und Praxis von Public Health. Stuttgart<br />
(3. Aufl.).<br />
WALSH, PATRICIA (2001): Ageing People with Intellectual Disabilities. A European Perspective. In :<br />
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, Proceedings of the conference<br />
‘Looking to a positive future: the best quality of life for ageing people with intellectual<br />
disabilities’. Held on the 4th and 5th of October 2001 in Verona, Italy. Brussel, Belgium<br />
(www.easpd.org), 33-40.<br />
WANSING, GUDRUN (<strong>2005</strong>a): Die Gleichzeitigkeit des gesellschaftlichen „Drinnen und Draußen“<br />
von Menschen mit Behinderung. In: Elisabeth Wacker et al. (Hrsg.): Teilhabe. Wir wollen mehr als<br />
nur dabei sein. Marburg, 21-33.<br />
WANSING, GUDRUN (<strong>2005</strong>b): Teilhabe an der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung zwischen<br />
Inklusion und Exklusion. Wiesbaden.<br />
WANSING, GUDRUN; HÖLSCHER, PETRA; WACKER, ELISABETH ( 2003): Maß nehmen und Maß halten<br />
– in einer Gesellschaft für alle (3). Personenbezogene Leistungen für alle – Budgetfähigkeit<br />
und Klientenklassifikation in der Diskussion. In: Geistige Behinderung 42, 210-221.<br />
WHO – World Health Organization (1980): International Classification of Impairments, Disabilities,<br />
Handicaps (ICIDH). A manual of classification relating to the consequences of disease. Geneva.<br />
WHO – World Health Organization (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa; Ontario,<br />
Canada.<br />
WHO – World Health Organization (2001): International Classification of Functioning, Disability and<br />
Health. Geneva.<br />
50<br />
Dr. med. Christina Ding-Greiner<br />
Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg<br />
Begegnung zweier Welten –<br />
Was Altenhilfe und Behindertenhilfe<br />
voneinander lernen können<br />
1. Die demografische Entwicklung und ihre Folgen<br />
Die demografische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland zeigt ein rasches<br />
Wachstum der Altersgruppe über 60 Jahre, von heute 23 Prozent auf 36<br />
Prozent im Jahre 2050. Insbesondere die Altersgruppe der über 80-Jährigen<br />
zeigt nach Vorausberechnungen eine rasche anteilmäßige Zunahme von heute<br />
3,5 Prozent auf 6,2 Prozent im Jahre 2020 und 11 Prozent im Jahre 2050.<br />
Eine ähnliche Entwicklung findet sich in den höheren Altersgruppen bei geistig<br />
oder körperlich behinderten oder psychisch kranken Menschen. Die zahlenmäßig<br />
kleinste Altersgruppe ist die der über 65-Jährigen, und sie zeigt den größten Zuwachs.<br />
Insgesamt hat sich das Durchschnittsalter im stationären Wohnbereich<br />
der Behindertenhilfe in den letzten Jahren von 38,7 auf 40 Jahre erhöht. Diese<br />
Entwicklungen müssen bei der Planung von Wohnen, Pflege und der Alltagsgestaltung<br />
berücksichtigt werden.<br />
Auf Grund verbesserter hygienischer Bedingungen, einer besseren medizinischen<br />
Versorgung und eines gesunden Lebensstils ist die durchschnittliche Lebenserwartung<br />
in der Gesamtbevölkerung deutlich angestiegen. Auch bei Menschen<br />
mit geistiger Behinderung zeigt sich diese Entwicklung, allerdings in<br />
Abhängigkeit vom Schweregrad der geistigen Behinderung. Sehr schwer geistig<br />
behinderte Menschen haben insbesondere in den ersten Lebensjahrzehnten ein<br />
deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko, während Menschen mit einer leichten oder<br />
mittelgradigen geistigen Behinderung eine durchschnittliche Lebenserwartung<br />
erreichen, die jener der Gesamtbevölkerung entspricht.<br />
Diese Entwicklung führt dazu, dass zunehmend auch bei Menschen mit geistiger<br />
Behinderung demenzielle Erkrankungen auftreten. Die Prävalenz der Demenz in<br />
der Altersgruppe über 65 Jahren beträgt das Vierfache des Vorkommens in der<br />
51
Gesamtbevölkerung, wie Untersuchungen durch Vergleich von alterskorrelierten<br />
Probandenpaaren ergeben haben. Diese Patientengruppe zeigt auch eine erhöhte<br />
allgemeine Morbidität. Bei Menschen mit Down-Syndrom treten dementielle<br />
Erkrankungen 10 bis 20 Jahre früher auf und ihre Prävalenz ist deutlich<br />
erhöht.<br />
In dem Projekt „Vergleich von stationären Einrichtungen der Altenhilfe mit Einrichtungen<br />
der Behindertenhilfe hinsichtlich der Betreuungs- und Pflegekonzepte<br />
für ältere Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung“,<br />
das am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg mit Unterstützung<br />
der Robert-Bosch Stiftung ausgeführt worden ist, wurden Formen der<br />
Betreuung und Pflege von älteren geistig behinderten oder psychisch kranken<br />
Menschen in stationären Einrichtungen der Altenhilfe und der Behindertenhilfe<br />
dokumentiert. Es wurde davon ausgegangen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen<br />
auf Grund ihrer Ausbildung und langjährigen praktischen Erfahrung im<br />
täglichen Zusammenleben mit geistig behinderten Menschen Einsichten in<br />
deren Problemlagen und deren Entwicklung erworben haben, die sie zu Experten<br />
auf diesem Gebiet machen. Einige Ergebnisse der Befragung werden in der<br />
Folge dargestellt.<br />
2. Das Altern der BewohnerInnen und die Anforderungen an die MitarbeiterInnen<br />
in Einrichtungen der Behindertenhilfe<br />
Durch schriftliche und mündliche Befragung von MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe<br />
wurden Veränderungen ermittelt, die bei älteren Menschen mit geistiger<br />
Behinderung beobachtet wurden. Sie sind Ausdruck von Alternsprozessen,<br />
die sich bei dieser Personengruppe bemerkbar machen. Der Alternsprozess bei<br />
Menschen mit geistiger Behinderung unterscheidet sich in seinem Verlauf qualitativ<br />
nicht von jenem in der Gesamtbevölkerung. Er wird charakterisiert durch<br />
Zeichen einer zunehmenden Einschränkung kognitiver und körperlicher Leistungsfähigkeit,<br />
eine allgemeine Verlangsamung und raschere Ermüdbarkeit,<br />
einen erschwerten Umgang mit Anforderungen und Belastungen, eine erschwerte<br />
Kommunikation und eine Zunahme von Ängstlichkeit und Unsicherheit,<br />
häufig als Folge von Stürzen. Menschen mit geistiger Behinderung haben<br />
die Fähigkeit sich auch noch im hohen Alter weiterzuentwickeln; sie können mit<br />
Hilfe einer professionell geführten Gesprächstherapie bei schwerem Verlusterleben<br />
ihre Problematik aufarbeiten und ihre Krise überwinden.<br />
52<br />
Bedarf und Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung entsprechen<br />
jenen von älteren Menschen ohne Behinderung. Sie benötigen mehr Zeit für ihre<br />
Tätigkeiten, der Bedarf an Unterstützung und Pflege steigt, sie brauchen Sicherheit<br />
und Geborgenheit, dazu gehört der Verbleib in einer ihnen bekannten Umgebung<br />
auch im Alter und die Kontinuität der persönlichen Beziehungen. Eine<br />
angemessene Beschäftigung soll sich den veränderten Interessen und einer veränderten<br />
Leistungsfähigkeit im Alter anpassen und mögliche Einschränkungen<br />
im Bereich der Motorik, des Gedächtnisses, des Seh- und Hörvermögens berücksichtigen.<br />
Kommunikation und Teilhabe an der Gemeinschaft, selbstständiges<br />
und selbstverantwortliches Handeln haben einen sehr hohen Stellenwert für<br />
eine gute Lebensqualität im Alter. Die genannten Bedürfnisse, die die Grundlage<br />
der Betreuung und Pflege bilden, sind für alle Personengruppen relevant. Sie bilden<br />
Grundbedürfnisse des Menschen ab, die ihre Gültigkeit haben bei allen<br />
Menschen und unabhängig davon sind, ob eine chronische Krankheit, eine geistige<br />
Behinderung oder eine Demenz vorliegen.<br />
MitarbeiterInnen, die geistig behinderte Menschen betreuen, haben Anforderungen<br />
und Belastungen in ihrem Berufsalltag benannt. Sie weisen darauf hin,<br />
dass im Alter eine erhebliche allgemeine Verlangsamung der BewohnerInnen beobachtet<br />
wird, die Begleitung bei relativer Selbstständigkeit der BewohnerInnen<br />
geht daher auch mit einem wesentlich höheren Zeitbedarf einher als bei Übernahme<br />
der Tätigkeiten durch den Mitarbeiter. Häufig wird die Kommunikation<br />
mit den BewohnerInnen zusätzlich durch ablaufende Alternsprozesse erschwert,<br />
insbesondere auch bei demenziellen Entwicklungen. In Wohngruppen, in denen<br />
überwiegend SeniorInnen leben, sind u.a. auch deshalb die Anforderungen<br />
größer als in gemischten Gruppen. MitarbeiterInnen und BewohnerInnen brauchen<br />
mehr Zeit um sich gegenseitig zu verstehen, insbesondere jedoch brauchen<br />
die BewohnerInnen länger, um Besprochenes umzusetzen.<br />
Die Entwicklung in den vergangenen Jahren führt in den Einrichtungen der Behindertenhilfe<br />
zu einer zunehmenden Übernahme von Pflege- und von hauswirtschaftlichen<br />
Tätigkeiten durch pädagogisch ausgebildete MitarbeiterInnen,<br />
sodass die pädagogischen Elemente in der Arbeit häufig zu kurz kommen. Die<br />
körperliche Belastung der MitarbeiterInnen nimmt durch Leistungseinschränkungen<br />
und einen größeren Pflegebedarf der BewohnerInnen zu. Als Ursache<br />
nennen sie den Verlust der Selbstständigkeit, Inkontinenz, Stürze, Folgeerscheinungen<br />
von Erkrankungen, beispielsweise Schlaganfall, und eine allgemeine<br />
Verlangsamung. Es ist nicht nur die aufwändige Pflege von einem oder mehreren<br />
bettlägerigen BewohnerInnen, die den Mitarbeiter belastet, sondern es sind<br />
53
ganz besonders die Folgen für die Wohngruppe, für die der Mitarbeiter auch verantwortlich<br />
ist. Die Anforderungen auf dem Gebiet der Pflege werden anspruchsvoller.<br />
Kenntnisse zur fachgerechten Lagerung von Bettlägerigen zur Vermeidung<br />
von Dekubitalgeschwüren oder zur Wundversorgung werden von den<br />
MitarbeiterInnen häufig als mangelhaft empfunden und führen zu Unsicherheiten<br />
auf dem Gebiet der Pflege.<br />
Die Mitarbeitenden nennen Offenheit für neue Entwicklungen, das Wahrnehmen<br />
von Veränderungen im Verhalten der BewohnerInnen und das Umsetzen der<br />
neuen Situation im alltäglichen Umgang mit den BewohnerInnen als eine wichtige<br />
Anforderung, die für eine gute Versorgung einen hohen Stellenwert hat. Sie<br />
erfordert ein hohes Maß an Sensibilität und Einfühlungsvermögen aber auch an<br />
Flexibilität, die den Mitarbeiter dazu befähigt, den Bewohner täglich neu in seiner<br />
Befindlichkeit oder in seinem Leistungsvermögen zu sehen. Als eine Voraussetzung<br />
dafür werden einerseits eine laufende Aktualisierung des Wissenstandes<br />
der MitarbeiterInnen genannt, zudem Erfahrung im Beruf – und im persönlichen<br />
Bereich Selbstreflexion und Lebenserfahrung, die die Entwicklung der<br />
erforderlichen Reife und Stabilität der Persönlichkeit unterstützen. Schließlich<br />
wurden der zunehmende Zeitaufwand für Dokumentation und Qualitätssicherung<br />
als eine weitere Anforderung und Belastung genannt.<br />
Das Wissen um Alternsprozesse ist jedoch bei AltenpflegerInnen vorhanden, sie<br />
kennen sich aus in allen Belangen der Fachpflege des älteren Menschen und können<br />
durch ihr Wissen und ihre Erfahrung wichtige Beiträge leisten zu einer guten<br />
(körperlichen) Versorgung von Menschen mit einer geistigen Behinderung.<br />
3. Die BewohnerInnen von Einrichtungen der Altenhilfe und die Anforderungen<br />
an die MitarbeiterInnen<br />
Das Profil der BewohnerInnen von stationären Einrichtungen der Altenhilfe hat<br />
sich in den vergangenen Jahren radikal verändert. Aufgrund der demografischen<br />
Entwicklung nimmt das Vorkommen dementieller Erkrankungen zu. Eine eigene<br />
Untersuchung in 28 Einrichtungen der Altenhilfe im Rhein-Neckar-Kreis ergab<br />
eine hohe Prävalenz sowohl von Demenz als auch von chronisch psychischen Erkrankungen<br />
(Depressionen, Schizophrenien, Persönlichkeitsstörungen) in Altenund<br />
Pflegeheimen ohne Pflegeschwerpunkt.<br />
Demenziell erkrankte Menschen sollen in ihrem Verlust der kognitiven und funktionalen,<br />
später auch der körperlichen Kompetenzen begleitet werden. Diese Be-<br />
54<br />
gleitung erfordert nicht nur die kompetente Ausübung pflegerischer Tätigkeiten,<br />
sondern auch genaue Kenntnisse der Biografie des Patienten und der neuropsychologischen<br />
Veränderungen, die diese Erkrankung verursacht. Diese Kenntnisse<br />
sind notwendig, um die oft schwer verstehbare Handlungsweise der PatientInnen<br />
einordnen, verstehen und auch akzeptieren zu können. Auf dieser Basis können<br />
dementiell Erkrankte fachgerecht versorgt werden. Die erforderlichen vertieften<br />
Kenntnisse werden allerdings nicht in der Regelausbildung der Altenpflege<br />
vermittelt, und in der Ausbildung von HeilerziehungspflegerInnen sind<br />
Kenntnisse zur Demenz nicht prüfungsrelevant. Vertiefende themenbezogene regelmäßige<br />
Weiterbildungen sind unabdingbare Voraussetzung einer professionell<br />
ausgerichteten Pflege in diesem Bereich.<br />
Der teilweise sehr hohe Anteil von chronisch psychisch kranken älteren BewohnerInnen<br />
stellt ganz neue Anforderungen an das Pflegepersonal, zumal in Einrichtungen<br />
mit einem hohen Anteil an chronisch psychisch Kranken auch geistig<br />
behinderte Menschen versorgt werden. Sie bilden eine anteilmäßig kleine Gruppe,<br />
doch eine Versorgung durch pädagogisch ausgebildete Pflegekräfte ist aus<br />
finanziellen Gründen nur unzureichend wenn überhaupt möglich. Im Curriculum<br />
der Altenpflegeausbildung erscheint die geistige Behinderung nicht als Lehrinhalt,<br />
sodass keine fachlichen Kenntnisse vorhanden sind und eine angemessene<br />
Versorgung nicht gewährleistet ist.<br />
Auch bei chronisch psychisch kranken Menschen entspricht der Verlauf der<br />
Alternsprozesse jenem in der Gesamtbevölkerung. Eine große interindividuelle<br />
Variabilität zeigt sich jedoch in den Reaktionen auf die wahrgenommenen Veränderungen.<br />
Anders als geistig behinderte Menschen, deren Behinderung im Lebenslauf<br />
weitgehend unverändert bleibt, haben chronisch psychisch kranke<br />
Menschen bei einem Auf und Ab ihrer Befindlichkeit und dem phasenweisen und<br />
häufig nicht vorhersehbaren Verlauf ihrer Erkrankung kaum die Möglichkeit<br />
einer Integration ihrer wechselnden psychischen und körperlichen Symptomatik.<br />
Kommen zusätzliche Belastungen hinzu, ist es noch schwieriger für den Patienten,<br />
das ohnehin labile Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.<br />
Die Anforderungen und Belastungen sind bei der Berufsgruppe der AltenpflegerInnen<br />
besonders groß. Nach Aussagen von MitarbeiterInnen der Altenhilfe sind<br />
die Kenntnisse, die ihnen in der Ausbildung vermittelt worden sind, nur oberflächlich<br />
und sie befähigen sie nicht zu einer umfassenden geronto-psychiatrischen<br />
Pflege, die zunehmend zu einer Notwendigkeit im Alltag von stationären<br />
Einrichtungen der Altenhilfe wird. Nur ein profundes Wissen um die Erkrankungen<br />
und ihre Manifestation erlaubt es auch den MitarbeiterInnen zwischen per-<br />
55
sönlichen oder aber krankheitsbedingten Übergriffen durch PatientInnen zu unterscheiden,<br />
das notwendige Maß an Distanz und Nähe, das der Patient zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt braucht, abzuschätzen. Genauso sollten die Pflegepersonen<br />
in der Lage sein, durch Selbstreflexion das Ausmaß an Nähe und an<br />
Distanz zum Patienten zu bestimmen, das für sie im Augenblick notwendig ist.<br />
4. Merkmale einer guten Betreuung und Pflege von älteren Menschen<br />
mit geistiger Behinderung oder psychischer Erkrankung<br />
MitarbeiterInnen von Einrichtungen der Alten- und der Behindertenhilfe haben<br />
gemeinsam Merkmale einer guten Pflege und Betreuung erarbeitet.<br />
An erster Stelle wurde von den MitarbeiterInnen die fachliche Qualifikation bezogen<br />
auf das Profil der BewohnerInnen genannt. Großes Gewicht wurde der<br />
Wahrung der Individualität in Pflege und Betreuung beigemessen. In der konzeptionellen<br />
Arbeit, die sich an den individuellen Bedürfnissen der BewohnerInnen<br />
orientiert, soll dies seinen Niederschlag finden. Dazu gehört auch das Recht<br />
des Bewohners in der ihm vertrauten Umgebung bis zu seinem Lebensende verbleiben<br />
zu können und die Kontinuität der Bezugspersonen. Tagesstrukturierende<br />
Angebote sollen sich an den Interessen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten<br />
der BewohnerInnen und auch an aufgetretenen Funktionseinschränkungen ausrichten,<br />
um eine optimale Versorgung der älteren BewohnerInnen zu gewährleisten.<br />
Die adäquate medizinische Versorgung gewinnt im Rahmen der Ausgliederung<br />
von BewohnerInnen in Wohngruppen in der Gemeinde an Bedeutung, denn<br />
die Ärzteschaft ist in keiner Weise fachlich darauf vorbereitet, mit geistig behinderten<br />
Menschen zu kommunizieren und sie adäquat zu versorgen. Schließlich<br />
wird auf die Bedeutung der Anpassung der räumlichen Umwelt auf die veränderten<br />
Bedürfnisse und Fähigkeiten der BewohnerInnen hingewiesen.<br />
Pflege und Betreuung in der Altenhilfe<br />
„Pflegebedürftigkeit entsteht, wenn körperliche und psychische Ressourcen<br />
nicht mehr ausreichen, die Anforderungen der alltäglichen Lebensführung und/<br />
oder die Anforderungen der Selbstversorgung, die aus einer Erkrankung und<br />
ihren Konsequenzen erwachsen, aus eigener Kraft zu bewältigen“. Es sind vor<br />
allen Dingen die Einschränkungen motorischer Funktionen, die zunächst zu<br />
einem zunehmenden Bedarf an Unterstützung führen, später in eine Abhängigkeit<br />
von pflegerischer Hilfe münden können. Der gesundheitspolitische Grund-<br />
56<br />
satz „ambulant vor stationär“ hat älteren Menschen durch die Einrichtung ambulanter<br />
Dienste die Möglichkeit gegeben, auch bei bestehendem Pflegebedarf<br />
ihr Alter weitgehend in der eigenen häuslichen Umgebung zu verbringen. Als<br />
eine Folge davon hat die Altenpflege ihren Aufgabenbereich erweitert; sie<br />
schließt nicht nur Maßnahmen ein, die sich auf die Pflegebedürftigen richten, zu<br />
ihrem Aufgabenbereich gehören auch die Unterstützung und Beratung sowie<br />
Anleitung und Überwachung der pflegenden Angehörigen und weiterer an der<br />
ambulanten, teilstationären oder stationären Pflege beteiligten Personen.<br />
Im Mittelpunkt der Altenpflegeausbildung steht für die Pflege und Begleitung<br />
älterer Menschen die so genannte „theoriegeleitete Pflegeprozesssteuerung“,<br />
die weltweit – so die WHO – als der <strong>Kern</strong> pflegerischen Handelns gesehen wird.<br />
Der Pflegeprozess wird begleitet mit folgenden Schritten: Pflegediagnostik, Pflegeplanung,<br />
Durchführen der Pflege (Pflegeintervention), Pflege-Supervision und<br />
Evaluation der Pflege.<br />
Diese Tätigkeiten sind auf das aktuelle Befinden des Bewohners ausgerichtet<br />
mit der Zielsetzung einer für den Bewohner befriedigenden Gestaltung seiner<br />
Situation.<br />
Pflege und Betreuung in der Heilerziehungspflege<br />
Heilerziehungspflege versteht sich als ganzheitliche Lebensbegleitung von Menschen<br />
mit psychischer Erkrankung, geistiger und/oder körperlicher Behinderung.<br />
Sie umfasst folgende Tätigkeitsbereiche: Bilden, Pflegen, Fördern und Begleiten.<br />
Das professionelle Handeln wird grundsätzlich durch persönlichkeitsfördernde<br />
und -bildende Aspekte bestimmt. Die heilerziehungspflegerischen Arbeitsfelder<br />
beziehen sich auf die gesamte Lebenswelt der begleiteten Menschen.<br />
Die Betreuung erfolgt in stationären, teilstationären Einrichtungen oder in ambulanter<br />
Form. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung eigenverantwortlich die<br />
Persönlichkeitsentwicklung, Sozialisation und/oder Rehabilitation von Menschen<br />
zu fördern, die auf Grund ihrer Behinderung oder Erkrankung auf körperlichem,<br />
geistigem oder sozialem Gebiet einen Unterstützungsbedarf haben.<br />
In der Behindertenhilfe hat sich das Berufskonzept als Fachlichkeitsprofil mit der<br />
Verbindung von sozialpädagogischen und pflegerischen Qualifikationen etabliert.<br />
57
Es werden drei Kompetenzbereiche unterschieden:<br />
1. Fachkompetenz wird durch Übertragung theoretischer Inhalte in die Praxis<br />
gesichert und zu professionellem selbstständigem Handeln weiterentwickelt.<br />
2. Selbstkompetenz ermöglicht es den HeilerziehungspflegerInnen in Beziehungsprozesse<br />
einzutreten und die Verantwortung für anvertraute Menschen<br />
zu übernehmen. Über das „Du“ des anderen erfährt und definiert sich das eigene<br />
„Ich“.<br />
3. Sozialkompetenz entwickelt sich aus einer Überprüfung eigener Beziehungsund<br />
Kommunikationserfahrungen und ermöglicht es, professionelle Beziehungen<br />
aufzubauen durch Reflexion der eigenen Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit<br />
und der eigenen Haltung gegenüber dem anderen Menschen.<br />
Die verschiedenen Kompetenzbereiche verstehen sich als integrierte<br />
Bestandteile eines ganzheitlichen Ansatzes des Berufsverständnisses.<br />
5. Was können Altenhilfe und Behindertenhilfe voneinander lernen?<br />
Auf Grund der demografischen Entwicklung, die auch geistig behinderte und<br />
psychisch kranke Menschen betrifft, wird das Thema Altern zunehmend relevant<br />
in der Behindertenhilfe. Inhalte aus der Geriatrie, der Gerontopsychiatrie, der<br />
Pflege älterer Menschen sollten in die Ausbildung von Heilerziehungspflegern<br />
implementiert werden.<br />
Der Aspekt der lebenslangen Entwicklung, der durchaus seine Gültigkeit auch<br />
für ältere und auch hochbetagte Menschen hat, sollte in der Altenhilfe berücksichtigt<br />
werden, um Entwicklungen zuzulassen und zu fördern, auch in der letzten<br />
Lebensphase.<br />
Bei fortgeschrittenen Stadien dementieller Erkrankungen treten Einbußen der<br />
Kommunikation immer häufiger auf. Die Altenhilfe sollte die jahrzehntelangen<br />
Erfahrungen nutzen, die mit Menschen mit geistiger Behinderung, die Kommunikationsstörungen<br />
zeigen, entwickelt worden sind.<br />
Die bedarfs- und bedürfnisgerechte Versorgung von älteren (pflegebedürftigen)<br />
Menschen erfordert ein Umdenken und eine Aufhebung der strengen Trennung<br />
zwischen Altenhilfe und Behindertenhilfe. Folgende Maßnahmen sind in diesem<br />
Kontext von Bedeutung:<br />
1. Die Integration von AltenpflegerInnen und HeilerziehungspflegerInnen in<br />
einem interdisziplinären Team.<br />
58<br />
2. Die Implementierung von Inhalten aus der Altenhilfe in die Ausbildung von<br />
HeilerziehungspflegerInnen (z.B. Alternsprozesse, Erkrankungen im Alter, Körperpflege,<br />
Umgang mit Demenz) und von Inhalten aus der Behindertenhilfe in<br />
die Ausbildung von AltenpflegerInnen (z.B. pädagogische Elemente, Kommunikationstechniken,<br />
lebenslange Entwicklung, Selbstreflexion).<br />
3. Die Öffnung von Altenhilfe und Behindertenhilfe zu einer gemeinsamen Nutzung<br />
von Angeboten.<br />
Das Wissen um Behinderung und um Erkrankung ermöglicht es der Pflegeperson<br />
einen guten Zugang zum Patienten zu finden. A. Frank, der selber Patient war,<br />
definiert die Rolle des Betreuers folgendermaßen:<br />
Betreuung beginnt damit, einen Unterschied zu machen. Ich gebrauche den Ausdruck<br />
„Betreuer“ nur für diejenigen, die bereit sind, dem Patienten zuzuhören<br />
und auf seine individuellen Bedürfnisse einzugehen. Eine solche Behandlung ...<br />
sieht Patienten als Individuen. Diese Einstellung ermöglicht es, dem Patienten<br />
ein Gefühl der Einzigartigkeit zu geben und sein Leben bedeutungsvoll zu machen.<br />
Wenn auf diese Weise die Lebensgeschichte des Patienten Teil der eigenen<br />
wird, gibt dies auch dem Leben des „Betreuers“ eine neue Bedeutung.<br />
59
60<br />
Prof. Mag. Rudolf Sotz<br />
Neue Wege gehen –<br />
Die Ausbildungsreform der<br />
Sozialbetreuungsberufe in Österreich<br />
Von diesem Referat liegt uns leider keine schriftliche Fassung vor. Wir drucken<br />
statt dessen einen Beitrag von Dr. Karl Winding aus der Zeitschrift Diakonie 1/05<br />
ab.<br />
Die PowerPoint-Präsentation des Vortrags von Mag. Sotz und den Originaltext<br />
der § 15a-Vereinbarung von Bund und Ländern finden Sie auf www.diakoniewerk.at<br />
unter dem Menüpunkt „Download“.<br />
Dr. Karl Winding<br />
Diplom- und Fach-SozialbetreuerIn als<br />
neu geregelte Sozialberufe<br />
Mit einer Bund-Länder-Vereinbarung haben sich ganz aktuell alle Länder mit<br />
dem Bund auf einheitliche Anerkennung und Regelungen für die Sozialberufe in<br />
Österreich geeinigt. Diese wichtige Weiterentwicklung bringt den sozialberuflichen<br />
Schulen des <strong>Diakoniewerk</strong>s neue Ausbildungsmöglichkeiten.<br />
Zu Sozialberufen wird in Österreich einerseits an Fachschulen und andererseits<br />
an Fachhochschul-Studiengängen ausgebildet. Die letzteren sind vor wenigen<br />
Jahren gegründet worden und ersetzen die Ausbildung an den früheren ‚Akademien<br />
für Sozialarbeit’. Sie bieten neben der klassischen Sozialarbeit auch neue<br />
Fachrichtungen wie ‚Soziale Dienstleistungen’ und ‚Sozialmanagement’. Die<br />
weitaus meisten sozialberuflichen AusbildungsteilnehmerInnen finden sich aber<br />
an den verschiedenen Fachschulen für die Alten-, Behinderten- und Familienarbeit.<br />
Die eingangs erwähnte Bund-Länder-Vereinbarung setzt genau hier an.<br />
Noch gibt es (auslaufend) verschiedene Schulen für die genannten Fachrichtungen;<br />
ein neuer Fachschultyp vereinigt diese Ausbildungsrichtungen und bietet<br />
61
eine Kombination aus Grundausbildung(en) und Spezialisierung(en). Das System<br />
ist dreijährig angelegt: Die vom <strong>Diakoniewerk</strong> entwickelte und sehr bewährte<br />
Lehranstalt für Heilpädagogische Berufe (LHB) geht in die Sparte Behinderten-<br />
Begleitung (BB) über: Ähnlich wie bisher kann hier mit starkem sozialpädagogischen<br />
Zuschnitt auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in der<br />
Ausbildung eingegangen werden.<br />
Neu ist ein Abschluss nach zwei Jahren als Fach-SozialbetreuerIn/BB, der genauso<br />
wie die Absolvierung zur Diplom-SozialbetreuerIn/BB (nach drei Jahren)<br />
durch die 15a-Vereinbarung eine österreichweite Berufsanerkennung genießen<br />
wird. Das frühere Basismodul wird weitgehend in das erste Jahr der neuen Ausbildungssparte<br />
aufgehen und bleibt somit eine ausbaubare Ausbildungseinheit.<br />
Wer – aus welchen Gründen immer – die Ausbildung schon nach dem ersten<br />
Jahr beenden will/muss, erwirbt eine Berufsberechtigung als ‚HeimhelferIn’.<br />
Neu ist für die Behindertenhilfe die folgende zweite Möglichkeit: Die Sparte<br />
‚Behindertenarbeit’ (BA) bietet eine zwei- bzw. dreijährige Ausbildung für die<br />
Behindertenhilfe inklusive Pflegehilfe. Diese Kombiausbildung hat sich in der Altenhilfe<br />
schon seit Jahren bewährt. Dennoch muss man klar sagen: Die Pflegehilfe<br />
bringt zwar einerseits 800 Stunden pflegerelevantes Wissen und Knowhow,<br />
andererseits verdrängt dieses Ausbildungsmodul aber auch im gleichen<br />
Stundenausmaß wichtige sozialpädagogische Inhalte, die aber weiterhin in der<br />
vorhin beschriebenen Sparte der Behindertenbegleitung vermittelt werden können.<br />
So werden die Schulträger und wohl letztlich der ‚Markt’ regulieren, wo<br />
welche Ausbildungssparten wie häufig angeboten werden. Im <strong>Diakoniewerk</strong> als<br />
großer Schulträger wird es meiner Meinung nach Sinn machen, beide Varianten<br />
anzubieten.<br />
Diplom- und Fach-SozialbetreuerInnen/BA sind durch die integrierte Pflegehilfekomponente<br />
auch zu den gesetzlich geregelten Tätigkeiten von PflegehelferInnen<br />
berechtigt. Diplom- und Fach-SozialbetreuerInnen/BB erhalten über eine<br />
Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (GuK) durch ein integriertes<br />
Ausbildungsmodul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ ebenfalls<br />
neu die Berechtigung zu einzelnen im Gesetz genau aufgezählten pflegenahen<br />
Tätigkeiten und treten damit aus einer rechtlichen Grauzone.<br />
In der Altenarbeit können genauso zwei- und dreijährige Abschlüsse erworben<br />
werden, wobei die zweijährige Ausbildung zur Fach-SozialbetreuerIn/AA der jetzigen<br />
‚Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe’ sehr ähnlich sein wird (beispielsweise<br />
ist weiterhin die Pflegehilfe enthalten). Neu ist hier die Option eines<br />
dritten Ausbildungsjahres und damit die von vielen schon lange herbei gesehnte<br />
62<br />
Diplom-Möglichkeit in der Altenarbeit. Dass diese Möglichkeit nicht nur über die<br />
Ausbildung verfügbar, sondern zusätzlich als Beruf österreichweit geregelt sein<br />
wird, ist eine große, ja sensationelle Entwicklung. Ähnlich ist auch die Ausbildung<br />
in der Familienarbeit (F) mit dreijährigem Abschluss angelegt, wenngleich<br />
dies bis dato kein Geschäftsfeld des <strong>Diakoniewerk</strong>s darstellt und von anderen<br />
Schulträgern die entsprechende Ausbildung angeboten wird.<br />
Als Fortschritt sind die zahlreichen horizontalen und vertikalen Um- und Aufstiegsmöglichkeiten<br />
zu bewerten, die das neue System bereit hält: Wer beispielsweise<br />
einen zweijährigen Abschluss als Fach-SozialbetreuerIn/AA erworben<br />
hat, kann über ein ‚Fachmodul’ den zusätzlichen Abschluss der Sparte BA<br />
erwerben und wird damit beruflich mobiler; neben der Diplommöglichkeit/AA<br />
gewinnt jemand damit auch den Zugang für das Diplom/BA. Dabei kann die<br />
Theorie eines Fachmoduls in wenigen Wochen absolviert werden (das entsprechende<br />
Praktikum wird mehr Zeit in Anspruch nehmen). Ein anschließendes Diplom(modul)<br />
ist auf ein Schuljahr angelegt, wobei Schulen die Diplomausbildungen<br />
sicherlich auch berufsbegleitend anbieten werden.<br />
Eine Anmerkung für sehr Bildungshungrige: Wer schon ein Diplom erworben hat<br />
(z.B. AA) für den verkürzt sich das Diplom der zweiten Fachrichtung (z.B. BA)<br />
deutlich! Die neue Gesetzeslage eröffnet zahlreiche weitere Um- und Aufstiegsmöglichkeiten,<br />
die im Detail dargestellt werden können, sobald das BMBWK (in<br />
Kooperation mit den Schulen) die Ausbildungsdetails entwickelt hat. Denn die<br />
15a-Vereinbarung ist für sich primär ein Berufsanerkennungsgesetz und kein<br />
Schulstatut oder Lehrplan. Interessant sind diese neuen Entwicklungen auch für<br />
AbsolventInnen früherer Ausbildungen (z.B. AltenfachbetreuerInnen), weil ihnen<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten und Anrechnungen winken werden.<br />
Das <strong>Diakoniewerk</strong> geht wie die anderen Schulträger davon aus, dass mit September<br />
2006 zu den neu geregelten Sozialberufen ausgebildet werden wird. Wer<br />
eine solche dreijährige sozialberufliche Fachschulausbildung abgeschlossen hat,<br />
kann sich übrigens – auch ohne Matura – an den eingangs beschriebenen Fachhochschulstudiengängen<br />
bewerben,* womit die Durchlässigkeit des neuen Systems<br />
auch in seiner vertikalen Dimension besonders deutlich wird.<br />
*<br />
Wer auf Basis einer dreijährigen Sozialberufsausbildung (ohne Matura) an einem einschlägigen<br />
Fachhochschulstudiengang aufgenommen wird, kann regulär mit dem FH-Studium beginnen. Bis<br />
Ende des ersten Ausbildungsjahres sind die ‚unvermeidlichen’ Ergänzungsprüfungen aus Deutsch,<br />
Englisch, Mathematik und eines (vierten) Wahlfachs (z.B. Geografie oder Geschichte) abzulegen.<br />
Klappt das, so kann man auch ohne Matura sein FH-Studium normal fortsetzen und abschließen.<br />
Genaue Auskünfte erteilen dazu die jeweiligen FH-Studiengänge.<br />
63
64<br />
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker<br />
KompAs – Kompetentes Altern sichern<br />
Gesundheitsförderung durch die Entwicklung eines<br />
Programms zur gesundheitlichen Prävention<br />
Ich berichte Ihnen über Erfahrungen, die wir in einem Projekt mit Menschen mit<br />
geistiger Behinderung und für Menschen mit geistiger Behinderung gesammelt<br />
haben, das noch nicht abgeschlossen ist. Ich gebe Ihnen einen Eindruck von den<br />
Erkenntnissen, wie wir sie bislang gewonnen haben. Das Projekt heißt „Kompetentes<br />
Altern sichern“.<br />
Das Projekt geht vom umfassenden Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) aus. Es geht nicht alleine um körperliche Funktionsfähigkeit,<br />
sondern um allgemeines Wohlbefinden. Die Zielgruppe sind Menschen, die geistig<br />
behindert genannt werden.<br />
Es geht darum herauszufinden, wie man die Gesundheit sichern und fördern<br />
kann und wie man präventive Elemente in den Alltag von Menschen mit geistiger<br />
Behinderung im Alter integrieren kann. Das Projekt wird von der Robert<br />
Bosch-Stiftung Stuttgart gefördert und wird gemeinsam mit dem Lehrstuhl für<br />
Sport und Gesundheitsförderung an der TU in München durchgeführt.<br />
Umfassender Gesundheitsbegriff<br />
Die Idee ist, bei einem umfassenden Gesundheitsbegriff anzusetzen. Es geht<br />
also nicht darum, körperliche Funktionen zu unterstützen, z.B. Sturzprophylaxe<br />
zu betreiben, die man im Alter dringend braucht. Es geht vielmehr darum, ein<br />
Körpergefühl und auch ein Selbstbewusstsein zu fördern.<br />
Wir gehen davon aus, dass die Bewegungskompetenz von Menschen mit Behinderung<br />
etwas ist, was sie befähigt, in ihrem Alltag wichtiger zu sein und viele<br />
Aufgaben besser bewältigen zu können. Dabei haben sie auch neue Chancen,<br />
soziale Kontakte zu knüpfen. Durch Bewegungskompetenz steigern sich nicht<br />
nur direkte Handlungspotentiale, sondern ebenso Chancen für soziale Kontakte<br />
und das Selbstwertgefühl. Dabei sind die Lebenskontexte der Zielgruppe von Bedeutung.<br />
Es verbessern sich die Rahmenbedingungen zum „Balanced Aging“,<br />
65
zum gelingenden Altern, das ich Ihnen heute morgen auf eine theoretische Art<br />
und Weise versucht habe näher zu bringen.<br />
Die älteren und alten Menschen mit geistiger Behinderung benötigen ein für sie<br />
geeignetes praxisnahes Gesundheits- und Bewegungsprogramm. Damit können<br />
ihre Chancen für gelingendes Altern sich verbessern, zusätzliche Beeinträchtigungen<br />
vermieden werden, und ihre Lebensqualität kann steigen.<br />
Projektaufbau<br />
Das Modul „ProPER“ dient zur Entwicklung und Erprobung eines Programms zur<br />
gesundheitlichen Prävention für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung<br />
durch Bewegung. Ziel ist ein optimiertes Bewegungsprogramm „ProPER“<br />
als Modell für Einrichtungen der Rehabilitation.<br />
Das Modul „KompAs“ dient der Steuerung des Prozesses der Programmentwicklung<br />
und Erprobung durch Workshops (lernendes System). Ziel ist ein optimiertes,<br />
zielgruppengerechtes Verfahren der Programmentwicklung und -gestaltung.<br />
Die Dauer des Projekts beträgt 2 Jahre, das Bewegungsprogramm selbst dauert<br />
12 Monate.<br />
Bewegungsprogramm<br />
Das Bewegungsprogramm wird in 5 Bereiche aufgeteilt:<br />
1. Gleichgewichtsschulung, Gangschule, Gangsicherheit<br />
2. Eigen- und Fremdwahrnehmung, Entspannung<br />
3. Krafttraining der Arm- und Beinmuskulatur<br />
4. Auge-Hand-Koordination<br />
5. Ausdauertraining<br />
Es wurden im Rahmen des Projekts sportmotorische Tests zur Ausdauerleistungsfähigkeit,<br />
Gleichgewichtsfähigkeit, Koordinationsfähigkeit, Reaktionsschnelligkeit<br />
und Kraft durchgeführt. Außerdem wurden Lebenslagenanalysen<br />
zu Wohlbefinden und Lebensqualität in Form von Interviews und Dokumentenauswertungen<br />
durchgeführt: Materielle, physische und psychische Lage, soziale<br />
Rollen und Kontakte, Wohnlage und andere Statusmerkmale.<br />
66<br />
Beispiele motorischer Assessments sind Ausdauerleistungsfähigkeit (Two-<br />
Minute-Walk), Beinkraft (Three-Chair-Rise), Zug- und Druckkraft der Arme<br />
(Kraftmessung), Koordinationsfähigkeit (Tapping-Test), Gleichgewichtsfähigkeit<br />
(Standpositionen nach Buchner), Reaktionsschnelligkeit (Reaktion auf visuelles<br />
Signal).<br />
Außerdem wurden alltägliche Handlungen („Activities of daily living“) herangezogen:<br />
• Eine Flasche öffnen<br />
• Eine Dose öffnen, einen Kaffeelöffel daraus entnehmen und das Pulver in<br />
einen Kaffeefilter geben<br />
• Mit einem Schlüssel ein Schloss aufschließen<br />
• Einen Kittel anziehen<br />
• Drei auf dem Boden liegende Gegenstände aufheben<br />
Sozialwissenschaftliche Assessments<br />
Nach einem Leitfaden wurden mit den StudienteilnehmerInnen Interviews zur<br />
Erfassung der Lebenslagen und zur Zufriedenheit mit den Lebensbedingungen<br />
von älteren und alten Menschen mit geistiger Behinderung an der Schwelle zum<br />
Ruhestand geführt. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach folgenden Kriterien:<br />
• Charakterisierung der Gesamtgruppe<br />
• Beschreibung der Lebenslagen und Lebensbedingungen einzelner Menschen<br />
mit geistiger Behinderung im Alter<br />
• Ermittlung eines Zufriedenheitsindexes<br />
• Ermittlung eines Aktivitätsindexes (ADLs und IADLs)<br />
Die Workshops zum Bewegungsprogramm wurden durch die TeilnehmerInnen<br />
bewertet. Die TeilnehmerInnen äußerten Verbesserungsvorschläge und Wünsche<br />
für die Zukunft. Die Auswirkungen des Programms auf den Alltag der TeilnehmerInnen<br />
wurde erhoben. Die Daten dienen der Konkretisierung der weiteren Planung<br />
des Angebots und der Anpassung des Angebots an die Vorstellungen der<br />
Zielgruppe. Rückmeldungen fließen im Verlauf in die Entwicklung des Programms<br />
ein.<br />
67
Ergebnisse der Workshops<br />
Die hohe Bedeutung des Programms hat sich bereits nach wenigen Wochen herausgestellt.<br />
Gesundheitliche Verbesserungen wurden bereits im zweiten Workshop<br />
geäußert. Die TeilnehmerInnen geben an, in den Bewegungsstunden auch<br />
etwas über ihre Gesundheit zu lernen. Verbesserungsvorschläge oder Wünsche<br />
beziehen sich meist auf die Wiederholung einzelner Übungen oder zusätzliche<br />
Aktivitäten. Nur wenigen TeilnehmerInnen sind die Stunden manchmal zu lang<br />
oder einzelne Übungen zu anstrengend. Befürchtungen bestehen in erster Linie<br />
in Hinblick darauf, dass das Programm über den Sommer hinaus nicht mehr fortgeführt<br />
wird.<br />
Die weitere Auswertung erfolgt mit dem Ziel<br />
• ein wissenschaftlich fundiertes Konzept für ein Bewegungsprogramm für ältere<br />
und alte Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung zu entwickeln<br />
• dieses Konzept in der Fachwelt (z.B. bei Symposien sowie in Form eines Manuals)<br />
zu verbreiten<br />
• Kostenträger für die Bedeutung von (präventiven) Gesundheitsprogrammen<br />
und damit verbundene Einsparungsmöglichkeiten zu sensibilisieren<br />
• die Lebensqualität für ältere Menschen mit Behinderungen durch ein flächendeckendes<br />
Angebot des Bewegungsprogramms zu fördern!<br />
Weitere Auswertungen folgen in den kommenden Monaten, insbesondere werden<br />
die speziellen Zufriedenheitsindices mit Programmelementen und die Aktivitätsindices<br />
(ADLs und IADLs) weiter ausgewertet und bewertet. Das Programm<br />
wird über ein Manual so dokumentiert, dass es in den Alltag der Angebote der<br />
Behindertenhilfe integriert werden kann. Zugleich wird daran gearbeitet, es in<br />
ein Gesamtkonzept des „Balanced Aging“ einzubinden. Dazu müssen die Lebenslagen<br />
und Lebensbedingungen der Menschen mit geistiger Behinderung im<br />
Alter berücksichtigt werden.<br />
Die PowerPoint-Präsentation von Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker mit Tabellen<br />
und weiteren Informationen finden Sie auf www.diakoniewerk.at unter dem<br />
Menüpunkt „Download“. Weitere Informationen zu den Projekten „KompAs“<br />
und „ProPER“ finden Sie unter www.fk-reha.uni-dortmund.de/Soziologie/KompAs<br />
68<br />
Dr. med. Christina Ding-Greiner<br />
Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg<br />
Lebensqualität im Alter bei<br />
Menschen mit geistiger Behinderung<br />
Ein Projekt zur Unterstützung<br />
kompetenzfördernden Verhaltens von<br />
MitarbeiterInnen in der Behindertenhilfe<br />
Selbstständigkeit und Selbstverantwortung gehören zu den wichtigsten Merkmalen<br />
von Lebensqualität, und selbst bei schweren psychischen und körperlichen<br />
Einschränkungen und auch noch im Sterben sollten Angehörige und Pflegepersonen<br />
versuchen, dem Betreuten selbstständiges Handeln zu ermöglichen.<br />
Auch bei demenziell erkrankten oder geistig behinderten und in der Selbstständigkeit<br />
der Lebensführung deutlich eingeschränkten Menschen sind immer Bereiche<br />
vorhanden, in denen Fähigkeiten erhalten sind. Diese Fähigkeiten zu entdecken,<br />
zu unterstützen und zuzulassen ist eine vordringliche Aufgabe von<br />
Angehörigen und von Pflegepersonen. Die Möglichkeit, den eigenen Willen oder<br />
die eigene Befindlichkeit in einer eigenständigen Handlung ausdrücken zu können,<br />
führt zu einer wesentlichen Verbesserung der Lebensqualität bei Menschen<br />
mit einer eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Leistungsfähigkeit.<br />
Zur Erfassung der Lebensqualität bei Menschen mit geistiger Behinderung hat<br />
Schalock einen Fragebogen entwickelt, der auch die Dimension „Selbstbestimmung“<br />
enthält. Diese Dimension umfasst folgende fünf Merkmale:<br />
Entscheidung über<br />
(a) tägliche Aktivitäten,<br />
(b) über das, was ich esse und trinke,<br />
(c) über die Art und Weise, wie ich meine Zeit verbringe,<br />
(d) persönliche Meinungen,<br />
(e) persönliche Ziele.<br />
Als eine Grundlage der Selbstbestimmung werden die Fähigkeiten und die Motivation<br />
des Individuums genannt, Aktivitäten des täglichen Lebens selbstständig<br />
auszuführen. Selbstbestimmung und soziale Teilhabe sind als Persönlichkeitsrechte<br />
zu betrachten, die allen Menschen zustehen.<br />
69
Untersuchungen aus dem Arbeitskreis von Margaret Baltes haben ergeben, dass<br />
unselbstständiges Verhalten älterer Menschen in stationären Einrichtungen der<br />
Altenhilfe nicht nur auf Kompetenzeinbußen beruhen, die auf Alternsprozesse<br />
zurückzuführen sind, sondern häufig Ausdruck einer negativen Erwartung hinsichtlich<br />
des Alternsverlaufs sind. Unselbstständiges Verhalten von älteren Menschen<br />
wird in stationären Einrichtungen von Pflegepersonen häufig mit einem<br />
Unselbstständigkeit unterstützenden Verhalten beantwortet. Dagegen werden<br />
selbstständige Verhaltensweisen meistens nicht verstärkt oder aber ignoriert.<br />
Unselbstständiges Verhalten im Selbstpflegebereich ist aus der Sicht des alten<br />
Menschen allerdings als eine Möglichkeit zu werten, eine persönlich zufrieden<br />
stellende Beziehung zum Pflegepersonal herzustellen oder aufrechtzuerhalten.<br />
Eine Umgebung, die die Selbstständigkeit der Bewohner weder beachtet noch<br />
unterstützt oder fördert, kann auch unselbstständiges Verhalten beim Bewohner<br />
bewirken.<br />
Prävention umfasst in diesem Kontext die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Vermeidung<br />
oder Verzögerung des Verlustes von Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die<br />
eine selbstständige Lebensführung ermöglichen. Prävention bedeutet hier Förderung<br />
selbstständigen Verhaltens in gefährdeten Aktivitätsbereichen im Frühstadium<br />
der Demenz oder aber lebenslang bei Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
Hilfestellung soll nur dann gewährt werden, wenn dazu eine Notwendigkeit<br />
besteht, wenn das selbstständige Verhalten des älteren Menschen entsprechend<br />
bestätigt und gelobt wird. In fortgeschrittenen Stadien der Demenz<br />
und/oder bei schwerer geistiger Behinderung werden sich präventive Maßnahmen<br />
auf die Ermittlung von erhaltenen Fähigkeiten und auf das aktive und gezielte<br />
Zulassen von noch vorhandenem selbstständigen Verhalten beschränken.<br />
Wie kann ein Verlust an Kompetenzen beim älteren Menschen verhindert werden?<br />
In dem Projekt „Lebensqualität im Alter bei Menschen mit einer geistigen Behinderung<br />
– Erhaltung und Förderung der Kompetenz“ wurden folgende Hypothesen<br />
untersucht:<br />
1. Ältere Menschen mit geistiger Behinderung können vorhandene Kompetenzen<br />
nicht nur erhalten, aktivieren und erweitern, sondern es können auch<br />
neue Kompetenzen erworben werden, da sie auch im hohen Alter lernfähig<br />
sind.<br />
2. Der Einfluss der sozialen Umwelt bzw. das Verhalten der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter kann bei Menschen mit geistiger Behinderung selbstständi-<br />
70<br />
ges Verhalten sowohl fördern als auch ignorieren und demzufolge zu einer<br />
Zunahme oder aber zu einem Verlust an Kompetenzen im alltagspraktischen<br />
Bereich führen.<br />
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen fachliche Kompetenzen um<br />
selbstständiges Verhalten gezielt zu fördern.<br />
Es wurde ein Interventionsprogramm entwickelt und eingesetzt, welches darauf<br />
ausgerichtet war, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine differenzierte<br />
Einschätzung vorhandener möglicher Kompetenzen bei älteren Menschen mit<br />
geistiger Behinderung vorzunehmen und das eigene Verhalten bei Pflege und<br />
Betreuung unter dem Gesichtspunkt der Unterstützung und Förderung von<br />
selbstständigem Verhalten zu reflektieren.<br />
Fünf Einrichtungen der Behindertenhilfe waren am Projekt beteiligt und insgesamt<br />
40 Probandenpaare – jeweils ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin und ein<br />
Bewohner / eine Bewohnerin, die bereit waren, sich an der Studie zu beteiligen.<br />
Das Projekt wurde in zwei Phasen durchgeführt; zur Interventionsgruppe gehörten<br />
30, zur Kontrollgruppe 10 Probandenpaare.<br />
Die Bewohner und Bewohnerinnen waren 46 bis 90 Jahre alt, und es sind leichte,<br />
mittlere und schwere Grade der Behinderung festgestellt worden; bei einem Teil<br />
der geistig behinderten Menschen bestand eine Demenz. Das Kriterium für die<br />
Teilnahme an der Studie war eine teilweise eingeschränkte Selbstständigkeit in<br />
den Aktivitäten des Alltags.<br />
Nach einer schriftlichen Befragung zu gerontologischen Themen, zu Erfahrungen<br />
mit beobachteten Veränderungen und Bedürfnissen im Alter bei Menschen mit<br />
geistiger Behinderung, zu Gewinnen und Verlusten im Alter, wurden in einem semistrukturierten<br />
Interview beobachtete Veränderungen im Alter erneut thematisiert,<br />
der Qualifizierungsbedarf ermittelt und die Situation, die gefilmt werden<br />
sollte, besprochen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten letztere selbst<br />
bestimmen.<br />
Ihr Betreuungsverhalten wurde an zwei Messzeitpunkten auf Video aufgenommen.<br />
Die Aufnahmen wurden später analysiert und die Ergebnisse quantitativ<br />
und qualitativ ausgewertet.<br />
Zwischen den beiden Messzeitpunkten fand eine zweitägige Fortbildung statt, in<br />
der gerontologische, geriatrische, gerontopsychiatrische und psychologische Inhalte<br />
vermittelt wurden und eine Einführung in die Methode der Verhaltensmodifikation<br />
stattfand. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten in die Lage<br />
71
versetzt werden, verloren gegangene Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den betreuten<br />
BewohnerInnen zu ermitteln, gezielt zu fördern und wieder aufzubauen.<br />
Im Anschluss daran fanden persönliche Gespräche statt, in denen die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter ihre Videosequenzen analysieren und reflektieren<br />
konnten. Ein Schwerpunkt dieser Reflexionsgespräche war die Analyse des eigenen<br />
Verhaltens mit Blick auf die Beeinflussung von selbstständigem bzw. unselbstständigem<br />
Verhalten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern.<br />
In der sich anschließenden Übungsphase konnten die erlernten Techniken in die<br />
Praxis umgesetzt werden und während 3 bis 5 Wochen konnten die Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter mit den Bewohnerinnen und Bewohnern alltagspraktische<br />
Tätigkeiten (Hauptaktivitäten) wie Zähne putzen, Haare waschen, duschen,<br />
Körbe flechten üben. Jede Hauptaktivität wurde in Teilaktivitäten untergliedert,<br />
die jeweils einzeln geübt werden konnten.<br />
Bei der quantitativen Analyse des Filmmaterials standen die Veränderungen im<br />
Verhalten der Bewohnerinnen und Bewohner im Vordergrund. Es wurde davon<br />
ausgegangen, dass die Ausführung einer Hauptaktivität 100 Prozent aller Teilaktivitäten<br />
einschließt. Der Anteil an Teilaktivitäten, den MitarbeiterInnen und<br />
BewohnerInnen jeweils übernommen hatten, wurde an beiden Messzeitpunkten<br />
bestimmt. Die Veränderungen im Grad der Selbstständigkeit zeigen statistisch<br />
signifikante Unterschiede zwischen den beiden Messzeitpunkten im Sinne einer<br />
Erweiterung alltagspraktischer Kompetenzen in der Interventionsgruppe.<br />
Die qualitative Analyse des Filmmaterials ergab, dass eine Zunahme der Kompetenzen<br />
bei Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur durch einen quantitativ erhöhten<br />
Anteil an ausgeführten Teilaktivitäten zum Ausdruck kommt.<br />
Es fanden sich qualitativ verschiedene Formen von Kompetenzerwerb:<br />
1. Erlernen einer neuen Aktivität führt zu zunehmender Selbstständigkeit des<br />
Bewohners und zu einer verminderten Unterstützung durch den Mitarbeiter.<br />
Beispiel: Der Bewohner hat gelernt, seine Zähne und sein Gebiss selbstständig<br />
zu putzen und die Utensilien aufzuräumen. Er braucht keine Unterstützung<br />
mehr durch die Mitarbeiterin.<br />
2. Erweiterung von Kompetenzen durch Ausbau vorhandener Fertigkeiten, die<br />
selbstständiger und mit mehr Ausdauer und Sorgfalt angewendet werden,<br />
führt zu einer reduzierten Hilfestellung durch den Mitarbeiter. Beispiel: Der<br />
Bewohner konnte sich rasieren, hatte jedoch keine Ausdauer, diese Tätigkeit<br />
72<br />
zu Ende zu führen. Er hat in der Übungsphase gelernt, weitgehend ohne Unterstützung<br />
sich komplett zu rasieren. Wegen einer Gehbehinderung ist eine<br />
geringe Unterstützung durch die Mitarbeiterin weiterhin notwendig.<br />
3. Erlernen einer neuen Aktivität mit zunehmender Selbstständigkeit des Bewohners<br />
bei gleich bleibender Unterstützung durch den Mitarbeiter wegen<br />
körperlicher Einschränkungen. Beispiel: Der Bewohner hat gelernt sich nach<br />
dem Bad abzutrocknen und einzucremen; sein Anteil an der Hauptaktivität<br />
hat sich deutlich vergrößert. Die Unterstützung durch die Mitarbeiterin ist allerdings<br />
wegen einer schweren Körperbehinderung in gleichem Umfang notwendig.<br />
Ihr Anteil an der Pflegehandlung ist daher zahlenmäßig gleich geblieben.<br />
4. Erweiterung der Kompetenzen durch Optimierung vorhandener Fertigkeiten,<br />
die selbstständiger und zweckmäßiger eingesetzt werden; dadurch ist eine<br />
Hilfestellung des Mitarbeiters nur in geringem Ausmaß notwendig. Beispiel:<br />
Der Bewohner hat beim Aufräumen der Spülmaschine gelernt Geschirr und<br />
Besteck so einzuräumen, dass kein Schaden entstehen kann. Er kommt mit<br />
derselben Anzahl von Handgriffen zu beiden Messzeitpunkten aus. Da er das<br />
Geschirr sinnvoller einräumt, greift der Mitarbeiter seltener korrigierend ein<br />
und daher reduziert sich sein Anteil an Teilaktivitäten.<br />
5. Erweiterung der Kompetenzen, ohne dass sich eine Veränderung in der anteilmäßigen<br />
Ausführung einer Hauptaktivität durch Mitarbeiter und Bewohner<br />
zeigt. Beispiel: Die Bewohnerin braucht aufgrund einer fortgeschrittenen<br />
Demenz sehr viel Hilfestellung. Der Anteil an geleisteten Teilaktivitäten bleibt<br />
in beiden Messzeitpunkten sowohl bei ihr als auch beim Mitarbeiter zahlenmäßig<br />
gleich, doch im Film zeigt sich, dass sie gelernt hat, den Pullover über<br />
den Kopf und die Hose hoch zu ziehen.<br />
6. Verminderung der Kompetenz. Die Anzahl der Teilaktivitäten des Bewohners<br />
verringert sich bei steigender Anzahl von Teilaktivitäten des Mitarbeiters. Beispiel:<br />
Der gesundheitliche Zustand dieser Bewohnerin verschlechterte sich,<br />
sodass die Mitarbeiterin zusätzliche Aktivitäten für sie übernehmen musste.<br />
Die Bewohnerin gehört der Kontrollgruppe an.<br />
Die selbstständige Ausführung von neu erlernten Aktivitäten durch die Bewohnerinnen<br />
und Bewohner ist meistens mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden,<br />
sodass die Umsetzung von Selbstständigkeitsfördernden Maßnahmen aus<br />
diesem Grund zwar sinnvoll und für die betroffene Person bedeutend, aber bei<br />
einer engen Personalsituation nicht immer auszuführen ist. Auf Grund bestehen-<br />
73
der körperlicher Einschränkungen kann häufig auf eine weitere Unterstützung<br />
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht verzichtet werden. Die Unabhängigkeit<br />
von jeglicher Unterstützung wie sie der Bewohner aus Beispiel 1 erreichte,<br />
charakterisiert den Ausnahmefall.<br />
Sowohl die detaillierte videogestützte Verhaltensbeobachtung als auch die Einschätzung<br />
des Grades alltagspraktischer Kompetenz durch schriftliche Befragung<br />
haben in der Interventionsgruppe statistisch signifikante Verbesserungen<br />
nach Intervention ergeben. Der Erfolg der Intervention macht deutlich, dass<br />
auch bei älteren Menschen mit geistiger Behinderung von einer lebenslangen<br />
Lern- und Bildungsfähigkeit ausgegangen werden kann. Einbußen in der Selbstständigkeit<br />
sind zu einem guten Teil vermeidbar oder aber korrigierbar. In dieses<br />
Projekt wurden auch Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung und<br />
auch mit einer Demenz miteinbezogen. Bei letzteren konnten in gleicher Weise<br />
nach einer Übungsphase Veränderungen i.S. einer Erweiterung von Kompetenz<br />
festgestellt werden. Ein höheres Ausmaß an Selbstständigkeit wird von den Bewohnern<br />
stets als eine Verbesserung der Lebensqualität betrachtet.<br />
74<br />
Mag. Harry F. J. Urlings<br />
Gesundheitspsychologe, Heilpädagoge<br />
und Validationsteacher<br />
Respektvolle und methodische<br />
Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit einer intellektuellen Behinderung<br />
Einleitung<br />
Auf folgende Punkte werde ich nacheinander zu sprechen kommen:<br />
• Die Vergreisung<br />
• Fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
• Die entwickelte Methodik<br />
• Die vier Elemente dieser Methodik<br />
• Die (spezielle) Schulung der BegleiterInnen<br />
1. Vergreisung<br />
Die Zusammensetzung der BewohnerInnen von Einrichtungen und Wohnheimen<br />
für Menschen mit intellektueller Behinderung verändert sich gegenwärtig stark<br />
(Maaskant, 1996). In den Niederlanden, mit zirka 16 Millionen Einwohnern,<br />
leben momentan ungefähr 130.000 Menschen mit einer intellektuellen Behinderung.<br />
Von ihnen lebten im Jahre 2004 18.000 Menschen in kleinen Wohnheimen<br />
und 35.000 Menschen in großen Einrichtungen. In diesen Wohnheimen und Einrichtungen<br />
nimmt die Vergreisung zu.<br />
In Zukunft werden daher nicht nur in allen Wohneinrichtungen sondern auch in<br />
den Tagesstätten immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen<br />
leben.<br />
Bei intellektuell behinderten Menschen wird meist ab einem Alter von 50 Jahren<br />
von Altwerden gesprochen. Die Zunahme des Anteils älterer Behinderter wird<br />
durch deren ständig wachsende Lebenserwartung verursacht. Das ist die Folge<br />
besserer medizinischer und pflegerischer Begleitung und auch der beschränkten<br />
75
Aufnahmekapazität. Um die Jahrtausendwende waren durchschnittlich 30 % der<br />
BewohnerInnen der Wohneinrichtungen für Menschen mit intellektueller Behinderung<br />
in den Niederlanden 50 Jahre und älter. Erwartet wird (Maaskant, 2001),<br />
dass im Jahre 2011 39 % der BewohnerInnen dieser Einrichtungen 50 Jahre oder<br />
älter sein werden.<br />
In Österreich und Deutschland spricht Weber über eine „verzögerte Alterswelle“<br />
der intellektuell behinderten Menschen. Bekanntlich leben hier weniger alte<br />
Menschen mit intellektueller Behinderung. Aber auch in Österreich und Deutschland<br />
wird in den kommenden Jahren diese Anzahl sehr stark zunehmen.<br />
Da bei intellektuell Behinderten häufig bereits in jüngerem Alter Alterserscheinungen<br />
wie die Alzheimersche Krankheit auftreten, stellt die Vergreisung ein<br />
drückendes Problem dar. Daher muss die Begleitung dieser Bewohnergruppe neu<br />
durchdacht werden. Viele MitarbeiterInnen machen bei der Begleitung mit älteren<br />
intellektuell behinderten Menschen die Erfahrung, in schwierigen Situationen<br />
über zu wenige Kenntnisse und nicht über die erforderlichen Fertigkeiten zu<br />
verfügen.<br />
2. Fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
Zur Illustration solcher Mängel möchte ich von zwei persönlichen Erfahrungen<br />
berichten. Ich arbeite als Gesundheitspsychologe und Heilpädagoge bei „Pepijn<br />
en Paulus“ in Echt, einer Trägerorganisation für Wohnheime und Tagesstätten für<br />
intellektuell behinderte Menschen.<br />
Meine erste diesbezügliche Erfahrung stammt aus der Mitte der achtziger Jahre,<br />
als ich anfing bei „Pepijn en Paulus“ als Gesundheitspsychologe und Heilpädagoge<br />
zu arbeiten.<br />
Diese persönliche Erfahrung beeindruckte mich sehr und führte dazu, mich intensiver<br />
in den Alterungsprozess intellektuell Behinderter zu vertiefen.<br />
76<br />
Der Fall Jan<br />
Ich kann mich noch sehr gut an einen Fall erinnern, als ich gerade bei<br />
„Pepijn en Paulus“ angefangen hatte. Die Begleiter baten mich um Rat bei<br />
Jan, einem älteren Bewohner mit Down-Syndrom, der sich sehr provozierend<br />
verhielt. An manchen Tagen kleidete er sich ganz normal und problemlos<br />
an, an anderen Tagen aber zog er sich beispielsweise seine Hose<br />
über den Kopf.<br />
Wir wollten ihm das abgewöhnen, denn wozu er an dem einen Tag fähig<br />
war, dazu musste er an einem anderen Tag auch imstande sein. Das war<br />
bei der Begleitung unser Ausgangspunkt.<br />
Jan reagierte auf unsere strengeren Anforderungen sehr heftig. Er wurde<br />
wütend, aggressiv und war verärgert. Unser Vorgehen hatte also eine entgegengesetzte<br />
Wirkung und führte lediglich zu mehr Aggressionen.<br />
Jan hatte in dieser Zeit bestimmt kein angenehmes Leben.<br />
Zum Glück kam jemand schließlich auf die Idee, es könnte sich um Demenz<br />
handeln. Ich war nicht derjenige. Wenn ich daran zurückdenke, empfinde<br />
ich noch heute tiefe Scham. Nun passten wir seine Begleitung an. Wir halfen<br />
Jan jetzt immer dann, wenn er nicht imstande war, sich selbst anzuziehen.<br />
Seine Laune besserte sich sichtlich, und er verbrachte noch ein paar<br />
gute Jahre bei uns.<br />
Ein häufiges Problem beim Altern ist das Dementieren. Keine seltene Erscheinung<br />
ist die Alzheimersche Krankheit, denn bei vielen Bewohnern mit Down-<br />
Syndrom treten Symptome dieser Krankheit bereits relativ früh auf. Aus dem<br />
Beispiel dürfte klar geworden sein, dass zur Früherkennung der Demenz entsprechende<br />
Kenntnisse vorhanden sein müssen. Die BegleiterInnen müssen wissen,<br />
welche Verhaltensweisen erste Anzeichen für das Dementieren sein können.<br />
Man muss jedoch ebenfalls wissen, dass Schilddrüsenabweichungen oder Intoxikationen<br />
und auch Depressionen manchmal zu ähnlichem Verhalten führen. Es<br />
muss ausgeschlossen werden können, dass es sich um diese Erkrankungen handelt.<br />
Diese sind oft gut zu behandeln.<br />
Im Folgenden werde ich nicht weiter auf die dafür erforderlichen Kenntnisse,<br />
sondern auf die für ältere und dementierende Menschen mit intellektueller Behinderung<br />
entwickelte Begleitungsmethodik zu sprechen kommen.<br />
Zunächst möchte ich von einer zweiten persönlichen Erfahrung berichten, die<br />
auch den Mangel an Kenntnissen und Fertigkeiten illustriert.<br />
„Pepijn en Paulus“ wurde 1970 eröffnet, in einer Zeit, als viele derartige große<br />
Einrichtungen gebaut wurden. In den siebziger Jahren wurden in diese Einrichtungen<br />
viele Kinder und Jugendliche aufgenommen. Hinzu kam in diesen Jahren<br />
eine große Anzahl von Einweisungen intellektuell Behinderter aus psychiatrischen<br />
Kliniken. Damals war es üblich, intellektuell behinderte Kinder in sonderpädagogische<br />
Einrichtungen einzuweisen, an die Sonderschulen gekoppelt wa-<br />
77
en. Im Laufe der Jahre veränderte sich die dieser Verfahrensweise zugrunde<br />
liegende Philosophie. Intellektuell behinderte Kinder bleiben nun solange wie<br />
möglich bei ihren Eltern, wobei die Eltern die erforderliche Unterstützung erhalten.<br />
Eine große Gruppe der erwachsenen Behinderten des Jahres 1970 war Ende der<br />
achtziger Jahre älter als 50 Jahre und gehörte deshalb zur Kategorie der alternden<br />
HeimbewohnerInnen. Ihre unmittelbaren BegleiterInnen – VerhaltenswissenschafterInnen,<br />
ÄrztInnen und SozialarbeiterInnen – mussten nun lernen,<br />
auch ältere intellektuell Behinderte adäquat und gut zu versorgen. Sie waren<br />
bisher daran gewöhnt, den BewohnerInnen zu möglichst großer Selbstständigkeit<br />
zu verhelfen und ihnen eventuelles problematisches Verhalten abzugewöhnen.<br />
Als sie jetzt mit diesen älteren BewohnerInnen konfrontiert wurden, stellte<br />
sich die auf Entwicklung abzielende Begleitungsform als inadäquat heraus. Viele<br />
BegleiterInnen fühlten sich den neuen Anforderungen nicht gewachsen.<br />
Bei „Pepijn en Paulus“ begannen wir damals mit der intensiven Ausarbeitung<br />
einer neuen Methodik zur Begleitung älterer Menschen mit intellektueller Behinderung.<br />
Auf diese Methodik werde ich gleich näher zu sprechen kommen.<br />
3. „Respektvolle und methodische Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit intellektueller Behinderung“<br />
Diese Methodik (Urlings, 1997, 2004) ist entstanden und bezieht ihre Stärke aus<br />
jahrelangen praktischen Erfahrungen bei der Begleitung und Versorgung alternder<br />
intellektuell behinderter Menschen. Angesichts von Begleitungsmethoden,<br />
die keine oder gegenteilige Effekte hatten, wurde in enger Zusammenarbeit mit<br />
den BegleiterInnen nach neuen Begleitungsformen gesucht. Im Laufe der Jahre<br />
konnte diese aus der Praxis abgeleitete Methodik weiterentwickelt werden. Sie<br />
wurde schließlich „respektvolle und methodische Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit intellektueller Behinderung“ genannt. Die Methodik<br />
besteht aus folgenden vier Elementen:<br />
• aus dem die Grundlage bildenden phänomenologischen Ansatz<br />
• aus anderen Begleitungsformen wie Realitäts-Orientierungs-Training, Reminiszenz,<br />
Warme Begleitung, Haptonomie, Massagen, Snoezelen und Validation,<br />
die den jeweiligen Bedürfnissen der Versorgung intellektuell Behinderter<br />
angepasst werden<br />
78<br />
• aus der Lebensgeschichte der älteren intellektuell behinderten Menschen<br />
• aus der Berücksichtigung des aktuellen Erlebens sowie der aktuellen Bedürfnisse<br />
und Wünsche dieser älteren Menschen.<br />
Schematisch lässt sich der Zusammenhang zwischen diesen Elementen wie folgt<br />
wiedergeben:<br />
4. Die vier Elemente der Methodik<br />
Der phänomenologische Ansatz ist das erste Element dieser Methodik.<br />
Die Phänomenologie ist eine sozialwissenschaftliche Strömung, die in der Psychologie<br />
sehr bekannt wurde, genannt humanistische Psychologie. Ihre Begründer<br />
waren Rogers und Maslow (Wilson, 1973). Die wichtigsten Ziele von Begleitung<br />
und Therapie sind dabei die Entfaltung des Individuums, das Respektieren<br />
der individuellen Persönlichkeit eines Jeden und seine Selbstverwirklichung. In<br />
der Hippie-Kultur der siebziger Jahre fand dieser Ansatz viele AnhängerInnen. In<br />
späteren Jahren galt die Phänomenologie lange als überholt, und verhaltenstherapeutische<br />
Ansätze überwogen. Angesichts des Fehlens einer theoretischen<br />
Grundlage für die Begleitung älterer intellektuell Behinderter erwies sich die<br />
phänomenologische Strömung der Erziehungswissenschaften als gut brauchbarer<br />
Ansatz – (Urlings und Mathijssen, 1996). Wichtige Begriffe, die sich auch in<br />
der Praxis gut verwenden lassen, sind hierbei:<br />
• die Bereitschaft, sich in andere Menschen einzufühlen (Empathie)<br />
• das Respektieren und Akzeptieren des anderen (unbedingte positive Akzeptanz)<br />
• das Respektieren eines Menschen als Individuum und das Berücksichtigen<br />
seiner Bedürfnisse.<br />
Aus diesen <strong>Kern</strong>punkten der Phänomenologie können wertvolle Aspekte bei der<br />
hier vorgestellten respektvollen und methodischen Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit intellektueller Behinderung abgeleitet werden. Die<br />
Phänomenologie bildet die Grundlage dieser Methodik. Sie gibt den Begleitungszielen<br />
Inhalt und Form, bestimmt die Grundhaltung und Einstellung der BegleiterInnen<br />
und liefert eine Reihe von Richtlinien für die Begleitung.<br />
79
Das Ziel der täglichen Begleitung ist kein wissenschaftlich abstraktes, sondern<br />
ein ganz normales Ziel: „Jedem Einzelnen einen guten und glücklichen Lebensabend<br />
ermöglichen“. Damit ist keinesfalls eine Einheitswurst gemeint, sondern<br />
maßgeschneiderte Hilfe, verbunden mit einem jeweils individuellen<br />
Begleitungsplan, der die Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigt und die Eigenheiten<br />
eines jeden respektiert.<br />
Voraussetzung für eine adäquate Begleitung ist eine Einstellung und Grundhaltung,<br />
bei der die individuellen Bedürfnisse der älteren intellektuell Behinderten<br />
im Mittelpunkt stehen. Was der Einzelne fühlt, was ihn oder sie beschäftigt,<br />
was er oder sie erlebt, sollte so gut wie möglich herausgefunden und verstanden<br />
werden. Denn sonst weiß man ja nicht, was für den jeweiligen behinderten Menschen<br />
ein glücklicher Lebensabend bedeutet.<br />
Nicht jeder Begleiter ist für die Arbeit mit alternden intellektuell Behinderten geeignet.<br />
Ein solcher Begleiter muss über empathische Fähigkeiten verfügen bzw.<br />
muss fähig sein, sich diese anzueignen. Außerdem darf er Befriedigung in seiner<br />
Arbeit nicht in Erfolgserlebnissen im Sinne von Fortschritten des versorgten Behinderten<br />
erwarten. Sollte ein Mitarbeiter eine solche Bestätigung brauchen und<br />
diese in der Hilfe zum „Selbständigerwerden“ finden, sollte er lieber um Versetzung<br />
bitten. Für ihn wäre die Begleitung intellektuell behinderter Kinder oder intellektuell<br />
Behinderter mit Verhaltensstörungen vielleicht das geeignetere Tätigkeitsfeld.<br />
Dort könnte er mit Sicherheit bessere Arbeit als bei älteren intellektuell<br />
Behinderten leisten.<br />
Bei der Arbeit mit älteren Menschen mit intellektueller Behinderung ist Flexibilität<br />
eine wichtige Voraussetzung. Der Begleiter muss auf eine oft stark wechselnde<br />
körperliche und psychische Verfassung des alten Menschen gefasst sein.<br />
Von einem Tag zum anderen, ja sogar von einem Augenblick zum anderen, kann<br />
man mit Veränderungen konfrontiert werden. Auf diese Veränderungen muss<br />
man sich einzustellen versuchen. Und man muss in der jeweiligen Situation einschätzen<br />
können, was dieser ältere Mensch noch selber kann und bei welchen<br />
Handlungen er Hilfe braucht. Im Anfangsstadium der Demenz ist dies oft sehr<br />
schwierig. Die Gefahr, dass der Begleiter den dementierenden Menschen überfordert,<br />
ist sehr groß und kann manchmal nicht nur Aggressionen, sondern auch<br />
Depressionen auslösen.<br />
Aus dem phänomenologischen Ansatz ergibt sich eine Reihe von Richtlinien für<br />
die tägliche Begleitung. Ich möchte hier zwei dieser Richtlinien nennen. Zum<br />
einen ist die Individualisierung der Begleitung sehr wichtig. Für jeden einzelnen<br />
80<br />
muss eine maßgeschneiderte Versorgung möglich gemacht werden. Tätigkeiten<br />
wie zum Beispiel das Frühstücken sollten nur noch dann, wenn der ältere<br />
Mensch es will, im Rahmen der ganzen Gruppe stattfinden. Oft gehen Begleiter<br />
davon aus, dass gemeinsame Aktivitäten für die Bewohner sehr wichtig und angenehm<br />
sind. Aber vielleicht gibt es Bewohner einer Wohneinheit, die lieber allein<br />
in ihrem Zimmer frühstücken möchten. Der tägliche Rhythmus älterer Menschen<br />
kann sehr unterschiedlich sein. Zum anderen ist Respekt für und<br />
Akzeptanz der Eigenheiten, die ein älterer Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt<br />
hat, wichtig. Krampfhaft wiederholte Versuche, ihm die weniger angenehmen<br />
Eigenheiten – oft als Verhaltensprobleme bezeichnet – abzugewöhnen,<br />
sind nicht sinnvoll.<br />
Dies gilt um so mehr für dementierende Menschen. Es ist besser, problematisches<br />
Verhalten bzw. Verhaltensstörungen zu akzeptieren, als zu versuchen,<br />
diese „wegzuarbeiten“. Wichtig ist allerdings die Suche nach Lösungen, bei<br />
denen die Mitbewohner so wenig wie möglich belästigt werden. Problematisches<br />
Verhalten sollte man möglichst gar nicht erst auslösen. Daher empfiehlt es<br />
sich, Voraussetzungen zu schaffen, die einem solchen Verhalten vorbeugen oder<br />
die präventiv wirken.<br />
Das zweite Element dieser Methodik bilden bekannte andere Begleitungsformen,<br />
die für diese intellektuell behinderten Menschen entsprechend<br />
angepasst werden. Dazu gehören das Realitäts-Orientierungs-Training, Warme<br />
Begleitung, Validation, Haptonomie, Massagen und das Snoezelen. Für die hier<br />
vorgestellte Methodik bildet der phänomenologische Ansatz eine gute und solide<br />
Grundlage. Aber auch andere, teilweise aus der Psychogeriatrie übernommene<br />
Begleitungsformen können einen wertvollen Beitrag zur Begleitung und<br />
Versorgung älterer und dementierender intellektuell Behinderter liefern, wenn<br />
sie auf deren Bedürfnisse zugeschnitten werden. Auch sie bieten brauchbare Begleitungs-<br />
und Versorgungskonzepte.<br />
Für Dementierende sind Begleitungsmethoden entwickelt worden, die sowohl<br />
bei intellektuell Behinderten als auch bei normal Begabten Verwendung finden.<br />
Beim Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) wird versucht, die Verwirrtheit<br />
des Betreffenden durch realistische Informationen und Orientierungshilfen (bezüglich<br />
Zeit, Ort und Personen) zu vermindern. Eine deutlich sichtbare Uhr, Photos<br />
sowie Piktogramme auf den Türen können sinnvolle Orientierungshilfen<br />
sein.<br />
Ausgangspunkt für die Gestaltung einer Warmen Begleitung ist, dass ein De-<br />
81
mentierender ständig nach Sicherheit und Geborgenheit sucht, weil er die ihm<br />
bekannten Personen immer weniger erkennt. Deshalb wird versucht, dem Dementierenden<br />
ein Gefühl ständiger Geborgenheit inmitten vertrauter Menschen<br />
und in einer vertrauten Umgebung zu vermitteln (beispielsweise durch ein altmodisch<br />
eingerichtetes Wohnzimmer, vertraute Möbel, weiche, warme Farben,<br />
klassische Musik oder Musik von früher).<br />
Bei der Reminiszenz (reminiszieren bedeutet erinnern) steht die Arbeit mit Erinnerungen<br />
an die Vergangenheit im Mittelpunkt der Begleitung. Vor allem bei<br />
Dementierenden, die sich noch regelmäßig an Ereignisse aus einer fernen Vergangenheit<br />
erinnern, ist diese Herangehensweise sinnvoll. Dies kann einerseits<br />
dem Selbstvertrauen zugute kommen, andererseits können so für beide Seiten<br />
wertvolle und interessante Gesprächsthemen vorhanden sein.<br />
In den letzten Jahren wird in zahlreichen Altenheimen die Validation angewendet.<br />
Diesen Ansatz hat die Amerikanerin Naomi Feil entwickelt. Demenzkranke<br />
orientieren sich bekanntlich zunehmend an einer eigenen Realität, die stärker<br />
mit ihrer Vergangenheit als mit der Gegenwart in Verbindung steht. Bei der Validation<br />
versucht sich der Begleiter in den Dementierenden hineinzuversetzen.<br />
Das Erleben des Demenzkranken wird dann vom Begleiter bestätigt (bestätigen<br />
= validieren).<br />
Feil hat eine Reihe von Techniken zusammengestellt, die Zugang zu dem Dementierenden<br />
verschaffen und es ermöglichen, sich in dessen Erlebenswelt einzufühlen.<br />
Feil beschreibt vierzehn Techniken, die der Begleiter anwenden kann.<br />
Diese Techniken lassen sich im Rahmen eines Trainingskurses erlernen.<br />
Die Haptonomie ist ein Begleitungskonzept, bei dem Körperkontakt im Vordergrund<br />
steht. Erlernt wird hierbei das Berücksichtigen des Nahbereichs und das<br />
respektvolle körperliche Unterstützen der Person, wenn deren Handlungsfähigkeit<br />
zurückgeht. Massage-Techniken können für Menschen in fortgeschrittenen<br />
Demenzstadien ebenfalls hilfreich sein. Und beim sogenannten Snoezelen werden<br />
die Sinnesorgane gezielt stimuliert, um angenehme Empfindungen oder Entspannung<br />
zu erreichen.<br />
Jedes Begleitungskonzept hat seinen eigenen Wert.<br />
Das dritte Element ist die Lebensgeschichte. Bei älteren Menschen gewinnt<br />
die Vergangenheit immer mehr an Gewicht. Ältere denken oft gern an früher<br />
zurück. Bei Demenz kommt noch hinzu, dass ab einem gewissen Stadium die<br />
Vergangenheit als Gegenwart erlebt wird. Wissen über diese Vergangenheit ist<br />
82<br />
unentbehrlich. Dabei geht es nicht nur um Faktenkenntnisse, sondern vor allem<br />
darum, wie bestimmte Ereignisse erlebt wurden. Dafür hat Trudy Beijk, eine Kollegin,<br />
ein gutes und brauchbares Modell entwickelt.<br />
Das vierte Element sind die individuellen Bedürfnisse, Erlebnisse und<br />
Wünsche eines älteren Menschen. Nach diesen sollte er möglichst genau befragt<br />
werden. In unserer fünfjährigen Vergreisungsstudie (Maaskant, 1996) wurden<br />
Interviews mit alten Menschen mit intellektueller Behinderung durchgeführt.<br />
Aus diesen Interviews ging hervor, dass ältere Menschen sehr gut fähig<br />
sind, bestimmte Dinge selbst in Worte zu fassen. Je besser den BegleiterInnen<br />
nicht nur die Vergangenheit, sondern je genauer und detaillierter sie auch deren<br />
aktuelle Wünsche, Erlebnisse und Bedürfnisse kennen, desto besser lässt sich die<br />
Begleitung gestalten.<br />
5. Die Schulung der BegleiterInnen<br />
BegleiterInnen sollten sich die für eine gute Begleitung und Versorgung älterer<br />
und dementierender Menschen mit intellektueller Behinderung erforderlichen<br />
speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten zu eigen machen. Daher wurden<br />
Schulungsprogramme entwickelt (Urlings und Mathijssen 1996; Urlings 1997),<br />
die den direkten BegleiterInnen das notwendige zusätzliche Wissen vermitteln<br />
und entsprechende Fertigkeiten trainieren. Praxisnahe Übungen gelten dabei als<br />
ebenso wesentliches Element wie das Umsetzen des Lehrstoffs in die persönliche<br />
Arbeitssphäre mit Hilfe von zu Hause auszuführenden Aufträgen. Dadurch<br />
lässt sich der Lehrstoff leichter aneignen und besser behalten.<br />
Eine solche Form interner Schulung wird bei „Pepijn en Paulus“ durchgeführt.<br />
Die Begleitung älterer intellektuell behinderter Menschen verlangt von den BegleiterInnen<br />
jedoch auch noch nach einem absolvierten Kurs viel Einfallsreichtum<br />
und Kreativität. Für jeden älteren Menschen wird der Begleiter die für diesen<br />
am besten geeignete Kombination der genannten Elemente, Begleitungskonzepte<br />
und Techniken herausfinden müssen. Zur Verdeutlichung wird oft das<br />
Bild vom „Werkzeugkasten des Begleiters“ (Kooij, 1995) verwendet.<br />
In diesem Werkzeugkasten liegen alle verfügbaren Kenntnisse und Fertigkeiten<br />
bereit. Für jeden Menschen und jede der vielen denkbaren Situationen sind diejenigen<br />
Fertigkeiten, Techniken und Kenntnisse herauszusuchen, die dem Einzel-<br />
83
nen am besten zu einem möglichst guten und glücklichen Lebensabend verhelfen.<br />
Deshalb ist die Begleitung älterer Menschen mit einer intellektuellen Behinderung<br />
spannend und wird immer eine Herausforderung bleiben.<br />
Harry F. J. Urlings<br />
Urlings Institut für Fortbildung<br />
Nachtorchis 11<br />
6467 HS Kerkrade<br />
Die Niederlande<br />
Tel. 0031 45 5421759<br />
Ubd-urli@cuci.nl<br />
84<br />
LITERATUR:<br />
Beijk, T.: Het levensverhaal van mensen met een verstandelijke handicap (Die Lebensgeschichten von<br />
intellektuell Behinderten). KAVANAH. Dwingeloo, 1997.<br />
ENIDA (European Network in Intellectual Disability and Aging): Volgen. Respectvol omgaan met<br />
dementerende mensen met een verstandeljke handicap (Einfühlen. Respektvoller Umgang mit<br />
dementierenden intellektuell Behinderten). KAVANAH. Dwingeloo, 1998.<br />
Feil, N.: Validation: een nieuwe visie op omgaan met gedesoriënteerde ouderen. (Validation: eine<br />
neue Sicht auf den Umgang mit desorientierten älteren Menschen). KAVANAH. Dwingeloo, 1995.<br />
Haveman, M und Stöppler, R: Altern mit geistiger Behinderung. Grundlagen und Perspektiven für Begleitung,<br />
Bildung und Rehabilitation. Kohlhammer. Stuttgart, 2004.<br />
van der Kooij, C.: De Toverspiegel: De momenten van echt contact. Presentatie eerste lustrumcongres<br />
Stichting Validation Nederland (Der Zauberspiegel:Augenblicke wirklichen Kontakts.Vortrag<br />
auf dem ersten Jubiläumskongreß der Stiftung Validation Niederlande). Utrecht, 1995.<br />
Maaskant, M.A., Urlings, H.F.J., Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J., van Hanssen, L., und Keijsers,<br />
W.: Psychische en sociale aspecten van veroudering bij mensen met een verstandelijke handicap.<br />
Verpleegkundige Probleemgebieden en Interventies. (Psychische und soziale Aspekte des Alterns<br />
bei intellektuell Behinderten. Pflegerische Problembereiche und Interventionen). KAVANAH.<br />
Dwingeloo, 1996,2.<br />
Urlings, H.F.J.: Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met een<br />
verstandelijke handicap (Respektvolle und methodische Begleitung älterer und dementierender<br />
Menschen mit intellektueller Behinderung). UBD. Kerkrade, 1997.<br />
Urlings, H.F.J., und Mathijssen B.: Belevingsgerichte begeleiding van dementerende mensen met een<br />
verstandelijke handicap. Bijscholingscursus Stichting Pepijnklinieken (Erlebensorientierte Begleitung<br />
von dementierenden intellektuell Behinderten. Schulungskurs der Stiftung Pepijnklinieken).<br />
Echt, 1996.<br />
Wilson, C.: Van Freud naar Maslow. Nieuwe wegen in de psychologie. (Von Freud zu Maslow. Neue<br />
Wege in der Psychologie). Lemniscaat. Rotterdam, 1973.<br />
85
ReferentInnen<br />
Dr. Karl Heinz Bierlein, Rummelsberg<br />
Pfarrer, Logotherapeut, Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Anstalten.<br />
Vorsitzender des DEVAP (Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege)<br />
Buchveröffentlichungen zum Thema: „Lebensbilanz – Krisen des Älterwerdens<br />
meistern“, „Alles hat seine Zeit – Ratgeber Leben im Alter“<br />
Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Wacker, Dortmund<br />
Studium der Katholischen Theologie, Germanistik, Soziologie und Rechtswissenschaft.<br />
1982–1996 wissenschaftliche Geschäftsführung der Forschungsstelle „Lebenswelten<br />
behinderter Menschen“ der Universität Tübingen.<br />
Seit 1996 Ordinaria für Rehabilitationssoziologie an der Universität Dortmund.<br />
Veröffentlichungen u.a. zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderung und<br />
zur Lebenslage von älteren Menschen mit geistiger Behinderung.<br />
Dr. med. Christina Ding-Greiner, Heidelberg<br />
Studium der Medizin, danach Assistenzärztin in Heidelberg und Gießen.<br />
Dreijähriger Aufenthalt in San Francisco (Kalifornien). Studium der Gerontologie<br />
an der Universität Heidelberg.<br />
Forschungsschwerpunkte: Altern bei geistiger Behinderung und psychischer<br />
Erkrankung; gesundheitliche Prävention bei Frauen in der zweiten Lebenshälfte.<br />
Fortbildungstätigkeit: Alternsprozesse und Krankheitsprozesse. Altern bei geistiger<br />
Behinderung und psychischer Erkrankung.<br />
Prof. Mag. Rudolf Sotz, <strong>Gallneukirchen</strong><br />
Studium der Wirtschaftspädagogik, von 1976 bis 2001 Lehrer am Beruflichen<br />
Bildungs- und Rehabilitationszentrum Linz und an der Handelsakademie Freistadt.<br />
Tätig als Erwachsenenbildner, in der LehrerInnenfortbildung und als Lehrbeauftragter<br />
für Didaktik an der Johannes Kepler Universität Linz. Seit 2001 Leitung der Lehranstalt<br />
für Heilpädagogische Berufe des Evangelischen <strong>Diakoniewerk</strong>es <strong>Gallneukirchen</strong>.<br />
Mag. Harry F. J. Urlings, Kerkrade/NL<br />
Studium der Heilpädagogik sowie Ausbildungen in Psychodiagnostik und zum<br />
Validations-Teacher.<br />
Seit 1984 Heilpädagoge und Gesundheitspsychologe bei „Pepijn und Paulus“ in<br />
Echt/NL.<br />
86<br />
Von 1990 bis 1995 Teilnahme an einer Untersuchung zum Prozess des Alterns bei<br />
Menschen mit geistiger Behinderung in Kooperation mit der Universität Maastricht.<br />
Seit 1994 Aufbau und Entwicklung des „European Network on Intellectual Disability<br />
and Ageing“. 1996 Gründung von „UBD – Fortbildungsbüro für BegleiterInnen von<br />
alten Menschen mit intellektueller Behinderung“.<br />
Moderation, Dr. Karl Winding, Salzburg<br />
Direktor der Fachschule für Altendienste und Pflegehilfe<br />
im Diakonie-Zentrum Salzburg.<br />
87
88<br />
Differenzierte Arbeitsangebote für geistig und mehrfach<br />
behinderte Menschen in <strong>Gallneukirchen</strong>, Wartberg, Mauerkirchen,<br />
Oberneukirchen, Schladming, Ried/Riedmark, Hagenberg und Linz<br />
Die Behindertenhilfe des Evangelischen <strong>Diakoniewerk</strong>es <strong>Gallneukirchen</strong> bietet geistig<br />
und mehrfach behinderten Menschen sinnvolle Arbeits- und Beschäftigungsbereiche an.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass das Arbeiten und das „Zur-Arbeit-Gehen“ auch für geistig und<br />
mehrfach behinderte Menschen einen hohen Stellenwert besitzt. Damit verbunden sind<br />
soziale Kontakte, Lernerfahrungen, Anerkennung, Status und Rollenidentität, Selbstbestätigung,<br />
Entfaltung, Förderung und Tagesstruktur. Arbeit und sinnvolle Beschäftigung<br />
sind Teil des gemeinsamen Lebens und wichtige Bestandteile menschlicher Existenz. Entsprechend<br />
den individuellen Fähigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen der behinderten<br />
Menschen wird versucht, geeignete Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten.<br />
Neben differenzierten Arbeits- und Beschäftigungsangeboten für Menschen mit Behinderung<br />
ist es uns wichtig, mit den angebotenen Produkten und Dienstleistungen möglichst<br />
nahe an die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen heran zu kommen.<br />
Es ist Ziel, dass die Produkte und Dienstleistungen der im <strong>Diakoniewerk</strong> betreuten<br />
Menschen aufgrund ihrer Qualität und wegen eines realen Bedarfs gekauft oder in Anspruch<br />
genommen werden. Erst dadurch können Menschen mit Behinderungen eine<br />
echte und begründete Wertschätzung erfahren und Normalisierung erleben. Die Individualität<br />
der bei uns beschäftigten Personen macht es notwendig, die Angebote und die inhaltlichen<br />
bzw. pädagogischen Schwerpunkte laufend zu reflektieren und auf deren spezifische<br />
Bedürfnisse abzustimmen. Die Beschäftigung erfolgt in allen Fällen auf der<br />
Grundlage des OÖ Behindertengesetzes, §12 „Hilfe durch Beschäftigung“. Das Aufnahmeverfahren<br />
wird vom Arbeitspädagogischen Fachdienst in enger Zusammenarbeit mit<br />
den jeweiligen Leitungen der einzelnen Beschäftigungsbereiche durchgeführt.<br />
Im Evangelischen <strong>Diakoniewerk</strong> <strong>Gallneukirchen</strong> gibt es mehrere regionale<br />
bzw. differenzierte Beschäftigungsbereiche:<br />
■ Werkstätte <strong>Gallneukirchen</strong> (verschiedene Werkgruppen)<br />
■ Fördergruppen <strong>Gallneukirchen</strong> (Kleingruppen)<br />
■ Werkstätte Wartberg (Werk- und Fördergruppen)<br />
■ EDV-Werkstätte Hagenberg<br />
■ Werkstätte Mauerkirchen (Werk- und Fördergruppen)<br />
■ Werkstätte Oberneukirchen (Werkgruppe)<br />
■ Werkstätte Linz („Kulinarium“, Bürowerkgruppe)<br />
■ Werkstätte Schladming (Werkgruppen und Fördergruppen)<br />
■ Fördergruppen Ried in der Riedmark (Kleingruppen)<br />
Werkstätten Bücherinsel<br />
Kommen Sie auf unsere Insel …<br />
Schmökern Sie in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder blättern<br />
Sie in unserem Buchkatalog unter www.diakoniewerk.at/kno.htm<br />
Hier können Sie auch gleich online bestellen!<br />
Wir führen<br />
■ Fachliteratur zur Behindertenpädagogik, Altenpflege,<br />
Gesundheit und Lebenshilfe<br />
■ Aktuelle Romane<br />
■ Geschenkbücher<br />
■ Ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur, u.v.m.<br />
Ein kleiner „Welt-Laden“ mit Lebensmitteln und Kunsthandwerk<br />
aus außereuropäischen Ländern ist in das Geschäft integriert.<br />
Mehrmals im Jahr werden Lesungen und Kurse zu aktuellen<br />
Themen veranstaltet. Wenn Sie Interesse daran haben, informieren<br />
wir Sie gerne.<br />
Neugierig geworden?<br />
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!<br />
Bücherinsel<br />
Hauptstraße 7<br />
A-4210 <strong>Gallneukirchen</strong><br />
Telefon 07235 / 62513<br />
Telefax 07235 / 63251-270<br />
E-Mail: m.dewagner@diakoniewerk.at<br />
89
90<br />
Aus unserem Programmangebot<br />
■ Gemüsejungpflanzen und Gemüse<br />
aus eigener biologischer Produktion<br />
■ Beet- und Balkonblumen<br />
Bepflanzung von Balkonkisten nach Ihren Wünschen<br />
■ Obst und Gemüse<br />
Warenangebot aus biologischer Produktion<br />
■ Bioecke<br />
Frisch- und Trockenware<br />
■ Stauden, Schnitt- und Topfblumen,<br />
Gestecke aller Art, Hochzeits- und<br />
Trauerfloristik<br />
Ihr Partner für<br />
BIO-Obst und<br />
BIO-Gemüse<br />
in <strong>Gallneukirchen</strong>!<br />
<strong>Diakoniewerk</strong><br />
BIO<br />
AT-O-02-BIO<br />
Aus kontrolliertem ökologischen Anbau.<br />
G ärtnerei<br />
Friede nshort<br />
Gärtnerei<br />
Friedenshort<br />
A-4210 <strong>Gallneukirchen</strong><br />
Reichenauer Straße 37a<br />
Tel. 07235/63251-420<br />
www.diakoniewerk.at<br />
Öffnungszeiten:<br />
Montag bis Freitag:<br />
8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet<br />
Samstag: 8 bis 13 Uhr<br />
TOGETHER – Integriert ist, wer gebraucht wird<br />
Georg Jungwirth – Down Syndrom – spielt bei TOGETHER Schlagzeug. Er wird<br />
gebraucht, es geht nicht ohne Schlagzeuger. Und daher ist er genauso Teil der<br />
Band wie die anderen Musiker, wie Andi, Gerald, Barni und Edi.<br />
TOGETHER, das sind<br />
Gerald Endstrasser, Bernhard Girlinger, Georg Jungwirth,<br />
Eduard Jungwirth, Andreas Pointecker<br />
Von TOGETHER gibt es „TOGETHER“ – Popular Jazz, aufgenommen 1999<br />
bereits drei CDs: „2 gether“ – Popular Jazz, aufgenommen 2000<br />
„Impressionen“, aufgenommen 2002<br />
Diese CDs können über die Homepage bestellt werden: www.listen.to/together.<br />
Kontaktadresse: Gerald Endstrasser, Tel.: 0650 / 4815369<br />
91