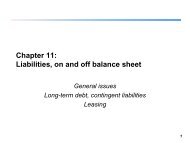HARMONICES MUNDI“ - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
HARMONICES MUNDI“ - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
HARMONICES MUNDI“ - Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Otto</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Guericke</strong>-<strong>Universität</strong> <strong>Magdeburg</strong><br />
Fakultät für Naturwissenschaften<br />
Harald Böttger<br />
” <strong>HARMONICES</strong> <strong>MUNDI“</strong><br />
Abschiedsvorlesung<br />
gehalten am 27. Januar 2005
Harald Böttger<br />
” Das Paradies habe ich<br />
mir immer als eine Art<br />
Bibliothek vorgestellt.“<br />
(Jorge Luis Borges)<br />
” <strong>HARMONICES</strong> <strong>MUNDI“</strong><br />
Abschiedsvorlesung<br />
— über Kepler, Physik, Musik und Alchemie<br />
” anitzo mit sonderbahrem Fleiß compilieret und mit vilen newen<br />
Additionibus und Anmerckungen vermehret“<br />
Mai 2005<br />
1
Inhalt<br />
Theorienbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Weltharmonik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
Johannes Kepler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
Physik und Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />
Der Dreiklang der Schöpfung . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br />
Quintessenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<br />
Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72<br />
Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75<br />
3
Magnifizenz,<br />
liebe Kollegen, liebe Gäste,<br />
meine sehr geehrten Damen und Herren!<br />
” Keplerus, (Joann) einer<br />
derer vornehmsten<br />
Astronomorum . . .“<br />
(Zedlers Universal-Lexikon, 1732–1754)<br />
” Wer an die Straßen baut<br />
der soll sich nit an der Leute<br />
Reden stören.“ (Johannes Kepler)<br />
Nach dem heute Gehörten und Erlebten hätte ich guten Grund die gesamte<br />
mir zur Verfügung stehende Redezeit für Dankesworte zu nutzen.<br />
Da Sie aber, der Einladung entsprechend, <strong>von</strong> mir jetzt eine Abschiedsvorlesung<br />
zum Thema ” Harmonices mundi“ erwarten, muß ich meine<br />
Danksagung auf wenige Sätze beschränken.<br />
Ich freue mich, hier heute mit Ihnen zusammensein zu dürfen. Ich danke<br />
Ihnen für Ihr Kommen und Ihre Glückwünsche. Meinen Vorrednern<br />
danke ich für ihre freundlichen, ja herzlichen Worte.<br />
Meiner Frau Tochter danke ich für ihr feines Cellospiel. Und nicht zuletzt<br />
danke ich meiner Sekretärin für die umsichtige organisatorische<br />
Vorbereitung unseres heutigen Zusammenseins.<br />
” Harmonices mundi“ ist der Titel <strong>von</strong> Johannes Keplers (1571–1630)<br />
gewichtigem Werk aus dem Jahre 1619 über Planetenbewegung und<br />
Sphärenharmonie (Abb. 1). Ein Exemplar der deutschen Übersetzung<br />
dieses Werkes, unter dem Titel Weltharmonik“, entliehen aus der Bi-<br />
”<br />
bliothek der <strong>Universität</strong>, liegt seit Jahren auf meinem Schreibtisch, als<br />
eine Art Heiligtum (Abb. 2).<br />
” Harmonices mundi“ habe ich als Überschrift für meine Abschiedsvorlesung<br />
gewählt, zum einen schon des Wohlklanges der Worte wegen,<br />
zum anderen klingt dieses Harmonices mundi“ doch so schön gelehrt,<br />
”<br />
5
und nicht zuletzt läßt ” Harmonices mundi“ ganz gut erahnen, worüber<br />
ich hier heute sprechen möchte: über Physik und Musik, über Johannes<br />
Kepler und andere große Physiker, über Theorienbildung in der Physik<br />
und nicht zuletzt auch über Alchemie.<br />
Theorienbildung<br />
Lassen Sie mich beginnen mit einem Blick in die Werkstatt des Theoretischen<br />
Physikers.<br />
Nach Albert Einstein (1879–1955) gibt es für den Theoretischen Physiker<br />
zwei Aufgaben, zwei Aufgabenbereiche.<br />
Zum einen gilt es für ihn, allgemeine Prinzipien aufzusuchen und zum<br />
anderen, aus diesen Prinzipien fließende Folgerungen zu entwickeln.<br />
Das Gros der Theoretischen Physiker widmet sich Aufgaben <strong>von</strong> der<br />
zweiten Art. Für die Erfüllung dieser Aufgaben erhält der Theoretische<br />
Physiker, wie Einstein sagt, ” an den Schulen ein treffliches Rüstzeug“.<br />
Hier, bei den Aufgaben <strong>von</strong> der zweiten Art, hat er festen Boden unter<br />
den Füßen. Hier ist er tätig ähnlich wie ein Handwerker.<br />
Hingegen, der vom Schicksal begnadete Theoretische Physiker, der<br />
befähigt ist, sich erfolgreich mit Aufgaben <strong>von</strong> der ersten Art zu<br />
beschäftigen, zu deren Lösung es keine lehr- bzw. erlernbaren Methoden<br />
gibt, ist, in gewisser Weise, eher wie ein Künstler tätig. Ähnlich wie<br />
des Künstlers Werk ist sein Produkt, das allgemeine Prinzip, wie Einstein<br />
sagt, eine ” freie Erfindung“, geleitet durch Intuition, gegebenenfalls<br />
mitgeformt durch ästhetische Kriterien (wie Eleganz, Sparsamkeit,<br />
Symmetrie), oder auch inspiriert durch die Realität, durch experimentelle<br />
Befunde.<br />
Jedoch anders als des Künstlers Werk ist das Werk des Theoretischen<br />
Physikers an bestimmte Selektionskriterien gebunden, wie logische<br />
Richtigkeit bzw. Widerspruchsfreiheit, experimentelle Überprüfbarkeit,<br />
Reproduzierbarkeit, Allgemeingültigkeit etc.<br />
Die ” Erfindung“ des Theoretischen Physikers ist wahr, wenn sie die<br />
Wirklichkeit beschreibt, wenn sie der experimentellen Überprüfung<br />
standhält, anderenfalls ist sie eine bloße Phantasterei.<br />
6
Ein berühmtes Beispiel für die Nützlichkeit ästhetischer Kriterien bei<br />
der Formulierung grundlegender Gleichungen der Theoretischen Physik<br />
ist Einsteins Theorie der Brownschen Bewegung, der Diffusion<br />
<strong>von</strong> Molekülen, aus dem Jahre 1905, seinem ” Annus mirabilis“, seinem<br />
wunderbaren Jahr, in dem er neben seiner gewichtigen Arbeit<br />
zur Brownschen Bewegung noch zwei weitere grundlegende Arbeiten<br />
veröffentlichte, zur Speziellen Relativitätstheorie und zum Photoeffekt;<br />
für letztere erhielt er später den Nobelpreis für Physik.<br />
Doch 1905 war der sechsundzwanzigjährige Einstein in Fachkreisen<br />
noch weitgehend unbekannt. Da bekam er Post <strong>von</strong> einem Experimentalphysiker,<br />
einem Nobelpreisträger, zu seiner Arbeit zur Brownschen<br />
Bewegung. Der schrieb: Sehr geehrter Herr Einstein! Ich habe Ihre<br />
”<br />
Theorie überprüft mit meinen Meßgeräten und muß Ihnen leider sagen,<br />
daß sie falsch ist.“<br />
Einstein schrieb zurück: Sehr geehrter Herr Nobelpreisträger! Ich habe<br />
”<br />
die Theorie noch einmal angeschaut. Die Gleichungen sind so schön, so<br />
symmetrisch. Ich bin zufrieden damit, sie müssen richtig sein. Prüfen<br />
Sie doch bitte noch einmal nach.“ Eine Woche später kam die Antwort.<br />
” Verehrter Herr Einstein! Sie haben recht: Die Messungen waren falsch,<br />
aber Ihre Zufriedenheit war wohl zutreffend.“<br />
Auf der Suche im Internet nach einem hier zum Zeigen geeigneten Porträt<br />
Einsteins fand ich eine Photographie aus dem Jahre 1930, die Einstein<br />
zusammen mit Rabindranath Tagore (1861–1941) (Abb. 3) zeigt,<br />
dem großen indischen Dichter, Schriftsteller und Philosophen, Nobelpreisträger<br />
für Literatur, Verfasser des Textes der indischen Nationalhymne,<br />
die er auch selbst vertont hat, wie auch eine Vielzahl seiner<br />
eigenen Gedichte, — dem großen Experten für das Mahabharata, speziell<br />
für die Bhagavadgita, über die er gewichtige, vielzitierte Abhandlungen<br />
schrieb.<br />
Ich habe diese Photographie ausgewählt und mit Anmerkungen zu Tagore<br />
versehen aus zweierlei Gründen: Zum einem zum Zwecke eines<br />
vorgesehenen Wiedererkennungseffektes, kommt in meiner Vorlesung<br />
doch an späterer Stelle noch einmal Indien und die Bhagavadgita vor,<br />
7
und zum anderen aus einem inhaltlichen Grunde: Tagore ist mir seit<br />
frühester Kindheit, seitdem ich lesen kann, wohl vertraut, hing doch<br />
über dem Bette meines Großvaters, wohlgerahmt und schön geschrieben,<br />
ein Spruch Tagores, der mich tief beeindruckt hat, so daß ich,<br />
würde ich nach ihm gefragt, Tag oder Nacht, zu beliebiger Stunde, ihn<br />
aufsagen könnte. Aber allein schon des Dichters Name, Rabindranath<br />
Tagore, der unter dem Spruche stand, faszinierte mich, beflügelte meine<br />
Phantasie, ließ in mir das Bild eines Weltweisen entstehen, vom Aussehen<br />
etwa des ” Lieben Gottes“, streng aber gütig, etwa so wie Tagore —<br />
wie ich jetzt auf der Photographie sehe — in Wirklichkeit aussah.<br />
Der Tagore-Spruch:<br />
” Ich schlief und träumte, das Leben wäre Freude.<br />
Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht.<br />
Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude.“<br />
Als ich, mit Blick auf meine Abschiedsvorlesung, den Tagore-Spruch<br />
kürzlich erneut las, kam mir die Idee zu folgendem Gedankenspiel, das<br />
mir, mit etwas Augenzwinkern, manch Element der Theorienbildung,<br />
des Auffindens grundlegender Prinzipien, zu illustrieren gestattet.<br />
Vorausgeschickt sei eine Anmerkung zur Entstehung des Homo sapiens.<br />
Wie ich vor kurzem las, entstand die den Homo sapiens auszeichnende<br />
Fähigkeit zu abstraktem und symbolischem Denken vor etwa<br />
50 000 Jahren. Die dazu nötigen anatomischen Voraussetzungen des<br />
Gehirns sollen jedoch schon seit ca. 150 000 Jahren existieren.<br />
D.h., so der Anthropologe, nicht ein anatomischer, sondern ein kultureller<br />
Auslöser bewirkte die Entstehung unseres außergewöhnlichen<br />
Denkvermögens. Völlig im Dunkeln liegt jedoch die Natur des besagten<br />
kulturellen Auslösers.<br />
Nun meine Idee, und damit zurück zu meinem Gedankenspiel: Der gesuchte<br />
kulturelle Auslöser war, mit Tagore gesprochen, die Entdeckung<br />
unserer Vorfahren, daß Handeln die Pflicht zur Freude werden läßt,<br />
d.h. Handeln, Tätigkeit, Pflichterfüllung bewirkten Kommunikation,<br />
8
Entstehung der Sprache, beförderten die Entwicklung des abstrakten<br />
und symbolischen Denkens, machten uns zu dem, was wir sind.<br />
Damit habe ich möglicherweise ein grundlegendes Prinzip im Sinne<br />
Einsteins gefunden, das natürlich noch weiter durchdacht und insbesondere<br />
auch experimentell überprüft werden muß.<br />
Aber zuerst einige Anmerkungen zur Genesis meiner neuen Theorie,<br />
meiner ” Pflicht-Theorie“.<br />
Die Vorstellung, daß Handeln Pflicht zur Freude werden läßt, ist mir<br />
offenbar eingeboren, war in potentia in meinem Unbewußten verborgen;<br />
denn sonst hätte der Tagore-Spruch mich ja nicht schon als kleines Kind<br />
so fasziniert.<br />
Das Lesen, vor kurzem, eines Artikels über die Entstehung des Homo<br />
sapiens, sowie das erneute Lesen des Tagore-Spruches ließen nun in<br />
meiner Seele die Idee aufleuchten, daß Handeln und Freude durch Pflichterfüllung<br />
der gesuchte Auslöser für die Entwicklung zum Homo sapiens<br />
gewesen sein könnten.<br />
Johannes Kepler schreibt über den Erkenntnisprozeß: ” Erkennen heißt,<br />
das äußerlich Wahrgenommene mit den inneren Ideen zusammenbringen<br />
und ihre Übereinstimmung beurteilen . . . Wie nämlich das uns außen<br />
Begegnende uns erinnern macht an das, was wir vorher wußten, so<br />
locken die Sinneserfahrungen, wenn sie erkannt werden, die intellektuellen<br />
und innen vorhandenen Gegebenheiten hervor, so daß sie dann in<br />
der Seele aufleuchten, während sie vorher wie verschleiert in potentia<br />
dort verborgen waren. . . . Alle Ideen . . . werden nicht etwa diskursiv<br />
innen aufgenommen . . . sondern sind mit eingeboren . . .“<br />
Wolfgang Pauli (1900–1958) (Abb. 4), der über Kepler einen hoch interessanten<br />
Essay mit dem Titel Der Einfluß archetypischer Vorstellun-<br />
”<br />
gen auf die Bildung naturwissenschaftlicher Theorien bei Kepler“ verfaßt<br />
hat, dem ich übrigens für meine Abschiedsvorlesung viel Nützliches<br />
entnommen habe, schreibt über den Erkenntnisprozeß:<br />
” Theorien werden nicht durch zwingende Schlüsse aus Protokollbüchern<br />
abgeleitet. Theorien kommen zustande durch ein <strong>von</strong> empirischem<br />
Material inspiriertes Verstehen. . . . Der Vorgang des Verstehens<br />
9
der Natur . . . scheint auf einem Zur-Deckung-Kommen <strong>von</strong> präexistenten<br />
inneren Bildern der menschlichen Psyche mit äußeren Objekten und<br />
ihrem Verhalten zu beruhen.“ Letzteres entspricht ganz dem <strong>von</strong> Kepler<br />
Gesagten.<br />
Soviel zur Genesis meiner ” Pflicht-Theorie“, meiner Theorie zur Erklärung<br />
der Entstehung des Homo sapiens. Aber vielleicht ist die Tragweite<br />
dieser Theorie weit größer als bisher gedacht. Vielleicht ist meine<br />
Theorie gar eine T.O.E., eine ” Theory of everything“, eine Theorie,<br />
die — wenigstens im Prinzip — alles zu erklären vermag.<br />
Früher nannte man solch eine universelle Theorie, solch Mechanismus,<br />
der die Welt im Gange hält, ” Machina mundi“ oder, nach Werner Heisenberg<br />
(1901–1976) (Abb. 5), ” Weltformel“.<br />
Doch bevor ich diesen Gesichtspunkt vertiefe, einige Anmerkungen zur<br />
Frage, wie das menschliche Gehirn die Welt abbildet. Unter den Philosophen<br />
und Hirnforschern gibt es eine nicht kleine Fraktion, die meint,<br />
die Welt, die Wirklichkeit, werde im wesentlichen im Gehirn konstruiert,<br />
d.h. unser Gehirn sei ein informatorisch weitgehend abgeschlossenes<br />
System, dessen Zustandsänderungen nur <strong>von</strong> eigenen Operationen<br />
abhängen, und auf das Signale aus der Umwelt lediglich als eine Art<br />
Störung wirken, ohne wirklich ein dominierender Faktor zu sein.<br />
Ganz in diesem Sinne sagt Schopenhauer (erster Satz aus seinem<br />
Hauptwerk ” Die Welt als Wille und Vorstellung“): ” Die Welt ist meine<br />
Vorstellung. . . . im abstrakten Bewußtsein . . .“, und Heisenberg: ” Bei<br />
dem Naturbild der exakten Naturwissenschaft handelt es sich nicht um<br />
ein Bild der Natur, sondern ein Bild unserer Beziehung zur Natur . . .“,<br />
und Markus Fierz (Pauli-Schüler): ” Vom psychologischen Standpunkt<br />
aus gesehen projizieren Physiker . . . archetypische Formen auf die Natur.“,<br />
und Meister Eckhart (um 1260–1328): ” Wäre ich nicht, so wäre<br />
Gott nicht — ich bin die Ursache meiner selbst und aller Dinge.“<br />
Und nun wieder zurück zu meiner Theorie: Da diese beansprucht,<br />
erklären zu können, wie das abstrakte Bewußtsein zustande kam,<br />
nämlich durch Handeln und Freude an der Pflichterfüllung, und, da<br />
nach dem Konstruktivismus, das abstrakte Bewußtsein die Welt im<br />
10
Kopfe konstruiert, d.h. alles, was wir zu beschreiben in der Lage sind,<br />
im Gehirn erzeugt wird, kann, so gesehen, meine ” Pflicht-Theorie“ alles<br />
erklären, und sie ist somit eine T.O.E.<br />
Bevor ich jedoch auf Anerkennung meiner Theorie in der Fachwelt hoffen<br />
kann, bedarf die Theorie noch der experimentellen Überprüfung.<br />
Eine solche Überprüfung könnte zum Beispiel dadurch erfolgen, daß,<br />
und dem Politiker sollte dies, wie jüngste einschlägige Experimente zeigen,<br />
unschwer möglich sein, im Alltag Pflicht durch Spaß ersetzt wird,<br />
möglichst global. Und dann fragen wir mit Sienkiewicz: ” Sapientia, quo<br />
vadis?“<br />
Schwindet die Sapientia wider Erwarten nicht, so ist meine Theorie<br />
wohl nicht richtig.<br />
Aber schwindet sie, vielleicht schon in zwei oder drei Generationen,<br />
dann ist sie richtig, dann ist sie wahr. Vielleicht merkt jedoch im letzteren<br />
Falle der Mensch gar nicht, daß ihm das Attribut ” sapiens“ nicht<br />
mehr zusteht. Dann wird es wohl wieder 50 000 Jahre, vielleicht gar<br />
150 000 Jahre dauern, bis . . .<br />
Die Versuchung ist für mich groß, das Thema ” Pflicht“ noch etwas zu<br />
vertiefen, sind doch neben den heute ständig beschworenen Rechten<br />
der Menschen auch die Pflichten, nicht minder als die Rechte, wichtig<br />
für die ethische und soziale Ordnung, für die Harmonie in der Gesellschaft,<br />
für die ” Musica humana“.<br />
Man mag des Physikers Kompetenz in Fragen der Anthropologie, philosophischen<br />
Ethik etc. bezweifeln. Vielleicht gar zu Recht. Andererseits<br />
ist aber nach des Physikers Selbstverständnis, und dies seit Galilei,<br />
sein beanspruchter Zuständigkeitsbereich praktisch unbegrenzt.<br />
Mit diesem Anspruch befindet sich der Physiker ja in guter Gesellschaft.<br />
Auch der Theologe beansprucht, daß sein Zuständigkeitsbereich<br />
praktisch unbegrenzt ist.<br />
Darüber hinaus ist sowohl der Theologe als auch manch Physiker der<br />
festen Überzeugung, daß es eine T.O.E. gibt bzw. geben sollte, mit dem<br />
Unterschied, daß der Theologe meint, die T.O.E. schon gefunden zu<br />
11
haben, während der Physiker noch auf der Suche nach einer solchen<br />
ist.<br />
Einer, der da bis vor kurzem eifrig gesucht hat, ist Stephen Hawking<br />
(Abb. 6). Mitte der siebziger Jahre hatte er verkündet, in zehn, spätestens<br />
zwanzig Jahren werde er eine T.O.E. gefunden haben. Vor nicht<br />
allzu langer Zeit sagte er, die 20 Jahre beginnen erst jetzt.<br />
Hawking suchte seine T.O.E. im Rahmen einer Elementarteilchentheorie,<br />
genauer, einer Stringtheorie. Ein String ist eine Saite, wie die Saite<br />
eines Cellos, nur winzig klein. Die Schwingungsanregungen dieser<br />
Saite liefern die Elementarteilchen. Die Strings sind 10 35 mal kürzer als<br />
eine Cello-Saite. Wären sie 10 10 mal kürzer, wären sie so klein wie ein<br />
Atom und man könnte sie mit einem geeigneten Elektronenmikroskop<br />
sehen. Aber sie sind noch 10 25 mal kleiner als ein Atom. Strings sind<br />
nicht nur winzig, sie schwingen auch anders als Cello-Saiten, nicht im<br />
üblichen dreidimensionalen Raum, sondern in einer zehndimensionalen<br />
Raumzeit, wobei die zusätzlichen sechs Raumdimensionen winzig<br />
klein, wie man sagt, kompaktifiziert sind.<br />
Hawkings Bestreben war nicht der erste Versuch, eine T.O.E. zu finden,<br />
wie ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte zeigt. So glaubte schon<br />
Heisenberg, vor nunmehr knapp einem halben Jahrhundert, kurz vor<br />
der Formulierung einer T.O.E. zu stehen. In einem Radiointerview (im<br />
Jahre 1958) kündigte er an, daß er zusammen mit Pauli in Kürze eine<br />
Weltformel auf der Grundlage einer Spinortheorie, einer Theorie<br />
der Elementarteilchen, veröffentlichen werde, es müßten nur noch einige<br />
technische Details geklärt werden. Als Pauli <strong>von</strong> dem heisenbergschen<br />
Interview hörte, war er sehr verärgert, hatte er sich innerlich <strong>von</strong><br />
dem gemeinsamen Weltformel-Projekt schon losgesagt, war ihm dessen<br />
prinzipielle Undurchführbarkeit doch bewußt geworden. Seinen<br />
Ärger brachte er unmißverständlich zum Ausdruck, so auch in einem<br />
Brief (Abb. 7), den er an George Gamow, einen bekannten amerikanischen<br />
Elementarteilchentheoretiker russischer Herkunft, sandte. Der<br />
Brief enthält eine Skizze, auf der ein leeres Rechteck zu sehen ist, versehen<br />
mit folgendem Kommentar:<br />
” Das soll der Welt zeigen, daß ich wie Tizian malen kann. Es fehlen nur<br />
12
die technischen Details.“<br />
Gestatten Sie mir, noch etwas bei Pauli zu verweilen, bevor ich, tiefer<br />
in die Wissenschaftsgeschichte zurückschreitend, mich der Weltharmonie<br />
widme, der Weltharmonie als Machina mundi, als T.O.E., als Ordnungsprinzip<br />
in Natur, Gesellschaft, Musik etc.<br />
Nach Expertenmeinung war Pauli als Physiker vom Range Einsteins,<br />
hinsichtlich seiner allgemeinwissenschaftlichen und philosophischen<br />
Kompetenz jedoch Einstein gar noch überlegen.<br />
In einer Tischrede — auf einem Bankett anläßlich der Nobelpreisverleihung<br />
an Pauli (im Jahre 1945) — bezeichnete Einstein Pauli als ” seinen<br />
geistigen Sohn“ und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, in ihm seinen<br />
Nachfolger in Princeton, am renommierten ” Institute for Advanced<br />
Studies“, gefunden zu haben.<br />
Paulis weitgefächertes fundamentales Wissen fasziniert mich seit eh<br />
und je, — Paulis Wissen, das <strong>von</strong> der Physik über Biologie, Psychologie,<br />
Mystik, Alchemie, Kabbala hin bis zur Parapsychologie reichte und seinen<br />
Niederschlag u.a. in einem umfangreichen über 5000 Druckseiten<br />
umfassenden wissenschaftlichen Briefwechsel gefunden hat, <strong>von</strong> dem<br />
einige Bände, aus der <strong>Universität</strong>sbibliothek entliehen, seit Jahren auf<br />
meinem Schreibtisch liegen, neben Keplers ” Weltharmonik“, nicht als<br />
Heiligtum, sondern als Lektüre für Zeiten der Muße.<br />
Pauli war nicht nur befähigt grundlegende Prinzipien zu formulieren,<br />
wie das nach ihm benannte Ausschließungsprinzip der Quantenmechanik,<br />
für das er den Nobelpreis erhielt, oder seine ebenfalls nobelpreiswürdige<br />
Neutrinohypothese, sondern er hat sich auch stets<br />
mit dem Vorgang der Herausbildung naturwissenschaftlicher Begriffe<br />
und Theorien beschäftigt, zeitweise im engen wissenschaftlichen Gedankenaustausch<br />
mit dem Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung (1875–<br />
1961) und dessen Mitarbeitern. Dabei interessierte ihn besonders die<br />
Frage nach der möglichen Existenz <strong>von</strong> Strukturelementen im Unbewußten<br />
— <strong>von</strong> Archetypen, präexistierenden Bildern, Resonanzstrukturen<br />
— die, so die Vermutung, als Regulatoren Vorstellungen anordnen<br />
bzw. das Wahrgenommene mitbestimmen können.<br />
13
In seinem oben erwähnten Kepler-Essay hat Pauli am historischen Beispiel<br />
der Theorien Keplers, der übrigens selbst den Begriff des Archetypus,<br />
wie er die Archetypen nannte, ausgiebig und regelmäßig verwendet<br />
hat, nämlich als Urbild, als mathematische Urintuition, die Wirksamkeit<br />
<strong>von</strong> Archetypen bei der Bildung naturwissenschaftlicher Theorien<br />
aufgezeigt. Mit diesem Essay hatte Pauli, der zu Jung ursprünglich<br />
(im Jahre 1931) als Patient gekommen war, einen wichtigen Beitrag<br />
im Geiste der Jungschen Schule geleistet. Bei Jung und dessen Mitarbeitern,<br />
insbesondere dessen weiblichen Mitarbeitern, war Pauli zunehmend<br />
zum Experten für naturwissenschaftliche Fragen geworden,<br />
spätestens seit 1948, wie in der einschlägigen Literatur zu lesen ist.<br />
Rückblickend schreibt Pauli über den Beginn seines Kontaktes zu<br />
C. G. Jung: ” Dies kam so, daß ich . . . Herrn Jung konsultiert hatte wegen<br />
gewisser neurotischer Erscheinungen bei mir, die unter anderem<br />
auch damit zusammenhängen, daß es mir leichter ist, akademische Erfolge<br />
als Erfolge bei Frauen zu erringen. Da bei Herrn Jung eher das<br />
Umgekehrte der Fall ist, schien er mir ganz der geeignete Mann, um<br />
mich zu behandeln.“<br />
Kurz vor Beginn seines Kontaktes zu C.G. Jung war Pauli <strong>von</strong> seiner<br />
Frau, einer Tänzerin, verlassen worden, was wohl seine ” neurotischen<br />
Erscheinungen“ mit auslöste.<br />
In diese Zeit fällt auch die Abfassung seines berühmten Briefes, aus<br />
Zürich, an die Teilnehmer einer Physikertagung in Tübingen im Jahre<br />
1930, denen er seine (epochale) Neutrinohypothese schriftlich mitteilte,<br />
da er ” . . . infolge eines in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember in Zürich<br />
stattfindenden Balls hier unabkömmlich . . .“ war.<br />
Das Thema Weib bzw. Anima (weibliches Element im Unbewußten<br />
des Mannes, nach Jung) klingt in Paulis spekulativen Äußerungen und<br />
Schriften immer wieder an. So entdeckte er ein seltsames Naturge-<br />
”<br />
setz“:<br />
” Die Regel, daß bedeutende Philosophen unverheiratet waren und daß<br />
Frauen in ihrem Leben eine höchst untergeordnete Rolle spielen, hat<br />
kaum Ausnahmen. Dies gilt unabhängig vom psychologischen Typus<br />
14
des Philosophen . . . bei so verschiedenen Persönlichkeiten wie z.B. Plato,<br />
Ficino, Descartes, Leibniz, Spinoza, Newton, Kant, Schopenhauer.<br />
Man kann fast <strong>von</strong> einem Naturgesetz sprechen.“ Offenbar, so vermutet<br />
der in zweiter Ehe glücklich verheiratete Pauli, hat das ” philosophische<br />
System . . . oft die Funktion einer Ersatz-Frau.“<br />
Auch ist es eine ” Anima“, eine Klavierspielerin, die in Paulis ” Die Klavierstunde<br />
— eine aktive Phantasie über das Unbewußte“ (aus dem<br />
Jahre 1953) dem Physiker, der nach der Verbannung der Seele ins Subjektive<br />
durch Descartes, ” die Welt zwar“, so Pauli, ” beschreiben aber<br />
nicht verstehen kann“, mit ihrem Klavierspiel den Zugang zum Geheimnis<br />
des Seins, den Sinn der Dinge erfassen läßt, birgt doch das Klavierspiel,<br />
neben aller der Harmonik zugrunde liegenden Mathematik,<br />
auch irrationale, emotionale Elemente, die die Seele ansprechen und so<br />
auch das Verstehen der Dinge ermöglichen.<br />
Nach Pauli bilden Vollständigkeit und Objektivität ein komplementäres<br />
Gegensatzpaar (wie in der Quantenphysik Wellen- und Teilchencharakter<br />
eines Objektes, die sich nur alternativ, je nach experimenteller<br />
Fragestellung, manifestieren können, nicht aber gleichzeitig), d.h. man<br />
mag zwar, wie auch Pauli selbst, die Verbannung der Seele ins Subjektive<br />
bedauern, aber nur so ist moderne Naturwissenschaft möglich.<br />
Und zur praktischen Seite wissenschaftlicher Tätigkeit sagt Pauli: ” [Es<br />
gilt] eine Sache immer wieder vorzunehmen, über den Gegenstand<br />
nachzudenken, dann wieder beiseite zu legen, dann neues empirisches<br />
Material zu sammeln, und dies, wenn nötig, durch viele Jahre fortzusetzen.<br />
Auf diese Art und Weise wird das Unbewußte durch das Bewußtsein<br />
angekurbelt und, wenn überhaupt, kann nur so etwas dabei<br />
herauskommen. Ich glaube, man kann Wissenschaft nicht nebenbei betreiben.“<br />
Doch jetzt, wie angekündigt, zur Harmonie, Weltharmonie, Sphärenharmonie<br />
— als universellem Ordnungsprinzip, als Machina mundi,<br />
als T.O.E. — <strong>von</strong> Pythagoras (570 bis 480 v. Chr.) bis ins 17. Jahrhundert,<br />
bis in die Zeit Keplers.<br />
15
Weltharmonik<br />
Zum Zusammenhang zwischen Mathematik und Musik schreibt Jean-<br />
Philippe Rameau (1683–1764), der gewichtige Musiktheoretiker und<br />
Komponist der Barockzeit: ” Trotz aller Erfahrungen, die ich durch den<br />
langen Umgang mit der Musik erlangt habe, muß ich zugeben, daß mir<br />
erst mit Hilfe der Mathematik meine Ideen klar werden“, und Gottfried<br />
Wilhelm Leibniz (1646–1716) sagt: ” Die Musik ist die Freude, die der<br />
menschliche Geist erfährt, wenn er zählt ohne sich des Zählens bewußt<br />
zu sein“, und er sagt auch: ” Wenn die Seele auch nicht merkt, daß sie<br />
rechnet, so fühlt sie doch die Wirkung dieser unbewußten Rechnung,<br />
sei es als Freude am Zusammenklang, sei es als Bedrückung am Mißklang.“<br />
Daß Mathematik und Musik miteinander zusammenhängen, hatte<br />
schon Pythagoras gefunden, durch das Studium der Beziehung zwischen<br />
Tonhöhe und Saitenlänge an einem einfachen Musikinstrument,<br />
dem Monochord, bestehend aus einer über einen Resonanzkörper gespannten<br />
Saite, deren Länge bei gleichbleibender Saitenspannung mit<br />
Hilfe eines beweglichen Steges verändert werden kann. Er fand, daß<br />
harmonische Intervalle durch ganzzahlige Proportionen charakterisiert<br />
sind. So ergibt sich die Oktave bei Verkürzung der Länge der Saite auf<br />
die Hälfte, die Quinte auf zwei Drittel, die Quarte auf drei Viertel usw.<br />
So hatten sich Töne als verkörperte Zahlen herausgestellt, qualitative<br />
Unterschiede waren auf quantitative zurückgeführt worden. Diesen<br />
Befund übertrug Pythagoras auf die Ordnung im Kosmos, auf die<br />
sich, nach seiner Vorstellung, in der regelmäßigen Bewegung der Himmelskörper<br />
manifestierende Sphärenharmonie und, nachfolgend bzw.<br />
nachbildend, auf die ethische und soziale Ordnung. Und so kam er zu<br />
dem Schluß: Alles ist Zahl. Die Zahl ist das Weltprinzip. Die durch Zahlen<br />
regierte Harmonie ist das Ordnungsprinzip für die Dinge in der<br />
Welt, ist die Machina mundi.<br />
Und in diesem Sinne sagt der Pythagoräer Philolaos <strong>von</strong> Kroton (Ende<br />
des 5. Jh. v. Chr.): ” Und in der Tat hat ja alles, was erkannt wird, Zahl;<br />
denn, daß sich ohne diese irgend etwas denken oder erkennen läßt, ist<br />
nicht möglich“, und Proclus Diadochus (5. Jh. n. Chr.) schreibt: ” Für die<br />
16
Betrachtung der Natur leistete die Mathematik den größten Beitrag, indem<br />
sie das wohlgeordnete Gefüge der Gedanken enthält, nach dem<br />
das All gebildet ist . . . und die einfachen Urelemente in ihrem ganzen<br />
harmonischen und gleichmäßigen Aufbau darlegt, mit dem der ganze<br />
Himmel begründet wurde . . .“ (so zitiert <strong>von</strong> Kepler in der ” Weltharmonik“).<br />
Der Gedanke der mathematischen Bedingtheit der Harmonie, der Gedanke,<br />
daß die Ordnung in der Welt aus zugrunde liegenden mathematischen<br />
Strukturen resultiere, bestimmte in der Antike das Denken<br />
der griechischen Philosophen, prägte das Bestreben der griechischen<br />
Naturphilosophie und Naturwissenschaft, die Welt und das Weltgeschehen<br />
allein mit Mitteln des Verstandes ohne Bezug auf Mythen und<br />
göttliches Wirken zu verstehen.<br />
Zu Pythagoras und zur Bedeutung der pythagoräischen Denkweise für<br />
die moderne Naturwissenschaft sagt Heisenberg: ” Der Gedanke [der<br />
sinnstiftenden Kraft mathematischer Strukturen] tritt zum ersten Mal<br />
deutlich entgegen in den Lehren der Pythagoräer, und erschließt sich<br />
diesem Kreis durch die Entdeckung der mathematischen Bedingtheit<br />
der Harmonie. Diese Entdeckung gehört zu den stärksten Impulsen<br />
menschlicher Wissenschaft überhaupt, und wer den Blick einmal für<br />
die gestaltende Kraft mathematischer Ordnung erkennt, erkennt ihr<br />
Wirken in der Natur . . .<br />
Wenn in einer musikalischen Harmonie . . . die mathematische Struktur<br />
als Wesenskern erkannt wird, so muß auch die sinnvolle Ordnung<br />
in der uns umgebenden Natur ihren Grund in dem mathematischen<br />
Kern der Naturgesetze haben . . . Letzten Endes beruht . . . die ganze<br />
mathematische Naturwissenschaft auf dieser Denkweise.“<br />
Dazu noch Galilei: ” Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik<br />
abgefaßt“, und Kant: ” In jeder reinen Naturlehre ist nur so viel an<br />
eigentlicher Wissenschaft enthalten, als Mathematik in ihr angewandt<br />
werden kann.“<br />
Aber pythagoräische Zahlenspekulationen gelangten auch in die Mystik<br />
des Mittelalters, insbesondere auch in die Kabbala, die jüdische Geheimlehre,<br />
die auf einer höchst komplizierten Zahlenmystik aufgebaut<br />
17
ist, die da<strong>von</strong> Gebrauch macht, daß die Buchstaben (Konsonanten) des<br />
hebräischen Alphabets gleichzeitig Zahlzeichen sind.<br />
In diesem Zusammenhang sei noch eine Pauli-Anekdote eingefügt, die<br />
ich gelegentlich auch in einer meiner Vorlesungen erzählt habe, eine<br />
Anekdote die Zahl 137 betreffend, deren Kehrwert dem Physiker als<br />
Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante (genauer: 1/137, 035 999 11. . . )<br />
bekannt ist, und die die ganze Quantenelektrodynamik regiert. Pauli<br />
war der festen Überzeugung, daß es eine wesentliche Aufgabe künftiger<br />
theoretisch-physikalischer Forschung sei, diesen Zahlenwert zu<br />
erklären.<br />
Aber die Zahl 137 hatte für Pauli, der, wie erwähnt, auch wohlbewandert<br />
auf den Gebieten Mystik, Kabbala, Alchemie etc. war, nicht nur<br />
eine rationale physikalische, sondern auch eine irrationale magischsymbolische<br />
Bedeutung, hatte er doch herausgefunden, daß entsprechend<br />
dem genannten Zusammenhang zwischen Buchstaben und Zahl,<br />
dem Wort Kabbala (korrekt geschrieben: QABALAH, und mit den Zahlenwerten:<br />
Q=100, B = 2, L = 30, H=5) der Zahlenwert 137 entspricht.<br />
Als Pauli nach plötzlicher Erkrankung im Dezember 1958 in das Rotkreuzspital<br />
in Zürich eingeliefert wurde, wies er seinen ihn besuchenden<br />
Mitarbeiter beunruhigt auf die Nummer seines Zimmers, die Nummer<br />
137, hin und äußerte die Gewißheit, daß er hier sterben werde. Und<br />
so geschah es dann auch.<br />
Doch zurück zu Pythagoras und zur pythagoräischen Lehre.<br />
Pythagoras gilt als legendäre Gestalt, auf die griechische Denker der<br />
ersten vorchristlichen Jahrhunderte wohl auch manche Leistung projizierten,<br />
die erst aus späterer Zeit stammte oder auch gar nichtgriechischen<br />
(ägyptischen, babylonischen . . . ) Ursprungs war, um so auf<br />
solide historische Wurzeln des eigenen Denkens verweisen zu können.<br />
Pythagoras hat keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, und<br />
somit läßt sich auch wenig Verläßliches über seinen eigenen Beitrag zur<br />
Lehre der Pythagoräer, seiner Schule, sagen.<br />
Ähnliches gilt auch für Biographisches zu seiner Person. Ernst Bloch<br />
(1885–1977) hielt es gar für möglich, daß Pythagoras ein Kollektivp-<br />
18
seudonym war, ähnlich wie im 20. Jahrhundert das Kollektivpseudonym<br />
Nicolas Bourbaki für eine Gruppe gewichtiger französischer Mathematiker.<br />
Heraklit (um 550–480 v. Chr.) und Empedokles (um 494–434 v. Chr.)<br />
hielten Pythagoras für einen Eklektiker. So schreibt Heraklit: ” Pythagoras<br />
. . . widmete sich am meisten <strong>von</strong> allen Menschen der Forschung,<br />
und indem er daraus dies herausgriff, machte er sich daraus eine eigene<br />
Weisheit: Vielwisserei, kunstvolle Gaunerei“, d.h. nach Heraklit<br />
bestand Pythagoras’ Forschung einfach darin, Kenntnisse, die er bei<br />
anderen fand, auszuwählen und idiosynkratisch auszuwerten. Ähnlich<br />
äußerte sich auch Empedokles über Pythagoras.<br />
Pythagoras wirkte in Griechenland und im süditalienischen Kroton, wo<br />
er Kopf eines Geheimbundes, eines Ordens, einer Sekte war. Von seinen<br />
Zeitgenossen wird er als ” Wundermann“ beschrieben, <strong>von</strong> dem berichtet<br />
wird, daß allein ihm es möglich gewesen sei, den Gesang der Planeten,<br />
die Sphärenmusik zu hören. Seine Schüler, die Pythagoräer, bilden<br />
bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. eine einflußreiche Philosophenschule in<br />
Unteritalien.<br />
Nach der pythagoräischen Lehre regierten ganzzahlige Verhältnisse die<br />
Welt, entsprechend dem am Monochord gefundenen Zusammenhang<br />
zwischen Tonhöhe und Saitenlänge. In dieser Lehre gab es keinen Platz<br />
für irrationale Zahlen. Als der Pythagoräer Hippasos <strong>von</strong> Metapont<br />
(5. Jh. v. Chr.) entdeckte, daß im Pentagramm, dem pythagoräischen<br />
Erkennungszeichen, eine irrationale Zahl (der Goldene Schnitt, die irrationalste<br />
der irrationalen Zahlen) verborgen ist, drohte das Weltbild der<br />
Pythagoräer zusammenzubrechen. Sie lösten das Problem wie folgt:<br />
Hippasos <strong>von</strong> Metapont wurde als Verräter geächtet, aus der Gemeinschaft<br />
der Pythagoräer ausgestoßen und im Meer ertränkt. Damit war<br />
das Weltbild gerettet. Dies ist ein berühmtes Beispiel dafür, wie ästhetische<br />
Kriterien nicht nur in die Irre, sondern auch gar zu Intoleranz<br />
führen können.<br />
Ein anderes wohlbekanntes Beispiel für eine Fehlleistung auf Grund<br />
einer ästhetischen Norm ist die Einführung einer fiktiven Gegenerde<br />
19
durch Philolaos <strong>von</strong> Kroton, in dessen Weltsystem die heilige Zahl zehn<br />
für die Anzahl der um ein Zentralfeuer kreisenden Himmelskörper dadurch<br />
erhalten wurde, daß zu Erde, Mond, Sonne, den fünf übrigen damals<br />
bekannten Planeten und dem Fixsternhimmel noch eine Gegenerde<br />
hinzugesellt wurde, die sich auf der Bahn der Erde, aber immer<br />
diametral zu dieser, bewegen sollte.<br />
Aber, wie der eingangs zitierte Einstein-Briefwechsel aus dem Jahre<br />
1905 zeigt, gibt es auch sehr schöne Beispiele dafür, daß in der Physik<br />
ästhetische Normen sehr hilfreich beim Auffinden grundlegender Prinzipien<br />
sein können. Zu diesen Beispielen gehören auch die Allgemeine<br />
Relativitätstheorie und das Standardmodell der Elementarteilchen, das<br />
auf dem Prinzip der Invarianz unter lokaler Eichtransformation, einer<br />
Symmetrieforderung, beruht.<br />
Noch eine Anmerkung zu Philolaos <strong>von</strong> Kroton. Von ihm existieren<br />
heute noch einige authentische Fragmente, die aus erster Hand Einblicke<br />
in pythagoräisches Denken erlauben. — Nach Diogenes Laertius<br />
(3. Jh. n. Chr.) hatte Philolaos seine Lehre in einem einzigen Buche niedergelegt,<br />
das gerüchteweise nach seinem Tode <strong>von</strong> seinen Verwandten<br />
an Platon verkauft wurde, der daraus den ” Timaios“ zusammengeschrieben<br />
habe. —<br />
Der ” Timaios“ gilt heute als wichtige Quelle über pythagoräisches Denken,<br />
legt doch in ihm der (fiktive?) Pythagoräer Timaios seine Ansichten<br />
über Weltentstehung, Menschwerdung und Harmonik dar.<br />
Unter den Pythagoräern hatten sich zwei Richtungen des Denkens<br />
herausgebildet: die Akusmatiker und die Mathematiker. Während<br />
die Akusmatiker ( ” akusmata“: gehörte Dinge) sich der Befolgung<br />
bzw. Pflege bestimmter pythagoräischer Maximen und Prinzipien verpflichtet<br />
fühlten, so der Harmonie als grundlegendem, universellem<br />
Ordnungsprinzip, widmeten sich die Mathematiker ( ” mathemata“:<br />
Lehrfächer) den pythagoräischen Lehrfächern Arithmetik, Geometrie,<br />
Musik und Astronomie.<br />
Pythagoras hatte, entsprechend der der Zahl zuerkannten herausragenden<br />
Bedeutung, die vier Mathemata in die Ausbildung seiner Jünger<br />
20
aufgenommen, und Platon (428–348 v. Chr.), für den die Mathematik<br />
eine wichtige Hilfe auf dem Wege zum Verständnis der Ideen im Rahmen<br />
seiner Ideenlehre war, verlangte die vier Mathemata für die Ausbildung<br />
der Führungskräfte seines Idealstaates.<br />
Die vier Mathemata fanden Eingang in das allgemeine Bildungs- und<br />
Erziehungssystem der Griechen und später auch der Römer.<br />
Auch im Mittelalter, an den Dom-, Stifts- und Klosterschulen und<br />
später an den Artistenfakultäten der <strong>Universität</strong>en, waren die vier Mathemata<br />
wichtiger Bestandteil der Ausbildung, im Rahmen der sieben<br />
Artes liberales, der sieben freien Künste, die die drei Grunddisziplinen<br />
(Trivium) Grammatik, Rhetorik und Dialektik (Logik) sowie die weiterführenden<br />
vier Mathemata (Quadrivium) umfaßten.<br />
Hervorzuheben ist, daß in der Antike und im Mittelalter die Musik<br />
zu den vier mathematischen Wissenschaften gezählt wurde, gemäß der<br />
Tatsache, daß die Musik ihrer Struktur nach reine Mathematik ist, sind<br />
doch Harmonie, Rhythmus, Metrum etc. mathematische Abläufe.<br />
In Griechenland wurde auch der Musikpraxis hoher Wert für Erziehung<br />
und Bildung beigemessen, so sagt Platon: ” Darum ist die Musik<br />
der wichtigste Teil der Erziehung. Rhythmus und Töne dringen am tiefsten<br />
in die Seele und erschüttern sie am gewaltigsten. Sie machen bei<br />
richtiger Erziehung den Menschen gut, anderenfalls schlecht.“<br />
Und Cicero (106 bis 43 v. Chr.) schreibt: ” Höchste Bildung lag nach dem<br />
Urteil der Griechen in der Beherrschung des Saitenspiels und Gesanges<br />
. . . alle suchten Musik zu lernen, und niemand galt für recht gebildet,<br />
der sich nicht auf sie verstand.“<br />
Im Mittelalter, vor dem Aufkommen der <strong>Universität</strong> im 12. Jh., stand<br />
unter den Fächern des Quadriviums die Musik an erster Stelle, insbesondere<br />
wegen ihrer Bedeutung für die Gestaltung der liturgischen<br />
Gesänge im Rahmen des Gottesdienstes.<br />
Der pythagoräische Ansatz der Musiktheorie war im frühen Mittelalter<br />
in Vergessenheit geraten, bis er im 9. Jahrhundert wiederentdeckt und<br />
<strong>von</strong> da an auch weiterentwickelt wurde.<br />
21
Angemerkt sei, daß der Begriff Quadrivium <strong>von</strong> Ancius Manlius Severinus<br />
Boethius (480 bis 524) geprägt wurde, dem gewichtigen Philosophen<br />
und Musiktheoretiker der Spätantike, der Kanzler des Königs<br />
Theoderich war, aber in politische Intrigen verwickelt und, unter Anschuldigung<br />
des Hochverrates, ins Gefängnis geworfen (wo er sein<br />
berühmtes Werk ” Trost der Philosophie“ schrieb) und schließlich hingerichtet<br />
wurde.<br />
Im Mittelalter war Boethius die Autorität in Sachen der auf Zahlen und<br />
Proportionen gegründeten Musiktheorie der Antike. Die <strong>von</strong> ihm verfaßten<br />
fünf Bücher ” De institutione musica“ waren bis in die frühe Neuzeit<br />
hinein die einflußreichste musiktheoretische Schrift.<br />
Ganz im Sinne der Pythagoräer gliederte Boethius die spekulative und<br />
hörbare Musik hierarchisch (vgl. Abb. 8), in Musica mundana (Sphärenharmonie,<br />
Gleichmaß der Bewegung der Himmelskörper), Musica humana<br />
(Zusammenspiel <strong>von</strong> Körper und Seele des Menschen und in den<br />
Beziehungen der Menschen untereinander), und Musica instrumentalis<br />
(hörbare Musik der Stimmen und Instrumente), wobei die Musica humana<br />
und Musica instrumentalis in bezug auf die Musica mundana als<br />
nachahmend bzw. nachschöpferisch betrachtet wurden, bzw. wie Plotin<br />
(205 bis 270) sagt: ” Alle Musik, wie sie auf Melodie und Rhythmus<br />
beruht, ist der irdische Stellvertreter der himmlischen Musik, die sich<br />
im Rhythmus der ursprünglichen Idee bewegt.“<br />
Die hierarchische Dreiteilung der Musik, mit der Sphärenmusik an<br />
der Spitze, widerspiegelt den universell-musikalischen Harmoniebegriff<br />
der pythagoräischen Lehre als Ausdruck der göttlichen Ordnung<br />
der Welt.<br />
Sie wurde bis Ende des 13. Jh. auch <strong>von</strong> den Musiktheoretikern allgemein<br />
akzeptiert, als allgemein-philosophisches Konzept, jedoch ohne<br />
praktisch-kompositorische Konsequenzen.<br />
Die Lehre vom klingenden Kosmos, <strong>von</strong> den tönenden Sphären, ist nie<br />
gänzlich aus des Menschen Gedächtnis geschwunden, sondern hat immer<br />
wieder dessen Phantasie beflügelt, bis in die jüngste Zeit.<br />
So schreibt der Theoretische Physiker Arnold Sommerfeld (1868–1951),<br />
22
Doktorvater <strong>von</strong> Pauli und Heisenberg, im Vorwort zu seinem Buche<br />
” Atombau und Spektrallinien“ (1931):<br />
” Was wir heutzutage aus der Sprache der Spektren heraushören, ist eine<br />
wirkliche Sphärenmusik des Atoms, ein Zusammenklingen ganzzahliger<br />
Verhältnisse, eine bei aller Mannigfaltigkeit zunehmende Ordnung<br />
und Harmonie. . . Alle ganzzahligen Gesetze der Spektrallinien<br />
und der Atomistik fließen letzten Endes aus der Quantentheorie. Sie<br />
ist das geheimnisvolle Organon, auf dem die Natur die Spektralmusik<br />
spielt und nach dessen Rhythmus sie den Bau der Atome und Kerne<br />
regelt.“<br />
Zu dieser Sicht Sommerfelds sagte Pauli in seiner Nobelpreisrede<br />
(1946), im Rückblick auf die zwanziger Jahre, auf die Zeit der Herausbildung<br />
der durch das Plancksche Wirkungsquantum regierten neuen<br />
Atomphysik: ” Es gab damals zwei Wege, auf denen man sich<br />
den schwierigen mit dem Wirkungsquantum verknüpften Problemen<br />
nähern konnte. Der eine. . . [mit Hilfe des] Bohrschen Korrespondenzprinzips.<br />
Sommerfeld dagegen zog . . . eine Deutung der Spektralgesetze<br />
mit Hilfe ganzer Zahlen vor, indem er, wie einst Kepler bei seiner<br />
Untersuchung des Planetensystems, einem inneren Gefühl für Harmonie<br />
folgte . . .“<br />
Kepler schreibt in seiner ” Weltharmonik“: ” Es sind also die Himmelsbewegungen<br />
nichts anders als eine fortwährende mehrstimmige Musik<br />
(durch den Verstand, nicht das Ohr faßbar), eine Musik, die durch<br />
dissonierende Spannungen, gleichsam durch Synkopen und Kadenzen<br />
hindurch (wie sie die Menschen in Nachahmung jener natürlichen<br />
Dissonanzen anwenden) auf bestimmte, vorgezeichnete je sechsgliedrige<br />
[entsprechend der zu Keplers Zeit bekannten Zahl der Planeten]<br />
(gleichsam sechsstimmige) Klauseln lossteuert und dadurch in dem unermeßlichen<br />
Ablauf der Zeit unterscheidende Merkmale setzt. Es ist daher<br />
nicht mehr verwunderlich, daß der Mensch, der Nachahmer seines<br />
Schöpfers, endlich die Kunst des mehrstimmigen Gesanges, die den Alten<br />
unbekannt war, entdeckt hat . . .“<br />
Nach Kepler sind, ganz im Sinne Pythagoras’ bzw. Boethius’, die realen<br />
musikalischen Harmonien nicht mehr als eine materielle Realisierung<br />
23
der Sphärenharmonie, an deren Wahrheit Kepler glaubte, die er durch<br />
das Studium der Planetenbewegung zu beweisen suchte, und die ihm,<br />
nach seiner Vorstellung, Einblick in Gottes Gedanken eröffnete.<br />
Doch bevor ich näher auf Kepler eingehe, noch einige Zitate und Anmerkungen<br />
zur pythagoräischen Idee der Sphärenharmonie:<br />
Im ” Prolog im Himmel“, den er seinem ” Faust“ voranstellt, sagt Goethe<br />
(1749–1832):<br />
” Die Sonne tönt nach alter Weise<br />
in Brudersphären Wettgesang,<br />
und ihre vorgeschriebne Reise,<br />
vollendet sie mit Donnergang.“<br />
Und Dante (1265–1321) sagt in der ” Göttlichen Komödie,“ in der 31.<br />
Strophe des 30. Gesanges des Purgatoriums (Übersetzung <strong>von</strong> Karl<br />
Streckfuß):<br />
” So war ich ohne Seufzer, ohne Zähren,<br />
bevor die Engel sangen, deren Sang<br />
nur Nachklang ist vom Lied der ewigen Sphären“,<br />
und in der 42. Strophe des 6. Gesanges des Paradieses:<br />
” Verschiedene Tön’ erzeugen süßen Klang;<br />
so bilden hier die Harmonie der Sphären<br />
die lichten Kreise <strong>von</strong> verschiednem Rang.“<br />
Über den harmonischen Zusammenklang der kreisenden Gestirne auf<br />
den himmlischen Sphären (vgl. Abb. 9, Miniatur aus dem 9. Jh.) —<br />
auf der äußersten die Fixsterne und nach innen folgend Saturn, Jupiter,<br />
Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond und in der Mitte, unbeweglich,<br />
die Erde — schreibt Cicero in ” Der Staat“, 6. Buch, ” Der Traum Scipios“:<br />
” Das ist der Klang, der — zusammengesetzt aus unterschiedlichen,<br />
aber doch in einem wohl . . . abgestimmten Verhältnis stehenden Intervallen<br />
— durch Schwung und Bewegung der Sphären selbst erzeugt<br />
24
wird und, das Hohe mit dem Tiefen mischend, verschiedene Akkorde<br />
gleichmäßig hervorbringt . . .<br />
Jene acht Bahnen aber, <strong>von</strong> denen zwei den gleichen Charakter haben,<br />
bringen sieben durch Intervalle <strong>von</strong>einander getrennte Töne hervor, eine<br />
Zahl, die die Verknüpfung fast aller Dinge darstellt. Das haben die<br />
klugen Menschen mit Saitenspiel und Gesang nachgebildet . . .“<br />
Es ist Scipio Africanus der Jüngere (um 185–129 v. Chr.), der hier<br />
träumt, sich im Traum im Bereich der Sphäre der Fixsterne sieht — auf<br />
die kreisenden Bewegungen der anderen Gestirne herabblickend und<br />
deren Gesang lauschend — sich im Gespräch sieht mit seinem Großvater,<br />
Scipio Africanus dem Älteren (um 235–183 v. Chr.), der seinerzeit,<br />
im zweiten Punischen Krieg (218–201 v. Chr.), in der Schlacht <strong>von</strong> Zama<br />
(202 v. Chr.), Hannibal schlug, und der ihm jetzt (149 v. Chr.) prophezeit,<br />
daß er in Kürze, im dritten Punischen Krieg (149 bis 146 v. Chr.),<br />
Karthago vernichten wird.<br />
Angemerkt sei, daß das antike Bild des Gesanges der kreisenden Gestirne,<br />
wie es hier <strong>von</strong> Cicero beschrieben wird, <strong>von</strong> den Kirchenvätern<br />
übernommen und verchristlicht wurde, durch Ansiedelung der Engelschöre<br />
jenseits aller Sphären, wo sie stets Gottes Angesicht sehen<br />
und ihm ohne Ende lobsingen konnten, wie ja auch in der oben zitierten<br />
Strophe Dantes anklingt, und so konnte die Weltharmonie als Hinweis,<br />
ja als Beweis, für den Schöpfer ausgelegt werden.<br />
Ein Kleinod in der Literatur zur Sphärenharmonie ist das ” Kosmische<br />
Monochord“ (Abb. 10) des englischen Arztes, Theologen und Hermetikers<br />
Robert Fludd (1574–1637), aus dessen Schrift ” Metaphysica . . .“<br />
(1619). Wie zu sehen, ist die Saite des Monochords eingeteilt in zwei<br />
Oktaven und diese sind jeweils, symmetrisch angeordnet, in Quinte<br />
und Quarte unterteilt. Auf den Intervallen bewegt sich das obere lichte<br />
Prinzip hinab in die dunkle Materie, mit der Sonne als Zentrum: oben<br />
das Empyreum, die Region der Engel, dann das Sonnensystem mit den<br />
tönenden Planetensphären, und schließlich unten die vier Elemente der<br />
Erde. Gottes Hand, aus den Wolken greifend und das Instrument stimmend,<br />
sorgt für die Harmonie des Weltgeschehens.<br />
25
Kepler und Fludd befehdeten sich hinsichtlich ihrer Vorstellungen <strong>von</strong><br />
der Weltharmonie. So ist nach Kepler Fludds ” Kosmisches Monochord“<br />
untauglich, das Weltgeschehen zu erfassen, da in ihm Größen verschiedener<br />
physikalischer Dimension miteinander vermengt und empirisch<br />
belegte Sachverhalte ignoriert werden (vgl. Anhang zum V. Buch der<br />
” Weltharmonik“).<br />
Fragt sich, woher kommt des Menschen unerschütterliche Zuversicht,<br />
daß das Weltgeschehen letztlich durch Harmonie bestimmt sei? Vielleicht<br />
projiziert sein Hirn Harmonie in die Welt?<br />
Betrachten wir z.B. die allegorische Darstellung der Musik nach Boethius<br />
(Abb. 8), speziell das Teilbild zur Musica humana, dann sehen<br />
wir, daß offenbar schon um 1300 eine Konsensgesellschaft oder gar der<br />
ewige Friede, im Bereich des Möglichen oder wenigstens Wünschenswerten,<br />
gelegen zu haben schien. Wie weit man damals da<strong>von</strong> entfernt<br />
war, wissen wir heute sehr wohl.<br />
Aber wie gesagt, vielleicht ist ja des Menschen Harmonie-Zuversicht<br />
eine gehirnbedingte Orientierungs- und Überlebensstrategie.<br />
So schrieb Kepler in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges: ” Wenn<br />
der Sturm rast und der Staat vom Untergang bedroht ist, können wir<br />
nichts Würdigeres tun, als den Anker unserer friedlichen Studien in<br />
den Grund der Ewigkeit zu senken.“<br />
Nach Kepler sind die harmonikalen Verhältnisse dem Menschen als Urbilder<br />
eingeschrieben. ” Eine geeignete Proportion in Sinnesdingen auffinden<br />
heißt die Ähnlichkeit der Proportion mit einem bestimmten, innen<br />
im Geist vorhandenen Urbild [harmoniae archetypus qui intus est<br />
anima] ans Licht bringen.“<br />
In diesem Zusammenhang ist ein neuerer Befund aus der Hirnforschung<br />
(P. Janata et al., Science 298, 2167 (2002)) nicht uninteressant:<br />
Mittels funktionaler Kernspintomographie wurde die Hirnaktivität<br />
beim Abspielen eines tonal komponierten und mittels diatonischer Modulation<br />
durch alle 24 Dur- und Moll-Tonarten geführten Musikstücks<br />
studiert und gefunden, daß tonale Musik nur in einer ganz bestimm-<br />
26
ten Hirnregion, dem rostromedialen präfrontalen Cortex (Abb. 11) verarbeitet<br />
wird, einer Hirnregion, in der Erinnerungen gesammelt und<br />
Informationen aufgefrischt werden. Falsche Töne, Dissonanzen, hingegen,<br />
bewirken Hirnaktivitäten in den Schläfenlappen, die allgemein für<br />
Klangverarbeitung zuständig sind.<br />
Somit sind Musikalität und Harmonie-Präferenz möglicherweise ein<br />
Produkt der Evolution und harmonikale Verhältnisse, wie Kepler spekuliert,<br />
wirklich ” dem Menschen eingeboren“.<br />
Ob die genannten Befunde der Hirnforschung etwas mit Archetypen<br />
im Sinne Keplers, Jungs etc. zu tun haben, sei dahingestellt. Dies zu<br />
entscheiden, ist Sache der einschlägigen Experten.<br />
Nach orientierenden Recherchen in der Literatur (Kihlstrom, Schüßler,<br />
Singer, Libet . . . ) stellt sich mir der hier anklingende Fragenkomplex<br />
wie folgt dar: Dem Unbewußten wird heute, auch seitens der Neurobiologen<br />
und Kognitionswissenschaftler, eine wichtige Bedeutung zuerkannt,<br />
für seelische Prozesse, für das gesamte Denken und Handeln —<br />
aber die Freudsche Triebtheorie ist wohl obsolet. Das Thema Archetypen<br />
ist offenbar zu kompliziert, als daß es (gegenwärtig) Gegenstand<br />
der Hirnforschung sein könnte. Ob das kollektive Unbewußte angeboren<br />
oder sozial bedingt ist, ist umstritten.<br />
Nicht zuletzt, da bewußte und unbewußte Prozesse schwer <strong>von</strong>einander<br />
getrennt werden können, ist auch das Problem der Willensfreiheit<br />
noch nicht geklärt, obgleich es bei den Hirnforschern eine nicht unbedeutende<br />
Fraktion gibt, die die Willensfreiheit in Frage stellt. Für den<br />
oben erwähnten Konstruktivismus sieht die gegenwärtige Forschungund<br />
Meinungslage nicht schlecht aus, und damit auch nicht für Schopenhauers<br />
” Die Welt ist meine Vorstellung“, und somit auch nicht für<br />
eine Theorie der Theorienbildung im Sinne Keplers, Paulis, Heisenbergs<br />
. . .<br />
Johannes Kepler<br />
Von Stephen Hawking herausgegeben, erschien kürzlich ein opulenter<br />
Band, der fünf für die neuzeitliche Physik grundlegende Werke in sich<br />
27
vereinigt: ” Über die Kreisbewegungen der Weltkörper“ ( ” De revolutionibus“<br />
(1543)) <strong>von</strong> Nicolaus Copernicus (1473–1543), Galileo Galileis<br />
(1564–1642) ” Unterredungen über zwei neue Wissenszweige“ ( ” Discorsi“<br />
(1638)), das fünfte Buch der ” Weltharmonik“ ( ” Harmonices mundi“<br />
(1619)) Johannes Keplers (1571–1630), die Bücher I und III <strong>von</strong> Issac<br />
Newtons (1643–1727) ” Die mathematischen Prinzipien der Physik“<br />
( ” Principia“, 1687) und wichtige Artikel Albert Einsteins (1879–1955)<br />
zur Speziellen (1905) und Allgemeinen (1916) Relativitätstheorie.<br />
In diesem Band wird ” mit Hilfe der Originaltexte die Entwicklung unseres<br />
Weltbildes nachgezeichnet, <strong>von</strong> der revolutionären Behauptung<br />
des Nicolaus Copernicus, die Erde umkreise die Sonne, bis zu der ebenso<br />
revolutionären Theorie Albert Einsteins, nach der Raum und Zeit<br />
durch Masse und Energie gekrümmt und verzerrt werden. Es ist eine<br />
faszinierende Geschichte, weil Copernicus wie Einstein die Auffassung<br />
<strong>von</strong> unserem Status in der Ordnung der Dinge tiefgreifend verändert<br />
haben“, so Hawking.<br />
Zu Kepler und dessen Werk schreibt Hawking: ” . . . Wie Copernicus,<br />
<strong>von</strong> dessen Arbeiten er sich inspirieren ließ, war auch Kepler ein zutiefst<br />
religiöser Mensch. Sein fortwährendes Studium der universellen<br />
Eigenschaften begriff er als Christenpflicht, als Erfüllung der frommen<br />
Aufgabe, das Universum zu verstehen, das Gott geschaffen hat . . .<br />
Sein Werk ” Harmonices mundi“ war die erste eindeutig kopernikanische<br />
Arbeit, seit Copernicus sein eigenes Werk ” De revolutionibus“<br />
veröffentlicht hatte . . .<br />
Obwohl er nie den Bekanntheitsgrad <strong>von</strong> Galilei erreicht hat, hinterließ<br />
Kepler ein Werk, das sich für professionelle Astronomen wie Newton<br />
als außerordentlich nützlich erwies, weil sie in seinen Schriften eine<br />
Fülle <strong>von</strong> wissenschaftlich exakten Details fanden. Johannes Kepler<br />
war ein Mensch, der ästhetische Harmonie und Ordnung über alles<br />
liebte, und alles was er entdeckte, war unauflöslich verknüpft mit seiner<br />
Vorstellung <strong>von</strong> Gott.“<br />
Hinzugefügt sei: Kepler entdeckte die Gesetze der Planetenbewegung,<br />
die drei ” Keplerschen Gesetze“, deren drittes Newton den Weg zur Entwicklung<br />
des Gravitationsgesetzes wies. Kepler war Wegbereiter der<br />
28
Astrophysik und der wissenschaftlichen Optik, und mit den ” Rudolfinischen<br />
Tafeln“ schuf er, auf der Grundlage <strong>von</strong> Tycho Brahes Beobachtungsdaten<br />
und umfangreicher eigener Berechnungen, ein <strong>von</strong> Astronomen,<br />
Astrologen und Seefahrern hochgeschätztes Standardwerk der<br />
Planetenbewegungen und -positionen. Kepler lieferte auch wichtige<br />
Beiträge zur reinen Mathematik, so zur Entwicklung der Infinitesimalrechnung<br />
(Berechnung des Volumens <strong>von</strong> Rotationskörpern) und<br />
zum Problem der dichtesten Packung <strong>von</strong> Kugeln. Seine Hypothese, eine<br />
pyramidenförmige Kugelpackung habe die höchstmögliche Dichte,<br />
konnte erst kürzlich, 400 Jahre nach Kepler, computergestützt, bewiesen<br />
werden.<br />
Kepler wurde zum Wegbereiter der Astrophysik, da er — anders als<br />
die Astronomen vor ihm, für die die Bewegung der Himmelskörper ein<br />
rein kinematisches Problem war — die kausale Rolle der Sonne für die<br />
Planetenbewegung erkannte und so die Beschreibung der Planetenbewegung<br />
zu einem physikalischen Problem werden ließ, auch wenn er<br />
die Dynamik dieser Bewegung nicht korrekt erfassen konnte, war ihm<br />
doch die Natur der <strong>von</strong> der Sonne auf die Planeten ausgeübten Kraft<br />
noch nicht bekannt.<br />
Kepler benötigte für die Erklärung der Bewegung auf einer gekrümmten<br />
Bahn eine treibende und eine stabilisierende Kraft, während Newton<br />
später in seinem Werke ” Principia“ zeigte, daß die Gravitationskraft<br />
allein vom Abstand zwischen Sonne und Planeten abhängt, und mit<br />
einer solchen Kraft, zusammen mit seinem Trägheitsgesetz, die Planetenbewegung<br />
korrekt beschrieben werden kann. Damit hatte Newton<br />
gezeigt, daß die Gesetze der Physik in gleicher Weise für irdische und<br />
himmlische Phänomene gelten, was ihn zum Begründer der Astrophysik,<br />
der modernen Astronomie machte.<br />
Die physikalische Natur der gravitativen Kraft wirklich zu erklären<br />
vermochte jedoch weder Kepler noch Newton, was Friedrich<br />
W. J. Schelling (1775–1854) in seinen ” Ideen zu einer Philosophie<br />
der Natur“ (1797) wie folgt beschreibt: ” Lange vor Newton hatte Kepler,<br />
dieser schöpfrische Geist, in poetischen Bildern gesagt, was Newton<br />
nachher prosaischer ausdrückte. Als jener zuvor <strong>von</strong> Sehnsucht, die<br />
29
Materie gegen Materie triebe, dieser <strong>von</strong> Anziehung zwischen Körper<br />
und Körper sprach, dachte keiner <strong>von</strong> beyden daran, daß diese Ausdrücke<br />
ihnen selbst oder anderen je für Erklärungen gelten sollten. Denn<br />
Materie und anziehende und zurückstoßende Kraft war ihnen Eins und<br />
dasselbe — Beyde nur zween gleichgeltende Ausdrücke derselben Sache,<br />
die Eine für die Sinne, die andere für den Verstand gültig.“<br />
Eine Erklärung, im Sinne <strong>von</strong> Zurückführung auf ein universelles physikalisches<br />
Konzept, wird die Gravitationskraft wohl erst im Rahmen<br />
einer Theorie der Quantengravitation finden, zu der gegenwärtig zwei<br />
Zugänge, die Stringtheorie und die Schleifen-Quantengravitation (die<br />
zu einer diskreten Raumzeit führt), intensiv verfolgt werden.<br />
Wegbereiter für solch eine Theorie war Einstein mit seiner Allgemeinen<br />
Relativitätstheorie, nach der Raum und Zeit dynamische Größen<br />
sind — und damit auch der Quantentheorie unterliegen, zu deren Entwicklung<br />
Einstein ja ebenfalls wesentliche Beiträge geliefert hat.<br />
Angemerkt sei hier, daß, im Zusammenhang mit der Quantengravitation,<br />
Hawking, in der Einleitung zu dem oben erwähnten Sammelband<br />
<strong>von</strong> gewichtigen Originalarbeiten <strong>von</strong> Klassikern der Physik, auf das<br />
anthropische Prinzip zurückgreift, ” das uns wieder die zentrale Stellung<br />
einräumt, die einzufordern uns unsere Bescheidenheit seit der<br />
Zeit des Copernicus verboten hat. . . , nach dem wir keine Fragen über<br />
die Natur des Universum stellen würden, wenn das Universum keine<br />
Sterne, Planeten und chemischen Elemente enthielte, denn [entsprechend<br />
der Quantentheorie, die nur Wahrscheinlichkeitsangaben liefert]<br />
hat das Universum selbst jede mögliche Form und Geschichte [und wir<br />
beobachten die Dinge in dem Universum, in dem sich Leben entwickeln<br />
konnte].“<br />
Doch zurück zu Kepler (Abb. 12), seinem Denken und Wirken: Ganz<br />
im Geiste des anthropischen Prinzips sagt Kepler: ” Ich glaube, daß die<br />
Ursachen für die meisten Dinge in der Welt aus der Liebe Gottes zu den<br />
Menschen hergeleitet werden können.“<br />
Nach Kepler — ähnlich auch Newton — hat Gott die Naturgesetze geschaffen<br />
mit dem Ziel, Ordnung in der Natur walten zu lassen. Und so<br />
30
ist das Studium der Natur für Kepler nichts anders, als die Gedanken<br />
Gottes nachzudenken, Einblicke in das Wirken Gottes zu erlangen.<br />
Kepler glaubte erkannt zu haben, daß Gott bei der Erschaffung der<br />
Dinge zwei wesentliche Prinzipien befolgt hat, ein geometrisches, das<br />
der Kugelform eine exzeptionelle Bedeutung beimißt, und ein harmonisches,<br />
das die Sphärenmusik erklingen läßt.<br />
Die Kugel ist für Kepler, den tief-religiösen Protestanten, ein Symbol<br />
der Dreifaltigkeit, der Trinität. In seinem Jugendwerk ” Mysterium cosmographicum“<br />
(1596) sagt er: ” Das Abbild des dreieinigen Gottes ist<br />
in der Kugel(fläche), nämlich des Vaters im Zentrum, des Sohnes in<br />
der Oberfläche und des Heiligen Geistes im Gleichmaß der Bezogenheit<br />
zwischen Punkt und Zwischenraum (oder Umkreis).“<br />
” Geometrische Figuren“ waren für Kepler Gottes Gedanken“, und er<br />
”<br />
war, wie schon gesagt, überzeugt <strong>von</strong> der Wahrheit der Sphärenharmonie.<br />
Geometrie und Harmonie waren Keplers eingeborene Ideen“ bzw.<br />
”<br />
Archetypen.<br />
Nach Pauli ging bei Kepler das symbolische Bild der Formulierung eines<br />
Naturgesetzes voran: Die symbolischen Bilder und archetypischen<br />
”<br />
Vorstellungen sind das, was ihn zum Suchen nach Naturgesetzen veranlaßt.<br />
Deshalb sehen wir auch Keplers Anschauung der Entsprechung<br />
der Sonne und der sie umgebenden Planeten mit seinem abstrakten<br />
sphärischen Bild der Trinität als primär an: Weil er Sonne und Planeten<br />
mit diesem archetypischen Bild im Hintergrund anschaut, glaubt er<br />
mit religiöser Leidenschaft an das heliozentrische System — und nicht<br />
etwa umgekehrt, wie eine rationalistische Auffassung irrigerweise annehmen<br />
könnte.“<br />
In seinem Werk ” Mysterium cosmographicum“ präsentiert Kepler —<br />
seine Idee verwirklichend, daß das Universum nach geometrischen<br />
Prinzipien aufgebaut sei — als Modell für das Sonnensystem ein Konstrukt<br />
aus ineinander verschachtelten platonischen Körpern mit eingeschriebenen<br />
bzw. umspannenden Sphären. Die platonischen Körper<br />
werden durch das lückenlose Zusammenfügen gleichmäßiger Vielecke<br />
gebildet (Abb. 13). Kepler betrachtet sie als bestmöglich ” das Sphärische<br />
nachahmend“. Die Tatsache, daß es genau fünf platonische Körper<br />
31
gibt, und sich somit in dem Konstrukt sechs Sphären unterbringen lassen,<br />
genauso viele wie nach damaliger Kenntnis Planeten existierten,<br />
nahm Kepler als Beweis für die Richtigkeit seines Modells, lieferte dies<br />
ja auch, bis auf wenige Prozent, die richtigen Werte für die mittleren<br />
Abstände zwischen den Planeten und der Sonne.<br />
Die Idee zu dem verschachtelten Polyedermodell (Abb. 14) war Kepler<br />
gekommen, als er — in Graz als Mathematiklehrer während einer<br />
Geometrievorlesung — an der Wandtafel ein gleichseitiges Dreieck in<br />
einen Kreis einzeichnete und einen weiteren Kreis innerhalb des Dreiecks<br />
— und ihm auf einmal klar wurde, daß das Verhältnis der Kreise<br />
dem Verhältnis der Bahnen <strong>von</strong> Saturn und Jupiter entsprach.<br />
Es waren also ästhetische Gründe, vor allem das Prinzip der Symmetrie,<br />
der Vollkommenheit, ja Göttlichkeit der Sphäre, die Kepler dazu<br />
brachten, durch Verschachtelung platonischer Körper, ein Modell des<br />
Sonnensystems zu konstruieren. Durch die Entdeckung weiterer Planeten<br />
(Uranus (1781), Neptun (1846), Pluto (1930)) wurden jedoch grundlegende<br />
Voraussetzungen des keplerschen Modells hinfällig.<br />
D.h., obgleich das keplersche Modell bestimmte Dinge (mittlere Abstände)<br />
richtig zu beschreiben vermag, ist es doch falsch: ein beeindruckendes<br />
Beispiel für die Falsifizierung einer an sich feinen Theorie<br />
durch das Experiment bzw. die Beobachtung.<br />
Himmelsmechanik ist auch heute noch ein interessantes Teilgebiet der<br />
Theoretischen Physik. Das fundamentale Problem der Himmelsmechanik<br />
ist das N-Körperproblem, d.h. die Vorhersage der Bahnen <strong>von</strong> N<br />
miteinander wechselwirkenden Körpern auf der Grundlage des Newtonschen<br />
Trägheitsgesetzes, bei Vorgabe <strong>von</strong> Positionen und Geschwindigkeiten<br />
der Körper zu einem bestimmten Zeitpunkt (Anfangszeitpunkt).<br />
Newton hatte das Zweikörperproblem (N=2) (z.B. Sonne und ein Planet)<br />
gelöst und so die Keplerschen Gesetze für die Planetenbewegung<br />
in analytischer Weise bestätigt.<br />
Aber schon das Dreikörperproblem (N=3) (z.B. Sonne, Erde, Mond) ist<br />
bis heute nicht voll verstanden, kann doch schon dieses Problem nicht<br />
32
mehr exakt gelöst werden. Wie zuerst <strong>von</strong> Henri Poincaré (1854–1912)<br />
gezeigt, können sich für N ≥ 3 sehr interessante Bewegungsabläufe, z.B.<br />
Bahninstabilitäten, ergeben, wofür auch jüngste Beobachtungen an einem<br />
extrasolaren Planetensystem sprechen (E.B. Ford et al., Nature 434,<br />
873 (2005)).<br />
Bislang ist nicht verstanden, weshalb sich bei der Entstehung unseres<br />
Planetensystems — vor ca. 4,5 Milliarden Jahren — als stabile Planetenbahnen<br />
gerade die herausgebildet haben, die wir heute vorfinden.<br />
D.h. die Newtonsche Theorie kann nicht ohne weiteres erklären, was<br />
Kepler mit seinem Modell verschachtelter Polyeder konnte: die mittleren<br />
Abstände zwischen Sonne und Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter,<br />
Saturn.<br />
Erwähnt sei hier der Laplacesche Dämon, eine T.O.E. auf der Grundlage<br />
der Newtonschen Mechanik, eine Metapher für das deterministische<br />
Weltbild auf der Grundlage des Newtonschen N-Körperproblems.<br />
Pierre-Simon Laplace (1749–1827) beschreibt im Vorwort seines Werkes<br />
” Essai philosophique sur les probabilités“ (1814) besagten Dämon, ein<br />
intelligentes, rechnendes Wesen, dem zu einem beliebigen Zeitpunkt<br />
alle im Kosmos wirkenden Kräfte sowie Positionen und Geschwindigkeiten<br />
aller Teile (Körper) bekannt sind. Diesem Wesen wäre es nach<br />
den Gesetzen der Newtonschen Mechanik möglich, die Entwicklung<br />
des Weltalls — sowohl in die Zukunft voraus, als auch in die Vergangenheit<br />
zurück — zu berechnen. Auf die Frage Napoleons, dem Laplace<br />
ein Exemplar seines Werkes überreicht hatte, nach dem Platze Gottes<br />
in seiner Theorie, antwortete Laplace: Diese Hypothese benötige ich<br />
”<br />
nicht.“ D.h., während Kepler und auch noch Newton Gott einen wichtigen<br />
Platz im Weltgeschehen einräumten, hat Laplace Gott aus dem<br />
Weltgeschehen eliminiert.<br />
Keplers Polyedermodell ist Ausdruck finalen, teleologischen Denkens:<br />
Eine Zweckursache, Gottes Idee <strong>von</strong> der Idealgestalt der Kugel, bestimmt<br />
die Sachverhalte, d.h. die Frage wird nach dem ” Warum“ gestellt<br />
und nicht nach dem ” Wie“, wie im Falle kausalen Denkens, wenn<br />
nach physikalischen Wirkursachen gesucht wird.<br />
Auch die Ellipsenform der Planetenbahnen, wie sie sich zwingend<br />
33
aus den Beobachtungsdaten Tycho Brahes ergibt, hat nach Kepler eine<br />
Zweckursache, nämlich den <strong>von</strong> Gott gewollten mehrstimmigen Planetengesang,<br />
wie schon in der Überschrift zu dem fünften Buch der<br />
” Weltharmonik“ anklingt: Die vollkommene Harmonie in den himm-<br />
”<br />
lischen Bewegungen und die daher rührende Entstehung der Exzentrizitäten,<br />
Bahnhalbmesser und Umlaufszeiten.“<br />
An kausales Denken gewöhnt, hätte man erwartet, daß Kepler seine gefundenen<br />
harmonischen Intervallproportionen als Folge der Ellipsenform<br />
der Planetenbahnen betrachtet, und nicht umgekehrt. Aber kausales<br />
Denken, auch Kepler nicht unbekannt, setzte sich im Bereich der<br />
exakten Naturwissenschaften erst ab dem 18. Jh. allgemein durch, im<br />
Zusammenhang mit der Etablierung der Newtonschen Mechanik als<br />
Grundlage physikalischer Forschung.<br />
Keplers Weltharmonik“ liest sich über weite Strecken wie ein Buch der<br />
”<br />
Musiktheorie. Das dritte Buch der Weltharmonik“ nennt Kepler das<br />
”<br />
” eigentlich harmonische Buch“. In ihm erarbeitete er eine umfassende<br />
Theorie der Musik. Dabei geht er auch ausführlich auf das musiktheoretische<br />
Werk Vincenzo Galileis (1520–1591), des Vaters <strong>von</strong> Galileo Galilei,<br />
ein.<br />
” Musik“, so Kepler, soll ihm behilflich sein, den Plan der Schöpfung<br />
”<br />
zu erkennen“.<br />
Im fünften Buch der ” Weltharmonik“ bringt Kepler kosmische bzw.<br />
physikalische Harmonien in Zusammenhang mit musikalischen Harmonien.<br />
Dazu betrachtet er im Aphel (sonnenfernster Punkt auf einer<br />
ellipsenförmigen Planetenbahn) und Perihel (sonnennächster Punkt)<br />
die Tagesbögen (Winkel der pro Tag <strong>von</strong> einer gedachten Verbindungslinie<br />
(Fahrstrahl) zwischen Sonne und Planet überstrichen wird) und<br />
stellt fest, daß ihre Verhältnisse harmonischen musikalischen Intervallen<br />
entsprechen. So ergibt sich, mit einem Fehler im Prozentbereich, für<br />
den Saturn ein Verhältnis 4:5 (große Terz), Jupiter 5:6 (kleine Terz), Mars<br />
2:3 (Quinte) usw. Die gefundenen Intervalle bringt Kepler — anders als<br />
Pythagoras durch Saitenlängenverhältnisse — mit an den fünf platonischen<br />
Körpern (Abb. 13) identifizierten geometrischen Proportionen in<br />
Verbindung.<br />
34
Kepler untersucht auch Harmonien <strong>von</strong> zwei, drei Planeten, die im Unterschied<br />
zur Harmonie, erzeugt durch einen Planeten, auch zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt entstehen können, und bringt diese in Zusammenhang<br />
mit ” mehrstimmigem, sogenanntem figuriertem Gesang . . . ,<br />
der eine Erfindung der letzten Jahrhunderte ist . . .“.<br />
Zur möglichen Harmonie aller sechs damals bekannten Planeten sagt<br />
er: ” Wenn es nun eine einzige sechsfache Harmonie oder unter mehreren<br />
eine besonders ausgezeichnete gäbe, so könnte man in dieser zweifellos<br />
die Konstellation bei der Erschaffung der Welt erblicken . . .“<br />
Zur Entstehungsgeschichte der Weltharmonik“ schreibt Kepler (1619):<br />
”<br />
” . . . Als ich vor 24 Jahren auf diese Betrachtungen [geometrisch bedingter<br />
harmonischer Proportionen] verfiel, habe ich zuerst untersucht,<br />
ob die Planetensphären um gleiche Beträge <strong>von</strong>einander abstehen . . .<br />
Schließlich kam ich zu den fünf räumlichen [platonischen] Figuren.<br />
Hier ergab sich eine Zahl der Planetenkörper und eine Größe der<br />
Abstände, die nahezu richtig war . . .<br />
Die Astronomie wurde nun in den vergangenen 20 Jahren vervollkommnet<br />
[durch Beobachtungsdaten Brahes]; aber siehe da, die Abstände<br />
stimmten immer noch nicht mit den [durch die] räumlichen Figuren<br />
[überein], auch zeigten diese keine Ursachen für die in so ungleicher<br />
Weise auf die Planeten verteilten Exzentrizitäten . . .<br />
So kam ich allmählich, insbesondere in den letzten drei Jahren, auf die<br />
Harmonie, indem ich kleine Abweichungen der räumlichen Figuren<br />
duldete. Dazu bestimmte mich einerseits der Gedanke, daß die Harmonien<br />
die Rolle der Form spielten, die die letzte Hand anlegte, die Figuren<br />
dagegen die Rolle der Materie, die in der Welt die Zahl der Planetenkörper<br />
und die rohe Ausdehnung der räumlichen Bereiche ist. Andererseits<br />
lieferten die Harmonien auch die Exzentrizitäten, welche die<br />
räumlichen Figuren nicht einmal in Aussicht stellten. Oder: die Harmonien<br />
gaben der Statue Nase, Augen und die übrigen Glieder, während<br />
die räumlichen Figuren nur die äußere Größe der rohen Masse vorgeschrieben<br />
hatten.“<br />
So war für Kepler die Wahrheit der pythagoräischen Idee der ” himmlischen<br />
Harmonien“ Leitgedanke seiner Forschungen. Dabei versuch-<br />
35
te er seine eigenen Entdeckungen zum Planetengesang durch Umdeutung<br />
des pythagoräischen Begriffs der Sphärenmusik zu stützen. Die<br />
Planetengesetze waren gleichsam Nebenprodukt <strong>von</strong> Keplers Untersuchungen<br />
zur Sphärenmusik.<br />
Sicherlich ist es Kepler nicht leicht gefallen, sich der Überzeugungskraft<br />
der Beobachtungsdaten Brahes zu beugen und für die Planetenbahnen<br />
anstelle <strong>von</strong> Kreisen, der nach seiner und seiner Zeitgenossen<br />
Meinung vollkommensten geometrischen Figur, Ellipsen anzunehmen.<br />
Aber, so Kepler: ” Wenn die errechneten Werte nicht [mit Beobachtungsdaten]<br />
übereinstimmen, war unsere ganze Arbeit vergeblich.“ D.h. über<br />
die Richtigkeit einer Theorie entscheidet, für Kepler, der Vergleich mit<br />
der Beobachtung, mit dem Experiment, auch wenn die experimentellen<br />
Daten mit Autoritätsmeinung, mit jahrtausendealten Dogmen im<br />
Widerspruch stehen.<br />
So sagt Kepler auch: ” Auf die Meinungen der Heiligen über diese<br />
natürlichen Dinge antworte ich mit einem einzigen Wort: In der Theologie<br />
gilt das Gewicht der Autorität, in der Philosophie aber das der<br />
Vernunftsgründe.“<br />
Diese Denkweise und Haltung machten Kepler zu einem der wichtigsten<br />
Begründer der modernen Naturwissenschaften.<br />
Dies sei verdeutlicht durch einen kurzen Blick auf die geistige Situation<br />
der Zeit Keplers und auf deren Vorgeschichte.<br />
Wie Pauli bemerkt, hat Kepler in einer Zeit gelebt, die als ” eine<br />
merkwürdige Zwischenstufe zwischen der früheren magischsymbolischen<br />
und modernen quantitativ-mathematischen Naturbeschreibung<br />
[charakterisiert werden kann]. In [dieser] Zeit . . . ist das<br />
Weltbild noch nicht in ein religiöses und ein wissenschaftliches auseinander<br />
gefallen. [Und so finden sich bei Kepler] religiöse Betrachtungen,<br />
ein beinahe mathematisches Symbol der Trinität, moderne optische<br />
Lehrsätze . . . im selben Buch . . .“<br />
Bis ins späte Mittelalter, ja nahezu bis in Keplers Zeit, hatten die Schriften<br />
der Alten, der Kirchenväter, der Großen der griechischen und römischen<br />
Antike, der Hermetiker, für den mittelalterlichen Gelehrten im<br />
36
allgemeinen höhere Beweiskraft als jegliche sinnliche Erfahrung. Der<br />
Gelehrte des Mittelalters verstand Wissenschaft vornehmlich als Erklärungsversuch<br />
mittels aristotelischer Auffassungen ohne Anspruch<br />
auf eine Beschreibung der Wirklichkeit auf Grund sinnlicher Erfahrung,<br />
war doch nach Aristoteles die Wirklichkeit auch durch reines Denken,<br />
durch Logik, zu erkennen.<br />
Vermittelt durch arabische und jüdische Gelehrte wie Averroes (1126–<br />
1198) und Maimonides (1135–1206) hatte Aristoteles im 12. Jh. wieder<br />
Eingang in das Denken des Abendlandes gefunden und war so zum<br />
zentralen Philosophen der christlichen Scholastik (9.–15. Jh.), der vernunftsmäßigen<br />
Begründung christlichen Glaubens, geworden. Der damals<br />
bedeutendste christliche Aristoteleskommentator war der Dominikaner<br />
Albertus Magnus (1193–1280), einer der Wegbereiter modernen<br />
naturphilosophischen Denkens.<br />
Die Wiederentdeckung Platons für das Abendland im 15. Jh. ist hingegen<br />
byzantinischen Gelehrten zu verdanken. Sie war ganz wesentlich<br />
auch das Verdienst des berühmten Philosophen der Renaissance<br />
Marsilio Ficino (1433–1499), der in lateinischer Sprache den ganzen Platon<br />
herausgab, aber auch das ” Corpus Hermeticum“, ein Konvolut religiös-naturphilosophischer<br />
Traktate der Hermetik, zugeschrieben der<br />
im alten Ägypten angesiedelten Kunstfigur des Hermes Trismegistos<br />
(Abb. 15) — dem legendären Begründer der Alchemie — aber verfaßt<br />
<strong>von</strong> verschiedenen Autoren aus dem Umkreis der Gnosis in den ersten<br />
nachchristlichen Jahrhunderten.<br />
Die Zeit Keplers war auch die hohe Zeit der Alchemie, jener spekulativen<br />
Naturerkenntnis, die erst im 17./18. Jh. sukzessive durch die<br />
moderne Chemie und Pharmakologie abgelöst wurde. Noch Newton,<br />
siebzig Jahre nach Kepler, war hoch engagierter Alchemist, der nicht<br />
weniger Zeit der alchemistischen Labortätigkeit und der hermetischen<br />
Philosophie widmete als seinen mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Forschungen. —<br />
” Der Alchemist“, so C.G. Jung, projiziert seine Empfindungen, Wün-<br />
”<br />
sche und Erwartungen in den beobachteten alchemistischen Prozeß“,<br />
37
der so, auf dem Hintergrund der hermetischen Philosophie, ” zum<br />
überwältigenden Gesamterlebnis, zum Selbstbefreiungsprozeß wird,<br />
zum Erlebnis, in dem sich der Alchemist in Harmonie mit sich selbst<br />
fühlt.“ So schwingen im alchemistischen Prozeß, im hermetischen Denken,<br />
Gefühle und Seele mit, sind hier Seele und Denken nicht getrennt.<br />
Kepler, der, wie auch René Descartes (1596–1650), als einer der ersten<br />
modernen Denker die Grenzlinie erkannt hat zwischen objektiv meßbaren<br />
und mathematisch beweisbaren Fakten einerseits und subjektiven<br />
Ideen und Spekulationen andererseits, äußert sich reserviert bis ablehnend<br />
zur Alchemie und Hermetik, wie folgende Passagen aus dem Anhang<br />
zum fünften Buch der ” Weltharmonik“ zeigen: ” Man sieht, daß er<br />
[der Hermetiker Robert Fludd] seine Hauptfreude an unverständlichen<br />
Rätselbildern <strong>von</strong> der Wirklichkeit hat, während ich darauf ausgehe,<br />
gerade die in Dunkel gehüllten Tatsachen der Natur ins helle Licht der<br />
Erkenntnis zu rücken. Jenes ist Sache der Chymiker, Hermetiker, Parazelsisten,<br />
dieses dagegen Aufgabe der Mathematiker“, und an anderer<br />
Stelle sagt Kepler: ” Ich hasse alle Kabbalisten.“<br />
All dies machte Kepler zu einem der Begründer der modernen Naturwissenschaften.<br />
Aber er war auch noch Kind seiner Zeit, wie folgende<br />
Tatsachen belegen:<br />
Im Zedlerschen Universallexikon (1732–1754) ist über ” Keplerus, (Joann)<br />
einer der vornehmsten Astronomorum . . .“ u.a. zu lesen: ” . . . Viele<br />
seiner Meynungen waren seltsam, sonderlich da er der Sonne, denen<br />
Sternen und Planeten nicht nur ein Leben, sondern auch Seelen zuschrieb<br />
und <strong>von</strong> der Erde vornehmlich behaupten wollte, daß sie durch<br />
Ausblasung der Winde und Dämpfe aus denen Bergen und unterirdischen<br />
Hölen atmete. Indessen war er in der Mathesi sehr geschickt . . .<br />
Als aber Tycho Brahe zu Kayser Rudolpho II. nach Prag kam, schrieb<br />
er an Keplern, und brachte es bey ihm so weit, daß er sich anno 1600<br />
mit seiner gantzen Familie auch dahin wandte . . . [damit er] dem Tycho<br />
Brahe . . . an die Hand [als Assistent] gehen konnte, wie selbiger es<br />
wünschte; wie denn auch Brahe ziemlich geheim gegen ihn war, und<br />
ihm eben nicht alles communicirte . . .<br />
Nach dessen Tode, der anno 1601 erfolgte, bekam Kepler den Titel ei-<br />
38
nes Kayserlichen Mathematici, und machte sich durch seine Schriften<br />
bekannt . . . “ Über den Tod Brahes ist im Zedler zu lesen:<br />
” . . . Im folgenden Jahre [1601] wurde er [Brahe] den 13 Oct. <strong>von</strong> dem<br />
<strong>von</strong> Rosenberg zu einem Gastmahl eingeladen, da er aus Schamhaftigkeit<br />
nicht aufstehen wollte, das Wasser zu lassen, worüber er in eine<br />
Kranckheit fiel, und den 24 Oct. im 55. Jahr seines Alters starb . . .“<br />
Und Kepler notierte: [Brahe hielt] sein Wasser über Gebühr der<br />
”<br />
Höflichkeit zurück.“<br />
Brahe soll an geplatzter Blase gestorben sein.<br />
Wie dem auch sei, besagter <strong>von</strong> Rosenberg war Peter Wok <strong>von</strong> Rosenberg<br />
(1539–1611), der letzte des mächtigen böhmischen Adelsgeschlechts<br />
derer <strong>von</strong> Rosenberg, mit dem Stammsitz in Krumau, mit<br />
einer fünfblättrigen Rose als Familienwappen, auch heute noch in<br />
Südböhmen allgegenwärtig, und offenbar mit Tischsitten, die es ungehörig<br />
erscheinen ließen, während des Essens <strong>von</strong> der Tafel aufzustehen,<br />
um sich zu erleichtern“.<br />
”<br />
” Was dem einen sein Uhl, ist dem anderen sein Nachtigall.“ So war<br />
Brahes Mißgeschick für Kepler Glück im Unglück, denn jetzt erhielt er,<br />
nun als kaiserlicher Mathematiker und Hofastronom Rudolfs II., den<br />
ihm bislang verwehrten ungehinderten Zugang zu Brahes exzellentem<br />
Beobachtungsmaterial, das ihm ein sorgfältiges Studium der Planetenbahnen<br />
ermöglichte und so den Weg zu den Gesetzen der Planetenbewegung<br />
wies.<br />
Ähnlich befremdlich wie Keplers Annahme der Existenz einer Seele<br />
der Gestirne und des Entstehens der Winde durch Atmen der Erde erscheint<br />
uns heute auch Keplers intensive Beschäftigung mit Astrologie<br />
und dem Erstellen <strong>von</strong> Horoskopen. Berühmt sind Keplers Horoskope<br />
für Wallenstein und Kaiser Rudolf II. Für die Nachwelt interessant<br />
sind in diesen weniger die Prophezeiungen, etwa daß Wallenstein im<br />
siebzigsten Jahre an einem viertägigen Fieber sterben werde, sondern<br />
eher die Charakterbilder, die <strong>von</strong> den Bestellern der Horoskope gegeben<br />
werden. So schrieb 1608 Kepler dem damals 25jährigen Wallenstein:<br />
” Gewaltsam er auch sein wird, umbarmherzig, ohne brüderliche<br />
und eheliche Lieb, niemand achtend nur sich und seinen Wollüsten ergeben,<br />
hart über die Untertanen, an sich ziehend, geizig, betrüglich . . .<br />
39
auch streitbar, unverzagt weil Sonne und Mars beisammen, wie wohl<br />
Saturnus die Einbildung verderbt, sodass er oft vergeblich Furcht hat.“<br />
Wallenstein gefiel sein Horoskop und er bewahrte es zeitlebens sorgsam<br />
auf, ja er ließ es 1625 <strong>von</strong> Kepler aktualisieren und machte diesen<br />
1628 zum Hofastronomen in seinem schlesischen Herzogtum Sagan.<br />
Kepler war sich seiner Grenzen als Astrologe durchaus bewußt. So antwortete<br />
er auf Wallensteins Fragen sein Schicksal betreffend: ” Ich antwortte<br />
auf diese und alle dergleichen fragen erstlich haubtsächlich wie<br />
bißhero: Welcher Mensch gelehrt, oder ungelehrt, Astrologus oder Philosophus<br />
in erörtterung dieser fragen die augen <strong>von</strong> des Gebornen eignen<br />
WillChur abwendet, oder sonsten <strong>von</strong> seinem Verhalten und Qualiteten<br />
gegen den Politischen Umbständen betrachtet, und will diß alles<br />
bloß allein aus dem Himel haben, es sey gleich jezo Zwangs oder nur<br />
Inclinations und Naigung weiß, der ist wahrlich nie recht in die Schul<br />
gegangen, und hat das Licht der Vernunft, daß ihme Gott angezündt,<br />
noch nie recht gepuzet; [und] wann er der Sachen nur mit Vleiß nachsinnet,<br />
würdt er befinden, das diese fragen baides zu erörttern, und<br />
auch fürzulegen eine rechte unsinnige weiß seyen. Ich meins theills sage<br />
Gott danckh, das ich die Astrologiam so vill gestudirt, das ich nunmehr<br />
<strong>von</strong> diesen Fantaseyen welche in der Astrologorum Bücher heuffig<br />
zueffinden gesichert bin.“<br />
Kurz gesagt, Kepler war der Ansicht, daß man vergeblich ” ein Glück<br />
<strong>von</strong> oben herab wünsche“, für das im Charakter keine ” Anleitung“ vorhanden<br />
ist.<br />
Für Kepler bot das Erstellen <strong>von</strong> Horoskopen eine willkommene<br />
zusätzliche Einnahmequelle, denn, zwar stand er in des Kaisers<br />
Diensten, sein Gehalt bekam er jedoch nur recht unregelmäßig gezahlt.<br />
Zeitlebens hatte Kepler nicht nur finanzielle sondern auch arge familiäre<br />
Sorgen, so überlebten <strong>von</strong> seinen 11 Kindern, aus zwei Ehen, nur<br />
fünf ihre Kindheit. Auch war die Zeit, in der er lebte, alles andere als<br />
günstig für eine ungestörte wissenschaftliche Tätigkeit. Es war die Zeit<br />
der Gegenreformation und des Beginns des Dreißigjährigen Krieges.<br />
Dreimal wurde er, der überzeugte und unangepaßte Protestant, aus religiösen<br />
bzw. politischen Gründen <strong>von</strong> den Orten seines Lebens und<br />
40
Wirkens — Graz, Prag und Linz — vertrieben.<br />
Doch all die Widrigkeiten der äußerlichen Lebensumstände konnten<br />
seine wissenschaftliche Schaffenskraft nicht brechen, dank seiner seelischen<br />
und charakterlichen Konstitution, die er in einem ” Selbsthoroskop“,<br />
erstellt im Alter <strong>von</strong> 26 Jahren, wie folgt beschreibt:<br />
” Dieser Mensch hat in jeder Hinsicht Hundenatur. Er ist wie ein<br />
verwöhntes, gezähmtes Hündchen.<br />
1.) Der Körper ist beweglich, dürr, wohlproportioniert. Er freut sich,<br />
an Knochen und harten Brotkrusten zu nagen, er ist gefräßig . . . Er ist<br />
sogar mit dem Geringsten zufrieden.<br />
2.) Auch der Charakter ist sehr ähnlich. Zunächst schmeichelt er sich<br />
ständig bei den Vorgesetzten ein, er hängt in allem <strong>von</strong> anderen ab,<br />
er dient ihnen, er zürnt ihnen nicht, wenn er getadelt wird, er versucht<br />
auf jede Weise sich auszusöhnen . . . Er ist ungeduldig im Gespräch und<br />
grüßt die, die häufig ins Haus kommen, nicht anders als ein Hund. Sobald<br />
ihm jemand das Geringste entreißt, knurrt er, wird heiß, wie ein<br />
Hund . . .“<br />
Und in einem vom 25jährigen Kepler erstellten umfangreichen Familienhoroskop<br />
heißt es: ” Über die Geburt Johannes Keplers. Ich bin der<br />
Frage meiner Zeugung nachgegangen, die im Jahre 1571 am 16. Mai,<br />
morgens 4.37 erfolgte. Meine Schwächlichkeit bei der Geburt widerlegt<br />
den Verdacht, meine Mutter sei bei ihrer Verheiratung, die am 15.<br />
Mai stattfand, bereits schwanger gewesen. . . Ich kam also vorzeitig zur<br />
Welt, mit zweiunddreißig Wochen, nach 224 Tagen, zehn Stunden . . .“<br />
Und noch etwas zu Kepler: Kurz vor Vollendung der ” Weltharmonik“<br />
(1619) hatte das ” Heilige Offizium“ in Rom, das oberste Inquisitionsgericht,<br />
die Verbreitung der kopernikanischen Lehre verboten (1616), was<br />
Kepler befürchten ließ, daß dadurch der Verkauf seines neuen Werkes<br />
in Italien auf arge Schwierigkeiten stoßen würde. Aber ein italienischer<br />
Bekannter beruhigte ihn mit den Worten: ” Bücher <strong>von</strong> hervorragenden<br />
deutschen Verfassern werden, auch wenn sie verboten sind, in Italien<br />
heimlich verkauft und um so eifriger gelesen.“<br />
41
Dieses Verboten-und-um-so-eifriger-Gelesen läßt in meiner Seele“ Er-<br />
”<br />
innerungen aufleuchten“, Erinnerungen an eine Zeit, da mein gelieb-<br />
”<br />
tes Klavier noch den Firmennamen Schiller“ (ehemalige ostberliner<br />
”<br />
Firma) trug, und nicht wie jetzt Bechstein“, ausgerüstet mit einem<br />
”<br />
elektronischen Zusatz <strong>von</strong> Yamaha“, einem Kleinod zur Beförderung<br />
”<br />
der Liaison <strong>von</strong> Physik und Musik, das mir jetzt das Spiel auch zu<br />
später Stunde erlaubt, ohne Störung der nächtlichen Ruhe anderer —<br />
Erinnerungen an eine Zeit, da ich gebunden war an ein Weltsystem, das<br />
sich fest gefügt und ewig wähnte durch die Gemeinschaft der Interes-<br />
”<br />
sen und Ziele und die gemeinsame Ideologie . . .“, — an eine Zeit, da anderenorts<br />
die Political correctness“ noch nicht erfunden war als Stütz-<br />
”<br />
korsett für die Musica humana“, wohl aber hierzulande jeder wußte,<br />
”<br />
daß politisch korrekt sein heißt, an den Sieg des Sozialismus zu glauben,<br />
zumindest so zu tun, als ob man glaubte, jedenfalls Zweifel, ob<br />
” eingeborene“ oder erworbene, für sich zu behalten, es sei denn, man<br />
hatte keinerlei berufliche Ambitionen.<br />
In dieser Zeit war für mich und andere am Sieg des Sozialismus Zweifelnde<br />
das Buch des gewichtigen Experten des Westens für die Ideologie<br />
des Ostens, des Jesuiten und Professors an einem Institut des Vatikans<br />
in Rom, Gustav A. Wetter, ” Sowjetideologie heute — Dialektischer<br />
und historischer Materialismus“, in einschlägigen Kreisen ” konspirativ“<br />
<strong>von</strong> Hand zu Hand gereicht, ein Buch der Erbauung, — wurde<br />
doch in ihm die staatstragende ” wissenschaftliche Weltanschauung“<br />
einer scharfsinnigen Kritik unterzogen, wurde z.B. gezeigt, daß der leninsche<br />
Materiebegriff, das Fundament der ganzen Ideologie, eine Tautologie<br />
ist, definiert er doch die Materie in Bezug auf das Bewußtsein,<br />
das Bewußtsein aber in Bezug auf die Materie.<br />
Das Buch Wetters war hervorragend für die Vorbereitungen auf<br />
Prüfungen über Marxismus und Leninismus geeignet, so auf Prüfungen<br />
im Rahmen des Promotions- und Habilitationsgeschehens, vermittelte<br />
es doch dem Prüfling Wissen, das diesem dem Prüfenden gegenüber<br />
das Gefühl der Überlegenheit verlieh, nur mußte er, um den<br />
Ausgang der Prüfung und damit seinen beruflichen Werdegang nicht<br />
zu gefährden, die Wahrheit wohlweislich für sich behalten, den Prüfenden<br />
in Unwissenheit belassen. Aber vielleicht kannten ja beide, Prüfling<br />
42
und Prüfer, die Wahrheit, zogen es aber vor, ganz im Sinne späterer Gedanken<br />
Rortys (Richard Rorty: ” Wahrheit und Fortschritt“, Suhrkamp,<br />
2000), der Zweckmäßigkeit den Vortritt vor der Wahrheit zu lassen.<br />
Wie auch immer, Gustav A. Wetter, und damit auch der Vatikan, haben<br />
mir geholfen ” meine Straßen zu bauen“ und so hier und heute meine<br />
Abschiedsvorlesung halten zu können.<br />
Doch zurück zu Kepler und dem Heiligen Offizium.<br />
Keplers ” Weltharmonik“ wurde, wider Erwarten, nicht vom Heiligen<br />
Offizium auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt, wohl aber<br />
sein Lehrbuch ” Grundriß der kopernikanischen Astronomie ( ” Epitome<br />
astronomiae copernicanae“ (1618–1621)).<br />
Weitaus größeren Ärger als Kepler hatte mit dem Heiligen Offizium<br />
sein berühmter Zeitgenosse Galileo Galilei (1564–1642) (Abb. 16), der,<br />
wie ein Briefwechsel mit Kepler aus dem Jahre 1597 belegt, schon früh<br />
mit dem kopernikanischen System sympathisierte, was er jedoch lange<br />
nicht publik machte. Seine kopernikusfreundliche Haltung war jedoch<br />
ein offenes Geheimnis.<br />
Ausgelöst wurde Galileis Konflikt mit der Katholischen Kirche im Jahre<br />
1613 durch einen Brief an seinen Schüler, den Benediktiner Benedetto<br />
Castelli, in dem Galilei seine Vorstellungen über das Verhältnis<br />
der Bibel zum heliozentrischen System schilderte und die Neuinterpretation<br />
der Heiligen Schrift forderte. Im Jahre 1616 wurde Galilei <strong>von</strong><br />
der Katholischen Kirche ermahnt, die kopernikanische Lehre in keiner<br />
Weise zu verteidigen, und 1633 wurde er, der Rückfällige, <strong>von</strong> selbiger<br />
schließlich offiziell verurteilt und unter lebenslangen Hausarrest<br />
gestellt.<br />
Zum Verhängnis wurde Galilei, in seiner Auseinandersetzung mit der<br />
Katholischen Kirche, wohl weniger seine kopernikanische Weltsicht, als<br />
vielmehr der Verdacht, Anhänger der Hermetik in Nachfolge Giordano<br />
Brunos (1548–1600) zu sein, der angeklagt und schließlich verbrannt<br />
worden war, weil er in der Hermetik die ” vormalige, wahre Philosophie“<br />
gesehen hatte. Die Hermetik wurde <strong>von</strong> der Katholischen Kirche<br />
43
als gefährlich eingestuft, da sie Gotteserkenntnis durch eigene Anstrengung<br />
lehrte, zu eigenständigem Denken und Handeln ermutigte, Doktrinen<br />
und Dogmen ablehnte.<br />
Unter den Anhängern der Hermetik finden sich neben Bruno und Galilei<br />
auch Paracelsus, Newton, Leibniz, Goethe, Schelling, Novalis . . .<br />
Des Paracelsus (1493–1541) Motto: ” Sei keinem anderen Knecht, wenn<br />
Du Dein eigener Herr sein kannst“, läßt erahnen, daß die Kirche in der<br />
Hermetik den Kein der Aufmüpfigkeit gegen Autorität und Dogmen<br />
witterte und entsprechend allergisch reagierte.<br />
Aber wer sich noch der Zeit der ” Diktatur des Proletariats“ erinnert,<br />
sich erinnert der Furcht derer Protagonisten vor Häresien (Trotzkismus,<br />
Maoismus, Eurokommunismus, demokratischer Sozialismus . . . ) und<br />
häretischem Gedankengut (Revisionismus: ” . . . bürgerliche Ideologie<br />
. . . , die darauf gerichtet ist, den revolutionären Geist des Marxismus-<br />
Leninismus . . . zu untergraben“), kann der Katholischen Kirche seinerzeitige<br />
Ängste vor hermetischer Philosophie leicht nachempfinden,<br />
aber auch die Tatsache verstehen, daß Galileis Abschwören der kopernikanischen<br />
Lehre und sein der Kirche versprochenes Wohlverhalten<br />
ihn vor dem Scheiterhaufen bewahren konnten, geht es autoritären Regimen<br />
doch vorrangig um strikte Befolgung <strong>von</strong> verordneten Verhaltensnormen<br />
und weniger um das, was im Kopfe des Einzelnen vor sich<br />
geht, vorausgesetzt, dieser behält seine Gedanken für sich.<br />
Physik und Musik<br />
In seiner bekannten Typologie musikalischen Hörens unterteilt Theodor<br />
W. Adorno (1962) die Hörer in Gruppen unterschiedlichen Musikverständnisses,<br />
vom musikalisch-naiven emotionalen Hörer“, für<br />
”<br />
den die Musik Mittel zum Zweck seiner Triebökonomie“ ist, über den<br />
”<br />
” Bildungskonsumenten“ und guten Zuhörer“ bis hin zum des struk-<br />
”<br />
turellen Hörens fähigen Experten“, der dem Verlauf auch verwickelter<br />
”<br />
Musik spontan zu folgen und das Gehörte hinsichtlich Harmonik, Vielstimmigkeit<br />
und Sinnzusammenhang sofort zu durchschauen vermag.<br />
Ob es dem adornoschen Experten“ auch wirklich gelingt, jedwe-<br />
”<br />
44
des Werk, insbesondere der kompositorischen Avantgarde, spontan<br />
zu durchschauen, sei dahingestellt, macht doch beispielsweise Iannis<br />
Xenakis (1922–2001) in seinen Kompositionen auch <strong>von</strong> mathematischen,<br />
geometrischen, architektonischen und philosophischen Prinzipien<br />
Gebrauch, wobei selbst Elemente der Wahrscheinlichkeitsrechnung,<br />
mathematischen Spieltheorie, Chaostheorie, Mengentheorie, Boolschen<br />
Algebra etc. Verwendung finden.<br />
Aber wer nun beim Lesen <strong>von</strong> Adornos musiksoziologischer Studie<br />
sich in einer der Gruppen geringeren musikalischen Sachverstandes<br />
wiederfindet — z.B. in der Gruppe des ” Bildungskonsumenten“, der<br />
nach Adorno vornehmlich viel über Äußerlichkeiten des Musikgeschehens<br />
weiß und mit geschmacklicher Willkür urteilt — und jetzt<br />
den Ehrgeiz entwickelt, durch fleißiges Studieren in die nächst höhere<br />
Gruppe zu gelangen — im betrachteten Falle in die Gruppe des ” guten<br />
Zuhörers“, der ” Musik etwa so versteht, wie wenn man die eigene<br />
Sprache versteht, auch wenn man <strong>von</strong> ihrer Grammatik und Syntax<br />
nichts oder nur wenig weiß“ — dem würde ich als ersten Schritt<br />
empfehlen, zu einem elementaren Physikbuch zu greifen, z.B. zum ” Taschenbuch<br />
der Physik“ <strong>von</strong> H. Kuchling, mittlerweile in 17. Auflage<br />
erschienen, und dort das Kapitel ” Akustik“ zu lesen (Abb. 17).<br />
Hier findet er Nützliches über Schallerzeugung (schwingende Saite,<br />
Grundton, Obertöne, Klang, Klangfarbe. . . ), Schallwellen, Schallausbreitung<br />
. . . , aber auch über Tonleitern und Intervalle (diatonische Tonleiter,<br />
chromatische Tonleiter, gleichmäßig temperierte Tonleiter, konsonante<br />
und dissonante Intervalle . . . ).<br />
Doch zunächst einige Anmerkungen zur Geschichte der Akustik:<br />
Wie schon erwähnt, Pythagoras (um 570 bis 480 v. Chr.) war der erste<br />
Forscher“ auf akustischem Gebiet. Er fand, durch Untersuchungen<br />
”<br />
am Monochord, daß konsonante Intervalle durch ganzzahlige Proportionen<br />
der Saitenlänge bestimmt werden: Oktave 1:2, Quinte 2:3, Quarte<br />
3:4. Jedoch anders als <strong>von</strong> Pythagoras angenommen, gelten diese<br />
Proportionen nicht, wenn der Zusammenhang zwischen konsonanten<br />
Intervallen und Proportionen der Saitenspannung und des Saitenquerschnitts<br />
betrachtet wird, wie Galilei in seinen Discorsi“ (1638) bemerkt:<br />
”<br />
” . . . Behalten wir . . . dieselbe Länge und Dicke [der Saite] bei und<br />
45
möchten wir sie zum Aufstieg in die Oktave durch vermehrte Spannung<br />
bringen, dann genügt es nicht, sie um das Doppelte zu spannen,<br />
sondern es bedarf des Vierfachen.“<br />
Den Beitrag des Aristoteles-Schülers Aristoxenos (um 350 v. Chr.) zur<br />
Akustik bzw. Musiktheorie beschreibt Xenakis wie folgt: ” Aristoxenos<br />
entwickelt in der Theorie eine vollständige gleichtemperierte chromatische<br />
Tonleiter mit dem zwölften Ton als Modulus [d. h. er unterteilt die<br />
Oktave in zwölf gleiche Teile]. Parallel dazu wird die Arbeit an der multiplikativen<br />
(geometrischen) Sprache der Saitenlänge fortgesetzt, was<br />
de facto eine Umsetzung der additiven Tonhöhensprache bedeutet [Anmerkung:<br />
Die Tonhöhenempfindung entspricht dem Logarithmus der<br />
Frequenz]. Daher deklariert die Musiktheorie die Entdeckung des isomorphen<br />
Verhältnisses zwischen Logarithmus (musikalische Intervalle)<br />
und der Exponentialfunktion (Saitenlänge) mehr als 15 Jahrhunderte<br />
vor der Mathematik; noch dazu wird eine Vorahnung der Gruppentheorie<br />
<strong>von</strong> Aristoxenos ausgesprochen.“<br />
Anmerkung: In der Neuzeit wurde die Aufteilung der Oktave in zwölf<br />
gleiche Teile — d.h. ein Halbtonintervall mit dem Frequenzverhältnis<br />
zwölfte Wurzel aus 2 (vgl. Abb. 17) — <strong>von</strong> dem Mathematiker und Ingenieur<br />
Simon Stevin (1548–1620) vorgeschlagen.<br />
Doch noch einmal kurz zurück zur Antike. Bereits in der Antike wurde<br />
der Wellencharakter des Schalls vermutet, so <strong>von</strong> dem griechischen<br />
Philosophen Chrysippos (um 240 v. Chr. ) und dem römischen Architekten<br />
und Ingenieur Vitruv (1. Jh. v. Chr.).<br />
Chrysippos erkannte die Analogie zwischen Wellen auf einer Wasseroberfläche<br />
und der Schallausbreitung. Damit erfaßte er bereits die Ausbreitung<br />
des Schalls als Phänomen räumlich und zeitlich oszillierender<br />
Dichteschwankungen ohne Materietransport. Vitruv diskutierte Schall<br />
in Amphitheatern, insbesondere in Hinblick auf Nachhall und Reflexion.<br />
Die Geschichte der modernen Akustik begann am Anfang des 17. Jahrhunderts.<br />
Die hörbaren Töne sowie ihre Intervalle und Konsonanzen<br />
46
wurden jetzt nicht mehr durch Längenverhältnisse (<strong>von</strong> Saiten), sondern<br />
durch Frequenzen (Oszillationen pro Sekunde), d.h. ein zeitliches<br />
Maß, erklärt. Die absoluten Frequenzen hörbarer Töne konnten gemessen<br />
werden. Es konnte experimentell gezeigt werden, daß ein vibrierender,<br />
einen Ton erzeugender Körper die umliegende Luft zu einer<br />
oszillatorischen Bewegung der gleichen Frequenz anregt. Und es konnte<br />
gezeigt werden, daß die Klangfarbe eines musikalischen Tones bzw.<br />
Klanges durch den Spektralgehalt des schallerzeugenden Ereignisses,<br />
d.h. durch den Beitrag der Obertöne, bestimmt wird.<br />
Einen Höhepunkt fand die Entwicklung der Akustik mit Hermann <strong>von</strong><br />
Helmholtz (1821–1894) und seinem berühmten Werk ” Die Lehre <strong>von</strong><br />
den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie<br />
der Musik“ (1863), in dem u.a. die Obertonstruktur des Klanges analysiert<br />
und gezeigt wird, daß das Gehör wie ein Fourieranalysator arbeitet,<br />
d.h. wie ein Instrument, das die spektrale Zerlegung des Klanges<br />
vornimmt.<br />
Noch einige Fakten aus der neuzeitlichen Geschichte der Akustik: Marin<br />
Mersenne (1588–1648): Messung der Schallgeschwindigkeit, Quantifizierung<br />
der Tonhöhe als Frequenz, Frequenz einer schwingenden<br />
Saite in Abhängigkeit <strong>von</strong> Länge, Spannung, Durchmesser; ” Erahnen“<br />
der Obertöne einer schwingenden Saite; Robert Hooke (1635–<br />
1703): Tonerzeugung und Tonfrequenzmessung mittels rotierender<br />
Zahnräder; Christian Huygens (1629–1695): Schall als Wellenphänomen<br />
gedeutet; Formulierung des Prinzips der Sekundärwellen; Anwendung<br />
<strong>von</strong> Logarithmen auf musikalische Intervallberechnung; Robert<br />
Boyle (1627–1691): Nachweis, daß Schall Luft zur Fortpflanzung<br />
braucht (Wecker im Vakuum); Joseph Sauveur (1653–1716): Untersuchung<br />
der Obertöne einer schwingenden Saite, Anstoß zum Superpositionsprinzip;<br />
Isaac Newton (1643–1727): Berechnung der Schallgeschwindigkeit,<br />
jedoch unter der Annahme isothermer Prozesse, anstatt,<br />
wie korrekt, adiabatischer; Leonhard Euler (1707–1783): Beschreibung<br />
der Klangentstehung (Grundschwingung mit Obertönen) in Pfeifen,<br />
Aufstellung der Wellengleichung für Schall; Jean-Baptist d’Alembert<br />
(1717–1783) und Joseph Louis Lagrange (1736–1813): Weiterentwicklung<br />
der theoretischen Beschreibung der Wellenausbreitung; Ernst Flo-<br />
47
ens Friedrich Chladni (1756–1827): Schwingungsformen <strong>von</strong> Platten;<br />
Jean Baptiste Joseph Fourier (1768–1830): ” Fourieranalyse“, d.h. Darstellung<br />
der Schwingungsform eines beliebigen Klanges als Superposition<br />
<strong>von</strong> Beiträgen <strong>von</strong> Grundton und Obertönen.<br />
Dieser kurze Abriß der Frühgeschichte der Akustik enthält viele klangvolle<br />
Namen, was die Tatsache widerspiegelt, daß die Akustik, insbesondere<br />
die Untersuchung des Schwingungsverhaltens einer Saite,<br />
Wegbereiter der neuzeitlichen Physik war — Paradigma war für eine<br />
auf sorgfältig durchdachten Experimenten beruhenden quantitativmathematischen<br />
Naturbeschreibung, einer Naturbeschreibung auf der<br />
Erde, analog zu der im Bereiche der Astronomie durch Brahe und Kepler.<br />
Gelegentlich spricht man gar <strong>von</strong> einer gemeinsamen Geschichte<br />
<strong>von</strong> Physik und Musik bzw. da<strong>von</strong>, daß die Musik das ursprüngliche<br />
mathematische Modell für die Physik bzw. die Naturwissenschaften<br />
war. Ausdruck findet die ” Verzahnung“ <strong>von</strong> Physik und Musik auch<br />
in musiktheoretischen Untersuchungen und Schriften — vornehmlich<br />
zur Harmonik und musikalischen Temperatur — <strong>von</strong> Kepler, Descartes,<br />
Newton, Leibniz, Euler, d’Alembert . . . , aber auch in dem Wirken<br />
<strong>von</strong> Vincenzo Galilei und dessen Sohn Galileo.<br />
Vincenzo Galilei (1520–1591) war, wie schon gesagt, Musiktheoretiker<br />
und Lautenspieler, Schüler des bedeutenden Musiktheoretikers und<br />
Komponisten <strong>von</strong> Madrigalen Gioseffo Zarlino (1517–1590), der als erster<br />
das Wesen der konsonanten Harmonie (Dur- und Moll-Akkord) definierte,<br />
die dann über Jahrhunderte, bis zu Wagner und Schönberg, die<br />
abendländische Musik in mehr oder weniger starkem Maße beherrschte,<br />
und die insbesondere Mehrstimmigkeit ermöglichte.<br />
Vincenzo Galilei liebte jedoch nicht die Mehrstimmigkeit, die Polyphonie.<br />
Sie erschien ihm zu kompliziert, zu schwülstig. Und so wandte er<br />
sich ab <strong>von</strong> Zarlino, insbesondere ab <strong>von</strong> der temperierten Stimmung,<br />
und widmete sich der antiken bzw. pythagoräischen Monodie (Einzelgesang<br />
mit sparsamer Instrumentalbegleitung) und experimentierte<br />
mit dem Monochord, ganz wie seinerzeit Pythagoras.<br />
Vincenzo Galileis Streben nach Einfachheit und Durchschaubarkeit —<br />
48
ei der musiktheoretischen Fragestellung, bei dem Experimentieren<br />
mit dem Monochord, bei der theoretischen Beschreibung der Befunde<br />
— ist offenbar <strong>von</strong> seinem Sohn Galileo tief verinnerlicht worden,<br />
und ließ diesen — des Vaters Prinzip der Vereinfachung und Reproduzierbarkeit<br />
auf das zu untersuchende physikalische Phänomen, z.B.<br />
die Rollbewegung auf der schiefen Ebene oder die Pendelbewegung,<br />
übertragend — zum ” Erfinder“ des physikalischen Experiments und —<br />
in seinem Bestreben die experimentellen Befunde auch quantitativmathematisch<br />
zu erfassen — auch zum ersten Theoretischen Physiker<br />
werden.<br />
Und so gilt heute Galileo Galilei, neben Newton, als Vater des modernen,<br />
auf einem abstrahierenden Idealisierungsprozeß beruhenden,<br />
physikalischen Denkens, eines Denkens, dessen Wurzeln bis in die Antike<br />
zurückreichen, bis zu Platon — nach dem die durch reines Denken<br />
sich erschließenden Ideen das Reich der wahren Wirklichkeit bilden,<br />
wohingegen die Welt der wahrnehmbaren Dinge nur ein unvollständiges<br />
Abbild des ewigen Reichs der Ideen ist. So gesehen ist Platon gewissermaßen<br />
der Großvater des modernen physikalischen Denkens.<br />
Nach Platon ist Wissenschaft auch praktisch nützlich, und zwar um<br />
sich in der sinnlichen Welt besser zurechtfinden, nicht um dort etwas<br />
bewirken zu können.<br />
Eine originelle Verbindung <strong>von</strong> Physik und Musik wird <strong>von</strong> Galileo<br />
Galilei berichtet. Für seine Experimente zur Mechanik hätte er eigentlich<br />
eine mechanische Präzisionsuhr benötigt. Aber solche Uhren gab es<br />
noch nicht zu seiner Zeit. Und so mußte er sich — in Analogie zur Messung<br />
<strong>von</strong> Intervallverhältnissen am Monochord — mit der Messung<br />
<strong>von</strong> Zeitverhältnissen begnügen, mit Hilfe <strong>von</strong> Wasseruhren, oder auch<br />
durch Zählen des Puls- bzw. Herzschlags, sowie durch Singen eines<br />
Liedes, gegebenenfalls eines Psalms, wie früher üblich in den Klöstern.<br />
Nicht uninteressant ist Newtons Verhältnis zur Musik. An der Aufführung<br />
<strong>von</strong> Musik hatte Newton (Abb. 18) offenbar wenig Interesse, wohl<br />
aber beschäftigte er sich intensiv mit Musiktheorie, insbesondere mit<br />
der diatonischen Tonleiter mit sieben Tönen und der chromatischen<br />
49
Tonleiter mit zwölf Tönen, und hier besonders mit der musikalischen<br />
Temperatur, erkannte er doch diese als wichtig für die musikalische<br />
Praxis. Die sieben Töne der Notenskala fanden als sieben Spektralfarben<br />
auch ihren Widerhall in Newtons Theorie des weißen Lichtes.<br />
Aber, wie schon gesagt, für reale Musik hatte Newton wenig Sinn. So<br />
war er in der Oper nur ein einziges Mal. Hier ” hörte er den ersten Akt<br />
mit Vergnügen, der zweite strapazierte bereits seine Geduld, und beim<br />
dritten lief er weg.“ Auch ” hörte Newton Händel spielen, fand aber<br />
außer der Gelenkigkeit <strong>von</strong> dessen Fingern nichts bemerkenswert.“<br />
Reichlich befremdlich ist Newtons Behauptung, daß Pythagoras’<br />
Sphärenmusik eine versteckte Darstellung des <strong>von</strong> ihm, Newton, entdeckten<br />
quadratischen Gesetzes der gravitativen Anziehung enthalte.<br />
Mit Blick auf Pythagoras’ Untersuchungen mit dem Monochord, führte<br />
Newton zur Begründung seiner Behauptung an, daß eine gespannte<br />
Saite denselben Ton erzeugt, wenn bei Verlängerung der Saite um einen<br />
beliebigen Faktor gleichzeitig die Spannung der Saite um das Quadrat<br />
eben dieses Faktors erhöht wird. Aber, wie schon erwähnt, war nach<br />
Galileo Galilei dieser Zusammenhang Pythagoras noch unbekannt. Er<br />
war erst durch die beiden Galileis und Mersenne entdeckt worden.<br />
Die genannte Behauptung ist jedoch Ausdruck der festen Überzeugung<br />
Newtons, daß praktisch all seine Entdeckungen den Alten (Pythagoras,<br />
Aristoteles, Platon, . . . ) schon bekannt gewesen seien. Diese hätten ihre<br />
Befunde jedoch in symbolischen Darstellungen verschlüsselt, so wie<br />
das Gravitationsgesetz im Bilde <strong>von</strong> der Sphärenharmonie, damit sie<br />
dem Pöbel vorenthalten blieben. Das Verderbnis, der Niedergang der<br />
Wissenschaft, setzte — so Newton — jedoch ein, als solche Symbole<br />
fehlgedeutet bzw. nicht mehr verstanden wurden.<br />
Newton war der Auffassung, daß auch das heliozentrische Weltbild<br />
den Alten schon vertraut gewesen sei: Es fand seinen symbolischen<br />
Ausdruck in den vestalischen Tempelzeremonien, wo ein zentrales Feuer<br />
die Sonne im Zentrum darstellte. Das gleiche Symbol fand sich in der<br />
jüdischen Stiftshütte, in der ein zentrales Feuer <strong>von</strong> sieben Lampen, die<br />
die sieben Planeten symbolisierten, umgeben war. Die sieben Töne der<br />
diatonischen Tonleiter und die <strong>von</strong> Newton postulierten sieben Farben<br />
des Spektrums des weißen Lichtes hatten denselben zahlenmystischen<br />
50
Bezug.<br />
Nach Newtons Meinung hatte sich die Weisheit der Alten in den alchemistischen<br />
Schriften der hermetischen Tradition am reinsten erhalten.<br />
Allerdings galt es noch diese ” Prisca sapientia“ (uralte Weisheit) durch<br />
sorgfältiges Studium des einschlägigen Schrifttums und durch Anwendung<br />
der Mittel der modernen experimentellen Wissenschaften zu dechiffrieren.<br />
Newtons alchemistisches Denken war stark mitgeprägt worden durch<br />
die Schriften des bekannten Arztes und Alchemisten Michael Maier<br />
(1569–1622), der übrigens in den Jahren 1608–1610 Leibarzt Rudolfs II.,<br />
eines großen Liebhabers der Alchemie, war, zu einer Zeit, da auch Kepler<br />
am Hofe Rudolfs II. in Prag weilte. Maier vertrat die, später <strong>von</strong><br />
Newton geteilte, Ansicht, daß die Mythen der Antike in Wahrheit allegorisch<br />
verschlüsseltes naturkundliches Geheimwissen einer ” Prisca<br />
sapientia“ seien. Neun der zahlreichen alchemistischen Schriften Maiers<br />
befanden sich in Newtons Nachlaß. Berühmt ist Maiers Fugensammlung<br />
” Atlanta fugiens“ (1618) (Abb. 19, 20), in der er zugleich hermetische<br />
Symbolik und Philosophie musikalisch verarbeitet. Erwähnt<br />
sei, daß Maier in <strong>Magdeburg</strong> gestorben ist, wo er auch seine beiden letzten<br />
Lebensjahre verbracht hat.<br />
Newton trennte sorgfältig private Beschäftigung und öffentliche Lehre.<br />
Sein Interesse an der Alchemie verbarg er vor der Öffentlichkeit. So hat<br />
er auch keine Arbeiten zur Alchemie publiziert. Er hat aber eine Vielzahl<br />
<strong>von</strong> Manuskripten zur Alchemie der Nachwelt hinterlassen, die<br />
seine späteren Nachfahren im Jahre 1936 in einer Auktion bei Sotheby’s<br />
in London versteigern ließen, und <strong>von</strong> denen fast die Hälfte (121<br />
Manuskripte) <strong>von</strong> John Maynard Keynes (1883–1946), dem bekannten<br />
englischen Nationalökonomen und großen Büchersammler, erworben<br />
und anschließend dem King’s College in Cambridge geschenkt wurde,<br />
und die seitdem der Forschung zugänglich sind.<br />
Nach Pauli war ” Newton mit dem ganzen Komplex alchemistischer<br />
Schriften wahrscheinlich besser vertraut als irgend jemand vor ihm . . .<br />
und nach ihm . . .“<br />
51
Newton fand die Behauptung der Alchemisten glaubhaft, daß ihre<br />
Symbolik eine fundamentale Wahrheit verberge. Er war überzeugt,<br />
daß sich aus den überlieferten alchemistischen Texten ein zusammenhängendes<br />
Begriffssystem herleiten ließe, <strong>von</strong> dem er sich eine<br />
Entschlüsselung der Sprache der Alchemisten versprach und sich so<br />
den Zugang in die Reihen der in die Geheimnisse der Alchemie Eingeweihten<br />
erhoffte. Zu diesem Zwecke erstellte er u.a. Lexika und<br />
Wörterbücher zur Alchemie, u.a. eines mit mehr als 5000 Seitenverweisen<br />
unter fast 900 Stichwörtern. Auch exzerpierte er oder schrieb<br />
gar wortwörtlich ab, oft mehrfach, ihm wichtig erscheinende Werke<br />
der Alchemie, stets besorgt, daß durch Nichtbeachtung eines Details<br />
ihm eine wichtige Information verborgen bleiben bzw. entgehen könnte<br />
(Abb. 21).<br />
Über Newtons Beweggründe für eine extensive Beschäftigung mit Alchemie<br />
wird unter Wissenschaftshistorikern noch gerätselt. Vielleicht<br />
erhoffte Newton sich <strong>von</strong> der Alchemie neue Einblicke in Struktur<br />
und Wesen der Materie, insbesondere in das Geheimnis der lebenden<br />
Materie, vielleicht strebte er eine Synthese <strong>von</strong> okkult-alchemistischer<br />
und exakt-naturwissenschaftlicher Forschung an, oder er wollte wirklich<br />
den Stein der Weisen finden, um Macht und Einfluß zu gewinnen,<br />
Ebenbürtigkeit mit den adlig Geborenen. Wie dem auch sei, die Verbindung<br />
<strong>von</strong> exakter Wissenschaft und magischen Denkformen entsprach<br />
noch dem Geist des 17. Jahrhunderts, auch wenn diese Geisteshaltung<br />
bei Newton zu finden, aus heutiger Sicht, verwundern mag.<br />
Gerätselt wird in einschlägigen Fachkreisen auch über Ursache und<br />
Folgen einer gewissen mentalen Labilität, unter der Newton offenbar<br />
zeitlebens litt, mal mehr, mal weniger stark, so insbesondere im Jahre<br />
1693, in seinem 51. Lebensjahr, als er eine Art geistigen Zusammenbruch<br />
erlitt und John Locke (1632–1704), der große Philosoph, eines Tages<br />
<strong>von</strong> Newton einen Brief folgenden Inhalts erhielt: ” Sir, in der Meinung,<br />
daß Sie bemüht waren, mich mit Frauen und anderen Methoden<br />
zu verwirren, war ich dermaßen betroffen, daß ich, als man mir erzählte,<br />
Sie seien kränklich und würden nicht mehr lange leben, antwortete,<br />
besser wäre es, Sie seien tot. Es ist nun mein Verlangen, daß Sie mir<br />
diese mangelnde Liebenswürdigkeit vergeben. Denn ich bin überzeugt,<br />
52
daß Sie richtig gehandelt haben . . . Ich bitte auch um Verzeihung dafür,<br />
daß ich gesagt oder gedacht habe, Sie hatten die Absicht, mir ein Amt<br />
anzudrehen oder mich zu verwirren. Ich bin — Ihr untertänigster und<br />
unglücklichster Diener Is. Newton.“<br />
In dem bekannten, ja berühmten Buch ” Genie, Irrsinn und Ruhm“ <strong>von</strong><br />
Wilhelm Lange-Eichbaum (1928) ist über Newton zu lesen: ” Nach 50.<br />
Jahr Psychose. Unzusammenhängende, bizarre Reden. Depression, paranoide<br />
Verfolgungsideen. Sein Werk ’ Chronologie‘ mit psychotischen<br />
Symptomen. Wohl Spätschizophrenie.“<br />
Bevor ich, vor dem Hintergrund <strong>von</strong> Newtons Psychose, auf den<br />
berühmt-berüchtigten Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz<br />
zu sprechen komme, in dem Newton mit befremdlicher Verbissenheit<br />
Leibniz des Plagiats bezichtigte, noch eine kurze biographische Notiz<br />
zu Newton: In seiner Biographie lassen sich drei ganz unterschiedliche<br />
Lebensabschnitte erkennen: 1643–1669, Newtons Jugend; 1669–<br />
1687, Newton als Lucasian-Professor in Cambridge (derzeit besetzt S.<br />
Hawking diese Professur), wissenschaftlich und alchemistisch hochproduktive<br />
Phase; 1687–1727 (fast die Hälfte seines Lebens), Newton<br />
als hochbezahlter Staatsbeamter (Direktor der Münze, ab 1703 Präsident<br />
der Royal Society), wenig Interesse an wissenschaftlicher und alchemistischer<br />
Tätigkeit.<br />
Und nun zum Streit zwischen Newton und Leibniz (Abb. 22) um die<br />
Priorität an der Entwicklung des Infinitesimalkalküls: Nach dem derzeitigen<br />
Stand des Wissens, wurde dieser Kalkül zuerst <strong>von</strong> Newton<br />
1665–1666 entwickelt, <strong>von</strong> Leibniz 1675, unabhängig <strong>von</strong> Newton, dessen<br />
Untersuchungen bis dahin nicht publiziert worden waren bzw. vor<br />
1677 Leibniz nicht zur Kenntnis gekommen sein konnten. Leibniz publizierte<br />
seine Differentialrechnung 1684, Newton seine ” Fluxionsrechnung“<br />
1687, dabei erwies sich Leibniz ” in der Wahl seiner Bezeichnungen<br />
glücklicher als Newton, was die Verbreitung der leibnizschen<br />
Theorie, vor allem auf dem Kontinent, beförderte und möglicherweise<br />
den Neid Newtons weckte“.<br />
Die Kontroverse um die Priorität am Infinitesimalkalkül begann im Jahre<br />
1700 und wurde nicht nur <strong>von</strong> den beiden Protagonisten sondern<br />
53
auch <strong>von</strong> deren Anhängern geführt. Ihren Höhepunkt erreichte sie in<br />
den Jahren 1710 bis 1713, als Newton durch die Royal Society eine<br />
” unparteiische Kommission“ zur Klärung des Prioritätsstreits einsetzte<br />
und selbstgeschriebene Pamphlete unter dem Namen <strong>von</strong> Kollegen<br />
erscheinen ließ und den selbstgeschriebenen Bericht der Kommission<br />
veröffentlichte, der, wie nicht anders zu erwarten, den Streit zu Gunsten<br />
<strong>von</strong> Newton entschied. Newton und seine Anhänger führten den<br />
Prioritätsstreit noch weit über Leibniz’ Tod (1716) hinaus.<br />
Aber schon Platon hat den Zustand der ” Mania“ als ” Geschenk der<br />
Götter, das Künstler zu ihrem Werk“ befähigt bezeichnet. Und wie das<br />
oben zitierte Werk <strong>von</strong> Lange-Eichbaum, mittlerweile (1985–1996) <strong>von</strong><br />
anderen Wissenschaftlern überarbeitet und auf 11 Bände angewachsen,<br />
zeigt, litten viele der Großen — ob Künstler, Politiker, Philosophen oder<br />
Wissenschaftler — unter seelischen Störungen verschiedener Art, unter<br />
ihnen Beethoven, Darwin, Freud, Galilei, Goethe, Kepler, Mendel, Sartre,<br />
Schopenhauer . . .<br />
Zu Goethe, speziell zu dessen Farbenlehre in Opposition zu Newtons<br />
Farbenlehre: In der einschlägigen Literatur wird die Theorie (des Psychoanalytikers<br />
Kurt R. Eissler) diskutiert, Goethe habe sich mit seiner<br />
Farbenlehre einen ” Nebenschauplatz geschaffen, um eine Psychose<br />
auszuagieren, während er als Dichter und Mensch erstaunlich gesund<br />
und kreativ blieb.“<br />
Newton, nach dem im weißen Licht alle Farben potentiell vorhanden<br />
sind, wurde ja bekanntlich <strong>von</strong> Goethe scharf attackiert, entstehen doch<br />
nach dessen Meinung die Farben aus einer Vermischung <strong>von</strong> Licht und<br />
Finsternis, ganz im Sinne des alchemistischen Farbkonzepts, entsprechend<br />
dem die ” Entstehung des bunten Gewebes aus der Brechung<br />
des göttlichen Lichts in der Finsternis der unteren Gewässer“ erfolgt.<br />
Newtons Perspektive ist die des Wissenschaftlers, Goethes eher die des<br />
Künstlers.<br />
Der späte Goethe legte auf seine naturwissenschaftlichen Studien, insbesondere<br />
seine Farbenlehre, mehr Wert als auf seine Dichtungen, wie<br />
folgendes Zitat <strong>von</strong> Eckermann belegt: ”’ Auf alles was ich als Poet geleistet<br />
habe‘, pflegte er wiederholt zu sagen, ’ bilde ich mir gar nichts<br />
54
ein. Es haben treffliche Dichter mit mir gelebt, es lebten noch Trefflichere<br />
vor mir, und es werden ihrer nach mir seyn. Daß ich aber meinem<br />
Jahrhundert in der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der Einzige<br />
bin, der das Rechte weiß, darauf thue ich mir etwas zu gute, und<br />
ich habe daher das Bewußtseyn der Superiorität über Viele.‘ “<br />
Doch zurück zu Newton. Bei seinem Tode (1727) galt Newton unbestritten<br />
als größter Wissenschaftler und mächtigster Wissenschaftspolitiker<br />
seines Landes. Bei Newtons Begräbniszeremonie wurde sein Sarg<br />
in einem feierlichen Leichenzug <strong>von</strong> zwei Herzögen, drei Grafen und<br />
dem Lord Chancellor getragen. Voltaire, der die Begräbniszeremonie<br />
verfolgte, schreibt: ” Er wurde begraben wie ein König, der beim Volke<br />
sehr beliebt war.“ Noch heute gilt Newton als einer der ganz Großen<br />
der Physik, der zusammen mit Galilei und Kepler im 17. Jahrhundert —<br />
durch einen Bruch mit Aristoteles — die moderne Physik begründete,<br />
und dessen Konzepte <strong>von</strong> Raum und Zeit, Trägheitsgesetz, Gravitationskraft<br />
etc. die Physik über zwei Jahrhunderte, bis zum Beginn des<br />
20. Jahrhunderts, bis zur Entwicklung der Relativitätstheorie und der<br />
Quantenmechanik, prägten.<br />
William Blake (1757–1827), hoch eigenwilliger Kupferstecher, Maler<br />
und Dichter, Mystiker, Hauptvertreter der Frühromantik in der englischen<br />
Kunst, verehrte und haßte Newton zugleich, zeichnete Newton<br />
als Halbgott (Abb. 23), nackt und muskulös, tatkräftig, besessen, getrieben<br />
<strong>von</strong> seinen Ideen, seinem Werk.<br />
Blake beschuldigte Newton der Verdrängung der Imagination zugunsten<br />
des Verstandes, der Freiheit zugunsten des Gesetzes, des Besonderen<br />
zugunsten des Allgemeinen, der Entzauberung des Gartens Eden,<br />
der Umweltzerstörung durch Beförderung <strong>von</strong> Industrialisierung und<br />
Mechanisierung: ” Viele Räder seh’ ich, Rad ohne Rad, mit tyrannischen<br />
Radzähnen, einander durch Druck und Zwang bewegen, nicht wie jene<br />
in Eden, die Rad in Rad, in Freiheit, Harmonie & Frieden sich drehen.“<br />
Blake warf Newton vor, über den Zweifel zum Wissen gefunden zu<br />
haben: ” Die Vernunft sagt Wunder, Newton sagt Zweifel. Jawohl, so<br />
schafft man die gesamte Natur aus Zweifel, Zweifel & glaubt nicht ohne<br />
Experiment.“<br />
55
Und er beschuldigte ihn der Einseitigkeit in Weltsicht und Wahrheitssuche:<br />
” Gott verhüte, daß die Wahrheit auf mathematische Beweisführung<br />
beschränkt werde.“<br />
Aber jetzt zu Newton (1643–1727) und Johann Sebastian Bach (1685–<br />
1750) (Abb. 24), zur Frage nach einer möglichen Parallele zwischen beiden,<br />
und damit zurück zum Thema ” Physik und Musik“. Newton und<br />
Bach waren Zeitgenossen, wenn auch Bach um eine Generation jünger<br />
war als Newton, und sie gehören beide zu den ganz Großen ihrer jeweiligen<br />
Zunft: ” Newton gehört zu den bedeutsamsten Naturforschern aller<br />
Zeiten“, und ” Bach war einer der größten Tonkünstler aller Zeiten“,<br />
so ist im Brockhaus (1929) zu lesen.<br />
Christoph Wolff, der große Bach-Experte, vergleicht in seiner Bach-<br />
Biographie (erschienen 2000) Bach und Newton: Bach erscheint als Universalist,<br />
der seine Kunst als Wissenschaft versteht. Er ist, wie Newton,<br />
Wegbereiter und Gesetzgeber.<br />
Wolff zitiert den Dichter und Musikwissenschaftler Christian Friedrich<br />
Daniel Schubart (1739–1791): ” Was Newton als Weltweiser war, war Sebastian<br />
Bach als Tonkünstler“, kommentiert diesen Satz: ” Mit anderen<br />
Worten: wie Newton die Welt der Naturwissenschaften <strong>von</strong> Grund auf<br />
veränderte und neue Prinzipien schuf, so veränderte Bach die Welt der<br />
Musik, gleichermaßen im Blick auf Komposition wie Aufführung“, und<br />
verweist auf die ” Allgemeine musikalische Zeitung“, zu deren Abonnenten<br />
auch Beethoven gehörte, die im Jahre 1801 im Sinne Schubarts<br />
schrieb: ” Hoch und her strahlt der Name Johann Sebastian Bachs vor<br />
allen deutschen Tonkünstlern in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts.<br />
Er umfaßte mit Newtons Geist alles, was man bisher über Harmonie<br />
gedacht und als Beyspiel aufgestellt hatte, durchwühlte ihre Tiefen<br />
so ganz und so glücklich, dass er mit Recht als Gesetzgeber in der<br />
ächten Harmonik, die bis auf den heutigen Tag gilt, anzusehen ist.“<br />
Jedoch Wolffs Satz: ” Bachs Musik — seine Suche nach Wahrheit — war<br />
mehr als die irgend eines anderen Musikers seiner Zeit teils bewußt,<br />
teils unbewußt geprägt <strong>von</strong> der sich ausbreitenden Kultur des Newtonianismus<br />
und dem der Wissenschaftlichen Revolution folgenden Entdeckergeist<br />
. . .“, und die diesem Satz zugrunde liegende Annahme,<br />
56
daß in Deutschland um 1750, speziell auch in Leipzig, Bachs Ort seines<br />
Wirkens, der Geist Newtons das Denken geprägt habe, lösten harsche<br />
Kritik (D. Shavin (2001)) aus. Wolff wird Unkenntnis im Prioritätsstreit<br />
zwischen Newton und Leibniz vorgeworfen, der auch noch Mitte<br />
des 18. Jahrhunderts die Gemüter bewegte, und in dem Bach die Partei<br />
Leibniz’ einnahm, und er somit wohl schwerlich als vom Geiste Newtons<br />
durchdrungen betrachtet werden darf.<br />
Zu Bachs Leistungen schreibt Wolff: ” Eine Liste <strong>von</strong> Bachs wichtigsten<br />
Leistungen in seiner musikalischen Wissenschaft zeigt, wie entschieden<br />
und konsequent er das Prinzip des Kontrapunkts anwandte, d.h.<br />
des dynamischen Miteinander melodisch und rhythmisch unterschiedlicher<br />
Stimmen, woraus sein einzigartiger Kompositionsstil resultiert.<br />
Eine solche Liste schließt . . . ein . . . : Fuge und Kanon ( ’ Die Kunst der<br />
Fuge‘), Dur/Moll-Tonalität ( ’ Das Wohltemperierte Clavier‘), erweiterte<br />
Harmonik ( ’ Chromatische Fantasie und Fuge‘) . . .<br />
Was Bachs Musikerwesen darüber hinaus auszeichnete, . . . waren seine<br />
unverzichtbaren Beiträge zum Verständnis der Wechselbeziehung zwischen<br />
Musik, Sprache, Rhetorik, Poetik und Theologie . . .<br />
Wenn Bach tatsächlich eine ’ Revolution‘ ausgelöst hat, dann in seiner<br />
Kompositionslehre, in der er die bisher getrennt behandelten Prinzipien<br />
<strong>von</strong> Generalbaß, Harmonik und Kontrapunkt zusammenführte . . .<br />
Schon bald nach 1750 kam es in der deutschen Musiktheorie — und<br />
ein halbes Jahrhundert später in ganz Europa — zu einer Neuorientierung,<br />
für die in erster Linie der dominierende Einfluß der ’ Bach-Schule‘<br />
verantwortlich war . . .“<br />
Pythagoras’ Idee der Sphärenharmonie, der Ordnung in den Dingen<br />
durch zugrundeliegende Mathematik, war offenbar auch noch in der<br />
Zeit Bachs lebendig, so auch in Leipzig in Bachs philosophischem Umfeld,<br />
das mitgeprägt wurde durch die ” Societät der musicalischen Wissenschaften“<br />
(1738–1761) seines Schülers Lorenz Christoph Mizler, zu<br />
deren Mitgliedern Bach (seit 1747) gehörte, aber auch u.a. Händel, Telemann,<br />
Graun.<br />
Wolff schreibt: ” Sowohl die pythagoräische Philosophie als auch die<br />
mittelalterliche Theologie vertraten die Lehre, daß die Harmonie der<br />
Sphären konsonante (wenngleich unhörbare) Musik erzeuge, welche<br />
57
die Vollkommenheit der himmlischen Welt, des gesamten Kosmos widerspiegele.<br />
. . . Sie zählte . . . auch zu den wenigen gültigen Grundwahrheiten,<br />
die zu Bachs Zeit <strong>von</strong> Philosophen und Theologen gleichermaßen<br />
aufrechterhalten wurden . . . Georg Venzky, ebenso wie<br />
Bach Mitglied <strong>von</strong> Mizlers Societät der musicalischen Wissenschaften‘,<br />
’<br />
formulierte: Gott ist ein harmonisches Wesen. Alle Harmonie rühret<br />
’<br />
<strong>von</strong> seiner weisen Ordnung und Einrichtung her . . . Wo keine Übereinstimmung<br />
ist, da ist auch keine Ordnung, keine Schönheit und keine<br />
Vollkommenheit. Denn Schönheit und Vollkommenheit bestehet in der<br />
Übereinstimmung des Mannigfaltigen.‘ “<br />
In diesem Zusammenhang sei auf das Buch Johann Sebastian Bachs<br />
”<br />
’ Kunst der Fuge‘ — Ein pythagoräisches Werk und seine Verwirklichung“<br />
(2000) des Cellisten und Musikwissenschaftlers Hans-Eberhard<br />
Dentler hingewiesen, in dem der Einfluß pythagoräischen Denkens auf<br />
Mizler und dessen Societät sorgfältig erörtert und die Kunst der Fu-<br />
”<br />
ge“ als ein Werk im Geiste Pythagoras’ — geprägt durch Zahlenmystik,<br />
Ordnung durch Mathematik, Hören mit geistigem Ohr — dargestellt<br />
wird. Die <strong>von</strong> Dentler in seinem Buch verfolgte Argumentation ist arg<br />
kritisiert worden. Auch enthält das Buch wenig Handfestes über Bachs<br />
Beziehung zu Pythagoras. Dennoch ist das Buch durchaus lesenswert,<br />
vermittelt es, gewürzt mit vielen Literaturhinweisen, doch einen recht<br />
guten Einblick in pythagoräisches Denken.<br />
Lesenswert ist auch das Buch (Abb. 25) ” Das Lied des Grünen Löwen<br />
— Musik als Spiegel der Seele“ (2004) <strong>von</strong> Jörg Rasche, Facharzt<br />
für psychotherapeutische Medizin, über eine gewisse Analogie zwischen<br />
Musik und Alchemie, ganz im Sinne <strong>von</strong> Spekulationen C.G.<br />
Jungs und Paulis, nach denen der Musik im Unbewußten angesiedelte<br />
Muster zugrunde liegen, die gelegentlich identisch sind mit strukturellen<br />
Abläufen ganzer mythologischer Erzählungen, sowie mit strukturellen<br />
Abläufen des alchemistischen Opus magnum, bei dem es darum<br />
geht, aus einem geeigneten Ausgangsmaterial, der Prima materia,<br />
durch eine Reihe <strong>von</strong> Operationen eine transzendente, wunderbare<br />
Substanz, den Stein der Weisen, zu schaffen. Am Beispiel <strong>von</strong> Bachs<br />
Passacaglia in C-Moll illustriert Rasche diese Analogie: ” Das musikalische<br />
Thema ist die ’ Prima materia.‘ Es kommt ins ’ Lösungsmittel‘ —<br />
58
das Reich des Grünen Löwen (Variationen 1,2), wird verflüssigt (Variationen<br />
3, 4), fragmentiert (Variation 5) und so fort. Das Thema wird<br />
sozusagen erhitzt, gekocht, zerstückelt, gerinnt wieder, es wird mit etwas<br />
Neuem, das aber aus ihm selbst kommt, zusammengesetzt ( Co-<br />
’<br />
niunctio‘ der Alchemisten, ein musikalischer Höhepunkt des Stücks in<br />
den Variationen 10, 11). Dann stirbt es gewissermaßen, immer noch auf<br />
’<br />
heißer Flamme‘ ( Nigredo‘). Die Musik verflüchtigt sich nach oben (Va-<br />
’<br />
riationen 14, 15), so wie bei den Alchemisten die Seele der zerkochten<br />
und zu Asche gewordenen Substanz nach oben entweicht . . . Aus den<br />
’ Wehen‘ <strong>von</strong> Variationen 19 und 20 wird die Fuge geboren . . . Bei der<br />
’ Geburt‘ der Fuge wird allerdings die zyklische Form der Variationen<br />
aufgebrochen, es ist ein Zerbrechen des Gefäßes‘: Vertreibung aus dem<br />
’<br />
Paradies — und Schöpfungsakt.“<br />
Rasche schreibt: ” Bach und Beethoven selber dürften <strong>von</strong> Alchemie wenig<br />
gewußt haben, doch das tut offenbar nichts zur Sache. Sie verfahren<br />
mit ihrem musikalischen Material nicht anders als der Alchemist<br />
mit seinen Substanzen und sie strukturieren damit nicht nur ihre chemischen<br />
oder musikalischen Kompositionen, sondern auch ihre Psyche<br />
. . .“<br />
In einer anderen Arbeit zur Rolle des Unbewußten in der Musik<br />
schreibt Rasche: ” Natürlich weiß ein Komponist genau, was er tut, aber<br />
er kann es kaum erklären, allenfalls nachträglich. Ein Beispiel ist Arnold<br />
Schönberg: Seine Schüler mußten nachträglich die thematischen<br />
Reihen, die der Komposition zugrunde liegen, herausfiltern und analysieren.<br />
Bei einer Fuge sind, wie Max Reger einmal seufzend bemerkte,<br />
das Entscheidende und Schwierige nicht die thematischen sondern die<br />
freien Stimmen. Da habe der Komponist eine gewissermaßen furchtbare<br />
Freiheit . . .“<br />
Und dazu noch ein Zitat <strong>von</strong> Schopenhauer, der sich, ganz im Geiste<br />
der Romantik, gegen eine Überbetonung <strong>von</strong> Maß und Zahl in der Musik<br />
(für die Zuordnung der Töne und die Ordnung im Tonraum) ausspricht:<br />
” Die Musik steht ganz abgesondert <strong>von</strong> allen anderen Künsten,<br />
wir erkennen in ihr nicht die Nachbildung, Wiederholung irgendeiner<br />
59
Idee der Wesen der Welt; dennoch ist sie eine große und überaus herrliche<br />
Kunst, sie wirkt so mächtig auf das Innerste des Menschen, wird<br />
dort so ganz und so tief verstanden als eine ganz allgemeine Sprache,<br />
deren Deutlichkeit sogar die der anschaulichen Welt übertrifft, daß wir<br />
gewiß in ihr mehr zu suchen haben, als ein exercitium arithmeticae occultum<br />
nescientis se numerare animi [‘Musik ist eine geheime arithmetische<br />
Übung des unbewußt zählenden Geistes‘], wofür sie Leibniz<br />
ansprach.“<br />
Harmonie/ Sphärenharmonie/ universelle Harmonie — das zentrale<br />
Thema meiner Abschiedsvorlesung — hat auch ihren Platz in der Alchemie:<br />
Soll der Stein der Weisen wirksam sein — ob als Wundermittel,<br />
das unedle Metalle in Gold verwandeln kann, ob als Lebenselexier, das<br />
Gesundheit, Jugend, Unsterblichkeit verspricht — muß er in Harmonie<br />
mit der Welt sein. Dabei verwandelt sich der Stein der Weisen in<br />
” geistige Materie“, in die sogenannte Quintessenz“, der, im Falle einer<br />
”<br />
Transmutation in Gold, die Fähigkeit zugeschrieben wird, in dem zu<br />
transmutierenden unedlen Metall die Summe aller Eigenschaften des<br />
Goldes bilden zu können.<br />
Nach der ” Warnungs-Schrifft des Authoris/ seine Experimenta betreffend“<br />
aus ” Magnalia medico-chymica continuata, oder Fortsetzung der<br />
hohen Artzney = Feuerkunstigen Geheimnissen . . .“ <strong>von</strong> Johanne Hiskia<br />
Cardilucio, Nürnberg (1680), sind die Erfolgsaussichten einer Goldherstellung<br />
mittels Opus magnum jedoch wohl eher bescheiden:<br />
” . . . Ich hab gearbeitet in Schwefel und Vitrol/Welchen die Thoren<br />
den grünen Löwen nennen/In arsenic und auripigment, fort mit beyden/Auf<br />
schwachem principio bestund meine Anhebung/Darum war<br />
am Ende ein Betrug der Schluß/Meine Kleider waren schmutzig/der<br />
Magen schwach/ Und solcher Gestalt verwandelte ich mein Gut in<br />
Rauch . . .“<br />
Die ” Magnalia medico-chymica continuata“ sind Teil eines Konvoluts<br />
<strong>von</strong> über 1300 Seiten, für mich Alchemie mit Physik verbindend, habe<br />
ich doch diese bibliophile Kostbarkeit, vor nunmehr knapp fünf-<br />
60
zehn Jahren, in Münster, während der ersten gesamtdeutschen Physikertagung<br />
nach 1989 — seinerzeit ein bewegender Akt der Musica<br />
humana — gekauft, <strong>von</strong> einem meiner ersten Gehälter in westlicher<br />
Währung. Der Kauf war für mich ein erster, wenn auch bescheidener<br />
Beitrag zu dem Opus magnum der deutschen Wiedervereinigung, ein<br />
Beitrag, der mich mit einem Gefühl der Genugtuung erfüllte, konnte<br />
ich mit meinem Kauf doch zur ausgleichenden Gerechtigkeit beitragen,<br />
suchte man ja vor der politischen Wende <strong>von</strong> 1989 in ostdeutschen<br />
Antiquariaten vergebens nach solch feinen Büchern, wurden doch diese,<br />
wie ganz allgemein feine Antiquitäten, vom ostdeutschen Teilstaat<br />
nach Westdeutschland exportiert, zwecks Devisenbeschaffung.<br />
Heute würde ich mich freuen, ein Buch zu finden, ob im Buchhandel<br />
oder in einer Bibliothek, über die Ideengeschichte <strong>von</strong> Physik und Musik,<br />
über deren gemeinsame Wurzel in der Antike, in Pythagoras, und<br />
deren parallele und teilweise verzahnte Entwicklung bis in die späte<br />
Antike und seit der frühen Neuzeit, gekennzeichnet durch Namen wie<br />
Zarlino, Mersenne, Rameau, Bach, Wagner, Schönberg einerseits und<br />
Copernicus, Galilei, Kepler, Newton und Einstein andererseits. Aber<br />
vielleicht muß ein solches Buch erst noch geschrieben werden.<br />
Der Dreiklang der Schöpfung<br />
Eine Planetenkonstellation, die eine ” sechsfache Harmonie“ erzeugt,<br />
war für Kepler die ” Konstellation bei der Erschaffung der Welt“.<br />
Und in Joseph Haydns ” Die Schöpfung“, Text nach John Milton (1608–<br />
1674), heißt es: ” Vollendet ist das große Werk, des Herrn Lob sei unser<br />
Lied! . . . Aus Rosenwolken bricht, geweckt durch süßen Klang, der<br />
Morgen jung und schön. Vom himmlischen Gewölbe strömt reine Harmonie<br />
zur Erde. . .“<br />
Heute jedoch, anderes als früher, sind Weltentstehung und Harmonie<br />
eher verschiedene Dinge. Allein das Wort ” Urknall“, zur Bezeichnung<br />
des Beginns der Entwicklung des Universums, nach dem Standardmodell<br />
der Kosmologie, läßt kaum eine Assoziation mit dem Begriff ” Harmonie“<br />
aufkommen.<br />
61
Zischen, Fauchen, Krächzen sind zu hören in einer akustischen Aufbereitung<br />
der physikalischen Prozesse nach dem Urknall mittels Computersimulation<br />
(im Internet zu finden unter:<br />
http://www.astro.virgina.edu/˜dmw8f), wobei die auftretenden Frequenzen<br />
in den hörbaren Bereich verschoben wurden, nach oben um<br />
50 Oktaven, und die betrachtete Zeitspanne <strong>von</strong> 100 Millionen Jahren<br />
auf 20 Sekunden komprimiert wurde.<br />
Und dennoch sehen — seit einigen Jahren — die Astrophysiker in der<br />
Anisotropie der kosmischen Hintergrundstrahlung, dem Nachglimmen<br />
des Urknalls, ein harmonisches Phänomen, einen ” Dreiklang der<br />
Schöpfung“. Dieser Dreiklang besteht aus einem Grundton und zwei<br />
Obertönen — verursacht durch akustische Dichteschwankungen in der<br />
Baryon-Photon-Flüssigkeit des frühen Kosmos. Er wurde kurz nach<br />
dem Urknall erzeugt, durch die Inflationsphase, und ” ertönte“ über<br />
300 000 Jahre lang, bis der Kosmos aufhörte flüssigkeitsähnlich zu sein,<br />
und die akustischen Dichteschwankungen erstarrten und sich so in der<br />
Anisotropie der kosmischen Hintergrundstrahlung verewigten.<br />
Erinnert sei in diesem Zusammenhang daran, daß bei einem Blasinstrument<br />
die Klangfarbe durch die Obertöne bestimmt wird und damit<br />
durch das Material, aus dem das Instrument gefertigt wurde. Ganz<br />
ähnlich liefert im Falle des ” Dreiklangs der Schöpfung“ eine Analyse<br />
der Anisotropie der Hintergrundstrahlung, eine Analyse des ” Klanges“,<br />
Aussagen über die gefundenen Obertöne und damit Aussagen<br />
über Energie- und Materieverteilung im frühen Kosmos.<br />
Bevor ich diese Dinge noch etwas vertiefe, einige Anmerkungen zur<br />
neueren Geschichte der Kosmologie. Newton hatte mit seiner Mechanik<br />
und seinem Gravitationsgesetz die Voraussetzungen für eine Untersuchung<br />
der dynamischen Struktur des Universums, für eine Kosmologie,<br />
geschaffen. Er formulierte auch das sogenannte kosmologische<br />
Prinzip: ” Das Universum ist homogen und isotrop. Es war schon<br />
immer so, und es wird auch immer so bleiben.“ D.h. das Universum<br />
bietet, lokale Unregelmäßigkeiten ausgenommen, zu jedem Zeitpunkt<br />
<strong>von</strong> jedem Punkt aus den gleichen Anblick.<br />
Newton hat selbst kein eigenständiges kosmologisches Modell ge-<br />
62
schaffen, nicht zuletzt, wußte er doch nicht so recht, wie in einem<br />
solchen Modell ein durch wechselseitige gravitative Anziehung der<br />
Himmelskörper verursachter Kollaps des Universums hätte vermieden<br />
werden können.<br />
Immanuel Kant (1727–1804) machte sich Newtons Vorstellungen <strong>von</strong><br />
Raum, Zeit, Mechanik und Gravitation zu eigen und formulierte ein<br />
kosmologisches Modell unter der Annahme eines primordialen Chaos<br />
und, zur Vermeidung eines Gravitationskollapses, unter Annahme<br />
einer Abstoßungskraft zwischen den Himmelskörpern. Kants Theorie<br />
gilt heute als erste wissenschaftlich ausgearbeitete Kosmologie, ungeachtet<br />
der Tatsache, daß sie recht spekulativ war und in vielen Punkten<br />
nicht richtig ist.<br />
Die Kosmologie als eigenständiger Zweig der Wissenschaft entstand<br />
erst mit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (1916), nach der ” die<br />
Materie dem Raum sagt, wie er sich krümmen muß, und der Raum der<br />
Materie sagt, wie sie sich zu bewegen hat“ (John A. Wheeler).<br />
Allgemeine Relativitätstheorie und kosmologisches Prinzip sind zwei<br />
wichtige Grundpfeiler der modernen Kosmologie. Aufbauend auf diesen<br />
beiden Grundpfeilern hat Alexander Friedmann Anfang der zwanziger<br />
Jahre die Expansion des Universums, verbunden mit einem Anfangsurknall,<br />
theoretisch vorhergesagt, Jahre bevor Edwin Powell Hubble<br />
(1929) auf Grund astronomischer Beobachtungen das später nach<br />
ihm benannte Gesetz fand, nach dem das Universum expandiert und<br />
die Fluchtgeschwindigkeit einer Galaxie <strong>von</strong> einem gegebenen Punkt<br />
proportional zum Abstand <strong>von</strong> diesem Punkt ist.<br />
An dieser Stelle eine kurze Abschweifung zu Raum und Zeit: Newton<br />
(1687) führte die Idee des absoluten Raumes und der absoluten Zeit<br />
ein, die beide <strong>von</strong> ihm als Emanation (Ausströmung) Gottes verstanden<br />
wurden. Newton: ” Die absolute, wahre und mathematische Zeit<br />
fließt aus sich selbst heraus ohne Bezug zu etwas Äußerem gleichmäßig<br />
dahin.“ Im Sinne Newtons kann man sich überall im Universum Uhren<br />
aufgestellt denken, die stets synchron laufen. Und den Raum kann<br />
man sich als unendlich großen Kasten vorstellen, mit Euklidischer Geometrie,<br />
in dem die physikalischen Prozesse ablaufen, ohne den Raum<br />
irgendwie zu beeinflussen.<br />
63
Die newtonsche Idee <strong>von</strong> Raum und Zeit bestimmte das Denken der<br />
Physiker und Philosophen über mehr als 200 Jahre, bis Einstein —<br />
mit seiner Speziellen Relativitätstheorie (1905) und Allgemeinen Relativitätstheorie<br />
(1916) — sie verworfen bzw. ihren Gültigkeitsbereich stark<br />
eingeschränkt hat. Nach Einsteins Spezieller Relativitätstheorie haben<br />
Raum und Zeit nur relativ zu einem speziellen Bezugssystem (Inertialsystem)<br />
Bedeutung, wodurch, beispielsweise, je nach Bezugssystem,<br />
Ereignisse in verschiedenen Raumpunkten als gleichzeitig oder nicht<br />
gleichzeitig festgestellt werden. Die absolute Bedeutung <strong>von</strong> Raum<br />
und Zeit ist somit aufgehoben. Und in der Allgemeinen Relativitätstheorie<br />
wird die Schwerkraft, die Gravitation, berücksichtigt und geometrisiert,<br />
d.h. alle Eigenschaften der Gravitation und ihrer Einwirkung<br />
auf physikalische Vorgänge werden auf die Eigenschaften eines<br />
Riemannschen Raumes abgebildet. Die Geometrie der Raumzeit, die<br />
Krümmung der Raumzeit, wird so durch die Massen- und Energieverteilung<br />
bestimmt. So gehen Uhren, die sich in einem Gravitationsfeld<br />
bewegen langsamer, und am Rande eines Schwarzen Loches bleibt die<br />
Zeit gar gleichsam stehen.<br />
Mit Bezug auf Newtons Vorstellung <strong>von</strong> Raum und Zeit, als Emanation<br />
Gottes, bemerkt Pauli: ” . . . daß Newton Raum und Zeit quasi zur rechten<br />
Hand Gottes gesetzt hat und zwar auf den leer gewordenen Platz<br />
des <strong>von</strong> dort vertriebenen Gottessohnes. Bekanntlich hat es dann einer<br />
ganz außerordentlichen Anstrengung [Einstein!] bedurft, um Raum<br />
und Zeit aus diesem Olymp herunterzuholen. Diese Arbeit wurde noch<br />
künstlich erschwert durch Kants philosophischen Versuch, den Zugang<br />
zu diesem Olymp für die menschliche Vernunft zu versperren . . .“<br />
Angemerkt sei, daß in der schon erwähnten Schleifen-<br />
Quantengravitation, der Vereinigung <strong>von</strong> Allgemeiner Relativitätstheorie<br />
und Quantentheorie, auch die Kontinuität <strong>von</strong> Zeit und Raum<br />
in Frage gestellt und durch die Vorstellung entsprechender diskreter,<br />
gequantelter, Größen ersetzt wird. So gibt es dieser Theorie zufolge<br />
keine Zeitspanne, die kleiner als die Planckzeit <strong>von</strong> 10 −43 Sekunden<br />
ist.<br />
Doch zurück zum Urknall und zur kosmischen Hintergrundstrahlung.<br />
64
Einer der Begründer der Theorie des heißen Urknalls war George Gamow<br />
(1948) (ich erwähnte Gamow schon im Zusammenhang mit Paulis<br />
” Tizian“-Bild, Abb. 7). Seine Theorie des Urknalls beruhte auf dem<br />
Friedmann-Modell des Universums und der seinerzeitigen Elementarteilchentheorie.<br />
Sie enthält auch die Voraussage einer kosmischen Hintergrundstrahlung,<br />
einer Schwarzkörperstrahlung als Relikt des Urknalls. Erstmals<br />
beobachtet wurde solch eine Strahlung <strong>von</strong> Arno Penzias und Robert<br />
Wilson im Jahre 1965. Für die Entdeckung der Hintergrundstrahlung<br />
erhielten die beiden 1978 den Nobelpreis. Gamow ging bei der Nobelpreisverleihung<br />
leer aus.<br />
Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnis ereignete sich der Urknall<br />
vor ca. 13,7 Milliarden Jahren. Anfangs waren Dichte und Temperatur<br />
unvorstellbar hoch im Kosmos. Doch schon nach etwa einer Sekunde<br />
war die Bildung der Bausteine der Materie weitgehend abgeschlossen.<br />
Durch die Expansion des Kosmos war dessen Temperatur<br />
auf 10 10 K (Grad Kelvin) gefallen. Als der Kosmos ungefähr 300 000<br />
Jahre alt und durch weitere Expansion seine Temperatur auf etwa 3000<br />
K gesunken war, konnten die durch primordiale Nukleosynthese entstandenen<br />
Atomkerne Elektronen einfangen und neutrale Wasserstoff-,<br />
Helium- und Lithiumkerne bilden. Dadurch hatten die Photonen keine<br />
Streupartner mehr. Die Photonen trennten sich <strong>von</strong> der Materie und das<br />
thermische Gleichgewicht zwischen Strahlung und Materie geriet ins<br />
Wanken. Das Universum wurde durchlässig für Photonen, für Strahlung.<br />
Seit den letzten Streuereignissen, etwa 380 000 Jahre nach dem Urknall,<br />
passiert die beobachtete kosmische Hintergrundstrahlung ungehindert<br />
das Universum. Sie kommt zu uns, nach einer Laufzeit <strong>von</strong> 13,7 Milliarden<br />
Jahren, <strong>von</strong> einer Kugelfläche aus einer Entfernung <strong>von</strong> 13,7 Milliarden<br />
Lichtjahren. Dank der endlichen Geschwindigkeit des Lichtes<br />
ist es so den Astronomen möglich, weit in die Geschichte des Weltalls<br />
zurückzublicken, bis in die Zeit etwa 380 000 Jahre nach dem Urknall.<br />
Ähnlich wie die kosmische Hintergrundstrahlung, die Mikrowellen-<br />
Hintergrundstrahlung, sollte es nach der Erwartung der Astronomen<br />
65
auch eine Gravitationswellen-Hintergrundstrahlung geben, d.h. periodische<br />
Dehnungen und Stauchungen der Raumzeit des frühen Kosmos,<br />
erzeugt durch die Bildung supermassereicher Schwarzer Löcher,<br />
kurz nach dem Urknall (Abb. 26). Eine Beobachtung dieser Strahlung,<br />
so die Erwartung der Astronomen, würde eines Tages ein Zurückblicken<br />
in die Geschichte des Weltalls bis in die Zeit etwa 10 bis 20<br />
Sekunden nach dem Urknall gestatten.<br />
Doch noch einige Anmerkungen zur kosmischen Hintergrundstrahlung:<br />
Sie zeigt das fast perfekte Intensitätsprofil eines schwarzen<br />
Körpers mit einer Temperatur <strong>von</strong> durchschnittlich 2,73 K, und sie<br />
ist hochgradig isotrop. Eine schwache Anisotropie, <strong>von</strong> der Größe<br />
10 −5 K, wurde erstmals 1989 im Rahmen der satellitengestützten Mission<br />
COBE (Cosmic Background Explorer) beobachtet. Seitdem wird die<br />
Anisotropie mit Hilfe <strong>von</strong> Satelliten- und Ballonexperimenten eingehend<br />
studiert, liefert sie doch äußerst interessante physikalische Aussagen,<br />
so über statische Dichteschwankungen (Vorläufer der Galaxien,<br />
Galaxienhaufen), dynamische Dichteschwankungen ( ” Dreiklang der<br />
Schöpfung“) und die Existenz Dunkler Energie in dem frühen Kosmos,<br />
aber auch über die Raumkrümmung des heutigen Kosmos. Danach ist<br />
heute der Kosmos flach, d.h. nicht gekrümmt, und das Licht läuft zu<br />
uns auf geraden Bahnen, seit 13,7 Milliarden Jahren.<br />
Die hochgradige Isotropie der Hintergrundstrahlung sowie die Flachheit<br />
des Raumes können im Standardmodell der Kosmologie, dem<br />
Friedmann-Modell, nicht erklärt werden. Dies führte Alan Guth (1981)<br />
zu der Hypothese, daß in einer Inflationsphase, kurz nach dem Urknall,<br />
sich der Kosmos in kürzester Zeit um einen gewaltigen Faktor (10 30 bis<br />
10 50 ) aufgebläht hat, verursacht durch einen Übergang aus einem energetisch<br />
metastabilen in einen stabilen Zustand. Dieses Aufblähen ließ<br />
den Kosmos flach werden, ähnlich wie ein Luftballon um so flacher erscheint,<br />
je stärker er aufgeblasen wird. Und die Winzigkeit des Kosmos<br />
vor Einsetzen der Inflation garantierte in ihm ein thermisches Gleichgewicht<br />
bzw. einen kausalen Zusammenhang, wodurch sich die hochgradige<br />
Isotropie der Hintergrundstrahlung erklären läßt. Nach der Inflationsphase<br />
expandierte der Kosmos weiter wie durch das Friedmann-<br />
Modell beschrieben: mit einer strahlungsdominierten Ära, gefolgt <strong>von</strong><br />
einer materiedominierten Ära.<br />
66
Im Inflationsmodell werden quantenmechanische Dichtefluktuationen<br />
im Kosmos vor der Inflation zu Keimen für die späteren großräumigen<br />
Strukturen im All, wie sie sich in der Anisotropie der Hintergrundstrahlung<br />
manifestieren. Durch die Inflation blähen sich die quantenmechanischen<br />
Fluktuationen zu makroskopischer Größe auf und bleiben<br />
so für alle Zeiten erhalten.<br />
Zur Klumpung der gewöhnlichen Materie, der baryonischen Materie,<br />
am Ende der Inflationsphase ist Dunkle Materie, nicht-baryonische Materie,<br />
erforderlich. Dunkle Materie, wie schon ihr Name besagt, wechselwirkt<br />
nicht mit Strahlung. Eine durch zufällige Verteilung und Gravitation<br />
bewirkte Klumpung Dunkler Materie wird somit nicht durch<br />
Strahlungsdruck behindert. Gebiete erhöhter Dichte Dunkler Materie<br />
befördern nun auch durch gravitative Anziehung eine Klumpung baryonischer<br />
Materie, und somit statistische Dichteschwankungen in der<br />
Baryon-Photon-Flüssigkeit. Darüber hinaus verursacht das Wechselspiel<br />
zwischen gravitativer Anziehung und Abstoßung durch Strahlungsdruck<br />
akustische Dichtewellen in der Baryon-Photon-Flüssigkeit,<br />
verursacht den Dreiklang der Schöpfung.<br />
Die Natur <strong>von</strong> Dunkler Materie und Dunkler Energie ist weitgehend<br />
ungeklärt. Man kennt nur wichtige Eigenschaften <strong>von</strong> Dunkler Materie<br />
und Dunkler Energie. Dunkle Materie ist hauptverantwortlich für die<br />
Strukturbildung im Kosmos, für die Bildung <strong>von</strong> Galaxien und Galaxienhaufen,<br />
und Dunkle Energie treibt, wie Untersuchungen an jüngeren<br />
Supernovae zeigen, seit etwa 7,5 Milliarden Jahren das Weltall erneut<br />
beschleunigt auseinander. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand<br />
sind <strong>von</strong> der Gesamtenergie des Kosmos etwa 73 % Dunkle Energie,<br />
22 % Dunkle Materie und 5 % gewöhnliche, baryonische, Materie.<br />
Kandidaten für Dunkle Materie sind exotische, hypothetische Elementarteilchen,<br />
wie supersymmetrische Teilchen, aber möglicherweise<br />
auch Neutrinos, wenn auch letztere nur Bruchteile eines Prozents<br />
Dunkle Materie liefern könnten.<br />
Dunkle Energie wird mit einem skalaren Feld, einem Higgs-Feld, formal<br />
ähnlich dem in der Theorie der kosmischen Inflation und in der<br />
67
Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung, in Zusammenhang gebracht,<br />
aber auch mit der kosmologischen Konstante aus Einsteins Allgemeiner<br />
Relativitätstheorie.<br />
Dieses Feld, quantisiert, führt zu neuen Teilchen, mit einer Masse mindestens<br />
10 39 mal kleiner als die des Elektrons, und damit zu einer neuen<br />
Kraft, Quintessenz genannt, die das Äquivalenzprinzip, die Grundlage<br />
der Allgemeinen Relativitätstheorie, verletzt, nach dem Körper<br />
mit gleicher Masse aber verschiedener Zusammensetzung im Vakuum<br />
gleich schnell fallen, wie seinerzeit zuerst <strong>von</strong> Galilei gefunden.<br />
Die neue Kraft hat ihren Namen in Anlehnung an die ” Quinta essentia“<br />
des Aristoteles erhalten. Doch während die Quinta essentia ein fünftes<br />
Element — neben Feuer, Wasser, Erde, Luft — war, ein Element, das die<br />
Himmelskörper bilden und auf ihrer Bahn halten sollte, so ist jetzt die<br />
Quintessenz eine fünfte Kraft, neben der gravitativen, elektromagnetischen,<br />
schwachen und starken Kraft.<br />
Mit der Quintessenz der Alchemie wird die Quintessenz der heutigen<br />
Kosmologie wohl nichts zu tun haben. Aber, wie dem auch sei, alle drei<br />
Quintessenzen, die der heutigen und der antiken Kosmologie und die<br />
der Alchemie, sind höchst geheimnisvoll.<br />
Das Modell des inflationären Universums wird gegenwärtig mehr und<br />
mehr zum Standardmodell der Kosmologie — wenn auch das Konzept<br />
der Inflation immer noch hinterfragt, ja auch in Frage gestellt wird. So<br />
hat es möglicherweise nicht nur eine inflationäre Expansion gegeben,<br />
sondern eine Vielzahl inflationärer Expansionen (Andrei Linde, 1983),<br />
wobei jede zu einem neuen Universum führte, und so ein unendliches<br />
Geflecht sich aufblähender kosmischer Räume entstand, ein sogenanntes<br />
Multiversum. Vorstellbar wäre, daß die Physik im Multiversum sich<br />
<strong>von</strong> Universum zu Universum unterscheidet, und wir gerade in einem<br />
solchen dieser Universen leben, wo Leben möglich ist (anthropisches<br />
Prinzip). In diesem Falle fände auch Paulis Frage, weshalb die Sommerfeldsche<br />
Feinstrukturkonstante den Wert 1/137 hat, eine Antwort: Weil<br />
dann die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung (im Verhältnis<br />
zu den anderen Kräften) so ist, daß Leben möglich ist.<br />
Ganz in diesem Sinne meinte kürzlich Mario Livio, Experte für Dunkle<br />
68
Energie, auf die Frage, ob hinter den 73 % Dunkle Energie sich vielleicht<br />
eine neue Naturkonstante verberge: ” Die Werte einiger Naturkonstanten<br />
sind möglicherweise eher zufällig als fundamental“, und<br />
er verglich den angesprochenen Sachverhalt mit Keplers Beschreibung<br />
des Sonnensystems mit Hilfe eines Modells verschachtelter Polyeder<br />
(Abb. 14): ” Keplers Mathematik war hervorragend, aber er ging <strong>von</strong><br />
völlig falschen Voraussetzungen aus. Er nahm an, daß den Bahnen und<br />
der Zahl der Planeten fundamentale Naturkonstanten zugrunde liegen<br />
— und nicht, daß sie zufällig entstanden sind, weil im Sonnensystem<br />
eben bestimmte Bedingungen herrschten.“<br />
Wäre das Multiversum-Konzept schon 1944 bekannt gewesen, als Jorge<br />
Luis Borges (1899–1986) seine später berühmt gewordene Erzählung<br />
” Die Bibliothek <strong>von</strong> Babel“ schrieb, hätte er seine fiktive Bibliothek vermutlich<br />
nicht mit einem Universum, sondern einem Multiversum identifiziert,<br />
aber so heißt es: Das Universum (das andere die Bibliothek<br />
”<br />
nennen) setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen<br />
Zahl sechseckiger Galerien zusammen . . . Von jedem Sechseck aus kann<br />
man die unteren und oberen Stockwerke sehen: ohne Ende . . .<br />
Auf jede Wand jeden Sechsecks kommen fünf Regale; jedes Regal faßt<br />
zweiunddreißig Bücher gleichen Formats; jedes Buch besteht aus vierhundert<br />
Seiten, jede Seite aus vierzig Zeilen, jede Zeile aus etwa achtzig<br />
Buchstaben . . . [Sämtliche] Bücher, wie verschieden sie auch sein<br />
mögen [bestehen] aus den gleichen Elementen: dem Raum, dem Punkt,<br />
dem Komma, den zweiundzwanzig Lettern des Alphabets. In der ungeheuer<br />
weiträumigen Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher.<br />
. . . ihre Regale [verzeichnen] alle irgendmöglichen Kombinationen der<br />
zwanzig und so viele orthographischen Zeichen . . . mithin alles, was<br />
sich irgend ausdrücken läßt: in sämtlichen Sprachen. Alles: die bis<br />
ins einzelne gehende Geschichte der Zukunft, . . . , den getreuen Katalog<br />
der Bibliothek, Tausende und Abertausende falscher Kataloge, den<br />
Nachweis ihrer Falschheit, den Nachweis der Falschheit des echten Katalogs<br />
. . .“<br />
Mag sein, vielleicht ist das Multiversum-Konzept gar für die Vertreter<br />
des Konstruktivismus, für die Anhänger <strong>von</strong> der Idee <strong>von</strong> der Welt im<br />
69
Kopfe, ein nützliches Denkmodell, unterscheiden sich doch die Parameter<br />
<strong>von</strong> Kopf zu Kopf nicht unbeträchtlich.<br />
Anmerkung: Reisen durch das Universum, vielleicht auch durch das<br />
Multiversum, Kontakt mit fremdem Leben, fremden Zivilisationen;<br />
Zeitreisen, Abkürzungen des Weges zwischen weit <strong>von</strong>einander entfernten<br />
Raumzeitpunkten unter Ausnutzung <strong>von</strong> Effekten der Allgemeinen<br />
Relativitätstheorie, über Einstein-Rosen-Brücken bzw. durch<br />
Wurmlöcher hindurch — alles Dinge aus der Science-Fiction Literatur,<br />
als deren Begründer Johannes Kepler gilt, der eine phantastische,<br />
märchenhafte Erzählung hinterlassen hat, an der er über vierzig Jahre<br />
gearbeitet hatte, über eine Reise zum Mond — zwecks Abkürzung des<br />
Weges bei Neumond im Erdschatten — veröffentlicht postum <strong>von</strong> seinem<br />
Sohn Ludwig im Jahre 1734 unter dem Titel ” Somnium, seu opus<br />
posthumum de astronomia lunaria“ ( ” Traum, oder postumes Werk<br />
über die Astronomie des Mondes“).<br />
Quintessenz<br />
Die modernen Naturwissenschaften seien antihistorisch aber hoch effizient<br />
hinsichtlich Erkenntnisgewinn und Anwendungsrelevanz, ganz<br />
im Gegensatz, beispielsweise, zur Alchemie — so las ich kürzlich in einem<br />
Artikel über Hermetik und Alchemie. Zweifellos, die modernen<br />
Naturwissenschaften sind hoch effizient, und zwar in erster Linie, weil<br />
sie, mit Descartes, die Seele ins Subjektive verbannt haben und sich auf<br />
das Objektive und Reproduzierbare beschränken. Zweifellos, sie sind<br />
auch antihistorisch in dem Sinne, daß für die Forschungstätigkeit eines<br />
Naturwissenschaftlers ein zu großes Maß an Wissen über die Geschichte<br />
seines Faches und an Erinnerungen an Fehlschläge und Irrwege im<br />
allgemeinen eher hinderlich als nützlich ist.<br />
Und so schreibt auch Paul Dirac (1902–1984), einer der großen Theoretischen<br />
Physiker des 20. Jahrhunderts, daß ” der forschende Physiker, der<br />
eine Entdeckung gemacht hat, vielmehr darum besorgt ist, sich auf dem<br />
neu gewonnenen Standpunkt zu behaupten und das vor ihm liegende<br />
Feld zu überblicken. Seine Frage lautet: Wo gehen wir jetzt hin? Wo sind<br />
70
die Anwendungen dieser neuen Entdeckung? Wie weit werden wir damit<br />
die Probleme aufklären können, die noch vor uns liegen? . . .“ Deshalb<br />
wünsche der Physiker, ” lieber den Weg zu vergessen, auf dem er<br />
zu dieser Entdeckung gelangte. Er hat einen mühevollen Pfad zurückgelegt,<br />
war falschen Fährten gefolgt und sein Wunsch ist es, nicht mehr<br />
daran zu denken . . .“<br />
Die Verbannung der Seele ins Subjektive bzw. ihre Eliminierung aus<br />
der naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise schwingt auch in folgender<br />
Einstein-Anekdote mit:<br />
” Ja, glauben sie denn“, wurde Einstein gefragt, daß sich einfach al-<br />
”<br />
les auf naturwissenschaftliche Weise wird abbilden lassen können?“ —<br />
” Ja“, meinte Einstein, das ist denkbar, aber es hätte doch keinen Sinn.<br />
”<br />
Es wäre eine Abbildung mit inadäquaten Mitteln, so als ob man eine<br />
Beethoven-Symphonie als Luftdruckkurve darstellte.“<br />
Und so kann man sich lebhaft vorstellen, was beispielsweise eine Abbildung<br />
eines Gedichtes mit naturwissenschaftlichen Mitteln ergeben<br />
würde, insbesondere vor dem Hintergrund des folgenden Zitats der<br />
russischen Dichterin Marina Zwetajewa (1892–1941): ” Das Leben als<br />
solches liebe ich nicht, für mich gewinnt es erst Bedeutung, d.h. Sinn<br />
und Gewicht, wenn es verwandelt ist, d.h. in der Kunst. . . . Die Sache<br />
als solche liebte ich nicht.“ (vgl. Abb. 27)<br />
Somit sind dem Gültigkeitsbereich und dem Nutzen einer <strong>von</strong> manch<br />
einem Elementarteilchenphysiker angestrebten Weltformel bzw. Theory<br />
of everything (T.O.E.) wohl enge Grenzen gesetzt, selbst auf dem<br />
Gebiet der Physik, speziell dem Gebiet der kondensierten Materie, wo<br />
gerade in jüngster Zeit Indizien für Organisationsprinzipien auf mesoskopischer<br />
Ebene, sogenannte Quantenprotektorate (Robert B. Laughlin,<br />
David Pines et. al (2000)), erneut Zweifel an der universellen Nützlichkeit<br />
einer potentiellen T.O.E. aufgeworfen haben. Philip W. Anderson,<br />
Nobelpreisträger und gewichtiger Experte für die Theorie der kondensierten<br />
Materie, hält den Anspruch der Vertreter einer T.O.E. für arrogant<br />
( ” More Is Different“, Science 177, 393 (1972)) und illustriert seine<br />
Sicht, daß die Natur hierarchisch strukturiert ist und Komplexeres nicht<br />
völlig auf Einfacheres reduziert werden könne, mit einer Anekdote, ei-<br />
71
nem Dialog, aus den zwanziger Jahren in Paris, zwischen den damals<br />
noch relativ unbekannten Schriftstellern F. Scott Fitzgerald und Ernest<br />
Hemingway: ” Fitzgerald: The rich are different from us. Hemingway:<br />
Yes, they have more money“, und Anderson weist auch auf das marxsche<br />
Umschlagen quantitativer Veränderungen in qualitative hin ( ” objektiv<br />
wirkendes allgemeines Grundgesetz der materialistischen Dialektik“,<br />
Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, 1969), dabei offenbar auf<br />
die Suggestivkraft marxscher Worte bauend, waren ja seinerzeit, 1972,<br />
marxsche Worte hierzulande Dogma und andernorts, in weiten Kreisen,<br />
Verheißung letzter Wahrheiten.<br />
Aber selbst Stephen Hawking, bis vor Kurzem noch exponierter<br />
Fürsprecher einer T.O.E., glaubt heute nicht mehr an die Möglichkeit<br />
einer T.O.E., und zwar auf Grund des Gödel-Theorems, der Unvollständigkeit<br />
formaler Systeme, nach dem kein Teil eine vollständige<br />
Aussage über das Ganze machen kann, also hier der Mensch, als Teil<br />
der Natur, keine vollständige Aussage über die Natur als Ganzes.<br />
Das ist das bekannte Kreter-Paradoxon: ” Alle Kreter sind Lügner“, sagte<br />
der Kreter Epimenides <strong>von</strong> Knossos (6. Jh. v. Chr.). — Lösbar ist das<br />
Paradoxon nur durch einen Nicht-Kreter.<br />
Und so kommt — nun auch nach Hawking (2004) — die Forschung<br />
wohl niemals zu einem Ende.<br />
Epilog<br />
Eingangs hatte ich — anhand eines Gedankenspiels, mit Bezug auf<br />
einen Spruch Tagores — Merkmale einer Theorienbildung und einer<br />
T.O.E. illustriert. Als ich mir seinerzeit diese Dinge durch den Kopf<br />
gehen ließ, erinnerte ich mich der Begegnung mit einem amerikanischen<br />
Kollegen indischer Herkunft, in Albuquerque, USA, nach der politischen<br />
Wende 1989, als ich — die gewonnene Reisefreiheit nutzend,<br />
großzügig <strong>von</strong> der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt —<br />
ein halbes Jahr durch die USA und Israel reiste, und so viele <strong>von</strong> denen<br />
besuchte, die mich in der Vergangenheit eingeladen hatten, aber<br />
deren Einladung ich vor der Wende nicht nachkommen konnte. Besag-<br />
72
ter Kollege indischer Herkunft war, wie sich zeigte, auch ein großer<br />
Kenner der Bhagavadgita, über die er damals gerade ein Buch schrieb.<br />
Er freute sich, in mir einen interessierten Zuhörer in Sachen Bhagavadgita<br />
gefunden zu haben. Als ich mich jetzt seiner erinnerte, kam<br />
mir der Gedanke, doch im Internet nachzusehen, ob er denn mittlerweile<br />
sein Bhagavadgita-Buch veröffentlicht hat. Zwar fand ich nichts<br />
darüber, wohl aber fand ich auf seiner Home Page unter dem Stichwort<br />
” Miscelleanous“ eine lange philosophische Betrachtung, die mit<br />
folgenden Worten schloß: ” I was born Hindu. One may therefore ask<br />
me if in my next life I would want to become, again, a University Professor<br />
mentoring Ph.D. students: Yes, I certainly would.“<br />
Dem kann ich nur hinzufügen: Ich wurde nicht als Hindu geboren, sondern<br />
als Christ. Insofern glaube ich nicht an eine Wiedergeburt. Aber,<br />
falls ich doch wiedergeboren werden sollte, möchte ich auch gerne wieder<br />
Professor werden, für Theoretische Physik, am besten in <strong>Magdeburg</strong>,<br />
an der <strong>Otto</strong>-<strong>von</strong>-<strong>Guericke</strong>-<strong>Universität</strong>.<br />
Und falls auch Sie, liebe Gäste, liebe Zuhörer, wiedergeboren werden,<br />
und wir uns gar eines Tages zu einem Anlaß, wie dem heutigen, wieder<br />
treffen sollten, dann erzähle ich Ihnen noch all das, was mir jetzt<br />
noch auf der Zunge liegt, ich aber aus Zeitgründen nicht mehr erzählen<br />
kann.<br />
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.<br />
Herzlichen Dank!<br />
Nachtrag: Die mit dem Wiedergeburtsszenario verbundenen nicht unbeträchtlichen<br />
Imponderabilien waren für mich Anlaß, Zeit und Mühe<br />
nicht zu scheuen, die Noch-auf-der-Zunge-liegenden Dinge vorsorglich<br />
aufzuzeichnen und in den Text meiner Abschiedsvorlesung einzufügen,<br />
was zu dem vorliegenden, nun vielleicht etwas spröden, Traktat<br />
geführt hat.<br />
73
Abbildungen<br />
75
Abbildung 1: Johannes Kepler Harmonices mundi“ (1619), Titelblatt (aus:<br />
”<br />
” Weltharmonik“, R. Oldenbourg Verlag München 1997, c○ mit<br />
freundlicher Genehmigung des Verlags)<br />
77
Abbildung 2: Deutsche Übersetzung des Titelblatts <strong>von</strong> Johannes Keplers<br />
” Harmonices mundi“ (1619) (aus: Weltharmonik“, R. Olden-<br />
”<br />
bourg Verlag München 1997, c○ mit freundlicher Genehmigung<br />
des Verlags)<br />
78
Abbildung 8: Musica mundana, humana und instrumentalis. Allegorische<br />
Darstellung aus einer Notre-Dame-Handschrift um 1300 (Bibliotheca<br />
Laurenziana, Florenz). ( c○ mit freundlicher Genehmigung<br />
Verlag Merseburger Berlin GmbH)<br />
84
Abbildung 10: Kosmisches Monochord. Aus: Robert Fludd ” Metaphysica . . .“<br />
(1619) ( c○ mit freundlicher Genehmigung Verlag Merseburger<br />
Berlin GmbH)<br />
86
Abbildung 13: Die fünf regulären platonischen Körper<br />
89
Abbildung 17: Auszüge aus dem ” Taschenbuch für Physik“ <strong>von</strong> Horst Kuchling<br />
(Fachbuchverlag Leipzig, 2004) ( c○ mit freundlicher Genehmigung<br />
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Fachbuchverlag<br />
Leipzig) 93
Abbildung 27: Interferenzmuster <strong>von</strong> Gardinen in künstlerischer Manier verwandelt<br />
zu einem ” Klang der Farben und Strukturen“<br />
104