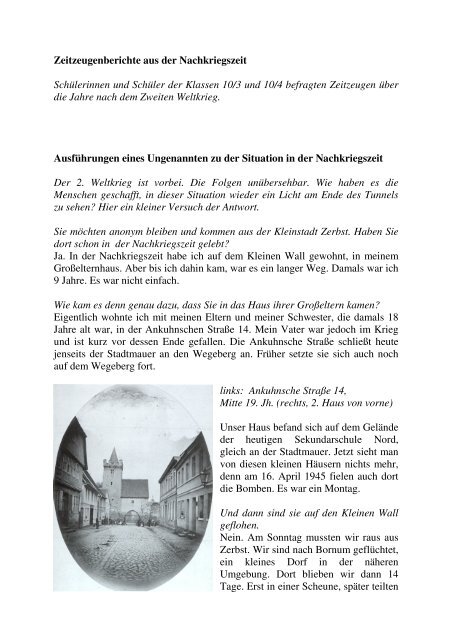download - Gymnasium Francisceum Zerbst
download - Gymnasium Francisceum Zerbst
download - Gymnasium Francisceum Zerbst
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zeitzeugenberichte aus der Nachkriegszeit<br />
Schülerinnen und Schüler der Klassen 10/3 und 10/4 befragten Zeitzeugen über<br />
die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.<br />
Ausführungen eines Ungenannten zu der Situation in der Nachkriegszeit<br />
Der 2. Weltkrieg ist vorbei. Die Folgen unübersehbar. Wie haben es die<br />
Menschen geschafft, in dieser Situation wieder ein Licht am Ende des Tunnels<br />
zu sehen? Hier ein kleiner Versuch der Antwort.<br />
Sie möchten anonym bleiben und kommen aus der Kleinstadt <strong>Zerbst</strong>. Haben Sie<br />
dort schon in der Nachkriegszeit gelebt?<br />
Ja. In der Nachkriegszeit habe ich auf dem Kleinen Wall gewohnt, in meinem<br />
Großelternhaus. Aber bis ich dahin kam, war es ein langer Weg. Damals war ich<br />
9 Jahre. Es war nicht einfach.<br />
Wie kam es denn genau dazu, dass Sie in das Haus ihrer Großeltern kamen?<br />
Eigentlich wohnte ich mit meinen Eltern und meiner Schwester, die damals 18<br />
Jahre alt war, in der Ankuhnschen Straße 14. Mein Vater war jedoch im Krieg<br />
und ist kurz vor dessen Ende gefallen. Die Ankuhnsche Straße schließt heute<br />
jenseits der Stadtmauer an den Wegeberg an. Früher setzte sie sich auch noch<br />
auf dem Wegeberg fort.<br />
links: Ankuhnsche Straße 14,<br />
Mitte 19. Jh. (rechts, 2. Haus von vorne)<br />
Unser Haus befand sich auf dem Gelände<br />
der heutigen Sekundarschule Nord,<br />
gleich an der Stadtmauer. Jetzt sieht man<br />
von diesen kleinen Häusern nichts mehr,<br />
denn am 16. April 1945 fielen auch dort<br />
die Bomben. Es war ein Montag.<br />
Und dann sind sie auf den Kleinen Wall<br />
geflohen.<br />
Nein. Am Sonntag mussten wir raus aus<br />
<strong>Zerbst</strong>. Wir sind nach Bornum geflüchtet,<br />
ein kleines Dorf in der näheren<br />
Umgebung. Dort blieben wir dann 14<br />
Tage. Erst in einer Scheune, später teilten
wir 3 uns ein kleines Zimmer mit 6 weiteren Personen. Dafür musste meine<br />
Mutter jedoch arbeiten. Als wir wieder nach <strong>Zerbst</strong> zurückgingen, kamen wir<br />
bei einer Tante unter. In der Hopfenbänke Nr. 3. Und dann waren die Russen da.<br />
Sie meinen die sowjetische Befreiungsarmee…<br />
Es war der 8. Mai. Wir mussten innerhalb von 12 Minuten aus dem Haus raus<br />
und fliehen … in unseren Schrebergarten am Wasserturm. Mit uns flüchteten<br />
meine Tante, ihre Familie und die Untermieter. Denn diese Siedlung war für die<br />
Russen vorgesehen. Dann hieß es, wir könnten zurück. Als wir wieder in der<br />
Hopfenbänke waren, mussten wir dann doch wieder in die Laube im<br />
Schrebergarten. Aufgespürt durch russische Soldaten flohen wir noch am selben<br />
Abend zu einer Familie auf der Großen Wiese 9. Neun Wochen auf dem<br />
Dachboden. Zurück in die Hopfenbänke. Und dann letztendlich am 15.<br />
November 1945 zu meiner Großmutter auf den Kleinen Wall 32 im Ankuhn.<br />
Dort lebte auch schon mein Onkel mit seiner Familie. Es war ein kleines Haus.<br />
Wie haben Sie während dieser turbulente Zeit vom Kriegsende bzw. von der<br />
Kapitulation erfahren?<br />
Wie gesagt, ich war damals 9 Jahre alt. Ich habe öfters gehört, dass man vom<br />
Radiosender Oslo sprach, aber wer genau die Bevölkerung informierte? Keine<br />
Ahnung. All solche Dinge wurden aber auch von Mund zu Mund<br />
weitergegeben. Solche Fragen haben sich mir nie gestellt. Für mich war das<br />
schlimmste, dass ich meinen Wellensittich in meinem Elternhaus zurücklassen<br />
musste. Meine Mutter sah da ganz andere Sachen im Vordergrund stehen. Ihre<br />
ganzen Werte und ihr bisheriges Leben lagen in Schutt und Asche. Unsere ganze<br />
Existenz war dahin. Wir hatten nicht mehr als einen kleinen Handwagen und<br />
jeder einen Rucksack mit dem Nötigsten. Ein Handtuch, einen Waschlappen,<br />
Schuhe und Wechselsachen.<br />
Sie standen sozusagen vor dem Nichts. Sind ihnen denn noch einige Dinge aus<br />
den Trümmern ihres Hauses erhalten geblieben?<br />
Meine Mutter und meine Schwester holten das Letzte aus dem Keller heraus.<br />
Sonst wäre es geklaut worden. Es war nicht viel. Ich habe das Haus nur noch als<br />
eine Trümmerstätte gesehen. Ansonsten wurden wir Kinder von uns<br />
unverständlichen Dingen immer etwas ferngehalten. Wir waren zu klein.<br />
Als Sie jedoch nach <strong>Zerbst</strong> zurückkamen, sahen Sie doch auch die übrigen<br />
Trümmerfelder.<br />
Man hörte es bis Bornum krachen, rund 10 km entfernt. 20 Minuten fielen die<br />
Bomben. Ich habe die Trümmer erst gar nicht so wahrgenommen, weil die<br />
Siedlung um die Hopfenbänke nicht zerstört worden war. Später gehörte es zum<br />
Alltag. Sie waren eben da. Die Trümmer. In der Fuhrstraße lagen sie noch sehr<br />
lange. Man muss bedenken, dass diese Straße viel schmaler war als heute. Die
Gerippe der Häuser ragten gespenstisch in den Himmel. Links und rechts<br />
Trümmer. Dazwischen nur ein schmaler Fahrweg.<br />
Aber es wurden doch auch bestimmt viele Wiederaufbauarbeiten geleistet?<br />
Erst einmal mussten die Ruinen der Stadt weggeräumt werden, um Neues bauen<br />
zu können. Dies erledigten die Trümmerfrauen und die Trümmerbahn.<br />
Im Hintergrund Durchbruch in der Stadtmauer für die Trümmerbahn<br />
Meine Schwester arbeitete als Trümmerfrau auf dem Flugplatz und meine<br />
Mutter als Näherin für die Russen im Hotel Anhalt. Irgendwie musste man sich<br />
ja etwas Geld verdienen. Ich kann mich noch erinnern, dass die Trümmerbahn -<br />
ich beschreibe sie mal als Dampf- und Dieselloks mit mehreren Kipploren - in<br />
der Alten Brücke fuhr und dann wurde der Schutt zur alten Badeanstalt<br />
gebracht. Das sind heute diese großen Hügel. Ansonsten bauten private Leute<br />
ihre Häuser wieder auf. Wenn es sich lohnte. Und wenn die Männer bald wieder<br />
zurückkamen. Wenn sie das überhaupt taten. Aber es sind ja auch viele<br />
umgekommen. Beim Angriff. bzw. sie waren einfach weg – aber wohin? Ich<br />
weiß es nicht.<br />
Was ist mit den sowjetischen Besatzern? Haben auch sie beim Aufbau geholfen?<br />
Ich glaube nicht. Aber sicher bin ich mir da nicht.<br />
Wie erlebten Sie die Besatzer weiterhin?<br />
Uns Kindern waren sie immer zugetan. Wir hatten also keine Angst vor ihnen.<br />
Dazu muss ich aber sagen, dass die Russen, die das Haus meiner Tante in den<br />
Hopfenbänken besetzt hatten, relativ vernünftig waren. Zu anderen hatte ich<br />
weniger Kontakt. Aber auch diese haben allerhand Unfug getrieben. So war<br />
doch viel im Haus zerstört worden. Mutwillig oder aus Unwissen. Einer von<br />
ihnen hat mir aber auch meinen Ring weggenommen, den ich einmal von<br />
meinem Onkel geschenkt bekommen habe. Wir durften jedoch die Kaninchen,<br />
die sie zuvor freigelassen hatten, im Garten füttern kommen. Etwas anderes:<br />
Eher die jungen Mädchen hatten Angst. Vor möglicher Vergewaltigung.<br />
Manche wurden deswegen wohl auch versteckt. Meiner Cousine und deren<br />
Freundin soll tatsächlich etwas angetan worden sein. Aber darüber sprach man<br />
nicht. Auch hatten wohl eher unsere Eltern Angst um uns.
Angst. Also Sorge. Die gab es doch bestimmt auch hinsichtlich der<br />
notwendigsten Lebensmittel.<br />
Es gab ja die Lebensmittelkarten. Man ging damit z.B. zum Bäcker und bekam<br />
für den aufgedruckten Wert Brot. Dieser musste die Karten mit dem<br />
Wirtschaftsamt abrechnen und so gelangte er wieder zu Mehl. Doch übermäßig<br />
davon leben konnte man nicht. Man musste schon sparsam wirtschaften.<br />
Wie hat man sich dann weitergeholfen?<br />
Mit Tauschen. Aus diesem Grund kamen auch viele aus ihren zerbombten<br />
Großstädten in den ländlichen Ankuhn. Hier gab es eben Lebensmittel. Ich war<br />
einmal auch mit meiner Tante bei einem, der Möhren zog.<br />
links: Selbstversorgung durch Feldarbeit<br />
Ein andermal war ein Mann mit einem Strauß<br />
Kamille bei uns. Er wollte sie gegen einen<br />
Brotkanten eintauschen. Wir hatten keinen mehr und<br />
noch dazu war es zu seinem Unglück keine echte<br />
Kamille. Das tat mir doch in der Seele weh. Man<br />
tauschte aber auch Kleidung, Schuhe und andere<br />
Haushaltsgegenstände. Es fehlte ja nicht nur an<br />
Nahrungsmitteln. Auch Brennstoffe waren knapp.<br />
Man konnte sich vom Förster eine Erlaubnis zum<br />
Hakholz sammeln geben lassen.<br />
Könnten Sie uns das mit dem Hakholz erklären?<br />
Wer hatte, ging mit einem Handwagen in den Wald.<br />
Mit einer langen Stange, an der ein Haken war,<br />
hakte man trockene Äste von den Bäumen. Mir fällt ein: Meine Mutter hat auch<br />
auf Arbeit eine Kohle mitgehen lassen. So groß war die Not.<br />
Ihre Mutter und Schwester kamen also für den Unterhalt auf. Wie sah es mit<br />
Ihnen aus? Ihre Schulzeit wurde vom Krieg unterbrochen.<br />
Ich ging bis zum Freitag vor dem 16. April zur Schule. Im August/September<br />
1945 begann dann das neue Schuljahr. Es war aber nicht so, dass wir im<br />
Sommer ´45 frei hatten. Wir mussten auf den Acker und Kartoffelkäfer<br />
sammeln. Je Käfer gab es 1 Pfennig und je Gelege sogar 3 Pfennige.<br />
Es wurde in Schichten in der Schule Am Rephuns Garten unterrichtet. Es war<br />
die einzige nach dem Krieg in <strong>Zerbst</strong>, daher ging die erste Hälfte der Schüler<br />
von 7 Uhr bis Mittag zur Schule und darauf die zweite. Dort war ich bis zur 6.<br />
Klasse. Die letzten beiden Jahre ging ich dann im heutigen Rathaus zur Schule.
Was war noch charakteristisch für die Schule der Nachkriegszeit?<br />
Teilweise lief man barfuß, weil man keine Schuhe hatte oder man turnte in<br />
Unterwäsche, weil man kein Sportzeug besaß. Etwas, was heute unvorstellbar<br />
ist: es gab kein Papier. So schrieb ich u. a. auch lange Texte auf Zeitungsränder.<br />
„Man hatte nichts“, sagten Sie. Inwieweit waren die Menschen bereit, sich<br />
gegenseitig zu helfen?<br />
Also, es war schon die Hilfe von einem zum anderen da. In Bornum hausten wir<br />
kurzzeitig in einer Scheune ohne Gegenleistung. Das passierte halt aus der Not<br />
heraus. Aber jeder versuchte sich selbst erstmal zu helfen. Man brauchte eben<br />
selber.<br />
Können Sie sagen, dass Ihr weiteres Leben von dieser Zeit geprägt wurde?<br />
Auf jeden Fall. Ohne Fleiß und Arbeit geht es nicht. Wir durften die Arbeit<br />
damals nicht scheuen, wir mussten aus dem Nichts etwas aufbauen. Hätten wir<br />
nicht fleißig gearbeitet, hätten wir uns nicht das geschaffen, was wir heute<br />
haben. Es wird einem nie etwas in den Schoß fallen. Außerdem muss man auch<br />
andern helfen. Man muss solidarisch denken. Und zudem sparsam sein. Nichts<br />
kaufen, was man nicht unbedingt braucht. Zuletzt: wenn man etwas nicht kann,<br />
muss man es lernen. Es führt kein Weg daran vorbei.<br />
Kleiner Wall 32, vor 1936<br />
Anmerkung: Das Bildmaterial wurde vom Befragten zur Verfügung gestellt.<br />
aufgezeichnet von Andrea Thiem, Klasse 10/3
Der Krieg bedeutete für viele Menschen Leid, Angst und Tod. So spielte dieser<br />
Schmerz auch für unsere Familie eine große Rolle im und nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg. Meine Großmutter, Herta Ritter, die beim Ausbruch des Krieges erst<br />
elf Jahre alt war, berichtet über ihre Erlebnisse.<br />
Kriegsbeginn<br />
Auf meine erste Frage, wie sie vom Krieg erfahren habe, holte sie weit aus, denn<br />
Anzeichen gab es angeblich schon länger. Bereits im Sommer 1939 kamen<br />
Soldaten in ihr Heimatdorf Wikoline in Niederschlesien und verlegten Draht auf<br />
den Feldern und bauten Schützengräben und Bunker. Zu der Zeit ahnten die<br />
Menschen im Ort schon, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Noch<br />
ein Zeichen gaben auch andere Soldaten. "Öfters kamen Soldaten zu uns nach<br />
Hause, übernachteten dort einmal, zogen dann aber sofort weiter", so Herta<br />
Ritter. Einige Tage bevor der Krieg dann wirklich ausbrach, kam ein Mann aus<br />
der Stadt und gab bekannt, dass der Krieg bald beginnt. Es herrschte immer<br />
mehr Panik und die Wikoliner wurden unruhiger. Am 1. September ´39 war es<br />
dann soweit: Der Krieg brach aus! Die Kinder, darunter auch meine Großmutter<br />
mit ihrem Bruder, rannten aus den Häusern, versteckten sich hinter<br />
Gartenzäunen und zählten hunderte von Flugzeugen, die über den Ort, der nur 3<br />
km Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt liegt, flogen. Es war sowieso<br />
eine Seltenheit mal ein Flugzeug zu sehen – aber plötzlich waren es so viele!<br />
Eins war damals klar: Das konnte nichts Gutes heißen...<br />
Nach 3 Wochen war Polen überrannt und für die Menschen aus Wikoline ging<br />
alles normal weiter.<br />
Flucht<br />
Vom weiteren Verlauf des Krieges hörten die Leute nur über das Radio.<br />
Im Herbst 1944 rückte die Ostfront näher. Manche Familien nahmen<br />
Flüchtlingskinder auf. Auch die Familie meiner Oma hatte ein Pflegekind. Trotz<br />
der näher kommenden Ostfront wurde bei der letzten Einwohnerversammlung<br />
noch behauptet, es bestehe keine Gefahr und alles könne geregelt weitergehen.<br />
Dadurch waren die meisten Bürger vorerst beruhigt, doch dies währte nicht<br />
lange. Schon einen Tag später kam der Befehl zur Flucht für Kinder und<br />
Senioren bis hinter die Oder. Die Menschen wurden aufgeteilt auf Pferd und<br />
Wagen, z.B. musste Hertas Bruder mit der Frau des Lehrers und ihren 3 kleinen<br />
Kindern, einer Rentnerin vom Gut und mit dem Pflegekind nach Mlitsch fliehen.<br />
Da sie nach 5 Tagen wieder zurückkehren sollten, blieben Herta und ihre Mutter<br />
zu Hause, um das restliche Vieh zu versorgen, bis der Bruder zurückkehrt (Der<br />
Vater war derzeitig Soldat). Doch leider wurde aus diesem Vorhaben nichts,<br />
denn wiederum einen Tag später, am 21. Januar 1945, hieß es: "Fertigmachen,<br />
wir müssen alle hinterher. Treff ist um 9 Uhr auf dem Dorfplatz." Sichtlich<br />
berührt schildert Frau Ritter die damaligen Bedingungen. Es waren nämlich<br />
-10°C und es lag eine 30 cm hohe Schneeschicht. Zu allem Übel kam hinzu,<br />
dass sie mit dem Fahrrad fahren mussten, denn der Bruder hatte ja den
Pferdewagen. Tag und Nacht fuhren sie und kamen nach knapp 2 Tagen an.<br />
Endlich Mlitsch erreicht, wollten sie sich von den Strapazen der Fahrt erholen,<br />
doch auch daraus wurde nichts, denn durch Lärm und Krach konnten sie nicht<br />
schlafen. Es ging das Gerücht herum, dass das Treibeis auf der Oder gesprengt<br />
wird, aber schon am nächsten Tag erfuhren sie, dass die Oderbrücke zerstört<br />
worden war, d.h. dass niemand wieder zurück konnte. Kurze Zeit später mussten<br />
sie wieder weiter und so zogen sie von Ort zu Ort. Nicht weit von Dresden<br />
entfernt erlebten sie den "Bombenhagel der Amerikaner, als Dresden zerstört<br />
wurde." Von den Behörden wurde festgelegt, dass sie sich in Niederwirschnitz<br />
im Erzgebirge niederlassen sollen und so kamen sie nach 4 Wochen am 19.<br />
Februar ´45 dort an. Alle Familien wurden zu verschiedenen Bauern aufgeteilt<br />
und arbeiteten dort. Im Ort lebten noch viele andere Flüchtlinge. "Wir fühlten<br />
uns zwar nicht sehr wohl, aber waren froh, endlich mal wieder etwas schlafen zu<br />
können!", berichtete sie mir. Dieser "Luxus" währte allerdings auch nicht lange,<br />
denn wegen "Fliegeralarm und Bombenbeschuss" mussten sie sich alle im<br />
Keller einquartieren. Am 8. Mai 1945 kam dann die Erlösung: Der Krieg war<br />
vorüber!!! Ein Amerikaner gab das lang ersehnte Kriegsende bekannt. Endlich<br />
konnten sie beruhigt schlafen in voller Vorfreude auf die alte Heimat. "Alle<br />
wollten so schnell wie möglich zurück und die Felder bestellen. Deshalb ist der<br />
komplette Ort Wikoline, der mit im Erzgebirge untergebracht war, wieder in<br />
Richtung Heimat gezogen!", schilderte Frau Ritter. Allerdings war das ohne<br />
Erfolg, denn an der Neiße angekommen, wurde niemand über den Fluss<br />
gelassen und so warteten sie dort 3 Wochen in der Hoffnung, doch noch ans Ziel<br />
zu gelangen. Jedoch vergebens!!!<br />
Der weite Weg bis in die jetzige Heimat<br />
Da es nun an der Neiße nicht weiterging, mussten sie umkehren bis nach Linz in<br />
Sachsen. Wieder kamen sie zu einem Bauern und durften dort für Arbeit<br />
wohnen. Der Bauer hatte keine Pferde und deshalb kamen ihm die Wikoliner<br />
mit ihrem Vieh gerade recht. Auf meine Frage, ob sie für die Feldarbeit Geld<br />
bekamen, antwortete Frau Ritter, dass sie Glück hatten und eine Mark pro Tag<br />
bekamen, während andere Familien nichts bekamen. Fast alles schien gut: Der<br />
Krieg war vorbei und sie hatten eine Arbeit und eine Unterkunft, nur der Vater<br />
war noch in Gefangenschaft. Dann die Überraschung: Im September kam er<br />
vorzeitig aus russischer Gefangenschaft, da er krank war, denn er hatte Wasser<br />
in den Beinen und Probleme mit dem Herzen. Endlich war die Familie wieder<br />
komplett. Noch knapp 3 Jahre lebten sie in Linz bis ihnen zu Ohren kam, dass in<br />
Buhlendorf ein Gut aufgelöst wird. Prompt bemühten sie sich um<br />
eine Siedlerstelle, die sie dann auch bekamen. Am 21. Juli 1948 erreichten sie<br />
Buhlendorf nach 2 Tagen Bahnfahrt. Um so schnell wie möglich das Haus fertig<br />
zu bekommen, packten alle mit an. "Früher war das nicht so wie heute. Selbst<br />
Kinder mussten mithelfen. Man konnte nicht mal eben schnell ein Haus bauen<br />
lassen. Das musste selber erledigt werden!", so Herta Ritter.
Nahrung und Trinkwasser<br />
Neues Dorf, neues Haus, neues Feld - woher also neue Nahrung? Auf diese<br />
Frage wurde mir folgendermaßen geantwortet: "Da das Gut aufgelöst worden<br />
war, bekam jeder einen Zentner Getreide und 2 Schafe. Das reichte vorerst<br />
solange, bis man die Felder selber bestellt hatte. Später hatten wir sogar eine<br />
eigene Kuh." Auch das "Trinkwasserproblem" ist ganz gut gelöst worden, selbst<br />
wenn es ziemlich knapp war. Es gab nämlich nur eine Wasserstelle im Dorf.<br />
Zuerst wurde es mit Eimern geholt, später dann mit einem Wasserwagen. Das<br />
erleichterte den Transport extrem.<br />
Unerwartete Wiedersehensfreude<br />
Im Krieg hatten sie viele Tanten, Cousinen und Freunde durch die Flucht aus<br />
den Augen verloren. Glücklicherweise fanden sie sie alle durch Zufall wieder<br />
und die Freude darüber war groß.<br />
Nun begann ein neues Leben, das sich anfangs als schwierig erwies, aber mit der<br />
Zeit immer besser wurde. Bald fand Herta in ihrem Nachbarn ihre große Liebe<br />
und das neue Leben machte ihr wieder Spaß...<br />
aufgezeichnet von Katrin Ritter, Klasse 10/4<br />
Ich habe Meta Schulze (95) aus Lindau befragt, wie sie die Zeit zwischen 1945-<br />
1949 persönlich erlebt hat. Sie schilderte den Kampf ums Überleben und wie<br />
erleichtert sie nach dem Krieg war, hatte aber Angst vor der Zukunft. Ihre<br />
Erfahrungen und Erlebnisse möchte ich in einem Text zusammenfassen.<br />
Meta Schulze lebte nach dem Krieg mit ihren zwei Söhnen Gerhard und Horst,<br />
ihrer Mutter und einigen zugeteilten Umsiedlern in Lindau in einem schönen<br />
großen Haus bzw. Bauernhof, wo sie und ihre Familie einen<br />
Landwirtschaftsbetrieb besaßen. Im Dorf gab es genug Trinkwasser und<br />
Nahrung, wovon die Bewohner in Lindau lebten, aber es wurde bzw. musste<br />
untereinander in der Stadt, in den Familien und bei den Umsiedlern aufgeteilt<br />
werden. Meta erzählte auch, dass es in der Zeit von 1945-1949<br />
Lebensmittelkarten gab. Da sie aufgeteilt werden mussten und es nur wenige<br />
gab, hatten manche Bewohner, die selbst keine Landwirtschaft besaßen, zu<br />
wenig zum Essen. Durch Familie Schulzes eigene Landwirtschaft besaßen sie<br />
Acker und Tiere und konnten sich deshalb gut selber versorgen. Probleme mit<br />
Geld gab es auch nicht, da sie ihre überschüssigen Produkte gewinnbringend<br />
verkaufen konnten. Durch die viele Arbeit auf dem Hof gab es auch ein<br />
Dienstmädchen im Haus, das gut bezahlt wurde. Am 01.05.1945 kamen<br />
Amerikaner und forderten die Bewohner auf, alle Waffen abzugeben. Einen Tag<br />
später waren sie über die Elbe wieder verschwunden. Metas Verkehrsmittel zu<br />
dieser Zeit war ein Fahrrad, mit dem sie überall hinfuhr und all ihre
Erledigungen machte. Meta war verheiratet und ihr Mann Willy war 1945 im<br />
Rückzug aus Frankreich nach Naumburg an der Saale gekommen und schrieb<br />
seiner Ehefrau Meta einen Brief, dass er bald nach Hause kommen würde. Sie<br />
sollte sich keine Sorgen machen. Meta bekam diesen Brief, freute sich und<br />
wartete, aber nach einiger Zeit bekam sie wieder einen Brief aus Belgien, wo<br />
drin stand, dass er von den Amerikanern in Belgien gefangen gehalten wird und<br />
unter Tage arbeiten muss.<br />
Als die Russen kamen, musste die Familie Schulze ihr Haus für ein halbes Jahr<br />
verlassen, sie fanden eine Unterkunft bei Verwandten in Lindau. Das eigene<br />
Haus wurde von Russen bezogen und von Polen geplündert. Nach einem halben<br />
Jahr wurde das Haus aber wieder zurückgegeben, damit sie dort weiter arbeiten<br />
konnten. Zusammen mit Leuten aus Polen musste Meta in der Landwirtschaft<br />
unter Aufsicht der Russen arbeiten, aber Meta hatte ziemlich große Angst und<br />
Respekt, deshalb versteckte sie sich öfters, da die Russen versucht haben sie zu<br />
vergewaltigen. Nach der bedingungslosen Kapitulation im Mai lagen noch<br />
Verwundete in der Scheune bei Schulzes, die dann aber herüber nach<br />
Westdeutschland wollten und Meta sollte mitkommen, aber da sie eine Familie<br />
hatte, blieb sie in Lindau. 1947 kam ihr Mann wieder aus der Gefangenschaft<br />
und alle waren überglücklich. Sie nahmen zu dieser Zeit auch einen zugeteilten<br />
Umsiedler aus Schlesien auf. Ausgebombte wurden auch in Lindau von jedem<br />
aufgenommen. Das Jahr 1947 war sehr trocken im Klima und brachte nicht<br />
soviel Ernte und es gab deshalb wenig zu essen und alle Bauern mussten einen<br />
Soll an Nahrungsmitteln abgeben. Es wurde ihnen auch vorgeschrieben, was sie<br />
anzubauen hatten. Es kamen viele Leute auch aus anderen Städten, die mit den<br />
Dorfbewohnern Ware gegen Nahrungsmittel tauschten. 1948 gab es eine andere<br />
Währung in Deutschland, da es in West und Ost geteilt wurde. Von Lindau<br />
wurden auch Reparationsleistungen für die Russen verlangt. Zum Beispiel<br />
wurde das komplette zweite Bahngleis abmontiert und nach Russland gebracht.<br />
Am 07.10.1949 wurde die DDR gegründet, zu dieser Zeit hatte dann Meta auch<br />
keine Umsiedler mehr im Hause.<br />
Ich hoffe, ich konnte mit meinem Beitrag Metas Leben in der Nachkriegszeit<br />
verdeutlichen und nachvollziehbar machen. An einigen Stellen hat man im<br />
Interview gemerkt, wie schwer es ihr fiel, auf manche Fragen zu antworten, wo<br />
man doch schlechte Erinnerungen hervorholte und man sah, wie ihr Leben als<br />
Tochter, Ehefrau und Mutter in guten und schlechten Zeiten war. Mir selber hat<br />
das Interview Spaß gemacht und ich war sehr gerührt über die Ereignisse in der<br />
Zeit von 1945-1949, die Meta durchlebte.<br />
aufgezeichnet von Jenny Lorenz, Klasse 10/4
Waren Sie ein Flüchtling? Wenn ja, aus welchem Ort mussten Sie fliehen?<br />
Ja, meine Familie und ich (Hans Georg Semrau, geb. 1936) wurden im Februar<br />
1945 von den Russen vertrieben. Wir mussten unser Grundstück in Grünthal<br />
verlassen und wir wurden ausgeraubt. Nach 14 Tagen, die wir noch auf unserem<br />
Grundstück verbringen durften, flohen wir nach Turwangen. Dies war ein<br />
Nachbargrundstück, auf dem wir bis 1947 lebten. Alle Einwohner wurden von<br />
den Russen erschossen und deren Rinder und Schweine liefen in den Wald oder<br />
frei umher.<br />
Wurden Sie von Ihren Eltern getrennt?<br />
Als die Russen zu unserem Grundstück kamen, nahmen sie meinen 43-jährigen<br />
Vater und meinen 71-jährigen Opa gefangen. Sie sollten nach Sibirien geschickt<br />
werden. Uns Kindern sagte meine Mutter, sie kämen bald wieder, um uns zu<br />
beruhigen. Mein Vater und mein Opa wurden, wie auch alle anderen Männer aus<br />
unserer Umgebung, auf einen Wagen verladen und nach Sensburg gebracht.<br />
Dort wurden sie von den Russen verhört. Mein Vater überlebte die Überfahrt<br />
nach Sibirien nicht, da er schon vorher etwas kränklich war. All diese<br />
Informationen bekamen wir von einem Überlebenden, der aus Sibirien<br />
zurückkehrte.<br />
Wurden Sie jemals von Soldaten eines anderen Landes bedroht?<br />
Ich wurde nicht direkt bedroht, da ich mich immer versteckte. Wie ich schon<br />
erzählte, wurden aber mein Vater und mein Opa von Soldaten der Sowjetunion<br />
bedroht und verschleppt. Junge Frauen wurden vergewaltigt, daher versteckten<br />
sich meine älteren Schwestern. Doch meine älteste Schwester wurde entdeckt<br />
und von den Russen bedroht, meine Mutter reagierte und wir mussten unseren<br />
Familienschmuck ausgraben, um meine Schwester freizukaufen. Wir hatten<br />
noch einmal Glück.<br />
Wie schafften Sie es in der Nachkriegszeit zu überleben?<br />
Heute muss ich sagen, wir haben einen großen Anteil, dass wir überlebten und<br />
zusammen geblieben sind, meiner Mutter und meiner ältesten Schwester zu<br />
verdanken. Vor allen Dingen unser Glaube hat uns sehr geholfen. Wir gingen<br />
jeden Sonntag in die Kirche, auch nach unserer Vertreibung.<br />
Hatten Sie genügend Trinkwasser?<br />
Wir hatten immer genügend Trinkwasser, denn auf dem Grundstück, auf dem<br />
wir bis 1947 lebten, war ein Ziehbrunnen. Daraus bekamen wir Brunnenwasser<br />
zum Trinken, Waschen und Kochen.<br />
Woher bekamen Sie Ihre Nahrung?<br />
Im Sommer 1946 gingen meine beiden ältesten Schwestern zu Polen arbeiten.<br />
Ihr Lohn waren Getreide und Rüben, die wir nötig brauchten. Das Getreide<br />
wurde, wie wir es damals nannten, geschruddelt zur Weiterverarbeitung.
Manchmal fing ich ein bis drei Hasen, die es an besonderen Tagen zu essen gab.<br />
Außerdem gab es auf dem Grundstück noch Reste von Zucker, Mehl und<br />
Getreide. Daraus kochten wir hauptsächlich Grütze. Grütze war unser<br />
Hauptnahrungsmittel. Sehr oft pflückten wir Brennnessel, Melde oder<br />
sammelten Kartoffeln. Wenn die Russen das herum laufende Vieh schlachteten,<br />
ließen sie die Därme und Pansen liegen, welche wir uns nahmen. Im Winter<br />
fingen wir Eichelhäher mit Siebfallen. Diese Tiere waren eine besondere<br />
Spezialität. Heutzutage kann man sie mit einer kleinen Taube vergleichen, die<br />
man nur als Sonntagsessen bekommt. 1947/48 waren sehr schwere Jahre für<br />
meine Familie und mich, da es sehr wenig Nahrung gab.<br />
Was war Ihr Ankunftsort? Wie wurden Sie aufgenommen? Wurden Sie verachtet<br />
oder herzlich aufgenommen?<br />
Bevor ich erzähle, wo wir ankamen, finde ich es wichtig zu erzählen, wie wir<br />
den langen Weg zurücklegten. Im Mai 1947 sollten alle Ostpreußen die<br />
polnische Staatsbürgerschaft erhalten. Meine Familie unterschrieb diese<br />
Formulare nicht, also mussten wir Polen verlassen. Anfang Juni wurden wir mit<br />
einem Güterzug ausgesiedelt. Meine Mutter war schon vorbereitet. Sie hatte für<br />
jeden einen kleinen Rucksack aus Leinenhandtüchern genäht. Zuerst mussten<br />
wir zum Bahnhof von Rastenburg. Und unsere Endstation war Jütrichau in<br />
Sachsen-Anhalt. Von dort aus hatten wir einen Fußmarsch nach Wertlau ins<br />
Lager, in dem wir entlaust, unsere Kleider entkeimt und wir gewaschen wurden.<br />
Am 16./17. Juli kam ein Bauer aus Dobritz mit seinem Pferd zum Lager und<br />
holte uns ab. Wir mussten gezwungener Weise untergebracht werden. Bei dem<br />
Bauern bekamen wir ein Zimmer. Meine Mutter, meine 5 Geschwister und ich<br />
lebten dort für einige Zeit. Unser Zimmer war nach drei Tagen mit Wanzen<br />
befallen, was wir nicht von zu Hause kannten. Meine Mutter besorgte sich<br />
Schwefel um unsere Unterkunft auszuschwefeln. Wir mussten drei Tage in der<br />
Scheune übernachten. Meine Familie und ich waren unbeliebt, da wir fremd<br />
waren. In Dobritz gab es noch viele andere Flüchtlinge und so war es für mich<br />
nicht schwer neue Freundschaften zu schließen. Vor der Nachkriegszeit hatte<br />
Dobritz etwa 200 Einwohner, mit den Flüchtlingen gab es 600 Dobritzer.<br />
aufgezeichnet von Lydia Meerkatz, Klasse 10/4<br />
Meine Oma Walli Karge (geb. Röschke) wuchs mit vier weiteren Geschwistern<br />
in Östlich-Neufähr, einem Fischerdorf in der Nähe von Danzig, auf. Ihr Vater<br />
Erich Röschke ernährte die Familie, indem er sich durch Fischen in der Ostsee<br />
Geld verdiente. Als der Krieg begann, wurde ihr Vater einberufen, um in Polen<br />
zu kämpfen. Nach 12 Tagen wurde Erich Röschke aufgrund eines Kopfschusses<br />
ins Lazarett nach Königsberg geliefert, in dem er fünf Jahre blieb. Er wurde von
seinen eigenen Landsleuten angeschossen, weil er die Erkennungsparole nicht<br />
nennen konnte. Ihr Bruder Leo Röschke wurde 1943 als Soldat bei der Marine<br />
eingezogen.<br />
Meine damals 13-jährige Oma erinnert sich, wie ihre Familie in einer Aprilnacht<br />
im Jahre 1945 von deutschen Soldaten aufgefordert wurde, ihr Zuhause<br />
schnellstmöglich zu verlassen. Die Familie hatte keine Zeit mehr, irgendwelches<br />
Hab und Gut einzupacken, also blieb ihnen nur das, was sie am Körper trugen<br />
und alle anderen Gebrauchsgegenstände, Papiere und sonstige Erinnerungsstücke<br />
mussten sie in der Eile der Flucht zurücklassen. Umgebene Dörfer<br />
und auch das von weiten zu erkennende Danzig gingen durch alliierte<br />
Bombenangriffe in Flammen auf. Zum kleinen Hafen des Fischerdorfes rennend<br />
wurde meine Oma Zeuge eines heillosen Durcheinanders: Sie erinnert sich an<br />
die vielen Tiere, die von ihren Weiden in Ostpreußen immer weiter nach<br />
Westpreußen gedrängt wurden, an die anderen Menschen im Dorf, die ihre<br />
Heimat verlassen mussten und an die brennende Landschaft. Mit Fischerbooten<br />
wurden die Familien auf die vor der Danziger Bucht liegenden Halbinsel Hela<br />
verschifft und von dort aus brachte sie das nächste Schiff nach Gotenhafen.<br />
Als sie dort ankamen, trafen sie auf tausende Flüchtlinge, die größtenteils mit<br />
der Gustloff nach Gotenhafen fahren sollten. Elli Röschke, eine ältere Schwester<br />
meiner Oma wurde durch die riesigen Menschenmassen vom Rest der Familie<br />
getrennt und rettete sich mit der Lützow (ehemals Deutschland) trotz<br />
zweimaliger Bombardierungen nach Dänemark. Aber dennoch hatte auch die<br />
Familie meiner Oma vor, mit der Gustloff zu fliehen, da dieses Schiff ja ein<br />
großes und angeblich sehr sicheres Gefährt war. Doch der Opa meiner Oma, ein<br />
erfahrener Fischer, konnte sich denken, dass gerade große Schiffe bevorzugte<br />
Versenkungsziele der alliierten Flieger waren. Deshalb ließ er unter den<br />
tausenden Flüchtlingen Hulda Röschke, die Mutter meiner Oma, und ihre<br />
Kinder ausrufen, um an einem vereinbarten Ort am Hafen mit ihm neu<br />
zusammenzukommen. Als sich die Familie dort getroffen hat, fuhr sie mit einem<br />
Fischkutter auf die offene See, wo sie auf einen Schwimmbagger trafen, der die<br />
Flüchtlingsfamilie aufnahm. Diese Zeit auf dem Schwimmbagger, der sie nach<br />
Stralsund bringen sollte, war geprägt von fürchterlicher Angst und vom Kampf<br />
ums Überleben, denn die Bomben fielen nicht weiter entfernt als 20 Meter ins<br />
Wasser. Zusammen mit drei anderen Familien, die mit an Bord waren, hat meine<br />
Oma ausgeharrt und darauf gehofft, dass keine Bombe den Schwimmbagger<br />
treffen möge, denn das wäre ihr sicherer Tod gewesen. Meine Oma hört noch<br />
heute den Lärm der Bomben, die unmittelbar neben ihnen in die Ostsee stürzten.<br />
Doch ihr Opa hat ihrer Familie durch seinen Ausruf am Gotenhafener Hafen das<br />
Leben gerettet, denn die Gustloff ist bei dieser Fahrt bombardiert worden und<br />
alle Menschen, die sich an Bord befanden, sind ums Leben gekommen. Die<br />
Lützow, auf der sich die Schwester meiner Oma befand, ist bei einem darauf<br />
folgenden Flüchtlingstransport untergegangen. Unter den Toten war auch der
Cousin meiner Oma mit seiner Frau und drei Kindern. Glücklicherweise ist die<br />
Familie meiner Oma sicher in Stralsund eingetroffen und wurde weiter mit der<br />
Bahn ins Strandbad Göhren auf die Insel Rügen transportiert. Die Flüchtlinge<br />
erfuhren Unterstützung durch den Bürgermeister Göhrens, der ihnen<br />
Notunterkünfte zuwies, die den mittellosen Familien ein Dach über dem Kopf<br />
boten. Die Zeit nach der Flucht erwies sich als sehr schwer, denn nur wenige<br />
Flüchtlinge haben Arbeit gefunden und waren somit nicht mehr auf die<br />
Unterstützung von den Göhrener Bürgern angewiesen. Erst als 1947 die ersten<br />
Urlaubsgäste wieder das Strandbad aufsuchten, konnte sich meine Oma als<br />
Zimmermädchen und Kellnerin im Waldhotel ihr Gehalt verdienen, das 70 DM<br />
betrug. Beim Arbeiten im Hotel lernte sie 1948 Herrn Dr. Dengler kennen, der<br />
zusammen mit seiner Familie Urlaub in Gören machte. Herr Dr. Dengler war in<br />
Berlin als Chefredakteur der Zeitung Vorwärts beschäftigt und seine Frau war<br />
Vorsitzende des DFD (Demokratischer Frauenbund Deutschlands). Meine Oma<br />
wurde gefragt, ob sie nicht Kindermädchen bei den Denglers in Berlin werden<br />
möchte und somit verließ sie 1948 Göhren und trat als Kindermädchen in<br />
Stellung. In Berlin, wo meine Oma im russischen Sektor lebte, blieben ihr die<br />
Trümmerfrauen, die mit bloßen Händen die zerstörte Stadt wieder aufbauten,<br />
besonders in Erinnerung. In dieser Zeit fand man mittels eines Suchdienstes<br />
auch die bei der Flucht verlorene Schwester Elli wieder, die in Dänemark in<br />
einem Flüchtlingslager untergebracht war und somit zur Familie nach Göhren<br />
zurückkehren konnte. In Berlin lernte meine Oma den S-Bahnführer Ernst Karge<br />
kennen, den sie später heiratete und zu ihm nach Königs Wusterhausen zog und<br />
dort eine eigene Familie gründete.<br />
Meine Oma erinnert sich nicht gern an den Krieg und die damit verbundenen<br />
Leiden und Schrecken zurück: die Flucht aus der Heimat, die Ängste während<br />
der Flucht und den Neuanfang in einer fremden Stadt im zerstörten Deutschland.<br />
Dennoch ist es ihr sehr wichtig, dass die Generation, die zur Zeit des<br />
Nationalsozialismus gelebt hat, ihre Erinnerungen weitergibt, um zu verhindern,<br />
dass derartiges je wieder passieren kann.<br />
aufgezeichnet von Pia Karge, Klasse 10/4<br />
Bericht einer Zeitzeugin von ihrer Gefangennahme bis zur Freilassung.<br />
Sie möchte gerne anonym bleiben.<br />
Nach einer Denunziation wurde ich am 13.5.1945 im Alter von 23 Jahren von<br />
einem sowjetischen Offizier verhaftet. Der Grund war meine Tätigkeit als<br />
Schreibkraft beim damaligen Sicherheitsdienst der SS, zu der ich als Angestellte<br />
der Stadtverwaltung in <strong>Zerbst</strong> aufgefordert worden war und die ich von 1942 bis<br />
April 1945 ehrenamtlich ausübte. Fünf Polizisten brachen mich nach Rosslau,
wo man mich verhörte. Nach drei Tagen wurde ich nach <strong>Zerbst</strong> zurückgebracht.<br />
Ein Protokoll wurde zwar angefertigt, ich bekam es aber nie zu Gesicht. In<br />
<strong>Zerbst</strong> kam ich in den Keller eines Hauses Am Klapperberg. Die Bewohner der<br />
Fohlenweide-Siedlung hatten Hals über Kopf ihre Häuser räumen müssen, damit<br />
dort in dem relativ abgeschlossenen Wohngebiet die GPU (Sowjetische<br />
Geheimpolizei) ihr Quartier aufschlagen konnte.<br />
In dem Keller erwartete mich Schreckliches. Ich traf dort auf 40 Russinnen, die<br />
von den Deutschen aus ihrer Heimat zur Zwangarbeit verschleppt, aber nun von<br />
ihren eigenen Leuten als Kollaborateure behandelt wurden. Diese Menschen<br />
waren also doppelt bestraft. Dementsprechend war auch der Hass, der mir<br />
entgegenschlug. Drei Wochen musste ich diese Tortur ertragen, bis wir auf<br />
einen LKW, dicht gedrängt stehend, nach Frankfurt/Oder transportiert wurden.<br />
Doch im September besetzen die Polen Frankfurt. Die Deutschen mussten den<br />
Ort verlassen und wir wurden zu Fuß in das 60 km entfernte Lager Jamlitz bei<br />
Cottbus getrieben. Dabei gab es die ersten Toten. Wir wurden dort zu 200<br />
Personen in eine Baracke gepfercht. Auf dem blanken Holzfußboden hatten wir<br />
etwa 50 cm Platz zum Schlafen. Die Verpflegung bestand täglich aus 300 g Brot<br />
und einen halben Liter Wassersuppe. Noch viel schlimmer war die völlige<br />
Isolierung. Die Nachrichtensperre war vollkommen.<br />
Wir wussten nichts von unseren Angehörigen, die auch nicht erfuhren, ob wir<br />
noch am Leben waren. Und dann die schreckliche Ungewissheit, was man mit<br />
uns vor hatte, das Warten auf eine Verurteilung, die nie erfolgte. Die quälenden<br />
Gedanken an das Schicksal unseres Landes ließen uns nicht los, denn wir hatten<br />
keine Ahnung, was in der Welt vorging<br />
Ein Gerücht jagte das andere. Manchmal durften wir unter Bewachung<br />
außerhalb des Lagers für die Lagerleitung Sauerampfer pflücken oder Kartoffeln<br />
sortieren. Das bedeutete „Freiheit“ für ein paar Stunden. Jeden Tag fragten wir<br />
uns: „Wie lange müssen wir das noch ertragen?“<br />
Im August 1947 ging es wieder auf Transport per Güterzug in das NKDW-<br />
Speziallager Mühlberg bei Torgau/Elbe. Und unser Leiden ging weiter. In<br />
Mühlberg setzte das große Sterben ein. Auf Grund der mangelhaften Ernährung<br />
litten Hunderte, ja Tausende der Gefangenen an Dystrophie – wir nannten sie<br />
Hungerkrankheit – die unweigerlich zum Tode führte. Es war von 8000-9000<br />
Toten während unserer Zeit in Mühlberg die Rede. Bei jedem Zählappell stellten<br />
wir neue Lücken fest, vor allem in den Reihen der Männer.<br />
Wie hat man das alles überstanden? Ein starker Wille und eiserne Disziplin<br />
verhinderten die Selbstaufgabe. Wir waren ja noch so jung, wir wollten leben.<br />
Gleichgesinnte fanden sich zu einer festen Gemeinschaft zusammen. Die<br />
Kameradschaft, die Freundschaft, das Beieinandersein, die Übereinstimmung<br />
der Gedanken und Gefühlen halfen uns über die schlimmsten Stunden hinweg.<br />
In dieser Zeit waren es vor allem zwei Frauen, die uns die Kraft zum Überleben<br />
gaben, einmal unsere Barackenältesten, die Schauspielerin Marianne Simson<br />
und die Schriftstellerin Gertrud Waldschütz, die ich bereits im Lager Jamlitz<br />
kennen gelernt hatte. Wir nannten sie liebvoll unsere „Lagermutti“. Mir hat sie
sogar einiger ihrer Gedichte gewidmet. Die Schauspielerin entriss uns dem<br />
Stumpfsinn, indem sie unseren Geist, unser Gedächtnis, unser Hirn trainierte.<br />
Wir mussten Gedichte und Balladen auswendig lernen. Wir spielten Theater.<br />
Alle Lieder, die wir kannten, wurden geübt und im Chor gesungen. Unseren<br />
Geburtstagskindern brachten wir Ständchen. Das half uns über die Tristesse des<br />
Lagerlebens hinweg. Wir ließen uns von dem Elend ringsumher nicht erdrücken.<br />
Alle aus unserem Kreis haben überlebt.<br />
Anfang Juli 1948 begannen die Entlassungen. Ich war inzwischen 26 Jahre alt.<br />
Vor jedem stand die bange Frage: „Was werde ich zu Hause vorfinden?“ Mir<br />
war es in all den Jahren ein einziges Mal gelungen, eine Nachricht<br />
hinauszuschmuggeln und einmal eine zu empfangen. Für mich schlug am 20.<br />
Juli 1948 die Stunde der Freiheit. Mitten in der Nacht kam ich in <strong>Zerbst</strong> an und<br />
wagte mich nicht nach Hause, um meine Eltern nicht zu erschrecken. Auf einer<br />
Holzbank auf dem Bahnhof verbrachte ich die Zeit bis zum Morgen. Auf dem<br />
Heimweg begegnete mir der damalige Oberbürgermeister Willy Wegener. Er<br />
erkannte mich, sprach mich an und stellte mir aber in der Stadtverwaltung in<br />
Aussicht. Ich war erleichtert. Doch erst musste ich mich auf der Kommandantur<br />
melden. Dort wurden mir Verhaltensmaßregeln gegeben und die Verpflichtung<br />
abgenommen, zu niemandem über meinen Aufenthalt in den Internierungslagern<br />
zu sprechen.<br />
So geritten wir in der Öffentlichkeit in Vergessenheit. Deshalb erfüllte es mich<br />
mit besonderer Genugtuung, dass wir nach der Wende durch die Zahlung einer<br />
Entschädigung Anerkennung fanden. Doch kein Geld der Welt kann diese<br />
verlorenen Jahre und all das Erlittene vergessen machen.<br />
aufgezeichnet von Anika Rau, Klasse 10/3<br />
Manche meinen, Geschichte gehe uns nichts an. Erst recht nicht jene<br />
Geschehnisse, die über 60 Jahre zurückliegen. Doch wer auf das 20. Jahrhundert<br />
zurückschaut, entdeckt die absolut größten Gewalttaten in der Geschichte. Viele<br />
Menschen mussten diese miterleben – wie auch der Zeitzeuge Franz Morawietz<br />
aus Straguth, der mir vor kurzem über seine Schicksalstage als Kind ausführlich<br />
berichtete, in denen Flucht, die vorbeiziehende Front, Hunger, Gewalt und die<br />
ersten Schritte in Richtung Neubeginn dazugehörten.<br />
Als das ganze Dorf Waldsiedel (Kreis Falkenberg in Oberschlesien), in dem er<br />
mit seiner Familie wohnte, am 22.01.1945 von der deutschen Wehrmacht<br />
evakuiert wurde, wusste dort noch keiner, wie schwer das Überleben werden<br />
wird. Die deutsche Wehrmacht brauchte ihre Unterkünfte, da sie den nahe<br />
liegenden Flugplatz zur Verteidigung benötigte. Der elfjährige Franz musste<br />
innerhalb weniger Stunden sein Zuhause verlassen und das Nötigste mitnehmen.<br />
Die Flucht war von den Erwachsenen vorbereitet, denn schon lange vorher
estand die Angst vor der russischen Front, die immer näher rückte. Die Pferde<br />
trugen die Lasten von den Betten, Essen, Heu und Hafer. Die Gruppe, bestehend<br />
aus der Familie von Franz Morawietz und anderen Dorfbewohnern, lief in<br />
Richtung Niederschlesien, nach Waldenburg, weiter nach Hirschburg und dann<br />
nach Reichenberg (dem heutigen Liberetsch) in die Tschechoslowakei.<br />
Eigentlich war geplant, dass sie über die Neiße nach Dresden gelangen, aber das<br />
hatten bereits die Russen blockiert. Somit gingen sie zu Fuß weiter bei -20°C bis<br />
-25°C und 3-5 cm Schnee über Prag bis kurz vor Bayern. Dort erfuhren sie von<br />
der deutschen Kapitulation. Somit durften sie in der Tschechoslowakei nicht<br />
bleiben, da diese wieder eigenständig wurde. Die Amerikaner boten ihnen an,<br />
gemeinsam nach Bayern zu gehen, mit der Bedingung, Pferde und Wagen<br />
zurückzulassen, oder sie gingen wieder zurück in die Heimat. Eine schwere<br />
Entscheidung, denn bis dahin waren sie ca. 600 km unter harten winterlichen<br />
Bedingungen gelaufen und hatten entweder im Freien, in Schulen oder in<br />
Gaststätten genächtigt.<br />
Sie gingen zurück, bis kurz hinter Prag, wo ihnen alles von den<br />
Tschechoslowaken weggenommen wurde, außer dem, was sie selber tragen<br />
konnten (hauptsächlich Lebensmittel). Dann wurden sie mit vielen anderen auf<br />
eine Wiese zusammengetrieben. Es gab kein Essen und kein Trinkwasser. Sie<br />
versuchten etwas Trinkwasser durch Regen aufzufangen, dennoch sind viele<br />
verdurstet. Auch Franz war mit seiner Familie und den anderen Dorfbewohnern<br />
dort, die den weiten Weg bis dahin überlebt hatten (ältere Menschen und Babys<br />
sind gestorben). Einige Tage später wurden alle (ca. 50 Leute) in einen Zug<br />
geladen, welcher nur nachts fuhr. Keiner wusste wohin. Endstation war<br />
Theresienstadt, das ehemalige KZ von Hitler. Dort hausten sie in Baracken,<br />
welche von den Tschechoslowaken überwacht wurden. Nun hatten sie die<br />
Hoffnung aufgegeben, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Wieder mussten<br />
sie alles abgeben, was diese verlangten. Die ihnen noch gebliebenen Zigaretten<br />
tauschten sie bei dem Aufpasser ihrer Baracke gegen ihre Freiheit ein. Früh halb<br />
drei kam ein LKW und brachte ca. 39 Leute vor die deutsche Grenze, wo sie<br />
tagelang die Grenzwacht beobachteten und sich dann durch den Wald über die<br />
Grenze in die sowjetische Besatzungszone schlichen.<br />
Ab da ging jede Familie ihren eigenen Weg. Es war bereits Juli 1945. Franz`<br />
Familie fuhr mit dem Zug ziellos von Stadt zu Stadt, im August waren sie auch<br />
schon einmal in <strong>Zerbst</strong>. Sie bettelten oder entwendeten unerlaubt Möhren und<br />
Kartoffeln von den Feldern, um nicht zu verhungern. Als in Jüterbog die Russen<br />
abzogen und die Kasernen frei wurden, gingen sie dort hin. Der Vater zog dann<br />
allein los, um sich Arbeit zu suchen. In Dobritz fand er diese und gleichzeitig<br />
eine Wohnung für seine Familie.<br />
Am 19. September 1945 kam die Familie von Franz Morawietz in Dobritz an,<br />
wo sie sich ein neues Zuhause aufbauten. Ab November 1945 ging Franz nach<br />
fast einem Jahr wieder zur Schule.<br />
Er war als elfjähriger 8 Monate unterwegs ohne ein Dach über dem Kopf, hatte<br />
nicht viel zu essen und ist ca. 1000 km gelaufen. Eine sehr schwere Zeit lag
hinter ihm und seiner Familie, aber auch die folgenden Monate waren nicht<br />
einfach, denn nach der Kapitulation Deutschlands blieb die Hungersnot in der<br />
sowjetischen Besatzungszone bestehen. Erst mit der Währungsreform 1948<br />
verbesserten sich die Lebensbedingungen.<br />
Zu seinen Verwandten, die in Oberschlesien bleiben konnten, aber die polnische<br />
Staatsangehörigkeit annehmen mussten, besteht jahrelanger Kontakt, auch durch<br />
persönliche Besuche. Im Jahr 1997, nach 52 Jahren, kam es zum Kontakt zu<br />
Bekannten, die damals in die britische Besatzungszone gingen.<br />
aufgezeichnet von Madlen Busse, Klasse 10/4<br />
Wie und wo hast du das Kriegsende erlebt?<br />
Ich (Waltraud Sanftenberg) verbrachte meine Jugend in Gehrden. Als der Krieg<br />
1945 endete, war fast das ganze Dorf, es waren ja größten Teils Frauen und<br />
Kinder, im Keller eines Großgrundbesitzers versammelt. Wir hörten, wie<br />
Maschinen langsam anrollten und viele Männer zu Fuß nebenher gingen.<br />
Plötzlich trat ein großer, dunkelhäutiger Amerikaner die Tür auf. Wir sollten alle<br />
die Hände hoch nehmen und hinter den Kopf halten und dann in einer Reihe<br />
herauskommen. Auf dem Hof wurden wir dann alle nach Waffen durchsucht,<br />
sogar die Kinder. Als festgestellt wurde, dass wir keine Waffen besaßen, durften<br />
wir uns wieder frei bewegen, jedoch war das Verlassen des Ortes nicht erlaubt,<br />
weil das Nachbardorf noch mit Deutschen besetzt war und wir sie hätten warnen<br />
können. Es wurden Panzergeschütze auf den Ort Lübs gerichtet, sodass die<br />
Ortschaft im Falle eines Angriffs hätte zerbombt werden können. In den<br />
nächsten Tagen rückten die Amerikaner weiter vor und nahmen auch Lübs ein<br />
und die, ich schätze 30, deutschen Soldaten wurden festgenommen.<br />
Was geschah nach Ende des Krieges?<br />
In einer Nacht wurde es plötzlich still. Wir gingen auf die Straße um zu schauen,<br />
was da los war. Alle Amerikaner zogen ab. Der Ort war in 10 Minuten komplett<br />
leer. Alle wunderten sich, was das zu bedeuten habe, jedoch wurde es uns am<br />
nächsten Morgen klar. Früh kamen Soldaten aus der Sowjetunion an. Sie<br />
bildeten eine Schlange, deren Ende wir gar nicht sehen konnten. Immer mehr<br />
Soldaten zogen durch unsere Straße und wir wussten nicht, was sie mit uns<br />
vorhatten. Sie kamen aus Richtung Leitzkau, zogen über Prödel, Lübs, Gehrden<br />
nach Gödnitz und schlugen in der Nähe des Waldes ihr Lager auf. Ab und zu trat<br />
ein Soldat aus der Reihe und ging in ein Haus. Sie beschädigten nichts, sondern<br />
wühlten "nur" herum und verließen das Haus dann wieder, meist mit einigen<br />
Flaschen Alkohol, die sie aus den Schränken der Leute nahmen. Später kamen<br />
Soldaten öfter in das Dorf, um Decken und Kissen zu holen. Nach Abzug der<br />
Truppen holten sich viele ihre zurückgelassenen Sachen wieder, da keine neuen
Kissen oder Decken zu haben waren. Die meisten kamen mit Pferden, hunderten<br />
von Pferden. Die Schmiede in Gehrden hatten viel zu tun, da alle Pferde<br />
beschlagen werden mussten. Im Großen und Ganzen verhielten sich die Männer<br />
der Sowjetunion jedoch sehr ruhig und wir brauchten sie eigentlich nicht<br />
fürchten.<br />
Wie wurdet ihr mit Nahrungsmitteln versorgt?<br />
Anfangs wurden die Großgrundbesitzer enteignet, dieses Land wurde dann<br />
aufgeteilt. Jeder bekam 5 ha Land zugeteilt und musste diese bewirtschaften.<br />
Von den Endprodukten, die der Acker brachte, musste ein bestimmtes Soll an<br />
z.B. Eiern, Weizen, Milch abgegeben werden und von dem Rest mussten wir<br />
leben. Das Soll wurde dann der Stadtbevölkerung zugeteilt, da diese sich ja nicht<br />
selbst versorgen konnte.<br />
Konntet ihr zur Schule gehen?<br />
Der Unterricht war gesichert, es wurde eine Notschule in einer Gaststätte in<br />
Lübs eingerichtet, die von Kindern aus Gehrden, Lübs, Prödel und Dornburg<br />
besucht wurde. Der Schulweg musste allerdings selbst gemeistert werden, da<br />
keine Busse fuhren. Das hieß für uns, dass wir laufen mussten, denn ein Fahrrad<br />
war Luxus, den wir nicht besaßen.<br />
aufgezeichnet von Daniel Schemionek, Klasse 10/4<br />
Der Ausschnitt eines Dialogs mit der Cousine meines Vaters (75 Jahre)<br />
Wo hast du den Zweiten Weltkrieg erlebt?<br />
Ich habe meine Kindheit bis zur Vertreibung in meinem Geburtsort verlebt. Er<br />
hieß Großkunzendorf und lag damals in Schlesien. An den genauen Hergang des<br />
Krieges kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war damals noch sehr klein.<br />
Jedoch wurde mir vieles nachträglich erzählt. Von meinen Verwandten und von<br />
Freunden, die ich später wieder gesehen habe. Meine Mutter war Schneiderin<br />
und mein Vater arbeitete auf dem Hof, der sich nur ein wenig die Straße runter<br />
befand. Er half dort beim Versorgen der Tiere und bei der Ernte.<br />
Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?<br />
Na ja ... ich würde schon sagen, dass ich ein glückliches Kind war. Unser Dorf<br />
war ziemlich klein und Gefechte gab es in unserer näheren Umgebung auch<br />
nicht. Jedoch kann ich mich noch gut daran erinnern, dass meine Mutter und<br />
meine Tante, die im Nachbarort nicht weit entfernt wohnte, häufig weinten. Uns<br />
Kindern war dann auch klar, dass wieder jemand aus der Familie oder dem<br />
Freundeskreis gefallen sein muss.
Gab es in deiner Familie auch Gefallene?<br />
Ja. Der Bruder meiner Mutter fiel bei Gefechten. Es war schrecklich. Meine<br />
Mutter weinte den ganzen Tag. Sie stand ihren 3 Brüdern immer sehr nahe. Er<br />
war Soldat bei der Wehrmacht, glaube ich. Sie bekam einen Brief von einem<br />
Freund ihres Bruders. Er hatte ihn gebeten, ihr zu schreiben, falls er sterben<br />
sollte. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war 9, als das geschehen ist.<br />
Meine Mutter, mein Vater, meine Tante und ihr Mann saßen mit uns Kindern<br />
am Tisch und lasen den Brief. Ich weiß leider nicht mehr, was genau in dem<br />
Brief stand, jedoch kann ich mich noch gut an dieses bedrückte Gefühl erinnern,<br />
das alle danach hatten. Und an die Stimme meiner Mutter, die nach der Hälfte<br />
abbrach und den Zettel mit zitternden Händen an meinen Vater weiterreichte.<br />
Der Bruder wurde bei einem Gefecht in Ostpreußen von einem russischen<br />
Soldaten erschossen. Es war ein Lungenschuss. Meine Tante hat mir später<br />
erzählt, dass er wohl mit diesem Freund und drei weiteren in einer Scheune<br />
Zuflucht gesucht hatten. Als die zwei zusammen die Scheune verließen um nach<br />
Wasservorräten zu suchen, wurde er in die Lunge getroffen. Der russische<br />
Soldat war allein gewesen. Er sollte wohl das Gelände erkunden. Mein Onkel<br />
hat noch eine Nacht überlebt. Er soll sehr gekämpft haben. Seine Kameraden<br />
brachten ihn zur Kirche des Ortes. Sie fanden dort einen Pfarrer, der auf einem<br />
Feld oder so ein Begräbnis für ihn abhielt. Dieser Freund meines Onkels hat<br />
meine Tante nach Kriegsende besucht.<br />
[...]<br />
An was erinnerst du dich in Bezug auf eure Vertreibung?<br />
Wir wussten, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Auch wenn noch kurze<br />
Zeit vorher der Sieg Deutschlands standfest herausgeschrieen wurde, so wussten<br />
wir doch, dass das nicht stimmte. Die Briefe, die von der Front zu Angehörigen<br />
in unser Dorf kamen, machten uns bewusst, dass Deutschland wohl erliegen<br />
würde. Der Tag, an dem wir dann aus unserem Haus mussten, kam jedoch<br />
überraschend. Aus dem Nachbardorf kamen Leute. Mit Pferdekarren und schwer<br />
beladen mit ihren Sachen. Sie sagten wir sollten sofort unser Haus verlassen und<br />
nach Westen gehen. Jemand Hohes von der Wehrmacht ist in ihr Dorf<br />
gekommen und hat ihnen gesagt, sie sollen jetzt schnell verschwinden. Nur<br />
wenige Kilometer weiter östlich sind die Russen dabei, die Front zu<br />
durchbrechen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis sie kämen und das Dorf<br />
einnähmen. Es war Vormittag, als sie in unser Dorf kamen. Meine Mutter<br />
handelte ganz besonnen, aber in höchster Eile. Rasch packte sie ein paar Sachen<br />
für jeden von uns ein. Ich wurde zu meiner Tante geschickt. Sie sollte sich auch<br />
vorbereiten und ich half ihr und ihrem Mann beim Packen. Um die Mittagszeit<br />
kam der Treck dann und wir zogen nach Westen. Meine Mutter wollte zu einem<br />
Cousin in die Stadt. [...] Ich kann mich noch an das dröhnende Geräusch der<br />
Flugzeugmotoren erinnern. Es waren russische Jagdbomber. Sie warfen
Splitterbomben ab und schossen mit ihren Bordkanonen auf unseren Treck. Es<br />
roch so verbrannt. Alle schrieen. Ich weiß noch, dass meine Mutter mich an der<br />
Hand nahm. Sie rannte mit mir los. In einer Mulde an der Seite von diesem<br />
Feldweg versuchten wir uns zu verstecken. Es waren nur offene Felder um uns.<br />
Das Pferd, das unsere Karre gezogen hat, lag zuckend auf dem Weg. Das Blut<br />
strömte aus seiner Wunde am Hals. Es hat fürchterlich gewiehert. Diese Schreie<br />
werde ich nie vergessen. Mein Vater lag zusammen mit einigen anderen ein paar<br />
Meter weiter in der Mulde. Auf dem Weg lagen die Toten und Verletzten. Es<br />
war so laut. Meine Mutter, sie lag ja halb auf mir, um mich zu schützen, hat aber<br />
nicht geweint und nicht geschrieen. Sie schien vollkommen erstarrt. Meine<br />
Tante und ihr Mann, die auch noch Kleinkinder bei sich hatten, waren<br />
zusammen mit den anderen von unserem Treck weiter hinten geblieben. Auch<br />
mein Cousin war da noch klein. Ihre Schwägerin war bei ihr. Auch sie hatte ein<br />
Baby. Ihr Mann ist kurze Zeit vorher zum Volkssturm abkommandiert worden.<br />
Wir haben nachträglich nichts mehr von ihm gehört. Irgendwann kamen wir in<br />
der Stadt an. Wir wurden dann dort von unseren Verwandten aufgenommen. Sie<br />
hatten ein kleines Haus. [...] Einige Tage später kamen auch meine Tante und<br />
ihre Schwägerin. Es war schrecklich. Als wir meine Tante fragten, wo ihr Mann<br />
sei, begann sie zu weinen. Wir hörten dann, dass er von einer Panzerfaust<br />
getroffen wurde, als sie durch ein besetztes Dorf mussten. Meine Tante lag wohl<br />
hundert Meter entfernt in einem Schützengraben. Er ist vor ihren Augen<br />
verbrannt. Sie sprach nie wieder davon. [...]<br />
Wie würdest du dein nachträgliches Verhältnis zu den Besatzungsmächten<br />
ausdrücken?<br />
Ich weiß von vielen grausamen Taten. Als die Russen unsere Dörfer einnahmen,<br />
gab es viele Vergewaltigungen. Sie haben auch Leute erschossen und erhängt.<br />
Wenn im Nachhinein darüber nachdenkt und alles wieder hochkommt ... Aber<br />
ich weiß auch, dass die Deutschen keinen Deut besser waren. Ich habe heute<br />
nichts gegen Russen oder Amerikaner. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihnen<br />
die vielen Zivilopfer nicht verzeihen kann. So viele Menschen mussten einfach<br />
sterben. Aber auf beiden Seiten. Ich kann sagen, dass ich nicht die<br />
Besatzungsmächte hasse, sondern den Krieg und was er aus den Menschen<br />
macht.<br />
aufgezeichnet von Theresa Pfitzner, Klasse 10/3
Russische Kriegsgefangenschaft 1944 – 1949<br />
Um Ihnen meine späteren Handlungen und Ansichten etwas verständlicher zu<br />
machen, lassen sie mich Ihnen erst kurz schildern, wie ich überhaupt nach<br />
Russland kam.<br />
Ich war mit 18 Jahren Obergefreiter in Bergen-Belsen und absolvierte im Alter<br />
von 19 Jahren die Unteroffiziersschule und durchlief eine vollständige Ausbildung<br />
am Flammenwerfer.<br />
1943 bekamen wir den Marschbefehl. Wir kamen unter großen Verlusten bis<br />
nach Sawastopol, wo wir tagelang im Schützengraben lagen. Bei einem Angriff,<br />
der einem Himmelfahrtskommando gleichkam, verweigerten wir den Befehl und<br />
wurden gefangen genommen. Noch auf dem „Schlachtfeld“ wurden wir auf die<br />
Gravur der Waffen-SS untersucht. Diejenigen, die diese Tätowierung aufwiesen,<br />
wurden an Ort und Stelle exekutiert.<br />
Wer sich daraufhin einschmeicheln wollte und voller Verachtung auf sie<br />
spuckte, wurde ebenfalls sofort umgebracht. Das war im Winter 1944.<br />
Ich weiß nicht mehr genau, wohin sie uns damals brachten. Ich weiß nur noch,<br />
dass 40 Männer in einen kleinen Waggon gesperrt wurden und dass es kalt war,<br />
so kalt.<br />
Nun lassen sie mich mit meiner Schilderung der nun folgenden fünf Jahre<br />
beginnen:<br />
Da es mir bei meiner Gefangennahme gelungen war, meine Papiere, sprich<br />
meine Identität zu zerstören, konnte mein Rang nicht ermittelt werden. Diesem<br />
Umstand hatte ich es zu verdanken, dass ich in einer Schmiede arbeiten durfte,<br />
was auch mein erlernter Beruf war. Das Leben im Lager war grausam und die<br />
Lebensbedingungen hart. Das Essen war knapp und wenn du etwas haben<br />
wolltest, musste deine Leistung mindestens 100% betragen, ansonsten wurde<br />
deine Nahrung rationiert. Zu diesem Zeitpunkt überraschten mich die Russen<br />
das erste von vielen Malen. Sie waren uns immer als barbarische Feinde<br />
geschildert worden, doch ich musste erfahren, dass dem keineswegs so war: Die<br />
Gefangenen hatten oftmals sehr wenig Wasser und der nächste Brunnen war drei<br />
Kilometer weiter im Wald. Oft beobachteten wir die Frauen, wenn sie Wasser<br />
holten, doch da wir kein Russisch konnten, war es uns nicht möglich um einen<br />
Schluck zu bitten. Die Frauen müssen uns aber trotzdem bemerkt haben, denn<br />
sie kamen zu uns und ließen uns aus ihren Eimern trinken, wofür wir ihnen sehr<br />
dankbar waren.<br />
In so einem Lager bleibt es nicht aus, dass Gefangene und Wächter voneinander<br />
lernten. Durch die Arbeit in der Schmiede verstand ich bald ein paar Brocken<br />
Russisch. Mein Arbeitsplatz war in jenem Lager auch eine Art Treffpunkt zum<br />
Erzählen für die russischen Soldaten. Und der häufigste Satz den ich in dieser<br />
Zeit von ihnen hörte war: „Hitler nicht gut, Stalin nicht gut. Beide müssen an<br />
den Baum.“<br />
Durch das langsame Verstehen ihrer Sprache kamen mir diese Menschen auf<br />
eine bestimmte Art und Weise näher.
Die Winter dort sind schrecklich: von Oktober bis März nur Dunkelheit, Schnee<br />
und Kälte. Gerade dieser erste Winter, den wir dort verbrachten, ist mir als der<br />
grausamste in Erinnerung geblieben. Im Gegensatz zu den Russen, die warme<br />
Filzkleidung trugen, hatten wir nur unsere dünnen Jacken. An die kalten Tage<br />
und Nächte konnte man sich nach vier Wochen gewöhnen, aber ich hatte immer<br />
Angst vor dem Morgengrauen, wenn man es denn so nennen konnte. Wenn du<br />
wach wirst und siehst, dass der Mann, der in der Nacht neben dir geschlafen<br />
hatte, tot und steif vor Kälte neben dir lag und du beim Augenaufschlagen in<br />
seine aufgerissenen Augen starrst. Mir ist es ein paar Mal so ergangen. Im<br />
Durchschnitt starben in diesem Winter 10-15 Mann pro Nacht. Doch sie konnten<br />
nicht begraben werden, denn die Erde war zu hart, um sie umzugraben. So<br />
wurden die Toten einfach in den Straßengraben geschmissen, wo der Schnee bis<br />
zum Frühling gnädig ihre Körper bedeckte.<br />
Im Frühjahr hatte sich etwas wie „Alltag“ dort eingestellt. Am Morgen wurde<br />
man zusammen mit anderen von vier Soldaten zum jeweiligen<br />
Beschäftigungsort gebracht, wo man ebenfalls unter Aufsicht stand, und abends<br />
wurde man zurück eskortiert. Dass die Soldaten mit voll funktionsfähigen<br />
Gewehren ausgestattet waren, versteht sich.<br />
Dadurch, dass ich ein recht guter Schmied war, bekam ich auch Aufträge von<br />
den Wächtern. Einmal sollte ich für den Koch eine große Suppenkelle<br />
anfertigen. Natürlich bekam ich dafür kein Geld, schließlich war ich ein<br />
Gefangener. Dafür durfte ich mich satt essen und das war in meiner damaligen<br />
Situation wesentlich mehr wert. Ich aß einen halben Eimer Kohlsuppe, in der<br />
Hoffnung mein Frühstück zu sparen. Die Suppe war jedoch so dünn, dass ich<br />
das Gefühl hatte, gar nichts gegessen zu haben. Dies geschah nicht aus böser<br />
Absicht des Kochs, sondern einfach deswegen, weil sie wirklich nichts hatten.<br />
Ein Offizier, der zu mir kam um sein Gewehr reparieren zu lassen, sagte mir<br />
etwas, worüber ich lange nachgedacht habe: „Wenn du nach Hause kommst,<br />
Schmied, warten auf dich ein Teller Suppe und eine Scheibe Brot. Auf mich<br />
warten drei hungrige Kinder.“<br />
Im Sommer wurde ich krank und musste auf die „Krankenstation“. Eine<br />
dreckige, stickige, etwas größere Baracke. Die Betten dort waren dreistöckig<br />
und sehr klein und schmal. Die Tage dort waren der reinste Horror. Wenn einer<br />
starb, dann prügelten sich die anderen um sein übriges Essen, sein Bett und<br />
seine restlichen Habseligkeiten. Nach drei Tagen in diesem Irrenhaus bat ich<br />
darum, wieder an die Arbeit gehen zu dürfen, was mir auch gestattet wurde. Ein<br />
russischer Schmied, der mit mir zusammenarbeitete, erbarmte sich schließlich<br />
und gab mir etwas, das er Medizin nannte. Es hätte genauso gut Gift sein<br />
können, doch es war mir egal. Ich wusste, würde ich nicht an diesem Gift<br />
sterben, dann in einer Woche an der Krankheit. Also trank ich und am nächsten<br />
Tag ging es mir eindeutig besser. Ich fühlte mich jenem Russen zu tiefem Dank<br />
verpflichtet.<br />
Eines Tages wurde ich auf einmal in ein anderes Lager gebracht, wo ich drei<br />
Monate unter Tage arbeiten musste. Irgendjemand hatte meinen militärischen
Rang verraten, denn diese Arbeit war Strafarbeit. In diesen drei Monaten<br />
vegetierte ich mehr dahin, als dass ich lebte. Die Arbeit war sowohl physisch<br />
wie auch psychisch dazu geeignet, einen abzustumpfen und fertig zu machen.<br />
Doch dann wurde das Lager aufgelöst und ich kam wieder in ein anderes.<br />
Dort durfte ich wieder als Schmied arbeiten, und um mein Essen etwas<br />
aufzubessern, schmiedete ich im Austausch für Maiskolben Messer für Kinder.<br />
Im Winter saßen wir abends noch oft in unserer Baracke zusammen und<br />
erzählten einander von der Heimat und wir teilten alle die Hoffnung, dass es<br />
unseren Familien gut gehen möge und wir sie noch mal sehen könnten.<br />
Es war einer solcher Abende, als plötzlich ein paar von den älteren Männern<br />
anfingen „Stille Nacht, heilige Nacht“ zu singen. Da erst wurde mir bewusst,<br />
dass ich inzwischen 23 Jahre alt war und dies bereits mein viertes Jahr in<br />
Gefangenschaft war. Es sollte nicht mein letztes sein. Ich blieb in diesem<br />
Gefangenenlager bis zum Mai des Jahres 1949, wo ich nach 5-jähriger<br />
Kriegsgefangenschaft Russland endlich verlassen durfte!<br />
Ich traf mich in Berlin mit meinem Bruder, der bereits Anfang 1946 aus<br />
amerikanischer Gefangenschaft entlassen worden war und inzwischen Medizin<br />
studierte.<br />
Ich erinnere mich noch daran: als wir einmal abends ausgehen wollten, drehte<br />
ich mich dauernd um, damit ich sicher sein konnte, dass mich niemand<br />
verfolgte. Mein Bruder musste mich ständig beruhigen, denn ich hatte unter so<br />
vielen Menschen einfach nur Angst. Zu tief waren die Erinnerungen an fünf<br />
verlorene Jahre in mir eingebrannt.<br />
Hiermit möchte ich meine Geschichte beenden. Ich habe längst nicht alles<br />
erzählt, was ich erlebt habe, doch manches ist zu dunkel und zu tief verborgen,<br />
um es nach all den Jahren einfach wieder ans Licht zu bringen. Ich hoffe, Sie<br />
haben dafür Verständnis<br />
aufgezeichnet von Vivien Lock, Klasse 10/3<br />
Zeitzeugenbefragung zu Erlebnissen in der Kindheit im Nachkriegsberlin<br />
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges mussten viele Kinder in den durch Alliierte<br />
und Deutsche zerstörten Städten aufwachsen. Ebenso mein Zeitzeuge, der aus<br />
persönlichen Gründen ungenannt bleiben möchte. Er wird nun von seiner<br />
Kindheit im Nachkriegsberlin berichten.<br />
Wie erlebten sie die ersten Monate, nachdem Sie und ihre Familie wieder nach<br />
Berlin zurückgekehrt waren?<br />
Meine Mutter war in der ersten Zeit, nachdem wir wieder nach Berlin
zurückgekehrt waren, oft auf "Hamsterfahrt", um Lebensmittel zu beschaffen.<br />
Das bedeutete für meinen Bruder, meine Schwester und mich (1945 im Alter<br />
von 10, 6 und 7 Jahren), dass wir so genannte "Schlüsselkinder" waren.<br />
Was meinen Sie mit "Schlüsselkinder"?<br />
Na ja, mit dem Wohnungsschlüssel an einem Band um den Hals konnten wir<br />
nach Hause kommen, wann immer wir wollten. Wir waren uns selbst überlassen,<br />
bis meine Mutter wieder von der Hamsterfahrt zurück war und, wenn es gut<br />
gegangen war, auch mit etwas zu essen. Wann dies der Fall war, war immer<br />
abhängig davon, wie schnell sie bei einem Bauern irgendwo etwas bekam.<br />
Bestenfalls dauerte es nur einen Tag, schlimmstenfalls mehrere.<br />
Sie waren also stark an Ihre Mutter gebunden, aber wie kamen Ihnen andere<br />
Erwachsene zu der Zeit vor?<br />
Ja das stimmt, obwohl Mutter oft unterwegs war, war sie die Einzige, die sich<br />
um uns Kinder kümmerte. Die meisten anderen Erwachsenen erlebte ich als<br />
große Egoisten, die nur mit sich selbst und ihren Problemen beschäftigt waren,<br />
wobei wir Kinder ihnen nur im Wege standen und lästig waren. Ihr Egoismus<br />
kam am stärksten zum Ausdruck in den langen Schlangen vor den<br />
Lebensmittelgeschäften, in denen ich mit den Abschnitten der Lebensmittelmarken<br />
in der Hand stand.<br />
Und was passierte dann?<br />
Dann spielte sich folgendes ab: Ich stellte mich, wie es sich gehört, hinten an. In<br />
der Regel dauerte es aber nicht lange, bis die Erwachsenen hinter mir zuerst<br />
halblaut zu nörgeln begannen, um dann immer lauter zu schimpfen und mich<br />
schließlich als freche Göre zu bezeichnen, die sich vorgedrängelt hatte. Und so<br />
ging es weiter und sogar die Verkäuferinnen schikanierten mich, sodass ich am<br />
Ende eines derartigen Erlebnisses nach Hause kam und Mutter berichtete. was<br />
passiert war, und natürlich mit leeren Händen da stand. Dann hatte auch ich<br />
nichts mehr zu lachen.<br />
Sie haben mir bis jetzt ja nur von Ihrer Mutter erzählt, aber was war mit Ihrem<br />
Vater?<br />
Heute weiß ich, dass mein Vater an der Ostfront gekämpft hat. Zuletzt, d.h. im<br />
Februar 1945 soll er in Sommerfelde/Guben eingesetzt gewesen sein. Das<br />
belegen Unterlagen vom Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes vom 12. Mai<br />
1945. Seither fehlt jede Spur von ihm – er ist und bleibt vermisst.<br />
Also war Ihr Vater eigentlich nie da, wie bewältigten Sie das?<br />
Das ist wohl wahr, und da mir immer mehr bewusst wurde, wie sehr die<br />
Erwachsenen gegen uns Kinder waren, umso mehr sehnte ich mich nach<br />
meinem Vater. Diese Sehnsucht gründete sich auf viele Ungerechtigkeiten der<br />
Erwachsenen mir und anderen Kindern gegenüber. So kam es, dass ich heimlich
alles aufschrieb und die fromme Hoffnung hegte, ihm in absehbarer Zeit eines<br />
Tages meine Liste zeigen zu dürfen und dass er mich ganz bestimmt verstehen<br />
würde! Die Liste wurde im Laufe der Jahre sehr lang! Jahrelang stand mein<br />
Vater auch an erster stelle meines Abendgebetes. Es dauerte also seine Zeit, bis<br />
ich begriff, dass es sinnlos war, Jahre nach Kriegsende Gott zu bitten, meinen<br />
Vater zu "behüten", zu beschützen und ihn "bald" und "gesund" wieder aus dem<br />
Krieg zurückkommen zu lassen. Als ich soweit war, landete die Liste im<br />
Mülleimer und mein Abendgebet umfasste nicht länger meinen Vater.<br />
Wie sah es eigentlich mit der Religion in dieser Zeit bei Ihnen aus?<br />
Wir beteten auch vor jeder Mahlzeit. Dieses Gebet leitete Mutter immer ein mit<br />
den Worten: "Komm Herr Jesus, sei unser Gast...". Eines Tages aber, als wir<br />
besonders wenig Essen auf dem Tisch hatten, kam sie nicht weiter, denn mein<br />
Bruder unterbrach sie vorwurfsvoll und sagte: "Nein, lade den nicht auch noch<br />
ein. Das Essen reicht ja nicht einmal für uns!" Am Mittagstisch geschah aber<br />
auch sonst so einiges, was sich nicht nur auf himmlische Vorkommnisse<br />
beschränkte, sondern auch durchaus sehr reale Formen annahm.<br />
Wie sah denn so etwas aus?<br />
Ja, das war schon was! (lacht) Also: Ich saß neben meinem Bruder und Mutter<br />
hatte das wenige Essen gerecht auf den Tellern verteilt. Jeder hatte einen<br />
Eierkuchen mit einem Klecks Sirup erhalten. Als wir gerade zu essen beginnen<br />
wollten, spuckte Dieter auf meinen Eierkuchen! Erstaunt und angeekelt guckte<br />
ich abwechselnd zu ihm und auf meinen Eierkuchen, bis es aus mir<br />
herausplatzte: "Den Eierkuchen will ich nicht essen!" Und gerade auf diese<br />
Reaktion hatte er gewartet und nahm sich unschuldig meinen Eierkuchen. Fortan<br />
saß ich immer außer Reichweite seiner Spuckattacken.<br />
Das ist ja schon ein starkes Stück! Gibt es noch mehr solcher Geschichten?<br />
Aber natürlich! (lacht) Wenn die Fenster unserer im Parterre gelegenen<br />
Wohnung geschlossen und die Gardinen zugezogen waren, beendeten wir<br />
Geschwister normalerweise jede Mahlzeit, indem wir unsere Teller ableckten.<br />
Jeder noch so kleine Rest wurde verwertet. Im Sommer jedoch, wenn die<br />
Fenster offen standen, konnten die Leute, die vorbeigingen, sehen, was und auch<br />
wie gegessen wurde (grinst). Wenn es dann soweit war, dass die Teller<br />
abgeleckt werden sollten, verschwanden unsere vier Köpfe und Teller unter dem<br />
Tisch. So konnte keiner sehen, was wir taten und Mutter brauchte sich nicht für<br />
uns zu schämen!<br />
Wie sah es bei Ihnen eigentlich mit der Nahrungsversorgung genau aus, mussten<br />
sie oft hungern und wie ging es unter Ihren Geschwistern zu?<br />
Alle waren wir mehr oder weniger hungrig; einige waren es mehr, andere<br />
weniger. Doch da gab es auch noch jene, die extrem hungrig waren. Zu denen<br />
gehörte mein Bruder. In seiner Verzweiflung aß er manchmal auch etwas, von
dem ich kaum zu träumen wagte, dass es überhaupt essbar ist. Dies erklärte<br />
teilweise auch, dass zu Hause immer wieder Dinge auf mysteriöse Weise<br />
verschwanden. Wenn dies der Fall war, fragte Mutter uns immer, doch jedes<br />
Mal dasselbe Ergebnis: Keiner wusste etwas, hatte etwas gehört oder gesehen.<br />
Ich zog es immer vor zu schweigen, da mein lieber Bruder mir Dresche<br />
angeboten hatte.<br />
Versuchte Ihre Mutter dies nicht irgendwie zu verhindern?<br />
Tja! (lacht) .Aus Platzmangel aßen wir meistens im Wohnzimmer. Also musste<br />
alles, was gebraucht wurde, aus der Küche ins Wohnzimmer gebracht werden.<br />
Manchmal passierte es aber, dass doch mal etwas vergessen wurde. Unter<br />
"normalen" Umständen würde man sagen: "Na und?" Nun muss man aber<br />
bedenken, dass die Nachkriegsjahre aber eben nicht "normal" waren! Wenn also<br />
etwas vergessen wurde, wurde einer von uns damit beauftragt, es zu holen.<br />
Damit lief Mutter aber Gefahr, dass dieser schnell etwas in den Mund stecken<br />
konnte, bevor er wieder im Wohnzimmer war (lacht). Um dies zu vermeiden,<br />
waren viele Mütter auf die Idee gekommen, dass ihre Kinder auf dem Weg in<br />
die Küche pfeifen sollten. Da hieß es gehorchen und einsehen, dass es<br />
unmöglich war, gleichzeitig zu kauen und zu pfeifen.<br />
Aber Sie schafften es trotzdem Ihre Mutter zu überlisten, oder?<br />
So war es! Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Speisekammer übte auf uns<br />
Kinder irgendwie magische Kräfte aus! Teils weil ihre Tür fast immer<br />
verschlossen war, teils weil wir uns gerade aus diesem Grund einbildeten, dass<br />
sich hinter der Tür alle mögliche Leckereien verborgen hielten. Leckerbissen,<br />
die nur darauf warteten, dass wir an sie herankamen, und Dieter war in dieser<br />
Beziehung sehr erfinderisch, um dies in die Tat umzusetzen.<br />
Können Sie mir mehr dazu erzählen?<br />
Sicher doch! Die Speisekammer besaß ein kleines Lüftungsfenster zum Balkon<br />
hin, das meistens immer nur angelehnt war. Durch dieses Fenster steckte er<br />
einen Ausklopfer, bis er damit die Innenseite der Tür erreichte. Dort hakte er<br />
den Ausklopfer am Riegel ein und zog ihn zurück. Die Tür war geöffnet! - ohne<br />
Beschädigungen zu hinterlassen. Mein Bruder ließ es erst, als er eines Tages ein<br />
Glas mit Schmierseife für Honig hielt.<br />
Wie kam es eigentlich, dass dies bei ihnen an der Tagesordnung war?<br />
Oftmals war es für meine Mutter schwierig herauszufinden, wer von uns etwas<br />
angestellt hatte und schuldig war. Wir sagten Unwahrheiten oder<br />
Halbwahrheiten, stritten alles ab oder erfanden Ausreden. Heute habe ich dafür<br />
eine Erklärung, warum wir so waren, damals hatte ich keine. Die Erwachsenen,<br />
die uns im Nachkriegsberlin umgaben, waren unsere Vorbilder. Wir taten letzten<br />
Endes nicht mehr oder weniger, als dass wir ihr eigenes Benehmen nachahmten<br />
und folglich nur verkleinerte Spiegelbilder ihrer selbst waren. Sie logen und
etrogen sich gegenseitig und uns, und eigneten sich unrechtmäßig Sachen<br />
anderer an, was im Allgemeinen mit „organisieren“ umschrieben wurde. All dies<br />
ging natürlich nicht unbemerkt an uns vorbei und machte später einen Teil<br />
meiner Freunde zu richtigen Kleinverbrechern.<br />
Zum Abschluss noch eine letzte Frage: Wie würden sie also insgesamt ihre<br />
Kindheit beschreiben?<br />
Sicherlich hatte ich keine leichte Kindheit, so wie es heutzutage meist der Fall<br />
ist, ich musste hart mit anpacken, um alles wieder aufzubauen. Es war keine<br />
leichte Kindheit besonders deshalb, weil ich auch keinen Vater hatte. Doch ich<br />
muss sagen, dass es uns zu der damaligen Zeit noch recht gut ging. Meine<br />
Kindheit war nicht so schrecklich, es gab viele Momente, die sehr schön waren<br />
und die ich auch nicht vergessen werde. Es war aber auf jeden Fall eine Zeit, die<br />
mich sehr geprägt hat.<br />
Danke für das Interview!<br />
aufgezeichnet von Alexander Friedrich, Klasse 10/3<br />
Der folgende Zeitzeuge hat das Geburtsjahr 1934<br />
Wo kamen Sie her?<br />
Meine Heimat liegt im ehemaligen Oberschlesien, in Oppeln. Von hier etwa 500<br />
km entfernt.<br />
Waren Sie Vertriebener oder Flüchtling?<br />
Ich war Flüchtling und Vertriebener. Am 23.1.1945 wurde meine Familie von<br />
der deutschen Wehrmacht (SS) spät abends aus unserem Dorf ausgesiedelt.<br />
Unser Dorf hatte ca. 180 Einwohner, bis zum nächsten Morgen 7.00 Uhr musste<br />
das Dorf geräumt werden.<br />
Mein Vater hatte eine kleine Landwirtschaft, besaß 2 Traktoren, einen Hänger.<br />
Nachts haben wir unser Hab und Gut aufgeladen, Pferde angespannt, Heu<br />
aufgeladen, Decken und Essen mitgenommen. Im Januar 1945 lagen 50 cm<br />
Schnee und es waren -20° C. Im Dorf hatte sich ein Treck gebildet, der aus etwa<br />
20 Pferdefuhrwerken bestand. Auf unserem Wagen waren 12 Personen, aber alle<br />
mussten laufen. Kinder, alte Leute, alle. Am Tag haben wir ungefähr 13 km<br />
geschafft, wir hatten z. T. sechsspännige Wagen. Von Januar bis März 1945<br />
waren wir unterwegs (Glasener Kessel, Weidenburg).<br />
Mein Vater war Treckführer und musste sich jeden Tag auf dem Landratsamt<br />
melden, um unseren neuen Fahrbefehl zu erhalten. Täglich sind wir bis nachts<br />
um 24.00 Uhr gelaufen.<br />
Unser Weg führte von Weidenburg über Hirschberg, Schweinitz nach Liberez,<br />
früher Reichenberg. Bis Görlitz waren es noch 60 km, aber die Russen hatten
einen Durchbruch an der Oder, die einzige Brücke, die über die Neiße ging,<br />
besetzt. Kein Deutscher kam mehr durch. Mit unseren Pferden sind wir nach<br />
Pilsen, Bayr. Wald, ca. 80 km südwestlich von Pilsen. Insgesamt sind wir 600<br />
km gelaufen, die Wagen waren schwer beladen, alle mussten laufen.<br />
Mitte April kamen die Amerikaner, sie waren bis fast vor Prag, der Rest war von<br />
den Russen besetzt. Mitte Mai mussten in der Tschechoslowakei alle Flüchtlinge<br />
raus. Wir hätten mit den Amerikanern, begleitet durch Armeefahrzeuge zurück<br />
nach Bayern oder nach Hause fahren können. Etwa 10 % sind mit den<br />
Amerikanern nach Bayern, wir sind mit unseren Pferdewagen eine Woche<br />
zurück. Die Amerikaner haben uns offiziell den Russen übergeben. Wir waren<br />
etwa 10 000 Menschen, 6000 Pferde, 2000 Wagen. Dann mussten wir in<br />
Richtung Prag. Jeder musste eine Decke tragen und Essen. Nach 2 Tagen<br />
Fußmarsch wurden wir auf einer Wiese zusammengetrieben und wie eine<br />
Viehherde mit Stacheldrahtzaun eingegrenzt. Es war Ende Mai und sehr heiß.<br />
Keiner hatte mehr etwas zu essen oder zu trinken. Nur weil es 2 Tage geregnet<br />
hatte und wir das Regenwasser aufgefangen haben, sind wir nicht verdurstet.<br />
Viele Menschen sind dort gestorben.<br />
Nach ein paar Tagen erfolgte der Abmarsch. Wir mussten uns auf einem Feld<br />
versammeln zu je 50 Personen, wurden in einen Güterzug gebracht und wurden<br />
in die Nähe von Dux gebracht. Danach kamen wir nach Theresienstadt. Wir<br />
wurden von Tschechen mit MG bewacht, waren 200 Personen in einer Baracke.<br />
Morgens wurden die Toten auf Karren aus der Baracke gebracht. Es sind sehr<br />
viele gestorben. Meine Eltern konnten Polnisch und etwas Tschechisch und<br />
haben sich mit den Aufsehern unterhalten. Die Deutschen mussten raus, es sind<br />
wenige herausgekommen. Uns ist die Flucht nur gelungen, weil meine Eltern<br />
vor unserem Aufbruch Schweine geschlachtet haben. Für ein Schwein bekam<br />
man 10 000 Zigaretten. Diese Tauschobjekte haben uns das Leben gerettet. Die<br />
Aufseher haben uns 2 Fahrzeuge zur Verfügung gestellt.<br />
Die Tschechen haben uns alles weggenommen: Geld, Uhren, Schmuck. Mein<br />
Vater hatte neue Stiefel, die haben ihm sie abgenommen und alte dafür gegeben.<br />
Innerhalb von 8 Tagen hatte man uns alles abgenommen und es so ausgelegt,<br />
dass wir es freiwillig getan haben. Nachts sind wir dann weggefahren und uns<br />
wurde gesagt, dass wir uns von den Grenzern nicht erwischen lassen sollten.<br />
Dann sind wir in die Ostzone. Überleben konnten wir nur von dem, was wir auf<br />
dem Acker fanden oder wir mussten stehlen.<br />
Dann hat es uns nach <strong>Zerbst</strong> verschlagen in ein Barackenlager – Mozartsiedlung.<br />
In diesen Lagern wurden wir nur für eine Nacht jeweils aufgenommen, wir<br />
wussten nicht wohin.<br />
Erwachsene bekamen einen Teller Suppe, Kinder eine Scheibe Brot mit<br />
Marmelade. Am nächsten Morgen 7.00 Uhr mussten wir das Lager wieder<br />
verlassen. Dann haben wir davon gehört, dass die Russen aus Jüterbog abziehen<br />
und dort 2 Kasernen frei sind. Wir hatten keine Papiere, keine Ausweise. In<br />
Jüterbog hatten wir ein Zimmer, der Winter stand vor der Tür. Mein Vater und<br />
andere haben ständig auf den Landratsämtern nach Arbeit gefragt. In Dobritz
haben wir dann etwas gefunden. Drei Familien aus unserem Dorf sind am<br />
20.9.1945 nach Dobritz, wir waren 8 Monate unterwegs. Dort lebten wir bis<br />
1960.<br />
Wie haben Sie die Besatzungssoldaten erlebt?<br />
Die Amerikaner haben uns den Russen übergeben und gleichzeitig den<br />
Tschechen. Das waren alles Zivilisten. Da Hitler 1938 die Tschechei einverleibt<br />
hatte, hatten sie keine Armee. Alle, die konnten, sind nach England gegangen.<br />
Die Russen haben uns nichts getan.<br />
Haben Sie noch Kontakt zu ihren Angehörigen?<br />
1974 sind wir zum ersten Mal dorthin gefahren. Wir mussten sehr vorsichtig<br />
sein. In der DDR wurde unsere Heimat gar nicht erwähnt, es war ein weißer<br />
Fleck auf der Landkarte. Die Schlesiertreffen wurden in der DDR von der Stasi<br />
überwacht.<br />
2005 waren wir zuletzt dort. Die Dörfer sind noch da. Gleiwitz, Katowice sind<br />
ca. 50 km entfernt. Meine Eltern stammten von dort, haben 1930 eine Wirtschaft<br />
gekauft, ein Sägewerk und Langholz gefahren.<br />
Nach dem Krieg 1945/50 haben wir bei einem Bauern gearbeitet, 1950 bis 1960<br />
hatte ich eine Neubauernstelle und dann wurde alles LPG.<br />
aufgezeichnet von Henriette Finger, Klasse 10/4<br />
… Am 05.01.1945 bekam ich (Anneliese Lindauer, Jahrgang 1923) die<br />
Nachricht, dass mein Mann im Luftkampf gefallen ist. Ende Januar wurden alle<br />
Fahrzeuge beschlagnahmt. Munition und Geschütz standen auf unserem Hof.<br />
Die Russen näherten sich der Oder und die Aufforderung kam, Frauen und<br />
Kinder sollten die Stadt verlassen.<br />
Ich konnte nur ein ganz kleines Bündel nehmen, denn ich war im 6. Monat<br />
schwanger und ich hatte noch meinen dreieinhalbjährigen Sohn an der Hand.<br />
Meine Mutter hatte eine schwere Erkältung mit Fieber. Mein Herz war voller<br />
Trauer und mir war schon alles egal. Aber ein junger Soldat, der die Munition<br />
gefahren hatte, sagte zu uns: „Schnell, kommen Sie, viel Zeit habe ich nicht, die<br />
Mutter und der Kleine sind schon im Auto“. Wir wurden noch mit Planen<br />
zugedeckt und er wollte in Richtung Berlin fahren. Er hatte gehört, dass von<br />
den Randgebieten noch Züge in Richtung Westen fahren. Wir hatten Glück,<br />
dass wir trotz des unbeschreiblichen Chaos noch Platz in einem Personenzug<br />
nach Hannover bekamen. Unterwegs wurden wir zweimal von Tieffliegern<br />
beschossen. Die ganze Fahrt hatten wir nur entsetzliche Angst. Endlich in<br />
Hannover angekommen, da heulten schon die Sirenen und die ersten Bomben<br />
fielen.<br />
Wir erreichten einen Schutzraum. In der Nähe fiel eine Luftmine und der Druck
iss eine Mauer nieder, wo sich von den Leuten die Gepäckstücke stapelten. Ich<br />
wurde darunter begraben und drohte zu ersticken. Später erzählte man mir, dass<br />
von meinen Sohn ein Bein zu sehen war und da wurde mit Windeseile alles<br />
fortgeräumt. Ich hatte aber schon fast die Besinnung verloren und hörte noch die<br />
Menschen sagen: „Mein Gott, die Frau ist ja hochschwanger.“ Bis auf ein paar<br />
Schrammen war mir nichts passiert und das Bein von meinem Sohn wurde<br />
notdürftig verbunden. Es war kein Rotes Kreuz, keine Schwester da. Hilfsbereite<br />
Menschen brachten uns später zu dem Zug nach Celle und damit waren wir fast<br />
am Ziel, Wachtlingen, die Heimatstadt meines verstorbenen Mannes. Alles war<br />
mit Flüchtlingen besetzt. Wir wurden doch noch untergebracht und ein Arzt<br />
untersuchte uns. Er stellte fest, dass ich einen Schock erlitten hatte, und damit<br />
war eine weitere Reise für uns beendet. Die Gemeindeschwester kümmerte sich<br />
um mich. Es war unmöglich in ein Krankenhaus zu kommen.<br />
Inzwischen hatte Feldmarschall Montgomery mit seiner Armee das Land<br />
Niedersachsen besetzt. Der Geburtstermin rückte immer näher und um 21.00<br />
Uhr war Ausgangssperre. Da habe ich mir ans Herz gefasst und bin in die<br />
englische Rote-Kreuz-Baracke gegangen und es wurde sogar ein Dolmetscher<br />
geholt und ich bekam sogar einen Passierscheinfalls ich Hilfe brauchte. Nach<br />
alldem, was passiert war, wurde ich von einem englischen Arzt untersucht, ob<br />
mit dem Baby alles in Ordnung war. Am 25. April setzten die Wehen ein und<br />
eine ganz alte Hebamme kam, die junge amtierende war schon auf einem<br />
entlegenen Bauernhof bei einer Wöchnerin. Die Baracke eignete sich aufgrund<br />
der Hygiene nicht für eine Entbindung. Die alte Hebamme war entsetzt! Meine<br />
Tochter war geboren und dann kam das Kindbettfieber. Daran kann ich mich<br />
noch genau erinnern, dass der englische Arzt kam, sich ein Federkissen<br />
besorgte, dort mein Baby reinlegte, und ich wurde in eine große Decke<br />
gewickelt. Dann ging es los nach Celle in ein Militärkrankenhaus. Es war vorher<br />
die Landesfrauenklinik. Die Schwestern holten ein fahrbares Babybett vom<br />
Boden und Sachen für meine Tochter. Ich besaß ja nichts und es war ein<br />
Glücksfall, dass man mich gerade in diese Klinik brachte. Das Fieber hatte mich<br />
so mitgenommen, dass ich die Ärzte und Schwestern, die mein Leben retteten,<br />
kaum wahrgenommen habe. Später habe ich erfahren, dass amerikanische Ärzte<br />
mit ihren Medikamenten das Fieber besiegten.<br />
Wie und wann hast du vom Ende des Krieges erfahren?<br />
Am 8. Mai habe ich erfahren, dass der Krieg zu Ende ist. Am 9. Mai stand<br />
plötzlich meine Mutter an meinem Bett. Der englische Arzt, der mich in die<br />
Klinik gebracht hatte, hatte veranlasst, dass Sie mich einmal ausnahmsweise<br />
besuchen durfte. Zur damaligen Zeit durfte man nur mit einem Militärfahrzeug<br />
hinein und wieder heraus. So habe ich vom Ende des Krieges erfahren.<br />
Wo hast du nach Kriegsende gelebt? Und was hatte sich verändert?<br />
Im Juli war ich soweit gewesen, dass ich mit meiner Tochter in den Wohnort<br />
Sandlingen, ein winziges Dorf mit zwölf Häusern, gefahren wurde. Die
mitleidigen Schwestern gaben mir noch Decken und Babysachen mit.<br />
Untergebracht waren wir in einer Baracke, die vorher zur Unterbringung<br />
serbischer Kriegsgefangener gedient hatte. Sie stand ja nun leer und meine<br />
Mutter hat versucht, es einigermaßen wohnlich zu machen. Dort bin ich das<br />
erste Mal in meinem Leben betteln gegangen. Ich hatte ja Verantwortung für<br />
zwei kleine Kinder. Für Halbweisen gab es je 35 Mark, für die Witwen gab es<br />
noch nichts.<br />
Was hast du nach Kriegsende unternommen, um wieder auf die Beine zu<br />
kommen? Wie waren deine Gefühle?<br />
Ich war 23 Jahre alt und es konnte doch nicht alles zu Ende sein. Ich musste<br />
mich um Arbeit bemühen und zum Glück hatte sich ein Zahnarzt in seinem<br />
Jagdhaus mit Familie hier niedergelassen. Seine Praxis wurde in Hannover<br />
zerstört und er richtete sich hier in einem großen Bauernhof eine neue Praxis<br />
ein. Ich bekam die Arbeit. Wir wussten aber, dass wir hier niemals sesshaft<br />
werden würden. Als die Züge wieder fuhren, ist meine Mutter erstmals in unsere<br />
Heimat gefahren. Sie hat unser Haus und unser Grundstück als eine einzige<br />
Trümmerstätte wieder gefunden. Die Russen war so schnell an der Oder und<br />
man hatte die gesamte Munition, die bei uns gelagert wurde, einfach in die Luft<br />
gesprengt. In der Straße wurde vieles mit zerstört, aber die Menschen kamen<br />
wieder und haben sich untereinander geholfen. Für uns haben fleißige Helfer<br />
eine Anderthalb-Zimmerwohnung instand gesetzt. Das war dann die Zeit nach<br />
dem Krieg. Jeder hat es auf seine Weise schmerzlich empfunden. Bevor ich in<br />
meine Heimatstadt kam, habe ich in Hannover von einem Ohrenspezialisten<br />
erfahren müssen, dass meine kleine Tochter gehörlos geboren wurde. Sie war<br />
ein fröhliches Kind und geistig aufgeweckt und dann die furchtbare Gewissheit.<br />
Wie habe ich diesen Krieg verflucht! Ich bin auch wieder in meine Heimat<br />
zurück. Dort habe ich als Trümmerfrau in den zerschossenen Straßen die Oder<br />
entlang Steine geputzt und schwere Arbeit leisten müssen. Für meine gehörlose<br />
Tochter gab es nicht einmal einen Kindergartenplatz. Mit vielen Gesprächen<br />
erreichte ich, dass ein Platz im Oberlin-Haus in Potsdam-Babelsberg, bis zu<br />
ihrer Vorschulung, frei war.<br />
Nachdem das geregelt war, habe ich Frankfurt verlassen und bin nach<br />
Annaberg-Erzgebirge gegangen, um im Bergbau zu arbeiten. Ich bekam eine<br />
gute Stelle als topographische Helferin, ein schönes Zimmer, und die<br />
Versorgung war bestens. Im Winter kam ich nach Johanngeorgenstadt und<br />
bekam die Stelle als Köchin im Clubhaus "Franz Mehring". Ich lernte meinen<br />
Mann kennen, er arbeitete als Bohrmeister. Wir heirateten und bekamen eine<br />
schöne Wohnung und haben zwei Söhne und zwei Töchter.<br />
Mein Mann wollte zurück in seine Heimatstadt, <strong>Zerbst</strong>, das war 1963. Wir<br />
lebten uns hier gut ein, aber leider starb mein Mann 2003 und ich lebe in dem<br />
Haus und auf dem Grundstück meiner Kinder.<br />
Was hieltest du und hältst du vom Krieg?
Ich bin im 84. Lebensjahr und wünsche mir, dass es weiter so bleibt in Liebe<br />
und Harmonie. Die Verlierer eines jeden Krieges sind ganz gleich, ob Sieger<br />
oder Besiegte, immer die Frauen, die Mütter und die Kinder.<br />
aufgezeichnet von Florian Lindauer, Klasse 10/4