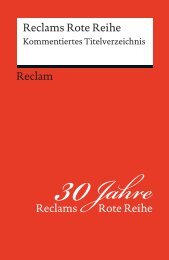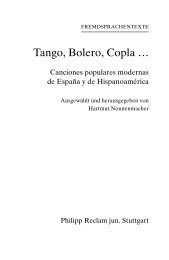Leseproben Grundwissen Philosophie E-Books - Reclam
Leseproben Grundwissen Philosophie E-Books - Reclam
Leseproben Grundwissen Philosophie E-Books - Reclam
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Leseproben</strong><br />
<strong>Grundwissen</strong> <strong>Philosophie</strong><br />
Herbert Schnädelbach: Kant<br />
Udo Tietz: Heidegger<br />
Reinhard Mehring: Politische <strong>Philosophie</strong><br />
Annette Vowinckel: Arendt<br />
Gunzelin Schmid Noerr: Geschichte der Ethik<br />
Alle Rechte vorbehalten<br />
© 2012 Philipp <strong>Reclam</strong> jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart<br />
Gesamtherstellung: <strong>Reclam</strong>, Ditzingen<br />
Made in Germany 2012<br />
RECLAM ist eine eingetragene Marke<br />
der Philipp <strong>Reclam</strong> jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart<br />
www.reclam.de
Kant, der klassische Philosoph der Moderne<br />
Im Jahr 2004 jährte sich der Todestag Immanuel Kants zum<br />
200. Mal, und auf vielfältige Weise wurde seiner gedacht. Was<br />
für ein Name – kantig und erzprotestantisch! Nicht herzerwärmend<br />
wie die Namen Mozarts oder Goethes, sondern ehrfurchtgebietend<br />
und einschüchternd. Kant ist schwer und<br />
dunkel: Wer weiß schon, was das Wort »transzendental« bedeutet<br />
oder was er mit dem legendären »Ding an sich« meinte?<br />
Und dann erscheint Kant vielen als der Philosoph mit dem erhobenen<br />
Zeigefinger, der die Pflicht um ihrer selbst willen eingefordert<br />
haben soll – typisch deutsch also – und deswegen sogar<br />
in die Geschichte des Präfaschismus eingeordnet wurde.<br />
(Vgl. Ebbinghaus 81ff.) In jüngerer Zeit wurde er überdies als<br />
rationalistisches Monstrum hingestellt, dessen Lebenslauf<br />
zeige, wohin zu viel Vernunft führt. (Vgl. Böhme/Böhme)<br />
Überhaupt dienen die skurrilen Geschichten über den alten<br />
und senil gewordenen Kant bis heute dazu, sich seiner zu erwehren<br />
und aus seinem Schatten zu entfliehen: »Seht, er war<br />
auch nur ein Mensch!« So ist das öffentliche Andenken an ihn<br />
wohl mehr Pflicht als Neigung, eine publizistische Verpflichtung,<br />
die dem allgemeinen Kulturkalender folgt, und da wäre<br />
es blamabel, wenn man eine Geistesgröße vergessen hätte.<br />
Ganz anders verhält es sich im philosophischen Diskurs; die<br />
daran teilnehmen, braucht man nicht an Kant zu erinnern.<br />
Hier ist er allgegenwärtig, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit,<br />
die nicht leicht zu erklären ist. Nimmt man einmal<br />
Platon aus, für den Ähnliches gilt, so fällt auf: Keiner unserer<br />
»Großen«, von Aristoteles bis Hegel, Nietzsche und Heidegger,<br />
kann so unumstritten beanspruchen, im Kontext unseres eigenen<br />
Denkens zu Wort zu kommen wie Kant, und darum füllen<br />
Arbeiten über ihn ganze Bibliotheken; nicht die Forschung erhält<br />
Kant am Leben, sondern Kant die Forschung und damit
zahllose Forscher in Amt und Brot. Goethe und Schiller sagten<br />
dazu: »Wie doch ein einziger Reicher so viele Bettler in Nahrung/Setzt!<br />
Wenn die Könige bau’n, haben die Kärrner zu<br />
tun.« (Goethe I, 210) Sein Werk hat alles überlebt, was seitdem<br />
als philosophische Revolution daherkam, und trotz seiner Verwurzelung<br />
im 18. Jahrhundert bewies es immer erneut, dass<br />
es unüberholbar ist. Nicht dass wir alle seine Antworten und<br />
Auskünfte einfach übernehmen könnten, aber was Kant sagte,<br />
fordert bis heute ständiges Gehör; kein anderer Philosoph<br />
wurde so oft »überwunden«, um sich danach bald wieder unüberhörbar<br />
zu Wort zu melden.<br />
Was nicht veralten will, nennen wir »klassisch«. In diesem<br />
Sinne ist Platon der klassische Philosoph schlechthin; durch<br />
ihn wissen wir überhaupt erst, was <strong>Philosophie</strong> ist. Wir lesen<br />
ihn nicht wegen seiner positiven Theorien, die schon sehr<br />
lange nicht mehr zu überzeugen vermögen, sondern wegen<br />
der rätselhaften und unausschöpflichen Kraft seiner Schriften,<br />
unser eigenes Fragen anzuregen und zu bereichern. Überhaupt<br />
sind wohl die Fragen der <strong>Philosophie</strong> bestes Teil. Kant<br />
schreibt dazu: »Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der<br />
Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftiger<br />
Weise fragen solle« (B 82), und er erbrachte selbst diesen Beweis<br />
in Form der berühmten vier Fragen, auf die sich ihm zufolge<br />
das gesamte »Feld der <strong>Philosophie</strong>« bringen lässt: »Was<br />
kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist<br />
der Mensch?« (Log A 25) Das sind klassische Fragen, weil<br />
nicht zu sehen ist, wie man es als <strong>Philosophie</strong>render unterlassen<br />
könnte, sie zu stellen. Im Unterschied zu Platon können<br />
wir aber bei Kant das, was er lehrte, nicht einfach auf sich beruhen<br />
lassen; seine Antworten gehen uns unvermindert an,<br />
und darum blieb es keinem bedeutenden Philosophen seit<br />
Kants Lebzeiten erspart, sich auch dann zuerst einmal mit ihm<br />
zu befassen, wenn er sich von ihm abwenden wollte. Es bleibt<br />
uns nichts anderes übrig, als die <strong>Philosophie</strong>geschichte in die<br />
Zeit »vor Kant« und »nach Kant« einzuteilen, und wir denken<br />
alle, wenn wir nicht bloß <strong>Philosophie</strong>historiker sein wollen,
»nach Kant«, d. h. unter Bedingungen, die er ermittelt und zu<br />
respektieren gelehrt hat.<br />
So ist Kant der philosophische Klassiker unserer Epoche – der<br />
klassische Philosoph der Moderne. Und doch ist Kant nicht<br />
modern im Sinne dessen, was gerade in Mode ist; sein Denken<br />
ist nicht der »letzte Schrei«, nicht der Inbegriff des Neuesten<br />
und Fortgeschrittensten, denn manches davon hat sich inzwischen<br />
als zeitbedingt und wissenschaftsgeschichtlich überholt<br />
erwiesen. »Moderne« kann hier nur als der Zustand gemeint<br />
sein, den unsere Kultur im Zuge der Neuzeit schließlich<br />
angenommen hat. Es ist Kants epochale Leistung, erkannt zu<br />
haben, was Modernität für unsere Orientierung im Bereich der<br />
Grundsätze unseres Denkens, Erkennens und Handelns bedeutet,<br />
und dies betrifft die Art der Fragen ebenso wie die<br />
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Beantwortung. Wir können<br />
heute relativ unumstritten drei Strukturmerkmale angeben,<br />
die moderne Kulturen kennzeichnen: vollständige Reflexivität,<br />
Profanität und Pluralität, und bei Kant lässt sich beobachten,<br />
wie sich diese Trias in geradezu unwiderstehlicher<br />
Weise auch im Innenraum einer <strong>Philosophie</strong> durchsetzt, die<br />
an der Zeit ist und ihre Zeit in Gedanken erfasst.<br />
Seitdem es Menschen gibt, leben sie als Kulturwesen, aber das<br />
wussten sie sehr lange Zeit nicht. Kulturen sind reflexiv, wenn<br />
sie sich vom bloß Natürlichen zu unterscheiden wissen und<br />
damit als Kulturen erfassen; die Unterscheidung zwischen der<br />
Menschenwelt und einem »Draußen« wird in elementarer<br />
Form bereits in den Mythologien getroffen, und sie ist auch die<br />
Wurzel des uns geläufigen Begriffs der Natur. (Vgl. Schnädelbach<br />
1991, 517f.) Vollständig reflexiv sind Kulturen, wenn sie<br />
sich bei ihrer Selbstinterpretation nicht länger auf etwas beziehen<br />
können, was Kultur und damit menschlicher Verfügung<br />
entzogen wäre – seien es Dämonen, Götter oder »die« Natur. So<br />
ist in der Moderne die Kultur in allen Dingen ganz auf sich<br />
selbst verwiesen; sie ist ihr eigenes Subjekt, denn es gibt hier<br />
keine höhere Instanz als das kulturelle »Wir«. Dass Kant<br />
gleichwohl die klassischen philosophischen Fragen in der Ich-
Form formuliert, steht dazu nicht im Widerspruch, denn das<br />
»Wir« besteht ja, wenn es nicht selbst wieder zur einer mythischen<br />
Größe erhoben wird, faktisch aus lauter Einzelnen, die<br />
nur deswegen ›wir‹ sagen können, weil sie auch ›ich‹ zu sagen<br />
vermögen. So beginnt die <strong>Philosophie</strong> der Neuzeit seit René<br />
Descartes (1596–1650) ganz selbstverständlich mit dem seiner<br />
selbst bewussten Ich-Sagen: »Ego cogito, ergo sum (Ich denke,<br />
also bin ich)«, und dies ist der Raum der philosophischen Reflexion,<br />
in der sich die Reflexivität moderner Kulturen spiegelt;<br />
die <strong>Philosophie</strong> in einer Kultur, die sich anschickt, ihre<br />
eigene Subjektrolle zu übernehmen, ist notwendig <strong>Philosophie</strong><br />
der Subjektivität.<br />
Dabei wird zunächst der methodische Ausgang vom individuellen<br />
Bewusstsein nicht als Gefährdung der Allgemeingültigkeit<br />
der philosophischen Ergebnisse angesehen, weil man<br />
bis ins 19. Jahrhundert glaubt, von einer allgemeinen Menschennatur<br />
ausgehen zu können, die garantiert, dass das, was<br />
ich als Individuum im Medium des »Ich denke« über mich sicher<br />
wissen kann, auch für alle anderen gilt; in diesem Sinn<br />
spricht auch Kant vom »Bewußtsein überhaupt« (Prol A 82) als<br />
dem Garanten des philosophischen Wir-Sagens. Erst durch einen<br />
weiteren Aufklärungsschritt wurde es zum Problem:<br />
durch den Historismus, der erkennt, dass das, was Menschen<br />
über sich wissen, stets durch die jeweiligen historischen und<br />
kulturellen Verhältnisse bedingt ist, in denen sie leben; so ersetzt<br />
er das kantische »Bewußtsein überhaupt« durch das<br />
»historische Bewusstsein«, das als Bewusstsein vom Historischen<br />
sich selbst als ein historisches erfasst. (Vgl. Schnädelbach<br />
1983, 51ff.)<br />
Dieser methodische Individualismus ist freilich keine bloß<br />
theoretische Veranstaltung. Wenn man sich fragt, was einen<br />
<strong>Philosophie</strong>renden dazu bewegen könnte, sich gegen allen<br />
Common Sense zunächst einmal ganz auf sein Ego und sein<br />
Bewusstsein zurückzuziehen, dann finden wir bei Descartes<br />
die Antwort: Es ist der Zweifel – nicht um des Zweifels willen,<br />
sondern auf der Suche nach einem Wissen, das auch subjektiv
gewiss ist. Subjektive Gewissheit aber meint Autonomie im<br />
Wissen, unabhängig von der Macht der Traditionen und Autoritäten,<br />
und damit etwas eminent Praktisches, nämlich vernünftige<br />
Selbstständigkeit in allen Dingen. So ist die subjektive<br />
Vernunft als Prinzip der neuzeitlichen <strong>Philosophie</strong><br />
notwendig zugleich kritische Vernunft, die nichts gelten lassen<br />
möchte, was sie nicht selbst einzusehen vermag. Kant<br />
zeigte dann, dass dies notwendig die Selbstkritik der Vernunft<br />
einschließt, dass es also keine vernünftige <strong>Philosophie</strong> ohne<br />
Vernunftkritik geben kann; deswegen die gigantische Arbeit<br />
seiner drei »Kritiken« – der reinen Vernunft, der praktischen<br />
Vernunft und der Urteilskraft. So reicht die vollständige Reflexivität<br />
der Kultur, die sich um 1800 im Westen durchzusetzen<br />
beginnt, in Kants Werk bis in die innere Struktur dessen hinein,<br />
was die <strong>Philosophie</strong> als unsere Vernunft zu explizieren<br />
versucht.<br />
Vollständig reflexive Kulturen sind zugleich profane Kulturen.<br />
Profan ist das Weltliche, das was im Vorhof des Heiligen verbleibt,<br />
und dies ist bei den Prinzipien kultureller Moderne<br />
wirklich der Fall. Hier ist die politische Macht nicht mehr von<br />
Gottes Gnaden; sie geht vom Volk aus. Das Rechtssystem vollstreckt<br />
nicht länger göttliche Gebote, sondern von Menschen<br />
gesetztes Recht, und selbst im Bereich der Moral ist Religion<br />
Privatsache. Auch die autonom gewordene kritische Vernunft<br />
ist profan; die Philosophen der Neuzeit verstehen sie nicht<br />
mehr wie die Stoa und die Scholastik als einen Widerschein<br />
der göttlichen Weltvernunft, sondern als eine bloße Naturtatsache;<br />
sie mag zwar von Gott geschaffen sein, aber das hat<br />
keine Bedeutung mehr für ihre Selbstauslegung. Diese Autonomie<br />
der kritischen Vernunft bedeutet jedoch zugleich ein<br />
Problem und eine Last. Kant vergleicht die Vernunftkritik mit<br />
einem Gerichtsverfahren. (Vgl. B 779) Da es sich dabei um<br />
eine Kritik der Vernunft durch die Vernunft selbst handelt,<br />
muss sie die verschiedenen Rollen des Angeklagten, Anklägers,<br />
Verteidigers und Richters selbst übernehmen; externe<br />
Instanzen sind nicht im Spiel. Diese Merkwürdigkeit ist der
Preis für die vollständige Reflexivität der Vernunft unter Bedingungen<br />
der Profanität, und er erhöht sich zudem durch die<br />
Tatsache, dass es, wenn man das Prinzip der kritischen Vernunft<br />
ganz konsequent durchführt, keine Objektivität mehr<br />
geben kann, die nicht in der selbstgewissen Subjektivität<br />
gründete – eine ziemlich halsbrecherische Situation. Die neuzeitlichen<br />
Philosophen vor Kant waren davor noch zurückgeschreckt,<br />
und sie suchten Halt für ihr Denken bei Gott als<br />
einem höchsten und notwendigen Wesen, dessen Existenz sie<br />
glaubten beweisen zu können. Wir können heute kaum noch<br />
ermessen, welchen Schock Kants Nachweis für die Mitwelt bedeutete,<br />
dass Gottesbeweise prinzipiell unmöglich sind; es<br />
ging dabei weniger um den Gott der Bibel, als um den Zusammenbruch<br />
einer Weltdeutung, die sich die Perspektive des<br />
Absoluten zugetraut hatte. Nach Kant haben wir nur unsere<br />
eigene subjektive Vernunft, die als fehlbare ständig der Kritik<br />
bedarf; und sie allein muss jetzt die Lasten tragen, die wir uns<br />
mit unseren Ansprüchen auf Allgemeingültigkeit und Objektivität<br />
aufbürden.<br />
Kant selbst ist der kritische Abschied von dem, was er als dogmatische,<br />
d. h. nicht begründbare Metaphysik hinter sich lassen<br />
musste, sehr schwer gefallen; dass es keinen Gott geben<br />
könne, war für ihn wie für seine Zeitgenossen ein nicht fassbarer<br />
Gedanke, und das galt auch für die Unsterblichkeit der<br />
Seele sowie für die Willensfreiheit, die bis heute ins neuzeitliche<br />
Weltbild deswegen so gar nicht hineinpassen will, weil<br />
sie die Naturgesetze außer Kraft zu setzen scheint. Heinrich<br />
Heine verglich Kants Widerlegung der Gottesbeweise mit der<br />
Französischen Revolution und fand die Hinrichtung des Königs<br />
harmlos dagegen, denn jetzt gelte: »der Oberherr der Welt<br />
schwimmt unbewiesen in seinem Blute«, und doch sei Kant<br />
schließlich umgefallen und habe, um seinen alten Diener<br />
Lampe (und wohl auch sich selbst) zu trösten, den toten Gott<br />
nachträglich wieder ins Spiel gebracht. (Vgl. Heine, 250f.)<br />
Diese Legende ist seitdem häufig wiederholt worden, ohne dadurch<br />
wahrer zu werden. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit
sind nach Kant keine Prinzipien, auf die sich Wissenschaft<br />
und Moral begründen ließen, sondern sie sind nur Postulate,<br />
d. h. notwendige Gedanken, die sich uns unwiderstehlich aufdrängen,<br />
wenn wir uns als Wesen verstehen, die zu wissenschaftlicher<br />
Erkenntnis und zu moralischem Handeln fähig<br />
sind. Dass Kant »redlich« ist, sich nichts vormacht und nichts<br />
erschleicht, wofür ihm die Gründe fehlen, hat sogar Nietzsche<br />
anerkannt, der sonst zu Kant ein ziemlich zwiespältiges Verhältnis<br />
unterhielt. Von Kant unterscheidet uns Heutige nur,<br />
dass uns der Verlust des Gottesglaubens und der Erwartung<br />
eines ewigen Lebens nichts mehr auszumachen scheint; wir<br />
können damit ganz gut leben. Und wie ist es mit der Freiheit?<br />
Neuerdings wollen die Neurowissenschaftler sie uns ausreden<br />
(vgl. Roth/Singer), und solange wir uns dagegen sträuben,<br />
bleiben wir gute Kantianer.<br />
Vollständige Reflexivität einer Kultur bedeutet aber nicht nur<br />
Profanität, sondern auch Pluralität. Wenn Kulturen sich erst<br />
einmal als Lebenszusammenhänge begriffen haben, die ohne<br />
göttliche Offenbarung und Weisung auskommen müssen,<br />
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihre Weltdeutungen und<br />
Handlungsnormen selbst zu erfinden und zu verantworten;<br />
die aber sind dann notwendig umstritten, denn es sind ja immer<br />
viele, die sich daran beteiligen wollen. Moderne Kulturen<br />
sind darum Kulturen ohne eine »natürliche« oder gottgewollte<br />
»Mitte«, die menschlicher Verfügung entzogen wäre; in diesem<br />
Sinne sind sie dezentriert, und sie erhalten sich nur im<br />
Zusammenspiel und häufig genug im Konflikt der verschiedenen<br />
kulturellen Mächte und Instanzen. Genau in diesem Sinne<br />
hat Heinrich Rickert Kant in einem Buch, das zu dessen 200.<br />
Geburtstag im Jahre 1924 erschien, als Philosophen der modernen<br />
Kultur gefeiert. Darin entwirft er in ausführlichem<br />
Rückgriff auf Max Webers Modell der abendländischen Rationalisierung<br />
ein Bild der modernen Kultur und spricht Kant das<br />
folgende Verdienst zu: »Kant hat als erster Denker in Europa<br />
die allgemeinsten theoretischen Grundlagen geschaffen, die<br />
wissenschaftliche Antworten auf spezifisch moderne Kultur-
probleme überhaupt möglich machen, und insbesondere läßt<br />
sich dartun: sein Denken, wie es sich in seinen drei großen Kritiken<br />
darstellt, ist in dem Sinn ›kritisch‹, das heißt scheidend<br />
und Grenzen ziehend gewesen, daß es dadurch im Prinzip<br />
dem Prozeß der Verselbständigung und Differenzierung der<br />
Kultur entspricht, wie er sich seit dem Beginn der Neuzeit faktisch<br />
vollzogen, aber in der <strong>Philosophie</strong> vor Kant noch keinen<br />
theoretischen Ausdruck gefunden hatte.« (Rickert 141) Verselbstständigung<br />
und Differenzierung der Kultur meint das,<br />
was Max Weber als Ausdifferenzierung und Autonomisierung<br />
von Handlungssystemen und Wertsphären, Lebensformen<br />
und Weltbildern beschrieb, an deren Ende der »Polytheismus<br />
der Werte« steht, also ein Pluralismus letzter und oberster Lebensorientierungen,<br />
in dem sich die menschliche Vernunft<br />
zurechtfinden muss. (Vgl. Weber 474ff., insbes. 500; auch<br />
Habermas I, 225ff.)<br />
Dass moderne Kulturen kein Zentrum mehr aufweisen, von<br />
dem her alle Teilbereiche gesteuert werden könnten, wird seit<br />
ihrer Entstehung als »Entzweiung«, »Entfremdung« oder »Verlust<br />
der Mitte« beklagt; in unserer Tradition war hier vor allem<br />
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) der Wortführer. So wurde<br />
er zum Stammvater der deutschen Romantik und ihrer<br />
Träume von Ganzheit und Versöhnung, die bis in unsere<br />
Gegenwart fortdauern. Dabei ist die Romantik selbst ein modernes<br />
Phänomen. Sie setzt die Erfahrung der Modernität voraus;<br />
sie verleugnet sie nicht einfach, möchte sie aber hinter<br />
sich lassen. Darum sind romantische Visionen in der Regel weniger<br />
bloß nostalgische Beschwörungen eines Vergangenen<br />
als vielmehr Vorgriffe auf eine Utopie. Die <strong>Philosophie</strong> des<br />
deutschen Idealismus, die nicht schon mit Kant, sondern erst<br />
mit Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) beginnt und in Hegels<br />
System (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) ihren<br />
Gipfelpunkt erreicht, kann man nicht als romantisch bezeichnen;<br />
sie kommt aber mit der Romantik darin überein, dass sie<br />
die Moderne zwar auf den Begriff bringt, sie aber zugleich in<br />
die Perspektive ihrer Überwindung rückt. Kant hingegen er-
scheint hier wie bei allen Hegelianern bis hin zu Adorno als<br />
»Reflexionsphilosoph« (vgl. Hegel 2, 25ff. und 287ff.), d. h. als<br />
ein Denker, der vor der eigentlichen Aufgabe der <strong>Philosophie</strong>,<br />
das Wahre als das Ganze zu begreifen (vgl. Hegel 3, 24), resigniert<br />
und sich verstockt in seiner Subjektivität eingerichtet<br />
hat.<br />
Inzwischen sollten uns spätestens die Erfahrungen des Totalitarismus<br />
von jenen romantischen Ganzheitssehnsüchten<br />
geheilt haben; ihre Anhänger übersehen meist, dass hier nur<br />
freiheitsfeindliche Ideologien wie der moderne Fundamentalismus<br />
ein Angebot machen können. Wir haben gelernt, dass<br />
es die Pluralität, ja sogar die Gegensätzlichkeit der Prinzipien<br />
ist, die in der modernen Kultur unsere Freiheiten garantiert;<br />
und die Vorstellung, sie müssten sich sämtlich aus einem einzigen<br />
Superprinzip ableiten lassen, das womöglich noch von<br />
der politischen Macht verwaltet wird, sollte uns schrecken. In<br />
der modernen Kultur mit ihrer Pluralität der Prinzipien besteht<br />
unsere Freiheit in einer Pluralität von Freiheiten; diese<br />
gründen selbst in einer Reihe fundamentaler Unterscheidungen,<br />
die in ihrer Gegensätzlichkeit die Modernität unserer Kultur<br />
ausmachen. Aus dem, was ist, folgt nicht, was sein soll;<br />
also hat die Wissenschaft nicht die Kompetenz, uns zu sagen,<br />
was wir tun sollen. Moral und Politik stehen auf eigenen Füßen,<br />
und die Diktatur von Theoretikern ist ausgeschlossen,<br />
was umgekehrt Wissenschaftsfreiheit bedeutet. Moral und<br />
Politik bedürfen ihrerseits keiner religiösen Basis, was wiederum<br />
die Religion von der Zumutung entlastet, die Menschen<br />
Mores lehren zu sollen. Die Künste sind nicht länger die<br />
Mägde von Religion und Moral, und ihre politische Instrumentalisierung,<br />
an der in prämodernen Zeiten niemand Anstoß<br />
nahm, gilt jetzt als ästhetischer Frevel. All dies hat Kant wie<br />
keiner vor ihm auf den Begriff gebracht und auf Argumente gegründet,<br />
die auch heute noch standhalten; auch darum ist er<br />
der klassische Philosoph der Moderne.<br />
Die Frage ist freilich, ob die moderne Pluralität nicht doch eines<br />
inneren Zusammenhaltes bedarf; in der Tat kann sie nicht
das letzte Wort sein, wenn wir den möglichen Konflikt zwischen<br />
den verschiedenen Prinzipien bedenken, der oft genug<br />
in offenen Krieg übergeht. Kants Moralprinzip, der Kategorische<br />
Imperativ, bietet hier einen Ausweg. Er wurde seit Hegel<br />
(vgl. 2, 461ff.) immer wieder als formalistisch gescholten, und<br />
es wurde behauptet, man könne mit ihm alles und jedes, und<br />
sei es das Verbrechen, moralisch rechtfertigen und zur Pflicht<br />
erheben. (Vgl. Ebbinghaus, insbes. 85ff.) Dies schien nach<br />
dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu erklären, warum die kantianischen<br />
Deutschen Hitler pflichtbewusst bis in den Untergang<br />
folgten. Tatsächlich ist der Kategorische Imperativ formal,<br />
er lässt uns unsere jeweiligen Handlungsgrundsätze, die<br />
er »Maximen« nennt, fordert uns aber auf zu prüfen, ob wir sie<br />
als allgemeingültige Gesetze denken und wollen könnten, und<br />
nur dann seien sie moralisch. Das hat mit Formalismus nichts<br />
zu tun, denn bei solcher Prüfung scheiden viele Maximen als<br />
unmoralisch aus. Das Formale der kantischen Ethik aber hat<br />
den Vorteil, dass es uns die Entscheidung darüber, wie wir leben<br />
wollen, selbst überlässt, und uns nur dazu verpflichtet zu<br />
überlegen, ob dies mit der freien Entscheidung anderer, die<br />
anders ausfällt, verträglich ist oder nicht. Aus solchen Überlegungen<br />
ergibt sich ihm zufolge der Gedanke einer formalen<br />
Rechtsordnung, die die Menschen nicht bevormundet, sondern<br />
nur den Frieden unter ihnen garantiert. So ist Kant der<br />
Philosoph des Friedens unter Bedingungen der Moderne, d. h.<br />
einer Friedensordnung, die Pluralität eröffnet und lebbar<br />
macht.<br />
Diese Einführung versucht, an Kants <strong>Philosophie</strong> am Leitfaden<br />
der großen Unterscheidungen heranzuführen, die sein<br />
Denken bestimmten; in ihnen meldete sich die kulturelle<br />
Moderne im begrifflichen Medium zu Wort: »Wissenschaft<br />
und Aufklärung«, »Ding an sich und Erscheinung«, »Sinnlichkeit<br />
und Verstand«, »Verstand und Vernunft«‚ »Natur und Freiheit«,<br />
»Sein und Sollen«, »Pflicht und Neigung«, »Moral, Recht<br />
und Politik«, »Wissen und Glauben«, »Die Vernunft und der<br />
Mensch«. Sie alle haben immer wieder die »Kantüberwinder«
herausgefordert, weil sie doch nicht das letzte Wort der <strong>Philosophie</strong><br />
sein könnten; dabei übersahen sie stets, dass die kantischen<br />
Gegensätze sämtlich die Endlichkeit unserer Vernunft<br />
ausdrücken. Das hegelsche Argument, wer Endlichkeit gedacht<br />
habe, sei doch schon darüber hinaus, weil man schon<br />
Unendlichkeit gedacht haben müsse, um Endlichkeit denken<br />
zu können, hat bis heute manche überzeugt, und so glaubten<br />
sie, über Kant hinausgehen zu können. Dagegen ist zu sagen:<br />
Endlichkeit verweist unter Bedingungen der Moderne nicht<br />
mehr der Sache nach, sondern höchstens grammatisch auf die<br />
Unendlichkeit. Die Tatsache, dass wir verstehen, was ›unendlich‹<br />
bedeutet, ermächtigt uns noch nicht dazu, unsere Vernunft<br />
in dem Sinne für unendlich zu halten, dass wir mit ihr<br />
den Gottesstandpunkt einer absoluten Perspektive aller Perspektiven<br />
einnehmen könnten. Kant selbst gestand sogar zu,<br />
dass wir gar nicht umhinkönnen, das Ganze, das Unendliche,<br />
Absolute denkend ins Auge zu fassen, aber wir können nicht<br />
damit Erkenntnisansprüche verbinden oder gar unser Leben<br />
danach einrichten.
Einleitung<br />
»Jede philosophische Problematik hat etwas im Rücken, das<br />
sie selbst und trotz ihrer höchsten Durchsichtigkeit nicht erreicht,<br />
denn die Durchsichtigkeit hat sie gerade daher, daß<br />
sie um jene Voraussetzung nicht weiß.«<br />
Martin Heidegger<br />
Heidegger zählt zu den Denkern, die den philosophischen<br />
Diskurs der Moderne im 20. Jahrhundert entschieden geprägt<br />
haben. Wie wenige vor ihm hat er unser abendländisches<br />
Selbstverständnis einer grundlegenden Revision unterziehen<br />
wollen, die auch noch die Grundlagen eines Denkens betrifft,<br />
das sich auf das neuzeitliche Prinzip der Subjektivität und das<br />
damit verbundene Seinsverständnis gründet. Heidegger geht<br />
es um einen anderen Anfang, um einen Anfang, der nicht<br />
mehr den Menschen samt seiner verabsolutierten Zweckrationalität<br />
der »Durchrechnung alles Handelns und Planens« in<br />
den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, sondern um einen Anfang,<br />
der auf dem Weg einer intern ansetzenden Überwindung<br />
der Metaphysik dieses Seinsverständnis überschreitet. Und insofern<br />
im Abendland die Metaphysik der Ort ist, an dem sich<br />
dieses Seinsverständnis artikuliert, zielt Heidegger nicht nur<br />
auf eine philosophische Revision des abendländischen Selbstverständnisses,<br />
sondern gleichzeitig auf eine Revision der<br />
gesamten Metaphysik.<br />
Es besteht kein Zweifel: Heidegger geht es um die Eröffnung<br />
neuer Denkhorizonte, die jenseits des vergegenständlichenden<br />
Denkens der traditionellen Metaphysik liegen, von der er<br />
meint, daß sie das abendländische Denken gefangenhält. Er<br />
stieß dabei jedoch auch an Grenzen, die er nicht zu überschreiten<br />
vermochte. Genau hier liegen die Schwierigkeiten<br />
einer angemessenen Rezeption. Denn angemessen kann keine<br />
Rezeption sein, die einzelne Begriffe, Thesen und Einsichten<br />
aus ihrem Zusammenhang heraushebt oder aber die Denk-
weise von Heidegger nur imitiert – einer der wohl unsympathischsten<br />
Züge der »Verehrung« eines Philosophen, der nur<br />
Verachtung für eine derartige Verehrung übrig gehabt hätte.<br />
Eine produktive Rezeption kann nur indirekter Art sein, wobei<br />
sich zweierlei zeigen müßte: erstens, inwieweit wir noch heute<br />
von den Fragen betroffen sind, die Heidegger umtrieben, und<br />
zweitens, wie sich einzelne Intentionen und Motive Heideggers<br />
retten lassen, ohne daß wir uns damit auf Prämissen verpflichten,<br />
die sich unter den Bedingungen eines Denkens nach<br />
Heidegger nicht mehr vertreten lassen.
Die Frühschriften<br />
Im Vorwort zu den Frühen Schriften stellt Heidegger 1972 fest:<br />
»Zur Zeit der Niederschrift der vorliegenden, im wörtlichen<br />
Sinne hilf-losen frühen Versuche, wußte ich noch nichts von<br />
dem, was später mein Denken bedrängte. Gleichwohl zeigen<br />
sie einen mir damals noch verschlossenen Wegbeginn: in Gestalt<br />
des Kategorienproblems die Seins-frage, die Frage nach<br />
der Sprache in der Form der Bedeutungslehre. Die Zusammengehörigkeit<br />
beider Fragen blieb im Dunkel. Die unvermeidliche<br />
Abhängigkeit ihrer Behandlungsart von der herrschenden<br />
Maßgabe der Lehre vom Urteil für alle Onto-Logik ließ das<br />
Dunkel nicht einmal ahnen.« (GA 1, 55) Nimmt man diese<br />
Feststellung ernst, dann deuten sich in Heideggers »hilf-losen<br />
frühen Versuchen« die zwei zentralen Themen seines Denkens<br />
an: die Seinsfrage und die Frage nach der Sprache. Beide<br />
Fragen haben ihn zeit seines Lebens beschäftigt.<br />
Bei den hier angesprochenen Versuchen handelt es sich um<br />
Heideggers Dissertation Zur Lehre vom Urteil im Psychologismus<br />
aus dem Jahr 1913 und um seine Habilitation zur<br />
Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus von 1915,<br />
die Heidegger Heinrich Rickert (1863–1936), dem damaligen<br />
Haupt des südwestdeutschen Neukantianismus, »in dankbarster<br />
Verehrung« widmet. Rickert, der auch schon der Zweitgutachter<br />
der Dissertation war, übte einen überaus starken Einfluß<br />
auf den frühen Heidegger aus, insofern dieser zusammen<br />
mit Emil Lask (1875–1915) und Edmund Husserl (1859–1938),<br />
dem Begründer der Phänomenologie, in Frontstellung zum<br />
Psychologismus das Urteil als »psychischen Vorgang des Zusammentreffens<br />
verschiedener Vorstellungen« gegenüber dem<br />
»Vorstellungsinhalt« im Sinne des »Urteilssinns« abgehoben<br />
hat – womit der Weg in Richtung einer antipsychologistischen<br />
und damit antirelativistischen Logikbegründung frei schien.
Auch Heidegger geht es in seinen beiden Qualifikationsarbeiten<br />
um solch eine antipsychologistische Logikbegründung,<br />
wobei sich das maßgebliche Argument aus der Unterscheidung<br />
von »Urteilssinn« und »Urteilsvollzug« ergeben soll. Heidegger<br />
entnimmt den beiden bedeutendsten antipsychologistischen<br />
Denkbewegungen am Anfang des 20. Jahrhunderts,<br />
der neukantianischen Geltungsphilosophie und der Phänomenologie,<br />
aber nicht nur seine Argumente gegen den<br />
Psychologismus, sondern auch seine Argumente zum »Wesen<br />
des Urteils«. Und dies ist kein Zufall. Heideggers Interesse am<br />
Urteil ist gut begründet. Er wählt die »Lehre vom Urteil [...],<br />
weil sich am Urteil, das mit Recht als ›Zelle‹, d. h. als Urelement<br />
der Logik, betrachtet wird, am schärfsten der Unterschied<br />
zwischen Psychischem und Logischem herausstellen lassen<br />
muß, weil vom Urteil aus der eigentliche Aufbau der Logik sich<br />
zu vollziehen hat« (GA 1, 64).<br />
Wie immer man das komplizierte Spannungsverhältnis von<br />
Geltungsphilosophie und Phänomenologie im Frühwerk von<br />
Heidegger einschätzen mag, sicher ist, daß Heidegger es seinerzeit<br />
Rickert, Lask und Husserl als Verdienst anrechnete, das Urteil<br />
vom »Vorstellungsinhalt« im Sinne des »Urteilssinns« abgegrenzt<br />
zu haben, womit Rickert, Lask und Husserl »den<br />
psychologischen Bann eigentlich gebrochen« haben. Auch<br />
Heideggers Antipsychologismus ist durch diese Unterscheidung<br />
von »Urteilssinn« und »Urteilsvollzug« charakterisiert.<br />
Antipsychologismus: Urteilssinn und Urteilsvollzug<br />
Heideggers Strategie, den Psychologismus zu widerlegen, besteht<br />
aus zwei Teilschritten: In einem ersten Schritt attackiert<br />
er die Konsequenzen, die sich aus den Versuchen ergeben, die<br />
Logik psychologistisch zu fundieren, um dann in einem zweiten<br />
Schritt mittels ebendieser Unterscheidung die Voraussetzungen<br />
des Psychologismus in Frage zu stellen.
Die Quintessenz seiner Psychologismuskritik besteht in der<br />
Feststellung, daß die »verschiedenen Urteilslehren in der allgemeinen<br />
Auffassung des Urteils« darin einig sind, daß »das<br />
Urteil [...] ein psychischer Vorgang« sei, der »sich in den<br />
Zusammenhang der psychischen Wirklichkeit einordnet«<br />
(GA 1, 116f.). Genau hierin sieht Heidegger den Grundfehler<br />
der bekämpften Position. »Die Ableitung des Urteils aus der<br />
Grundeigenschaft der apperzeptiven Geistestätigkeit [...] ist<br />
Psychologismus« (GA 1, 162), was insofern auch plausibel ist,<br />
als wir die Wahrheit oder Falschheit unserer Urteile ganz offensichtlich<br />
nicht von dem einwandfreien Funktionieren unseres<br />
Bewußtseins abhängig machen. Wenn wir fälschlicherweise<br />
von einem roten Tisch sagen, er sei blau, dann erklären<br />
wir diesen Fehler mit Rekurs auf eine Wahrnehmungstäuschung<br />
oder damit, daß wir die Farbprädikate »rot« und »blau«<br />
verwechselt haben, nicht aber damit, daß wir sagen, unser<br />
Bewußtsein hat gerade nicht richtig gearbeitet.<br />
Der Gehalt unserer Überzeugungen, Heidegger spricht hier<br />
durchweg von Urteilen, läßt sich nicht aus der »apperzeptiven<br />
Geistestätigkeit« ableiten. »Die Problematik des Urteils liegt<br />
nicht im Psychischen.« (GA 1, 164) Zudem kollidiert die psychologistische<br />
Fundierung der Logik mit ihrem normativen<br />
Charakter, weshalb solch eine Position abzulehnen sei. Denn<br />
wenn sich die Logik mit der Normierung des Denkens befaßt,<br />
dann kann die normierende Kraft nicht in einem empirischen<br />
Sinn verstanden werden. Für Heidegger ist früh schon klar,<br />
daß sich der Psychologismus mit »seinen relativistischen Konsequenzen«<br />
selbst widerlegt. Gleichwohl meint er, daß mit der<br />
Feststellung seiner relativistischen Konsequenzen in positiver<br />
Hinsicht wenig ausgemacht sei. (GA 1, 165)<br />
Heidegger greift also den Psychologismus als Relativismus mit<br />
einem Selbstwiderlegungsargument an und fragt dann, worin<br />
die Alternative zu dieser selbstwidersprüchlichen Position besteht.<br />
Und diese Alternative sieht er durch die Geltungsphilosophie<br />
vorgezeichnet, insofern hier »die Wirklichkeitsform des<br />
im Urteilsvorgang aufgedeckten identischen Faktors« als gel-
tender Sinn bestimmt wird. Heidegger orientiert sich mit der<br />
Unterscheidung von Urteilssinn und Urteilsvollzug, von logischem<br />
Gehalt und psychischen Akten an der Geltungsphilosophie,<br />
weil er der Auffassung ist, daß das »in der Zeit verlaufende<br />
Denkgeschehen« und der »ideale außerzeitliche<br />
identische Sinn« nicht identisch sein können. Nach Heidegger<br />
muß man das, »was ›ist‹, von dem, was ›gilt‹«, unterscheiden.<br />
Diese Unterscheidung, die für Heidegger eine zwischen dem<br />
Faktischen und dem Normativen ist, hat der Psychologismus<br />
nicht getroffen und statt dessen das Normative ins Faktische<br />
herabgezogen. Genau dies hält Heidegger für einen Fehler.<br />
»Die Logik bewegt sich nur in der Sphäre des Sinns«, nicht in<br />
der des Faktischen. Es ist das Reich der Geltung, das Heidegger<br />
für das Logische reserviert, ein Reich, welches der Psychologismus<br />
nicht kennt, weil er »die logische ›Wirklichkeit‹« nicht<br />
kennt, wobei Heidegger meint, daß dieses Reich nicht nur gegen<br />
das Psychische, sondern auch gegen das Metaphysische<br />
abzugrenzen sei. Er will den Relativismus nicht um den Preis<br />
eines Rückfalls in eine unkritische Metaphysik überwinden,<br />
sondern auf dem kritischen Weg.<br />
Für Heideggers antipsychologistische Logikfundierung ist somit<br />
erstens die Unterscheidung von »Urteilssinn« und »Urteilsvollzug«<br />
und zweitens die Unterscheidung von »Sein« und<br />
»Gelten« charakteristisch. Doch was ist das: »Sinn«? Auch Heidegger<br />
stellt sich diese Frage: »Hat es überhaupt Sinn, danach<br />
zu fragen? Wenn wir den Sinn des Sinnes suchen, müssen wir<br />
doch wissen, was wir suchen, eben den Sinn. Die Frage nach<br />
dem Sinn ist nicht sinnlos.« (GA 1, 170) Diese Frage ist nicht<br />
trivial. Denn von der Art und Weise ihrer Beantwortung hängt<br />
nicht nur die Plausibilität von Heideggers früher Psychologismuskritik<br />
ab, es werden zugleich die Weichen für spätere<br />
Entwicklungen gestellt.<br />
Wie beantwortet er nun die Frage nach dem Sinn? »Sinn steht<br />
im engen Zusammenhang mit dem, was wir ganz allgemein<br />
mit Denken bezeichnen, wobei wir unter Denken nicht den<br />
weiten Begriff Vorstellen verstehen, sondern Denken, das rich-
tig oder unrichtig, wahr oder falsch sein kann [...]. Die Wirklichkeitsform<br />
des Sinnes ist das Gelten.« (GA 1, 172) Der Sinn<br />
ist es, der gilt. Er »verkörpert« das Logische. Denn der Sinn ist<br />
der »Inhalt, die logische Seite des Urteils«, oder, wie Heidegger<br />
auch sagt: »Das Urteil der Logik ist Sinn.« (GA 1, 172)<br />
Bemerkenswert an dieser Antwort ist zum einen, daß der Sinnbegriff<br />
nicht mit Bezug auf die Sprache eingeführt wird, was<br />
insofern naheläge, als es sich bei Urteilen um einen sprachlich<br />
zugänglichen Sinn handelt, sondern mit Bezug auf das »Denken«,<br />
also innerhalb eines mentalistischen Paradigmas; und<br />
zum anderen, daß Heidegger behauptet: der Sinn gilt. Ebendiese<br />
Rede von einem Sinn, der gilt, ist keineswegs eindeutig.<br />
Eindeutig ist lediglich, daß Heidegger den Wahrheitsanspruch<br />
als einen Geltungsanspruch versteht. Denn das Wahre ist für<br />
ihn das Geltende selbst. Vergleichen wir aber die Prädikatausdrücke<br />
»... ist wahr« und »... gilt«, dann stellen wir fest, daß ein<br />
Wahrheitsanspruch kein Geltungsanspruch ist, da »gelten« in<br />
aller Regel in dreistelligen Prädikaten vorkommt, wobei wir<br />
zwei paradigmatische Fälle unterscheiden können: »X gilt für<br />
jemanden als Y« und »X gilt für jemanden für etwas«.<br />
Nun untersteht die Wahrheitsfrage allerdings keiner solchen<br />
normativen Beziehung. Der Anspruch, den wir mit einem konstatierenden<br />
Sprechakt erheben, ist lediglich der, daß das, was<br />
wir sagen, wahr ist. Daher ist es »nichtssagend, den Wahrheitsanspruch<br />
einen Geltungsanspruch zu nennen, weil das, was<br />
da als Geltung beansprucht wird, nichts anderes als die Wahrheit<br />
selbst ist, oder es ist irreführend, weil der Anspruch ›p ist<br />
wahr‹ und der Anspruch ›p gilt‹ schon aus semantischen Gründen<br />
nicht miteinander identisch sein können. Wahrheitsfragen<br />
sind keine Geltungsfragen in dem Sinn, daß man in<br />
allen Kontexten das Prädikat ›... ist wahr‹ durch das Prädikat<br />
›... gilt ...‹ ersetzen könnte.« 1<br />
Um den Relativismus in der Urteilstheorie abzuwehren, greift<br />
Heidegger also – in Reaktion auf den Psychologismus – zuerst<br />
das Wahrheitsproblem auf der Ebene der Erkenntnis auf und<br />
leitet damit den Übergang von der deskriptiven zur normati-
ven Rede ein, der dann mit dem Terminus »gelten« effektiv<br />
vollzogen wird. Nachdem auf diese Weise die objektive Geltung<br />
von den Relativierungen des Urteilsvorgangs abgezogen<br />
wurde, behauptet er nun, daß das »Gelten dieses von jenem<br />
[...] der logische Begriff der Kopula« besagt, die die »Relation<br />
zwischen Gegenstand und bestimmendem Bedeutungsgehalt«<br />
repräsentieren soll und daher als ein »notwendiger dritter<br />
Bestandteil des Urteils« (GA 1, 178) aufgefaßt werden muß. Im<br />
Bestreben, die Gebietsfremdheit von Logik und Grammatik<br />
darzutun, wird so die Kopula, also das grammatische Bindeglied<br />
zwischen Subjekt und Prädikat, »das wesentlichste und<br />
eigentümlichste Element im Urteil«. Denn sie repräsentiert<br />
das Logische überhaupt, »sofern dessen Wirklichkeitsform gerade<br />
das Gelten ist«. Und so meint Heidegger nun behaupten<br />
zu können: »Aus der bestehenden Zweigliedrigkeit folgt analytisch,<br />
daß die Kopula ein notwendiger dritter Bestandteil des<br />
Urteils sein muß.« (GA 1, 178)<br />
Mit dieser Interpretation der Kopula als dritter Bestandteil des<br />
Urteils glaubt Heidegger die »Frage nach dem ›Sinn des Seins‹<br />
im Urteil erledigt« zu haben. Die Schlußfolgerung, daß die<br />
Kopula als vermittelnde Mitte zwischen den Relaten die Vermittlung<br />
leistet, wäre jedoch nur zwingend, wenn man bereits<br />
akzeptiert, was erst noch zu zeigen wäre: daß das Urteil im<br />
Sinne der Gegenstandstheorie als eine Verbindung des Subjekts<br />
mit dem Prädikat gedacht werden muß. Wenn man jedoch<br />
das Urteil als »Relation« vorstellt und die Kopula als jenes<br />
»wesentlichste [...] Element im Urteil« interpretiert, das eine<br />
»Relation vor den Gliedern« darstellt, dann wird nicht nur<br />
deutlich, daß der Wahrheitsanspruch fälschlicherweise als ein<br />
Geltungsanspruch verstanden werden muß, insofern die<br />
Kopula das logische »gilt« repräsentieren soll, sondern auch,<br />
daß Heideggers Antipsychologismus erkauft wird mit einer<br />
Idealisierung der Geltung und der Bedeutung, die sich zu den<br />
Urteilen wie Platons (427–347 v. Chr.) Ideen zu ihren irdischen<br />
Manifestationen verhält.<br />
Dies zeigt sich, wenn wir Heideggers Beispiel des prädikativen
Satzes betrachten. Das »Urteil: ›Der Einband ist gelb‹ hat den<br />
Sinn: Gelbsein des Einbandes gilt. Dieser Sinn läßt sich genauer<br />
so ausdrücken: Vom Einband gilt das Gelbsein.« (GA 1,<br />
175) Doch was besagt eigentlich: »Vom Einband gilt das Gelbsein«?<br />
Klar ist, daß der Übergang von »Der Einband ist gelb« zu<br />
»Vom Einband gilt das Gelbsein« eine Veränderung des Ausdrucks<br />
mit sich bringt. Die Form des Ausdrucks hat sich in der<br />
Weise verändert, daß das Prädikat »ist gelb« durch eine Nominalisierung<br />
in den singulären Terminus »das Gelbsein« verwandelt<br />
wurde.<br />
Nun läßt sich aber nicht nur zeigen, daß die nominalisierte<br />
Form semantisch sekundär ist gegenüber der prädikativen<br />
Form, sondern auch, daß Heidegger dadurch, daß er die semantische<br />
Dimension überhaupt nicht wahrnimmt, die Bedeutung<br />
des Prädikates durch dessen Vergegenständlichung<br />
als einen selbständigen Gegenstand auffassen muß, auf den referierend<br />
Bezug genommen wird, so daß die Prädikation nach<br />
dem Modell der Referenz mißdeutet werden muß. Semantisch<br />
sekundär ist die nominalisierte Form deshalb, weil der nominalisierte<br />
Satz »daß p« nicht mehr, sondern weniger enthält als<br />
der ursprüngliche Satz »p«. Denn ihm wurde bei der Transformation<br />
in den singulären Terminus sein Behauptungsmoment<br />
entzogen. 2 Wenn man nur sagt: »daß es heute regnet«, gibt<br />
man im Unterschied zu »heute regnet es« noch nichts zu verstehen,<br />
schafft allerdings eine Leerstelle durch den Verzicht<br />
auf das Behauptungsmoment. Und die Bedeutung des Prädikats<br />
muß Heidegger deshalb als einen selbständigen Gegenstand<br />
auffassen, weil das Geltende, das ja gerade nicht mehr<br />
im Sinne von Existenz gedacht werden sollte, sich durch die<br />
Nominalisierung »das Gelbsein« selbst in ein Existierendes<br />
verwandelt 3 , so daß Heidegger analog zu Rickert, Lask und<br />
Husserl die Bedeutung des Aussagesatzes als einen zusammengesetzten<br />
Gegenstand auffassen muß. Zwar sagt Heidegger<br />
selbst: »Aus dem Eigenschaftswort ›blau‹ ergibt sich durch<br />
Nominalisierung ›das Blaue‹ und so in jedem Fall.« (GA 1, 356)<br />
Dennoch meint er, daß es zu jedem Ausdruck, also auch für
Adjektive wie »blau« oder für Zahlen wie »fünf«, eine besondere<br />
Entität gibt, zu der der Ausdruck in der Beziehung der<br />
Bezeichnung steht.<br />
Nominalisten – für die die Universalien nur Namen sind und<br />
nichts Wirkliches repräsentieren – hatten für solche Vergegenständlichungen<br />
von Entitäten nur abfällige Etikettierungen<br />
übrig, da dieser Universalienrealismus auf einem simplen<br />
Kategorienfehler beruht, der nach Gilbert Ryle (1900–1976)<br />
folgendermaßen funktioniert: So wie es eine mir bekannte<br />
Entität gibt, etwa meinen Hund Fido, der auf den Namen<br />
»Fido« hört und durch diesen Namen bezeichnet wird, so muß<br />
es für jeden sinnvollen Ausdruck eine besondere Entität geben,<br />
zu der er in der Beziehung der Bezeichnung steht, eben<br />
der durch »Fido«–Fido bezeichneten Realität. Während jedoch<br />
»Fido« tatsächlich ein Name ist, behandelt der Universalienrealist<br />
auch Ausdrücke als Namen, die überhaupt keine<br />
Namen sind, eben Ausdrücke wie »blau« und »fünf«.<br />
Während für den Nominalismus, der in ontologischer Hinsicht<br />
als eine Gegenposition zum Universalienrealismus angesehen<br />
werden kann, die These charakteristisch ist, daß es<br />
keine abstrakten Entitäten gibt, die durch singuläre oder allgemeine<br />
Termini bezeichnet werden 4 , glaubt Heidegger, daß<br />
das Nomen nicht nur einen »Gegenstand überhaupt« oder ein<br />
»Wesen« zu bedeuten hat, sondern eben auch, daß dieses<br />
Wesen das Universale »repräsentiert«. Damit sind in bedeutungstheoretischer<br />
Hinsicht schon in seiner Dissertation und<br />
seiner Habilitation die Weichen für eine gegenstandstheoretische<br />
Engführung der Sprachphilosophie im allgemeinen und<br />
der Prädikations- und Bedeutungstheorie im besonderen<br />
gestellt.<br />
Aber auch Heideggers These, daß sich die Urteile in positive<br />
und negative einteilen lassen und daß die »Negation primär in<br />
der Kopula ruht« (GA 1, 183f.), eine Auffassung, die Heidegger<br />
mit Rudolf Hermann Lotze (1817–1881), Rickert, Husserl und<br />
den meisten Logikern seiner Zeit teilte 5 – eine These im übrigen,<br />
die uns in ontologisch modifizierter Form in Heideggers
Freiburger Antrittsvorlesung, Was ist Metaphysik, wiederbegegnen<br />
wird, insofern Heidegger hier behauptet, daß das<br />
»Nichts«, also ein unbestimmter singulärer Terminus, der<br />
überhaupt erst durch seine Nominalisierung zu einem bestimmten<br />
singulären Terminus wird, »ursprünglicher als das<br />
Nicht und die Verneinung« (GA 9, 108) ist –, kann in dieser<br />
Form nicht richtig sein, da es keine Möglichkeit gibt, die Sätze<br />
in bejahende und verneinende einzuteilen. Denn das Prädikat<br />
»ist gelb« ist genauso positiv wie das Prädikat »ist nicht gelb«.<br />
Folglich unterscheiden sich die beiden Sätze nicht als Behauptungen,<br />
sondern lediglich hinsichtlich ihres propositionalen<br />
Gehalts. Dies jedoch bedeutet, daß die Negation keine Eigenschaft<br />
ist, die einem Urteil an sich zukommt, sondern eine<br />
Operation darstellt, die, auf einen Satz angewendet, den entgegengesetzten<br />
erzeugt. 6<br />
Der von Heidegger übersehene Punkt ist, daß der Aussagesatz<br />
»Der Einband ist gelb« genauso behauptend ist wie der Aussagesatz<br />
»Der Einband ist nicht gelb«. Der zweite Satz negiert<br />
nicht den ersten, sondern lediglich das, was der erste behauptet<br />
– seinen propositionalen Gehalt. 7 Der propositionale Gehalt<br />
entspricht nun aber genau dem, was in der nominalisierten<br />
Form durch »daß p« zum Ausdruck gebracht wird. Wenn also<br />
sowohl der Sprecher als auch der Hörer sagen kann: »das ist<br />
wahr«, dann sind die Sprechhandlungen, mit denen ein Hörer<br />
auf eine Behauptung des Sprechers reagiert, in der gleichen<br />
geregelten Weise auf die Äußerungen des Sprechers bezogen,<br />
wie die Sprechhandlungen eines Sprechers auf die Ja/Nein-<br />
Stellungnahmen des Hörers. Dies aber bedeutet, daß es keinen<br />
generellen Unterschied und auch kein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis<br />
»zwischen bejahenden und verneinenden Aussagen<br />
gibt; wir können nur sagen, daß die zweite die Verneinung<br />
der ersten ist«, so wie die erste die Verneinung der<br />
zweiten. Beide Sprechhandlungen beziehen sich offenkundig<br />
auf dasselbe: Das, was der eine Sprecher verneint, wird von<br />
dem anderen Sprecher bejaht. 8<br />
Hätte sich Heidegger an der Konfrontation zweier entgegen-
gesetzter Behauptungen orientiert, dann hätte sich zweierlei<br />
gezeigt: erstens, daß die Möglichkeit der Verwendung des<br />
Wortes »wahr« mit der Erklärung der Verwendung assertorischer,<br />
also behauptender Sätze zusammenfällt. Und zweitens,<br />
daß das, was Heidegger mit Bezug auf Rickerts Aufsatz Urteil<br />
und Urteilen »beim Akt der Bejahung« eines »wahren Urteilsgehaltes«<br />
den »Ja-Sinn« nennt 9 (beim Akt der Verneinung des<br />
unwahren Urteilsgehalts müßten wir dann folglich von einem<br />
»Nein-Sinn« sprechen können, obgleich Rickert auch sagt, daß<br />
immer dann, wenn dem »gültigen Wertgehalte« kein »Bejahen<br />
im Subjektiven« entspricht, »Urteilen logisch sinnlos« sei 10 ),<br />
der als immanenter Urteilssinn dem objektiven Urteilsgehalt<br />
zur Seite steht, sich sprachanalytisch reformuliert als die Stellungnahme<br />
eines Hörers rekonstruieren läßt, der zu einem<br />
konstatierenden Sprechakt mit »Ja« oder »Nein« Stellung<br />
nimmt – und zwar ohne dafür auf einen objektiven Urteilsgehalt<br />
jenseits der tatsächlichen Bejahung oder Verneinung<br />
rekurrieren zu müssen. Dies setzt allerdings voraus, daß die<br />
Kopula nicht in die Negation lanciert und dann auch noch als<br />
die vermittelnde Mitte zwischen Subjekt und Prädikat interpretiert<br />
wird, die das Geltende repräsentiert. Denn eben mit<br />
dieser Interpretation der Kopula stellt Heidegger seine Bedeutungstheorie<br />
auf eine Basis, die es erforderlich macht, die Bedeutung<br />
des ganzen Satzes aus der Bedeutung seiner Teile zu<br />
rekonstruieren. Das Problem besteht jedoch gerade darin, daß<br />
sich der prädikative Satz überhaupt nicht als eine solche Relationsaussage<br />
verstehen läßt. Allein unter der gegenstandstheoretischen<br />
Voraussetzung, daß sich die Kopula vom Prädikat<br />
trennen läßt und als unselbständiges, also »synkategorematisches«<br />
Verbindungswort fungiert, das die Synthesis repräsentiert,<br />
kann es erst als sinnvoll erscheinen, daß das Prädikat für<br />
etwas steht und daß sich der Sachverhalt in einer kategorialen<br />
Synthesis konstituiert.<br />
Während sich also Heideggers Kritik an den relativistischen<br />
Konsequenzen des Psychologismus mittels der Unterscheidung<br />
von »Urteilsvollzug« und »Urteilssinn« auch heute noch
aufrechterhalten läßt, muß sein Versuch, die Voraussetzungen<br />
des Psychologismus durch eine gegenstandstheoretische Urteilstheorie<br />
in Frage zu stellen, als gescheitert angesehen werden.<br />
Und dies aus zwei Gründen: zum einen, weil die Widerlegung<br />
des Psychologismus mit einer falschen Ontologisierung<br />
logischer Sachverhalte erkauft wird, so daß Heidegger den<br />
Relativismus nur um den Preis des Absolutismus überwinden<br />
konnte – was ihm im Verlauf seines »Denkweges« bewußt<br />
wird; zum anderen, weil Heidegger eine Voraussetzung mit<br />
dem Psychologismus teilt, die Voraussetzung nämlich, daß<br />
das Urteil sich einer Synthesis von Subjekt und Prädikat verdankt,<br />
wobei der Status der Kopula innerhalb der einzelnen<br />
»Urteilslehren« strittig war. Diese Voraussetzung, die sowohl<br />
von Psychologisten als auch von Antipsychologisten nie angezweifelt<br />
wird, ist deshalb problematisch, weil sie das, was mit<br />
ebendieser Voraussetzung aufgeklärt werden soll, nämlich die<br />
logische Struktur des Urteils, nicht aufklären kann.<br />
Freilich bleibt die Frage offen, ob es für Heidegger überhaupt<br />
eine Alternative zum gegenstandstheoretischen Paradigma<br />
gab. Und eine solche gab es in der Tat – und zwar in Gestalt der<br />
Arbeiten von Gottlob Frege (1848–1925). 11 Freges Theorie des<br />
Sinns bietet uns einen Ansatz zur Lösung unserer Frage, insofern<br />
der Sinn lediglich in der Art und Weise der Bestimmung<br />
des Bezuges des Ausdrucks besteht, die ihrerseits ein Schritt<br />
ist bei der Bestimmung des Wahrheitswerts eines Satzes, in<br />
dem dieser Ausdruck vorkommt.<br />
Wenn es also innerhalb eines gegenstandstheoretischen Paradigmas<br />
unmöglich ist, die logische Struktur des prädikativen<br />
Satzes aufzuklären, dann kann es sich bei den Differenzen<br />
zwischen Heidegger, Husserl, Rickert, Lask und Josef Geyser<br />
(1869–1948) lediglich um binnentheoretische Unterschiede<br />
innerhalb eines Paradigmas handeln, eben des gegenstandstheoretischen.<br />
Dies bedeutet dann aber, daß die Frage, an der<br />
sich im »Psychologismusstreit« die Geister scheiden, nicht die<br />
ist, ob wir in der Urteilstheorie einen psychologistischen oder<br />
antipsychologistischen Standpunkt vertreten. Die Logistik ist
ja ebenfalls antipsychologistisch ausgerichtet. Die Frage, an<br />
der sich die Geister scheiden, bezieht sich darauf, ob wir in der<br />
Urteilstheorie einen gegenstandstheoretischen oder einen<br />
funktionalen Ansatz vertreten. Das heißt dann aber, daß die<br />
Frontlinie im »Psychologismusstreit« nicht nur zwischen<br />
Psychologisten und Antipsychologisten verläuft, da auch alle<br />
von Heidegger kritisierten psychologistischen Positionen<br />
gegenstandstheoretisch ausgerichtet sind, sondern zwischen<br />
Frege, Bertrand Russell (1872–1970) und dem frühen Ludwig<br />
Wittgenstein (1889–1951) auf der einen Seite und Heidegger,<br />
Husserl, Rickert, Lask und Geyser inklusive der psychologistischen<br />
Positionen von Wilhelm Wundt (1832–1920), Heinrich<br />
Maier (1867–1933), Franz Brentano (1838–1917), Anton Marty<br />
(1847–1914), und Theodor Lipps (1851–1941) auf der anderen<br />
Seite. Der Grund für diesen etwas seltsam klingenden Befund<br />
ist leicht benannt: Die gegenstandstheoretische Voraussetzung<br />
in der Urteilstheorie ist sowohl mit einer relativistisch-psychologistischen<br />
als auch mit einer absolutistischontologischen<br />
Deutung kompatibel, nicht hingegen mit einer<br />
funktionalen, mit der sich allein die logische Struktur prädikativer<br />
Sätze aufklären läßt.<br />
Heidegger und die Logistik<br />
Der beschriebenen Auffassung steht jedoch das Gros der Heidegger-Interpretationen<br />
entgegen, insoweit sie sich überhaupt<br />
auf unser Problem einlassen – was allerdings eher die Ausnahme<br />
als die Regel darstellt. So gibt Manfred Riedel zwar zu,<br />
daß sich Heidegger, um der »Subjektivierung des Wahrheitsproblems«<br />
zu entgehen, »die der angestrebten Objektivität der<br />
Lehre vom Urteil aufs härteste widerspricht«, auf »die neue<br />
Logik von Frege« hätte beziehen können, »die gegen die Reduktion<br />
der Kopula im Urteil auf das ›es gilt‹ auf ein ›es gibt<br />
(existiert)‹ zurückgreift und damit die Begrifflichkeit von Sinn
1. Die politische <strong>Philosophie</strong> als Frage nach<br />
der Freiheit<br />
»Was dieser heute baut,/reißt jener morgen ein;<br />
Wo itzund Städte stehn,/wird eine Wiesen sein.«<br />
Andreas Gryphius, 1643<br />
Eine Einführung zu einem philosophischen Thema besteht<br />
nicht nur aus Zahlen, Daten und Fakten; sie zielt auch auf<br />
das Verständnis der leitenden Fragestellung und Methode<br />
und möchte dem Leser das <strong>Philosophie</strong>ren näher bringen.<br />
<strong>Philosophie</strong>ren lernt man wie das Schwimmen. Man springt<br />
hinein und strampelt, bis es einen trägt. Eigentlich springt<br />
man aber nicht, sondern strampelt »immer schon« in einem<br />
Fluss ohne Ufer mit offenem Horizont. Man beginnt nicht zu<br />
einem bestimmten Zeitpunkt mit einem klar begrenzten Geschäft<br />
der <strong>Philosophie</strong>; vielmehr hat man Fragen, die mit der<br />
menschlichen Existenz gegeben sind und mehr oder weniger<br />
streng bedacht werden können. Man startet nicht bei null und<br />
endet nicht mit einer einzig wahren, absolut richtigen <strong>Philosophie</strong>.<br />
Es geht darum, sich Gedanken zu machen und sie<br />
professionell in der Auseinandersetzung mit der klassischen<br />
Überlieferung und im lebendigen Gespräch mit Lehrern und<br />
Freunden zu entwickeln.<br />
Der Wissensbestand oder Stoff, den philosophische Einführungen<br />
zu bieten haben, ist zumeist ziemlich unstrittig. So<br />
wird jeder Leser hier wohl erwarten, dass vom »Menschen«<br />
als einem sozialen, politisch lebenden Wesen, vom »Staat« als<br />
institutioneller Organisation des politischen Lebens und vom<br />
Verhältnis der Bürger zum Staat sowie der Staaten untereinander<br />
die Rede ist. Er wird auch erwarten, dass von Gerechtigkeit,<br />
Menschenrechten und Demokratie, von Krieg und<br />
Frieden gesprochen wird. Weniger selbstverständlich dürfte<br />
aber sein, wie sich die philosophische Betrachtungsweise von
der rechtswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen<br />
unterscheidet. Denn alle genannten Themen werden auch<br />
von Juristen, Soziologen und Politikwissenschaftlern in ihren<br />
Beschreibungen einer Staatsorganisation behandelt. Die Eigenart<br />
einer philosophischen Einführung also ist strittig. Welche<br />
Sprache ist ihr angemessen? Wie viel Stoff gehört hinein?<br />
Soll man sich auf die Ideengeschichte oder auf die philosophische<br />
Betrachtung aktueller Probleme konzentrieren?<br />
Gute Einführungen sind zugleich Werbeschriften für die<br />
<strong>Philosophie</strong>. Man kann nicht eine Teildisziplin darstellen,<br />
ohne zugleich eine Gesamtauffassung vom Fach zu vertreten.<br />
Das vorliegende Bändchen macht sie eingangs explizit. <strong>Philosophie</strong><br />
lässt sich, scheint mir, als argumentativer Versuch verstehen,<br />
die eigene Lebensführung akademisch umfassend zu<br />
verantworten: als Selbstbegründung der Freiheit. Weil Individuen<br />
sich Freiheit unterstellen, haben sie philosophische<br />
Fragen und Antworten. Politische <strong>Philosophie</strong> fragt deshalb<br />
nach den humanen Möglichkeiten und den historisch-politischen<br />
Bedingungen der Freiheit. Das Gute und das Gerechte<br />
lassen sich hier nicht gänzlich voneinander trennen. Denn die<br />
Selbstrechtfertigung zwingt moralisch zu der universalisierenden<br />
Forderung, dass auch andere Menschen unter<br />
ähnlichen Bedingungen in Freiheit leben sollten. Dies führt<br />
zu politischen Konsequenzen, ohne die eine <strong>Philosophie</strong><br />
nicht vollendet wäre. <strong>Philosophie</strong> rechtfertigt insofern einen<br />
Teilnahmestandpunkt und sollte deshalb auch engagiert betrieben<br />
werden. Ihr Versuch, den eigenen Standpunkt akademisch<br />
auszuweisen, unterscheidet sie dabei vom geläufigen<br />
Parteistandpunkt. Ihr Teilnehmerstandpunkt hingegen<br />
unterscheidet sie von der Beobachterperspektive der Rechtsund<br />
Sozialwissenschaften. Zwar sind auch Juristen keine<br />
»neutralen« Beobachter, sondern nehmen mit ihren Positionen<br />
und Begriffen am politischen »Ringen um ›Verfassung‹« 1<br />
Anteil; damit setzen sie aber einen Rechtsstandpunkt ihrer<br />
normativen Perspektive voraus. Politische Philosophen dagegen<br />
treten noch hinter das positiv geltende Recht zurück. Wie
Rechtsphilosophen fragen sie danach, ob eine Rechtsordnung<br />
gerechtfertigt ist. Anders als Rechtsphilosophen fragen sie jedoch<br />
auch, ob die konkrete Politik im Interesse der Entwicklung<br />
der humanen Möglichkeiten und politischen Verfassung<br />
wünschbar ist.<br />
Eine Einführung in die politische <strong>Philosophie</strong> ist kein Lehrbuch.<br />
Sie kann nicht alle Argumente durchspielen und eine<br />
breite Übersicht über die Vielfalt historisch und aktuell vertretener<br />
Positionen bieten. In der gebotenen Kürze möchte ich<br />
dennoch den Grundriss politischer <strong>Philosophie</strong> vom Keller<br />
bis zum Dach zeigen. Die philosophischen Fundamente gehören<br />
dabei ebenso dazu wie das aktuelle Material und die<br />
ideengeschichtlichen Tapeten. Die Einführung gliedert sich<br />
deshalb in einen philosophisch-systematischen, einen werkgeschichtlich-literaturwissenschaftlichen<br />
und einen politisch-aktuellen<br />
Teil: Sie skizziert einen systematischen Ansatz,<br />
literarische Traditionen und Methoden sowie einige<br />
aktuelle Aufgaben politischer <strong>Philosophie</strong>. Zunächst wird der<br />
leitende <strong>Philosophie</strong>begriff entwickelt, dann werden die<br />
ideengeschichtliche Methode und Überlieferung und schließlich<br />
einige aktuelle Aufgaben skizziert. Bei der kurzen Besichtigung<br />
des weiten Gebäudes soll dem Leser vor allem<br />
deutlich werden, dass politische <strong>Philosophie</strong> eine normativpraktische<br />
Disziplin ist, die sich in ständiger Reflexion auf die<br />
politische Geschichte entwickelt. Selbstverständlich gibt es<br />
auch andere Zugangsweisen: Peter Nitschke 2 berücksichtigt<br />
die politische Ideengeschichte eingehender, Christoph Horn 3<br />
sondiert die Fülle aktuell möglicher Ansätze systematisch. Ich<br />
will die Einheit des philosophischen Fragens im Ansatz skizzieren,<br />
die literarische Tradition vorstellen und einen politischen<br />
Faden philosophisch knüpfen.
2. Systematische Aspekte politischer<br />
<strong>Philosophie</strong><br />
<strong>Philosophie</strong>: Der »Sinn des Lebens«<br />
Die Rede von »politischer <strong>Philosophie</strong>« ist leicht missverständlich.<br />
Denn sie lässt eine politische Betrachtung der <strong>Philosophie</strong><br />
oder eine philosophische der Politik erwarten. Landläufig<br />
ist alles politisch, damit auch die <strong>Philosophie</strong>. Hier ist<br />
allerdings keine politische Betrachtung oder gar Politisierung<br />
der <strong>Philosophie</strong> gemeint, sondern eine philosophische Reflexion<br />
der Politik. Eine wichtige Aufgabe dieser <strong>Philosophie</strong> ist<br />
es, den Politikbegriff angemessen zu begrenzen. Denn nicht<br />
alles ist politisch. Zwar neigt der Sprachgebrauch dazu, alles<br />
interessegeleitete strategische Handeln politisch zu nennen.<br />
Dann müsste es aber auch Politik sein, wenn ein Kind sich von<br />
seinen Eltern ein paar Süßigkeiten erbettelt. Ein solcher<br />
Sprachgebrauch ist zu weit. Andererseits verengt es den Politikbegriff,<br />
politisches Handeln mit institutionellem Handeln<br />
gleichzusetzen und darunter nur staatliches Handeln zu verstehen.<br />
Damit würden die Bürger nur als Adressaten staatlicher<br />
Verwaltung angesprochen und fielen als politische Akteure<br />
aus. Zwischen diesen Extremen muss der Politikbegriff<br />
bestimmt werden. Statt also missverständlich von »politischer<br />
<strong>Philosophie</strong>« zu sprechen (oder den engeren Wortgebrauch<br />
nur durch eine Großschreibung als »Politische <strong>Philosophie</strong>«<br />
anzudeuten), sollte besser von einer »<strong>Philosophie</strong> der Politik«<br />
oder des »politischen Handelns« gesprochen werden, die sich<br />
auch als anwendungsorientierte politische <strong>Philosophie</strong> der<br />
Politik vorstellt. Deshalb könnte dieses Büchlein auch<br />
»Einführung in die <strong>Philosophie</strong> der Politik« heißen. Weil die<br />
Rede von politischer <strong>Philosophie</strong> aber verbreiteter ist und es<br />
gute Gründe gibt, sich am Sprachgebrauch zu orientieren,
wird weiter von politischer <strong>Philosophie</strong> gesprochen. Wo terminologische<br />
Klarheit erforderlich ist, steht »<strong>Philosophie</strong> der<br />
Politik«.<br />
Historisch betrachtet gibt es eine Vielzahl von <strong>Philosophie</strong>begriffen.<br />
Ein Blick in begriffsgeschichtliche Lexika 1 belehrt<br />
darüber. Es wäre somit naiv, den eigenen Begriff schlicht für<br />
»die« <strong>Philosophie</strong> zu erklären. Andererseits gehört der Geltungsanspruch<br />
auf »Wahrheit« zur Sache. Die vorliegende<br />
Einführung will keine beliebige Meinung, sondern allgemein<br />
zustimmungsfähige Einsichten formulieren. Ein elementares<br />
Fachverständnis ist dabei weniger strittig als die systemphilosophische<br />
Ausarbeitung. Die Vielfalt der vertretenen <strong>Philosophie</strong>begriffe<br />
reduziert sich bei vergleichender Betrachtung<br />
überhaupt schnell. Typologien und Klassifikationen belegen<br />
die Begrenztheit sinnvoll und konsequent möglicher Standpunkte.<br />
2<br />
Das Wort »<strong>Philosophie</strong>« 3 stammt bekanntlich aus dem Griechischen<br />
(philosophia). Es ist ein Kompositum aus philos<br />
(Freund) und sophia (Weisheit) und meint ein liebendes Streben<br />
nach Wissen im weiten Sinne von Kenntnissen, Fertigkeiten,<br />
Umsicht und Urteilskraft. Der Philosoph strebt nach<br />
Wissen. Er hat es nicht geoffenbart bekommen oder für sich<br />
gepachtet. Selten nennen wir einen Wissenschaftler weise.<br />
Denn »Weisheit« meint heute ein praktisches Tugendwissen.<br />
Einen weisen Menschen stellt man sich gern als alten Mann<br />
oder alte Frau am Fluss vor, als eine Person, die um die Sitten<br />
weiß und Lebenserfahrungen gesammelt hat, die sie in Geschichten,<br />
moralischen Exempeln oder Spruchweisheiten<br />
mitteilt. Ein solches Tugendwissen fällt in traditionalen Gesellschaften<br />
unter stabilen Verhältnissen mit dem Wissen um<br />
die Sitten, Gebräuche, Gepflogenheiten zusammen. Solche<br />
Klugheitsregeln des sozialen Erfolgs sind, historisch betrachtet,<br />
in einem Zwischenraum zwischen einem religiösen und<br />
einem säkular-moralischen Wissen um Prinzipien und Regeln<br />
angesiedelt. An der Schwelle der Unterscheidung moralischer<br />
Normen von religiösen Geboten steht ein Tugendwissen, das
sich nicht mehr rein religiös und noch nicht dezidiert moralisch<br />
in der Unterscheidung von konventionell überkommenen<br />
Sitten versteht. Es kennt die Gründe nicht, weshalb es<br />
moralisch ist, und pflegt ein moralisches Vorurteil für die Sitten.<br />
Das ist aber auch pragmatisch heikel. Denn die Sentenzen<br />
der Guten, Alten, Weisen verlieren unter gewandelten<br />
Lebensverhältnissen an praktischem Nutzen und Geltungskraft.<br />
<strong>Philosophie</strong> hingegen ist keine solche Weisheitslehre,<br />
sondern Wissenschaft. Sie begnügt sich nicht mit lehrhaften<br />
Geschichten, sondern sucht die moralischen Gründe für ein<br />
Verhalten im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit an einem<br />
Weltbild begrifflich zu bestimmen.<br />
Historisch lässt sich der Unterschied von <strong>Philosophie</strong> und<br />
Weisheitslehre an der Schwelle der Entstehung der okzidentalen<br />
Wissensform »<strong>Philosophie</strong>« gut studieren. Man kann ihn<br />
auch diskursanalytisch und literaturwissenschaftlich untersuchen.<br />
Der philosophische Diskurs entstand in der Abgrenzung<br />
von der überlieferten religiösen und mythologischen Weltdeutung<br />
mit der Ausbildung wissenschaftlicher Prosa. 4 Die ersten<br />
Autoren, die als Philosophen kanonisiert sind, pflegten noch<br />
literarische Formen, die heute nicht als Sachtexte gelten. Das<br />
Lehrgedicht, das Epigramm, der Aphorismus, der Kunstdialog,<br />
der Brief sind literarische Formen der Frühzeit der <strong>Philosophie</strong>.<br />
Noch Platon (428/427–349/348 v. Chr.) spricht nicht<br />
im eigenen Namen, sondern lässt für sich sprechen. Auch die<br />
Texte des Aristoteles (384/383–322 v. Chr.), ursprünglich<br />
Vorlesungsmanuskripte für den Schulgebrauch, wurden erst<br />
im 1. Jahrhundert v. Chr. (von Andronikos von Rhodos) zusammengestellt<br />
zum Muster der okzidentalen Wissenschaftsprosa.<br />
In den heutigen Sprachgebrauch geht die <strong>Philosophie</strong>geschichte<br />
ein. Schon Aristoteles setzte beim philosophiegeschichtlichen<br />
Sprachgebrauch an und prüfte ihn systematisch.<br />
Dieser begriffsgeschichtliche und -analytische Zugang<br />
ist heute selbstverständlich. Wenn es einen Fortschritt in der<br />
<strong>Philosophie</strong> gibt – und wenn <strong>Philosophie</strong> eine Wissenschaft
ist, sollte es ihn geben –, dann kondensiert die Alltagssprache<br />
ihn mehr oder weniger klar. Nicht nur die <strong>Philosophie</strong>geschichte,<br />
sondern auch der alltagssprachliche Gebrauch ist<br />
deshalb ein Anhalt des <strong>Philosophie</strong>begriffs.<br />
Fragt man, wie Sokrates (470–399 v. Chr.) einst die Bürger und<br />
Sklaven Athens, in Deutschland einen beliebigen Passanten<br />
auf der Straße nach dem Gegenstand der <strong>Philosophie</strong>, so wird<br />
er vermutlich etwa sagen: »Die <strong>Philosophie</strong> sucht irgendwie<br />
nach dem ›Sinn des Lebens‹.« Bildungsstolz klingt an. Fragt<br />
man weiter nach der Methode, die die Wissenschaftlichkeit<br />
der <strong>Philosophie</strong> kennzeichnet, so antwortet er vielleicht:<br />
»Philosophen labern.« Eine solche Antwort baut den ersten<br />
Respekt mit der auftrumpfenden Versicherung ab, jedermann,<br />
so auch der Passant, philosophiere irgendwie und<br />
irgendwann. Der Durchschnittsbürger banalisiert die <strong>Philosophie</strong><br />
zur Durchschnittsmeinung und hält alle Meinungen für<br />
relativ wahr. Er bezweifelt die Wissenschafts- und Wahrheitsfähigkeit<br />
der <strong>Philosophie</strong> und negiert den Sinn der »Sinnfrage«,<br />
von der er eingangs selbst sprach. Seine Skepsis gegenüber<br />
dem »Gelaber« ist zwar durchaus angebracht;<br />
Geringschätzung aber ist nicht angemessen. Denn Menschen<br />
»wohnen« in ihrer Sprache.<br />
Die gängige Auffassung, <strong>Philosophie</strong> bearbeite in diskursiver<br />
Form und natürlicher Sprache Fragen nach dem »Sinn des<br />
Lebens«, kann als Minimalverständnis akzeptiert werden. Die<br />
Frage nach dem »Sinn des Lebens« heißt hier deshalb die<br />
»Grundfrage« der <strong>Philosophie</strong>. Sie kann nicht empirisch gültig<br />
beantwortet werden, weil sie die Handlungsorientierung<br />
durch Prinzipien und Normen betrifft, und sollte dennoch so<br />
intensiv wie möglich diskutiert werden.<br />
Wie gestaltet sich nun das Verhältnis der <strong>Philosophie</strong> zu den<br />
anderen Wissenschaften? Die <strong>Philosophie</strong> gilt als Mutter aller<br />
Wissenschaften. Die Wissenschaftsgeschichte erscheint dann<br />
als ein Prozess der »Ausdifferenzierung« selbstständiger Wissenschaften.<br />
Dies lässt sich als Fortschritt der Profilierung der<br />
einzelnen Wissenschaften, so auch der <strong>Philosophie</strong>, auffas-
sen. Systemtheoretisch belehrt sehen wir heute die Schwierigkeiten<br />
interdisziplinärer Kooperation. Wissenschaftler tragen<br />
die Brille ihres Fachs und können die Methoden und<br />
Ergebnisse der anderen kaum nachvollziehen. Das ist für die<br />
<strong>Philosophie</strong> besonders beunruhigend, weil sie als weltanschauliches<br />
Synthesefach von der Überschau und Zusammenschau<br />
des gegenwärtigen Wissens lebt. 5 Der Universalitätsanspruch<br />
der <strong>Philosophie</strong>, »Platzanweiser« der<br />
einzelnen Wissenschaften zu sein 6 und jedem positiv festgestellten<br />
Wissen seinen Ort in einem enzyklopädischen System<br />
zuzuweisen, erscheint den anderen Wissenschaften heute<br />
zwar oft als eine Anmaßung; er rechtfertigt sich aber durch<br />
einen »schwachen«, oder besser: normativ-praktischen und<br />
»lebensweltlichen«, Wissenschaftsbegriff. <strong>Philosophie</strong> klärt<br />
den Funktions- und Organisationszusammenhang des Lebens<br />
aus der Perspektive des normativ-praktisch interessierten<br />
Individuums. Menschen müssen die Frage nach dem<br />
»Sinn des Lebens« individuell beantworten. Deshalb lässt<br />
<strong>Philosophie</strong> sich in der Tat als Mutter aller Wissenschaften bezeichnen.<br />
Denn alle Wissenschaften dienen in unterschiedlicher<br />
Weise der pragmatischen Bewältigung des Lebens<br />
durch eine Rationalisierung der Lebensführung.<br />
Wissenschaft gibt es nur, weil Menschen sich als frei handelnde,<br />
moralische Wesen verstehen, die ihr Leben sinnhaft<br />
führen können. Diverse Wissenschaften haben einen pragmatischen<br />
Bezug zur Rationalisierung der Lebensführung,<br />
den sie allerdings in ihrer alltäglichen Forschungspraxis nicht<br />
thematisieren. <strong>Philosophie</strong> kann ihnen nicht hineinregieren;<br />
doch sie kann als Wissenschaftstheorie mit ihnen kommunizieren.<br />
Der wissenschaftstheoretische Bezug richtet sich dabei<br />
heute vornehmlich auf die methodologische Kritik der<br />
Forschungspraxis. <strong>Philosophie</strong> prüft dann die Begriffe und<br />
Methoden der anderen Wissenschaften und misst sie an ihren<br />
eigenen Begriffen.<br />
Immanuel Kant (1724–1804) hat in seiner Universitätsschrift<br />
klassisch vorgeführt, wie dies geschieht 7 . Er geht dabei von
der überlieferten Einteilung der mittelalterlichen Universität<br />
aus und zeigt, dass den »oberen«, berufsausbildenden (theologischen,<br />
juristischen und medizinischen) Fakultäten die leitenden<br />
Grundbegriffe durch Kirche und Staat vorgegeben<br />
sind. Im Rahmen dieser autoritativen Vorgaben ist den oberen<br />
Fakultäten, so Kant, eine umfassende Bestimmung der Religion,<br />
des Rechts, der Gesundheit nicht möglich. Sie sind an<br />
einen »Nutzen« für Kirche und Staat gebunden, was freie, an<br />
der Idee der »Wahrheit« orientierte Forschung unmöglich<br />
macht. Die untere, philosophische Fakultät dagegen sei nur<br />
der Idee freier Forschung verpflichtet und könne deshalb die<br />
vorausgesetzten Begriffe von Religion, Recht, Gesundheit in<br />
ihren Grenzen prüfen.<br />
Bei der heutigen, komplexeren Struktur der Universitäten ist<br />
diese Unterscheidung nutzenorientierter Ausbildung und<br />
wahrheitsorientierter Forschung zu einfach. Viele Wissenschaften<br />
institutionalisieren ihre philosophische Kritik auch<br />
in eigenen Lehrstühlen oder Lehraufträgen, und ein großer<br />
Teil der philosophischen Forschung hat sich aus dem interdisziplinären<br />
Gespräch auf das eigene Fach und dessen Geschichte<br />
zurückgezogen. Die Begriffs- und Theoriebildung<br />
der anderen Wissenschaften unterscheidet sich aber dennoch<br />
von der philosophischen. Es macht einen Unterschied, ob<br />
man seine Begriffe von Gott, der Natur oder dem Recht im<br />
Rahmen theologischer, physikalischer oder juristischer Forschung<br />
oder im Zusammenhang genuin philosophischer Theoriebildung<br />
entwickelt.<br />
Idealtypisch lässt sich hier zwischen analytisch-beschreibenden<br />
und philosophisch-konstruktiven Theoriebildungen<br />
differenzieren. Unstrittig findet in theologischen oder juristischen<br />
Fakultäten auch philosophische Forschung statt. Umgekehrt<br />
mögen etablierte Philosophen bisweilen wie Historiker<br />
oder Juristen arbeiten. Dennoch ist die Unterscheidung<br />
hilfreich. So beschreiben etwa theologische oder auch transkonfessionelle<br />
religionswissenschaftliche Studien Praktiken<br />
und Selbstverständnisse, die sie historisch oder aktuell vor-
finden, ohne ihre Resultate an einer metapositiven philosophischen<br />
Begriffsbildung zu messen und etwa zu entscheiden,<br />
ob eine empirisch gegebene Religion einen philosophisch<br />
adäquaten Begriff von Gott hat. So analysieren<br />
beispielsweise Juristen die interne Kohärenz und Semantik<br />
eines Rechtssystems und formulieren dogmatisch tragende<br />
Grundbegriffe, ohne sie vor das Forum eines metapositiven<br />
Gerechtigkeitsbegriffs zu zitieren. Kant hat das spitz bemerkt:<br />
»Was ist Recht? Diese Frage möchte den Rechtsgelehrten [...] eben so<br />
in Verlegenheit setzen, als die berufene Aufforderung: Was ist Wahrheit?<br />
den Logiker. Was Rechtens sei (quid sit iuris), d. i. was die Gesetze<br />
an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt<br />
haben, kann er noch wohl angeben; aber ob das, was sie wollten,<br />
auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt<br />
Recht sowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erkennen könne,<br />
bleibt ihm wohl verborgen, wenn er nicht eine Zeitlang seine empirischen<br />
Prinzipien verläßt, die Quellen jener Urteile in der bloßen Vernunft<br />
sucht (wiewohl ihm dazu jene Gesetze vorzüglich zum Leitfaden<br />
dienen können), um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung<br />
die Grundlage zu errichten.« 8<br />
Die bundesdeutsche Rechtswissenschaft trägt der Eigenart<br />
einer juristisch disziplinierten Theoriebildung dadurch Rechnung,<br />
dass sie die analytische Rechtstheorie bis in die Lehrstuhlbeschreibungen<br />
hinein terminologisch von der Rechtsphilosophie<br />
absetzt. 9 Schon Georg W. F. Hegel (1770–1831) 10<br />
unterschied beiläufig zwischen »Theorie« und »<strong>Philosophie</strong>«.<br />
Das ist sinnvoll, um die jeweilige akademische Perspektivierung<br />
von Grundlagendiskursen zu kennzeichnen. Deshalb<br />
schlage ich vor, trotz der abweichenden Begriffsgeschichte,<br />
die auf eine Gleichsetzung der beiden Termini hinausläuft,<br />
generell zwischen Theorie und <strong>Philosophie</strong> zu unterscheiden.<br />
Von analytischen Theoriebildungen ist dann zu sprechen,<br />
wenn Grundfragen aus der Perspektive empirischer Wissenschaften<br />
behandelt werden, von <strong>Philosophie</strong> dagegen nur
dort, wo die Begriffs- und Theoriebildung metapositiv mit<br />
philosophischen Mitteln erfolgt. Das ermöglicht es, den methodischen<br />
Ansatz bestimmter Forschungen terminologisch<br />
deutlicher zu markieren und den Beitrag philosophischer<br />
Fragestellungen im interdisziplinären Gespräch zu ermitteln.<br />
Im fachphilosophischen Gespräch gibt es immer wieder Unklarheiten<br />
darüber, wann sich ein Philosoph im Kompetenzbereich<br />
anderer Wissenschaften bewegt und wann er einen<br />
philosophischen Beitrag leistet. Solche Grenzüberschreitungen<br />
sind unvermeidlich und unerlässlich. Philosophen sollen<br />
möglichst »universitär« kommunizieren. Sie sollten aber auch<br />
wissen, was ihr genuiner Aufgaben- und Kompetenzbereich<br />
ist und wo sie in fremden Jagdgründen wildern. Das ist schon<br />
um der Klärung der jeweiligen Wissenschaftsstandards und<br />
Diskurspflichten willen nötig.<br />
Üblicherweise wird innerhalb der <strong>Philosophie</strong> beispielsweise<br />
von Erkenntnistheorie oder Wissenschaftstheorie gesprochen.<br />
11 Hilfreich ist es, darüber hinaus zwischen Wissenschaftstheorie<br />
und -philosophie zu unterscheiden. Wissenschaftstheoretische<br />
Fragestellungen betreffen insbesondere<br />
die Methodologie der Forschung. Die Kompetenzvermutung<br />
liegt hier zunächst bei den empirischen Wissenschaften, die<br />
ihre Forschungspraxis oft besser beschreiben können, als<br />
Philosophen dies möglich ist. Dennoch gibt es interessante<br />
perspektivische Differenzen und Berührungen, weshalb ein<br />
interdisziplinäres Gespräch über wissenschaftstheoretische<br />
Fragen sinnvoll ist. Jenseits dieser Fragen gibt es aber auch<br />
einen Bereich wissenschaftsphilosophischer Fragen, bei denen<br />
die Kompetenzvermutung eher auf Seiten der Fachphilosophen<br />
liegt. Sie betrifft beispielsweise ethische Probleme der<br />
Forschungspraxis und ihrer technischen Verwertung oder<br />
den Status einer Wissenschaft im Feld der Natur- bzw. Geisteswissenschaften<br />
und die »Einheit« der Wissenschaften im<br />
Gesamtzusammenhang humaner Orientierung.<br />
Im interdisziplinären Gespräch interpretieren Philosophen<br />
die Ansätze und Erträge der anderen Wissenschaften im Hin-
lick auf deren Konsequenzen für die Menschen. Auch innerhalb<br />
des Kernbereichs philosophischer Forschung wird freilich<br />
die initiale Frage nach dem »Sinn des Lebens« kaum noch<br />
explizit gestellt. Erst in den letzten Jahren hat sich das in den<br />
Debatten um <strong>Philosophie</strong> als »Lebenskunst« zwar etwas geändert<br />
12 , doch die Kärrnerarbeit an oft sehr speziellen Forschungsfragen<br />
und viel akademische Betriebsamkeit und<br />
Jargon lenken von der Grundfrage ab. Dabei weist die Frage<br />
nach dem Sinn des Fachs schon auf jene Grundfrage der<br />
<strong>Philosophie</strong> und die Richtung einer Antwort.<br />
Wozu <strong>Philosophie</strong>? Welchen Sinn macht es in der Ökonomie<br />
eines Lebens, darauf Zeit und Mühe zu verwenden? Es gibt<br />
doch andere Wissenschaften, deren Studium sichere Erträge<br />
und berufliche Perspektiven verheißt! <strong>Philosophie</strong> ist kein<br />
Brotstudium, das einen klar umrissenen Ausbildungsbedarf<br />
deckt und seinen Absolventen gute berufliche Perspektiven<br />
bietet. Aus der Sicht der Berufswelt, unter den Bedingungen<br />
von Massendauerarbeitslosigkeit, ist sie existenziell riskant.<br />
Dennoch ist es sinnvoll, <strong>Philosophie</strong> zu studieren, weil die<br />
Frage nach dem »Sinn des Lebens« individuell bedacht und<br />
beantwortet sein will. Sie ist mit der menschlichen Existenz<br />
gegeben, weil der Mensch, anders als andere Lebewesen,<br />
nicht instinktiv gelenkt ist, sondern sein Leben bewusst führen<br />
muss. Die menschliche Freiheit ist das Problem, das praktische<br />
Antworten verlangt. Weil Menschen nicht sicher wissen,<br />
wie sie leben sollen, müssen sie ihr Leben selbst<br />
gestalten. Dieses praktische Problem individueller Selbstbestimmung<br />
stellt für sie zugleich ein theoretisches dar. <strong>Philosophie</strong><br />
fragt deshalb nach dem Grund und Zweck menschlicher<br />
Freiheit; sie stellt diese Fragen aus der Position des<br />
Individuums, das seine Lebensführung politisch versteht und<br />
moralisch zu orientieren sucht.<br />
Vieles lässt sich zwar teleologisch betrachten. Jede Maschine<br />
hat einen Funktionszusammenhang, jeder Organismus seine<br />
Zwecke. Von einem »Lebenssinn« oder »Sinn des Lebens« aber<br />
sprechen wir nur, wo ein Spielraum individueller Wahrneh-
mung und Handlungsorientierung existiert. Solche Selbstbestimmung<br />
hat eine normative Struktur. Die Handlungszwecke<br />
diktiert ein »Wollen«, das dem Handelnden auch sinnhaft<br />
als »Sollen« erscheint. Der Sollenscharakter der Handlungsnormen<br />
begegnet objektiv als soziale Forderung, die Gemeinschaften<br />
oder Mitmenschen an einen richten, die vom Handelnden<br />
aber (positiv oder negativ) individuell bewertet wird.<br />
Die sokratische Frage nach dem »guten« und »richtigen« Leben<br />
und die neuere, nach Kant seit Friedrich Nietzsche<br />
(1844–1900) und Wilhelm Dilthey (1833–1911) gängige 13 und<br />
heute landläufige Frage nach dem »Sinn des Lebens« meinen<br />
deshalb eigentlich dieselbe Grundfrage der <strong>Philosophie</strong>: die<br />
Freiheit als Grund und Zweck des individuellen Lebens.<br />
Individuen stellen sich diese Frage in ihrer Geschichte. Jedes<br />
Individuum stellt sie mehr oder weniger explizit. Das Fach<br />
<strong>Philosophie</strong> hat insofern lebensweltliche Wurzeln. Es radikalisiert<br />
und professionalisiert lebensweltlich geläufige Fragen.<br />
<strong>Philosophie</strong> geht von der Erfahrung einer individuellen<br />
Lebensführungsproblematik aus, klebt aber nicht an der Lebenswelt<br />
und bestärkt nicht die alltägliche Selbstgerechtigkeit,<br />
sondern reflektiert auf die allgemeinen anthropologischen<br />
Möglichkeiten und die historisch-politischen<br />
Bedingungen gelingenden Lebens oder individueller Freiheit.<br />
Dieser Rückgang auf allgemeine Möglichkeiten und Bedingungen<br />
ist schon moralisch geboten: Der moralische Standpunkt<br />
fordert eine Distanzierung von individuellen Aspekten<br />
und eine Generalisierung der Antwort. Als philosophische<br />
Antworten überzeugen nur systematische Argumente: keine<br />
heiligen Texte, historische Autoritäten oder exklusive Erfahrungen<br />
eines Du und Wir. Akademisches <strong>Philosophie</strong>ren<br />
nimmt seinen Ausgang zwar meist bei mehr oder weniger<br />
kontingenten und speziellen Arbeitsschwerpunkten und Problemen.<br />
Jedes originäre Gesamtwerk aber lässt einen Bezug<br />
auf die Grundfrage und eine interne problemgeschichtliche<br />
Konsequenz erkennen und drängt zur systematischen Antwort.
Die Entwicklung solcher Fragen und Antworten kann man anhand<br />
der Klassiker gründlich studieren. Aristoteles beispielsweise<br />
hat die teleologische Ausrichtung alles organischen<br />
Lebens auf Zwecke durchgängig herausgestellt und handlungsanalytisch<br />
nach dem letzten Ziel (telos) alles menschlichen<br />
Lebens gefragt. Dieses Ziel bezeichnete er formal als<br />
das Glück (eudaimonia). Die Eigenart des Menschen im Gesamtzusammenhang<br />
des Lebens bestimmte er durch die Freiheit,<br />
zwischen verschiedenen Glücksentwürfen zu wählen<br />
und unterschiedliche Lebensformen zu kultivieren. Er unterschied<br />
dabei grob zwischen einer Orientierung des Lebens<br />
am Endzweck der »Lust« (hêdonê), der politischen Orientierung<br />
an der »Ehre« (timê), also dem Ansehen in der Bürgerschaft,<br />
und der intellektuellen Orientierung an der wissenschaftlichen<br />
Schau (theôria). Das philosophische Leben (bios<br />
theôrêtikos) betrachtete er als das höchste Glück der Menschen.<br />
Diese Typologie möglicher »Lebensformen« ließe sich<br />
weiter differenzieren und auch anders diskutieren, als Aristoteles<br />
dies tat. Im 20. Jahrhundert bestimmte eine Richtung<br />
philosophischer Anthropologie die Eigenart des Menschen im<br />
Mensch-Tier-Vergleich und Zusammenhang der neueren biologischen<br />
und ethologischen Forschung genauer. Arnold Gehlen<br />
(1904–1976) 14 betonte dabei in Anschluss an Nietzsche<br />
das Problem, dass sich der Mensch, das »nicht festgestellte<br />
Tier« (Nietzsche), mühsam orientieren muss, um sein Überleben<br />
zu sichern.<br />
Kommen wir nun zum »Anfang« und zum Aufbau des <strong>Philosophie</strong>rens:<br />
Aus der Grundfrage ergibt sich die Methodik der<br />
<strong>Philosophie</strong>. Wenngleich sich die Frage nach dem Sinn des<br />
Lebens alltäglich stellt und in der gängigen Weltauslegung<br />
beantwortet wird, diszipliniert <strong>Philosophie</strong> doch diese Antworten.<br />
Die »Logik«, die Lehre vom Denken, ist deshalb ihre<br />
Fundamentaldisziplin. Sie beschränkt sich allerdings nicht<br />
auf die formale Lehre vom korrekten Definieren, Folgern und<br />
Schließen, sondern ist eine umfassende Lehre vom richtigen<br />
und überzeugenden Argumentieren. Ihr Grundgerüst und
ihre Reichweite lassen sich ihrer ersten umfassenden Durchbildung<br />
ablesen: dem sog. Organon des Aristoteles. Aristoteles<br />
hat die Formen der Rationalität in Syllogistik, Dialektik<br />
(Topik) und Rhetorik so umfassend und genau beschrieben,<br />
dass dieser Teil seines Werks lange autoritativ galt und noch<br />
heute für eine lebensweltliche Theorie der Rationalität anregend<br />
ist; er analysierte auch das wissenschaftliche Argumentieren<br />
und betrachtete dessen Regeln als Teil einer umfassenden<br />
Lehre vom überzeugenden Argumentieren. Aristoteles<br />
gab dieser Argumentationslehre einen politischen Sinn, so<br />
dass man sogar von einer Theorie des »Bürgerdiskurses« sprechen<br />
kann. 15<br />
Eine Einführung in die <strong>Philosophie</strong>, die als systematischer<br />
Lehrgang angelegt ist, könnte mit der Logik als Analyse des<br />
Instrumentariums des <strong>Philosophie</strong>rens beginnen. So macht es<br />
Max Bense (1910–1990) 16 in seiner Einleitung in die <strong>Philosophie</strong>,<br />
die als »Einübung des Geistes« die ethische Absicht hat,<br />
»das Leben vor den Geist« zu bringen, bewusst zu führen und<br />
so für eine intellektuell disziplinierte, »geistige« Lebensführung<br />
zu werben. Und so ist es auch in der wohl umstrittensten<br />
Logik der <strong>Philosophie</strong>geschichte: in Hegels Wissenschaft der<br />
Logik. Hegel beantwortet die Frage nach dem Anfang des<br />
<strong>Philosophie</strong>rens ebenfalls mit einem Verweis auf das Denken<br />
als Mittel und Medium aller Erkenntnis. Seine – strittige – Erweiterung<br />
des Begriffs und der Aufgaben der Logik wurde<br />
dabei philosophiegeschichtlich durch Kants Kritik der reinen<br />
Vernunft (1781) ermöglicht.<br />
Kants sog. »Erste Kritik«, das Grundbuch aller neueren <strong>Philosophie</strong>,<br />
ist keine Logik; sie beschreibt nicht die Regeln des<br />
Denkens, sondern kritisiert die Annahme einer »reinen Vernunft«<br />
in ihren Grenzen erkenntnistheoretisch. Kant abstrahiert<br />
»zwei Stämme« (KrV B 30) der Erkenntnis, »Sinnlichkeit«<br />
und »Verstand«, und macht darauf aufmerksam, dass<br />
alles Denken von sinnlichen Eindrücken ausgeht. Er setzt der<br />
»Logik« eine »Ästhetik« voraus und betrachtet beide »transzendental«<br />
als ermöglichende Bedingungen aller »Erkennt-
nis«: »Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne<br />
Begriffe sind blind.«(KrV B 75) Erkenntnis ist ein Zusammenspiel<br />
von Wahrnehmen und Denken, das Kant in seinem Ablauf<br />
minutiös (aber anders als die heutige Psychologie und<br />
Kognitionswissenschaft) beschreibt. Diesen Erkenntnisprozess<br />
richtet er auf die Frage nach der Möglichkeit eines »reinen<br />
Denkens« aus und diskutiert die metaphysischen Ideen<br />
von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als Ideen, die notwendig<br />
gedacht werden müssen, um die Einheit der Erfahrung zu<br />
begründen. Kant unterscheidet strikt zwischen »Denken« und<br />
»Erkennen«. Erkenntnis ist an die Anschauung gebunden. Die<br />
metaphysischen Ideen dagegen können nur gedacht werden<br />
(müssen dies freilich auch), weil ihnen keine sinnliche Wahrnehmung<br />
entspricht. Er verwirft also die Idee einer »reinen<br />
Vernunft« nicht gänzlich, sondern verteidigt sie für die metaphysischen<br />
Ideen. Dieses reine Denken der Ideen verweist<br />
religionsphilosophisch auf einen vernünftigen »Glauben«. 17<br />
Deshalb schreibt Kant in seiner Vorrede: »Ich mußte also das<br />
Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu machen.«(KrV<br />
B 30) Kants »Vernunftglaube« brach dabei mit der christlichen<br />
Orthodoxie.<br />
Die Frage nach dem Anfang und der ersten Aufgabe der <strong>Philosophie</strong><br />
beantworteten viele also mit der Logik: Den ersten und<br />
eigensten Gegenstand philosophischer Forschung bilden die<br />
Regeln des Denkens. Die Logik stellt die Teildisziplin der<br />
<strong>Philosophie</strong> dar, ohne die nichts anderes geht; sie ist deshalb<br />
im Studium auch das erste und wichtigste Thema. Schon Mephistopheles<br />
spottete zwar: »Zuerst Collegium Logicum. Da<br />
wird der Geist Euch wohl dressiert,/In spanische Stiefel eingeschnürt,/Daß<br />
er bedächtiger so fortan/Hinschleiche die<br />
Gedankenbahn,/Und nicht etwa, die Kreuz und Quer,/Irrlichteliere<br />
hin und her.« 18 Man lasse sich aber vom Teufel<br />
nicht schrecken: Auf das Tempo kommt es nicht an. Wo nicht<br />
logisch argumentiert wird, gibt es kein vernünftiges Gespräch.<br />
Wenn jemand sich in Widersprüche verwickelt und<br />
den Grundsatz vom Ausschluss des Widerspruchs als Ein-
wand nicht anerkennt, erübrigt sich jede weitere Diskussion.<br />
Eine beliebte Strategie ist es in philosophischen Disputen<br />
denn auch, Widersprüche nachzuweisen. Das geschieht mitunter<br />
nicht nur im Interesse der Klärung der Argumente, sondern<br />
auch als Totschlagargument zur akademischen Disqualifizierung<br />
des Diskutanten. Die Anerkennung der Logik als<br />
Methode und Gegenstand des <strong>Philosophie</strong>rens kann aber unter<br />
Philosophen nicht ernstlich strittig sein. Wer sie bezweifelt,<br />
disqualifiziert sich selbst. Allerdings ist es legitim, die<br />
Logik auf der Grundlage unstrittiger Regeln zu erweitern.<br />
Eben dies zeigen schon die Beispiele Aristoteles, Kant, Hegel<br />
und Bense. Sie zeigen auch, wie die philosophische Betrachtung<br />
der Logik weitere Teilgebiete wie Erkenntnistheorie, Ontologie<br />
und Metaphysik erschließt. Es ist also doch nicht ganz<br />
beliebig, womit man das Studium der <strong>Philosophie</strong> beginnt; es<br />
beginnt eigentlich erst mit der Arbeit an der eigenen Begrifflichkeit<br />
und Argumentation. Stets geht es um die Perfektionierung<br />
des Denkens und Erkennens im Interesse der Orientierung<br />
des eigenen Standpunkts.<br />
Die moderne <strong>Philosophie</strong> kennzeichnet dabei eine besondere<br />
Hinwendung zur Sprache (»linguistic turn«). Diese sprachphilosophische<br />
Wendung – mit dem Namen Ludwig Wittgensteins<br />
(1889–1951) eng verbunden – richtet sich gleichermaßen<br />
auf die »natürlichen« und die »formalen« Sprachen. Die<br />
moderne <strong>Philosophie</strong> verfeinert ihre Instrumentarien in Aufnahme<br />
linguistischer wie mathematisch-kybernetischer<br />
Mittel. Man kann die <strong>Philosophie</strong>geschichte deshalb in erster<br />
Annäherung auch durch Paradigmenwechsel gliedern und<br />
von einer antiken, neuzeitlichen und modernen Epoche<br />
sprechen. Schnädelbach unterscheidet ein »ontologisches«,<br />
ein »mentalistisches« und ein »linguistisches« Paradigma; das<br />
»Sein«, »der Geist« und die »Sprache« waren demnach jeweils<br />
vorherrschende Themen des <strong>Philosophie</strong>rens. 19 Die Pointe<br />
dieser Unterscheidung liegt darin, dass die alten Fragen nicht<br />
durch die neueren abgelöst und erledigt sind, sondern den alten<br />
Fragen lediglich neue zuwachsen und die Standards der
Diskussion aller überlieferten Fragen steigen. Durch die<br />
sprachwissenschaftliche Erweiterung des <strong>Philosophie</strong>rens<br />
stellen sich heute die alten Fragen im Paradigma der Sprache<br />
und Horizont ihrer sprachlichen Verfasstheit sinnkritisch. 20<br />
Damit kann unsere erste Definition der <strong>Philosophie</strong> (als »akademisch<br />
umfassende Selbstverantwortung einer Lebensführung«)<br />
durch eine andere ergänzt werden. Schnädelbach<br />
definiert das <strong>Philosophie</strong>ren als »die Tätigkeit der denkenden<br />
Orientierung im Bereich der Grundlagen unseres Denkens,<br />
Erkennens und Handelns« 21 . Diese Definition berücksichtigt<br />
die akademische Arbeitsteilung und Eigenständigkeit aller<br />
Wissenschaften durch die Beschränkung auf den Bereich der<br />
Grundlagen. Die Sinnfrage kommt in der seit Kant verbreiteten<br />
Rede von »Orientierung« zur Sprache. 22 Sie meint weder<br />
eine autoritative Vorgabe noch ständige Sinnhuberei. Es<br />
widerspricht der Orientierungsaufgabe deshalb auch nicht,<br />
<strong>Philosophie</strong> als kritische »Verunsicherungswissenschaft« und<br />
»Abbruchunternehmen« zu propagieren. 23 <strong>Philosophie</strong>ren<br />
lässt sich als ein ständiger Versuch ansehen, das wissenschaftliche<br />
Instrumentarium und Rüstzeug des Denkens auf<br />
die leitende Grundfrage zurechtzuschneiden und das Niveau<br />
an Wissenschaftlichkeit zu finden, das den Problemen angemessen<br />
ist. Diese Klärung der Wissenschaftsstandards, die<br />
möglich sind, bei Akzeptanz »schwacher« Gründe, wo keine<br />
»stärkeren« zu haben sind, erfolgt unter der Voraussetzung,<br />
dass die philosophischen Fragen immer schon irgendwie<br />
beantwortet sind: wenn nicht durch <strong>Philosophie</strong>, so durch Religion<br />
oder die Idole unserer Erlebnisgesellschaft. Platon bereits<br />
konzipierte die <strong>Philosophie</strong> dagegen als eine dialogischdialektische<br />
Prüfung der herrschenden Meinungen über das<br />
Seiende im Ganzen. Die Frage nach dem »Sinn des Lebens«<br />
geht alle Menschen an. Nicht alle aber stellen sie explizit;<br />
viele lassen sie sich durch geläufige Weltdeutungen beantworten.<br />
Deshalb wurde auch nicht immer und überall philosophiert.<br />
Nicht jede Weltanschauung ist <strong>Philosophie</strong>. <strong>Philosophie</strong><br />
entwickelte sich als methodische Disziplin unter
historisch-politisch angebbaren, prekären Bedingungen und<br />
ist heute als institutionell etablierte akademische Disziplin erneut<br />
in ihrem Bestand gefährdet.<br />
Aufgaben und Methoden der <strong>Philosophie</strong> stehen also in<br />
einem Bedingungsverhältnis. Die <strong>Philosophie</strong> hat immer<br />
wieder strenge Wissenschaftlichkeit angestrebt, indem sie<br />
ihre Aufgaben begrenzte. Kants Kritizismus suchte bereits<br />
das falsche »dogmatische« Wissen aufzuheben, »um zum<br />
Glauben Platz zu machen«. In neuerer Zeit meinte Wittgenstein:<br />
»Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man<br />
schweigen.« 24 Die Gefahr ist dabei groß, dass die Limitierung<br />
der Wissenschaftsstandards undisziplinierter Schwärmerei<br />
und Gerede das Terrain überlässt. Die Selbstbegrenzung der<br />
<strong>Philosophie</strong> mag dazu führen, dass das Fach vor seinen ursprünglich<br />
leitenden Fragen kapituliert. Wenn <strong>Philosophie</strong><br />
aber einen lebensweltlichen Ursprung und Sinn – in der Klärung<br />
der Frage nach dem Sinn des Lebens – hat, verfehlt ein<br />
allzu enges Fachverständnis die Aufgaben. Denn die Fragen<br />
sind immer gestellt und beantwortet. Es widerspricht der<br />
»Mündigkeit« des Menschen, sich ein zu striktes Schweigen<br />
über drängende Fragen aufzuerlegen. 25 Damit sinkt nur das<br />
Niveau ihrer Beantwortung. Beliebigkeit und Obskurantismen<br />
breiten sich aus.<br />
Spezielle Forschungsbeiträge in einer Teildisziplin sind kaum<br />
möglich, wenn das philosophische Profil nicht insgesamt klar<br />
umrissen ist. Eine Orientierung über den ganzen Aufgabenbereich<br />
und Zusammenhang des Fachs ist unerlässlich. Immer<br />
philosophiert man gewissermaßen aus der Mitte des<br />
Fachs von einem leitenden <strong>Philosophie</strong>begriff her. Klassische<br />
Muster sind die platonischen Kunstgespräche, die als Einführungen<br />
in die <strong>Philosophie</strong> konzipiert wurden und über die<br />
aporetische Zuspitzung oder auch Klärung bestimmter Fragen<br />
hinausgehend auf die Einübung der dialogischen Methode<br />
zielten. Platon gestand seinen Texten insgesamt nur<br />
einen propädeutischen Status zu, weil er das lebendige Gespräch<br />
bevorzugte und die monologische Schriftlichkeit als
ein defizientes Medium des <strong>Philosophie</strong>rens ansah. Nach<br />
Aristoteles erst festigte sich das System der <strong>Philosophie</strong> mit<br />
der editorischen Ordnung des überlieferten Textkorpus. Immer<br />
wieder entwickelten Philosophen im Lehrbetrieb der<br />
Schulen dann neue Einteilungen. Dies verstärkte sich in der<br />
Neuzeit mit gewachsenem Methodenbewusstsein und der<br />
institutionellen Etablierung des Fachs.<br />
Die systematischen Einteilungen lassen sich heute an den<br />
gängigen Lehrstuhlbezeichnungen ablesen. Die erste und<br />
wichtigste Unterteilung ist die Gliederung in theoretische und<br />
praktische <strong>Philosophie</strong>. Dazu kommen meist bescheidener<br />
ausgestattete Professuren für Geschichte der <strong>Philosophie</strong>. Sie<br />
sind häufig nach lokalen Traditionen der Institute oder Forschungsschwerpunkten<br />
ihrer Vertreter für bestimmte Epochen<br />
(etwa für die antike <strong>Philosophie</strong> oder den deutschen<br />
Idealismus) spezifiziert. Die theoretische <strong>Philosophie</strong> untergliedert<br />
sich in Disziplinen wie Logik, Erkenntnistheorie oder<br />
Wissenschaftstheorie. Heute dringen weitere Zweige wie<br />
Medientheorie oder Kognitionswissenschaften vor, die auch<br />
als Teile der Erkenntnistheorie gefasst werden können. Die<br />
praktische <strong>Philosophie</strong> umfasst Disziplinen wie Ethik,<br />
Rechts- und Sozialphilosophie, politische <strong>Philosophie</strong>, Kulturphilosophie<br />
oder auch philosophische Anthropologie.<br />
Viele Kombinationen und Untergliederungen sind möglich.<br />
Wichtig ist aber, dass es in dieser Vielfalt ein verbindendes<br />
Fachverständnis gibt.<br />
Gleiches gilt für die Fakultäten und Universitäten. Die zentrale<br />
Stellung der <strong>Philosophie</strong> innerhalb der neueren deutschen<br />
Universität basierte auf Überzeugungen von der philosophischen<br />
»Idee« und »Einheit« aller Wissenschaften.<br />
Wilhelm von Humboldt (1767–1835) setzte die universitäre<br />
Wahrheitsorientierung als »Einheit von Forschung und<br />
Lehre« ins Werk, indem er die Lehre unter den Primat der<br />
Forschung stellte. Diese Forschungsuniversität hatte ihre<br />
Spitze in der <strong>Philosophie</strong>; sie zog die humanen Konsequenzen<br />
aus den wissenschaftlich-technischen Entwicklungen für
das Weltbild und Selbstverständnis der Gesellschaft. Zivilisation<br />
steigert Standards möglichen Handelns. <strong>Philosophie</strong><br />
fordert ein Höchstmaß an kultureller Differenzierung. Um<br />
Aristoteles zu zitieren: »Was dem einzelnen wesenseigen ist,<br />
das stellt für den einzelnen von Natur das Höchste und das<br />
Lustvollste dar. Für den Menschen ist das also das Leben des<br />
Geistes, nach dem dieser vor allem das wahre Selbst des Menschen<br />
darstellt, und dieses Leben ist denn also auch das<br />
glücklichste.« 26<br />
Moral: Individuelle Verantwortung eigenen Handelns<br />
Moral und Politik gehören für das Alltagsverständnis eng<br />
zusammen. Nicht jedes moralische Handeln nennen wir politisch<br />
und nicht jedes politische moralisch. Dabei nennen wir<br />
nur dasjenige soziale Handeln »politisch«, das die staatliche<br />
Willensbildung beeinflussen möchte oder effektiv beeinflusst<br />
und bestimmt. Der Begriff der Politik lässt sich aber philosophisch<br />
nicht unabhängig vom »moralischen Standpunkt«<br />
bestimmen. Vielmehr kennzeichnet es gerade die philosophische<br />
Teilnehmerperspektive gegenüber der rechts- und sozialwissenschaftlichen<br />
Beobachterperspektive, dass sie eine<br />
moralische Kritik der Politik ermöglicht. Deshalb bedarf politische<br />
<strong>Philosophie</strong> auch einer ethischen Grundlegung. Sie beginnt<br />
mit einer Klärung des Begriffs der Moral.<br />
Rechtsfähig sind auch juristische Personen, handlungsfähig<br />
hingegen nur entwickelte menschliche Individuen. So beurteilen<br />
wir Säuglinge nicht moralisch. Weil moralische Urteile<br />
sich ausschließlich auf verantwortliches Handeln richten,<br />
muss zunächst geklärt sein, ob überhaupt ein solches vorlag.<br />
Dann erst lässt sich fragen, ob es gut oder böse war. Nicht jedes<br />
Verhalten heißt ein Handeln, sondern nur dasjenige, das<br />
intentional gewollt und vollzogen ist. Wo wir keine Freiheit<br />
voraussetzen, urteilen wir nicht moralisch. Auch Unterlassen
Ein Leben zwischen Politik und <strong>Philosophie</strong><br />
Hannah Arendt (1906–1975) war studierte Philosophin, doch<br />
lehnte sie es ab, als Philosophin bezeichnet zu werden. Ihrem<br />
Selbstverständnis nach beschäftigte sie sich mit politischer<br />
Theorie, die sich naturgemäß nicht mit der <strong>Philosophie</strong> vertrage.<br />
Seit dem Prozess gegen Sokrates, erklärte sie, habe sich<br />
das Denken vom Handeln und das Handeln vom Denken<br />
verabschiedet. Während das Denken auf der Suche nach der<br />
einen Wahrheit gewesen sei, habe das Handeln nur auf der<br />
Grundlage der Akzeptanz vielfältiger Meinungen funktionieren<br />
können; während das Denken stets ein Dialog des Einzelnen<br />
mit sich selbst sei, sei das Handeln auf den Dialog der<br />
vielen angewiesen.<br />
Gleichwohl arbeitete Arendt auch in ihren politisch-theoretischen<br />
Schriften stets mit philosophischen Begriffen und<br />
Konzepten. In ihrem Prozessbericht über Eichmann in Jerusalem<br />
bezog sie sich auf Kants Begriff der Urteilskraft, an der<br />
es dem Angeklagten Arendt zufolge mangelte, in ihrem Buch<br />
über den Totalitarismus beklagte sie den von totalitären Regimen<br />
unternommenen Versuch, die Pluralität als Grundbedingung<br />
menschlicher Existenz abzuschaffen, und ihre biografischen<br />
Schriften sind samt und sonders Plädoyers dafür, die<br />
Idee von der einen und einzigen Wahrheit zugunsten der<br />
Meinungsvielfalt und des Dialogs zu opfern.<br />
Es ist ihre Präferenz für das perspektivische Denken und eine<br />
von Pluralität bestimmte Welt, die Arendt gegen die einsame<br />
Welt des Philosophen setzte, und es ist die Einsicht, dass<br />
Geschichte nicht von Philosophenkönigen, sondern von den<br />
Zufällen und von der Willkür der handelnden Menschen gelenkt<br />
wird, die sie zu einer politischen Denkerin par excellence<br />
machten. Arendts frühe Abkehr von der <strong>Philosophie</strong><br />
und die gleichzeitige Hinwendung zur politischen Theorie
und zur Geschichtsschreibung ist indes kaum nachvollziehbar<br />
ohne Kenntnis ihrer Lebensgeschichte, die Ernest Gellner<br />
(1925–1995) einmal als Parabel der Moderne beschrieben hat:<br />
»If Hannah Arendt had not existed it would most certainly be<br />
necessary to invent her. Her life is a parable, not just of our<br />
age, but of several centuries of European thought and experience.«<br />
1 (Auf Deutsch: Wenn Hannah Arendt nicht existiert<br />
hätte, hätte man sie erfinden müssen. Ihr Leben ist nicht nur<br />
eine Parabel unseres Zeitalters, sondern mehrerer Jahrhunderte<br />
europäischen Denkens und Handelns.)<br />
1906 in Hannover geboren, verbrachte Arendt ihre Kindheit<br />
und Jugend in Königsberg, wo sie ein altsprachliches Gymnasium<br />
besuchte. Schon früh las sie die Werke der großen<br />
Philosophen, die im elterlichen Bücherschrank standen.<br />
Nach eigener Auskunft hatte sie im Alter von vierzehn Jahren<br />
bereits Kant gelesen, später Kierkegaard und Karl Jaspers’<br />
Psychologie der Weltanschauungen. Nachdem sie als Achtzehnjährige<br />
wegen Anstiftung zum Unterrichtsboykott der<br />
Schule verwiesen worden war und das Abitur als externe<br />
Schülerin hatte ablegen müssen, nahm sie das Studium der<br />
<strong>Philosophie</strong>, des Griechischen und – obwohl sie selbst aus<br />
einer jüdischen Familie stammte – der protestantischen Theologie<br />
an der Universität Marburg auf. Das Interesse für die<br />
Theologie ergab sich aus einer frühen Kierkegaard-Lektüre,<br />
während ihr Interesse an <strong>Philosophie</strong> quasi einem existenziellen<br />
Grundbedürfnis entsprang: »Da können Sie fragen:<br />
Warum haben Sie Kant gelesen? Irgendwie war es für mich<br />
die Frage: entweder kann ich <strong>Philosophie</strong> studieren oder ich<br />
gehe ins Wasser sozusagen.« 2<br />
Bereits im ersten Semester besuchte Arendt die Seminare<br />
von Martin Heidegger (1889–1976), den sie als »heimlichen<br />
König« im Reich des Denkens bezeichnete. 3 Schon bald<br />
bahnte sich eine Affäre zwischen Heidegger und seiner Studentin<br />
an – eine Affäre, die streng geheim gehalten werden<br />
musste, da Heidegger verheiratet war und zwei Söhne hatte.<br />
1926 ging Arendt, um den amourösen Verwicklungen zu ent-
kommen, nach Heidelberg zu Karl Jaspers (1883–1969), bei<br />
dem sie 1929 mit einer Dissertation über den Liebesbegriff bei<br />
Augustinus promovierte. Zwar hatte sie sich infolge ihrer<br />
Affäre mit Heidegger gezwungen gesehen, Marbach zu verlassen,<br />
doch trug ihr diese Affäre auch das Privileg ein, die<br />
Entstehung von Heideggers Hauptwerk, Sein und Zeit, aus<br />
allernächster Nähe verfolgen zu können. Obwohl Arendt sich<br />
in den folgenden Jahren aufgrund der politischen Entwicklungen<br />
in Deutschland ostentativ von der <strong>Philosophie</strong> und<br />
von Martin Heidegger als Person distanzierte, hinterließ die<br />
Lektüre von Sein und Zeit nachhaltige Spuren, die sich in all<br />
ihren Werken finden lassen.<br />
Ebenfalls 1929 heiratete Arendt den Philosophen Günther<br />
Stern (1902–1992) – der sich später Günther Anders nannte –<br />
und nahm die Arbeit an einer Habilitationsschrift über die<br />
deutsche Romantik auf. Als sie auf Hinweis ihrer Freundin<br />
Anne Mendelssohn, einer Nachfahrin des jüdischen Aufklärers<br />
Moses Mendelssohn, den Nachlass der Dichterin Rahel<br />
Varnhagen (1771–1833) in der Berliner Staatsbibliothek entdeckte,<br />
änderte sie ihre Pläne und begann, eine Biografie<br />
der Dichterin zu schreiben. Am Abschluss des Verfahrens<br />
hinderte sie jedoch die nationalsozialistische Machtübernahme,<br />
die Arendt nach kurzer Inhaftierung dazu bewegte,<br />
gemeinsam mit ihrer Mutter nach Paris zu flüchten. Günther<br />
Stern folgte ihnen nach Paris, allerdings hatte sich das Ehepaar<br />
schon in Berlin auseinander gelebt und ließ sich bald<br />
wieder scheiden.<br />
Über gemeinsame Bekannte lernte Arendt in Paris ihren zweiten<br />
Ehemann Heinrich Blücher (1899–1970) kennen, der als<br />
Kommunist ebenfalls nach Frankreich geflüchtet war. Beide<br />
wurden nach dem Einmarsch der deutschen Truppen interniert,<br />
konnten aber dem Lager entkommen und trafen sich bei<br />
Freunden in Südfrankreich wieder, von wo aus sie mit amerikanischen<br />
Notvisa nach New York ausreisten. Bald fand<br />
Arendt eine Stelle als Lektorin im New Yorker Schocken-Verlag<br />
und übernahm dort die Verantwortung für die Edition der
Werke Franz Kafkas. Später arbeitete sie für die Jewish Cultural<br />
Reconstruction, in deren Auftrag sie 1949 erstmals wieder<br />
nach Europa reiste, um Listen erhalten gebliebener jüdischer<br />
Kulturgüter zu erstellen.<br />
In diesen Jahren schrieb Arendt mehrere Aufsätze für akademische<br />
Zeitschriften und Kolumnen für die deutschsprachige<br />
Emigrantenzeitschrift Der Aufbau, bevor sie 1951 ihr erstes<br />
großes Werk unter dem Titel The Origins of Totalitarianism<br />
in englischer Sprache veröffentlichte (dt.: Elemente und Ursprünge<br />
totaler Herrschaft, 1955). Im selben Jahr nahm sie die<br />
amerikanische Staatsbürgerschaft an. Es folgten mehrere<br />
Lehraufträge, unter anderem in Princeton und Berkeley, bevor<br />
Arendt eine Professur an der University of Chicago und<br />
später an der New Yorker New School for Social Research<br />
annahm. Sie starb am 4. Dezember 1975 in ihrer New Yorker<br />
Wohnung, kurz nachdem sie die Arbeit an einer Vorlesungsreihe<br />
über das Urteilen aufgenommen hatte.<br />
Während Arendts Werke in der politischen Theorie und der<br />
Geschichtswissenschaft unmittelbar nach Erscheinen kontrovers<br />
diskutiert wurden, ließ die Rezeption durch die akademische<br />
<strong>Philosophie</strong> noch einige Zeit auf sich warten. Erst<br />
nach der Veröffentlichung von Elisabeth Young-Bruehls umfangreicher<br />
Biografie im Jahr 1980 4 setzte eine Arendt-Renaissance<br />
ein, zunächst in den Vereinigten Staaten, dann in<br />
Deutschland und schließlich in Frankreich. Ihren Höhepunkt<br />
in Deutschland erreichte sie kurz nach dem Fall der Berliner<br />
Mauer – wobei die abenteuerliche Lebensgeschichte vermutlich<br />
dazu beitrug, das Interesse eines breiten Publikums für<br />
Arendts Leben und Werk zu wecken. Obwohl sich Jürgen<br />
Habermas (geb.1929) mit seiner Theorie des kommunikativen<br />
Handelns bereits in den siebziger Jahren auf Hannah<br />
Arendt bezogen hatte, fand sie erst jetzt auch bei der deutschen<br />
Linken Beachtung, der sie wegen des in der Schrift<br />
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft angestellten Vergleichs<br />
der nationalsozialistischen mit der stalinistischen<br />
Ideologie als Antikommunistin gegolten hatte.
Nun aber wurde das Buch sehr breit rezipiert. Arendts Ansatz<br />
wurde als Alternative zu den von der Linken traditionell favorisierten<br />
Faschismustheorien wiederentdeckt und Arendt als<br />
Person rehabilitiert. Seither ist in Deutschland eine verstärkte<br />
Auseinandersetzung mit ihrem Werk zu verzeichnen, verbunden<br />
mit einer großen Bereitschaft, die Autorin als moralische<br />
Autorität anzuerkennen. Nicht nur wies sie den Weg<br />
für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit,<br />
sie zeigte gleichzeitig auch Alternativen zum ideologischen<br />
Marxismus auf. Dass man es bei ihr nicht mit einer<br />
Amerikanerin im Dienste eines Reeducation-Programms zu<br />
tun hatte, sondern mit einer Exildeutschen, die Goethe, Schiller<br />
und Kant gelesen hatte, trug ein Übriges zu der posthumen<br />
Erfolgsgeschichte bei.<br />
Seither sind so gut wie alle Aspekte ihres Werks gründlich<br />
untersucht worden, wobei neben den philosophischen Kernfragen<br />
vor allem ihre persönliche Beziehung zu Martin Heidegger<br />
im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. In der vorliegenden<br />
Einführung wird diese Beziehung – von der zu<br />
Arendts Lebzeiten niemand außer ihren engsten Vertrauten<br />
und Heideggers Ehefrau Elfride etwas wusste – jedoch<br />
nur dort eine Rolle spielen, wo sich heideggersches Gedankengut<br />
in Arendts Werken wiederfindet beziehungsweise<br />
weiterentwickelt wird. Dies gilt vor allem im Hinblick<br />
auf die phänomenologische Methode, die möglicherweise<br />
das stärkste gemeinsame Charakteristikum aller Werke darstellt.<br />
Im negativen Sinn hat Heidegger das arendtsche Werk<br />
aber auch im Hinblick auf die Frage nach dem Antagonismus<br />
von Politik und <strong>Philosophie</strong> geprägt: Wiederholt nannte<br />
Arendt ihn als Beispiel für einen Philosophen, der in der<br />
Abgeschiedenheit des Denkens den Sinn für Pluralität und<br />
Diskursivität als Grundbedingungen des menschlichen<br />
Miteinanders verloren hatte.<br />
Leitfaden der vorliegenden Einführung ist die Frage nach dem<br />
Verhältnis von Politik und <strong>Philosophie</strong>, die Arendt bereits<br />
früh beschäftigte und die sich als Subtext durch alle nach der
Rahel-Biografie verfassten Schriften hindurchzieht. Dabei<br />
erscheint die frühe Abkehr von der <strong>Philosophie</strong> und die verstärkte<br />
Auseinandersetzung mit politischen Fragen vordergründig<br />
als Reaktion auf die nationalsozialistische Machtübernahme.<br />
Wie Arendt später in einem Interview erklärte,<br />
stand dieser Paradigmenwechsel in unmittelbarem Zusammenhang<br />
mit dem Verhalten vieler deutscher Akademiker,<br />
mit denen sie sich bis dahin eng verbunden gefühlt<br />
hatte: »Man denkt heute oft, daß der Schock der deutschen<br />
Juden 1933 sich damit erklärt, daß Hitler die Macht ergriff.<br />
Nun, was mich und Menschen meiner Generation betrifft,<br />
kann ich sagen, daß das ein kurioses Mißverständnis ist. [...]<br />
Das Problem, das persönliche Problem war doch nicht etwa,<br />
was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten.<br />
[...] Ich lebte in einem intellektuellen Milieu, ich kannte aber<br />
auch andere Menschen, und ich konnte feststellen, daß unter<br />
den Intellektuellen die Gleichschaltung sozusagen die<br />
Regel war. Aber unter den anderen nicht. Und das hab’ ich<br />
nie vergessen. Ich ging aus Deutschland, beherrscht von<br />
der Vorstellung – natürlich immer etwas übertreibend –: Nie<br />
wieder! Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte<br />
an.« 5<br />
In einer 1954 gehaltenen Vorlesung über Philosophy and Politics<br />
reichte sie eine fundierte Begründung für ihre »Wende«<br />
nach. Hier verwies sie auf die historische Trennung der<br />
<strong>Philosophie</strong> von der Politik infolge des Todesurteils gegen<br />
Sokrates. 6 Gegenstand der <strong>Philosophie</strong> sei seither die<br />
Wahrheitsfindung, während Politik als bloßer Austausch von<br />
Meinungen gelte, die mit großer Geschwindigkeit auftauchen,<br />
um dann ebenso schnell wieder zu verschwinden.<br />
Fortan hätten die Philosophen gemeint, es könne nur eine einzige<br />
Wahrheit geben, die in den vielfältigen, perspektivisch<br />
bedingten und stets variablen Meinungen der Politiker qua<br />
Definition nicht enthalten sein könne. Der Philosoph meide<br />
seither den öffentlichen Austausch und ziehe sich auf den<br />
Dialog mit sich selbst zurück. Der Politiker hingegen sei nicht
handlungsfähig ohne Öffentlichkeit, ohne die Anwesenheit<br />
von anderen, mit denen er seine Argumente austauschen, die<br />
er überzeugen oder von denen er sich überzeugen lassen<br />
kann.<br />
Der Pluralität als Grundbedingung menschlichen Lebens<br />
nicht Rechnung getragen, sie gar als Defizit – nämlich als<br />
Nährboden für die Entstehung »bloßer« Meinungen – behandelt<br />
zu haben ist Arendt zufolge das größte Defizit der abendländischen<br />
<strong>Philosophie</strong>. Die einzige Ausnahme sei Immanuel<br />
Kant (1724–1804), der in der Kritik der Urteilskraft wiederholt<br />
darauf verweist, dass das Urteilen nur auf der Grundlage einer<br />
»erweiterten Denkungsart« funktionieren könne. Als solche<br />
bezeichnet er das Bemühen, die Welt nicht nur mit den eigenen<br />
Augen zu sehen, sondern sie sich auch aus der Perspektive<br />
anderer vorzustellen.<br />
Die Beschreibung des Antagonismus von Politik und <strong>Philosophie</strong>,<br />
von Meinung und Wahrheit verbindet Arendt mit der<br />
Beschreibung eines zweiten Problems, das die Geschichte der<br />
<strong>Philosophie</strong> seit Platon maßgeblich bestimmt hat. Es ist die<br />
Frage nach der Differenz von Sein und Erscheinung, die Platon<br />
bekanntlich mit einer Zwei-Welten-Theorie beantwortet<br />
hat: Alles, was existiert, ist Abbild einer unter der bloßen<br />
Erscheinung liegenden Idee, die nur als geistige zu verstehen<br />
und die allein wahrhaftig ist; alles sinnlich Wahrnehmbare ist,<br />
im Unterschied zur Idee, abhängig von der Wahrnehmung;<br />
die Wahrnehmung aber ist perspektivisch und kann keinen<br />
Anspruch auf Wahrheit geltend machen.<br />
Dieses Auseinanderfallen von Sein und Erscheinen steht für<br />
Arendt in zeitlichem wie auch kausalem Zusammenhang mit<br />
dem Auseinanderfallen von Wahrheit und Meinung, von<br />
<strong>Philosophie</strong> und Politik: Die Wahrheit des Philosophen ist<br />
wirklich und ewig, während die Meinung des Politikers nur<br />
erscheint und bald wieder verschwindet. Vor diesem Hintergrund<br />
erscheint Arendts Gesamtwerk als ein Versuch, die von<br />
Platon erdachte Zweiteilung der Welt zu überwinden, Pluralität<br />
und Perspektivität als genuin menschliche Bedingungen
und Begabungen zu rehabilitieren und Sein und Erscheinung<br />
wieder in eins zu setzen.<br />
So erklärte sie in ihrem Spätwerk Vom Leben des Geistes ohne<br />
Umschweife, sie versuche, »die Metaphysik und die <strong>Philosophie</strong><br />
mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit ihren Anfängen<br />
in Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, zu<br />
demontieren« (LG 1 207); doch hatte sie längst gezeigt, dass<br />
auch das »trostlose Ungefähr«, das als akzidentiell und partikular,<br />
als willkürlich und perspektivisch erscheinende Treiben<br />
der Menschen im öffentlichen Raum Gegenstand des<br />
<strong>Philosophie</strong>rens sein kann und soll. Mehr noch: Zum eigentlichen<br />
Gegenstand der <strong>Philosophie</strong> erhob sie Begriffe und<br />
Konzepte wie Natalität und Pluralität, Perspektivität als Bedingung<br />
für eine »erweiterte Denkungsart«, Spontaneität als<br />
die Fähigkeit, »eine Reihe von vorn anzufangen« (Kant), Performativität<br />
als Modus, in dem alles Handeln stattfindet, das<br />
Angewiesensein der Menschen auf die Erde als Lebensraum<br />
und die Körperlichkeit der menschlichen Existenz.<br />
Wenn auch Arendt die Möglichkeit einer politischen <strong>Philosophie</strong><br />
bestritt, so gehört sie doch selbst zu denen, die – im<br />
Anschluss an die husserlsche und heideggersche Phänomenologie<br />
und Existenzphilosophie – mit ihren Schriften die<br />
Grundlagen für eine mögliche <strong>Philosophie</strong> des Politischen gelegt<br />
haben.<br />
Die Anordnung der folgenden Kapitel entspricht der Chronologie<br />
des Gesamtwerks. Nicht berücksichtigt wird die Korrespondenz,<br />
die Arendt teilweise über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich<br />
pflegte, wobei vor allem der Briefwechsel mit Karl<br />
Jaspers als Lektüre zu empfehlen ist. 7 Auch die »Denktagebücher«,<br />
eine Reihe von neunundzwanzig Notizbüchern mit<br />
handschriftlichen Einträgen aus den Jahren 1950 bis 1973,<br />
werden im Rahmen dieser Einführung nicht behandelt. Bei<br />
diesen Notizen handelt es sich überwiegend um fragmentarische<br />
Aufzeichnungen und Zitate, die zwar die Entstehungsgeschichten<br />
der Monografien erhellen, selten aber ganz neue<br />
Gedanken enthalten. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt
auf den für die Frage nach dem Verhältnis von Politik und<br />
<strong>Philosophie</strong> maßgeblichen Texten, wobei neben den Monografien<br />
in Ausnahmefällen auch kleinere Essays beziehungsweise<br />
Aufsatzsammlungen berücksichtigt werden (Reflections<br />
on Little Rock, Menschen in finsteren Zeiten).
Moral und Ethik<br />
»Euathlos wurde von Protagoras zum Anwalt ausgebildet. Man traf<br />
eine großzügige Vereinbarung, nach der Euathlos erst dann und nur<br />
dann für sein Studium bezahlen muss, wenn er seinen ersten Fall gewinnt.<br />
Zum Ärger von Protagoras, der viel Zeit für die Ausbildung seines<br />
Schülers aufgewendet hatte, entscheidet sich dieser jedoch, Musiker<br />
zu werden und die Robe an den Nagel zu hängen. Protagoras<br />
verlangt daraufhin, dass Euathlos ihn für seine Ausbildung bezahlt.<br />
Euathlos aber weigert sich, und so geht Protagoras vor Gericht. So wie<br />
Protagoras die Dinge sieht, muss Euathlos, wenn er den Prozess verliert,<br />
seine Schulden an ihn zurückzahlen. Aber auch wenn Euathlos<br />
gewinnt, muss er bezahlen, da er ja dann seinen ersten Prozess gewonnen<br />
hat. Euathlos sieht die Sache etwas anders. Wenn ich verliere,<br />
so denkt er, habe ich meinen ersten Prozess verloren und muss, wie<br />
der Vertrag es vorsieht, keinen Cent bezahlen. Wenn ich jedoch gewinne,<br />
darf Protagoras nicht mehr auf dem Vertrag beharren, so dass<br />
ich ebenfalls nicht zahlen muss.« 1<br />
Armer Richter! Wenn beide Argumentationsweisen in sich<br />
logisch schlüssig sind, dann kann es in diesem Prozess kein<br />
gerechtes Urteil geben. Die antiken griechischen Philosophen,<br />
von denen diese logische Paradoxie überliefert ist, liebten<br />
solche gedanklichen Verwirrspiele, bei denen es keinen<br />
Ausweg zu geben scheint. Aber angesichts dieser Abgründe<br />
der Logik sollte man nicht übersehen, dass sich dahinter neben<br />
rechtlichen Fragen auch moralische Probleme verbergen.<br />
Dies wird deutlich, wenn man sich den Fall nicht als logisches<br />
Gedankenspiel, sondern als reale Auseinandersetzung vorstellt.<br />
Dann würden die Beteiligten nämlich Fragen wie diese stellen<br />
beziehungsweise beantworten müssen: Wie ernst war die<br />
Absicht des Euathlos, den Beruf des Anwalts zu ergreifen?
Zu welchem Zeitpunkt hat er sich entschlossen, diese Absicht<br />
fallen zu lassen? Hat er seinen Lehrer längere Zeit über seine<br />
neue Absicht im Unklaren gelassen oder getäuscht? Hat Protagoras<br />
bei Euathlos falsche Erwartungen geweckt? Was verstanden<br />
beide ursprünglich unter Euathlos’ »erstem Fall«, und<br />
ist dieses Verständnis Bestandteil der Absprache oder nicht?<br />
Welche Absicht verfolgte der Lehrer mit dem Arrangement<br />
des Erfolgshonorars? Wenn seine Kunst darin besteht, den<br />
nächstbesten Fall ganz unabhängig davon zu gewinnen, worum<br />
es inhaltlich geht, ist dann nicht diese Kunst selbst<br />
moralisch fragwürdig? Geschieht ihm dann vielleicht Recht,<br />
wenn er sein Honorar nicht bekommt?<br />
Beim juristischen Streitfall und der richterlichen Entscheidung<br />
kommt es darauf an, was bewiesen wird oder was zumindest<br />
als plausibel angenommen werden kann und unter<br />
welche Gesetze die so rekonstruierten Vorgänge fallen. Die<br />
moralische Frage bezieht sich dagegen darauf, was wir von<br />
unseren Mitmenschen oder was diese von uns berechtigterweise<br />
erwarten können. Und es geht auch darum, was wir<br />
selbst von uns erwarten, wie wir uns selbst sehen, wie wir leben<br />
wollen. Das Recht stellt also ein äußeres Gebot dar, das im<br />
Zweifelsfall, wenn auch nicht immer erfolgreich, durch Polizei<br />
und Gerichte durchgesetzt werden kann. Demgegenüber<br />
wirkt das Moralische, wenn es denn wirkt, als innere Orientierung.<br />
Im Konfliktfall erscheint es als inneres Gebot, das<br />
nicht mit äußeren Zwangsmitteln durchgesetzt wird, sondern<br />
sich als Stimme des Gewissens Gehör zu schaffen versucht.<br />
Obwohl das Moralische bisweilen als von außen an uns<br />
herangetragene Pflicht erscheint, wird die Erfüllung dieser<br />
Pflicht nur dann als eigentlich moralisch angesehen, wenn sie<br />
freiwillig erfolgt und gefühlsmäßig bejaht wird. Wir sollen<br />
das, was wir sollen, auch wollen.<br />
Moralische Bewertungen fließen in die alltäglichen Auseinandersetzungen<br />
oft unbemerkt ein. Sie kommen in begrenzten<br />
Feststellungen (»Du kannst nicht eine Arbeit in Rechnung<br />
stellen, die du nicht geleistet hast«), eher selten auch als
moralische Regeln begrenzter Reichweite (»Betrug ist nicht<br />
erlaubt«) zu Wort. Wird dagegen über Gut und Böse, richtiges<br />
und falsches Handeln grundsätzlicher nachgedacht und<br />
versucht man, moralische Annahmen ausdrücklich festzuschreiben,<br />
dann geht man – der diesem Buch zugrunde liegenden<br />
Definition zufolge – von der Moral zur Ethik über. Ethik ist<br />
eine Form der Kommunikation, in der Lebensverhältnisse<br />
hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Chancen, Beeinträchtigungen<br />
und Verpflichtungen verglichen und bewertet werden.<br />
Ethische Prinzipien tauchen auch schon im Alltag auf,<br />
insbesondere in Form der so genannten goldenen Regel (»Was<br />
du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern<br />
zu«), aber auch in Form von Standesregeln und berufsethischen<br />
Kodizes. Ethiktheorien versuchen, moralische Normen<br />
und Werte mit Gründen und Prinzipien abzustützen oder<br />
problematische Ansichten darüber zu widerlegen. Während<br />
also Moral eine individuelle und gesellschaftliche Praxis<br />
darstellt, ist Ethik eine Theorie dieser Praxis.<br />
Dementsprechend wird in diesem Buch unter »Ethik« in Übereinstimmung<br />
mit dem heute vorherrschenden Sprachgebrauch<br />
die <strong>Philosophie</strong> der Moral verstanden, wobei »Moral«<br />
nicht nur den engeren Bereich des unbedingten Sollens,<br />
sondern auch den weiteren des Strebens nach einem gelingenden<br />
Leben umfasst. Die Ethik als philosophische Disziplin<br />
befasst sich analysierend und wertend mit den moralischen<br />
Normen und Werten des menschlichen Handelns, vor<br />
allem mit ihren Begründungen, ihren Prinzipien und ihren<br />
Anwendungen.<br />
Es gibt allerdings auch andere Bestimmungen der Ausdrücke<br />
»Ethik« und »Moral«. Dies kann, wenn man die Unterschiede<br />
übersieht, durchaus zu Verwirrungen führen. Einige Philosophen<br />
verwenden beide Ausdrücke gleichbedeutend – dies entspricht<br />
überwiegend dem alltäglichen Sprachgebrauch. Andere<br />
machen sich den sprachlichen Unterschied inhaltlich<br />
zunutze. Beispielsweise wird »Ethik« manchmal (in Anlehnung<br />
an die vorherrschende Thematik der antiken Ethik) als
Lehre vom wesensgemäß gelungenen Leben verstanden,<br />
während »Moralphilosophie« (in Anlehnung an die vorherrschende<br />
Thematik der modernen Ethik) die Lehre von der Gerechtigkeit<br />
im Interessenausgleich bezeichnet. Oder »Moral«<br />
beschreibt das in einer Gesellschaft üblicherweise Gesollte,<br />
während »Ethik« den moralischen Reflexions- und Entscheidungsprozess<br />
meint, mit dem Individuen sich auch gegen<br />
eine herrschende Moral abgrenzen können (für diese Gegenüberstellung<br />
werden auch die Begriffe »Sittlichkeit« und<br />
»Moralität« verwendet). Oder gerade umgekehrt wird unter<br />
»Ethik« der Bereich der konkreten kulturellen Orientierung<br />
und individuellen Entscheidung verstanden, während »Moral«<br />
sich auf grundsätzliche Fragen der Legitimität der Handlungsorientierungen<br />
bezieht.<br />
Solche Unterscheidungen setzen aber immer schon bestimmte<br />
inhaltlich-theoretische Festlegungen voraus. Eine<br />
Geschichte der Ethik, die es mit einer Zeitspanne von zweieinhalbtausend<br />
Jahren und entsprechend unterschiedlichen<br />
Kulturen, Individuen und Theorien zu tun hat, verwendet<br />
dagegen sinnvollerweise einen Ethikbegriff, der möglichst<br />
wenig inhaltlich vorbestimmt ist, um sich den Blick auf die<br />
jeweils dargestellte Ethiktheorie nicht durch vorgefasste<br />
Kategorien zu verstellen.<br />
»Ethik« in der allgemeinen Bedeutung von »Moralphilosophie«<br />
entspricht auch der geschichtlichen Herkunft dieser<br />
Begriffe selbst. Als philosophische Disziplin wurde die<br />
Ethik innerhalb des abendländischen Denkens zum ersten<br />
Mal von Aristoteles (ca. 384–322 v. Chr.) abgegrenzt und benannt,<br />
wobei er Sokrates (ca. 469–399 v. Chr.) als denjenigen<br />
bezeichnete, der sich als Erster (im Unterschied zu den<br />
vorsokratischen Naturphilosophen) mit dem Wesen des<br />
»Ethischen« (tà ethiká) beschäftigt habe. Aristoteles verwendete<br />
das Adjektiv »ethisch« (ethikós) entweder im Zusammenhang<br />
mit einem Substantiv (er sprach von ethischer<br />
Tüchtigkeit, ethischer Abhandlung) oder auch als substantiviertes<br />
Adjektiv (das Ethische). Schon Sokrates und Pla-
ton (ca. 427–347 v. Chr.) bevorzugten diese Sprachform (»das<br />
Fromme«, »das Schöne«, »das Gerechte«), um den Blick auf<br />
das Wesen der Sache zu lenken und von allen zufälligen<br />
Besonderheiten zu abstrahieren. Das Adjektiv »ethisch« gehört<br />
sprachlich zum Substantiv »Ethos«, das im Griechischen<br />
zunächst die Grundbedeutung der Wohnstätte und, davon<br />
abgeleitet, zwei weitere Bedeutungen hatte: Gewohnheit/<br />
Sitte/Brauch und Charakter/Tugend. Unter »Ethos« wird seither<br />
die (einigermaßen verlässliche) Regelung von Grundverhaltensweisen<br />
der Menschen zueinander und zu ihrer<br />
Umwelt verstanden. Durch das Ethos als Lebensform werden<br />
die wechselseitigen Verhaltenserwartungen zu relativ dauerhaften<br />
Einstellungen geformt.<br />
Eine Geschichte der Ethik kann angesichts des begrenzten<br />
Umfangs – dies ist fast überflüssig zu sagen – keineswegs beanspruchen,<br />
auch nur alle »klassischen« Autoren zu behandeln,<br />
ja sie kann nicht einmal die ethischen Ansichten der<br />
jeweils behandelten Autoren im Ganzen wiedergeben. Während<br />
die meisten Ethikgeschichten einen (dann doch allzu<br />
knappen) Überblick über die jeweiligen Ansätze geben, verfolgt<br />
das vorliegende Buch vor allem den Zweck der Einführung.<br />
Sich in philosophisches Denken einführen zu lassen<br />
heißt aber weniger, Denkresultate zur Kenntnis zu nehmen,<br />
als sich mit ausgewählten Gedanken und Argumentationsweisen<br />
auseinander zu setzen. Deshalb habe ich mich für ein<br />
exemplarisches Verfahren entschieden. Das heißt, aus der<br />
Fülle der Ethiktheorien wurden einige Gedanken herausgegriffen,<br />
die als charakteristisch für den jeweiligen Autor und<br />
seine Epoche gelten können und über ihre Zeit hinaus bis<br />
heute gewirkt haben. Die Kriterien dieser Auswahl sind nicht<br />
allein objektiv zu rechtfertigen, ein subjektiver Anteil daran<br />
ist unleugbar, aber, wie ich hoffe, auch nicht nachteilig. Die<br />
Verweise auf den jeweiligen geschichtlichen Kontext, in dem<br />
ein ethischer Ansatz zu verorten ist, mussten aus Umfangsgründen<br />
auf ein Minimum reduziert werden. Auch habe ich<br />
mich auf das abendländische ethische Denken beschränkt.
Außereuropäische Ethiken vom Kodex des Hammurabi bis<br />
zu Gandhis Satyagraha-Lehre mussten ganz außer Betracht<br />
bleiben. Schließlich endet die vorliegende Geschichte der<br />
Ethik auf vielleicht etwas willkürlich anmutende Weise in<br />
der Mitte des 20. Jahrhunderts. Versteht man jedoch unter<br />
»Geschichte« das Vergangene, dann kann man das, was seither<br />
die moralphilosophischen Diskussionen bestimmt, zur<br />
»Gegenwart« der Ethik zählen.<br />
Willkürlich, wenn auch unvermeidlich, ist ein solcher Einschnitt<br />
allerdings auch insofern, als sich Geschichte und<br />
Gegenwart in der <strong>Philosophie</strong> anders zueinander verhalten als<br />
in den Wissenschaften. Philosophische Fragen, zumal die der<br />
Ethik, erledigen sich zumeist nicht ein für alle Mal, es gibt<br />
hier, ähnlich wie im Bereich des Ästhetischen, keinen geradlinigen<br />
Fortschritt, vielmehr eine erstaunliche Kontinuität der<br />
Diskussion. Im geschichtlichen Abstand erscheint zwar auch<br />
manches zeitgebunden und überholt, anderes aber aktuell<br />
wie je. Auch das Vergessen und die Rückschritte hinter einmal<br />
Erreichtes gehören zur Geschichte der Ethik. Die in der Wissenschaftsgeschichte<br />
übliche Differenzierung in gesicherte<br />
Erkenntnis und historische Irrtümer wäre im Fall der Ethik<br />
selbst ein Irrtum. Die strikte Entgegensetzung von geschichtlichen<br />
und systematischen Fragen ist in der <strong>Philosophie</strong> unangemessen.<br />
Vielmehr sind beide Aspekte untrennbar. <strong>Philosophie</strong>geschichtliche<br />
Darstellungen müssen sowohl die<br />
Voraussetzungen und Motive der dargestellten geschichtlichen<br />
Personen wie auch die philosophischen Fragen der<br />
Gegenwart im Auge behalten. <strong>Philosophie</strong> ohne <strong>Philosophie</strong>geschichte<br />
verliert den breiten Horizont ihrer Fragemöglichkeiten<br />
aus dem Blick, während <strong>Philosophie</strong>geschichte ohne<br />
<strong>Philosophie</strong> steril bleibt.<br />
Das bedeutet, dass <strong>Philosophie</strong>geschichte auch von der systematischen<br />
Erörterung des jeweils Dargestellten lebt. <strong>Philosophie</strong><br />
war und ist eine vielstimmige Diskussion über Orte<br />
und Zeiten hinweg, und dazu gehören unabdingbar das Kommentieren,<br />
Auslegen, Kritisieren. Indessen musste ich auch
diesen notwendigen Anteil im Rahmen einer knappen<br />
Einführung in die Geschichte der Ethik stark beschränken. Im<br />
Vordergrund steht neben zeitgenössischer oder späterer<br />
Kritik der dargestellten Ansätze ihr bis heute wirksames<br />
Anregungspotenzial.
Weitere E-<strong>Books</strong><br />
<strong>Grundwissen</strong> <strong>Philosophie</strong>
Erhältlich in allen bekannten E-Book-<br />
Shops und unter buchversand-stein.de:<br />
Herbert Schnädelbach: Immanuel Kant<br />
Gunzelin Schmid Noerr: Geschichte der Ethik<br />
Geert Keil: Willensfreiheit und Determinismus<br />
Gerald Hartung: Philosophische Anthropologie<br />
Beatrix Himmelmann: Nietzsche<br />
Herbert Schnädelbach: Vernunft<br />
Detlef Horster: Sozialphilosophie<br />
Udo Tietz: Heidegger<br />
Dirk Baecker: Kommunikation<br />
Heiner Hastedt: Sartre<br />
Eva-Maria Engelen: Gefühle
Therese Steffen: Gender<br />
Detlef Horster: Ethik<br />
Annette Vowinckel: Hannah Arendt<br />
Reinhard Mehring: Politische <strong>Philosophie</strong><br />
Wolfgang Detel: Aristoteles