Erläuterungen
Erläuterungen
Erläuterungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
,<br />
...<br />
•<br />
..<br />
tr<br />
..<br />
tr
H"\t:.<br />
JOrl 1\1 C,{ E.RAfI\<br />
t.t.~~f\Y
Erläuterungen<br />
zum zweiten Abdruck<br />
der neunten Auflage der<br />
Geologischen Übersieh tskarte<br />
von<br />
Württemberg und Baden,<br />
dem Elsass, der Pfalz<br />
und den<br />
weiterhin angrenzenden Gebieten.<br />
Mit 17 Profilen im Text und einer Erdbebenkarte<br />
Südwestdeutschlands.<br />
Bearbeitet<br />
von<br />
C. Regelmann.<br />
Herausgegeben<br />
von dem<br />
K. Württ. Statistischen Landesamt.<br />
Stuttgart.<br />
Kommissionsverlag der Buchhandlung H. Li n dem a n n (P. Kur t z).<br />
19 14.<br />
~d
Druck von W. K 0 h 1 h a m m er in Stuttgart.
Vorwort.<br />
Die im August 1905 erschienene 5. Auflage der geologischen<br />
Übersichtskarte des Königreichs Württemberg brachte<br />
eine namhafte Erweiterung des Kartengebietes nach Westen hin,<br />
bis an den Meridian von Belfort. An diesem Umfang wurde<br />
bis zur jetzigen Auflage festgehalten. Dadurch wurde ein<br />
einheitliches Bild der geologischen Verhältnisse<br />
von ganz Südwestdeutschland gewonnen. Nun erscheint<br />
die Geologie Württembergs im vollen natürlichen Zusammenhang<br />
mit derjenigen der mittelrheinischen Gehirge und des Rheintales.<br />
Diese Abgrenzung entspricht demnach einer geologischen Einheit.<br />
Dadurch ergeben sich mancherlei neue und wichtige Gesichtspunkte<br />
und Beziehungen, so daß die Darstellung auch als<br />
L ehr mit tel bedeutend gewonnen hat. Es schien nun angezeigt,<br />
um den geäußerten Wünschen entgegenzukommen, den<br />
neuen Auflagen zum Kartenbild noch das er I ä u t ern d e Wo l' t<br />
in einem kurz ge faßten Texte beizugeben. Durch das Entgegenkommen<br />
der Deutschen Geologischen Gesellschaft konnte hiezu<br />
ein Vortrag verwendet werden, den der Verfasser am 14, August<br />
1905 bei der 50. Hauptversammlung in Tübingen gehalten<br />
hat, und der im L. Band der Zeitschrift dieses Vereins im Druck<br />
erschienen ist. Zahlreiche Umformungen und Nachträge waren<br />
durch den neuen Zweck gegeben.<br />
Da für die 8. Auflage der Karte ein Neudruck der "Er-<br />
1 ä u te run gen" vollzogen werden mußte, so konnten auch hier<br />
die nötigen Ergänzungen und Verbesserungen eingefügt werden,<br />
damit so das Ganze wiederum dem neuesten Stand der geologischen<br />
I
4 -<br />
Die 9. Auflage (März 1913) hat sich im Farbenbild nur wenig<br />
verändert (am meisten im "B au I an d") ; dagegen hat das<br />
System der te k ton is ch en Li ni en wesentliche Vervollständigungen<br />
erfahren.<br />
Der rasche Absatz der 9. Auflage hat im Juli 1914 einen<br />
unveränderten Neu d r u c k nötig gemacht, welchem die vorliegenden<br />
- noch weiter ergänzten - Er 1 ä u t e run gen beigegeben<br />
werden.
Geschichte und Inhalt der Karte.<br />
Die Karte ruht durchaus auf geologischen Spezialaufnahmen<br />
und .konnte - durch das freundliche Entgegenkommen der geologischen<br />
Landesanstalten von WUrttemberg, Elsaß-Lothringen,<br />
Baden, Hessen, Bayern und Preußen - auch für die 9. Auflage<br />
namhafte Originalbeiträge aus ungedruckten geologischen<br />
Manuskriptkarten verarbeiten. Bei den "E r I ä u tel' u n gen"<br />
wurde die geologische Literatur des Gebietes bis zum Schluß<br />
des Jahres 1913 berücksichtigt.<br />
Die E i gen art der Karte erklärt sich aus ihrer Entstehungsgeschichte,<br />
sie ist kurz gesagt "technischer Art" und<br />
hat vor allem den ernsten wissenschaftlichen Gebrauch im Auge.<br />
Die Präzision der topographischen Grundlage und des geologischen<br />
Bildes ist so weit getrieben, als es überhaupt der Maßstab zuläßt.<br />
- Der Verfasser hatte im Auftrage seiner Behörde fUr<br />
die K. Württ. Ministerialabteilung für Straßen- und Wasserbau<br />
- im Jahre 1885 - vier Karten für die hydrographische<br />
Beschreibung des Neckargebietes im Maßstab 1:600000<br />
zu liefern: Flußgebiete, Höhenschichten, Bodendurchlässigkeit<br />
und geologische Verhältnisse. Diese bildeten einen Teil der Beiträge<br />
Württembergs an die Reichskommission zur Untersuchung.<br />
der Rheinstromverhältnisse. Da das K. Statistische Landesamt<br />
für die damals beendigte "Geognostische Spezialkarte<br />
Württem bergs" (55 Blätter in 1: 50000) eine Üb ers i ch tskar<br />
t e haben wollte, dehnte der Verfasser die genannten Darstellungen<br />
bis zur Landesgrenze und bis darüber hinaus zu<br />
einem - etwas eng bemessenen - Kartenrand aus (etwa bis<br />
zum Meridian der Hornisgrinde); so entstanden folgende vier<br />
Karten zur Naturgeschichte Württembergs in<br />
1: 600000:<br />
1. Die hydrographische übersichtskarte des Königreichs<br />
Württemberg (mit einem Verzeichnis der Flächeninhalte<br />
der Flußgebiete [1891]).<br />
2. Die hydro grap h is ch e Durchi äss ig k ei ts karte<br />
des Königreichs Württemberg; mit einer Schraffierung
- 6 -<br />
der Gebietsteile nach den drei Stufen der B 0 d e n<br />
durchlässig kei t: Undurchlassend, Mitteldurchlassend<br />
und Sehrdurchlassend (1892).<br />
3. Die Gewässer- und Höhenkarte des Königreichs<br />
Württemberg; mit abgetönten Höhenschichten von 100<br />
zu 100 m (1893), und<br />
4. die g e 0 g nos t i s ehe übe r sie h t s kar t e des<br />
Königreichs Württemberg (1893 erstmals erschienen).<br />
Nach Abdruck der 4. Auflage der letzteren Karte im Jahre<br />
1903 erschien eine völlige Erneuerung der 16 Farbplatten notwendig.<br />
Bei diesem Anlaß verfügte das K. Württ. Statistische<br />
Landesamt eine namhafte Ausdehnung der Karte nach Westen,<br />
welche in der 5. Auflage (1905) erstmals ans Licht getreten ist.<br />
Der 6. - wiederum verbesserten - Auflage ist erstmals ein<br />
e r1 ä u t ern der Text beigegeben worden, welcher in etwas<br />
erweiterter Gestalt auch die 7. Auflage begleitete. Für die<br />
9. Auflage ist dieser Text besonders gründlich durchgesehen<br />
und vielfach verbessert und erweitert worden.<br />
Diese Erläuterungen beschränken sich absichtlich auf die<br />
Schilderung des Gebirgsbaues im großen. Für die stratigraphischen<br />
und paläontologischen Einzelheiten verweisen wir auf die "E r<br />
I ä u t e run gen", welche von den geologischen Landesanstalten<br />
unseres Kartengebietes den einzelnen geologischen Spezialkarten<br />
im Maßstab 1 : 25000 beigegeben'werden. - Auch eine Reihe von<br />
"F ü h I' ern" dient solchen speziellen Zwecken. So: 'rH. ENGEL,<br />
Geognostischer Wegweiser durch Württemberg. Stuttgart 1908.<br />
(Ein kleiner, sehr brauchbarer "Geologischer Exkursionsführer<br />
durch Württemberg" desselben Verfassers<br />
erschien 1911.) - E. FRAAS, Führer durch die 1(. Naturalien<br />
Sammlung zu Stuttgart, 3. Aufl., 1910. - E. v. KOKEN, Führer<br />
durch die Sammlungen des Geologisch-Mineralogischen Instituts<br />
in Tübingen. Stuttgart 1905. - G. STEINMANN und GRÄFF,<br />
Oeologischer FUhrer der Umgegend von Freiburg. Freiburg i. B.<br />
1890. - J. RUSKA, Geologische Stl'eifzüge in Heidelbergs Umgebung.<br />
Leipzig 1908. - C. CHELIUS, Geologischer Führer<br />
durch den Odenwald, 2. Aufl. Gießen 1907. - G. KLEMM, GeologischCl'<br />
FUhrer durch den Odenwald. 1910. - E. W. BENECKE,<br />
H. BÜCKING, K SCHUMACHER und L. VAN WERVEKE, Geologischer
- 7<br />
FUhrer durch das Elsaß. Berlin 1900 und D. HÄBEBLE, Der<br />
POOzerwald. Kaiserslautern 1911.<br />
Die tektonis eh en Ver h ältni s s e Slidwestdeutschlands<br />
finden auf der Karte gleich den ge 0 10 gi s c he neingehende<br />
Darstellung. Farben und Zeichen entsprechen - mit geringen<br />
Abweichungen - durchaus den Vereinbarungen der internationalen<br />
Geologenkongresse. Die Anordnung der Farbenschilde ist derart<br />
getroffen, daß sie eine Ge 010 gie Sü d westd eu tsch lan ds<br />
"i n nu c e" darstellen und auf die Faziesunterschiede einzelner<br />
Gebiete hinweisen. Auch die eigenartige Namengebung der<br />
schweizerischen und französischen Jurageologen ist mit QUEN<br />
STEDTS Stufen in Parallele gebracht. Der Darstellung des<br />
Qua r t ä r s ist besondere Sorgfalt gewidmet. Nicht nur treten<br />
die großen Vergletscherungen Oberschwabens in der Karte<br />
plastisch heraus, sondern auch die Schotter der vier Eiszeiten<br />
(Günz-, Mindel-, Riß- und Würmeiszeit) konnten im Alpenvorlande<br />
nach den Originalaufnahmen von Geh. Rat Prof. Dr. A. PENCK<br />
(Berlin), Dr. AnoLPH E. FORSTER (Wien) und Prof. Dr.<br />
MARTIN SCHMIDT (Stuttgart) ausgeschieden werden. Auch im<br />
Rheintal konnte mit freundlicher Unterstützung der Herren:<br />
Prof. Dr. GUTZWILLER (Basel), Prof.Dr. KLEMM (Darmstadt), Bergrat<br />
Dr. SCHUMACHER (Straßburg), Geh. Oberbergrat Dr. VAN WER<br />
VEKE (Straßburg) und Prof. Dr. A. SAUER (Stuttgart) einheitliche<br />
Ordnung geschaffen werden. Letzterem verdankt der<br />
Verfasser auch als dem Referenten - des K. Statistischen<br />
Landesamtes - manche freundliche Anregung.<br />
Die B ru chi i nie n der Erdkruste sind in drei Abstufungen<br />
in die Karte eingetragen worden: Verwerfungsspalten mit über<br />
1000 m Sprunghöhe am kräftigsten, solche mit 100 m leichter<br />
und solche unter 100 m mit zarten Linien; dabei ist stets der<br />
ti efere Fl ü gel durch Zacken markiert. Als neue Signatur<br />
erscheint auf der 9. Auflage - nach dem Vorschlag von Prof.<br />
Dr. PAULKE (Karlsruhe) - die "senkrechte Schubfläche".<br />
Sie erscheint von Bedeutung für die Tektonik der Schwäbischen<br />
Alb und fand erstmalige Verwendung bei E bin gen, wo sie<br />
das Gebirge in der Richtung N 13 0 0 durchschneidet. (Vergl.<br />
Blätter des Schwäbischen Albvereins. XXI. Jahrg. 1909. S. 46 f.)<br />
Um den innigen Zusammenhang dieser Bruchlinien mit den<br />
Erdbebenherden und Herdlinien im südwestdeutschen
- 8 -<br />
Gebirgsbau klarzustellen, wurde im Anhang (auf Tafel I) eine<br />
übersichtliche Zusammenfassung dieser Verhältnisse gegeben.<br />
Die absolute Höhenlage ist allenthalben in der Karte durch<br />
zahlreiche H ö h e n z a h I e n übe I' No r mal null festgestellt.<br />
Hinzugefügt ist auch in der neuesten Ausgabe ein Gebirgsprofil<br />
auf dem unteren Rande, das - quer zum Streichen -<br />
folgende Linie einhält: Hochwald im Hunsrück, - Saarbrücker<br />
Steinkohlengebirge, - N ordvogesen, - Rheintalgraben, - Nördlicher<br />
Schwarzwald, - Schwäbische Alb, - Donautal, - Oberschwäbische<br />
Hochebene, - Algäu. Das Profil gibt ein deutliches<br />
Bild von dem Aufbau des südwestdeutschen Bodens entlang<br />
der 4:4:0 km langen Schnittebene. - Um auch für andere Gebietsteile<br />
Einblick in den Gebirgsbau zu gewähren, ist überdies noch<br />
eine Anzahl von Spezialprofilen in den Text eingefügt worden.<br />
Von der 6. Auflage an konnten auch die alp i n e n Übe 1'<br />
s chi e b u n gen (im Algäu) zur Darstellung gelangen, nach gefälligen<br />
Mitteilungen von Prof. Dr. A. ROTHPLETZ (München).<br />
Die Karte zeigt nun die Algäuer und die Lechtaler Überschiebungen<br />
durch den Verlauf der Stirnränder und das<br />
Gebirgsprofil deutet die Sc hub fl ä c h e n an. - Am Nordrand<br />
des S ä n t i s wurde der Stirnrand der Überschiebung nach dem<br />
schönen Säntiswerk von Prof. Dr. A. HEIM (Zürich) nachgetragen.<br />
Im und am R i e s sind die Ergebnisse der Forschungen graphisch<br />
dargestellt nach den Auffassungen des Geheimen<br />
Bergrat Dr. W. v. BRANcA (Berlin) und Prof. Dr. E. FRAAS<br />
(Stuttgart).<br />
Die 7. Auflage war der 6. gegenüber nur wenig verändert,<br />
doch brachte das Erscheinen einer ganz neuen Ausgabe der<br />
"Carte geologique de la France a l'echelle du million<br />
I e m e. Paris (Janvier 1906), Ministere des travaux publies" ,<br />
für den Südwesten unseres Kartengebietes mehrere Verbesserungen.<br />
Auch das damals erschienene 1. Blatt "Saarbrücken",<br />
der "Geolugischen und tektonischen Übersichtskarte<br />
von Elsaß-Lothringen" (12 Blätter in 1:200(00),<br />
mit Brläuterungen, bearbeitet von Bergrat L. VAN WERVEKE<br />
(Straßburg i. E. 1906) brachte viel Neues für diese Ausgabe.<br />
)1~Ur die bayerisclte Pfalz waren die 1906 ausgegebenen "Geognostischen<br />
Jahreshefte (XVII, 1904:)" von besonderer Wichtigkeit.<br />
- Neu wal' in der 7. Anflage eine eingehende Verwer-
- 9 -<br />
tung der Arbeiten der sl1dwestdeutschen Erbebenkommissionen<br />
zur Bestimmung der Erdbebenherde und Herdlinien,<br />
welche durch S tel' nein der Karte ausgezeichnet worden<br />
~~ ,<br />
Die 8. Auflage brachte wiederum eine stattliche Reihe von<br />
Nachträgen und Verbesserungen. Auf Grund einer eig'enen<br />
Spezialarbeit wurde dem Zusammenhang zwischen dem Gebirgsbau<br />
Südwestdeutschlands und den hier beobachteten Erd beb e llerscheinungen<br />
nachgespürt und die Karte in diesem wichtigen<br />
Punkt durch 42 Nachträge noch weiter ergänzt. - Auch die<br />
"Bemerkungen zur 7. Auflage der geologischen Übersi<br />
c h t s k arte" von W. KRANZ (Zentralblatt für Mineralogie,<br />
Geologie und Pa!., Jahrg. 1908, Nr. 18, Stuttgart, S. 556 f.) habe<br />
ich dankbar verwertet, soweit ich die gegebenen Anregungen mit<br />
den mir bekannten Tatsachen vereinigen konnte. Das SpaItensystem<br />
im Hochsträß bei DIrn kann ich freilich vorläufig nicht<br />
anerkennen. Ich habe meine Ablehnung auf der 41. Versammlung<br />
des 0 bel' I' h ein i s c h eng e 0 log i s c h e n Ver ein s<br />
(Ostern 1908) näher begründet und verweise dieserhalb auf den<br />
gedruckten Bericht (Karlsruhr. 1909) über diese Versammlung.<br />
Das Auskeilen der Triasschichten unter dem Donautal bei Beuron<br />
scheint mir ebenfalls sehr unwahrscheinlich und ist jedenfalls<br />
nicht nachgewiesen. (Im übrigen verweise ich auf meine Erwidemng<br />
im Zentralblatt für Min., Geo!. und Pa!., Jahrg. 1910,<br />
Nr. 10, S. 307 f.) Wertvolle Ergänzungen für die 9. Auflage<br />
lieferten die neueren Arbeiten der Gl'oßh. Badischen Geologischen<br />
Landes:rnstalt, welche mil' - mit Ermlichtigung des Vorstands<br />
Prof. Dr. DEECKE (Freiburg) - von den Landesgeologen Geheimer<br />
Bergrat Dr. SCHALCH, Bergrat Dr. THÜRACH, Dr. SCHNARRENBERGER<br />
und Assistent SPIZ giitigst mitgeteilt wurden. - Überdies wurde<br />
die Tektonik des Schwarzwaldes wesentlich aufgeklärt durch die<br />
Freiburger Geologenschule. Wir nennen die Dissertationen von:<br />
S. v. BUBNoFF; T. WILSER; E. BRÄNDLIN; F. SPIEGELHALTER;<br />
O. WURZ, K. STIERLIN und J. GLASER. (Verg!. Mitt. der Großh.<br />
Bad. Geo!. Landesanstalt, VI. u. VII. Bd.) - Zur Tektonik des<br />
schweizerischen Tafeljura konnten wichtige Beiträge des Herrn<br />
Dr. :E. BLÖSCH (Zürich) verwertet werden. - Das Te rt i ära m<br />
Ha r d tr a n d e und im Mainzer Becken konnte llbersichtlicher<br />
zusammengefaßt werden durch freundliche Beiträge 'der Heidelberger<br />
Geologen: Geh. Hofrat Prof. Dr. SALOMON, Dr. D. HÄBERLE
10 -<br />
und Dr. W. BueHER. - Auch sonst habe ich manchen freundlichen<br />
Beitrag verwerten können und ich danke an dieser Stelle<br />
besonders den Herren Prof. Dr. SAUER (Stuttgart); Prof. Dr.<br />
BuxToRF (Basel); Geh. Bergrat Dr. L. VON AMMON (München)<br />
und Direktor W. SCHMIDLE (Konstanz) für gütige Mithilfe.<br />
Die neue Auflage der Karte zeigt auch die Ortslagen der<br />
wichtigen Tiefbohrungen von Krotzingen (südwestlich<br />
von Freiburg), von K ö ni g s bI'o n n (südlich von Aalen) und<br />
von He i den h e i m. Neuestens ist auch bekannt geworden, daß<br />
ein gegen 900 m tiefes Bohrloch bei E I' I e n b ach im Tale der<br />
Sulm (4,3 km südöstlich von Neckarsulm) niedergebracht wurde,<br />
das im nördlichen Württemberg Zechstein und Rotliegendes<br />
erschloß.<br />
Klar überschaut man nun auf der erweiterten Karte den<br />
Bau des ganzen Schwarzwaldes und des Odenwaldes, des<br />
Schwäbischen Unterlandes, der S eh w ä bis ehe n Alb mit ihrer<br />
Fortsetzung im Randen und Aargau bis zum "Clos du Doubs",<br />
ferner die Schwäbisch-Schweizerische Molassehochebene mit<br />
dem Grabenbruch des Bodensees, im Süden begrenzt von den<br />
Kreidezügen des Säntis und der Algäuer Kalkalpen. Im Westen<br />
finden sich im Sundgau und längs der Rheintalspalten weithin<br />
verbreitet die Ablagerungen der 0 I i g 0 z än z e i t, welche die<br />
Tiefen des Rheintalgrabens füllen. Die V 0 ges en sind von der<br />
Burgundischen Pforte bei Belfort an dargestellt - mit dem<br />
Zaberner Bruchfeld - bis zum Anschluß an die Hardt; darüber<br />
hinaus diese selbst und das Gebiet bis hinab nach Kreuznach.<br />
Im Hinterlande findet sich noch das Lot h I' i n ger S tu fe nl an d<br />
bis Avricourt, samt dem anschließenden Wes tri eh; also die<br />
P fa I z ganz, neben dem S t ein k 0 h I eng e b i eta n der S aar<br />
bis zum Anschluß an die Taunusquarzite des Hoc h - und I d a r<br />
wal des.<br />
Die vorzügliche technische Ausführung des Farbendruckes<br />
durch das Typographische Institut von Gi e sec k e & D e v r i e n t<br />
in Leipzig hat es auch jetzt wieder ermöglicht, das viele geologische<br />
Detail so zu verstecken, daß es den klaren Überblick<br />
iiber die großen Verhältnisse in keiner Weise stört und doch<br />
von dem gesehen werden kann, der es sucht.
Die wiohtigsten Struktur linien im geologisohen<br />
Aufbau des Kartengebietes.<br />
Allgemeiner Überblick.<br />
Es handelt sich darum, den<br />
von der N atnr auf das Antlitz<br />
der Erde geschriebenen P 1 a n<br />
der Lei tl in i e n zu ermitteln.<br />
E. SUESS. Das Antlitz<br />
der Erde. III. S. 6.<br />
Die neunte Auflage der "Geologischen Übersichtskarte<br />
von Württemberg und Baden" umfaßt (gleich der<br />
fünften, sechsten, siebenten und achten) das Elsaß, die Pflllz,<br />
Teile der preußischen Provinz Rheinland, den südlichen Teil<br />
des Großherzogturns Hessen, das westliche Bayern bis zum Ansbacher<br />
Meridian, ein beträchtliches Stück der Voralpen und des<br />
Schweizerischen Molasselandes, sowie endlich größere Gebiete des<br />
Schweizerisch-Französischen Jurazuges und des Lothring-ischen<br />
Tafellandes. Die Karte ist mit einem reichen Tatsachenmaterial<br />
der Te k ton i k ausgestattet. Es ist deshalb auch in den Erläuterungen<br />
der S chi I der u n g des ge 0 log i s ehe n Au f<br />
bau e s die erste Stelle eingeräumt. Dies geschieht am besten<br />
durch Heraushebung der w ich t i g s t e n S t r u k t ur) in i e n im<br />
Grundplan des schönen Schichtstufenlandes, das den Sammelnamen<br />
"Südwestdeutschland" trägt.<br />
Vielgestaltig erscheint der geologische Aufbau dieses Landes,<br />
und doch zeigen sich auch hier ruhende Pole in der Erscheinungen<br />
Flucht; einfache einheitliche Grundgedanken eines<br />
weisen großzügigen Schöpfungsplanes.<br />
Als solche sind zu betrachten die wichtigsten Strukturli<br />
nie n des Schichtengebäudes. Richtung und Stärke der gebirgsbildenden<br />
Kräfte haben ihre deutlichen Spuren hinterlassen<br />
in den Elementen der Te k ton i k: S tr ei c h e n und Fall e n<br />
der aufgerichteten Schichtentafeln; Richtung und Art der Faltenzüge<br />
; Richtung und Sprunghöhe der Zerreißungen an den Bruchlinien<br />
der Erdkruste, den Verwerfungsspalten; Bau und
12<br />
Richtung der großen M u 1 den (Richtung der S y n k I i na I e n) ;<br />
Bau und Richtung der .großen Sättel (Richtung der Antik<br />
I i n ale n); endlich die Gestaltung der F I e x ure n, d. h. der<br />
Schichtenabbiegungen und diejenige der Überschiebungen.<br />
Darin spiegeln sich vor allem die großen Gebirgsbewegungen,<br />
welche schon in alten Zeiten im "Varistischen 1) Grundge<br />
bi I' g e" stattfanden, aber auch diejenigen, welche bei der<br />
Alpenfaltung und beim Einbruch des Rheintalgrabens<br />
das Antlitz Südwestdeutschlands umgestaltet haben.<br />
Der geologische Aufbau des Landes zwischen dem Rheinischen<br />
Schiefergebirge im Nordwesten und den Voralpen<br />
Vor a r I b erg s im Südosten unseres Kartengebietes ist so einheitlich,<br />
daß es möglich war, ein Querprofil von der Nordwestecke<br />
nach der Südostecke in ziemlich gerader Linie so zu zeichnen,<br />
wie es am nnteren Rande der Karte zu sehen ist und demselben die<br />
Überschrift zu geben: "Gebirgsprofil quer zum Streichen".<br />
Damit ist bereits gesagt, daß die Streichlinien im großen und<br />
ganzen die Richtung Süd wes t -N 0 l' dos t einhalten. Das Fallen<br />
geht vorwiegend nach Südost, aber auch entgegengesetzt nach<br />
Nordwest. Es wird sich sofort im einzelnen zeigen, daß viele<br />
Fa I t e n z ü g e, F I e x ure n, BI' U eh li nie n, sowie M U I den -<br />
und Sattelachsen Südwestdeutschlands diesem Varistischen~)<br />
Gen er als t r eie he n folgen. Durch drei Welten alter hindurch<br />
haben sich die gebirgsbildenden Kräfte so geäußert, wie wenn<br />
ein gewaltiger horizontaler, tangentialer Druck aus Südost in<br />
dem siidwestdeutschen Schichtengebäude immer von neuem ausgelöst<br />
worden wäre, oder wie wenn die Last der stets im Siid-<br />
1) Das zum Teil abgetragene "Varistische Grundg'ebirge"<br />
erstreckt sich bekanntlich - meist unter Tag - von dem französischen<br />
Zentralplateau bis zur Böhmischen Masse, bildet also für ganz Südwestdeutschland<br />
die vormesozoische Unterlage. CE. SUESS.)<br />
2) Der Verfasser möchte vorschlagen, das gebirgsbildende System,<br />
welches - in der Tiefe - weithin alles Gebirge in eine ziemlich einheitliche<br />
Folge nordöstlich streichender Falten gelegt hat, nicht mehr<br />
das Rheinische oder das Niederländische, sondern das "Va r ist i s ehe<br />
S y s t e m" zu nennen, um die stets naheliegende Versuchung der<br />
Verwechselung mit den B r u c h s p alt endes Rheintalgrabens zu beseitigen.<br />
- Die Varisken (oder wie neuerdings von E. ZIMMEHMANN<br />
vorgeschlagen ist, die Varisten) waren eine germanische Völkerschaft.<br />
En. SmJK.~ hat dem alten - nach NO Atreichellden - Faltengebirge<br />
Mittcleuropas ihren Namen beigelegt. (Das Antlitz der Erde. 2. S.116.<br />
Wien 1888 und ZeitschI'. der Deutsch. geol. Ges. 190G. Bel'. S. 51.)
13 -<br />
osten in der Geosynklinalen - in einem tiefen Trog der Erdkruste<br />
- sich anhäufenden Se dirn e n te eine Aufpressung der<br />
Grundgebirgskerne - dem heutigen Rheintal entlang - bewirkt<br />
hätte. L. VAN WERVEKE hat es (ebenso wie A. DE LAPPARENT)<br />
neuerdings mit voller Bestimmtheit ausgesprochen (Geol. Zentralblatt.<br />
Bd. VIII. 1906. S.671): "Vogesen, Schwarzwald,<br />
Hardt und Odenwald sind Teile von Gewölben. Nicht<br />
ein Zug der Tafelländer in die Tiefe hat demnach die höhere<br />
Lage der Gebirge bedingt, sondern eine infolge seit I ich e n<br />
D I' 11 C k e s erfolgte Emporwölbung dieser selbst. Die Tafelländer<br />
wurden bei diesem Vorgang mitgehoben, wenn auch in<br />
geringerem Maße und mitgefaltet. " Die Entstehung dieser Falten<br />
der Erd I' i nd e ist auf dieselbe Ursache zurückzuführen, wie<br />
die Faltung der Alpen und des Jura. Als wirkliches<br />
Sen ku n g s fe I d bleibt nur das Rheintal übrig.<br />
Auch heute noch bestehen ganz ähnliche Verhältnisse, wie<br />
die neuere Erdbebenforschung gezeigt hat. Die großen Bruchli<br />
nie n der Erd k I' U s t e, welche Südwestdeutschland durchziehen,<br />
sind auch jetzt noch die Linien des geringsten Widerstands<br />
gegen die durch die Abkühlung und die stellenweise Abtragung<br />
der Erdkugel fortwährend hervorgerufenen Spannungen.<br />
An ihnen lösen sich die tektonischen Kräfte - nach dem Gesetz<br />
der Isostasie - von Zeit zu Zeit ,aus; es gehen von ihnen die<br />
te k ton i s c h e n Erdbeben aus. Auch die vom Ausland her<br />
verpflanzten Erdbebenwellen branden stark an den Hauptspalten<br />
an, lösen sich aber häufig auch dort aus und treten auf die<br />
Nachbargebiete nur abgeschwächt oder gar nicht mehr hinüber. -<br />
Noch immer - wie zu den Zeiten der mittelkarbonischen varistischen<br />
Faltung (in N 50 0 0) - liegen unsere Gebirgskerne und<br />
unser Schollenland unter einem kräftigen tangentialen Druck, der<br />
aus SO und S wirkt. Die Alpen wollen vorrücken und pressen<br />
das ganze Zwischenland gegen die mittelrheinischen<br />
Grundgebirgskel'ne und gegen das böhmische Massiv.<br />
(Vergl. C. REGELMANN, Erdbebenherde und Herdlinien in Südwestdeutschland.<br />
Württ. naturwiss. Jahreshefte. Jahrg. 1907.<br />
S.11O-176.) -- Die Beeinflussung der Fortpflanzung der seismischen<br />
Energie durch die t e k ton i s c h e n B I' U chi i nie n<br />
zeigte sich auch neuerdings wieder augenfällig bei dem mäßig<br />
starken Erd beb e n vom 26. Mai 1910. Dasselbe ging vom<br />
Schweizer Jura (sUdlich von Basel) aus und erschütterte das
- 14 -<br />
Rheintal bis zum Parallel von Pforzheim. Aus der Rheinebene<br />
selbst liegen nur wenige Beobachtungen dieses Bebens vor. Dagegen<br />
drängen sie sich an den bei den großen Rheintalspalten<br />
ganz dicht zusammen. (VergL DE QUERVAINj in der Monatl.<br />
Übersicht der Kais. Hauptstation für Erdbebenforschung in<br />
Straßburg, 1910, Nr. 5, S. 7.) -<br />
Über "D a s Mit tel e ur 0 p ä i s ehe Erd beb e n vom<br />
16. No v e m be r 1911" hat die Kais. Hauptstation für Erdbebenforschung<br />
(Straßburg) durch R. LAIS und A. SIEBERG eine<br />
Arbeit veröffentlicht, welche die engen Beziehungen dieses Bebens<br />
zum geologischen Aufbau Süddeutschlands klar hervortreten läßt.<br />
Auf Grund der Tektonik, welche unsere Übersichtskarte zur<br />
Darstellung bringt, gelang es, die Wirkungsweise der "Verwerfungslinien"<br />
Südwestdeutschlands auf den Verlauf des<br />
genannten Bebens festzustellen. (VergL GERLANDS Beiträge zur<br />
Geophysik. XII. Bd., 1. Heft. Leipzig. 1912.)<br />
Die Erdbebenherde und Herdlinien sind daher in der<br />
neuesten Auflage der Karte noch weiter ergänzt worden und<br />
eine übersichtliche graphische Darstellung derselben ist _. wie<br />
gesagt - am Schlusse dieses Heftes beigefügt worden. (Tafel I.)<br />
Betrachtet man vom Nordwesten unserer Karte aus gegen<br />
Südosten vor3chreitend, die einzelnen Schollen des Landes, so<br />
zeigen sich folgende geologische Einheiten:<br />
1. Der Bau des Hoch- und Idarwaldes im Huusrück.<br />
Der Hoc h wal d, ein Teil des großen Rheinischen Schiefergebirges<br />
besteht aus unterdevonischen Hunsrückschiefern<br />
und Tau n u 8 qua r z i t z ü gen 1). Man sieht die über 1000 m<br />
mächtigen Schichtenstöße dieses alten Festlandes in steile Falten<br />
gelegt, welche hier die Richtung 2) N 47 0 0 (d. h. nahezu Südwest<br />
-Nordost) einhalten. In diese Faltenziige sind eingewickelt<br />
si I u I' i s c he bunte Schiefer und Phyllite (seidenglänzende Tonschiefer).<br />
Die Fallwinkel der Schichten sind groß, sie betragen<br />
1) Vergl. uie von ucr Kgl. Preußischen geologischen LandesaDstalt<br />
voröffentlichten Spezialkarten 1: 25 000 nnd die dazngehörigen Er·<br />
läuterungen. Berlin lS70-1911.<br />
2) Derartige Z"hlcn angaben sind als Mit tel wer t e zu betrachten,<br />
wolche einen wahrschcinliehcn Fehler von + 3 0 in sich tragen. Es<br />
ist stets das w a h r e (red.) Streichen gemeint.
15<br />
50"_90') lIud neigen meist gegen Nordwest. Diese Faltung ist<br />
vorpermisch, denn auf der SUdseite des Hochwaldes breiten<br />
sie,h die Schichten des unteren Rotliegenden ab w e ich e 11 d und<br />
ungestört über die Falten des Devonkörpers Ilinweg. Die Zeit<br />
der Faltuug ist ahcl' noch näher bestimmbar durch die Art der<br />
Auflt\gerUllg des Saarbriicker Oberkarbons auf die Devonfaltell<br />
- unter Tag - , sie el'Weiilt sich sicher als pos t k 11 I m i s c h<br />
oder kurz gesagt vom Alter des mittleren Karbon. Die<br />
Faltullg des Hoch- uud Idarwaldes stimmt überein mit der Fa 1-<br />
tungsrichtullg des Rheinischen Schiefergebirges<br />
überhaupt, welche wir durchweg die Yaristische Strukturlinie<br />
(ideal N 50 11 0) nennen.<br />
2. Der Bau des Saa.rbrücker Steinkohlengebirges.<br />
Abweichend und muldenförmig lagern sich die kohlenfiillJ'enden<br />
Schichten de~ Saat-Nahe-Gebietes l ) an<br />
den gefalteten Devonkörpel' des Hochwaldes und Idarwaldes an.<br />
Fig. 1.<br />
Die Lagel'uug des Steiukolllengebirges und des Rot.<br />
liegenden im Saar-Yahe-Gebiet.<br />
(Nach NASSE, WI':ISS, LASPEnlE8, GÜ~n\);r.<br />
UDd CLl\'ER.)<br />
Der Pet e rs b erg \)e~tellt uus oberem Rotliegenden. Darunter<br />
folgt UDterrotJiegendeB ('l'holeyer-, Lebacher- und Cuselerschichten).<br />
Die eingeschalteten schwarzen Lager bezeichnen die sog. Gre n z lager<br />
(Eruptivgesteine deB mittleten Rotlieg'enden, r.ielaphyre usw. in Deckenform).<br />
- Die St,eiukohlenfliize liegen (wie ::mgcdeutet) tiefer in den<br />
S a ar b r ü c k e rs chi c h t endes oueren Steinkohlengebirge~.<br />
Die 30 km hreite gralJcnartigc BinsellkUlI;.\· crstrcekt sich Illel'kwlirdigerweise<br />
genau wieder in lIer Richtung SW -NO; die<br />
1) VergI. A.<br />
koblellgebil'ges.<br />
Berlin 1\104.<br />
L'JPI'LA, Geologische Skizze des Saarbrücker Stein<br />
:Fc~tschrift zum IX. allgemeiuen BCl'g'llla.IlU~tllg.
16<br />
richtenden Kräfte der mittleren Karbonzeit haben also bis und<br />
nach dem Schluß der Permzeit gleichartig fortgewirkt, nur<br />
brachten sie statt der Faltung dem gegen 5000 m mächtigen<br />
produktiven Stein kohlen gebirge 1) an der Saal' nur M u I d e n<br />
und Satt e I bi I dun g und kräftige Ein b rü ch e. Letztere,<br />
sowie das Aufsteigen der Eruptivgesteine, erfolgten wohl am<br />
Schluß der Ablagerung der Tholeyer Schichten; sie haben also<br />
das Alter des mit tl e ren Rotliegenden. Bezeichnend ist der<br />
Verlauf des sog. "Saarbrücker Kohlensattels"2) (die<br />
Firstlinien sind in der Karte durch rote Kreuze angedeutet),<br />
welcher nördlich von St. Avold ins Blatt einzieht, um über<br />
Saarbrücken nach Neunkirchen und Altenkirchen zu verlaufen;<br />
es ist im Mittel die Richtung N 51 0 0. Auf derselben Linie<br />
erscheinen auch in der Verlängerung die kuppelförmigenAufwölbungen<br />
der "Ottweiler Schichten" des Bayerischen Kohlengebietes<br />
am Potzberg und Königsberg. Das Kohlengebirge wird,<br />
unter Tag, einige Kilometer südlich von Neunkirchen durch eine<br />
annähernd dem Sattel parallele Verwerfung (dem sog. großen<br />
südlichen Rauptsprung) abgeschnitten (siehe das Profil<br />
am Fuß der Karte), deren Sprunghöhe nach OLIVER bei St. Ingbert<br />
4000 m beträgt. Diese riesige Verwerfung durchschneidet<br />
den Nordflügel des Kohlensattels, deshalb steigen auf der Linie<br />
Saarbrücken-Neunkirchen die Steinkohlenflöze der unteren und<br />
mittleren "Saarbrücker Schichten" unter einem Winkel<br />
von 35 °-40 0 an den Tag herauf. Südlich von dieser Verwerfung<br />
erreicht dagegen der Bohrer nur die flözarmen, 1400 m<br />
mächtigen "Ottweiler Schichten". Auf der Ostseite wird<br />
1) Das Oberkarbon gliedert sich nach den Arbeiten der KgJ.<br />
.Preußischen Landesaufnahme an der Saar von oben nach unten wie<br />
folgt: 0 t t weil er(Breitenbacher-Potzberg)schichten (flözarm) 1400 m;<br />
Obere Saarhrückerschichten (flözal'm) 100 m, im Liegenden<br />
das sog. Holzer Konglomerat; Mittlere Saarhrückerschichten<br />
mit 2 Flammkohlenzügen 1360m; Untere Saarbrückerschichten<br />
mit vielen Fettkohlenzügen 1600 m (soweit bis jetzt erschlossen). Vergl.<br />
auch L. v AN WERVEKE; Erläuterungen zu Blatt Saarbrücken 1 : 200000.<br />
Straßburg 1906, S. 56.<br />
2) Durch die neuesten Untersuchungen ist eine Teilung des Hauptsattels<br />
in zwei "N e ben sät tel" nötig geworden, so wie dies unsere<br />
Karte nunmehr zeichnet. Vergl. L. v AN WE)~WEKE. Erläuterungen zu<br />
Blatt Saarbrücken der geolog. und tekton. Ubersichtskarte von Elsaß<br />
Lothringen, in 1: 200000, Straßburg i. E. 1906, S. 22 und O. M. REIS.<br />
Der Potzberg, seine Stellung im Pfälzer Sattel; in: Bayer. Geogn.<br />
Jahreshefte. XVII. 1904. München 1906, S.93-233.
17<br />
der Sattel durch den "östlichen Hauptsprung" N500W<br />
bei Neunkirchen plötzlich abgeschnitten, so daß auch dort ostwärts<br />
die ertragreichen Flöze tief versenkt erscheinen. Doch hat<br />
am Pot z bel' g' eine neUeI'e Tiefbohrung die "F I a m m k 0 h I e n<br />
g'ruppe" etwa 1000 m unter Tag mit hinreichender Sicherheit<br />
festgestellt. (Vergl. L. VAN WERVEKE. Erl. z. BI. Saarbrücken,<br />
S. 122.)<br />
Nach den Ermittelungen des Oberberghauptmann H. v. DECHEN<br />
finden sich im Ostfelde bei Neunkirchen in den "Saarbrücker<br />
Schichten" 88 bauwürdige }'!öze mit zusammen 92,4 m Kohle;<br />
neben 145 unbauwürdigen Flözen mit 34,5 m Kohle in einer<br />
Gebirgsmächtigkeit von 1604 m. Die größte Mächtigkeit einer<br />
Kohlenbank beträgt 3,9 m. Nur die liegendsten Schichten sind<br />
flöz reich (Fettkohlen und Flammkohlen). (GeoI. und paläont.<br />
Übersicht der Rheinprovinz. Bonn 1884.) - Die preußischen<br />
Gruben des Saarreviers haben von 1816-1903 im ganzen<br />
255 464 508 t Kohlen g'eliefert, von deren Verkauf an die<br />
Staatskasse 509,7 Mill. Mark abgeführt wurden. Vorhanden<br />
sind im Saarbecken bis zu einer Abbautiefe von 1000 m derzeit<br />
noch 3817250000 t verfügbare Kohle: dies reicht nach dem<br />
Ausbringen 1) der letzten Zeit noch auf etwa 270 Jahre. (VergI.<br />
L. VAN WERVEKE, Erläut. zu BI. Saarbrücken. Straßburg 1906,<br />
S. 56.)<br />
Südöstlich vom großen südlichen Hauptsprung liegen nach<br />
dem Ergebnis der neuesten Tiefbohrung bei St. Ingbert<br />
die Kohlenflöze der Saarbrückerschichten in so großer Tiefe,<br />
daß derzeit - auch im Falle der Fündigkeit - eine vorteilhafte<br />
Ausbeute unmöglich erscheint. Das Bohrloch liegt an der Sengscheiderstraße<br />
und wurde 1407 m tief abgestoßen. Es folgen<br />
sich von oben nach unten: Buntsandstein (500 m) durchbohrt<br />
230 m; mittlere Ottweilerschichten 570 m; untere<br />
Ottweilerschichten 607 m bis vor Ort. (L. v. AMMON,<br />
Bayr. Geogn. Jahreshefte. XXI. 1908, S. 195 f.)<br />
1) Das Aus b r i n gen an Steinkohlen ergab im Jahre 1906 in<br />
dem Saar-Nahe-Gebiet 14300225 t im Wert von 163976000 Mark;<br />
wovon auf Preußen 133785000 Mark, auf Lothringen 22502000 Mark<br />
und auf Bayern 7716600 Mark entfielen, (Zeitschrift für prakt. Geologie.<br />
1909, S. 484.)<br />
2
18<br />
3. Der Aufbau im Hügellande an der Glan und Nahe.<br />
Betrachtet man weiterhin das Hügelland des Rotliegenden<br />
1), das sich zwischen Saarwellingen und Kreuznach bis zur<br />
Breite von 35 km ausdehnt, so sieht man nicht nur in der<br />
Längenachse die Varistische Strukturlinie: SW-NO herrschen,<br />
sondern auch die Eruptivgesteine des sog. Grenzlagers<br />
- aufgepreßt in der Zeit zwischen der Ablagerung des mittleren<br />
und oberen Rotliegenden - folgen in ihrer Längenausdehnung<br />
aufs deutlichste der richtenden Kraft des Va r ist i s ehe n<br />
S y s t e m s. Viele Kilometer weit ziehen (in nordöstlicher Richtung')<br />
die Felsenkuppen der Quarzporphyre, Porphyrite<br />
und Me I a p h y I' e in ausgezeichneter Weise orientiert durch das<br />
Hügelland dahin. Die eingepreßten Magmen folgten eben den<br />
Spalten und Bruchlinien der genannten Strukturlinie. Auf dieser<br />
Linie sind auch die merkwürdigen "S chi eh t e n k u p p eIn" des<br />
Potzbergs, des Hermannsbergs und des Königsbergs (die Intrusivmassen<br />
im P f ä 1 zer S at tel) angeordnet. Der Verlauf<br />
1) Das Rotliegende (Perm) gliedert sich, nach den Arbeiten der<br />
beteiligten geologischen Landesanstalten, in der Glan-Nahemulde (von<br />
oben nach unten) wie folgt.<br />
In Preußen:<br />
o b er rot I i e gen des.<br />
Kreuznacherschichten (100 m)<br />
Wadernerschichten (300 m)<br />
Söternerschichten (100 m)<br />
In der Pfalz:<br />
Ob er rot I i e gen des.<br />
Staudenbühlerstufe (100 m)<br />
Winnweilerstufe (150 m)<br />
Hochsteinerstufe 100 m).<br />
Eruptivgesteine des sog. Grenzlagers.<br />
(Quarzporphyre, Melaphyre und Porphyrite.)<br />
Un te rro tliege n de s.<br />
Tholeyerschichten (60 m)<br />
Lebacherschichten (450 m)<br />
Obere KuseJerschichten<br />
(etwa 1000 m)<br />
Untere Kuselerschichten<br />
(130-150 m)<br />
U n t err 0 tli eg e nd e s.<br />
Obere Lebacherschichten (60 m)<br />
Untere Lebacherschichten (50 m)<br />
Hooferstufe (350 m)<br />
AJsenzer Sandsteinstufe (450 m)<br />
Odenbacherstufe (250 m)<br />
Königsborner- oder Börsbornerstufe<br />
(370-750 m).<br />
Die Schichten keUen vielfach aus und transgredieren von unten<br />
nach oben immer mehr gegen NW, so daß sich schließlich Ober~otli<br />
e gen des direkt über dem gefalteten Devonkörper ausbreItet.<br />
(Siehe Fig. 1.)<br />
Vergl. L. VAN WlmVgKE. Erlltuterungen zu Blatt Saarbrücken<br />
1: 200000. Strallburg 1906, S.96 und K. BURCKHARDT. Bayer. Geognostische<br />
Jahreshefte. XVII. Hl04, S.9-19,
- 19<br />
der Flußrinnen der Nah e von den Quellen bis nach Kirn und<br />
der Glan auf der Strecke von Niederalben bis in die Gegend<br />
von Sobernheim folgen ebenfalls genau der gleichen Strukturlinie.<br />
Die heute an der Oberfläche sichtbaren Ver wer fu n g s<br />
li nie n in dem weiten Hügellande des Rotliegenden an Nahe<br />
und Glan verlaufen in der mittleren Richtung N 56 0 0 oder<br />
stehen nahezu senkrecht darauf, wie Kluft und Gegenkluft. Sie<br />
folgen also annähernd der va r ist i s c he n Struktur in Kombination<br />
mit derjenigen, welche nach NW gerichtet ist, und welche<br />
wir nach alter Übung "h erz y n i sc h" nennen. Nur in zwei<br />
Fällen macht sich auch hier schon das "alpine" System geltend,<br />
welches Bruchlinien hervorgebracht hat, die von West nach Ost<br />
verlaufen; wenn man nicht diese Sprünge als Komponenten der<br />
heiden erstgenannten Systeme ansehen will.<br />
4. Der Dau der Pfälzer Mulde und des Lothringer<br />
Stnfenlandes.<br />
Im Aufbau der großartigen, aber flachen Lot h r i n ger<br />
Qder P fälz e l' ~ful d e (S a ar gern ü n d - Pfälz is ch e n<br />
M u 1 d e) zeigt sich wiederum sehr schön die varistische<br />
Strnkturlinie SW -NO als Beherrscherin der Schichtenstellung,<br />
Qbgleich dieses Tafelland aus Trias- und Juraschichten gebildet<br />
ist. Den ausgezeichneten Arbeiten der preußischen, reichsländischen<br />
und bayerischen Landesgeologen 1) verdanken wir<br />
die gen aue Kenntnis des Zusammenhangs. Die Muldenlinie<br />
(in der Karte durch eine blau gestrichelte Linie angedeutet)<br />
hält die Richtung ein N 56 0 0 und fällt etwa zusammen mit<br />
der Linie Nancy-Saargemünd-Hochspeyer. Nur ganz<br />
sachte - mit 1 °-3 0 heben sich die beiden Muldenflügel gegen<br />
SO und NW empor bis hinaus an den Rand der Hardt und<br />
an die Erosionsgrenze auf den älteren karbonischen und permischen<br />
Schichten des Nordwestens. Diese riesige flache Mulde<br />
besteht aus eiuer etwa 550 m mächtigen Schichten folge des<br />
Buntsandsteins, auf welche sich gegen Südwesten hin der<br />
Muschelkalk (210 m mächtig) aufgelagert hat und weiterhin<br />
1) E. WEISS, A. LEl'PI,A, L. VAN WERVEKE, E. SCHUMACIIER,<br />
lj:. TnüHAcH, L. VON AMMON, O. REIS u. a. - Insbesondere A. LEl'l'LA,<br />
lTbcr den Bau der pfälzischen Nordvogesen und des triadischen Westrichs.<br />
Jahrb. Kgl. Preuß. geol. L.-A. für 1892. Berlin 1893.<br />
2*
- 20 -<br />
gegen SW der Lothringer Keuper (230 m mächtig) obenauf<br />
liegt. Die ~Iulde umschließt reiche Salzlager 1). Unser Profil<br />
schneidet die .,Pfälzer Muldenlinie" im Großen Kahlenberg<br />
(396 m) nordöstlich von Sam'gemünd; dieselbe neigt sich nach<br />
LEPPLA im Mittel 0 0 40' ge gen SW, also gegen das Pariser<br />
Senkungsfeld hin. Dies bewirkt, wie schon berührt, daß auf<br />
der Karte, gegen Südwesten hin, immer jüngere - von der<br />
Abtragung übrig gelassene - Formationsterrassen erscheinen,<br />
so bei Großtännchen: Rhät und uuterer Lias. - Beide<br />
Mnldenfiügel sind von zahlreichen Störungen durchsetzt.<br />
Diese Bruchlinien verlaufen teils annähernd parallel der genannten<br />
1Iuldenlinie (varistisch), teils annähernd senkrecht<br />
darauf (herzynisch). Sehr klar zeigt sich die varistische (oder<br />
NO) Strukturlinie am Einbruch der Nordvogesen bei Niederbronn<br />
im Verlauf der großen Rheintalspalte. Bei Weißenburg<br />
dagegen biegt dieser Bruchrand allmählich um, so daß<br />
bei Dürkheim a. d. Hardt die alpine Süd-Nordrichtung ausgeprägt<br />
ist. (Vergl. die Karte und das Gebirgsprofil am unteren<br />
Rande derselben.)<br />
5. Ban der Vogesen (des Wasgenwaldes).<br />
Auch in den Süd v 0 g e sen 2) findet sich die varistische<br />
Strukturlinie SW-NO; liegt doch gerade hier das varistische<br />
Grundgebirge offen am Tage. Dasselbe ist aufgebaut aus<br />
1) Auf dieses Vorkommen gründen sich große chemische Industrien<br />
und die Salinen bei S aar alb e n und Die uze. Das Profil der Trias<br />
ist nach der neuesten Tiefbohrung in Dieuze (etwa 210 m ü. d. 1\1.)<br />
folgendes: K e u per: Schilfsandstein un d Gipsmergel 244 m; Lettenkohlenformation<br />
34 m; - Oberer Muschelkalk 64 m; Mittlerer Muschelkalk<br />
105 m; Unterer Muschelkalk 43 m; (also Mus c hel kai k im<br />
ganzen 212 m). - Oberer B u nt san d s t ein 77 m; Mittlerer Bunt<br />
Randstein bis vor Ort 80 m. Ganze Teufe 647 m. - Die Salzlager<br />
von Saaralben setzen nnter Dieuze fort. In den Gipsmergeln des<br />
Keupers fanden sich 70 m Salz in 19 Lagern; in der Anhydritgruppe<br />
des Muschelkalks ferner 6 Salzlager mit 16 m totaler Mächtigkeit. -<br />
(L. VAN WINBUSCH, P. GRO'l'H,<br />
E. Co liEN 11. a.; sowie den trefflichen "Geologischen Führer dnrch<br />
daR EIsl~ß" von E. W. BENJ.]CKE, H. BÜCKING, E. SCHUM~CHER und<br />
L. VAN W~jRVElm. Berlin 1900. - Ferner: W. BIWIINS, Uber Granit<br />
und Gneis in den Vogesen. Mitt. d. philomath. Ges. in Straßbnrg ..<br />
1800. Bd. II. 8. 13~ ff.
21<br />
GI\{'i8Cll, Graniten lind Gesteinen des {Tlltcl'karbons<br />
(Kulm). In letzterem hensehen Schiefer, Gl'lUtwacken, Konglollwrate<br />
IllHl zahll'cicllC Decken alter El'upti~'gesteine (branne<br />
lind grane Porphyre, Labratlorpol'phyre, (]lw.rzfl'eie Porphyre und<br />
Qn:lI'ZllOrphYl'e). .Mit wenigen Ausnahmen zeigen die Schichteu<br />
;; te i I e A 11 f r ich t un g in einem umlaufenden Bau. Diese<br />
Sdlichtenstelluug if;t kill!" ersichtlich ans dem nachstellenden Profil.<br />
Fig. 2.<br />
Pl'oftl durch eInen Teil der siidlichell Yogeaen.<br />
(Vierfach überhöht; Schnittebene von S\V nach NO.)<br />
(Xa1)h L. VAX \VERVEKE, Begleitworte zur Höhenschichtenkarte von<br />
Eh:>f:i-Lothringen, 1906, S. 26 und Geol. .Führer durch das Elsaß, S. 307.)<br />
GII' = Grauwacke; S + Gw = Schiefer und Grauwacke; S = Schiefer;<br />
cm = contactwetaworph; Cp = Konglomerate mit Geröllen von Eruptivg&
22<br />
Silberbergwerk S y I v es tel' bei Urbeis im obersten Weiler Tal<br />
im Betrieb (38 Bergleute). Der Haupterzgang streicht fast ostwestlich<br />
(N 83 0 0) und fällt unter 700 bis 75 0 nach Süden.<br />
Er setzt im W eil e r sc h i e fe r auf, nahe der Grenzzone gegen<br />
den Gneis von Urbeis. - Das Dreieck Saal e s - U rma tt-A nd lau<br />
umschließt das besonders mannigfaltige G l' an i t m ass i v des<br />
Hoc hf eid es. Daran reihen sich im Süden alte paläozoische<br />
Schiefer des Weiler Tales an, die glänzenden Steigerschiefer<br />
und W eil e r sc h i e fe r, welche dem Silur zugeschrieben werden<br />
und an die ältesten Vogesengesteine, die Ur bei seI' G n eis e<br />
anstoßen. -~ Nördlich von der Brensch kann man D e von<br />
studieren (Gesteine des rheinischen Schiefergebirges) und darüber<br />
breiten sich die Schichten und Porphyrdecken des Rotliegen den,<br />
für welche die sagenreiche Burg Nie d eck berühmt geworden<br />
ist. - Über der Abrasionsfläche des Grundgebirgs aber erhebt<br />
sich die prachtvolle Steilwand des B u n t san d s t ein s (die Südstirne<br />
der Nordvog'esen), der von hier an nordwärts ausnahmslos<br />
den Wasgenwald bildet. Auf dieser Steilwand erhebt sich kühn<br />
und formenschön der Götterberg Don 0 n, der das ganze Gebirge<br />
beherrscht. - Ein merkwürdiges Vorkommen im Granitmassiv<br />
des Hoch waldes sind die einst sehr berühmten Eis e n erz lag e 1'<br />
S t ä t te n von Rothau und Framont im Breuschtal. Die Eisenglanz-Magnetitgänge<br />
setzen bei Rothau durchweg im Granit auf;<br />
sie streichen N 50 0 0 im Mittel. Der Eisenbergbau ist eingegangen,<br />
einst aber zogen die Arsenale das Rothauer Eisen allen anderen<br />
Marken vor. Die Augen dei' Mineralogen ruhten seinerzeit mit<br />
besonderem Wohlgefallen auf diesen Gruben, weil sie eine Menge<br />
der seltensten Mi n e r a 1 i e n in die Kabinette der ganzen Welt<br />
lieferten.<br />
Der große "Vogesensattel" (rote Kreuze der Karte)<br />
zieht von Luxeuil aus (südlich von Gerardmer) hinüber zur Hohkönigsbl1rg,<br />
um weiterhin - jenseits des Rheintalgrabens im<br />
Schwarzwald - nach der Hornisgrinde und an Wildbad vorüber<br />
bis nach Liebenzell vorzudringen. Er hält in den Hochvogesen<br />
die Richtung N 56 0 0 ein und schneidet das Rheintal schräg<br />
anf der Linie Benfeld-Appenweier. Die SC'hichtenstellung in<br />
diesem mittleren 'l'eile der V ogesen ist aus dem nachstehenden<br />
Gebirgsprofil zu crsehen. Sehr schUn hebt sich hier der Gegensatz<br />
zwischen dem Urnndgebirge und dem abweichend gelagerten<br />
BuntsamlHtein heraus.
23<br />
Fig. 3. Proßl durch einen TeU der mittleren Yogescu.<br />
(Vierfach überhöht; Schnittebene VOll SW nach NO.)<br />
(Xach L. \').X WBRYEKE, Begleitworte zur Höhenschichtenkarte von<br />
Elsaß-Lothringen, 1906, S. 25 und Geol. Füluer durch dns Eleaß, S. 319.)<br />
Gn = Gneis; Kgr. = Kammgranit ; G1gr = Gl8.llhüttengranit (Randaus.<br />
bild\lng des Kammgranits); Brgr = Bressoirgranit; Bigr = Bilsteingra.nit<br />
mit scbiefrigen Salbändern (Sa); Ggr = Ganggranit ; ro = Oberrot·<br />
liegelides ; sm '"" :Mittlerer Buntsandstein; h = Hauptkonglomerat des<br />
mittleren Buntsandsteins j St = Störung.<br />
VOll Belfol1 his nach Thanll verläuft die stldliche Abbruch<br />
I j 1\ i e det' Vogesen in det' gleichen SW-NO-RichtUllg genaner<br />
~ 50 ~ 0; während der Rheintnlbruch gegen Gebweller zu umbiegt<br />
nnd auf der Strecke Rufach-Ksyael'sberg ganz meridional (a.lpin)<br />
gerichtet ist. Der NordflUgel des Vogesenssttela reicht bis zur<br />
Linie Epinal- Raon-I'Etappe-Schneeberg, welche dem Sattel parallel<br />
verHillft IlJId als Erosionsgl'enze zwischen Bun1aandstein und<br />
Grundgebirge Beachtung verdient, a.uch die Hocllvogeaen gegen<br />
Nonhre8t :Im t1lglichsten nbgl'enzt. Diese Linie war frllher als<br />
durchlaufendo V erw er fu 11 g von den französischen Forschel'1l<br />
itllfgefaßt worden, und demgemäß erklärte SUESS die Vogesell<br />
als einen "Horst u • Das kann llieht aufrechterlJalten werden, die<br />
T1oehvogC
- 24 -<br />
ältesten Sedimente der kristallinell Vogesen sind "G n eis e".<br />
Ihr Auftreten beschränkt sich auf die Gebiete westlieh und östlich<br />
von dem Granitzug, der den "Col du Bonhomme und die "St. Didlel'<br />
höhe" trägt. Die Streichrichtungder enggestelltenFalten istvaristisch<br />
(SW-NO), das Einfallen meist steil gegen Nordwest. - In diese<br />
Sedimente drangen die G r an i te ein, welche zu verschiedenen<br />
Zeiten aufgepreßt wurden (Welscher Belchen 1245 m). Die Längserstreckung<br />
der "Massive des Kammgranits" folgt gehorsam<br />
annähernd der val' ist i s c h e n S t l' U k t u I' 1 i nie,<br />
wie der St. Didlerzug' schön zeigt. Der Kammgranit wirkte<br />
verändernd auf die Grauwacken des Kulm (Unterkarbon), er ist<br />
also jünger als diese. Dagegen ist das "Oberkarbon" nicht<br />
gefaltet und liegt übergreifend auf den Falten der Sedimente und<br />
über den gequetschten Graniten. Die s e G r an i t e sind also vom<br />
Alter des mittleren Karbon. Dagegen sind die Zweiglimmergranite<br />
des Bressoir (1146m) jünger; ihr Massiv<br />
streckt sich von West nach Ost; bezeichnet also wohl eine älteste<br />
Vorbereitung der alpinen Faltung. - Das ° b er kar bon lagert<br />
in den Vogesen ziemlich horizontal. Es sind aber nur spärliche<br />
Reste der Abwaschung entgangen; doch fand bei St. Pilt, Hury,<br />
Laach, Erlenbach und Rodem Abbau von brauchbaren Steinkohlen<br />
statt. - Das Rotliegende der Vogesen setzt mit seinen<br />
älteren Schichten (bei Trienbach 300 m) die Ausfüllung der<br />
Mulden im alten Faltengebirge fort; ebnet also dasselbe ein und<br />
schafft eine "A b ras ion s fl ä c h e", doch so, daß die die Mulden<br />
trennenden Rücken meist noch unbedeckt bleiben. So wurde die<br />
Senke des W eil e I' Tal e s durch mächtiges Rotliegendes vollständig<br />
ausgefiillt. Erst das ,,0 b e 1'1' 0 tl i e gen d e" griff weiter<br />
über, hat daher eine viel größere Verbreitung (Breuschtal). -<br />
Wie im Schwarzwald brachen auch in den Vogesen zur Zeit des<br />
mittleren Rotliegenden gewaltige Massen von Qua r z pol' P h Y I'<br />
an den Tag; sie sind erhalten geblieben z. B. in dem malerischen<br />
Felsenkranze der Ruine Niedeck. - Der Z e c h s t ein fehlt vollständig<br />
im Gebiet des Wasgenwaldes. Dagegen wurde der B u n t<br />
san d s t ein in einer 25-500 m mächtigen Schichten reihe abgelagert.<br />
Die Mächtigkeit der Buntsandsteinahlagerungen schwankt<br />
also in den Vogesen, wie im Schwarzwald, sehr stark. Die<br />
Forts. v. S. 23.<br />
sind, wie die Fa I tun g der Alp e n und des .Jura. (L. VAN W~~RVEKE,<br />
neol. ZentraliJlatt. Bd. VIII. 1906. S. 671.)
26<br />
La g(' l' 1111 ~s \' C I' h Hit n i Si! e im Gehiet der KonhQgeseu wel'~le\1<br />
gilt angedeutet dnl'
26<br />
weiler 16 m; bei Saarreinsburg 4, m. - Die Ha r d t zeigt aber<br />
wieder ganz andere Verhältnisse. Der B u nt san d s te i n bildet<br />
in den "Nordvogesen" weithin das Deckgebirge, d. h. die wichtige<br />
"Mulde von Pfalzburg" (N 56° 0), welcher die bekannte große<br />
Viilkerstraße nach Zabern folgt. Südwärts von der Linie Donon<br />
Schneeberg hat aber die lange Erdperioden hindurch wirksame<br />
Abtragung nur geringe Reste des Buntsandsteins auf den Hochflächen<br />
übriggelassen. Diese Reste bilden öfters spitze, hochragende<br />
Kuppen; so die weitschauende Frankenburg, die stolze Hohkönigsburg,<br />
den Königstuhl und Tännchel (siehe Fig.3), sowie den<br />
Ung'ersberg, Climont, Donon u. a. - Sowohl in den Vogesen als<br />
in der Rardt lagert der Buntsandstein "diskordant" (ungleichförmig)<br />
auf dem älteren Gebirge. Gegen Westen beginnt er mit<br />
den Konglomeraten des Eckschen Geröllniveaus und weiterhin<br />
sogar mit dem Hauptkonglomerat ; es feh 1 e n als 0 dort der<br />
untere und teilweise der mittlere Buntsandstein<br />
v ö 11 i g, während sie im Osten gut ausgebildet sind. Das Buntsandsteinmeer<br />
(oder die Wüste) ist also in der Weise gegen NW<br />
vorgedrungen, daß bei St. lngbert und Neunkirchen der obere<br />
Buntsandstein direkt auf Karbon lagert.<br />
6. Bau der Hardt (des Pfälzerwaldes).<br />
Die Tektonik der Hardt ist beherrscht von der Zugehörigkeit<br />
zu der "P f ä 1 zer M u 1 d e" (Muldenlinie Saargemünd<br />
Altleiningen; varistisch N 56 (\ 0), welche erst in der Tertiärzeit<br />
die heutige Gestalt erhalten hat. Bei dieser Gelegenheit hat<br />
auch - allerdings nur an einem Punkte - tertiäres Eruptivgestein,<br />
sog. Limburgit, den Schichtenmantel der Hardt durchbrochen.<br />
Am Pe c h s t ein k 0 p f südlich von Dürkheim stehen in hohen<br />
Säulen ausgebildete, von Tuffen umhüllte Ba s alt f eis e n (ß)<br />
mitten zwischen Buntsandstein am Tag. Der Buntsandstein 1)<br />
1) Die Gliederung dieser Formation in der Hardt siehe bei<br />
H. THÜltAmr. Bericht~. des Oberrhein. geol. Vereins. 27. Versanllnl. zu<br />
Landau. 1894. S. 32. Uber den geologischen Aufbau des H.ardtgebirges.<br />
- Die Tektonik ist eingehend geschildert: A. LEPPI,A. Über den Bau<br />
der pfälzischen Nordvogesen und des triadischen Westrichs. Jahrb.<br />
der k. preuß. Landesanstalt für 1892. Berlin 1893. S. 23 - 90. Ferner:<br />
A. LlcI'I'LA. (rhor das Grundgebirge der pfälzischen Nordvogesen<br />
(Hftrdtgebirge). Zeitschrift der deutsch. geol. Ges. Bd. XLIV. 1892.<br />
S. 40ü f. (Gneis VOll Alber~weiler.) - Ferner: C. W. v. GÜMBI
27<br />
bildet eine mächtige Tafel und tlamit den Hauptboden fill' das<br />
(11("ht bewaldete Berglnntl, den "P fit I zer wal d". Durch die Tätigkeit<br />
des tlit'llendell Wassers wurde nuer diese Hnntsandsteillplattc<br />
reie]l gegliedert llJl(l vielfach entstandm reizvoll geformte, spitze<br />
lügelberge (Madellul\l'g, Trifels, Kalmit, Rehberg n. H. ). Gegen<br />
Ü"t('1l bl'kht die Pl:ltte in m e r i d ion a I gericllteten Staffeln ab<br />
(nm i"J50 m bis 200 III N.X.), wie das nachstehende Pro:fil fUr<br />
die Gpgend YOIl Lalldun zei/:,>1:. (Ebenso Fig. ! fitr die Gegend<br />
\'011 Zabern.)<br />
,.~<br />
,<br />
Fig.5. Schematisches Proftl durch den Hardtgebirgsrand lind die<br />
Yorbergzone (südlich von Albersweiler). (Ost links.)<br />
(Xach C, BOTZONG, Bel'. über die Vers. des Oberrheinischen geol. Vereins<br />
7.U Bad Dürkhcim, 1910, S.63.)<br />
g: = gnei~artiger Granit; or', or " "" OherrotliegeJldes; z = Zechstein;<br />
nbs = Unterer Buntsandatein; Tr = Trifelsschiehten mit (E) ECKsehem<br />
Gertillhorizont; ba = abgestürzte Buntsandstein- und llusehelkalkseholle;<br />
ug = unterer Gipskeuperj S = ScllilIsanclsteinj r = Rhiltj li = Lias;<br />
ml = mitteloligozäne Kilstenkonglomeratej 01 = Cyrenenmergel; cl',<br />
d ' und d l = diluviale Schotter und Sande: Is = Löß und Lehm;<br />
v '-' VCl'werfungsspalten.<br />
Die hiiehste F:rhebung ist die Kuppe der "Gl'OASen Kal <br />
mit" 11 ci Neustadt a, 41. 11. (683 m), welehe vom Hall p tk 0 n g 10-<br />
me rat deR Buntsandsteins gebildet wil'll. An dem steilen Ost<br />
),[llule tilHlet man einen G5 km langen Zug hober Berge, ausgehend<br />
von Wiirth im gJSIl/.\, z. B.; II 0 h c n b e rg (5:12 lll), Re 11 b c r g<br />
(mG 111) IllHlllic "Ilohe Weinbiet" bei Nenstadt lt. (]. H.<br />
(tlo4 111; lI au)ltkong]mllcrat). Im Innem des Gebirgs nimmt dei'<br />
Fort.". Y. I;;. 2(;.<br />
'10:'·, A. 1.1
_I';sdlk'lpr- (610 m) eine oehClTsdleude Lage ein. Er sendet<br />
nm 81'ill(.) 111 ureiten Hik ken n:lch all(!n tieiten Wasserrinnen ius<br />
I.alld hiuau. Die Weslgffillze des Gebiets bildet wie oei Jeo<br />
'- (l~,.estlt Ilie Grenze zwi!ld len B \lLlt~audstein lIud Muscllel kalk ;<br />
mit letzterem begiunt tler ., n- e 8 tri c h". Im Siiden legt man<br />
Heul:Il'dings tlie Grenze an den Pal) \'011 Zabern.<br />
Oe\' iistliche Hand der Hartlt zeigt !In mehreren Stellen tiefe<br />
QlIcrtillt,l', welclle in das Bergland einiIchneiden und bis in das<br />
Grll1Idgebil'ge nieo ergehell. So hcs()nderg bei Weißen\)ul'g, Klingcllmlln,.te'·.<br />
Alucl'sweiler \Ind KeulIbdt :1.. H. Dort zeigen sich noc!,<br />
:llte 1' :11 ;l o1.o i 8c ll e S e ll i e fer und G I' I\ Il Waeke ll , G u e ise<br />
lind G r a 11 i t e. Yiel hesncht werden illl~ be80ndere die scbönen<br />
Allf~ hli lil8e \'on Albersweilt'l', d(ll'en spezielle V e rhliltni~e .Iie<br />
1\:\chstehel\(le l-'i[lll' 6 zeigt.<br />
Fil,l'. 6,<br />
.Al/.>.. ... "',,".<br />
~ I<br />
SCIUml8.tiscIHll! Profil des Grundgebirges bei Alberl!welll'l'<br />
( Sch!li~t von SUd pach Ko rd).<br />
Mit, Benützllng "on A . LEI'I'I,M Profilen gezeicbnet VOD C . ßcrrz"x\;.<br />
(Rer. lies Oberrliein. gcol. Vereills. 43. Vers. 1910. S. CL)<br />
G = g n ci8:utig~ r GflInit mit bmpropbyriseheo Gängen ; Me = qU Il I7.<br />
ftlh rcnder Melaphyr ; TO "" Rottiegcndes; d· = Diluvium.<br />
,<br />
. ~,.<br />
Jlie ill tt! re~sllllten geologischen VcrJlältnisse der H:mlt 1I1l (1<br />
ilm:r weim'cie.hcn YOl'berge 8illll weiteren Kreisen bekannt ge<br />
\\'(>]'(lcII \ln"c]J die 43. Veuammlung aeg Oberrheini8chen geol.<br />
Vr.l'(lin>l zu Bil,1 J) ii rkh ci m im J\Hlrz 1910. Vergl die BerirlJtc<br />
ilhcl' litt, in (]je U lI1geLuug :1.lIsg'efullrwn lo~x kursioncn Hm 0, M. H1WI<br />
( ;"IIU .. dl1'lI) , H . fl ÄU ERI,F. (lI ('ideluerg), A. S TKUI.:R (Jln.rlllst:ldt)<br />
1111tl U. lIono"u ( llcide.llll'rg). (K:,rlsl'l1l1e 1910. 11. S. 13-ßö.)<br />
l .i\,81· AII:d lll~I" mhrtmJ lIie!Jl ll llr ill ,1111 ('rllluI;.."Cbirgc- \'011 Albcl'!l<br />
\\'('il('l' 1I1Id ill die IbIll1 ~ t'ILHlkll tlcl' lIartlt, ~0I11 1 en l IlIIch in 11:\)1<br />
'I'('diär deri llaiuz(lr Bt'l'k('n ~ lIud ,I ().~ llartltl'llllucs.<br />
"'111' Ilie 1'f:J ! ~ g-:lht'l1 ~wci ~dll'ift(ln von lJr. n. ]lÄll.EltL Y.<br />
tKni~ . 1 :(~I', li11Il11g'~l'at i11 IIei(iI'lh i\l'~): " I) C l' I' fä I ~ C I' will d",<br />
Ih:lIlll ~ dlw e i;.: , WI'~!i'I'Jll:mll, 1H!:1 IIw\ .,n i t1 11 a t ii r I j c h (1 11<br />
1.: I JI,I ~ I· \I : l f t l '!I dt'r H h ('illpfal~~. 1\ :ti~l'r~ lanterll, J!11 3V{)J'o
29<br />
anlassung, den Namen .,Pfä 1 zer wal d" in die Karte einzutragen<br />
für die westlichen "\Valdgebiete der Hardt.<br />
Das Blatt K n seI der geognostischen Karte des Königreichs<br />
Bayern in 1 : 100000 ist erschienen. Damit sind von den vier<br />
Blättern der Rh ein p fa 1 z drei fertiggestellt : Speyer, Zweibrücken<br />
und Kusel. Die reichhaltigen Erläuterungen zu Blatt<br />
Kusel sind von L. VON AMMON, O. M. REIS, M. SCHUSTER und<br />
W. KOEHNE bearbeitet worden (186 S.).<br />
7. Der Bau des Rheinta1grabens.<br />
(Vergl. das Gebirgsprofil der Karte und die Fig.4, 5, 7, 8 und 9 im Text.)<br />
Der Rh ein tal g r a ben des Mittelrheintales ist zu beiden<br />
Seiten von kräftigen Ver wer fun g s p alt e n begrenzt. Die<br />
Sprung'höhe derselben beträgt narh STEINMANN bei Freiburg i. Br.<br />
bis zu 1800 m und wird noch bei Landau auf über 1200 m angegeben.<br />
Um diese Beträge sind also die auflagernden Sedimente<br />
- im Graben - in die Tiefe versunken 1), während sie an<br />
den Bruchrändern der Halbhorste : Vogesen, Schwarzwald, Odenwald<br />
und Hardt noch hochliegen. Der Gedanke, dieses riesenhafte<br />
Senkungsfeld als eine einheitliche N 20 0 0 streichende versunkene<br />
Platte aufzufassen, kann bei näherer Untersnchung nicht<br />
festgehalten werden. Die einzelnen Strecken zeigen verschiedenen<br />
Ban und sind als eine Kombination von einander durchdringenden<br />
Au fw ö 1 b u n gen und Zu s am m e nb r ü ehe n anzusehen, welche<br />
teils dem NO verlaufenden varistischen System, teils dem no rdw<br />
ä r t s drängenden alpinen System angehören. - Etwas näher<br />
kommt man wohl den rratsachen, wenn das Rheintal von Basel<br />
bill Mainz in drei Teilstrecken zerlegt wird.<br />
1) Der große Einbruch des Rheintales muß erfolgt sein in der<br />
Tertiärzeit, und zwar genauer im 0 be ren E 0 z ä n und in der 0 ligozän-Periode.<br />
Von Süden und Norden ist damals das Meer in<br />
diese tiefe Spalte eingedrungen und hat den Graben mit seinen Ablagerungen<br />
erfüllt. Die Brandung hat von den Seiten große Schuttmassen<br />
aus Jura- und Triasgesteinen aufgehäuft, nämlich die<br />
" K 0 n gl 0 m er at e ", die wir am Rande von Schwarzwald und<br />
Vogesen als einen ununterbrochenen Zug beobachten. - Es macht<br />
den Eindruck, als wenn diese in der älteren Tertiärzeit beginnende<br />
" G ra ben b i 1 dun g " dadurch schärfer ausgeprägt wäre, daß in<br />
der jüngeren Tertiärzeit und im Diluvium die heiden Ränder<br />
langsam hochstiegen, während die Mitte entsprechend einsank. -<br />
(Vergl. W. DEEUKF. in: Das Großherzogtum Baden. Band I. Karlsruhe<br />
1912, S. 25.)
- 30 -<br />
1. Basel-Altbreisach N 01) 0; Alpines System, mit der<br />
meridional gerichteten Schwarzwaldspalte St. Chrischona-Kandern.<br />
Das hohe Granitmassiv des Blauen überragt hier machtvoll<br />
das triadische Senkungsfeld des D i n k e I b erg s und das<br />
jurassische Sc h 0 II e n I a n d, das sich - steil aufgerichtet - im<br />
Büden von Müllheim an diese Hauptvel"Werfung anlehnt.<br />
11. Al t br ei s ach-Ge rm er s h ei m N 42 () O. Varistisches<br />
System mit den varistischen Randspalten Lahr-Bruchsal und<br />
Ingweiler-Niederbronn, aber auch durchkreuzt von den Richtungskräften<br />
des alpinen Systems. - Wichtig ist hier der Erdbebenherd<br />
von Kandel in der Rheinpfalz. Er liegt in der Verlängerung<br />
der Schurwaldspalte und der Filderspalten und wirkt<br />
manchmal bis tief ins Herz Schwabens hinein. Bei dem Beben<br />
vom 22. März 1903 zeigte sich eine "Herdlinie", welche das<br />
Rheintal quert, etwa in der Richtung N 66 0 W, d. h. Grötzingen<br />
Kandel-Kling"enmünster. (H. LEUTZ, Die süddeutschen Erdbeben<br />
im Frühjahr 1903. Verh. des naturw. Vereins in Karlsruhe,<br />
18. Bd. Karlsruhe 1905.) - Diesen 'feil des Rheintalgrabens<br />
zeichnen die großen "B r u c h fe I der" von Zabern und<br />
von Lahr aus. Die Ein b r u c h s c ho II e n bei L a h r sind<br />
dem Schwarzwald vorgelagert und aus Buntsandstein und<br />
unterem Muschelkalk aufgebaut.. Sie haben sich bei Erdbeben<br />
wiederholt als ein selbständiges Schüttergebiet erwiesen.<br />
Das riesenhafte Z ab ern erB ru eh fe I d zeigt eine weitg"ehende<br />
Zerstücklung der Schollen und - den Vogesen gegenüberein<br />
sehr ye r s chi e den ti e fes Ab si t zen derselben in parallelepipedischen<br />
und keilförmig'en Schichtenpaketen, so daß die Oberfläche<br />
von den verschiedensten Horizonten der 'J'rias und des<br />
Jura gebildet wird. Merkwürdigerweise ist dadurch der geologisch<br />
tiefste Punkt (0 b er e 0 z ä ne Kalke am Bastberg bei Buchsweiler)<br />
der orographisch höchste geworden.<br />
IH. Germersheim-Mainz NooO; Alpines System mit<br />
den meridionalen Randspalten Heidelberg-Darmstadt und Dürkheim-GrÜnstadt.<br />
Hier fehlen vorgelagerte Einbruchschollen fast<br />
ganz, nur bei Albersweiler und Grünstadt finden sich noch<br />
schmale Streifen VOll Muschelkalk, Keuper, unterem und mittlerem<br />
Lias. Sie legen sich enge an den Gebirgsfuß der Hardt an und<br />
sind statt'elförmig' gegen die Tiefe abgesunken. (Vergl. Fig. 5.)<br />
Auch Hiidlich von Weinhcim findet man eine kleine Scholle von<br />
Buntsandstein dcm krystallincn Odenwald vorgelagert. Die große
- 31<br />
KraichgauerSenke mit der "Juraversenkung bei Langenbr<br />
U c k e n" breitet sich dagegen nur im Osten der Rheiutalspalte<br />
aus.<br />
m I Kalktertiär, ) Corbiculakalke,2)<br />
Farbe von m 5 , Cerithienkalke 2) }<br />
(siehe Karte).<br />
_---~Meeressande<br />
o I und<br />
Farbe von ozLettentertiär<br />
(siehe Karte).<br />
Cyrenenmergel.<br />
Rupelton<br />
(Septarienton),<br />
Meeressande<br />
(Ktistenkonglomerate)<br />
Die tel' t i ä I' e Au ffti II u n g des Rheintalgrabens ist keineswegs<br />
eine gleichartige, sondern nach Alter, Material, Mächtigkeit<br />
und Lagerung (von Süd nach Nord) recht mannigfaltigem Wechsel<br />
unterworfen. Gerade dies nördliche Gebiet im Rh ein tal e -<br />
n Ö rdl i ch von Weiß e n b ur g und im MaiIlzer Bet'ken -<br />
ist im Tertiär so eigenartig ausgebildet, daß die Signaturen der<br />
Legende (am rechtsseitigen Rand der Karte) hier nicht ausreichen.<br />
Wir geben daher - nach A. STEUER 1), D. HÄBERLE und<br />
W. BUCHER 2) - (als eine Ergänzung' der Kartenlegende) noch<br />
folgende weitere Zeichen und Erläuterungen:<br />
I m H I Pli 0 z ä n e Kiese, Sande und Tone.<br />
I<br />
5-20 m.<br />
F b (Dinotheriensande von Eppelsheim.)<br />
ar e vonm"<br />
(siehe Karte). , Hydrobien-<br />
Untermiozän,<br />
I .<br />
J schichten,2)<br />
Oberoligozän<br />
MitteIoligozän<br />
, ~<br />
~§<br />
I<br />
l s<br />
(~<br />
I ~<br />
, 0<br />
Als Unterlage des 'rerWirs in Rheinhessen und in der Mainniederung<br />
findet sich immer das Rot I i e gen d e (Perm) mit den<br />
Melaphyrdecken, welche die Grenzlager zwischen unterem und<br />
oberem Rotliegenden bilden. Der Aufbau des Tertiärs von den<br />
Me e res san den im Liegenden aufwärts bis zu den H y d r 0 bi e n<br />
kaI k e n lind den pliozänen Dinotheriensanden, Kiesen und Tonen<br />
zeigt die nachstehende Profilskizze.<br />
1) Berichte des Oberrhein. geol. Vereins, 37. Offcnbach a. M. 1904.<br />
S. 10-14.<br />
. . 2) Vergl. ~. ·BuCHl
32<br />
Cerithiel!-ko.lk<br />
R:-!peltoll<br />
''-,:",., I,,,,<br />
Fig'.7.<br />
Entwicklnng des TCl1Uirs im iIIaim:er Recken.<br />
(Xiirdlich VOll W eiß e n bu r g und um HaJ.·dtrande.)<br />
(X,leh A. STlo:mm, Ber. deR Oberrheillischen geol. Vereins.<br />
zn Offellbach. 1904. S. 12.)<br />
37. Vers.<br />
o = 1Ieeressand und Letten t ertiitr: Mitteloligozällj lll = Kalk.<br />
tc r t i ä r: Obcroligozän und 'Untermiozän ; lll" = Pliozän; L~ß = Diluvial.<br />
Die tiefste Schiehte im 'l'ertHir (11'8 ~lainzer Beckens bildet<br />
der ~reel'es;;an(l, der nilmentlich in der Gegend von Alzey<br />
Ilnd Wil.ldhrii('kelheim gilt stndiert werden kann, Er liegt hl den<br />
Spalten Imd Tuschen des Hotliegenden, bald grob k Oll g 10 rn e·<br />
ratisch IllH1 nnr wenige ~Ieter mächtig', bald fcinsandig oder<br />
zn 8audstein verkittet, his zu 30 oder 40 m Dicke ansehwelleJld.<br />
Er i~t seIn' reieh an rncm-ischell Vcrsteillerllngen (.Allsternhiinke)<br />
«( lstren. eaLlifera Sum.). Auf Iiell ~reeressan(l folgt ein blaugrauer<br />
ziiher ~Icr;;el mit l\alkknollen (Septarien) von 100-120 m<br />
:\Ull'hti;;:keit, der Hlljleltoll, Seine FmuUI. ist rein marin,<br />
h'itend ist Le(la l1eshnycsi Duell. - Der Rllpelton geht nach<br />
olwlI ill eille Ill"1l('kwa~serbi\(lull;;: Uber, in den Cyrenenlllel'gel.<br />
1
- 33<br />
silHl grane Hydrobieulllergel nachgewiesen. - Weit vom<br />
Gebirgsrande entfCl1lt erhebt sich nönllich von Lauterburg die<br />
aus IIl1termiozänem Corbieula-LitorinellenknJk bestehende merkwiirdige<br />
Kuppe des B Ii ehe I b erg s. Hier erreicht der Kalk in<br />
tli{'ken BiinkeJl eiDe :.\Iäcllt.igkeit bis zu 90 mund liefel1 in groß~<br />
m1igen Steinbrllchen dns Material zn Bau- und Straßensteinen.<br />
lY. GÜllBEL, Erläut. zn lllatt Speyer. Kassel 1897, S. 65.) -<br />
Yüllig gleich dem Büchelberg lagern auf dem Hoc h ger ich t,<br />
niirdlich von Brnchsal, 50 m mächtige Hydrobien- lInd Corbiculakalke;<br />
159 1Il Uber No N. (auf 225 m mächtigen mitteloligoz!iJ1en<br />
Cyrenenmergeln). - :Nördlich von Ubstatt stehen obereozäne<br />
Salldkalke IIml )[ergel (Bastbergkalke mit Planorbis pseudo·<br />
ammonins SCHLOTH; bei 134 m über N. N. an. Südlich von<br />
tlieser Stelle finden sich im Rheintalgraben nirgends mehr eozäne<br />
Schichten. (H. THÜRACH, Erl. z. BI. Bruchsal. Heidelberg 1907,<br />
S. 16.)<br />
Die Rnpeltone (Septarientone) im Dämmelwald nnd an<br />
der Holme bei Wiesloch (verg!. Fig.8) haben eine SToßartige<br />
Fig.8. QuerproßI durch das Tertiär neben der Rheintalspalte<br />
bei Wiesloch.<br />
(Ost rechts, West links.)<br />
(Nach H. TnÜltA CH, Erl. zu BI. Wiesloch, 1904.)<br />
Tonwarenindustrie ins Leben gerufen. Näheres Uber diese äußers<br />
zähen, bis 270 m Tiefe abgebohrten, meist blaugrauen, mitt€luligozänen<br />
'rone mit ihren 3llsge.sueht sehtinen Gipskristallen<br />
lind den eingclagel'ten Kiistenkonglomeraten findet sich<br />
bei A. SAt:ER, Erl. ~. BI. NeckargemUnd. Heiddberg 1898,<br />
8 . .j.() f.<br />
Auf Ilern Schnittpunkt der Teilstrecken I 1111(1 11 sind die<br />
Basalte, Tephrite UI1(! Phonulithe des K:t i s e r s t U 11 I s ,) empor-<br />
1) Sn;I:-':MA),[N und GItÄr~', Geol. Fllhrer der Uml!ebung von Freiburg.<br />
Frcibllrg i. Br. 18!Kl, ~owie O. WILCKgN.~, Über die Verbreit.<br />
der ßn~altgiinge bei Freiburg im Breisgau. (Zentmlbl. f. Min. usw.<br />
Jahrg. m08. S.2Hl).
34 -<br />
gepreßt worden, und zwar in der Tertiärzeit. In diese Periode<br />
der Erdgeschichte fallen also - der Hauptsache nach - auch<br />
die großen vertikalen Bewegungen, welche den Rheintalgraben<br />
gesehaffen haben, der so tief absank, daß vom Norden her das<br />
tongrische Oligoz än meer eindringen und am Boden bis 1200m<br />
mächtige Schlammabsätze (Septarientone usw.) - an den Küsten<br />
Konglomerate und Sande - ablagern konnte. Mi 0 z ä n e Schichten<br />
finden sieh fast nur nordwärts vom Parallel von Karlsruhe,<br />
d. h. vom Büchelberg an. Die Senkung des Grabens und die<br />
Hebung der angrenzenden Halbhorste dauerte an bis weit hinein<br />
in die Diluvialzeit und scheint bis heute noch nicht völlig zur<br />
Ruhe gekommen zu sein. Basel ist noch jetzt einer der von<br />
leichten Erd beb e n meist erschütterten Orte Südwestdeutschlands,<br />
und die Erdbeben von G l' 0 ß ger a u 1) (im Rheintal bei Darmstadt)<br />
in den Jahren 1869 bis 1870 sind noch in frischer Erinnerung.<br />
Im Kai s er s tu h I gibt es noch in unseren Tagen hie<br />
und da Erdbeben, die auf die tief hinabgreif'ßnden Stiele der<br />
Eruptivgesteine zurückgeführt werden müssen. - Der Abfluß des<br />
Rheins nach Norden gelang dem Strome erst in der mittleren<br />
Diluvialzeit (Riß-Eiszeit). Vom oberen Pliozän an wälzte er seine<br />
Fluten vom heutigen Basel aus in die Burgundische Pforte bei<br />
Mömpelgard und durch den Doubs und die Saone zur Rhöne<br />
ins Mittelmeer. Die "Oberelsäßischen Deckenschotter"<br />
(Gerölle der Günz- und Mindel-Eiszeit) auf den niedrigen Plateaus<br />
des Sundgaus - zwischen Belfort und Basel - sind Zeugen.<br />
Die merkwürdigen, meist aus Quarziten und kristallinen Alpengesteinen<br />
bestehenden Geröllablagerungen konnten auf der Karte<br />
erstmals dargestellt werden nach den Originalaufnahmen von<br />
Prof. Dr. FÖRSTER (Mülhausen).<br />
Die Ra nd s p alt e n am Rheintalgraben stehen meist steil,<br />
nahezu senkrecht im Gebirge und schneiden messerscharf ab,<br />
1) Vergl. über ganz junge Verwerfungen: A. STEUER, Geologische<br />
Beobachtungen im Gebiet der alten Mündungen von Main und Neckar<br />
in den Rhein. Notirilbl. d. Ver. für Erdkunde u. d. Großh. hessischen<br />
geol. L.-A. (4) 24. Darmstadt 1903. - Ferner: R. LANGENBECK,<br />
Die Erdbebenerscheinungen in der oberrheinischen Tiefebene und ihrer<br />
Umgebung; in GERLAND, Geogr. Abhandl. aus Elsaß-Lothringen. Stuttgart<br />
1892. - Endlich: K. FUTTERER, Die Erdbebenforschung in Baden;<br />
in GEIU,AND, Beiträge zur Geophysik. Ergänzungsband 1. 19U2. S. 158 f.<br />
und C, REGELMANN, Erbebenherde und Herdlinien in Südweetdeutsch·<br />
land; in Württ. naturw. Jahreshefte. 1907. S.110f.
- 3ö -<br />
wie man an den polierten Rutschfiäehen des Blauengranits bei<br />
K&lIdern gll!t beobaehten kann. - In den zerbrochenen Kreuzgewölben<br />
der Bruchfelder ..,.on. Z a be l' n Ilnd La n gen b r ü e k e n<br />
- Achse N M 0 0 - h.erl1scht deutlich die varistische Strukturlinie<br />
SW -NO und se 1'1 k I' e C' b. t e s Ab s i t zen der triadischen<br />
und Jura.ssisch~n SchicMenstöße; ntl'r südlich vom BremlChtal<br />
- um den Odilienberg - domini~lrt die Nordrichtung des alpinen<br />
Syst~s.<br />
Die Südgrenze des Rheintalgrabens weicht in drei<br />
Aus b u c h tun gen ~ nach Süden hin - von der geraden 0 s t<br />
wes t I i nie ab. A. TOl'lLER 1) hat diese einspringenden Winkel<br />
mit den Namen Largbucht (bei Köstlach), Illbucht (bei<br />
Burg) und B ir sec k (bei Aesch) bezeichnet und ihre tektonische<br />
Bedeutung klargestellt. Der Kampf der beiden Strukturlinien 0 s t<br />
wes t und Süd w es t- N 0 r dos t ist Ursache der Entstehung<br />
dieser merkwürdigen Buchten. In der sog. "P fi r t" greift das<br />
jurassische Gebiet mit 4 Kettenpaaren in das vorliegende Tiefland<br />
ein; westlich mit der Bürgerwaldkette (665 m) und der<br />
Blochmontkette (GIaserberg 811 m) und im Osten mit der Landskronkette<br />
(500 m) und der Blauenkette (767 m). Verlängert man<br />
die Vogesenverwerfung~) bei Rufach an den Westrand<br />
der Largbucht, so hat man die Ostgrenze des Tafeljura (nur<br />
oberen Malm) im Elsgau und eine wichtige Strukturscheide im<br />
J·ura iiberhaupt. Ganz ähnliche Bedeutung hat die Verlängerung<br />
der Sc h war z wal d fl e x u I' bei Lörrach bis zur "Hohen Winde"<br />
und an die "Röthifluh". Zwischen diesen Linien steckt der Faltenjura<br />
(Kettenjura), welcher hier 12 km weiter gegen Norden in<br />
das mittelrheinische Tiefland vorgedrungen ist, als sonst im Osten<br />
und Westen. Der Gem~nstoUen und das ganze Baselgebiet gegen<br />
1) Der Jura im Südosten der obel'rheinischen Tiefebene. Verhand!.<br />
Naturf.-Ges. in Basel. n. 1897.<br />
2) L. VAN WERVEKE hat neuerdings gegen Verlängerung der<br />
" V 0 il e sen I in i e" Einsprache erhoben und den genaueren Verlauf der<br />
Störungen im Sundgau festgestellt, soweit die Bohrungen zur Aufsuchung<br />
von Kalisalzen im Ober-Elsaß dieselben bis jetzt erkennen<br />
laiBen. - Eine Bohrung im Non n e n b ru c h (nordwestlich von Mülhausen),<br />
angesetzt in der Höhe von + 26ö m N. N., blieb bei 1119 m<br />
Tiefe !loch im U nt e r 0 1 i go J ä n stehen. - Näheres siehe: Die Tektonik<br />
des Sundgaues und ihre Beziehungen zur Tektonik der angrenzenden<br />
']lalle des Juragebirges. (Mitt. der G.L.A. von Elsaß-Lothringen. ßd. VI.<br />
1908. $, 320 f.)<br />
3*
36<br />
Osten gellUrt dem Plattenjl1ra an. 1m SUden wird dieser begrenzt<br />
yon Iler Linie ReclCre-Mont 'l'errible-Reigoldsweil-Bötzberg.<br />
Bemerkenswert ist noch, daß zwischen den Dislokationslinien<br />
lIes Vogesenrandes lInd des Schwarzwaldrandes auch die größten<br />
\lud zahlreichsten Tertiäl'becken liegen: Deisberg, MOlltier IlSW.<br />
Die Ostgrenze der Largbucht wird gebildet durch die außerordentlich<br />
wichtige Fl ex n r der sog. ,,8 und g a ulin i e" N 41 00<br />
(Köstlach-Kcmbs), welche die tektonisehen Verhältnisse im<br />
badischen Oherlande weitllin beherrscht. und in der Verlängerung<br />
iibergeht in die große Breisgaller l ) Verwerfung am Schwarzwald.<br />
In den Tiefen des Rheintalgrabens sind neuerdings durch<br />
'1' i e fb 0 h ru n g ungeahnte Schätze erschlossen worden. Gegen<br />
Fig. fI.<br />
Querproftl durch den Rheintalgraben im Parallel VOn<br />
Mttlhausen im Elsaß.<br />
(Nach den Bohrergebnissen im Kalirevier gezeichnet von W. WAUNER<br />
und A. TORl>QlTH!T.) (Verg1.: Grundzüge der geologischen Formationsund<br />
Gebirgskunde von A. TOHNQUIST. Berlin, Bornträger 1913. S.239.)<br />
Die Schichten gehoIen - mit Einschluß del reichen S tein salz· und<br />
K alilager -- dem Oligozän an, das auf oberem Br a unjura<br />
la.gert.<br />
En(1e des .Jallrell 1904 wurde ein mltclltiges oligozänes Kalisalzhlgcr<br />
im 0 b e r- EI saß erstmals angebohrt; ungefähr 3,5 km<br />
sudliell vun Wittelsheim (nordwestlich von Miilhausen). Das<br />
Uo1Lrluch erreiellte eine Tiefe von 1119 m und zeigte von oben<br />
nn('h ullkn folgc1Hle 8chichtenreihe; 39 IIL Vogesenschottel' un(l<br />
RaJl(le; B1!} Tl! mittcloligozliue Mergel nnd KalkslllulRtein; 154 1Il<br />
1) }liesc S!lalte dc~Rhcintalgrabens Imt noch in den letztcnJahry,ehnt"ll<br />
i;fler" selbstli.ndig al~ ,,~;rregcr yon Erdbeben" gewirkt,<br />
durch Verschiebullg" der (jcbirg:s~chollen liinga der Hauptverwerfung:>.<br />
spaltl'; iushcH(lIHkrc tritt dip 8treeke Staukn-Freihurg wiederh()lt als<br />
~ .s t()ß I i nie" auf. -- Vergl. z. B. Kl,IU'S, DM Erdbehen vom 24. Januar<br />
1SS:1. Vcrh. dc~ natltrwis~ensel!. Vereins Karlsruhc. X. 1887.
- 37 -<br />
I. Salzlager mit Anhydrit und 1,5 m Kalisalze; 108 m harter<br />
schiefriger (unteroligozäner) Mergel; 327 m 11. Salzlager und<br />
Anhydritschichten, dabei 3-5 m Kalisalze, 172 m graugrüne<br />
unteroligozäne Mergel; Tiefstes vor Ort. - Diese wichtige Salzablagerung<br />
findet sich in dem 200 qkm großen Gebiet zwischen<br />
den Ortschaften Heimsbrunn, Sausheim-Ensisheim, Regisheim,<br />
Ungersheim, Sultz, Sennheim und Schweighausen. Der Nonnenbruch<br />
bei Mülhausen hat dadurch eine große volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung gewonnen. Die Salzablagerung hängt aufs deutlichste<br />
zusammen mit der Mulde vo n M ö mp el g ar d (N 49 0 0),<br />
deren Achse etwa auf der Linie Bourogne--Wittelsheim<br />
Kai se l' s t u h I verläuft. - Das Salzlager zeigt ein Absinken gegen<br />
Norden - in der Form eines tiefen Grabens - in der Richtung<br />
Wittelsheim-Regisheim. (Vergl. B. FÖRSTER, Zeitschr. f. prakt.<br />
Geologie. XVI. Jahrg. 1908. S. 517 f.). - Die Gesamtlagerung<br />
im Kalirevier von Mülhausen ergibt sich aus dem Querprofil<br />
auf voriger Seite.<br />
Die Kenntnis dieses volkswirtschaftlich so außerordentlich<br />
wichtigen Steinsalz- und Kalisalzlagers im Nonnenbruch<br />
bei Mülhausen hat neuerdings große Fortschritte gemacht durch<br />
eine Arbeit von Professor Dr. B. FÖRSTER; Ergebnisse der<br />
Untersuchung von Bohrproben aus den seit 1904 im Gange befindlichen,<br />
zur Aufsuchung von Steinsalz und Kalisalzen<br />
ausgeführten 'riefbohrungen im Tertiär (Oligozän) des Oberelsaß".<br />
(Mitteilungen der Geologischen Landesanstalt von Elsaß<br />
Lothringen. Bd. VII. Heft 4. Straßburg. 1911. S. 349 - 524.) -<br />
Die Salzlagerstätte ist nun durch 51 Bohrlöcher festgestellt. Der<br />
Salzreichtum ist enorm; im Bohrloch Ensisheim 11 488 m. Sie<br />
enthält zwei S y I v i n i t lag er (KOI) mit 52,4 % Kali, VOll je<br />
etwa 1 m Mächtigkeit.<br />
Auch im badischen Rheintal wird neuerdings auf Kali gebohrt.<br />
Am 26. Nov. 1911 wurde bei Krotzingen zunächstin<br />
400 m Tiefe - eine sulfatisch-salinische Bit tel' q u e 11 e erschlossen,<br />
die in 3 m hohem Sprudel aufstieg und sich durch<br />
hohe Temperatur (40,3 0 0) und außerordentlich reichen Gehalt<br />
an Kohlensäure auszeichnet. Die Quelle liefert in einer Sekunde<br />
80 l' Mineralwasser und ist damit die wasserreichste Thermalquelle<br />
in Europa. Die Quelle liefert täglich über 2000 kg gasförmige<br />
und 10000 kg gebundene Kohlensäure. Nach einer<br />
Analyse von Prof. G. Rupp, Karlsruhe, enthält das Wasser in
- 38 -<br />
einem Liter 4: Gl'Wlm f-este Bestandtttie, die im wesentieh.en<br />
a.us schweCelsaurem Calzium ,md Natrium, Walenaa1U8'l Erdnlkali~<br />
Eisen, .Alkalichlorid.ea, wie Kalium, Natrium und Lithiumchlorid<br />
bestehe.. Dies begründet die Vermutung, daß die Quelle<br />
mit d.eft K a H lag ern ill VerbindBng steht, naeh OODoM ~_<br />
bohrt wurde.<br />
8. Bau des Schwarzwaldes.<br />
Der am Eßde der Kulmptlri0de al!lfgefaltete Grund'gebirg!!<br />
kern des Sc b. w a'l'll wal des ist d'lloohaus nach .der varistisehe:n<br />
Strukturlinie gebaut. Die Karte Miigt im Kinziggebiet zwisehtl'lll<br />
Gengenba.ch und Hausoolt - auf Grund der AufnahmenJ.) der<br />
Großh. Badischen Geologischen Landesanstalt - die langhin von<br />
S W na c h NO sich 6l'streekenden Faltenzlig>e der GneiMoO!"mati-on.<br />
Renehgneifle, Kinzigitgneise und g,ehapbachgncit!
39<br />
ECKsehcn Aufnahmen ergeben. Vergl. auch die nachstehende<br />
Figur 10. Die Randschollen gegen Rnstatt hin bestehen aus<br />
Buntsandstein, der an der Rheintalspalte bis auf200m}l",N.<br />
Fig.10. l'roftl durch die .M:erkurschollfl bei Bade.·Baden.<br />
(Xaeh E. HECKER, Monatsbericht der Deutschen geo!. GeB, Bd. 62.<br />
Jahrg. 1910. S.657.)<br />
Gr = Granit; Kb = Oberes Karbon; ru = Unt.eres Rotliegendes;<br />
ro 1-4 = Oberes lliItJiegendes; sn = Unterer Buntsandstein; sm = Mitt·<br />
lerer Buntsandstein; so = Oberer Buntsandstein und dl = Diluvium.<br />
abgeslluken ist, während er auf den H()chfläehen vom Kniebis<br />
bis zum Hohloh bis zu 965 mund 988 m ~.N. aufragt. Von<br />
dieser nahezu meridional verlaufenden Firstlinie senkt sich der<br />
(im Mittel) 300 m mächtige Buntsandsteinmantel des nördlichen<br />
Schwarzwaldes 1 ) sachte hinab in das Schwäbische Becken.<br />
(Verg!. llierzu das Gebirgspl'ofil am unteren Rand der Karte.)<br />
Auch das "Tribel'gel' Gl'auitmassiv" folgt der varistischen<br />
Struktur, gleich den beiden Granitziigcn von WittiCllCll<br />
und \'on Schapbach. - Von TodtmOOB bis gegen Vi11ingen hin<br />
1) Der nürdliche Schwarzwald hat neuerdings auch von württem·<br />
bergi8cber Seite gen:lUc geologiache Spezialkarten in 1 : 25 üOO erhalten.<br />
Aufgenommen und in eingehenden Erläuteruugen beschrieben Rind diese<br />
Bliitter von K. RE(fELMA NN, M. SClIlIIlV'l', A. SUlIMlDT, M. B){ÄUHÄ\J~ ~J R ,<br />
A. SAmJll. (Leiter: A. SA\T]
- 40<br />
halten sich die Granitstöcke 1) von "S chi u c h see und<br />
Hammereisenbach" wieder in der Richtung N40 0 0. Auch<br />
diese Intrusionen beherrscht die richtende Kraft der varistischen<br />
Struktllrlinie. Dagegen ist das "B lau e n m ass i v" ganz und gar<br />
(nachträglich?) von der alpinen Faltungsrichtung W -0 beein<br />
Hußt, wie im Norden die Faltung der Schichten des Kulm, im<br />
Süden der Abbruch an der Dinkelbergspalte lehren. - Der<br />
Schwarzwald ist ein einseitiges Bruchgebirge, ein "H alb ho r s t"2),<br />
wie auch E. SUESS gegenüber mit Nachdruck betont werden<br />
muß, denn er ist von Basel über Waldshut nach Donaueschingen,<br />
Horb und Pforzheim bis nach Durlach von einem Mantel triadischer<br />
und jurassischer Sedimente umlagert, der nach Osten hin<br />
nicht zerrissen ist. (Vergl. das Ge b i r g s pro fil am unteren<br />
Rand der Karte.)<br />
Die mesozoischen "H ü II m ass e n" bedeckten einst auch<br />
die jetzigen höchsten Gebirgsteile (Feldberg 1493 m), doch in<br />
geringerer Mächtigkeit als dies im schwäbischen Becken<br />
der Fall ist. Der Beweis für die frühere Bedeckung ist neuerdings<br />
von G. STEINMANN 3) einwandfrei erbracht worden durch<br />
Aufschlüsse in dem Explosionsschlot (Vulkanembryo) von ALPERs<br />
BACH am Feldberg. Hier fanden sich Gesteine mit den Tierresten<br />
des Lias und des Braunen Jura. - Jenseits der Rheintalspalte<br />
haben sich noch ganze Schichtenreihen der Trias und des Jura<br />
erhalten; so z. B. am Sc h ö nb erg bei Freiburg i. B. Dieser<br />
ist aufgebaut aus einer regelmäßigen Schichtenfolge von Buntsandstein,<br />
Muschelkalk, Keuper, Lias und Braunem Jura. Die<br />
Spitze des Berges wird gebildet von den oligozänen Küsten-<br />
1) Der wichtigste Erd beb e n her d im Schwarzwald liegt hiN'<br />
bei Ti ti see und Neu s t a d t, nahe der Grenze zwischen der großen<br />
Gneisscholle und dem Schluchseer Granitmassiv. Von 19 Erdbeben des<br />
ganzen Schwarzwaldes gingen neuerdings 14 von diesem Herde aus.<br />
Näheres: Verh. des naturw. Vereins Karlsruhe. Bd. X-XVIII und<br />
Württ. naturw. Jahresh. 1907. S. 136 f.<br />
2) Die Hebung ist durch Faltenbildung infolge seitlichen Zusammenschubs<br />
bedingt. Die Gründe für diese neuere Auffassung hat<br />
L. VAN WJilRVEKE nochmals ausführlich dargelegt in dem Vortrag über:<br />
"Die Trierer Bucht und die Horsttheorie.". (Versammlung<br />
des Niederrheinischen geol. Vereins in Trier vom 4.-6. April 1910.)<br />
(Vergl. dessen "Bericht" S.12.-37. Herausgegeben vom Naturhistorischen<br />
Verein der preußischen Rheinlande und Westfalens.)<br />
3) Berichte über die Versammlung des Oberrheinischen geol. Vereins<br />
zu Froiburg im Jahre 1902.
41<br />
konglomeraten. Auch andere vereinzelte Schollen blieben in der<br />
Rheinebene stehen, wie der Tuniberg, die Marchhügel und<br />
die Jurakalke in den Schelinger Klippen im Kaiserstuhl.<br />
Verg!. die llachstehende Figur 11 sowie G. STEINMANN und<br />
Fr. GRÄFF. Geologischer Fiihrcr der Umgebung ,"on Fl'ciburg.<br />
Freiburg i. B. 1890.<br />
Fig, 11.<br />
QuerprofLl dnrell die Freibürger Ducht und das Gneisund<br />
GranitmassiT des südlichen Schwarzwaldes.<br />
(,2,5 mal Uberhllht.)<br />
(Nach G. 8TEINl lAJS"Y und Fr. GRÄFF. Geol. Flihrer der Umgebung<br />
von l
42<br />
Heilbronn) 517 In. Schon das flache Bunts&1dstainmßer transgradierte<br />
auf der Ab ras i 'Ü n 8 fU, ehe 1) -des vuistischen Grundgebirges<br />
gegen Westoo. Deshalb fehlt z. B. am Stöcklewaldk~:Pltf<br />
bei Triberg der ganze untere lInd mittlere BllntBandstein, un61<br />
es lagern sich die Geröllbänke des HauptkonglomerattJ<br />
direkt auf Granit. Das allgemeine Gesetz derAnschwel-<br />
1 u n g, welchem die den Ostrand des Schwarzwaldes umgebenden<br />
Flözbildungen unterworfen sind, hat auf den Verlauf der im<br />
Liegenden des Buntsandsteins m e ri d ion a I gerichteten S tr e i c h<br />
Ii nie n die bemerkenswerte Wirkung, daß sie sich beim Aufsteigen<br />
durch die Schichtenreihe bis zum Lias hin dreh en und schließlich<br />
0 s t w ä r t s verlaufen. - Die S t.ö ru n gen in dcer Hüllmalilse<br />
des Schwarzwaldes sind herzynische, etwa die Richtung N 45 0 W<br />
einhaltende Verwerfungen: so im Dornstetter 2) GrabeneinbruchS)<br />
bei Freudenstadt, so in den Filderspalten des<br />
Schönbuchs. Die Abtragung der Schichtenreihe foJgt durchaus<br />
den Strukturlinien, und ZWM' wirkte sie wegen der größeren<br />
Niederschlagsmengen auf den höchsten Höhen am stärksten.<br />
9. Bau des Odenwa!des.<br />
In dem kristallinen Teil des Odenwaldes liegt wiederum<br />
ein Stück des varistischen Rumpfgebirges offen am Tage. Der<br />
nordöstlich gerichtete Faltenwurf herrscht hier in solchem<br />
Grade, daß die älteren hessischen geologischen Spezialkarten<br />
1) Nachdem am Ende der Kulmperiode die altpaläozoischen A,b·<br />
lagerungen des Schwarzwaldes aufgefaltet und die Granitmassive in s,ie<br />
eingedrungen waren, setzte in der Folgezeit eine tiefgreifende<br />
Den u d at ion (Abtragung) der "Karbonischen Alpen" ein, durch welche<br />
das Dach der Granitlakkolithen allmählich abgetragen und der Granit<br />
selbst mit seinen Kontakthöfen angeschnitten wurde; so entstand die<br />
im Schwarzwald weithin verebnete per mi s c h e Ab ras ion s fl ä c h e.<br />
2) Die "Dornstetter Scholle" ist noch nicht völlig zur Ruhe<br />
gekommen. Sie verursacht hie und da leichte Dislokationsbeben mit ganz<br />
lokalem Schüttergebiet (z. B. am 30. Dezember 1893; Württemb.<br />
naturwissensch. Jahreshefte, 50. Jahrgang 1894, S. 503). Schon die<br />
Oberamtsbeschreibung von Freudenstadt, Stuttgart 1858, schreibt<br />
S. 218: "In DOl'Dstetten und Freudenstadt verspürt man nicht Reiten<br />
Erd s t ö ß e, welche man eu gleicher Zeit in anderen Gegenden nicht<br />
wahrnimmt".<br />
.. 3) Vergl. A. SCHl\! IDT. Der N eubulacher und Freudenstädter Graben.<br />
I1bcrsicht über die Ve r wer fu n gen und Erz g ä n g e im Deckgebirge<br />
des östlichen Schwarzwaldes. (Zeitschr. für prakt. Geologie. XVIII. Jahrg.<br />
1!l10, S. 4fJ f.)
- 43 -<br />
' ·Oll LUDWIG teil ..... eise ~r;,dezu .UB8eheu, als seien sie mit dem<br />
PIU':l.lIrllillenl über ßSl"g und 'l'Rl hinweg VOll SW IInch NO<br />
~t:llrnl'firrt. Auch in den neneren Bliittern der geologischen<br />
Spezialkartel) des Großhel"Zogtums Hessen tritt UllS diese ge,.<br />
waltige Riehtungskraft uoch deutlich genllg entgegen. So z. B.<br />
iu der Richtung N ö7 ·' 0, welche die Falten der si tpaläozoischen<br />
Se hiefe r bei Lindenfels einhalten, nnd in den kontaktmeta mol"phen<br />
Salbändern der mittelkarbOllisc h e n 01'30it- und Dioritin<br />
tru iouen, welelle in gleicher Richtung streichen. Aber auch<br />
..<br />
Fig. 12. Proftl durch den mittleren OdenwRld von ~w DRell SO.<br />
(Vom Buch bis zum Knabenberg bel Lindenfels t O.)<br />
lNach C. CHEf.WS, Noti2blatt der Geol. L!\udeIJ8UMalt zu Darml tadt..)<br />
108 (die Ltll.zelriSder) =' Metam()rpbe Schiefer, durchzogeo '"00 Grg =<br />
GrOonil>ischeGänge: Di - Diorit, durchzogen 'on Grh = Horoblendegranit;<br />
Gr = Grauit; v = Verwerfuogen.<br />
die t.erWire alpin e Nord-SUd und West..Ost-Richtung dlll'('.htrümert<br />
lIeben dem permischen Quarzp0l'phyrerguß dieSe& Gebiet,<br />
das deshalb an Kontaktgl\i!te.inen ungemein reich ist. Selbst die<br />
H h e i n taillp alte ist nicI.t e.lnheiilieb meridional gelichtet, 80ndern<br />
h;11 einen etwas unregelmäßigen Verlau(i ) lind 86tzt sich ans teilll<br />
nordsUdlieh, teils nortlUst1ich, teils 811 Cll westöstlich verlaufenden<br />
'l'eillrll'ceken zusammen, - Auch im Sandstein-Oll en w a ld ,<br />
der stru'k durehsetzt ist von N ord-SUd-streichellden jungen<br />
1) Die KartiefWIg du Odenwaldee in 1 : 25000 liegt nllht1.tl<br />
vollendet vor. Die Aufnahmen und Erliiuwungen lltammen "Von den<br />
Lllnde8j,'llologen C. C''':I,1t18, G. KU';loIl11 , A. S· ' · EV~:I!, W. SCHO'l"r u :: lI.<br />
Varetand der gool. Lanlleunst.a.lt ist R. LKi'IIU;s (Darlllst.adt). - Gute<br />
f"l benicht bieten: C. CIH;,.llll1, GooIOgtIChH Führer durch den Oden<br />
Wild, Gie/ku, 2. Anti., 1907, F . .TA(JKlI, ÜLClr OLerftächcngeijtaltung im<br />
Odenwald, Heidelberger Diu., Stnttglil"t 1904, endlicll: G. Kt.r·;IoIM:<br />
IfUhrer bei geologischen Exkursionen iIll Odenwald. Berlin, 1!)10.<br />
2) Verg!. G. K],HMIoI, ErliLutenlngen ;t;UlU ß I I\t.~ Birkennu-Wdnh cjtn.<br />
Dl\tln~tAdt HIO!). 1:).67.
44<br />
alpinen Verwerfungen 1) und Gräben 2) taucht nebenbei noch<br />
die vielgenannte varistische Strukturlinie wieder auf. So in der<br />
Verwerfung südlich vom Stüber-Centwald und in der Spalte,<br />
welche der Talstrecke Neckargemünd-Eberbach die Richtung<br />
vorgeschrieben hat, und welcher am Spessart die Mainstrecke<br />
Miltenberg-Wertheim entspricht. Auch die Abtragung der Schichten<br />
folgt im Oden wald wesentlich der uralten Strukturlinie. Wie die<br />
neuen Funde von Liasgesteinen 3) auf der Westseite des weitschauenden<br />
Basaltberges Katzenbuckel (626 m) beweisen, war<br />
auch hier einst noch eine Juradecke vorhanden. Heute ist alles<br />
abgetragen bis auf den 500 m mächtigen Buntsandstein. Das<br />
Einfallen der Schichten gegen SO und die Erosionsgrenz e<br />
gegen den Muschelkalk auf der Linie Mosbach-Wertheim scheinen<br />
ebenfalls noch den Weisungen zu folgen, welche im tiefen Untergrund<br />
die alten varistischen tektonischen Leitlinien vorschreiben .<br />
.s(~I",~or,'<br />
I<br />
l1tcl-.Y ...•.. ~ .••.......••..••_•••_ .•••••_ •.• _••••••••••••••.•.••••••.••. J!!).r.'t;z<br />
Fig. 13. Profil durch den südlichen Odenwald bei Heidelberg.<br />
(Nach W. SALOMON, Ber. des Oberrhein. geol. Vereins. 42. Vers. zu<br />
Heidelberg, S.9.)<br />
Der nahezu meridional über das N eckartal geführte Schnitt zeigt<br />
sehr schön über dem G r a n i t (meist Biotitgranit) die per m i sc h e<br />
Ab ras ion s fl ä c h e des Grundgebirges, bedeckt von der Arkose des<br />
Rotliegenden und der Schichtenfolge des Buntsandsteins,<br />
welche am Königsstuhl bis zum Hauptkonglomerat hinaufreicht.<br />
Der sü dli che Odenwald ist durch die Arbeiten der badischen<br />
Geologen erforscht worden. Besonders kommen in Betracht die<br />
1) G. KLEMM, Die Muschelkalkversenkung bei Michelstadt. Blatt<br />
Erbach und Micbelstadt der geol. Spezialkarte von Hessen. 1900.<br />
2) W. SALOMON, Über eine eigentümliche Grabenversenkung bei<br />
Eberbach im Odenwald. Mitteil. Großh. Bad. geol. L.-A. 4. (2.) 1901.<br />
3) W. SALOMON, Muschelkalk und Lias am Katzenbuckel. Zentralbl.<br />
f. Min. 1902, S. 651 f. und W. FREUDENBERG, Exkursion auf den<br />
Katzenbuckel. Ber. des Oberrhein. geol. Vereins, 42. Vers. zu Heidelberg,<br />
Karlsruhe 1909, S. 17. f. (Außerhalb des Eruptionsschlotes wurden<br />
auch Brocken von Keupersandsteinen, von Oolith des oberen Braunjura<br />
und von Weiß Jura ~ gefunden.)
- 45 -<br />
Blätter der Spezialkarte in 1: 25 000: He i dei bel' g von A. ANDREÄ<br />
und A. o SANN, H. Aufl. von H. THÜRACH, 1909 und Blatt<br />
Neckargemünd von A. SAUER, 1898, mit dem Fundorte des<br />
berühmten Homo Heidelbergensis, welcher 24 m tief in den<br />
Sanden von Ma u er gefunden wurde. - Gute Übersicht gibt auch:<br />
J. RUSKA, Geologische Streifzüge in Heidelbergs Umgebung, Leipzig<br />
1908; sowie die Berichte über die 42. Versammlung des Oberrheinischen<br />
geol. Vereins zu Heidelberg im April 1909, Karlsruhe<br />
1909.<br />
Für den Odenwald hat Prof. Dr. A. STRIGEL den dankenswerten<br />
Versuch unternommen, die permische Abtragungsfläche<br />
durch Streichkurven von 10 und 25 m Äquidistanz<br />
gen au darzustellen. (Vergl. Verhandlungen des N aturhistorischmedizinischen<br />
Vereins zu Heidelberg. N. F. XII. Bd. 1. Heft.<br />
Heidelberg. Winter, 1912.) Leider gibt diese graphische Darstellung<br />
nicht überall die heu t i geLage der Abrasionsfläche, sondern<br />
eine ideale, welche die nachkarbonischen Verwerfungen auszugleichen<br />
sucht.<br />
Die Gliederung der Quartärbildungen am Westabhange<br />
des Odenwaldes hat Dr. W. FREUDENBERG geklärt durch eine<br />
Abhandlung im Notizblatt des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt<br />
für das Jahr 1911: "Beiträge zur Gliederung des Quartärs<br />
von Weinheim an der Bergstraße, Mauer bei Heidelberg,<br />
J 0 c k g r imin der Pfalz u. a. m. und seine Bedeutung für den<br />
Bau der Oberrheinischen Tiefebene" S.76-149.<br />
Der Odenwald ist reich an Hartsteinen. Weithin bekannt<br />
ist die Granit- und Syenitindustrie (Kreuzer & Böhringer) in<br />
Li nd e n fe I s, Bensheim und Elmshausen. Auch die Straßenschotter<br />
aus den Porphyrwerken von S chri e s h ei mund D ossenheim<br />
an der Bergstraße sind hervorragend und haben ein weitgedehntes<br />
Absatzgebiet.<br />
10. Bau des Kralchgaues.<br />
Auch im Kr a ich gau - der tiefen Einsenkung zwischen<br />
Oden~ald und Schwarzwald - zeigt das Hügelland der Lettenkohle<br />
und des Keupers deutlich den machtvollen Einfluß der<br />
varistischen Strukturlinie (N 50° 0); viele Höhenrücken<br />
und Täler sind danach angeordnet. Die Verwerfungen verlaufen
- 46 .-<br />
im Kraichgau vorwiegeud in dieser Richtung. Die H ll; u poils<br />
t ö run g 1 i nie am Sfidostrand de3 Odenwaldes ist glefchfall8<br />
entschieden va r ist i sc h gerichtet (N 52 0 0 im Mittel der Strecke<br />
Hoffenheim a. d. Elsenz-Trienz-Builhen). Sie zerfällt in zwei<br />
wesentlich verschiedene Teilstrecken: Im Kraichgau bis 2'Illm<br />
N eckar ist an ihr die n ö r d li c h e, vom N eckar bei Neekargerach<br />
ostwärts die süd}i c he Scholle abgesunken. (E. HECKER,<br />
Berichte des Oberrhein. geol. Vereins über die 42'. Vers. zu<br />
Heidelberg. 1909. S.72.)<br />
Die Kr a. ich gau sen k e stellt eine eigenartig gebaute Mulde<br />
dar, welche neben tiefen Verwerfungsspalten auch eine ADIZJlhl<br />
von aufgepreßten S chi c h t e n ku pp ein und Sätteln zeigt. Diesem<br />
Aufbau entspricht es, wenn wir im inneren Teil der S~nke die<br />
jüngsten Schichten antreffen. Nach Nord und Süll folgen. immer<br />
ältere Schichten. Der Boden des fiachwelligen Landes erhebt<br />
sieh im Westen kaum 100 m über das Rheintal, erreicht aber<br />
im Osten der Muldenachse Höhen von etwas über 300 m N.N.<br />
Die Schichten des Muschelkalkes, der Lettenkohle und des Keupers<br />
bieten, meist mit tiefgründigem Löß bedeckt, vorzügliches Ackerland.<br />
- Bei dem Schwefelbad Langenbrücken, dessen Heilquelle<br />
aus dem Posidonienschiefer des Lias kommt, treffen wir<br />
neben der tiefen Hauptspalte (in N 49 00) nordwärts ein j urassi<br />
s ch e s Ge biet. Vom Bahnhof Langenbrücken (Brauner Juraß)<br />
ersteigt man im Dorfe die Opalinustone, um dann weiter nordostwärts<br />
in den mittleren und unteren Li a s und endlich tiber den<br />
Bonebedsandstein zum Keuper aufzusteigen. Also die Terrassenfolge<br />
Schwabenl3 in umgekehrter Reihe. Dabei stimmen die Sehichten<br />
und Petrefakten bis ins einzelne mit Schwaben überein. Der<br />
Einbruch ist so tief, daß das Liegende der Lettenkohle bei<br />
LangenprUcken auf - 340 m N.N., also tief unter dem Meere&<br />
spiegel, lagert. (Vergi. C. DEFFNER und O. FRAAS, Die Jura;.<br />
versenkung bei Lallgenbrticken. Neues Jahrb. fUr Min., Geol.<br />
l1SW. 1859 und die Blätter der neuen geologischen Karte von<br />
Baden in 1: 25000, welche samt den auch tektonisch vorzUglich<br />
ausgearbeiteten Erläuterungen vom ganzen Kraichgau<br />
vollendet vorliegen.)<br />
11. Der Schichtenaufbau im Schwäbiselten Trlasbe"ek.e.D.<br />
(Vergl. das Gebirgsprofil am unteren Rand der Karte.)<br />
Das Sc h w ä bis c he 'F ri as b ecke n (Neekarland), die
"i'I'tl.nkia.ehe Platte" und die Frankenhöhe mit dem<br />
8t ei ger w al d gehören durchweg einem einheitlichen mesozoischen<br />
Senkußgefelde 1 ) an, das durch gegen lOOOm m!iclltige Sedimentanhäufungen<br />
nach 8Udosten hin allmlthlich ausgeebnet wurde.<br />
h.,<br />
~m n; '<br />
Fig. 14. Schematisches Profil durch den Untergrund und die<br />
Berge Stutt.garls.<br />
Der Schnitt geht von Südo~t nach Nordwest quer dnrch den varistisch<br />
gerichteten Stu t tg arte r G r a ben. Er zeigt die konkordante<br />
AUfeinBDderfolge der Triaitchichten auf dem kristaUinen Grundgebirge<br />
und dM Abbrechen derselben an den Verwerfungsspalten.<br />
1) H. ECK bat ia den WÜfttemb. naturwisseasch. Jahresheftea 1887<br />
S. 367 f., 1888 S. 271 t., 1889 S. 34-1 f. eine Üben!ich ~ über die in der<br />
Zeit vom 1. Januar 1867 bu. zum 28. Februar 1889 in Württemberg<br />
und Hohenzollem wahrgenommenen Erd er9ch Ü tternngen gegeben,<br />
welche zum Teil als Senknngeerschelnungen, zum Teil aber al8 beginnende<br />
alpine Auffaltung des Schollenl:mdes aufzufas!!en sind. Die<br />
Fortsetlung dieser wertvolleu Erdbebenberichte hat August Sc h m i d t<br />
in den genannten Jahreahelten 1891-19(M, gegeben.
48 -<br />
Diese Einebnung des Beckens geht so weit, daß das normale<br />
Hangende des Stubensandsteins im Mainhardter Wald fast eine<br />
Horizontalebene bildet, welche 550 m über dem Meere liegt.<br />
Bun tsandstein (400m), Muschelkalk (250m) und Keuper<br />
(im Mittel 250 m) legen sich in der Ausbildungsform der germanischen<br />
Trias, Bank für Bank, konkordant 1) aufeinander bis<br />
hinauf zum rätischen Sandstein und zu den Arietenkalken des<br />
Lias, welche sich weithin noch als Erosionsreste auf den Hochflächen<br />
erhalten haben; zum Zeichen, daß das ganze Gebiet einst<br />
eine Juradecke getragen hat.<br />
Die varistische Struktur schwächt sich in dem schwäbischen<br />
Triasbecken etwas ab, und die Süd-Nordrichtung der alpinen<br />
Faltung mit der zugehörigen Ost-Westrichtung treten stärker<br />
hervor (Neckarstrecke : Cannstatt-Kochendorf ; Enzstrecke:<br />
Mühlacker-Bietigheim; Filsstrecke : Plochingen-Göppingen;<br />
Remsstrecke : Gmünd-W aiblingen). Doch taucht das Einfallen<br />
des Schichtengebäudes gegen SO immer wieder auf. Die Landesterrassen<br />
werden daher an den nordwestlich gerichteten Steilrändern<br />
am stärksten abgetragen. Aber gerade diese zahlreichen<br />
Te r ras sen, welche steil aufsteigen und sachte (mit etwa 1 (l/o<br />
gegen Südost) zurücksinken, sind Grund und Ursache der<br />
landschaftlichen Reize im schwäbischen Lande. Die Abgrenzung<br />
des N eckarlandes ist nicht ganz einfach; im großen ganzen liegt<br />
es innerhalb des Dreiecks: Schwenningen-Ellwangen-Eberbach.<br />
Gegen Schwarzwald und Oden wald bildet die Formationsgrenze<br />
des oberen Buntsandsteins gegen den unteren Muschelkalk die<br />
anerkannte Grenze; am Fuß des Steilrandes der Schwäbischen<br />
Alb mag das Liegende des mittleren Lias dafür gelten und gegen<br />
Nordosten schließt die wichtige te k ton i s c h e S t ö run g s li nie<br />
ab, welche aus dem Ries ausstrahlt und auf den Basalt des<br />
Katzenbuckels hinüberzielt. Diese herz y n i sc h e Verwerfung<br />
- N 54 0 W - zeigt sich zwar nur streckenweise: auf der Linie<br />
Hürnheim-Bopfingen (Granit), bei Vellberg und an den Pfitz-<br />
1) Das beim Schwarzwald schon berührte Anschwellen der Schichten<br />
gegen Norden und Osten zeigt sich insbesondere auch bei dem Stubensandstein<br />
des Keupers. Er ist bei Schwenningeu nur 4 m mächtig,<br />
Hchwillt aber bis Löwenstein auf 161 man. Württemb. Jahrb. f. Statistik<br />
lind Landeskunde. Jahrg. 1877, 5. S. 224.
- 49 -<br />
höfen bei MöckmUhl, aber KARL DEFFNER 1) hat längst ihre<br />
Bedeutung für die Tektonik des Rieses el'kannt und sie "Sigart<br />
L i nie" genannt. - Gleiche Richtung halten die S c h u r wal d<br />
spalte: Plochingen-Enzweihingen und die Schar der Fildersp<br />
alten ein (im Mittel N 51 0 W). E. FRAAS nennt dieselben<br />
daher mit Recht herzynische Störungen. Sie dürften auf den<br />
Bau des unterlagernden varistischen Grundgebirges hinweisen.<br />
Es ist bekannt genug, daß auch im Fichtelgebirge, im Bayerischen<br />
Wald und sonst in der Böhmischen Masse das "E r z g e bi r gis c he<br />
System", das identisch ist mit dem varistischen (N 50 ° 0) der<br />
·interkarbonischen Faltung, so oft alterniert mit dem herzynischen<br />
S tr e ich e n der alten Schieferfalten (N 56 ° W), daß sich beide<br />
Systeme geradezu durchdringen und ersetzen; oder, wie schon<br />
früher angedeutet, sich wie Kluft und Gegenkluft verhalten. -<br />
Die in Südwestdeutschland tonangebende varistische Strukturlinie<br />
zeigt sich aber wieder deutlich in dem - mit den Filderspalten<br />
gleichalterigen (oligozänen) - System von Störungen, das in<br />
der Gestalt von schmalen G r ä ben oder als einfache V e r<br />
werfungen von Ergenzingen aus über Bebenhausen und Plochingen<br />
gegen den Hohenstaufen hinzieht und die mittlere Richtung<br />
N61 0 0 einhält.-Die "Fränkische Platte" breitet sich wie<br />
ein Teppich am Fuß der Frankenhöhe und des Steigerwaldes<br />
aus und umfaßt die fruchtbaren lehmbedeckten Hochflächen der<br />
Lettenkohle und des Muschelkalks. Main, Tauber, Jagst und<br />
Kocher, haben sich hier meist über 100 m tiefe Täler eingenagt,<br />
deren Verlauf in vielen Strecken auf den hier vorherrschenden<br />
EinHuß des her z yn i s c h e n Systems hinweist; so die Strecken<br />
Ochsenfurt-Würzburg, Mergentheim-Wertheim, und Langenburg-Dörzbach;<br />
sowie in der Abßußrichtung von Altmühl, Rezat<br />
und Bibart. Der alp in e EinHuß spielt aber auch noch deutlich<br />
herein in der W -0 gerichteten Mainstrecke bei Ochsenfurt, im<br />
Taubergrund ostwärts von Mergentheim, im Umbiegen der Jagst<br />
bei Dörzbach und im Verlauf der Nord-SUd streichenden Gipfelhöhen<br />
der Frankenhöhe und des Steigerwaldes. Hierher gehört<br />
auch die m er i d ion a I verlaufende tektonische Höhenlinie Ingelfingen-Tauberbischofsheim<br />
(in der Karte mit roten Kreuzen<br />
1) K. DE}''FNER und O. FRAAS, Begleitworte zur geognostischen<br />
Spezialkarte von Württemberg. 1: 50 000. Atlasblätter Bop f i n gen<br />
und Ellenberg. Stuttgart 1877. S.27.<br />
4
- 50 -<br />
bezeichnet), welche bei Ingelfingen und Dörzbach den 0 b e ren<br />
Buntsandstein im Talgrunde an den Tag heraufhebt und die<br />
merkwürdige Ablenkung der SchwesterflüBse Kocher und Jagst<br />
ver anlaßt. - Die Schichten liegen übrigens Bonst im ganzen Gebiet<br />
fast ungestört, abgesehen von wellenformigen Au fw öl b u n gen<br />
und kleinen Verwerfungen fallen sie im großen ganzen schwach<br />
(mit etwa 0,5 %) gegen Südosten ein. Das bedeutendste<br />
Schichtengewölbe steigt vom Neckar an gegen Osten mehr<br />
als 350 m hoch hinanf - unbeirrt durch die zahllosen lokalen<br />
Störungen - bis zu dem 15 km breiten horizontalen Gewölbscheitel,<br />
der auf der Hochfläche (500 m NN) bei Langenbur<br />
g und Sc h I' 0 z b erg liegt, von dem sich so dann der Ostflügel<br />
gegen den Franken- und den Steigerwald hin absenkt. Das<br />
normale mittlere Streichen hält etwa die Richtung N 53 0 Wein,<br />
erinnert also lebhaft an das Streichen des her z y n i s c h e n<br />
Ur g e b i I' gs r a n d e B, welcher von dem nahen Fichtelgebirge<br />
aus mehrere hundert Kilometer weit fortzieht und auch an<br />
dem Südwestrande des Thüringerwaldes an der Richtung N 46 0 W<br />
festhält.<br />
Die Kenntnis des Untergrundes im Schwäbischen Triasbecken<br />
ist durch eine Tiefb 0 h rung bei Erlen bach in der Aue der<br />
Sulm (etwa in der Mitte zwischen N eckarsulm und Weinsberg)<br />
aufgeklärt worden. Die Hängebank des 856 m tiefen Bohrlochs<br />
liegt 163,68 m über N.N. Es wnrden durchteuft : Alluvium 9,3 m;<br />
Kenper 22,3; Lettenkohle 27,5 m; Muschelkalk 237,8 m; Buntsandstein<br />
517,3 m; Zechstein 23,6 m. Tiefstes vor Ort: Rotliegendes<br />
(18 m erschlossen). - Vergl. E. FRAAS. Das Bohrloch<br />
von Erlenbach bei Heilbronn. Württ. naturwiss. Jahreshefte.<br />
70. Jg. 1914. S. 37-42.<br />
12. Bau der Schwäbischen Alb.<br />
(Vergl. hierzu das Gebirgsprofil am unteren Rand der Karte.)<br />
Die S c h w lt bis ehe Alb ist nach einer früheren Vorstellung<br />
eine einheitlich nach der v a r ist i s ehe n S tr u k t u r 1 i nie N 51 0 0<br />
aufgerichtete Platte, deren Hochfläche, von den felsgekrönten<br />
Gipfeln des nordwestlichen Steilrandes aus, in gleichmäßiger Abdachung<br />
gegen SO Zur Donau hinabsinkt. Das ist z. T. richtig,<br />
trifi't aber z. B. in der mittleren Alb nicht zu. Hier findet
51<br />
man im Innern des Albkörpers auf der tektonischen Höhenlinie 1 )<br />
Augstberg-EisenrüttelN35 0 0 (auf der Karte mit roten<br />
Kreuzen bezeichnet), die höchsten Gipfel Augstberg (849 m),<br />
Stel'llenberg (844 m), Guckenberg' (852 m), Buchhalde (870 m),<br />
Eisenriittel (847 m). Am Nordwestrande dagegen (12 km entfel'llt)<br />
hat der "Grüne Fels" nur 805 m. Gegen Südost zeigt<br />
das Albmassiv (14 km entfernt) eine Knickung bei 730 m absoluter<br />
Höhe, und an der Donau (weitere 9 km gegen SO) ist<br />
die Hochfläche auf 500 m abgesunken. Wir haben also hier<br />
eine nördliche Zone mit 0-0,5% Gefälle gegen Nord; eine<br />
Mittelzone mit 1 Ofo Gefälle ge gen Süd und eine südliche Zone<br />
mit 2,4 Ofo Gefälle gegen Süd. Die letztere trägt zum großen<br />
Teil schon eine Tertiärdecke (Rugulosakalk der unteren Süßwassermolasse).<br />
Die Stabilität der Albplatte hat also in diesem<br />
Gebiet bei der Aufrichtung durch den tangentialen Schub<br />
aus dem Süden nicht standgehalten. Die Nordzone brach ab<br />
und sank etwas gegen Norden ein, auf der tektonischen Höhen~<br />
linie entstand ein Knick und eine Spalte, auf welcher Basaltmassen<br />
aufgestiegen sind. Die Vulkanembryonen 2) BRANCAS sind<br />
meist tufferfüllte Pufflöcher, deren Entstehung 3) mit dem Einbrechen<br />
des nördlichen Gebirgsstücks gewiß irgendwie zusammenhängt.<br />
Noch heute ist die tektonische Linie Au g s t beI' g-<br />
Eis e n I' Ü t tel von Bedeutung; an derselben haben sich z. B.<br />
die leichten Erd beb e n 4) vom 7. und 14. Oktober 1890<br />
ausgelöst.<br />
1) Vergl. die geotektonische Untersuchung in Württemb. Jahrb.<br />
f .. Statistik und Landeskunde. Jahrg. 1877, 5. S. 123 ff. '<br />
2) W. BRANCA. Schwabens 125 Vulkan-Embryonen. Jahreshefte<br />
des Ver. für vaterl. Naturkunde in Württemberg 1894 und 1895.<br />
3) H. LENK hat neuestens - auf Grund der Forschungen von<br />
J. E. HmscH im Böhmischen Mittelgebirge - darauf hingewiesen, daß<br />
es nicht auf die Lagerungsverhältnisse der Juratafel im U ra c her<br />
V ulk a n g e b i e t ankomme, sondern auf die Zerspaltung des tieferen<br />
U.ntergrundes. Der Verlauf der herzynischen Schönbuchs<br />
pa 1 t e n deute entschieden darauf hin, daß der triadische Untergrund<br />
der Uracher Basaltdurchbrüche zerspalten und stark disloziert sei.<br />
Monatsber. d. Deutschen geolog. Ges. 1908. S. 201. (Die Unabhängigkeit<br />
der Uracher Vulkanembryonen von der Lagerung der etwa 600 m<br />
mächtigen jurassischen Schichten, bleibt aber trotzdem bestehen.<br />
Anmerk. d. Verf.)<br />
4) Vergl. den Erdbebenbericht im Jahrg. 1891 der Württemb.<br />
natul'wissensch. Jahreshefte 4:7. S. 243-245.<br />
4*
Der von SUdwest naeh :Soruost hinziehende S t eil r a n d<br />
der AI b ist die sehönste Zierde des schwäbischen Landes. Er<br />
ist aufgebaut allS den zahllosen Schichten des Lias (90 m), des<br />
Brannen Jura (280m) und deB Weißen Jura (über 200 m),<br />
welche uns FR. A. QUENSTEDT so trefflich beschrieben hat.<br />
(FR. A. QUENSTEDT, Dm' .Jura, Ttibingen 18ö6-1858.) In seine<br />
Fußstapfeu traten TB. ENGEL 1 ) und E. SCHÜTZE. (Geognostißeher<br />
Wegweiser durch WtirUemberg, III. Aufl., Stuttgart 1908 sowie<br />
'rH. ENOEL. Geologischer ExknrsionsfUhrer durch Württemberg.<br />
Stuttgart 1911.)<br />
Fig. 15. Schematisches Sellichtcoprofil am Nordl'lcstrand der<br />
SchwlU)lschcll Alb.<br />
(Nach E. FRAAS, Führer durch die K. Naturaliensammlung zu Stuttgart<br />
I. Die geognostische Sammlung Württembergs, In. AufL, Stuttgart 1910,<br />
S.42.)<br />
Der Persona tcnsandB tein (Murchisonäsandstein) des Braunen<br />
Jura nmscilließt Eiscnerzfliize von praktischer Bedeutung.<br />
Aalen, Wasseralfingen und Knchen sind die Mittelpunkte des<br />
wcitgedeilnten Erzreviers am Kocher und an der Fils. Abgebaut<br />
wird der..:eit nur noch in Waaseralfingen (45 Bergleute),<br />
wo sieh zwei Erzflöze (ein oberes 1,4m und ein untereß 1,7m<br />
mlLchtig, getrennt (lurch 11 m Sandsteine und Tone der Murchisonä<br />
Ilchiehten) weit in den AlbkUrper als Schieilte hineinziehen. Es<br />
wnrdcn z. H. erzeugt bei einern Ausbringen von etwa 35 % im<br />
.hhre 1903: 3:)82 t EiRen im Wert von 379157 Mk. (Vergl.<br />
1) Für den Gehrauch de~ Albwande-rers findet ~ich eine allgemein<br />
v('r~täudliche Ühersicht in T11. E){{U;}" Die Sehwaben,\lb uud ihr geo<br />
IObo1_eher Aufl,uu . .Mit 60 Abbildungen. H. Auflage. Tübingen 1!)().i ..
53<br />
R. FLUHR, Die Eisenerzlagerstätten Württembergs und ihre volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung. ZeitschI'. für praktische Geologie, 1908,<br />
S.1-23.)<br />
Die absolute Höhe der Albhochfläche nimmt vom Heuberg<br />
(Lemberg 1015m) nach dem Ries l ) hin allmählich ab (Braunenberg<br />
725 m), deshalb fällt das wahre Streichen nicht mit der<br />
Längenerstreckung zusammen, sondern beträgt im Mittel etwa<br />
N 46 0 O. In Wahrheit besteht aber das Juramassiv der Schwäbischen<br />
Alb aus einer Menge verschiedenartig geneigter Platten,<br />
deren Streichrichtung schwankt zwischen N 28 0 0 und N 63 0 O.<br />
Der Süd 0 s tr a n d der Alb wird seit 50 Jahren als Bruchrand<br />
in der gesamten Literatur betrachtet. Nach meiner Auffassung<br />
hat ein Abbruch 2) der Juratafel am Donautalrand niemals statt-<br />
1) Das R i e s ist nach der Auffassung von W. BRANCA und<br />
E. FRAAS äußerlich ein Einbruchkessel, innerlich aber ein aufgetriebener<br />
Grundgebirgspfropfen. Während der Fränkische Jura - gleich dem<br />
Schwäbischen - höchstens einmal ein kleines "E i n 8 t u r z beb e n" zu<br />
verzeichnen hat, gehört das Ries zu den unruhigen "S t 0 ß zen t ren",<br />
von denen je und je Erdbeben ihren Ausgang nehmen. Es scheinen<br />
hier die schlummernden tertiären jungvnlkanischen Kräfte zeitweise<br />
wieder etwas zu erwachen. Die Annalen von Nöl' d li n gen wissen<br />
davon zu erzählen. Vergl. S. GÜN'l'HER, Die seismischen Verhältnisse<br />
Bayerns; in GERLAND, Beitr. z. Geophysik .. Ergzbd. 1. 1902. S. 138.<br />
Ferner: W. BRANCA und E. FRAAS, Das vulkanische Ries bei Nördlingen<br />
in seiner Bedeutung für Fragen der allgemeinen Geologie.<br />
Abh. der K. Preuß. Akademie der Wissenschaften. 167 S. und 2 Tafeln.<br />
Berlin 1901. - Neuerdings zeigt sich in der Schwäbischen Alb<br />
(Gegend um Ebingen) ein Erdbebenherd, der sich am 16. November<br />
1911 als "Epizentrum" des Mitteleuropäischen Erdbebens gezeigt<br />
hat. (Vergl. R. LAIS und A. SIEDERG in GERLANDS Beiträgen zlIr.<br />
Geophysik. XII. Bd. 1. Heft. Leipzig. 1912.)<br />
2) Die nenen Bohrungen im La n gen aue r r i e d haben meiner<br />
Ansicht nach diese Auffassung bestätigt. Die stratigraphischen Rechnungen<br />
ergaben ein Streichen im Hangenden des Jura e (unter dem<br />
Torfmoor) von N 56 ° 0 und ein Ansteigen gegen NW von 1 : 55.<br />
Damit erreicht man den Jurarand beim Bahnhof Rammingen (458 m N.N.)<br />
ohne erhebliche Anschlußdifferenz. - Im B 0 h rio c h 23 (1560 m vom<br />
Albrand im Moor gelegen, 2600 m vom Bahnhof Rammingen gegen<br />
OSO, ~60<br />
(Terrainhöhe 450,90 m N.N.):<br />
Torfiger schwarzer Humus<br />
Gelber Mergel. . . . .<br />
Blaue fette Tone. . . .<br />
Kies der Niedertermsse<br />
Brauner Letten . . . . . . . . . . .<br />
m südlich vom Kimmiggraben) zeigte sich folgendes Proftl<br />
Kirchberger (Brackwassermolasse) - Schichten<br />
Weißj ura Ep sil onk al ke<br />
(bei 421,30 m N.N. beginnentl).<br />
....<br />
0,50 m<br />
1,10 "<br />
1,00 "<br />
3,70 "<br />
0,20 "<br />
23,10 ,.<br />
(Hangendes.)
54<br />
gefunden. Es ist ein Er 0 si 0 n s I' an d gleich der Albtraufe im<br />
Nordwesten. Die JuratafeP) taucht nur unter den 'l'ertiäl'mantel<br />
Oberschwabens hinab, welcher deutliche Spuren eines Aufschubs<br />
aus Südost zeigt. (Näheres: Bericht über die Vers. des Oben·hein·<br />
geol. Vereins zu tam. 1908. Karlsruhe 1909. S. 39 f.y - Die tektonische<br />
Höhenlinie Wildenstein-Lemberg (s. Karte) verläuft<br />
so dann in herzynischer Richtung (N57°W), was Beachtung<br />
verdient. - Von hier aus gegen Südwest schmiegt sich der JUl'azug<br />
in elegantem Bogen an den· Südfuß des Schwal'zwaldes und an<br />
die Vogesen. Er zeigt hier so recht deutlich sein Verhältnis zu<br />
diesen kl'istallinen Gebirgskernen, als ein Teil ihrer ehemaligen<br />
Sedimenthülle. (Vergl. das Profil am unteren Rand der Karte.)<br />
An der "Länge" (924 m) und am Randen (924 m) erleidet<br />
die Juratafel eine große Einschränkung ihrer Breite und in<br />
dem Vulkangebiet des II e ga u einen tiefen Einbruch.<br />
13. Bau des Schweizerischen und Französischen Jurazuges.<br />
Der Schweizerische und der Französische Jura<br />
zeigen sich in den gefalteten Ketten durchaus abhängig von der<br />
Alpenfaltung, welche in der oligozänen und in der pliozänen<br />
Tertiärzeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Fast genau in der<br />
Richtung N 90° 0 scheidet die wichtigste Strukturlinie in<br />
diesem .Jul'azug, die "Mont Terrible-Kette" (etwa in der<br />
• Richtung Blamont-Aarau), den nördlichen Tafeljura von dem<br />
südlichen Kettenjnra. In der Übel'schiebungszone Hauenstein<br />
Bötzbel'g rückt diese Grenze dann im Norden der Stadt 'Aarau<br />
allerdings etwas gegen Nordost vor.<br />
1) Eine Verwerfung von erheblicherem Betrage (südöstlich von<br />
Langenau) scheint mir nicht vorhanden zu sein. Sie wurde auf<br />
speziellen WunRch des Prof. Dr, E. FRAAS, der aus verschiedenen<br />
Gründen eine solche annimmt und dieselbe durch jene Bohrungen<br />
begründet, eingetragen. - Nach meiner Auffassung liegt hier lediglich<br />
eine mittelmiozäne S t r a n d ver sc h i e b u n g vor j die Juratafel ist<br />
nicht zerbrochen. (Vergl. dagegen: E. FRAAS. Das Tertiär der Ulmer<br />
Hegend, Verein f. vat. Naturk. 1911, und C. R~~GELMANN. Zur Tektonik<br />
der Schwäbischen Alb. Oberrhein. geo!. Verein. 44. Vers, JahreRber.<br />
uud Mitt. 1911.)
55<br />
-----<br />
Fig. 16. Zwei ProJlle durch den Schweizerischen Jura von<br />
A. ßu:dorf.<br />
I'rofil t: Vo .. der LiI ..",..\ o.b . r die I' ~ B8r .. zU S.h ...... rn. bei W eld.but.<br />
Profil:?: Vo .. der Aer. bei SOlo\btl= üb
- 56 -<br />
G. STEINMANN1) hat nachzuweisen versucht, daß im Bau<br />
des Jurazuges sowohl die Nord-Süd verlaufende Vogesenspalte<br />
(Rappoltsweiler-Altkirch) als auch die ebenso durchgreifende<br />
D in k el berg spalte (Schwarzwaldflexur Lörrach-Hohe Winde)<br />
maßgebenden Einfluß geübt haben. Zwischen diesen beiden<br />
Rh ein t al s palt e n seien dann die Falten der Ketten nordwärts<br />
vorgedrungen hinaus über den Blauen zu der B ü r ger wal d<br />
k e t t e bei Pfirt. Aber sowohl im Elsgau bei Pruntrut, als im<br />
Basler Jura hören die Ketten mit derjenigen des Mont-Terrible<br />
auf, und der Tafeljura herrscht in den nördlich anschließenden<br />
Gebieten. B. FÖRSTER~) konnte - durch das Ergebnis der<br />
Bohrungen auf Erdöl - deu Nachweis geben, daß der Weiße<br />
Jura unter den Schichten des Oligozän im Sundgau vorhanden<br />
ist. Allerdings ist derselbe in der Breite von Sierenz schon<br />
30 m; bei Foussemagne (11 km östlich von Belfort) 437 m; bei<br />
Heimsbrunn tiefer als 800 m und im Nonnenbruch bei Luttenbach<br />
sogar tiefer als 853 munter N.N. abgesunken. Vom Isteiner<br />
Klotz gegen Westen hin findet also ein treppenförmiges Absinken<br />
des Jura gegen die Mittellinie der Mulde von Mömpelgard<br />
(varistisch N 48° 0) statt; unterbrochen von einem Rücken<br />
östlich von Altkirch. - In den Kettenjura sind merkwürdige<br />
Tertiärbecken eingesenkt: Die Becken von Deisberg, Laufen,<br />
Moutier (Münster) und Balsta!. Die wichtigsten Ketten sind in<br />
unserem Gebiet diejenigen, welche nach dem Weißenstein, Moron<br />
(Hauenstein), Raimeux (Paßwang) und Mont-Terrible benannt<br />
werden. - Im Ta fe lj ur a zeigt sich nebenbei wiederum ein<br />
Schimmer von v aris tis ch er S t ru k tur in der merkwürdigen<br />
jungen (miozänen?) Flex ur, welche vom Bruchrande des Schwarzwaldes<br />
bei Freiburg ausstrahlt und den Sundgau durchquerend<br />
in dem Winkel bei Köstlach endet, sie hält die Richtung ein<br />
N 41 0 O. Wie bereits auf S. 35 ausgeführt wurde, zeigen die<br />
merkwUrdig gebauten "J u l' abu eh t e n" am Sundgau - die<br />
1) Bemerkuugen über die tektonischen Beziehungen der oberrheinischen<br />
Tiefebene zu dem nordschweizerischen Kettenjura. Berichte<br />
naturf. Ges. zu Freiburg i. B. 1892. 2. (4.) S. 150 f. - FerJ.1er<br />
A. 'rOlll,~m, Verh. der Naturf. Ges. in Basel. 11. Basel 1897. S. 284:f. -<br />
Dagegen hat L. v AN WERVEKE auf Grund von neuen Bohrergebnissen<br />
im Sundgau andere Anschauungen gewonnen. (Mitt. der geoJ. L.-A.<br />
VOll Elsaß-Lothr. Bd. VI. 1908. S. 3:20 f.)<br />
2) Weißer Jura unter dem Tertilir des Sundgaus im Oberelsaß.<br />
Mitteil. der geoJ. L.-A. VOll Elsaß-Lothr. ö. 1904. S. 381 f.
57 -<br />
Largbucht, die IlIbucht und die Bucht von Birseck bei Basel -<br />
besonders schön das Eingreifen der varistischen Strukturlinie in<br />
das alpine System. - Südlich davon treten am Mont-Terrible<br />
wiederum nach NO gerichtete S t ö run gen 1) auf, welche den<br />
D 0 u b s veranlaßt haben, seinem Laufe bei st. Ursanne plötzlich<br />
eine ganz entgegengesetzte Wendung zu geben. - Südlich VOll<br />
Rheinfelden ist der Tafeljura bei Liestal und Gelterkinden durch<br />
eine ganze Schar von (nach NO gerichteten u n tel' mi 0 z ä 11 e 11)<br />
varistischen Ver wer fun gen 2) zerstückelt, GI' ä ben und<br />
Ho rs te erscheinen als schmale Streifen, welche mit der Köstlacher<br />
Flexur übereinstimmend streichen und ein ziemlich senkrechtes,<br />
aber ungleich tiefes Einbrechen der Schollen erkennen<br />
lassen. In dem Wechsel von stehengebliebenen Horsten und<br />
eingesunkenen Gräben ist die Sedimentreihe natürlich verschieden<br />
abgetragen worden. In den eingebrochenen Partien sind z. T.<br />
die Betakalke des Weißen Jura noch erhalten, während in den<br />
Horsten gewöhnlich alles abgetragen ist bis auf den Hauptrogenstein<br />
des Braunen Jura.<br />
Die Tektonik des Sc h w e i zer J u l' a hat weitere Aufklärung<br />
erhalten durch Profile in einer Arbeit von A. BUXTORF: "B e<br />
rn e r k u n gen ii b erd enG e b i l' g s bau des N 0 r d s c h w e i z e<br />
rischen Kettenjura, im besonderen der Weißensteink<br />
e t t e". (Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft,<br />
Bd. 63, Jahrgang 1911, Abh. Heft 3.)<br />
Die Te k ton i k des Eis gau e s ist neuerdings von KARL<br />
L. HUMMEL näher untersucht worden. Dieser fand in diesem<br />
"Berne)' Tafcljura" (Gebiet nordwärts von Pruntrut und<br />
BI am 0 n t) mehrere meridional streichende Ver wer fu n gen;<br />
radiale Krustenbewegungen des Elsgaues vom Alter des unteren<br />
Oligozän, welche die Transgression des tongrischen Meeres mit<br />
veranlaßt haben. - Die Auffaltung des Kettenjura verlegt dieser<br />
Autor,' ebenso wie die Entstehung der kleineren Antiklinalen<br />
im Elsgauer Tafellande in das jüngere Pliozän. -- (Vergl. Be-<br />
1) VergI. F. MÜHLBERG, Bericht über die Exkursionen des Oberrheinischen<br />
geol. Vereins. Beilage zum Bel'. über die XXV. Vers. zu<br />
Basel im April 1892.<br />
2) Vergl. FR. v. HUFlNE, Geologische Beschreibung der Gegend<br />
von Liestal im Schweizer Tafeljura. Verhand1. N aturf. Ges. Basel 12.<br />
Basel 1900 und A. BuxToRl" Ec10gae geo1. Helvetiae 6. NI'. 2. 1900.<br />
'Über vor- oder altmiozltne Verwerfungen im Basler Tafel-Jura.
- 58 -<br />
richte der Naturforschenden Ges. zu Freiburg i. Br.<br />
1914.)<br />
Band XX.<br />
H. Bau des Oberschwäbischen Molassebeckens.<br />
(VergJ. das Gebirgsprofil am unteren Rand der Karte.)<br />
Der Bau des Moll ass e be c k en s zwischen dem Jurazug<br />
und den Alpen ist ziemlich einfach. Der obere Weiße Jura verschwindet<br />
auf der Linie Aarau-Schaffhausen-Ulm endgültig<br />
unter den Schichten der mi 0 z ä ne n Molasse; das ist die nahezu<br />
geradlinig (etwa 570 m über dem Meere) verlaufende Mantellinie<br />
einer tonnengewölbeartigen M u I d e, welche der va r ist i<br />
sc he n S t r u k t u I' li nie N 51° 0 gehorcht. In der miozänen<br />
Tertiärzeit lag in dem langgestreckten Dreieck Genf-Regensburg-Linz<br />
eine Ge 0 s y n k I i n ale, in welcher eine unermeßliche<br />
Fiille von feinen Sanden nach Hnd nach zur Ablagerung gelangte.<br />
Die ~Iächtigkeit der oberen Süßwassermolasse mit Unio<br />
fiabellata und Helix sylvana schwillt in der Mitte des Beckens<br />
wohl auf 400 m an, die Me e I' e s mol as se darf man dort auf<br />
mindestens 300 m schätzen, und die u nt e I' e Süß was se r<br />
mol as semit Helix 1'ugulosa dürfte mehr als 600 m erlangen.<br />
Auf und am Jura keilen die Schichten aus. Die beiden<br />
Siißwasserbildungen sind dort als Kalkfazies (Landschneckenkalke)<br />
ausgebildet, während beckeneinwärts, wie gesagt, die Sande<br />
weit vorherrschen. Die Mol ass emu I d e hat im Gebiet unserer<br />
Karte - auf der Linie Ehingen-Sonthofen - eine Breite von<br />
95km. Die große An tiklin ale Hochham-Hauchenberg (etwa<br />
12111 m über dem Meere), in N 63 0 0 verlaufend, schließt die<br />
tonnenförmige Mulde am Rande der Voralpen ab; hier steigt<br />
auch die sonst meist von der oberen Süßwassermolasse<br />
iibcrdeckte Me e I' e s mol ass e wieder an den Tag. (Siehe<br />
Profil der Karte.)<br />
In Ochsenhausen (Oberschwaben) wollte man -'29km<br />
VOll der Mantellinie Schaffhausen _. Ulm gegen SO entferntmioziinc<br />
BI' a unk 0 h 1 e n erschließen. Die Hängebank des BohrloehR<br />
liegt dort 59!) m üher dem Meere; der Bohrer drang hinab<br />
his 141 m unter den Meeresspiegel; der Löffel brachte aber fast<br />
niehtH heranf :111, feinen Sand und immer wieder feinen Sand<br />
(l'fohHand); d. h. er dnl'chtenfte 736 m Sand- und Mergelschichten,<br />
ohne deli .Jnra zn el'l'ei('hen; leider auch olme die hegehrten
59<br />
Kohlen. zu treffen .. Doch gelang es, durch Muschelreste und Haifischzähne<br />
festzustellen, daß das Hangende der hier 207 m mächtigen<br />
Meeresmolasse bei 319 m tiber N.N. liegt.-Zieht man<br />
von Mengen aus eine gerade Linie in N 67° 0 nach Burtenbach<br />
an der Mindel, so hat man eine wichtige Knickung'linie<br />
(flache Antiklinale) im oberschwäbischen Schichtenbau eingezeichnet,<br />
welche wenigstens bis zur Iller gültig ist. Nördlich von<br />
Biberach und bei Baltringen, sowie südlich vom Bussen hebt sich<br />
auf dieser tektonischen Linie die Me e I' e sm 0 las s e (Muschelsandstein)<br />
aus der Mulde 1) empor, das Hangende im Mittel 597 m<br />
über dem Meere; im Bohrloch Ochsenhausen (16 km gegen SO)<br />
dagegen fand man nur noch 319 m; wir haben also gegen das<br />
)Iuldentiefste hin, im Hangenden der Meeresmolasse ein Schichtengefälle<br />
von 1,7 %. - Faßt man die gleichartigen Ablagerungen<br />
auf der Juraplatte ins Auge, so findet man für ihre mittlere<br />
Meereshöhe etwa 584 m. Nur die etwas jüngere tertiäre Jurana<br />
gel fl u h transgredierte noch viel höher hinauf auf die Juraplatte<br />
(bis 860 m). Von der Baltringer Knickungslinie aus finden<br />
wir gegen Nordwest über die Donauspalte hinüber merkwürdigerweise<br />
nahezu hol' i z 0 n tal e Lagerung im Hangenden der<br />
mal' i n e n Sc h ich t e n; gegen Süd 0 s te n findet dagegen zum<br />
Mnldentiefsten hinab ein relativ s ta I' k es Ein fall e n der Schichten<br />
statt. - Die tiefsten Tiefen der Molassemulde sind bis heute<br />
unbekannt, keine Tiefbohrung hat sie erschlossen. Doch wird<br />
man nicht viel fehlgehen, wenn man die Muldenachse etwa auf<br />
die Linie Zürich-Ravensburg verlegt; das wäre N 59 0 O.<br />
Für das B 0 den see g e b i e t sind - neben den trefflichen<br />
Arbeiten von Oberrealschuldirektor W. SCHMIDLE 2) (Konstanz)<br />
für die Tektonik von Bedeutung geworden: S. G. GUTMANN.<br />
Gliederung der Molasse und 'l'ektonik des östlichen Hegaus.<br />
1) In dieser Mulde treten noch heute leichte Erderschütterungen<br />
ziemlich häufig auf. Biberach war sogar im Januar 1842<br />
der Schauplatz eines kleinen Erdbebenschwarms. Die meisten oberschwäbischen<br />
Erdbeben kommen aber von den Her den der V 0 T<br />
alpen, aus der Schweiz und dem AIgäu. Andere aber stammen aus<br />
dem Hegau und aus dem Bodensee und haben nur ein kleines<br />
Schüttergebiet.<br />
2) Die zahlreichen einzelnen Beiträge SUHMIDLES sind nun zusammengefaßt<br />
in dem Werke: W. SUHMIDLE; Die diluviale Geologie<br />
der Bodenseegegend. Mit 42 Abb. und 7 Tafeln. Westermann, 1914.)
- 60<br />
(Mitt. d. Großh. Bad. Geol. L.-A. VI. Bd., 2. Heft. 1911. S.469<br />
bis 514.) und:<br />
S. KNuPFER. Molasse und Tektonik des südöstlichen Teiles<br />
des Blattes S t 0 c k ach der topographischen Karte des Großh.<br />
Baden. (Berichte der Naturforsch.-Gesellschaft zu Freiburg i. Br.<br />
Bd. XIX. 1912.)<br />
Aus diesen Arbeiten und unserer neugestalteten Karte geht<br />
unzweifelhaft hervor: "Das Bodenseebecken ist ein<br />
Grabenbruch".<br />
Die Gebilde der vier Eiszeiten (Günz-, Mindel-, Riß-,<br />
und Würm-Eiszeit nach A. PENCK), deren alpiner Schutt n-50 m<br />
mächtig ganz Oberschwaben überdeckt, sind nun auch von der<br />
geologischen Landesaufnahme Württembergs in Angriff genommen<br />
werden und haben in den Blättern in 1: 25000: 179 Friedrichshafen;<br />
180 Tettnang; 1S1 N eukirch und 184 Langenargen<br />
spezielle Darstellung gefunden. (Vergl. auch die zugehörigen<br />
"E r I ä u t e run g s heft e" und MARTIN SCHMIDT. Die geologischen<br />
Verhältnisse des Oberamts Tettnang. Oberamtsbeschreibung ;<br />
zweite Auflage. Stuttgart 1914.)<br />
Unsere Übersichtskarte gibt von der Ausdehnung des Rheingletschers<br />
- während der dritten und vierten Vergletscherung<br />
- ein klares Bild. Auch die Rückzugsphasen der vierten<br />
Eiszeit sind aus der Karte zu ersehen.<br />
11). Aufbau der Voralpen (Säntis, Allgäu und Vorarlberg).<br />
(Vergl. das Gebirgsprofil am unteren Rand der Karte.)<br />
Die Strukturlinien in dem kleinen Stück der Voralpen,<br />
das in der Südostecke unserer Karte noch zur Darstellung gelangt<br />
ist, hängen natürlich aufs engste mit der Alp e n falt u n g der<br />
Tertiärzeit zusammen, und doch schimmert auch in den S än tisketten<br />
und den Algäuer Kalkalpen in der teilweisen<br />
SW -NO-Richtung der Faltenziige noch die va I' ist i sc he<br />
Strukturlinie durch. Das nordwärts ziehende Rheintal, südlich<br />
vom Bodensee, scheidet bekanntlich die verschieden gebauten<br />
Ost- und Westalpen voneinander. Das spricht sich deutlich aus<br />
in dem Faltenwurf der Vorarlberger Kreidezüge 1), welche ent-<br />
1) Diese Tektonik ist geschildert in: MICH. V ACEK, Über Vorarlherger<br />
Kreide. Eine Lokalstudie. Jahrb. k. k. Geol. R.-A. 2D. Wien,<br />
Forts. s. S. 61.
61<br />
6
~ 62 -<br />
nichts; hier ist alles solid und "wurzelecht". Daß übrigens<br />
die Keuperschichten der Kai kai p e n auf den tertiären Flysch<br />
überschoben sind, läßt sich auf dem heutigen Ausbiß (Zitterklapfen--Oberstdorf-Hindelang-Vilstal)<br />
überall beobachten und<br />
ist auch aus unserem Profil deutlich zu ersehen. Die bahnbrechenden<br />
Arbeiten von A. ROTHPLETZ haben das Einzeichnen<br />
der "Stirllränder" der rätischen Überschiebungell in unsere<br />
Karte ermöglicht, dank den direkten Mitteilungen des genannten<br />
Herrn. Über Ausdehnung und Herkunft der ,,1' ä t i s c h e n<br />
Schnbmasse" gibt der Ir. und IH. Band seiner "Geologischen<br />
Alpenforschungen" , München 1905 und 1908, überraschende<br />
Nachweise.<br />
Für das A 19'ä u zwischen Breitach und Still ach hat H. PON<br />
TOPPIDAN eine Neuaufnahme in 1 : 25000 geliefert, welche die<br />
"Algäuer Schubmasse" und einen kleinen Teil der "Lechtaler<br />
Schubmasse" in ihrem Aufbau speziell darstellt. (VergI.<br />
Bayer. Geognostische Jahreshefte. XXIV. Jahrgang. 1911. München.<br />
1912, S. 1-22.)<br />
A. TORNQUIsT hat (I. c. S. 111) versucht, die tektonischen<br />
Vorgänge im Gebiet der Algäuer und Vorarlberg'er Voral<br />
p en zeitlich festzustellen. Das heutige Gebirgsbild setzt sich<br />
zusammen aus der Algäuer Schubmasse (Hauptdolomit, Rät<br />
und Lias), wurzellos auf Flysch stehend, südlich, östlich und nordöstlich<br />
von Oberstdorf ; auf diese Schubmasse gelangte durch<br />
späteren Aufschub die Lech talsch u bmasse, welche die Mädelergabel<br />
und den Hochvogel aufgebaut hat. Der Hauptdolomitdieser<br />
höheren Schubmasse ruht überall auf den weichen Fleckenmergeln<br />
des Lias. In dem Ausbiß der Lechtaler Überschiebung<br />
beobachtete auch G. SCHULZE nirgends 0 beI' j ur a; an den<br />
Höfats aber sind auf der Algäuer Schubmasse noch mächtige<br />
Komplexe von Oberjura erhalten. Es erregt nun das allergrößte<br />
Interesse, daß auch in der äußeren Flyschzone - nördlich von<br />
den Kreidekettell - beim Feuerstätterkopf (westlich vom Bolgen)<br />
eine 1~ kill lange, ostweststreichende, seiger im Gebirge stehende<br />
GesteinRplatte VOll 0 b e rem W eiß e m J ur a nachgewiesen worden<br />
ü;t (TORN
- 63 -<br />
teils aus groben Kong'lomeraten bestehenden Flysches erfolgte<br />
während des Eozäns und des Olig·ozäns. Das außerordentlich<br />
wechselnde Gesteinsmaterial des Flysch kann nur VOll den inneralpinen<br />
Gebieten abgeleitet werden. Das gTobe kristallinische<br />
Basalkonglomerat stammt von der ersten kräftigen Heraushebung<br />
der Alpen im Eozän (also auch der rätselhafte Bolgengranit).<br />
Der Deckenschub der Algäuscholle erfolgte - während der<br />
Ablagerung des jüng'eren Flyschs - im älteren Olig·ozän; die<br />
IJechtaldeckl\wurde während des oberen Oligozäns aufgeschoben.<br />
- Die energische Auffaltung der Kreideketten und der<br />
Flyschzone, sowie die Überschiebung der Kreide auf den<br />
Flysch war das Werk der gebirgsbildenden Kräfte während des<br />
älteren Miozäns. - Die F alt u n g der Mol ass e und die<br />
Überschiebung des Flysch auf die Molasse geschah sodann im<br />
o her· Miozän. - Diese gewaltigen tektonischen KraftäußeruilgeIl<br />
wirkten naturgemäß auch auf den gesamten süddeutschen Schichtenbau<br />
hinüber und haben insbesondere die Juraplatte der Schwäbischen<br />
Alb in Mitleidenschaft gezogen.<br />
Riickblick auf das ganze Gebiet.<br />
Blickt man zurück nach dem niederrheinischen Schiefergebirge<br />
und überschaut den geologischen Aufbau unseres Gebietes<br />
nochmals in allgemeiner Übersicht, so ergibt sich,<br />
daß hier die Strukturlinien der gebirgsbildenden Kräfte<br />
mit einfachen Mitteln eine außerordentliche Mannigfaltigkeit im<br />
Antlitz der Erdkruste hervorgebracht haben. Durch Aufrichtung<br />
der Schichtentafeln, Niederbrechen der Senkungsfelder und durch<br />
die Abtragung der "Hüllmassen der emporstrebenden kristallinen<br />
Gebirgskerne - alles nach den festen Regeln, welche die<br />
Strukturlinien vorgezeichnet haben - ist eine reizvolle vielgestaltige<br />
Landschaft entstanden. Was wäre Siiddeutschland<br />
für ein eintöniges Flachland ohne dieses Walten der gebirgsbildenden<br />
Kräfte! - Nun aber zeigt sich eine überwältigende<br />
Mannigfaltigkeit in den Landschaftsformen, in den Höhenverhältnissen,<br />
in der Zusammensetzung der Böden, in der Bewachsung<br />
und infolge davon in dem unendlichen Reichtum an yerschiedenartigen<br />
Schichtquellen und an nutzbaren Flußgefällen.<br />
Damit sind sehr wichtige und mannigfaltige Lebensbedingungen<br />
für die Volkswirtschaft geschaffen worden.
- 64<br />
Die wichtigste Strukturlinie ist diejenige der interkarbonischen<br />
varistischen Faltung, welche sich im Mittel - in<br />
unserem Kartengebiet - in der Richtung N 1)0 0 0 zeigt •. Sie<br />
herrscht offenbar vor in der gesamten kristallinen Unterlage<br />
Südwestdeutschlands und verschafft sich in den Strukturlinien<br />
immer wieder Geltung bis herab auf unsere Zeit; selbst durch<br />
Sedimentdecken hindurch von 1000 m bis 2000 m Mächtigkeit.<br />
Den Richtlinien dieses alten Faltenwurfs folgen noch in unseren<br />
Tagen die glücklicherweise meist leichten Erdbebenwellen ; sie<br />
ziehen vorherrschend in der Richtung von Südwest nach Nordost<br />
durch unser Land.<br />
In naher Beziehung zu dem eben genannten Generalstreichen<br />
steht die vielleicht ältere, vielleicht aber auch etwas<br />
jüngere herzynische Faltung, welche bei uns die Strukturlinien<br />
im Durchschnitt in die Richtung N 51 0 W stellt. Sie<br />
scheint ebenfalls einen Teil des kristallinen Untergrundes für<br />
sich in Anspruch zu nehmen und das varistische System zu<br />
durchkreuzen, wie dies ja aus dem Fichtelgebirge und dem<br />
großen Böhmischen Massiv wohl bekannt ist. Die beiden<br />
Systeme verhalten sich in der Sedimentdecke wie Kluft und<br />
Gegenkluft.<br />
Das größte geologische Ereignis in unserem Gebiet - das<br />
allmähliche tiefe und immer tiefere Einbrechen des Rheintalgrabens<br />
- steht niit den eozänen, mitteloligozänen, obel'miozänen, pliozänen<br />
und diluvialen Alpenfaltungen, Überschiebungen und<br />
Hebungen in innigstem Zusammenhang. Die hierdurch entstandenen<br />
Richtlinien verlaufen ungefähr in No 0 0 und N 90 0 0;<br />
das sind die überaus wichtigen alpinen Strukturlinien.<br />
Die vorliegende Arbeit sucht die gesamte Tektonik Südwestdeutschlands<br />
einheitlich darzustellen. Was die gewaltigen<br />
Störungen der Tertiäl'zeit auseinandergerissen haben und<br />
was auch mit der früheren politischen Trennung der einheitlichen<br />
Darstellung entbehrte, faßt nun unser Kartenrand friedlich<br />
zusammen. Möge diese einheitliche Darstellung auch - im<br />
Neudruck 1914 - der 9, Auflage dazu dienen, die Kenntnis der<br />
geologischen Verhältnisse Slidwestdeutschlands nicht nur in<br />
weiteren Kreisen zu fördern, sondern auch zu vertiefen und<br />
einheitlicher als seitdem auszugestalten!
Inhaltsübersioht.<br />
Vorwort . . . . . . . . . . .<br />
Geschichte und Inhalt der Karte . .<br />
Die wichtigsten Strukturlinien im geologischen Aufbau des<br />
Kartengebietes, und zwar:<br />
Seite<br />
3<br />
;)<br />
Allgemeiner Überblick ............ 11<br />
1. Bau des Hoch- und Idarwaldes im Hunsrück (Devon) . . 14<br />
2. Bau des Saarbrücker Steinkohlengebirges (Karbon) 15<br />
3. Der Auf bau im Hügellande des Rot 1 i e gen den an der<br />
Glan und Nahe. . . . . . . . . . • . . . ; 18<br />
4. Der Bau der Pfälzer Mulde (Trias und Jura im<br />
Westrich und im Stufenland Lothringens) 19<br />
5. Bau der Vogesen (des Wasgenwaldes) 20<br />
6. Bau der Ha r d t (des Pfälzerwaldes) 26<br />
7. Bau des Rheintalgrabens 29<br />
8. Bau des S eh war z wal des 38·<br />
9. Bau des 0 den wal des. . . 42<br />
10. Bau des Kr a ich gau es 45<br />
11. Der Schichtenaufbau im Sc h w ä bis ehen Trias be c k e n 46<br />
12. Bau der Sc h w ä bis c h e n Alb. . • . . . . . . . 50<br />
13. Bau des Schweizerischen und Französischen J u ra zug e s<br />
14. Bau des Oberschwäbischen Molassebeckens .<br />
15. Aufbau der Vor alp e n (Säntis, Allgäu und Vorarlberg)<br />
Rückblick 3_uf das ganze Gebiet ...... .<br />
54<br />
58<br />
60<br />
63
Erdbebenherde und Herdlinien<br />
."im südwestäeutschen Gebirtsbau.<br />
Oargestellt von C. Regelmann.<br />
Tafel 1.<br />
b't/~h6nMrrh, 7f>kmni(/:he linien: -. --Herdlmfe(rinfoche}<br />
Kfu/eI:* lrJrme~no/J H++' '!,:::/::~'(J:f;J};':;~) _·.~--;;-Wl!tdl"*auf1Mdenl;,,;e<br />
• I: *EJ,.fllad:lJU"9U1l~m .......... 8ruchlillie_l'OI:lOm -.l!:!!!tJ:fHerdllmilo~<br />
• 1/[: .t'flillf>/~~f#O«n~ ~:~:;-:: +*.+*+* HMi!ini.ovf!irflinie<br />
~ l SlrJaf!icheErdhebenltYJrf(~än1'Jn.<br />
-- -- OteP{e,/e<br />
-- --;fJJjMda$<br />
QefH!ralll!'Pkhen derSc.-fllch~ntafeln .<br />
~Krifo/I
•<br />
,
.. •<br />
•<br />
..<br />
..


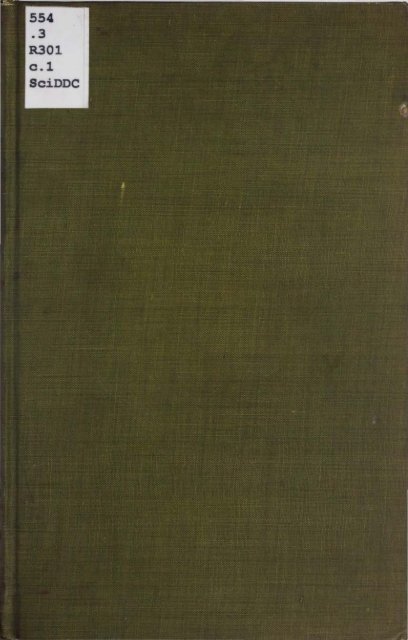




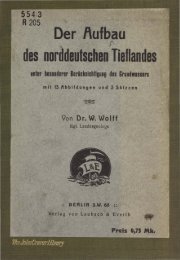


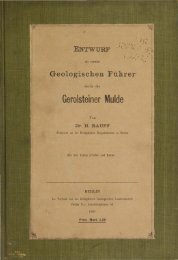



![Selbstl{ostenberecllnllng illl ]\iaschinenbatl](https://img.yumpu.com/22368829/1/161x260/selbstlostenberecllnllng-illl-iaschinenbatl.jpg?quality=85)

