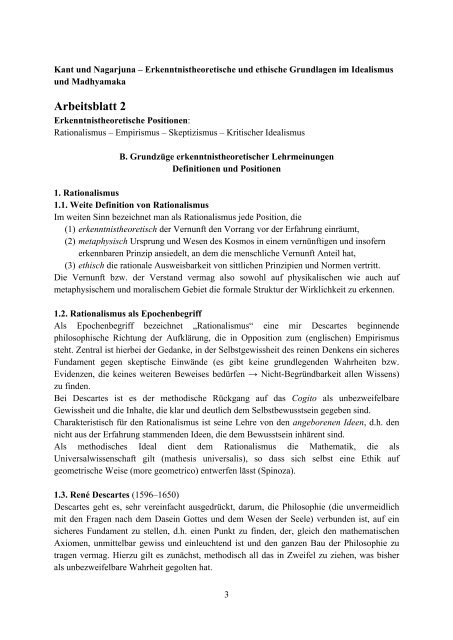Arbeitsblatt 2
Arbeitsblatt 2
Arbeitsblatt 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kant und Nagarjuna – Erkenntnistheoretische und ethische Grundlagen im Idealismus<br />
und Madhyamaka<br />
<strong>Arbeitsblatt</strong> 2<br />
Erkenntnistheoretische Positionen:<br />
Rationalismus – Empirismus – Skeptizismus – Kritischer Idealismus<br />
B. Grundzüge erkenntnistheoretischer Lehrmeinungen<br />
Definitionen und Positionen<br />
1. Rationalismus<br />
1.1. Weite Definition von Rationalismus<br />
Im weiten Sinn bezeichnet man als Rationalismus jede Position, die<br />
(1) erkenntnistheoretisch der Vernunft den Vorrang vor der Erfahrung einräumt,<br />
(2) metaphysisch Ursprung und Wesen des Kosmos in einem vernünftigen und insofern<br />
erkennbaren Prinzip ansiedelt, an dem die menschliche Vernunft Anteil hat,<br />
(3) ethisch die rationale Ausweisbarkeit von sittlichen Prinzipien und Normen vertritt.<br />
Die Vernunft bzw. der Verstand vermag also sowohl auf physikalischen wie auch auf<br />
metaphysischem und moralischem Gebiet die formale Struktur der Wirklichkeit zu erkennen.<br />
1.2. Rationalismus als Epochenbegriff<br />
Als Epochenbegriff bezeichnet „Rationalismus“ eine mir Descartes beginnende<br />
philosophische Richtung der Aufklärung, die in Opposition zum (englischen) Empirismus<br />
steht. Zentral ist hierbei der Gedanke, in der Selbstgewissheit des reinen Denkens ein sicheres<br />
Fundament gegen skeptische Einwände (es gibt keine grundlegenden Wahrheiten bzw.<br />
Evidenzen, die keines weiteren Beweises bedürfen → Nicht-Begründbarkeit allen Wissens)<br />
zu finden.<br />
Bei Descartes ist es der methodische Rückgang auf das Cogito als unbezweifelbare<br />
Gewissheit und die Inhalte, die klar und deutlich dem Selbstbewusstsein gegeben sind.<br />
Charakteristisch für den Rationalismus ist seine Lehre von den angeborenen Ideen, d.h. den<br />
nicht aus der Erfahrung stammenden Ideen, die dem Bewusstsein inhärent sind.<br />
Als methodisches Ideal dient dem Rationalismus die Mathematik, die als<br />
Universalwissenschaft gilt (mathesis universalis), so dass sich selbst eine Ethik auf<br />
geometrische Weise (more geometrico) entwerfen lässt (Spinoza).<br />
1.3. René Descartes (1596–1650)<br />
Descartes geht es, sehr vereinfacht ausgedrückt, darum, die Philosophie (die unvermeidlich<br />
mit den Fragen nach dem Dasein Gottes und dem Wesen der Seele) verbunden ist, auf ein<br />
sicheres Fundament zu stellen, d.h. einen Punkt zu finden, der, gleich den mathematischen<br />
Axiomen, unmittelbar gewiss und einleuchtend ist und den ganzen Bau der Philosophie zu<br />
tragen vermag. Hierzu gilt es zunächst, methodisch all das in Zweifel zu ziehen, was bisher<br />
als unbezweifelbare Wahrheit gegolten hat.<br />
3
1. Als fragwürdig erscheint zunächst das Sein der Außenwelt, dass nämlich die Dinge in<br />
Wahrheit so sind, wie sie uns erscheinen und dass sie überhaupt existieren.<br />
2. Auch unsere eigene leibliche Existenz (die uns bisher gewiss erschien) mithin das ganze<br />
Leben könnte ein beständiger Traum sein, dem nichts Wirkliches entspricht.<br />
3. Dennoch scheint es ein unaufhebbares Wissen zu geben. Nämlich etwa der Satz „2 + 3 =<br />
5“, oder die allgemeinsten Grundbegriffe wie Ausdehnung, Gestalt, Zeit, Raum. Aber auch<br />
diese unzertrennlich mit der Struktur des menschlichen Geistes verbundenen Gewissheiten<br />
könnten bloß die Produkte eines täuschenden Gottes (genius malignus) sein, der den<br />
Menschen in eine wesenhafte Verkehrung und Unwahrheit hineingeschaffen hätte.<br />
Der Zweifel aber gebiert aus sich selbst eine ursprüngliche Gewissheit: Mag auch alles, was<br />
ich mir vorstelle, jeder Gegenstand, den ich zu erkennen glaube, fragwürdig sein, so existieren<br />
doch meine Vorstellungen von diesem Gegenstand, und damit existiere auch ich, der ich diese<br />
Vorstellungen habe. Mag mich auch ein betrügerischer Gott täuschen, so existiere ich, der<br />
Getäuschte doch: „Ich denke, also bin ich“ bzw. „Ich zweifle, also bin ich“ bzw. „Ich werde<br />
getäuscht, also bin ich“. Was aber ist dieses „Ich“, das sich seiner selbst im Zweifel bewusst<br />
ist?<br />
In der Selbsterfahrung erfährt es sich als denkendes Wesen. Von der körperlichen Welt her<br />
und mit Hilfe der Begriffe, die aus der Erfahrung der Weltdinge geschöpft sind, kann es<br />
verstanden werden als ein „denkendes Ding“ (res cogitans) bzw. als Etwas, an dem sich die<br />
Eigenschaften des Denkens, Wollens und Fühlens in der gleichen Weise vorfinden, wie die<br />
Farbe oder Schwere an den Dingen der physikalischen Welt. Dabei ist das Wesen des „Ich“<br />
„Denken“, in einem Sinn der den gesamten Bereich des Bewusstseins (Fühlen und Wollen)<br />
umfasst. Das bloß im Bewusstsein lebende Ich aber verliert theoretisch dabei den Kontakt mit<br />
den anderen nicht bewussten, nicht denkenden Wesen (res extensa). Die res cogitans ist durch<br />
eine unüberwindliche Kluft von der res extensa getrennt.<br />
Allerdings reicht auch die Entdeckung der Selbstgewissheit und die Untersuchung des<br />
Wesens des Ich nicht hin, die Philosophie auf ein sicheres Fundament zu stellen. Es bleibt die<br />
Frage nach dem Ursprung der Wirklichkeit bzw. die Frage nach Gott. Denn die grundlegende<br />
Verkehrung setzt ja, unter der Herrschaft des Schöpfergedankens, voraus, dass Gott als<br />
Betrüger gedacht wird. Descartes muss also nicht nur zeigen, dass Gott wahrhaftig ist,<br />
sondern grundlegender, dass Gott überhaupt existiert und unsere klaren und deutlichen<br />
Erkenntnisse tatsächlich Gültigkeit hinsichtlich der Welt der Dinge besitzen.<br />
Descartes geht davon aus, dass der Mensch in seinem Innern die Idee eines höchst<br />
vollkommenen Wesens vorfindet. Ein unvollkommenes Wesen wie der Mensch kann aber die<br />
Idee des höchst vollkommenen Wesens nicht aus sich selbst hervorbringen. Also kann diese<br />
Idee nur durch das höchst vollkommene Wesen selbst in uns eingepflanzt sein (idea innata).<br />
Gott als Ursprung der Idee Gottes muss also notwendig existieren. Wenn aber Gott<br />
vollkommen ist, dann gehört zu seiner Vollkommenheit auch die Wahrhaftigkeit; denn Betrug<br />
entspringt einem Mangel. Also garantiert die Wahrhaftigkeit Gottes die Richtigkeit der Welt<br />
4
und ihrer Erkenntnis, wobei auch die unmittelbare Evidenz daraus ihre letzte Begründung<br />
erhält.<br />
Literatur:<br />
Descartes, René: Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité<br />
dans les sciences. (1637). Deutsch: Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und<br />
der wissenschaftlichen Forschung. Hamburg: Meiner, 1997.<br />
Descartes, René: Meditationes de prima philosophia (1641). Deutsch: Meditationen über die<br />
Grundlagen der Philosophie. Hamburg: Meiner, 2008.<br />
2. Empirismus<br />
2.1. Weite Definition von Empirismus<br />
Allgemein bezeichnet „Empirismus“ die erkenntnistheoretische Lehre, gemäß der alles<br />
Wissen seinen Ursprung nicht im Verstand oder der Vernunft, sondern allein in der Erfahrung<br />
(Beobachtung, Experiment) hat. Zentral für den Gebrauch des Erfahrungsbegriffs im<br />
Empirismus ist die Idee, dass das Erkenntnissubjekt dem Objekt (in letzter Konsequenz)<br />
passiv gegenübersteht. Erfahrung in diesem Sinne kann sich dann näher bestimmen als die<br />
Gesamtheit des noch unstrukturiert Gegebenen, das sich erst im Erkennen durch Begriffe und<br />
Erinnerung zu einer stabilen und erkennbaren Wirklichkeit formt.<br />
2.2. Empirismus (Thomas Hobbes 1588–1679)<br />
Die Kritik von Hobbes am Rationalismus bezieht sich insbesondere auf die Beurteilung von<br />
Descartes’ erstem Prinzip. Daraus, dass ich denke, folgt zwar nach Hobbes, dass ich existiere,<br />
aber nur darum, weil jede Tätigkeit jemanden voraussetzt, der sie ausübt. Dass „Ich“ auf ein<br />
rein geistiges Wesen hinweist, lehnt Hobbes ab, da er es für möglich hielt, dass das<br />
Bewusstsein auf gewissen Vorgängen im menschlichen Organismus beruht.<br />
Begründete Urteile über das Verhältnis von Geist und Körper sind unmöglich, da wir<br />
grundsätzlich nicht imstande sind, das Wesen der Wirklichkeit, auch nicht das Wesen des<br />
Körpers, zu erkennen. Da es ohne Erfahrung keine Vorstellungen (Ideen) gibt, können wir<br />
auch keine Idee von Gott haben.<br />
Nach Hobbes gibt es also keine wahrhaften und unveränderlichen Naturen, deren<br />
Zusammenhang eine objektive vernünftige Ordnung bilden würde, auch keine einsichtigen<br />
Urteile, in denen etwas von dieser Ordnung erfasst würde.<br />
Das direkte Erfahrungsobjekt sind nicht die Dinge selbst, sondern die Vorstellungen. Wenn<br />
wir vernünftig urteilen, drücken wir also nicht eine Einsicht in die Natur der Dinge aus,<br />
sondern verbinden Namen aufgrund ihrer konventionellen Bedeutung. Namen werden<br />
aufgrund von Vorstellungen gebildet, die ihrerseits unmittelbar oder mittelbar der Erfahrung<br />
entspringen. Ihre genaue Bedeutung erhalten sie durch Übereinkunft der Angehörigen einer<br />
Sprachgemeinschaft.<br />
Hobbes fordert, die Vorstellungen, die er als die unmittelbaren Gegenstände des Bewusstseins<br />
ansieht, so lange zu zerlegen, bis man zu einfachen gedanklichen Elementen gelangt. Wenn<br />
5
man den einfachen Gedanken Namen zuordnet, kann man mit diesen Namen, wie mit den<br />
Symbolen der Algebra, „rechnen“.<br />
Außer Nominaldefinitionen gibt es auch genetische Definitionen, die angeben, wie die<br />
definierte Sache entstanden bzw. als entstanden zu denken ist. (Bezeichnet man z.B. einen<br />
„Kreis“ als „Linie, die durch Bewegung eines Punktes mit konstantem Abstand von einem<br />
gegebenen Punkt erzeugt wird“, so liegt eine genetische Definition vor)<br />
Einfache Begriffe, die sich bei der Zergliederung der Vorstellungen von Dingen ergeben, sind<br />
„Größe“, „Gestalt“, „Bewegung“, „Raum“, „Zeit“, „Ursache“, „Wirkung“, mit denen sich<br />
Grundsätze formulieren lassen, die für alle Körper gelten (z.B. Trägheitsprinzip oder der Satz<br />
über die Gleichheit von Aktion und Reaktion). Diese Sätze sollen nicht nur für physikalische,<br />
sondern auch für organische und für soziale „Körper“ (Staaten) gelten.<br />
In der Erkenntnislehre erblickt Hobbes eine Anwendung der allgemeinen Bewegungsgesetze<br />
auf Bewegungen im menschlichen Organismus, insbesondere in den Sinnenorganen und den<br />
Nerven.<br />
Das Leben führt er auf die Bewegung der „Lebensgeister“ (spiritus animales) zurück. Wenn<br />
vermittels der Sinnesorgane Reize aufgenommen werden, wirken von außen kommende<br />
Bewegungen auf die Lebensgeister ein und rufen eine Reaktion hervor, die bewusst erfahren<br />
wird, entweder als Vorstellung oder als Begehren.<br />
Die Bewegung der Lebensgeister hat, wie jede Bewegung, die Tendenz, ihren<br />
Bewegungszustand beizubehalten. Unterliegt sie einem hemmenden Einfluss, erleben wir als<br />
Reaktion die Unlust, wird sie gefördert, entsteht das Gefühl der Lust. Je nachdem, ob etwas<br />
die vitale Bewegung fördert oder hemmt, wird es als Wert oder als Unwert erlebt und<br />
entweder begehrt oder abgelehnt. Am heftigsten lehnen alle Lebewesen ab, was zum völligen<br />
Aufhören der Vitalbewegung, mithin zum Tod führt. Die Selbsterhaltung ist das alles<br />
beherrschende Ziel auch des menschlichen Strebens, das daher egoistischen Charakter hat.<br />
Literatur:<br />
Hobbes, Thomas: Leviathan (1651). Deutsch: Leviathan. Hamburg: Meiner, 2004.<br />
2.3. Empirismus (John Locke 1632–1704)<br />
Kurzreferat von Michael Palm<br />
Grundzüge der Position von John Locke<br />
Lockes Wissenschaftsverständnis gründet auf der Erfahrungswelt (Empirie), wie sie das 17.<br />
und 18. Jahrhundert definierte, wobei er die Aufgabe der Philosophie den Vorzeichen der<br />
Praxisrelevanz und Erfahrungsbereicherung unterordnete. Erkenntnistheoretisch leitet ihn die<br />
Frage nach dem Ursprung, der Gewissheit und dem Umfang der menschlichen Erkenntnis.<br />
Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass der Mensch kein Bewusstsein von den „Ideen“ (dem<br />
Wahrzunehmenden bzw. der Vorstellung von Objekten) hat, das gleichsam nur aktiviert<br />
werden müsste, sondern der kindliche Verstand gleicht einem leeren, unbeschriebenen Blatt.<br />
(„Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu“). Die „Ideen“ bzw. Vorstellungen,<br />
die jeder Mensch in seinem Bewusstsein findet, stammen ausschließlich aus der Erfahrung,<br />
6
die allerdings bei allen verschieden ist, woraus sich die unterschiedlichen<br />
Entwicklungsprozesse verschiedener Völker und Epochen erklären.<br />
Dem Menschen eignet dabei a priori das Vermögen, Vorstellungen überhaupt bilden zu<br />
können.<br />
Die Erfahrung hat zwei Quellen:<br />
1. die äußere Sinneswahrnehmung (sensation), die sich auf materielle Dinge bezieht<br />
2. die innere Selbstwahrnehmung (reflection), die sich auf Bewusstseinsvorgänge<br />
bezieht (Denken, Wollen , Glauben usw.)<br />
Die aus diesen beiden Quellen stammenden Vorstellungen sind entweder einfach oder<br />
komplex:<br />
1. Einfache Ideen, die nur durch den Sinn wahrgenommen werden (z.B. Farben und<br />
Töne)<br />
2. Einfache Ideen, die durch mehrere Sinne wahrgenommen erfasst werden (Raum,<br />
Bewegung)<br />
3. Einfache Ideen, die der Reflexion entspringen (innere Bewusstseinsvorgänge)<br />
4. Einfache Ideen, an denen Sensation und Reflexion beteiligt sind (Zeit, Lust)<br />
In Bezug auf diese einfachen Ideen bzw. Vorstellungen verhält sich der Geist passiv, sie<br />
werden direkt durch vom Objekt ausgehende Reize verursacht.<br />
Die Sinneswahrnehmung kann wiederum unterteilt werden in<br />
1. Primäre Qualitäten, die den äußeren Dingen als solchen zugeschrieben werden (z.B.<br />
Ausdehnung, Gestalt, Dichte, Zahl)<br />
2. Sekundäre Qualitäten, die nur Empfindungen im Subjekt darstellen (z.B. Farbe,<br />
Geschmack, Geruch usw.)<br />
Der Geist hat aber auch die aktive Fähigkeit, durch Kombinatorik, durch Vergleichen,<br />
Trennen, Verbinden und Abstrahieren komplexe Ideen zu erzeugen, die allerdings wiederum<br />
aus einfachen Ideen zusammengesetzt sind, und an die Erfahrung gebunden bleiben. Dabei<br />
werden drei Arten von komplexen Ideen gebildet:<br />
1. Substanzen sind entweder für sich selbst bestehende Einzeldinge oder Spezies (z.B.<br />
Mensch, Pflanze)<br />
2. Modi sind komplexe Ideen, die nicht für sich bestehen, sondern an Substanzen<br />
vorkommen (z.B. Tag als einfacher Modus der Zeit). Daneben gibt es auch gemischte<br />
Modi, wie Moralbegriffe (z.B. Gerechtigkeit)<br />
3. Relationen sind Ideen wie die von Ursache und Wirkung<br />
7
Für Locke können dabei ohne die Untersuchung der Sprache keine gesicherten Schlüsse auf<br />
die menschliche Erkenntnis gezogen werden. Denn gerade die Worte bedeuten uns ja die<br />
Dinge, wobei meist vergessen wird, dass sie lediglich Zeichen darstellen, die die Substanz nur<br />
repräsentieren. Erkenntnistheorie ist also für Locke notwendigerweise mit Sprachphilosophie<br />
gekoppelt, wobei dem Unterscheidungsproblem zwischen der Wirklichkeit der Erfahrung, der<br />
Wahrnehmung und der Erfahrung repräsentierter Wirklichkeit durch willkürlich gesetzte<br />
Zeichen (Namen) eine entscheidende Bedeutung zukommt. Wenn keine verlässlichen<br />
Aussagen über die Wirklichkeit der Dinge an sich zu machen wären, dann gäbe es notwendig<br />
auch keine ewigen Wahrheiten, weshalb keine Person oder Glaubensgemeinschaft die allein<br />
gültige Wahrheit für sich in Anspruch nehmen könnten.<br />
Locke, John: An Essay concerning Humane Understanding. Deutsch: Versuch über den<br />
menschlichen Verstand. Hamburg: Meiner, 2000.<br />
2.4. Grundzüge des Skeptizismus von David Hume (1711–1776)<br />
Kurzreferat von Erik Ositis<br />
Der Skeptizismus ist eine Weiterentwicklung des Empirismus durch David Hume, der die<br />
metaphysische Erkenntnis bestreitet und auch alle rein durch Gedanken hervor gebrachten<br />
Ergebnisse innerhalb der Naturwissenschaft nicht anerkennt. Wenn der Empirismus die<br />
Erkenntnis allein auf die Wahrnehmung konzentriert, d.h. durch die Sinne, so erweitert Hume,<br />
dass die Erkenntnis nicht weiter reiche als die Erfahrung, da für ihn nichts als real<br />
anzunehmen sei, was nicht durch äußere und innere Erfahrung gegründet ist.<br />
Auch für Hume gilt es also, die empirische Untersuchungsmethode in die Wissenschaft<br />
einzuführen und sich dabei auf Erfahrung und Beobachtung zu stützen (Induktion).<br />
Unmittelbarer Gegenstand unserer Erfahrung sind dabei allerdings nur unsere<br />
Bewusstseinsinhalte (Perzeptionen), die sich in zwei Klassen (hinsichtlich des Grades ihrer<br />
Intensität) unterscheiden:<br />
1. Eindrücke (impressions), d.h. alle Sinneswahrnehmungen und inneren<br />
Selbstwahrnehmungen (Affekte, Emotionen, Wollen).<br />
2. Vorstellungen (ideas) als Abbilder von Eindrücken, die wir haben, wenn wir uns mit<br />
diesen Eindrücken in Form von Nachdenken, Erinnern und Einbilden beschäftigen.<br />
Da die einfachen Vorstellungen (ideas) aus Eindrücken (impressions) entstehen, ist es uns<br />
nicht möglich, etwas vorzustellen oder zu denken, was nicht irgendwann in der unmittelbaren<br />
Wahrnehmung bzw. Erfahrung gegeben war.<br />
Aufgrund seiner Einbildungskraft (imagination) besitzt der Mensch jedoch die Fähigkeit, aus<br />
einfachen Vorstellungen komplexe Vorstellungen zu bilden. Diese komplexen Vorstellungen<br />
entspringen also nicht direkt einem unmittelbaren Eindruck, bleiben aber auf die Erfahrung<br />
verwiesen. Wie gelangen wir aber zu Urteilen über Tatsachen, die über unsere unmittelbare<br />
Wahrnehmung und Erinnerung hinausgehen?<br />
Die Verbindung von Vorstellungen folgt gemäß Hume dem Gesetz der Assoziation als<br />
Tendenz, von gewissen Vorstellungen zu anderen überzugehen, insbesondere gemäß dem<br />
Prinzip von Ursache und Wirkung.<br />
8
Aussagen über Tatsachen bzw. über das Verhältnis von Tatsachen zueinander beruhen also in<br />
letzter Konsequenz immer auf Erfahrung unter dem Gesetz der Assoziation von Vorstellungen<br />
mit Hilfe der Beziehung von Ursache und Wirkung, d.h. die erwartete Wirkung wird aufgrund<br />
bisheriger Erfahrung erschlossen. Allerdings ist das Verhältnis von Ursache und Wirkung<br />
nach Hume nicht streng allgemeingültig und notwendig, sondern A und B werden dann kausal<br />
verknüpft genannt, wenn deren Aufeinanderfolge mehrfach beobachtet wurde, so dass der<br />
Vorstellung von A die von B assoziativ aufgrund unserer Gewohnheit folgt.<br />
Die Frage was Erfahrung sei, beantwortet er also anhand bzw. unter Berücksichtigung der<br />
Kausalität, verstanden als Folgerung von Tatsachen. Der Ursprung des Kausalprinzips ist für<br />
ihn weder aus reiner Vernunft noch aus objektiver Erfahrung zu gewinnen. Für H. ist es<br />
unmöglich, die Wirkung einer Ursache gedanklich abzuleiten, und mit absoluter<br />
Notwendigkeit darzustellen, d.h. es gibt keine letztgültige Begründung, warum, wenn A<br />
auftritt, B darauf notwendig folgen muss oder gar mit A notwendig verknüpft ist. Die<br />
Gewohnheit und Regelmäßigkeit des Lebens bringen uns dazu, Assoziationen zu erstellen,<br />
diese können aber nicht beweisen, dass das bisherige Geschehen in der Art und Weise wie<br />
bisher, noch einmal auftritt, es ist nicht logisch notwendig, sondern zufällig, weil auch das<br />
Gegenteil der Fall sein kann. Vielmehr ist es die Gewohnheit, die unsere Erfahrung versucht,<br />
nutzbringend zu gestalten. Nach H. ist es der Glaube an Gesetzmäßigkeiten der uns dazu<br />
bringt Gesetze aufzustellen, die wir allerdings aus Beobachtung und Erfahrung gewonnen<br />
haben. Die Kraft, die zwei Geschehnisse miteinander verbindet, sei uns laut H. aber nicht<br />
zugänglich, es ist für uns nur eine konstante Beziehung zwischen Vorgängen.<br />
Zusammenhänge sind für uns also erkennbar, nicht aber die tatsächlichen Verknüpfungen,<br />
diese gestalten wir selbst durch Assoziation, die durch Gewohnheit zustande kommt. So ist<br />
Kausalität subjektiv, da bei wiederholten Vorgängen ein Gefühl subjektiver Notwendigkeit<br />
entsteht, das gegenüber A und B eine Erwartung erzeugt. Es entsteht ein intensives und<br />
lebhaftes Überzeugungsgefühl, das sich an Vorstellungen und Abläufe knüpft, nicht nur an<br />
Gedanken oder Vorstellungen. Wir sind felsenfest davon überzeugt. Dessen ungeachtet<br />
gebrauchen wir Assoziation, Gewohnheit und unsere Überzeugung (Glaube) für unsere<br />
Erfahrungsobjekte. Hiermit gründen wir laut H. Gesetze und allgemeine Ursachen, ohne die<br />
Transzendenz dabei zu nutzen, da die von H. vorgestellte Theorie eine empirische ist.<br />
Bei ihm spielt die Vernunft also keine allzu große Rolle, sie dient mehr oder minder nur der<br />
sinnvollen Verknüpfung von Geschehnissen.<br />
Er sagt auch, dass die Vernunft für sich allein nicht das Handeln bestimmen kann, sondern das<br />
jedes Handlungsmotiv gesteuert ist von einem Gefühl oder im Affekt geschieht. So ist für ihn<br />
Sittlichkeit erlebnisorientiert, gefühlt und hinterfragt, es richtet sich nach der Gesellschaft und<br />
deren Interessen. Handlungen werden als positiv bewertet, wenn sie nützlich oder angenehm<br />
sind für das Individuum selbst oder für andere bzw. das Ganze der Gemeinschaft. Die<br />
subjektiven Empfindungen beruhen für Hume dabei wesentlich auf den beiden Prinzipien der<br />
Selbstliebe und der Sympathie.<br />
Die Aufgabe einer Moralphilosophie liegt für Hume entsprechend darin, auf der Basis<br />
empirischer Methoden, die tatsächlich bestehenden moralischen Wertungen zu erklären, ohne<br />
sich dabei auf spekulative oder metaphysische Voraussetzungen bzw. Prämissen zu stützen.<br />
9
Literatur (Auswahl):<br />
Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel/Stuttgart: Schwabe,<br />
1971ff.<br />
Grundtexte:<br />
Hume, David: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748). Deutsche Übersetzung:<br />
Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hamburg: Meiner, 12. Aufl., 1993<br />
Hume, David: An Enquiry Concerning the Principles of Morals. (1751). Deutsche<br />
Übersetzung: Eine Untersuchung der Grundlagen der Moral. Göttingen: Vandenhoeck &<br />
Ruprecht, 2002.<br />
3. Kritischer Idealismus<br />
3.1. Definition des Kritischen Idealismus (Transzendentaler Idealismus)<br />
Eine Definition des kritischen bzw. transzendentalen Idealismus gibt Kant selbst in der ersten<br />
Auflage der Kritik der reinen Vernunft von 1781:<br />
„Ich verstehe aber unter dem transzendentalen Idealism aller Erscheinungen den Lehrbegriff,<br />
nach welchem wir sie insgesammt als bloße Vorstellungen und nicht als Dinge an sich selbst<br />
ansehen, und dem gemäß Zeit und Raum nur sinnliche Formen unserer Anschauung, nicht<br />
aber für sich gegeben Bestimmungen oder Bedingungen der Objekte als Dinge an sich selbst<br />
sind“ (Kr.d.r.V., A 369)<br />
3.2. Die Position des Kritischen Idealismus in ihren Grundzügen in Absetzung vom<br />
Rationalismus, Empirismus und Skeptizismus<br />
Kants Erkenntnislehre, so wie er sie maßgeblich in den beiden Auflagen der Kritik der reinen<br />
Vernunft vorlegt, stellt eine die Positionen und wesentlichen Momente des Rationalismus und<br />
Empirismus in einem neuen Standpunkt überführende, eigenständige Position dar.<br />
(Kurze Wiederholung)<br />
Sehr vereinfachend lässt sich der mit dem philosophischen Ansatz Descartes’ anhebende und<br />
sich über Spinoza, Malebranche bis hin zu Leibniz entfaltende Rationalismus als Position<br />
beschreiben, die davon ausgeht, dass sich das Wesen der Dinge durch eine Erkenntnis<br />
erfassen lässt, die allein auf reinen, der Vernunft bzw. dem (reinen) Denken selbst<br />
entsprungenen Begriffen beruht. Nicht die Erfahrung oder die Sinnlichkeit, die als eine<br />
depotenzierte und als solche nicht unmittelbar erkennbare, sondern verworrene<br />
Vernunfterkenntnis bloß ein minderes Vernunftvermögen darstellt, ist Ursprung und<br />
Grundlage wirklicher Erkenntnis, sondern die Vernunft und ihre reinen Begriffe, die es mit<br />
Hilfe der philosophischen Reflexion aus der verworrenen Erkenntnis, die uns die Sinnlichkeit<br />
bietet, herauszustellen gilt.<br />
Die von Bacon über Hobbes zu John Locke, Berkeley und Hume führende empiristische bzw.<br />
erfahrungsphilosophische Tradition geht dagegen davon aus, dass Erkenntnis allein auf<br />
sinnlicher Wahrnehmung – Beobachtung und Experiment – beruht. Hierbei hebt unsere<br />
Erkenntnis mit den Sinnen an und verbleibt im Bereich dieser Sinnlichkeit. Die Vernunft stellt<br />
dabei kein eigenständiges und spontanes Vermögen dar, welches Ideen und Begriffe aus sich<br />
selbst hervorbringen könnte. Vielmehr stammen ihre Vorstellungen, die sie aufeinander<br />
10
ezieht und Gleichheiten oder Verschiedenheiten feststellt, allein aus der sinnlichen<br />
Wahrnehmung.<br />
Allerdings gibt es weder für den Rationalismus noch für den Empirismus Grund, daran zu<br />
zweifeln, dass die Dinge, so wie sie an sich sind, unserer Erkenntnis in irgendeiner Form<br />
zugänglich sind. Beide Positionen verfahren also unkritisch und dogmatisch. Denn der<br />
Rationalismus setzt die uneingeschränkte Erkenntnisfähigkeit unseres Vernunftvermögens,<br />
der Empirismus die uneingeschränkte Erkennbarkeit der Dinge unhinterfragt voraus.<br />
In der Weiterführung des Empirismus stellt sich für David Hume nun gerade im Hinblick auf<br />
die Möglichkeit von Erkenntnis das Problem, wie die sinnlich gegebenen Vorstellungen bzw.<br />
Wahrnehmungen überhaupt systematisch verbunden werden. Für ihn sind es insbesondere die<br />
Vorstellungen der Kausalität und der Substanz, vermittels deren wir die Wahrnehmungen zu<br />
einer einheitlichen Erfahrungswelt ordnen, und so zu Erfahrungsurteilen gelangen. Da für<br />
Hume Kausalität und Substanz weder reine Verstandesbegriffe noch reine Vernunftbegriffe<br />
sind, sondern lediglich auf Gewohnheit und Einbildung beruhen, ist in der Konsequenz dieser<br />
These jegliche Möglichkeit einer streng allgemeingültigen und notwendigen Aussage in den<br />
Bereichen der Naturwissenschaften und der Metaphysik ausgeschlossen. Dem Dogmatismus<br />
rationalistischer wie auch empiristischer Provenienz stellt der Skeptizismus Humes also ein<br />
mehr oder weniger begründetes Meinen oder Glauben gegenüber.<br />
(Kants Position in Grundzügen)<br />
Im Hinblick auf den wichtigen Begriff der Kausalität geht auch Kant davon aus, dass unsere<br />
Erkenntnis von der Erfahrung anhebt, denn um zwei Sachverhalte als Ursache und Wirkung<br />
zu bestimmen, müssen wir zuvor zumindest zwei Wahrnehmungen haben. Lässt sich für<br />
Hume nun nicht einsehen, mit welchem Recht wir beide Wahrnehmungen mit strenger<br />
Allgemeinheit und Notwendigkeit im Sinne von Ursache und Wirkung verbinden, wir also<br />
den Gebrauch des Begriffs der Kausalität aus reiner Vernunft begründen können, so lässt sich<br />
für Kant dagegen der Begriff der Ursache, auf den auch Hume nicht verzichten wollte, aus<br />
der Erfahrung niemals begründen, weil der Begriff der Kausalität in der Erfahrung gar nicht<br />
beobachtet werden kann.<br />
Zwar muss es für Kant – entgegen den Positionen des Empirismus und Skeptizismus –<br />
insofern von jeglicher Erfahrung unabhängige bzw. reine Verstandesbegriffe (Kategorien)<br />
geben, entgegen einer ontologisierenden rationalistischen Metaphysik, die glaubt, aufgrund<br />
solcher reinen Begriffe zu einer klaren und deutlichen Erkenntnis des Wesens der Dinge und<br />
des moralisch Guten zu gelangen, schränkt Kant die Geltung solcher reinen<br />
Erkenntniselemente allerdings auf den Bereich einer uns möglichen Erfahrung ein. Das Ding<br />
an sich bzw. die Wirklichkeit, wie sie unabhängig von aller Erfahrungsmöglichkeit für sich<br />
selbst als absolute Realität besteht, auch wenn Kant ein solches Ding an sich denknotwendig<br />
voraussetzen muss, ist und bleibt gemäß Kant für uns unerkennbar. Die reinen<br />
Verstandesbegriffe (Kategorien) besitzen zwar objektive Geltung, allerdings nur im Hinblick<br />
auf eine uns mögliche Erfahrung und deren Objekte.<br />
Gegenüber dem Rationalismus betont Kant die Unverzichtbarkeit der sinnlichen Anschauung<br />
für die Erkenntnis. Zwar stellt die Sinnlichkeit für Kant eine rezeptive Fähigkeit des Gemüts<br />
dar, von Gegenständen affiziert zu werden, dennoch ist sie – neben dem Verstand – einer der<br />
Stämme unseres Erkenntnisvermögens. Damit allerdings Erkenntnis entstehen kann, müssen<br />
11
Sinnlichkeit und Verstand zusammenkommen. Denn durch die Anschauung werden uns zwar<br />
Gegenstände gegeben, durch den Verstand aber werden sie gedacht, d.h. begrifflich bestimmt.<br />
Kant geht es dabei im Folgenden allerdings weder um die empirischen Bedingungen unseres<br />
Verstandesvermögens, noch geht es ihm um eine empirisch begründete Theorie hinsichtlich<br />
der materialen Wirkung von Gegenständen auf unsere Sinne, die den reinen Verstandesbegriff<br />
der Kausalität bereits voraussetzen muss. Eine solche Theorie würde letztlich wieder auf die<br />
Position Humes und die mit ihr verbundenen Probleme bzw. auf den Schluss hinauslaufen,<br />
dass die Möglichkeitsbedingungen der Erfahrung die Möglichkeitsbedingungen der<br />
Gegenstände der Erfahrung sind. Eine solche Position lässt keinerlei Spontanität unseres<br />
Erkenntnisvermögens zu. Kant behauptet vielmehr, dass die Bedingungen a priori einer<br />
möglichen Erfahrung überhaupt zugleich die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände<br />
der Erfahrung sind. Insofern meint auch eine transzendentale Ästhetik (Ästhetik hier im Sinne<br />
der ursprünglichen griechischen Bedeutung von ›aisthesis‹ als ›sinnliche Wahrnehmung‹)<br />
nicht die Untersuchung der empirischen Wirkung von Gegenständen auf unsere Sinnesorgane,<br />
die – durch die von dem Gegenstand ausgehende Wirkung im Sinne des kausalen<br />
Zusammenhanges – zum Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen bzw. zur<br />
Empfindung veranlasst werden, sondern es geht ihm um den rein formalen Bezug der<br />
Sinnlichkeit und des Verstandes auf den Gegenstand. Die Sinnlichkeit stellt insofern eine<br />
Bedingung der Möglichkeit dafür dar, dass uns Gegenstände überhaupt als Erscheinungen<br />
gegeben werden. Der noch begrifflich unbestimmte Gegenstand einer sinnlichen Anschauung<br />
heißt bei Kant entsprechend Erscheinung, die durch den Verstand und seine reinen Begriffe<br />
bestimmte Erscheinung aber heißt Objekt.<br />
Literatur:<br />
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (erste Auflage 1781)<br />
Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird<br />
auftreten können (1783)<br />
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (zweite Auflage 1787)<br />
12