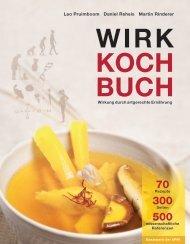Wirkmechanismus 2 Der undichte Darm (Leaky Barriers Syndrome)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Assoziierte Symptome<br />
Antriebslosigkeit<br />
Atembeschwerden<br />
Blähungen<br />
Chronische Ermüdungszustände<br />
Durchfall<br />
Hautunreinheiten<br />
Schlafprobleme<br />
Sodbrennen<br />
Starke bzw. häufige Stimmungsschwankungen<br />
Verstopfung<br />
Assoziierte Krankheitsbilder<br />
Akne<br />
Allergien<br />
Alzheimer<br />
Asthma<br />
Autismus<br />
Chronisches Ermüdungssyndrom<br />
Colitis Ulcerosa<br />
Depression<br />
Diabetes Mellitus Typ 1<br />
Hautekzeme<br />
Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />
Migräne<br />
Morbus Bechterew<br />
Morbus Crohn<br />
Multiple Sklerose<br />
Nahrungsmittelunverträglichkeit<br />
Psoriasis<br />
Rheumatoide Arthritis<br />
Schizophrenie<br />
Urtecaria<br />
Zöliakie
Löchrig wie ein Schweizer Käse …<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> (<strong>Leaky</strong> <strong>Barriers</strong> <strong>Syndrome</strong>)<br />
wirkmechanismus<br />
02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Wo sind die Löcher im Körper?<br />
»<strong>Leaky</strong> <strong>Barriers</strong>« ist der Sammelbegriff für alle teildurchlässigen<br />
(semipermeablen) Schutzschichten unseres Körpers zur<br />
Außenwelt – Haut, Lunge, Mund und der gesamte Verdauungstrakt.<br />
Dass wir von unserer Haut geschützt werden, ist offensichtlich.<br />
Aber der gesamte Weg der Nahrung und der Luft<br />
ist ebenfalls mit Schutzbarrieren ausgekleidet, die teildurchlässig<br />
sein müssen. <strong>Der</strong> Weg, in Mund und Nase beginnend<br />
bis zum Ausgang, ist anatomisch gesehen ebenfalls Teil der<br />
gefährlichen Außenwelt. Nahrung ist erst dann im Körperinneren,<br />
wenn diese verdaut und kontrolliert über die <strong>Darm</strong>wand<br />
aufgenommen wird. Diese Schutzbarrieren bilden die erste<br />
Verteidigungslinie des Immunsystems 1<br />
.<br />
Die Wichtigkeit der jeweiligen Teilbarrieren spiegelt sich in<br />
den Flächenverhältnissen wieder. Die Haut hat mit ca. 2 m 2<br />
den kleinsten Anteil, obwohl es für uns und unseren Etat<br />
(Kosmetikartikel und Hautcremes) am wichtigsten erscheint.<br />
<strong>Der</strong> Grund dafür ist einfach, dass die Haut sichtbar und es<br />
für uns emotional entscheidend ist, dass ihre Qualität optimal<br />
sein sollte, um möglichst gut auszusehen. Die Lunge ist mit<br />
mehr als 100 m 2 schon wesentlich größer. Mit deutlich über<br />
500 m 2 Oberfläche ist der Verdauungstrakt zusammen mit<br />
der Mundhöhle die größte Schutzbarriere, die von zentraler<br />
Bedeutung ist und daher auch am Beginn jeder Diagnose<br />
und Intervention Beachtung finden muss.<br />
Die große Mehrheit der Bewohner der westlichen Industrieländer<br />
dürfte an zu durchlässigen Barrieren, vor allem im<br />
Abb. 1: 1. Eine geschwächte erste Abwehrlinie des Immunsystems, das sekretorische Immunglobulin A (IgA) führt ebenfalls zu einer erhöhten<br />
Invasion von Bakterien und Viren. 2. Stresshormone wie Noradrenalin und Cortisol sorgen für eine physiologische Öffnung (Internalisierung) der<br />
Zellverbindungen (Tight Junctions), um während Bedrohung mehr Energie aufnehmen zu können. 3. Antinutrienten (Lectine, Gliadine, Sapponine)<br />
zerstören direkt oder indirekt die Zellverbindungen zwischen den Zellen. Gluten und Gliadine wirken durch die Aktivierung der körpereigenen<br />
Eiweißsubstanz Zonulin indirekt schädigend. 4. Wenn Nahrungsbestandteile wie Gluten oder Bakterien und Viren unkontrolliert die <strong>Darm</strong>barriere<br />
überwinden können, werden sie von Fresszellen (Makrophagen) des angeborenen Immunsystems aufgenommen und den anderen Immunzellen<br />
(Thymus-Helfer-Zellen) als Eindringling präsentiert. Diese bekämpfen die Bedrohung mit zellzerstörenden Substanzen und Entzündungsreaktionen,<br />
die auch lokal zu Schäden an anderen Zellen führen – eine Endotoxämie. 5. Ein Teil der auf den über 500 qm <strong>Darm</strong>oberfläche produzierten<br />
entzündungsauslösenden Substanzen gelangt über die Blutbahn und Lymphe in den gesamten Organismus und bildet die Basis für unzählige<br />
Folgeerkrankungen.<br />
Bakterien (z. B. Coli, Streptokokken)<br />
Sekretorisches IgA<br />
1<br />
<strong>Darm</strong>kanal<br />
Gluten<br />
Zonulin<br />
Tight<br />
Junctions<br />
<strong>Darm</strong>barriere<br />
3<br />
2<br />
<strong>Darm</strong>-<br />
wand-<br />
Zellen<br />
Thymus-Killer-Zelle<br />
4<br />
<strong>Darm</strong>wand<br />
Gluten<br />
Körper intern<br />
Thymus-<br />
Helfer-<br />
Zelle<br />
Blutgefäße<br />
Pro-entzündliche<br />
Substanzen<br />
5<br />
Fresszelle<br />
(Makrophag)<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
74
Mund- und <strong>Darm</strong>bereich, leiden. Die Folge von durchlässigen<br />
Teilen in unseren Schutzwänden ist, dass vermehrt<br />
Stuhl, Viren und Bakterien unkontrolliert in unseren Körperkreislauf<br />
gelangen können 2, 3<br />
. <strong>Der</strong> zuverlässigste Test für die<br />
Diagnose von durchlässigen Barrieren neben dem Evaluieren<br />
der klinischen Symptome und Krankheitsbilder ist der<br />
13C-Sucrose-Atmungs-Test 4<br />
.<br />
Die folgenden Wirkmechanismen werden von einer Dysfunktion<br />
unserer Schutzbarrieren sehr stark negativ beeinflusst,<br />
darum ist es von Bedeutung, unabhängig vom persönlichen<br />
Ziel bzw. Problem, diesen <strong>Wirkmechanismus</strong> immer zu berücksichtigen!<br />
»<strong>Der</strong> Tod sitzt im <strong>Darm</strong>« (chinesisches Sprichwort)<br />
Unser <strong>Darm</strong> ist acht Meter lang, beheimatet 80 Prozent<br />
aller Immunsystemzellen und über 90 Prozent des körpereigenen<br />
»Glückshormons« Serotonin 5<br />
. Eine komplexe, mehrschichtige<br />
Schutzbarriere beginnend beim Mund bis zum<br />
Körperausgang schützt vor Krankheitserregern und kontrolliert<br />
die Aufnahme von Nahrung. Unzäh lige Studien haben<br />
gezeigt, dass ein Großteil aller uns bekannten Erkrankungen<br />
ihre direkte Ursache im <strong>Darm</strong> haben bzw. er eine zentrale<br />
Rolle spielt: Allergien 6<br />
, Asthma 6<br />
, Zöliakie 7<br />
, Chronisches<br />
Ermüdungs syndrom 8<br />
, Morbus Crohn 9<br />
, Depression 10<br />
, Diabetes<br />
Mellitus Typ 1 11<br />
, Hashimoto, Migräne 12<br />
, Multiple Sklerose<br />
13<br />
, Psoriasis 14<br />
, Rheumatoide Arthritis 15<br />
, Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />
16<br />
und Alzheimer 17<br />
. Am Beispiel unseres <strong>Darm</strong>s<br />
sollen die wichtigsten negativen und positiven Einflüsse auf<br />
unsere Schutzbarrieren beschrieben werden.<br />
Die Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen<br />
Um zu verstehen, welchen Einfluss Nahrungsmittel auf unser<br />
Verdauungssystem haben, muss man die Welt der Pflanzen<br />
ein wenig genauer betrachten. Noch mehr als ihr eigenes Leben<br />
schützen Pflanzen das Leben ihrer »Nachkommen«, um<br />
nicht auszusterben. Pflanzen existieren auf unserem Planten<br />
seit ca. 460 Millionen Jahren, menschenartige Primaten erst<br />
seit ca. 25 Millionen Jahren. Pflanzen hatten genügend Zeit,<br />
Überlebensstrategien zu entwickeln und Wege zu finden, ihre<br />
Samen möglichst weit zu verbreiten.<br />
Die drei häufigsten Strategien in der Pflanzenwelt<br />
1. Pflanzen mit fleischartiger Frucht wie Äpfel,<br />
Birnen, Mangos, Marillen, usw. können<br />
sich meistens nur mit Hilfe von Säugetieren<br />
oder Vögeln über deren Verdauungstrakt<br />
verbreiten. Fällt die Frucht in der Nähe<br />
des eigenen Stammes zu Boden, kann<br />
aufgrund des Wurzelwerks, das etwa so<br />
breit ist wie die Pflanze hoch, kein neuer Spross<br />
entstehen. Die Pflanze produziert darum ein möglichst gesundes<br />
und schmackhaftes Fruchtfleisch, das genießbar<br />
wird, sobald ihre »Kinder« (Samen) ausgereift sind. Reife<br />
Früchte locken Tiere und Menschen an, die das Fruchtfleisch,<br />
aber nicht die darin versteckten Samen, verdauen<br />
können. Die Pflanze »hofft« nun auf eine weiter entfernte<br />
Ausscheidung der Kerne, wodurch ihre Nachkommen in<br />
bereits gedüngtem Milieu wachsen können.<br />
2. Die zweite Gruppe, wie zum Beispiel die Macadamianuss,<br />
schützt sich durch eine sehr<br />
harte Schale, Stacheln oder andere physikalische<br />
Barrieren. Diese Kerne enthalten kaum<br />
giftige Abwehrsubstanzen.<br />
3. Bei der dritten Strategie wird der Nachwuchs<br />
mit eigenen Giften (Anti-Nutrienten) geschützt,<br />
welche die Pflanze vor allem in<br />
die Schale einlagert. Diese Substanzen<br />
müssen in der Lage sein, Bakterien, Insekten<br />
und Pilze zu töten, Verdauungsenzyme<br />
zu hemmen, die <strong>Darm</strong>wand von<br />
Insekten zu durchbrechen und weitere<br />
giftige Substanzen frei zu setzen. Größere<br />
Tiere und Menschen können aber nur mit<br />
mäßigem Erfolg am Verzehr gehindert werden,<br />
vor allem weil letztere gelernt haben zu kochen. Die Abwehrstoffe<br />
von Pflanzen haben also meistens keinen spürbaren<br />
Effekt auf den Menschen. Aber immer mehr Untersuchungen<br />
bringen den täglichen Konsum mit zahlreichen<br />
Erkrankungen in Verbindung 18<br />
.<br />
Die Toxizität der einzelnen Teile einer Pflanze ist sehr unterschiedlich.<br />
Die Samen beinhalten aufgrund ihrer Wichtigkeit<br />
für den Fortbestand der Pflanzenart die höchste Dichte an Abwehrstoffen.<br />
Die Wurzeln und deren Schutzstoffe sind nur bei<br />
gewissen Pflanzenarten (v. a. Knollen) schädlich. Blätter und<br />
Stiel sind am wenigsten belastend für uns Menschen.<br />
75 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Antinutrienten<br />
Nahrung und deren Inhaltsstoffe sind nicht nur Energielieferanten.<br />
Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß sind Makronährstoffe<br />
und dienen als Energiequelle, Bausubstanz und als<br />
Vorläufer von Botenstoffen. Mikronährstoffe sind Vitamine (z.<br />
B. Vitamin C), Mineralien (z. B. Magnesium), Spurenelemente<br />
(z. B. Selen) und sekundäre Pflanzenstoffe (z. B. Polyphenole,<br />
Flavonoide, Carotinoide). Makronährstoffe und Mikronährstoffe<br />
in unterschiedlichen Nahrungsmitteln haben nicht<br />
immer die gleiche biochemische Struktur. Stärke aus Wurzelgemüse<br />
und Stärke aus Getreide ist nicht völlig identisch.<br />
Stärke aus Getreide ist zum Teil unverdaulich und kann als<br />
Nahrung für pathogene E. coli Bakterien im <strong>Darm</strong> dienen.<br />
Vitamin C im Fisch ist fettlöslich und in Orangen ist es wasserlöslich.<br />
Und auch beim Vitamin E gibt es viele verschiedene<br />
biochemische Variationen. Damit alle diese Nährstoffe im<br />
Körper wirken können, müssen sie in ausreichender Menge<br />
konsumiert, richtig verdaut und aufgenommen werden.<br />
Spricht man von Nahrung als Medizin, geht es, neben einer<br />
ausreichenden, qualitativen Versorgung mit Makro- und Mikronährstoffen,<br />
hauptsächlich um die Zufuhrmengen an Antinutrienten<br />
aus Gemüse, Obst, Nüssen, Kräutern und auch<br />
Tieren. Einige dieser Substanzen wurden primär erforscht,<br />
weil sie die Aufnahme von anderen Nährstoffen reduzieren,<br />
daher ihr Name. Antinutrienten sind aber bioaktive Substanzen<br />
und wirken sehr unterschiedlich, aber in den meisten<br />
Fällen sehr positiv auf den menschlichen Organismus.<br />
Beispielsweise ist die Salizylsäure in Karotten notwendig, um<br />
Entzündungen abzuschalten. <strong>Der</strong> überwiegende Teil dieser<br />
Substanzen wird von Pflanzen gebildet, um sich gegen Insekten,<br />
Mikroben, Sonnenstrahlung, Hitze, Kälte oder Pflanzenfresser<br />
zu schützen. Daher ist es nicht verwunderlich,<br />
dass einige bioaktive Substanzen giftige und für den Menschen<br />
nachteilige Effekte haben. Das Verhältnis zwischen<br />
positiven und negativen Eigenschaften kann durch den NET<br />
TOX-Wert (Netto-Toxizität) angegeben werden. Liegt dieser<br />
im positiven Bereich, dann hat eine Pflanze mehr giftige als<br />
gesundheitsfördernde Substanzen und sollte daher mengenmäßig<br />
reduziert werden.<br />
Antinutrienten können aufgrund ihrer Wirkung in drei Gruppen<br />
eingeteilt werden:<br />
1. Antinutrienten aus Gemüse und Kräutern zeigen oft<br />
eine hemmende Wirkung: Substanzen wie Carvacrol<br />
in Oregano sind starke Entzündungshemmer und<br />
reduzieren auch Pilze im <strong>Darm</strong> 19<br />
. Auch Sulforaphan<br />
in Kohlgemüse und vor allem in Brokkoli hat eine sehr<br />
starke entzündungshemmende Wirkung 20, 21<br />
.<br />
2. Antinutrienten aus Früchten haben einen primär energetischen<br />
Effekt: Tropische Früchte liefern Enzyme, die<br />
unter anderem die Bildung von Ribose stimulieren, und<br />
beinhalten ATP-ähnliche Substanzen, die direkt für mehr<br />
Energie im Organismus sorgen 22<br />
.<br />
Abb. 2: <strong>Der</strong> Vergleich von Soja und Oliven macht bewusst, dass nicht nur die Nährstoffdichte für die Qualität eines Nahrungsmittels von Bedeutung<br />
ist, sondern auch wie lange wir etwas schon essen bzw. wie hoch die Toxizität einer Pflanze ist (NETTOX) 81<br />
.<br />
Wilde Oliven<br />
Zeitspanne 120.000–150.000 Jahre<br />
Nährstoffdichte Hoch<br />
NETTOX-Wert Niedrig<br />
Pflanzenart Fruchfleisch<br />
artgerecht<br />
Soja<br />
Zeitspanne<br />
Nährstoffdichte<br />
NETTOX-Wert<br />
Pflanzenart<br />
3.000 Jahre<br />
Hoch<br />
Hoch<br />
Samen (Baby)<br />
nicht artgerecht<br />
Getreide<br />
Gerste<br />
Linsen<br />
Erbsen<br />
Kichererbsen<br />
Saubohnen<br />
Kidneybohnen<br />
Kartoffel<br />
Mais<br />
Reis<br />
Erdnüsse<br />
Limabohnen<br />
150.000<br />
120.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000<br />
Jahre<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
76
3. Tierische Antinutrienten sind vorwiegend stimulierend:<br />
Die Körpertemperatur steigt und Insulin wird durch insulinähnliche<br />
Faktoren beispielsweise in Eiern reguliert,<br />
und konjugierte Linolsäure in getreidefrei ernährtem Geflügel<br />
erhöht die fettfreie Muskelmasse.<br />
Im Folgenden sind die wichtigsten Substanzen zusammengefasst,<br />
die eine hohe Netto-Toxizität haben, unsere Schutzbarrieren<br />
zerstören und in der täglichen Nahrung keinen hohen<br />
Stellenwert haben sollten.<br />
Gliadine (Gluten)<br />
Sie kommen vor allem in Getreide wie Weizen, Dinkel, Roggen,<br />
Hafer und Grünkern vor 23-26<br />
. Sie können weder durch<br />
Erhitzen noch durch Enzyme in unserem Körper reduziert<br />
werden. Sie erhöhen die Produktion eines spezifischen Eiweißes<br />
(Zonulin), das durch eine biochemische Reaktion die<br />
Verbindungsstellen zwischen den <strong>Darm</strong>wandzellen zerstört,<br />
wodurch Löcher entstehen.<br />
Lektine (PHA)<br />
Sie sind im Pflanzenreich als Abwehrstoffe allgegenwärtig<br />
und der überwiegende Teil hat für Menschen mehrheitlich<br />
positive Effekte. Eine Gruppe von Lektinen, die vor allem in<br />
Getreide und Hülsenfrüchten vorkommen, haben die Fähigkeit,<br />
sich an <strong>Darm</strong>wandzellen zu binden und ebenfalls die<br />
Durchlässigkeit zu erhöhen 27<br />
. Sie sind bis 100 Grad Celsius<br />
relativ hitzestabil. Eine mindestens zehnminütige Erhitzung<br />
im Druckkochtopf ist zur Eliminierung der meisten Lektine<br />
notwendig 28<br />
. Lektine können, wie Gluten auch, die Vermehrung<br />
von gram-negativen Bakterien im <strong>Darm</strong> unterstützen 27<br />
.<br />
<strong>Der</strong> negativste Effekt ist aber wahrscheinlich die Tatsache,<br />
dass Lektine sehr schnell in den Körper und die Blutbahn<br />
aufgenommen werden. Sie können sich an beinahe alle<br />
Zellarten anheften und dadurch z. B. Insulin- oder Leptinrezeptoren<br />
blockieren, was dann bis zu einer Resistenz führen<br />
kann 29<br />
. Vermehrt werden auch Enzyme (MMPs) gebildet, die<br />
bei Wundheilung, aber auch beim Tumorwachstum eine Rolle<br />
spielen 30<br />
. Dabei sind rote Blutkörperchen einer verstärkten<br />
Verklumpung unterworfen, was ideale Voraussetzungen für<br />
eine Thrombose schafft 31, 32<br />
.<br />
Lektine bleiben auch bei der Verarbeitung zu pflanzlichen<br />
Ölen erhalten. Bei Erdnussöl konnte eine starke Arteriosklerose<br />
bildende Wirkung gezeigt werden, die sich reduzierte,<br />
wenn die Lektine weggelassen wurden 33<br />
.<br />
Abb. 3: Die Tabelle zeigt eine Auswahl wichtiger Lebensmittel und<br />
den in ihnen enthaltenen Anteil an Lektinen.<br />
Lektine in ausgesuchten Lebensmitteln<br />
mg / kg<br />
Lektinart<br />
Vollkorn 300 – 350 WGA<br />
Vollkornmehl 30 – 50 WGA<br />
Weißes Mehl 4,4 WGA<br />
Kidney Bohnen 1.000 – 10.000 PHA<br />
Sojabohnen 200 – 2.000 SBA<br />
Erdnüsse 110 PNA<br />
Saponine<br />
Saponine sind seifenartige, schäumende Substanzen, die<br />
sich an das Cholesterol von <strong>Darm</strong>wandzellen binden und dadurch<br />
deren Durchlässigkeit erhöhen 34, 35<br />
. Sie aktivieren auch<br />
das Immunsystem und erhöhen signifikant Entzündungsmarker<br />
36, 37<br />
. Zudem zerstören sie rote Blutkörperchen, hemmen<br />
Verdauungsenzyme und verringern dadurch die Aufnahme<br />
von Nährstoffen 38<br />
. Man sieht diese schäumende Eigenschaft<br />
auch beim Kochen von Hülsenfrüchten und Kartoffeln oder<br />
als Schaumkrone beim Bier.<br />
Abb. 4: Die Tabelle zeigt eine Auswahl wichtiger Lebensmittel und<br />
den in ihnen enthaltenen Anteil an Saponinen 39-41<br />
.<br />
Saponine in ausgesuchten Lebensmitteln (mg/kg)<br />
Soja Eiweiß 10.600<br />
Kichererbsen 5.000<br />
Vegetarisches Eiweißpulver 4.510<br />
Soja Bohnen 4.040<br />
Kartoffeln 720<br />
Grüne Tomaten 70<br />
Linsen 2.500<br />
Alfalfasprossen 8.000<br />
Quinoa 6.000<br />
Linsen 1.100<br />
Amaranth 7.900<br />
77 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
AGEs<br />
Endprodukte fortgeschrittener Glykierung (AGEs) entstehen<br />
durch starkes Erhitzen, Pasteurisieren, Sterilisieren, Bestrahlen,<br />
Oxidieren oder Ionisieren von Lebensmitteln, wo Eiweiße<br />
oder Fette mit Kohlenhydraten reagieren ohne Beteiligung<br />
von Enzymen 42<br />
. AGEs können Cholesterin oxidieren, was<br />
zu Arteriosklerose führen kann 43<br />
. Auch eine Erhöhung von<br />
fast allen wichtigen Entzündungsmarkern kann durch AGEs<br />
ausgelöst werden, und damit ist der Grundstein für eine<br />
chronische Entzündung gelegt. Vor allem sind Menschen mit<br />
einer Insulinresistenz (Diabetiker) betroffen, da diese durch<br />
den erhöhten Blutzucker ohnehin schon große Mengen an<br />
AGEs bilden 42<br />
.<br />
Beim Kochen entstehen AGEs vor allem durch Erhitzen<br />
über 120 Grad Celsius, wie beim Braten und Grillen<br />
von Eiweiß (Fleisch) und Kohlenhydraten gleichzeitig.<br />
Aus diesem Grund werden in diesem Buch viele Zubereitungsarten<br />
wie Pochieren, Dämpfen, Marinieren und<br />
Sieden vorgestellt, die den AGEs-Gehalt der Gerichte um ein<br />
vielfaches verringern. AGEs lassen sich weiter durch Marinieren<br />
mit Säure (Essig, Zitrusfrüchte) reduzieren 44<br />
.<br />
Schilddrüsenhemmende Substanzen (Goitrogene)<br />
Diese Substanzen beeinträchtigen die Funktion der Schilddrüse<br />
und werden aus diesem Grund im Kapitel »Schilddrüse«<br />
genauer erläutert.<br />
Phytinsäure<br />
Sie hemmt Verdauungsenzyme und vermindert besonders<br />
die Aufnahme von Zink, Magnesium und Eisen, drei Mikronährstoffe,<br />
deren Mangel sehr weit verbreitet ist 45<br />
. Vor allem<br />
Hülsenfrüchte (Soja) und Vollkorn sind reich an Phytinsäure.<br />
Enzymhemmer<br />
Da Enzyme essentiell für eine optimale Verdauung und die<br />
Aufnahme von Nährstoffen wie fettlöslichen Vitaminen verantwortlich<br />
sind, stellt deren Hemmung für uns Menschen ein<br />
gesundheitliches Problem dar. In der Natur kommen unterschiedliche<br />
Substanzen (z. B. Bowman–Birk-Faktoren oder<br />
Kunnitz-Domänen), die in der Lage sind, Verdauungsenzyme<br />
zu hemmen, häufig vor. Vor allem in Getreide und Hülsenfrüchten<br />
gibt es große Mengen. Diese Substanzen schützen<br />
die »Pflanzenbabies«, damit sie nicht von anderen Lebewesen<br />
verdaut werden können. Um z. B. das Korn vor Verdauung<br />
zu schützen, müssen die Enzymhemmer vor allem in den<br />
Schalen lokalisiert sein. Als Kleie werden angeblich gesunde<br />
Ballaststoffe angeboten. Die Kleie aber ist ein Konzentrat aller<br />
Abwehrsubstanzen einer Pflanze, die für uns Menschen<br />
sehr schädlich sind.<br />
Alkohol<br />
Alkohol aktiviert Mastzellen in der <strong>Darm</strong>schleimhaut, die<br />
dann pro-entzündliche Botenstoffe produzieren und ausschütten<br />
47, 48<br />
.<br />
Abb. 5: Die Untersuchung zeigt, dass es gesunde Ballaststoffe wie das Pektin aus Äpfeln gibt, aber auch Ballaststoffe aus Getreide, die nicht nur<br />
das Wachstum schädlicher Bakterien im <strong>Darm</strong> fördern, sondern auch unsere Verdauung bzw. unsere Enzymaktivität sehr effizient stören 46<br />
.<br />
Faserstoffe Einheiten / ml HPJ Amylase Lipase Trypsin Chymotrypsin<br />
Kontrollgruppe 12,92 9,31 100,80 22,30<br />
Alfalfa Sprossen 11,28 6,78 29,20 11,50<br />
Haferkleie 9,38 7,80 95,70 15,90<br />
Pektin (z. B. Apfel) 19,13 11,49 101,60 28,60<br />
standartisierter Faserstoff für<br />
industriell erzeugte Lebensmittel 2,64 0,43 55,70 11,80<br />
Weizenkleie 8,64 8,00 94,70 17,00<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
78
Fructose<br />
Hohe Mengen an reiner, freier Fructose, wie sie in Fruchtsäften,<br />
Softdrinks, Energydrinks, Fertigprodukten oder Süßigkeiten<br />
vorkommt, zerstört direkt die <strong>Darm</strong>schleimhaut. Weiter<br />
benötigt die Aufnahme von freier Fructose mehr Energie<br />
(ATP), die dann nicht mehr der Aufrechterhaltung der <strong>Darm</strong>barriere<br />
und den <strong>Darm</strong>wandzellen zur Verfügung steht 49, 50<br />
.<br />
Natürlich vorkommende Fructose in Früchten ist Teil eines<br />
Nährstoff- und Faserstoffkomplexes und hat in diesem Zusammenhang<br />
keine negativen Effekte.<br />
Linolsäure<br />
Omega-6-Linolsäure, deren Vorkommen und Auswirkungen<br />
bereits ausführlich erläutert wurden, verursacht eine direkte<br />
Schädigung von weißen und roten Blutkörperchen sowie des<br />
Lebergewebes und aktiviert den Entzündungsprozess über<br />
den Botenstoff NFkB 51, 52<br />
.<br />
Schmerzmittel (NSAID)<br />
NSAID (Aspirin, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac) zerstören<br />
direkt die <strong>Darm</strong>wandbarriere 53-55<br />
. NSAID provozieren außerdem<br />
Veränderungen an einer weiteren immunologisch<br />
wichtigen Schicht der <strong>Darm</strong>barriere, genannt Glykokalix.<br />
Ein dritter Mechanismus über den diese Schmerzmittel die<br />
<strong>Darm</strong>schleimhaut zerstören, betrifft die Aktivierung von Zellwandrezeptoren<br />
(TLR), die die Produktion von pro-entzündlichen<br />
Botenstoffen fördern 56<br />
.<br />
Stress<br />
Akuter und chronischer Stress können durch die Hormone<br />
Cortisol und Noradrenalin die Durchlässigkeit der <strong>Darm</strong>schleimhaut<br />
und die Eiweißverdauung negativ beeinflussen<br />
57-59<br />
. Stress aktiviert wie Alkohol die Mastzellen in der<br />
<strong>Darm</strong>schleimhaut 60-62<br />
. Es gibt auch Verbindungen von<br />
Stress mit Magengeschwüren, darmabhängigen Autoimmunkrankheiten<br />
(Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa), dem<br />
Reizdarm-Syndrom und chronischen Entzündungen. Diese<br />
Prozesse beeinflussen ihrerseits dann erneut die <strong>Darm</strong>schleimhaut<br />
negativ.<br />
Aluminiumhydroxid<br />
Diese chemische Verbindung wird vor allem als Magenschutz<br />
und Säureblocker verwendet. Sie wird häufig eingesetzt bei<br />
Sodbrennen, Refluxbeschwerden oder säurebedingten Magenproblemen.<br />
Eine Nebenwirkung ist ebenfalls die Erhöhung<br />
der Durchlässigkeit zwischen den <strong>Darm</strong>wandzellen 63<br />
.<br />
Antibiotika<br />
Es ist mittlerweile schon weitläufig bekannt, dass Antibiotika<br />
den Verdauungstrakt und insbesondere den <strong>Darm</strong> signifikant<br />
negativ beeinflussen. Das große Problem dieser<br />
manchmal überlebensnotwendigen Medikamente ist, dass<br />
unerwünschte Bakteriengruppen resistenter sind als andere.<br />
Nach der Antibiotikakur vermehren sich dann diese Bakterienkulturen<br />
wesentlich schneller und bilden noch größere<br />
krank machende Bakterienkolonien, die den überlebensnotwendigen<br />
Bakterien den Platz wegnehmen 64<br />
. Vor allem im<br />
Kindesalter können solche Veränderungen der <strong>Darm</strong>flora ein<br />
Leben lang nachteilige Folgen haben.<br />
Die Dosis macht das Gift<br />
Nahrungsmittel wie Sprossen, die hohe Mengen an Antinutrienten<br />
enthalten, aber nur sehr selten konsumiert werden,<br />
wirken sich wahrscheinlich kaum negativ auf einen Menschen<br />
aus. Im Gegenteil, unregelmäßig kleine Mengen an<br />
Schadstoffen sind sinnvoll, um unsere Abwehr fit zu halten.<br />
Wenn aber am Morgen Brot, mittags Nudeln und abends<br />
Kartoffeln oder Hülsenfrüchte konsumiert werden, ergibt das<br />
zusammen eine klare Überdosis. Zur starken Reduzierung<br />
von Giften in Nahrungsmitteln empfiehlt sich nicht nur das<br />
Erhitzen, sondern vor allem das Entfernen bzw. Weglassen<br />
der Schale (Kartoffeln schälen, kein Vollkorn und Kleie).<br />
Es gibt auch keine Lebensmittel oder Substanzen, die nur<br />
Nachteile oder Vorteile haben. Substanzen wie Saponine<br />
und Lektine zeigen auch effektive antikarzinogene Eigenschaften.<br />
Aber auch offensichtlich gesunde Lebensmittel<br />
wie Spinat enthalten die nicht unbedenkliche Oxalsäure und<br />
Tomaten geringe Mengen an Lektinen. Diese Beispiele zeigen,<br />
dass keine Ernährungslehre zu strikt und fanatisch eingehalten<br />
werden muss und das Hauptaugenmerk auf eine<br />
abwechslungsreiche Ernährung anhand von artgerechten<br />
Leitlinien gerichtet werden sollte.<br />
79 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Die Bewohner in unserem <strong>Darm</strong><br />
Die <strong>Darm</strong>flora ist ein Sammelbegriff für alle Bakterien, die<br />
unseren <strong>Darm</strong> bewohnen. Diese Gäste in unserem Körper<br />
leben von dem, was wir essen und helfen uns bei der<br />
Verdauung, stellen Enzyme her und produzieren wichtige<br />
Vitamine. <strong>Der</strong> <strong>Darm</strong> ist immer voll besiedelt, und je nach<br />
Nahrungsangebot verdrängt eine Bakteriengruppe teilweise<br />
eine andere. Beinahe alle Bakterien erfüllen eine Aufgabe in<br />
diesem kleinen Universum. Krankheitsauslösende Bakterien<br />
sind genauso Teil davon, nur sie dürfen sich nicht zu stark<br />
vermehren und sollten im richtigen Verhältnis zu den anderen<br />
Bakterien stehen. Durch ihre Form und Struktur reizen sie<br />
das Immunsystem mit Entzündungen und sie produzieren<br />
selbst auch wenig bis keine essentiellen Nährstoffe. Neben<br />
der Aufrechterhaltung von Entzündungskrankheiten werden<br />
auch Übergewicht, Bluthochdruck und Arterio sklerose<br />
mit einer entzündungsfördernden <strong>Darm</strong>flora in Verbindung<br />
gebracht 65<br />
. Diese, meistens gram-negative Bakterien, vermehren<br />
sich besonders schnell in Verbindung mit größeren<br />
Mengen an Kohlenhydraten. Allerdings gibt es auch bei<br />
Kohlenhydraten signifikante Unterschiede, da Völker wie die<br />
Kitava in Papua-Neuguinea sich zu 65 Prozent von Kohlenhydraten<br />
ernähren, aber weder Übergewicht noch Zivilisationskrankheiten<br />
kennen und zu den gesündesten Völkern<br />
gehören, die je untersucht wurden 66<br />
.<br />
Wo ist der Unterschied?<br />
Pflanzen wie Getreide, Kartoffeln und Reis speichern ihre<br />
Kohlenhydrate (Stärke) trocken und in hoher Dichte, um sie<br />
während des Aufkeimens schnell nutzen zu können. Diese<br />
nicht in Zellen gespeicherten Kohlenhydrate, wie sie auch in<br />
Fertiggerichten und Backwaren in großen Mengen vorkommen,<br />
setzen eine Kohlenhydratkonzentration in unserem Verdauungstrakt<br />
frei, die höher ist als alles, was unsere <strong>Darm</strong>flora<br />
in ihrer Evolution erlebt hat. <strong>Der</strong> Vorteil, der für pathogene<br />
Bakterien durch die hohe Kohlenhydratdichte entsteht,<br />
begünstigt deren Wachstum signifikant. Ebenfalls vermehren<br />
sich drei parasitäre Pilzgattungen deutlich schneller: Aspergillus,<br />
Penicillium und Fusarium. Diese produzieren Pilzgifte,<br />
die unsere Schutzbarrieren schädigen 67, 68<br />
. Wurzelgemüse<br />
wie Karotten, Rettich, Schwarzwurzel und Pastinaken sowie<br />
Früchte, Blätter und Nüsse lagern ihren Kohlenhydratanteil<br />
direkt in aktiven Teilstrukturen der Zellen. Diese Zellverbindungen<br />
bleiben auch beim Kochen intakt, wodurch die Kohlenhydrate<br />
»eingesperrt« bleiben, bis sie langsam während<br />
der Verdauung freigesetzt werden. Vergleicht man Bevölkerungsgruppen,<br />
die ähnliche Kohlenhydratmengen konsumieren,<br />
sind signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung<br />
der <strong>Darm</strong>flora erkennbar. Und bei denjenigen Gruppen, die<br />
sich primär von Wurzelgemüse, Blättern und Früchten ernähren,<br />
sieht man wenig bis keine Zivilisationserkrankungen 66, 69<br />
.<br />
Kleine Wurzelkunde<br />
Zelluläres Wurzelgemüse zeigt eine etwas gleichmäßig zylindrisch<br />
zulaufende Form, entstanden durch die evolutionäre<br />
Umbildung des Stengels.<br />
Die Kartoffel, Topinambur oder Maniok sind Umbildungen,<br />
die durch die Verbindung der biologischen Triebachse der<br />
Wurzel und des Stengels entstanden sind. Diese Pflanzenarten<br />
haben sehr viele Speicherorganellen für Stärke. Oft<br />
finden sich in Knollen auch schilddrüsenhemmende Substanzen<br />
(Goitrogene).<br />
Wurzeln mit einem Schichtaufbau wie z.B. Zwiebeln sind Umbildungen<br />
der Verbindung der Sprossachse und der Blätter,<br />
die im Laufe der Evolution zusammengefaltet wurden, um<br />
Nährstoffe besser speichern zu können. Im Vergleich zu Knollen<br />
zeigen Pflanzen, die sich aus Blättern entwickelt haben, für<br />
Menschen eine optimale Zusammensetzung an Inhaltsstoffen.<br />
Eine weitere Wurzel mit einem Schichtaufbau ist die Rote Beete.<br />
Sie gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse und<br />
ist verwandt mit dem Mangold und voll mit gesunden Pflanzenstoffen.<br />
Das Problem<br />
Hat sich eine pro-entzündliche <strong>Darm</strong>flora erst einmal etabliert,<br />
gelangen diese Bakterien über durchlässige Stellen in<br />
der <strong>Darm</strong>wand ständig in den Körper und lösen weitere Entzündungen<br />
im Körperinneren aus. Auch fettreiche Mahlzeiten<br />
können vermehrt Bakterien in den Körper transportieren, da<br />
sie die Fettmoleküle als Transportmittel durch die <strong>Darm</strong>wand<br />
nutzen können. Diese »zweite Angriffswelle« geschieht bei<br />
fast jeder Mahlzeit. Diesen Angriff von Bakterien nennt man<br />
Endotoxämie. Dauerhafte Endotoxämie durch negativ unterstützende<br />
Lebensmittel oder häufiges Essen, führt zu einer<br />
chronischen niedriggradigen Entzündung 65<br />
. Aber auch bei<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
80
Abb. 6: Zelluläres Wurzelgemüse wie Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzeln, Rettich und Schwarzwurzel zeigen spitz zylindrisch zulaufende<br />
Form und enthalten kaum für Menschen schädliche Substanzen.<br />
81 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
intensiven sportlichen Leistungen oder anderen Stressfaktoren<br />
wird über die Ausschüttung der Stresshormone eine Endotoxämie<br />
ausgelöst, weil dadurch gleichzeitig eine schnellere<br />
Energieaufnahme möglich ist.<br />
Ebenfalls unter einer pro-entzündlichen Bakterienbesiedelung<br />
des <strong>Darm</strong>es leiden Kinder, die mit einem Kaiserschnitt geboren<br />
wurden. Wird nach der Geburt kein spezifisches Probiotikum<br />
für Neugeborene oral gegeben und vielleicht auch nicht<br />
gestillt, zeigen die Neugeborenen eine unnatürliche <strong>Darm</strong>flora,<br />
die zunächst der mütterlichen Hautflora entspricht 70<br />
. Diese<br />
unnatürliche <strong>Darm</strong>flora schon zu Beginn des Lebens erhöht<br />
die Wahrscheinlichkeit auf unzählige Zivilisationserkrankungen<br />
im späteren Leben 71<br />
.<br />
Das effiziente Schließen unserer Barrieren und die Normalisierung<br />
der gesamten Bakterienflora ist das Fundament für<br />
die Genesung von beinahe allen Erkrankungen bzw. die Erhaltung<br />
der Gesundheit.<br />
Neben einer optimalen Ernährung und der Reduktion aller<br />
genannten negativen Einflüsse können auch Sub stanzen<br />
wie ein Probiotikum in Pulverform, Lactoferrin in Pulverform<br />
(Immunmolekül zur Reduktion pathogener Bakterien), der<br />
Eiweißbaustein Glutamin (Hauptsubstanz zur Reparatur unserer<br />
Schutzbarrieren) und Zink (wichtigster Co-Faktor) eingesetzt<br />
werden 76-78<br />
. Die Kombina tion aller vier Interventionen<br />
ist laut aktueller Forschung am vielversprechendsten 79, 80<br />
.<br />
Die Mundbarriere<br />
Obwohl die Fläche im Mundinnenraum nicht groß ist, verdient<br />
die Mundbarriere ganz besondere Aufmerksamkeit.<br />
Entzündungen des Zahnhalteapparates (Periodontitis) und<br />
Zahnfleischentzündungen als Folge einer ungünstigen Bakterienbesiedelung<br />
der Mundhöhle führen nicht nur zur Schädigung<br />
der Zähne, sondern auch zur systemischen Aktivierung<br />
des Immunsystems im gesamten Körper. Letzteres<br />
geschieht auch im <strong>Darm</strong> auf wesentlich größerer Fläche. <strong>Der</strong><br />
Mundraum ist aber intensiver mit Bakterien konfrontiert, weil<br />
ein Großteil anschließend in der Magensäure unschädlich<br />
gemacht wird, bevor sie in den <strong>Darm</strong> gelangen. Alle neuen<br />
Untersuchungen zeigen einen starken Zusammenhang zwischen<br />
Entzündungen und Fehlbesiedelung der Mundhöhle<br />
und systemischen Erkrankungen. Schon eine leichte Zahnfleischentzündung<br />
verursacht erhöhte Entzündungsmarker<br />
im Blut, was einer niedriggradigen Entzündung entspricht 72<br />
.<br />
Eine Bakterienfehlbesiedelung mit einer entzündlichen<br />
Mundflora wurde auch schon wissenschaftlich in Zusammenhang<br />
gebracht mit Diabetes Mellitus Typ 2 73<br />
und neurodegenerativen<br />
Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson, Multiple<br />
Sklerose) 74, 75<br />
.<br />
Ob bereits ein Zahnfleischleiden vorliegt, erkennt man am<br />
Zahnfleischbluten während der Benutzung von Zahnseide,<br />
Zahnbürste oder Zahnstocher. Beginnt es zu bluten, kann<br />
man von einer bakteriellen Belastung und gleichzeitigen Entzündung<br />
ausgehen.<br />
Eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Tipps<br />
für den Verdauungstrakt, vom Mund bis zum Ausgang<br />
õõ<br />
Süßwaren, Zucker und süße Getränke (Limonaden,<br />
Fruchtsäfte) nach Möglichkeit aus der täglichen Nahrung<br />
streichen. Empfehlenswert ist, die ganze Frucht zu pürieren,<br />
weil dann die Faserstoffe erhalten bleiben.<br />
õõ<br />
Getreide (Vollkorn), Reis, Kartoffeln und Hülsenfrüchte meiden<br />
bzw. reduzieren wegen ihrer Antinutrienten, Faserstoffe<br />
und Kohlenhydrate.<br />
õõ<br />
Zahnseide drei bis vier Mal pro Woche verwenden.<br />
õõ<br />
Mit Probiotikumpulver und/oder Lactoferrinpulver den<br />
Mund eine Minute lang spülen und dann schlucken. Anschließend<br />
zehn bis zwanzig Minuten wirken lassen ohne<br />
eine weitere Nahrungs- oder Flüssigkeitszufuhr.<br />
õõ<br />
Glutamin zusätzlich zu den Mahlzeiten verwenden für den<br />
Aufbau der Barrieren.<br />
õõ<br />
Den Mund mit Olivenöl spülen und anschließend ausspucken.<br />
õõ<br />
Keine chemischen Mundspülungen verwenden da diese<br />
vor allem nützliche Bakterien töten.<br />
õõ<br />
Verwendung der Lebensmittelliste und der Rezeptideen.<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
82
Nahrung als Medizin<br />
Hilfreiche Lebenssmittel<br />
Algen<br />
Ananas<br />
Apfel<br />
Avocado<br />
Curcuma<br />
Eier<br />
Fenchel<br />
Fermentiertes Gemüse<br />
Geflügel<br />
Grünes Blattgemüse, besonders Spinat<br />
Ingwer<br />
Knoblauch<br />
Kohlgemüse<br />
Meeresfisch<br />
Meeresfrüchte und Schalentiere<br />
Nelken<br />
Nüsse, besonders Mandeln, Cashewnüsse<br />
Oregano<br />
Papaya<br />
Petersilie<br />
Pilze<br />
Spargel<br />
Tymian<br />
Wurzelgemüse, besonders Karotten<br />
Honig<br />
Kokosnuss<br />
Minze<br />
Obst<br />
Sesam<br />
Tabu<br />
Amaranth, Quinoa<br />
Getreide<br />
Haushaltszucker<br />
Hülsenfrüchte, besonders Soja<br />
Industriell erzeugte Fertigprodukte<br />
Industriell erzeugte Fruchtsäfte<br />
Kartoffel<br />
Mais<br />
Pflanzenöle, besonders Maiskeim-, Distel-, Sonnenblumen-,<br />
Erdnussöl<br />
Reis<br />
Senf<br />
Süßgetränke, Energydrinks<br />
83 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Pulposalat<br />
Vorspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
400 g frischer Tintenfisch<br />
õõ<br />
200 g frisches Fischfilet mit festem Fleisch<br />
õõ<br />
50 g Sesam<br />
õõ<br />
1 Avocado<br />
õõ<br />
1 große Mango<br />
õõ<br />
1 Kopfsalat<br />
õõ<br />
½ Bund Minze<br />
õõ<br />
1 TL scharfes Paprika- oder Chilipulver<br />
õõ<br />
1 Zitrone, Saft<br />
õõ<br />
8 EL Olivenöl<br />
õõ<br />
Dunkler Honig nach Belieben<br />
õõ<br />
Salz<br />
õõ<br />
Pfeffer<br />
Tintenfisch in Stücke schneiden und in Salzwasser mit etwas<br />
Essig weich kochen (je nach Dicke beträgt die Kochzeit bis<br />
zu einer Stunde).<br />
Zitronensaft mit Pfeffer, Meersalz, Olivenöl, Paprikapulver<br />
und 5 fein gehackten Minzeblättern gut verrühren. Nach Geschmack<br />
Honig einrühren.<br />
Tintenfisch in mundgerechte Stücke schneiden und in einer<br />
Schüssel mit der Hälfte des Dressings vermengen.<br />
Fisch in Streifen schneiden, mit Sesam bestreuen und gut<br />
andrücken. In einer Pfanne mit etwas Olivenöl beidseitig<br />
braun anbraten.<br />
Salat waschen und in eine Schüssel geben. Mango und<br />
Avocado schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Minze<br />
grob hacken, mit Pulpo und dem restlichen Dressing zum<br />
Salat geben. Salat mit den Sesam-Fischsticks anrichten.<br />
INFO:<br />
Pulpo gehört zu der Familie der Schnecken. Beide sind reich an Iod, einer<br />
Vorstufe des menschlichen Schilddrüsenhormons, Zink und Omega-3-<br />
Fettsäuren. Diese Art von Tieren haben maßgebliche Auswirkungen auf<br />
die Gehirnaktivität.<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
84
Thain von der Aubergine<br />
Vorspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
3 Auberginen<br />
õõ<br />
300 g Gemüse der Saison (Karotten, Tomaten,<br />
Gurken …)<br />
õõ<br />
100 g Thain (Sesampaste)<br />
õõ<br />
30 g Pinienkerne<br />
õõ<br />
3 Knoblauchzehen<br />
õõ<br />
2 – 3 EL Zitronensaft<br />
õõ<br />
1 EL Olivenöl<br />
õõ<br />
1 TL Paprikapulver<br />
õõ<br />
Salz<br />
õõ<br />
Pfeffer<br />
Aubergine bei 200° C in den Ofen geben, bis sich die Haut<br />
schwarz gefärbt hat.<br />
Anschließend halbieren und mit einem Löffel das weiche<br />
Fruchtfleisch herauslöffeln.<br />
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht braun rösten.<br />
Das Gemüse in gleichmäßige Streifen schneiden.<br />
Sesampaste mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Aubergine und Zitronensaft<br />
pürieren. Paste in einer Schüssel anrichten und<br />
mit Pinienkernen bestreuen. Mit ein wenig Paprikapulver und<br />
Olivenöl verfeinern.<br />
Als Dipp zum Gemüse reichen.<br />
85 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Eigelb mit Schneckenkaviar<br />
und Olivenöl<br />
Vorspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
4 Eigelb<br />
õõ<br />
4 TL Schneckenkaviar<br />
õõ<br />
1 EL frisches, grünes Olivenöl<br />
Das Eigelb gründlich vom Eiweiß trennen. Zusammen mit<br />
einem TL Schneckenkaviar und einem Schuss Olivenöl anrichten.<br />
INFO:<br />
Früh geerntetes und richtig gelagertes (luftdicht, dunkel, kühl) Olivenöl<br />
ist durch einen scharf, frischen Geschmack gekennzeichnet. Ölsorten<br />
wie Picual und Frantoio entwickeln zusätzlich Aromen nach frisch geschnittenem<br />
Gras. Diese Art von Olivenöl passt besonders gut zu dieser<br />
Kombination.<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
86
Gemüsespaghetti<br />
Hauptspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
600 g verschiedenes Gemüse der Saison<br />
(Karotten, Zucchini, Pastinake, Kürbis)<br />
õõ<br />
50 g rote Currypaste<br />
õõ<br />
200 ml Kokosmilch<br />
õõ<br />
Meersalz oder Fischsauce<br />
õõ<br />
Korianderblätter<br />
Das Gemüse schälen und mit einem Spiralschneider Spaghetti<br />
abdrehen. Die Kokosmilch zum Kochen bringen und<br />
die Currypaste einrühren.<br />
Nach Geschmack mit etwas Fischsauce oder Salz abschmecken<br />
und einige Minuten leicht köcheln lassen. Die Spaghetti<br />
vorsichtig hinzufügen, den Topf verschließen und vom Herd<br />
nehmen. 5 Minuten ohne weiteres Erhitzen garen lassen und<br />
dann sofort anrichten.<br />
VARIANTE:<br />
Gemüsespaghetti Bolognese mit Huhn<br />
600 g verschiedenes Gemüse der Saison<br />
(Karotten, Zucchini, Pastinake, Kürbis)<br />
300 g Hühnerhackfleisch oder klein geschnittenes Hühnerfleisch<br />
400 g gewürfelte Tomaten aus der Dose (Glas)<br />
1 EL Tomatenmark<br />
2 Zwiebeln<br />
87 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...
Curryhühnchen im Zucchinimantel mit Feigen<br />
Hauptspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
500 g Hühnerfilet oder Brust<br />
õõ<br />
2 Zucchini<br />
õõ<br />
Meersalz<br />
õõ<br />
1 TL Kreuzkümmel<br />
õõ<br />
1 TL Korianderpulver<br />
õõ<br />
1 TL Curry<br />
õõ<br />
2 Zwiebeln<br />
õõ<br />
2 Knoblauchzehen<br />
õõ<br />
12 Feigen<br />
Für die Marinade Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, zusammen<br />
mit dem gemahlenen Kreuzkümmel, Koriander und<br />
Curry vermengen. Huhn in feine Würfel schneiden, marinieren<br />
und 1 – 2 Stunden ziehen lassen.<br />
Zucchini der Länge nach in dünne Scheiben hobeln, auf ein<br />
Blech legen und reichlich mit Meersalz bestreuen (Wasser<br />
soll entzogen werden). Anschließen das Salz unter fließendem<br />
Wasser abspülen. Die Zucchini-Scheiben trocken tupfen.<br />
Backofen auf 180° C vorheizen. Einen gehäuften Esslöffel<br />
des marinierten Huhns mittig auf eine Zucchini-Scheibe geben<br />
und einrollen. Eine zweite Scheibe um die Füllung geben,<br />
sodass ein geschlossenes Päckchen entsteht. In einer ofenfesten<br />
Form 15 Minuten bei 180° C garen.<br />
Vor dem Servieren die Päckchen halbieren, mit Kürbisspaghetti<br />
und den Feigen anrichten.<br />
89 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02
Löchrig wie ein Schweizer Käse ...<br />
Fischfilet à la Picasso mit<br />
Chinakohl<br />
Hauptspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
600 g Fischfilet (weißfleischig)<br />
õõ<br />
600 g verschiedene Früchte wie Mango,<br />
Melone, Marillen, Rosinen …<br />
õõ<br />
½ Chinakohl<br />
õõ<br />
2 große Zwiebeln<br />
õõ<br />
50 ml Fischfond<br />
õõ<br />
1 Chili<br />
õõ<br />
Salz<br />
õõ<br />
Pfeffer<br />
õõ<br />
1 Prise Sesamsamen<br />
Früchte (keine Zitrusfrüchte) und Chinakohl in mundgerechte<br />
Stücke schneiden. Zwiebeln in feine Würfel schneiden und in<br />
einer Pfanne kurz dünsten.<br />
Früchte und Chinakohl zu den Zwiebeln geben. Mit Fischfond<br />
aufgießen und leicht köcheln lassen.<br />
Fischfilet unter fließendem Wasser abspülen und evtl. vorhandene<br />
Gräten entfernen, zu den Früchten geben und 5 – 8<br />
Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und gehacktem Chili würzen.<br />
Sesamsamen kurz in einer Pfanne rösten.<br />
Auf einem Teller das Fischfilet mit den Früchten anrichten und<br />
mit den Sesamsamen bestreuen.<br />
INFO:<br />
Da dieses Gericht am Ende auf dem Teller wie ein Gemälde aussieht,<br />
wurde es nach dem berühmten Maler benannt.<br />
<strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02<br />
90
Mango-Avocado-Smoothie<br />
Nachspeise<br />
<br />
Zutaten<br />
õõ<br />
1 Avocado<br />
õõ<br />
1 Mango<br />
õõ<br />
1 EL Honig<br />
õõ<br />
5 EL Crushed Ice<br />
õõ<br />
200 ml Kokosmilch<br />
õõ<br />
frische Minze<br />
Avocados halbieren, entkernen und Fruchtfleisch mit einem<br />
Löffel auslösen.<br />
Mango schälen, entkernen und Fruchtfleisch in grobe Stücke<br />
schneiden.<br />
Avocado-Fruchtfleisch, Mango, Eis, Honig und Kokosmilch<br />
in einem Gefäß fein pürieren.<br />
Vor dem Servieren mit etwas Minze garnieren.<br />
91 <strong>Der</strong> <strong>undichte</strong> <strong>Darm</strong> 02