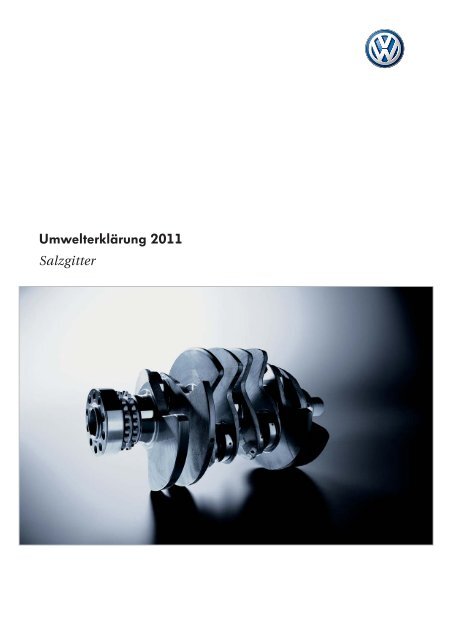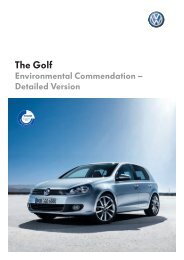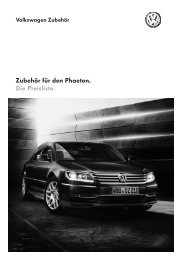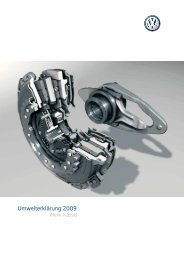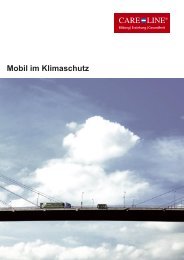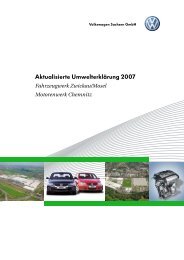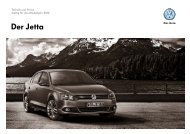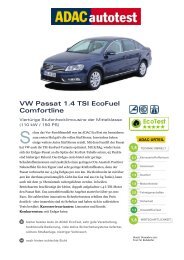Umwelterklärung 2011 Werk Salzgitter (1,8 MB) - Volkswagen AG
Umwelterklärung 2011 Werk Salzgitter (1,8 MB) - Volkswagen AG
Umwelterklärung 2011 Werk Salzgitter (1,8 MB) - Volkswagen AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Umwelterklärung</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
standortübergreifender Teil 1
2<br />
Standortübergreifender Teil
Standortübergreifender Teil 3<br />
Für den <strong>Volkswagen</strong> Konzern ist Nachhaltigkeit<br />
ein wesentliches Grundprinzip der Unternehmensführung.<br />
Wirtschaftlicher Erfolg, Umweltschutz und soziale<br />
Verantwortung: Diese drei Aspekte gilt es<br />
langfristig und weltweit in Einklang zu bringen.<br />
Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn<br />
Vorsitzender des Vorstands der <strong>Volkswagen</strong> Aktiengesellschaft
4<br />
Standortübergreifender Teil
Inhalt<br />
Gemeinsames<br />
6 Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
9 Umweltpolitik von <strong>Volkswagen</strong><br />
11 Produktion und Erzeugnisse<br />
16 Betriebliches Umweltmanagement<br />
19 Methoden und Instrumente<br />
22 System zur Erfassung und Bewertung von<br />
Umweltaspekten<br />
24 Umweltbilanzen<br />
25 Einhaltung von Vorschriften<br />
27 Einbindung von Mitarbeitern<br />
28 Umweltaudits<br />
28 Umweltleistung<br />
29 Umweltschonende Fertigungsverfahren<br />
Standortübergreifender Teil 5<br />
Zum <strong>Werk</strong><br />
5 Vorstellung des Standortes<br />
9 Beschreibung wesentlicher umweltrelevanter<br />
Anlagen<br />
10 Besonderheiten und Entwicklung<br />
15 Umweltauswirkungen des Standortes<br />
16 Entwicklung der Kernindikatoren<br />
24 Umweltprogramm<br />
28 Gültigkeitserklärung<br />
Anhang<br />
33 Abkürzungen und Erklärungen<br />
34 Weitere Informationen<br />
35 Impressum<br />
Die <strong>Umwelterklärung</strong>en der <strong>Werk</strong>e Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Emden, <strong>Salzgitter</strong>, Dresden (Automobilmanufaktur)<br />
und Hannover (<strong>Volkswagen</strong> Nutzfahrzeuge) erscheinen in dieser Broschüre zusammen.<br />
Modularer Aufbau und stilgleiche Darstellungsweise der vorliegenden „Gemeinsamen <strong>Umwelterklärung</strong> <strong>2011</strong>“<br />
ermöglichen einen informativen und gesamthaften Überblick über die kontinuierliche Verbesserung des<br />
Betrieblichen Umweltschutzes an diesen Standorten. Diese Broschüre wird jährlich aktualisiert und herausgegeben.<br />
Hinweis: Die Angaben dieser <strong>Umwelterklärung</strong> beziehen sich auf das Bilanzjahr 2010.
6<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
Michael Macht und Bernd Osterloh<br />
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,<br />
in Ihren Händen halten Sie unsere aktuelle <strong>Umwelterklärung</strong>,<br />
in der wir dokumentieren, wie ernst wir<br />
bei <strong>Volkswagen</strong> das Thema Umweltschutz nehmen<br />
und wie wir es in den gesamten Unternehmensprozess<br />
einbinden. Als global agierendes Unternehmen<br />
sind wir uns unserer besonderen Verantwortung gegenüber<br />
Mensch, Umwelt und Gesellschaft bewusst.<br />
Nur wer soziale, ökonomische und ökologische Aspekte<br />
berücksichtigt, kann nachhaltig wirtschaften,<br />
umweltgerecht handeln und Beschäftigung sichern.<br />
Sichtbare Anerkennung findet unser Engagement<br />
durch die Aufnahme in den renommierten Dow<br />
Jones Sustainability Index, in dem <strong>Volkswagen</strong> seit<br />
Jahren vertreten ist. Im strengen Auswahlverfahren<br />
für diesen Index werden Kriterien wie z. B. das<br />
Umweltmanagement, die Klimastrategie sowie das<br />
Risikomanagement geprüft und bewertet.<br />
Alle für uns wichtigen Leitbilder haben wir aus der<br />
oben beschriebenen Verantwortung abgeleitet und<br />
in unserer Umweltpolitik festgeschrieben. Konkret<br />
umgesetzt werden sie u. a. durch die „Betriebsvereinbarung<br />
Umweltschutz“, mit der wir jeden<br />
<strong>Volkswagen</strong> Beschäftigten auffordern, die gute<br />
Umweltpraxis in sein individuelles Arbeitsumfeld<br />
aufzunehmen und in der täglichen Arbeit zu berücksichtigen.<br />
Ein kontinuierlicher Motor bei der Verbesserung von<br />
Umweltleistungen ist dabei unser Umweltmanagement-System.<br />
Seit 1995 beteiligt sich <strong>Volkswagen</strong> am<br />
Öko-Audit-Verfahren der Europäischen Union und<br />
kann damit auf die längste Erfahrung aller europäischen<br />
Hersteller zurückgreifen. Durch die regelmäßige<br />
Durchführung von internen und externen<br />
Umweltaudits werden die Umweltmanagement-Systeme<br />
ständig überprüft und weiter optimiert.<br />
Die eigenverantwortliche Festlegung von Zielen und<br />
Programmen fordert kontinuierlich alle Organisationseinheiten<br />
der Standorte und ermöglicht die<br />
ständige Verbesserung der Umweltleistungen.<br />
Neben der EMAS-Validierung der hier dargestellten<br />
Standorte wird auch die Arbeit unserer Technischen<br />
Entwicklung zertifiziert, u. a. auf der Grundlage der<br />
internationalen Norm DIN ISO 14062 (Umweltmanagement<br />
– Integration von Umweltaspekten in Produktdesign<br />
und -entwicklung), um den Gedanken<br />
und die Anforderungen des Umweltschutzes nachhaltig<br />
in der Produktentwicklung zu verankern. Für<br />
uns spielen die Reduktion des Kraftstoffverbrauchs<br />
und damit des CO -Ausstoßes in der Nutzungsphase<br />
2<br />
und die kontinuierliche Reduzierung des Energieverbrauchs<br />
und der Emissionen in der Produktion<br />
bei gesteigerter Fertigungszahl eine wichtige Rolle.<br />
<strong>Volkswagen</strong> hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2018 der<br />
ökologisch und ökonomisch führende Automobilhersteller<br />
zu sein. Dies erfordert eine ganzheitliche<br />
Betrachtungs- und Herangehensweise, die sich in<br />
unserem Handeln und in unserer Kommunikation<br />
widerspiegeln muss. „Think Blue“ als Haltung, die<br />
über Produkte und Technologien hinausgeht, ist<br />
hierfür ein wichtiges Zeichen nach innen wie außen.<br />
Wir wollen damit einen Denkanstoß geben und<br />
gemeinsam mit unseren Kunden nach Möglichkeiten<br />
suchen, noch umweltverträglicher mobil zu sein.<br />
Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist<br />
das <strong>Volkswagen</strong> „BlueMotion Technologies“-Konzept.<br />
Unter dieser Dachmarke bündeln wir innovative<br />
Technologien und Produkte, die umweltverträgliche<br />
Mobilität ohne Verzicht auf Dynamik und<br />
Alltagstauglichkeit ermöglichen. Für unsere Kunden<br />
bedeutet das mehr Effizienz, geringere Schadstoffbelastung<br />
und uneingeschränkten Fahrspaß.
Umweltschutz im Gesamtprozess<br />
Michael Macht und Bernd Osterloh<br />
Aushängeschild dieses umweltfreundlichen Konzepts<br />
ist der Polo BlueMotion, der sparsamste Fünfsitzer<br />
der Welt. Bei einem Kraftstoffverbrauch von<br />
3,3 Litern emittiert dieser gewichtsreduzierte Polo<br />
pro gefahrenem Kilometer lediglich 87 g Kohlendioxid,<br />
wobei der 1,2-Liter-Motor 55 kW/75 PS leistet.<br />
Innovative Konzepte und Ideen werden in den<br />
Produkten und in unseren Produktionsprozessen<br />
umgesetzt. An vielen Standorten finden dazu Modellprojekte<br />
z. B. zur Steigerung der Energieeffizienz<br />
und der Ressourcenschonung statt.<br />
Dr. Michael Macht<br />
Konzernvorstand Produktion<br />
Standortübergreifender Teil 7<br />
Mithilfe der Innovationsstärke unserer Mitarbeiter<br />
und Partner haben wir in den vergangenen Jahren<br />
unsere Umweltleistungen kontinuierlich verbessert.<br />
Gründe dafür sehen wir auch in der stetigen<br />
Schulung unserer Mitarbeiter und der Motivation<br />
durch die Vergabe des internen <strong>Volkswagen</strong> Umweltpreises.<br />
Im Namen der aktiven und transparenten Informationspolitik<br />
unseres Hauses wünschen wir Ihnen<br />
nun viel Freude beim Lesen.<br />
Bernd Osterloh<br />
Vorsitzender Gesamtbetriebsrat<br />
<strong>Volkswagen</strong>
8<br />
Standortübergreifender Teil
Umweltpolitik von <strong>Volkswagen</strong><br />
Präambel<br />
<strong>Volkswagen</strong> entwickelt, produziert und vertreibt<br />
weltweit Automobile zur Sicherstellung individueller<br />
Mobilität. Das Unternehmen trägt Verantwortung<br />
für die kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit<br />
seiner Produkte und die Verringerung<br />
der Beanspruchung der natürlichen Ressourcen und<br />
des Energieverbrauchs unter Berücksichtigung wirtschaftlicher<br />
Gesichtspunkte. Es macht daher<br />
Grundsätze<br />
1. Es ist das erklärte Ziel von <strong>Volkswagen</strong>, bei all<br />
seinen Aktivitäten die Einwirkungen auf die Umwelt<br />
so gering wie möglich zu halten und mit den<br />
eigenen Möglichkeiten an der Lösung der regionalen<br />
und globalen Umweltprobleme mitzuwirken.<br />
2. Es ist das Ziel von <strong>Volkswagen</strong>, hochwertige<br />
Automobile anzubieten, die den Ansprüchen seiner<br />
Kunden an Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit,<br />
Sicherheit, Qualität und Komfort in gleicher<br />
Weise gerecht werden.<br />
3. Zur langfristigen Sicherung des Unternehmens<br />
und zur Steigerung seiner Wettbewerbsfähigkeit<br />
erforscht und entwickelt <strong>Volkswagen</strong> ökologisch<br />
effiziente Produkte, Prozesse und Konzepte für individuelle<br />
Mobilität.<br />
4. Das Umweltmanagement von <strong>Volkswagen</strong> stellt<br />
auf der Grundlage der Umweltpolitik sicher, dass gemeinsam<br />
mit Zulieferunternehmen, Dienstleistern,<br />
Handelspartnern und Verwertungsunternehmen die<br />
Umweltverträglichkeit seiner Automobile und<br />
Standortübergreifender Teil 9<br />
umwelteffiziente fortschrittliche Technologien weltweit<br />
verfügbar und bringt sie über den gesamten Lebenszyklus<br />
seiner Produkte zur Anwendung. Es ist an<br />
allen Standorten Partner für Gesellschaft und Politik<br />
bei der Ausgestaltung einer sozialen und ökologisch<br />
nachhaltigen positiven Entwicklung.<br />
Fertigungsstandorte einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
unterworfen ist.<br />
5. Der Vorstand von <strong>Volkswagen</strong> überprüft regelmäßig<br />
die Einhaltung der Umweltpolitik und -ziele<br />
sowie die Funktionsfähigkeit des Umweltmanagement-Systems.<br />
Dies schließt die Bewertung der<br />
erfassten umweltrelevanten Daten ein.<br />
6. Die offene und klare Information sowie der<br />
Dialog mit Kunden, Händlern und der Öffentlichkeit<br />
sind für <strong>Volkswagen</strong> selbstverständlich. Die Zusammenarbeit<br />
mit Politik und Behörden beruht auf einer<br />
handlungsorientierten und vertrauensvollen Grundhaltung<br />
und bezieht die Notfallvorsorge an den<br />
einzelnen Produktionsstandorten mit ein.<br />
7. Alle Mitarbeiter von <strong>Volkswagen</strong> werden entsprechend<br />
ihren Aufgaben im Umweltschutz informiert,<br />
qualifiziert und motiviert. Sie sind zur Umsetzung<br />
dieser Grundsätze sowie zur Erfüllung der gesetzlichen<br />
und behördlichen Auflagen im Rahmen ihrer<br />
jeweiligen Aufgabenstellung verpflichtet.
10<br />
Standortübergreifender Teil
Produktion und Erzeugnisse<br />
Fahrzeugfertigung<br />
Logistik<br />
Um ein modernes Kraftfahrzeug herstellen zu<br />
können, müssen bis zu 10.000 Einzelteile programmund<br />
zielgerecht zusammengeführt werden. Dies<br />
bedeutet hohe Anforderungen an eine exakte Produktionsplanung,<br />
präzise Organisation und termingerechten<br />
Transport. Jedes Teil muss zum richtigen<br />
Zeitpunkt am richtigen Einbauort sein. Großrechner<br />
steuern die Anlieferung der Einzelteile sekundengenau.<br />
Diese komplizierten Abläufe erfordern eine<br />
detaillierte Logistik. Sie beginnt im Beschaffungsbereich,<br />
der bei der Zulieferindustrie die benötigten<br />
Teile, Baugruppen und Komponenten einkauft. Größere<br />
Materialmengen werden für alle <strong>Werk</strong>e zentral<br />
beschafft und möglichst ohne Zwischenlagerung<br />
direkt an die Produktion geliefert.<br />
Die wesentlichen Umweltaspekte sind Emissionen<br />
von CO, CO und NO . Mit ständig verbesserten Lo-<br />
2 x<br />
gistikkonzepten wird an deren Reduzierung gearbeitet.<br />
Erfolgreiche Maßnahmen sind u. a. Nutzung der<br />
Bahn, soweit technisch und wirtschaftlich möglich,<br />
und Erhöhung der Ausnutzung des Transportraums<br />
durch Warenbündelung sowie durch Optimierung<br />
der Behältergrößen. Transparenz schafft eine neu<br />
entwickelte Datenbank, mit der sich die Umweltauswirkungen<br />
verschiedener Verkehrsträger und<br />
logistischer Lösungen miteinander vergleichen<br />
lassen.<br />
Ein Fließschema auf Seite 14 verdeutlicht die Abläufe,<br />
die im Folgenden beschrieben werden.<br />
Karosserie<br />
An erster Stelle in der Prozesskette steht das Presswerk.<br />
Ausgangsmaterial für die meisten Karosserieteile<br />
ist Feinblech in Rollenform (Coils). Das verwendete<br />
Material ist immer noch überwiegend Stahl,<br />
Standortübergreifender Teil 11<br />
zunehmend kommt aber auch Aluminium zum<br />
Einsatz.<br />
Die Bearbeitung erfolgt mit Scheren, Stanzen und<br />
Tiefziehpressen. Dabei entstehen Bodengruppen,<br />
Dächer, Rahmenprofile, Motorhauben, Heckklappen<br />
und Türen. Um die Materialeffizienz des Prozesses<br />
zu optimieren und gleichzeitig die Abfallmenge zu<br />
verkleinern, wird ständig daran gearbeitet, durch<br />
Verbesserung des Zuschnitts und durch Weiternutzung<br />
von ausgestanzten Blechen die Coils möglichst<br />
gut auszunutzen. Rund 45 % des eingesetzten Materials<br />
fallen als Abfall an. Nach sortenreiner Sammlung<br />
wird dieser zur Volumenverringerung paketiert<br />
und zu 100 % in den Materialkreislauf zurückgeführt.<br />
Aus Sicht des Umweltschutzes sind daneben die<br />
Anwendung großer Mengen an Zieh- und Hydraulikölen<br />
und das Auftreten von Lärm, Erschütterungen<br />
und Schwingungen besonders zu beachten.<br />
Im nächsten Arbeitsschritt fügen Roboter im nahezu<br />
vollständig automatisierten Karosseriebau die Einzelteile<br />
zur Rohkarosserie.<br />
Wesentliche Fügetechnik ist das energieeffiziente<br />
Punktschweißen, es kommen aber auch Verfahren<br />
wie Clinchen, Kleben – mit lösemittelarmen<br />
bzw. -freien Klebstoffen – und Laserschweißen zur<br />
Anwendung. Die Energieeffizienz der Laseraggregate<br />
konnte in den vergangenen Jahren signifikant<br />
gesteigert werden.<br />
Viele Maschinen im Karosseriebau werden hydraulisch<br />
betrieben. Die entsprechenden Aggregate<br />
befinden sich in Auffangwannen. Sie bewahren den<br />
Untergrund im Fall einer Betriebsstörung vor austretender<br />
Hydraulikflüssigkeit.<br />
Schweißrauche werden gezielt abgesaugt und vor<br />
Abgabe an die Umwelt über geeignete Filteranlagen<br />
vom größten Teil der Partikel befreit.
12<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Produktion und Erzeugnisse<br />
Fahrzeugfertigung<br />
Lackieren<br />
In der Lackiererei wird mit großen Mengen Material,<br />
Wasser und Energie umgegangen. Es entstehen<br />
Emissionen organischer Lösemittel in die Luft und<br />
als gefährlicher Abfall zu entsorgende Lackschlämme.<br />
Außerdem müssen große Abwassermengen<br />
behandelt werden. Dieser Bereich ist deswegen der<br />
Prozessschritt in der gesamten Fahrzeugproduktion<br />
mit der größten Umweltrelevanz.<br />
Nach dem Entfetten, Spülen und Passivieren in<br />
Tauch- und Spülbädern erhalten die Karossen<br />
in mehreren Arbeitsgängen verschiedene Lackschichten.<br />
Sie schützen das Metall vor Korrosion<br />
und geben dem Fahrzeug die gewünschte Farbe.<br />
Es wird ständig daran gearbeitet, den Wirkungsgrad<br />
des Lackauftrags zu erhöhen, den Lack also möglichst<br />
verlustarm zu applizieren. Hierbei kommen<br />
Lackaufbau, schematisch. Schichtdicken in Tausendstel Millimeter (μm).<br />
Verzinktes Stahlblech<br />
Kathodische<br />
Tauchlackierung<br />
Zinkphosphatierung<br />
Basislack<br />
Füller<br />
Klarlack<br />
0–8 µm<br />
überwiegend Wasserlacke mit einem äußerst geringen<br />
Lösemittelanteil zum Einsatz. Die oberste<br />
Schicht, der Klarlack, muss die Karosserie gegen<br />
vielfältige äußere Einflüsse schützen sowie höchsten<br />
Qualitätsanforderungen genügen und enthält deshalb<br />
einen größeren Anteil organischer Lösemittel.<br />
Beim Trocknungsprozess verdunsten die Lösemittel<br />
und werden in nachgeschalteten Anlagen verbrannt.<br />
Die dabei entstehende Wärme wird wiederum zum<br />
Beheizen des Lacktrockners genutzt. Die Lösemittelemissionen<br />
unterliegen regelmäßiger Überwachung.<br />
Alle Grenzwerte werden eingehalten bzw.<br />
unterschritten.<br />
Abschließend erfolgt die Konservierung. Dabei<br />
werden die Hohlräume mit Heißwachs geflutet – ein<br />
lösemittelfreier und deshalb umweltverträglicher<br />
Vorgang.<br />
17–22 µm<br />
25–35 µm<br />
12–30 µm<br />
35–45 µm<br />
Haftung<br />
Steinschlagschutz<br />
Korrosionsschutz<br />
Farbton<br />
UV-Schutz<br />
Glanz
Produktion und Erzeugnisse<br />
Fahrzeugfertigung<br />
Montage<br />
Anschließend erfolgt der Zusammenbau des Fahrzeugs<br />
an den zum Teil automatisierten Montagelinien.<br />
Hierbei komplettieren überwiegend vorgefertigte<br />
Baugruppen und Module (unter anderem Cockpit,<br />
Sitze, Antriebseinheit) das Automobil. So besteht<br />
beispielsweise die Antriebseinheit aus Motor, Getriebe<br />
und Vorderachse. Diese stammen hauptsächlich<br />
aus der Produktion anderer <strong>Werk</strong>e des Konzerns.<br />
Eine logistische Herausforderung stellt die enorme<br />
Vielfalt an möglichen Fahrzeugvarianten dar. Ein<br />
riesiges Spektrum von Komponenten muss zeitlich<br />
und räumlich punktgenau an den Montagebändern<br />
eintreffen.<br />
Wolfsburg<br />
49.858 Beschäftigte<br />
Braunschweig<br />
5.548 Beschäftigte<br />
Kassel<br />
12.988 Beschäftigte<br />
Emden<br />
7.536 Beschäftigte<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
5.950 Beschäftigte<br />
Hannover<br />
12.530 Beschäftigte<br />
Dresden<br />
ca. 400 Beschäftigte<br />
Fahrzeuge<br />
Golf, Golf Plus,<br />
Touran, Tiguan<br />
Passat, Passat Variant,<br />
Passat CC<br />
Großraumlimousinen,<br />
Nutzfahrzeuge<br />
auf Basis T5<br />
Phaeton<br />
Massenstrom<br />
Kunststoff technik<br />
Stoßfänger,<br />
Kunststoff tanks<br />
breite Palette an<br />
Spritzgussteilen<br />
Standortübergreifender Teil 13<br />
Ist das Fahrzeug fahrbereit, wird es betankt. Zur Vermeidung<br />
von Emissionen wird dabei wie bei externen<br />
Tankstellen ein Befüllsystem mit Abgasrückführung<br />
angewendet. Anschließend fährt das Fahrzeug<br />
mit eigenem Antrieb zu den Einstellständen. Hier<br />
prüfen Mitarbeiter die Funktion von Motor, Bremsen,<br />
Lenkung und Scheinwerfern. Auf einem Rollenprüfstand<br />
absolviert das Auto eine erste Probefahrt.<br />
Im Anschluss fahren die Automobile zur Verladerampe<br />
und per Bahn bzw. Lkw zu den Händlern. Auf<br />
Kundenwunsch werden sie dabei durch Klebefolien<br />
oder Transportschutzhauben gegen Umwelteinflüsse<br />
geschützt.<br />
Massenstrom<br />
Karosseriebau<br />
Massenstrom<br />
Fahrwerk<br />
Pressteile Stahlräder,<br />
Lenkstangenrohr,<br />
Seilzugschaltung<br />
Pressteile, Zusammenbauten<br />
Pressteile<br />
Pressteile, Zusammenbauten,<br />
lackierte<br />
Karossen für andere<br />
Montagestandorte<br />
Querlenker,<br />
Cornermodule, Federbeine/Dämpfer,<br />
Hilfsrahmen,<br />
Schwenklager,<br />
Achsen,<br />
Lenkgetriebe,<br />
Schräglenker<br />
Massenstrom<br />
Antrieb<br />
Antriebsgelenkwellen<br />
Getriebe, Zylinderkurbelgehäuse,Abgasanlagen,aufbereitete<br />
Aggregate<br />
und Aggregateteile<br />
Motoren,<br />
Zylinderkurbelgehäuse,Zylinderköpfe,Kurbelwellen,<br />
Saugrohre<br />
Wärmetauscher,<br />
Zylinderköpfe,<br />
Saugrohre
14<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Produktion und Erzeugnisse<br />
Fahrzeugfertigung<br />
So entsteht ein Fahrzeug<br />
Gießerei<br />
Aluminium/Magnesium<br />
Einsatz von Leichtmetallschrotten<br />
Mechanische <strong>Werk</strong>stätten<br />
Getriebe, Motoren, Achsen,<br />
Bremsen, Felgen, Kleinteile<br />
Härterei<br />
Konservierung, Galvanik,<br />
Tauchlackierung<br />
Kunststoff teilefertigung<br />
Stoßstange, Armaturentafel,<br />
Karosserieteile<br />
Fremdherstellung<br />
stark umweltrelevante Bereiche<br />
umweltrelevante Bereiche<br />
wenig umweltrelevante Bereiche<br />
Vormontage<br />
Montage<br />
umweltrelevante Bereiche (nicht im Verantwortungsbereich von <strong>Volkswagen</strong>)<br />
Presswerk<br />
Karosseriebau<br />
Lackiererei<br />
Hohlraumkonservierung<br />
Nachbehandlung<br />
Prüfstände
Produktion und Erzeugnisse<br />
Komponentenfertigung<br />
Die Produktion von Komponenten ist neben der<br />
Fahrzeugherstellung ein Fertigungsschwerpunkt der<br />
Standorte. So werden zahlreiche Aggregate und Baugruppen,<br />
beispielsweise Getriebe, Motoren, Achsen,<br />
Abgasanlagen und Kunststoffteile, konzernintern<br />
hergestellt. Drei Beispiele:<br />
Getriebe<br />
Je nach Typ bestehen Getriebe aus 400 bis 800 Einzelteilen:<br />
Gehäuse, Zahnräder, Wellen, Wälzlager,<br />
Flansche, Synchronisationseinrichtungen, Schaltelemente<br />
und Kleinteile. Die Gießerei fertigt Leichtmetall-Getriebegehäuse.<br />
Hierbei wird in hohem Maß<br />
Recyclingmaterial genutzt. Zahnradrohlinge bekommen<br />
ihre Grundform in der Schmiede, wobei immer<br />
mehr versucht wird, schon hier eine möglichst endkonturnahe<br />
Form zu erreichen. Die nachfolgende<br />
Bearbeitung kann dann erheblich reduziert werden.<br />
Den nächsten Arbeitsgang – die spanabhebende<br />
Bearbeitung – leistet der Bereich Mechanik. Hierbei<br />
eingesetzte Kühlschmierstoffe werden ständig regeneriert<br />
und so lange wie möglich wiederverwendet.<br />
Das erklärte und systematisch verfolgte Umweltziel<br />
ist hier der weitestgehende Einsatz von Trockenbearbeitung<br />
und Minimalmengenschmierung, was<br />
technisch bei vielen, aber nicht allen Bearbeitungsschritten<br />
möglich ist. Die Folge ist die zunehmende<br />
Eliminierung großer Mengen an Kühlschmierstoffen,<br />
die mit Energieaufwand gefördert und gereinigt<br />
werden müssen.<br />
Anfallende Metallabfälle gelangen nach sortenreinem<br />
Trennen erneut in den Produktionskreislauf.<br />
In der Härterei erhalten Zahnräder und Wellen ihre<br />
Verschleißfestigkeit, wobei je nach Einsatzbereich<br />
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz kommen,<br />
wie beispielsweise Einsatzhärten, Salzbadhärten,<br />
Induktionshärten und Carbonitrieren.<br />
Motoren<br />
In der mechanischen Fertigung entstehen aus angelieferten<br />
Gussteilen und Rohlingen Motorblöcke,<br />
Zylinderköpfe und Kurbelwellen. Für die spangebenden<br />
Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, Bohren,<br />
Standortübergreifender Teil 15<br />
Drehen, Schleifen und Honen gilt das Gleiche wie<br />
für den Bereich Getriebebau: Es gelingt in immer<br />
mehr Abschnitten der mechanischen Fertigung,<br />
durch Verwendung optimierter <strong>Werk</strong>zeuge auf Verfahren<br />
umzustellen, die den Einsatz von minimalen<br />
Schmiermengen erlauben.<br />
Komponenten, die im Motor besonders großen<br />
Kräften ausgesetzt sind, erhalten durch eine<br />
chemisch-physikalische Behandlung oder mittels<br />
Plasmaverfahren eine höhere Verschleißfestigkeit.<br />
In weiteren Produktionsbereichen werden Pleuel,<br />
Nockenwellen, Ventile, Tassenstößel, Lager und eine<br />
Vielzahl weiterer Motorkomponenten gefertigt. Der<br />
Zusammenbau der Aggregate erfolgt anschließend<br />
auf Montagelinien. In Einstellständen werden die<br />
Motoren auf ihre Funktion geprüft. Die Serienüberwachung<br />
erfolgt auf Motorprüfständen. Dort finden<br />
neben einem Leistungstest auch die Messung des<br />
Verbrauchs und die Kontrolle der Emissionswerte<br />
statt. Durch den zunehmenden Einsatz von Kalttests<br />
können hierbei Kraftstoff und Schadstoff- sowie<br />
CO -Emissionen eingespart werden.<br />
2<br />
Vor dem Abtransport in die fahrzeugbauenden<br />
<strong>Werk</strong>e wird ein Teil der Aggregate mit einer Schutzschicht<br />
aus Wachs versehen, wobei keine organischen<br />
Lösemittel mehr eingesetzt werden.<br />
Kunststoff teile<br />
Die Kunststofftechnik stellt beispielsweise Kraftstofftanks,<br />
Stoßstangen, Gehäuse, Verkleidungen und<br />
Instrumententafeln her. Hier wird mit modernsten<br />
Methoden wie Mehrkomponenten-Spritzgießen,<br />
Gas-Innendruckverfahren und Hinterspritztechnik<br />
produziert. Zum Einsatz gelangt in unterschiedlicher<br />
Intensität Recyclinggranulat. Es stammt aus<br />
eigenen Produktionsabfällen.<br />
Unter dem Arbeitstitel „Green Door Concept“ wurde<br />
eine auf pflanzlichen Rohstoffen basierende Türverkleidung<br />
entwickelt und realisiert. Damit gelang<br />
nicht nur ein Beitrag zur notwendigen Gewichtsreduzierung;<br />
außerdem wird mit diesem neuen Verfahren<br />
ein Beitrag zur Verringerung der Abhängigkeit<br />
von petrochemischen Rohstoffen erreicht.
16<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Betriebliches Umweltmanagement<br />
Die Integration des Umweltschutzgedankens in alle<br />
betrieblichen Prozesse besitzt bei <strong>Volkswagen</strong> eine<br />
lange Tradition und ist fester Bestandteil der Aufbau-<br />
und Ablauforganisation. Einen weiteren Schritt<br />
in Richtung Systematisierung ist <strong>Volkswagen</strong> mit<br />
der Einführung von Umweltmanagement-Systemen<br />
gegangen. Seit 1995 wurden und werden sukzessive<br />
alle Standorte mit einem individuellen Umweltmanagement-System<br />
ausgestattet.<br />
Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang<br />
die kontinuierliche Verbesserung der<br />
Umweltleistung sowie die Einbeziehung der Mitarbeiter.<br />
<strong>Volkswagen</strong><br />
Vorstand für Forschung und<br />
Entwicklung (§ 52a BlmSchG)<br />
Leiter Forschung<br />
Technische<br />
Entwicklung<br />
Standorte<br />
(Aufbau- und Ablauforganisation im <strong>Volkswagen</strong> Umweltmanagement)<br />
Produkt-Paten<br />
Umweltbeauftragter Produkt<br />
Leiter Konzern Umwelt<br />
Umweltmanagementbeauftragter<br />
Umweltbeauftragte<br />
Aufbau und Ablauforganisation<br />
Der Vorstand „Forschung und Entwicklung“ trägt<br />
aufgrund seiner Benennung nach § 52a BImSchG<br />
die Gesamtverantwortung für den Umweltschutz bei<br />
<strong>Volkswagen</strong>. Diese Zuständigkeit wurde über den<br />
Leiter Forschung auf den Leiter Konzern Umwelt<br />
übertragen. In Personalunion ist er gleichzeitig der<br />
Umweltbeauftragte für die Produkte und der Umweltmanagementbeauftragte.<br />
In dieser Doppelfunktion<br />
stecken Synergien, die sich durch das gesamte<br />
UMS bei <strong>Volkswagen</strong> fortsetzen. Als Umweltmanagementbeauftragter<br />
der Marke koordiniert er auch die<br />
Arbeit der Umweltbeauftragten der Standorte.<br />
Umweltgrundsätze Produkt<br />
Umweltpolitik<br />
Umweltmanagement-<br />
Handbuch<br />
Umweltgrundsätze Produktion<br />
Umwelt Audit
Betriebliches Umweltmanagement<br />
Ausgangspunkt für die Arbeit des Leiters Umwelt<br />
und seiner Mitarbeiter im Bereich des Umweltmanagement-Systems<br />
ist die <strong>Volkswagen</strong> Umweltpolitik.<br />
Durch sie wird das grundlegende Verständnis<br />
des Unternehmens festgelegt und der Rahmen für<br />
die Aktivitäten der einzelnen Beteiligten gesteckt.<br />
Eine weitere fundamentale Arbeitshilfe beschreibt<br />
das Umweltmanagementhandbuch, in dem alle<br />
wesentlichen umweltrelevanten Fragestellungen<br />
behandelt werden.<br />
Umweltpaten<br />
Die Mitarbeiter der Organisationseinheit „Umwelt“<br />
sind dabei über ein sogenanntes Patenkonzept den<br />
einzelnen Produktgruppen zugeordnet. Dafür wurden<br />
auf Basis der Umweltpolitik und des Umweltmanagementhandbuchs<br />
sowie weiterer Normen und Gesetze<br />
die Umweltgrundsätze für die Produkte geschaffen.<br />
Diese Grundsätze regeln alle aus Umweltsicht relevanten<br />
Anforderungen an die Produkte. Auf diese Weise<br />
werden die benannten Anforderungen bereits in<br />
einer sehr frühen Phase in den Produktentstehungsprozess<br />
integriert. Die drei wesentlichen Bestandteile<br />
der Umweltgrundsätze Produkt sind die folgenden<br />
Felder:<br />
- Klimaschutz<br />
- Ressourcenschonung<br />
- Gesundheitsschutz<br />
<strong>Werk</strong>leiter/Umweltbeauftragte/Sachkundige für<br />
Umweltschutz<br />
Auch für die Produktion und die operative Arbeit<br />
an den Standorten werden unter Einbeziehung von<br />
Rechtsnormen und internen Vorgaben Grundsätze<br />
festgelegt. Diese werden über die <strong>Werk</strong>leiter und<br />
Umweltbeauftragten der Standorte konkretisiert und<br />
verfolgt. Sachkundige in den einzelnen Organisationseinheiten<br />
unterstützen dieses System.<br />
Standortübergreifender Teil 17<br />
Neben der zentralen Doppelfunktion werden die<br />
Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich Umweltschutz<br />
und Umweltmanagement an die <strong>Werk</strong>leiter<br />
und Umweltbeauftragten an den Standorten<br />
delegiert. Die zentrale Koordination erfolgt dann<br />
wieder über den Umweltmanagementbeauftragten<br />
der Marke <strong>Volkswagen</strong>.<br />
Zertifi zierung/Validierung<br />
Die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung<br />
sowie die Umweltschutzmaßnahmen an den<br />
Produkten und in der Produktion werden regelmäßig<br />
durch interne und externe Auditoren überprüft.<br />
Grundsätzlich haben alle in dieser <strong>Umwelterklärung</strong><br />
vertretenen Standorte eine EMAS-Validierung sowie<br />
eine Zertifi zierung nach DIN EN ISO 14001. Da produktrelevante<br />
Themen in der genannten EMAS-Verordnung<br />
und ISO-Norm nur angeschnitten werden,<br />
verfügt die Technische Entwicklung noch über eine<br />
Zertifi zierung nach DIN EN ISO 14062 „Integration<br />
von Umweltaspekten in Produktdesign und -entwicklung“.<br />
Auf diese Weise wird es möglich, die Umweltbelange<br />
noch detaillierter in die einzelnen Schritte des<br />
Produktentstehungsprozesses zu integrieren.<br />
Eine weitere Besonderheit bei <strong>Volkswagen</strong> stellt die<br />
Integration des Energiemanagements in das Umweltmanagement-System<br />
dar. Da der Bereich Energieund<br />
Ressourceneinsparung schon immer ein Bestandteil<br />
des Umweltmanagement-Systems war, wurde 2010<br />
begonnen, diesen Teilbereich systematisch anhand<br />
der DIN 16001 auszubauen. Im ersten Pilotprojekt am<br />
Standort Braunschweig wurde 2009 der Grundstein<br />
dafür gelegt. Mittlerweile werden sukzessive alle<br />
weiteren Standorte nach dieser Norm im Rahmen der<br />
Umweltaudits zertifi ziert.
18<br />
Standortübergreifender Teil
Methoden und Instrumente im Umweltmanagement<br />
Für ein funktionierendes Umweltmanagement-System<br />
ist eine Vielzahl von Beteiligten, Methoden und<br />
Abläufen notwendig. Die wesentlichen Instrumente,<br />
die nun vorgestellt werden, werden zentral durch<br />
die „Konzern Umwelt“ erarbeitet sowie kontinuierlich<br />
weiterentwickelt und können daher von allen<br />
Standorten genutzt werden.<br />
Umweltkennzahlen<br />
Der Ausgangspunkt für alle Verbesserungsmaßnahmen<br />
im Umweltschutz ist das Messen und<br />
Auswerten von Prozessdaten; dies schließt Produktströme<br />
genauso ein, wie z. B. Emissionen, Energieverbräuche<br />
und Abfälle. Bei <strong>Volkswagen</strong> werden<br />
derzeit ca. 90 Umweltkennzahlen anhand einer<br />
internen Norm weltweit erfasst, durch die Zentralabteilung<br />
dokumentiert und ausgewertet. Besonders<br />
wichtig sind in diesem Zusammenhang die<br />
Vorgaben der Datenerhebung und Dokumentation,<br />
sodass alle Kennzahlen über die gleiche Bedeutung<br />
und Aussagekraft verfügen. Alle erhobenen Daten<br />
werden zentral vorgehalten und stehen anderen<br />
Anwendern für Auswertungen zur Verfügung.<br />
Standortübergreifender Teil 19<br />
Kernindikatoren<br />
<strong>Volkswagen</strong> veröffentlicht beginnend mit dem Berichtsjahr<br />
2009 die von der neuen EMAS-Verordnung<br />
geforderten Kernindikatoren auf den Gebieten Energieeffi<br />
zienz, Materialeffi zienz, Wasser, Abfall, biologische<br />
Vielfalt und Emissionen in die Luft.<br />
Im Rahmen der großen Produkt- und Produktionsvielfalt<br />
der einzelnen Standorte wurde ein Verfahren<br />
entwickelt, welches es erlaubt, die gesuchten Kernindikatoren<br />
durch eine gemeinsame Methode zu<br />
erfassen und darzustellen. Die erhobenen und kommunizierten<br />
Daten der hier im Verbund berichtenden<br />
Standorte sind allerdings aufgrund der unterschiedlichen<br />
Produkte, Produktionstiefe und Produktionsvielfalt<br />
nicht vergleichbar, auch wenn die einheitliche<br />
Darstellung des Kernindikators R dies suggeriert.<br />
Nichtsdestotrotz werden die Daten an den Standorten<br />
anhand eines einheitlichen Leitfadens und der<br />
<strong>Volkswagen</strong> Umweltdatennorm erfasst, dokumentiert<br />
und zentral durch die „Konzern Umwelt“ ausgewertet.<br />
Im Folgenden wird erläutert, wie die EMAS-Anforderungen<br />
an die Kernindikatoren im Rahmen der<br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>Umwelterklärung</strong> umgesetzt werden.<br />
Unterschieden wird dabei in die Kernindikatoren „A –<br />
jährlicher Input“ und „B – jährlicher Output“.<br />
Kernindikator A<br />
i. Kernindikator Energieeffi zienz<br />
Im Bereich der Energieeffi zienz wird der gesamte<br />
direkte Energieverbrauch in MWh berichtet. Der<br />
direkte Energieverbrauch am jeweiligen Standort setzt<br />
sich aus der verbrauchten elektrischen Energie, aus<br />
der Wärmeenergie sowie aus dem Brennstoffeinsatz<br />
für Fertigungsprozesse zusammen. Angaben über den<br />
Anteil erneuerbarer Energien werden dabei von der<br />
<strong>Volkswagen</strong> Kraftwerk GmbH als Energielieferant zur<br />
Verfügung gestellt.
20<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Methoden und Instrumente im Umweltmanagement<br />
ii. Kernindikator Materialeffi zienz<br />
Ein Fahrzeug von <strong>Volkswagen</strong> besteht aus mehreren<br />
Tausend Einzelteilen, die im Konzernverbund<br />
gefertigt oder von Lieferanten zugekauft werden. Die<br />
Ermittlung und die Darstellung der Massenströme<br />
in die einzelnen Standorte sind deshalb mit sehr<br />
großem Aufwand und gewissen Ungenauigkeiten verbunden.<br />
Abgeleitet aus der sich stetig verändernden<br />
Modellpalette und der variierenden Fertigungstiefe<br />
kann sich das Produktportfolio innerhalb des Berichtszeitraums<br />
stark verändern. Aus diesem Grund<br />
ist eine verständliche und eindeutige Darstellung von<br />
einzelnen „Massenströmen der Einsatzmaterialien“,<br />
gerade auch mit Blick auf einen Jahresvergleich, nicht<br />
möglich.<br />
Die <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> verfolgt an dieser Stelle eine globale<br />
Berichtsstrategie und berechnet den Material-<br />
Input aus der Summe des Produkt-Output [t] und<br />
der Abfallmenge [t]. Hier vereinen sich in diesem relativ<br />
leicht nachvollziehbaren Ansatz zwei Vorteile:<br />
- Zum einen ist es so möglich, auf die komplexe und<br />
aufwendige Erhebung der Einsatzmaterialmengen<br />
zu verzichten.<br />
- Zum anderen werden über das „Kriterium“ Abfall<br />
mit den Produktionsabfällen auch Verbrauchsmaterialien<br />
und verbrauchte Prozessmittel aus der<br />
Produktion erfasst.<br />
iii. Kernindikator Wasser<br />
Im Bereich des Wassers wird der Frischwasserverbrauch<br />
in m³/a berichtet. Der Indikator Frischwasser<br />
setzt sich dabei aus Frischwasser (Fremdanlieferung),<br />
Brunnenwasser (selbst gefördert) und<br />
Regenwasser (Niederschlagswasser, das selbst<br />
gesammelt und für Produktionszwecke verwendet<br />
wird) zusammen.<br />
iv. Kernindikator Abfall<br />
Hier wird die Summe der Gewerbe- und Metallabfälle<br />
sowie der gefährlichen Abfälle in [t] angegeben.<br />
Die zehn mengenmäßig wichtigsten gefährlichen<br />
Abfälle werden detailliert dargestellt.<br />
v. Kernindikator Biologische Vielfalt<br />
Die Biologische Vielfalt wird in der <strong>Volkswagen</strong> <strong>Umwelterklärung</strong><br />
abweichend von den Anforderungen<br />
der Verordnung über eine Angabe zur versiegelten<br />
Fläche (in m²) dargestellt. Die versiegelte Fläche<br />
beinhaltet bebaute und betonierte/gepflasterte<br />
Flächen. Aus heutiger Sicht hat die so ermittelte<br />
Kennzahl eine größere Aussagekraft als die von<br />
EMAS geforderte bebaute Fläche.<br />
vi. Kernindikator Emissionen<br />
Im Bereich der Emissionen sind die Gesamtemissionen<br />
von Treibhausgasen in t CO -Äquivalent an-<br />
2<br />
zugeben. Für die Standorte der <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> sind<br />
dabei die folgenden Treibhausgase von besonderer<br />
Relevanz:<br />
- CO -Äquivalente aus Brennstoffeinsatz (z. B.<br />
2<br />
thermische Nachverbrennung und Heizhäuser) – H-<br />
FKW sowie H-FCKW (z. B. Leckagen an stationären<br />
Kälteanlagen). Vollfluorierte FKW, Methan sowie<br />
Lachgas spielen dagegen bei <strong>Volkswagen</strong> keine Rolle.<br />
Weiterhin sind Gesamtemissionen in die Luft (in t)<br />
für folgende Komponenten anzugeben:<br />
- Stickoxide, Staub und Schwefeldioxid (wird bei<br />
<strong>Volkswagen</strong> nicht emittiert)<br />
Darüber hinaus werden noch Emissionen wie Kohlenmonoxid<br />
und der Ausstoß leichtflüchtiger organischer<br />
Verbindungen (VOC) freiwillig berichtet.
Methoden und Instrumente im Umweltmanagement<br />
Kernindikator B<br />
i. Kernindikator Produktoutput<br />
Wie bereits erwähnt, besteht ein Fahrzeug der<br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> aus mehreren Tausend Einzelteilen.<br />
Für die Datenerfassung in diesem Bereich<br />
werden die Input- und Outputströme mehrerer<br />
Datenbanken ausgewertet und dokumentiert. Das<br />
Ergebnis dieser Auswertung wird in die klassischen<br />
Produktionsbereiche „Fahrzeuge“ und „Fahrzeugkomponenten“<br />
unterteilt. Die Dokumentation für<br />
den Kernindikator „Produktoutput B“ erfolgt als<br />
Tonne Produkt/Jahr.<br />
Standortübergreifender Teil 21<br />
Kernindikator R<br />
Die Indikatoren A werden mit dem Indikator B ins<br />
Verhältnis gesetzt und führen so zu den Kernindikatoren<br />
R=A/B der EMAS-Verordnung, über die in<br />
den Folgejahren als standortspezifische Zahlenreihe<br />
berichtet wird.
22<br />
Standortübergreifender Teil<br />
System zur Erfassung und Bewertung von Umweltaspekten<br />
(SEBU)<br />
Zur Bewertung der Umweltauswirkungen an Standorten<br />
der <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> wird die „Methode der<br />
Ökologischen Knappheit“ verwendet. Dieses auch<br />
als „BUWAL“ oder „Umweltbelastungspunkteverfahren“<br />
bezeichnete Vorgehen arbeitet stoffflussorientiert.<br />
Das Verfahren erlaubt den Vergleich eines aktuellen<br />
Stoffflusses (IST-Menge) in die Umwelt mit<br />
einem gesellschaftspolitisch als tolerierbar angesehenen<br />
Maximalwert. Der Vergleich zwischen IST-<br />
Menge und Toleranzwert wird dann als ökologische<br />
Knappheit bezeichnet. Die Bewertung der Umweltauswirkungen<br />
erfolgt unter Einbeziehung von<br />
Ökofaktoren, die sich wiederum aus der „Methode<br />
der ökologischen Knappheit“ [Ökofaktoren 2006]<br />
ableiten. Das Verfahren erlaubt so eine objektive<br />
Wirkungsabschätzung für die Umweltaspekte. Im<br />
Ergebnis bedeutet es eine Bewertung der Umweltauswirkungen<br />
in Form von Umweltbelastungspunkten.<br />
Dieses Vorgehen ermöglicht einen Vergleich der<br />
verschiedenen Aspekte und Wirkkategorien.<br />
Die Umweltauswirkungen einer Automobilproduktion<br />
charakterisieren sich im Wesentlichen durch<br />
den Verbrauch von Ressourcen, Energie sowie die<br />
Erzeugung von Emissionen und Abfall. Um hier im<br />
Sinne der Verordnung eine Bewertung vornehmen<br />
zu können, wurde bei <strong>Volkswagen</strong> das „System zur<br />
Erfassung und Bewertung der Umweltaspekte“<br />
aufgebaut.<br />
Durch diesen systematischen Ansatz werden im<br />
ersten Schritt die wesentlichen Stoffströme eines<br />
Standortes erhoben. Dies erfolgt jeweils für die einzelnen<br />
Bereiche des Standortes, mindestens jedoch<br />
für die klassischen Umfänge (Presswerk, Lackiererei,<br />
Karosseriebau, Montage) des Automobilbaus oder<br />
der Komponentenfertigung (mechanische Fertigung<br />
etc.).<br />
Die Datenerfassung und Tiefe wird dabei von der<br />
internen Norm zur „Erhebung von Umweltdaten“<br />
unterstützt.<br />
Klassischerweise werden die für die Automobilproduktion<br />
identifizierten qualitativen und quantitativen<br />
Umweltaspekte wie z. B. Emissionen, Energieeinsatz,<br />
Abfall, Geruch und Lärm direkt am Standort<br />
erfasst und im weitergehenden Verfahren aufgrund<br />
ihrer Umweltrelevanz bewertet.<br />
Eine Beispielrechnung für die Bewertung von einem<br />
Teilstrom der CO -Emissionen in einer Lackiererei<br />
2<br />
könnte folgendermaßen aussehen:<br />
Eingangswerte: Emissionen 30.000 t CO /a aus der<br />
2<br />
Verbrennung von Erdgas in der Abgasreinigung<br />
Ökofaktor [2006] für CO 0,31 Umweltbelastungs-<br />
2<br />
punkte pro g CO2 Ergebnis: 9.300 *106 Umweltbelastungspunkte [UBP]<br />
Für den Bereich der Lackiererei errechnen sich somit<br />
aufgrund seiner Emissionen im zurückliegenden<br />
Jahr 9.300 [*106 UBP]. Dieser Schritt wird für alle<br />
Organisationseinheiten sowie die betrachteten<br />
Umweltaspekte wiederholt. Im Ergebnis werden alle<br />
Aspekte summiert und zu einer einheitlichen standortweiten<br />
Darstellung zusammengefasst.
Standortübergreifender Teil 23<br />
System zur Erfassung und Bewertung von Umweltaspekten<br />
(SEBU)<br />
Umweltauswirkungen eines fi ktiven Standortes<br />
Durch die für einen fi ktiven Standort beispielhaft<br />
dargestellte Grafi k wird die Verteilung der Umweltauswirkungen<br />
deutlich.<br />
Für weitere Faktoren der Umweltauswirkungen wie<br />
z. B. Lärm, Erschütterung, Notfallsituation, Organisation<br />
und Qualifi kation wird ein subjektives Bewertungsverfahren<br />
durchgeführt. Die Bewertung durch<br />
den Umweltschutz an den Standorten berücksichtigt<br />
dabei normative Anforderungen (z. B. GIRL – GeruchsImmissionsRichtLinie),<br />
aber auch Anwohnerbeschwerden<br />
oder Aufl agen der jeweiligen Verwaltungsbehörden.<br />
Mithilfe der grafi schen Darstellung und der berechneten<br />
Umweltbelastungspunkte werden in<br />
den einzelnen Bereichen Umweltziele entwickelt.<br />
Ausschlaggebend sind in diesem Fall die Menge der<br />
Umweltbelastungspunkte sowie die Art und Weise der<br />
Möglichkeit zur Einfl ussnahme durch die jeweilige<br />
Organisationseinheit.<br />
Verteilung der Umweltaspekte eines fi ktiven Standortes<br />
40,0 %<br />
3,0 %<br />
33,0 %<br />
22,0 %<br />
2,0 %<br />
Umweltziele/Umweltprogramm<br />
Umweltziele sind in dem avisierten kontinuierlichen<br />
Entwicklungsprozess eine wichtige Methode, um<br />
die Umweltleistung langfristig zu verbessern. Im<br />
Rahmen des Umweltmanagement-Systems werden<br />
Umweltziele z. B. auf Basis der Umweltpolitik, von<br />
Konzernzielen (siehe Nachhaltigkeitsbericht), gesetzlichen<br />
Umweltanforderungen, Umweltaspekten<br />
und bedeutenden Umweltauswirkungen entwickelt.<br />
Diese Entwicklung wird in allen Organisationseinheiten<br />
forciert und durch die internen/externen Audits<br />
kontrolliert. In diesem Zusammenhang dienen<br />
die Audits nicht nur als Kontrollinstrument, sondern<br />
auch als Initiatoren von neuen Entwicklungen und<br />
zum Austausch neuer Ideen.<br />
Die bedeutendsten Umweltziele eines Standortes<br />
werden im Umweltprogramm zusammenfassend<br />
dargestellt. Hier werden auch die Abarbeitungsstände<br />
sowie die erzielten Ergebnisse berichtet (siehe<br />
<strong>Umwelterklärung</strong> Standorte).<br />
Verkehr<br />
Abfall<br />
- Abwasser (0 %)<br />
Emissionen<br />
Wärme<br />
Strom
24<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Umweltbilanzen<br />
Autos nehmen Einfluss auf die Umwelt – egal, ob sie<br />
fahren oder nicht. Welchen Einfluss ein Automobil<br />
auf die Umwelt besitzt, wurde lange Zeit nur am<br />
Auspuffrohr gemessen. Doch das reicht schon längst<br />
nicht mehr aus. Heute müssen wir das gesamte<br />
Autoleben im Blick haben. Denn nur wer über den<br />
gesamten Lebenszyklus erkennt, wo Verbesserungen<br />
den größten Effekt haben, kann gezielt Innovationen<br />
entwickeln. Dabei helfen uns Umweltbilanzen, die<br />
wir gemäß den Anforderungen der ISO-Normen<br />
14040 und 14044 erstellen.<br />
Mit diesen Umweltbilanzen, auch Lebenszyklusanalysen<br />
(engl. Life Cycle Assessment – LCA) genannt,<br />
analysieren wir die Entstehung von neuen Fahrzeugen<br />
und Antriebssystemen, Komponenten und<br />
<strong>Werk</strong>stoffen – von der ersten Designskizze über die<br />
Produktion und Nutzung bis zum Recycling. Auf<br />
dieser Grundlage können wir eine ganzheitliche Bewertung<br />
und einen Vergleich der Umweltwirkungen<br />
verschiedener Fahrzeuge und Technologien vornehmen.<br />
Damit ein Teil dieser Arbeit auch für unsere Kunden,<br />
Aktionäre und weitere Interessenten innerhalb und<br />
außerhalb des Unternehmens sichtbar wird, erteilen<br />
wir für ausgewählte Modelle und Technologien<br />
sogenannte Umweltprädikate. Die Angaben im Umweltprädikat<br />
basieren auf Umweltbilanzen, die vom<br />
TÜV NORD geprüft und zertifiziert werden. Mit dem<br />
Zertifikat wird bestätigt, dass die Umweltbilanzen<br />
auf zuverlässigen Daten beruhen und die Methode,<br />
mit der sie erstellt wurden, den Anforderungen der<br />
ISO-Normen 14040 und 14044 entspricht.<br />
Umweltbilanzen sind heute nicht nur ein bewährtes,<br />
sondern auch ein wichtiges Umweltmanagementwerkzeug,<br />
mit dem sich die Ziele der <strong>Volkswagen</strong><br />
Umweltpolitik sicher erreichen lassen.<br />
(Weitere Informationen: www.umweltpraedikat.de)
Einhaltung von Vorschriften im Umweltrecht<br />
Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ist für den<br />
<strong>Volkswagen</strong> Konzern und jeden seiner Mitarbeiter<br />
selbstverständlich.<br />
Allerdings ist die Menge an Rechtssetzungen gerade<br />
im Umweltschutz nur noch schwer überschaubar, zu<br />
beachten sind europaweite Regelungen, Vorschriften<br />
des Bundes und der einzelnen Länder sowie kommunale<br />
Sonderregelungen.<br />
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,<br />
wurden im Umweltmanagement-System spezielle<br />
Strukturen geschaffen. In der zentralen Abteilung<br />
„Konzern Umwelt“ verfolgen Fachleute alle gesetzlichen<br />
Entwicklungen und werten diese aus. Falls<br />
notwendig, werden über die beteiligten Industrieverbände<br />
in Berlin bzw. in Brüssel Stellungnahmen<br />
abgegeben. Informationen werden allen Beteiligten<br />
im Unternehmen zur Verfügung gestellt.<br />
Die Umweltbeauftragten der einzelnen Standorte<br />
werden bei regelmäßigen Treffen über alle wichtigen<br />
neuen Regelungen informiert, sie diskutieren<br />
und beschließen die notwendigen einzuleitenden<br />
Maßnahmen.<br />
Eine kommerzielle Datenbank ist im unternehmenseigenen<br />
Intranet jedem mit Umweltschutz befassten<br />
Mitarbeiter zugänglich. Damit ist jederzeit der Zugriff<br />
auf das geltende Recht möglich.<br />
Standortübergreifender Teil 25<br />
Das Thema Legal Compliance (Einhaltung der<br />
Rechtsvorschriften) ist ein wichtiges und regelmäßiges<br />
Thema bei allen internen und externen<br />
Umweltaudits bei <strong>Volkswagen</strong>. In einem hierin integrierten<br />
Dokumentenaudit werden bspw. Genehmigungen<br />
gesichtet und die Einhaltung von Auflagen<br />
und Nebenbestimmungen vor Ort überprüft.<br />
Notfallvorsorge<br />
Um die durch möglichen Betriebsstörungen hervorgerufenen<br />
Umweltrisiken (Brandfall, Umgang mit<br />
chemischen Produkten und Fertigung) so gering wie<br />
möglich zu halten, wurden in den <strong>Werk</strong>en entsprechende<br />
technische und organisatorische Maßnahmen<br />
festgelegt. Die Notfallpläne werden laufend<br />
aktualisiert und zur Berücksichtigung werkübergreifender<br />
Auswirkungen auch mit den zuständigen lokalen<br />
Behörden abgestimmt; die Mitarbeiter werden<br />
in Unterweisungen geschult.<br />
An allen Standorten ist eine gut trainierte und mit<br />
entsprechenden Einsatzfahrzeugen gut ausgerüstete<br />
<strong>Werk</strong>feuerwehr in Bereitschaft, die in jedem Fall<br />
auch mit der örtlich zuständigen kommunalen<br />
Feuerwehr in Kontakt steht.<br />
Das Funktionieren der in den Alarm- und Gefahrenabwehrplänen<br />
beschriebenen Festlegungen und Abläufe<br />
wird regelmäßig – sowohl auf Stabs- als auch<br />
auf Arbeitsebene – geübt.
26<br />
Standortübergreifender Teil
Einbindung der Mitarbeiter/Verbesserungsideen<br />
Über die turnusmäßig stattfindenden Unterweisungen,<br />
Schulungen und Informationen zum Umweltschutz<br />
hinaus sind die <strong>Volkswagen</strong> Mitarbeiter<br />
über das Ideenmanagement ständig aufgefordert, an<br />
der Gestaltung von Arbeitsplätzen, der Effizienzsteigerung<br />
von Arbeitsabläufen und der Verbesserung<br />
des Betrieblichen Umweltschutzes mitzuwirken.<br />
Zusätzlich wird jährlich europaweit ein interner<br />
Umweltpreis ausgelobt.<br />
Die Auszeichnungen werden in den drei Kategorien<br />
Produkt,<br />
Produktion und<br />
persönliches Engagement (Sonderpreis für Eigeninitiative)<br />
vergeben.<br />
Standortübergreifender Teil 27
28<br />
Standortübergreifender Teil<br />
Umweltaudits<br />
Im Rahmen der betrieblichen Ablauforganisation<br />
erfüllen die von der Abteilung Umwelt durchgeführten<br />
Umweltbetriebsprüfungen (Auditgespräche,<br />
Betriebsbegehung) eine Kontroll- und Rückkopplungsfunktion.<br />
Zum einen werden auf diese Weise die Informationen,<br />
Methoden und Abläufe durch die speziell<br />
geschulten Auditoren in die einzelnen Bereiche getragen<br />
und zum anderen kann so eine Überprüfung<br />
der zentralen Aufbau- und Ablauforganisation sowie<br />
der Einhaltung von Rechtsvorschriften und internen<br />
Vorgaben erfolgen.<br />
Umweltleistung<br />
Mithilfe der ausgewählt dargestellten Instrumente<br />
des Umweltmanagement-Systems ist es möglich, die<br />
Umweltleistung bei <strong>Volkswagen</strong> kontinuierlich zu<br />
verbessern.<br />
Letztendlich sind die eingesetzten Methoden nur<br />
in Verbindung mit den Beteiligten und den Produktionsprozessen<br />
wirksam. Technische Änderungen<br />
sowie nachhaltige Umweltziele sind hier die<br />
Wegweiser für die stetige Verbesserung des in die<br />
Produktion integrierten Umweltschutzes, der auch<br />
die Belange der natürlichen Standortumgebung mit<br />
Fauna und Flora nicht vergisst.<br />
Die Audits werden jährlich an den einzelnen Standorten<br />
in ausgewählten Organisationseinheiten<br />
durchgeführt. Das Ziel dabei ist, dass im Verlauf von<br />
drei Jahren alle Organisationseinheiten mindestens<br />
einmal beteiligt waren.<br />
Im Rahmen eines Auditgesprächs und einer Begehung<br />
werden sowohl die rechtlichen Anforderungen<br />
als auch die internen Normen und die Aufbau- und<br />
Ablauforganisation überprüft. Am Ende werden alle<br />
Erkenntnisse in einem Auditbericht dokumentiert,<br />
der einem externen Gutachter als Basis für seine<br />
eigenen Umweltaudits dient.<br />
Dass die Verbindung zwischen Managementsystem,<br />
Mensch und Technik funktioniert, zeigen die<br />
folgenden jährlich aktualisierten Beispiele für eine<br />
verbesserte Umweltleistung.
Umweltschonende Fertigungsverfahren<br />
<strong>2011</strong> Materialnutzungsgrad im Presswerk<br />
Um die Umweltleistung von <strong>Volkswagen</strong> plakativ und<br />
interessant darzustellen, möchten wir in jeder erscheinenden<br />
<strong>Umwelterklärung</strong> eine neues, besonders<br />
umweltschonendes Fertigungsverfahren darstellen.<br />
Für das abgelaufene Berichtsjahr möchten wir Ihnen<br />
eine aktuelle Entwicklung aus dem Bereich des Presswerkes<br />
vorstellen.<br />
Die Lebensgeschichte eines jeden Automobils beginnt<br />
im Presswerk. Hier werden aus Flachstahlbändern<br />
in mehreren Arbeitsschritten Karosserieteile geformt<br />
(siehe S. 11).<br />
Durch die spezifi sche Form eines jeden Pressteils ist<br />
es bisher schwierig, das eingesetzte Flachstahlband<br />
vollständig auszunutzen. Das bedeutet, dass eine<br />
nicht zu vernachlässigende Menge Stahl wieder in den<br />
Recyclingkreislauf zurückgeführt werden muss.<br />
Umweltvorteile der vorgestellten Fertigungstechnologie<br />
Zukünftig sollen die entstehenden Verschnittmengen<br />
bei der Teileausformung auf ein Minimum reduziert<br />
werden. Diese Bemühungen betreffen dabei<br />
alle Prozesse der vorgelagerten Produktentwicklung<br />
als auch der Produktionsschritte.<br />
Um das Umweltziel der Technischen Entwicklung<br />
zu erreichen, wurden bereits seit 2006 verschiedene<br />
Maßnahmen wie z. B.<br />
- die Optimierung der Zuschnitt- und Presswerkzeuge,<br />
- die Optimierung der Flachstahlbreite,<br />
- die Anpassung der Platinenschachtelung sowie<br />
- die Änderungen der Bauteilgeometrie<br />
umgesetzt. Der Materialnutzungsgrad wurde dadurch<br />
weiter erhöht. Der Materialnutzungsgrad<br />
beschreibt dabei das Verhältnis von dem Gewicht<br />
Standortübergreifender Teil 29<br />
des fertigen Zwischenprodukts (z. B. einer Seitentür)<br />
zu dem zu Beginn des Prozesses eingespeisten<br />
Einsatzgewichts der Rohplatine. Je höher also der<br />
Materialnutzungsgrad ist, desto weniger Stahl fällt<br />
im Prozess als Schrott an.<br />
In der Addition aller Optimierungsmethoden zeichnet<br />
sich bereits für das Jahr <strong>2011</strong> eine Einsparung<br />
von 73.000 t Stahlblech ab. Diese Menge entspricht<br />
ca. 14 % der Stahlmenge, die im Jahr 2009 im <strong>Werk</strong><br />
Wolfsburg zur Produktion eingesetzt wurde.<br />
Eindrucksvoll erscheint neben der eigentlichen<br />
Reduzierung des Stahls die Einsparungsrechnung in<br />
Form von CO -Emissionen. Für die Erzeugung von<br />
2<br />
1 kg Blech werden ca. 2,583 kg CO emittiert 2 1 , dies<br />
ergibt eine Gesamteinsparung von 188,559 t CO /a. 2<br />
Für den voraussichtlich ab 2012 produzierten Golf<br />
VII könnte der Materialnutzungsgrad von derzeit<br />
43 % auf ca. 58 % gesteigert werden. Eine solche<br />
Entwicklung wurde durch Optimierungsschritte im<br />
Bereich des Produkts (Entwicklung, Design) als auch<br />
der Produktionsschritte möglich gemacht und ist ein<br />
gutes Beispiel für die enge Verzahnung von Entwicklung<br />
und Produktion bei <strong>Volkswagen</strong>.<br />
Platinenschachtelung, schematisch<br />
1620<br />
Platine<br />
linkes Bauteil<br />
Anmerkung 1: Quelle IISI Daten für Europa. Die Werte beziehen sich auf eine „Cradel-to-gate“ Betrachtung.<br />
1395<br />
Platine<br />
rechtes Bauteil<br />
DLR
30<br />
Standortübergreifender Teil
Der Umweltschutz im<br />
Standortübergreifender Teil 31<br />
<strong>Volkswagen</strong> Konzern ist in den Strukturen,<br />
Prozessen und Instrumenten fest verankert.
Dresden
<strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
<strong>Salzgitter</strong>
<strong>Salzgitter</strong>
<strong>Salzgitter</strong><br />
Voller Antrieb. Volle Verantwortung.<br />
Motoren seit 1970.<br />
3
4<br />
<strong>Salzgitter</strong>
Vorstellung des Standortes<br />
Die im Jahr <strong>2011</strong> vorgelegten aktualisierten Zahlen<br />
und Aussagen des <strong>Salzgitter</strong>aner Teils der <strong>Umwelterklärung</strong>,<br />
die sich auf das Betrachtungsjahr 2010<br />
beziehen, wurden im Rahmen des Revalidierungs-<br />
<strong>Werk</strong>leiter<br />
Falko Rudolph<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
audits durch den Umweltgutachter der TÜV Nord<br />
Cert Umweltgutachter GmbH auf sachliche Richtigkeit<br />
überprüft.<br />
Umweltbeauftragter<br />
Dr. Hans-Otto Bode<br />
5
6<br />
<strong>Salzgitter</strong>
Vorstellung des Standortes<br />
Lage und historische Entwicklung des Standorts<br />
Der Standort liegt innerhalb der Grenzen der kreisfreien<br />
Stadt <strong>Salzgitter</strong>, die aus 31 Stadtteilen mit<br />
insgesamt ca. 103.000 Einwohnern besteht. Die Verkehrsanbindung<br />
zu der Autobahn A 39 ist über die<br />
Anschlussstelle <strong>Salzgitter</strong>-Thiede im Norden sowie<br />
<strong>Salzgitter</strong>-Lebenstedt im Westen gegeben. Ca. 1,5<br />
Kilometer in westlicher Richtung befindet sich der<br />
Stichkanal mit Norddeutschlands größtem Binnenhafen.<br />
In südlicher und südöstlicher Richtung sowie<br />
im Norden liegen in der unmittelbaren Nachbarschaft<br />
des <strong>Werk</strong>es land- und forstwirtschaftlich genutzte<br />
Freiflächen. In westlicher Richtung befindet<br />
sich der Stadtteil Beddingen und im Nordosten der<br />
Stadtteil Thiede. Der Standort zählt zu den wichtigsten<br />
Arbeitgebern Südost-Niedersachsens.<br />
Motorenwerk mit Leitfunktion<br />
Der Produktionsstart im <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong> erfolgte im<br />
Jahr 1970.<br />
Damals wurde mit dem Modell K 70 das erste frontgetriebene<br />
Fahrzeug unter dem <strong>Volkswagen</strong> Emblem<br />
hergestellt. Hierfür wurde am Standort ein neuartiges<br />
Motorenkonzept mit Wasserkühlung entwickelt.<br />
Diese Kompetenz wurde in den Folgejahren<br />
auf vielfältige Art und Weise weiter ausgebaut. Mit<br />
Einführung der Modelle Passat, Golf und Scirocco<br />
sowie Polo wurde die Motorenproduktion des<br />
<strong>Werk</strong>es erheblich forciert und nach Auslauf der Fahrzeugfertigung<br />
im Jahr 1975 konzentrierte sich der<br />
Standort vollständig auf den Bau von Motoren. Er<br />
fungiert seither innerhalb des <strong>Volkswagen</strong> Konzerns<br />
als Leitwerk für die Motorenfertigung.<br />
Das <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong> produziert heute Otto- und Dieselmotoren<br />
für Fahrzeuge vom Polo bis zum Bugatti.<br />
Die Motorenleistung liegt im Bereich von 55 kW<br />
(drei Zylinder) bis zu 882 kW (sechzehn Zylinder).<br />
Hauptkunden sind die Marken <strong>Volkswagen</strong>, Seat,<br />
Skoda, Audi und VW Nutzfahrzeuge; geliefert wird<br />
aber auch an externe Kunden. Darüber hinaus werden<br />
am Standort auch Motoren für Boote und<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Schiffe sowie Industriemotoren, z. B. für Gabelstapler,<br />
hergestellt, außerdem auch Motorkomponenten<br />
für die eigene Produktion sowie andere <strong>Werk</strong>e des<br />
Konzerns. Mit der Aufbereitung von gebrauchten<br />
Geschäfts-, Mitarbeiter- und Leasingfahrzeugen<br />
wurde ein neues Tätigkeitsfeld für das <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
erschlossen, das von der Autovision GmbH<br />
betrieben wird.<br />
Meilensteine im Motorenbau<br />
Im Jahr 1976 wurde im <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong> der erste<br />
Dieselantrieb für <strong>Volkswagen</strong> hergestellt. Die<br />
Motorenpalette wurde in der Folgezeit sowohl bei<br />
den Benzinern als auch bei den Dieselmotoren auf<br />
5- und 6-Zylinder-Antriebe erweitert. 1982 folgte die<br />
Produktion des ersten Turbo-Diesels. 1989 erhielten<br />
die Turbo-Diesel-Motoren durch die neue Technik<br />
erstmals die Bezeichnung „umweltfreundlich“. Die<br />
Dieselmotoren wurden ständig hinsichtlich reduziertem<br />
Kraftstoffverbrauch und Umweltfreundlichkeit<br />
verbessert. Seit 2008 erfüllen sie die Anforderungen<br />
der EU-5-Norm.<br />
Im Premiumsegment wurde im Jahr 2000 mit der<br />
Produktion von 8- und 12-Zylinder-Motoren begonnen,<br />
das Spektrum wurde 2006 sogar auf 16-Zylinder-Motoren<br />
ausgeweitet. Weitere Meilensteine<br />
waren die Einführung des VR 6 FSI und bei den Dieseln<br />
der Umstieg auf die TDI-Common-Rail-Technik<br />
im Jahr 2008. Ab dem Jahr 2010 wurden durch die<br />
neu entwickelten Dieselmotoren mit 3-Zylinder-<br />
Commonrail-Technik neue Verbrauchsmaßstäbe für<br />
Verbrennungsmotoren gesetzt. Auch bei den Benzinmotoren<br />
wird durch den 4-Zylinder-TSI-Motor<br />
ein besonders wirtschaftlicher und umweltgerechter<br />
Betrieb erreicht. Zur Erweiterung des Geschäftsfelds<br />
wurde 2001 mit der Entwicklung von Marinemotoren<br />
begonnen; weiterhin wurden 2009 bestimmte<br />
Ottomotoren so weiterentwickelt, dass sie unter dem<br />
Label „Ecoblue“ als Erdgas-Blockheizkraftwerke für<br />
verschiedene Anwendungen, z. B. auch in privaten<br />
Haushalten, eingesetzt werden können.<br />
7
8<br />
<strong>Salzgitter</strong>
Beschreibung wesentlicher umweltrelevanter Anlagen<br />
Genehmigungsbedürftige Anlagen nach Immissionsschutzrecht<br />
Der gesamte Standort ist als genehmigungspflichtige<br />
Anlage nach der 4. Bundesimmissionsschutzverordnung,<br />
Nr. 3.24, Spalte 1 genehmigt. Separat genehmigungspflichtig<br />
sind das gasbefeuerte Heizhaus,<br />
das auch der Emissionshandelspflicht unterliegt,<br />
sowie die 16 Motorenprüfstände. Nur eine relativ<br />
kleine Stichprobe der Motoren wird auf diesen Leistungsprüfständen<br />
für durchschnittlich 6,5 Stunden<br />
getestet, um die volle Leistungsfähigkeit zu überprüfen.<br />
Dies geschieht ergänzend zu emissionsfreien<br />
Kalttests, die alle gefertigten Motoren durchlaufen.<br />
Anlagen zur Metallbearbeitung<br />
Haupttätigkeit des Standortes ist die klassische mechanische<br />
Bearbeitung von Bauteilen aus Grauguss<br />
und Aluminium (z. B. Drehen, Bohren, Schleifen),<br />
was in vielfältiger Art und Weise mit unterschiedlichen<br />
Maschinen geschieht. Um den Umgang mit<br />
großen Mengen an umweltgefährdenden Stoffen wie<br />
Emulsionen und Bearbeitungsölen einzuschränken,<br />
werden Neuanlagen – soweit technisch möglich –<br />
mit Minimalmengenschmierung ausgestattet.<br />
Abwasseraufbereitungsanlagen/zentrale Kläranlage<br />
In die am Standort vorhandene zentrale Kläranlage<br />
(mit einer derzeitigen Nutzungsgröße von ca. 4.000<br />
Einwohnergleichwerten) werden zzt. überwiegend<br />
Küchen- und Sanitärabwässer sowie kommunale<br />
Abwässer der Nachbarschaft eingeleitet. Industrielles<br />
Abwasser aus der Produktion fällt nur in<br />
geringen Mengen an (z. B. als Abwasser aus der<br />
Kundendienst-<strong>Werk</strong>statt). Emulsionen und ölhaltiges<br />
Waschwasser aus der Produktion werden im<br />
Rahmen der Abwasservorbehandlung mithilfe einer<br />
Verdampferanlage in Wasser (Kondensat) und Öl<br />
getrennt, wobei das dabei anfallende Öl als Abfall<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
einem thermischen Verwertungsverfahren zugeführt<br />
und das Kondensat in einem internen Kreislaufprozess<br />
zum Neuansatz von Emulsionen verwendet<br />
wird. Zukünftig rechnen wir aufgrund der Einführung<br />
der Minimalmengenschmierung mit einem<br />
Rückgang des Bedarfs an Bearbeitungsemulsion im<br />
Prozess.<br />
Gefahrstoffl ager<br />
Für die unterschiedlichen Bearbeitungsprozesse<br />
werden große Mengen an Ölen und flüssigen Betriebsmitteln<br />
benötigt, die als Gefahrstoff eingestuft<br />
sind und überwiegend als Gefahrguttransporte den<br />
Standort erreichen. Insbesondere aufgrund der hohen<br />
Wassergefährdung, die von diesen Stoffen ausgeht,<br />
war es notwendig, den Anlieferprozess sowie<br />
die Lagerung und den innerbetrieblichen Transport<br />
zum Einsatzort abzusichern. Die Beschickung des<br />
Gefahrstofflagers, das in Halle 9 untergebracht ist,<br />
erfolgt mittels Gabelstapler über eine mit entsprechender<br />
Sicherheitseinrichtung ausgestattete<br />
Umschlagfläche im Freien. Von dort werden die auf<br />
speziellen Chemiepaletten angelieferten Fässer in<br />
Regalelemente eingelagert. Diese sind im gefliesten<br />
Lagerbereich auf ausreichend bemessenen Auffangwannen<br />
aufgestellt (Lagerkapazität: ca. 145 m3 ). Der<br />
Transport zum Einsatzort erfolgt über dafür vorgesehene<br />
Transportwege auf die gleiche Art und Weise<br />
wie die Einlagerung.<br />
9
10<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Besonderheiten und Entwicklung<br />
Neuerungen in der Organisation<br />
Im Hinblick auf die Zertifizierung des Energiemanagement-Systems<br />
nach DIN 16001 im Jahr <strong>2011</strong><br />
nimmt der Umweltmanagementbeauftragte Dr.<br />
Hans-Otto Bode nun auch die Funktion des Energiemanagementbeauftragten<br />
für den Standort <strong>Salzgitter</strong><br />
wahr.<br />
Er wird in seiner Arbeit unterstützt durch zzt. 9<br />
Sachkundige für Energie. Zwei dieser Sachkundigen<br />
koordinieren standortübergreifend die Arbeiten<br />
im Energiemanagement zum einen für das Themengebiet<br />
Strom, zum anderen für das Themengebiet<br />
rohrgebundene Medien (z. B. Druckluft- und<br />
Kühlwasserversorgung). Die übrigen Sachkundigen<br />
initiieren und verfolgen Energieziele in den Produktionsbereichen,<br />
in denen sie eingesetzt sind.<br />
Neue Produkte und Fertigungstechnologien<br />
Gebaute Nockenwellen<br />
Die Innovationskraft des Standortes zeigt sich in<br />
vielen Beispielen. So führte die ständige Suche nach<br />
Möglichkeiten der Gewichtseinsparung im Motor<br />
zur Entwicklung einer neuartigen Art von Nockenwelle,<br />
die für alle Common-Rail-Motoren des<br />
<strong>Volkswagen</strong> Konzerns zum Einsatz kommt.<br />
Diese „gebaute Nockenwelle“ (Rohr mit aufgesteckten<br />
Nocken) ist durchschnittlich ca. 66 % leichter<br />
als herkömmliche gegossene Nockenwellen, die aus<br />
einem Stück gefertigt werden. Dies ist umweltseitig<br />
besonders positiv, da einige der bislang notwendigen<br />
energieintensiven Bearbeitungsschritte (z. B.<br />
Drehen und Schleifen) entfallen.<br />
Durch die erzielte Gewichtsreduzierung trägt das<br />
neue Bauteil direkt zur weiteren Verringerung des<br />
Kraftstoffverbrauchs im Fahrbetrieb und somit auch<br />
zur Senkung der CO -Emissionen bei.<br />
2<br />
Minimalmengenschmierung (MMS)<br />
Die Minimalmengenschmiertechnik wurde in den<br />
vergangenen 10 Jahren im <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong> eingeführt<br />
und schrittweise auf die Großserienfertigung<br />
ausgeweitet. Ein besonders gutes Beispiel für den<br />
mittlerweile erreichten sehr hohen Entwicklungsstand<br />
zeigt sich in der neuen Zylinderkopffertigung<br />
für den 1,2-l-TSI-Otto-Motor, die im Laufe des Jahres<br />
2010 in Betrieb gegangen ist. Das Besondere ist, dass<br />
hier ein relativ komplexes Bauteil mit sehr vielen<br />
aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten in einer<br />
Fertigungslinie bestehend aus mehreren Bearbeitungszentren<br />
komplett mit MMS-Technik gefertigt<br />
wird. Bei der Minimalmengenschmierung sorgt ein<br />
Gemisch aus Druckluft und kleinsten Öltröpfchen<br />
für die erforderliche Schmierung.<br />
Je nach <strong>Werk</strong>zeug- und Bearbeitungserfordernissen<br />
werden die Öl-/Luftmengen mit einem Dosiersystem<br />
einzeln geregelt. Die Einführung der neuen<br />
Technik bringt große Vorteile für den Umweltschutz<br />
und die Arbeitssicherheit mit sich: So kann der<br />
Einsatz von Kühl-Schmier-Stoffen (KSS) deutlich<br />
reduziert werden. Hierdurch werden u. a. Verunreinigungen<br />
vermieden, die im Umgebungsbereich<br />
der Anlage durch die Emissionen der Schmierstoffe<br />
entstehen.<br />
Bei der herkömmlichen Technik müssen bei einer<br />
solchen Anlage im Drei-Schicht-Betrieb ca. 358.000<br />
Liter KSS im Prozess „bewegt“ und kontinuierlich<br />
aufbereitet werden. Dabei werden ca. 4 Liter Emulsion<br />
pro gefertigten Zylinderkopf verschleppt oder<br />
an die Umgebung abgeführt.<br />
Bei der neuen Technologie reduziert sich diese<br />
Menge auf gerade einmal 0,02 Liter MMS-Öl. Diese<br />
ist somit auch wesentlich energieeffizienter, weil<br />
verschiedene technische Hilfsprozesse, wie z. B. ein
Besonderheiten und Entwicklung<br />
aufwendiger Pumpenbetrieb oder der Betrieb einer<br />
Kälteanlage zur Kühlung des Bearbeitungsmediums,<br />
nicht mehr erforderlich sind.<br />
Monolithisches Haubenmodul<br />
Aktuell (Mitte <strong>2011</strong>) wird daran gearbeitet, neue<br />
konstruktive Lösungen in der Fertigungstechnik<br />
von Zylinderkopfhauben zu realisieren, um weitere<br />
Potenziale der Gewichtsreduktion zu erschließen.<br />
Das Beispiel „monolithisches Haubenmodul“ – eine<br />
Konstruktion aus den Bauteilen „Nockenwelle“ und<br />
„Lagerrahmen“ – zeigt, wie sich durch Optimierungen<br />
in der Bauteilgeometrie Gewichtsreduktionen<br />
von ca. 20 % erschließen lassen.<br />
Baumaßnahmen und neue Tätigkeitsfelder<br />
Neubau Logistikhalle 2b<br />
Zur Optimierung der bestehenden Logistikprozesse<br />
wird derzeit der Neubau der Logistikhalle 2b projektiert.<br />
Nach heutigen Planungen ist die Inbetriebnahme<br />
für Mitte des Jahres 2012 vorgesehen. Durch<br />
die direkte Anbindung an die bereits bestehenden<br />
Motormontagelinien (Halle 2a/2) können weite<br />
Transportwege in Außenläger vermieden und transportbedingte<br />
CO -Emissionen verringert werden.<br />
2<br />
Für die im Rahmen dieses Projektes zu rodenden<br />
Waldflächen auf dem Betriebsgelände werden<br />
Ausgleichsmaßnahmen (Ersatzflächen) in bis zu<br />
3-facher Größe realisiert.<br />
Produktion von Blockheizkraftwerken für eigene und<br />
fremde Anwendungen<br />
Ausgehend von einem internen Energieeinsparprojekt<br />
mit dem Arbeitstitel „dezentrale Wärmeversorgung“,<br />
welches im Jahr 2007 gestartet wurde,<br />
entwickelte sich als neue Idee das Geschäftsfeld<br />
„Blockheizkraftwerke“. Nach der öffentlichen Vorstellung<br />
erster Pilotprojekte im Jahr 2008 folgte am<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
09.09.2009 die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung<br />
mit dem Vertriebspartner (Fa. LichtBlick),<br />
die auch den notwendigen Service während des<br />
Betriebs leistet. Der professionelle Einstieg in dieses<br />
zukunftsträchtige Marktsegment war somit vollzogen.<br />
Im Mai des Jahres 2010 erfolgte dann zunächst<br />
eine Kleinserienfertigung. Im November 2010 wurde<br />
der Einstieg in die Serienproduktion realisiert.<br />
<strong>2011</strong> konnten bereits 620 Blockheizkraftwerke gebaut<br />
werden, für 2012 sind nach gegenwärtigem Stand der<br />
Planung ca. 2.300 BHKWs vorgesehen.<br />
Als Herzstück des Blockheizkraftwerkes dient ein<br />
herkömmlicher gasbetriebener Vier-Zylinder-Reihenmotor.<br />
Die hergestellten Blockheizkraftwerke arbeiten<br />
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung<br />
mit dem Ziel maximaler Ausnutzung des eingesetzten<br />
Brennstoffs.<br />
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kleinfeuerungsanlagen,<br />
bei denen der Brennstoff lediglich zur<br />
Gewinnung von Wärme eingesetzt wird, erfolgt<br />
hier parallel die Erzeugung von Wärme und Strom.<br />
Expertenrechnungen weisen im Vergleich mit einer<br />
herkömmlichen Strom- und Wärmeversorgung ein<br />
CO -Einsparpotenzial von ca. 58 % aus.<br />
2<br />
Der über einen Asynchrongenerator gewonnene<br />
Strom kann in das öffentliche Netz eingespeist werden.<br />
Mit den Blockkraftwerken können bei einer Feuerungswärmeleistung<br />
von insgesamt 60 kW auf der<br />
elektrischen Ebene 20 kW Strom und auf der thermischen<br />
Ebene 34 kW Wärme gewonnen werden.<br />
Dies entspricht einem Wirkungsgrad von ca. 92 %.<br />
11
12<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Besonderheiten und Entwicklung<br />
Der Standort betätigt sich beim Einsatz der entwickelten<br />
Technik selbst als Vorreiter, indem er diese<br />
ebenfalls nutzt. So wurden im Jahr 2010 insgesamt<br />
33 dieser kleinen Kraftwerke in verschiedenen<br />
Bereichen installiert und in Betrieb genommen,<br />
um technische Wärme für die Waschmaschinen der<br />
Produktion sowie Warmwasser für Waschkauen zu<br />
erzeugen und den dabei erzeugten Strom in das<br />
<strong>Volkswagen</strong> Stromnetz einzuspeisen.<br />
Bis Ende 2012 sollen weitere Blockheizkraftwerke am<br />
Standort realisiert werden. Danach soll die Kesselabschaltung<br />
des Heizhauses im Sommer erfolgen<br />
können, was im Ergebnis die Energiekosten und die<br />
Treibhausgasemissionen durch geringere Leitungsverluste<br />
deutlich verringern (reduzieren) könnte.<br />
Naturschutz und Landschaftspfl ege<br />
Als weltweit tätiges Unternehmen verbindet<br />
<strong>Volkswagen</strong> die notwendigen Erfordernisse der<br />
materiellen Produktion mit dem Erhalt der Biodiversität.<br />
Unsere Selbstverpflichtung zum Artenschutz<br />
setzen wir durch Projekte an den Standorten um.<br />
Die im Jahr 2010 begonnene Biotypenkartierung<br />
am Standort wurde mittlerweile abgeschlossen.<br />
Aufgrund des geplanten Neubaus der Logistikhalle<br />
(siehe Baumaßnahmen und neue Tätigkeitsfelder)<br />
wurde darüber hinaus das von Abholzung betroffene<br />
Waldstück gesondert kartiert und eine Zustandsbeschreibung<br />
durchgeführt. Im Rahmen dieser Kartierung<br />
wurden u. a. Bäume mit Höhlenbrütern und<br />
-bewohnern erfasst sowie Maßnahmen beschrieben,<br />
wie artenschutzrechtliche Beeinträchtigungen vermieden<br />
werden können.<br />
Veranstaltungen mit Umweltrelevanz<br />
Think-Blue-Veranstaltung<br />
Im Rahmen einer von der Konzern-Kommunikation<br />
begleiteten Maßnahme wurde am 15. Dezember 2010<br />
am Standort eine interne Informationsveranstaltung<br />
zur Förderung des Umweltbewusstseins initiiert.<br />
Als sog. „Leuchtturmprojekt“ wurden die gefertigten<br />
Blockheizkraftwerke zusammen mit anderen<br />
Umweltschutzschwerpunkten des <strong>Werk</strong>es einem<br />
ausgewählten Mitarbeiterkreis des Konzerns als<br />
Beispiel für verantwortungsbewusstes, nachhaltiges<br />
Umweltschutzhandeln durch den Umweltbeauftragten<br />
des <strong>Werk</strong>es vorgestellt. Zu der Vorstellung des<br />
Themas gehörte auch eine anschauliche Präsentation<br />
des Technikeinsatzes vor Ort.
Besonderheiten und Entwicklung<br />
Spezifi sche Umweltschutzereignisse<br />
und -planungen<br />
Aktualisierung des Altlastenkatasters<br />
Im Laufe der Verschrottung alter Produktionsanlagen<br />
(Bereich Späneförderer Halle 1) im Jahr 2010<br />
wurden innerhalb der Betongrube, die als Kanal für<br />
den Späneförderer diente, Verunreinigungen mit<br />
Mineralöl festgestellt. Diese wurden abgepumpt<br />
und fachgerecht entsorgt. Da die Betonsole zudem<br />
Beschädigungen aufwies, wurden Bohrkerne sowie<br />
darunter liegendes Erdreich entnommen und untersucht.<br />
Die Analyseergebnisse brachten entsprechende<br />
Belastungen des Untergrunds zutage. Eine Gefährdung<br />
für das Grundwasser kann zzt. ausgeschlossen<br />
werden. Die Ergebnisse wurden in das <strong>Volkswagen</strong><br />
Altlastenkataster aufgenommen. Sofern dort neue<br />
Baumaßnahmen erfolgen, wird dieser Bereich zu<br />
einem späteren Zeitpunkt saniert.<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Verbesserung der stofflichen Abfallverwertung<br />
Durch den im Verlauf des Jahres 2010 neu eingerichteten<br />
Demontageplatz für Verbundmaterialien in der<br />
Halle 4 können Metallabfälle und Kunststoffabfälle<br />
nun getrennt einer geeigneten stofflichen Verwertung<br />
zugeführt werden, die zudem deutlich besser<br />
vergütet wird.<br />
Sanierung des Kanalnetzes<br />
Um den Sanierungsaufwand für die Kanalisation<br />
abzuschätzen, wurde im Jahr 2010 ein Ingenieurbüro<br />
beauftragt. Mittels Kamerabefahrung wurde<br />
zunächst der westliche Bereich des <strong>Werk</strong>geländes<br />
analysiert. Dazu gehören beispielsweise die Kundendienstwerkstatt<br />
und der Bereich des Geländes, auf<br />
dem die Partnerfirmen am Standort ansässig sind.<br />
Mit der Sanierung des Netzes wurde bereits im Jahr<br />
2010 begonnen. Der Abschluss der Sanierung ist für<br />
2015 vorgesehen.<br />
13
14<br />
<strong>Salzgitter</strong>
Umweltauswirkungen des Standortes<br />
Am Standort <strong>Salzgitter</strong> werden die Umweltauswirkungen<br />
der Tätigkeiten mit dem bei <strong>Volkswagen</strong> entwickelten<br />
„System zur Erfassung und Bewertung der<br />
Umweltaspekte“ (S. 22 standortübergreifender Teil)<br />
analysiert. Das Ziel dabei ist es, die entstehenden<br />
Umweltauswirkungen nach ihrer Bedeutung zu ordnen<br />
und darauf aufbauend Optimierungspotenziale<br />
zu ermitteln, die als Ziele in das Umweltprogramm<br />
einfließen können. Das Diagramm zeigt deutlich,<br />
dass die wesentlichen Umweltauswirkungen aus<br />
dem Energieeinsatz hervorgehen (bedeutendster<br />
Umweltaspekt). Aufgeteilt auf die Bereiche Wärme<br />
(16,3 %) und Strom (65 %) wird ersichtlich, dass die<br />
verbrauchte elektrische Energie den größten Anteil<br />
beisteuert. Aufgrund der hohen Relevanz zielen die<br />
wesentlichen Bemühungen des Standortes auf die<br />
Verbesserung der Energieeffizienz insbesondere von<br />
Prozessen ab (siehe „Entwicklung von Kernindikatoren“:<br />
Schwerpunkt Energie).<br />
Der Umweltaspekt mit der zweitgrößten Bedeutung<br />
ergibt sich aus den Auswirkungen, die der Verkehr<br />
hervorruft. Diese Betrachtung beinhaltet sowohl den<br />
81,3 %<br />
14,2 %<br />
2,8 %<br />
0,5 % 1,2 %<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
individuellen Personenverkehr (Pendler) als auch<br />
die Auswirkung aus dem Güterverkehr.<br />
Aufgrund der breiten Produktpalette des Standortes<br />
sind derzeit ca. 700 verschiedene Lieferanten in die<br />
Bereitstellung von Produktionsmaterialien integriert.<br />
Vielfach sind diese Lieferanten und auch die<br />
Kunden des Standortes über ganz Deutschland und<br />
Europa verteilt. Derzeit ist es aufgrund der Produktvielfalt<br />
noch nicht möglich, größere Lieferungen<br />
zusammenzufassen oder auch eine Verlagerung auf<br />
die Schiene zu generieren. Im Rahmen der jetzigen<br />
Möglichkeiten wird indes schon auf die Auslastung<br />
der einzelnen Lieferanten geachtet.<br />
Eine etwas geringere Relevanz am Standort <strong>Salzgitter</strong><br />
haben die durch die Produktion oder auch<br />
begleitende Prozesse entstehenden Emissionen<br />
(drittgrößte Bedeutung). Die hier aufgeführten<br />
1,2 % beziehen sich z. B. auf die Emissionen aus<br />
den Motorenprüfständen und den Härteöfen. In<br />
den Motorenprüfständen werden die hergestellten<br />
Motoren mit handelsüblichen Kraftstoffen befüllt<br />
und unter kontrollierten Bedingungen getestet (siehe<br />
Entwicklung der Kernindikatoren: Schwerpunkt<br />
Emissionen). In den bereits erwähnten Härteöfen<br />
werden die Metallteile durch Wärmebehandlung<br />
und schnelles Abkühlen „gehärtet“, um sie gegen<br />
mechanischen Verschleiß widerstandsfähiger zu machen.<br />
Beide Prozesse unterliegen kontinuierlichen<br />
Effizienzuntersuchungen.<br />
Verkehr<br />
Abfall<br />
Emissionen<br />
Energieeinsatz<br />
- Abwasser (< 1 %)<br />
- Ressourcen (< 1 %)<br />
15
16<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Kernindikator A 2009 2010<br />
Energie (siehe Abbildung 1)<br />
gesamter direkter Energieverbrauch [MWh] 410.916 441.218<br />
... davon Gesamtverbrauch an erneuerbaren Energien [MWh] 1 41.218 44.427<br />
der gesamte direkte Energieverbrauch setzt sich wie folgt zusammen:<br />
elektrische Energie 251.330 251.000<br />
Wärmeenergie 152.112 183.195<br />
Brennstoff einsatz (Erdgas für Fertigungsprozesse) 7.474 7.023<br />
Materialeinsatz<br />
Massenstrom an Einsatzmaterial [t] 218.834 248.035<br />
Wasser<br />
Wasserverbrauch [m³] 299.496 287.342<br />
Abfall<br />
Abfallaufkommen [t] 2 35.463 38.873<br />
... davon gefährlicher Abfall [t] 3.876 3.263<br />
Biologische Vielfalt<br />
Grundstücksfl äche gesamt [m²] 2.635.194 2.635.194<br />
Flächenverbrauch [versiegelte Fläche in m²] 3 809.819 859.141
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Emissionen 4<br />
Gesamtemissionen von Treibhausgasen [t-CO 2 -Äquivalent] 4 37.091 48.079<br />
CO 2 -Äquivalente 5 (aus Heizhaus, Härterei, Motorprüfständen) 33.139 39.517<br />
CO 2 -Äquivalente (aus H-FKW- und H-FCKW-Emissionen) 367 197<br />
CO 2 -Äquivalente 6 (aus Schwefelhexafl uorid (SF 6 )) 3.585 8.365<br />
Gesamtemissionen in die Luft [t] 7 17,1 28,2<br />
NO x (Stickoxide) 17 28<br />
SO 2 (Schwefeldioxid) 0,1 0,2<br />
Die nachfolgenden Anmerkungen beziehen sich auf das Jahr 2010<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Anmerkung 1: Der Anteil der erneuerbaren Energien bezieht sich ausschließlich auf elektrische Energie. Hier sind die Energieversorger nach § 42 Energiewirtschaftsgesetz<br />
auskunftspfl ichtig. Der Bezug von regenerativ erzeugtem Strom liegt im Energiemix der <strong>Volkswagen</strong> Kraftwerk GmbH zzt. (2010)<br />
bei 17,7 %. Für die Bereiche Wärmeenergie und Brennstoff liegt zzt. kein Ermittlungsansatz zur Bestimmung der regenerativen Anteile vor.<br />
Anmerkung 2: 98,25 % aller Abfälle (inkl. Metallabfälle) wurden im Betrachtungsjahr verwertet. Nicht produktionsspezifi sche Abfälle wie z. B. Bauschutt<br />
sind unberücksichtigt. Die mengenmäßig 10 bedeutendsten gefährlichen Abfallarten sind nachfolgender Aufstellung zu entnehmen.<br />
Anmerkung 3: Der Unterschied des Flächenverbrauchs in den dargestellten Betrachtungsjahren ergibt sich daraus, dass im Jahr 2009 diverse Randbauten<br />
und Nebengebäude noch nicht berücksichtigt waren.<br />
Anmerkung 4: Folgende von EMAS geforderte Treibhausgasemissionen sind für den Standort nicht relevant: Lachgas, Methan.<br />
Anmerkung 5: Bei den hier dargestellten CO -Äquivalenten handelt es sich ausschließlich um Emissionen, die im Zusammenhang mit den Produktions-<br />
2<br />
prozessen betrachtet werden müssen. Sie kommen aus dem Heizhaus (93 %), der Härterei (4 %) sowie den verschiedenen Motorprüfständen (3 %).<br />
Anmerkung 6: SF wird am Standort zzt. als Prüfgas für die Dichtigkeit von Rail-Verteilerleisten verwendet. Es besitzt den Vorteil einer sehr hohen<br />
6<br />
Nachweisempfi ndlichkeit und ermöglicht eine kurze Prüfdauer. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 350 kg des Gases verbraucht. Das entspricht einem<br />
Mehrverbrauch von 200 kg. Dieser resultiert aus einer deutlichen Stückzahlerhöhung von 377.000 Rails im Jahr 2010 und entspricht dem o. ausgewiesenen<br />
Treibhauseff ekt (ca. 0,54 g/Rail).<br />
Anmerkung 7: Folgende von EMAS geforderte Abluftemissionen sind für den Standort nicht relevant: PM (Staub).<br />
17
18<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Abfallbezeichnung AVV-Nr. Menge<br />
2009 [t/a]<br />
Abfälle zur Beseitigung<br />
Menge<br />
2010 [t/a]<br />
Feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (nur Filtertücher) 15 02 02* 496,68 481,44<br />
Bearbeitungsemulsion, halogenfrei 12 01 09* 180,22 41,48<br />
Zellstoff tücher, ölhaltig (Putzwolle, -lappen) 15 02 02* 91,92 87,04<br />
Leim- und Klebemittel 08 04 09* 5,70 5,11<br />
Kunststoff behältnisse mit schädlichen Anhaftungen 15 01 10* 1,24 2,64<br />
Abfälle zur Verwertung<br />
Altöl 12 01 07* 2.274,40 1.945,20<br />
Metallschleifschlamm (Honschlamm) 12 01 18* 644,00 567,08<br />
Bleibatterien 16 06 01* 83,14 56,28<br />
Elektronikschrott 16 02 13* 61,45 66,26<br />
Quecksilberhaltige Entladungslampen 20 01 21* 3,98 3,74<br />
Bsp. Energie (Abbildung 1)<br />
(Energieverbrauch in MWh)<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Betrachtet man den Energiebedarf des Standortes<br />
insgesamt, so ist festzustellen, dass es im Jahresvergleich<br />
2009/2010 vor allem durch den Bedarf an<br />
Wärmeenergie (Erdgas für technische Wärme und<br />
Raumwärme) zu einem Anstieg des Verbrauchs gekommen<br />
ist. (Produktionssteigerung)<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
(Motorenproduktion [St.])<br />
Motoren<br />
Brennstoff einsatz (Gas)<br />
Wärmeenergie<br />
elektrische Energie<br />
Bei differenzierter Analyse des gesamten Wärmeenergiebedarfs<br />
(Wärmeenergie und Brennstoffeinsatz)<br />
wird klar erkennbar, dass dieser Anstieg in erster<br />
Linie auf witterungsbedingte Einflüsse und die<br />
Produktionssteigerung zurückgeführt werden kann.
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Bsp. Vergleich Erdgasverbrauch <strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
(Erdgasverbrauch in 10³ x MWh )<br />
Der Winter des Jahres 2010 lag mit einer Durchschnittstemperatur<br />
von 3,1 °C in der Heizperiode genau<br />
2,4 °C unter den entsprechenden Durchschnittswerten<br />
des Jahres zuvor.<br />
Bereinigt man den Wärmebedarf um die witterungsbedingten<br />
Einflüsse und berechnet mittels Korrekturfaktors<br />
der Heizgradtage einen theoretischen<br />
Verbrauch, wird ersichtlich, dass auch hier eine<br />
rückläufige Tendenz im Verbrauch erkennbar ist.<br />
Im Jahresvergleich 2009/2010 würde so eine Senkung<br />
von 176 GWh auf 161 GWh bei der benötigten Wärmeenergie<br />
zustande kommen. Die größten Erfolge<br />
des Energiemanagements konnten bislang aber im<br />
Bereich der Elektroenergie realisiert werden.<br />
Im Jahr 2007 betrug der Anteil der Elektroenergie<br />
noch etwas mehr als 70 % bezogen auf den gesamten<br />
Bsp. Energieverbrauch pro hergestelltem Motor<br />
(Verbrauch elektrischer Energie in MWh)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
0,35<br />
0,30<br />
0,25<br />
0,20<br />
0,15<br />
0,10<br />
0,05<br />
50<br />
0<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
2006 2007 2008 2009 2010<br />
7<br />
5,6<br />
4,2<br />
2,8<br />
1,4<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Temperaturjahresmittel der Heizperiode<br />
(01.01.-30.4./01.10.-31.12.) in °C<br />
Erdgasverbrauch (Produktion, Raumund<br />
techn. Wäme) in 10³ x MWh<br />
Erdgasverbrauch in 10³ x MWh<br />
0<br />
normiert (mittels Korrekturfaktor<br />
der Heizgradtage)<br />
(Temperaturjahresmittel<br />
der Heizperiode in °C)<br />
Energiebedarf des Standortes. Seitdem konnte der<br />
Verbrauch elektrischer Energie von seinerzeit 327.000<br />
MWh/a auf aktuell 251.000 MWh/a gesenkt werden.<br />
Heute beträgt der Anteil der elektrischen Energie<br />
noch knapp 57 % des gesamten Energieverbrauchs.<br />
Betrachtet man zusätzlich den Kernindikator R im<br />
Bereich Energie, ist auch im direkten Jahresvergleich<br />
2009/2010 ein Rückgang der Kennzahl erkennbar,<br />
und das, obwohl die Motorenproduktion deutlich<br />
angestiegen ist.<br />
Sowohl die absolute Senkung des Verbrauchs elektrischer<br />
Energie im Jahresverlauf als auch die Kennzahl<br />
belegen also eine beeindruckende Entwicklung,<br />
die sich zudem mit einer motorenspezifischen<br />
Energiekennzahl belegen lässt.<br />
spez. Energieverbrauch pro hergestelltem Motor<br />
19
20<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Der größte Beitrag zur Verbrauchsreduzierung im<br />
Bereich elektrischer Energie konnte bisher durch die<br />
Erarbeitung bedarfsorientierter Abschaltpläne für<br />
Anlagen und Maschinen erreicht werden, deren Umsetzung<br />
mittels konsequent durchgeführter Wochenendkontrollen<br />
überprüft wurde. Allein diese Maßnahme<br />
hatte ca. einen Beitrag von 40 % am Erfolg.<br />
Ein weiterer bedeutender Einspareffekt wurde durch<br />
den Einsatz von automatischen Lichtsteuerungen<br />
erreicht. Diese haben einen ca. 25-prozentigen<br />
Anteil an der erreichten Einsparung beim Stromverbrauch.<br />
Aber auch viele kleine Maßnahmen, wie<br />
beispielsweise<br />
die Durchführung von Energieworkshops in verschiedenen<br />
Kostenstellen,<br />
das gezielte Abstellen von Druckluftleckagen,<br />
die gezielte Fahrweise von Belüftungsanlagen,<br />
die Optimierung der Heiz- und Kühlungsintervalle<br />
beim Einsatz von Waschmedien,<br />
die Demontage nicht mehr benötigter Produktionsanlagen<br />
und<br />
die Neubeschaffung von verbrauchsoptimierten<br />
Anlagen und Maschinen,<br />
haben zum Erfolg beigetragen. Dennoch besteht<br />
noch ein bedeutendes Potenzial, das in den nächsten<br />
Jahren erschlossen werden soll. Eine Maßnahme<br />
ist beispielsweise die Modernisierung der<br />
Hallengrundbeleuchtung. Im Rahmen dieser Maßnahme<br />
sollen mittelfristig in allen Hallen die<br />
vorhandenen Leuchtstoffröhren und Halogenmetalldampflampen<br />
(HQI) durch wesentlich effizientere<br />
Leuchtstofflampen ersetzt werden. Im Jahr<br />
2010 wurde die Maßnahme in Halle 2a komplett<br />
abgeschlossen, im Jahr <strong>2011</strong> wird aktuell Halle 2<br />
diesbzgl. modernisiert. Durch die vollständige Umsetzung<br />
der Maßnahme in allen Hallen, die ein<br />
Investitionsvolumen von mehr als 5 Mio. Euro erfordert,<br />
könnte ein jährliches Einsparpotenzial von<br />
12.600 t CO -Äquivalenten erreicht werden. Auch das<br />
2<br />
im Jahr 2009 neu gegründete Technik-Team, das sich<br />
u. a. mit Effizienzsteigerungen von Waschmaschinen<br />
befasst, hat dafür gesorgt, dass auf der Energieseite<br />
Einsparungen realisiert werden konnten.<br />
Ein Fokus dieses Teams lag im Jahr 2010 auf der<br />
Entwicklung und dem Aufbau einer flexiblen Waschmaschine<br />
zur Reinigung bestimmter Bauteile vom<br />
1,2-l- bis zum 6,0-l-Motor. Unterschiedliche Bauteile<br />
benötigen verschiedene Drücke für den Reinigungsprozess<br />
– eine variable „Fahrweise“ der Anlage ist<br />
hier möglich. Ziel der Anlage ist es, Waschanforderungen,<br />
d. h. „maßgeschneiderte“ Drucklagen<br />
für die Reinigungsprozesse an neuen Bauteilen zu<br />
ermitteln und damit den Reinigungsprozess auch<br />
energetisch zu optimieren. Anschließend können<br />
für diese Bauteile die benötigten Waschmaschinen<br />
mit den optimalen Drucklagen beschafft werden.<br />
Eine bedarfsgerechte Auslegung der Anlage spart<br />
Betriebskosten und bringt Umweltvorteile, weil<br />
kleinere Pumpen deutlich weniger Strom benötigen<br />
als große.
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Bsp. Emissionen Motorenprüfstände<br />
(Emissionen [t])<br />
Output<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Kernindikator B 2009 2010<br />
Produktoutput<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Dieses Thema wird in dieser <strong>Umwelterklärung</strong> vollständig<br />
durch die noch etwas intensivere Aus-<br />
1.500.000<br />
1.284.000<br />
1.070.000<br />
856.000<br />
642.000<br />
428.000<br />
214.000<br />
(Motorenproduktion [St.])<br />
Motoren<br />
Gesamtausbringungsmenge aller Produkte [t] 183.371 209.162<br />
Massenstrom Antrieb [t] 183.371 209.162<br />
Motoren [t] 140.217 175.818<br />
Motoren [St.] 1.109.688 1.315.610<br />
Zylinderköpfe [t] 593 623<br />
Zylinderköpfe [St.] 29.122 30.401<br />
Zylinderkurbelgehäuse [t] 10.661 3.334<br />
Zylinderkurbelgehäuse [St.] 247.962 84.769<br />
Kurbelwellen [t] 10.019 6.335<br />
Kurbelwellen [St.] 811.237 465.466<br />
Saugrohre [t] 2.247 1.055<br />
Saugrohre [St.] 687.554 341.552<br />
weitere Motorenkomponenten dieses Massenstroms, die nicht näher benannt werden [t] 19.634 21.997<br />
0<br />
NO x<br />
CO<br />
CO 2 x Faktor 100<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
weitung des Themas Energie und die Detailbetrachtungen<br />
dazu ersetzt.<br />
21
22<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Bsp. Fertigungseinheiten<br />
(Millionen Produkte)<br />
1.500.000<br />
1.250.000<br />
1.000.000<br />
750.000<br />
500.000<br />
250.000<br />
0<br />
2008 2009 2010<br />
Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Stückzahlen<br />
der für das <strong>Werk</strong> bedeutendsten Fertigungseinheiten<br />
in den vergangenen 3 Jahren.<br />
Vor allem im Kerngeschäft des Standortes konnte im<br />
Jahresvergleich 2009/2010 ein außerordentlich hoher<br />
Zuwachs erreicht werden. Die Fertigung der Motoren<br />
legte um ca. 18 % zu.<br />
Der offensichtliche Rückgang der Zylinderkurbelgehäusefertigung<br />
betrachtet gemäß EMAS-Vorgaben<br />
Motoren<br />
Zylinderkurbelgehäuse<br />
Kurbelwellen<br />
nur die Auslieferung an externe Kunden, nicht aber<br />
die Zylinderkurbelgehäuse, die direkt in die Motoren<br />
am Standort verbaut werden. Die Entwicklung<br />
dieses Produktionsoutputs schwankt folglich in<br />
Abhängigkeit von den im <strong>Werk</strong> benötigten Zylinderkurbelgehäusen.<br />
Der Rückgang bei den Kurbelwellen erklärt sich<br />
durch die Bedarfsreduzierung in Brasilien und Südafrika.<br />
Zudem lief die Produktion für den 5-Zylinder<br />
(R5k) mittlerweile aus.
Entwicklung der Kernindikatoren<br />
Die Entwicklungen des Kernindikators R wurden<br />
bereits im Kontext der Beschreibungen zum Kernindikator<br />
A begründet. Eine Ausnahme bildet hierbei<br />
der Kernindikator R im Bereich Wasser, der – wie<br />
erkennbar ist – ebenfalls eine positive Entwicklung<br />
genommen hat. Die Senkung dieses Kernindikators<br />
wurde vor allem dadurch erreicht, dass im Kühlturm<br />
aufgrund von Veränderungen in der Verfahrenstechnik<br />
beim Betrieb der Anlage der Frischwasserbedarf<br />
um ca. 12.000 m² reduziert wurde.<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Daneben haben auch andere Faktoren, wie beispielsweise<br />
die Installation sparsamer Armaturen in den<br />
Waschkauen,<br />
der Austausch von Nasswäschern (Filteranlagen)<br />
durch Trockenabsaugung (mikropore Filter),<br />
Verbrauchskontrolle der Waschmaschinen und Verlängerung<br />
von Standzeiten,<br />
maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen.<br />
Kernindikator R 2009 2010<br />
Energie<br />
gesamter direkter Energieverbrauch [MWh]/Gesamtoutput [t] 2,24 2,11<br />
... davon Gesamtverbrauch an erneuerbaren Energien [MWh]/Gesamtoutput [t] 0,22 0,21<br />
Materialeinsatz<br />
Massenstrom an Einsatzmaterial [t]/Gesamtoutput [t] 1,19 1,19<br />
Wasser<br />
Wasserverbrauch [m³]/Gesamtoutput [t] 1,63 1,37<br />
Abfall<br />
Abfallaufkommen [t]/Gesamtoutput [t] 0,19 0,19<br />
... davon gefährlicher Abfall/Gesamtoutput [t] 0,02 0,02<br />
Biologische Vielfalt<br />
Flächenverbrauch [bebaute Fläche in m²]/Gesamtoutput [t] 4,42 4,11<br />
Emissionen<br />
Gesamtemissionen von Treibhausgasen [t-CO 2 -Äquivalent]/Gesamtoutput [t] 0,20 0,23<br />
Gesamtemissionen in die Luft [t]/Gesamtoutput [t] 0,0001 0,0001<br />
23
24<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Umweltprogramm<br />
Im abgelaufenen Revalidierungszeitraum 2008–<strong>2011</strong><br />
wurde an der Abarbeitung von 14 Zielen mit insgesamt<br />
35 Einzelmaßnahmen gearbeitet (die neuen<br />
Maßnahmen aus <strong>2011</strong> sind hierin unberücksichtigt).<br />
Über den Fortgang im Einzelnen haben wir jährlich<br />
in den veröffentlichten Umweltprogrammen berichtet.<br />
Resümierend lässt sich für den Standort <strong>Salzgitter</strong><br />
feststellen, dass 24 dieser Maßnahmen erfolgreich<br />
abgeschlossen werden konnten, an 10 Maßnahmen<br />
wird noch gearbeitet.<br />
Lediglich eine Maßnahme musste aufgegeben<br />
werden, weil sich in den Detailplanungen herausgestellt<br />
hat, dass deren Wirtschaftlichkeit nicht mehr<br />
gegeben war. Auch konnten drei noch offene Maßnahmen<br />
aus dem Begutachtungszyklus 2005–2008<br />
mittlerweile vollständig abgearbeitet werden.<br />
Umweltprogramm <strong>2011</strong><br />
Ziel-Nr.<br />
Ziele<br />
1 Verbesserung des Boden- und Grundwasserschutzes<br />
Maßnahmen<br />
Bewertet man das Erreichte unter dem Kriterium<br />
„besondere Umweltleistung“, lässt sich vor allem<br />
das Gesamtpaket zur Senkung des Energiebedarfs<br />
herausstellen. Hier haben sehr viele Einzelmaßnahmen<br />
zu einem nachhaltigen Erfolg beigetragen.<br />
Auch die Maßnahmen, die eine Gewichtsreduktion<br />
am Produkt bewirken, bewerten wir in doppelter<br />
Hinsicht besonders positiv.<br />
Einerseits wird der Kraftstoffverbrauch immer weiter<br />
abgesenkt (Bsp. Leichtbaunockenwelle), andererseits<br />
werden die Fertigungstechniken umweltfreundlicher<br />
(Bsp. Minimalmengenschmierung).<br />
Das nachfolgend dargestellte Umweltprogramm<br />
<strong>2011</strong> zeigt den Sachstand in den aktuell verfolgten<br />
Punkten.<br />
Verfolgung von neuen und laufenden VAwS-Sanierungsmaßnahmen<br />
nach einem behördlich abgestimmten Zeitplan<br />
Sanierung bzw. Stilllegung von acht Fettabscheidern gemäß<br />
3-Jahres-Plan<br />
Umsetzung des Sanierungsplanes bis zur Freiräumung<br />
der Halle 3 im Jahre 2015<br />
Erfassung und Bewertung noch vorhandener Kraftstoff -<br />
ringleitungen mit dem Ziel der Reduzierung der Ringleitung<br />
Schrittweise Sanierung der 6 Kanalnetzbereiche nach<br />
vorheriger TV-Befahrung<br />
Termin<br />
2014<br />
<strong>2011</strong><br />
2015<br />
2013<br />
(<strong>2011</strong>)<br />
2013<br />
Abarbeitungsstand<br />
1
Umweltprogramm<br />
Ziel-Nr.<br />
Ziele<br />
2 Einsparung von elektrischer Energie Zertifi zierung des bestehenden Energiemanagement-Systems<br />
nach DIN EN 16.001<br />
Maßnahmen<br />
Schrittweise Umsetzung einer energiesparenden Hallengrundbeleuchtung<br />
Systematisches Erfassen und Abstellen von Druckluftleckagen<br />
werkweit<br />
Einsparung von 4.000 kWh/a durch Einsatz effi zienter<br />
Büro-PCs im Motorenprüfzentrum Halle 1<br />
Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung einer bedarfsgerechten<br />
Zuluft- und Abluftsteuerung in der Halle 4<br />
Beschaff ung von 3 drehzahlgeregelten Umwälzpumpen<br />
für das Heizhaus<br />
Untersuchung des Einsatzes von LED-Technik für die<br />
Außenbeleuchtung<br />
3 Einsparung von Prozesswärme Wärmerückgewinnung an 17 technischen Absaugungen<br />
von <strong>Werk</strong>zeugmaschinen<br />
Ausrüstung von allen Waschkauen und Waschmaschinen<br />
mit Blockkraftheizkraftwerken aus der eigenen Produktion<br />
4 Einsparung von Erdgas Reduzierung von 3.670 MWh/a Erdgas durch Beschaffung<br />
von 18 Schnelllauftoren für die Logistikhalle und für<br />
Torschleusen<br />
5 Reduzierung der Treibhausgase Untersuchung zur technischen Umrüstung der 8 Dichtprüfanlagen<br />
von SF 6 auf N 2 O<br />
6 Verringerung der Abfallmenge Kontinuierliche Erhöhung der <strong>Werk</strong>zeugstandzeiten bei<br />
gleichzeitiger Einsparung von Minimalmengenschmieröl<br />
Kontinuierliche Standzeiterhöhung von Bohrköpfen durch<br />
Aufbringen einer Nanobeschichtung auf Metallsilikatbasis<br />
Zerstörungsfreies Prüfen von 500 ZKGs/a durch Beschaffung<br />
eines Konfokalmikroskopes<br />
Wiederaufbereitung statt thermische Verwertung von ca.<br />
2.000 t/a Altöl<br />
Termin<br />
<strong>2011</strong><br />
2014<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
2013<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
(<strong>2011</strong>)<br />
2014<br />
2014<br />
2012<br />
2012<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Abarbeitungsstand<br />
2<br />
25
26<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
Ziel-Nr.<br />
Anmerkung 1: Diese Maßnahme wird stufenweise umgesetzt. Geplant ist die Bereinigung hallenweise. Die Halle 2 ist abgeschlossen, Halle 1 und Halle 9 sollen in<br />
den nächsten beiden Jahren umgesetzt werden. Insgesamt soll die Maßnahme 2013 abgeschlossen sein.<br />
Anmerkung 2: Ein neuer Prüfstand, der das Prüfen mit anderen Prüfgasen/Prüfmedien (N O) erlaubt, wird im I. Quartal 2012 aufgebaut. Mit dieser Anlage soll<br />
2<br />
u. a. eine Freigabe für alternative Prüfverfahren geschaff en werden. Erste aussagekräftige Ergebnisse werden für Ende 2012 erwartet.<br />
Legende<br />
Ziele<br />
7 Reduzierung von CO 2 -Emissionen beim Otto-Motor<br />
EA 211<br />
8 Reduzierung von CO 2 -Emissionen bei neuer Generation<br />
von CR-Motoren<br />
leerer grauer Kreis = Maßnahme, die in der Vergangenheit geplant, aber noch nicht begonnen wurde<br />
leerer blauer Kreis = neue Maßnahme in dieser <strong>Umwelterklärung</strong><br />
viertel Kreis = Maßnahme begonnen<br />
halber Kreis = Maßnahme mitten in der Umsetzung<br />
dreiviertel Kreis = Abschluss der Maßnahme ist absehbar<br />
voller Kreis = Maßnahme abgeschlossen<br />
rote Zahl = Der ursprünglich geplante Termin wurde auf den angegebenen Termin nach hinten verschoben<br />
Maßnahmen<br />
Reduzierung des CO 2 -Verbrauches um 10 g/km durch<br />
technische Maßnahmen<br />
Reduzierung des CO 2 -Verbrauches um 2 g/km durch<br />
technische Maßnahmen<br />
9 Verbesserung des Naturschutzes Erfassung und Bewertung von Bäumen (Baumkataster)<br />
zur Durchführung von Pfl egemaßnahmen und Wahrung<br />
der Verkehrssicherheit<br />
10 Reduzierung von Transporten Vermeidung der externen Zwischenlagerung von Zulieferteilen<br />
durch Nutzung und Erweiterung eigener Lagerfl ächen<br />
im <strong>Werk</strong><br />
11 Untersuchungen zur Ressourcenschonung in<br />
Waschprozessen<br />
Ermittlung der optimalen Waschparameter (Druck, Volumen,<br />
Düsen) zur Erstellung von Vorgaben für die Maschinenhersteller<br />
Entwicklung eines gesicherten Nachweisverfahrens zur<br />
Einzeldosierung von Inhaltsstoff en (z. B. Tensiden)<br />
12 Verringerung von Emissionen Untersuchungen zum Einsatz eines neuen Reinigers im<br />
Bereich Motorenprüfstände mit dem Ziel Verringerung<br />
der Geruchsemissionen<br />
Verringerung der Lärmemissionen durch eine Scheitelrolle<br />
mit elektrischer Schwungmassensimulation<br />
Termin<br />
2012<br />
2012<br />
<strong>2011</strong><br />
2013<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
2012<br />
Abarbeitungsstand
<strong>Salzgitter</strong> 27
B30<br />
<strong>Salzgitter</strong><br />
<strong>Werk</strong> <strong>Salzgitter</strong><br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Dr. Hans-Otto Bode, Umweltbeauftragter<br />
Brieffach 7353<br />
38231 <strong>Salzgitter</strong><br />
Telefon: +49 5341 232 459<br />
E-Mail: hans-otto.bode[at]volkswagen.de<br />
Die nächste Aktualisierung erfolgt 12/2012. Dieser Standort verfügt<br />
über ein Umweltmanagement-System. Die Öffentlichkeit wird im<br />
Einklang mit dem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement<br />
und die Umweltbetriebsprüfung über den betrieblichen<br />
Umweltschutz dieses Standortes unterrichtet.<br />
VERIFIED<br />
ENVIRONMENTAL<br />
MAN<strong>AG</strong>EMENT<br />
REG. NO. DE-111-000014
<strong>Salzgitter</strong> B31
32 Standortübergreifender Teil
Abkürzungen und Erläuterungen<br />
AOX Adsorbierbare organische Halogenverbindungen<br />
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
BSB Summenparameter, beschreibt die<br />
5<br />
Menge der unter definierten Bedingungen<br />
biologisch abbaubaren Stoffe<br />
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und<br />
Landschaft (Schweiz)<br />
CKW Chlorierte Kohlenwasserstoffe<br />
CO Kohlendioxid<br />
2<br />
CO Kohlenmonoxid<br />
CSB Summenparameter, beschreibt die<br />
Menge der unter definierten Bedingungen<br />
chemisch abbaubaren Stoffe<br />
EMAS Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement<br />
und die Umweltbetriebsprüfung<br />
(eco-management and<br />
audit scheme)<br />
FeCl Eisen(III)chlorid<br />
3<br />
FCKW Fluorchlorkohlenwasserstoffe<br />
H-FCKW Teilhalogenierte Flurchlorkohlenwasserstoffe<br />
H-FKW Teilfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe<br />
GbV Gefahrgutbeauftragtenverordnung<br />
KD Kundendienst<br />
KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz<br />
KSS Kühlschmierstoffe<br />
Standortübergreifender Teil 33<br />
LAU/HBV- Anlagen, in denen mit wassergefähr-<br />
Anlagen denden Stoffen umgegangen wird<br />
MWh Megawattstunden<br />
NOx Stickoxide<br />
OE Organisationseinheit<br />
SEBU System zur Ermittlung und Bewertung<br />
von Umweltaspekten<br />
SO Schwefeldioxid<br />
2<br />
TPM Total Productive Management<br />
UF Ultrafiltration<br />
UIS Umweltinformations-System<br />
UMS Umweltmanagement-System<br />
VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang<br />
mit wassergefährdenden Stoffen<br />
VOC Volatile organic compounds (flüchtige<br />
organische Stoffe)<br />
VBH/KTL Vorbehandlung und Kathodische<br />
Tauchlackierung; im Lackierprozess<br />
Tauchverfahren, in denen erste Korrosionsschutzschichten<br />
aufgetragen<br />
werden
34 Standortübergreifender Teil<br />
Weitere Informationen<br />
Informationen zum Umweltschutz bei <strong>Volkswagen</strong><br />
finden Sie in weiteren Broschüren und im Internet.<br />
Der Nachhaltigkeitsbericht von <strong>Volkswagen</strong><br />
<strong>2011</strong>/2012<br />
Im Frühjahr <strong>2011</strong> hat die <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong> unter dem<br />
Motto „Nachhaltigkeit – Bericht <strong>2011</strong>“ ihren vierten<br />
konzernweiten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Der<br />
Bericht umfasst alle Konzernbereiche mit den beiden<br />
Markengruppen <strong>Volkswagen</strong> und Audi, den Geschäftsbereichen<br />
Nutzfahrzeuge und Finanzdienstleistungen<br />
sowie allen Gesellschaften, an denen der<br />
Konzern mit über 50 Prozent beteiligt ist.<br />
Schwerpunkte des Konzern-Nachhaltigkeitsberichts<br />
bilden die Strategien und Maßnahmen des Konzerns<br />
zur Weiterentwicklung im Bereich Antriebe und<br />
Kraftstoffe, zur Beschäftigungssicherung sowie zur<br />
Kundenorientierung.<br />
Bestelladresse: <strong>Volkswagen</strong> Distributionsservice,<br />
Postfach 1450, 33762 Versmold<br />
www.mobilitaet-und-nachhaltigkeit.de<br />
Informationsportal zum Umweltschutz mit<br />
Berichten, Interviews und Nachrichten. Ständig<br />
aktualisiert bietet diese Site aktuelle News, Informationen<br />
zum Umweltschutz an den internationalen<br />
Standorten von <strong>Volkswagen</strong>, Tipps zum ökologischen<br />
Fahren, Hintergrundwissen zu Themen<br />
wie Öko-Audit und nachhaltiger Entwicklung,<br />
umweltbezogene Informationen zu einzelnen<br />
<strong>Volkswagen</strong> Modellen und vieles mehr.<br />
Ansprechpartner<br />
Umwelt Strategie<br />
Dr. Daniel Sascha Roth<br />
Telefon: 05361-9-49171<br />
E-Mail: daniel-sascha.roth[at]volkswagen.de<br />
Öko-Audit und Umweltschutz<br />
Wissenswertes zum Thema Umweltschutz und Öko-<br />
Audit erfahren Sie beim Umweltbundesamt in Berlin.<br />
Unter anderem hält es unter der Rubrik „Umwelt<br />
im Netz“ eine umfangreiche Linkliste bereit.<br />
Umweltbundesamt<br />
Postfach 1406, 06813 Dessau<br />
Telefon: 0340-2103-0<br />
Internet: www.umweltbundesamt.de
Impressum<br />
Herausgeber dieser <strong>Umwelterklärung</strong><br />
ist die <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong>. Verantwortlich<br />
für den Inhalt des standortübergreifenden<br />
Teils ist der Konzernbereich Umwelt (Wolfsburg).<br />
Verantwortlich für die enthaltenen standortspezifischen<br />
Teile sind die Umweltbeauftragten der<br />
jeweiligen <strong>Werk</strong>e.<br />
<strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Günter Damme<br />
Brieffach 1896<br />
38436 Wolfsburg<br />
guenter.damme[at]volkswagen.de<br />
Beratung/Konzept/Grafi k & Gestaltung/Umsetzung<br />
FOUR MOMENTS - Marken. Design. Kommunikation.<br />
Redaktion/Text<br />
Paradies und Partner Unternehmensberatung für Umweltschutz, Qualität und Arbeitssicherheit<br />
Standortübergreifender Teil 35
32<br />
Standortübergreifender Teil<br />
© <strong>Volkswagen</strong> <strong>AG</strong><br />
Stand: <strong>2011</strong>