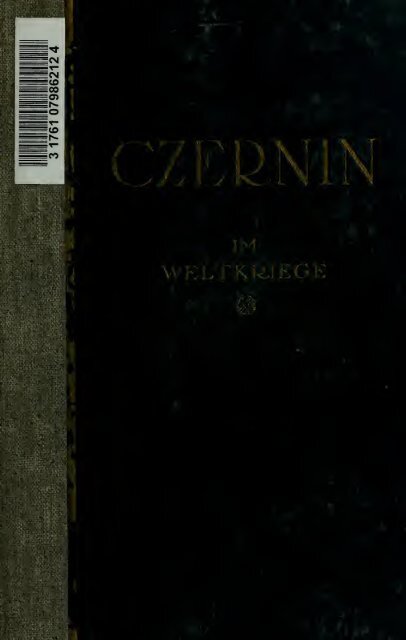Im Weltkriege - booksnow.scholarsportal.info
Im Weltkriege - booksnow.scholarsportal.info
Im Weltkriege - booksnow.scholarsportal.info
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1:100co•CO1 1.'-';'ft
z c r n 1 nIMWELTKRIEGE
Ottokar CzerninIMWELTKRIEGEZweite Auflage19 19Verlegt bei Ullstein 'S) Co, Berlin und Wien
Alle Rechte einschließlidi des Rechts derÜbersetzung sind dem Verlage Ullstein Co, Berlin vorbehalten.Copyright 191 9 by Albert Bonnier, Stockholm.!*\
Österreich-Ungarns Zerfall unabänderlich 38— 42. VInhaltVorwortI. Einleitende Betrachtungen3—42Die europä-'sche Spannung 5—6. Frankreich und Englandwollten 1914 den Krieg nicht 6. Die moralische Koalitiongegen Deutschland 7—8. Das wahnsimrge Rüstungsfieber8— 9. Czernins letzte Unterredung mit Franz Ferdinand 10.Die Katastrophe 11. Berchtold und das Ultimatum anSerbien 11— 12. Eine Depesche Lichnowskys (Greys Vermittlungsversuch)13. Telegramm König Georgs an denPrinzen Heinrich 14— 15. Der englische Vorschlag bedingtangenommen 15. Der Krieg durch Rußland entfesselt 15.Tisza gegen das scharfe Ultimatum 15— 16. Die eigenenDemarchen des Herrn von Tschirschky 16— 17. Er, nichtBethmann, für Hineinziehung Österreich-Ungarns in diesenKrieg 17. Audienz Czernins beim Kaiser in Ischl 18.Rumänien und Italien vor vollendete Tatsachen gestellt18— 19. Unser größtes Unglück: der deutsche Einmarschin Belgien 20. Am 4. August abends die Entscheidung überEnglands Neutralität bei Deutschland 21. Der erste verhängnisvolleSieg der deutschen Militärs 21»Bismarcks Erbeein Fluch für Deutschland 21—23. Kaiser Wilhelm Gefangenerseiner Gener. le 24. Die Entente niemals für einenVerständigungsfrieden 25—26. Der Londoner Pakt vom26. April 191 5 26— 27. Österreich-Ungarns militärische Inferiorität28. Ein Separatfriede Österreichs der Krieg mitDeutschland 2(5— 35. Die Politik Stephan Ti-zas 35—37.
InhaltII.Konopischt43—66Franz Ferdinands unausgeglichene Natur 45.Der Park vonKonopischt 46. Mangel an Sprachtalent 46. Verbitterung47—49. Antipathie gegen alles Ungarische 49— 50. GegenKriecher und Schmeichler 51. Franz Ferdinand und Aehrenthal52— 53. Das großösterreichische Programm 54. Erkaltungder Beziehungen zu Franz Joseph 54— 55. Annäherungan Kaiser Wilhelm 55. Der Thronfolger keinKriegshetzer 56— 57. Die Herzogin von Hohenberg 57— 58.Persönliche Furchtlosigkeit $3—59. Seine großen Eigenschaften60. Der alte Kaiser 60—62. Franz FerdinandsEnde 62—63. Die geplante Umgestaltung der Monarchie63—65. Heer und Flotte 65. Drei-Kaiser-Bündnis gegendie Revolution 65. Mehr Gönner als Gegner der Serben 65—66.Kein engerer Anschluß an Deutschland 66.III.Wilhelm II.67—99Das Gottesgnadentum 69 — 72. Die Kaiser krise von 190872—73. Wilhelm II. und Czernin 1917 und 1918 75. KaiserKarls Glaube an seine Popularität 75— 78. Byzantinismus 79.Kaiser Karl und Conrad 80. Die Wiederernennung JosephFerdinands 80—81. Kaiser Wilhelm bei der Kieler Woche 82.Sein Naturell 83—85. Tragik seines Lebens 86—88. Haltungvor dem Weltkrieg 88 — 90. Bei Kriegsausbruch 91. InKreuznach 92. Zweifel am Ausgang des Kriegs 92. Schwankungenin den Kriegszielen 93. Der deutsche Kronprinz 1917Pazifist 94. Besuch Czerninsian der Westfront 95—97. BriefKaiserKarls an den Kronprinzen über territoriale Opfer inElsaß-Lothringen, österreichischen Verzicht auf Galizien,Angliederung Polens an Deutschland 97— 98. Ludendorffüber den pazifisti chcn Kronprinzen, Ludendorffs Wille 99.VI
InhaltIV.RumänienIOI— 147tAls Gesandter in Bukarest Herbst 19 13 103— 105. KönigCarol 106. Das geheime Bündnis ein Fetzen Papier 107.Bratianu 108— 109. Ru näni-che Gesell chaft 110— 114. DerTag von Sarajevo 114. Take Jonescu 114. Plötzlicher Umschwungnach de:n Ultimat im: Österreich ist toll geworden115. Eine Welle des Hasses 116. Der König voller Kummer119— 120. Carmen Sylva 120— 124. Bratianu nie wahrhaftneutral 125— 128 Königin Marie für den Krieg 129— 130.Czernin interniert 130— 131. Zepptlinan.riffe auf Bukarest132— 136. Rückrei e Czernin- durch Rißland 137— 138.Drei Phasen der Bezieh mgen 138— 139. Ungarn soll Konzessionenmachen 139. Tiszas Weigerung 139— 140. ÜberDiplomatie 142— 145. Der russische Rubel 145.V. Der verschärfte U-Bootkrieg149— 180Czernin Minister des Äußern 151— 152.Das Friedensangebotder Zentralmächte 152. Kaiser Wühelm: Die Entente habeihm ins Gesicht geschlagen 152. Tirpitz 152. Der rücksichtsloseU-Bootkrieg 152. Bethmann über den eisernen Druckder Militärs 153. Warnungen Czernins und des Prinzen Hohenlohe155— 161. Zimmermann und Admiral Holtzendorff inWien 161. Holtzendorff: Er garantiere den Erfolg 163. NochApril 191 8 posierter Optimismus der deutschen Führer 168bia 169. Hindenbur^ und Ludendorff 169— 170. Ludendorff:Die Dynastie könne einen Verzichtfrieden nicht überleben 171.Schriftwech el Czernin i mit Ti za 172— 178. Deutschlandverkennt die Situation, Bau weiterer U-Boote im Krieg eingeschränkt178.VII
InhaltVI.Friedensversuche181— 252Österreich-Unearns auswärtige Politik 183— 184. IngerenzUngarns 184— 185. Tisza 185—187. Ein Brief Tiszas 188— 190.Februar 1917: Friedensfühler des zarischen Rußland 192— 193.Ausbruch der russischen Revolution 193— 194. Befürchtungenan der Themse 194— 197. April 191 7: Czernins Bericht anKaiser Karl über Erschöpfung Österreichs, dumpfes Grollender Massen, Eingreifen Amerikas, Notwendigkeit des Friedens198—204. Antwort des Reichskanzlers Bethmann 204bis 210.Czernin sucht Verbindung mit dem Deutschen Reichstag211.Erzberger und Südekum2i2. Friedensresolution desReichstags vom 19. Juli 1917 213. Bethmann ihr Opfer 213.Michaelis: ,,so wie ich sie auffasse" 213. Michaelis schreibtan Czernin, fordert, Belgien, Kurland, Litauen, Polen in nahenwirtschaftlich-militärischen Zusammenhang mit Deutschlandzu bringen, Longwy und Briey für Deutschland wirtschaftlichnutzbar zu machen 213—218. Forderungen der deutschenObersten Heeresleitung: militärische Kontrolle Belgiens biszu Schutz- und Trutzbündnis mit Deutschland, Lüttich undflandrische Küste 217. Czernin: Belgien ein schweres Friedenshindernis219 Indiskretionen und Einmischungen 220.Paris und London glauben an Zerfall des Vierbunds 220—221.Abnahme des Friedenswunsches bei der Entente 223. DasKokettieren mit dem Separatfrieden 224 Englands Furchtvor dem deut den Militarismus 226—228. Die Sozialistenkonferenzin Stockholm 228—231. Das Scheitern der Friedensbestrebuncien231—236. Czernin in Budapest über Weltabrüstung236—242. Das Fiasko des U-Bootkriegs 242— 243.Österreich und das Londoner Diktat 244. England undDeutschland 244—246. Der tote Punkt 246. IrreführendeDoppelpolitik hinter dem Rücken der verantwortlichenMänner 2; 7. Clemenceau für Deutschlands Vernichtung 249.Intransi_;enz der Entente 249—252.VIII
InhaltVII. Wilson253—263Herbst 1917: Wilsons 14 Punkt« 256— 257. Das nationaleWeltproblem 257—260. Der Präsident über Czernins Politik261—262. Verständigungsversuche durch Czernins Demissionunterbrochen 262.VIII.Eindrücke und Betrachtungen265—270Die Niederlage der Sieger 267—268. Europas Selbstzerfl«ischung19 17 268. Hertling 270.IX. Polen271—287Tisza gegen die austropolnische Lösung 273—278.Deutschlandverlangt Räumung des von Österreich besetzten Teiles278— 279. Die polnische Taktik 279—280. Die deutschenGrenzberichtigungswünsche, Ludendorffs Widerstand 282.Statt Polens Rumänien 282—283. Czernin und die Polen284—285. Mitteleuropa 285—287.X. Brest-Litowsk289—347Kerenskis Offensive und die russischen Parteien 291— 296.Die Bolschewiki 298. Reise nach Brest-Litowsk 301— 302.General Hoffmann 302. Joffe, Kamenew, Frau Bizenko 303bis 305. Kühlmann 305— 306. Der annexionslose Friede 306.Drohungen der Bulgaren 307— 308.Die Deutschen fürchten,die Entente könne auf den allgemeinen Frieden eingehen 308.Hoffmann über die Randprovinzen 309. Wütende TelegrammeHindenburgs über den „Verzicht" auf alles, stündlicheIX
InhaltTelephonate Ludendorffs 3.1 1. Russischer Widerspruch undProteststreik 313. Die Ukrainer 315. Ankunft Trotzkis 316.Czernin fordert bei Abbruch der Deutschen mit den Russenfür sich freie Hand 318. Trotzki nimmt Ultimatum an 318bis 319. Hoffmann will den Russen „noch eine ordentlicheauf den Kopf schlagen" 319. Seine unglückliche Rede 322.Hungerkatastrophe in Österreich 322— 331. Trotzki rechnetauf Weltrevolution 331. Czernin in Berlin, Hertling undLudendorff 334. Telegramm Kaiser Wilhelms verlangt Livlandund Estland 336. Der Friede mit der Ukraine 336— 337.Der Brotfriede 338— 347.XI. Der Friede von Bukarest349—366Rumänien und Ungarn 351— 354.Botschaft des Kaisers Karlan den König Ferdinand 354— 355. Österreichs Parität, Kühlmanndurch Czernin von vollzogenem Faktum verständigt 355.Ohne den König nur illegitimer Friede mit Rumänien 356.Das Ministerium Averescu 357— 358. Unterredung Czerninsmit König Ferdinand 35c;— 361. Die Dobrudscha-Frage 360.Marghilomann 361. Zwangslage Czernins gegenüber denungarischen Grenzforderungen 361. Die wirtschaftlichenForderungen Deutschlands 362. Deutschland will Okkupationnoch fünf bis sechs Jahre nach allgemeinem Frieden 363. Derbulgarisch-türkische Konflikt 363— 366.XII.Schlußbetrachtung367—373Der Versailler Viererrat 369— 370. Ein Diktatfriede furchtbarsterArt 371. Die Weltgefahr des Bolschewismus 371.Andere Generationen werden erstehen 372— 373.X
InhaltAnhang375—418I. Die Beschlüsse der Londoner Konferenz vom 26. AprilII.1915 377—38o.Note des Grafen Czernin an die amerikanische Regierungvom 5. März 1917 381— 388.III. Staatssekretär Helfferich über den U-Bootkrieg 388— 395.IV. Rede des Grafen Czernin in der österreichischen Delegationam 24. Januar 191 8 395—407.V. Protokoll über die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk 407—413.VI. Protokoll über die Friedensverhandlungen in Bukarest413—417.VII. Die 14 Punkte Wilsons 417—418.Namen- und Sachregister419—428
EsVorwortist unmöglich, in einem kleinen Buche die Geschichtedes <strong>Weltkriege</strong>s nur halbwegs erschöpfend zu schreiben.Das ist auch nicht der Zweck des Buches.Sein Zweck ist vielmehr, einzelne Ereignisse und einzelnePersönlichkeiten, die ich aus größerer Nähe und daher deutlichersehen konnte als die Allgemeinheit, zu schildern —einzelne Momentphotographien des großen Dramas zu liefern.Aus den einzelnen hier entwickelten Bildern wird sich dennochein Ganzes ergeben, das vielleicht in manchem von derbisher bekannten, noch so lückenhaften Kriegsgeschichteabweicht.Ein jeder Mensch sieht die Menschen und die Ereignisseunter seinem persönlichen Gesichtswinkel. Das ist unvermeidlich.Ich spreche in meinem Buche von Männern, die mirnahegestanden sind, von anderen, die meinen Weg gekreuzthaben, ohne irgendein persönliches Gefühl bei mir zu hinterlassen,und schließlich von Männern, mit welchen ich schwereKonflikte gehabt habe. Ich versuche, über alle objektiv zuurteilen.Ich schildere die Menschen und die Dinge, wie ichsie gesehen habe — wo die Schilderung falsch erscheint, liegtder Grund nicht in vorgefaßter Meinung, sondern in vielleichtvorhandenem Mangel an Beurteilungsfälligkeit.Nicht alles wollte gesagt werden.So manches wurde nichterklärt, obwohl es sich erklären ließe. Noch ist die Zeit,welche uns von den Ereignissen trennt, zu kurz, um denSchleier von allen Vorgängen zu ziehen.Aber das Verschwiegene ändert nichts an dem Totalbilde,welches ich so schildere, wie es sich in meinem Kopfe spiegelt.O. Cz.
I.Einleitende Betrachtungeni m
,BevorI.sich ein Gewitter unter Blitz und Donner entladet,spielen sich ganz bestimmte Vorgänge in der Atmosphäreab. Die Elektrizitäten scheiden sich, und das Gewitter istdas Resultat einer gewissen, nicht mehr haltbaren atmosphärischenSpannung ; ob wir diese Vorgänge an äußeren Zeichenerkennen können oder nicht, ob uns die Wolken mehr oderweniger drohend erscheinen, ändert nichts an dem Faktum,daß die elektrische Spannung bestehen muß, bevor dasGewitterausbricht.In den Palästen derAuswärtigen Ämter stand das politischeBarometer seit Jahren auf Sturm. Es stieg zeitweise,um neuerlich zu fallen, es schwankte — selbstverständlich —aber seit Jahren deutete alles darauf hin, daß der Weltfriedegefährdet sei.Die sichtbaren Anfänge dieser europäischen Spannungreichen Jahre zurück — bis auf die Zeit Eduards VII. Aufder einen Seite die Furcht Englands vor dem gigantisch anwachsendenDeutschland, auf der anderen Seite die BerlinerPolitik,welche der Schrecken an der Themse geworden war,der Glaube, daß in Berlin der Gedanke Wurzel fasse, die Weltherrschaftan sich reißen zu wollen, diese Befürchtungen, dienur zum Teil aus Neid und Mißgunst, zum Teil aber auchaus wirklichen, überzeugten Besorgnissen um die eigeneExistenz entsprangen — diese Befürchtungen führten zurEinkreisungspolitik Eduards VII., und mit ihr begann dasgroße Kesseltreiben gegen Deutschland. Es ist bekannt, daßEduard VII. den Versuch unternommen hat, durch direkte
Einleitende BetrachtungenEinwirkung auf Kaiser Franz Joseph denselben von demBündnisse abzuwenden und sich den Deutschland einkreisendenMächten anzuschließen. Es ist ferner bekannt, daßKaiser Franz Joseph diesen Gedanken von sich wies, unddieser Augenblick war Österreich-Ungarns Schicksalswende.Von diesem Augenblicke an waren wir nicht mehr die selbständigenHerren unseres Schicksals. Unser Schicksal waran das Deutschlands gebunden, wir wurden durch das Bündnisvon Deutschland, ohne daß wir es wußten, fortgeschleppt.Ich will dabei absolut nicht bestreiten, daß Deutschlanddie letzten Jahre vor dem Kriege noch immer die Möglichkeitgehabt hätte, denselben abzuwenden, wenn es in europäischerÖffentlichkeit den Verdacht nach Weltherrschaftsträumenzerstört hätte. Denn ich bin weit davon entfernt,behaupten zu wollen, daß die Westmächte diesen Krieg gernunternommen hätten, sondern ich betone meine feste Überzeugung,daß die maßgebenden Faktoren der Westmächteihrerseits die Situation so auffaßten, daß, wenn es ihnen nichtgelinge, Deutschland zu schlagen, eine deutsche Weltherrschaftunaufhaltsam sein werde.Ich sage: der Westmächte,da ich glaube, daß eine starke Militärpartei in Rußland,welche ihr Haupt in dem Großfürsten Nikolaus Nikolajewitschhatte,anders dachte und diesen Krieg mit Genugtuung begann.Die furchtbare Tragik in diesem größten Unglückealler Zeiten — und das ist dieser Krieg — liegt darin, daß erals Angriff im Grunde von niemand Verantwortlichemgewollt war und daraus entstand, daß serbische Mörder undsodann kriegslustige russische Generale eine Situation schufen,in welcher die Monarchen und Staatsmänner der Großmächtedurch die Ereignisse überrumpelt wurden. Man muß allerdingsinnerhalb der feindlichen Staaten einen diesbezüglichensehr bedeutenden Unterschied machen.Frankreich und Englandwollten im Jahre Vierzehn keinen Krieg. Frankreichhat die Revancheidee immer wacherhalten,hatte aber allenAnzeichen nach im Jahre Vierzehn gar nicht die Absicht,
Einleitende Betrachtuneenloszuschlagen, sondern überließ damals, wie seit fünfzigJahren, den Augenblick, wann es Krieg machen solle, derZukunft. Der Krieg kam ihm ganz überraschend. Englandwollte trotz seiner antideutschen Politik neutral bleibenund ward erst durch den Einfall in Belgien anderen Sinnes.In Rußland war ein Zar, der nicht wußte, was er wollte,und nicht konnte, was er wollte, und eine Kriegspartei,die unbedingt zum Kriege trieb. Rußland begann tatsächlichden Krieg ohne Kriegserklärung. Die nachfolgendenStaaten, Italien und Rumänien, traten aus Eroberungsabsichtenin den Krieg ein. Insbesondere Rumänien.Italien natürlich auch, aber Italien war durch seine geographischeLage exponierter und dem Drucke Englandsmehr ausgesetzt — es konnte schwerer als Rumänienneutral bleiben.Aber der Weltkrieg wäre niemals ausgebrochen, wennnicht das wachsende Mißtrauen der Entente in DeutschlandsPläne die Situation bereits zum Siedepunkt erhitzt gehabthätte. Die Art und Weise Deutschlands, sich zu geben, dieReden Kaiser Wilhelms, das Auftreten der Preußen in derWelt, das fortwährende Auf-die-eigene-Kraft-Pochen und Mitdem-Säbel-Rasselnerweckte auf der ganzen Welt ein Gefühlvon Antipathien und Besorgnissen und bewirkte jene moralischeKoalition gegen Deutschland, welche in diesem Kriegeeinen so furchtbaren praktischen Ausdruck gefunden hat. Aufder anderen Seite bin ich fest überzeugt, daß die deutschen,oder bessergesagt, preußischen Tendenzen in der Welt mißverstandenwurden und daß die maßgebenden deutschenFaktoren niemals die Absicht auf eine Weltherrschaft hatten.Sie wollten ihren Platz an der Sonne behaupten, siewolltenunter den ersten Mächten der Welt segeln; dies war ihr Recht,aber diesewirklichen und angeblichen fortwährenden deutschenProvokationen und diese hierdurch ausgelösten, sichstetig steigernden Befürchtungen der Entente schufeneben jene verhängnisvolle Rüstungskonkurrenz und jene7
Einleitende BetrachtungenKoalitionspolitik, welche sich in dem Kriege wie ein furchtbaresGewitter entladen hat.Nur auf dem Boden dieser europäischen Besorgnissekonnte der französische Revanchegedanke sich zur Tat entwickeln.Niemals hätte England, nur um Elsaß-Lothringenzu erobern, das Schwert gezogen — aber in die von KönigEduard inaugurierte Politik, welche nicht französischen,sondern englischen Motiven entsprang, fügte sich der französischeRevanchegedanke ausgezeichnet ein.Aus dieser Furcht vor Angriff und Verteidigung entsprangjenes wahnsinnige Rüstungsfieber, welches das Charakteristikonder vorkriegerischen Zeit war. Das Wettrennen,mehr Soldaten und mehr Kanonen zu haben als der Nachbar,mußte sich ad absurdum führen. Die Rüstung, welche dieVölker trugen, war so schwer geworden, daß sie nicht mehrtragbar war, und es war wohl schon jedermann seit langemklar, daß der eingeschlagene Weg nicht fortgesetzt werdenkonnte, daß es nur zwei Möglichkeiten gab: entweder diefreiwillige allgemeine Abrüstung oder den Krieg.Ein leiser Versuch zu ersterer ist im Jahre 1912 in den Verhandlungenzu einer Flottenabrüstung zwischen Deutschlandund England gemacht worden ; er kam nicht über den erstenAnfang hinaus und scheiterte nicht an einseitiger Schuld.England war nicht friedfertiger und nicht entgegenkommenderalsDeutschland, es war nur geschickter, und es gelang ihm,der Welt die Überzeugung zu suggerieren, daß es die durch diedeutschen Expansionspläne bedrohte Macht sei.Ich erinnere mich einer sehr treffenden Beschreibung,welche ich von einem hervorragenden Politiker eines neutralenStaates gehört habe. Der Herr fuhr auf einem amerikanischenDampfer herüber, und in der Reisegesellschaftbefanden sich unter anderen ein prominenter deutscher Großindustriellerund ein Engländer. Der Deutsche sprach gern undviel und erzählte mit Vorliebe vor einem möglichst großenAuditorium von „dem Aufschwünge Deutschlands, von dem
Einleitende Betrachtungenunaufhaltsamen Expansionsdrange des deutschen Volkes,von der Notwendigkeit, die Welt mit deutscher Kultur zudurchdringen" und von den ,, Fortschritten in allen diesenBestrebungen". Er schilderte den Aufschwung des deutschenHandels in den verschiedenen Weltteilen, er nannte die Orte,wo heute die deutsche Flagge weht, er betonte, daß das „Madein Germany" das Wort sei, welches die Welt erobern müsseund erobern werde, und unterließ nicht, zu betonen, daßdiese ganzen großzügigen Projekte auf festem Grund gebautseien, denn sie seien militärisch „untermauert". Das wardeutsch. Und als mein Gewährsmann den still dabeisitzenden,lächelnden Engländer fragte, was denn er zu diesen Ausführungensage, da antwortete er: ,,Es ist nicht notwendig zusprechen, ich weiß doch, daß die Welt uns gehört." Das war englisch.Es ist nur ein Stimmungsbild, eine Momentphotographie,wie sich die deutsche und die englische Psyche in dem Kopfeeines neutralen Staatsmannes gespiegelt hat. Aber sie ist symptomatisch,weil Tausende den gleichen Eindruck gehabt haben,und weil dieser Eindruck eines aggressiven germanischenGeistes so unendlich viel zu der Katastrophe beigetragen hat.Die Aehrenthalsche Politik, welche im Gegensatze zu dem,was wir bisher am Ballplatze zu sehen gewohnt waren, mitgroßer Kraft und Energie expansive Tendenzen verfolgte,verstärkte noch das Mißtrauen der Welt gegen uns. Dennder Gedanke rang sich durch, daß die Wiener Politik ein Ablegerder Berliner sei,daß man in Wien jetzt ebenso wie inBerlin vorzugehen gedenke, und die allgemeine Besorgnisstieg. <strong>Im</strong>mer schwärzer wurden die Wolken, immer dichterzogen sich die Maschen des Netzes zusammen — das Unglückwar auf dem Wege.Weit zurück reichen die Ursachen des <strong>Weltkriege</strong>s. Derletzte Anlaß verschwindet neben denselben. Wir machen heutewieder Ähnliches durch. Die französischen Frieden werden dieUrsachen neuer Kriege bilden, mag der letzte Anstoß dannwelcher auch immer sein.
Einleitende BetrachtungenKurz vor Kriegsausbruch war ich inKonstantinopel undhatte mit unserem dortigen Botschafter, dem klugen undklarblickenden Markgrafen Pallavicini, eine lange Unterredungüber die politische Situation. Er faßte die Lage ungemeinernst auf. Mit der Erfahrung, die ihm eine j ahrzehntelangeBeobachtung der Politik gegeben hatte, fühlte er Europaden Puls, und seine Diagnose lautete dahin, daß wir, wennnicht eine rasche Änderung des ganzen Kurses erfolge, demKriege zusteuern. Er entwickelte, er sähe die einzige Möglichkeit,einem Kriege mit Rußland auszuweichen, darin, daßwir definitiv auf unseren Einfluß auf dem Balkan verzichtetenund Rußland das Feld räumten. Pallavicini war sich vollständigklar darüber, daß ein solcher Entschluß unsere Abdankungals Großmacht bedeuten würde, aber es schien mir,daß er selbst diese harte Eventualität dem Kriege, den erkommen sah, vorzog. Ich habe dieses Gespräch bald daraufdem Erzherzog-Thronfolger Franz Ferdinand erzählt und fandihn sehr impressioniert über diese pessimistische AuffassungPallavicinis, von welchem er, wie alle, die ihn näher kannten,eine äußerst hohe Meinung hatte. Der Thronfolger erklärte,sobald alsmöglich mit dem Kaiser die Frage besprechen zuwollen. Ich habe ihn nie mehr wieder gesehen. Es war dieletzte Unterredung, die ich mit ihm hatte, und ich weiß auchnicht, ob er sein Projekt, die Frage mit dem Monarchen zubesprechen,noch durchgeführt hat.Die zwei Balkankriege waren das Wetterleuchten desheraufziehenden europäischen Gewitters. Für jeden Kennerder Balkanverhältnisse war es klar, daß die dortigen Friedenkein definitives Resultat geschaffen hatten, und der inRumänien so enthusiastisch bejubelte Bukarester Friede desJahres 1913 trug den Keim seines Todes bereits bei der Geburtin sich. Bulgarien gedemütigt und verkleinert, Rumänienund vor allem Serbien unverhältnismäßig vergrößert,10
Einleitende Betrachtungenvon einem Übermut, der jeder Beschreibung spottet, Albanienals Zankapfel zwischen Österreich-Ungarn und Italien —das war ein Bild,das keine Entspannung, sondern nur neueMan muß am Balkan gelebt haben, um denKriege verhieß.maßlosen Haß zu begreifen, welcher zwischen den einzelnenVölkern herrschte. Als sich dieser Haß im <strong>Weltkriege</strong> entlud,zeitigte er die fürchterlichsten Szenen, und es ist beispielsweisenotorisch, daß gefangene Bulgaren von den Rumänenmit den Zähnen zerfleischt wurden, und daß Bulgarenihrerseits die gefangenen Rumänen auf die schrecklichsteWeise zu Tode marterten.Mit welcher Brutalität die Serbenin dem Kriege vorgingen, das wissen unsere Truppen besserzu schildern als alle anderen.Kaiser Franz Joseph hat vollkommenklar vorausgesehen, daß der Friede nach demzweiten Balkankriege nichts anderes sei als ein Atemholen zuneuen Kriegen. Als ich vor meinem Abgange nach Bukarestim Jahre Dreizehn in Audienz bei dem greisen Kaiser erschien,sagte er mir: „Der Bukarester Friede ist unhaltbar, und wirgehen einem neuen Kriege entgegen. Gebe nur Gott, daß eram Balkan lokalisiert bleibt!" Das fast um das Doppeltevergrößerte Serbien war weit davon entfernt, saturiert zu sein,sondern hatte im Gegenteil mehr denn je die Ambition,Großmacht zu werden. Noch war die Situation anscheinendruhig. Es trat im Gegenteil einige Wochen vor der Katastrophein Sarajevo ein Zustand ein, den man fast als eineBesserung des Verhältnisses zwischen Wien und Belgrad bezeichnenkönnte. Aber es war die Ruhe vor dem Sturm. Am28. Juni zerriß der Schleier, und von einem Moment zumanderen stand drohend die Katastrophe vor der Welt. DerStein war ins Rollen gekommen.Ich war zu jener Zeit bereits Gesandter in Rumänien undhabe daher die Wiener und Berliner Ereignisse nur aus derFerne beobachten können. Aber ich habe doch nachher mitzahlreichen maßgebenden Persönlichkeiten über die Vorgängein den kritischen Tagen gesprochen und mir aus alledem,11
Einleitende Betrachtungenwas ich gehört habe, ein bestimmtes und klares Bild über dieVorgänge machen können. Für mich unterliegt es gar keinemZweifel, daß Berchtold an einen Weltkrieg von der Dimension,in der er ausgebrochen ist, niemals auch nur im Schlafe gedachthat, daß er vor allem überzeugt war, daß England neutralbleiben werde, und daß er durch den BotschafterTschirschky in der Überzeugung bestärkt wurde, daß einKrieg gegen Frankreich und Rußland unbedingt siegreichenden werde. Ich glaube, daß die SeelenVerfassung, inwelcher Graf Berchtold das Ultimatum an Serbien gerichtethat, die war, daß er sich sagte, entweder nimmt Serbien dasUltimatum an, und dann bedeutet das einen großen diplomatischenErfolg — oder es lehnt dasselbe ab, und dann wirddank der Hilfe Deutschlands der siegreiche Krieg gegen Rußlandund Frankreich die Wiedergeburt einer neuen und unvergleichlichstärkeren Monarchie bewirken. Daß diese Argumentationeine Kette von Fehlern war, soll keinen Augenblickbestritten werden, aber es soll nur konstatiert werden, daßmeiner Überzeugung nach Graf Berchtold selbst durch dasUltimatum nicht den Krieg wollte, sondern bis zum letztenAugenblicke hoffte, den Sieg mit der Feder davonzutragen —daß er aber in den deutschen Zusicherungen die Rückversicherungauch gegen einen Krieg erblickte, dessen Teilnehmerund Siegeschancen ebenfalls wieder ganz falsch eingeschätztwurden. Hinter Berchtold standen andere, die andersdachten und ihn vorschoben. Dadurch war seine Haltungkeine einheitliche.*Einen Zweifel darüber, daß ein serbischer Krieg den russischennach sich ziehen werde, dürfte Berchtold nicht gehabthaben.Wenigstens haben die Berichte meines Bruders ausPetersburg ihm keinen Zweifel darüber gelassen.Serbien nahm das Ultimatum nur unvollständig an,der serbische Krieg brach aus.undRußland griff bewaffnet ein.• Die während des Drucks veröSentüchten Protokolle aus dem Staatsamte des Äußerngeben wohl kein gani unparteiisches Bild dieser Phase.12
umleitende BetrachtungenIn diesem Augenblicke aber ereigneten sich ungemein wichtigeVorfälle. Am 30. Juli mittags sprach Tschirschky im Ministeriumdes Äußern vor und teilte auftragsgemäß Berchtoldden Inhalt eines von Lichnowsky eingetroffenen Telegrammesmit. Dieses wichtige Telegramm enthielt folgendes : Er — Lichnowsky— käme soeben von Grey. Derselbe sei sehr ernst,aber vollkommen ruhig, betone jedoch, daß die Lage sichimmer mehr kompliziere. Sasonow habe erklärt, daß er nachder erfolgten Kriegserklärung nicht mehr in der Lage sei,direkt mit Österreich-Ungarn zu verhandeln, und Englandersucht, die Vermittlung wieder aufzunehmen. Voraussetzungsei die vorläufige Einstellung der Feindseligkeiten.Grey proponiere eine Vermittlung zu vier. Ihm — Grey —schiene es möglich, daß Österreich-Ungarn nach BesetzungBelgrads seine Bedingungen kundgebe. Grey fügte privathinzu, er mache Lichnowsky aufmerksam, daß ein Kriegzwischen Rußland und Österreich-Ungarn Englands Neutralitätermöglichen würde, daß die Lage sich jedoch ändernmüßte, falls Deutschland und Frankreich hineingezogenwürden. Auch die öffentliche Meinung Englands, welche nachdem Morde für Österreich sehr günstig gewesen sei, beginnezu schwenken, da man Österreichs Hartnäckigkeit nicht verstehe.Lichnowsky fügte bei, daß Grey dem italienischen Botschaftergesagt habe, er glaube, daß Österreich bei der Annahmeder Vermittlung jede Genugtuung verschafft werdenwürde.Die Serben würden auf alle Fälle gezüchtigt werden.Österreich könne auch ohne Krieg Bürgschaften für dieZukunft erlangen.Dies der Inhalt der von Tschirschky übermitteltenMeldung aus London. Bethmann fügte dem bei,daß er dem Wiener Kabinett dringendst anheimstelle, dieVermittlung anzunehmen.Berchtold nahm den Inhalt zur Kenntnis und begab sichmit dieser Nachricht zum Kaiser. Seine Lage war die, daßRußland bereits im Kriege mit der Monarchie war, am Abenddesselben Tages dem Kaiser die Order für die allgemeine13
Einleitende BetrachtungenMobilisierung unterbreitet werden sollte und esihm zweifelhaftzu sein schien, ob ein Aufschub der eigenen Mobilmachungin Anbetracht des russischen Überfalles noch mög-Ich sei. Er mußte dabei berücksichtigen, daß in Rußlandverschiedene Strömungen herrschten und keine Garantie vorhandenwar, daß diejenige, welche die Vermittlung wünschte,siegen werde. Eine Verschiebung der Mobilisierung konntein diesem Falle unberechenbare militärische Konsequenzenhaben. Die Feindseligkeiten hatten offenbar ohne Wissenund Willen des Zaren begonnen; wenn sie nun auch gegenseinen Willen fortgeführt würden, so kam Österreich-Ungarnzu spät.Ich habe niemals mit Berchtold über diese Phase gesprochen,aber das mir zur Verfügung stehende Material läßt keinenZweifel, daß er sich wohl verpflichtet fühlte, auch diese Seiteder Frage zu beleuchten und dem Kaiser Franz Josephsodann dieEntscheidung zu überlassen.Am 31. Juli, also tags darauf, teilte Tschirschky am Ballplatzeden Inhalt eines Telegrammes König Georgs an denPrinzen Heinrich von Preußen mit.Dasselbe lautete*:"Thanks for telegram. So pleased to hear of William'sefforts to concert with Nicky to maintain peace. IndeedI am earnestly desirous that such an irreparable disasteras an european war should be averted. My government isdoing its utmost, suggesting to Russia and France to suspendfurther military preparations, if Austria will consent to besatisfied with occupation of Beigrade and the neighbouringServian territory as a hostage for satisfactory settlement• .,Ich danke für das Telegramm. Ich bin sehr erfreut, von Wilhelm zu hören, daß etsich bemüht, mit Nikolaus den Frieden zu erhalten. Es ist wünschenswert, daß solch ein unvorhergesehenesGeschehnis keinen Krieg in Europa verursachen würde. Meine Regierung übtden äußersten Einfluß aus, Rußland und Frankreich zurückzuhalten, keine weiteren militärischenVorbereitungen zu machen, wenn Österreich sich mit der Okkupation von Belgrad unddem serbischen Nachbarterritorium zufriedengibt. Um genügend Satisfaktion zu gewähren,werden die übrigen Völker inzwischen ihre Kriegsvorbereitungen ebenfalls einstellen müssen.Ich hoffe, daß Wilhelm diesem Vorschlag zustimmt, um zu beweisen, daß Deutschland undEngland zusammenarbeiten, um eine internationale Katastrophe zu verhindern. Bitte, versichereWilhelm, daß ich mich bemühe und dabei verbleiben werde, mit allen Kräften das zu tun,was in meiner Macht liegt, um den Frieden in Europa zu garantieren. Georg."14
Einleitende Betrachtungenof her demands, other countries meanwhile suspending theirwar preparations. Trust William will use his great influenceto induce Austria to accept his propose thus proving thatGermany and England are working together to preventwhat would be an international catastrophe. Pray assureWilham I am doing and shall continue to do all that lies inmy power to preserve peace of Europe. George."Die beiden zitierten Vorschläge wurden am 31. Juli in Wien,aber unter Voraussetzung gewisser militärischer Kautelenangenommen, eine bedingte Annahme, welche in Londonnicht genügte. Und nunm.hr überstürzten sich die Ereignisse.An der Themse wie in Berlin wollte man den KonfliktSerbien lokalisieren, ebenso Berchtold.aufIn Rußland war einemächtige Partei an der Arbeit, um den Krieg um jeden Preiszu erzwingen. Der russische Einfall schuf ein Faktum, undin Wien wagte man im letzten Augenblick nicht mehr, dieMobilisierung einzustellen, aus Furcht, in der Abwehr zu spätzu kommen. Die Botschafter sprachen teilweise nicht so, wieihre Regierungen es wollten; sie überbrachten korrekt dieAufträge, aber ihre hiervon abweichende persönliche Meinungblieb kein Geheimnis und fiel ins Gewicht. Das erhöhte dieUnsicherheit und Unklarheit. Berchtold schwankte, hin undher gerissen von den verschiedenen Einflüssen. Es handeltesich aber nur um Stunden. Diese gingen ungenützt vorüber,und das Unheil brach herein.Rußland hatte eine Zwangslage geschaffen und damit denWeltkrieg entfesselt.Ich habe mehrere Monate nach dem Kriegsausbruch einelange Unterredung mit dem ungarischen MinisterpräsidentenGrafen Stephan Tisza über alle diese Fragen gehabt. Erselbst, Tisza, war entschieden gegen das scharfe Ultimatumgewesen, weil er einen Krieg voraussah und denselben nichtwollte. Es ist einer der verbreitetsten Irrtümer, wenn Tiszaheute als einer der „Kriegshetzer" bezeichnet wird. Er war15
Einleitende Betrachtungengegen den Krieg, nicht aus allgemein pazifistischen Tendenzen,sondern deshalb, weil er der Meinung war, eine kluggeführte Bündnispolitik könne dieKräfte der Monarchie ineinigen Jahren bedeutend verstärken. Insbesondere kam erimmer wieder auf Bulgarien zu sprechen, welches ja damalsnoch neutral war und welches er hätte gewinnen wollen,bevor ein Krieg begann. Von Tisza habe ich auch verschiedeneDetails über die Tätigkeit der deutschen Regierungrespektive die des deutschen Botschafters in der letzten Zeitvor dem Kriege gehört.Ich unterscheide absichtlich zwischendeutscher Regierung und deutscher Botschaft, weil ich denEindruck habe, daß Herr von Tschirschky verschiedeneDemarchen unternommen hat, ohne hierfür beauftragt wordenzu sein, und wenn ich früher gesagt habe, nicht alle Botschaftersprachen, wie ihre Regierungen wollten, so meinteich damit Herrn von Tschirschky, dessen ganzem Wesen undTemperament es entsprach, mit einer gewissen Vehemenzund nicht immer in der taktvollsten Weise in unsere Angelegenheitenhineinzusprechen und die Monarchie ,,aus demSchlafe zu rütteln".Es ist gar kein Zweifel, daß die ganzen privaten Redendes Herrn von Tschirschky zu dieser Zeit auf den Tenor gestimmtwaren: „Jetzt oder nie!" Und es ist sicher, daß derdeutsche Botschafter seine Meinung dahin erklärte, ,,imjetzigen Augenblicke sei Deutschland bereit, unseren Standpunktmit aller moralischen und militärischen Macht zuunterstützen — ob dies in Zukunft noch der Fall sein werde,wenn wir die serbische Ohrfeige einsteckten, schiene ihmzweifelhaft". Ich glaube, daß speziell Tschirschky von derÜberzeugung durchdrungen war, daß Deutschland in der allernächstenZeit einen Krieg gegen Frankreich und Rußlandwerde durchkämpfen müssen, und daß er das Jahr 1914hierfür für günstiger hielt als eine spätere Zeit, und zwar deshalb,weil er erstens weder an die Schlagfertigkeit Rußlandsund- Frankreichs glaubte, und weil er zweitens — und dies16
Einleitende Betrachtungenist ein sehr wichtiger Punkt — überzeugt war, daß er dieMonarchie jetzt mit in den Krieg hineinziehen könne undwerde, während es ihm zweifelhaft schien,ob der alte friedfertigeKaiser Franz Joseph bei einer anderen Gelegenheit,wo er weniger im Mittelpunkte des Angriffes stehe, fürDeutschland das Schwert ziehen werde. Er wollte also denserbischen Zwischenfall benutzen, um Österreich-Ungarns indem entscheidenden Kampfe sicher zu sein. Das war aberseine Politik und nicht die Bethmanns.Das ist, ich wiederhole es, der Eindruck langer Schilderungen,welche vornehmlich aus dem Munde des GrafenTisza erflossen, aber mir auch von anderer Seite in ähnlicherWeise bestätigt wurden. Ich habe aber die Überzeugung,daß Tschirschky durch die Art und Weise seines Auftretensseinen Wirkungskreis weit überschritten hat. Iswolsky warnicht der einzige seiner Art. Ich schließe dies daraus, daßTschirschky, wie aus der früheren Depesche erhellt,niemalsin der Lage war, eine amtliche Erklärung in einem solchenzum Kriege treibenden Sinne abzugeben, sondern nur so gesprochenzu haben scheint, wie diplomatische Vertretersprechen, wenn sie bestrebt sind, die Politik ihrer Regierungim eigenen Sinne zu ,,korrigieren".Gewiß hat Tschirschky korrekt und loyal die Aufträgeübermittelt und nichts zurückbehalten oder verheimlicht.Ein Botschafter wird aber, je nachdem mit welcher Energieer sich für die Intentionen seiner Regierung einsetzt, mehroder weniger erreichen. Und die „private" Ansicht des Botschaftersist unter Umständen von seinen „amtlichen" nichtleicht zu trennen.Jedenfalls wird erstere die letztere beeinflussen,und Tschirschkys private Ansicht zielte auf eineschärfereTonart.In völliger Unkenntnis der sich vorbereitenden Ereignissewar ich wenige Tage vor dem Ultimatum in Steiermark eingetroffen,um meine Familie dortselbst für den Sommer zuetablieren. Dort erhielt ich den Auftrag Berchtolds, raschestens2 Czernin <strong>Im</strong> Weltkrise TT
Einleitende Betrachtungenauf meinen Posten zurückzukehren. Ich folgte dieserAufforderung sofort, hatte jedoch vorher noch eine Audienzbei Kaiser Franz Joseph in Ischl. Ich fand den Kaiser sehrgedrückt. Er sprach über die bevorstehenden Ereignisse nurganz kurz und stellte mir bloß die Frage, ob ich im Falle einesKrieges für die Neutralität Rumäniens garantieren könne.Ich erwiderte bejahend, solange König Carol lebe, darüberhinaus sei eine Diagnose unmöglich.3-Gewisse, ungemein wichtige Details der Zeit unmittelbarvor Kriegsausbruch erklären sich nur durch den Einflußjener Gruppe, deren Exponent Tschirschky war. Vor allemistes unverständlich, warum wir unseren damaligen Bundesgenossen,Italien und Rumänien, die Rolle des Abfallensdadurch so erleichtert haben, daß wir sie mit dem Ultimatumvor eine vollendete Tatsache stellten, anstatt sie dafür zugewinnen — sie mit hineinzuverwickeln.Über die römischen Vorgänge habe ich kein genaues Urteil;in Rumänien aber hätte König Carol bestimmt allesversucht, um Serbien zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Daswäre ihm wahrscheinlich nicht gelungen, da Serbien ja nichtdaran dachte, auf seine großserbischen Pläne zu verzichten —aber es wäre voraussichtlich zu einer mindestens getrübtenStimmung zwischen Bukarest und Belgrad gekommen, welcheden Fortgang der rumänischen Politik stark zu unserenGunsten beeinflußt hätte.In Bukarest istaus diesem diplomatischen Vorgehen dasallergrößte Kapital geschlagen worden.Vor dem ersten entscheidenden Kronrate haranguierte deritalienische Gesandte, Baron Fasciotti, alle Teilnehmer indiesem Sinne und erklärte, die Situation Rumäniens undItaliens sei die gleiche und für beide Teile kein Grund zueiner Kooperation, da weder Rom noch Bukarest vorher vonr8
Einleitende Betrachtun »endem Ultimatum verständigt worden seien. Seine Bemühungenhatten Erfolg.Ich habe am 4. August 1914 folgendes Telegramm anBerchtold gesendet:„Soeben teilt mir der Ministerpräsident das Ergebnis desKronrates mit:Nach einem warmen Appell des Königs, den Vertrag insLeben zu setzen, hat der Kronrat mit allen gegen eineStimme erklärt, keine Partei könne die Verantwortungdieser Aktion übernehmen.Der Kronrat hat beschlossen, daß, nachdem Rumänienvon der österreichisch-ungarischen Demarche inBelgrad weder avertiert noch darüber befragtworden sei, der Casus foederis nicht bestünde. DerKronrat beschloß weiter, daß militärische Vorkehrungen zurSicherung der Grenze unternommen werden, worin ein Vorteilfür die österreichisch-ungarische Monarchie bestünde, daihre Grenzen auf mehrere hundert Meilen dadurch gedecktwürden.Ministerpräsident fügte bei, er hätte bereits eine Verstärkungder Stände angeordnet, der demnächst allmählich dieallgemeine Mobilisierung folgen werde.Die Regierung beabsichtigt nur ein kurzes Communiqueüber die zur Sicherung der Grenzen beschlossenen militärischenMaßnahmen zu veröffentlichen."Zweitens scheint es unverständlich, warum das Ultimatumin dieser Form abgefaßt wurde.Diese Form erklärt sich nichtdurch den Berchtoldischen Wunsch nach Krieg, sondern denanderer Elemente, vor allem wohl Tschirschkys. Bismarckwollte 1870 den Krieg, aber die Emser Depesche war nacheinem ganz anderen Schnitt. Das soll heißen, daß es unverständlicherscheint, warum eine Note gewählt wurde,welche durch die Art und Weise ihrer Abfassung viele bisheruns Wohlgesinnte abstoßen mußte.Wenn wir den uns nach dem Attentate zum Teile nichtübelwollenden Großmächten, vor allem England, vor demUltimatum und unter der Hand vertraulich die Beweisegeliefert hätten, daß ein von Belgrad aus inszenierter19
Einleitende Betrachtungenpolitischer Mord vorliege, so hätten wir die dortige Regierungin eine ganz andere Mentalität versetzt. Statt dessen warfenwir ihm und ganz Europa das Ultimatum über den Kopf.Wahrscheinlich hat man damals am Ballplatz gefürchtet,daß eine Mitteilung an die Mächte deren Intervention inForm einer neuen „Botschafterkonferenz" zur Folge habenund der Fall versumpfen werde. Aber der Fall lag im Jahre1914 doch ganz anders als früher — das Recht war vor demUltimatum so zweifellos auf unserer Seite.Die Tschirschky-Gruppe hat jedenfalls eine solche verwässerteLösung gefürchtet und daher auf ein denkbarscharfes Vorgehen gedrungen. Bismarck war 1870 der Angreifer,und es gelang ihm, die Rollen zu vertauschen. Unsauch,aber im umgekehrten Sinne.inDann kam unser größtes Unglück :Belgien.4-der deutsche EinmarschWenn England neutral geblieben wäre, so hätten wir denKrieg nicht verloren. Jagow erzählt in seinem Buche „Ursachenund Ausbruch des <strong>Weltkriege</strong>s" auf Seite 172, daßder englische Botschafter am 4. August gegen Schluß derReichstagssitzung bei ihm erschien und nochmals die Fragestellte, ob Deutschland die belgische Neutralität respektierenwerde. Zu dieser Zeit waren die deutschen Truppen bereitsauf belgischem Boden. Der Botschafter entfernte sich aufdiese Nachricht hin, kam aber einige Stunden darauf wiederund forderte bis zwölf Uhr nachts eine Erklärung, daß dasweitere Vorrücken der deutschen Truppen in Belgien eingestelltwerde, sonst sei er beauftragt, seine Pässe zu verlangen,und England werde Belgien schützen. Dies lehnteDeutschland ab. Darauf folgte die englische Kriegserklärung.Daß England am gleichen Tage nach Belgien sagen ließ,es werde einer Verletzung seiner Neutralität ,,mit allen Kräften20
Einleitende BetrachtungenWiderstand leisten",stimmt mit der Berliner Demarche desenglischen Botschafters vollkommen überein.Zwei Tage früher, am 2. August, hat allerdings das englischeKabinett an Frankreich die Zusicherung gegeben, daßes außer dem Schutze der belgischen Neutralität auch dasUnterlassen einer Flottenaktion gegen Frankreich verlange,und der Widerspruch zwischen beiden Standpunkten istoffensichtlich. Mir scheint jedoch, er läßt sich nur so erklären,daß England seinen Standpunkt vom 2. August am4. August eben nicht mehr vertrat. Denn die deutsche Annahmedes englischen Ultimatums vom 4. August abendshätte England die moralische Möglichkeit, weitere Forderungenzu stellen, genommen. Wenn England am 4. Augusteinen Vorwand zum Kriege gesucht hätte, dann hätte esaußer der belgischen Forderung auch die der zu unterlassendenFlottenaktion erhoben. Es tat dies nicht, beschränktesein Ultimatum auf die belgische Frage und band sich damitselbst die Hände, falls Deutschland das Ultimatum öffentlichannahm. Am 4. August, zwischen neun und zwölf Uhrabends, lag die Entscheidung, ob England neutralbleiben werde oder nicht, bei Deutschland.Deutschland blieb bei dem Entschluß, die belgischeNeutralität zu verletzen, trotz der Sicherheit der damitverbundenen englischen Kriegserklärung. Das war dererste verhängnisvolle Sieg der Militärs über die Diplomatenin diesem Kriege. Denn erstere waren natürlich dieTreibenden.Der Gedanke der deutschen Militärs war der, Frankreichzu überrennen und sichdann mit ganzer Wucht auf Rußlandzu werfen. An der Marne scheiterte dieser Plan.In mehr als einer Beziehung ist die deutsche Politik ander Bismarckschen Erbschaft zugrundegegangen.Nicht nur,daß die Eroberung von Elsaß-Lothringen dauernd die FreundschaftFrankreichs verhinderte und dieses stets in die Armejeder antideutschen Koalition trieb — aber Bismarcks Erbe21
.Einleitende Hctrachtun^euwurde zum Fluche für Deutschland, weil die Deutschen in'seinen Fußstapfen wandeln wollten und keiner da war,das Maß hatte, das zu können.Über Düppel, Königgrätz und Sedan hat Bismarck dasDeutsche Reich geschaffen. Seine Politik war die von ,,Blutund Eisen" — diese Politik der Gewalt und der gewalttätigenMittel saß seit fünfzig Jahren als Evangelium diplomatischerKunst in dem Kopfe eines jeden deutschen Gymnasiasten— aber die geniale Geschicklichkeit, Klugheit undauch Vorsicht in der Anwendung seiner gewalttätigen Mittel,die konnte Bismarck dem deutschen Volke nicht vererben.Bismarck hat die Kriege von 1866 und 1870 sorgfältigvorbereitet und schlug los, als er gute Karten in der Handhatte; das Deutschland Wilhelms II. wollte keinen Krieg;es stürzte sich aber eines Tages kopfüber in denselbenund schuf in der ersten Woche politische Situationen, denenes nicht, mehr gewachsen war. Es behandelte Belgien undLuxemburg nach dem Bismarckschen Prinzip von „Machtgeht vor Recht" und entfesselte die Welt gegen sich.Ich sage die Welt, denn Englands Macht reichte überdie Welt.England stand bei Beginn des Krieges Gewehr bei Fuß.Es hätte vollständig seiner traditionellen Politik entsprochen,Deutschland gegen Frankreich und Rußland kämpfen undsich gegenseitig schwächen zu lassen und dann im gegebenenMomente friedengebietend einzugreifen. Das hätte den Kriegbis zum Äußersten verhindert. Dadurch, daß Deutschlandsich in Belgien festzusetzen drohte, zwang es England, einzugreifen.Inwieweit der deutsche Einfall in Belgien sichdurch französische Absichten, das gleiche zu machen, moralischentschuldigen läßt, ist heute nicht aufgeklärt — aberfür Luxemburg kann dieses Argument nicht gelten, und derRechtsbruch bleibt derselbe, ob das Land, an dem er verübtwird, größer oder kleiner ist.Der Einbrach in Belgien und Luxemburg war Bismarcksche2ider
Einleitende BetrachtungenGewaltpolitik, ausgeführt nicht von den Politikern, sondernvon den Generalen, aber ohne Bismarcksche Berechnungsgabeüber dieverheerenden Folgen.Später, im Laufe des Krieges, hat ja die deutsche ObersteHeeresleitung wiederholt gewalttätige Mittel angewandt,welche uns mehr geschadet als genützt haben — aber späterwaren diese Mittel moralisch gerechtfertigt und erklärlich, jadirekt aufgezwungen dadurch, daß Deutschland um seineExistenz kämpfte und die Gegner, die keine Verständigungwollten, ihm keine Wahl der Mittel ließen. Die Anwendungder erstickenden Gase, die Luftangriffe auf offene Städtewaren Mittel der Verzweiflung gegen einen erbarmungslosenFeind, welcher Frauen und Kinder dem Hungertode auslieferteund tagtäglich erklärte, Deutschland müsse vernichtetwerden.Bei der Kriegserklärung fehlte dieses mörderische Moment,und erst durch den Einfall in die neutralen Gebiete begannjene Atmosphäre entsetzlichen Hasses und der Rache, welcheden Kampf zu einem Vernichtungskrieg stempelte.Auch die Politik Englands gegen Napoleon I. war mehreine diplomatische als eine militärische, und alle Anzeichensprechen dafür, daß England ursprünglich nicht die Absichthatte, in die Konflagration einzugreifen, sondern sich damitbegnügt hätte, Deutschland durch die eigenen Bundesgenossenschwächen zu lassen.Soweit ich die Situation der damaligen Zeit zu überblickenin der Lage bin, trifft unsere Botschafter in London keineSchuld an der falschen Einschätzung der englischen Psyche.Sie hatten richtig vorausgesagt und gewarnt, und die letzteEntscheidung über das früher erwähnte englische Ultimatumfiel ja in Berlin und nicht in London. Auch hätte das deutscheAuswärtige Amt sich niemals freiwillig zu diesem Gewaltstreichehergegeben, aber die Militärs, welche sich weder umdiplomatische Berichte noch um politische Komplikationenkümmerten, rannten alles über den Haufen,23
Einleitende BetrachtungenEs wird immer ungemein schwierig bleiben, in einemKrieg die militärischen gegen die politischen Kompetenzenabzugrenzen.Beide Tätigkeiten greifen dermaßen ineinander,daß sie ein Ganzes bilden, und natürlich gebührt im Kriegeden militärischen Notwendigkeiten der Vorrang. Die vollständigeVerschiebung der Parität zu einem Verhältnis derSubordination jedoch, welche sich in Deutschland vollzogenund darin ausgedrückt hat, daß die deutsche Oberste Heeresleitungalle Befehlsgewalt im Staate an sich riß, war einUnglück. Wenn man die politischen Faktoren Berlins gehörthätte, so wäre es weder zum Einfalle in Belgien nochzum verschärften U-Bootkriege gekommen, und diese beidenUnterlassungen hätten den Mittelmächten das Leben gerettet.Kaiser Wilhelm war vom ersten Tage an der Gefangeneseiner Generale.Der blinde Glaube an die Unüberwindlichkeit des Heereswar, wie so manches andere, ein Erbstück aus BismarcksNachlaß, und der „preußische Leutnant, den niemandDeutschland nachmacht", ward sein Verhängnis. Das gesamtedeutsche Volk glaubte an den Sieg, und ein Kaiser,der seinen Generalen in den Arm gefallen wäre, hätte eineVerantwortung auf sich genommen, die das normale Maßdes Erträglichen überschritten hätte. So ließ Kaiser Wilhelmseine Generale schalten und walten, und anfangs schien ihreTaktik ja auch von Erfolg begleitet.Die erste Marne-Schlachtwar Hilfe in höchster Not für die Entente. Später wieder,als der Krieg längst einen ganz anderen Charakter angenommenhatte, als der Stellungskrieg die Truppen an dieStelle schmiedete und uns immer neue Feinde erstanden,als Italien, Rumänien und schließlich Amerika auf den Plantraten, da verrichteten die deutschen Generale Wunder derStrategie; Hindenburg und Ludendorff waren Götter gewordenfür das deutsche Volk, nur auf sie blickte ganzDeutschland, nur von ihnen erhoffte es den Sieg.24Sie waren
Einleitende Betrachtungenviel mächtiger als der Kaiser und er weniger denn je in derLage, ihnen zu opponieren.Die beiden Generale bezogen nach den später besprochenenFriedensversuchen im Jahre 1917 das schier unermeßliche Maßihrer Macht direkt von der Entente. Denn diese ließ demdeutschen Volke keinen Zweifel darüber, daß es siegen oder sterbenmüsse — und so klammerte sich das geängstigte und gequälteVolk an jene,die allein den Sieg ihm bringen konnten.Sowie der Krieg im Gange war, wäre ein Separatfriedeunsererseits, welcher Deutschland ausgeliefert hätte, Verratgewesen. Wenn der Friede an Deutschlands Ansprüchen gescheitertwäre, so wären wir moralisch berechtigt gewesen,uns zu trennen, denn wir waren zu einem Verteidigungskrieg,aber nicht zu einem Eroberungskrieg vereint. Obwohl die deutschenMilitärs stets von Eroberungen träumten und sprachenund dies gewiß einer Verkennung der Situation entsprach,so war doch nicht dieser Umstand der ausschließliche Grund,der den Frieden verhinderte, sondern der, daß die Ententeihrerseits Deutschland unter keiner Bedingung begnadigenwollte. Ich habe dies schon in einer Rede am 11. Dezember1918, in welcher ich über die Politik im <strong>Weltkriege</strong> gesprochenhabe, gesagt: „Ludendorff war genau so wie dieStaatsmänner in England und Frankreich, sie alle wolltenkein Kompromiß, nur den Sieg — in dieser Beziehung warkein Unterschied zwischen ihnen." Solange ich im Amtewar, wollte sich die Entente niemais mit Deutschland interpares ausgleichen, und dadurch drängte sie uns die Rolledes Verteidigungskrieges direkt auf. Hätten wir, was wirsooft versucht, erreicht, die Entente dieses erlösende Wortsprechen zu machen, hätten wir dieEntente jemals veranlassenkönnen, zu erklären, daß sie bereit sei, mit Deutschlandeinen Frieden auf dem Status quo zu schließen, so wären25
Einleitende Betrachtungenwir unserer moralischen Pflichten enthoben gewesen. Mankann dagegen einwenden : Salus rei publicae suprema lex —um die Monarchie zu retten, hätte man Deutschland preisgebenmüssen, und daher ist die andere Frage zu beleuchten,ob die „physische Möglichkeit" eines Separatfriedens überhauptbestand. Ich habe auch hierüber in der früher erwähntenRede gesprochen und habe damals ausdrücklicherklärt, und ich nehme nichts davon zurück, daß ich nachdem Eintritt Englands, dann Italiens, Rumäniens undschließlich Amerikas in den Krieg einen „Siegfrieden" unsererseitsfür eine Utopie gehalten habe. Aber bis zum letztenMoment meiner Amtstätigkeit und noch darüber hinaus habeich an der Hoffnung eines Verständigungsfriedens festgehalten,von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, javon Tag zu Tag hoffte ich, daß die Ereignisse die Möglichkeitbieten würden, zu einem solchen, wenn auch opferreichenVerständigungsfrieden zu gelangen. Das Ende, welches tatsächlicheingetreten ist,den Zustand, den wir heute haben,den konnte ich nicht voraussehen, den habe ich ebensowenigvorausgesehen wie irgend jemand anderer. Eine Katastrophevon dieser Größe und dieser Ausdehnung hat niemals Platzin meinen Befürchtungen gefunden. Der in der früher erwähntenRede veröffentlichte, von mir an Kaiser Karl imJahre 1917 geschriebene und später reproduzierte Berichtkonkludiert auch darin, daß ich sage, „ein Siegfriede seiausgeschlossen, daher müßten wir einen Frieden mit Opfernherbeiführen". Der kaiserliche Antrag, Galizien an Polenund indirekt an Deutschland abzutreten, entsprang diesemGedankengange, sowie alle Friedensfühler mit der Entente,welche stets zu verstehen gaben, daß wir zu erträglichenOpfern bereit seien.Daß die Entente Fetzen aus dem Körper der Monarchiereißen werde, war von jeher klar; auch bei einem Verständigungs-wie bei einem Separatfrieden, das entsprach erstensden Beschlüssen des Londoner Paktes vom 26. April 1015.26
Einleitende Betrac'tuneenDie Bestimmungen dieser Konferenz, welche den KriegseintrittItaliens vorbereiteten, waren für den weiteren Verlaufdes Krieges entscheidend, denn sie enthielten als Resultatdie Aufteilung der Monarchie und zwangen uns daher denVerteidigungskrieg bis zum Äußersten auf. Ich glaube, auchLondon und Paris haben später in Augenblicken, wo dasKriegsglück sich uns zuzuneigen schien,diese Londoner Beschlüssebedauert, da sie an der Seine und Themse einejede von ihnen zeitweise gewünschte Annäherung an unsunmöglich machten.Schon im Jahre 1915 erhielten wir vage Nachrichten überden Inhalt dieser streng geheimen Londoner Abmachungen,den authentischen Text erfuhren wir jedoch erst im Februar1917, als die revolutionäre russische Regierung das diesbezüglicheProtokoll veröffentlichte, welches dann auch inunseren Blättern reproduziert wurde.Ich füge das Protokoll dem Buche im Anhange bei, dastrotz seiner eminenten Wichtigkeit in unserer Öffentlichkeitnicht die genügende Beachtung gefunden hat.Nach diesen die vier Staaten England, Frankreich, Rußlandund Italien bindenden Abmachungen wurde Italien zugesprochen:Trentino, ganz Südtirol bis zum Brenner,Tri est, Görz, Gradiska, ganz Istrien und eine Zahl vonInseln, Dalmatien usw.Ferner hatte sich die Entente im Laufe des Krieges auchden Rumänen und Serben bindend verpflichtet — daher dieMonarchie aufgelöst.Dies vorausgeschickt, möchte ich erklären, warum einSeparatfriede von uns eine plrysische Unmöglichkeit war,mit anderen 'Worten, welches die Gründe waren, die unsverhinderten, den Krieg zu beendigen und „neutral" zuwerden, die Gründe, die uns nur die Möglichkeit ließen,den Gegner zu wechseln und anstatt mit Deutschland gegendie Entente, mit der Entente gegen Deutschland zu kämpfen.Vor allem muß festgehalten werden, daß bis in die letzte
Einleitende BetrachtungenZeit vor meinem Amtsaustritt die Ostfront österreichischungarischeund deutsche Truppen durcheinandergewürfeltenthielt und diese ganze Armee unter reichsdeutschem Kommandostand. Wir hatten im Osten keine eigene Armee imeigentlichen Sinne des Wortes mehr, sondern sie war in derdeutschen aufgegangen. Das war die Folge unserer militärischenInferiorität. <strong>Im</strong>mer und immer wieder brauchten wirdie deutsche Hilfe. In Serbien, Rumänien, Rußland undItalien haben wir wiederholt nach deutscher Hilfe gerufen,und immer mußten wir dieselbe durch Preisgabe einzelnerStücke unserer Selbständigkeit erkaufen. Die notorischeInferiorität war zum geringsten Teil die Schuld des einzelnenSoldaten, sie war vielmehr das Produkt österreichischungarischerZustände überhaupt. Schlecht ausgerüstet, mithöchst mangelhafter Artillerie traten wir in den Krieg —die verschiedenen Kriegsminister und die Parlamente trugenhieran die Schuld. Das ungarische Parlament hat durchJahre die Armee gedrosselt,weil seine nationalen Postulatenicht berücksichtigt wurden, und die SozialdemokratenÖsterreichs haben jeder Ausgestaltung der Verteidigungopponiert, weil sie darin Angriffs- und nicht Verteidigungsplänewitterten.Unser Generalstab war zum Teile ganz schlecht. Ausnahmenwaren vorhanden, aber diese bestärken die Regel.Vor allem fehlte ihm jeder Kontakt mit der Truppe. DieHerren saßen rückwärts und gaben Befehle. Fast nie sahsie der Soldat in der Front und dort, wo die Kugeln pfiffen.Die Truppe hat den Generalstab während des Krieges hassengelernt. Das war anders in der deutschen Armee. Die deutschenGeneralstäbler forderten viel, aber sie leisteten auchviel; sie exponierten sich vor allem auch selbst und gabendas Beispiel. Ludendorff hat, begleitet von ein paar Mann,Lüttich mit dem Säbel in der Hand genommen ! Dann warenbei uns Erzherzöge in leitenden Stellen,die für diese Postennicht paßten, Zum Teil waren sie ganz unfähig. Die Erzherzöge28
Einleitende Betrachtungen/Friedrich, Eugen und Joseph haben eine Ausnahme gemacht.Besonders ersterer faßte seine Stellung nicht als Leiter derOperationen, sondern als Bindeglied zwischen uns undDeutschland sowie der Armee und Kaiser Franz Joseph sehrrichtig auf, ging stets mit hervorragendem Takt und sehrkorrekt vor und hat viele Schwierigkeiten beseitigt. NachLuck verloren wir ungefähr den Rest unserer Selbständigkeit.Um also auf den oben entwickelten Gedanken zurückzukommen:Ein Separatfriede, welcher den Befehl an unsereOsttruppen, die Waffen niederzulegen oder zurückzumarschieren,enthalten hätte, hätte unzweifelhaft sofort zu bewaffnetenKonflikten in der Front selbst geführt. Bei demäußersten Widerstände, den die deutschen Befehlshaber einemsolchen Befehle natürlich entgegengesetzt hätten, wärendurch Wiener Befehle und Berliner Gegenbefehle Zuständevollständiger Desorganisation, ja der Anarchie entstanden.Eine friedliche, kampflose Entwirrung an der Front warnach menschlicher Berechnung ausgeschlossen. Ich sage dies,um meine feste Überzeugung zu erklären, daß die Vorstellung,als ob eine solche Trennung der beiden Armeensich in gegenseitigem Einvernehmen hätte vollziehen können,auf vollständig falschen Voraussetzungen beruht, und umdamit zu beweisen, daß hier das erste Moment vorliegt,welches ergibt, daß wir durch einen Separatfrieden den Kriegsich in verstärktem Maße in dem gesamten Hinterlandwiederholt:der Bürgerkrieg wäre unaufhaltsam gewesen.Ich muß hier ein zweites Mißverständnis aufklären, welchesebenfalls aus meiner schon zitierten Rede vom n. Dezembernicht beendet hätten, sondern in einen neuen Krieg verwickeltworden wären.W T as sich aber an der Front abgespielt hätte, das hätteerfließt und welches in meinem Ausspruche wurzelt : „Deutschlandkönnte, wenn wir austraten, den Krieg nicht weiterführen."Dieser Ausspruch — ich gebe zu, er ist nicht klargefaßt — wurde so interpretiert, als ob ich hätte sagen wollen,20
Einleitende Betrachtungenwenn wir austraten, war der sofortige ZusammenbruchDeutschlands eine gegebene Tatsache. Das habe ich nichtsagen wollen und habe ich nie gesagt und nie gemeint. Ichhabe sagen wollen, daß unser Abfall von Deutschland einesiegreiche Beendigung des Krieges oder auch nur eine dauernderfolgreiche Fortsetzung des Krieges für dasselbe unmöglichgemacht hätte, daß Deutschland also durch diese Eventualitätvor die Alternative gesetzt worden wäre, sich entweder demDiktate der Entente zu unterwerfen oder die äußerstenKampfmittel anzuwenden und die Monarchie zu unterdrücken,respektive ihr das gleiche Los zu bereiten wie seinerzeitRumänien. Ich wollte sagen, daß ein Österreich-Ungarn,welches die Ententetruppen hereinläßt, eine so furchtbareGefahr für Deutschland war, daß dieses gezwungen gewesenwäre, alles aufzuwenden, um uns raschestens zuvorzukommenund einen solchen Schachzug zu paralysieren. Und derjenige,welcher meint, daß die deutschen Militärs dieseletztere Eventualität nicht ergriffen hätten, der kennt siesehr schlecht und schätzt ihre Psyche sehr schlecht ein.Man muß, um diesen Gedankengang objektiv beurteilen zukönnen, sich in den Geist der damaligen Situation hineindenken.<strong>Im</strong> April 1918, als ich aus anderen Gründen meineDemission gab, war die Siegeszuversicht Deutschlands stärkerdenn je. Die Ostfront war erledigt — Rußland und Rumänienwaren ausgeschaltet — , die Truppen rollten nach Westen,und niemand, der die damalige Situation kennt, wird mirwidersprechen können, wenn ich behaupte, daß in diesemAugenblicke die deutschen Militärs sich ihrem Siegfriedennäher denn je glaubten, daß sie überzeugt waren, sie würdenParis und Calais erobern und die Entente in die Knie zwingen.Es ist ganz ausgeschlossen, daß sie in einem solchen Augenblickund unter solchen Verhältnissen einen Abfall Österreich-Ungarnsanders als mit Gewalt beantwortet hätten.Aber alle diejenigen, welche diese Argumentation nichtzugeben wollen, verweise ich auf ein Faktum, welches wohl30
Einleitende Betrachtungenschwer wegeskamotiert werden kann: ein halbes Jahr später,als der deutsche Zusammenbruch bereits vollständig klarerwiesen war, als Andrassy den Separatfrieden erklärte,haben ja die Deutschen tatsächlich Truppen nachTirol geworfen. Wenn sie in einem Zustande vollständigerErschöpfung, bereits geschlagen und vernichtet, die Revolutionim eigenen Rücken, noch an diesem Entschlußfesthielten und versuchten, österreichischen Boden zumKriegsschauplatz zu machen — um wieviel mehr hätten siedasselbe sechs Monate früher getan, wo sie kraftstrotzenddastanden und ihre Generale von Sieg und Triumph träumten.Das zweite also, was ich konstatieren wollte, war, daß einSeparatfriede die unmittelbare Folge gehabt hätte, Österreich-Ungarnzum Kriegsschauplatz zu machen. Tirol wieBöhmen wären zu Schlachtfeldern geworden — das wäre ganzunvermeidlich gewesen.Wenn heute behauptet wird, die große Kriegsmüdigkeit,welche die ganze Monarchie schon vor dem April 1918 beherrschthabe, hätte es bewirkt, daß die gesamte Bevölkerungder früheren Monarchie sich um jenen Minister gescharthätte, welcher den Separatfrieden geschlossen hätte, so istdies eine bewußte oder unbewußte Unwahrheit. Gewiß, dieTschechen waren unbedingt gegen Deutschland, und es wärennicht Gründe der Bündnispolitik gewesen, welche siedarangehindert hätten, zuzustimmen. Aber ich möchte wissen,was das tschechische Volk gesagt hätte, wenn man Böhmenzum Kriegsschauplatz gemacht und zu allen Leiden, welchedieses Volk ebensogut wie alle anderen Völker erduldete,auch noch das gekommen wäre, daß man ihr Vaterlandverwüstet hätte, und man gebe sich doch gar keinem Zweifeldarüber hin, daß die von Sachsen einfallenden deutsehenTruppen mit fliegenden Fahnen nach Prag und noch weitervorgedrungen wären. Wir hatten gar keine militärischenKräfte in Böhmen, wir waren gar nicht imstande, sie aufzuhalten,und viel rascher, als wir oder die Entente imstande3*
Einleitende Betrachtunsengewesen wären, nennenswerte Truppen nach Nordböhmenzu schaffen, hätten die Deutschen aus ihren fast unerschöpflichenReservoirs Truppen geschöpft, die gegen uns — odergegen die Entente auf unserem Boden — marschiert wären.Die Öffentlichkeit Deutschösterreichs aber hätte einem solchenMinister schon gar keine Gefolgschaft geleistet; die Deutschnationalenund das deutsche Bürgertum bestimmt nicht.-Die Deutschnationalen veröffentlichten am 28. Oktoberihren einschlägigen Standpunkt in folgender Weise:„Die Mitglieder der deutschnationalen Parteien waren überdie Art und Weise, wie Graf Andrassy die Note Wilsonsbeantwortete, tief entrüstet. Graf Andrassy war vonUngarn gekommen, setzte sich weder mit der deutschenReichsregierung noch mit der Vertretung des Vollzugsausschussesins Einvernehmen, bevor er die Note verfaßt hatte.Obwohl man auf das lebhafteste die Friedensverhandlungenbegrüßte und als notwendig erachtete, so hatte dochdas einseitige Vorgehen des Grafen Andrassy, daß er ohneEinvernehmen mit dem Deutschen Reiche die Note an Wilsonergehen ließ, unter den deutschen Parteien tiefste Entrüstunghervorgerufen. Vor wenigen Tagen noch war eineAbordnung des Deutschen Vollzugsausschusses in Berlin undhat bei der deutschen Reichsregierung für die VersorgungDeutschösterreichs Entgegenkommen gefunden. Trotzdemdeutsche Soldaten in den Alpenländern und in den Karpathenan der Seite der Unseligen gekämpft, wurde jetzt die Formverletzt und ohne Einvernehmen mit dem Deutschen Reiche,wie es ja in der Note auch ausdrücklich heißt, an Wilsonherangetreten. Außerdem hat man auch ein vorheriges Einvernehmenmit den Vertretern des Deutschen Vollzugsausschussesnicht gesucht, sondern über dessen Kopf hinweg dieNote Wilsons beantwortet. Die deutschnationalen Parteienerheben gegen ein solches unqualifizierbares Vorgehenentschiedenen Widerspruch und werden im Deutschen Vollzugsausschußdarauf dringen, daß das SelbstbestimmungsrechtDeutschösterreichs unbedingt gewahrt und der Friede imEinvernehmen mit dem Deutschen Reiche durchgesetzt werde."Aber auch die deutschösterreichischen Sozialdemokratenhätten eine solche Schwenkung nicht mitgemacht.
Einleitende BetrachtungenEs liegt eine gewollte und beabsichtigte Verdrehung derTatsachen vor, wenn heute behauptet wird, die Nationalversammlungoder auch die österreichischen SozialdemokratenIch er-hätten eine solche Politik gebilligt und unterstützt.innere wieder an die Tage Andrassys.Am 30. Oktober nahm die Nationalversammlung zu seinemDen Bericht erstattete Dr. Sylvester undSchritte Stellung.führte hierbei folgendes aus:„Es war jedoch nicht notwendig und daher nicht zulässig,diesen Versuch auf solcheWeise zu unternehmen, daß dadurchzwischen Deutschösterreich und dem Deutschen Reicheein unheilbarer Riß entstehen kann, der die Zukunftunseres Volkes gefährdet.Die Nationalversammlung Deutschösterreichsstellt fest, daß die Note des k. u. k. Ministersdes Äußern an den Präsidenten Wilson vom 27. Oktoberverfaßt und abgesendet wurde, ohne daß mit den Vertreterndes deutschösterreichischen Volkes in irgendeiner Weise dasEinvernehmen gepflegt worden wäre. Gegen dieses Vorgehenlegt die Nationalversammlung um so mehr Verwahrungein, als die Nation, der der gegenwärtige Minister des Äußernangehört, jede Gemeinsamkeit ausdrücklich ablehnt. DieNationalversammlung erklärt, daß einzig und allein sie undihre Organe befugt sind,allen Angelegenheiten der äußeren Politik,das deutschösterreichische Volk ininsbesondere beiden Friedensverhandlungen, zu vertreten."Ein Widerspruch gegen die „Verwahrung" erfolgte in derNationalversammlung nicht.Nach dem Referenten sprach der Sozialdemokrat Dr. Ellenbogenund führte aus:„Statt jetzt dem Deutschen Kaiser zu sagen, daß seinVerbleiben im Amte das stärkste Friedenshindernis ist (lebhafterBeifall bei den Sozialdemokraten) und daß, wennjemals ein Curtiussprung einen Sinn hatte, er heute in bezugauf den Deutschen Kaiser einen Sinn hat zur Rettung seinesVolkes, sucht sich diese Koalition den jetzigen Augenblick3 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong>33
EinV.tende BetrachtungenLür den Abfall von Deutschland heraus, indem sie damitder deutschen Demokratie in den Rücken fällt. Die Herrschaftenkommen zu spät, um sich ein Verdienst um denFrieden zu erwerben. Was jetzt übrigbleibt, ist der kalte,schmähliche Treubruch, der von einem berühmten deutschenDichter gekennzeichnete Dank vom Hause Österreich."''Beifall bei den Sozialdemokraten und Deutschradikalen.)(Die Rede ist aus der „Arbeiterzeitung" vom 31. Oktober1918 zitiert.)Es war der Angriff gegen den Sonderfrieden, welcher dieseltene Gelegenheit bot, daß Sozialdemokraten und Deutschradikalegemeinsam Beifall spendeten, wohl auch der ersteFall in diesen ganzen Kriegsjahren.Wenn dies geschehen konnte in einem Augenblick, wo esbereits klar war, daß gar keine Möglichkeit mehr bestehe,mit Deutschland zusammen zu einem Verständigungsfriedenzu kommen — was wäre geschehen, frage ich,alszu einer Zeit,dies noch der überwiegenden Majorität der Bevölkerunglange nicht so klar war, zu einer Zeit, als es noch gar nichtsicher, jedenfalls mathematisch gar nicht beweisbar war, daßwir mit der Zeit nicht doch noch mit Deutschland zusammenzu einem erträglichenVerständigungsfrieden gelangen können:Auflösung an der Front — der Kampf aller gegen allein derselben, die Monarchie zum Kriegsschauplatz geworden,der Bürgerkrieg im Innern, das wäre das Resultat einesSeparatfriedensversuches gewesen. Und alles das, umzum Schlüsse die Durchführung der Londoner Beschlüssean unserem Leibe zu ermöglichen. Dennniemals hat — wie ich später entwickele — die Entente vondiesen Beschlüssen abgelassen, da, sie an Italien gebunden"war und Italien keine Veränderung zugab. Eine solchePolitik wäre Selbstmordaus Angst vor dem Tode gewesen.Ich habe im Jahre 1917 einmal mit dem verstorbenenDr. Viktor Adler die ganze Frage besprochen und ihm dieEventualitäten einesSeparatfriedens entwickelt.34
Einleitende BetrachtungenDr. Adler erwiderte mir: „Um Gottes willen, stürzen Sieuns nicht in einen Krieg mit Deutschland!" — und nachdem Einfall von bayrischen Truppen in Tirol (Adler wardamals bereits im Staatssekretariat des Äußern) erinnerteer mich an jene Unterredung und fügte hinzu: „Jetzt habenwir die Katastrophe, die wir damals besprochen haben.wird Kriegsschauplatz werden."Alle Welt inTirolÖsterreich wollte den Frieden, aber niemandeinen neuen Krieg — und der Separatfrieden hättekeinenFrieden, sondern den Krieg mit Deutschland gebracht.In Ungarn übte Stephan Tisza eine fast unumschränkteMacht aus; er war viel mächtiger als das gesamte MinisteriumWekerle zusammen. Auf Ungarn angewendet hieß ein Separatfriedenebenfalls die Durchführung der Ententeversprechungen,d. h. Verlust der größten und reichsten Gebieteim Norden und Süden an Tschechen, Rumänen und Serben.Gibt es jemanden, der ehrlich behaupten kann, die Ungarnhätten im Jahre 1917 in diese Opfer gewilligt ohne denäußersten Widerstand? Jeder Mensch, der die Verhältnissekennt, muß zugeben, daß Tisza in diesem Falle ganz Ungarnin dem heftigsten Kampf gegen Wien hinter sich gehabthätte. Bald nach meinem Amtsantritte hatte ich die erstelange, sehr ernste Unterredung mit ihm über die deutscheund die Friedensfrage. Tisza entwickelte: Die Deutschenseien schwer zu behandeln, anmaßend und despotisch; wirkönnten aber ohne dieselben den Krieg nicht beenden. DieZumutung, ungarisches Territorium abzutreten (Siebenbürgen),aber auch der Gedanke einer aufgezwungenen internenungarischen Reform zugunsten der Nationalitätenseien völlig undiskutierbar. Die Londoner Konferenz vomJahre 15 habe wahnsinnige Beschlüsse gefaßt, die nimmerWirklichkeit werden würden; der Vernichtungswille derEntente sei jedoch nur mit Gewalt zu brechen. Wir müßtendaher unter allen Umständen an Deutschlands Seite ausharren.In Ungarn seien viele verschiedene Strömungen —3*35
Einleitende Betrachtungenin dem Augenblicke aber, in welchem Wien sich vorbereite,Teile Ungarns zu opfern, werde ganz Ungarn wie ein Manndagegen auftreten.Von ihm — Tisza — bis Karolyi sei darinkein Unterschied. Tisza erinnerte an die Haltung Karolyisvor der rumänischen Kriegserklärung, berief sich auf dasgesamte Parlament und betonte, „wenn auf dem RückenUngarns Frieden gemacht werden solle, so werde Ungarnsich von Österreich trennen und selbständig vorgehen".Ich erwiderte, es sei weder von einer Trennung von Deutschlandnoch von einer Preisgabe ungarischen Territoriums dieRede — wir müßten uns aber klar darüber sein, was wirzu machen hätten, wenn wir durch deutsche Eroberungswünscheweiter fortgeschleppt würden.Tisza entwickelte darauf, die Situation sei eine andere:„Man wisse nicht genau, was die Londoner Konferenz beschlossenhabe (das Protokoll war damals noch nicht veröffentlicht),aber daß ungarisches Territorium an Rumänienversprochen sei, sei ebenso sicher, wie daß die Entente eineEinmischung in die internen Angelegenheiten Ungarns plane,und beides sei unannehmbar. Wenn die Entente Ungarnden Status quo ante garantiere und jede Einmischung unterlasse,so ändere dies die Situation. Bis dahin müsse er sichgegen jeden Friedensversuch aussprechen."Die Unterredung wurde im Laufe heftiger,besonders aufmeine Vorwürfe, daß er — Tisza — die ganze Politik nurvom ungarischen Standpunkte aus betrachte, was er garnicht leugnete, jedoch — richtigerweise — betonte, der Streitsei ein mehr platonischer, denn die Friedensbedingungender Entente schienen derart, daß von Österreich noch vielweniger übrigbleiben werde als von Ungarn.Ich möge dochvorerst konstatieren, welches die Bedingungen seien, unterwelchen wir Frieden schließen könnten — erst dann werdees sich zeigen, ob der äußerste Druck auf Deutschland anzuratensei oder nicht. Es habe doch keinen Sinn, in Deutschlandzum Frieden zu raten, wenn dieses weiterkämpfen wolle.36
;Einleitende BetrachtungenDenn Deutschland kämpfe ja vor allem für die Integritätder- Monarchie, welche verloren sei in dem Augenblicke, inwelchem Deutschland die Waffen niederlege. Ob deutschePolitiker und Generale dies oder jenes sprächen, sei vongeringerem Belange; solange London daran festhalte, seineBundesgenossen aus unserem Territorium zu befriedigen, seiDeutschland der einzige Schild gegen diese Pläne.Eroberungen wolle er keine, außer einem Grenzschutz gegenRumänien, und gegen die Angliederung neuer Staaten (Polen)sei er unbedingt; dies sei eine Schwächung, keine StärkungUngarns.Nach langer Aussprache einigten wir uns bindend auf dieeinzuschlagende Taktik, und zwar:i. Solange der Beschluß der Londoner Konferenz, d. h.die Zertrümmerung der Monarchie, für die Entente maßgebendbleibt, muß gekämpft werden, in der sicheren Hoffnung,diesen Vernichtungswillen zu brechen.2. Da unser Krieg aber nur ein Verteidigungskrieg ist,wird derselbe auf keinen Fall für Eroberungen irgendeinerArt fortgesetzt.3. Jeder Schein der Schwächung unseres Bundesverhältnissesist zu vermeiden.4. Konzessionen aus ungarischem Territorium dürfennicht ohne Wissen des ungarischen Ministerpräsidenten gemachtwerden.5. Sollte das österreichische Ministerium sich mit demMinister des Äußern über eine Preisgabe österreichischenGebietes einigen, so stimmt der ungarische Ministerpräsidentselbstverständlich zu.Soweit die Londoner Konferenz und die Zertrümmerungder Monarchie in Frage kam, hatte Tisza vollständig rechtdaß er auch sonst bis zum Schlüsse auf seinem Standpunktgebheben ist, beweist sein letzter Besuch bei den Südslawen,welchen er unmittelbar vor dem Zusammenbruch im Auftragedes Kaisers machte und bei welchem er auf das entschiedenstegegen die südslawischen Aspirationen auftrat.37
Einleitende BetrachtungenWer objektiv zu urteilen bestrebt ist, darf nicht, von heuterückblickend, alles seither Vorgefallene als im vorhinein erkennbareTatsachen hinstellen, sondern muß bedenken, daßtrotz allem Pessimismus und trotz aller Befürchtungen dieHoffnung auf einen erträglichen Verständigungsfrieden, wennauch mit Opfern, immer noch bestand, und daß es unmöglichwar, die Monarchie in eine sofortige Katastrophe zu stoßen,werde später kommen.Wenn heute die Situation so geschildert wird, als wennaus Furcht, dieselbedie Bevölkerung der Monarchie und speziell auch die Sozialdemokratenfür eine jede Eventualität gewesen wären, alsoauch für den Separatfrieden, so muß ich nochmals auf dasentschiedenste widersprechen. Ich erinnere daran, daß dieSozialdemokratie, welche zweifellos die Partei war, die sicham entschiedensten für den Frieden eingesetzt hat, daßdie Sozialdemokratie, in Deutschland wie bei uns, wiederholtbetont hat, daß es gewisse Grenzen ihres Friedenswunschesgäbe. Niemals haben die deutschen Sozialdemokratenzugegeben, daß Elsaß-Lothringen abgetreten werdendürfe, und niemals haben die unseren einer Preisgabe Triests,Bozens und Merans zugestimmt. Dies aber wäre unter allenUmständen der Preis des Friedens gewesen — auch derPreis des Separatfriedens —, denn die Londoner Konferenz,welche, wie erwähnt, auf das Jahr 1915 zurückreicht, hatteja bereits bindende Verpflichtungen für die Aufteilung derMonarchie übernommen und das alles an Italien vergeben.Der Zerfall der Monarchie war auch bei einer Trennungvon Deutschland, das heißt auch bei einer Schwenkung indie Reihen der Entente, ganz unabänderlich, denn denItalienern, den Rumänen, den Serben waren ihre Ansprüchezugesagt. Auch in diesem Falle wäre die Monarchie zerfallen,wäre Deutschösterreich entstanden, so wie es heuteentstanden ist, und ich zweifle daran, ob die Rolle, diedieses Land bei dem Vorgang gespielt hätte, es der besonderenProtektion der Entente empfohlen hätte. Ich38
Finleitende Betracl tunkenverweise auf die Rolle, welche die österreichische Sozialdemokratiein der Anschlußfrage gespielt hat. Sie war dietreibende Kraft des Anschlusses an Deutschland, und ihreBlätter wiederholten täglich,daß materielle Vorteile, welchedie Entente Deutschösterreich anbieten könnte, diesen Beschlußnicht zu ändern vermöchten.Wie aber sah die Situation noch im März, knapp vormeiner Demission, aus? Deutschland stand am Höhepunktseiner Erfolge.Ich will nicht sagen, daß diese Erfolge realewaren. Darauf kommt es in diesem Zusammenhangenicht an, aber die Deutschen waren überzeugt, daß sie demsiegreichen Ende ganz nahegerückt seien, daß sie sich nachErledigung der Ostfront auf die Westfront werfen und denKrieg beendigen werden, bevor Amerika Zeit habe, „zukommen". Die Rechnung war falsch. Das wissen wir heutealle. Aber für die deutsche Generalspsyche war sie maßgebend,und alle Entschlüsse, welche Deutschland gegenein abfallendes Österreich-Ungarn gefaßt hätte, wären ausdieserdeutschen Siegespsyche erflossen.Ich habe, wie schon betont, in meiner bereits mehrmalszitierten Rede über die äußere Politik am u. Dezember erklärt,daß weder die Entente noch Deutschland einen Friedenmit Verzicht schließen wollten. Ich habe aber seitdemGelegenheit gehabt, mit verschiedenen Persönlichkeiten derEntente zu sprechen, und ich muß auf Grund aller übereinstimmendenNachrichten, die ich erhalten habe, den obenangeführten Satz noch schärfer formulieren : Ich habe die festeÜberzeugung gewonnen, daß die Entente, und vor allemEngland — wenigstens vom Sommer 17 ab — den unbeugsamenEntschluß gehabt hat, Deutschland zu zerschmettern.Ich entwickle später, welche Verhältnisse im Sommer 17Von diesem Augenblicke ab scheint England miteintraten.jener Zähigkeit, welche den Hauptzug seines Charaktersbildet, entschlossen gewesen zu sein, nicht mehr mit Deutschlandzu verhandeln, sondern das Schwert ersteinzustecken/39
Einleitende Betrachtungenbis Deutschland vernichtet am Boden liegt.Das ändert nichtsdaran, daß die deutschen Militärs, und zwar aus anderenGründen, aus vollständiger Verkennung der Siegeschancen,sich stets geweigert haben, den Frieden durch Opfer anzustreben,auch zur Zeit, als dies vielleicht noch möglich war.Dieses Faktum ist historisch, aber ich muß zur Steuer derWahrheit ausdrücklich konstatieren, daß ich daran zweifle,ob spätere Konzessionen das Schicksal Deutschlands geänderthätten. Wir konnten im Jahre 19 17 oder auchnoch 1918 zum Feinde überlaufen — wir konnten auf österreichisch-ungarischemBoden zusammen mit der Ententegegen Deutschland kämpfen, dann wäre zweifellos der ZusammenbruchDeutschlands noch rascher erfolgt, aber dieWunden, die Österreich-Ungarn dabei davongetragen hätte,wären nicht geringer gewesen als die, die es heute besitzt —es wäre zugrundegegangen in dem Kampfe gegen Deutschland,so gut es zugrundegegangen ist in dem mit Deutschland.Österreich-Ungarns Uhr war abgelaufen. Auchunter den wenigen Staatsmännern, welche im Sommer 1914den Krieg erhofften — wie beispielsweise Tschirschky undder um Bosniens Zukunft bangende Bilinski —, wird eskeinen gegeben haben, welcher seine Ansichten nicht schonnach wenigen Monaten bedauert und revidiert hätte. Dennauch sie dachten nicht an einen Weltkrieg. Trotzdem glaubeich heute, daß der Zerfall der Monarchie auch ohne diesenKrieg eingetreten wäre, und daß das serbische Attentat unterallen Umständen das erste Anzeichen hierfür war.Der Erzherzog-Thronfolger war ein Opfer der großserbischenAspirationen; diese Aspirationen, welche die Losreißungunserer südslawischen Provinzen bezweckten, wärenaber nicht eingeschlafen, wenn die Monarchie über den Mordzur Tagesordnung übergegangen wäre. Sie hätten sich imGegenteil in verstärktem Maße und fortgesetzt geltend gemachtund hätten die zentrifugalen Tendenzen andererVölker innerhalb der40Monarchie gestärkt.
Einleitende BetrachtungenWie der Blitz bei Nacht auf Sekunden die Gegend zeigt,so hat der Feuerschein der Schüsse in Sarajevo gewirkt. Eswar klar geworden, daß das Signal zum Zerfall der Monarchiegegeben war. Die Glocken Sarajevos, welche eine halbeStunde nach dem Morde .zu läuten begannen, waren dasGrabgeläute der Monarchie.Und das Gefühl, daß es sich in Sarajevo um mehr als dieErmordung eines kaiserlichen Prinzen und seiner Gemahlingehandelt habe, daß es der Alarmschuß zum Beginn derVernichtung des Habsburgischen Reiches sei, war damals inder österreichischen und speziell in der Wiener Bevölkerungsehr allgemein. Mir ist erzählt worden, daß in jener Zeitzwischen Attentat und Krieg in den Wiener Restaurants undVolksgärten tagtägliche kriegerische Demonstrationen stattfanden,patriotische und antiserbische Lieder gesungen undBerchtold verhöhnt wurde, weil er sich zu ,,keiner energischenDemarche aufraffen könne". Das soll keine Entschuldigungfür eventuelle Fehler der maßgebenden Faktoren sein — dennein leitender Staatsmann soll sich nicht durch das Geschreider Gasse beeinflussen lassen —, es soll nur beweisen daß deroben entwickelte Gedanke im Jahre 19 14 sehr allgemeingewesen zu sein scheint. — Und vielleicht ist es gestattet,die Reflexion daran zu knüpfen, wie viele von denen, welchedamals nach Krieg und Rache schrien und „Energie" verlangten,heute, nachdem das Experiment gründlich mißlungenist, das „verbrecherische Vorgehen Berchtolds"geißeln und verurteilen.In welcher Form sich der Zerfall der Monarchie abgespielthätte, wenn der Krieg vermieden worden wäre,läßt sich natürlich nicht sagen. Weniger schrecklich alsdurch diesen Krieg gewiß. Wahrscheinlich auch langsamerund vielleicht, ohne die ganze Welt mit in den Strudelhineinzureißen. — Wir mußten sterben. Die Todesart konntenwir uns wählen, und wir haben uns die schrecklichstegewählt.41
Einleitende BetrachtungenMit dem Ausbruch des Krieges verloren wir, ohne es selbstzu wissen, unsere Selbständigkeit. Wir wurden aus einemSubjekt einObjekt.Wir konnten, da dieser unselige Krieg einmal begonnenwar, ihn nicht mehr beenden — die Londoner Konferenzhatte das Todesurteil über das Reich der Habsburgergesprochen, und der Separatfriede wäre keine mildereTodesart gewesen als das Ausharren bei unseren Bundesgenossen.
II.Konopischt
Konopischtist die Wiege mannigfacher Sagen geworden.Der Schloßherr war das erste Opfer des furchtbarenWeltbrandes, und die Rolle, die er vor dem Kriege gespielthat, unterliegt vielen und teilweise falschen Kommentaren.Der Erzherzog-Thronfolger war eine ganz eigenartigeNatur. Der Hauptzug seines Charakters war der einer großenUnausgeglichenheit. Er kannte selten eine mittlere Linie,und er war ebenso heiß im Haß wie in der Liebe. Er war unausgeglichenin allem, er betrieb nichts wie andere Menschen,sondern tat, was er tat, in übermenschlichen Dimensionen.SeineKauf- und Sammelwut von Antiquitäten war sprichwörtlichund ging in das Phantastische. Ein hervorragenderSchütze, war die Jagd für ihn nur mehr in größtem Maßstabeerwünscht, und die Zahl des von ihm erlegten Wildes geht indie Hunderttausende. Einige Jahre vor seinem Tode hatteer seinen fünftausendsten Hirsch erlegt.Seine Kunstfertigkeit im Schießen grenzte an das Fabelhafte,mit Schrot wie mit der Kugel. Als er auf seiner Weltreisein Indien war, produzierte sich bei einem Maharadschaein Kunstschütze. Es wurden Geldmünzen in die Höhe geworfen,und der Kunstschütze schoß mit der Kugel danach.Der Erzherzog versuchte es seinerseits und schlug den Indier.Er verachtete bei dem Schießen alle modernen Behelfe wieFernrohr und Repetiergewehr; er schoß stets aus einemdoppelläufigen Stutzen, und sein ungemein scharfes Augeließ ihm das Fernrohr entbehrlich erscheinen.45
KonopischtDas künstlerische Verständnis für Parkanlagen führte dieletzten Jahre zu der ihn dominierenden Leidenschaft; inKonopischt kannte er jeden Baum und jeden Strauch, undseine Blumen liebte er über alles. Er war sein eigener Gärtner.Jedes Beet und jede Gruppe wurden nach seinen genauenAngaben angelegt. Er kannte die Lebensbedingungen jedereinzelnen Pflanze, die Bodenqualität, in der sie gedeiht, undjede, auch die geringste Anlage oder Änderung erfolgte aufseine bestimmte Angabe. Aber auch hier geschah alles ineinem Riesenmaße, und die Summen, welche dieser Parkverschlungen hat, müssen enorm gewesen sein.In vieler Beziehunghatte der Erzherzog ein Kunstverständnis wie wenigeMenschen; kein Händler konnte ihm einen modernen Gegenstandals „alt" aufschwätzen, und er hatte ebensoviel Geschmackals Verständnis. Hingegen war für ihn Musik einunangenehmer Lärm, und für Dichter hatte er nur eine unsäglicheVerachtung. Wagner konnte er nicht leiden, undGoethe sagte ihm gar nichts. Ganz eigenartig war sein Mangelan Sprachtalent. Er sprach sehr mittelmäßig Französisch,sonst eigentlich gar keine Sprache ; einige Brocken Italienischund Tschechisch. Mit der Erlernung der ungarischen Sprachequälte er sich durch Jahre mit eiserner Energie bis zu seinemLebensende ab; er hatte ständig einen Geistlichen im Hause,der ihm ungarische Stunden gab. Dieser Lehrer begleiteteihn auch auf seinen Reisen, und in St. Moritz beispielsweisenahm Franz Ferdinand tagtäglich ungarischen Unterricht —trotzdem litt er fortgesetzt unter dem Gefühl, diese Sprachenie erlernen zu können, und er übertrug die Mühen, die ihmdiese Erlernung bereitete, auf das ganze ungarische Volk.„Schon wegen ihrer Sprache sind sie mir antipathisch," warein Ausspruch, den ich öfter von ihm gehört habe. Auch inder Beurteilung der Menschen war Franz Ferdinand nichtausgeglichen, er konnte nur lieben oder hassen, und leiderwar die Zahl derer, welche in die zweite Kategorie gehörten,die bedeutend größere.46
KonopischtEs unterliegt keinem Zweifel,daß Franz Ferdinand einenharten Zug in seiner ganzen Denkungsweise hatte, und füralle jene, die ihn weniger nahe gekannt haben, war dieseHärte seines Charakters das Markanteste an ihm, und diegroße Unpopularität, deren er sich erfreute, geht zweifellosauf diesen Charakterzug zurück. Die ganz hervorragendenEigenschaften, welche der Erzherzog besaß, kanntedie Öffentlichkeit nicht, daher beurteilte sie ihn vielfachfalsch.Er soll nicht immer so schroff gewesen sein. Er machte inseiner Jugend eine schwere Lungenkrankheit durch und wareine Zeitlang von den Ärzten so gut wie aufgegeben. Er hatmir selbst des öfteren diese Zeit und alles das, was er in derselbendurchgemacht hat, geschildert und stets mit maßloserVerbitterung über die Menschen gesprochen, welche ihn voneinem Tage zum anderen als abgetan beiseite geschobenhätten. Solange er als Thronfolger galt und die Menschen mitihm für die Zukunft rechneten, war er der Mittelpunkt derallgemeinen Aufmerksamkeit. Als er krank wurde und füraufgegeben galt, schwenkte die Welt von einer Stunde zuranderen und brachte ihre Huldigungen seinem jüngerenBruder Otto dar. Ich will keinen Augenblick bezweifeln,daß sehr viel Wahres an dieser Schilderung des verewigtenErzherzogs war, und niemand, der die Welt kennt, wird denerbärmlichen und servilen Egoismus bezweifeln, der den Huldigungen,die den hohen Herren gebracht werden, fast immerzugrunde liegt. Schärfer noch als in andere Herzen hat sichdieser Groll in das Herz Franz Ferdinands eingegraben, undniemals hat er der Welt vergessen, was er in diesen schwerenMonaten erlebt und durchgemacht hat. Vor allen war es derdamalige Minister des Äußern, Graf Goluchowski, dessen angeblicheplötzliche Schwenkung den Erzherzog schwer verwundethatte; hatte er doch immer geglaubt, daß Goluchowskiihm persönlich zugetan sei. Nach der SchilderungFranz Ferdinands soll Goluchowski dem Kaiser Franz Joseph47
tvonopischterklärt haben, der Erzherzog Otto müsse nunmehr den ihm alsThronfolger gebührenden Hofstaat erhalten, da er — FranzFerdinand — ja „sowieso verloren sei". Weniger die Sacheselbst als die Art und Weise, wie Goluchowski ihn bei „lebendigemLeibe begraben" hat, hat den durch seine Krankheitnoch reizbareren Mann verstimmt und gekränkt. Aberneben Goluchowski waren es noch zahllose andere, denen erihr Verhalten in der damaligen Zeit verübelte, und die beispielloseVerachtung der Welt, welche, als ich ihn kennenlernte,ein charakteristischer Zug seines ganzen Wesenswar, scheint zum Teile wenigstens auf jene Krankheitserfahrungenzurückzureichen.Auch in politischer Beziehung hat diese Verbitterung einennachhaltigen Einfluß auf sein ganzes Denken ausgeübt.Mirist von einem authentischen Zeugen erzählt worden, daß derErzherzog, als er schwerleidend im Süden gegen die furchtbareKrankheit kämpfte, eines Tages den Artikel einer ungarischenZeitung zu Gesicht bekam, welche in brutalerund höhnender Form von der abgetanen Zukunftsregierungdes Erzherzogs sprach und eine offenkundige Schadenfreudeüber diese erwartete Eventualität zur Schau trug. Der Erzherzog,welcher beim Lesen des Artikels grau vor Zorn undEmpörung geworden war, soll eine Weile stillgeblieben sein,worauf ihm das charakteristische Wort entfuhr: „Jetzt mußich gesund werden. Jetzt werde ich nur meiner Gesundheitleben, denn ich will gesund werden, um ihnen zu zeigen,daß ihre Freude verfrüht ist." Und war dies gewiß auchnicht der einzige Grund jener heftigen Antipathie gegen alles,was ungarisch war, so spielten zweifellos solche persönlichenMomente in seinem ganzen Denken stets eine Rolle. DerErzherzog war „ein guter Hasser", er vergaß nicht leicht,und wehe denen, die er mit seinem Hasse verfolgte. Aufder anderen Seite hatte er eine allerdings nur wenigen bekannte,ungemein warme Ecke seines Herzens; er war einidealer Gatte, der beste Vater und ein treuer Freund seiner48
KonopischtFreunde.Aber die Zahl derer, die er verachtete, war unvergleichlichgrößer als die derjenigen, denen er seine Zuneigunggeschenkt hatte, und er selbst gab sich auch gar keinemZweifel darüber hin, daß er eine der unpopulärsten Persönlichkeitender Monarchie war. Gerade aber in der Verachtungder Popularität lag wieder eine gewisse Größe. Niemalshätte er es über sich gebracht, gegenüber einer Zeitung oderanderen Instrumenten, welche die öffentliche Meinung zugunstenoder zuungunsten zu beeinflussen pflegen, irgendeinEntgegenkommen zu zeigen. Er war zu stolz, um um Popularitätzu buhlen, und ein zu großer Verächter der Menschheit,um auf ihr Urteil etwas zu geben.Wie ein roter Faden hat sich durch den politischen Ideengangdes Erzherzogs seine Abneigung gegen Ungarn gezogen.Es ist mir erzählt worden, daß zu der Zeit, als KronprinzRudolf viel in Ungarn jagte, auch der Erzherzog öftersan diesen Jagden teilnahm, und daß die ungarischen Herrensich ein Vergnügen daraus gemacht hätten, den jungen Erzherzogin Gegenwart und zur Freude des bedeutend älterenKronprinzen aufzuziehen und zu verspotten. So gern ichglaube, daß Kronprinz Rudolf an solchen Scherzen seineFreude gefunden haben dürfte, und so wenig ich daranzweifle, daß sich Menschen gefunden haben werden, die, umsich das Wohlwollen des Kronprinzen zu erwerben, diese Saiteanschlugen — so glaube ich doch, daß diese JugendVerstimmungenbei Franz Ferdinand weniger in das Gewicht fielenals die bereits erwähnten, auf seine Krankheit zurückreichendenVorfälle.Abgesehen von diesen persönlichen Antipathien, welcheer von einigen wenigen Ungarn auf dieganze Nation übertrug,waren aber doch sehr tiefgehende und begründetepolitische Ursachen vorhanden, welche den Erzherzog inseinergegnerischen Haltung gegenüber Ungarn bestärkten.Franz Ferdinand hatte einen ungemein feinen politischenWitterungssinn. Und dieser Witterungssinn ließ ihn4 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> AQ
Konopi-chterkennen, daß die ungarische Politik eine eminente Gefahr fürdie Existenz des gesamten Habsburger Reiches sei. SeinWunsch, die magyarische Vorherrschaft zu brechen und denNationalitäten zu ihrem Rechte zu verhelfen, hat ihn niemalsverlassen, und bei jeder politischen Entscheidung oder Handlunghat er die Frage von diesem Standpunkte aus geprüft.Er war der. stetige Vertreter der Rumänen, der Slowakenund der übrigen in Ungarn lebenden Nationalitäten undging allerdings darin oft so weit, daß er eine jede Frage sofortim antimagyarischen Sinne gelöst haben wollte, ohne dieselbeüberhaupt objektiv und sachlich zu prüfen. Diese seineTendenz war selbstverständlich in Ungarn kein Geheimnisgeblieben und löste dort bei den magyarischen Machthaberneine starke Reaktion aus, welche er wiederum als eine reinpersönliche, gegen ihn selbst gerichtete feindselige Oppositionauffaßte, wodurch sich die bestehenden Differenzenmit den Jahren automatisch vergrößerten und schließlichunter dem Regime Tiszas zu einer direkten Feindschaftführten.Eine noch stärkere Antipathie als gegen Tisza hatte derErzherzog gegen verschiedene andere Führer in Ungarn, sovor allem gegen eine der markantesten Figuren der damaligenZeit.ist;Ich weiß nicht genau, was zwischen beiden vorgefallenich weiß nur, daß der Herr mehrere Jahre vor der Katastropheeine Audienz im Belvedere hatte,welche jedenfallseinen sehr unbefriedigenden Verlauf genommen hat. DerErzherzog erzählte mir, „der Herr sei mit einer ganzen Bibliothekerschienen, um den gesetzlichen Beweis zu erbringen,daß der magyarische Standpunkt der berechtigte sei. Er,der Erzherzog, pfeife auf diese Gesetze, habe dies auch gesagt.Sie seien gewaltig aneinandergeraten, und der Herrsei bleich wie die Wand hinausgewankt".Sicher ist, daß die Minister und die übrigen Beamten seltenohne Herzklopfen zu dem Erzherzog gingen; er konnte dieMenschen so anfahren und verschrecken, daß sie völlig den50
KonopischtKopf verloren. Ihren Schrecken nahm er dann oft wiederfür Stütz und passive Resistenz und wurde noch gereizter.Auf der anderen Seite war er ungemein leicht zu entwaffnen,wenn man ihn gut kannte und sich nicht imponieren ließ.Ich habe zahllose Szenen mit ihm gehabt und bin auch selbstdabei öfters heftig geworden, aber eine dauernde Verstimmungwar nie vorhanden. Einmal in Konopischt machteer mir des Abends nach dem Essen eine Szene, „weil ich ihm— dem Erzherzog — fortgesetzt entgegenarbeitete, seineFreundschaft durch Verrat vergelte". Ich brach das Gesprächab, indem ich erklärte, wenn er solche Dinge rede,so sei eine vernünftige Konversation nicht mehr möglich;im übrigen würde ich den nächsten Morgen abreisen. Wirtrennten uns, ohne uns „Gute Nacht" zu sagen.In der Früh'— ich lag noch im Bette — erschien er in meinem Zimmerund sagte mir, „ich möge vergessen, was er gestern gesagthabe, es sei nicht ernst gemeint gewesen" usw., und entwaffnetemeine noch bestehende Verstimmung vollständig.Ein Verächterder Menschen und gewitzigtdurch die Erfahrungen,die er schon selbst gemacht hatte, ließ er sich durch Servilität,Kriecherei und Schmeichelei nicht betören. Er hörte dieMenschen an, aber wie oft habe ich von ihm vernommen:„Mit dem ist es nichts, der ist ein Kriecher." Und diese Sortehatte bei ihm für immer ausgespielt, weil er ihnen fortanständig mißtraute. Er war mehr als irgendein anderer^aus dieser hohen Sphäre gegen das Gift der Servilität gewappnet,an welchem mehr oder weniger alle Monarchenerkranken.Seine zwei besten Freunde und die Menschen, welche ernebst seiner engsten Familie zweifellos am liebsten hatte,waren sein Schwager Albrecht von Württemberg und derFürst Karl Schwarzenberg.Ersterer ein Mann von reizendem Wesen, hoher Intelligenzund politisch ebenso klug wie militärisch tüchtig, lebte mitFranz Ferdinand auf dem Fuße echter brüderlicher Eintracht.
KonopischtEs ist selbstverständlich, daß zwischen beiden ein ZustandvölligerParität herrschte.Karl Schwarzenberg war der aufrichtigste,ehrlichste undgeradeste Charakter, dem ich jemals begegnet bin, und einMann, der niemandem die Wahrheit vorenthielt. Reich,unabhängig, selbstbewußt und ohne irgendwelche persönlicheAmbitionen, war es ihm völlig gleichgültig, ob dem ErzherzogEr war dessen Freunddas, was er verfocht, gefiel oder nicht.und hielt es für seine Pflicht, offen und ehrlich zu sein — wennes notwendig war, auch unangenehm. Der Erzherzog hatdas verstanden, geschätzt und geachtet. Ich glaube nicht,daß es viele Monarchen oder Thronfolger gibt, welche, wieder Erzherzog, die Art und Weise Schwarzenbergs ertragen undgewürdigt hätten.Sehr schlecht stand sich Franz Ferdinand mit Aehrenthal.Auch Aehrenthal war leicht schroff und ablehnend; daß diesebeiden harten Steine aber nicht zusammen mahle.i konnten,hatte doch einen anderen Grund. Ich glaube nicht, daß diegroßen Vorwürfe, die der Erzherzog gegen Aehrenthal erhob,politischen oder programmatischen Differenzen entsprangen;es war mehr die Art Aehrenthals, die den Thronfolger stetsverstimmte. Ich hatte Gelegenheit, Briefe Aehrenthals anFranz Ferdinand zu lesen, welche vielleicht unabsichtlicheinen etwas ironischen Beigeschmack hatten und welche indem Erzherzog das Gefühl auslösten, „nicht ernst genommenzu werden". In diesem Punkte war er ungemein empfindlich.Noch in der Krankheit Aehrenthals soll sich der Erzherzogsehr unfreundlich über den sterbenden Mann geäußert haben,und allgemein war damals die Empörung über die Gefühllosigkeitseiner Aussprüche. Er wohnte als Vertreter desKaisers der Einsegnung der Leiche bei, und nach derselbenempfing er mich im Belvedere. Wir standen im Hofe, alsder Zug mit dem Leichenwagen zum Bahnhof vorüberfuhr;der Erzherzog ging raschen Schrittes in eines der kleinenNebenhäuser, welches seine Fenster auf die Straße hat,52und
Konopischthier versteckt, hinter dem Vorhang des Fensters, ließ er denZug an sich vorbei passieren. Er sprach kein Wort, aberdicke Tränen standen in seinen Augen. Als er wahrnahm,daß ich seine Erregung bemerkte, wendete er sich rasch undunwillig ab, geärgert über den erbrachten Beweis seinerSchwäche. Das war ganz er. Lieber wollte er für hart undherzlos gehalten werden als für weich und schwach, undnichts war ihm unsympathischer als der Gedanke, er könneden Verdacht erwecken, eine Rührszene aufführen zu wollen.Für mich ist kein Zweifel, daß er in diesem Augenblicke unterheftigen Selbstvorwürfen gelitten hat — vielleicht mehr gelittenhat als ein anderer, der, nicht wie er verschlossen biszum Äußersten, seinen Gefühlen einen sichtbaren freien Laufgelassen hätte.Der Erzherzog konnte ungemein lustig sein und hatteausnehmend viel Sinn für Humor. Er konnte lachen wie einjunger Mensch in seinen glücklichsten Jahren und rißseineZuhörer mit mit seiner natürlichen Heiterkeit.Vor einigen Jahren war ein deutscher Prinz, welcher dievielen verschiedenen Erzherzöge nicht auseinanderkannte, inWien, und in der Hofburg fand ihm zu Ehren ein Dinerstatt, bei welchem er neben Franz Ferdinand saß. Es warim Projekte, daß "er mit dem 7 Erzherzog den nächsten Morgenin die Umgebung auf die Auerhahnbalz fahren solle. Derdeutsche Prinz, welcher den Erzherzog Franz Ferdinand fürirgend jemand anderen hielt, sagte ihm während des Essens:„Morgen soll ich auf die Jagd fahren, aber ich höre, mit demlangweiligen Franz Ferdinand, hoffentlich wird das nochgeändert." Es kam dann, soviel ich weiß, überhaupt nichtzu der Fahrt, und ich weiß auch nicht,ob der Prinz jemalsseinen Irrtum entdeckt hat — der Erzherzog aber lachtenoch nach Tagen über dieseEntgleisung.Mit viel Zuneigung'sprach der Erzherzog stets von seinemNeffen, dem späteren Kaiser Karl.' Das Verhältnis der beidenwar jedoch das einer unbedingten Subordination des Neffen53
Konopischtunter den Onkel. Auch in politischen Gesprächen war ErzherzogKarl stets nur der zuhörende Teil, der den AusführungenFranz Ferdinands lauschte.Die Heirat Karls fand die volle Zustimmung seines Oheims,auch die Herzogin von Hohenberg war stets von den liebevollstenGefühlen für das junge Ehepaar erfüllt.Der Erzherzog war ein unbedingter Anhänger des großösterreichischenProgramms. Sein Gedanke war der, dieMonarchie in zahlreiche mehr oder weniger selbständigeNationalstaaten aufzulösen, welche für wichtige und unumgänglichnotwendige Dinge einen gemeinsamen Zentralapparatin Wien besitzen sollten, d. h. mit anderen Worten,den Dualismus durch den Föderalismus zu ersetzen. Heute, wonach furchtbaren kriegerischen und revolutionären Krämpfendie Entwicklung der ehemaligen Monarchie sich in nationalemSinne vollzieht, wird es wohl schwer jemand geben, der diesenGedanken noch als Utopie bekämpfen würde. In der damaligenZeit aber hatte der Plan gewaltige Gegner, welche davorwarnten, den Staat zu zertrümmern, um an dessen Stelledann etwas ganz Neues und ,, angeblich Besseres" aufzubauen,und Kaiser Franz Joseph war viel zu konservativ und vielzu alt, um auf die Ideen seines Neffen einzugehen. Dieswieder, die direkte Ablehnung des Gedankenganges, dem derErzherzog huldigte, verletzte diesen, und er beschwertesich oft in bitteren Worten darüber, daß er beim Kaisernicht mehr gehört werde wie „der letzte Hausknecht inSchönbrunn". Die Gabe der Menschenbehandlung fehlte demErzherzog. Er konnte oder wollte sich nicht überwinden,und so charmevoll er sein konnte, wenn seine natürliche Herzlichkeitzum Ausdrucke kam, so wenig gelang es ihm, seinenZorn, seine Mißstimmung zu verbergen, und so erklärt essich auch, daß das Verhältnis zwischen dem alten Kaiserund ihm ein immer schlechteres und schlechteres wurde.Bei diesem so bedauerlichen Verhältnis zwischen Kaiser undThronfolger war die Schuld zweifellos eine beiderseitige. Der54
KonopisclitStandpunkt des alten Kaisers, „solange er regiere, habe niemandanderer hineinzusprechen", stand dem des Erzherzogs,„er werde einmal für die jetzt begangenen Regierungsfehlerbüßen müssen", schroff gegenüber, und ein jeder, der dasLeben bei Hofe kennt, wird wissen, daß solche zwischen denhöchsten Herren bestehenden Differenzen nie darauf zuwarten brauchen, geschürt und vergrößert zu werden. Anjedem Hofe finden sich Männer, die die Gunst ihres Herrndadurch erobern wollen, daß sie öl in das Feuer gießen unddurch Geschichten und Klatsch aller Art die Antipathie vergrößern.So war es auch im vorliegenden Fall, und statt sichnäherzukommen, entfremdeten sich die beiden immer mehr.Der Erzherzog hatte wenig Freunde, und unter den Monarchenso gut wie gar keinen. Dies war einer der Gründeseiner Annäherung an Kaiser Wilhelm. <strong>Im</strong> Grunde warzwischen ihm und Kaiser Wilhelm ein großer Unterschied,und sie waren so verschiedene Männer, daß eine wirklicheFreundschaft im wahren Sinne des Wortes, ein wirkliches Sichverstehengar nicht in Frage kommen konnte und auch tatsächlichnicht in Frage kam. Ähnlich in beiden Charakterenwar ein stark ausgeprägter autokratischer Zug, aber das warauch ungefähr alles. Nicht sympathisch waren dem Erzherzog-Thronfolgerdie Reden Kaiser Wilhelms, dessen offenbarerWunsch nach Popularität, den der Erzherzog nichtverstand. Kaiser Wilhelm seinerseits hat den Erzherzogzweifellos in den letzten Jahren bedeutend liebergewonnen,als er ihn ursprünglich hatte. Mit dem deutschen Kronprinzenverstand sich der Erzherzog Franz Ferdinand wenigergut. Die beiden Herren verbrachten einige Wochen gemeinsamin St. Moritz in der Schweiz, ohne sich dabei irgendwienäherzukommen, wobei allerdings der so große Altersunterschiedund die doch viel ernstere Lebensauffassung des Erzherzogseinen vollkommen erklärlichen Grund liefert.Die Abgeschlossenheit und Zurückgezogenheit, inder derErzherzog lebte, der bedauerlich geringe Umgang, den er55
Konopischtmit weiteren Kreisen hatte, haben es mit sich gebracht,daß neben manchem Wahren zahllose falsche Gerüchte überihn in Umlauf kamen. Eines dieser Gerüchte, welches sichmit großer Hartnäckigkeit bis auf die heutigen Tage erhaltenhat, geht dahin, daß der Erzherzog ein „Kriegshetzer" gewesensei und den Krieg als eine notwendige Kombinationin seine Zukunftspläne eingestellt hätte. Keine Variante istfalscher als diese. Obwohl der Erzherzog es mir gegenüberniemals offen zugegeben hat, so bin ich doch der Überzeugung,daß er das instinktive Gefühl hatte, daß die Monarchie diefurchtbare Kraftprobe eines Krieges nicht werde aushaltenkönnen, und Tatsache ist, daß er sich nicht nur nicht imkriegstreibenden, sondern im entgegengesetzten Sinne betätigthat. Ich erinnere mich an eine ungemein symptomatischeEpisode; ich kann mich nicht genau auf das Datumerinnern, es war einige Zeit vor dem Tode des Erzherzogs,als einer jener berüchtigten Balkanrummel die MonarchieAufregung versetzte und die Frage, ob mobilisiert werden'insolle oder nicht, auf die Tagesordnung brachte. Ich war zufälligin Wien, wo ich eine Unterredung mit Berchtold hatte,der sehr besorgt über die Situation sprach und sich darüberbeschwerte, daß der Erzherzog angeblich im kriegerischenSinne einwirke. Ich machte mich erbötig, den Erzherzog aufdie Gefahr eines solchen Vorgehens aufmerksam zu machen,setzte mich mit diesem telegraphisch in Verbindung undvereinbarte mit ihm, noch denselben Tag in seinen Zug inWessely einzusteigen, durch welche Station er, von Chlumeckommend, nach Konopischt zurückfuhr. Ich hatte nur diekurze Zeit zwischen den beiden Stationen zu der Unterredung,nahm daher sofort den Stier bei den Hörnern und erklärte demErzherzog die in Wien über ihn kursierenden Gerüchte und dieGefahr, durch ein allzu scharfes Vorgehen auf dem Balkaneinen Konflikt mit Rußland heraufzubeschwören.Ich fandauch nicht den geringsten Widerspruch seitens des Erzherzogs,und in jener expeditiven Art, die ihm eigen war,56
Konopischtschrieb er noch im Zuge ein Telegramm an Berchtold, welchesseine volle Zustimmung zu einer entgegenkommenden Haltungaussprach und die Gerüchte über seine angebliche entgegengesetzteHaltung dementierte.Sicher ist, daß gewisse Militärs,welche den Krieg wünschten, den Erzherzog benutzten oder,besser gesagt, mißbrauchten, um in seinem Namen eineKriegspropaganda zu treiben, und auf diese Art und Weiseein so völlig falsches Urteil über ihn hervorriefen. Verschiedenedieser Militärs sind im Kriege den Heldentod gestorben.Andere sind verschwunden und vergessen. Niemalswar unter denen, die den Erzherzog vorschoben, der GeneralstabschefConrad. Dieser Mann schob niemanden vor. Waser notwendig fand, vertrat er selbst offen und gegenüberjedermann.Ein merkwürdiges Detail verdient im Zusammenhangemit diesen Gerüchten über den Erzherzog erwähnt zu werden.Er selbst hat mir erzählt, eine Wahrsagerin habe ihm prophezeit,,,er werde einst den Weltkrieg entfesseln". Obwohl ihmdiese Wahrsagung bis zu einem gewissen Grade schmeichelte,lag doch darin die unausgesprochene Anerkennung, daß dieWelt mit ihm als einem starken Faktor werde rechnen müssen,so betonte er doch ausdrücklich, wie unsinnig eine solcheProphezeiung sei. Sie ist doch später wahr geworden, dieseProphezeiung, nur so ganz anders, als sie damals verstandenwurde, und unschuldiger hat noch nie ein Fürst ein Blutvergießenhervorgerufen als das arme Opfer von Sarajevo.Unverhältnismäßig stark hat der Erzherzog unter denVerhältnissen gelitten, welche die Folgen seiner unebenbürtigenHeirat waren.Die wahre, aufrichtige Liebe, die er zu seinerGattin hatte, ließ in ihm den Wunsch nicht sterben, dieselbezu seiner völlig, auch äußerlich, gleichberechtigten Gemahlinzu machen, und die fortwährenden Widerstände, die er imHofzeremoniell fand,verbitterten und verärgerten ihn überalle Maßen. Der Erzherzog hatte die feste Absicht, sofortnach seiner Thronbesteigung seiner Gemahlin zwar nicht den57
KonopischtTitel einer Kaiserin, jedoch eine Stellung einzuräumen,welche ihr ohne diese Titulatur den ersten Rang gegebenhätte. Er motivierte dies damit, „sie werde überall, wo ersei, als Hausfrau auftreten, und der Hausfrau gebühre immerder erste Platz. Daher werde sie allen Erzherzoginnen imRange vorausgehen". Niemals hat der Erzherzog jedochauch nur im entferntesten daran gedacht, die Thronfolgeumzustoßen und seinen Sohn an Stelle des Erzherzogs Karlzu setzen. Er war im Gegenteil entschlossen, als erste Amtshandlungnach der Thronbesteigung eine feierliche Erklärungzu veröffentlichen,in welcher dieser sein Standpunkt dokumentiertwerde, um den immer wiederkehrenden diesbezüglichenfalschen und tendenziösen Nachrichten entgegenzutreten.Für seine Kinder, für die er alles an Liebe aufbrachte,was ein Vaterherz aufbringen kann, hatte er stets nur denWunsch, sie zu sehr wohlhabenden, selbständigen Privatierszu machen, welche frei von Sorgen um das materielle Wohlihr Leben genießen können. Für seinen ältesten Sohn hatteer sich den Titel eines Herzogs von Hohenberg zurecht gelegt,und es war daher vollständig in seinem Sinne, als KaiserKarl dem jungen Herrn diesen Titelverlieh.Eine hübsche Eigenschaft des Erzherzogs war seine Furchtlosigkeit.Er war sich vollständig im klaren darüber, daß dieGefahr eines Attentates für ihn immer bestehe, und er sprachoft und vollständig ohne jede Pose über diese Eventualitäten.Von ihm erhielt ich ein Jahr vor Kriegsausbruch die Nachricht,daß die Freimaurer seinen Tod beschlossen hätten.Er nannte auch die Stadt, wo dieser Beschluß angeblich gefaßtworden sei — dies ist mir entfallen — und nannte dieNamen verschiedener österreichischer und ungarischer Politiker,welche davon wissen müßten. So erzählte er ferner gerne,daß er, ich glaube bei der Krönungsfeierlichkeit des Königsvon Spanien, in dem Zuge mit einem russischen Großfürsteneingeteilt worden sei und knapp vor der Abfahrt die Nachrichterhalten habe, daß dieser Großfürst während der Fahrt58
Konopischtermordet werden solle.Er leugnete nicht, daß er mit gemischtenGefühlen in seinen Wagen eingestiegen sei.In St. Moritzerhielt er die Nachricht, daß zwei türkische Anarchisten inder Schweiz eingetroffen seien mit der Absicht, ihn zu morden,daß alle Anstrengungen gemacht würden, ihrer habhaft zuwerden, bisher aber keine Spur von ihnen gefunden wordensei, und er möge auf der Hut sein. Der Erzherzog zeigtemir damals das diesbezügliche Telegramm. Ohne die geringsteAngst zu verraten, legte er es lächelnd beiseite, da, wie ermeinte, die angekündigten Attentate selten zur Ausführunggelangten. Um so mehr litt die Herzogin in der Furcht umsein Leben, und ich glaube, die arme Frau hat die Katastrophe,der sie und ihr Mann schließlich zum Opfer gefallen sind,hundertmal im Geiste vorausgesehen. Auch das war einhübscher Zug des Erzherzogs, daß er aus Rücksicht für seineFrau und ihre Ängstlichkeit die ständige Begleitung einesDetektivs duldete, dessen Gegenwart ihn nicht nur langweilte,sondern dessen Anwesenheit er auch als lächerlich empfand.Er fürchtete, das Bekanntwerden dieser Tatsache könnte aufihn den Schein der Furchtsamkeit werfen, und nur um seinerFrau eine gewisse Beruhigung zu schenken, brachte er ihrdieses Opfer.Aber alle seine guten Eigenschaften versteckte er fast ängstlich,und in einem gewissen Trotz setzte er etwas hinein, sichhart und unangenehm zu zeigen. Ich will hier nicht versuchen,gewisse Züge seines Charakters zu entschuldigen.Sein stark ausgeprägter Egoismus istebensowenig zu leugnenwie jene Härte des Charakters, welche für die Leiden allerderer, die ihm nicht persönlich nahestanden, nichts übrighatte. Er machte sich ferner verhaßt durch seine strengfinanziellen Maßnahmen und seine Unerbittlichkeit gegenjeden Untergebenen, dem er auch nur die geringste Unredlichkeitvorzuwerfen glauben konnte. Die diesbezüglichenAnekdoten gehen in die Hunderte, sind zum Teil wahr,zum Teil falsch. Diese kleinlichen Charakterzüge haben ihm59
Konopischtbegreiflicherweise in der großen Öffentlichkeit viel geschadet,und die wirklich großen und männlichen Eigenschaften, die erhatte, waren der Öffentlichkeit unbekannt und fielen dahernicht zu seinen Gunsten in die Wagschale. Für die, welcheihn näher kannten, überwogen die großen undschönen Eigenschaften hundertmal die schlechten.Sehr groß war stets die Besorgnis des Kaisers vor denZukunftsplänen des Erzherzogs. Auch der alte Herr hatteeinen strengen Zug in seinem Charakter, und er fürchtetedie <strong>Im</strong>petuosität und den starren Sinn seines Neffen imInteresseder Monarchie.Dabei hat er oft wieder eine in das Großartige gehende Auffassungbewiesen. Der ermordete Ministerpräsident GrafStürgkh hat mir beispielsweise die Details meiner seinerzeitigenErnennung in das Herrenhaus erzählt, welche — wieich glaube — den alten Kaiser genau charakterisieren. Ichwurde in das Herrenhaus auf Wunsch Franz Ferdinandsvorgeschlagen, weil dieser meine Entsendung in die Delegationund meine intensivere Schulung auf dem Gebiete deräußeren Politik wünschte. Nun muß erwähnt werden, daßdem alten Kaiser von vielen Seiten zugetragen wurde, daßdie Freunde und die Vertrauensmänner des Erzherzogsgegen ihn, den Kaiser, arbeiteten, eine Version, die er offenbarbis zu einem gewissen Grade glaubte, dank der vielenKonflikte mit Franz Ferdinand. Als ihm mein Name vonStürgkh für die Ernennung in das Herrenhaus genanntwurde, stutzte der Kaiser einen Augenblick und sagte dann:„Ach ja, das ist der, der nach meinem Tode Minister desÄußern werden soll, — ja, der soll nur ins Herrenhaus kommen,um noch etwas zu lernen." Es liegt zweifellos Größe in diesemGedankengang und Ausspruche.Schwierig waren die politischen Gespräche mit KaiserFranz Joseph öfters deshalb, weil er sich streng an die Ressortshielt und mit einem jeden nur das ihn direkt Betreffende besprach.60Mit mir besprach der Kaiser, als ich Gesandter war,
KonopischtRumänien und den Balkan, sonst nichts. Nun hängen dieverschiedenen Fragen aber innerlich oft so eng zusammen,daß diese Scheidung unmöglich wird. Ich erinnere mich aneine Audienz, in welcher ich dem alten Kaiser über dierumänischen Pläne eines engeren Anschlusses an die Monarchiereferierte, Pläne, welche ich in einem späteren Kapitel erwähne,und wobei ich selbstverständlich darüber sprechenmußte, wie sich die Rumänen diese Angliederung an Ungarnvorstellen, respektive welche Änderungen in der Struktur derungarischen Verfassung hierfür notwendig seien. Der Kaiserbrach das Gespräch ab, mit Hinweis darauf, das sei interneungarische Politik.Der alte Kaiser war fast stets sehr wohlwollend und gütigund verblüffte noch in allerletzter Zeit durch seine Kenntnisder kleinsten Details.So sprach er von den verschiedenenrumänischen Ressortministern nicht per „der Ackerbau" -oder „der Handelsminister", sondern nannte stets ihre Namen,ohne sich jemals zu irren.Das letztemal sah ich ihn nach meiner definitiven Rückkehraus Rumänien, im Oktober 1916, und fand ihn damals immernoch klar und geistig frisch, jedoch körperlich stark verfallen.Kaiser Franz Joseph war einGrandseigneur im wahrstenSinne des Wortes. Er war der Kaiser. Er blieb immer unnahbar.Jeder, der von ihm ging, war unter dem Eindruck,vor dem Kaiser gestanden zu sein. In der Würde als Exponentder monarchischen Idee war er allen SouveränenEuropas weit überlegen.In dem Zeitpunkte großer militärischer Erfolge der Mittelmächtewurde er zu Grabe getragen. Nun liegt er in derKaisergruft, aber seit seinem Tode scheint ein Jahrhundertvergangen. Die Welt hat sich geändert.Der Menschenstrom wallt Tag für Tag an der kleinen Kirchevorüber, aber wohl keiner denkt mehr an den, der still undvergessen darin Hegt, und der doch durch lange Jahrzehnte61
Konopischt„Österreich" war, dessen Person das einzige war, das demmehr und mehr auseinanderfallenden Staat noch ein gemeinsamesZentrum gab.Da ruht er nun aus von all seinem Kummer und allseinen Sorgen; Frau, Sohn und Freunde sah er sterben, denAnblick seines sterbenden Reiches wenigstens hat ihm dasSchicksal erspart.Franz Ferdinand war ein scharf gemeißelter Charakter mitvielen Ecken und Kanten; er hatte große Fehler, kein objektiverBeurteiler wird dies leugnen, aber er war keinervon denen, bei welchen zwölf auf ein Dutzend gehen. Soergreifend die Umstände seines Todes waren — vielleicht wares ein Glück für ihn. Es ist kaum denkbar, daß sich der Erzherzog,einmal auf dem Thron, mit seinen Ideen hätte durchsetzenkönnen. Das Gebäude der Monarchie, welches ergerne stützen und festigen wollte, war bereits dermaßenmorsch, daß es keinen stärkeren Eingriff mehr vertrug, undwenn nicht dieser Krieg von außen, so hätte es wahrscheinlichdie Revolution von innen gesprengt — der Kranke warschwerlich mehr in der Lage, die Operation auszuhalten.Auf der anderen Seite scheint es zweifellos, daß der Erzherzog-Thronfolgermit der ganzen Vehemenz und <strong>Im</strong>pulsivitätseines Charakters den Versuch unternommen hätte, dieStruktur der Monarchie von Grund auf zu ändern, und somüßig es ist, Kombinationen über die Möglichkeit des Gelingenshier anzustellen — nach menschlicher Voraussicht wäre dasExperiment nicht gelungen, und er wäre unter den Trümmernder zusammenbrechenden Monarchie erschlagen worden.Es ist schließlich auch müßig, Vermutungen darüber aufzustellen,wie der Erzherzog sich benommen hätte, wenn erden Krieg und den Umsturz erlebt hätte. Ich glaube, daßseine Haltung in zweifacher Hinsicht von der, die eingeschlagenwurde, abgewichen wäre.62Erstens hätte er niemals
Konopischtzugegeben, daß unsere Armee völlig unter die KuratelDeutschlands komme. Das wäre seinem stark entwickeltenautokratischen Zug gegen den Strich gegangen, und er warauch politisch zu klug, um nicht zu verstehen, daß wir damitjede politische Aktionsfreiheit verlieren. Zweitens wäre ernicht, wie Kaiser Karl, der Revolution gewichen. Er hätteseine Getreuen um sich versammelt und wäre mit dem Säbelin der Hand gefallen; er wäre gefallen,gefährlichsterGegner Stephan Tisza.wie sein größter undAber auf dem Schlachtfeld der Ehre ist er ja als ersterwie ein Held gestorben, tapfer und im Dienste.Die goldenenStrahlen der Märtyrerkrone umgaben sein sterbendes Haupt.Viele der Kleinen und Kleinsten haben wie befreit von einemAlp aufgeatmet, als sie die Kunde von seinem Tode erhielten.Am Wiener Hofe und in der Budapester Gesellschaft hat esmehr Freudige als Leidtragende gegeben, und die ersteren mitrichtiger Vorahnung, denn unter ihnen hätte er fürchterlichaufgeräumt.Sie alle konnten nicht ahnen, daß der Gewaltigesie im Sturze mitreißen und daß die entfesselte Weltkatastrophesie alle verschlingen werde.Auch Franz Ferdinands Bild „schwankt noch in der Geschichte,von der Parteien Haß und Gunst verwirrt". Abersein tragischer Tod an der Seite seiner Frau, die noch imSterben mit ihm vereint sein wollte, wirft ein mildes, versöhnendesLicht auf das ganze Leben dieses eigenartigenMannes. Die letzten Schläge dieses heißen Herzens galtenseinem Vaterlande und seinerPflicht.Es war eine in der damaligen Monarchie ziemlich verbreitetefalsche Auffassung, daß der Erzherzog ein fertig ausgearbeitetesProgramm für seine zukünftige Tätigkeit habe. Dieswar nicht der Fall. Der Erzherzog hatte bestimmte undzwar sehr ausgesprochene Richtlinien, nach welchen er die63
KonopischtUmgestaltung der Monarchie projektierte, aber es waren dochnur allgemeine Richtlinien, ich möchte sagen der Rahmeneines Programms, welcher niemals detailliert ausgefülltworden ist. Der Erzherzog ist mit Fachmännern der verschiedenenRessorts in Verbindung gestanden, er hat hervorragendenMilitärs sowohl wie ihm nahestehenden Politikerndie Grundgedanken seines Zukunftsprogrammes entwickeltund sich Anregungen geben lassen, wie dieselben in die Tatumzusetzen seien — aber zu einem wirklich fertig ausgearbeitetenProgramm ist es niemals gekommen. Die Grundlinienseines Programmes waren, wie bereits höher oben an,gedeutet, die Abschaffung des Dualismus und die Umgestaltungder Monarchie in einen Föderativstaat. In wievieleLänder die Habsburgische Monarchie zerfallen wäreschienihm selbst noch nicht ganz klar, aber das Prinzip warder Wiederaufbau der Monarchie auf nationaler Basis. <strong>Im</strong>mervon dem Gedanken ausgehend, daß die Voraussetzung desGedeihens die Schwächung des magyarischen Einflusses sei,wünschte der Erzherzog eine denkbar starke Bevorzugungder in Ungarn lebenden Nationalitäten, vor allem der Rumänen.Erst nach meiner später zu besprechenden Entsendungnach Bukarest und nach meinen einschlägigen Berichtenfaßte der Erzherzog den Plan, unter der BedingungSiebenbürgen an Rumänien abzutreten, daß dieses neugeschaffeneGroßrumänien sich dem Habsburger Reicheeinfüge.In Österreich dachte er sich einen deutschen, tschechischen,südslawischen und polnischen Staat, welche in mancher Beziehungautonom, in mancher Beziehung vom zentralen Wienabhängig gewesen wären. Aber wie erwähnt, ganz fest undklar stand, soviel ich weiß, sein Programm nicht, und dieverschiedenen Modifikationen, die es auch in seinem Kopfenoch durchmachte, waren sehr bedeutend.Eine lebhafte Abneigung hatte der Erzherzog gegen jeneDeutschen speziell Nordböhmens, welche Anhänger des64
Konopischtpangermanistischen Gedankens waren, und er hat beispielsweisedem Abgeordneten Schönerer seine Haltung nie verziehen.Eine unbedingte Vorliebe hatte er für die Deutschender Alpenländer, wie überhaupt seine ganze Richtung jenerder Christlichsozialen am nächsten kam. Lueger war seinpolitisches Ideal. Als Lueger bereits sehr krank war, sagtemir der Erzherzog: „Wenn Gott uns diesen Mann nur erhaltenwollte, ein besserer Ministerpräsident ist undenkbar."Ungemein stark ausgeprägt war bei Franz Ferdinand derWunsch nach straffer Zentralisierung der Armee. Er war derheftigste Gegner der magyarischen Bestrebungen, welche eineselbständige ungarische Armee bezweckten, und die Frageder Embleme, der Kommandosprache und einschlägige Dingekonnten, solange er lebte, zu keinem Ende gebracht werden,weil er allen ungarischen Vorstößen den größten Widerstandentgegensetzte.Ein besonders warmes Herz hatte der Thronfolger für dieFlotte. Seine häufigen Aufenthalte in Brioni brachten ihmunsere Marine näher, und der Gedanke, die Flotte dereinstzu heben und zu einer wirklichen Großmachtflotte umzugestalten,hat ihn stets begleitet. In außenpolitischer Richtunghat der Erzherzog stets an dem Gedanken eines Dreikaiserbündnissesfestgehalten. Das leitende Motiv bei diesem Gedankendürfte das gewesen sein, daß er in den drei damalsso mächtig scheinenden Monarchen von Petersburg, Berlinund Wien die sicherste Stütze gegen die Revolution erblickteund dergestalt einen starken Wall gegen den Umsturz aufzurichtenwünschte. Er sah in der Wien-Petersburger Konkurrenzauf dem Balkan eine große Gefahr für das gute Einvernehmen. zwischen Rußlands und uns, und er war daherganz im Gegensatze zu den über ihn verbreiteten Gerüchtenbei weitem eher ein Gönner als Gegner der Serben. Er warfür die Serben schon aus dem Grunde, weil er davon durchdrungenwar, daß die kleinliche magyarische Agrarpolitikden Hauptgrund der ewigen Verstimmungen der Serben5 Czeiain <strong>Im</strong> Weltkriegs QC
Konopischtbilde. Er war zweitens für ein Entgegenkommen Serbiengegenüber, weil er die serbische Frage als störend zwischenWien und Petersburg empfand, und er war drittens für dieSerben, weil er aus persönlichen und sachlichen Gründen keinFreund König Ferdinands von Bulgarien war, welcher seinerseitsja eine antiserbische Politik betrieb. Ich glaube, wenndiejenigen, welche die Mörder gegen den Erzherzog geschickthaben, gewußt hätten, wie wenig gerade jene Intentionen beiihm vorhanden waren, wegen derer sie ihn ermordeten — siewären von ihrem Mordplane abgestanden.Ungemein stark ausgesprochen war dabei in Franz Ferdinanddas Gefühl, daß die Monarchie trotz allerBündnisseselbständig bleiben müsse. Er war ein Gegner eines jedennoch engeren Anschlusses an Deutschland, er wollte anDeutschland nicht enger angeschlossen sein als an Rußland,und jener Plan, welcher später unter dem Begriff „Mitteleuropa"Form angenommen hat, war stets außerhalb seinerWünsche und Bestrebungen.Seine Zukunftsideen waren nicht ausgearbeitet, nicht fertig,vielfach lückenhaft, aber sie waren gesund. Das genügtjedoch noch lange nicht zu dem Glauben, daß ihreDurchführungauch gelungen wäre. Energie allein ohne die nötigeGeduld kann unter Umständen mehr Schaden als Segenanstiften.
III.Wilhelm" II.5*
Kaiser Wilhelm hat so lange sichtbar im Zehtrum der weltgeschichtlichenEreignisse gestanden, es ist so viel überihn geschrieben worden, daß er eigentlich allerWelt als bekannterscheint. Und dennoch glaube ich, daß er vielfachfalsch beurteilt wird.Es ist bekannt, daß der rote Faden, welcher sich durch denCharakter und den ganzen Gedankengang Wilhelms IL zog,seine feste Überzeugung von seinem „Gottesgnadentum" undvon den „in dem deutschen Volke unausrottbar wurzelndendynastischen Gefühlen" war. Auch Bismarck glaubte an dasdynastische Gefühl der Deutschen.Mir scheint, daß es ebensowenig ein allgemein dynastisches als ein allgemein republikanischesGefühl der Völker gibt,bei den Deutschen ebensowenig wie irgendwo anders, sondern nur ein Gefühl der Zufriedenheitoder Unzufriedenheit, welche sich je nachdem füroder gegen die Dynastie und die Staatsform äußert.Bismarckselbst war ein Beweis für die Richtigkeit dieser Argumentation.Er war, wie er selbst stets behauptete, „durch und durch dynastisch",aber nur, solange Kaiser Wilhelm I. lebte ; Wilhelm IL,der ihn schlecht behandelt hatte, liebte er nicht, und er machteaus seinen Gefühlen kein Geheimnis. Er hängte das Bild des„jungen Mannes" in die Waschküche und schrieb ein Buchüber ihn, welches dank der Angriffe, die es enthielt, nicht veröffentlichtwerden konnte. Die Monarchisten, die sich ausihrer angestammten Treue für das Herrscherhaus ein Verdienstvindizieren, täuschen sich selbst über ihre Gefühle;sie sind Monarchisten, weil sie diese Staatsform für die69
Wilhelm II.befriedigendste halten.Und die Republikaner, welche angeblichdie „Majestät des Volkes" verherrlichen, meinen de factosich selbst dabei. Ein Volk aber wird sich auf die Dauer immerzu jener Staatsform bekennen, welche ihm am ehesten Ordnung,Arbeit, Wohlstand und Zufriedenheit bringt. Beineunundneunzig Prozent der Bevölkerung ist der Patriotismusund ihre Begeisterung für die eine oder andere Staatsformimmer nur eine Magenfrage. Ein guter König ist ihnen lieberals eine schlechte Republik und umgekehrt — die Staatsformist das Mittel zum Zweck, der Zweck aber ist die Zufriedenheitder Regierten. Auch mit der Freiheit der Regierten hat dieStaatsform gar nichts zu tun. Das monarchische England istgenau so frei wie das republikanische Amerika, und dieBolschewisten haben der ganzen Welt ad oculos demonstriert,daß das Proletariat die allergrößte Tyrannei ausübt.Der verlorene Krieg hat die Monarchen hinweggefegt,aber die Republik wird sich ihrerseits nur halten, wenn sieden Völkern die Überzeugung beibringt, daß es ihr besser gelingt,die Massen zufriedenzustellen, als es den Monarchiengelungen ist, ein Beweis, den — wie mir scheint — die deutschösterreichischeRepublik bisher noch schuldig geblieben ist.Die Überzeugung, daß diese Binsenwahrheiten nicht nurfalsch, sondern verwerfliche und sträfliche Irrtümer seien,daß ein göttlicher Wille den Monarchen auf seine Stelle gesetzthabe und ihn auch dort erhalte — diese Überzeugungwurde in dem deutschen Volke systematisch gezüchtet undbildete einen integrierenden Bestandteil des auch demKaiser anerzogenen Denkens.Alle seine Aussprüche sind aufdiesen Grundton gestimmt, sie alle atmen diesen Gedanken.Ein jeder Mensch aber istdas Produkt seiner Geburt, seinerErziehung und seiner Erfahrung. Und bei der BeurteilungWilhelms II. muß berücksichtigt werden, daß er von Jugendauf getäuscht und ihm eine Welt gezeigt worden ist, die garnicht besteht. Allen Monarchen sollte gelehrt werden, daßihr Volk sie gar nicht liebt, daß sie ihm im besten Falle ganz70
Wilhelm II.gleichgültig sind, daß es ihnen nicht aus Liebe nachläuft undsie nicht aus Liebe anstarrt, sondern aus Neugierde, daß esihnen nicht aus Begeisterung zujubelt, sondern aus Unterhaltungund aus „Hetz" und genau so gern pfeifen würde,wie es jubelt — daß nicht der geringste Verlaß auf die „Treueder Untertanen" ist, daß sie auch gar nicht die Absicht haben,treu zu sein, sondern nur zufrieden sein wollen, daß sie dieMonarchen dulden, solange sie entweder durch die eigeneZufriedenheit hierzu veranlaßt werden oder, falls nicht, solangesie nicht die Kraft haben, sie davonzujagen. Das wäredie Wahrheit, und ihre Kenntnis würde die Monarchen vorsonst unvermeidlichen Trugschlüssen bewahren.Kaiser Wilhelm ist hierfür ein Schulbeispiel. Ich glaubenicht, daß es einen Regenten gibt, der von einem besserenWillen beseelt war als Kaiser Wilhelm. Er lebte nur seinemsein ganzes Denken undBerufe — so wie er ihn auffaßte — ,Trachten kreiste um den deutschen Pol. Familie, Zerstreuung,Vergnügen, alles trat bei ihm zurück hinter dem einen Gedanken,das deutsche Volk groß und glücklich zu machenund zu erhalten, und wenn der gute Wille genügen würde,um Großes zu leisten, so hätte Kaiser Wilhelm Großes leistenmüssen. Von Anfang an ward er mißverstanden. Er hieltReden, tat Aussprüche und machte Gesten, die nicht nur dieZuhörer, aber die Welt gewinnen sollten, und stieß so oftdamit ab.Aber nie kam er zum Bewußtsein des tatsächlichenEffektes seiner Handlungen, weil er nicht so sehr von seinerUmgebung im engeren Sinne, sondern von dem ganzen deutschenVolke systematisch getäuscht und irregeführt wurde.Wie viele Millionen, die heute nur Flüche hinter ihm herschleudern,konnten sich nicht tief genug bücken, wenn erim Glänze seiner ganzen Herrlichkeit am Horizont erschien,wie viele fühlten sich beglückt, wenn nur ein kaiserlicherBlick auf sie fiel — und alle sie sind sich wohl heute nichtklar darüber, daß sie selbst die Schuld daran tragen, demKaiser eine Welt vorgetäuscht zu haben, die niemals bestanden71
Wilhelm II.hat, und ihn in eine Richtung getrieben zu haben, inwelche er sonst nie gekommen wäre. Gewiß soll nicht geleugnetwerden, daß das ganze Naturell Wilhelms IL für diesedeutsche Art besonders empfänglich war, und daß Monarchen,die weniger talentiert, weniger lebhaft, weniger beredt undvor allem weniger von dem Bedürfnisse erfüllt sind, selbsthervorzutreten, dem Gifte der Popularität weniger ausgesetztsind, als er es war.Ich hatte zufällig Gelegenheit, Kaiser Wilhelm in einer inseinem Leben sehr wichtigen Phase zu studieren. In denberühmten Novembertagen des Jahres 1908, als die großenStürme im Reichstage gegen Kaiser Wilhelm losbrachen, alsder damalige Reichskanzler Fürst Bülow ihn so ziemlichpreisgab, war ich mit dem Kaiser bei einem Freunde zusammen.Obwohl er mit uns fremden Gästen, die ihm fernerstanden, über das Thema nicht sprach, so war doch der überwältigendeEindruck, den diese Berliner Vorgänge auf ihnmachten, vollständig sichtbar, und ich hatte das Gefühl, inWilhelm IL einen Menschen zu sehen, der mit vor Entsetzengeweiteten Augen zum erstenmal in seinem Leben die Welt sosieht, wie sie wirklich ist. Er sah am Horizont die brutaleWirklichkeit aufsteigen, die ihm wie eine häßliche Fratzeerschien. Vielleicht zum erstenmal in seinem Leben fühlteer ein leises Beben unter den Füßen seines Thrones. Er hatdie Lehre zu schnell vergessen. Wäre der überwältigende Eindruck,der durch mehrere Tage vorgeherrscht hat, ein nachhaltigergeblieben, vielleicht hätte es ihn dazu bewogen, ausden Wolken, in welche ihn seine Umgebung und sein Volkhinaufgehoben hatte, herunterzusteigen und wieder festenBoden unter den Füßen zu suchen. Und umgekehrt : hätte dasdeutsche Volk den Kaiser öfter so hart angefaßt wie damals,so hätte es ihn heilen können.Ein merkwürdiges Detail, welches bezeichnend ist für dieganze Art und Weise, wie Kaiser Wilhelm auch von manchenHerren seiner Umgebung behandelt wurde, spielte sich bei72
Wilhelm ILdieser Gelegenheit ab: Ich hatte bei der Hinfahrt in einerdeutschen Bahnhofrestauration, in welcher ich die Ankunftdes nächsten Zuges abwarten mußte, Gelegenheit, die Aufregungder Bevölkerung über die Berliner Vorgänge zustudieren und eine kleine Welle zu sehen, welche fast revolutionärenCharakter trug. Die dichtgefüllte Restaurationwiderhallte von dem Tagesgespräche und der heftigen Kritikgegen den Kaiser, und plötzlich stand einer der Männer aufeinem Tische und hielt eine Brandrede gegen das Staatsoberhaupt.Noch ganz unter dem Eindruck dieser vorgefallenenSzene erzählte ich dieselbe den Herren aus der Umgebungdes Kaisers, welche ebenso wie ich einen höchst unangenehmenEindruck von dem Vorfall hatten und mich beschworen, jadem Kaiser nichts davon zu sagen. Ein Herr aber widersprachauf das energischste und erklärte, man müsse das im Gegenteildem Kaiser in allen Details mitteilen, und soviel ich weiß,unterzog er sich auch dieser wahrscheinlich nicht sehr angenehmenAufgabe. Dieser Fall aber ist symptomatisch. DerWunsch, dem Kaiser alles Unangenehme fernzuhalten, ihmjede, auch die begründetste Kritik zu ersparen, ihn immer nurzu loben und zu verhimmeln, nie aber zu zeigen, daß er auchgetadelt werde, dieses systematische Großziehen der kaiserlichenGottähnlichkeit, welches im Grunde weder der Liebezu seiner Person noch irgendwelchen dynastischen Momentenentsprang, sondern dem rein egoistischen Wunsche, sich nichtszu verderben und sich selbst keinen Unannehmlichkeiten auszusetzen,dieser ungesunde und unmännliche Zustand mußteauf die Dauer wie ein den Körper und Geist erschlaffendesGift wirken. Ich glaube gern, daß Kaiser Wilhelm, dessenEntwöhnung der Kritik einen ganz ungemein hohen Gradangenommen hatte, es seiner Umgebung nicht immer leichtgemacht hätte, offen und wahr zu sein. Aber trotzdem bleibtes richtig, daß diese erschlaffende Atmosphäre, welche ihnumgab, der erste und der letzte Grund alles Übels an seinemHofe war./o
Wilhelm II.In seinen jüngeren Jahren hielt sich Kaiser Wilhelm nichtimmer streng an das Konstitutionelle : später legte er diesenFehler vollständig ab und handelte niemals ohne Wissenseiner Ratgeber. In der Zeit, in welcher ich amtlich mitihm zu tun hatte, konnte er als Vorbild konstitutionellenVorgehens gelten. Bei einem so jungen, unerfahrenen Herrnwie Kaiser Karl war es doppelt notwendig, das Prinzipderministeriellen Verantwortlichkeit im vollen Umfange aufrechtzuerhalten.Da nach unserem Gesetze der Kaiser „über demGesetze stehend und unverantwortlich" war, so war derGrundsatz, daß er keine Regierungshandlung ohne Wissenund Gutheißen des verantwortlichen Ministers vornehmendürfe, unbedingt notwendig, und Kaiser Franz Joseph hatan diesem Prinzip wie an dem Evangelium festgehalten,Kaiser Karl, der voll guten Willens, aber ohne jede politischeVorschule und Erfahrung war, hätte zu dieser konstitutionellenTätigkeit erzogen werden müssen. Dies wurdeleider nicht von allen Seiten bedacht und beachtet.Nach meiner Demission im April 1918 sprach eineDeputationder Verfassungs- und Mittelpartei des Herrenhausesbeim Ministerpräsidenten Dr. Seidler vor und betonte dieWichtigkeit eines streng konstitutionellen Regimes.Dr. Seidlererklärte damals, die volle Verantwortung für die„Briefaffäre"zu übernehmen.Das war widersinnig. Dr. Seidler konnte die Verantwortungfür Vorgänge, welche sich ein volles Jahr vorher abgespielthatten — also zu einer Zeit, da er gar nicht Ministerwar — nicht übernehmen, abgesehen davon, daß er nachweislichauch während seiner Ministerschaft von den einschlägigenVorgängen gar nichts erfuhr, sondern erst nachmeiner Demission die kaiserliche Auffassung der Sachlagekennen lernte.Ebenso gut hätte er die Verantwortung für den SiebenjährigenKrieg oder die Schlacht von Königgrätz übernehmenkönnen.74
Wilhelm II.In den Jahren 1917 und 1918, in welchen ich amtlich mitKaiser Wilhelm zu tun hatte, war seine Scheu vor unangenehmenErörterungen so stark, daß es oft die größtenSchwierigkeiten machte, das Notwendige an den Mann zubringen.Ich erinnere mich, daß ich einmal auf Kosten derRücksicht, die man einem Kaiser schuldig ist, eine privateAussprache direkt erzwingen mußte. Ich war mit KaiserKarl an der Ostfront und stieg in Lemberg aus, um dort in denZug Kaiser Wilhelms einzusteigen und zwei Stunden mit ihmzu fahren; ich hatte ihm einiges vorzutragen, aber es warnichts besonders Unangenehmes darunter. Ich weiß nichtwarum, aber offenbar erwartete der Kaiser peinliche Auseinandersetzungenund setzte der erbetenen Ausspracheunter vier Augen eine passive Resistenz entgegen. Er ludmich in den Speisewagen zum ersten Frühstück ein, unddort saßen wir in Gesellschaft von ungefähr zehn Herren, sodaß keine Möglichkeit war, die sachliche Konversation zubeginnen. Das Frühstück war längst beendet, und der Kaisererhob sich nicht.Ich mußte ihn mehrmals und das letztemalsehr ausdrücklich ersuchen, mir einen privaten Vortrag zuermöglichen, bis er endlich aufstand — dann aber nocheinen Herrn des Auswärtigen Amtes der Unterredung beizog,wie um beidemselben Schutz gegen erwartete Vorstöße zufinden. Mit Fremden war Kaiser Wilhelm niemals schroff,was seinen eigenen Leuten gegenüber öfters vorgekommenseinsoll.Bei Kaiser Karl war ja die Situation eine ganz andere,Kaiser Karl war niemals unfreundlich, ja ich habe ihn niemalszornig oder böse gesehen. Es hat nicht der geringste Mut dazugehört, ihm unangenehme Dinge zu sagen, denn die Gefahreinerheftigen Antwort oder irgendeiner unangenehmen Reaktionwar nicht vorhanden. Dennoch war auch bei Kaiser Karlder Wunsch, nur das Angenehme zu glauben und das Unangenehmevon sich zu schieben, so stark, daß eine Kritik oderein Tadel nicht haften blieben, jedenfalls keinen nachhaltigen75
Wilhelm II.Eindruck auszuüben vermochten. Aber auch bei Kaiser Karlwar es die Umgebung im engeren und weiteren Sinne, welchees unmöglich machte, ihn von der brutalen Wirklichkeit zu überzeugen.So hatte ich einmal auf einer Rückreise von der Fronteine längere Auseinandersetzung mit ihm.Ich hatte ihm Vorwürfeüber ich weiß nicht mehr welchen Punkt seiner Regierungstätigkeitgemacht und den Standpunkt verfochten,daß seine Handlungen nicht nur bei mir, sondern in der ganzenMonarchie einen ungünstigen Eindruck hervorriefen.sagte ihm im Verlaufe des Gespräches, er möge sich erinnern,mit welchen ungemein großen Hoffnungen die ganze Monarchiebei seiner Thronbesteigung auf ihn geblickt habe, und erkönne mir glauben, daß er achtzig Prozent des Vertrauens bereitsverloren habe. Das Gespräch schloß ohne Ergebnis, derKaiser blieb freundlich wie gewöhnlich, obwohl begreiflicherweisenicht angenehm berührt über den Inhalt meiner Ausführungen.Einige Stunden später kamen wir durch eineStadt, und nicht nur der Bahnhof, sondern auch alle Gebäudelängs des Bahnhofes bis auf die Dächer hinauf warenschwarz von Menschen, welche den kaiserlichen Zug mitTücherschwenken und unbeschreiblichem Jubel begrüßten.Und die gleichen Szenen wiederholten sich auf verschiedenenanderen Bahnhöfen, die wir durchfuhren. Der Kaiser drehtesich lächelnd nach mir um, und ein Blick von ihm zeigte mir,wie felsenfest er überzeugt sei, daß alles, was ich von seinerabnehmenden Popularität gesprochen hatte, falsch sei, denndas lebendige Bild, das er soeben vor Augen hatte, beweiseihm das Gegenteil. Zur Zeit, als ich in Brest-Litowsk war,begannen in Wien aus Nahrungsmangel hervorgehende Unruhen,welche in Anbetracht der ganzen Situation, und daman nicht wußte, welchen Grad sie noch annehmen werden,etwas Bedrohliches an sich hatten.IchAls ich mit dem Kaiserdie Situation besprach, meinte er lächelnd: ,,Der einzige,der gar nichts zu fürchten hat, bin ich ; wenn es sich wiederholt,dann werde ich unter das Volk gehen, und dann werden
Wilhelm II.Sie sehen, wie sie mir zujubeln werden."Dieser selbe Kaiserist wenige Monate nachher sang- und klanglos von der Bildflächeverschwunden, und unter all den Tausenden, die ihmzugejubelt hatten, und deren Begeisterung er für echt gehalten,hat sich auch nicht ein einziger gefunden, der für ihn auchnur den kleinen Finger gerührt hätte.Ich habe Szenen derBegeisterung miterlebt, die tatsächlich auch einen kühlenund skeptischen Beurteiler der Volkspsyche hätten täuschenkönnen. Ich sah den Kaiser und die Kaiserin umgeben vonweinenden Frauen und Männern, fast erstickt von dem Blumenregen,ich sah die Leute in die Knie sinken und die Händeerheben, wie man eine Gottheit anbetet — und ich kann esden Objekten dieser begeisterten Huldigungen nicht verübeln,wenn sie dieses Talmi für echtes Gold nahmen und indem Glauben festwurzelten, daß sie persönlich von demVolke geliebt würden, geliebt ungefähr wie der Vater oderdie Mutter von den eigenen Kindern. Begreiflich ist es, daßKaiser und Kaiserin nach solchen Eindrücken alles, was manihnen von Kritik und Unzufriedenheit im Volke sagte,sinnloses Gerede auffaßten und steif und festbei der Überzeugungblieben,alsdaß gewaltsame Erschütterungen zwar inanderen Ländern, aber nicht bei ihnen vorkommen könnten.Ein jeder einfache Staatsbürger, welcher eine Zeitlang einehöhere Stellung eingenommen hat, erlebt ja an sich selbst inverkleinertem Maßstabe Ähnliches. Ich könnte viele Namennennen von Männern, welche sich nicht tief genug bückenkonnten, solange ich an der Macht war, und nach meinerDemission schnell auf die andere Seite der Straße gingen, umeinen Gruß zu vermeiden, da sie fürchteten, die kaiserlicheUngnade könne auf sie rückwirken. Aber ein einfacherStaatsbürger hat jahrzehntelang vor seinem Aufstieg Gelegenheitgehabt, die Welt kennen zu lernen, und er wird,wenn er normal veranlagt ist, die Servilität während seinerAmtszeit mit der gleichen Verachtung einschätzen wie dasBenehmen nachher. Den Monarchen fehlt diese Lebensschule,77
Wilhelm II.und sie taxieren die Psyche der Welt daher gewöhnlichfalsch. In dieser Tragikomödie aber sind sie die Irregeführten.Weniger begreiflich ist es, wenn die verantwortlichen Ratgeber,welche die Wirklichkeit von der Komödie zu unterscheidenverpflichtet sind, sich ebenfalls täuschen lassenund aus solchen Begebenheiten heraus ganz falsche politischeSchlüsse ziehen. <strong>Im</strong> Jahre 1918 fuhr der Kaiser in Begleitungdes Ministerpräsidenten Dr. Seidler in die südslawischenProvinzen, um dort die Stimmung zu ergründen.Natürlichfand er dort die gleiche Aufnahme wie überall; die Neugierdetrieb die Menschen auf seinen Weg, der Dnick der Behördeneinerseits und die Hoffnung auf kaiserliche Gunst andererseitslöste die gleichen Ovationen aus wie in den anderen „zweifellosdynastischen Provinzen". Und nicht nur der Kaiser, auchSeidler kamen triumphierend zurück und betonten ihrefeste Überzeugung, daß alles, was im Parlament und inden Blättern von südslawischenseparatistischen Tendenzengesprochen würde, barer Unsinn und Verdrehung sei,daß es niemals einer Trennung vom Habsburgischen Thronzustimmen würde.Wenn solche Vorstellungen der Begeisterung und dynastischerTreue den Gefeierten irreführen, so sind — ich wiederholees — die Schuldigen in erster Linie nicht die Monarchen,sondern diejenigen selbst, die diese Szenen veranstalten undaufführen, und diejenigen, die es unterlassen, die Monarchenaufzuklären. Gewiß, eine solche Aufklärung, welche ja, wiemenschlich begreiflich,gegen die Natur des Aufzuklärendenerfolgt, kann nur gelingen, wenn ungefähr alle die, die dieUmgebung des Herrschers bilden, in der gleichen rücksichtslosenForm der Wahrheit die Ehre geben. Denn wenn unterzehn Menschen einer oder der andere erklärt, das sei allesnicht echt, und die anderen widersprechen und erklären, diezutagetretende „Liebe des Volkes" sei überwältigend, sowird der Monarch immer geneigt sein, lieber den vieleD78
Wilhelm II.angenehmen als den wenigen unangenehmen Ratgebern zuglauben." Gewollt oder nicht gewollt, sträuben sich die Monarchenalle dagegen, aus der Hypnose zu erwachen — aberdas istmenschlich.Natürlich hat es auch in der engsten Umgebung des KaisersWilhelm Männer gegeben, deren Mannesstolz vor dem Kaiserthronekeine starke Belastung vertrug; im allgemeinen aberlitten sie mehr unter dem Byzantinismus Deutschlands, alsdaß sie sich an ihm erfreuten. Ich habe immer gefunden,daß die Servilsten nicht die am Hofe Lebenden waren,sondern Generale, Admirale, Professoren, Beamte, Volksvertreterund Gelehrte, die den Kaiser seltener sahen.Speziell in der zweiten Hälfte des Krieges waren die maßgebendenMänner um Kaiser Wilhelm herum gewiß keineByzantiner — vor allem Ludendorff nicht. Dem ganzenNaturell Ludendorffs war jeder Byzantinismus fremd. Energisch,kühn, ziel- und selbstbewußt, reizte ihn jeder Widerspruch,und er war in seinen Worten nicht wählerisch. Dabeiwar es ihm ganz gleichgültig, ob er seinen Kaiser oder jemandanders gegenüber hatte — er ging gegen jeden an, der sichihm in den Weg stellte.Aber wie viele Bürgermeister, Stadträte, Universitätsprofessoren,Abgeordnete — kurz Männer des Volkes und derWissenschaft — haben sich durch Jahre vor Kaiser Wilhelmbis zum Boden geneigt; ein kaiserliches Wort hat sie berauscht— und wie viele von diesen sind heute unter denen,welche das alte Regime und seine Entartungen, vor allemden Kaiser selbst,verurteilen.Der geschäftliche Umgang mit Kaiser Wilhelm war fürseine politischen Ratgeber während des Krieges dadurch sehrerschwert, daß er fast nie in Berlin, sondern stets im Hauptquartierwar. Auch bei Kaiser Karl war die Abwesenheitvon Wien sehr erschwerend.'<strong>Im</strong> Sommer 1917 war der Kaiser Karl beispielsweise inReichenau, wohin eine zweistündige Autofahrt notwendig79
Wilhelm II.ist ;ich war wöchentlich zwei- bis dreimal bei ihm und verlorauf diese Weise auf der Hin- und Rückfahrt und der Audienzstets fünf bis sechs Stunden, die ich dann durch eine verlängerteNachtarbeit einzubringen trachten mußte. NachWien wollte er um keinen Preis, trotz aller Überredungsversucheseiner verschiedenen Ratgeber. Ich habe aus gewissenÄußerungen des Kaisers den Eindruck, daß der Grund dieserständigen Weigerungen die Besorgnis für die Gesundheitder Kinder war. Er selbst war so anspruchslos, daß seineBequemlichkeit nicht der Grund der ständigen Weigerunggewesen sein kann. So milde der Kaiser Karl auch war,seine Umgebung widersprach ihm ungern.Nach dem Abgehen Conrads war auch unter denBadener Generalen keiner mehr, welcher dem Kaiser opponierte.Große Unannehmlichkeiten brachte mir der Wunsch desKaisers, dem Erzherzog Joseph Ferdinand wieder ein Kommandozu geben. Der Erzherzog galt als der Schuldige vonLuck. Ich kann nicht beurteilen, ob mit Unrecht — wie derKaiser behauptete — oder ob mit Recht, aber das Faktum,daß er in der Öffentlichkeit kein Vertrauen mehr genoß,stand fest.Zufällig erfuhr ich, daß seine Wiedereinrückung unmittelbarbevorstehe. Nun ging mich diese rein militärische Maßregelselbstverständlich im Grunde genommen gar nichts an.Ich mußte aber mit der Stimmung der Bevölkerung rechnen,welche weitere Belastungsproben nicht vertrug, und damit,daß sich nach Conrads Abgang niemand mehr in der Umgebungdes Kaisers fand, welcher den geringen Mut aufbrachte,ihm die Wahrheit zu sagen. Der einzige General,von dem ich wußte, daß er noch rücksichtslos offen mit demKaiser zu sprechen pflegte, war Alois Schönburg — und derwar irgendwo an der italienischen Front. So sagte ich demKaiser, daß die Wiederernennung eine Unmöglichkeit sei,und begründete dies damit, daß der Erzherzog alles Vertrauen80
Wilhelm II.des Hinterlandes verloren habe und daß man von denMüttern nicht verlangen könne, daß sie ihre Söhne demKommando eines Generals ausliefern, in welchem sie alle denSchuldtragenden der Lucker Katastrophe erblickten. DerKaiser blieb dabei, dies sei ungerecht, der Erzherzog tragenicht die Schuld. Ich entgegnete, auch wenn dies der Fallsei, müsse der Erzherzog resignieren, denn das Vertrauen derWelt habe er einmal verloren, und die äußerste Kraftanstrengungder Völker sei nicht zu verlangen und nicht zu erreichen,wenn man das Kommando Generalen gäbe, welcheeinstimmigem Mißtrauen begegneten.Meine Bemühungen blieben fruchtlos.Ich schlug daher einen anderen Weg ein und sandte einenHerrn aus dem Ministerium des Äußern zu dem Erzherzog mitdem Ersuchen, freiwillig auf das Kommando zu verzichten.Es muß anerkannt werden, daß sich Joseph Ferdinand sehrloyal und vornehm verhielt, indem er auf dieses Ersuchen hin,um dem Kaiser nicht zu schaden, Seiner Majestät selbstseinen Verzicht auf ein Kommando an der Front meldete.Zwischen dem Erzherzog und mir fand dann noch ein kurzerBriefwechsel statt, welcher seitens des Erzherzogs in gereizterund nicht übermäßig höflicher Form geführt wurde — einVorgehen, welches ich ihm nicht übel nahm in Anbetrachtdes Umstandes, daß meine Einmischung ihm seine Wiederverwendungverdorben hatte.Seine spätere Ernennung zum Chef der Luftstreitkräfte erfolgteohne mein Wissen, war jedoch harmlos im Vergleichezu den früherenPlänen.Der Byzantinismus hat aber zweifellos in Berlin viel abstoßendereFormen angenommen, als dies jemals in W7iender Fall war. Das Faktum allein, daß hohe Würdenträgerdem Kaiser Wilhelm die Hand küßten, wäre ein in Wien ganzunmögliches Vorgehen gewesen. Ich habe es niemals erlebt,daß bei uns jemand, und wäre er unter den Servilsten gewesen,6 Czernin <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 8l
Wilhelm II.sich zu einer solchen Handlung erniedrigt hätte — einerHandlung, die in Berlin etwas vollständig Alltägliches war.Ich habe das sehr oft gesehen. So schenkte Kaiser Wilhelmnach einer Fahrt auf dem „Meteor" in der Kieler Woche zweideutschen Herren Krawattennadeln als Erinnerung an dieFahrt. Er übergab sie ihnen, und mein Erstaunen war groß,als die beiden als Dank dafür die kaiserliche Hand küßten.Zu der Kieler WToche kamen stets auch zahlreiche Ausländer: Amerikaner, Engländer und Franzosen. Kaiser Wilhelmbeschäftigte sich viel mit ihnen, und fast immer waren sieunter dem Charme seiner Persönlichkeit. Für Amerika hatteWilhelm II. anscheinend eine Vorliebe — der Eindruck seinerGefühle England gegenüber läßt sich schwer beschreiben.Ich habe immer den Eindruck gehabt, daß der Kaiser die geringeSympathie, die er in England genoß, als störendenMangel empfand und gerne an der Themse beliebt gewesenwäre, und daß das Mißlingen dieses Bestrebens bei ihm einengewissen Ärger auslöste. Er war sich natürlich vollkommenklar darüber, daß die Art und Weise, wie er persönlich inEngland eingeschätzt würde, auf die englisch-deutschen Verhältnisseeinwirken müsse, und sein Wunsch, in England gutbeurteilt zu werden, entsprang daher nicht persönlicherEitelkeit, sondern politischen Interessen.Den Eindruck, daß das prononcierte Auftreten KaiserWilhelms, seine ganze Art und Weise, „sich zu geben", in Englandnicht abstieß, aber doch das „Sichverstehen" erschwerte,gaben auch die Schilderungen, welche den Kontakt zwischendem' Kaiser und König Eduard betreffen.König Eduard war wie bekannt einer der geschicktestenMenschenbehandler Europas, und sein Interesse für dieäußere Politik war stets dominierend. Er hätte den idealstenTypus eines Botschafters dargestellt. Gut verstanden habensich Onkel und Neffe niemals, schon in der Zeit nicht, alsder Neffe schon Kaiser und der viel ältere Onkel immernoch Prinz war — eine Positionsdifferenz, welche der ewig82
:Wilhelm II.spöttische Kiderlen-Wächter durch die Worte charakterisierte„Der Prinz von Wales könne es seinem achtzehn Jahrejüngeren Neffen nicht verzeihen, daß dieser eine bessereKarriere mache als er selbst."Persönliche Sympathie und persönliche Differenzen in denleitenden Sphären können aber die Weltgeschichte beeinflussen.Politik wird von Menschen gemacht und immer gemachtwerden, und immer werden persönliche Beziehungendabei eine gewisse Rolle spielen. Wer kann heute sagen, obder Lauf der Welt nicht ein anderer geworden wäre, wenndie Monarchen Englands und Deutschlands mehr homogeneNaturen gewesen wären? Die Einkreisungspolitik KönigEduards begann ja erst, als er die — meiner Ansicht nachunrichtige — Überzeugung gewann, daß eine Verständigungmit Kaiser Wilhelm unmöglich sei.' Die Schwierigkeit im Naturell Kaiser Wilhelms, sich anderenIdeen und Gedankenrichtungen anzupassen, nahm imLaufe der Jahre zu. Das war die Schuld seiner Umgebungim weitesten Sinne.In der Atmosphäre, in welcher Kaiser Wilhelm lebte, mußtedie beste Pflanze verderben. Der Kaiser konnte sagen odertun, was er wollte : ob es richtig oder falsch war — er stieß aufbegeistertste Bewunderung und Lob. Es fanden sich immerMenschen dutzendweise, welche ihre verhimmelnde Bewunderungüberbrachten.Beispielsweise kam im Kriege ein Buch heraus ,,Der Kaiserim Felde" von Dr. Bogdan Krieger. Kaiser Wilhelm schenktemir dasselbe im Mai 1917 in Kreuznach mit einer auf denKrieg bezüglichen Inschrift. Das Buch enthält eine genaueBeschreibung dessen, was der Kaiser während des Feldzugesgetan hat — aber nichts als Äußerlichkeiten; wohin er gefahren,wo er gefrühstückt, mit wem er gesprochen, welcheWitze er gemacht, wie er gekleidet gewesen, wie sein Augegeleuchtet usw. ; ferner Ansprachen an die Truppen, ganzuninteressante und belanglose Worte, die er den einzelnen••8^
;Wilhelm 11.Soldaten gesagt, und dergleichen mehr. Und das Ganze istumgeben, durchwoben und durchtränkt von grenzenloser,maßloser Bewunderung, von unausgesetztem Lob. DerKaiser gab mir das Buch bei meiner Abreise, und ich blättertees im Waggon durch.Einige Wochen später fragte mich ein deutscher Offizier,welcher meiner Abreise beigewohnt hatte, was ich von demBuche hielte; ich erwiderte ihm, es sei Schundliteratur, diedem Kaiser schade, und es wäre in seinem Interesse, dasselbezu konfiszieren. Der Offizier erwiderte, das sei auch seine Ansicht,dem Kaiser aber sei von vielen Seiten versichert worden,es seiein ausgezeichnetes, den Geist der Armee anfeuerndesWerk, und daher verbreite er es.Später machte ich einmalgesprächsweise bei einem Diner den Grafen Hertling auf dieSchrift aufmerksam und riet ihm, solche Produkte, die demKaiser mehr als irgendein Pamphlet schadeten, zu unterdrücken.Der alte Herr bekam einen roten Kopf vor Ärgerund erklärte, ,,es sei immer dasselbe: Leute, die sich beimKaiser einschmeicheln wollten,brächten ihm solche Sachen.Dieses Buch sei ihm — Hertling — erst vor kurzem voneinem Universitätsprofessor ungemein gelobt worden. DerKaiser habe ja gar nicht die Zeit, das Zeug zu lesen, und sitzesolchen Schmeicheleien auf; er selbst habe es auch nicht gelesen,werde es sich aber jetzt vorlegen lassen."Ich weiß nicht, wer der Universitätsprofessor war, aberjedenfalls war er nicht in der ständigen Umgebung des Kaisers,ebenso wenig wie der Verfasser des Buches.Ich hatte indiesem Falle, wie öfters, den Eindruck, daß viele Herren ausder Suite Kaiser Wilhelms mit dieser Richtung gar nicht einverstandenwaren. Aber das deutsche Volk in seiner Gesamtheiterschwerte es ihnen, dagegen aufzutreten. Der Hof warin diesem Strom von Servilität nicht der Führer, sondernder Geschobene.Der Botschafter Prinz Hohenlohe hatte während meinerAmtszeit sehr zahlreiche Unterredungen mit Kaiser Wilhelm84
Wilhelm II.er hat stets ungemein offen und frei mit ihm gesprochen undist dennoch stets auf dem besten Fuß mit ihm geblieben.Gewiß war dies für einen fremden Botschafter leichter als füreinen Reichsdeutschen, aber es beweist doch, daß der Kaiserdies ertrug, wenn es in der richtigen Form geschah.Kaiser Wilhelm wurde in seinem Lande verherrlicht undverhimmelt oder in einem kleinen Teil der Presse tendenziösverhöhnt und verspottet. Diese letztere Richtung trug aberdermaßen den Charakter der persönlichen Feindschaft umjeden Preis an sich, daß dadurch ihr Tadel a priori diskreditiertwar. Hätten sich häufiger ernste Blätter und Stimmengefunden, welche die zweifellos vorhandenen Fehler des Kaiserswürdig besprochen und getadelt, gleichzeitig aber seine großenund guten Eigenschaften anerkannt hätten, so wäre das bessergewesen — und wären mehr Bücher über ihn geschrieben worden,die, statt läppisches Zeug zu erzählen, seine Witze zuwiederholen, seinen Anzug zu beschreiben und ihm Weihrauchzu streuen, erzählt hätten, daß der Mann innerlich ganz andersist, als er sich gibt, daß er voll des besten Willens und voll leidenschaftlicherLiebe für Deutschland ist,daß er in seiner tiefenReligiosität oft mit sich selbst und seinem Gott ringt und sichfragt,ob es der richtige Weg sei, den er gehe, daß er in seinerLiebe für das deutsche Volk viel ehrlicher war als vieleDeutsche für ihn, daß er sie niemals täuschte, aber fortgesetztvon vielen getäuscht wurde, — so wäre auch dies besser undvor allem wahrer gewesen.Kaiser Wilhelm, der zweifellos,was Begabung und Talentanbelangt, über dem Durchschnitt der Menschen steht, wäregewiß, wenn er als gewöhnlicher Sterblicher zur Welt gekommenwäre, ein sehr brauchbarer Offizier, Architekt, Ingenieur,Parlamentarier oder was immer geworden; seine große Begabunghätte ihre Früchte getragen, wenn er gezwungengewesen wäre, sich seinen Weg tastend an den Stacheln derKritik zu suchen. Bei der bestehenden Kritiklosigkeit verlorer das Maß, und das war sein Unglück. Kaiser Wilhelm I. war85
Wilhelm II.ja, nach allem, was man über ihn zu lesen bekommen hat,eine ganz andere Natur, und doch war es Bismarck gewiß oftnicht leicht, mit ihm fertig zu werden, obwohl BismarcksLoyalität und dynastische Subordination niemals seinerrücksichtslosen Offenheit Eintrag getan haben dürfte. AberKaiser Wilhelm I.alswar ein ,,self made man" auf dem Throne,er zur Regierung kam, wankte sein Reich, mit Hilfe derausgezeichneten Männer, die er zu finden und zu halten wußte,stützte er dasselbe und zimmerte über Königgrätz und Sedanhinaus das große Deutsche Reich. Für Wilhelm II. hätte dasWort des Dichters gegolten: „Was du ererbt von deinenVätern hast, erwirb es, um es zu besitzen." Wilhelm II.kam auf den Thron, als Deutschland den Höhepunkt seinerMacht erreicht hatte. Er hat nicht wie sein Großvater durcheigene Arbeit das geschaffen, was er besessen, ihm wares mühelos in den Schoß gefallen, und auf seine ganzegeistige Entwicklung hat dieses Faktum einen großen Einflußgenommen.Kaiser Wilhelm war ein unterhaltender, interessanter,,Causeur". Man konnte ihm stundenlang zuhören, ohne sichzu langweilen. Die Kaiser haben ja im allgemeinen den Vorteil,leicht ein Auditorium zu finden — aber Kaiser Wilhelmhätte man auch gerne zugehört, wenn er ein gewöhnlicherBürger gewesen wäre. Er sprach über Kunst, Wissenschaft,Gegenteil verstieg er sich oftPolitik und Musik, Religion und Astronomie und war stetsanregend. Nicht daß alles richtig schien, was er sagte, imzu sehr anfechtbaren Konklusionen— aber den größten Fehler, den der Mensch in derGesellschaft haben kann, den Fehler, die anderen zu langweilen,den hatte er nie.War Kaiser Wilhelm in Worten und Gesten stets sehrstark, so war er speziell während des Krieges doch in seinenHandlungen bedeutend weniger selbständig, als man imallgemeinen annimmt. Und in diesem Punkte ist meinerAnsicht nach einer der Hauptgründe gelegen, welcher eine86
Wilhelm II.mißverständliche Beurteilung der ganzen RegierungstätigkeitKaiser Wilhelms in der Öffentlichkeit involviert. Viel mehrals die Öffentlichkeit glaubt, war er der Geschobene, nichtder Schiebende, und wenn sich die Entente heute das Rechtanmaßt, Kläger und Richter in einer Person zu sein unddem Kaiser einen Prozeß zu machen, — so ist dies, abgesehenvon allem anderen, deshalb falsch und ungerecht, weilKaiser Wilhelm sowohl bei der Vorgeschichte des Kriegesals auch während des Krieges niemals die Rolle gespielt hat,die die Entente ihm zuschreibt.Der Arme hat Böses durchgemacht, und vielleicht stehtihm noch Böseres bevor. Er ist zu hoch getragen worden,um nicht furchtbar tief zu fallen. Das Schicksal scheint ihnauserlesen zu haben, eine Schuld zu sühnen, die, soweit sieüberhaupt besteht, nicht so sehr die seine ist, als die seinesLandes und seiner Zeit. Kaiser Wilhelms Verderben warder Byzantinismus Deutschlands, dieser Byzantinismus, derihn umstrickte und umgarnte, wie eine Schlingpflanze einenBaum — diese unübersehbar große Schar der Schmeichlerund Streber, die ihn im Unglück verließ. Und Kaiser Wilhelmwar nur ein besonders markanter Exponent seinerKlasse. Alle modernen Monarchen haben diese Krankheit,nur war sie bei Kaiser Wilhelm stärker entwickelt und daherauch stärker zu sehen als bei den anderen. Von Jugendauf dem Gifte des Lobes besonders zugänglich, in einerEpoche, in einem Lande und an einem Hofe, wo das Handküssenheimatberechtigt war, dabei an der Spitze einesgrößten und stärksten Staaten der Welt, mit einer nahezuunbeschränkten Macht, unterlag er dem fatalen Los, demMenschen unterliegen müssen, wenn sie den realen Bodenderunter den Füßen verlieren und an ihre Gottähnlichkeit zuglauben beginnen.Er sühnt eine Schuld, die nicht die seine ist. Er kannin seine Einsamkeit den Trost mitnehmen, stets nur dasBeste gewollt zu haben. Und trotz allem, was heute über87
Wilhelm II.Wilhelm II. gesprochen und geschrieben wird, gilt für ihn vollund ganz das schöne Wort: „Friede den Menschen auf Erden,die eines guten Willens sind." Wenn er sich von der Weltzurückzieht, so kann er als kostbarstes Gut sein gutes Gewissenmit sich nehmen.Und vielleicht wird sich Wilhelm II. an seinem Lebensabendsagen können, daß er erkannt habe, daß es im menschlichenLeben kein Glück und kein Unglück gibt, — sondernnur einen Unterschied der Kraft, sein Schicksal zu tragen.Niemals war der Krieg in dem Programm Wilhelms II.Ich kann nicht sagen, wo in seinem Geiste die Grenzender Rolle gesteckt waren, welche er Deutschland zugedachthatte, und ob die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, ,,inseinenAmbitionen für Deutschland zu weit gegangen zu sein," sichrechtfertigen lassen oder nicht. An eine alleinige WeltherrschaftDeutschlands hat er gewiß niemals gedacht, denner war nicht so naiv, zu glauben, daß er dieselbe ohne Kriegerreichen könne, aber seine Pläne gingen gewiß dahin, daßDeutschland dauernd unter den ersten Mächten der W7eltrangiere. Ich weiß bestimmt, daß dem Kaiser als sein Idealder Gedanke vorgeschwebt hat, zu einem Weltabkommenmit England zu gelangen und sich gewissermaßen mit Englandin die Welt zu teilen.In seinem Gedankengang lag es,in dieser Weltaufteilung noch Rußland und Japan einegewisse Rolle zuzudenken, für die übrigen Staaten, insbesonderefür Frankreich hatte er wenig übrig, von derÜberzeugung durchdrungen, daß dies im Abstieg begriffeneNationen seien. Wenn heute behauptet wird, W'ilhelm habediesen Krieg absichtlich vorbereitet und dann entfesselt, sowiderspricht dies seiner jahrzehntelangen friedlichen Regierungstätigkeit.In seinem W erke „Die Vorgeschichte desT<strong>Weltkriege</strong>s" schreibt Helfferich über die Haltung Kaiser
Wilhelm II.Wilhelms während der Balkanwirren und erwähnt: „Für dieHaltung des Deutschen Kaisers in dieser für die deutschePolitik schwierigen Lage, die eine große Ähnlichkeit mit derLage vom Juli 1914 hat, ist ein Telegramm bezeichnend,das Wilhelm IL damals an den Reichskanzler richtete desInhalts: Der Bündnisvertrag mit Österreich-Ungarn zwingeuns, zu marschieren, wenn Österreich-Ungarn von Rußlandangegriffen werde. Dann werde auch Frankreich hineingezogenwerden, und England werde unter solchen Umständenwohl auch nicht ruhig bleiben. Die jetzt schwebendenStreitfragen ständen zu dieser Gefahr in keinem Verhältnis.Es könne nicht der Sinn des Bündnisvertrages sein,daß wir, ohne daß Lebensinteressen des Verbündeten bedrohtseien, für eine Laune des Verbündeten in einen Kampfauf Leben und Tod gehen müßten. Wenn sich allerdingszeigen sollte, daß die andere Seite einen Angriff beabsichtige,dann werde man jede Gefahr auf sich nehmen müssen.Dieser ruhige und feste Standpunkt, der allein den Friedenerhalten konnte, war für die deutsche Politik auch in derweiteren Entwicklung maßgebend. Er wurde durchgehaltensowohl gegenüber einem starken russischen Druck, wie auchgegenüber anders gerichteten Tendenzen und vorübergehendenVerstimmungen in Wien." Ob eine Verstimmung in Wiengeherrscht hat, weiß ich nicht — aber im übrigen halte ichdie Darstellung für vollkommen richtig.Es wurde schon höher oben erwähnt, daß alle die geharnischtenWorte, die der Kaiser in die Welt schleuderte,aus einer mißverständlichen Auffassung über ihre Wirkunghervorgingen. Der Kaiser wollte imponieren, er wollte vielleichtsogar erschrecken, das soll gern zugegeben werden,aber er wollte nach dem Prinzip handeln: Si vis pacem,para bellum, und er wollte durch das markierte Betonen dermilitärischen Kraft Deutschlands die vielen Feinde undNeider seines Reiches davon abhalten, ihm ihrerseits denKriegzu erklären.89
Wilhelm II.Es wird hier keinen Augenblick bestritten,daß diese Haltungoft eine unglückliche und verfehlte war, es soll nichtgeleugnet werden, daß sie zum Ausbruche des <strong>Weltkriege</strong>sbeigetragen hat — aber es wird behauptet, daß dem Kaiserder „dolus" des Kriegmachens fehlte, daß er Worte sprachund Dinge unternahm, die gegen seinen Willen eine kriegschürendeWirkung hatten.\ Hätten sich in Deutschland Männer gefunden, welche dieschädliche Wirkung, die sein Auftreten mit sich brachte,nicht verheimlicht, sondern dem Kaiser das wachsendeMißtrauen der ganzen Welt geschildert hätten — hätte sichnicht einer oder der andere, aber hätten sich dutzendweiseMänner solcher Art gefunden, gewiß wäre der Eindruck aufden Kaiser nicht ausgeblieben. Es ist ja richtig, daß derPreuße unter allen Erdenbewohnern derjenige ist, der sicham wenigsten in die Psyche eines anderen Menschen hineindenkenkann, und vielleicht waren in der Umgebung desKaisers tatsächlich wenig Männer, welche die steigendeBesorgnis der Welt erkannten. Vielleicht waren viele vondenen, die dem Kaiser ununterbrochen Lob zollten, wirklichund ehrlich der Ansicht, daß sein Auftreten das richtige sei.Aber es hat unter den deutschen Politikern der letztenJahrzehnte zu viele kluge Männer gegeben, um nicht glaubenzu können, daß viele von ihnen ein klares Bild der Situationhatten, und es bleibt wahr, daß sie, um den Kaiser und vorallem sich selbst zu schonen, nicht den Mut fanden, ihnhart anzufassen und ihm die Wahrheit rücksichtslos insGesicht zu sagen.Das sind keine Vorwürfe, das sind Erinnerungen — aberErinnerungen, die nicht überflüssig scheinen zu einer Zeit,in der Kaiser Wilhelm zum Sündenbock der ganzen Weltgestempelt werden soll. Gewiß, wie der Kaiser nun einmalwar, wäre ein solches Experiment nicht abgegangen, ohnedaß vorerst einige Widerstände zu überwinden gewesenwären. Die ersten seiner Untertanen, die es sich heraus-90
Wilhelm II.genommen hätten, mit dem Kaiser wirklich einmal deutschzu sprechen, wären wohl vorerst etwas erstaunt angesehenworden, und dafür wollte sich keiner hergeben, keiner wollteden Anfang machen. Hätten sich aber Männer gefunden, dieohne Rücksicht auf sich selbst so vorgegangen wären, sowäre zweifellos ein Erfolg eingetreten, denn der Kaiser warnicht nur guten Willens, er war auch impressionabel, und einekonsequente, zielbewußte Arbeit auf Basis furchtloser Ehrlichkeithätte Eindruck auf ihn gemacht.Dabei war der Kaiser eindurch und durch guter, wohlwollender Mensch. Es verursachteihm aufrichtige Freude, Gutes zu tun. Auch war er frei von demHasse gegen die Feinde. <strong>Im</strong> Sommer 1917 sprach er mit mirüber das Los des gestürzten Zaren und seinen Wunsch, demselbenzu helfen und ihn eventuell nach Deutschland zu bringen.Und dieser Wunsch entsprang nicht nur dynastischen,sondern menschlichen Motiven. Wiederholt betonte er, daßihm jeder Wunsch nach Rache völlig fernliege und er „denniedergeworfenen Gegner wieder aufheben werde".Ich glaube, daß Kaiser Wilhelm die Wolken gesehen hat,die sich schwarz und schwärzer am politischen Horizontauftürmten, aber er war sicher der aufrichtigen und ehrlichenÜberzeugung, daß dieselben ohne das geringste Verschuldenseinerseits entstanden seien, daß sie nur dem Neidund der Eifersucht entsprangen, und daß es kein anderesMittel gebe, um die drohende Kriegsgefahr in Schach zuhalten, als eben die ostentativ aufgetragene Pose der Kraftund Unerschrockenheit. „Deutschlands Kraft und Stärkemuß täglich in die Welt hinausposaunt werden, denn solangesie uns fürchten, werden sie uns nichts machen" — warungefähr die These an der Spree. Und das Echo der Weltschrie zurück: „Dieses fortwährende Pochen auf die deutscheKraft, diese ewigen Einschüchterungsversuche beweisen, daßDeutschland die ganze Welt tyrannisieren will."Als der Krieg ausbrach, war der Kaiser von der felsenfestenÜberzeugung durchdrungen, daß es sich um einen ihm9i
Wilhelm II.aufgezwungenen Verteidigungskrieg handle, und diese Überzeugungteiltemit ihm die erdrückende Majorität des deutschenVolkes.Ich kann die obenerwähnten Schlüsse nur ausder ganzen mir bekannten Psyche des Kaisers und seinerUmgebung und aus indirekten Nachrichten ziehen. Wie ichbereits betont habe, hatte ich die letzten Jahre vor demKriege und auch noch die zwei nach Kriegsausbruch nichtden geringsten direkten Kontakt mit Berlin.Als ich den Kaiser im Winter 1917 in meiner Eigenschaftals Minister des Äußern wiedersah, fand ich ihn ergraut,aber immer noch von der gleichen Lebhaftigkeit wie früher.Trotz demonstrativ aufgetragener Siegeszuversicht glaubeich, daß Wilhelm II. im Winter 1917 bereits Zweifel an demAusgange des Krieges hatte und von dem sehnlichstenWunsche erfüllt war, zu einem erträglichen Ende zu kommen.Als ich ihm im Laufe einer unserer ersten Unterredungenzuredete, kein Opfer zu scheuen, um den Krieg zu beenden,unterbrach er mich mit den Worten: „Aber was wollenSie denn? Niemand will den Frieden heißer als ich. Aberwir hören es doch alle Tage, die anderen wollen keinenFrieden, bevor Deutschland nicht zerschmettert ist." DieseAntwort war richtig, denn alle englischen Äußerungengipfelten in demselben Satze: Germaniam esse delendam.Ich versuchte dennoch, den Kaiser zu überreden, das Opfervon Elsaß-Lothringen anzutragen, und gab meiner ÜberzeugungAusdruck, daß Frankreich schwerlich dazu zuhaben sein werde, den Krieg fortzusetzen, wenn es selbstalles das erreicht habe, was sein nationales Ideal verlange.Ich glaube, daß der Kaiser, wenn er die positive Sicherheitgehabt hätte, daß dies den Krieg wirklich beendet, undwenn er die Furcht losgeworden wäre, daß ein solches schmerzlichesAngebot von Deutschland als unerträglich empfundenwerden würde, daß, sage ich, der Kaiser für seine Personzugestimmt hätte. Aber die Befürchtung, daß gerade einsolcher Verlustfriede nach all den gebrachten Opfern das92
Wilhelm II.deutsche Volk in die Verzweiflung treiben werde, war beiihm ausschlaggebend.Es kann auch heute gar nicht konstatiert werden, ob dieBefürchtung nicht richtig war. <strong>Im</strong> Jahre 1917 und auch noch19 18 war der Glaube an ein siegreiches Ende in Deutschlandso stark, daß es mindestens sehr zweifelhaft ist, ob das deutscheVolk einer Preisgabe von Elsaß-Lothringen zugestimmt hätte.<strong>Im</strong> Reichstag waren alle Parteien dagegen, auch die Sozialdemokraten.Ein hoher deutscher Funktionär sagte mir im Frühjahr1918: „Ich hatte zwei Söhne. Der eine ist auf dem Schlachtfeldegeblieben, aber lieber gebe ich noch den zweiten her,als auf Elsaß-Lothringen zu verzichten" ; und so wie erdachten viele.<strong>Im</strong> Laufe der anderthalb Jahre, in welchen ich selbstverständlichoft Gelegenheit hatte, mit Wilhelm II.zusammenzukommen, hat seine Seelenverfassung natürlichauch verschiedene Phasen durchgemacht. Nach großenmilitärischen Erfolgen, so nach dem Niederbruche Rußlandsund Rumäniens, gelang es seinen Generalen immer wieder,ihn auf ihr Eroberungsprogramm einzuschwören, und eswäre eine falsche Auffassung, wenn man glauben würde,daß Wilhelm IL durchweg und ununterbrochen an demGedanken festgehalten hätte: „Vor allem nur der Friede!"Er schwankte, er war manchmal pessimistischer, manchmaloptimistischer, und damit änderten sich auch seine Friedensziele.Aber es ist ja menschlich nur begreiflich, daß die verändertenSituationen auf dem Kriegsschauplatze auch diePsyche des einzelnen beeinflußt haben, und kein Mensch inEuropa war frei von solchen Schwankungen.Anfang September 1917 schrieb er z. B. dem Kaiser Karlüber einen bevorstehenden Angriff an der italienischen Front,und in demselben Schreiben fand sich der Passus: „Ich hoffe,daß die Möglichkeit gemeinsamer Offensive unserer verbündetenHeere auch die Stimmung Deines Außenministers93
Wilhelm II.beleben wird. Zu einer anderen wie zu einer zuversichtlichenStimmung haben wir meines Erachtens bei Betrachtungder Gesamtlage keinen Grund." Auch andere Schreibenund Aussprüche des Kaisers beweisen diese Schwankungenin seiner Stimmung. Nebenbei befolgte er wie auch dieWilhelmstraße gerne die Taktik, dem „kriegsmüden Österreich-Ungarn" gegenüber eine prononcierte Siegeszuversicht zurSchau zu tragen, um unsere Widerstandskraft zu stärken.Ein großes Verdienst um die Erhaltung guter freundschaftlicherBeziehungen zwischen Wien und Berlin hat sich ErzherzogFriedrich erworben. Es war nicht immer leicht, dieheiklen Fragen der Kriegführung ohne Verstimmung zulösen.Die ehrliche, gerade Art des Erzherzogs und sein stetsfreundliches, bescheidenes Auftreten haben oft schwierigeSituationen gerettet.Nach dem Niederbruche und dem Umstürze, als die Beschimpfungender kaiserlichen Familie ein völlig gefahrlosesUnternehmen geworden waren, haben sich gewisse Blätterdarin gefallen, auch den Erzherzog Friedrich mit Kot zubewerfen. Es wird nichts davon an ihm haften bleiben.Der Prinz ist ein vornehmer, tadellos integrer Charakter,und er ist stets gegen Mißbräuche aufgetreten. Er hat somanches verhindert; wenn er nicht alles verhindern konnte,so war das nicht seine Schuld.Kriegsmüde und friedenbegehrend im wahrsten Sinne desWortes war der Kronprinz Wilhelm, als ich ihn nach vielenJahren im Sommer 1917 wiedersah. Ich war an die französischeFront gereist, um mit ihm zusammenzutreffen undzu versuchen, ob es nicht möglich sei, durch ihn einen Druckim Sinne der Nachgiebigkeit vor allem auf die herrschendenMilitärs auszuüben.Die lange Unterredung, die ich mit ihm hatte, bewies mir,daß er — wenn jemals kriegerisch — vollständig Pazifistgeworden war.94
:Wilhelm II.Aus meinem Tagebuch&*An der Westfront 191 7.Wir fahren nach den Camps des Romains.Gruppenweise,um nicht die Aufmerksamkeit der feindlichen Artillerie aufdie Autos zu lenken, denn stellenweise ist der Weg vomFeinde eingesehen. Ich bin mit Bethmann eingeteilt. Wirsprachen über die Militärs, und Bethmann sagte: „DieGenerale werden wohl mit Handgranaten nach mir schmeißen,wenn sie mich erblicken." Er hat einen furchtbar schwerenStand gegenüber diesen Siegfriedlern.Hoch über uns ein feindlicher Flieger. Er zieht seineKreise und kümmert sich den Teufel um die Schrapnelle,die um ihn herum platzen. Das Schießen hört auf, und dermenschliche Vogel kreist weiter in seinen unerreichbarenHöhen. Von weit her hört man Artilleriefeuer, wie fernenDonner.Von den Camps aus sind die französischen Linien nichtweit, ein paar hundert Meter. Hier und da fällt ein Schuß,und man hört eine Granate heulen, sonst ist es noch ruhig.Es ist noch zu früh am Tage, das Schießen beginnt gewöhnlicherst gegen zehn Uhr, hört zu Mittag auf — Frühstückspause —und geht nachmittags weiter.Bei der Rückfahrt beginnt die tägliche Artillerieschlacht.Auf der ganzen Linie dröhnt es ununterbrochen.St. Mihiel.Wir hielten in St. Mihiel. Es sind viele Franzosen dageblieben.Sie wurden zurückbehalten als Geiseln, damit dieStadt nicht beschossen wird. Am Platze standen die Leuteherum und betrachteten die Autokolonne.Ich sprach mit einer alten Frau, die, abseits von denanderen, auf den Stufen vor einem Hause saß. Sie sagte:„Niemals wird dieses Unglück wieder gut werden. Es kannnicht mehr ärger werden, als es ist. Mir ist es einerlei, wasgeschieht. Ich bin nicht von hier. Mein einziger Sohn ist95
Wilhelm II.gefallen, mein Haus ist verbrannt, ich habe nichts mehrzu verlieren. Ich habe nichts mehr als den Haß gegen dieDeutschen, und den werde ich Frankreich vererben." Undsie sah an mir vorüber ins Leere. Ohne Leidenschaft hatsiegesprochen — nur furchtbar traurig.Dieser entsetzliche Haß! Generationen werden ins Grabsteigen, bis diese Flut von Haß sich verläuft. Und ist einAusgleich, ein Verständigungsfriede möglich bei dieser Psycheder Völker? Muß es nicht dahin kommen, daß einer vonbeiden am Boden liegt und vernichtet wird?St. Privat.Auf der Fahrt nach Metz kamen wir durch St. Privat.Monumente, die vom Jahre 1870 erzählen, liegen längs derStraße. Alles historischer, blutgedüngter Boden. JederStein und jeder Fleck spricht von vergangenen großenZeiten. Hier wurde der Samen gelegt für die Revancheidee,um die jetzt gerungen wird.Bethmann scheint meine Gedanken zu erraten. JedesOpfer wäre für Deutschland erträglicher, meint er, als dieAbtretung von Elsaß, weil Deutschland damit eine derglänzendsten Epochen seiner Geschichte auslöschen müßte.Sedan.Auf der Fahrt nach dem Quartiere des Kronprinzen.Da liegt das kleine Haus, wo die historische Zusammenkunftzwischen Bismarck und Napoleon III. stattfand. DieFrau, die damals da wohnte, ist erst vor einigen Wochengestorben. Sie sah ein zweites Mal die Deutschen kommen.Einen Moltke haben sie wohl wieder mitgebracht — derBismarck fehlt. Aber dieses Detail wird die alte Frau nichtstark interessiert haben.Beim Kronprinzen.Ein hübsches, kleines Haus, außerhalb des Ortes. Ich fanddie Aufforderung des Kronprinzen vor, gleich zu ihm zukommen, und so sprachen wir fast eine Stunde unter vierAugen, noch vor dem Abendessen.96
Wilhelm 11.Ich weiß nicht,ob der Kronprinz jemals kriegerisch war,wie die Leute erzählen, aber heute ist er es nicht mehr.Er will den Frieden, er sehnt ihn herbei, nur weiß er nicht,wie man dazu kommen soll. Er sprach sehr ruhig und vernünftig.Er wäre dafür, auch territoriale Opfer zu bringen,aber er scheint auch zu glauben, daß Deutschland das nichtertragen würde. In dem Kontraste zwischen der tatsächlichenmilitärischen Lage, den zuversichtlichen Erwartungender Generale — und den Befürchtungen, die im Kopfe einesmilitärischen Laien sitzen, liegt die große Schwierigkeit.Und dann ist es ja nicht Elsaß-Lothringen allein. Die Vernichtungdes deutschen Militarismus heißt an der Themsedoch die einseitige Entwaffnung Deutschlands. Kann eineArmee, die weit im Feindeslande steht, und deren Generalevom Endsieg überzeugt sind, kann ein Volk, das nicht geschlagenist, das ertragen?Ich redete dem Kronprinzen dennoch zu, mit seinemVater über die Abtretung zu sprechen. Er war ganz einverstanden.Dann lud ich ihn, im Namen des Kaisers, nachWien ein, was er zu tun versprach, sobald er die Erlaubniserhalte.Zurückgekehrt , schrieb der Kaiser ihm einen vonmir entworfenen Brief, in welchem folgender Passus vorkam:„Mein Minister des Äußern hat mir die interessanteUnterredung gemeldet, die er mit Dir zu haben die Ehrehatte, und alle Deine Aussprüche haben mich von Herzengefreut, weil sich darin meine Auffassung der Lage so genauwiderspiegelt. Trotz aller übermenschlichen Leistungenunserer Truppen erfordert die Lage im Hinterlande unbedingtein Ende des Krieges noch vor dem Winter, diesgilt für Deutschland so gut wie für uns. Die Türkei wirdnur mehr sehr kurz mitmachen, und mit ihr verlieren wirauch Bulgarien, dann sind wir zwei allein, und das kommende7 Czern n, im Weltkrieg*97
Wilhelm II.Frühjahr wird Amerika bringen und eine noch verstärkteEntente. Ich habe andererseits bestimmte Anzeichen, daßwir Frankreich für uns gewinnen könnten, wenn Deutschlandsich zu gewissen territorialen Opfern in Elsaß-Lothringenentschließen könnte. Haben wir Frankreich gewonnen, sosind wir Sieger, und Deutschland kann sich anderweitigausgiebig entschädigen. Aber ich will nicht, daß Deutschlanddas Opfer allein tragen sollte. Ich will selbst denLöwenanteil dieses Opfers tragen und habe Seiner MajestätDeinem Vater erklärt, daß ich unter den vorerwähntenBedingungen bereit bin, nicht nur auf ganz Polen zu verzichten,sondern auch Galizien an Polen abzutreten unddieses Reich an Deutschland angliedern zu helfen. Deutschlandwürde im Osten ein Reich gewinnen, während es imWesten einen Teil seines Landes hergeben würde. <strong>Im</strong> Jahre1915 haben wir, ohne irgendeine namhafte Kompensationzu fordern, im Interesse unseres Bundes auf Bitten Deutsch-den Trento angeboten, um denlands dem treulosen ItalienKrieg zu vermeiden. Heute ist Deutschland in einer ähnlichen,jedoch weit aussichtsvolleren Lage. Du als Erbe derdeutschen Kaiserkrone bist berechtigt, Dein gewichtigesWort mit in die Wagschale zu werfen, und ich weiß, daßSeine Majestät Dein Vater diesen Standpunkt bezüglichDeiner Mitarbeit voll und ganz teilt. Darum bitte ich Dich,in dieser für Deutschland wie für Österreich-Ungarn entscheidendenStunde die gesamte Situation zu bedenken undDeine Bemühungen mit den meinen zu vereinen, um denKrieg rasch in ehrenvoller W^eise zu beenden. Wenn Deutschlandauf seinem ablehnenden Standpunkte verharrt undeinen möglichen Frieden zerstört, so ist die Situation inÖsterreich-Ungarn sehr kritisch.Ganz besonders würde es mich freuen, wenn ich baldigsteine Aussprache mit Dir haben könnte, und Dein mir durchden Grafen Czernin mitgeteiltes Versprechen, uns bald zubesuchen, freut mich ganz ausnehmend."98
Wilhelm II.Die Antwort des Kronprinzen war eine sehr freundlicheund entgegenkommende, bewegte sich jedoch in allgemeinenPhrasen, und es war klar, daß es den deutschen Militärsgelungen war, seine Bestrebungen im Keime zu ersticken.Als ich Ludendorff einige Zeit später in Berlin traf, wurdemeine Anschauung durch die Worte bestätigt, mit welchener mich apostrophierte: „Was haben Sie denn mit unseremKronprinzen gemacht, der ist ja ganz schlapp geworden?Aber wir haben ihn wieder aufgepumpt."Das Spiel war immer dasselbe. Die letzte Kriegszeit galtin Deutschland ein einziger Wille, und dies war der WilleLudendorffs. Sein Denken war bloß Kämpfen und seineSeele Sieg.
IV.Rumänien
MeineErnennurig zum Gesandten in Bukarest im Herbst1913 kam mir völlig unerwartet und sehr gegen meinenWillen. Sie erfolgte auf Initiative des Erzherzogs FranzFerdinand. Ich hatte nie gezweifelt, daß der Erzherzog michspäter einmal in der Politik werde verwenden wollen, zuLebzeiten des Kaisers Franz Joseph traf es mich überraschend.Es herrschte zu dieser Zeit in Wien eine große Differenzin der Beurteilung der rumänischen Frage. Eine rumänenfreundlicheRichtung kämpfte gegen eine rumänenfeindliche.Der Exponent der ersteren war Erzherzog Franz, mit ihm,wenn auch weniger ausgesprochen, Berchtold — der Exponentder letzteren Tisza und mit ihm so zirka das ganzeungarische Parlament.Die erstere Richtung wünschte einenengeren Anschluß Rumäniens an die Monarchie, die letzteredas Bündnis durch ein solches mit Bulgarien zu ersetzen;beide gemeinsam vertraten jedoch den Wunsch, es mögeeinmal eine vollständige Klarheit geschaffen werden, wie esmit diesem Bündnis überhaupt stehe und ob wir jenseits derKarpathen einen Freund oder einen Feind hätten. MeinVorgänger Karl Fürstenberg hatte zwar ganz klar und ganzrichtig hierüber berichtet, teilte aber das Los so mancherGesandten, indem er keinen Glauben fand.Die positive Aufgabe, welche mir gestellt worden war,ging also dahin, erstens zu untersuchen, ob dieses Bündnisirgendeinen praktischen Wert habe, und falls ich einer negativenAnsicht sei, jene Mittel und Wege vorzuschlagen,welche dasselbe lebensfähig machen könnten.103
RumänienIch muß hier einschaltend bemerken, daß meine Ernennungzum Gesandten in Bukarest einen Sturm im ungarischenParlament ausgelöst hatte. Der Grund zu der damals inUngarn ziemlich allgemein verbreiteten Empörung übermeine Wahl war eine von mir einige Jahre früher geschriebeneBroschüre, in welcher ich die magyarische Politik,allerdingsin ziemlich vehementer Form, angegriffen hatte. Ich hatteden Standpunkt verteidigt, daß eine Politik der Unterdrükkungder Nationen sich auf die Dauer nicht halten lassenund Ungarn nur eine Zukunft haben könne, wenn es definitivmit dieser Politik breche und den Nationen die volle Gleichberechtigungeinräume. Diese Broschüre war mir in Budapestungemein verübelt worden, und die Vertreter im ungarischenParlament hegten die Befürchtung, ich könntenunmehr in Rumänien eine Politik inaugurieren, welche,dem Gedankengang der Broschüre folgend, gegen die offizielleWiener und Pester Politik gerichtet wäre. Es war diesdie Zeit, in der ich die Bekanntschaft Tiszas machte. Ichhatte mit ihm eine lange und sehr offene Aussprache überdieganze Frage und erklärte ihm, daß ich auf dem Standpunkt,den ich in meiner Broschüre vertreten habe, stehenbleibenmüsse, weil er meiner festen Überzeugung entspreche,daß ich aber vollständig einsehe, daß ich in dem Augenblickeder Annahme eines Gesandtenpostens verpflichtet sei, michals Rad in die große Staatsmaschine einzufügen und loyaldie Politik des Ballplatzes zu unterstützen.Ich halte diesenStandpunkt auch heute noch für vollkommen berechtigt.Eine einheitliche Politik wäre ganz ausgeschlossen, wennein jeder subalterne Beamte seine eigenen Ansichten, seiensie nun richtig oder falsch, ins Leben setzen wollte, und ichhätte meinerseits als Minister niemals einen Gesandten geduldet,der eine von der meinen abweichende Politik selbständigzu betreiben versucht hätte. Tisza ersuchte mich,ihm mein Ehrenwort zu geben, daß ich keine Anstrengungenmachen würde, um eine der Wien-Pester Politik entgegen-104
Rumäniengesetzte in den Sattel zu heben, und ich erklärte mich einverstandenhiermit, vorausgesetzt, daß der Erzherzog-Thronfolgerdie Lösung akzeptiere.Ich hatte mit letzterem sodannebenfalls eine Aussprache und fand sofort seine volle Zustimmungzu meinem Vorgehen, welche er folgendermaßenmotivierte :solange er Thronfolger sei, werde auch er niemalseine Politik zu inaugurieren versuchen, welche der desKaisers widerspreche.Infolgedessen könne er auch von mirnichts Ähnliches erwarten. Käme er auf den Thron, sowerde er allerdings bestrebt sein, seinen eigenen AnsichtenGeltung zu verschaffen, in diesem Falle würde ich aber nichtmehr in Bukarest, sondern voraussichtlich an einer anderenStelle in der Lage sein, ihn in seinen Bestrebungen zu unterstützen.Der Erzherzog ersuchte mich, den Posten ausFreundschaft für ihn anzunehmen, und schließlich entschloßich mich dazu, nachdem mir Berchtold versprochen hatte,in längstens zwei Jahren meinem Wiederaustritte keineSchwierigkeiten zu bereiten.Erzherzog Franz schöpfte seine rumänenfreundliche Gesinnungaus einer sehr mangelhaften Quelle. Er kannteRumänien so gut wie gar nicht. Er war, soviel ich weiß, eineinziges Mal im Lande, und zwar zu einem kurzen Besuche beiKönig Carol in Sinaia gewesen, und die freundliche Aufnahme,welche sowohl seine Gemahlin wie er von dem alten Königspaarerhalten hatte, hatte sein Herz im Sturm erobert, under verwechselte König Carol mit Rumänien. Es war dieswieder ein Beweis, wie stark die persönlichen Beziehungender maßgebenden Faktoren die Politik der Völker beeinflussen.Das alte Königspaar holte den Erzherzog von derBahn ab, die Königin umarmte und küßte die Herzogin undließ sie, rechts von sich sitzend, in das Schloß fahren. Kurz,es, war das erstemal, daß die Herzogin von Hohenberg alsgleichberechtigte Gattin ihres Mannes den hergebrachtenFormen entsprechend behandelt wurde. Die wenigen Stundenin Rumänien genoß der Erzherzog die Freude, die jeder von105
Rumänienuns als etwas ganz Natürliches empfindet, daß die eigeneFrau dasselbe ist wie der Mann, nicht etwas Minderwertiges,das zurückgeschoben wird. Auf einem Wiener Hofball mußtedie Herzogin hinter allen Erzherzoginnen einhergehen undhatte keinen Herrn gefunden, welcher ihr den Arm bot. InRumänien war sie seine Frau, und das Zeremoniell kümmertesich nicht um ihre Geburt. Wie der Erzherzog einmalveranlagt war, rechnete er dem König diesen Beweis freundschaftlichenTaktes ungemein hoch an, und seitdem hatteRumänien für ihn einen besonderen Charme. Außerdem hatteer das richtige Gefühl, daß bei Änderung gewisser politischerVerhältnisse ein wirklich enges Bundesverhältnis zwischenRumänien und uns zu erreichen sei. Er fühlte mehr, als erwußte, daß diesiebenbürgische Frage wie ein großer Blockzwischen Wien und Bukarest liege und daß dieser Block,einmal weggeräumt, das ganze Bild ändern würde.Der erste Teil meiner Aufgabe, zu konstatieren, in welchemZustande sich das Bündnis überhaupt befinde, war nichtschwer, denn schon die ersten langen Konferenzen mitKönig Carol ließen mir keinen Zweifel darüber, daß der greiseMonarch das Bündnis selbst als sehr unsicher ansah. KönigCarol war ein ungemein kluger,sehr vorsichtiger und überlegterMann, und es war nicht leicht,ihn zum Sprechen zubringen, wenn er die Absicht hatte, zu schweigen. Die Frageder Lebensfähigkeit des Bündnisses klärte ich in der Form,daß ich dem König in meiner dritten oder vierten Audienzvorschlug, das Bündnis möge pragmatisiert, d. h. von denParlamenten in Wien, Pest und Bukarest ratifiziert werden.Der Schreck, welchen dieser Vorschlag auf den König ausübte,der bloße Gedanke, daß das streng gehütete Geheimnis,daß ein Bündnis überhaupt bestehe, preisgegeben werdenkönnte, dieser Schreck bewies mir, wie ganz unmöglich einIns-Leben-Rufen dieses toten Buchstaben unter den gegebenenVerhältnissen sein106müsse.Meine am Ballplatze erliegenden Berichte lassen keinen
RumänienZweifel darüber übrig, daß ich diese erste mir gestellte Fragein der Art und Weise beantwortet habe, daß ich auf daskategorischste erklärt habe,das Bündnis mit Rumänien seiunter den obwaltenden Umständen nichts anderes als eininhaltloserFetzen Papier.Die zweite Frage, ob es Mittel und Wege gebe, das Bündnislebendig zu machen, und welches diese Mittel und die Wegewären, war theoretisch ebenso leicht zu beantworten, als siepraktisch schwer durchführbar war. Wie bereits erwähnt,war das Hindernis wirklich enger Beziehungen zwischenBukarest und Wien die großrumänische Frage, d. h. derrumänische Wunsch nach nationaler Vereinigung mit den,, Brüdern in Siebenbürgen". Diesem Wunsche stand selbstverständlichder ungarische Standpunkt schroff gegenüber.Es ist nun interessant und für die ganze damalige Situationbezeichnend, daß mir bald nach meinem Amtsantritt inRumänien der später so berüchtigt gewordene KriegshetzerNikolai Filippescu den Vorschlag machte, Rumänien mögemit Siebenbürgen vereint werden, und dieses ganze vereinigteGroß-Rumänien möge sodann zu der Monarchie in ein Verhältnistreten, ungefähr wie Bayern zum Deutschen Reiche.Ich gestehe offen, daß ich diesen Gedanken mit beiden Händenaufgegriffen habe, denn wenn er von einer Seite lanciertwurde, welche von jeher mit Recht als die der Monarchiefeindlichste angesehen wurde, so war gar kein Zweifel, daßdie gemäßigten Elemente Rumäniens ihn mit noch größererGenugtuung ergriffen hätten. Ich glaube auch heute noch,daß dieser Gedanke, damals durchgeführt, eine wirklicheAngliederung Rumäniens an die Monarchie zur Folge gehabthätte, daß dann die Veröffentlichung des Bündnisses garkeinem Widerstände mehr begegnet wäre, und daß <strong>info</strong>lgedessenauch der Ausbruch des <strong>Weltkriege</strong>s uns in einer anderenSituation gefunden hätte. Leider scheiterte dieser Gedankeschon in seinem allerersten Stadium an dem schroffsten undschärfsten Widerstände Tiszas.Kaiser Franz Joseph stellte107
Rumäniensich vollständig auf den Standpunkt des Grafen Tisza, undes war ganz ausgeschlossen, mit Argumenten etwas zu erreichen.Auf der anderen Seite dachte ja zu dieser Zeit niemanddaran, daß der große Krieg und somit die Probe desBündnisses unmittelbar bevorstehe, und ich tröstete michüber meine mißlungenen Bemühungen damit, daß ich derfesten Hoffnung war, daß dieser, wie mir schien und heutenoch scheint, großzügige Gedanke unter der Regierung desErzherzogs Franz bestimmt Wirklichkeit werden würde.Bei meiner Ankunft in Rumänien fand gerade ein Wechselder Regierung statt. Das konservative Ministerium Majorescumachte dem liberalen Ministerium Bratianu Platz.Die Regierungstaktik König Carols war ganz eigenartig.Von Anfang an hatte er das Prinzip, niemals mit Gewaltoder auch nur größerer Energie gegen schädliche Strömungenim eigenen Lande vorzugehen, sondern den an ihn ständigverübten Erpressungsversuchen immer nachzugeben. Erkannte sein Volk sehr genau und wußte, daß man jede derbeiden Parteien, die Konservativen wie die Liberalen, abwechselndzur Krippe lassen müsse, bis sie sich an derselbengenügend gesättigt hätten und bereit seien, wieder den anderenPlatz zu machen. Fast ein jeder Regierungswechselvollzog sich in der gleichen Weise: die Opposition, welchezur Macht gelangen wollte, begann mit Drohungen und mitder Revolution zu spielen. Irgendein Schlagwort, eine ganzunmögliche Forderung wurde aufgestellt, mit Vehemenzverlangt und das Volk für diese Forderung aufgepeitscht;die bestehende Regierung, die diese Forderung gar nicht erfüllenkonnte, trat zurück, und die Opposition, einmal zurRegierung gekommen, dachte nicht mehr daran, das zu halten,was sie versprochen hatte. Der alte König kannte diesesSpiel ganz genau und ließ stets das oppositionelle Wasserso lange steigen, bis es seiner Regierung an den Hals ging,wechselte sodann seine Männer aus, sah zu, bis das Spielvon neuem begann. In Rumänien ist es Sitte, daß jede der108
Rumänienbeiden Parteien, wenn sie zur Macht gelangt, den ganzenApparat bis zum letzten Amtsdiener auswechselt. Diese Maßregeldes stetigen Wechseins hat naheliegende Schattenseiten.<strong>Im</strong> übrigen kann nicht geleugnet werden, daß sie insofernpraktisch ist, als sie Anwendung gewaltsamer Mittel überflüssigmacht. Auf die eben geschilderte Art und Weisekam auch das Ministerium Bratianu im Jahre 1913 in denSattel.Majorescu regierte zur vollständigen Zufriedenheit desKönigs und der ruhig denkenden Bevölkerung des Landes.Er hatte gerade durch den Frieden von Bukarest und die„Eroberung" der Dobrudscha einen in den Augen der Rumänengroßen diplomatischen Erfolg errungen, als Bratianumit der' Forderung nach großen Agrarreformen auftrat.Diese Agrarreformen sind eines der Steckenpferde der rumänischenPolitik,das immer wieder bestiegen wird, sobaldes gilt, die armen verelendeten Bauern vor den Wagen dereigenen Agitation zu spannen, und immer wieder gelingtdieses Manöver dank der noch sehr mangelhaften Intelligenzder rumänischen Bauernbevölkerung, immer wieder holensie der einen oder der anderen Partei die Kastanien ausdem Feuer, und immer wieder werden sie einfach beiseitegeschoben,sowie der Zweck erfüllt ist. Auch Bratianu dachte,einmal in den Sattel gehoben, gar nicht mehr daran, diegegebenen Versprechungen einzuhalten, sondern setzte denKurs, den Majorescu eingeschlagen hatte, ruhig weiter fort.<strong>Im</strong>merhin war es bedeutend schwieriger, mit Bratianuin der Frage der äußeren Politik zu einem gedeihlichen Ergebnissezu kommen, als es mit Majorescu der Fall gewesenwäre, weil ersterer eine vollständig westeuropäische Orientierunghatte und im Grunde seines Herzens germanophoban und für sich war. Einer der Unterschiede zwischen Liberalenund Konservativen war immer der, daß die LiberalenPariser Erziehung genossen hatten, nur Französisch und keinDeutsch sprachen, während dieKonservativen nach MusterCarps und Majorescus Berliner Ableger waren. Da derIOQ
RumänienGedanke, Rumänien durch eine Veränderung der internenungarischen Politik definitiv und fest an uns zu ketten,nicht durchzusetzen war, wurde natürlich und gewissermaßenautomatisch der Gedanke aktuell, Rumänien durch Bulgarienzu ersetzen. Dieser Gedanke, welcher hauptsächlichdem Grafen Tisza ungemein sympathisch war, konnte wiederdeshalb nicht durchgeführt werden, weil es nach dem BukaresterFrieden des Jahres 1913 vollständig ausgeschlossenwar, Rumänien und Bulgarien unter einen Hut zu bringen,und ein Bündnis mit Sofia Rumänien direkt in das feindlicheLager getrieben hätte. Gegen letztere Eventualität sträubtensich aus oben angeführten Gründen aber sowohl Berchtoldals auch der Erzherzog-Thronfolger, und auch Kaiser FranzJoseph dürfte diese Eventualität ungern gesehen haben —und so blieb alles beim alten, Rumänien wurde nicht gewonnen,auch nicht durch Bulgarien ersetzt, man begnügtesich in Wien damit, der Zukunft das Weitere zu überlassen.In gesellschaftlicher Hinsicht war das Jahr, welches ichvor dem Kriege inRumänien zugebracht habe, kein unangenehmes.Die Beziehungen, die ein österreichisch-ungarischerGesandter sowohl zu dem Hofe wie zu den zahlreichenBojaren hatte, waren freundschaftlich und angenehm, undniemand hätte zu dieser Zeit glauben können, welche Flutenvon Haß in Kürze gegen die österreichisch-ungarischen Grenzenanprallen würden.<strong>Im</strong> Kriege wurde dann auch das gesellschaftliche Lebenunangenehm, wie folgendes Beispiel beweist: In Bukarestexistierteein Oberleutnant Prinz Sturdza, der ein bekannterExaltado und Raufbold und ein eingefleischter TodfeindÖsterreich-Ungarns war. Ich kannte den Mann nicht persönlich,und es lagen keine persönlichen Momente vor, alser eines Tages damit begann, mich in den Zeitungen als Exponentender Monarchie öffentlich zu beschimpfen. Alsich auf seine Artikel selbstverständlich nicht reagierte, schrieber mir in dem Blatte ,,Adeverul" einen offenen Brief, in welchem110
Rumäniener mir mitteilte, „er werde mich bei der ersten Gelegenheitöffentlich ohrfeigen". Ich telegraphierte an Berchtold underbat die kaiserliche Erlaubnis, mich mit dem Individuumschießen zu dürfen,da er Offizier und daher nach unserenBegriffen satisfaktionsfähig war. Der Kaiser Franz Josephließ mir sagen, es sei ausgeschlossen, daß ein Gesandter sichin einem Lande, in welchem er akkreditiert sei, duelliere, undich möge mich bei der rumänischen Regierung beschweren.Ich ging darauf zu Bratianu, welcher erklärte, absolut nichtsmachen zu können. Nach den Gesetzen und Regeln desLandes sei ein fremder Gesandter gegen solche Beschimpfungennicht zu schützen. Wenn Sturdza seine Drohungen ausgeführthaben würde, werde man ihn einsperren,nichtszu machen.vorher seiIch erklärte Bratianu hierauf, daß ich, wenn die Sache sostehe, in Zukunft nur mehr mit einem Revolver ausgehenund den Mann niederschießen würde, falls er mich berühre;wenn man in einem Lande lebe, welches die Sitten von„Wild-West" habe, so müsse man dementsprechend vorgehen.Dem Oberleutnant ließ ich sagen, daß ich täglich pünktlichein Uhr im Hotel Boulevard essen würde. Dort könne ersich die Kugel holen, wenn er wolle.Als ich Kaiser Franz Joseph das nächste Mal wiedersah,erkundigte er sich nach den weiteren Vorgängen, und icherzählte ihm mein Gespräch mit Bratianu und meine festeAbsicht, mir selbst zu helfen. Der Kaiser erwiderte: „Natürlichkönnen Sie sich nicht schlagen lassen. Sie habenganz recht.Schießen Sie ihn nur nieder, wenn er Sie anrührt."Ich traf Sturdza dann noch mehrmals in Restaurants wiein Salons, ohne daß er versucht hätte, seine Drohungen auszuführen.Der Mann, der das Naturell eines verwegenenAbenteurers hatte, desertierte sodann zu der russischenArmee und kämpfte in derselben gegen uns zu einer Zeit,als Rumänien noch neutral war. Dann verlor ich ihn ausdem Gesicht.in
RumänienDie völlige Preßfreiheit, verbunden mit der Roheit derdortigen Sitten, trieb die mannigfachsten Blüten, und auchdie eigenen Könige wurden oft beschimpft. König Carolerzählte mir diesbezüglich drastische Beispiele. Als KönigFerdinand noch neutral war, erschien in einem Witzblattein Bild, das den König darstellte, welcher auf einenHasen zielt, und darunter stand der Ausruf des Hasen:„Höre, mein Lieber, du hast lange Ohren, ich habe langeOhren, du bist ein Feigling, ich bin ein Feigling. Bruder,warum schießt du auf mich?"Diese Preßfreiheit verwandelte sich mit dem Tage desKriegsausbruches in das Gegenteil und wurde durch dieschärfste Zensur und Diktatur ersetzt.Rumänien ist das Land der Gegensätze: landschaftlich,sozial und klimatisch. Der gebirgige Norden mit seinenprachtvollen Karpathen gehört zu den schönsten Gebirgsgegenden;dann kommt dieunendliche, unsagbar eintönige,fruchtbare Ebene der Walachei, welche ihrerseits in dasparadiesische Donautal übergeht. Besonders im Frühjahr,wenn die Donau alljährlich weite Strecken überschwemmt,bietet dieser Landstrich unbeschreibliche Reize. Er erinnertan die Tropen. <strong>Im</strong> Wasser liegende Urwälder, mit zerstreutenInseln, wo das Leben üppig emporwuchert. Es gibt keineschönere Gegend für den Jäger. Alle Sorten von Raubvögeln,Reihern, Enten, Pelikanen und anderen Vögeln trifft manhier neben dem Wolf und der Wildkatze, und tagelang kannman in diesem Paradiese herumrudern und herumwandern,ohne zu ermüden.Die Rumänen haben im allgemeinen wenig Sinn für Sport,da sie physischen Anstrengungen abhold sind. Sowie siekönnen, verlassen sie das Land und verbringen ihre Zeit inParis oder an der Riviera.Dieser Reisedrang bei ihnen istso stark, daß ein Gesetz geschaffen wurde, welches jedenRumänen bei sonst höherer Steuer zwingt, einen Teil desJahres im Lande zu verbringen. Von den zum Teil112
Rumänienunermeßlich reichen Bojaren sticht die Landbevölkerung inihrer desolaten Armut ab. Noch ungeheuer zurück in der Kultur,ist der rumänische Bauer dennoch ein fleißiger, ruhiger,genügsamer Typus, dessen rührende Anspruchslosigkeit ingrellem Gegensatze zu den oberen Klassen steht.Die gesellschaftlichen Verhältnisse der oberen Zehntausendsind dadurch kompliziert, daß die Titelfrage seit der Abschaffungdes Adels eine Rolle spielt wie nirgends auf derWelt. Ungefähr ein jeder Rumäne führt einen Adelstitel,Unkenntnis der ein-leitet ihn in irgendeiner Weise ab, hält ungemein auf denselbenund verübelt dem Fremden dieschlägigen Wissenschaft. <strong>Im</strong> allgemeinen wird man amsichersten gehen, wenn man einen jeden mit „mon prince"tituliert. Zweitens ist es dem Fremden wegen der unaufhörlichenScheidungen und Wiederverheiratungen schwergemacht, den inneren Zusammenhang der Bukarester Gesellschaftzu ergründen. Fast eine jede Frau ist wenigstenseinmal geschieden und wieder verheiratet, und daraus ergebensich komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse einerseitsund eine solche Unzahl von gestörten persönlichenBeziehungen andererseits, daß es zu" den schwierigsten Aufgabengehört, zwanzig Rumänen — und vor allem Rumäninnen— zum Essen zu laden,ohne irgendwo anzustoßen.Unter dem alten Regime gehörte es mit zu den Aufgaben derjüngeren der Gesandtschaft zugeteilten Herren, ihr keimendesdiplomatisches Talent durch die geschickte Zusammenstellungsolcher Dinerlisten und die Vermeidung aller drohendenKlippen zu beweisen. Da aber die ,,Rangfrage" in Rumänienebenso ernst genommen wird, als sie ungeregelt ist — fasteine jede Dame beansprucht für sich den ersten Rang — , soist die richtige „Placierung" eines Diners ebenfalls noch eineFrage hoher diplomatischer Fähigkeiten. Es gab in Bukarestein Dutzend Damen, die überhaupt eine Einladung nur dannannahmen, wenn sie sicher waren, auch an erster Stelleplaciertzu werden.8 Cz ernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> Hß
RumänienMein Amtsvorgänger durchhieb den gordischen Knotendieser Schwierigkeiten dadurch, daß er an zahlreichen kleinenTischen servieren ließ und sich auf diese Art eine große Zahl„erster Plätze" schuf, ohne jedoch auch mit diesem MittelalleAmbitionen befriedigen zu können.Ich erhielt die Nachricht von der Ermordung des ürzherzog-Thronfolgersin Sinaia durch Bratianu. Ich wardamals <strong>info</strong>lge einer Influenza bettlägerig, als von Bratianutelephonisch bei mir angefragt wurde, ob ich etwas davonwisse, daß der Zug des Erzherzogs in Bosnien verunglücktund sowohl er als die Herzogin tot seien. Diesem erstenAlarmruf folgten bald richtigere Nachrichten und ließenkeinen Zweifel über die Größe der Katastrophe. Der ersteEindruck in Rumänien war der des tiefsten und aufrichtigstenBeileides und wahrhafter Konsternation. Niemals hatteRumänien daran gedacht, daß es ihm gelingen könne, in. einemKriege den Traum seiner nationalen Wünsche zu erfüllen,stets war es nur von der Hoffnung geleitet, daß eine freundschaftlicheAuseinandersetzung mit der Monarchie die Vereinigungaller Rumänen bewerkstelligen könne, und eben indieser Hinsicht hatte man in Bukarest die größten Hoffnungenauf den Erzherzog-Thronfolger gesetzt. So schienmit seinem Tode auch Groß-Rumänien zu Grabe getragen zusein, und aus jenem Gefühl heraus ist jene aufrichtige Trauerzu verstehen, welche damals alle Kreise Rumäniens erfaßthatte. Der berüchtigte Take Jonescu hat nach Erhalt derNachricht in dem Salon meiner Frau heiße Tränen geweint,und die Kondolenzen, die ich erhielt, hatten nicht denCharakter, den solche Manifestationen gewöhnlich tragen,sondern waren Ausbrüche wirklichen und aufrichtigenSchmerzes. Der russische Gesandte Poklewski soll einenrohen Ausspruch getan haben, welcher ungefähr dahin114
:Rumänienlautete :„daß es nicht begründet sei, wegen dieses Zwischenfallesso viel Aufsehen zu machen," und die allgemeine Entrüstung,welche dieses Wort auslöste, beweist, wie stark dieSympathien waren, welche der Ermordete in diesem Landegenossen hat.Wie mit einem Schlage änderte sich jedoch die ganzeSituation bei Bekanntwerden des Ultimatums. Ich habe michniemals Täuschungen über die rumänische Psyche hingegebenund war mir auch vollständig klar darüber, daß das aufrichtigeBedauern an der Ermordung des Erzherzogs natürlicherweiseegoistischen Motiven entsprang, und zwar, wie gesagt,der Befürchtung, den nationalen Wünschen nunmehr entsagenzu müssen. Das Ultimatum und die von einer Stundezur anderen drohend am Horizont erscheinende Kriegsgefahrstürzte die ganze rumänische Psyche um und Heß sie plötzlicherkennen, daß ihr Ziel auch auf einem anderen Wegezu erreichen sei: nicht friedlich, sondern kriegerisch, nichtmit der Monarchie, sondern gegen dieselbe. Ich hätte esnie für möglich gehalten, daß ein solcher Umschwung sichtatsächlich binnen wenigen Stunden vollziehen könne. Echteund gespielte Empörung über den Ton des Ultimatums warauf der Tagesordnung, und der allgemeine Ausspruch lautete„L'Autriche est devenue folle."Frauen und Männer, die mitmir seit einem Jahre auf einem guten, freundschaftlichenFuße gestanden hatten, waren plötzlich erbitterte Feindegeworden, überall begegnete man einer Mischung von Empörungund erwachender Gier, nun endlich den heißestenWunsch des Herzens erfüllen zu können. Noch schwanktein einigen Kreisen die Stimmung durch wenige Tage. VorDeutschlands Militärmacht hatte Rumänien heiligen Respekt,und das Jahr 1870 war bei vielen Rumänen in noch zufrischer Erinnerung. Als aber England in die Reihen unsererGegner eintrat, schwand auch diese Besorgnis, und von demAugenblicke an war es der erdrückenden Majorität derRumänen klar, daß die Erfüllung ihrer Aspirationen nur8 ' 115
Rumänienmehr eine Frage der Zeit und eine Frage der diplomatischenGeschicklichkeit sein werde. Die gegen uns anstürmendeWelle von Haß und Eroberungssucht war im ersten Stadiumdes Krieges viel stärker als in verschiedenen späteren Stadien,weil die Rumänen, wie übrigens wir alle, den Fehler gemachthaben, daß sie mit einer viel kürzeren Kriegsdauer rechnetenund daher die Entscheidung viel näher gerückt glaubten, alssie es tatsächlich war. Erst später, nach den großen Erfolgender Deutschen im Westen, nach Gorlice und der UnterwerfungSerbiens traten verschiedene Strömungen unterden Rumänen hervor, welche für eine retardierende Politikeintraten.<strong>Im</strong> allerersten Augenblicke war bis auf Carp undseine kleine Gruppe mehr oder weniger alles dafür, sich sofortauf uns zu stürzen.Ganz allein, wie ein Fels im brausenden Meere dieses Hassesstand der arme alte König Carol mit seinem deutschen Herzen.Ich hatte den Auftrag erhalten, ihm das Ultimatum zur gleichenStunde zu verlesen, als es in Belgrad übergeben wurde,und der Eindruck, den diese Lektüre auf den alten Königmachte, wird mir ewig unvergeßlich bleiben. Er, der kluge, altePolitiker, erkannte sofort die unermeßliche Tragweite diesesSchrittes, und ich hatte das Schriftstück nicht zu Ende gelesen,als er mich leichenblaß mit dem Ausrufe unterbrach:„Das ist der Weltkrieg!" Es dauerte lange Zeit, bis ersichüberhaupt fassen konnte und jene Auswege zu suchenbegann, die ihn hoffen ließen, daß doch vielleicht eine friedlicheLösung noch ermöglicht werden könne. Ich muß hiereinschaltend bemerken, daß einige Zeit vorher der Zar mitSasonow in Konstantza gewesen war und dort eine Zusammenkunftmit der königlichen rumänischen Familie stattgefundenhatte. Ich war am Tage nach der Abreise des Zaren nachKonstantza gereist, um mich zu bedanken, da mir der Königdas Großkreuz eines seiner Orden verliehen hatte, offenbarum zu beweisen, daß er über Rußland sein Bündnis nichtvergesse, und wo er mir interessante Details über den Besuch116
Rumänienerzählte. Das Interessanteste war seine Schilderung des Gesprächesmit dem nissischen Minister des Äußern. Aufseine Frage, ob Sasonow die europäische Situation ebensogesichert auffasse wie er, der König selbst, erwiderte Sasonowbejahend: „Pourvu que l'Autriche ne touche pas äla Serbie." Ich hatte diesen vielsagenden Ausspruch selbstverständlichsofort nach Wien gemeldet, aber weder Wiennoch der König noch ich hatten damals den Gedankengangvollständig verstanden. Das Verhältnis zwischen Serbienund der Monarchie war um diese Zeit nicht schlechter, eherbesser als gewöhnlich, und es bestand nicht die geringsteAbsicht unsererseits, den Serben etwas zuleide zu tun. DerVerdacht^ daß Sasonow damals bereits wußte, daß serbischerseitsetwas gegen uns geplant werde, läßt sich dahernicht von der Hand weisen.An diesen Ausspruch Sasonows erinnerte mich nun derKönig und fragte, ob ich denn dieses so wichtige Faktumnicht nach W T ien gemeldet hätte. Ich bejahte, aber gleichzeitigbetonte ich, daß dieser Ausspruch ein Grund mehrfür mich sei, zu glauben, daß das Attentat eine von langerHand vorbereitete und unter russischer Patronanz vollzogeneMissetat sei.Den Verdacht eines russisch-rumänischen Attentats hattebereits das seinerzeitso viel Aufsehen erregende DebreczinerVerbrechen gegeben.Am 24. Februar 1914 veröffentlichte das „UngarischeKorrespondenzbureau" folgende Nachricht:„Heute vormittag ereignete sich in dem Amtslokale desneu errichteten griechisch-katholisch-ungarischen Bistums,das sich im zweiten Stockwerke des Palais der Handels- undGewerbekammer in der Franz-Deäk-Gasse befindet, einefurchtbare Explosion, und zwar im Amtszimmer des Vertretersdes Bischofs, Vikars Michael Jaczkowics, in dem sichaußer diesem auch der Sekretär Johann Slepkovszky befand.Beide wurden in Stücke zerrissen. In einem benachbartenZimmer hielt sich der griechisch-katholische Bischof Stephan117
RumänienMiklossy auf, der jedoch merkwürdigerweise unversehrtgeblieben ist. In einem anderen Zimmer befand sich derAdvokat und Rechtsanwalt des Bistums Alexander Csatth,der durch die Explosion tödlich verwundet wurde. In einemdritten Räume wurden der Diener des Bischofs und dessenFrau getötet. Sämtliche Wände der Kanzleiräumlichkeitensind eingestürzt und das ganze Gebäude stark erschüttert.Die Explosion verursachte im Hause eine derartige Panik,daß alle seine Bewohner in wilder Flucht zerstoben.benachbarten Gerichtsgebäude in der Verböczy-Gasse wurdendurch den Luftdruck sämtliche Fensterscheiben zertrümmert.Losgelöste Ziegel fielen auf die Straße und verletzten mehrerePassanten. Die vier Toten und die Verletzten wurden insKrankenhaus gebracht. Der Bischof verließ verstört dasGebäude und begab sich in die Wohnung eines Freundes.Die Tochter des Bischof-Stellvertreters Jaczkovics hat aufdie Nachricht von dem tragischen Tode ihres Vaters einenWahnsinnsanfall erlitten. Die Ursache der Explosion konntebisher nicht festgestellt werden."In demIch wurde bald insofern in die Angelegenheit verwickelt,als Ungarn und Rumänien sich gegenseitig der Urheberschaftbeschuldigten, was zu zahlreichen Interventionen und BerichtigungenAnlaß gab, ferner weil ein angeblicher Helfershelferdes bald konstatierten Mörders Catarau in Bukarestverhaftet wurde, dessen Auslieferung an Ungarn ich durchsetzensollte.Dieser Mann namens Mandazescu war beschul-dem Mörder Catarau einen falschen Paß verschafft zudigt,haben.Catarau, ein rumänischer Russe aus Beßarabien, war nachdem Attentate spurlos verschwunden. Bald trafen aus Serbien,bald aus Albanien Nachrichten ein, daß man seineSpur gefunden habe, immer aber erwiesen sich die Nachrichtenals falsch. Durch einen Zufall erfuhr ich Näheresüber ihn. Ich fuhr mit einem rumänischen Schiffe von Konstantzanach Konstantinopel und hörte zufällig, wie zweirumänische Schiffsoffiziere miteinander sprachen und dereine sagte: „Das war an dem Tage, als die Polizei uns denCatara,u an Bord brachte, um ihn unbemerkt fortzuschaffen."118
RumänienSpäter wurde Catarau in Kairo festgestellt, von wo erebenfalls mit Hilfe rumänischer Freunde entkommen zu seinscheint. Von da an verlor ich vorerst seine Spur.Es soll nicht behauptet werden, daßMie rumänische Regierungin das Komplott verwickelt war — aber rumänischeBehörden waren es, wie ja in den Balkanländern ähnlich wiein Rußland immer allerhand Banden wie diedie„cerna ruka",„narodna odbrana" usw. neben der Regierung ihr Spieltreiben.Es war ein von russischen oder rumänischen geheimenGesellschaften verübtes politisches Verbrechen — und dieRegierungen der beiden Länder zeigten jedenfalls ein auffallendgeringes Interesse, dem Sachverhalt auf den Grundzu gehen und die Schuldigen der Strafe auszuliefern.Am 15. Juni desselben Jahres erhielt ich aus sichererQuelle die Nachricht, daß Catarau in Bukarest gesehen wordensei. Er ging ganz ungeniert am hellen Tage spazieren,ohne beanstandet zu werden. Dann verschwand er.Um aber auf meine Unterredung mit dem Könige zurückzukommen,so sandte der angstgequälte alte König nochdenselben Abend Telegramme nach Belgrad und nach Petersburgab, beide des Inhaltes, das Ultimatum möge restlos angenommenwerden.Die namenlose Erschütterung, welche in der Seele desKönigs vorging, als er, wie einen Blitz aus heiterem Himmel,plötzlich den Weltkrieg vor sich sah, erklärt sich dadurch,daß er ganz genau wußte, daß der Konflikt zwischen dem,was er als Ehre und Pflicht erkannte, und seinem Volkeplötzlich offenbar werden müsse. Der arme alte Mann hatden Kampf durchgekämpft, so gut er konnte, und er ist indemselben geblieben. König Carol ist an dem Kriege gestorben.Die letzten Wochen waren eine Tortur für denalten Herrn, denn er empfand die Aufträge, die ich ihmauszurichten hatte, wie Peitschenhiebe.Ich hatte auftragsgemäßalles zu versuchen, um die dem Bündnis entsprechende119
Rumäniensofortige Kooperation Rumäniens zu erreichen, und ich mußtesoweit gehen, ihn daran zu erinnern, daß „das gegebene Wortkein Deuteln zulasse, daß ein Vertrag Vertrag sei und seineEhre es ihm gebiete, das Schwert zu ziehen". Ich erinneremich an eine tatsächlich ergreifende Szene, wo sich der alteKönig, laut weinend, auf seinenSchreibtisch warf und mitzitternden Händen versuchte, sich den ,,Pour le m6rite"-Orden, welchen er stets trug, vom Halse zu reißen. Ichkann ohne jede Übertreibung sagen, daß ich ihn unterdiesen fortwährenden moralischen Keulenschlägen dahinsiechensah, und daß die seelischen Aufregungen, die erdurchmachte, zweifellos sein Leben verkürzt haben.Königin Elisabeth wußte das alles, aber sie nahm mirmein Vorgehen nicht übel, weil sie verstand, daß ich Beauftragterund nicht Auftraggeber sei.Die Königin Elisabeth war eine gute,kluge und rührendeinfache Frau, keine Dichterin ,,qui court apres 1'esprit",sondern eine Frau, die die Welt durch versöhnliche, poetischeBrillen sah. Sie sprach gern und gut, und immerhatten ihre Ausführungen einen poetischen Charme. Aufihrer Stiege hing ein prachtvolles Meerbild, welches ich bewunderthatte, und anknüpfend daran erzählte die alte Frauvom Meer, von ihrer kleinen Villa in Konstantza, welche amEnde des vorspringenden Kais fast im Meere liegt, vonihren Eindrücken auf hoher See, von ihren Reisen; undimmer, wenn sie sprach, drang die große Sehnsucht nachallem Guten und Schönen, die in ihr wohnte, durch. Undsieerzählte:„Das Meer lebt. Wenn es ein Symbol gäbe für den Begriffder Ewigkeit, so wäre es das Meer.Unendlich in seinerGröße und ewig in seiner Bewegung. Ein trüber Tag mitWind. Einer nach dem anderen kommen die gläsernenWasserberge herangewälzt, überstürzen und brechen sich andem felsigen Strande. Wie beschneit sieht es aus durch alledie kleinen weißen Wogenkämme. Und das Meer atmet.120
RumänienFlut und Ebbe sind seine Atemzüge. Die Flut ist die treibendeKraft, welche die Wassermassen vom Äquator biszum Nordpol pumpt. So arbeitet es Tag und Nacht, Jahrfür Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert. Es kümmert sichnicht um die vergänglichen Wesen, die sich die Herren derWelt nennen, diese Eintagsfliegen, die kommen und diewieder gehen, kaum daß sie gekommen. Das Meer bleibtund arbeitet. Es arbeitet für alle, für Menschen, Tiere undPflanzen, denn ohne Meer gäbe es kein organisches Lebenauf der Erde. Das Meer ist der große Filter, der allein denzum Leben notwendigen Stoffwechsel bewirkt. ZahlloseFlüsse spülen im Laufe der Jahrtausende die Erde in dasMeer.Jeder Fluß trägt unaufhörlich Erde und Sand in denOzean, und das Meer übernimmt die Erdenstoffe, seineStrömungen tragen es weit hinaus in die See, und langsam,ganz allmählich im Laufe der Zeiten zermürbt und zerreibtdas Meer alles, was es übernimmt. Denn das Meer hat Zeit.Auf tausend Jahre mehr oder weniger kommt es ihm nichtan. Alle die schweren Erdenstoffe sinken auf den Meeresgrund,zerfasert, zermahlen, zu Staub geworden, und amMeeresgrund bleiben sie liegen. Lange Jahrtausende, vielleichtJahrmillionen — wer weiß es.Aber einmal, ganz plötzlich beginnt das Meer zu wandern.Alles Festland war ja einmal Meer, und alleaus dem Meere geboren.Kontinente sindAlso eines Tages erhebt sich irgendwoaus dem Meere das Land. Seine Geburt hat revolutionären Charakter, Erdbeben, speiende Krater, stürzendeStädte und sterbende Menschen — aber neues Land ist da.Oder aber es wandert langsam, ganz unsichtbar, ein paarMeter im Jahrhundert, es zieht sich zurück und macht zuLand, was früher ihm gehörte. Und so gibt es der Erdewieder den Stoff zurück, den es ihr geraubt, aber durchsiebt,verfeinert, wieder lebensfähig und lebenschaffend. Das istdas Meer und seine Arbeit." ,So erzählt die alte, halbblinde Frau, die ihr geliebtes Bild121
Rumänienselbst gar nicht mehr sehen kann, und dann erzählt sie, wiesie selbst das Meer vergöttert, und wie ihre Großneffen und-nichten die gleiche Leidenschaft hätten wie sie, und wiesie mit ihnen wieder jung werde, wenn sie ihnen erzähle vonaltenZeiten.Stundenlang kann man ihr zuhören, ohne sich zu langweilen,und jedesmal nimmt man ein hübsches Wort undeinen hübschen Gedanken mit fort, wenn man sie verläßt.Man kann solche Abhandlungen gewiß sachlicher undrichtiger in geologischen Büchern lesen. Aber in den WortenCarmen Sylvas schwingt immer halb unbewußt eine poetischeSaite mit. Das ist es, was sie so anziehend macht.Auch über Politik sprach sie gerne. Und ihre Politik hieß:König Carol. Es gab nur ihn und immer nur ihn. Nachseinem Tode, als die Rede davon war, daß alle Staaten derWelt in diesem schrecklichen Kriege verlieren, sagte sie:„Rumänien hat bereits das Kostbarste verloren, was es besessenhat." Nie sprach sie von ihren eigenen Dichtungenund Werken. In der Politik gab es für sie neben KönigCarol nur eins: Albanien. Die alte Frau hatte eine leidenschaftlicheLiebe für die Prinzessin von Wied und daher daseminenteste Interesse für das Land, in dem diese lebte.EinGespräch über die Wieds gab mir Gelegenheit, den altenKönig unfreundlich mit seiner Frau zu sehen. Es war daseinzige Mal, daß ich das erlebte. Es war in Sinaia, und ichsaß — wie häufig — beim König. Die Königin kam herein,was sie sonst niemals tat, und brachte ein Telegrammder Prinzessin von Wied, welche, ich weiß nicht mehrwas, für Albanien wünschte. Der König lehnte ab, dieKönigin insistierte, und da wurde der alte Herr bös: Manmöge ihn in Ruhe lassen, er habe andere Dinge im Kopfeals Albanien.Nach dem Tode König Carols verlor sie ihre Spannkraft.Auch die so veränderte Politik nagte an ihr. Sie liebte ihrenNeffen Ferdinand — wie sie122überhaupt nur Platz für Liebe
Rumänienin ihrem Herzen hatte — und zitterte davor, er könne„Verrat begehen". Ich erinnere mich, daß sie mir einmalweinend sagte: „Beruhigen Sie mich, sagen Sie mir, daß erdas niemals machen wird." Ich konnte der armen, alten FraudieSicherheit nicht geben — aber ein gütiges Geschick hatsie davor bewahrt, die Kriegserklärung zu erleben.Später — nicht lange vor ihrem Tode — war die alteKönigin von völliger Blindheit bedroht. Sie wünschte sichder Staroperation durch einen französischen Arzt zu unterziehen,welcher natürlich durch die Monarchie reisen mußte,um nach Bukarest gelangen zu können. Auf ihren Wunschintervenierte ich in Wien, und Kaiser Franz Joseph gabsofort den Befehl, die Reise zu gestatten.Nach gelungener Operation schickte die Königin einemmeiner Kinder ein selbstgeschriebenes kleines Gedicht undfügte hinzu, es sei dies der erste Brief, seitdem sie wiedersehend geworden. Gleichzeitig erfuhr ich, daß die alte Frauneuerlich politisch sehr beunruhigt sei.Ich schrieb ihrfolgenden Brief:„Euer Majestätdanke ich innigst für das hübsche Gedicht, welches Siemeinem Buben geschickt haben. — Daß es mir vergönnt war,etwas dazu beizutragen, daß Ihnen das Augenlicht wiedergeschenktwerde, belohnt sich in sich selbst und bedarf wahrlichkeines Dankes — und daß Eure Majestät die ersten wiedergeschriebenen Worte an meine Kinder richten, freut undrührt mich.<strong>Im</strong> übrigen wollen Eure Majestät sich nicht mit politischenSorgen quälen. Es hilft nichts. Für den Augenblick wirdRumänien die Politik des hochseligen Königs beibehalten;was die Zukunft bringt, weiß nur Gott allein.Wir alle sind Staubkörnchen in diesem furchtbaren Orkane,der über die Welt fegt, und werden willenlos herumgewirbelt,— ob dem Untergange oder der Auferstehung entgegen,steht dahin. Nicht ob wir leben oder sterben ist die Hauptsache, sondern wie wir es tun. Und König Carol kann unsallen darin als Vorbild dienen.123
RumänienIch hoffe, König Ferdinand wird niemals vergessen, daßsein Onkel ihm mit dem Throne ein politisches Glaubensbekenntnisvererbt hat, ein Glaubensbekenntnis der Ehreund der Treue, und ich weiß, daß Eure Majestät die sichersteHüterin dieses Testamentes sind..Euer Majestät ' ,dankbar ergebensterWenn ich sagte,Czernin."daß der König Carol den Kampf durchkämpfte,so gut er eben konnte, so wollte ich damit sagen,daß man von niemand verlangen kann, daß er ein andererwerde, als er immer war. Energie, Tatkraft und Wagemutdürfte der König schwerlich jemals in besonderem Maßegehabt haben, und zu dieser Zeit, als ich ihn kennen lernte,als alter Mann, schon gar nicht. Er war ein kluger Diplomat,eine ausgleichende Kraft, ein geborener Vermittler undSchwierigkeitenvermeider, keine Natur, die Sturm läuft undriskiert. Das mußte man wissen, und daher konnte mannicht glauben, daß der König versuchen werde, gegen denklaren Willen ganz Rumäniens an unsere "Seite zu treten.Wäre der König eine andere Natur gewesen, so hätte ermeiner Ansicht nach das Experiment mit Erfolg wagenkönnen. Der König hatte in Carp einen Mann von ganzungewöhnlicher, ja rücksichtsloser Tatkraft und Energie.Und dieser Mann hat sich vom ersten Augenblicke an füreine solche Aktion dem Könige zur Verfügung gestellt.Hätteder König, ohne zu fragen, die Mobilisierung angeordnet,so wäre es bestimmt der Energie des alten Carp gelungen,dieselbe auch durchzuführen. Wie die damalige militärischeSituation aber war, so wäre die rumänische Armee in denRücken der russischen gestoßen, und aller Wahrscheinlichkeitnach hätte der erste Erfolg auf den Schlachtfeldern dasBild vollständig geändert, und das gemeinsam vergosseneBlut siegreicher Kämpfe hätte jene Gemeinschaft geboren,welche die Seele unseres Bündnisses zu bilden hatte undnie gebildet hat. Aber ein Mann dieser Qualität war der124
RumänienKönig nicht, er konnte ebensowenig aus seiner Haut herauswie ein anderer Mensch, und das, was er getan hat, entsprachvollständig jener Tätigkeit, welche er durch Jahrzehnte aufdem Thron ausgeübt hat.Solange der König lebte, war die positive Sicherheit gegeben,daß Rumänien nicht gegen uns losschlagen würde.Denn mit derselben zähen Klugheit, mit der er stets eineAgitation in seinem Lande zu verhindern wußte, hätte erauch die Mobilisierung gegen uns verhindert. Es wäre ihmdabei zustatten gekommen, daß die Rumänen ja im Gegensatzzu den Bulgaren nicht kriegerisch veranlagt sind, unddaß Rumänien niemals die Absicht hatte, viel bei diesemFeldzug zu riskieren. Es hätte also eine Kunktatorenpolitikin der klugen Hand des Königs ein Losschlagen gegen unsbestimmt insUnendliche verzögert.Sofort nach Kriegsausbruch begann das bekannte SpielBratianus, welches darin bestand, daß sich die rumänischeRegierung gewollt und bewußt zwischen die beiden Mächtegruppenstellte, sich von beiden treiben und stoßen ließ,von beiden möglichst viele Vorteile einheimste und denAugenblick abwartete, wo sich der Stärkere als solcher erkennenlassen werde, um dann über den Schwächeren herzufallen.Auch in den Jahren 1914 bis 1916 war Rumänien niemalswirklich neutral. Es bevorzugte stets unsere Feinde undverhinderte alle unsere Aktionen nach Kräften.Eine große Rolle spielten die von uns begehrten Transportevon Pferden und besonders Artilleriemunition nachder Türkei im Sommer 1915.Die Türkei war damals sehrgefährdet und ersuchte dringend um Munition. Hätte sichdie rumänische Regierung auf den Standpunkt gestellt, überhauptkeiner der kriegführenden Mächte einen Vorteil zubieten, so wäre dies vom Standpunkt der Neutralität auskorrekt gewesen — sie hat aber diesen Standpunkt niemalseingenommen und beispielsweise den Serben stets die125
Rumänienrussischen Munitionstransporte auf der Donau gestattet undbewies dergestalt eine große Einseitigkeit. Als alle Versuchenichts fruchteten, wurde die Munition auf anderen Wegenwenigstens zum Teile durchtransportiert.Auch russische Soldaten konnten jederzeit rumänischenBoden betreten, ohne behelligt zu werden, während die unserensofort interniert wurden.Einstmals landeten zwei österreichische Flieger aus Versehenin Rumänien und wurden natürlich sofort interniert.Es waren dies ein Kadett namens Berthold und ein Zugsführer,dessen Name mir entfallen ist.Sie sandten Hilferufe aus ihrem Gefängnis an mich,und ich ließ ihnen sagen, sie möchten trachten, die Erlaubniszu einem Besuche bei mir zu erhalten. Einige Tagedarauf erschien der Kadett in Begleitung eines ihn bewachendenrumänischen Offiziers. Der Offizier blieb vordem Hause auf der Straße. Ich ließ das Tor schließen,setzte den Kadetten in eines meiner Automobile und ließihn durch das rückwärtige Tor hinaus und nach Giurgiufahren, wo er die Donau übersetzte und in zwei Stundenfrei war.Der Offizier entfernte sich nach vergeblichem Warten,Reklamationen kamen zu spät.aber seineDer arme, allein zurückgebliebene Zugsführer erhielt daraufnicht mehr die Erlaubnis, auf die Gesandtschaft zukommen. Er brach jedoch nachts durch das Fenster aus undkam ohne Erlaubnis. Ich versteckte ihn eine Weile bei mirund schaffte ihn sodann per Bahn nach Ungarn. Auch erist glücklich über die Grenze gekommen.Bratianu machte mir später Vorwürfe über mein Vorgehen,welches ich damit quittierte, daß ich ihm sagte, diessei die Folge seiner nicht eingehaltenen Neutralität. Wenner unsere Soldaten ebenso unbehelligt lassen würde wiedie russischen, so wäre ich nicht gezwungen gewesen, sovorzugehen.126
Rumänien<strong>Im</strong> Grunde seines Herzens hat Bratianu wohl nie ernstlichdaran gezweifelt, daß die Mittelmächte unterliegen würden,und seine nicht nur durch Erziehung, sondern auch durchdiese politische Spekulation hervorgerufenen Sympathienwaren stets bei der Entente. Es hat dann im späteren VerlaufeAugenblicke gegeben, wo Bratianu bis zu einem gewissenGrade wankend zu werden schien. Ganz besonderstrifft dies zu in der Zeit unserer großen Offensive gegenRußland. Der Durchbruch von Gorlice und der unaufhaltsameVormarsch in das Innere Rußlands hatten in Rumänieneine verblüffende Wirkung. Bratianu, der von Strategieauffallend wenig verstand, konnte es einfach nicht fassenund begreifen, daß die russischen Millionen, welche er bereitsim sicheren Anmärsche gegen Wien und Berlin wähnte,plötzlich zurückfluten und Festungen wie Warschau wieKartenhäuser fallen. Damals war er unruhig und magschlechte Nächte gehabt haben. Auf der anderen Seite begannendiejenigen, die von Anfang an, wenn auch nichtaustrophil, so doch nicht austrophob gewesen waren, plötzlichdie Köpfe zu heben und Morgenluft zu wittern. DerSieg der Mittelmächte tauchte als neue Eventualität amHorizonte auf. Das war der historische Moment, in welchemRumänien zu einer aktiven Kooperation hätte gewonnenwerden können. Nicht das Ministerium Bratianu. Bratianuselbst wäre niemals und unter keinen Umständen mit unsgegangen, aber wenn wir es damals über uns gebracht hätten,ein Ministerium Majorescu oder Marghilomann in den Sattelzu heben, so hätten wir die rumänische Armee an unsereSeite bekommen können.Diesbezüglich lagen konkrete Vorschlägevor. Allerdings hätten wir, um diesen Plan durchzuführen,einer Regierung Majorescu territoriale Konzessionenin Ungarn in Aussicht stellen müssen — Majorescuverlangte dies als Vorbedingung seiner Übernahme derGeschäfte, und dieses Postulat scheiterte an dem starrenWiderspruche Ungarns. Es ist eine fürchterlich gerechte127
RumänienStrafe, daß dieses arme Ungarn, welches so viel zu unsererdefinitiven Niederlage beigetragen hat, am allerschwerstenunter den Folgen derselben gelitten, und daß die von ihmso verachteten und verfolgten Rumänen es waren, welche diegrößten Triumphe in ungarischen Gefilden geschlürft haben.Unter den zahlreichen Vorwürfen, die mir im Laufe derletzten Monate gemacht worden sind, ist auch der, daß ichschon als Gesandter in Rumänien hätte „gehen" müssen,wenn meine Vorschläge in Wien nicht angenommen wurden.Diese Vorwürfe beruhen auf einer ganz falschen Vorstellungder Kompetenzen und der Verantwortung. Ein subalternerBeamter hat die Pflicht, die Situation so zu schildern, wieer siesieht, und jene Vorschläge zu machen, die ihm richtigerscheinen, aber die Verantwortung für die Politik trägtder Minister des Äußern, und es würde zu den unmöglichstenund absurdesten Zuständen führen, wenn ein jeder Gesandteraus der Ablehnung seiner Vorschläge die Konsequenz, seineDemission, ziehen würde. Wenn die Beamten immer danndemissionieren müßten, wenn sie mit der Richtung ihrerVorgesetzten unzufrieden sind, dann müßten sie ungefähralledemissionieren.Die Spionage und Konterspionage hat selbstverständlichin diesem Kriege viele Blüten getrieben. In Rumänien hatRußland sich besonders stark damit beschäftigt.<strong>Im</strong>. Oktober 1914 ereignete sich ein für mich peinlicherZwischenfall. Ich war im Automobil von Bukarest nachSinaia gefahren und hatte politische Schriften in meinerTasche, welche durch den Irrtum eines Dieners, statt in dasAutomobil gelegt zu werden, rückwärts aufgebunden war.Auf der Fahrt wurde die Tasche losgebunden und gestohlen.Ich machte sofort alle Anstrengungen, um dieselbe wiederzuerhalten,was mir erst nach ungefähr dreiwöchigemSuchen und sehr bedeutenden Spesen gelang. Sie ward beieinem Bauer in dessen Scheune gefunden, und er hatte anscheinendnichts entwendet als darin befindliche128Zigaretten.
RumänienNach der Okkupation Bukarests durch unsere Truppenfand man jedoch die Kopien und Photos aller meiner Papierein der Wohnung Herrn Bratianus.Ich hatte gleich nach dem Verluste der Tasche in Wienmeine Demission angeboten, welche jedoch von KaiserFranz Joseph abgelehnt worden war.Das von Burian veröffentlichte Rotbuch über Rumänien,welches einen Auszug meiner wesentlichsten einschlägigenBerichte enthält, gibt ein ziemlich klares Bild über dieeinzelnen Phasen dieser Zeit und dieheranrückende Kriegsgefahr.Die Niederlagen, welche Rumänien vorübergehenderlitten hat, ließen vorerst allen jenen recht geben, welchevor einem vorzeitigen Eingreifen gewarnt hatten. Es mußhier, um die Situation klar zu schildern, erklärt werden, daßes die letzte Zeit vor dem Kriegseintritte Rumäniens eigentlichnur zwei Parteien in diesem Lande gab; die eine wardie uns feindliche, welche die sofortige Kriegserklärungwünschte, die andere die „freundliche", welche die Situationfür noch nicht reif hielt und riet, noch etwas zu warten,bis wir genügend geschwächt seien. Diese „freundliche"Richtung triumphierte während der Zeit unserer Erfolge.Zu letzterer gehörte, glaube ich, auch die Königin Marie.Sie war von Anfang des Krieges an dafür, ,,an der SeiteEnglands zu kämpfen", wie sie sich stets nur als Engländerinfühlte, nur scheint sie — wenigstens im letzten Augenblick —den Moment des Losschiagens verfrüht gefunden zu haben.Ich hatte wenige Tage vor der Kriegserklärung ein „Abschiedsfrühstück"bei ihr,welches merkwürdig war, da wirbeide wußten, daß wir in einigen Tagen Feinde sein würden.Nach dem Frühstück nahm ich die Gelegenheit wahr, ihrzu sagen, „ich sei ebenfalls über die Situation orientiert,aber die Bulgaren würden früher in Bukarest sein als dieRumänen in Pest" — sie ging ruhig auf das Gespräch ein,wie sie überhaupt eine offene Natur war, die auch die Wahrheitvertrug. Unsere Zensurbehörden fingen einige Tage9 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> I2Q
Rumänienspäter einen Brief der Hofdame ab, welche diesem Frühstückbeigewohnt hatte, und welcher nicht für unsere Ohren bestimmtwar: er enthielt eine Beschreibung des „dejeunerfort embetant" mit wenig Schmeichelhaftem für mich.Die Königin Marie hat den Glauben an den Endsieg nie verloren.Sie war vielleicht mit Bratianu nicht in allen Phasenseiner Taktik einig,uns aber den Krieg zu erklären, war stetsin ihrem Programm. Sie hat auch in der schweren Zeit dervernichtenden Niederlagen den Kopf obenbehalten. Eineihrer Freundinnen hat mir später erzählt, daß sie, als sichvon Süden, Norden und Westen unsere Armeen Bukarestnäherten, als Tag und Nacht die Erde unter dem fortgesetztenKanonendonner dröhnte, ruhig ihre Vorbereitungenzur Abreise traf, in der festen Überzeugung, sie werde ,,alsKaiserin aller Rumänen" zurückkehren. Bratianu ist, wieman mir erzählt hat, nach der Einnahme von Bukarest völligzusammengebrochen — die Königin Marie war es, die ihntröstete und ihm Mut zusprach. Das englische Blut hatsich bei dieser Frau niemals verleugnet. Als wir die ganzeWalachei besetzt hatten, erhielt ich absolut sichere Nachrichten,nach welchen sie von Jassy aus an den KönigGeorg telegraphierte und ihr „kleines, aber tapferes Volk"seiner weiteren Protektion empfahl. Als wir den Friedenvon Bukarest machten, ist auf mich ein starker Druck ausgeübtworden, das Königspaar abzusetzen. Es hätte natürlichan der Situation nichts geändert, denn die Ententehätte sie nach dem Siege wieder eingesetzt — aber nichtaus diesem Grunde, den ich nicht voraussehen konnte, sondernaus den später zu erörternden Motiven widersetzte ichmich diesen Bestrebungen, trotzdem ich mir auch vollständigklar darüber war, daß Königin Marie stets unsere Feindinbleibenwerde.Die Kriegserklärung brachte alles, was österreichisch-ungarischoder deutsch war, in eine böse Situation.Ich begegnetezahlreichen Freunden aus der österreichisch-ungarischen130
RumänienKolonie, welche von den rumänischen Soldaten roh mitKolbenstößen dahergetrieben und eingesperrt wurden. Ichsah Hetzjagden, welche grotesk und abstoßend waren; tagelangdauerte dieses grausame Spiel.In Wien sind alle Bürger der feindlichen Staaten frei vonSekkaturen geblieben. Ich habe als Minister vorübergehendgegen rumänische Staatsbürger Repressivmaßregeln angeordnetund dies der Regierung in Jassy mitgeteilt,weil es keinanderes Mittel gab, um das Los unserer armen Verschlepptenzu mildem; sowie die neutrale Macht über eine humanereBehandlung berichtete, wurden sie wieder freigelassen.\Wenn wir am Fenster oder im Garten der Gesandtschafterschienen, wurden wir vom Volke beschimpft und verspottet,und auf der Bahn bei der Abreise drehte mir einjunger Beamter, den ich um eine Auskunft ersuchte, denRücken zu.Eineinhalb Jahre später bin ich wieder in Bukarest gewesen.Eine Siegeswelle hatte uns hinaufgetragen, und wirkamen, um den Frieden zu machen. Wir waren wiederGegenstand des Straßeninteresses, aber anderer Art. <strong>Im</strong>Theater bereiteten sieuns Ovationen, und ich konnte nichtauf der Straße gehen, ohne eine Schar von Bewunderernhinter mir zu haben.Gewalttätig gegen Wehrlose und untertänig gegen Mächtige— es gibt schönere Züge in dem Charakter der Völker. —Damals also wurden die Gesandtschaft und ungefährhundertfünfzig Mitglieder der Kolonie, darunter zahlreicheKinder, interniert, und wir verlebten böse zehn Tage, da esuns nicht klar war, ob wir überhaupt fortgelassen werdenwürden oder nicht. Interessant bleiben drei Zeppelinangriffe,welche wir in Bukarest mitzumachen Gelegenheit hatten,und welche in den prachtvollen mondhellen, wolkenlosenNächten des tropischen Himmels einen unvergeßlichen Eindruckauf uns hinterließen.Ich finde in meinem Tagebuche folgende Aufzeichnungen:9*131
,RumänienBukarest, August 1916.Auch meiner Frau und Tochter haben die Rumänen denKrieg erklärt. Eine aus zwei Beamten des Ministeriumsdes Äußern bestehende Deputation erschien nachts elf Uhrin Gehrock und Zylinder in Sinaia in meiner Villa, trommeltemeine Frau aus dem Schlafe und erklärte ihr beim Scheineeiner Kerze — Beleuchtung ist wegen Zeppelins verboten —daß Rumänien uns den Krieg erklärt habe. Der Sprechersagte dabei: ,,. . . vous a declare la guerre." Dann las erden beiden Frauen die ganze Kriegserklärung vor.Bratianuließ mir sagen, daß er meine Frau und Tochter sowie dieganze Gesandtschaft in einem Extrazug nach Bukarest kommenlassen werde.Bukarest, September 1916.Eigentlich erwarteten sich die Rumänen sofort einenZeppelinangriff. Bisher ist er ausgeblieben, und sie werdenschon wieder zuversichtlicher und erklären, es sei von Deutschlandzu weit für die Zeppeline, sie würden daher nicht kommen.Sie scheinen nicht zu wissen, daß Mackensen in BulgarienZeppeline hat. Aber wer weiß, ob sie kommen.Bukarest, September 1916.Vorige Nacht ist der Zeppelin doch gekommen. Gegendrei Uhr wurden wir durch das schrille Alarmpfeifen derPolizei aufgeweckt, welches hieß: „Das Telephon meldet,daß er die Donau überflogen hat." Und gleichzeitig begannenalle Kirchenglocken zu läuten. Und plötzlich wirdes ganz still und finster. Wie ein großes, böses Tier ziehtsich die Stadt zusammen, still und verbissen, und wartet aufden feindlichen Angriff. Nirgends ein Licht oder ein Laut.So liegt sie da, die große Stadt, unter dem prachtvollenSternenhimmel und wartet. Eine Viertelstunde vergeht,zwanzig Minuten, da plötzlich fällt,man weiß nicht wo, einSchuß; und als ob das das Signal gewesen wäre, kracht esan allen Ecken und Enden. Die Abwehrkanonen feuern ununterbrochen,und auch die Polizei hilft tapfer mit und132
Rumänienschießt Löcher in die Luft. Auf was schießen sie? Es istabsolut nichts zu sehen. Jetzt beginnen auch die Scheinwerferihr Spiel. Tastend suchen sie den Himmel ab vonOsten nach Westen, von Norden nach Süden, zucken sieüber das Firmament, aber sie können ihn nicht finden. Ister überhaupt da, oder ist das Ganze ein Spiel aufgeregterrumänischer Nerven?Plötzlich hört man ihn. Ganz deutlich hört man dieSchrauben mahlen, wie eine große Schiffsschraube klingtüber uns. Man glaubt, man muß ihn sehen können, in dersternenhellen Nacht, so nahe klingt es — das Rauschen derSchrauben verklingt in der Richtung nach Cotroceni. Undda fällt auch die erste Bombe. Wie ein Windstoß hört essich an, wie sie durch die Luft saust, und dann das Krachender Explosion — und die zweite und dritte. Das Schießennimmt an Heftigkeit zu. Aber sie scheinen nur nach demLärm zu schießen, sie können ihn nicht sehen. Krampfhaftsuchen die Scheinwerfer. Jetzt hat ihn einer gefaßt. Merkwürdigsieht es aus, das Luftschiff. Wie eine kleine goldeneZigarre. Aber ganz deutlich kann man die beiden Gondelnsehen, und der Scheinwerfer läßt es nicht mehr aus, undjetzt faßt es auch ein zweiter. Es sieht aus, als wenn derLuftkreuzer regungslos am Himmel stände, grell beleuchtetvon den Scheinwerfern von rechts und links, und jetzt beginnendie Kanonen erst recht. Rings um den Zeppelinherum krepieren die Schrapnelle in rotem Lichte — einprachtvolles Feuerwerk — aber unmöglich zu sagen, wie dieSchüsse liegen und ob ihm eine Gefahr droht. Der Zeppelinwird kleiner und kleiner, er scheint rapid zu steigen. Plötzlichist die Miniaturzigarre verschwunden, die Strahlenbündelder Scheinwerfer greifen ins Leere, und erregt wiegeärgert beginnen sie aufs neue über den Himmel zu zucken.Ganz still ist es auf einmal geworden. Ist er fort? Istder Angriff schon vorüber? Ist er getroffen und gezwungen,zu landen? Minuten vergehen. Wir sind längst alle ames133
RumänienBalkon, auch die Frauen, und verfolgen das aufregende Spiel.Da plötzlich wieder der bekannte Ton, den man, einmalgehört, nicht mehr vergißt, als wenn ein pfeifender Windstoßsich nähern würde, und dann das dumpfe Krachen derExplosion. Aber diesmal ist es weiter gegen die Forts hinaus.Und wieder kracht es von allen Seiten und bellen die Maschinengewehreden freundlichen Mond an; die Scheinwerferrasen wie verrückt über den Himmel und können ihn nichtfinden. Wieder kracht eine Bombe, diesmal bedenklich näher.Jetzt hört man auch die Schrauben wieder mahlen, laut undlauter. Ein Schrapnell platzt unmittelbar über der Gesandtschaft,pfeifend fliegen die Kugeln in den Garten, und jetztist er über uns. Deutlich hört man das Rauschen der gewaltigenSchraube, aber wie wir uns auch anstrengen, wirkönnen ihn nicht sehen. Und wieder krachen die Bomben —aber weiter und weiter. Dann wird es wieder still. Merkwürdigberührt diese plötzliche Stille nach dem furchtbarenLärm. Die Minuten vergehen. Nichts rührt sich mehr. <strong>Im</strong>Osten erscheint der erste zarte Schein des dämmerndenMorgens. Langsam verblassen die Sterne.Irgendwo weint ein Kind. Weit weg. Eigenartig, wiedeutlich man das hört in der stillen Nacht. Es macht denEindruck, als wenn die vor Angst gepeinigte Stadt sichnicht zu rühren und zu atmen wagen würde aus Furcht,das Ungeheuer könnte zurückkommen. Aber wie viele solcherNächte stehen ihr noch bevor? <strong>Im</strong>mer noch weint dasKind. In der Stille dieses feenhaften Morgens, der jetztlangsam anbricht, klingt dieses Weinen wie ein schrillerMißton. Unendlich traurig. Und ist diese arme Kinderstimmenicht nur das Echo von Millionen, die dieser furcht erhöheKrieg in die Verzweiflung getrieben hat?Blutigrot geht jetzt die Sonne auf. Einige Stunden habendie Rumänen Zeit, zu schlafen und neue Kraft zu sammeln.Aber der erste Besuch des Zeppelins wird nicht der letztesein, das wissen sie jetzt alle.*34
RumänienBukarest, September 1916.Die Presse ist empört über den nächtlichen Angriff.Bukarest sei zwar eine Festung, aber man müsse dochwissen, daß die Kanonen nicht mehr in den Forts seien i„Adeverul" soll geschrieben haben, die heldenhaften Abwehrkämpfehätten einen großen Erfolg gehabt. Das Luftschiffsei schwer havariert in der Nähe von Bukarest heruntergestürzt.Eine Kommission habe sich an Ort und Stellebegeben, um zu konstatieren, ob es ein Flieger oder einZeppelin sei!!Bukarest, September 1916.Heute nacht war er wieder da, und zwar überraschend.Er scheint von der anderen Seite, von Plojest, gekommen zusein, jedenfalls haben die Wächter an der Donau ihn verpaßt.Gegen Morgen sah die Nachtwache der Gesandtschaft,welche dafür zu sorgen hat, daß nirgends im Hause Lichtbrennt, eine Riesenmasse sich langsam auf die Gesandtschaftheruntersenken, ganz tief bis knapp über das Dach.Da blieb er durch mehrere Minuten schweben und orientiertesich. Niemand hat ihn bemerkt, bis er plötzlich seine Maschinengehen ließ und knapp an der Gesandtschaft seineerste Bombe warf. Er muß sehr hoch gekommen sein undsich dann ganz still gesenkt haben. Das Haus des GesandtenTresnea Crecianu soll einen Volltreffer erhalten haben, undzwanzig darin befindliche Gendarmen sind angeblich tot;ferner ist das königliche Schloß beschädigt. Die Regierungscheint begreiflicherweise nicht befriedigt über die Erfolgeder Abwehraktion und tröstet sich damit, daß die Übungerst den Meister mache. An der Übung wird es voraussichtlichdie nächste Zeit nicht fehlen.Unsere Abreise wird immer wieder unter allem erdenklichenVorwand verschoben. Einen Moment schien es, daßwir über Bulgarien nach Hause können. Der Gedankelächelte Bratianu sehr, denn er sah in der bulgarischenBereitwilligkeit die Garantie, daß Bulgarien keinen Angriff135
Rumänienplane. Diese Rechnung hat er ohne den Wirt gemacht. E.und W. sind sehr besorgt, weil die Rumänen sie zurückbehaltenund offenbar als Spione hängen wollen. Ich habeihnen erklärt: „Wir bleiben alle oder wir reisen gemeinsamab. Herausgegeben wird niemand." Das scheint sie etwasberuhigtzu haben.Wie zu erwarten, hatten diese nächtlichen Besuche einfür uns unangenehmes Nachspiel. Die Rumänen bildetensich anscheinend ein, es handelte sich nicht um Zeppeline,sondern um österreichisch-ungarische Luftschiffe, und meineAnwesenheit in der Stadt werde einen gewissen Schutz gegendiese Angriffe bieten; nach dem ersten Angriff erklärten sie,für jeden getöteten Rumänen würden zehn Österreicher oderUngarn hingerichtet werden, und die feindselige Behandlung,der wir ausgesetzt waren, nahm noch zu. Das unsgebrachte Essen wurde immer schlechter und weniger, undschließlich schnitten sie uns die Wasserleitung ab; bei dertropischen Temperatur, welche herrschte, und bei der Massenüberfüllungin einem Hause, welches normal auf zwanzigMenschen berechnet war und hundertsiebzig Bewohner hatte,entstanden dadurch binnen vierundzwanzig Stunden unhaltbareZustände, die Ausdünstungen ließen sofort einige Menschenunter hochgradigem Fieber erkranken, und weder einArzt noch eine Apotheke war zu erlangen. Nur dank derenergischen Intervention des holländischen Gesandten, Herrnvan Vredenburch, welcher den Schutz unserer Staatsangehörigenübernommen hatte, gelang es schließlich, diese Zuständeabzustellen und den Ausbruch einer Epidemie zuverhindern.Ein gutes Wort wurde in diesen Tagen von unseremMilitärattache, Oberstleutnant Baron Randa, geprägt:Einer unserer rumänischen Sklavenhalter stattete uns seinentäglichen Besuch ab und hielt einen jener großsprecherischenVorträge, in welchen die Rumänen ihre bevorstehenden Siege136
Rumänienzu verherrlichen pflegten. In der Antwort Randas fiel dasWort: „Mackensen." Der Rumäne war erstaunt über denihm unbekannten Namen und erwiderte: „Qu'est ce quec'est que ce Mackensen? Je connais beaucoup d'Allemands,mais je n'ai jamais fait la connaissance de Mr. Mackensen."„Eh bien" — antwortete Randa, ihm auf die Schulterklopfend — ,,vous la ferez, cette connaissance, je vous engarantis." Drei Monate darauf hatte Mackensen die ganzeWalachei besetzt und residierte in Bukarest — und zu dieserZeit dürfte auch unserem Rumänen der Name geläufigergeworden sein.Endlich wurden wir über Rußland nach Hause geschobenund hatten eine dreiwöchige, immerhin interessante Reiseüber Kiew, Petersburg, Schweden und Deutschland nachHause. Drei Wochen in einem Zuge zu leben, wird manchemlang erscheinen. Aber wie im Leben alles Gewohnheitist, gewöhnten wir uns dermaßen daran, daß viele vonuns die ersten Nächte in den Wiener Betten nicht schlafenkonnten, weil uns das Gerüttel des Fahrens fehlte. Wirhatten in unserem Extrazug übrigens allen Komfort undinsbesondere eine Abwechslung, als wir in der Nähe vonKiew in einer kleinen Station namens Baratinskaja auf BefehlBratianus durch mehrere Tage angehalten wurden. DerGrund ist niemals geklärt worden, wahrscheinlich warenSchwierigkeiten bei der Abreise des rumänischen Gesandtenin Sofia und der Wunsch, uns als Geiseln zu behandeln, dieUrsache. Die Reise quer durch das feindliche Land wareigenartig genug. Es wurden zu jener Zeit gerade mörderischeSchlachten in Galizien geschlagen, und wir begegnetenTag und Nacht den endlosen Zügen, welche heitere, lachendeSoldaten zur Front schleppten, und jenen, welche blasse,verbundene,stöhnende Verwundete zurückbrachten.Die Bevölkerung begegnete uns überall ungemein freundlich,und von dem Hasse, den wir in Rumänien empfundenhatten, war auch nicht die Spur vorhanden. Alles, was wir137
Rumäniensahen, stand im Zeichen der eisernen Ordnung und dergrößten Disziplin. Niemand von uns hielt es für möglich,daß dieses Reich am Vorabend der Revolution stehe, undals mich nach meiner Rückkehr Kaiser Franz Josephfragte, ob ich Anhaltspunkte für den Ausbruch einerRevolution gewonnen hätte, verneinte ich auf das entschiedenste.Der alte Kaiser hat dies unliebsam vermerkt. Er äußertesich später zu einem Herrn seiner Umgebung: ,,Über Rumänienhat Czernin sehr richtig berichtet, aber auf seinerReise durch Rußland hat er geschlafen."Die Entwicklung der rumänischen Verhältnisse währenddes Krieges zerfällt in drei Phasen. Die erste Phase umfaßtdie Regierungszeit König Carols. Während dieser Zeit wardie Neutralität garantiert. Es war auf der anderen Seite indiesen Monaten nicht möglich, Rumäniens Kooperation zuerreichen, weil wir in dieser ersten Kriegszeit militärisch soungünstig standen, daß sich die öffentliche Meinung Rumäniensnicht freiwillig zu einem Kriege an unserer Seitehätte bewegen lassen und, wie bereits früher erwähnt, eingewaltsames Vorgehen nicht dem Charakter des Königsentsprach.Anders lagen die Verhältnisse in der zweiten Phase, welchedie Zeit von dem Tode König Carols bis zu unserer Niederlagebei Luck umfaßt. Diese zweite Phase brachte diegrößten militärischen Erfolge, welche die Mittelmächte indem Kriege überhaupt hatten. In diese Epoche fällt dieNiederwerfung Serbiens und die Eroberung ganz Polens,und es sei wiederholt, in diesen Monaten wäre die aktiveKooperation Rumäniens zu erreichen gewesen. Trotzdemmuß ich hier ausdrücklich feststellen, daß, wenn die politischenVorbedingungen für ein solches Eingreifen Rumäniens138
Rumäniennicht geschaffen wurden, dies nicht dem damaligen Ministerdes Äußern zur Last zu legen ist, sondern der Vis major,welche sich in der Form eines ungarischen Vetos dem Vorgehenentgegenstellte. Es ist auch schon früher erwähntworden, daß Majorescu zu einer solchen Kooperation nurdadurch zu gewinnen gewesen wäre, daß Rumänien einStück des ungarischen Staates erhalten hätte. Dank dervollständig ablehnenden Haltung des Ballplatzes ist dasTerritorium niemals genau fixiert worden, doch dürftees sich ungefähr um Siebenbürgen und um ein .Stück derBukowina gehandelt haben. Ich kann nicht sagen, obGraf Burian, wenn er frei von anderen Einflüssen gewesenwäre, diesen Plan aufgegriffen hätte, aber sicher ist, daßer, wenn er noch so gern gehandelt hätte, den Gedankennicht gegen das ungarische Parlament durchführen konnte.Der Verfassung nach war das ungarische Parlament imungarischen Staate souverän, und ohne Anwendung vonWaffengewalt wäre Ungarn nie dazu zu haben gewesen,Teile des eigenen Staates herzugeben. Es liegt aber aufder Hand, daß es unmöglich gewesen wäre,in der Zeit des<strong>Weltkriege</strong>s auch noch einen bewaffneten Konflikt zwischenWien und Pest zu provozieren. Mein damaliger deutscherKollege von dem Bussche teilte völlig meine Ansicht, daßUngarn ein territoriales Opfer bringen solle, um RumäniensEingreifen zu ermöglichen.Ich glaube, daß damals, ähnlichwie vor der italienischen Kriegserklärung, auch direkt inWien ein gewisser Druck von Berlin in diesem Sinne ausgeübtwurde — ein Druck, der nur dazu beitrug, den WiderspruchTiszas noch zu verstärken und zu vertiefen. FürDeutschland lag die Frage ja auch viel einfacher, denn eshätte einen großen Gewinn aus fremder Tasche gezahlt.Die Abtretung der Bukowina wäre voraussichtlich durchzusetzengewesen, da Stürgkh sich nicht ablehnend verhielt,aber diese allein genügte den Rumänen nicht.Daß der Widerstand gegen eine Abtretung Siebenburgens139
Rumänienvon Ungarn ausgehe, war vollständig klar. Aber dieserWiderstand war keine Spezialität Tiszas, denn wer immervon den ungarischen Politikern an der Spitze des Kabinettsgestanden wäre, hätte denselben Standpunkt verfochten.Ich sandte damals einen Vertrauensmann zu Tisza, welcherdemselben die Situation erklären und ihn in meinem Namenbeschwören sollte, die Konzession zu machen. Tisza verhieltsich dem Boten gegenüber sehr zurückhaltend, schrieb mirjedoch sodann einen Brief, in welchem er ein für allemalerklärte, daß das freiwillige Abtreten ungarischen Bodensausgeschlossen sei; ,,wer immer es versuchen sollte, auchnur einen Quadratmeter ungarischen Bodens zu nehmen,auf den wird geschossen."So war nichts zu machen. Und doch glaube ich, daß dieseine der wichtigsten Phasen des Krieges war, welche, wennsie ausgenützt worden wäre, das Endresultat hätte beeinflussenkönnen. Der militärische Vorstoß in die Flanke derrussischen Armee wäre ein — nach Ansicht unserer Militärs— gar nicht abzuschätzender Vorteil gewesen, und dergeniale Durchbruch von Gorlice hätte erst dadurch einenErfolg erzielt. Die Politik unterstützte die Militärs nicht,und so blieb Gorlice eine strategische Kraftleistung ohnedauernde Wirkung.Der ablehnende ungarische Standpunkt erklärte sich zweifach:Erstens waren die Ungarn einer Abtretung eigenenTerritoriuns an und für sich abhold, und zweitens glaubtensie nicht — bis zum letzten Augenblicke — , daß Rumänienauf gar keinen Fall dauernd neutral bleiben werde, und daßwir daher früher oder später gegen Rumänien würdenkämpfen müssen, wenn wir es nicht rechtzeitig mit uns fortrissen.Tisza hat meinen diesbezüglichen „Pessimismus"stets bekämpft und bis zum letzten Augenblick daran festgehalten,daß Rumänien sich nicht „trauen" werde, unsanzugreifen. Nur so läßt es sich erklären, daß die Rumänenbei ihrem Einfall in Siebenbürgen dermaßen überraschen140
Rumänienund so reiche Vorräte erbeuten konnten. Ich hätte auch fürdie zahlreichen in Rumänien lebenden Österreicher undUngarn — welche nach der auch sie überraschenden Kriegserklärungeinem schrecklichen Los verfielen — viel bessersorgen können, wenn ich sie auf die herannahende Katastrophedeutlicher und allgemeiner hätte aufmerksammachen dürfen, — aber Tisza beschwor mich in mehrerenBriefen, keine Panik zu erzeugen, ,,da dieselbe unberechenbareFolgen nachziehen müsse". Da ich nicht wußte undnicht wissen konnte, inwieweit die geforderte Geheimhaltungmit unseren militärischen Gegenvorbereitungen im Zusammenhangestehe, so mußte ich mich streng an dieselbe halten.Burian hat anscheinend bis zu einem gewissen Grade meinenBerichten geglaubt, wenigstens gab er einige Zeit vor derKriegserklärung den Befehl, die geheimen Akten und dasvorhandene. Geld nach Wien transportieren zu lassen,und betraute Holland mit dem Schutze unserer Staatsbürger— aber Tisza hat mir viel später zugegeben,daß ermeine Berichterstattung als viel zu pessimistisch betrachtetund sich gefürchtet habe, eine überflüssige RäumungSiebenbürgens anzuordnen.<strong>Im</strong> ungarischen Parlamente schlug die Panik und derZorn nach dem unerwarteten Einfall hohe Wellen. Ich wurdeauf das heftigste kritisiert, da niemand daran zweifelte, daßmeine falsche Berichterstattung den Mangel an Vorbereitungenerkläre. Da war nun wieder Tisza ganz er selbst, als er miterhobener Stimme in den Saal rief: „Das sei nicht wahr, ichhätte richtig berichtet und rechtzeitig gewarnt, mich träfekeine Schuld" — und damit die Schuld der Wahrheit gemäßauf sich nahm. Furcht kannte er keine, und niemals versuchteer sich hinter jemanden zu decken. Als ich nachwochenlanger Reise durch Rußland in Wien eintraf unddort erst sehr verspätet allediese Details erfuhr, dankte ichTisza für die ehrliche, loyale Art, in welcher er mich verteidigthatte. Mit jenem etwas ironischen Lächeln, das ihm141
Rumänieneigen war, erwiderte er,das sei doch ganz selbstverständlichgewesen.Es war aber für einen österreichisch-ungarischen Beamtengar kein so selbstverständliches Erlebnis. Wir haben in derMonarchie so viele Feiglinge auf den Ministerbänken gesehen,so viele Männer, welche ebenso viel Mut gegen Untergebene,Kriecherei nach oben und Feigheit gegen eineschreiende Opposition bewiesen, daß ein Mann wie Tiszaschon durch seinen Gegensatz zu dieser Kaste erlösend underfrischendwirkte.Verschiedene Male haben die Rumänen versucht, irgendeineterritoriale Konzession für die Aufrechterhalfung ihrerNeutralität zu erpressen. Dagegen habe ich mich immergewehrt und war darin ganz einig mit dem Ballplatz. DieRumänen hätten eine solche Konzession eingesteckt und unsnatürlich später dennoch angefallen, um noch mehr zuerhalten. Für die militärische Kooperation schien mireine Gebietsabtretung am Platze, denn einmal im Felde,konnte Rumänien nicht mehr schwenken und band dadurchdauernd seinLos an das unsere.Die dritte Phase endlich' umfaßt den relativ kurzen Zeit^räum zwischen unserer Lucker Niederlage und dem rumänischenKriegsausbruch und war nichts anderes als die letzteAgonie der sterbenden Neutralität.Der Krieg lag in der Luft und war positiv vorauszusehen.'Wie nicht anders zu erwarten, hat die so mangelhaftediplomatische Vorbereitung für den Weltkrieg eine lebhafteKritik unserer diplomatischen Tätigkeit ausgelöst, und wennes in den Intentionen des Ballplatzes gelegen gewesen wäre,einen Krieg herbeizuführen, so kann nicht geleugnet werden,daß derselbe die Vorbereitung hierfür äußerst mangelhaftgetroffenhat.Diese Kritik hat aber nicht nur den Ballplatz getroffen,sondern sie ist auch in die Details eingegangen, indem sie142
Rumäniensich mit der Qualifikation der einzelnen auswärtigen Vertreterbeschäftigt hat. Ich erinnere mich an einen Artikeleines der gelesensten Blätter Wiens, welcher eine Gegenüberstellungdes „ausgezeichneten" Gesandten in Sofia und ungefähraller übrigen enthielt, das heißt aller derer, welchesich in Staaten befunden hatten, die entweder ihre Kooperationverweigert oder sogar gegen uns zu Felde gezogenwaren.Ich möchte hier, um ein Mißverständnis zu vermeiden,feststellen, daß meiner Ansicht nach unser damaliger Gesandterin Sofia, Graf Tarnowski, einer der besten und fähigstenDiplomaten Österreich-Ungarns war, daß jedoch derGesichtswinkel, unter welchem er in dieser Kritik lobendhervorgehoben worden ist, ein an und für sich vollständigfalscher war. Wenn Graf Tarnowski in Paris, London oderRom gewesen wäre, so hätten diese Staaten bestimmt trotzseiner unleugbaren Fähigkeiten keine andere Haltung eingenommenals die, die sie eingenommen haben, und auf deranderen Seite hätten gewiß zahlreiche andere ausgezeichneteBeamte des diplomatischen Korps ihre Aufgabe in Sofiaebenso gut gelöst wie Graf Tarnowski.Das soll mit anderen Worten heißen, daß es eine ungebührlicheForderung ist, von einem Vertreter im Auslandezu verlangen, daß er die Politik des Staates, bei welchemer akkreditiert ist, leitend beeinflusse. Was von einemdiplomatischen Vertreter verlangt werden kann, ist, daß erdie Situation richtig einschätze. Der Botschafter oder Gesandtemuß wissen, was die Regierung des Staates, beiwelcher er ist, machen wird. Stellt er falsche Diagnosen,ist er zu tadeln. Unmöglich aber kann ein Vertreter, undwer immer er sei,eine solche Macht über den fremden Staatgewinnen, daß er dessen Politik in dem von ihm gewünschtenSinne dirigiert. Die Politik eines Staates wird sich immernach jenen Regeln richten, welche der jeweiligen Regierungals Lebensbedürfnis erscheinen, und wird immer von Faktoren143
Rumänienbeeinflußt werden, welche ganz außerhalb der Ingerenz desfremden Vertreters liegen.Wie sich ein diplomatischer Vertreter die richtigen Informationenverschafft, ist seine Sache. Er wird trachtenmüssen, seinen Umgang nicht nur auf eine gewisse Gesellschaftsschichtzu beschränken, sondern sowohl mit derPresse als auch mit anderen Schichten der Bevölkerung inKontakt zu bleiben.Einer der Vorwürfe gegen das „alte Regime" war dessenangebliche Bevorzugung der Aristokraten in der Diplomatie.Der Vorwurf ist ganz falsch. Nicht Aristokraten wurdenbevorzugt, sondern in der Natur des Metiers lag es, daßVermögen und gesellschaftlicher Schliff für die Ausübungdes Berufes vorteilhaft waren. Der Attache warnicht bezahlt, und um standesgemäß im Auslande auftretenzu können, wurde von ihm der Nachweis verlangt,daß er eine gewisse ziemlich hohe Rente von zu Hausebeziehe. Dieses Prinzip entsprang der Not, respektive derablehnenden Haltung der Vertretungskörper, das Ministeriumdes Äußern besser zu dotieren. Die Folge war, daß nurSöhne reicher Eltern in die Karriere eintreten konnten.Ich habe einmal Abgeordneten, welche diesbezüglichbei mir intervenierten, gesagt, daß eine Änderung desSystems nur von ihnen und ihrer größeren Munifizenzabhängen würde.Ein gewisser gesellschaftlicher Schliff war für den Diplomatendes alten Regimes ebenso notwendig wie die nötigehäusliche Zulage und die Kenntnis fremder Sprachen. Solangees in Europa noch Höfe gibt, wird ein Hofleben alsZentrum des gesellschaftlichen Getriebes immer existieren,und die Diplomaten mußten Zutritt zu diesen Kreisen haben.Ein junger Mann, welcher nicht weiß, ob man mit der Gabeloder dem Messer ißt, wird dabei keine gute Rolle spielen —daher istseine gesellschaftliche Vorschule keine gleichgültigeNebensache. Nicht also Aristokraten wurden bevorzugt,144
Rumäniensondern wohlhabende junge Menschen mit europäischenUmgangsformen.Das soll, wie schon gesagt, nicht heißen, daß der Diplomatseine Aufgabe darin sehen soll,nur auf geselligen Festen deroberen Zehntausend zu erscheinen; aber es gehört mit zuseinen Pflichten, denn er wird an diesen Stellen viel erfahren,was er anderwärts nicht erfahren kann. Nebenbei soll derDiplomat seine Fäden auch nach anderer Richtung spinnen.Er soll im Kontakt sein mit all den Kreisen, aus welchen erInformationen beziehen kann.Die individuelle Geschicklichkeit und der persönliche Eiferdes einzelnen werden dabei natürlich immer eine großeRolle spielen. Sehr wichtig sind aber auch die Mittel,welche eine Regierung ihren ausländischen Missionen zurVerfügung stellt.Es gibt — ich weiß nicht, ob ich sagen soll : im Gegensatzzum Okzident — es gibt im Orient Menschen, welche gegendie Einwirkung des Goldes nicht immun sind. Die Mittel,über welche ein Gesandter oder Botschafter verfügt, werdendaher bei all seinen Aktionen immer eine sehr große Bedeutunghaben. In Rumänien beispielsweise hat Rußlandschon längst vor dem Kriege das ganze Terrain unterwühlt.Schon längst vor dem Kriege hat es Millionenausgaben nichtgescheut, um in diesem Lande Stimmung für sich zu machen»Die meisten Blätter waren festin russischen Händen; zahlreicheim politischen Leben maßgebende Persönlichkeitenwaren durch russische »Interessen gebunden — währendDeutschland und Österreich-Ungarn diese Vorarbeiten unterlassenhatten. So kam es, daß bei Kriegsausbruch Rußlandeinen immensen Vorsprung vor den Mittelmächten hatte,einen Vorsprung, der um so schwerer einzuholen war, alsRußland vom ersten Tage des Krieges an seine Goldschleusenin verstärktem Maße öffnete und Rumänien mit Rubelnüberschwemmte.Liegt in dieser den Krieg so wenig vorbereitenden10 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> I-t-T
werden.RumänienTätigkeit ein neuer Beweis ,daß die Mittelmächte nicht mit einemsolchen rechneten, so mag andererseits darin eine Erklärungfür manche anscheinend geringere Aktivität ihrer Vertretergefunden 'Mein Amtsvorgänger in Bukarest, KarlFürstenberg, hatte in sehr richtiger Einschätzung der Situationeinen größeren Dispositionsfonds von Wien verlangt,welcher ihm mit Hinweis darauf, daß kein Geld vorhandensei, abgelehnt worden war. Nach Kriegsbeginn kargte dasMinisterium nicht mehr, für viele Aktionen aber war eszu spät.Ob das offizielle Rußland vier Wochen vor dem Attentatauf den Thronfolger bereits mit demselben und mit demAusbruch eines Krieges in diesem Augenblicke gerechnet hat,bleibt dahingestellt. Ich gehe nicht so weit, dies zu behaupten,das eine aber ist sicher, daß Rußland den Krieg als inabsehbarer Zeit als unvermeidlich vorbereitet und auf dieKooperation Rumäniens hingearbeitet hat. Als der Zareinen Monat vor dem Drama in Sarajevo in Konstantza war,stattete sein Minister des Äußern, Sasonow, auch Bukaresteinen kurzen Besuch ab. Von dort aus unternahm er gemeinsammit Bratianu eine Spazierfahrt nach Siebenbürgen.Ich erfuhr von dieser unter den gegebenen Verhältnissenmindestens wenig taktvollen Exkursion erst nach erfolgter'Sat, muß aber Berchtold' recht geben, welcher mir damalsseinErstaunen über das Vorgehen der beiden Minister zurKenntnis brachte.Ich habe im Jahre 1914 durch Zufall das Gespräch zweierRussen gehört. Sie saßen im Hotel Capsa, dem später alsantiösterreichischen Hetzlokale bekannten Restaurant, andem Nebenlisch und sprachen ganz laut und ungeniert Französisch.Sie schienen bei dem russischen Gesandten zu verkehrenund besprachen den bevorstehenden Zarenbesuch inKonstantza. Wie ich nachher konstatierte, waren es zweiOffiziere in Zivil. Sie waren darin einig, daß KaiserFranz Joseph nicht mehr lange leben könne, und daß der146
RumänienThronwechsel der Moment sei, in welchem Rußland unsden Krieg erklären müsse.Es waren offenbar Exponenten jener „loyalen" Richtung,welche uns den Krieg ohne vorherigen Mord erklären wollten— und ich will gern annehmen, daß die Mehrzahl der inPetersburg befindlichen kriegslustigen Herren zu der gleichenRichtung zählte.
V.Der verschärfte UUBootkrieg
MeineErnennung zum Ministerdes Äußern wurde vielfachdahin gedeutet, daß Kaiser Karl das politischeTestament seines Onkels Franz Ferdinand ausführe. ObwohlErzherzog Franz Ferdinand die Absicht hatte, mich zu seinemMinister des Äußern zu machen, so hatte doch meine Ernennungunter Kaiser Karl mit diesem Plane gar nichts zutun. Meine Ernennung durch Kaiser Karl entsprang vorallem seinem damals starken Wunsche, sich vom GrafenBurian zu trennen, und dem Mangel an sonstigen dem Kaisergeeignet scheinenden Kandidaten. Das nach Ausbruch desKrieges mit Rumänien vom Grafen Burian veröffentlichteRotbuch dürfte die Aufmerksamkeit Kaiser Karls auf meineWenigkeit gelenkt haben.Obwohl Kaiser Karl als Erzherzog durch viele Jahre meinunmittelbarer Nachbar in Böhmen war — er war in Brandeisan der Elbe stationiert — ,sind wir uns doch niemals nähergetreten.Er war in den ganzen Jahren höchstens ein- biszweimal bei mir, und auch das waren Besuche ohne jedenpolitischen Einschlag. Erst im ersten Winter des Krieges,als ich von Rumänien aus im Hauptquartier in Teschenwar, lud mich der damalige Erzherzog Karl ein, die Rückreisemit ihm gemeinsam zu machen. In dieser mehrereStunden dauernden Eisenbahnfahrt wurde größtenteils Politikgesprochen, jedoch bezog sich die Unterredung weniger aufallgemeine Politik als auf Rumänien und die Balkanfragen.Ich gehörte jedenfalls niemals zu denen, welche das Vertrauen151
Der verschärfte U-Bootkriegdes Erzherzogs besessen hatten, und meine Berufung auf denBallplatz kam mir vollkommen überraschend.Auch meine erste Audienz begann mit einem längerenGespräch über Rumänien und die Frage, ob der Krieg mitBukarest hätte vermieden werden können oder nicht.Der Kaiser stand damals unter dem Eindrucke unseresersten, von der Entente so schroff abgelehnten Friedensangebotes.Auch im deutschen Hauptquartier in Pleß, woich einige Tage später eintraf, war die Stimmung durch dieAntwort der Entente stark beeinflußt. Hindenburg undLudendorff, welche anscheinend gegen den FriedensschrittBurians gewesen waren, erklärten mir, nur der definitiveSieg böte die Möglichkeit, den Krieg zu beenden, und KaiserWilhelm erklärte mir: „Er habe die Hand zum Frieden geboten,daraufhin habe ihm die Entente in das Gesicht geschlagen— und jetzt gäbe es hur den Krieg bis zumÄußersten".Zu dieser Zeit begann die Frage des verschärften U-Bootkriegesin den deutschen Köpfen zu spuken. Vorerst wares nur die deutsche Marine, vor allem Tirpitz, die unaufhörlichfür diesen Gedanken Reklame machten. Hohenlohe *,welcher dank seiner ausgezeichneten Konnexionen stets sehrgut <strong>info</strong>rmiert war, schrieb bereits mehrere Wochen vor demschicksalsschweren Entschlüsse, daß die Marine auf diesesZiel losgehe. Bethmann war entschieden abgeneigt, ebensoZimmermann. Es entsprach der klugen Vorsicht des ersteren,solche Experimente nicht gerne zu wagen; Bethmann warein absolut verläßlicher, ehrlicher, gescheiter Partner, aberseinem zur Konzilianz neigenden Naturell ist das maßloseAnwachsen der militärischen Autokratie vor allem zuzuschreiben.Gegen einen Ludendorff konnte er nicht aufkommen,und Schritt für Schritt wurde er von diesem zurückgedrängt.Meine erste Anwesenheit in Berlin gab mir• Botschafter Gottfried Prinz Hohenlobe-SchUlingsfürst.152
:Der verschärfte U-BootkricgGelegenheit, die U-Bootfrage sehr eingehend mit dem Reichskanzlerzu besprechen, und wir fanden uns in unserer Abneigunggegen dieses Kampfmittel.Allerdings betonte Bethmannschon damals, daß solche in erster Linie militärischeMaßregeln auch in erster Linie von den Militärs entschiedenwerden müßten, da sie allein imstande seien, den Erfolgderselben richtig einzuschätzen, und solche Betrachtungenließen mich gleich von Anfang an besorgen, daß die begründetenpolitischen Bedenken von den militärischen Argumentenüberrannt werden würden. Bei diesem meinem erstenBesuche in Berlin, bei welchem diese Frage selbstverständlichdominierte, entwickelte mir der Kanzler, daß seine Lagedeshalb so schwierig sei, weil die Militärs vom Lande undvom Wasser erklärten, bei Ablehnung des verschärftenU-Bootkrieges nicht mehr für diekönnen.Westfront garantieren zuSie stellten ihn dadurch unter einen eisernen Druck,denn wie sollte er — der Kanzler — seinerseits die Garantieübernehmen können, daß die Front weiter halten werde?Tatsächlich verdichtete sich die Gefahr des Einsetzens desunbeschränkten U-Bootkrieges bald mehr und mehr, und dieBerichte Hohenlohes ließen keinen Zweifel über die weitereEntwicklung der Dinge in Berlin. Am 12. Januar berichteteHohenlohe„Die Frage bezüglich der Erweiterung des U-Bootkriegeswird, wie Euer Exzellenz aus den letzten Besprechungen inBerlin bekannt ist — immer akuter.Auf der einen Seite drängen die maßgebenden Militär- undMarinestellen auf die baldigste Anwendung dieses Mittels,durch das sie den Krieg viel rascher beendigen zu könnenerklären, auf der anderen Seite erheben die Staatsmännerschwere Bedenken über die Rückwirkung dieses Vorgehensauf Amerika und die noch übrigen Neutralen.Die Oberste Heeresleitung erklärt, daß eine neue, großangelegte Offensive im Westen unmittelbar bevorstehe, unddaß es die Armeen, die diesen Anprall abzuwehren hätten,153
Der verschärfte U-Bootkriegabsolut nicht verstehen würden, wenn seitens der Marinenicht alles aufgeboten werde, um die Nachschübe an Truppenund Munition für unsere Gegner zu unterbinden oder wenigstenszu verringern. Das Ausbleiben einer Mitwirkung derMarine an den furchtbar schweren Kämpfen, denen dieTruppen an der Westfront abermals entgegengingen, würdeauf den Geist derselben einen geradezu verderblichenEindruck machen.Den früher erwähnten Einwendungen über den möglichenEindruck dieses Vorgehens auf Amerika halten die militärischenStellen entgegen, daß Amerika sich hüten werde, inden Krieg einzutreten, ja daß es dazu nicht einmalimstande sei; das klägliche Versagen des militärischenMechanismus der Vereinigten Staaten in dem Konflikte mitMexiko sei doch wohl ein klarer Beweis, was man von denLeistungen Amerikas auf diesem Gebiete zu erwarten habe,selbst ein eventueller Abbruch der Beziehungen zu denVereinigten Staaten brauche daher noch lange nicht denKrieg zu bedeuten.<strong>Im</strong> übrigen wiederholen die maßgebenden Marinestellen,man solle sich darauf verlassen, daß sie, wenn man ihnenschon nicht die Fähigkeit zugestehen wolle, England niederzuzwingen,zumindest imstande wären,. binnen kurzem, undzwar bevor Amerika überhaupt eingreifen könne, 'dasbritischeInselreich so weich zu machen, daß die englischenStaatsmänner nur mehr den einen Wunsch haben würden,sichmit uns an den Konferenztisch zu setzen.Hierauf sagte der Kanzler, wer bürge ihm denn dafür,daß die Marine recht habe, und in welcher Lage würdenwir uns in dem Falle befinden, wenn die Admirale sich irrensollten, worauf die Admiralität prompt erwidert, wie sichdenn der Kanzler seinerseits die Lage vorstelle, wenn wirim Herbste, ohne von der U-Bootwaffe den einzig richtigenGebrauch gemacht zu haben, aus Entkräftung gezwungenwären, um Frieden zu bitten.154
Der verschärfte U-BootkriegSo schwankt das Zünglein an der Wage, auf der die Chancendes U-Bootkrieges abgewogen werden, hin und her, ohnedaß die Möglichkeit vorläge, positiv festzustellen, welcheAufgabe die richtige sei.Zweifellos wird sich die deutsche Regierung, und zwarschon in nächster Zeit, zu einer definitiven Stellungnahmedieser Frage gegenüber entschließen müssen, und es ist ganzklar, daß — in welchem Sinne diese Entscheidung auch erfolgenmöge — wir durch dieselbe ganz bedeutend in Mitleidenschaftgezogen werden. Nichtsdestoweniger erschienemir, wenn einmal die deutsche Regierung diesbezüglich anuns herantritt, unsererseits möglichst große Zurückhaltunggeboten; wie die Dinge heute liegen, ist eine positive Entscheidung— welcher einzuschlagende Weg der unbedingtrichtige sei, wie schon erwähnt, nicht möglich, ich hieltees daher für wenig ratsam, durch eine dezidierte Parteinahmefür die eine oder andere Lösung der deutschen Regierungeinen großen Teil der Verantwortung abzunehmen und ihrdie Möglichkeit zu geben, dieselbe uns aufzubürden. Derk. u. k. Botschafter _ -t. .G. Hohenlone m. p.Der Schlußpassus des zitiertenBerichtes war unterdessenbereits durch einen telegraphischen Auftrag meinerseits überholtworden, einen Auftrag, in welchem ich den Botschafterersuchte, mit aller Energie die gegen den verschärften U-Bootkriegsprechenden politischen Argumente geltend zu machen,das erhellt aus einem Telegramm Hohenlohes vom 13. Januar,welches lautet:„Antwort auf Telegramm Nr. 15 von gestern.In Befolgung obzitierten Telegrammes und nach Rücksprachemit Baron Flotow habe ich sofort den Staatssekretär,den Kanzler konnte ich heute nicht sehen, aufgesucht undihn den Intentionen Euer Exzellenz entsprechend daraufaufmerksam gemacht, man solle doch nicht vergessen, daßwir an den Folgen des Unterseebootkrieges ganz ebenso155
Der verschärfte U-Bootkriea;beteiligt wären wie Deutschland, woraus der deutschen Regierungdie Verpflichtung erwachse, auch uns zu hören. DaßEuer Exzellenz bereits während Hochderen hiesigen Aufenthaltessich dagegen ausgesprochen hätten, sei denleitenden deutschen Staatsmännern bekannt, ich käme abernochmals als Dolmetsch Euer Exzellenz, um diese Warnungenvor jeder Übereilung zu wiederholen. Ichhabe weiters mit Nachdruck alle gegen den Unterseebootkriegsprechenden Argumente angeführt, mit deren Aufzählung ichEuer Exzellenz ebenso wenig aufhalten will, als mit den EuerExzellenz gleichfalls sattsam bekannten Gegenargumenten,die der Staatssekretär ins Treffen führte. Ich habe diesebeiden Standpunkte übrigens in meinem gestrigen gegenständlichenBericht Nr. 6 P in Kürze zusammengefaßt.Ganz besonders betonte Herr Zimmermann aber, daß ernach allen ihm zukommenden Nachrichten mehr und mehrdie Überzeugung gewinne, Amerika werde, speziell nach derAntwort der Entente an Herrn Wilson, die man als einendiesem angetanen Schimpf hinstellen müsse, es voraussichtlichgar nicht zum Bruche mit den Zentralmächten kommenlassen.Ich habe mein möglichstes getan, um immer wieder dieVerantwortung zu betonen, die Deutschland bei Entscheidungdieser Frage für sich und uns übernehme, wobei ich sehrnachdrücklich betonte, daß, bevor eine Entscheidung in dieserSache getroffen würde, unbedingt unsere Ansicht auch vommarinetechnischen Standpunkte, der sich einem Urteil meinerseitsnatürlich ganz entzieht, eingeholt werden müsse, worinmir der Staatssekretär rückhaltlos zustimmte.Ich habe das Gefühl, daß man sichhier der Auffassung,den Unterseebootkrieg auszugestalten, doch immer mehr zuneigt,ein Eindruck, den Euer Exzellenz in Berlin ja auchgewonnen haben dürften. Das letzte Wort für die definitiveStellungnahme der deutschen Regierung in dieser Frage wirdzweifellos von militärischer Seite gesprochen werden.156
Der verschärfte U-BootkriegDen erhaltenen Instruktionen entsprechend werde ichjedoch hier immer wieder mit allem Nachdruckdie gegen den Unterseebootkrieg sprechendenpolitischen Argumente geltend machen.Baron Flotow wird heute nachmittag auch noch Gelegenheithaben, mit dem Staatssekretär zu sprechen."Gleichzeitig hatte ich nämlich noch den Sektionschef BaronFlotow nach Berlin gesandt, damit derselbe die BestrebungenHohenlohes unterstütze und alles aufbiete, um Deutschlandvon seiner Absicht abzubringen. Flotow berichtete mirdarüber am 15. Januar folgendes:„Gelegentlich meines zweitägigen Aufenthaltes in Berlinhabe ich die Überzeugung gewonnen, daß die Frage des verschärftenUnterseebootkrieges für die maßgebenden Faktorenim Deutschen Reiche gegenwärtig wieder in die erste Liniegestellt ist. Die Frage steht — nach den Worten HerrnZimmermanns — unter Beobachtung des strengsten Geheimnissesder Öffentlichkeit gegenüber, zwischen der HeeresundMarineleitung und dem Auswärtigen Amte zur Erwägung;sie dränge aber zur Entscheidung. Denn soll eszum uneingeschränkten Unterseebootkrieg kommen, so müßteer zu einer Zeit einsetzen, wo seine Wirkungen bereits inAnsehung der bevorstehenden mächtigen englisch-französischenOffensive an der Westfront sich fühlbar machen würden.Hiermit wies der Staatssekretär auf den Monat Februar hin.Ich möchte im nachstehenden jene Momente zusammenfassen,die zur Begründung der Notwendigkeit der verschärftenUnterseebootkriegführung deutscherseits vorgebrachtwerden:Die Zeit arbeite gegen uns und für die Entente; könnealso die Entente ihren Kriegswillen durchhalten, so schwindefür uns immer mehr die Aussicht auf einen uns nicht aufgezwungenenFrieden. Die letzte Note unserer Gegner anWilson bringe aber neuerdings ihre Kriegsenergie in unwiderlegbarerWeise zum Ausdruck.157
Der vex-schärfte U-BootkriegÜber das Jahr 1917 hinaus können die Zentralmächte denKrieg mit Aussicht auf Erfolg nicht führen. Der Friedemüßte also, solle er uns nicht schließlich von den Feindenkommen, noch im Laufe dieses Jahres gemacht, d. h. ermüßte von uns erzwungen werden.Die militärische Lage sei nachteilig beeinflußt durch diedemnächst bevorstehende englisch-französische Offensive ander Westfront, von der man annehme, daß sie mit einernoch furchtbareren Wucht einsetzen werde wie die letzteOffensive an der Somme. Um ihr zu begegnen, mußtenbereits Truppen von den anderen Fronten abgezogen werden.Daraus ergebe sich, daß mit einer Offensive gegen Rußland,die wenigstens diesen Feind auf die Knie drücken sollte unddie vielleicht vor einem Jahre durchführbar gewesen wäre,nicht mehr gerechnet werden könne.Sei also die Möglichkeit im Schwinden, die Entscheidungim Osten herbeizuführen, so müsse versucht werden, sie imWesten zu bringen, und zwar zu einer Zeit, wo das rücksichtsloseEingreifen der Unterseeboote schon auf die bevorstehendeenglisch-französische Offensive durch Behinderung des unterneutraler Flagge durchgeführten Truppen- und Munitionstransportesihre Wirkung ausüben könnte.Bei der Einschätzung der Wirkungen des verschärftenUnterseebootkrieges auf England komme nicht bloß dasUnterbinden der Lebensmittelzufuhr in Frage, sondern dieVerminderung seiner Verkehrsmittel in einem Ausmaße,daß die Kriegführung als solche den Engländern unmöglichgemacht würde. Kaum weniger einschneidend würdendiese Wirkungen auch in Italien und in Frankreich inErscheinung treten; allerdings würden auch die Neutralenstark in Mitleidenschaft gezogen werden, dies könnteaber vielleicht gerade zur Herbeiführung des Friedensausgenutzt werden.Amerika würde kaum weiter als bis zum Abbruch derdiplomatischen Beziehungen gehen; mit einem Kriege gegen158
Der verschärfte U-Bootkriegdie Vereinigten Staaten brauchten wir heute nicht mehrunbedingt zu rechnen.Es sei nicht zu übersehen, daß die Vereinigten Staaten —wie sie dies ja Mexiko gegenüber bewiesen — zum Kriegeschlecht vorbereitet seien, daß sie nur eine Besorgnis hätten,und zwar Japan! Einen europäischen Krieg mit Amerikawürde Japan nicht ungenützt vorübergehen lassen.Aber selbst wenn Amerika in den Krieg eintreten würde,so könnte es vor drei bis vier Monaten nicht fertig sein, undinnerhalb dieses Zeitraumes müsse eben der Friede inEuropa erzwungen sein. England hätte nach Schätzung derFachleute (unter anderen holländischer Getreidehändler)für sechs Wochen, höchstens drei Monate Nahrungsvorräte.Der Unterseebootkrieg würde von fünfzehn Stationen in derNordsee aus gegen England geführt werden können, so daßdas Durchkommen eines größeren Schiffes nachEngland kaum denkbar erschiene. Der Verkehr imÄrmelkanal würde, selbst wenn er nicht ganz unterbundenwerden könnte, schon deshalb nur eine geringe Rolle spielen,da die Eisenbahnverkehrsverhältnisse in Frankreich eine entsprechendeEntwicklung ausschlössen.Und sei einmal der verschärfte Unterseebootkrieg im Gange,so würde der dadurch erzeugte Terror (Versenkung der Schiffeohne Warnung) es mit sich bringen, daß sich die Schiffevielfach gar nicht mehr auf die See wagen würden.<strong>Im</strong> vorstehenden ist schon die Entgegnung skizziert, dieauf die von uns gegen das Einsetzen des unbeschränktenUnterseebootkrieges geltend gemachten Argumente vorgebrachtwird. Damit wird auch die Auffassung bekämpft,daß die Getreidezufuhr aus Argentinien (schlechte Ernte)und den Vereinigten Staaten im gegenwärtigen Zeitpunktenicht diese weitgehende Rolle spielen würde, die ein raschesEingreifen der Unterseebootwaffe in ihrer ganzen Schärfeerheischen würde, indem, wie gesagt, auf die Vernichtungder Verkehrsmöglichkf iten im allgemeinen hingewiesen wird.159
Der verschärfte U-Bootkiiej'Ich habe in meinen einschlägigen Gesprächen bemerkt, dieTatsache, daß Amerika erst in drei Monaten kriegsbereit seinwürde, schließe nicht aus, daß es dies in sechs oder acht Monatenwäre, daß es also zu einer Zeit in den europäischen Kriegeingreifen könnte, wo dieser, auch ohne daß wir diese letzteKarte ausspielen, zu einem für uns annehmbaren Ende gebrachtwerden könnte. Man möge doch nicht vergessen,daß wir es in Amerika mit einer angelsächsischenRasse zu tun haben, die — wenn siesich einmal zum Krieg entschlossen — mit Energieund Zähigkeit daran gehen würde, wie England,das auch militärisch unvorbereitet in den Kriegtrat und heute ein achtunggebietendes Millionenheerden Deutschen entgegenstellt. Auch die japanischeGefahr für Amerika könne ich zu einer Zeit, wo Japanmit Rußland und England durch vorteilhafte Verträge verbundensei und Deutschland aus jenem Weltteil ausgeschaltet,nicht mit Zuversicht in Anschlag bringen.Unter anderem verwies ich auf die großen Hoffnungen,die man seinerzeit auf die Zeppeline als Kampfwaffe gesetzt.Herr Zimmermann sagte mir: , Glauben Sie mir, unsereBesorgnisse sind nicht geringer wie die Ihrigen; ich habeviel schlaflose Nächte darüber verbracht. Eine positiveSicherheit für den Erfolg gibt es nicht, es gibt nur Berechnungen.Daher sind wir auch noch nicht zu einem Entschlüssegekommen. Zeigen Sie mir einen Weg, um zu einemmöglichen Frieden zu kommen, und ich bin der erste, derden> Unterseebootkrieg verwirft ! Wie die Dinge heute hegen,habe ich und viele andere mich dazu schon beinahe bekehrenlassen!'Ob nun, wenn der rücksichtslose Unterseebootkrieg beschlossenwürde, dies in irgendeiner Weise angekündigt würdeoder nicht, dafür ist die Richtlinie auch noch nicht gefunden.Staatssekretär Zimmermann sagte mir, er überlege einenetwaigen Schritt bei Wilson, durch den dem Präsidenten160
:Der verschärfte U- Bootkriegunter Hinweis auf die hohnsprechende Haltung der Ententein der Friedensfrage eine Erklärung für das Vorgehen derdeutschen Regierung gegeben und er eingeladen würde, behufsWahrung des Lebens und Eigentums amerikanischer Staatsbürgerjene Schiffe und Schiffahrtslinien zu bezeichnen, durchdie der Verkehr aus Amerika mit den anderen Neutralenaufrechterhalten werden sollte.Wien, 15. Januar IQI7. M ,Flotow m. p... .Am 20. Januar erschienen Zimmermann und AdmiralHoltzendorff in Wien, und es fand unter Vorsitz des Kaiserseine Beratung statt. An derselben nahmen außer den dreigenannten noch Graf Tisza, Graf Clam-Martinic, GroßadmiralHaus, General Conrad und meine Wenigkeit teil. Holtzendorffentwickelte seine Gründe — welche ich weiter untenrekapituliere — und fand außer bei Admiral Haus bei niemandemeine ungeteilte Zustimmung. Alle Argumente, welcheaus den früher zitierten amtlichen Stücken und dem weiterunten angeführten ministeriellen Protokolle erhellen, wurdenverwertet, allerdings ohne den geringsten Eindruck auf diedeutschen Herren hervorzubringen. Der Kaiser, welcher nichtin die Debatte eingriff, erklärte zum Schluß, seine Entscheidungspäter treffen zu wollen. An diese Beratung schloß sichum 2 Uhr unter meinem Vorsitz im Ministerium des Äußerneine weiterewiedergebeKonferenz an, deren Protokoll ich nachstehend„Aufzeichnung über eine am 20. Januar 1917 im k. u. k.Ministerium des k. u. k. Hauses und des Äußern stattgehabteBesprechung.Teilnehmer: Der Staatssekretär des deutschen AuswärtigenAmtes Dr. Zimmermann, der Chef des deutschen MarinestabesAdmiral von Holtzendorff, der k. u. k. Minister desÄußern Graf Czernin, der königlich ungarische MinisterpräsidentGraf Tisza, der k. k. Ministerpräsident Graf Clam-Martinic, Großadmiral Haus, der deutsche Marine-Attache11 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> l6l
Der verschärfte U-Bootkriegin Wien Freiherr von Freyberg, der k. u. k. Marine-Attachein Berlin Graf H. Colloredo-Mannsfeld.Am 20. Januar hat im Ministerium des Außern|eine Besprechungstattgefunden, welche die Frage der Aufnahmedes verschärften U-Bootkrieges zum Gegenstand hatte.Wie aus den Äußerungen Admiral von Holtzendorffs hervorging,stellt sich die deutsche Marineleitung auf den Standpunktder unbedingten Notwendigkeit der ehebaldigstenAufnahme des verschärften U-Bootkrieges.Die zur Bekräftigung dieser These ins Gefecht geführtenArgumente sind aus der einschlägigen Berichterstattung desk. u. k. Botschafters in Berlin (Bericht vom 12. Januar 1917,Nr. 6 P, Telegramm vom 13. Januar, Nr. 22, sowie des k. u. k.Sektionschefs Baron Flotow — das sind die obenangeführtenStücke) bekannt und können wie folgt in Schlagworten zusammengefaßtwerden: Die Zeit arbeitet gegen uns, schwindendesMenschenmaterial der Zentralmächte, progressiveVerschlechterung der Ernteergebnisse, bevorstehende englisch-französischeOffensive an der Westfront mit verbessertenund vermehrten Kampfmitteln und die sich hieraus ergebendeNotwendigkeit, die zu einem derartigen Unternehmen erforderlichenNachschübe zu verhindern oder zum mindestenzu stören, Unmöglichkeit der Herbeiführung einer Entscheidungzu Lande, Notwendigkeit, die sinkende Moral derTruppen durch rücksichtslose offensichtliche Erfolge zeitigendeAusnutzung der zu Gebote stehenden Kriegsmittel zu heben,Sicherheit des Erfolges einer Verschärfung des U-Bootkriegesin Anbetracht der nur für zweieinhalb bis drei Monatereichenden Nahrungsmittelvorräte Englands sowiederUnterbindung der Munitionserzeugung und industriellenProduktion <strong>info</strong>lge der Verhinderung der Rohstoffzufuhr nachEngland, Unmöglichwerden der Kohlenzufuhr nach Frankreichund Italien usw. usw.Was die Durchführung anbetrifft, so stehen der deutschenMarine derzeit zu diesem Zwecke 120 U-Boote des modernsten162
Der verschärfte U-BootkriegTyps zur Verfügung. Angesichts der großen Erfolge,welche die U-Bootwaffe zu Beginn des Krieges, als nur19 Boote des alten Typs zur Verfügung standen, zu verzeichnenhatte, biete diese erhöhte Anzahl von Kampfschiffeneine sichere Gewähr eines durchschlagendenErfolges.Als Zeitpunkt des Einsetzens des rücksichtslosen U-Bootkriegcsist deutscherseits der 1. Februar 1917 in Aussichtgenommen, und zwar würde an diesem Tage die Zufuhr zuden englischen Küsten wie zu der Westküste Frankreichsals gesperrt erklärt werden. Jedes Schiff, welches diesem Verbotezuwiderhandeln sollte, würde ohne vorherige Warnungtorpediert werden. Auf diese Weise hofft man England inzirka vier Monaten zur Raison zu bringen, wobei hervorzuhebenist, daß Admiral von Holtzendorff sich expressis verbisdahin äußerte, er garantiere für den Erfolg.Was nun die zu erwartende Haltung der Neutralen anbelangt,so ist auch in dieser Hinsicht die Auffassung inden maßgebenden deutschen Kreisen, obwohl man sich derGefahr bewußt ist, eine optimistische. Man glaubt nicht anein Eingreifen der skandinavischen Staaten und Hollandsgegen uns, für welche Eventualität übrigens militärisch vorgesorgtsei. Die Maßnahmen an der holländischen unddänischen Grenze würden nach deutscher Ansicht den inBetracht kommenden Ländern den Appetit verderben, zumaldas Schicksal Rumäniens zweifelsohne abschreckend wirkenwerde. Man rechnet im Gegenteil mit einem völligen Zurückziehender neutralen Schiffahrt, welche in der Zufuhr Englands39% des Frachtraumes ausmache. <strong>Im</strong> übrigen wolleman die Neutralen durch Festsetzung von Fristen für dasZurückziehen ihrer am Tage des Einsetzens des U-Bootkriegesin See befindlichen Schiffe und anderweitige Verfügungenmöglichst schonen.Bezüglich Amerikas ist man deutscherseits entschlossen,wenn irgendwie möglich, die Vereinigten Staaten durch eine163
Der verschärfte U-Bootkrieg;entgegenkommende Haltung (u. a. Zurückgreifen auf dieseinerzeit nach dem „Lusitania"- Zwischenfall gemachtenVorschläge) von einem Eingreifen gegen die Zentralmächtezurückzuhalten; man istaber im übrigen auf eine derartigeStellungnahme Amerikas gefaßt und vorbereitet.Deutscherseitsherrscht indessen die Ansicht vor, daß die VereinigtenStaaten es auf einen Bruch mit den Zentralmächten nichtankommen lassen werden. Täten sie dies, so würden siejedenfalls zu spät kommen und erst dann aktiv eingreifenkönnen, wenn England bereits mürbe gemacht sein wird.Amerika sei auf einen Krieg nicht vorbereitet, was währendder mexikanischen Krise deutlich in die Erscheinung trat;es lebe in der Furcht vor Japan, habe mit wirtschaftlichenund sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zudem sei Mr. Wilsonein Pazifist, welche Richtung er, wie deutscherseits vermutetwird, nach seiner Wahl dezidierter einschlagen werde,und verdanke seine Wahl nicht den germanophoben Oststaaten,sondern der Zusammenarbeit der vornehmlich kriegsfeindlichenMittel- und Weststaaten mit den Iren und Deutschen.Diese Konsiderationen im Zusammenhalte mit dereinem Affront gleichkommenden Antwort der Entente aufdie Friedensdemarche des Präsidenten ließen es nicht alswahrscheinlich erscheinen, daß Amerika sich leichten Herzensin den Krieg stürzen werde.<strong>Im</strong> vorstehenden sind in Kürze die Gesichtspunkte wiedergegeben,welche diedeutsche Forderung des sofortigen Einsetzensdes verschärften U-Bootkrieges bestimmt und auchden Reichskanzler sowie das Auswärtige Amt zu einerRevidierung ihrer bisherigen gegenständlichen Auffassungveranlaßt haben.Seitens des k. u. k. Ministers des Äußern sowie des k. k.und k. ung. Ministerpräsidenten wurde vor allem auf die desaströsenFolgen hingewiesen, welche ein Eingreifen Amerikasin militärischer wie in moralischer, wirtschaftlicher undfinanzieller Hinsicht nach sich ziehen müßte; ferner wurde164
Der verschärfte U-Bootkriegder Skepsis Ausdruck gegeben, daß eine Absperrung Englandsauch tatsächlich gelingen werde. Man übersehe deutscherseits— so wurde vom Grafen Czernin hervorgehoben —die Möglichkeit einer Herabsetzung des Konsums in Englandund bedenke nicht, daß bei den Zentralmächten derKonsum während des Krieges auf die Hälfte reduziert wordensei. Es wurde ferner vom Grafen Czernin auf die dochsehr vagen und nicht überzeugenden Daten der deutschenMarineleitung hingewiesen. Es wurde weiter zur Erwägunggestellt, ob nicht eine Fortführung des U-Bootkrieges in denbisherigen Grenzen (Vernichtung von durchschnittlich400 000 Tonnen Schiffsraum pro Monat) sicherer zum Zieleführen werde, und ob es nicht ratsamer wäre, unsere letztegute Karte erst dann auszuspielen, wenn alleanderen Mittelversagt hätten. Die Möglichkeit, mit dem rücksichtslosenU-Bootkrieg beginnen zu können, hänge wie ein Damoklesschwertüber den Häuptern unserer Gegner und bildevielleichtein wirksameres Mittel, den Krieg rasch zu beenden, alsdie mit der Gefahr eines Eingreifens der Neutralen verbundenerücksichtslose Verwendung der U-Bootwaffe. Wenndiese die seitens Deutschlands eskomptierte Wirkung nichtzeitigen sollte, was immerhin im Bereiche der Möglichkeitliege, dann müsse man sich auf eine Intensifizierung desKriegswillens unserer Feinde gefaßt machen. Wie dem auchsei, mit einem Verschwinden der Friedensstimmungen müsseman bis auf weiteres als mit einer Tatsache rechnen. Schließlichwurde darauf hingewiesen, daß die deutscherseits inder letzten Zeit vorgebrachten Argumente ein völligesNovum aufweisen, nämlich die Gefährdung der Westfrontin Anbetracht der großen zu erwartenden englischfranzösischenOffensive. Während es bisher immer hieß, dieAngriffe unserer Gegner werden abprallen, werde jetzt diezur Entlastung der Landarmee unbedingt notwendige rücksichtsloseVerwendung der Marine ins Treffen geführt. Wenndiese Befürchtungen richtig sind, dann allerdings müßten165
.Der verschärfte U-Bootkrieeralle anderen Konsiderationen zurücktreten und die mit derrücksichtslosen Verwendung der U-Boote zusammenhängendenRisiken mit in den Kauf genommen werden. SowohlGraf Czernin wie Graf Tisza drückten jedoch ihre diesbezüglichenlebhaften Zweifel aus.Für diesen Fall wurde seitens des k. ung. Ministerpräsidentenauf die Notwendigkeit einer sofort zu entwickelnden propagandistischenTätigkeit in den neutralen Ländern undnamentlich in Amerika hingewiesen, durch welche vorerstdie auf Selbsterhaltung und Verteidigung gerichteten politischenZiele und Methoden der Zentralmächte ins richtigeLicht gerückt würden und später — nach Einsetzen desrücksichtslosen U-Bootkrieges — auseinanderzusetzen wäre,daß eben die friedlichen Tendenzen des Vierbundes diesemin Anbetracht der Zertrümmerungsabsichten der Ententekeine andere Wahl ließen, um zu einer möglichst raschenBeendigung des Völkerringens zu gelangen.Die Leiter der auswärtigen Politik sagten zu, in dieserRichtung die nötigen Verfügungen zu treffen, und bemerkten,daß vorbereitende Schritte bereits unternommen worden seienGroßadmiral Haus schloß sich rückhaltlos der Argumentationder deutschen Marineleitung an, indem er ausführte,daß an die Möglichkeit eines Eingreifens Amerikas in militärischerHinsicht keine weitgehenden Befürchtungengeknüpft werden sollten, und schließlich hervorhob,daß seitens der Entente in der Adria der rücksichtsloseU-Bootkrieg durch Torpedierung von Spitals- und Transportschiffentatsächlich schon seit geraumer Zeit praktiziertwerde.Großadmiral Haus empfahl, daß dieses Moment entsprechendeVerwertung finden sollte,was seitens der beiderseitigenLeiter der auswärtigen Politik zugesagt wurde.Der k. u. k. Minister des Äußern bemerkte endlich, daßdie definitive Entscheidung der zur Diskussion stehendenAngelegenheit der Schlußfassung der beiden Herrschervorbehalten bleiben müsse, wozu die für den 26. d. M.t66
Der verschärfte U-Bootkrieganberaumte Begegnung Allerhöchstderselben Gelegenheitgeben werde."Ich fand beim Kaiser, welchen ich nach der allgemeinenBesprechung noch separat sprach, die gleiche Abneigunggegen dieses neue Kampfmittel und die gleiche Besorgniswegen seines Effektes. Wir wußten jedoch, daß Deutschlandbereits definitiv entschlossen wäre, unter allen Umständenmit dem verschärften U-Bootkrieg einzusetzen, daßdaher alle unsere Argumente keinen praktischen Wert mehrhaben könnten. Es blieb daher zu überlegen, ob wir unsanschließen sollten oder nicht. Dank der geringen Zahlunserer U-Boote hätte unser Beiseitebleiben keinen großenEinfluß auf das Endergebnis des Experimentes gehabt, undich habe eine Weile die Idee ventiliert, dem Kaiser vorzuschlagen,uns in dieser Frage von Deutschland zu trennen,obwohl ich mir klar war, daß eine solche Trennung sehrleicht der Anfang des Bündnisendes überhaupt sein könne.Die Schwierigkeit aber lag darin, daß der U-Bootkrieg auchim Mittelmeer gemacht werden mußte, sollte derselbe, in dennördlichen Gewässern nicht völlig wirkungslos sein; wärenämlich das Mittelmeer frei geblieben, so hätten die Transportediesen Weg und sodann den Landweg über Italien,Frankreich und Dover genommen und dadurch den nördlichenU-Bootkrieg wirkungslos gemacht. Um aber denU-Bootkrieg im Mittelmeer führen zu können, brauchteDeutschland unsere Stützpunkte in der Adria, so Triest,Pola und Cattaro; gaben wir ihm diese frei, so machtenwir den U-Bootkrieg mit, auch wenn unsere wenigen Tauchbootezu Hause blieben, taten wir es nicht, so fielen wirDeutschland in den Rücken und kamen in direkten Konfliktmit ihm, welcher zu definitiver Sprengung des Bündnissesführen mußte.Es war dies wieder einer jener Fälle, welche beweisen, daß,wenn ein Starker und ein Schwacher gemeinsam Krieg führen,der Schwache nicht einseitig aufhören kann, es sei denn, er167
Der verschärfte U-Bootkriefmache die völlige Schwenkung und trete zu dem früherenVerbündeten in den Kriegszustand. Letzteres wollte niemandaus der damaligen Regierung, und so gaben wir schwerenHerzens unsere Zustimmung. Bulgarien, welches diese Kriegsphasenicht mitgemacht und. seine diplomatischen Beziehungenzu Amerika weiter aufrechterhalten hat, war insofernin einer anderen Lage, als es abseits bleiben konnte, ohnedie deutschen Pläne zu paralysieren. Abgesehen davon warich schon damals überzeugt, daß das ,,Nichtmitmachen"Bulgariens zwar einen sehr schädlichen Eindruck nach außenmachen, ihm selbst aber gar nichts helfen werde. Seine biszum letzten Augenblicke aufrechterhaltenen Beziehungen mitAmerika haben tatsächlich sein Los nicht gemildert.Hätten wir Deutschland von dem verschärften U-Bootkriegabhalten können, so wäre der Vorteil ein sehr großergewesen; ob wir ihn mitmachten oder nicht, war vom Standpunkteunserer Behandlung durch dieEntente ganz nebensächlich,wie das bulgarische Beispiel beweist. SowieAmerika an Deutschland den Krieg erklärt hatte, warder Konflikt auch mit uns aber unter allen Umständen unvermeidlich,denn österreichisch-ungarische Truppen undArtillerie standen ja dann an der Westfront amerikanischengegenüber. Wir mußten in den Krieg mit Amerika kommen,sowie sich Deutschland in demselben befand.Nicht einmal der Zustand eines scheinbar weiteren friedlichenVerhältnisses, wie er zwischen Amerika und Bulgarienbis zum Kriegsende bestand, war daher für uns möglich —abgesehen davon, daß Bulgarien ja,wie erwähnt, später dieErfahrung gemacht hat, daß die aufrechterhaltenen Beziehungenzu Washington ihm nicht den geringsten Nutzenbrachten.Wann Deutschland einsah, daß der schrankenlose U-Bootkriegwirkungslos und daher ein furchtbarer Fehler sei, istnicht ganz klar geworden. Nicht nur der Öffentlichkeit,auch den befreundeten Kabinetten gegenüber posierten168die
Der verschärfte U-Bootkriegdeutschen Militärs fortgesetzt den größten Optimismus, undals ich im April 1.918 aus meiner Stellung schied, war Berlinnoch immer auf dem Standpunkte, England werde und müssein diesem Seekrieg unterliegen. In einem Schreiben vom14. Dezember 1917 meldete Hohenlohe, an kompetenter deutscherStelle sei man durchaus optimistisch. Allerdings hatteichgewisse Anzeichen der beginnenden Ernüchterung auchin den deutschen Köpfen bemerkt, und Ludendorff selbst antwortetemir auf meine Vorwürfe, „im Kriege sei alles gefährlich,man könne nie vor einer Operation genau den Effektfeststellen, er gebe zu, die Zeitrechnung sei eine falsche gewesen,das schließüche Resultat aber" — so betonte er neuerlich— „werde ihm recht geben". <strong>Im</strong> übrigen betonten dieFührer Deutschlands, um sich selbst zu rechtfertigen, Amerikawäre unter allen Umständen in den Krieg getreten, und derU-Bootkrieg sei nur der letzte Anstoß gewesen. Ob dies tatsächlichder Wahrheit entspricht, scheint mindestens zweifelhaft.Es läßt sich positiv weder bejahen noch verneinen.Die Welt hatte sich angewöhnt, Hindenburg und Ludendorffwie eines zu behandeln; sie gehörten zusammen. Siestiegen zusammen auf zur höchsten Macht, und erst im Sturzewurden sie gewaltsam auseinandergerissen. Bei allen geschäftlichenVerhandlungen trat immer Ludendorff in denVordergrund. Er sprach viel und immer scharf und impreußischen Kommandoton. Gewöhnlich setzte es Feuer,aber er schien nichts nachzutragen, und sein Zorn verrauchteso schnell, als er entstand. Er hatte trotz seiner unangenehmenSeiten den Charme starker Naturen, und seine beispielloseEnergie und Arbeitskraft habe ich stets bewundert. DerVerkehr zwischen uns war immer, auch bei großen Differenzen,ein durchaus korrekter.Die durch einige Zeitungenverbreitete Nachricht, „Ludendorff hätte mir mit dem Kriegegedroht", ist eine einfältige Erfindung. Daß er bei einemAbfalle Österreich-Ungarns die durch die Monarchie einmarschierendenEntentetruppen lieber auf unserem als auf169
Der verschärfte U-Bootkriegreichsdeutschem Boden bekämpft hätte, konnte ich mir auchohne einschlägige Versicherungen denken. Der spätere Einfallreichsdcutscher Truppen nach Tirol — zu AndrassysZeit — hat mich daher auch keinen Augenblick überrascht.Der Umstand, daß der hervorragende General Ludendorffgleichzeitig Staatslenker wurde, war ein Unglück. Sein Gedanke,die Entente vernichtend zu schlagen, also bis zurWertlosigkeit zu besiegen, war eine Utopie, weil es immereine Unmöglichkeit war, England und Amerika nebst derganzen mit ihnen koalierten Welt in die Knie zu zwingen.Der Ludendorffsche Siegfrieden war unter allen Umständenausgeschlossen. Was der General Ludendorff schuf, verdarbder Staatsmann Ludendorff. Hätte Ludendorff dazu bewogenwerden können, nach seinen fabelhaften militärischen Erfolgeneinen Frieden mit Opfern anzutragen, hätte er Deutschlandretten können; so verdarb er durch seine Politik alles,was er durch seine Sieg? gewonnen hatte. Er jagte einemunmöglichen Ziele nach, er forderte Unmögliches von demdeutschen Volke, er spannte den Bogen, bis er riß. Und ihmund Hindenburg — den beiden allein — hätte das deutscheVolk gefolgt. Hätte Ludendorff rechtzeitig einen Friedenmit Opfern befürwortet, so hätte sich Deutschland gefügt.Später allerdings war die Entente ihrerseits zu keinem Ausgleichmehr b°r:it — aber ich greife vor, denn dieser Fragegilt das nächste Kapitel.Hindenburg gehört zu den Größten seiner Zeit. Er wird fortlebenin der Geschichte Deutschland >. Er war gleich bewunderungswürdigals Feldherr wie als Mensch. Er war bestechenddurch seine bescheidene Einfachheit. Als wir einst von denPhotographen sprachen, die jede Konferenz in Berlin belagerten,sagte der alteHerr: „Siebzig Jahre bin ich alt geworden,und niemals hat jemand etwas Besonderes an mir gefunden;jetzt haben sie auf einmal alle entdeckt, was für eineninteressanten Kopf ich haben soll." Er war viel ruhigerund ausgeglichener als Ludendorff, auch der Vox populi170
Der verschärfte U-Bootkriej:gegenüber viel unempfindlicher.Ich erinnere mich, daß mirLudendorff einstens, als ich ihm zur Nachgiebigkeit in derFriedensfrage zuredete, erregt zurief: „Das deutsche Volkwill keinen Verzichtfrieden, und ich will nicht enden, daßman mir Steine nachwirft. Auch die Dynastie könnte einenVerzichtfrieden nicht überleben."Die Dynastie ist gegangen,die Steine sind geflogen, und der Verzichtfrieden ist zurWahrheit geworden, allerdings viel fürchterlicher, als es dergrößte Pessimist jemals hätte glauben können!Der Abbruch der Beziehungen zwischen Amerika undDeutschland erfolgte am 3. Februar 1917.Der Botschafter Graf Tarnowski blieb in Washington,wurde jedoch nicht von Wilson empfangen, sondern verkehrteausschließlich mit Lansing; ich hatte damals noch die Hoffnung,diese halboffiziellen Beziehungen mit Amerika erhaltenzu können für den Fall, daß Amerika es bei dem Abbruchder Beziehungen mit Deutschland bewenden lasse und demselbennicht den Krieg erkläre.Die deutsche Regierung hättees lieber gesehen, wenn wir gleichzeitig mit ihr die diplomatischenBeziehungen abgebrochen hätten.Am 12. Februar sprach Graf Wedel bei mir vor, und seinAnsuchen sowie meine Erledigung erhellen aus folgendemTelegramm an Hohenlohe:,,Wien, am 12. Februar 1917.Zu Euer Durchlaucht Information.Graf Wedel hat mir auftragsgemäß folgende drei WünscheseinerRegierung übermittelt:1. Graf Tarnowski möge sein Beglaubigungsschreiben nichtübergeben, bevor die Lage zwischen Deutschland und Amerikageklärtsei.2. Graf Tarnowski möge bei Mr. Wilson dagegen protestieren,daß letzterer es versucht habe, die Neutralen gegenDeutschland zu stimmen.171
Der verschärfte U-Bootkrieg3. Bei Kriegsausbruch mit Deutschland möge Graf Tarnowskiabberufen werden.Die ersten zwei Punkte habe ich abgelehnt, den letztenangenommen."Da wir Deutschland nicht daran hatten hindern können,den verschärften U-Bootkrieg zu beginnen, so konnte wohltatsächlich unsere Rolle keine andere mehr sein als die,alles aufzuwenden, um unsererseits die Beziehungen mitAmerika aufrechtzuerhalten, um dergestalt eine gewisse Vermittlerrollenoch weiterspielen zu können. Allerdings gingdies nur so lange, als Amerika zwar abgebrochene diplomatischeBeziehungen, aber keinen Krieg mit Deutschland hatte.Meiner Antwort auf die amerikanische Anfrage nach Präzisierungunseres Standpunktes vom 5. März 1917 lag derGedanke zugrunde, Amerika von dem Abbruche der Beziehungenmit uns abzuhalten und andererseits womöglicheine Divergenz mit Deutschland vor der Öffentlichkeit zuverschleiern. Diese Antwort ist im Anhange reproduziert.Sie hatte insofern Erfolg und eine Bedeutung, als Amerikavorerst die diplomatischen Beziehungen mit uns aufrechterhielt.Dieselben wurden erst am 9. April 1917 abgebrochen.Eine sehr lebhafte Auseinandersetzung hatte ich <strong>info</strong>lgemeiner Antwort mit Stephan Tisza. Am 3. März erhielt ichfolgendenBrief:„Lieber Freund!Ich kann es im Interesse der Sache nur lebhaft bedauern,daß ich keine Gelegenheit erhielt, die definitive Fassungunseres Aide-Memoire's vor dessen Übergabe zu lesen. Vonanderen, minder schwerwiegenden Sachen abgesehen, kannich meine peinliche Überraschung darüber nicht verschweigen,daß wir wiederholt nachdrücklich zugeben, in unserer ,Ancona'-Note eine Zusage gegeben zu haben. Ich befürchte, daß wiruns damit in eine sehr mißliche Position Wilson gegenübergesetzt liaben, was um so leichter zu vermeiden gewesen172
Der verschärfte U-Bootkriegwäre, da es meines Erachtens gar nicht zutrifft, daß wireineZusage gegeben hätten.Eine Meinungsäußerung ist noch keine Zusage.Ohne ihrenmoralischen Wert irgendwie abschwächen zu wollen, hat sienoch einen ganz anderen juridischen Charakter und hat vomGesichtspunkte dritter Personen nicht dieselben rechtlichenFolgen zugunsten derselben als eine Zusage.Damit, daß wir — wirklich unnötigerweise — eingeräumthaben, den Amerikanern eine Zusage gegeben zu haben,geben wir zu, daß unsererseits Verpflichtungen ihnen gegenüberbestehen.Trotz all der schönen und geschickten Argumentationunserer Denkschrift wird es den Amerikanern nichtschwer sein, den Beweis zu führen, daß unser jetziges Vorgehensich mit der damaligen Äußerung nicht decke; warUndjene Äußerung eine Zusage, so hat die amerikanische Regierungdas Recht, die Erfüllung derselben zu fordern.dann sind wir ,in an awkward predicament'. Ich hatte inmeiner Notiz bemerkt, daß ich jetzt die Beweisführung, daßwir keine Zusage gemacht hatten, lieber unterlassen würde.Man hätte jedoch die Möglichkeit gehabt, wann immer daraufzurückzukommen. Dadurch, daß wir diese Waffe ihnenin die Hand gegeben haben, haben wir uns der Gefahr einesEchecs ausgesetzt, und ich befürchte sehr, daß wir dies nochschwer bereuen werden.Natürlich bleibt jetzt die Sache unter uns. Dir habe ichaber mein Herz ausschütten müssen, um die Bitte begründenzu können, daß ich den Text solcher wichtiger, mit so weitgehendenFolgen verbundener Staatsschriften rechtzeitig erhaltenkönne, um meine etwaigen Bemerkungen machen zukönnen. Glaube mir, es liegt dies wirklich im Interesse derSache und kann in jeder Hinsicht nur gute Folgen haben.Inwarmer FreundschaftDein ergebenerTisza.173
Der verschärfte U-BootkriegBeilage.„Es ist mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daßdie Friedensströmung in Amerika Fortschritte macht undPräsident Wilson vielleicht unter dem Einflüsse dieser Wahrnehmungdie Entscheidung im kriegerischen Sinne wenigstensaufzuschieben sucht. Selbst wenn ich mich in dieserVoraussetzung irren würde, läge es in unserem Interesse,den Abbruch unserer diplomatischen Beziehungen mitAmerika, solange es geht, zu vermeiden.Es wäre daher die möglichst spät abzusendende Antwortauf das amerikanische Aide-Memoire so zu verfassen, daßes als eine meritorische Behandlung des amerikanischerseitsvorgebrachten Themas aussieht, ohne jedoch in die Falle derim Aide-Memoire aufgestellten Frage einzugehen.Antworten wir mit ,ja' auf diese Frage, so kann PräsidentWilson den Bruch mit der Monarchie kaum vermeiden.Geben wir eine verneinende Antwort, so haben wir Deutschlandund unseren am 31. Januar eingenommenen Standpunktim Stiche gelassen.Die Handhabe ",um Ausweichen vor einer klaren Antwortgibt uns das Aide-Memoire selbst, indem es unsere in der,Ancona'- und ,Persia'-Frage gemachten Äußerungen mitder Stellungnahme der deutschen Note vom 4. Mai 1916identifiziert. Wir würden daher nur konsequent bleiben,wenn wir ähnlich wie in unserer Note vom 14. Dezember 1915erklären würden, daß wir uns durch eigene Rechtsauffassungleitenlassen.In unserer in der ,Ancona'-, ,Persia'- und ,Petrolite'-Frage mit der amerikanischen Regierung erfolgten Korrespondenzhaben wir stets den konkreten Fall behandelt, ohneuns in die einschlägigen prinzipiellen Rechtsfragen zu vertiefen.Gerade in unserer Note vom 29. Dezember 1915, inder die im Aide-Memoire zitierte Meinungsäußerung enthaltenist (es könnte auch bemerkt werden, daß unsere damaligeMeinungsäußerung kein ,pkdge' ist, da wir weder etwas174
Der verschärfte U-Bootkriegversprochen, noch eine Verpflichtung übernommen haben. Ichwürde aber dieses Thema, wenigstens im jetzigen Stadiumder Sache, lieber beiseite lassen), hat die k. u. k. Regierungausdrücklich erklärt, die mit dem Unterseebootkrieg zusammenhängendenschwierigen völkerrechtlichen Fragen ineinem späteren Zeitpunkte zur Erörterung zu bringen.Zu einer solchen Erörterung schien freilich der jetzigeKriegszustand nicht geeignet zu sein.Inzwischen haben sichaber <strong>info</strong>lge der Handlungen unserer Feinde Ereignisse eingestellt,es hat sich ein Zustand entwickelt, bei welchem dieintensivere Ausnutzung der Unterseebootwaffe auch unsererseitsnicht zu vermeiden war. Es wurden unsere Handelsschiffein der Adria, soweit der Feind sie erreichen konnte,Unsere Gegner habenkonsequent ohne Warnung torpediert.sich hiermit auf den Standpunkt des weitgehendsten rücksichtslosenUnterseebootkrieges gestellt, ohne auf den Widerstandder Neutralen zu stoßen.Dieselbe Rücksichtslosigkeit gegenüber der freien Schifffahrtund der Lebenssicherheit der Neutralen hat die Ententebei der Legung von Minenfeldern an den Tag gelegt.Als defensive Waffe zum Schutz der eigenen Küsten undHäfen wie auch als Blockierungsmittel eines feindlichenHafens waren die Seeminen wohl als anerkannte Waffe zu betrachten.Ganz neu ist jedoch der in diesem Kriege hervorgetreteneGebrauch dieser Waffe in aggressivem Sinne, indemauf dem Wege des Weltverkehres liegende weite Gebieteder offenen See zu Minenfeldern ausgestattet werden undhierdurch der Verkehr der Neutralen auf denselben unmöglichgemacht respektive mit der größten Lebensgefahrverbunden wurde.Ohne jeden Vergleich ist dies eine viel weitergehendeHemmung der Bewegungsfreiheit und Störung der Interessender Neutralen als die Einführung des verschärften U-Bootkriegesauf fest begrenzten und präzis bezeichneten Seegebieten,wobei offene Straßen für die neutrale Schiffahrti/5
Der verschärfte U-Bootkriesgelassen werden und durch andere Maßnahmen weitgehendeRücksicht auf die Interessen der Neutralen genommen wird.Gerade in dem Moment, wo der an die ganze kriegführendeWelt gerichtete Appell des Präsidenten mit der spontanenÄußerung unserer Gruppe zusammenfiel, in welcher wir vonder Geneigtheit, einen auch für unsere Feinde annehmbarenehrlichen Frieden zu schließen, feierlich Zeugnis abgelegthatten, wurde das neue größte englische Minenfeld auf einerder großen Straßen des WeltVerkehrs in der Nordsee angelegtund zum Hohne der edlen Initiative der VereinigtenStaaten der Vernichtungskampf gegen unsere Mächtegruppein der brutalsten Weise von der Entente angekündigt.Wir fördern die großen Ziele, welche die amerikanischeRegierung in ihrer Aktion geleitet haben: die baldigsteEinstellung dieses greulichen Menschenschlachtens und dieBegründung eines ehrlichen, dauernden, für die ganze Menschheitsegensreichen Friedens, wenn wir den wilden Eroberungskriegunserer Feinde auf das energischste bekämpfen; derWeg, den wir betreten, führt zu unserem mit der amerikanischenRegierung gemeinsamen Ziele, und wir können unsvor der Hoffnung nicht verschließen, Verständnis beim Volkeund bei der Regierung der Vereinigten Staaten zu finden.Ich antwortete ihm am 5. März nachstehendes:„Lieber Freund!Tisza."Ich kann Deine Ansicht nicht teilen. Nach der ersten,Ancona'-Note seid Ihr damals umgefallen und habt in einerzweiten Note erklärt, daß wir dem .deutschen Standpunktim wesentlichen zustimmen' — das ist ein offenes Nachgebenund eine versteckte Zusage gewesen.Ich glaube gar nicht, daß advokatorische Kniffe dieAmerikaner betören werden, und wenn wir diese Zusageleugnen würden, so kämen wir bestimmt nicht besservorwärts.176
Der verschärfte U-BootkriegZweitens und hauptsächlich aber gibt esüberhaupt keineMöglichkeit, die Amerikaner mit Worten von demKriege abzuhalten, wenn sie ihn wollen; entwedersie steuern auf den Krieg los, dann helfen alle Noten nichts,oder sie suchen einen Ausweg aus der Kriegsgefahr, dannfinden sie ihn in unserer Note.So vielmeritorisch.Technisch war das, was Du verlangst, unmöglich. DieNote war nicht einfach zu machen, sie wurde von mir ganzumgeändert, die Zeit verging; dann wollte S. M. sie sehen,nahm Änderungen vor und sanktionierte sie, unterdessendrängte Penfield* und telegraphierte sogar schon vor einerWoche nach Amerika, um seine Leute zu vertrösten; auchdie Deutschen mußten für den gewissen Passus gewonnenwerden.Du weißt, wie gerne ich mit Dir wichtige Sachen bespreche,aber ultra posse nemo tenetur — es war physisch unmöglich,nochmals alles umzuwerfen und nochmals S. M. für eineandere Fassung zu gewinnen.In treuer FreundschaftDein alterCzernin."Darauf erhieltich am 14. März folgende Antwort Tiszas:,, Lieber Freund!Den guten Erfolg Deines Amerika-Aide-Memoire's sehe auchich mit aufrichtiger Freude (gemeint istder damals gefaßteEntschluß Amerikas, die Beziehungen mit uns nicht abzubrechen).Dies ändert jedoch nichts an meiner dahingehendenMeinung, daß es schade war, zuzugeben, eine Zusageabgegeben zu haben. Das kann sich in einem späterenStadium der Polemik rächen, und es wäre leicht gewesen,dieses Thema einstweilen nicht zu berühren.* Mr. Penfield. amerikanischer Botschafter in Wien.U Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 177
Der verschärfte U-BootkriejjFindest Du mich sehr starrsinnig ?Ich habe dieses Schlußwortin unserer retrospektiven Polemik nicht zurückgehalten,damit Du mich nicht besser hältst als ich bin.Auf Wiedersehen in alter FreundschaftDeinTisza."Den U-Bootkrieg hat Tisza nur mit großem Widerstrebengeduldet, geduldet aus Gründen der Vis major, weil wir diedeutschen Militärs nicht an dieser Maßregel hindern konntenund weil er, ebenso wie ich, überzeugt war, daß das „Nichtmitmachen"uns keinen Vorteil bringen werde.Viel später erst, nach Kriegsende, habe ich aus einerguten Quelle erfahren, daß Deutschland in einer ganzunverständlichen Verkennung der Situation den Bau weitererU-Boote während des Krieges einschränkte. Von kompetentermarinetechnischer Seite wurde an StaatssekretärCapelle herangetreten und er aufmerksam gemacht, daß beiAussetzung aller anderen Schiffsbauten die fünffache Zahlvon U-Booten gebaut werden könne. Capelle habe dies abgelehntunter Hinweis darauf, ,,daß man nicht wisse, wasman nach dem Kriege mit den vielen U-Booten anfangensolle". Deutschland hatte, wie erwähnt, über hundert submarineBoote; hätte es fünfhundert besessen, wäre das Zielvielleicht erreicht worden.Ich habe diese Version — wie gesagt — erst im Winter 19gehört und kann die Wahrheit dieser Darstellung allerdingsnicht beweisen.Selten noch hat eine militärische Maßregel so viel Empörunghervorgerufen wie dieses warnungslose Versenkenfeindlicher Schiffe. Und doch wird ein objektiver Beurteilerzugeben müssen, daß der Kampf gegen „Kinder und Frauen"nicht von uns, sondern von unseren Gegnern durch dieBlockade begonnen wurde. Millionen sind im Bereiche derMittelmächte durch die Blockade zugrundegegangen, undgerade die178Ärmsten und Schwächsten — zum größten Teile
Der verschärfte U-BootkrietFrauen und Kinder — waren die Opfer. Wenn auf diesesArgument erwidert wird, ,,die Mittelmächte seien eine belagerteFestung gewesen und die Deutschen hätten Parisim Jahre 1870 ebenfalls ausgehungert", so hat diese Argumentationetwas für sich. Ebenso wahr ist es aber — wiedies auch in der Note vom 5. März gesagt ist — , daß beieinem Landkriege niemals Rücksicht auf Zivilpersonen,welche sich in die Kriegszone begeben, genommen wird,und daß kein Grund ersichtlich ist, warum der Seekrieganderen moralischen Bestimmungen unterliegen sollte. Wennsich eine Stadt oder ein Dorf im Schlachtenbereiche befindet,so hat dieser Umstand noch niemals die Artillerie verhindert,zu schießen, trotz der gefährdeten Frauen und Kinder. <strong>Im</strong>vorliegenden Falle aber konnten die gefährdeten Nichtkombattantender feindlichen Staaten der Gefahr dadurchsehr leicht ausweichen, daß sie keine Seereisen unternahmen.Nach dem Niederbruche im Winter 19 habe ich mit einigenmir seit langem befreundeten Engländern die Frage eingehendbesprochen und bei ihnen den Standpunkt vertretengefunden, daß nicht der U-Bootkrieg an und für sich, sonderndie völkerrechtswidrige, grausame Art seiner Handhabungdie große Empörung hervorgerufen habe. So hätten dieDeutschen stets Spitalschiffe torpediert, ferner die sichrettenden Passagiere mit Kanonen beschossen und dergleichenmehr. Diesen Erzählungen stehen die deutschenSchilderungen kraß gegenüber, welche ihrerseits haarsträubendeDetails englischer Brutalität wie beispielsweise den„Baralong"-Fall vermelden.Schandtaten sind gewiß in vereinzelten Fällen von allenArmeen verübt worden, daß die deutsche Oberste Heeresleitungsolche Grausamkeiten billigte oder gar anordnete,glaube ich nicht — ebenso wenig wie die englische.Eine Untersuchung vor einem internationalen, aberneutralen Gerichtshofe wäre das einzige Mittel, umKlarheit in diese Vorgänge zu bringen.170,
Der verschärfte U-BootkriegGrausamkeiten obiger Art sind auf das strengste zu verurteilen,von wem sie auch ausgegangen sein mögen; an undfür sich aber war der U-Bootkrieg ein moralisch erlaubtesAbwehrmittel.Die Blockade wird heute als erlaubte und notwendigeMaßregel — der verschärfte U-Bootkrieg als völkerrechtswidrigesVerbrechen gekennzeichnet. Das ist ein Urteilsspruchder Macht, aber nicht des Rechtes. Die Geschichtewird dereinst anders urteilen.
VI.Friedens versuche
Derverfassungsmäßige Zustand, welcher in allen parlamentarischenStaaten herrscht, ist der, daß der Ministereinem Vertretungskörper gegenüber verantwortlich ist. Ermuß über das, was er getan hat, Rechenschaft ablegen.Seine Taten unterliegen der Beurteilung der Kritik des Vertretungskörpers.Erklärt sich die Majorität des Vertretungskörpersgegen den Minister, so muß er gehen.Diese Funktion der Kontrolle über die äußere Politik versahenin der österreichisch-ungarischen Monarchie dieDelegationen.Außerdem aber bestand in der ungarischen Verfassung dieBestimmung, daß der ungarische Ministerpräsident seinemLande gegenüber für die äußere Politik verantwortlich sei,daher „dieäußere Politik der Monarchie im Einverständniszwischen dem jeweiligen Minister des Äußern und dem ungarischenMinisterpräsidenten zu führen sei".Es kam nun ganz auf die Persönlichkeit des ungarischenMinisterpräsidenten an, wie er diese Bestimmung auslegte.Bereits unter Burian war der Zustand eingetreten, daß alle,auch die geheimsten Telegramme und Nachrichten sofortdem Grafen Tisza mitgeteilt wurden, welcher sodann auchauf alle Entschlüsse und taktischen Vorgänge Einfluß nahm.Tisza war von einer ganz eminenten Arbeitsfähigkeit; erfand immer Zeit, sich neben seinen vielen Ressortgeschäftensehr eingehend mit der äußeren Politik zu beschäftigen, und
Friedensversuchees war daher notwendig, ihn stets für einen jeden Schrittzu gewinnen. Die Kontrolle der äußeren Politik bei uns waralso eine doppelte: durch die Delegation und durch denungarischen Ministerpräsidenten.So groß meine Achtung und Verehrung für den GrafenTisza war und so eng die Freundschaft war, welche uns verband,so stellte seine fortgesetzte Überwachung und Einsprachedoch eineganz unermeßliche Schwierigkeit des Geschäftsgangesdar. Schon in normalen Zeiten wird es oftnicht leicht sein, neben allen bestehenden Schwierigkeiten,welchen ein Minister des Äußern begegnet, auch noch diesezu überwinden. <strong>Im</strong> Kriege wurde diese Ehe zur Unmöglichkeit.Die unbedingte Voraussetzung einer solchen Doppelregierungwäre gewesen, daß der ungarische Ministerpräsidentalle Fragen von dem Standpunkte der Gesamtmonarchieund nicht von einem mag3^aro-zentrischen aus betrachte,eine Voraussetzung, die bei Tisza wie bei allen Ungarn fehlte.Tisza leugnete das nicht. Er hat mir öfters gesagt, daß erkeinen anderen Patriotismus als den ungarischen kenne, daßes aber im ungarischen Interesse liege, mit Österreich zusammenzubleiben— dadurch allein aber sah er alle Vorgängein schiefem Lichte. Nie hätte er einen Quadratmeter Ungarnsabgetreten, gegen die geplante Abtretung Galiziens hat ernicht den geringsten Widerspruch erhoben. Er hätte lieberdie Welt zugrunde gehen lassen, als Siebenbürgen herzugeben,aber für Tirol interessierte er sich so gut wie nicht.Abgesehen davon, ließ er aber überhaupt andere Regelnfür Österreich als für Ungarn gelten. Er wollte für Ungarnnicht die geringste Änderung der internen Verhältnisse eintretenlassen, .,da dieselben nicht unter äußerem Druckestattfinden dürften"; als ich unter dem Drucke der Nahrungssorgenden ukrainischen Wünschen nachgab und demösterreichischen Ministerium den ukrainischen Wunschnach Zweiteilung Galiziens übermittelte, war Tisza damit184
Friedens versuchevollständig einverstanden. Aber er ging noch weiter. Erwidersetzte sich auch jeder Vergrößerung der Monarchie, weildadurch der ungarische Einfluß geschwächt werden könnte.So war er zeitlebens ein Gegner der austro-polnischen Lösungund der Todfeind des trialistischen Gedankens; er wollte,wenn überhaupt, Polen höchstens als österreichische Provinzgelten lassen. Am liebsten aber Polen Deutschland überlassen.Sogar den Anschluß Rumäniens an Ungarn wollteer nicht, weil dadurch das magyarische Element in Ungarngeschwächt würde. Die Zulassung der Serben an das Meergalt ihm als ausgeschlossen, weil er die serbischen Agrarproduktehaben wollte, wenn er siebrauchte; er wollte aberauch keine offene Tür für die serbischen Schweine, weil erden Preis der ungarischen nicht drücken lassen wollte. Tiszaging in seiner Ingerenz noch weiter: Er hielt streng auf dieParität bei der Besetzung der ausländischen diplomatischenPosten. Ich konnte mich aber nicht streng daran kehren.Wenn ich den Österreicher X für fähiger zum Gesandtenhielt als den Ungarn Y, so mußte ich ihn nehmen, trotz eintretenderDisparität.Diese legal begründete, aber im Kriege undurchführbareund unerträgliche Ingerenz Ungarns hat zu verschiedenenKonflikten zwischen Tisza und mir geführt — und heute,wo er tot ist, hinterlassen diese Szenen bei mir nichts anderesals das Gefühl des lebhaften Bedauerns über manches heftigeWort, das ich gebraucht habe. Wir trafen später ein Kompromiß: Tisza versprach mir, nur -in den dringendsten Fällenhineinsprechen zu wollen, und ich versprach ihm, nichtsWichtiges ohne seine Zustimmung zu unternehmen. Baldnach dieser Vereinbarung ward er aus einem ganz anderenGrunde vom Kaiser entlassen.Ich habe seine Entlassung, trotz der Schwierigkeiten, dieer gebracht, lebhaft bedauert. Denn erstens war der magyarozentrischeStandpunkt keine Spezialität Tiszas, alle magyarischenPolitiker huldigten ihm; zweitens hatte Tisza den18s
Friedensversucheeinen großen Vorzug, daß er keine Kriegsverlängerung zwecksEroberungen wollte ; er wünschte die Grenzrektifikation gegenRumänien, sonst nichts. Wenn es also zu Friedensverhandlungengekommen wäre, so hätte er mich darin, ungefähr denStatus quo ante als Basis zu nehmen, jedenfalls unterstützt.Seine Unterstützung aber — und das war der dritte Grund —hatte einen großen Wert, denn er war ein Mann, der kämpfenkonnte ; er war hart und alt geworden auf dem Schlachtfeldeder parlamentarischen Arbeit, ihm imponierte nichts undniemand — und er war treu wie Gold. Auf sein Wort konnteman Häuser bauen. Viertens endlich war dieser aufrechteMann einer der wenigen, welche dem Kaiser stets ganzoffen und ungeniert die Wahrheit sagten — und dies brauchtenderKaiser und wir alle.Ich war mir daher im vorhinein klar, daß ein Wechselkeine Besserung in meiner Lage mit sich bringen werde.Eszterhazy, welcher Tisza folgte, erhob zwar niemals Einwändegegen meine Politik; dafür vermißte ich die starkeHand, die Ungarn in Ordnung hielt, und die strenge Stimme,die den Kaiser warnte, und Wekerle bot mir nicht den gleichenGrad von Verläßlichkeit wie Tisza, vielleicht auch nur deshalb,weil ich mit ihm niemals in ein ähnliches Freundschaftsverhältnisgetreten bin wie zu Tisza.Obwohl ich zahlreiche Konflikte mit Tisza hatte, so bleibtes doch eine der wenigen schönen Erinnerungen meiner Amtszeit,daß ich mit diesem seltenen Manne bis zu seinem Todein wahrhaft freundschaftlichen Beziehungen geblieben bin.Durch viele Jahre hieß Ungarn Stephan Tisza. Tisza warein Mann, dessen kühner, männlicher Charakter, dessenharter, entschlossener Sinn, dessen Furchtlosigkeit undLauterkeit ihn hoch über den Alltag erhoben. Er war einganzer Mann mit glänzenden Eigenschaften und großenFehlern, ein Mann, wie es wenige in Europa gibt — trotzseiner Fehler. Große Gestalten werfen lange Schatten, abergroß war er und aus dem Holz geschnitzt, aus dem die Helden186
Friedensversucheder Antike gemacht waren, jene Helden, die zu kämpfenund zu sterben verstanden. Wie oft habe ich ihm vorgeworfen,daß er durch seinen unglücklichen Puszta-Patriotismus sichselbst und uns allen das Grab grabe. Er war nicht zu ändern,er war starr und unbeugsam wie nur einer, und sein größterFehler war der, daß er zeitlebens in dem Banne dieser kleinlichenKirchturmpolitik gefangen blieb. Keinen Quadratmeterwollte er hergeben, weder seinerzeit an Rumänien nochan die Tschechen noch an die Südslawen. Eine furchtbareTragik liegt in dem Lebenslaufe dieses seltenen Menschen.Er hat gekämpft und gerungen wie nur einer für sein Volkund sein Land; durch Jahre ist er in der Bresche gestandenund hat die Seinen und sein Ungarn geschützt mit seinerbreiten männlichen Brust, und doch war seine Politik derstarren Unnachgiebigkeit einer der Hauptgründe für denZerfall Ungarns, das er so heiß geliebt, den Zerfall, den erselbst noch sterbend sah, als eine ewig verfluchte Mörderhandihr feiges Werk vollbrachte.Tisza hat mir einmal lachend erzählt, jemand habe ihmgesagt, sein größter Fehler sei, als Ungar auf die Welt gekommenzu sein.Ich finde diese Charakteristik schlagend. Als Mensch undals Mann war er hervorragend. Die magyarische Erbsündeseiner Denkungsart, alle Vorurteile und Fehler magyarozentrischenDenkens verdarben ihn.Ungarn und seine Verfassung, der Dualismus, waren imKriege eines unserer Unglücke.Wenn der Erzherzog Franz Ferdinand keinen anderenPlan gehabt hätte als den, mit dem Dualismus aufzuräumen,so hätte er schon deshalb verdient, geliebt und bewundertzu werden. Die ungarische Politik hat zur Zeit Aehrenthalsund Berchtolds die serbischen Differenzen gezüchtet, sie hatjedes Bündnis mit Rumänien unmöglich gemacht, sie hatim Kriege die Hungerblockade Österreichs durchgeführt, siehat jede interne Reform verhindert, und sie hat schließlich187
Friedensversuchenoch im letzten Moment, aus kleinlichem, kurzsichtigemEgoismus Karolyis, die Front zerschlagen. Dieses harteUrteil über Ungarns Einfluß im Kriege bleibt wahr, trotzder unzweifelhaft hervorragenden Leistungen magyarischerTruppen. Der Ungar ist an und für sich ein harter, kühner,männlicher Charakter, daher fast immer ein guter Soldat;aber leider hat dieungarische Politik im Laufe der letztenfünfzig Jahre viel mehr verdorben, als der tapfere ungarischeSoldat im Kriege retten konnte.Mir hat während des Krieges einst ein Ungar auf meineVorwürfe gesagt: wenigstens eines müsse ich zugeben: derUngarn seien wir sicher; sie seien fest an Österreich gebunden.Jawohl, antwortete ich ihm, Ungarn ist fest an uns gebunden,aber so wie ein Stein, den ein Ertrinkender um den Hals gebundenhat.Wenn wir den Krieg nicht verloren hätten, so wäre nachherder Kampf auf Leben und Tod mit dem magyarischen Volkeunvermeidlich gewesen, weil sich gar keine vernünftige europäischeKonstellation denken läßt, welche mit den magyarischenAspirationen und Herrscherplänen unter einen Hutzu bringen gewesen wäre.Aber während des Krieges war ein offener Kampf gegenBudapest natürlich unmöglich.Ob die Völker, die einstmals die Habsburgische Monarchiegebildet haben, jemals wieder vereint werden, stehtdahin;kommt es dazu, dann bewahre uns ein gütiges Geschick voreiner Wiederkehr des Dualismus.Am 26. Dezember 1916 — vier Tage nach meinem Amtsantritte— erhielt ich einen Brief Tiszas, in welchem er mirin folgender Weise seine Anschauung über die zu verfolgendeTaktik mitteilte:,,Es fühlen sich alle europäischen Neutralen weitaus mehrdurch England als durch uns bedroht. Die Ereignisse inGriechenland, Rumänien usw., sowie die kommerzielle
FriedensversücheTyrannei Englands muß Wind in unsere Segel blasen, undauch der Unterschied in unserer Stellungnahme zu Friedensgedankengegenüber jener der Entente wird — wenn konsequentund geschickt weitergeführt — die Sympathien unsererMächtegruppe zuwenden.Von diesem Gesichtspunkte sehe ich die Hauptgefahr darin,daß unsere notwendigerweise vorsichtige Stellungnahme inbezug auf die Mitteilung der Kriegsziele den Glauben aufkommenlassen könnte, als würden auch wir nur aus taktischenRücksichten mit dem Friedensgedanken spielen, ohne denFrieden im Ernste anstreben zu wollen.Wir müßten daher unsere bei den Neutralen akkreditiertenVertreter (wobei auf Spanien, Schweden und Holland dasgrößte Gewicht fiele) mit den nötigen Instruktionen versehen,damit sieunsere vorsichtige Haltung mit den nötigenAufklärungen begleiten und die Gründe darlegen können,welche uns von einer vorzeitigen oder gar einseitigen Veröffentlichungunserer Bedingungen gerade im Interesse desFriedens abhalten müssen.Schon eine beiderseitige Veröffentlichung der Bedingungenwürde den Kriegsparteien in beiden Lagern zu unliebsamenKritiken Tor und Tür öffnen und leicht eine Verschärfungder Situation herbeiführen; eine einseitige Mitteilungder Kriegsziele würde einfach den noch am Ruderstehenden Kriegsparteien der feindlichen Gruppedie Handhabe bieten, um alles zu verderben.Gerade im Interesse des Friedens kann daher eine Mitteilungder Friedensbedingungen nur gegenseitig und vertraulicherfolgen; wir könnten jedoch den einzelnen Neutralenverschiedene Andeutungen darüber geben, daß unsereKriegsziele mit den dauernden Interessen der Menschheitund des Weltfriedens zusammenfallen, unser Hauptziel:die Verhinderung der russischen Weltherrschaftam Kontinente und der englischen zur See imInteresse der ganzen neutralen Welt liegt und unserei8q
FriedensversucheFriedensbedingimgen nichts enthalten werden,was den zukünftigenWeltfrieden gefährden und von neutraler Seitebeanstandet werden könnte.Ich erlaube mir, diese Gesichtspunkte Deinem Erwägenanheimzustellen, und bleibe in warmer FreundschaftDein ergebenerTisza."Mein Amtsvergänger Burian hatte noch knapp vor seinemAbgange zusammen mit Bethmann einen Friedensvorschlaggemacht.Die fast höhnisch ablehnende Antwort der Ententedürfte noch in aller Erinnerung sein.Ich habe, seitdem dieFeindseligkeiten eingestellt sind und Gelegenheit war, mitMitgliedern der Entente zu sprechen, öfters den Vorwurf vernommen,daß dieses Friedensangebot für die Entente unannehmbargewesen, weil es im Tone des Siegers, der demFeinde einen Frieden „bewilligt", gemacht gewesen sei. Obwohlich nicht leugnen will, daß der Ton dieses Friedensangebotesein sehr selbstbewußter war — ein Eindruck, dernoch verstärkt werden mußte durch die Reden Tiszas imungarischen Parlament —,so glaube ich doch, daß dasselbe,auch wenn es anders abgefaßt worden wäre, wenig Aussichtauf Erfolg gehabt hätte. Wie dem auch sei, die schroffe Ablehnungseitens der Entente stärkte damals die Stellung derkriegslustigen Militärs, welche nunmehr mit gesteigerterVehemenz den Standpunkt verfochten, daß alles Sprechenüber den Frieden vom Übel sei und der Kampf bis zumäußersten fortgeführt werden müsse.<strong>Im</strong> Winter 1917 klopfte es leise von Italien an: zu welchenterritorialen Konzessionen die Monarchie sich entschließenwürde? Es war dies keine Anfrage der italienischen Regierung,sondern der Schritt eines Privatmannes, welcher mirdurch eine befreundete Regierung übermittelt wurde. SolcheDemarchen sind natürlich ungemein schwer auf ihren innerenWert zu prüfen. Es kann sich eine Regierung einer privatenIQO
.Frieden^ versuchePersönlichkeit bedienen, um den ersten Schritt zu machen— sie wird es sogar voraussichtlich tun, wenn sie ein Gesprächeinleiten will — , es kann aber auch sein, daß irgendeinePersönlichkeit ohne Auftrag und ohne Wissen ihrer Regierungdergleichen versucht. Letztere Fälle sind während meinerAmtszeit wiederholt vorgekommen.Ich stand immer auf dem Standpunkte, daß ein solchesFriedenstasten auch dann, wenn es seine ministerielle Genesisnicht a priori beweisen konnte, sehr vorsichtig, aber entgegenkommendaufzunehmen sei. In dem vorliegenden Falleaber stand die Sache so, daß Italien sich von seinen Bundesgenossenbestimmt weder trennen wollte noch konnte. Dennauch wenn es diese Absicht gehabt hätte, so wäre es durchdie Ausführung derselben in Konflikt mit England geraten,dessen Kriegszweck ja nicht die italienischen Aspirationen,sondern die Besiegung Deutschlands war. Ein Separatfriedemit Italien — eine Trennung Italiens von seinen Bundesgenossen— war also ganz ausgeschlossen, ein allgemeinerFriede aber erst dann möglich, wenn eine Verständigungzwischen den Westmächten und Deutschland gelang.Diese Anfrage konnte daher keinen anderen Zweck verfolgenals den, den Grad unserer Kriegsmüdigkeit zu konstatieren.Hätte ich geantwortet, ich sei bereit, die oder jeneProvinz preiszugeben, so wäre dies als ein befriedigendesSymptom unserer zunehmenden Schwäche verbucht worden,hätte uns aber dem Frieden nicht nähergebracht, sondernuns im Gegenteil von demselben entfernt.Ich erwiderte daher in sehr entgegenkommender Form,die Monarchie bezwecke keine Eroberungen und sei bereit,auf der Basis des vorkriegerischen Besitzstandes zu verhandeln.Darauf erfolgte keine Antwort mehr.Später, nach dem Niederbruche ist mir von einer allerdingsnicht kompetenten Stelleseivorgehalten worden, meine Taktikfalsch gewesen, denn Italien hätte sich damals von seinenBundesgenossen getrennt und einen Separatfrieden geschlossenIQI
FhedeusversucheDie weiteren Erzählungen dieses Kapitels beweisen die Unnahbarkeitdieses Vorwurfes. <strong>Im</strong> übrigen ist es heute nichtmehr schwer, zu konstatieren, daß es die ganze Kriegsdauerüber auch nicht einen Moment gegeben hat, in welchem Italienden Gedanken, sich von seinen Bundesgenossen zu trennen,auch nur ventilierte.In den letzten Tagen des Februar 1917 trat ein merkwürdigesEreignis ein : Am 26. Februar erschien bei mireine Persönlichkeit, welche sich als berufener Vertreter einerneutralen Macht zu legitimieren imstande war, und teilte mirim Auftrage seiner Regierung mit, er habe den Befehl, michwissen zu lassen, daß die Gegner oder einer von ihnen bereitseien, Frieden mit uns zu schließen, und daß die Bedingungendieses Friedensschlusses für uns günstig sein würden. Insbesonderewerde von einer Lostrennung Ungarns oder Böhmensvom Reiche nicht mehr die Rede sein. Ich möge, fallsich bereit sei, auf diese Anregung einzugehen, sofort auf demgleichen Wege meine Bedingungen mitteilen, werde jedochdarauf aufmerksam gemacht, daß die Vorschläge derfeindlichen Regierung in dem Augenblicke nullund nichtig seien, wo irgendeine andere mit ihroder mit uns befreundete Regierung von diesemSchritte erfahre.Der Überbringer dieser Nachricht wußte nicht mehr, alsder Inhalt dieser Demarche enthielt.Der Schlußpassus ließerkennen, daß eine der feindlichen Mächte ohne Wissender anderen verhandeln wolle.Ich zweifelte keinen Augenblick daran, daß es sich umRußland handle, und mein Gewährsmann bestärkte mich indieser Überzeugung, obwohl er ausdrücklich betonte, erkönne dies nicht positiv sagen. Ich antwortete sofort auftelegraphischem Wege durch die Vermittlung der intervenierendenneutralen Macht am 27. Februar, daß Österreich-Ungarn selbstverständlich bereit sei, dem weiteren Blutvergießensofort ein Ende zu machen und keinen wie immer192
Friedensversuchegearteten Gewinn aus dem Frieden ziehen wolle, da wir,wie bereits verschiedene Male betont, ja nur einen Verteidigungskriegführten. Ich müsse jedoch darauf aufmerksammachen, daß die etwas unklare Fassung der Anfrage es mirnicht ganz verständlich erscheinen lasse, ob der sich an unswendende Staat einen Frieden mit uns allein oder mitunserer ganzen Mächtegruppe zu schließen bereit sei,und ich müsse Wert darauf legen, zu betonen, daß wir vonunseren Bundesgenossen nicht zu trennen seien. Ich seijedoch bereit, meine guten Dienste als Vermittler anzubietenfür den von mir erwarteten Fall, daß der sich an uns wendendeStaat zu einem Frieden mit unserer ganzen Mächtegruppe bereitsei. Ich garantiere die Geheimhaltung, da ich vorerstfür überflüssig fände, unsere Bundesgenossen zu verständigen.Hierzu werde erst der Moment gekommen sein, bis dieSituation geklärt sein werde.Daraufhin erfolgte am 9. März eine weitere Antwort,welche anscheinend meinen Standpunkt akzeptierte, dieFrage jedoch, ob es sich um einen Frieden mit uns alleinoder mit unseren Bundesgenossen handle, nicht direkt beantwortete.Um raschestens Klarheit zu schaffen und keineZeit zu verlieren, antwortete ich sofort: Ich ersuche diegegnerische Macht, einen Vertrauensmann in ein neutralesLand zu senden, wohin ich meinerseits sofort einen Delegiertenabschicken würde, und fügte bei, daß ich hoffe,daß diese Zusammenkunft ein gedeihliches Resultat habenwerde.Auf dieses zweite Telegramm ist nie mehr eine Antwortgekommen. Sieben Tage später, am 16. März, ist der Zarentthront worden. Es hat sich hier offenbar um einen letztenRettungsversuch von ihm gehandelt, der vielleicht, wenn erwenige Wochen früher erfolgtwäre, nicht nur das SchicksalRußlands, sondern das der Welt hätte ändern können.Die russische Revolution stellte uns vor eine ganz neueSituation. <strong>Im</strong>merhin war es nicht zweifelhaft, daß der Osten13 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> IQ3
Friedensversuchedie näherliegende Möglichkeit eines abzuschließenden Friedensbot, und alle unsere Bestrebungen waren darauf gerichtet,den ersten möglichen Moment 'zu benützen, um mit derrussischen Revolution jenen Frieden zu schließen, den derbereits im Sturze begriffeneZar nicht mehr hatte schließenkönnen.War das Frühjahr 1917 durch den Beginn des U-Bootkriegesgekennzeichnet und durch alle die Hoffnungen,welche sich deutscherseits an seinen Erfolg und den durchihn bedingten Umschwung der Lage knüpften, so zeigte sichim Sommer dieses Jahres, daß das Ergebnis des U-Bootkriegeszwar nicht an die gestellten Erwartungen heranreiche,daß er aber England doch ernste Sorge bereite. Um dieseZeit herrschten in England große Befürchtungen, ob und wieder U-Bootkrieg zu paralysieren sei. Bevor die neuen Gegenmittelsich nicht bewährt hatten, wußte man an der Themsenicht, ob sie ausreichen würden — erst im Laufe des Sommerserkannte man, daß die Vernichtungsinstrumente der U-Booteund das Prinzip der „konvoiierten" Schiffe Erfolge brachten.<strong>Im</strong> Frühsommer 19 17 also trafen vorerst äußerst günstigeNachrichten über die englischen und französischen Zuständeein. Aus Madrid, woher stets sehr wahrheitsgetreue Meldungeneinliefen, kamen Nachrichten, daß spanische, aus Englandnach Madrid zurückgekehrte Schiffsoffiziere erzählten, „daßsich die Lage dortselbst in den letzten Wochen sehr verschlechterthabe und keine Siegeszuversicht mehr bestehe.Die Behörden beschlagnahmten alle ankommenden Lebensmittelfür die Truppen und Munitionsarbeiter; Kartoffelnund Mehl seien für die ärmeren Klassen unerschwinglich,die Mehrzahl der brauchbaren Seeleute sei zur Kriegsmarineeingezogen, so daß für die Handelsmarine nur minderwertigeMannschaften verfügbar seien, aber auch diese seien wegenFurcht vor den U-Booten schwer aufzutreiben, so daß gegenwärtigviele britische Handelsschiffe mangels Bedienungnicht194führen."
FriedensversucheDies war ungefähr der Tenor der spanischen Meldungen,welche aus verschiedenen Quellen stammten. Ähnliches,wenn auch in etwas anderer Form, wurde aus Frankreichgemeldet. Aus Paris wurde gemeldet, daß sich daselbsteine große Kriegsmüdigkeit geltend mache. Der definitiveSieg sei so gut wie aufgegeben, man wolle unbedingt nochvor Beginn des Winters Schluß machen, und viele maßgebendenPersönlichkeiten seien davon überzeugt, daß das Hineinziehendes Krieges in den Winter ähnlich wie in Rußlanddie Revolution zur Folge haben würde.Um die gleiche Zeit trafen Nachrichten aus Konstantinopelein, daß eine der feindlichen Mächte dortselbst wegen einesSeparatfriedens angeklopft habe. Die türkische Regierungantwortete, daß sie nicht von ihren Bundesgenossen zutrennen, jedoch bereit sei, einen allgemeinen Frieden aufannexionsloser Basis zu diskutieren. Talaat Pascha teiltemir sofort die Anfrage und die Antwort mit. Darauf verstummtedie Stimme aus der gegnerischen Mächtegruppe.Gleichzeitig kamen Nachrichten aus Rumänien, welche großeBesorgnisse wegen der zunehmenden russischen Zersetzungatmeten und erkennen ließen, daß Rumänien sein Spiel verlorengebe. In Rußland machte die Revolution und dieLähmung der Armee Fortschritte.Alles das zusammengenommen ließ das totale Bild füruns hoffnungsvoller erscheinen und jenen recht geben, welchestets behauptet hatten, noch einiges „Durchhalten" — umdas seitdem ominös gewordene Wort zu gebrauchen — werdeden Erfolg zeitigen.Ein jeder Minister des Äußern muß während eines Kriegesden Konfidentenberichten eine gewichtige, nicht zu unterschätzendeBedeutung beimessen. Die hermetische Absperrung,die während des <strong>Weltkriege</strong>s Europa in zweigetrennte Welten schied, machte dies doppelt notwendig.Es liegt aber in der Natur der Konfidentenberichte, daß siedoch immer mit einer gewissen Skepsis aufgenommen werden'3 105
Friedensversuchemüssen, und zwar aus verschiedenen Gründen; jene Persönlichkeiten,welche nicht aus materiellem, sondern auspolitischem Interesse, aus politischer Zuneigung und Sympathieoder ähnlichen ideellen Gründen schreiben und erzählen,sind natürlich an und für sich durch die Natur derSache schon über den Verdacht erhaben, aus persönlichenGründen optimistischer als berechtigt berichten zu wollen.Aber sie sind Täuschungen ausgesetzt. Auch Völker unterliegenStimmungen, und die Stimmungen der Massen müssennoch nicht ausschlaggebend für die Richtung der maßgebendenFaktoren sein. Frankreich war kriegsmüde, aber wieweitdie maßgebenden Faktoren von dieser, mit unserer Kriegsmüdigkeitübrigens nicht zu vergleichenden Stimmungbeeinflußt waren, war nicht erwiesen.Bei Konfidenten, welche dieses Metier als Erwerb betreiben,schleicht sich neben den erklärlichen und begreiflichen Irrtümernsehr leicht noch der Wunsch ein, durch die erstattetenBerichte Befriedigung und Freude, zu erwecken,um dergestalt den einträglichen Posten nicht am Ende zuverlieren. Ich glaube, man wird immer gut daran tun, Konfidentenberichte,ob sie nun aus der einen oder der anderender erwähnten Quellen fließen, um fünfzig Prozent pessimistischereinzuschätzen, als sie abgefaßt sind. Die stetsviel pessimistischere Auffassung, welche, verglichen mitBerlin, in Wien herrschte, fußte vor allem auf der verschiedenenBewertung der aus dem Feindesland kommenden Nachrichten.Berlin war sich natürlich auch darüber klar, daßdie Zeit gegen uns laufe — obwohl Bethmann einmal imReichstag das Gegenteil zu sagen für notwendig fand —,aberdie deutschen Militärs und Politiker sahen die Situation beiden Gegnern anders als wir.Als Kaiser Wilhelm im Sommer 1917 in Laxenburg war,erzählte er mir einzelne Fälle der rapid zunehmenden Hungersnotin England und war aufrichtig erstaunt, als ich ihm entgegnete,ich sei zwar überzeugt, daß der U-Bootkrieg an der196
FriedensversucheThemse große Sorgen bereite, von einer Hungersnot aberdort gewiß keine Rede sei.Frage sei,Ich sagte dem Kaiser, die großeob der U-Bootkrieg den Transport der amerikanischenTruppen tatsächlich eingreifend stören werde, wiedie deutschen Militärs dies behaupteten, oder nicht, warntejedoch davor, einzelne Stimmungsbilder und Momentaufnahmenaus den Ententeländern zu ernst einzuschätzen.Es haben — es sei wiederholt — nach Beginn des uneingeschränktenUnterseebootkrieges sehr ernste Befürchtungenin England geherrscht. Das scheint erwiesen. Aber es warenBefürchtungen und noch keine Tatsachen.Eine Persönlichkeit,die wußte, wie es steht, und die im Sommer 1917 ausdem neutralen Auslande zu mir kam, sagte mir: Wennsich die Hälfte der an der Themse gehegten Befürchtungenrealisiert, so ist der Krieg im Herbste aus — zwischen LondonerBefürchtungen und Berliner Hoffnungen einerseits undeingetretenen Tatsachen andererseits klaffteaber eine großeKluft, welche in der deutschen Psyche übersprungen wurde.Wie dem auch sei, ich halte es für zweifellos, daß der Sommer1917 trotz des angekündigten Nahens Amerikas, eine Phasedarstellte, welche hoffnangsvoller schien. Wir wurden voneiner Welle hinaufgetragen, und es handelte sich darum,die Konjunktur möglichst auszunützen. Deutschland mußtein eine Stimmung gebracht werden, den Frieden zu machen,falls die Friedenswelle an Intensität zunehme.Ich faßte daher den Entschluß, dem Kaiser vorzuschlagen,er möge selbst das erste Opfer bringen und in Berlin beweisen,daß er nicht nur mit Worten für den Frieden sei. Er mögemich bevollmächtigen, in Berlin zu erklären, daß für denFall, daß Deutschland sich mit Frankreich über die elsaßlothringischeFrage verständige, Österreich bereit sei, Galizienan das neuzugründende Polen abzutreten, und sich mit ganzerKraft dafür einzusetzen, daß dieses großpolnische Reich anDeutschland angeschlossen werde; nicht inkorporiert, aberbeispielsweise in Form einer Personalunion.197
,FriedensversucheDer Kaiser und ich fuhren nach Kreuznach, woselbst ichden Vorschlag zuerst Bethmann und Zimmermann und sodannin Gegenwart Kaiser Karls und Bethmanns Kaiser Wilhelmmachte. Es erfolgte keine unbedingte Annahme und keineAbsage, sondern die Konferenzen schlössen mit dem deutschenErsuchen, die Frage überlegen zu dürfen.Ich war mir bei dem Vorschlag der Tragweite desselbenvöllig bewußt. Wenn Deutschland das Angebot annahmund wir unsererseits bei den dann zu erwartenden Verhandlungenmit der Entente keine wesentlichen Änderungen desLondoner Paktes erreichten, so zahlten wir den Krieg allein.Denn wir hätten dann nicht nur Italien, Rumänien undSerbien befriedigen müssen, sondern auch den als gewisseKompensation stets erhofften Anschluß Polens verloren.Auch Kaiser Karl sah die Situation klar, war aber dennochsofort entschlossen, den ihm vorgeschlagenen Schritt zumachen.Ich glaubte aber damals — vielleicht irrtümlicherweise —daß London und Paris unter Umständen eine Änderung desLondoner Paktes würden durchsetzen können. Erst längereZeit nachher erfolgte die definitive Ablehnung unseres Angebotesseitens Deutschlands.<strong>Im</strong> April, noch bevor also eine Entscheidung über unserenAntrag erflossen war, hatte ich einen Bericht an Kaiser Karlgeschrieben, in welchem ich ihm unsere Situation schildertemit dem Ersuchen,denselben an Kaiser Wilhelm weiterzuleiten.Der Bericht lautete:„Wollen Euer Majestät mir gestatten, mit jener Offenheit,welche mir vom ersten Tage meiner Ernennung an gestattetwar, meine verantwortliche Meinung über die Situation entwickelnzu dürfen.Es ist vollständig klar, daß unsere militärische Kraftihrem Ende entgegengeht. Diesbezüglich erst lange Detailszu entwickeln, hieße die Zeit Euer Majestät mißbrauchen.198
FriedensversuchcIch verweise bloß auf das zur Neige gehende Rohmaterialzur Munitionserzeugung, auf das vollständig erschöpfteMenschenmaterial und vor allem die dumpfe Verzweiflung,welche sich wegen der Unterernährung aller Volksschichtenbemächtigt hat und welche ein weiteres Tragen der Kriegsleidenunmöglich macht.Wenn ich auch hoffe, daß es uns gelingen wird, noch dieallernächsten Monate durchzuhalten und eine erfolgreicheDefensive durchzuführen, so bin ich doch vollständig klardarüber, daß eine weitere Winterkampagne vollständig ausgeschlossenist, mit anderen Worten, daß im Spätsommeroder Herbst um jeden Preis Schluß gemacht werden muß.Die größte Wichtigkeit liegt zweifellos dabei auf demMoment, die Friedensverhandlungen in einem Augenblickzu beginnen, in welchem unsere ersterbende Kraft denFeinden noch nicht zu vollem Bewußtsein gekommen ist.Treten wir an die Entente heran in einem Augenblick, inwelchem Vorgänge im Innern des Reiches den bevorstehendenZusammenbruch ersichtlich machen, so wird jede Demarchevergeblich sein und die Entente wird auf keine Bedingungenaußer auf die,welche die vollständige Vernichtung der Zentralmächtebedeuten, eingehen. Rechtzeitig also zu beginnen,ist von kardinaler Wichtigkeit.Ich kann hier das Thema nicht beiseite lassen, auf welchemder Nachdruck meiner ganzen Argumentation liegt.Es istdies die revolutionäre Gefahr, welche auf dem Horizontganz Europas aufsteigt und welche, von England gestützt,seine neueste Kampfart darstellt. Fünf Monarchen sind indiesem Kriege entthront worden, und die verblüffende Leichtigkeit,mit welcher jetzt die stärkste Monarchie der Weltgestürzt worden ist, möge dazu beitragen, nachdenklich zustimmen und sich des Satzes zu erinnern: Exempla trahunt.Man antworte mir nicht, in Deutschland oder Österreich-Ungarn seien die Verhältnisse anders, man erwidere nicht,daß die festen Wurzeln des monarchistischen Gedankens in199
FriedensversucheBerlin oder Wien ein solches Vorgehen ausschlössen.DieserKrieg hat eine neue Ära der Weltgeschichte eröffnet: er hatkeine Vorbilder und keine Vorakten. Die Welt ist nicht mehrdieselbe, wie sie vor drei Jahren war, und vergeblich wirdman nach Analogien für alle die Vorgänge, die heute zurAlltäglichkeit geworden sind, in der Weltgeschichte suchen.Der Staatsmann, der nicht blind oder taub ist, muß wahrnehmen,wie die dumpfe Verzweiflung der Bevölkerung täglichzunimmt: er muß das dumpfe Grollen hören, das in denbreiten Massen vernehmbar ist, und er muß, wenn er sichseiner Verantwortung bewußt ist, mit diesem Faktor rechnen.Euer Majestät sind die geheimen Berichte der Statthalterbekannt. Zwei Sachen sind klar. Auf unsere Slawen wirktdie russische Revolution stärker als auf die Reichsdeutschen,und die Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges istweitaus größer für den Monarchen, dessen Land nur durchdas Band der Dynastie geeinigt wird, als für den, wo dasVolk selbst für seine nationale Selbständigkeit kämpft.Euer Majestät wissen, daß der Druck, der auf der Bevölkerunglastet,einen Grad angenommen hat, der einfach unerträglichwird; Euer Majestät wissen, daß der Bogen dermaßen gespanntist,daß ein Zerreißen täglich erwartet werden kann.vor dem Auslande zu verheimlichen, und inTreten aber erst einmal ernstere Unruhen bei uns oder inDeutschland zutage, so ist es unmöglich, ein solches Faktumdiesem Augenblickesind auch alleerreichen, erfolglos geworden.weiteren Bemühungen, den Frieden zuIch glaube nicht, daß die interne Situation in Deutschlandwesentlich anders steht als hier, nur fürchte ich, daß mansich in Berlin in den militärischen Kreisen gewissen Täuschungenhingibt. Ich habe die feste Überzeugung, daß auchDeutschland genau ebenso wie wir an dem Rande seinerKraft angelangt ist, wie dies ja die verantwortlichen politischenFaktoren Berlins auch gar nicht leugnen.Ich bin felsenfest davon durchdrungen, daß, wenn200
FriedensversucheDeutschland versuchen sollte, eine weitere Winterkampagnezu führen, sich im Innern des Reiches ebenfalls Umwälzungenergeben werden, welche mir viel ärger erscheinen als einvon den Monarchen geschlossener Friede. Wenn die Monarchender Zentralmächte nicht imstande sind, in dennächsten Monaten den Frieden zu schließen, dann werdenes die Völker über ihre Köpfe hinüber machen, und dannwerden die Wogen der revolutionären Vorgänge alles daswegschwemmen, wofür unsere Brüder und Söhne heute nochkämpfen und sterben.Ich möchte gewiß keine oratio pro domo halten,aber ichbitte Euer Majestät, sich gnädigst erinnern zu wollen, daß,als ich als einziger seit zwei Jahren den rumänischen Kriegvorausgesagt habe, ich nur tauben Ohren gepredigt habeund daß ich, als ich zwei Monate vor dem Kriegsausbruchfast den Tag des Beginnes prophezeite, nirgends Glaubenfand. Ebenso überzeugtwievon meiner damaligenDiagnose bin ich von meiner heutigen, und ichkann es nicht eindringlich genug wiederholen, daß wir die Gefahren,die ich wachsen sehe, nicht gering anschlagen mögen.Die amerikanische Kriegserklärung hat zweifellos dieSituation wesentlich verschärft.Es mag ja sein, daß Monatevergehen werden, bevor Amerika nennenswerte Kräfte aufden Kriegsschauplatz werfen kann, aber das moralischeMoment, das Moment, daß die Entente neue kräftige Hilfeerhofft,verschiebt die Situation zu unseren Ungunsten, weilunsere Feinde bedeutend mehr Zeit vor sich haben als wirund länger warten können, als wir dies leider imstande sind.Welchen Fortgang die russischen Ereignisse nehmen werden,kann heute noch nicht gesagt werden. Ich hoffe — und diesist ja eigentlich der Angelpunkt meiner ganzen Argumentation— , daß Rußland seine Stoßkraft für lange Zeit, vielleichtfür immer, verloren hat, und daß dieses wichtigeMoment ausgenützt werden kann. Trotzdem erwarte ich,daß eine französisch-englische, wahrscheinlich auch eine201
Friedensversucheitalienische Offensive unmittelbar bevorstehen, doch glaubeund hoffe ich, daß es uns gelingen wird, diese beiden Angriffeabzuschlagen. Ist dies gelungen — und ich rechne, daß diesin zwei bis drei Monaten geschehen sein kann — , dann müssenwir, bevor Amerika das militärische Bild neuerdings zuunseren Ungunsten verschiebt,einen weitergehenden detailliertenFriedensvorschlag machen und uns nicht davor scheuen,eventuell große, schwere Opfer zu bringen.Man setzt in Deutschland große Hoffnungen auf den Unterseebootkrieg.Ich halte diese Hoffnungen für trügerisch. Ichleugne keinen Augenblick die fabelhaften Leistungen derdeutschen Seehelden, ich gebe bewundernd zu, daß die Zahlder monatlich versenkten Tonnen etwas Fabelhaftes ist, aberich konstatiere, daß der von den Deutschen erwartete undvorausgesagte Erfolg nicht eingetreten ist.Euer Majestät werden sich erinnern, daß uns AdmiralHoltzendorff bei seiner letzten Anwesenheit in Wien positivvorausgesagt hat, der verschärfte Unterseebootkrieg werdebinnen sechs Monaten England matt setzen. Euer Majestätwerden sich weiter erinnern, wie wir alle diese Voraussagungenbekämpft haben und erklärt haben, daß wir zwar nicht daranzweifeln, daß der Unterseebootkrieg England schädigenwerde, daß aber der erwartete Erfolg durch den voraussichtlichenEintritt Amerikas in den Krieg paralysiert werdendürfte. Es sind heute zweieinhalb Monate (also fast die Hälftedes angesagten Termines) seit dem Beginne des Unterseebootkriegesvergangen, und alle Nachrichten, die wir ausEngland haben, stimmen darin überein, daß an einen Niederbruchdieses gewaltigsten und gefährlichsten unserer Gegneraucirnicht einmal zu denken ist. Wenn Euer Majestät trotzIhrer schweren Bedenken dem deutschen Wunsche nachgegebenund die österreichisch-ungarische Marine an demUnterseebootkrieg haben beteiligen lassen, so geschah diesnicht, weil wir durch die deutschen Argumente bekehrtworden waren, sondern weil es Euer Majestät für absolut202
Friedensversuchenotwendig hielten, in treuer Waffengemeinschaft auf allenGebieten mit Deutschland vorzugehen, und weil wir dieÜberzeugung gewonnen hatten, daß Deutschland von demeinmal gefaßten Entschlüsse, den verschärften Unterseebootkriegzu beginnen, leider nicht mehr abzubringen sei.Aber heute dürften auch in Deutschland die begeistertstenAnhänger des Unterseebootkrieges zu erkennen beginnen,daß dieses Mittel den Sieg nicht entscheiden wird, und ichhoffe, daß der leider unrichtige Gedanke, England werdebinnen weniger Monate zum Frieden gezwungen sein, auchin Berlin an Boden verlieren wird. Nichts ist gefährlicherin der Politik, als jene Dinge zu glauben, die man wünscht,nichts ist verhängnisvoller als das Prinzip, die Wahrheitnicht sehen zu wollen und sich utopischen Illusionen hinzugeben,aus denen früher oder später ein furchtbares Erwachenerfolgen muß.Auch in einigen Monaten wird England, der treibendeFaktor des Krieges, nicht gezwungen sein, die Waffen niederzulegen,aber vielleicht — und hierin gebe ich einen limitiertenErfolg des Unterseebootkrieges zu — vielleicht wirdEngland in einigen Monaten sich die Rechnung stellen, obes klug und vernünftig sei, diesen Krieg ä outrance weiterzuführen,oder ob es nicht staatsmännischer sei, goldeneBrücken zu betreten, wenn ihm dieselben von den Zentralmächtengebaut werden, und dann wäre der Augenblick gekommenfür weitgehende schmerzliche Opfer seitens derZentralmächte.Euer Majestät haben die wiederholten Versuche unsererFeinde, uns von unseren Bundesgenossen zu trennen, untermeiner verantwortlichen Deckung abgelehnt, weil EuerMajestät keiner unehrlichen Handlung fähig sind. AberEuer Majestät haben mich gleichzeitig beauftragt, den verbündetenStaatsmännern des Deutschen Reiches zu sagen,daß wir am Ende unserer Kräfte sind, und daß Deutschlandüber den Spätsommer hinaus nicht mehr auf uns wird rechnen20^
Friedensversuchekönnen.Ich habe diese Befehle ausgeführt, und die deutschenStaatsmänner haben mir keinen Zweifel darüber gelassen,daß auch für Deutschland eine weitere Winterkampagne einDing der Unmöglichkeit sei, und in diesem einzigen Satzeliegt eigentlich alles, was ich zu sagen habe:Wir können noch einige Wochen warten und versuchen,ob sich Möglichkeiten ergeben, mit Paris oder Petersburgzu sprechen.Gelingt dies nicht, dann müssen wir — nochrechtzeitig — unsere letzte Karte ausspielen und jene äußerstenPropositionen machen, die ich im Früheren angedeutethabe.Euer Majestät haben den Beweis erbracht, daß Sie nichtegoistisch denken und dem deutschen Bundesgenossen keinOpfer zumuten, welches Euer Majestät nicht selbst zu tragenbereit wären. Mehr kann niemand verlangen.Gott und Ihren Völkern sind es aber Euer Majestät schuldig,alles zu versuchen, um die Katastrophe eines Zusammenbruchesder Monarchie zu verhindern; vor Gott und IhrenVölkern haben Sie die heilige Pflicht, Ihre Völker, dasdynastische Prinzip und Ihren Thron zu verteidigen mitallen Mitteln und bis zu Ihrem letzten Atemzug."Darauf erfolgte am n. Mai folgende amtliche Antwortdes Reichskanzlers, welche von Kaiser Wilhelm an KaiserKarl und von diesem an mich gelangte:„Euer Majestät Befehl entsprechend bitte ich zu demwieder angeschlossenen Expose des k. u. k. Herrn Ministersdes Äußern vom 12. v. M. nachstehendes alleruntertänigstvortragen zu dürfen:Seit Abfassung des Exposes sind die Franzosen und Engländerim Westen zu der angekündigten großen Durchbruchsoffensiveunter rücksichtslosem Einsatz starker Menschenmassenund ungeheuren Kriegsmaterials auf breiter Frontübergegangen.Die deutsche Armee hat den gewaltigen Anprallder an Zahl weit überlegenen Feinde aufgehalten: andem Heldenmut der Mannschaften und dem stählernen204
Fried ensversucheWillen der Führer werden, wie wir fest zu hoffen berechtigtsind, auch weitere Angriffe zerschellen.Mit der gleichen Zuversicht dürfen wir nach allen bisherigenErfahrungen des Krieges die Lage der verbündetenArmee am Isonzo beurteilen.Die Ostfront ist durch die politischen Umwälzungen inRußland erheblich entlastet, mit einer Offensive der Russenim größeren Stil ist nicht mehr zu rechnen. Eine zunehmendeErleichterung der dortigen Lage würde weitere Kräfte freimachen,selbst wenn eine starke Absperrung der russischenGrenze gegen ein lokales Übergreifen der revolutionärenBewegung sich als notwendig erweisen sollte. Mit diesemZuschuß würden sich die Kräfteverhältnisse im Westen zuunseren Gunsten verschieben. Die Entlastung im Ostenwürde ferner der österreichisch-ungarischen Monarchie weiteresMenschenmaterial zur erfolgreichen Durchführung derKämpfe an der italienischen Front bis zur Beendigung desKrieges verschaffen.Rohmaterial für Munitionserzeugung ist in beiden verbündetenMonarchien hinreichend vorhanden.Unsere Verpflegungslageist eine derartige, daß wir bei äußerster Sparsamkeitbis zur neuen Ernte auskommen. Das gleichedürfte für Österreich-Ungarn gelten, zumal wenn der ihmzustehende Anteil der rumänischen Zufuhren in Betrachtgezogen wird.Den Waffenerfolgen der Armee reihen sich die Taten unsererMarine an. Als Admiral von Holtzendorff Seiner ApostolischenMajestät über den geplanten Unterseebootkrieg Vortraghalten durfte, waren hier vorher die Aussichten für denErfolg dieser einschneidenden Maßnahme eingehend geprüftund die zu erwartenden militärischen Vorteile genaugegen das politische Risiko abgewogen worden. Wir hattenuns nicht der Erkenntnis verschlossen, daß die Verhängungder Seesperre um England und Frankreich den Eintritt derVereinigten Staaten von Amerika in den Krieg und in205
Friedensversuchespäterer Folge ein Abbröckeln anderer neutraler Staatenherbeiführen würde. Wir waren uns dessen völlig bewußt,daß unsere Gegner hierdurch eine moralische und wirtschaftlicheStärkung erfuhren, waren und sind aber der Überzeugung,daß dieser Nachteil durch die Vorteile des U-Bootkriegesweit übertroffen wird. Das Schwergewicht des Weltkampfes,der im Osten seinen Anfang nahm, hat sich im Laufeder Zeit in zunehmendem Maße nach dem Westen verschoben,wo englische Zähigkeit und Ausdauer den Widerstand unsererFeinde mit wechselnden Mitteln immer aufs neue belebenund stählen. Ein günstiger Enderfolg ließ sich für uns nurdurch entschlossenen Angriff auf den Brennpunkt der gegnerischenKräfte, d. h. England, ermöglichen.Die durch den U-Bootkrieg bisher erzielten Erfolge undWirkungen gehen weit über die seinerzeitigen Berechnungenund Erwartungen hinaus. Die jüngsten Auslassungen leitenderMänner in England über die wachsenden Ernährungsschwierigkeitenund die steigende Unterbindung der Zufuhrensowie die entsprechenden Betrachtungen der Presse enthaltengewiß einen dringenden Appell an das Volk zu äußersterKraftanstrengimg, tragen aber zugleich das Gepräge ernsterSorge und zeugen von der Not, indie England geraten ist.Staatssekretär Helfferich hat in der Sitzung des Hauptausschussesdes Reichstages vom 28. v. M. eine eingehendeDarlegung über die Wirkungen des U-Bootkrieges auf Englandgegeben. Das Expose ist in der »Norddeutschen AllgemeinenZeitung' vom 1. d. M. veröffentlicht worden. Ichdarf mich dieserhalb alleruntertänigst auf die Anlage beziehen*.Nach den neuesten Nachrichten hat der LebensmitteldiktatorLord Devonport sich gezwungen gesehen, aus Rücksichtauf die unzureichende Getreidezufuhr eine neue Verteilungdes Frachtraumes anzuregen. Der Frachtraum ist* Das Expose Hetfferichs ist im Anhang reproduziert.206
Friedensversucheaber schon so eingeengt, daß für Getreide ein Mehr nurnoch zur Verfügung gestellt werden kann, wenn man sichentschließen will, an anderer Stelle die Kriegführung einschneidendzu schädigen.Abgesehen vom Aufgeben überseeischerExpeditionen, könnten Schiffe durch Beschneidungderjenigen Einfuhr, die viel Raum beansprucht, freigemachtwerden. England braucht indes nicht nur für Lebensmittelsehr große Mengen von Transportraum, sondern auch für dieZufuhr von Erz, um die Kriegsindustrie aufrechtzuerhalten,und von Grubenholz, um die Kohlenförderung auf der notwendigenHöhe zu halten. Weder die in England gefördertenErze noch das im Lande verfügbare Holz machen irgendwelcheEinschränkungen im Zuteilen von Schiffsraum aufdiesen beiden Gebieten möglich. Schon jetzt, nach dreiMonaten des Unterseebootkrieges, steht fest, daß die Lücken,die der U-Bootkrieg in den verfügbaren Frachtraum reißt,die Lebenshaltung der Bevölkerung auf ein unerträglichesMaß herabdrücken und die Kriegsindustrie so lähmen werden,daß die Hoffnung, Deutschland durch Übermacht an Munitionund Geschützen zu schlagen, aufgegeben werden muß. DerMangel an Transportraum dürfte ferner verhindern, daß eineeventuelle Mehrleistung Amerikas auf dem Gebiete der Kriegsindustrieeine Minderleistung Englands ausgleicht. DasTempo, in dem der U-Bootkrieg Schiffsraum vernichtet,schließt die Möglichkeit aus, daß Schiffsneubauten den erforderlichenFrachtraum schaffen könnten. Ein MonatU-Bootkrieg vernichtet mehr, als die Werften Englands imganzen letzten Jahre erzeugt haben.Selbst die tausend lautangekündigten amerikanischen Holzschiffe würden nur dieVerluste von vier Monaten decken können, wenn sie schonda wären. Sie werden aber zu spät kommen. In Englandhaben Sachkenner schon öffentlich ausgesprochen, daß esnur zwei Möglichkeiten gäbe, der vernichtenden Wirkungdes U-Bootkrieges zu entgehen: entweder schneller Schiffebauen, als die Deutschen sie vernichten, oder schneller U-Boote107
Friedensversuchevernichten, als die Deutschen solche bauen.Ersteres hat sichbereits als unmöglich erwiesen. Die U-Bootverluste aberbleiben weit hinter dem Neubau zurück.England muß demnach auf progressivsteigende Verlustean Schiffsraum rechnen.In zunehmendem Maße werden sich in England die Wirkungendes U-Bootkrieges auch auf die Volksernährung, aufalle individuellen und staatlichen Energien bemerkbarmachen.Ich sehe daher dem Endergebnis des U-Bootkrieges mitvoller Zuversicht entgegen.Geheimen, aber sicheren Nachrichten zufolge hat MinisterpräsidentRibot kürzlich zum italienischen Botschafter inParis geäußert, Frankreich ginge der Erschöpfung entgegen.Diese Worte sind vor Beginn der jüngsten französisch-englischenOffensive gefallen. Seit jener Zeit hat FrankreichBlutopfer gebracht, die sich bei Beibehaltung der jetzigenKampfintensität bis zur Einstellung der Offensive ins Ungeheuerlichesteigernwerden.Die französische Nation weist gewiß in diesem Kriegeaußerordentliche Leistungen auf, der Staatskörper vermagindes die enorme Belastung nicht ins Ungemessene zu tragen.Ein Rückschlag auf die mit allen anreizenden Mitteln künstlichhochgehaltene Stimmung in Frankreich scheint unausbleiblich.Was unsere eigene innere Lage anbelangt, so verkenne ichnicht die Schwierigkeiten, welche die unausbleibliche Folgedes schweren Kampfes und der Abgeschlossenheit vom Weltmeerbilden. Ich habe aber das feste Vertrauen, daß es unsgelingen wird, diese Schwierigkeiten ohne dauernde Gefährdungder Volkskraft und des allgemeinen Wohls, ohnegrößere Krise und ohne Bedrohung des staatlichen Gefügeszu überwinden.Obwohl wir hiernach das Recht haben, die Gesamtlageals günstig zu beurteilen, befinde ich mich doch in voller208
FriedensversucheÜbereinstimmung mit dem Grafen Czernin bei Verfolgung desZieles, einen ehrenvollen, den Interessen des Reiches undunserer Bundesgenossen gerechtvverdenden Frieden so baldwie möglich herbeizuführen. Ich teile auch die Ansicht desHerrn Ministers, daß das wichtige Moment der SchwächungRußlands ausgenutzt und daß eine erneute Friedensaktionzu einem Zeitpunkt eingeleitet werden muß, an dem diepolitische und militärische Initiative noch in unseren Händenruht. Graf Czernin hat den Zeitpunkt hierfür in zwei bisdrei Monaten ins Auge gefaßt, an dem die feindlichen Offensivenihr Ende gefunden haben. In der Tat würde gegenwärtigbei den weitgespannten Erwartungen der Franzosenund der Engländer auf einen entscheidenden Erfolg ihrerOffensive und den noch nicht geschwundenen Hoffnungender Entente auf ein Wiedererwachen der russischen Aktivitäteine zu stark unterstrichene Friedensbereitschaft nicht nurzur Erfolglosigkeit verdammt sein,sondern auch durch denin ihr ruhenden Schein der hoffnungslosen Erschöpfung derMittelmächte die Kräfte der Gegner neu beleben. Augenblicklichwäre ein allgemeiner Friede nur durch Unterwerfungunter den Willen unserer Feinde zu erkaufen. Einsolcher Friede aber würde vom Volke nicht ertragen werdenund verhängnisvolle Gefahren für die Monarchie heraufbeschwören.Ruhe, Entschlossenheit und eine auch nachaußen hin dokumentierte Zuversicht scheinen mir deshalbmehr denn je geboten. Die Entwicklung der Ereignisse inRußland hat sich bisher zu unseren Gunsten vollzogen.DerKampf der Parteien wird vom Gebiete politischer, wirtschaftlicherund sozialer Forderungen in zunehmendem Maßeauf das engumschriebene Feld der Kriegs- und Friedensfragengedrängt, und es gewinnt immer mehr den Anschein, alsob nur diejenige Partei sich dauernd wird an der Machthalten können, die den Weg zum Frieden mit den Mittelmächtenbeschreitet. Unsere ernste Aufgabe ist es, den Entwicklungs-und Zersetzungsprozeß in Rußland aufmerksam14 Czernin <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 20Q
Friedensversuchezu verfolgen und zu begünstigen und kommende russischeSondierungsversuche zwar ohne zur Schau getragenes Empressement,aber doch sachlich so zu behandeln, daß sie zutatsächlichen Friedensverhandlungen führen. Die Wahrscheinlichkeitspricht dafür, daß Rußland den Schein desVerrates an seinen Verbündeten wird vermeiden und einenModus suchen wollen, der faktisch einen Friedenszustandzwischen Rußland und den Mittelmächten herbeiführt,äußerlich aber die etwaige Vereinbarung zwischen beidenParteien als das Präludium zum allgemeinen Frieden darstellt.Wie wir uns im Juli 1914 in rückhaltloser Bündnistreuean die Seite Österreich-Ungarns gestellt haben, so werdensich auch am Ende des <strong>Weltkriege</strong>s die Grundlagen füreinen Frieden finden, der beiden eng verbündeten Monarchiendie Gewähr für eine verheißungsvolle Zukunft bringt."Dieser optimistischen Antwort Bethmanns lag offenbarnicht nur das Motiv zugrunde, uns etwas mehr Vertrauenin die Zukunft einzuflößen, sondern das richtige Gefühleiner in der Luft hegenden günstigeren Konstellation — daBerlin natürlich ähnliche Berichte aus den feindlichen Ländernerhalten hatte wie wir.Um diese Zeit erhielt ich einen Brief Tiszas, in welchemnachfolgender Passus vorkam:„Die verschiedenen, aus dem feindlichen Auslande kommendenNachrichten lassen keinen Zweifel darüber, daß derKrieg seinem Ende entgegengeht.Jetzt heißt es vor allem,gute Nerven behalten und die Partie mit kaltem Blute zuEnde spielen. Nur jetzt keine Zeichen der Schwäche. UnsereFeinde sind nicht aus allgemeiner Menschenliebe friedfertigergeworden, sondern weil sie einsehen, daß wir nicht zu vernichtensind.. Ich bitte Dich, nicht weiter im Sinne Deines Berichtesvom 12. April zu sprechen. Eine pessimistische Auffassungdes Leiters unserer äußeren Politik müßte jetzt alles verderben.2TOIch weiß, daß Du vorsichtig bist, aber ich bitte Dich,
Friedensversuchemache Deinen Einfluß geltend, damit auch Seine Majestätund dessen Umgebung nach außen Zuversicht zur Schautrage. Nochmals: So gut es steht, man wird nicht mehrmit uns sprechen wollen, wenn man nicht mehr an unsereWiderstandskraft glaubt — und nicht daran glaubt, daßunser Bündnis auf festen Füßen steht."Es war klar, daß die richtige Taktik nur darin bestehenkonnte, einerseits die allergrößten Anstrengungen an derFront und im Hinterlande zu machen, um die Situationnoch einige Zeit zu halten — andererseits den Feinden gegenüberden Beweis zu erbringen, daß wir trotz der günstigenKonstellation zu einem Frieden ohne Eroberungen bereitseien. Für die letztere Aktion den Hebel bei den deutschenMilitärs anzusetzen, schien aussichtslos. Ebenso erwarteteich mir wenig von einer neuerlichen Intervention in derWilhelmstraße und versuchte daher, mich direkt mit demDeutschen Reichstage in Verbindung zu setzen.Einer meiner politischen Freunde, welcher zahlreiche undgute Konnexionen im Deutschen Reichstag hatte, setzte sichmit verschiedenen Führern in Berlin in Verbindung und entwickeltedenselben die Situation der Monarchie. Es warselbstverständlich, daß dieser Herr nicht im Auftrage desMinisteriums sprechen konnte, sondern seine eigenen Eindrückeund Ansichten vorbringen mußte. Eine vorsichtigeHaltung war geboten, weil Indiskretionen unabsehbare Folgenhaben konnten. Sowie die Entente den Eindruck erhaltenhätte, daß wir nicht aus Friedensliebe, sondern weil wirnicht mehr können, den Krieg zu beendigen gedenken, wärealle Mühe umsonst gewesen. Darin hatte Tisza vollständigrecht.Es war also unbedingt notwendig, daß der mit dieserheiklen Mission betraute Herr in einer Art und Weise auftrat,die nach außen der Entente gegenüber geheim blieb, keineSchwäche zeigte und Zuversicht mit vernünftigen Kriegszielenverband — und welche es dem Ministerium möglichmachte, ihn eventuell zu desavouieren.«4* 211
;FriedensversucheMein Freund hat sich dieser Aufgabe mit ebenso großerHingebung als Geschicklichkeit unterzogen und den BerlinerHerren, insbesondere Erzberger* und Südekum, in Kürzefolgendes mitgeteilt: Soviel er beurteilen könne, seien wiran einem entscheidenden Wendepunkte angelangt. Dienächsten Wochen würden entscheiden, ob der Friede werdeoder der Krieg ä outrance weitergehe. Frankreich sei müde,wolle kein Eingreifen Amerikas, wenn es nicht sein müsse.Zwinge die Haltung Deutschlands die Entente zur Fortsetzungdes Krieges, so sei die Lage sehr ernst, Österreich-Ungarn könne nicht mehr, die Türkei auch nicht — Deutschlandkönne den Krieg nicht allein zu einem guten Endeführen. Die Stellung Österreich-Ungarns sei der ganzen Weltklar. Österreich-Ungarn sei bereit, einen Frieden ohneAnnexionen und Kriegsentschädigungen zu schließen undsich mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, daß die Wiederholungeines Krieges verhindert werde. (Österreich-Ungarnstehe auf dem Standpunkte, daß eine allseitige gleichmäßige,aber sehr weitgehende Abrüstung zu Wasser und zuLande das einzige Mittel biete, um den finanziellen WiederaufbauEuropas nach dem Kriege zu ermöglichen.) Deutschlandmüsse ebenso klar wie Österreich-Ungarn seine Stellungöffentlichbekanntgeben und erklären:i. Keine Annexionen, keine Kriegsentschädigung;2. insbesondere bedingungslose völlige Freigabe Belgiens(politisch und wirtschaftlich)3. alle von Deutschland und Österreich-Ungarn besetzter*Gebiete werden geräumt, sobald beide Staaten ihr Territoriumwieder zurückerhalten haben (inklusive der deutschenKolonien);* Zu dieser Zeit war mir die Tatsache, daß mein geheimer Bericht an den Kaiser HerrnErzberger übergeben und von diesem nicht geheimgehalten worden ist, noch nicht bekannt,(Seither öffentlich bekanntgeworden durch die Enthüllungen des Grafen Wedel.)212
Friedensversuche4. auch Deutschland will gleich Österreich-Ungarn an derallgemeinen Abrüstung mitarbeiten und die Garantie schaffen,daß kein zweiter Krieg mehr möglich sei.Eine solche Erklärung müsse gemeinsam von der deutschenRegierung und dem Reichstage öffentlich abgegebenwerden.Die bekannte Friedensresolution vom 19. Juli 1917 wardas Resultat dieser Demarche. Vorerst fiel ihr der ReichskanzlerBethmann zum Opfer. Die Oberste Heeresleitung,welche ihn verfolgte und schon seit längerer Zeit alle Anstrengungenmachte, um ihn zu entfernen, erklärte eine solcheResolution als unannehmbar. Als Bethmann gegangen undMichaelis ernannt war, fand sie sich damit ab.So erfreulich diese Resolution an und für sich war, so littsie doch an einem Geburtsfehler. Es blieb natürlich nirgendsein Geheimnis, daß alles, was alldeutsch oder ihm verwandtwar, so vor allem die deutsche Generalität, mit dem Beschlüssenicht übereinstimmte und die Resolution nicht alseine Enunziation ganz Deutschlands gelten konnte. Gewißstand die erdrückende Majorität Deutschlands, nach Köpfengerechnet, hinter dieser Resolution, aber die führendenMänner mit einem maßgebenden Anhang bekämpften sie.Der ,,Hungerfriede", der „Verzichtfriede", der „Scheidemann-Friede" waren die in den Blättern für die Resolution geprägtenAusdrücke, welche die große Unzufriedenheit mitihr bewiesen. Auch die deutsche Regierung nahm keinenklaren Standpunkt ein. Am 19. Juli hielt der ReichskanzlerMichaelis im Reichstage eine Rede, worin er dieResolutionguthieß, jedoch mit dem Nachsatze: ,,so wie ich sie auffasse",ein Nachsatz, mit dem er alle Vordersätze erschlug.<strong>Im</strong> August schrieb mir der Reichskanzler einen Brief, inwelchem er seine durchaus optimistische Beurteilung derLage begründete und die deutschen Anschauungen überBelgien präzisierte. Der obenerwähnte Satz der Gutheißungder Resolution, „so wie ich sie auffasse", fand in diesem213
FriedensversucheSchreiben eine Erklärung, wenigstens in bezug auf die belgischeFrage, „da Deutschland sich das Recht vorbehaltenwolle, einen weitgehenden militärischen und wirtschaftlichenEinfluß auf Belgien auszuüben".Sein Schreiben lautete:Lieber Graf Czernin!„Berlin, den 17. August 1917.Unserer Absprache gemäß gestatte ich mir, Ihnen in nachstehendemmeine Auffassung über unsere Besprechungenvom 14. und 15. d. M. kurz darzulegen und würde es mitbesonderem Dank erkennen, wenn Eure Exzellenz die Geneigtheithaben wollten, mir Ihren Standpunkt zu meinenAusführungen mitzuteilen.Die innere wirtschaftliche und politische Lage Deutschlandsberechtigt uns zu dem festen Vertrauen, daß Deutschlandfür sich allein auch ein viertes Kriegsjähr würde aushaltenkönnen. Die Brotgetreideernte hat sich besser entwickelt,als wir vor sechs Wochen angenommen haben, undwird günstiger als die vorjährige ausfallen. Die Kartoffelernteverspricht einen erheblich höheren Ertrag alsdie von1916/17. Die Futterernte schätzen wir erheblich geringerals die im vorigen Jahre ein; bei Einhaltung eines einheitlichen,wohldurchdachten Wirtschaftsplanes für Deutschland selbstund die besetzten Gebiete, einschließlich Rumäniens, werdenwir aber in der Lage sein, auch mit den Futtermitteln durchzuhalten,wie dies selbst in dem viel trockneren Jahre 1915möglich gewesen ist.Die politische Lage ist ohne Zweifel eine ernste. Die Bevölkerungleidet unter dem Kriege, und die Friedenssehnsuchtistgroß; eine wirkliche allgemeine krankhafte Kriegsmüdigkeitist indes nicht vorhanden, und die Arbeitsleistungenwerden bei geregelter Ernährung gegen das frühere Jahrnicht zurückstehen.Ändern könnte sich dieses Wirtschafts- und politische Bild214
Fried ensversuchenur dadurch, daß die Verhältnisse bei unseren Bundesgenossenoder unter dem Druck der Entente bei den Neutralensich wesentlich schlechter gestalten.Eine bedenklicheVerschiebung zu unseren Ungunsten würde eintreten, fallswider Erwarten und Erhoffen unsere Bundesgenossen oder dieneutralen Staaten in solchen Mangel gerieten, daß sie glaubten,auch auf uns zurückgreifen zu sollen. Bis zu einem gewissenGrade geschieht dies schon heute; eine erhebliche Zunahmedieser Ansprüche müßte unsere wirtschaftliche Lage scharf inMitleidenschaft ziehen und unter Umständen sogar gefährden.Daß die Situation im vierten Kriegsjahre im allgemeinen alseine schwerere wird angesprochen werden müssen als die desdritten, ist ohne weiteres zuzugeben ; unser ernstes Bestrebenwird <strong>info</strong>lgedessen auch fernerhin darauf gerichtet sein, denFrieden tunlichst bald herbeizuführen.Unser aufrichtiger Friedenswunsch darf uns indessen nichtdazu verleiten, mit einem neuen Friedensangebot hervorzutreten.Es wäre dies meines Erachtens ein schwerer taktischerFehler. Unsere Friedensdemarche vom Dezembervorigen Jahres hat bei den neutralen Staaten ein sympathischesEcho gefunden, sie ist aber von unseren Gegnern mitgesteigerten Forderungen beantwortet worden. Ein erneutergleichartiger Schritt würde uns als Schwäche ausgelegt werdenund den Krieg verlängern; die Friedensanregung muß demnachjetzt von den Feinden ausgehen.^Das Leitmotiv meiner auswärtigen Politik wird stets diesorgsame Pflege unseres durch dieKriegsstürme erhärtetenBündnisses mit Österreich- Ungarn, die vertrauensvolle, freundschaftlicheund loyale Zusammenarbeit mit den leitendenStaatsmännern der verbündeten Monarchie bilden. Wirdder Bündnisgedanke — und in diesem Bestreben weiß ichmich eins mit Euer Exzellenz — auch weiterhin so hochgehaltenwie bisher, so würde es selbst unseren Gegnernausgeschlossen erscheinen,daß einer der Bundesgenossen inSonderverhandlungen, die ihm etwa angetragen werden,215
Friedensversucheeintritt, ohne von vornherein zu erklären, die Besprechungenwürden nur unter dem Gesichtspunkte für möglich gehalten,daß sie einen allgemeinen Frieden zum Ziele haben. "Wird diesklar zum Ausdruck gebracht, so dürfte kein Bedenken dagegenbestehen, daß einzelne der Verbündeten einer etwaigen Anregungeines unserer Feinde folgen und in Besprechungenüber die Anbahnung des Friedens mit ihm eingehen.Zur Zeit lassen sich noch keine bestimmten Richtlinienfür solche Besprechungen festlegen. Euere Exzellenz hattendie Güte gehabt, die Frage an mich zu richten, ob die »Wiederherstellungdes Status quo' eine geeignete Grundlage für dieAufnahme von Verhandlungen bilden könne. Ich darf meinenStandpunkt zu dieser Frage wie folgt präzisieren: Wie ichbereits im Reichstag zum Ausdruck gebracht habe, erstrebtDeutschland keine gewaltsame Verschiebung der Machtverhältnissenach dem Kriege und ist zu Verhandlungenbereit, soweit von dem Feinde nicht die Herausgabe vondeutschem Reichsgebiet gefordert wird; bei einer in dieserRichtung sich bewegenden Auffassung der , Wiederherstellungdes Status quo' könnte diese Formel durchaus die Grundlagefür Verhandlungen bilden. Hierdurch würde nicht die unserwünschte Möglichkeit ausgeschlossen, auch bei Einhaltungder jetzigen Reichsgrenzen bisher feindliche Wirtschaftsgebietedurch Verhandlungen in nahen wirtschaftlichen und— es würde sich hierbei um Kurland, Litauen und Polenmilitärischen Zusammenhang zu Deutschland zu bringenhandeln — ,dadurch Deutschlands Grenzen zu sichern undseine Lebensbedingungen auf dem Kontinent und Überseezu gewährleisten.Deutschland ist bereit, die besetzten französischen Gebietezu räumen, muß es sich aber vorbehalten, durch die Friedensverhandlungendas Gebiet von Longwy undBriey wirtschaftlich für sich nutzbar zu machen,wenn auch nicht durch direkte Einverleibung, so doch durchrechtliche Sicherung der Nutzung. Nennenswerte Gebiete216
Friedensversuchevon Elsaß-Lothringen an Frankreich abzutreten, sind wirnicht inder Lage.Ich möchte für die Verhandlungen freie Bahn dafür behalten,daß Belgien mit Deutschland militärischund wirtschaftlich verbunden wird. Die von miraus einer Aufzeichnung über die Kreuznacher Verhandlungenvorgelesenen Bedingungen — militärische Kontrolle Belgiensbis zum Abschluß eines Schutz- und Trutzbündnisses mitDeutschland; Erwerb (oder langfristigePachtung) von Lüttichund der flandrischen Küste — sind die Maximalforderungender Obersten Heeresleitung und derMarine. Die Oberste Heeresleitung ist sich mit mir darüberklar, daß diese Bedingungen oder ihnen wesentlich angenähertenur zu erreichen sind, wenn England derFriede aufgezwungen werden kann. Aber wir sindder Meinung, daß ein weitgehendes Maß von wirtschaftlichemund militärischem Einfluß auf Belgien im Wege der Verhandlungenerreicht werden muß und vielleicht auch nichtgegen zu starken Widerstand erreicht werden kann, weilBelgien durch wirtschaftliche Notwendigkeiten zur Einsichtdaß in seinem Anschluß an Deutschland diekommen wird,beste Gewähr für eine verheißungsvolle Zukunft liegt.W T as Polen betrifft, so habe ich davon Kenntnis genommen,daß die vertrauliche Anregung Euerer Exzellenz,auf Galizien zu verzichten und das Land dem neuen polnischenReich zuzuschlagen, dadurch hinfällig gewordenist, daß ich die Abtretung elsaß-lothringischerLandesteile an Frankreich, die gewissermaßenals Gegenopfer gedacht war, als ausgeschlossenbezeichnen mußte. Die Entwicklung Polens zum selbständigenReich muß sich im Rahmen der Proklamation vom5. November 1916 vollziehen. Ob diese Entwicklung sich zueinem wirklichen Vorteil für Deutschland gestalten wird odersich zu einer großen Gefahr für die Zukunft auswachsenkann, wofür bereits mehrfache Anzeichen vorliegen und was217
Friedensversuchebesonders für den Fall zu befürchten ist, daß uns die österreichisch-ungarischeRegierung nicht schon alsbald, währenddes Kneges, ihre volle Uninteressiertheit an Polen aussprechenund uns freie Hand in der Verwaltung ganz Polenslassen kann, darf der weiteren Prüfung vorbehalten bleiben.Diese Prüfung würde sich auch darauf zu erstrecken haben,ob bei der Gefahr, die ein nur widerwillig angeschlossenesPolen für Deutschland und auch für das Verhältnis zwischenDeutschland und Österreich- Ungarn bieten würde, es politischnicht zweckmäßiger wäre, daß Deutschland Polenunter Zurückhaltung der Grenzgebiete, die alsdann zumZwecke des militärischen Grenzschutzes erforderlich erscheinen,seinem vollen Selbstbestimmungsrecht, auch mitMöglichkeit des Anschlusses an Rußland, überläßt.Die Frage des Anschlusses von Rumänien wird nach Maßgabeder Kreuznacher Abreden vom 18. Mai d. J. weiterzubehandelnund im Zusammenhang mit den Deutschlandinteressierenden Fragen hinsichtlich Kurlands, Litauens undPolens zu lösen sein.Es war mir eine besondere Freude, Sie, lieber Graf Czernin,hier in Berlin begrüßen und mich mit Ihnen über die verschiedenenFragen, die uns zur Zeit beschäftigen, mit freundschaftlicherOffenheit unterhalten haben zu dürfen. Ichhoffe, daß auch in der Folgezeit ein dauernder direkter Gedankenaustauschuns die Möglichkeit bieten wird, auftauchendeFragen zu klären und sie im vollen Einvernehmenzu betreiben.Mit dem Ausdruck meiner besonderen Wertschätzungverbleibe ich Ihr ganz ergebenerMichaelis."Ich antwortete dem Reichskanzler, daß ich den an undfür sich selbstverständlichen Standpunkt, völlige Offenheitzu bewahren, begrüße, betonte jedoch, seinen Optimismusnicht teilen zu können. Ich entwickelte, daß die zunehmendeKriegsmüdigkeit, sowohl in Deutschland wie bei uns, es218
Fri edensversuchenotwendig machte, rechtzeitig, d. h. vor Eintritt revolutionärerErscheinungen, zu einem Frieden zu gelangen, denn beginnendeUnruhen würden jeden Friedensversuch verderben. Derdeutsche Standpunkt in der belgischen Frage scheine mirein völlig irrtümlicher, denn niemals würde sich die Ententeund Belgien den entwickelten Bedingungen fügen, ich könneihm daher nicht verschweigen, daß sein Standpunktein schweres Friedenshindernis sei ; er sei aber auchin direktem Widerspruch mit dem Willen des Reichstagesund mir auch deshalb nicht verständlich.Ich -besprach sodann die Notwendigkeit, über das Minimumder Kriegsziele endlich ins klare zu kommen, wobei auchdie Frage, ob und wie wir den freiwilligen friedlichenAnschluß Polens und Rumäniens an die Mittelmächte erreichenwollten, eine wichtige Rolle spielte.Ich betonte schließlich nochmals, daß ich auf dem Standpunktedes Deutschen Reichstages stände, einen Friedenohne Annexionen und Entschädigungen zu verlangen, undes für ganz ausgeschlossen hielte, daß die deutsche Regierungden einschlägigen Beschluß des Reichstages werde ignorierenkönnen oder wollen. Nicht darum handle es sich, ob wirweiterkämpfen wollten, sondern ob wir es könnten, undes sei meine Pflicht, ihn rechtzeitig aufmerksam zu machen,daß wir zu einem Ende des Krieges kommen müßten.Dr. Michaelis stand den Alldeutschen näher als sein Amtsvorgänger.Der Grad, in welchem die Alldeutschen die Situation verkannten,war direkt verblüffend. Ich war bei ihnen dermaßenverhaßt, daß sie mich mieden und ich wenig Gelegenheithatte, mit ihnen zu verhandeln. Zu bekehren warensie übrigens nicht. Ich entsinne mich auf einen einzigenFall, in welchem ein Vertreter dieser Presse mich in Wienaufsuchte, um mir die Bedingungen zu entwickeln, unterwelchen seine Gruppe Frieden zu schließen bereit sei: AnnexionBelgiens, eines Teiles von Ostfrankreich (Longwy219
Friedensversucheund Briey), Kurlands und Litauens, Auslieferung der englischenFlotte an Deutschland und ich weiß nicht mehr wieviele Milliarden Kriegsentschädigung usw. Ich empfing denHerrn in Gegenwart des Gesandten von Wiesner, und wirhatten beide den Eindruck, daß in dem vorliegenden Fallenur der Arzt helfen könne.Zwischen den Ideen des Reichskanzlers Michaelis und denunseren war eine Kluft. Sie war unüberbrückbar. Balddarauf schied eraus dem Amte, um dem staatsmännischenGrafen Hertling Platz zu machen.Zu ungefähr der gleichen Zeit spielten sich nun aber hinterden Kulissen sehr weittragende Ereignisse ab, welche denGang der Dinge entscheidend beeinflußt haben dürften.Es fielen schwere Indiskretionen und Einmischungen vor,welche von Personen ausgingen, die, ohne in verantwortlicherStellung zu sein, Einblick in die diplomatischen Vorgängeerhalten hatten. Es hat keinen Zweck, hier Namen zu nennen,um so weniger, als selbst den verantwortlichen Leitern derPolitik die näheren Details dieser Vorgänge erst viel späterund auch dann vorerst in unvollständiger Form zur Kenntniskamen — also in einem Zeitpunkte, in welchem die pazifistischeTendenz der Entente bereits wesentlich abzuflauenbegann*.Es war damals unmöglich, in den Irrgarten dieser sichkreuzenden und widersprechenden Tatsachen volles Lichtzu bringen. Faktum ist, daß im Frühjahr oder Frühsommer1917 bei maßgebenden Faktoren in den Ländern der Bundesgenossenund der Entente der Eindruck erweckt wurde, daßder Bestand des Vierbundes erschüttert sei. In dem Augenblicke,in welchem die denkbar größte Betonung der Geschlossenheitunseres Bundesverhältnisses notwendiger alsjemals gewesen wäre, wurde der entgegengesetzte Eindruck* Die vom Grafen Wedel und Helfferich gegen Erzberger gemachten Enthüllungen bildet?nur ein Glied dieser Kette, Erzberger ging hierbei vollkommen bona fide vor.220
Friedensversuchehervorgerufen, und selbstverständlich begrüßte diedie ersten Anzeichen der Zersetzung im Vierbunde.EntenteIch weiß nicht, ob es jemals geboten sein wird, eine völligeKlarheit in alle die Ereignisse der damaligen Zeit zu bringen.Heute ist es nicht der Fall. Zur Erklärung der weiteren Entwicklunggenügt es, nachstehendes festzustellen. Folgendesspielte sich ab: <strong>Im</strong> Frühjahr 1917 knüpften sich Fäden mitParis und London an. Die ersten Gespräche erweckten denEindruck, daß die Westmächte bereit seien, uns als Brückezu Deutschland und zu einem allgemeinenFrieden zu benützen.In einem etwas späteren Stadium drehte sich derWind, und die Entente strebte einem Separatfrieden mituns zu.Ich habe verschiedene wichtige einschlägige Details erstspäter erfahren, teilweise bei meiner Demission im Frühjahr1918, teilweise sogar erst mit dem Niederbruche im Winter1919. Es hat nicht an Stimmen gefehlt, welche mir die Schuldan einer auch von der Öffentlichkeit vermuteten Doppelpolitikgegeben und mich beschuldigt haben, anders in Berlinals in Pajis gesprochen zu haben. Diese Beschuldigungengingen von persönlichen Feinden aus, welche bewußt verleumdeten,und wurden von anderen wiederholt,die nichtswußten. Tatsache ist, daß ich, als ich von den Vorgängengleichzeitig in den Besitz von Dokumentenerfuhr,gelangte, welche beweisen, daß ich von diesen Vorgängennicht nur nichts gewußt hatte, sonderngar nichts wissen konnte.Astronomische Apparate zeigen zuweilen Störungen imUniversum an, deren Grund dem Beobachter vorerst nichterklärlich ist. Ähnlich fühlte ich damals an gewissen Anzeichen,ohne es jedoch beweisen zu können, daß sich injenen Welten, welche jenseits des Schützengrabens Hegen,Dinge abspielen mußten, die mir unverständlich waren.Ichkonstatierte die Wirkung, konnte aber die Ursache nichtermitteln. In der dem Frieden geneigteren Stimmung der221
FriedensversucheEntente schwang ein fremder Unterton mit.Man war drübenbesorgt und friedensgeneigter als früher, aber doch wiederzuversichtlich in Anbetracht der angeblichen Lockerungunseres Bundesverhältnisses und der Hoffnung auf den Zerfalldes Vierbundes. Ein Freund von mir, ein Bürger einesneutralen Staates, teilte mir im Sommer mit, er habe aussicherer Quelle vernommen, man rechne am Quai d'Orsayanscheinend damit, daß die Monarchie sich von Deutschlandzu trennen beabsichtige. Das werde selbstverständlichdie gesamte Kriegslage ändern.Bald darauf trafenaus dem neutralen Auslande sehr geheimeNachrichten ein, daß eine bulgarische Gruppe mitder Entente verhandle, hinter dem Rücken und ohne WissenRadoslawows. Sowie bei unseren Bundesgenossen der Verdachtauf eine Sprengung des Bündnisses erwachte, warensie natürlich beflissen, den Ereignissen zuvorzukommen. Wirwaren Radoslawows ebenso sicher wie Talaat Paschas; aberinbeiden Ländern waren noch andere Strömungen an derArbeit.Dieses bei den Freunden erwachende Mißtrauen in urserePläne hatte noch einen weiteren, allerdings bloß technischen,aber nicht zu unterschätzenden Nachteil.Unsere verschiedenenUnterhändler arbeiteten ausgezeichnet, aber es liegtin der Natur der Sa.che,daß ihre Verhandlungen langsamervor sich gingen als beispielsweise von den Ministern desÄußern selbst geführte. Sie mußten je nach dem Gangeder Konversation stets erst neue Instruktionen einholen;sie waren gebundener und daher gezwungen, ein schleppenderesTempo einzuschlagen, als es die verantwortlichenLeiter vermocht hätten. Ich ventilierte daher im Sommer1917 den Gedanken, selbst in die Schweiz zu reisen, wo Verhandlungenstattfanden. Meine Reise aber konnte nichtgeheim bleiben, und je mehr man versucht hätte, sie zuverheimlichen, desto sicherer hätte sie Argwohn erregt dankdes leider erwachten Mißtrauens. Nicht in Berlin. Ich glaube222
Friedensversuchedas Vertrauen der maßgebenden Berliner Faktoren in genügendemMaße besessen zu haben, um dies zu verhindern;ich hätte dem Reichskanzler die Situation entwickelt, und dieshätte genügt. Anders aber lag der Fall in der Türkei undinBulgarien.In Bulgarien drängte eine Partei zu der Entente. WennBulgarien den Eindruck erhielt, unsere Gruppe zerfalle, sohätte es alles versucht, um sich selbst sofort durch einenSeparatfrieden zu retten. Auch in Konstantinopel gab eseine Ententegruppe; Talaat und Enver waren ebenso zuverlässigwie stark. Eine von mir unter den geschildertenVerhältnissen in die Schweiz unternommene Reise konnteaber das Alarmsignal zu einem allgemeinen ,,sauve qui peut"werden. Der bloße Eindruck jedoch, daß die zwei Balkanländer dies machen wollen, was sie von uns vermuteten,hätte in Paris und London natürlich genügt, um jeden Friedensversuchzu zerschlagen.Noch im Laufe des Sommers nahm die Friedensbereitwilligkeitunseres Gegners entschieden ab. Viele kleine Anzeichen,die jedes wenig, die alle zusammen viel bedeuteten,ließen das erkennen. Nun begann im Sommer 1917 auch derU-Bootkrieg seinen ersten Schrecken zu verlieren. Man sahdrüben, daß er nicht das halten werde, was man zuerst befürchtethatte, und natürlich ließ das den Wunsch nach demmilitärischenEndsieg wieder aufleben.Beide erwähnten Momente zusammen dürften beigetragenhaben, um den vom Westen wehenden Friedenswind abflauenzu lassen. Die Zeit über hatten die VerhandlungenArmand-Revertera gespielt. Es ist noch nicht der Moment,über diese Verhandlungen zu sprechen, welche dann imFrühjahr 1918 im Zusammenhange mit dem Briefe desKaisers an den Prinzen Sixtus so viel Aufregung verursachthaben. Nur so viel sei festgestellt, daß Revertera sich beiden Verhandlungen als ebenso korrekter wie geschickterUnterhändler erwies, welcher -genau nach den am Bahplatz223
Friedensversucheerhaltenen Instruktionen vorging. Unsere verschiedenenVersuche, Friedensfäden anzuknüpfen, galten, soweit sieihren Ausgangspunkt am Ballplatz hatten, stetsunserer ganzen Mächtegruppe.Selbstverständlich lag es aber nicht im Interesse derEntente, uns an einer Trennung von Deutschland zu hindern,und als von inoffizieller Seite der Eindruck in Londonund Paris erweckt wurde, daß wir Deutschland preisgeben,zu isolieren.Der furchtbare Irrtum in dem mit dem Separatfriedensabotierten wir selbst damit das Streben nach einem allgemeinenFrieden, denn natürlich wäre es der Ententesympathisch gewesen, Deutschland, welches als „Hauptfeind"galt,kokettierenden Gedanken erange war ein doppelter: Erstensbefreite uns auch diese Eventualität nicht von den Beschlüssendes Londoner Paktes, verdarb jedoch die Atmosphärefür einen allgemeinen Frieden. Wie ich zur Zeit,als diese Dinge sich abspielten, nur vermutete, aber spätererfuhr, hielt Italien an den ihm gemachten Zusagen unterallen Bedingungen fest.<strong>Im</strong> Frühjahr 1917 haben Ribot und Lloyd George in St.Jeande Maurienne mit der italienischen Regierung darüber konferiertund versucht, die Bedingungen im Falle unsererTrennung von Deutschland zu mildern.Italien verweigertedies und bestand auf seinem Schein, d. h. auch bei einemSeparatfriedenhätten wir Triest und Tirol bis zum Brenneran Italien abtreten, also einen unmöglichen Preis zahlenmüssen. Zweitens aber mußte diese separatistische Taktikdie Kraft unserer Gruppe zersetzen und hat siezersetzt.Wenn in einem Gefechte einer davonzulaufen beginnt, soreißt er nur allzu leicht die anderen mit; ich bezweifle nicht,daß die bulgarischen Sonderverhandlungen im Zusammenhangemit obigen Vorgängen standen.Der Effekt dieser gutgemeinten, aber geheimen und dilettantenhaftenEinmischungen war also der, daß wir der224
Friedensversuch eEntente unsere Bereitwilligkeit, uns von unseren Bundesgenossenzu trennen, suggerierten und unsere Position indem Kampfe für einen allgemeinen Frieden dadurch erschütterten,daß wir dennoch einsehen mußten, daß wirauch bei einer Trennung von Deutschland der Verstümmelungnicht entgehen, daß also ein Separatfrieden unmöglich sei,und daß wir dem bisher noch immer geschlossenen Vierbundeinen tödlichen Stoß versetzten.Etwas später, im Sommer, erhielt ich Nachrichten ausEngland über die dortige amtliche Auffassung der Situation,welche wesentlich von den optimistischen Konfidentennachrichtenabstachen und bewiesen, daß der Friedenswunschabgenommen hatte. Es ist selbstverständlich, daß die englischeGedankenrichtung stets die für uns interessantestewar. Der Kriegseintritt Englands hatte die Situation sogefährlich gestaltet, eine Verständigung mit ihm, das heißteine Verständigung zwischen England und Deutschland durchunsere Intervention, hätte den Krieg beendet.Diese Nachrichten nun lauteten dahin, daß England wenigerdenn je in der Lage sei, mit Deutschland zu sprechen, bevornicht die zwei Kardinalpunkte garantiert seien : die AbtretungElsaß-Lothringens und die•Abschaffung des deutschen Militarismus.Das erstere sei ein französisches Postulat, und Englandmüsse und werde Frankreich hierin bis zum äußerstenunterstützen; die zweite Forderung sei im Interesse des zukünftigenWeltfriedens notwendig. Die militärische KraftDeutschlands sei von England immer als sehr groß eingeschätztworden, aber ihre Leistungen in diesem Kriegehätten noch alle Erwartungen übertroffen. Und mit denErfolgen der Militärs sei auch der militärische Geist gewachsen.Die Friedensresolution des Reichstags beweisedennnichts — oder doch wenigstens nicht genügend — ,der Reichstag sei nicht der wahre Exponent des Reichesnach außen; er werde paralysiert durch eine inoffizielle15 Crem in. <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 225
FriedensversucheNebenregierung, die-- Generale, welche viel mehr Machthätten als er.Gewisse Äußerungen des Generals Ludendorffseien — so sagte man bei der Entente — der Beweis, daßDeutschland keinen ehrlichen Verständigungsfrieden wolle.Nebenbei scheine auch die Wilhelmstraße nicht mit der Majoritätdes Reichstags identisch. Der Krieg sei nicht gegendas deutsche Volk, sondern gegen seinen Militarismus gerichtet,aber mit letzerem sei ein Friedensschluß unmöglich.Was die Monarchie anbelangt, so schiene England bereit,mit derselben einen Separatfrieden, allerdings unter Einhaltungder den eigenen Bundesgenossen gegebenen Zusagen,zu schließen. Wir hätten danach an Italien, Serbien undRumänien große Gebietsteile abzutreten. Dafür aber könntenwir mit einer Art Anschluß neu geschaffener Staaten, wiePolen, rechnen.Obwohl diese Nachrichten keinen Zweifel darüber ließen,daß England zur Zeit an keine Annäherung an Deutschlanddenke, so schien doch dem ablehnenden Gedankengangevor allem dieFurcht vor dem preußischen Militarismus zugrundezu Hegen. Ich hatte den Eindruck, daß auch beigünstigerer Weiterentwicklung vielleicht ein Ausgleich undeine Verständigung in den territorialen Fragen, nicht aberin dieser „militärischen" möglich sei. <strong>Im</strong> Gegenteil: Jestärker sich Deutschlands militärische Macht erwies, destomehr wuchs die Furcht der Entente, daß diese Wehrmachtunüberwindlich werden würde, falls sie jetzt nicht gebrochenwerde.Nicht nur die Vorgeschichte und der Ausbruch des Krieges,auch dieKriegszeit selbst war von schweren und störendenMißverständnissen durchzogen.Bei uns hat man lange Zeitüberhaupt nicht verstanden, was England eigentlich mitdiesem Schlagworte des Militarismus meine. Man hat daraufhingewiesen, daß Englands Flotte eifersüchtig die Beherrschungder Meere wahre, daß Frankreich und Rußlandwaffenstrotzend dastünden, daß also Deutschland dabei226
Friedensvers uchekeine andere Rolle spieleStaat seine Wehrmacht so gut und sostark er könne, ausgestalte.als die anderen Staaten, daß jederEngland verstand unter preußischem Militarismus abernicht die Kraft des deutschen Heeres allein. Es verstanddarunter die Kombination eines kriegerischen, auf die Unterdrückungder anderen ausgehenden Geistes, gestützt aufdie beste und stärkste Landmacht der Welt. Das ersterewäre platonisch gewesen ohne das letztere — und die ausgezeichnetedeutsche Armee bedeutete für England das Instrumentherrsch- und eroberungssüchtiger Machthaber.Nach englischer Auffassung war Deutschland genau dieWiederholung Frankreichs unter Bonaparte — wenn manNapoleon durch ein mehrköpfiges Wesen ersetzt, welchesungefähr „Kaiser, Kronprinz, Hindenburg, Ludendorff"hieß — , und ebensowenig wie England jemals mit Napoleonpaktieren wollte, so wollte es nicht mit jener „juristischenPersönlichkeit" verhandeln, welche ihm den Begriff derEroberungssucht und der Gewaltpolitik verkörperte.Mir scheint die Vorstellung, daß ein deutscher Militarismusbestand, gewiß richtig, wenn auch der Kaiser und der Kronprinzdabei die geringste Rolle spielten. Unrichtig scheintmir nur der Glaube, daß dieser Militarismus eine SpezialitätDeutschlands gewesen sei. Die Verhandlungen von Versailleshaben jetzt wohl auch der Allgemeinheit gezeigt, daßes auch noch anderswo als an den Ufern der Spree einenMilitarismus gibt.Das alte Deutschland konnte niemals verstehen, daß imleindlichen Auslande neben einem — sagen wir — moralischnicht gerechtfertigten Neid tatsächlich Furcht und Besorgnisvor Deutschlands Plänen herrschten, und daß die Redenvom „harten" und vom „deutschen" Frieden, von „Siegund Triumph" öl in das Feuer dieser Besorgnisse waren,daß es auch seinerzeit in England und Frankreich Strömungengab, welche zu einem Frieden des Ausgleichesi5*227
,Friedensversuchedrängten, und daß man diesepazifistischen Tendenzen mitsolchen Aussprüchen auf das schwerste schädigte.In das gleiche Gebiet wie diese Redeblüten gehörtenmeiner Ansicht nach auch die Luftangriffe auf England,welche mit größtem Heroismus seitens der deutschen Fliegerunternommen wurden, aber keinen anderen Zweck erreichtenals den, England zu reizen und auch jene zum äußerstenWiderstand aufzustacheln, welche pazifistischer dachten. Ichsagte dies Ludendorff, als er mich im Sommer 1917 amBallplatz besuchte, ohne jedoch den geringsten Eindruckzu erwecken.* *Der Friedensschritt des Papstes und unsere Antwort hatsich in europäischer Öffentlichkeit vollzogen. Wir nahmendie edlen Vorschläge des Heiligen Vaters an. Ich habe demnichts hinzuzufügen.* **<strong>Im</strong> Frühsommer 1917 war die Frage der Sozialistenkonferenzin Stockholm aktuell geworden.Ich lieferte den Vertreternunserer Sozialdemokratie die Pässe aus und hattediesbezüglich Hindernisse zu überwinden.Mein einschlägigerStandpunkt erhellt aus nachfolgendem Briefe an Tisza:... „ ,,,Lieber Freund!(Ohne Datum)Ich höre, Du bist nicht einverstanden mit der ,Entsendung'der Sozialisten nach Stockholm. Erstens ist es keine Entsendung.Die Männer sind aus eigenem Antriebe zu mir gekommenund haben um dieAusreisebewilligung angesucht.Die habe ich ihnen gegeben. Adler, Ellenbogen und Seitzwaren da; Renner extra. Die beiden ersteren sind gescheiteMänner, und ich schätze sie trotz aller Unterschiede, dieuns trennen. Die beiden letzteren kenne ich wenig. Aberalle vier wollen ehrlich den Frieden, und Adler speziell willgar nicht die Vernichtung des Reiches.228
FriedensversucheEntweder siebringen den Frieden, dann wird es sicherlichein .sozialistischer' sein, und der Kaiser wird ihn aus derTasche bezahlen. Das, lieber Freund, weiß ich auch. Aberwenn der Krieg nicht zu beenden ist, so wird der Kaisernoch viel mehr zahlen — verlasse Dich darauf.Oder sie bringen — wie zu erwarten — den Frieden nicht,dann war mein Vorgehen um so richtiger, denn dann habeich ihnen bewiesen, daß nicht die , Unfähigkeit der zünftigenDiplomatie', sondern die Verhältnisse daran schuld sind, daßder Krieg nicht aufhört.Hätte ich ihnen die Ausreise verweigert, so hätten sienoch über mein Grab hinaus täglich ^erklärt, ,sie hätten denFrieden gemacht, wenn man siehinausgelassen hätte'.Hier sind sie auch empört über mich, vor allem im Herrenhause.Es kommt dazu, daß die Menschen sich einbilden,ich hätte die Sozialdemokraten dadurch ,gekauft', daß ichihnen versprochen hätte, den Oktroi zu verhindern, wennsie den Frieden bringen. Ich will den Oktroi nicht, wie Duweißt, aber das hat gar keinen Zusammenhang mit Stockholm,Sozisund Frieden.Ich habe neulich dem österreichischen Ministerrate beigewohntund dort dem Oktroi den Todesstoß gegeben —aber ich fühlte mich dabei wie Daniel in der Löwengrube;besonders N. N. war sehr erzürnt. Der einzige, der meinenStandpunkt völlig zu teilen scheint, ist außer Trnka derMinisterpräsidentClam.Also diese Kombination, daß ihnen wegen ,meiner Liebezu den Sozis' ihr Oktroi entrissen wird, macht sie noch böser— aber wie gesagt, die Kombination ist ganz falsch.Du machst, Heber Freund, einen doppelten Fehler. Erstenswerden wir nach dem Kriege Sozialpolitik machen müssen,ob es dem einzelnen gefällt oder nicht, und ich halte es fürunbedingt wichtig, die Sozialdemokraten dazu heranzuziehen.Die Sozialpolitik istdas Ventil, das wir aufmachen müssen,um den überschüssigen Dampf hinauszulassen — sonst22Q
Friedensversucheexplodiert der Kasten. Zweitens kann keiner von uns Ministernauch nur den ganz falschen Schein auf sich nehmen,den Frieden zu sabotieren.Die Völker vertragen vielleichtdie Kriegsqual noch eine Weile, aber nur dann, wenn siebegreifenund die richtige Überzeugung erhalten, daß es nichtanders geht — daß eine Vis major vorherrscht — daß, mitanderen Worten, der Friede an den Verhältnissen, nicht aberan dem schlechten Willen oder der Dummheit der Ministerscheitert.Der deutschböhmische Abgeordnete K. H. Wolf hat mirvor der Verlesung der Thronrede in der Burg eine Szenedarüber gemacht: ,wir seien verrückt geworden, und in derDelegation werde abgerechnet werden' und andere Liebenswürdigkeitenmehr — und auch er hatte einen ganz falschenKonnex zwischen Aufgeben des Oktrois und Stockholm gezogen.Ganz recht hast Du darin, daß es Deutschland gar nichtsangeht, was wir im Innern machen. Sie haben aber auchnicht die geringste Ingerenz auf den Oktroi versucht. — Wennsie sich vor einem antideutschen Kurs fürchten und dahergewiß innerlich für den Oktroi sind, so haben wir dabeieine gewisse Schuld. Die Berliner fürchten sich nämlichunausgesetzt vor Verrat.Ich besitze im Gebirge ein Segelschiff, welches nach Steuerbord,zieht', das heißt unwillkürlich und bei gerade eingelegtemSteuer drängt es nach rechts ab. Um das zu paralysieren,muß der Steuermann immer etwas nach Backbordsteuern — nur so kann er den geraden Kurs einhalten. Ermuß .dagegen halten'. Ebenso ist das Wiener Staatsschiff.Es drängt fortgesetzt von dem Kurse des Bündnisses ab.Man kann ja auch wenden und den Ententekurs steuern,wenn man glaubt, das durchführen zu können; aber dannmöge man die Courage haben, die Wendung ganz zu machen.Dieses Mit-Verrat-Kokettieren, ohne ihn zu machen, ist dasAllerdümmste ; wir verlieren alles Terrain in Berlin und230
Friedensversuchegewinnen nichts in London oder Paris. Aber warum schreibeich das, Du bist ja ganz meiner Ansicht, und Dich braucheich darin nicht zu bekehren.Aber über Stockholm sprechen wir noch.In treuerFreundschaftDein alterCzernin."Tatsächlich ließ sich Tisza in diesem Falle völlig bekehrenund machte auch bezüglich der ungarischen Sozialdemokratenkeinen Anstand. Das negative Ergebnis der StockholmerKonferenz istbekannt.Es ist, wie bereits früher angedeutet, vorerst noch unmöglich,die verschiedenen Friedensversuche und Verhandlungenim Detail zu besprechen. Außer den bereits erwähnten Verhandlungenzwischen Revertera und Armand fanden nochandere Fühlungnahmen, so etwas später die Unterredungenzwischen Botschafter Mensdorff und General Smuts statt,über welche dann im englischen Parlamente gesprochenwurde; ich halte es nicht für richtig, hier mehr darüberzu sagen. Wohl aber kann und will ich den Gedankengangwiedergeben, welcher allen unseren Friedensbestrebungenvom Sommer 1917 ab zugrunde lag und sie schließlichallescheitern ließ.Die angeführten letzten Berichte spiegelten die Auffassungder Entente richtig wider. Mit Deutschland sei es „vorerst"nicht möglich, zu sprechen. Frankreich bestehe auf derRückgabe Elsaß-Lothringens, und die gesamte Entente verlangedie definitive Beseitigung des deutschen Militarismus.Für diese Forderung sei aber Deutschland nicht „reif", unddaher sei ein Sprechen nach Ansicht der Entente zwecklos.Anders stünde die Sache mit uns. Man habe den Eindruck,daß wir einen Separatfrieden schließen könnten, vorausgesetzt,daß wir zu Opfern bereit seien. Die Londoner Beschlüsse231
Friedensversuchehätten eine fertige Sachlage geschaffen, die honoriert werdenmüsse. Konzessionen an Rumänien, ferner Trient undTriest, sowie das deutsche Südtirol an Italien, dann Abtretungenan den südslawischen Staat seien unvermeidlich,ebenso eine Umgestaltung der Monarchie auf föderalistischerBasis. Unsere Antwort war, eine einseitige Abtretung österreichisch-ungarischenund deutschen Gebietes in dieser Formsei natürlich unmöglich. Dennoch glaubten wir, daß untergewissen Voraussetzungen in den territorialen Fragen vielleichteine Einigung nicht unüberwindlichem Widerstandbegegnen würde. Selbstverständlich dürfe aber die Ententenicht Bedingungen vorschreiben, die nur der Sieger dem Besiegtenvorschreiben könne. Denn wir seien alles eher alsbesiegt. Trotzdem hielten wir selbst nicht starr an denGrenzpfeilern der Monarchie fest.Wir könnten uns daher denken, daß bei gutem Willenseitens der Entente ein Ausgleich der verschiedenen Interessenmöglich sei, unmöglich aber seien Propositionen wie beispielsweisedie Preisgabe von Triest, Bozen und Meran oder auchdie Zumutung, auf dem Rücken Deutschlands den Friedenzu machen. Ich wies auf die Kriegslage hin und die völligeUnmöglichkeit, für wen immer, den Gedankengang derEntente aufzunehmen. Ich sei voll Zuversicht für die Zukunft,aber selbst wenn ich dies nicht wäre, könnte ich beider bestehenden Situation nicht einen Frieden schließen,den die Entente nicht anders diktieren könnte, wenn wirvernichtet am Boden lägen. Triest und den Zugang zurAdria verlieren zu sollen, sei allein eine ganz unmöglicheZumutung, ebenso wie die bedingungslose Herausgabe Elsaß-Lothringens.Neutrale Staatsmänner stimmten meinem Standpunkte zu,die Gedankenrichtung der Entente bewege sich nicht in demRahmen eines Verständigungs-, sondern eines Siegfriedens.Darüber sei man sich in den neutralen Ländern klar. Speziellin England seien aber verschiedene Strömungen.Nicht alle232
Friedensversuchedächten wie Lloyd George. Die Hauptsache sei doch, ersteinmal ins Sprechen zu kommen, da könne sich so manchesklären. Diese Gedanken griff ich stets mit beiden Händenauf. Die größte Schwierigkeit lag, wie man mir versicherte,in folgender Auffassung der Entente: Deutschland habe eineunbeschreibliche militärische Kraft bewiesen, aber es wäredoch nicht genügend auf den Krieg vorbereitet gewesen;es habe nicht genügend Rohstoffe, nicht genügend Nahrungsmittelaufgestapelt und nicht genügend U-Boote gebaut.Die Entente sage sich, wenn sie jetzt Frieden mache, sowerde Deutschland vielleicht sogar ungünstigen Bedingungenzustimmen, aber doch nur, um Zeit zu gewinnen und denFrieden als Atempause zu neuen Kriegen zu benützen. Eswerde die Versäumnisse nachholen und dann „von neuemlosschlagen". Daher sei für die Entente die Vorbedingungeines jeden Friedens oder auch nur eines jeden Gesprächesüber die Bedingungen desselben die Sicherheit der Abschaffungdes deutschen Militarismus. Ich erwiderte, niemandwolle einen weiteren Krieg, und ich sei ganz einig mit derEntente, daß die Garantien dafür geschaffen werden müßten.Unmöglich aber sei eine einseitige Entwaffnung und Entmannungder Mittelmächte oder Deutschlands. Man stellesich doch vor: eine Armee, weit drinnen im Feindeslandstehend, voller Zuversicht und Hoffnung, siegesgewiß undvoll Vertrauen, solle eines schönen Tages die Waffen niederlegenund vom Erdboden verschwinden.Kein Mensch könneeine solche Proposition annehmen, wohl aber sei eine allgemeineAbrüstung aller Mächte möglich und notwendig.Abrüstung, Einführung des schiedsgerichtlichen Verfahrensunter internationaler Kontrolle und für alle. Das sei meinerAnsicht nach eine akzeptable Basis.Ich entwickelte jedochmeine Besorgnisse, daß die Machthaber der Entente in dieserFrage ebensowenig wie in der territorialen das gleiche Maßan sich wie an uns zu legen gedächten, und daß ich ohne dieseVoraussetzung natürlich nicht imstande sei, den Gedanken233
Friedensvers uchebei uns und unseren Bundesgenossen lebensfähig zu gestalten.<strong>Im</strong>merhin sei der Versuch der Arbeit wert.Lange und oft wurde über die mitteleuropäische Fragegesprochen, welche der Schrecken der Entente sei, denn siebedeute eine unermeßliche Machtzunahme Deutschlands.Man wollte in Paris und London angeblich viel lieber dieMonarchie unabhängig von Deutschland machen und perhorresziertedaher eine jede noch weitere Annäherung vonWien an Berlin. Wir erwiderten, dieser Standpunkt derEntente sei uns nicht neu. Die Verstümmelung durch dieBeschlüsse des Londoner Paktes zwängen uns aber, dieseOrientierung zu suchen. Abgesehen von Ehre und Bundespflichtkämpfe ja Deutschland, wie die Dinge lägen, fastmehr für uns als für sich selbst. Wenn Deutschland heute,so wußten wir, Frieden schlösse, so verlöre es Elsaß-Lothringenund seine militärische Vorherrschaft zu Lande — wir abermüßten die Italiener, Serben und Rumänen für ihre Kriegshilfeaus unserem Territorium bezahlen.Von verschiedenen Seiten hörte ich, es gebe Männer beider Entente, welche diesen Standpunkt völlig begriffen.Aber was wolle die Entente machen ? Italien sei nur auf Grundder Londoner Versprechungen in den Krieg getreten, Rumänienhabe ebenfalls feste Zusicherungen erhalten, unddas „heroische Serbien" müsse durch Bosnien und die Herzegowinaentschädigt werden. So mancher an der Seine undThemse bedaure das durch die Londoner Konferenz geschaffeneFaktum, Vertrag aber sei Vertrag, und wederLondon noch Paris könnten ihre Bundesgenossen sitzenlassen. <strong>Im</strong> übrigen meine man bei der Entente, daß sowohldas neue serbische wie das neue polnische Reich, eventuellauch Rumänien in ein gewisses Verhältnis zur Monarchietreten könnten. Über die Details dieses Verhältnisses seiman wohl noch selbst sehr im unklaren. Unsere Entgegnungwar: Wir sollten Galizien an Polen, Siebenbürgen und dieBukowina an Rumänien und Bosnien samt der Herzegowina234
Friedensversuchean Serbien abtreten für die vage Versicherung eines engerenVerhältnisses dieser Staaten an die uns gelassenen kümmerlichenReste der Monarchie. Es seien nicht höfische oderdynastische Interessen, die uns leiteten. Ich hätte es selbstbeim Kaiser durchgesetzt, Galizien an Polen zu opfern, aberdie Konzessionen an Italien !Ich fragte einmal einen neutralenStaatsmann, ob er sich klar sei, was das hieße, daß Österreichdas urdeutsche Tirol bis zum Brenner freiwillig ausliefernsolle — der Sturm, den ein solcher Friede entfesselnwürde, würde mehr entwurzeln als den diesen Friedenschließenden Minister.Ich sagte meinem Mitredner, es gebeOpfer, die man bei lebendigem Leibe nicht bringen könne,unter keiner Bedingung.Ich würde das deutsche Tirol nichthergeben, auch wenn wir viel schlechter stünden, als wires tun.Ich erinnerte meinen Mitredner an ein Bild, welcheseinen von Wölfen verfolgten Schlitten darstellt. Der Mannwirft nach und nach seinen Pelz, seinen Rock und was ersonst besitzt vor die Meute, um sie aufzuhalten und sich zuretten — aber sein eigenes Kind werde er nicht hinauswerfen,lieber werde er das Äußerste erleiden. So fühlte ich fürdas deutsche Tirol. Wir seien nicht in der Lage des Mannesim Schlitten, denn Gott sei Dank besäßen wir Waffen, umuns der Wölfe zu erwehren — aber selbst im äußerstenFalle würde ich keinen Frieden akzeptieren, welcher Bozenund Meran von uns fordert.Mein Gewährsmann verschloß sich diesen Argumentennicht, meinte jedoch, er könne auf diese Art und Weise keinEnde des Krieges erblicken. England sei bereit, noch zehnJahre Krieg zu führen, und es werde Deutschland unterallen Umständen zerschmettern, nicht das Volk, gegenwelches keine Feindschaft bestehe — (immer wieder kamdieses trügerische Argument — ), aber den deutschen Militarismus.England selbst sei in einer Zwangslage. Es sei wiederholt,wenn das heutige Deutschland in diesem Kriege nicht vernichtetwerde, so werde es verstärkt weiterrüsten; davon sei235
Friedensveriuch«man in London überzeugt; es werde dann in einigen Jahrenstatt hundert tausend U-Boote haben, und dann sei EnglandIn England kämpfe man daher auch um die eigeneverloren.Existenz, und England sei eisern in seinem Willen. Es wisse,daß die Arbeit schwer sei, aber es werde nicht erlahmen.Man rufe in London das Beispiel der Napoleonischen Kriegewach : „What man has done man can do again." (Was Männereinmal geleistet haben, können sie wieder leisten.)<strong>Im</strong>mer kam bei allen Gesprächen diese Furcht vor dempreußischen Militarismus zutage, und wiederholt erfolgte dieAnregung, daß, wenn wir uns mit der allgemeinen Abrüstungeinverstanden erklären wollten, dies allein bereits ein großerVorteil und gewaltiger Schritt zum Frieden wäre.Aus dieser Erwägung heraus, daß der Militarismus dasgrößte Hindernis jeder Annäherung sei, entsprang meineam 2. Oktober 1917 in Budapest gehaltene Rede über dieNotwendigkeit der Schaffung einer ,,neuen Weltordnung".Ich sprach in Budapest vor einem Auditorium von Parteiführern.Ich hatte dabei zu bedenken, daß ein allzu pazifistischerTon im In- und Auslande eine der Absicht entgegengesetzteWirkung haben würde. <strong>Im</strong> Inlande wären diegeringen Widerstandskräfte noch weiter erlahmt, im Auslandehätte man darin das Ende unserer Kampffähigkeiterblickt und wäre noch weiter von allen friedlichen Intentionenabgerückt.Der auf dieSchaffung einer neuen Weltordnung lautendePassus meiner damaligen Rede lautete:„Dem großen französischen Staatsmanne Talleyrand wirdder Ausspruch zugeschrieben, die Worte seien da, um dieGedanken zu verhüllen. Mag sein, daß dieser Ausspruchrichtig war für die Diplomatie seines Jahrhunderts, für dieheutige Zeit kann ich mir schwer einen Satz denken, welcherweniger zutreffend wäre. Die Millionen, welche kämpfen,einerlei ob im Schützengraben oder im Hinterlande, wollenwissen, warum und wofür sie kämpfen, sie haben ein Recht236
Friedensversuchedarauf, zu erfahren, warum der Friede, den die ganze Welterwünscht, noch nicht eingetreten ist.Als ich auf meinen Posten gestellt wurde, habe ich dieerste Gelegenheit benützt, um offen zu erklären, daß wirkeine Vergewaltigungen begehen wollen, daß wir aber auchkeine solchen erdulden werden, und daß wir bereit sind,Friedensverhandlungen einzutreten, sobald unsere Feindediesen Standpunkt eines Verständigungsfriedens annehmen.Damit glaube ich die Friedensidee der österreichisch-ungarischenMonarchie, wenn auch in allgemeinen Umrissen, sodoch klar hingestellt zu haben. So mancher im Inlande undim befreundeten Auslande hat mich wegen dieser offenenSprache getadelt — die Argumente dieser tadelnden Herrenhaben mich in der Richtigkeit meiner Auffassung bestärkt;ich nehme nichts von dem zurück, was ich gesagt habe, inder Überzeugung, daß die erdrückende Majorität hier undin Österreich meinen Standpunkt billigt. Dies vorausgeschickt,drängt es mich heute, der Öffentlichkeit einiges zusagen, wie sich die k. u. k. Regierung die weitere Entwicklungder völlig zerstörten europäischen Rechtsverhältnisse überhauptvorstellt.In großen Umrissen ist unser Programm des Wiederaufbauesder Weltordnung, das richtiger alsneuen Weltordnung zu bezeichnen wäre,in unserer Antwortauf dieinder Aufbau einerFriedensnote des Heiligen Vaters niedergelegt.Es- kann sich mir also heute nur darum handeln, diesesProgramm zu ergänzen und vor allem eine Aufklärung darüberzu geben, welche Erwägungen uns bestimmt haben,diese das bisherige System umstürzenden Grundsätzeaufzustellen.Weiten Kreisen mag es überraschend,ja unbegreiflich erscheinen,daß die Zentralmächte und speziell Österreich-Ungarn in Hinkunft auf militärische Rüstungen verzichtenwollen, da sie doch in diesen schweren Jahren nur in ihrerMilitärmacht den Schutz gegen vielfache Übermacht fanden.237
FrielensversucheDer Krieg hat nicht nur neue Tatsachen und Verhältnissegeschaffen, er hat auch zu neuen Erkenntnissen geführt,welche die Grundlagen der früheren europäischen Politikerschüttert haben. Unter vielen anderen politischen Thesenist vor allem auch jene zerronnen, welche vermeinte, Österreich-Ungarnsei ein sterbender Staat. Das Dogma vombevorstehenden Zerfall der Monarchie war es, welches unsereStellung in Europa erschwerte und aus dem alles Unverständnisfür unsere Lebensbedürfnisse entsprang.Wenn wiruns in diesem Kriege als durchaus gesund und mindestensebenbürtig erwiesen haben, dann folgt für uns hieraus, daßwir jetzt auf ein volles Verständnis unserer Lebensnotwendigkeitenin Europa rechnen können, und daß die Hoffnungenzerstört sind, uns mit der Gewalt der Waffen niederringenzu können.Bis zu dem Momente, in welchem wir den Beweishierfür erbracht hatten, konnten wir auf den Schutz derRüstungen nicht verzichten und uns einer mißgünstigen Behandlungunserer Lebensfragen durch einen von der Legendeunseres bevorstehenden Zusammenbruches beeinflußten Areopagnicht aussetzen. Mit dem Augenblicke aber, in welchemdieser Beweis erbracht worden ist, sind wir in der Lage, gleichzeitigmit unseren Gegnern die Waffen abzulegen undunsere etwaigen Streitigkeiten schiedsgerichtlich undfriedlichzuregeln. Diese neue Erkenntnis, die sich in derWelt durchgerungen hat, bietet uns die Möglichkeit, den Abrüstungs-undSchiedsgerichtsgedanken nicht nur anzunehmen,sondern, wie Sie, meine Herren, wissen, schon seit geraumerZeit für deren Verwirklichung mit allen Kräften einzutreten.Europa muß zweifellos nach diesem Kriege auf eine neueinternationale Rechtsbasis gestellt werden, welche Garantiender Dauerhaftigkeit bietet. Diese Rechtsbasis muß, wie ichglaube, im Wesen vierfacher Art sein:Erstens muß sie die Sicherheit bieten, daß es keinenRevanchekrieg, und zwar von keiner Seite, mehr gebenkann; wir wollen das eine erreicht haben, daß wir unseren238
FriedensversucheKindeskindern als Vermächtnis hinterlassen können, daß sievon den Schrecken einer ähnlichen fürchterlichen Zeit, wiewir sie jetzt durchmachen, verschont bleiben. Keine Machtverschiebungder kriegführenden Staaten kann dies erreichen.Der Weg, um zu diesem Ziele zu gelangen, ist allein der erwähnteder internationalen Weltabrüstung und derAnerkennung des schiedsgerichtlichen Verfahrens.Es istüberflüssig, zu sagen, daß sich diese Maßregel der Abrüstungniemals gegen einen einzelnen Staat oder gegen eineeinzelne Mächtegruppe richten darf, und daß sie selbstverständlichLand, Wasser und Luft in gleichem Maße umfassen muß.Aber der Krieg als Mittel der Politik muß bekämpft werden.Auf internationaler Basis unter internationaler Kontrollemuß eine allgemeine, gleichmäßige Und sukzessive Abrüstungaller Staaten der Welt erfolgen und die Wehrmachtauf das unumgänglich Notwendigste beschränkt werden.weiß sehr wohl, daß dieses Ziel ungemein schwer zu erreichenist, und daß der Weg, der dahin führt, voll Schwierigkeiten,lang und dornenvoll ist. Und dennoch bin ich fest überzeugt,daß er gegangen werden muß, und daß er gegangen werdenwird, ganz einerlei, ob der einzelne dies für wünschenswerthält oder nicht. Es ist ein großer Irrtum, zu glauben, daßdie Welt nach diesem Kriege wieder dort anfangen wird,wo sie im Jahre 1914 aufgehört hat. Katastrophen, wiedieser Krieg eine ist, gehen nicht ohne tiefe Spuren vorüber,und das schrecklichste Unglück, welches uns widerfahrenkönnte, wäre, wenn das Wettrüsten nach FriedensschlußIchseinen Fortgang nehmen würde, denn es würde den wirtschaftlichenRuin aller Staaten bedeuten. Schon vor diesemKriege waren die militärischen Lasten drückend — obwohlwir speziell uns sagen müssen, daß Österreich-Ungarn langenicht auf der militärischen Höhe war, als es vom Kriege überraschtwurde; es hat die früher unterlassenen Rüstungenerst während des Krieges nachgeholt —, aber nach diesemKriege wären bei freier Rüstungskonkurrenz die Lasten für239
Friedensversu chealle Staaten einfach unerträglich. Dieser Krieg hat gelehrt,daß mit dem Vielfachen der früheren Rüstungen gerechnetwerden muß. Um nach diesem Kriege bei freier Rüstungskonkurrenzauf der Höhe zu bleiben, müßten die Staatenalles verzehnfachen, sie müßten zehnmal so viel Artillerie,Munitionsfabriken, Schiffe und Unterseeboote als vorherund auch ungleich mehr Soldaten haben, um diesen Apparatspielen lassen zu können — das jährliche militärische Budgetaller Großstaaten müßte mehrere Milliarden umfassen — dasist eine Unmöglichkeit; bei all den Lasten, welche alle kriegführendenStaaten nach dem Friedensschlüsse mit sichschleppen werden, würden diese Ausgaben, ich wiederholees, den Ruin der Völker bedeuten. Zurückzukehren aber aufdie relativ geringen Rüstungen vor dem Jahre 1914, wärefür einen einzelnen Staat schon ganz und gar unmöglich,denn er wäre dadurch dermaßen in der Hinterhand, daß seinemilitärische Kraft nicht zählen, seine Auslagen daher völligzwecklos werden würden. Wenn es aber überhaupt gelingenkönnte, allgemein auf das relativ geringe Rüstungsniveaudes Jahres 1914 zurückzukommen, dann würde dies ja bereitsdie internationale Rüstungsverminderung bedeuten, nurhätte es allerdings gar keinen Sinn, nicht weiterzugehenund tatsächlich abzurüsten.Aus diesem Engpasse gibt es nur einen einzigen Ausweg : d i einternationale vollständige Weltabrüstung.Dieriesigen Flotten haben keinen Zweck mehr, wenn die Staatender Welt die Freiheit der Meere garantieren, und die Landheeremüßten auf das geringe Maß reduziert werden, welches dieAufrechterhaltung der inneren Ordnung erfordert. Und nurauf internationaler Basis, d. h. unter internationaler Kontrolle,ist dies möglich. Jeder Staat wird etwas von seinerSelbständigkeit aufgeben müssen, um den Weltfrieden zusichern. Wahrscheinlich wird die heutige Generation dasEnde dieser großen pazifistischen Bewegung gar nicht inihrer Vollständigkeit erleben; sie kann sich nur langsam240
Friedensversuchedurchsetzen, aber ich halte es für unsere Pflicht,uns an dieSpitze derselben zu stellen und alles Menschenmögliche zumachen, um ihr Durchgreifen zu beschleunigen.Bei dem Friedensschlüssemüssen ihre Grundprinzipien festgestellt werden.War das erste Prinzip das der obligatorischen internationalenSchiedsgerichtsbarkeit und der allgemeinen Abrüstungzu Lande, so ist das zweite das der Freiheit des hohenMeeres und der Abrüstung zur See. Ich sage absichtlich: dashohe Meer, denn ich dehne den Gedanken nicht auf die Meerengenaus, und ich gebe gerne zu, daß für die verbindendenSeestraßen besondere Vorschriften und Regeln werden geltenmüssen. Sind diese zwei ersten soeben angeführten Momenteklargestellt und gesichert, dann entfällt auch jeder Grundfür territoriale Sicherungen, und dies ist das dritte Grundprinzipder neuen internationalen Rechtsbasis. Der schönenund erhabenen Note, welche Seine Heiligkeit der Papst andie ganze Welt gerichtet hat, hegt dieser Gedanke zugrunde.Wir haben den Krieg nicht geführt, um Eroberungen zumachen, und wir planen keine Vergewaltigungen. Wenn dieinternationale Abrüstung, die wir von ganzem Herzen ersehnen,von unseren heutigen Feinden angenommen, zurTatsache wird, dann brauchen wir keine territorialenSicherungen;in diesem Falle können wir auf Vergrößerungen derösterreichisch-ungarischen Monarchie verzichten, vorausgesetztnatürlich, daß auch der Feind unser eigenes Gebietvölhg geräumt hat.Der vierte Grundsatz, der eingehalten werden muß, umnach dieser bösen Zeit eine freie, friedliche Entwicklung derWelt zu verbürgen, ist die freie wirtschaftliche Betätigungaller und die unbedingte Vermeidung eines zukünftigenWirtschaftskrieges. Ein Wirtschaftskrieg muß unbedingtaus jeder Zukunftskombination ausgeschaltet werden. Wirmüssen, bevor wir einen Frieden schließen, die positiveSicherheit haben, daß unsere heutigen Gegner diesemGedanken entsagt haben.16 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 2J.I
Friedens versucheDas sind, meine sehr verehrten Herren, die Grundprinzipiender neuen Weltordnung, so wie sie mir vorschweben und welchealle auf der allgemeinen Abrüstung basieren. Auch Deutschlandhat sich ja in seiner Antwort auf die Papstnote nachdrücklichstzu der Idee der allgemeinen Abrüstung bekannt— und auch unsere heutigen Gegner haben sich diese Prinzipienwenigstens zum Teile schon zu eigen gemacht. Ichbin in den meisten Punkten anderer Ansicht als Herr LloydGeorge, aber darin, daß es keinen Revanchekrieg mehr gebensollte, darin finden wir uns."Das Echo meiner Rede bei der Entente übertraf die pessimistischenErwartungen. Um nicht dem Gedanken dereigenen Abrüstungnäherzutreten, wurden meine Ausführungenals Heuchelei und Friedensfalle gestempelt. Darüber seinicht zu sprechen.Hätte die Entente damals geantwortet, ich möge denBeweis erbringen, ich möge die Garantie schaffen, daß Deutschlandabrüsten werde, so hätte siemir damit die Möglichkeitgegeben, mit Hilfe der Völker den denkbar größten Druckauf Deutschlands Führer auszuüben.So schlug sie mir selbstdie Waffen aus der Hand. Denn die Resonanz aus Berlinlautete: Hier ist der Beweis, daß die Entente auch die Zusageunserer Abrüstung verwirft, wie sie alles verwirft, wasvon uns kommt. Es gibt nur einen Ausweg — Kampf biszum äußersten und den Sieg.Wieder zwang die Entente die Völker der Mittelmächte,den Generalen bedingungslos Gefolgschaft zu leisten.Niemals in meiner ganzen Amtszeit habe ich so viele Briefeerhalten wie nach dieser meiner Rede. Pro und contra undbeide von gleicher <strong>Im</strong>petuosität. Es regnete „Todesurteile"— besonders aus Deutschland —, Hohn und Spott wechseltenab mit aufrichtiger Sympathie und Zustimmung.<strong>Im</strong> Herbste 1917 verflaute die Friedensbewegung zusehends.Das Fiasko des Unterseebootkrieges trat klar242
Friedensvers uchezutage. England erkannte, daß es die Gefahr zu überwindenimstande sei. Noch sprachen die deutschen Militärs von denbestimmt zu erwartenden Erfolgen des maritimen Krieges,aber der Tenor ihrer Reden war doch ein anderer geworden.Von einem Niederwerfen Englands binnen weniger Monatewar nicht mehr die Rede, der neue Winterfeldzug galt alssicher. Aber doch beharrten die Deutschen darauf, daß siesich zwar in dem Termine, nicht aber in der Wirkung desU-Bootkrieges überhaupt getäuscht hätten, — England werdezusammenbrechen. <strong>Im</strong> übrigen habe der U-Bootkrieg denErfolg gehabt, daß die Westfront bestehen geblieben sei,ohne denselben wäre sie . zusammengebrochen.Die militärischen Auspizien änderten sich im Herbste.Das Ende des Krieges im Osten ward sichtbar, und die Eventualität,die -enormen Truppenmassen nach dem Westenwerfen und dort endlich doch durchbrechen zu können,beherrschte die Lage.Der U-Bootkrieg hat also die Entscheidung nicht zu Wassergebracht, aber er hat die Endentscheidung zu Lande ermöglicht,war die neue militärische Auffassung. Paris undCalais werden genommen werden.In diesen verschiedenen Phasen der militärischen Hoffnungenund Erwartungen schwammen wir wie ein Boot aufstürmischer See. Wir brauchten, um im Friedenshafen landenzu können, eine militärische Welle, die uns näher zum Ufertrug — erst dann konnten wir das Seil der Verständigungan das rettende Ufer werfen.Solange der Feind dabei blieb,nur mit den zerschmetterten und entmannten Mittelmächtenzu sprechen, war allesvergebens.An den Erfolg des U-Bootkrieges habe ich nie geglaubt.An den Durchbruch an der Westfront habe ich geglaubt,und von der Hoffnung, daß er den starren Vernichtungswillenunserer Feinde brechen werde, habe ich im Winter1917/18 gelebt.Solange die Friedensbedingungen unserer Gegner die früher16«243
!Friedens versucheerwähnten waren, war nicht nur der Friede unmöglich, auchder äußerste Druck auf Deutschland war unmöglich, denndieWorte: „Deutschlands Heer kämpfe mehr noch um dieErhaltung Österreich-Ungarns als um die eigene Existenz"waren Wahrheit.Drohend und unheilverkündend stand der Beschluß desLondoner Vertrages vor uns. Er drückte uns immer wiederdie Waffen in die Hand und trieb uns in das Feld.* **Zur Zeit, als diese Zeilen geschrieben werden — im Juli1919 — existiert Österreich längst nicht mehr. Es gibt nurmehr ein kleines, verarmtes, elendes Land, namens Deutschösterreich,ein Land ohne Armee, ohne Geld, hilflos, hungerndund fast verzweifelt. Dieses Land hört die Friedensbedingungenvon St. Germain. Es hört, daß es Tirol biszum Brenner ausliefern soll, daß es die Berge Andreas Hofersden Italienern zu geben hat. Und wehr- und hilflos, wie esist,schreit es auf vor Verzweiflung und in wildem Schmerz,es herrscht nur eine Stimme, daß dieser Friede unmöglich ist.Wie konnte eine österreichische Regierung dieses LondonerDiktat akzeptieren, zur Zeit, als unsere Armeen weit draußenim Feindesland standen, unbesiegt und ungebrochen, alswir die stärkste Landmacht der Welt zum Bundesgenossenhatten und die größten Generale des Krieges fest an denDurchbruch und den Endsieg glaubten ?Das Verlangen, ich hätte im Jahre 1917 oder 1918 einenFrieden annehmen sollen, welchen das gesamte deutschöstereichischeVolk im Jahre 1919 ablehnt — das ist Wahnsinn.Aber vielleicht ist Methode in diesem Wahnsinn. DieMethode, ein jedes Mittel zu gebrauchen, um das „alteRegime" zu diskreditieren.***Anfang August 1917 fand eine Annäherung zwischen Englandund Deutschland statt, welche leider sofort scheiterte.244
Friedens-.- ersucheEine neutrale Macht hatte auf Anregung Englands inDeutschland bezüglich Belgiens angeklopft. Deutschlanderwiderte, es sei bereit, mit England über die belgische Fragedirekt und mündlich zu verhandeln. Mit der Übermittlungdieser entgegenkommenden Antwort betraute Deutschlandjedoch nicht die neutrale Macht, welche den englischenVorschlagübermittelt hatte, sondern aus mir unbekannten Gründen eineneinem anderen neutralen Staate angehörenden Vertrauensmann.Letzterer scheint Indiskretionen begangen zu haben,und in Frankreich, wohin Gerüchte dieser Nachricht drangen,wurde man nervös. Man faßte angeblich an der Seine denSchritt so auf, als ob England die belgische Frage mehr alsdie elsaß-lothringische interessiere.Der von Berlin beauftragte Vertrauensmann hielt damitseine Aufgabe als gescheitert und ließ nach Berlin sagen,die Stimmung der Entente sei <strong>info</strong>lge des Bekanntwerdenseine derartige, daß jeder Schritt von deutscher Seite schonim vorhinein verurteilt wäre, mit einem Mißerfolg zu enden.Die Regierung des erwähnten Vertrauensmannes jedochgriff die Sache dennoch aus eigener Initiative auf und leitetedie deutsche Antwort nach London.sollaber niemals eingetroffen sein.Eine Antwort EnglandsDies die Schilderung, welche mir post festum von Berlingegeben wurde und welche zweifellos die Berliner Auffassungwiderspiegelt. Ob der Vorgang in allen Details genau sowar respektive ob nicht noch so manches bisher Unbekanntehierbei vorgefallen ist, scheint dennoch nicht erwiesen.Man sah während des Krieges alle Vorgänge jenseits desSchützengrabens nur getrübt — wie durch einen Schleier,und es ist anderen, mir später zugekommenen Nachrichtenzufolge nicht erwiesen, ob England nicht dennoch eine Antwortgegeben habe ; ob sie gegeben und dann auf dem Wegeaufgehalten wurde oder was damit geschah, ist mir unbekannt.In Berlin soll sie nicht eingetroffen sein.Eine kriegerische Rede, welche Asquith am 27. September245
Friedender uchehielt, soll mit diesem gescheiterten Versuch zusammengehangenund zur Beruhigung der eigenen Bundesgenossengedient haben.Ob diese Anknüpfung bei einer glücklicheren Regie zueinem Ergebnis geführt hätte, scheint mir jedoch mindestenssehr zweifelhaft. Aus diesen Augusttagen stammt das frühererwähnte Schreiben des Reichskanzlers Michaelis, welchesbelgische Projekte entwickelte, die jedenfalls noch weit vondem englischen Gedankengange entfernt waren. Und auchwenn die belgische Frage hätte gelöst werden können, soblieb immer noch die elsaß-lothringische, welche Englandund Frankreich band, und vor allem die der Abrüstung —die Kluft, die beide Lager trennte, blieb immer noch so groß,daß es kaum denkbar schien, eine Brücke darüber zu schlagen.Erst im Januar 191 8 erfuhr ich die englische Version.Danach hätten die Deutschen den ersten Schritt getan,und die englische Regierung habe sich nicht ablehnend verhalten,dann aber nichts mehr davon gehört. <strong>Im</strong> „Vorwärts"aber habe man gelesen, daß diese Anregung <strong>info</strong>lge einesBeschlusses des Kronrates stattgefunden, nachher aberwieder der militärische Einfluß die Oberhand gewonnen habe.Dieser Vorfall habe die Stimmung der leitenden Männer inEngland nicht gebessert.<strong>Im</strong> Frühsommer 1917 segelten wir mit einem günstigenFriedenswind, und die Hoffnung, zu einer Verständigung zugelangen, erschien zwar noch sehr ferne, aber nicht alsUtopie. Inwieweit die Hoffnung, unsere Gruppe zu spalten,und inwieweit das Versagen des U-Bootkrieges beigetragenhaben, den Kriegswillen der Entente wieder zu versteifen,ist natürlich nicht bestimmbar. Beide Momente wirktenjedenfalls mit. Bevor wir mit den Verhandlungen auf einendaß wir auch beitoten Punkt gelangten, stand die Sache so,einem Separatfrieden die Beschlüsse der Londoner Konferenz246
Friedensversuchehätten akzeptieren müssen. Ob die Entente diese Basis verlassenhätte, wenn wir den geraden Kurs beibehalten hätten,nicht durch inoffizielle Quertreibereien in das schiefe Lichtseparatistischer Wünsche gelangt wären und dadurch ruhigund konsequent hätten weiterarbeiten können, ist auch nichterwiesen und nicht erweisbar. Ich habe nach dem Niederbrucheim "Winter 1919 als Fazit folgendes gehört: Als Clemenceauzur Macht gelangte, war ein Verständigungsfriedenmit Deutschland ausgeschlossen. Er stand auf dem Standpunkte,daß Deutschland definitiv besiegt und zerschmettertwerden müsse, — unsere Verhandlungen begannen jedochschon unter Briand, und Clemenceau kam erst zur Macht,als die Friedensverhandlungen desorientiert zu stockenbegannen.Was Österreich-Ungarn anbelangt, so hätten Frankreichund England einen Separatfrieden unsererseits begrüßt, auchunter Clemenceau; wir hätten aber auch in diesem Falle dieBeschlüsse der Londoner Konferenz honorieren müssen.So stand die Friedensfrage. Wie sie sich entwickelt hätte,wenn keine irreführende Doppelpolitik betrieben wordenwäre — ist natürlich nicht beweisbar.Ich entwickle hier keine Vermutungen, sondernich konstatiereTatsachen. Und Tatsache bleibtnur, daß das Versagen des U-Bootkrieges einerseits und einehinter dem Rücken der verantwortlichen Männer geführte Politikandererseits der Grund waren, daß der günstige Momentungenützt vorüberging und die Friedensversuche ins Stockengerieten. W 7 obei ich wiederhole, daß diese Tatsache an undfür sich noch nicht beweist, daß die Friedensversuche nichtspäter auch gescheitert wären, wenn die obigen zwei Momentenicht vorhanden gewesen wären.<strong>Im</strong> Herbste war es völlig klar geworden, daß der Kampfweitergehe. Meine Reden in den Delegationen versuchtenkeinen Zweifel darüber zu lassen, daß wir bundestreu seien.Wenn ich sagte: „Ich kenne keinen Unterschied zwischen247
Friedensver-ucheStraßburg und Triest" — so sagte ich dies in erster Liniefür Sofia und Konstantinopel, denn die Erschütterung desVierbundes war die größte Gefahr.Noch hoffte ich, den schwankenden Boden der Bündnispolitikwieder zu stützen und den allgemeinen Frieden entwederin dem militärisch niederbrechenden Osten zu erreichen— oder ihn <strong>info</strong>lge des erhofften deutschen Durchbruchesan der Westfront reifen zu sehen.Als ich mehrere Monate nach meiner Demission, im Sommer1918, im Herrenhause über die äußere Politik sprach undnochmals öffentlich davor warnte, den Bestand des Vierbundesunterminieren zu lassen, — als ich sagte: ,,Ehre,Bundespflicht und Selbsterhaltungstrieb zwingen uns, an derSeiteDeutschlands zu fechten" — da wurde ich nicht verstanden.Es scheint der Öffentlichkeit nicht klar gewesendaß unsere Partie in dem Augenblicke definitiv ver-zu sein,loren sein müßte, in welchem bei der Entente der GlaubePlatz griff, daß der Vierbund sich auflöse. Kannte die Öffentlichkeitdie Londoner Abmachungen nicht? Wußte sienicht, daß ein Separatfriede uns schutzlos diesen grausamenBedingungen auslieferte ? Wußte sie nicht, daß die deutscheArmee der Schild war, welcher uns die letzte und einzigeMöglichkeit bot, dem Los der Zerstückelung zu entgehen?Mein Nachfolger hat den gleichen Kurs beibehalten wieich, wohl auch aus denselben Gründen der Ehrlichkeit unddes Selbsterhaltungstriebes. Die Einzelheiten, welche diesbezüglichim Sommer 1918 vorfielen, sind mir unbekannt.Dann überstürzten sich die Ereignisse. Erst kamen unserefürchterlichen Niederlagen in Italien, dann der Ententedurchbruchan der Westfront und schließlich der bulgarischeAbfall, welcher sich seit dem Sommer 1917 langsam vorbereitete.248
Friedensver-aicheWie in allen Ländern, so gab es natürlich auch bei derEntente während des Krieges verschiedene Strömungen.Mit Clemenceaus Amtsantritt bekam, wie erwähnt, dasKriegsziel, Deutschland definitiv zu vernichten, die Oberhand.Denjenigen, welchen die geheimen Nachrichten, über welcheein Minister des Äußern natürlicherweise verfügt, nicht zuGebote standen, mag es geschienen haben, als ob die Ententein der Frage der Vernichtung Deutschlands militärischerKraft zuweilen zu Konzessionen bereit gewesen wäre. Ichglaube, daß dies vielleicht im Frühjahr 1917, aber späternicht mehr der Fall war. Die obige Ansicht war deshalbtrügerisch, als die auch später vernommene mildere Tonartvon nicht kompetenten Stellen ausging. Vor allem Lansdownesprach und schrieb friedlicher, aber ausschlaggebendfür England war Lloyd George.Bei verschiedenen Fühlungnahmen mit England versuchteich zu ergründen, durch welche Maßregeln eigentlich diemilitärische Entmannung Deutschlands garantiert werdensolle oder könne — und ich stieß dabei stets auf eine unsichtbareWand. Es war niemals zu konstatieren, wie sich Englanddie Durchführung dieses Schlagwortes vorstelle.Die Erklärung lag darin, daß es eben keine andere Möglichkeitgibt, ein starkes selbstbewußtes Volk völlig zu entwaffnen;als es zu erschlagen, — und daß dieses Ziel uns bei Besprechungennicht offen eingestanden werden wollte. DieAbgesandten konnten daher keinen diskutierbaren Modusvorschlagen — und was man sonst so daneben von anderenVorschlägen hörte,war nicht ausschlaggebend.Lansdowne, vielleicht auch Asquith hätten sich möglicherweisemit einem parlamentarischen Regime, welches dieMacht dem Kaiser genommen und dem Reichstag gegebenhätte, zufriedengestellt. Lloyd George nicht, wenigstens249
Friedensversuchespäter nicht mehr. Die bekannte Rede des englischen Premiers,,,ein Abrüstungsvertrag mit Deutschland wäre einPakt zwischen einem Fuchs und vielen Gänsen," sagte das,was er wirklich meinte.Nach meiner früher erwähnten Budapester Rede, welcheeine so höhnende Aufnahme in der Presse und öffentlichenMeinung jenseits des Kanals gefunden hatte, ließ man mirvon einer Stelle Englands sagen, die „Czerninsche Formel"könne die Lösung der Frage bringen. Aber das war wiedernicht Lloyd George, der so sprach.Bei dem unbeschreiblichen Mißtrauen, welches Clemenceauund der englische Premier und mit ihnen der überwiegendeTeil Englands und Frankreichs in Deutschlands Absichtenhatten, war keine Maßregel denkbar, welche die nötigenGarantien für eine friedliche Zukunftspolitik in London undParis hätte geben können. Deutschland hätte vom Sommer1917 ab was immer machen können, es wäre stets von LloydGeorge als ungenügend abgelehnt worden.Infolgedessen war es später auch für den weiteren Verlaufdes Krieges ganz nebensächlich, daß Deutschland nicht nurgar nichts getan hat, um die Beseitigung der englischen Besorgnissezu versuchen, sondern im Gegenteil fortgesetztin das Feuer gegossen hat.Das im Kriege maßgebende militärische Deutschlanddachte tatsächlich keinen Augenblick daran, nach dem Kriegeauf eine Abrüstung unter internationaler Kontrolle einzugehen.Nach meiner Budapester Rede wurde ich in Berlinnicht unfreundlich, aber mitleidig behandelt, so wie manjemanden behandelt, der geisteskrank geworden ist. Manvermied nach Möglichkeit dieses Thema, man behandeltemich schonend und berührte die „Wahnvorstellungen" liebernicht. Nur Erzberger gab mir sein volles Einverständnisbekannt.Hätte Deutschland gesiegt, so wäre sein Militarismusin das Maßlose gewachsen. Ich habe im Sommer 1917 an250öl
Frieden versucheder Westfront zahlreiche hohe Generale gesprochen,welchealle übereinstimmend erklärten, die Rüstungen müßten nachdem Kriege in unvergleichlich größerem Maße weiterbetriebenwerden; sie verglichen den Krieg mit dem ersten punischen,welchem weitere folgen würden und für welche man sichvorbereiten müsse — kurz die Versailler Taktik, dauernd dasBanner der Gewalt aufzupflanzen, war auch die Taktik derGenerale, der Alldeutschen, der Vaterlandspartei usw. Aneine Völkerversöhnung nach dem Kriege dachten sie genauebensowenig, wie der Viererrat in Versailles daran gedachthat. Und in diesem Strome gewalttätiger Absichten plätschertenKaiser, Regierung und Reichstag hilflos herum.Der militärische Geist gedieh an der Spree, wie er heutenoch an der Seine und Themse gedeiht. Lloyd George undClemenceau werden zahlreiche ihrer Ebenbilder unter denLinden Berlins finden. Foch und Ludendorff sind nur dadurchverschieden, daß der eine Franzose, der andere Deutscherist ; als Menschen gleichen sie sich wie ein Ei dem andern.Die Entente hat gesiegt, und viele Millionen jubeln darüberund schwören darauf, daß die Politik der Gewalt die richtigewar.Erst die Zukunft wird beweisen, ob dies nicht ein furchtbarerIrrtum ist. Die Hunderttausende, die gefallen sind,und deren junges, blühendes Leben zu retten war, wenn unsder Frieden im Jahre 1917 ermöglicht worden wäre, dieseToten weckt der Triumph des Sieges nicht mehr auf. Mirscheint, die Entente hat viel zu sehr, hat viel zu gründlichgesiegt. Der Wahnsinn des trotz aller Orgien sterbendenMilitarismus hat vielleicht in Versailles seine letzten Triumphegefeiert.* **Zusammenfassend ist die historische Wahrheit der Friedensbewegungwährend meiner Amtszeit die, daß im allgemeinenweder die Entente noch die in Deutschland herrschende allmächtigeMilitärpartei einen Verständigungsfrieden wollten.Beide wollten siegen und dem niedergeworfenen Gegner251
Friedensversucheeinen Gewaltfrieden aufzwingen. Deutschlands führendeMänner — vor allem Ludendorff — haben niemals die ehrlicheAbsicht gehabt, Belgien wirtschaftlich und politischwieder völlig freizugeben, noch viel weniger wollten sie Opferbringen, sie wollten im Osten und Westen erobern, und ihregewalttätigen Absichten haben jeder pazifistischen Tendenzder Entente, sowie sie sich nur leise rührte, entgegengearbeitet.Auf der anderen Seite waren die führendenMänner der Entente — Clemcnceau stets und Lloyd Georgejedenfalls später — auch fest entschlossen, Deutschland zuzerschmettern, und sie benützten die fortgesetzten deutschenDrohungen natürlich dazu, um jede pazifistische Bewegungin den eigenen Ländern zu ersticken und immer wieder zubeweisen, daß ein Verständigungsfriede mit Berlin ein „Paktzwischen dem Fuchs und der Gans" sein würde.Die Entente gewann dank der Haltung der führendendeutschen Militärs die Überzeugung, daßeine Verständigung mit Deutschlandganz unmöglichsei, und verbiß sich ihrerseits in Friedensbedingungen,welche wieder für ein nicht geschlagenesDeutschland nicht akzeptabel waren.Hier schließt sich der Circulus vitiosus, welcheralle vermittelnde Tätigkeit paralysierte.Wir waren zwischen diesen beiden Richtungen eingekeiltund außerstande, unsere eigenen Wege zu gehen, weil dieEntente, durch Versprechungen an ihre Bundesgenossen gebunden,bereits über uns verfügt hatte (Londoner Vertragund die Zusagen an Rumänien und Serbien). Wir konntendaher den äußersten Druck auf Deutschland so langenichtausüben, als wir nicht die Annullierung dieser Verträge durchzusetzenvermochten.<strong>Im</strong> Frühsommer 1917 schien die Möglichkeit einerVerständigung am Horizonte aufzutauchen. Die früher erwähntenVorgänge ließen sie scheitern.
VII.Wilson
:Mitdem Abnehmen der Friedensgeneigtheit im feindlichenLager standen wir im Herbste 1917 vor der Eventualitätentweder einen Separatfrieden zu schließen und diebereitsmehrfach entwickelten Folgen eines Krieges mit Deutschlandund die nachherige Verstümmelung der Monarchie auf Grundder Londoner Beschlüsse zu akzeptieren — oder weiterzukämpfenund mit Hilfe unserer Bundesgenossen den Vernichtungswillenunserer Feinde zu brechen.Hatte Rußland den Weltkrieg entfesselt, so war es Italien,welches ständig einen Verständigungsfrieden verhinderte, indemes dabei blieb, unter allen Umständen das ganze ihmim Jahre 1915 zugesagte österreichische Territorium zu erhalten.Die Rollenverteilung bei der Entente während des Kriegeswar die, daß Frankreich das meiste an Blut beisteuerte, Englandneben seinen fabelhaften militärischen Leistungen zusammenmit Amerika den Krieg finanzierte, Italien jedoch diediplomatische Leitung innehatte. Es ist heute noch viel zuwenig bekannt und wird wohl erst später zu dem allgemeinenBewußtsein kommen, in welchem Grad die italienischeDiplomatie in diesem Kriege führte und dominierte. Auchunsere Siege in Italien hätten nur dann die Lage geändert,wenn die erlittenen Niederlagen eine italienische Revolutionund damit den völligen Umsturz des dortigen Regimesherbeigeführt hätten — eine Möglichkeit, die gewiß imPrinzip bestand; die königliche Regierung aber wurde durch255
Wilfonunsere Siege in ihrer Haltung nicht beeinflußt, und auchwenn wir noch viel weiter vorgedrungen wären, so wäre sieauf ihrem Standpunkt verblieben in der Erwartung, daßzwar nicht Italien selbst, aber dessen Bundesgenossen denEndsieg herbeiführen müssen.So stand die Situation, als Wilson mit seinen 14 Punktenhervortrat.Der aller Welt in die Augen springende Vorteil des WilsonschenProgrammes war sein krasser Kontrast mit den Bestimmungendes Londoner Paktes. In London war dasSelbstbestimmungsrecht der Völker mit Füßen getretenworden, das deutsche Tirol an Italien vergeben worden.Wilson verbot dies und erklärte, daß die Völker nicht gegenihren Willen wie Steine bei einem Spiele hin und hergeschoben werden dürfen. Wilson sagte, daß „jede Lösungeiner Gebietsfrage, die durch diesen Krieg aufgeworfenworden ist, im Interesse und zugunsten der betreffendenBevölkerungen und nicht als Teil eines bloßen Ausgleichesoder Kompromisses der Ansprüche rivalisierender Stellengetroffen werden müsse", und weiter, „daß alle klar umschriebenennationalen Ansprüche die weitestgehende Befriedigungfinden sollen, die ihnen zuteil werden kann, ohneneue Elemente oder die Verewigung alter Elemente vonZwist und Gegnerschaft, die den Frieden Europas undsomit der ganzen Welt wahrscheinlich bald wieder störenwürden, aufzunehmen ;— ein allgemeiner Friede, auf solcherGrundlage errichtet, kann erörtert werden" — und anderesÄhnliches mehr.Das Hervortreten dieses klaren und unbedingt akzeptablenProgrammes schien von einem Tag zum anderen die friedlicheLösung des Weltkonfliktes zu ermöglichen. In denAugen von Millionen von Menschen eröffnete dieses Programmeine Welt von Hoffnungen. Ein neuer Stern war aufgegangenjenseits des Ozeans, und alles blickte nach demselben. Eingewaltiger Mann schien erstanden, der mit einer einzigen256
Wilsonkraftvollen Bewegung die Londoner Abmachungen über denHaufen warf und damit das Tor des Yerständigungsfriedensneuerlich öffnete.Für mich dominierte vom ersten Momente an..•die Frage: Welche Hoffnungen hat das WilsonscheProgramm, sich gegen London, Paris undvor allem gegen Rom tatsächlich durchzusetzen?Geheime Nachrichten, die ich aus den Ententcländern erhielt,deuteten darauf hin, daß die 14 Punkte absolut nichtim Einverständnisse mit England, Frankreich und Italienabgefaßt seien,andererseits war ich und bin ich heute nochder festen Überzeugung, daß Wilson ehrlich und aufrichtiggesprochen hatte und tatsächlich an die Durchführung seinesProgrammen glaubte.Der große Rechenfehler Wilsons war seine völlig falscheEinschätzung der reellen Machtverhältnisse innerhalb derEntente einerseits und die verblüffende Unkenntnis dernationalen Verhältnisse in Europa und speziell in Österreich-Ungarn andererseits, welche seine Machtstellung und seinenEinfluß auf seine Bundesgenossen noch ganz erheblichschwächen mußte. Denn für die europäische Entente wares nicht schwer, Wilson geschickt in das nationale Gestrüpphineinzuführen, ihn sich darin verfitzen und verirren undkeinen Ausweg mehr finden zu lassen. Wilsons Theoriebrachte uns also vorerst keinen Schritt weiter.Der Siebenundsechzigjr Ausgleich hat in Österreich- Ungarneine deutsch-magyarische Vorherrschaft eingeführt . Vor fünfzigJahren war der Nationalismus noch vielunentwickelter alsheute. Die Völker schliefen noch, bei Tschechen, Slowakenund Südslawen, bei Rumänen und Ruthenen war das nationaleLeben kaum erwacht. So konnte vor 50 Jahren etwasstatuiert werden, was täuschte und Hoffnung auf Dauerversprach. Die Einigung der Italiener und der Deutschenaber wirkte nach — oder vielleicht war sie nur das erste1; CzerniD <strong>Im</strong> Wellkriege 257
WilsonAnzeichen der kommenden Weitbewegung, jedenfallstratenwir mit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in dieHochkonjunktur nationaler Politik.Das nationale Problem der Welt war in der HabsburgischenMonarchie besonders konzentrisch und daher besonderssichtbar. Ein Chemiker kann in seiner Retorte verschiedeneStoffe und Elemente der Welt einkapseln und an ihnen seineStudien machen, und er wird sie in dieser Weise machen,denn die Stoffe werden sich, ewigen Gesetzen folgend, in derRetorte ebenso verhalten wie im Universum. So konnte manJahrzehnten in der Habsburgischen Monarchie die Wir-seitkung ungelöster nationaler Fragen studieren und ihre Sprengwirkungkonstatieren, bevor dieselben in dem Kriege dieganze Wrelt in die Luft sprengten.Herr Wilson fühlte bei Erlaß seiner 14 Punkte offenbarsehr klar die Notwendigkeit der Regelung des nationalenWeltproblems und erkannte, daß die Habsburgische Monarchie,einmal geordnet, als Schulbeispiel für die Weltdienen könne, wie sie bisher als abschreckendes Beispielgedient hatte. Nur übersah er erstens, daß es bei der Regelungder nationalen Fragen keinen „Gegner" und keinen „Bundesgenossen"geben dürfe, da diese Unterschiede vorübergehendsind, das nationale Problem jedoch bleibt, — er übersah,daß das, was für die Tschechen gilt, auch für Irland geltenmüsse, und daß die Armenier genau wie die Ukrainer ihreigenes nationales Leben leben wollen, und daß auch diefarbigen Völker Afrikas und Indiens Menschen sind mit dengleichen Rechten wie die weißen. Er übersah ferner, daßder gute Wille und der Wunsch nach Gerechtigkeit nochlange nicht genügt, um das nationale Weltproblem zu lösen.So kam es, daß unter seiner Patronanz und angeblich aufGrund seiner 14 Punkte die nationale Frage nicht gelöst,sondern einfach umgekehrt wurde, soweit sie nicht überhauptunberührt blieb. Waren Deutsche und Magyaren bisherdie Herrschenden, so wurden sie jetzt die Unterdrückten.258
WilsonSie wurden durch die Versailler Beschlüsse den fremdnationalenStaaten ausgeliefert. In zehn Jahren, vielleicht noch früher,werden aber die beiden Mächtegruppen, wie sie heute bestehen,längst zerfallen sein, ganz andere Konstellationenwerden dominieren — und nur der Sprengstoff der neuerlichungelösten nationalen Fragen wird weiterwirken und inabsehbarer Zeit die 'Welt wiederum in die Luft sprengen.Herr Wilson, welcher offenbar das Programm des LondonerPaktes kannte, die nationalen Schwierigkeiten jedochviel zu wenig einschätzte, hoffte wahrscheinlich, zwischen deritalienischen Eroberungspolitik und seiner Idealpolitik einKompromiß schließen zu können. In dieser Frage aber gabes keine Brücke zwischen Rom und Washington .erobern mit dem Rechte des Siegers — das war dieMan kannPolitikOrlandos und Clemenceaus, oder man regelt die Welt nachden Prinzipien der nationalen Gerechtigkeit — wie Wilsonwollte — dann wird man das Ideal zwar auch nicht erreichen,— jedes Idealist unerreichbar, aber man wird sich demselbenbedeutend nähern. Es kann nur die Macht siegen oder dasRecht. Man kann aber nicht Tschechen, Polen und andere befreienund gleichzeitig Tiroler Deutsche, Elsässer Deutsche undSiebenbürger Ungarn fremdnationaler Herrschaft ausliefern— man kann das nicht von dem Standpunkte der Gerechtigkeitaus und nicht mit der Hoffnung auf Dauer. Daßman es durch Macht und für den vorübergehenden Augenblickkann, das hat ja Versailles und St. Germain bewiesen.Die Lösung der nationalen Frage war der Punkt, umwelchen das politische Pendel Franz Ferdinands zeitlebensoszillierte. Ob sie ihm gelungen wäre, ist eine andere Frage,aber versucht hätte er sie.Auch Kaiser Karl verschloß sichdieser Notwendigkeit nicht. Kaiser Franz Joseph war zualt und zu konservativ, um das Experiment zu versuchen —für ihn galt das Quieta non movere. Ohne gewaltige Hilfevon außen war der Versuch gegen den deutsch-magyarischenWiderstand im Kriege nicht zu machen, und daher schien17« 25
Wilsonder Moment so hoffnungsvoll, als Wilson mit seinen 14Punkten auftrat, und trotz der großen Skepsis, welcher dieWashingtoner Botschaft in der deutschen und auch in unsererÖffentlichkeit begegnete, war ich sofort entschlossen, denFaden aufzugreifen.Ich wiederhole, daß ich niemals an der Ehrlichkeit undden aufrichtigen Absichten Wilsons gezweifelt habe — wieich auch heute nicht daran zweifle — , hingegen waren meineZweifel an seiner Macht, seine Ideen durchzusetzen, vomersten Momente an sehr lebhaft. Es war klar, daß der kriegführendeWilson unvergleichlich stärker war als der amFriedenstisch sitzende. Solange gekämpft wurde, warWilson der Herr der Welt. Er brauchte nur seine Truppenvon dem europäischen Kriegsschauplatze abzuberufen, und dieEntente kam in die schwierigste Lage. Es ist mir immer unverständlichgeblieben, warum der Präsident der VereinigtenStaaten dieses gewaltige Druckmittel nicht angewendet hat,solange es noch Zeit war, um seine Kriegsziele durchzusetzen.Schon die erwähnten vertraulichen Nachrichten, welcheich bald nach dem Erscheinen der 14 Punkte erhielt, ließenmich befürchten, daß Wilson in Verkennung der Situationkeine praktischen Anstalten treffe, um seinem verkündetenWillen auch tatsächlich Geltung zu verschaffen, und daß erden Widerstand Frankreichs und besonders Italiens unterschätze.Die logische, die praktische Folge desWilsonschen Programmes wäre die öffentlicheAnnullierung des Londoner Paktes gewesen, jasie hätte sie sein müssen, damit wir erkennen können, nachwelchen Prinzipien wir in Friedensverhandlungen eintretenkönnen. Nichts Ähnliches geschah, und die Kluft, diezwischen den Friedensgedanken Wilsons und Orlandosklaffte, blieb bestehen.Am 24. Januar 19 18 nahm ich in dem Ausschusse der österreichischenDelegation öffentlich Stellung zu den 14 Punktenund erklärte dieselben — soweit sie uns und nicht unsere260
WilsonBundesgenossen betreffen — als geeignete Grandlage zu Verhandlungen.Ungefähr gleichzeitig leiteten wir die notwendigenSchritte ein, um Klarheit zu gewinnen, wie nach Wilsons Ideendie 14 theoretischen Punkte praktisch durchgeführt werdensollten.Die Verhandinngen schienen nicht hoffnungslos.Währenddem liefen die Brester Verhandlungen. Obwohldas Ergebnis derselben, welches einen Sieg des deutschenMilitarismus darstellte, gewiß nicht aufmunternd auf Wilsongewirkt haben dürfte, so scheint der kluge Kopf doch klarerals mancher Österreicher erkannt zu haben, daß wir uns ineiner Zwangslage befanden und die Schuld, daß Deutschlandversteckte Annexionen mache, nicht Wien treffe.Wenigstenssagte der Präsident am 12. Februar — also nach verkündetemBrester Friedensschluß — in einer Rede vor demKongresse :,,Graf Czernin scheint die Grundlagen des Friedensmit klarem Auge anzusehen, und er scheint sie nicht zu verdunkeln.Er sieht, daß ein unabhängiges Polen, gebildet ausallen unbestreitbar polnischen Bevölkerungen, die eine andie andere grenzt, eine Angelegenheit europäischen Übereinkommensist und natürlich zugestanden werden muß,ferner, daß Belgien geräumt und wiederhergestellt werdenmuß, gleichgültig welche Opfer und Zugeständnisse dies mitsich bringen mag, und ferner, daß nationale Bestrebungenbefriedigt werden müssen, sogar in seinem eigenen Reicheim gemeinsamen Interesse Europas und der Menschheit.Wenn er über Fragen schweigt, die die Interessen und Absichtenseiner Verbündeten näher als Österreich-Ungarn alleinberühren, so ist es natürlich nur, weil er sich gezwungenfühlt, unter Umständen auf Deutschland und die Türkei zuverweisen. Indem er die wichtigen in Frage kommendenPrinzipien und die Notwendigkeit, sieoffenherzig in die Tatumzusetzen, erkennt und ihnen zustimmt, fühlt er natürlicherweise,daß Österreich-Ungarn auf die Kriegsziele, wiesie von den Vereinigten Staaten ausgedrückt wurden, mitweniger Schwierigkeit, als dies Deutschland möglich ist,261
Wilsoneingehen kann.Er würde wahrscheinlich noch weitergegangensein, wenn er auf Österreich-Ungarns Bündnis und seineAbhängigkeit von Deutschland keine Rücksicht zu nehmengebraucht hätte" — und weiter sagt der Herr Präsident inderselben Rede vom 12.Februar: „Die Antwort des GrafenCzernin, der Hauptsache nach an meine Adresse auf meineRede vom 8. Januar gerichtet, ist in einem sehr freundlichenTone gehalten. Er erblickt in meiner Erklärung eine hinreichendermutigende Annäherung an die Auffassungen seinereigenen Regierung, um seinen Glauben zu rechtfertigen,daßsie eine Grundlage für eine eingehende Besprechung der Zieledurch die beiden Regierungen hefern," und ferner: „Ichmuß sagen, Graf Hertlings Antwort ist sehr unbestimmtund sehr verwirrend. Sie ist voll zweideutiger Sätze, und esist nicht klar, wohin sie führt. Aber sie ist sicherlich ineinem von dem Tone der Rede des Grafen Czernin sehr verschiedenenTone gehalten und augenscheinlich mit einementgegengesetzten Zweck."Es ist klar, daß, wenn das Oberhaupt eines mit uns imKriege befindlichen Staates in so entgegenkommender Weiseüber den Minister des Äußern sprach, er voll der bestenIntentionen war, zu einer Verständigung zu gelangen.Meinediesbezüglichen Versuche wurden durch meine Demissionunterbrochen.In diesen letzten Wochen meiner Amtstätigkeit verlor ichdefinitiv das Vertrauen des Kaisers. Dies hing weder mitder Wilson-Frage zusammen, noch war es die direkte Folgemeiner Politik überhaupt. Meinungsverschiedenheiten zwischenverschiedenen Persönlichkeiten aus der kaiserlichenUmgebung und meiner Wenigkeit waren der Grund. DieseKonflikte nahmen eine Schärfe an,welche den Zustand unhaltbarmachten. Die Kräfte, die sich gegen mich verschworenhatten, ließen es mir unmöglich erscheinen, meinZiel noch zu erreichen,das dank seiner Schwierigkeiten nurbei vollem Vertrauen des Kaisers erreichbar war.263
WilsonTrotz aller gegen mich gerichteten Gerüchte und Erzählungenwerde ich über diese Details nicht sprechen,solange ich nicht durch Darstellungen, welche von einerkompetenten Stelle erfolgen, hierzu gezwungen werdensollte. Ich bin heute noch überzeugt, daß ich meritorischvollständig im Rechte war. Formell war ich im Unrechte,weil ich weder das Geschick noch die Geduld besaß, denWiderstand zu biegen, sondern ihn brechen wollte unddie Situation vor ein „Entweder — oder" stellte.
VIII.Eindrücke und Betrachtungen
<strong>Im</strong> Herbste 1917 hatte ich den Besuch eines Bürgers einesneutralen Staates, welcher ein überzeugter Anhänger derallgemeinen Abrüstung und des Weltpazifismus ist. 'Wienatürlich, begannen wir mit dem Thema der freien Rüstungskonkurrenz,des unseligen Militarismus, welcher in Englandzu Wasser und in Deutschland zu Lande verkörpert war,und mein Gast entwickelte die verschiedenen Möglichkeiten,welche sich nach dem Kriege ergeben könnten. An eineVernichtung Englands glaubte er nicht, ebensowenig wie ich— aber er hielt es für möglich, daß Frankreich und Italienniederbrechen würden. Das französische und italienischeVolk vertrügen keine große Belastungsprobe mehr, man seiin Paris und Rom nicht mehr weit von der Revolution, unddann werde eine neue Kriegsphase anbrechen. England undAmerika würden allein weiterkämpfen, zehn, zwanzig Jahrevielleicht. England sei nicht die kleine Insel, sondernAustralien, Indien, Kanada und das Meer, ,,1'Angleterre estimbattable," wiederholte er, und Amerika desgleichen. Andererseitssei die deutsche Landarmee auch unbesiegbar.Ein Ausscheiden Frankreichs und Italiens würden diewürgende Blockade so ziemlich paralysieren, denn die Hilfsquellendieser Länder — einmal von den Mittelmächtenerobert — seien enorm, und so sehe er überhaupt kein Endedes Krieges. Schließlich werde die Welt an allgemeiner Entkräftungzugrundegehen. Mein Gast erinnerte an die Fabel,267
l 7 indrücke und Betrachtungenin welcher zwei Ziegenböcke sich auf einer schmalen Brückebegegnen, keiner ausweichen will und. sie sich so lange bekämpfen,bis beide in das Wasser fallen und ertrinken. DerSieg einer Gruppe — so meinte mein Gast — in dem Sinnefrüherer Kriege, in dem Sinne, daß der Sieger reiche Vorteileeinheimst und der Besiegte die Nachteile trägt, sei bei einemKriege wie dem jetzigen ausgeschlossen. Tout le mondep^rdra, et ä la fin il n'y aura que des vaincus.Oft habe ich an die Unterredung zurückgedacht. VielFalsches und doch auch wieder, wie mir scheint, viel Wahreslag in den Worten meines Freundes.Frankreich und Italiensind nicht niedergebrochen, das Kriegsende ist viel raschereingetreten, als er dachte, und die unbesiegbare deutscheArmee wurde besiegt. — Dennoch will es mir scheinen, daßdie Konklusion meines Mitredners der Wahrheit sehr nahekommt.Auch die Sieger haben zerrüttete Finanzen, so vor allemItalien und Frankreich, auch bei ihnen gärt es, unerschwinglichsind auch dort die Arbeitslöhne, allgemein die Unzufriedenheit,das Gespenst des Bolschewismus grinst sie an,und sie leben von der Hoffnung, daß die geschlagenen Mittelmächtenunmehr zahlen und sie dadurch erretten werden.Sie haben das in den Friedensbedingungen diktiert. Aber:Ultra posse nemo tenetur, und die Zukunft erst wird zeigen,bis zu welchem Grade die Mittelmächte die diktierten Bedingungenerfüllenkönnen.Seit der Friedenskongreß in Versailles tagt, ist der europäischeKrieg in Permanenz erklärt — Russen gegen alleWelt, Tschechen gegen Ungarn, Rumänen gegen Ungarn,Polen gegen Ukrainer, Südslawen gegen Deutsche, Kommunistengegen Sozialisten — drei Viertel Europas sindHexenkessel, in dem alles betrieben, nur nicht gearbeitetund produziert wird, und vergeblich fragt man sich, wiedieses sich selbst zerfleischende Europa die ihm auferlegtenKriegskosten aufbringen wird. Nach menschlicher Berechnung268ein
Eindrücke und Betrachtungenkönnen die Sieger ihre Verluste auch nicht annähernd ausden geschlagenen Staaten herauspressen und werden ihrenSieg daher mit einer bedeutenden Unterbilanz schließen.Kommt es so, dann hatte mein Gast recht — es wird nurBesiegte geben.Wenn unser Vorschlag vom Jahre 1917: Deutschland trittElsaß-Lothringen an Frankreich ab, erhält dafür den Anschlußdes gesamten vereinigten Polen inklusive Galiziens,und alle Staaten rüsten ab — wenn dieser Vorschlag damalsin Berlin angenommen und von der Entente genehmigtworden wäre, wenn nicht das Non possumus in Berlin undder römische Widerstand gegen eine Abänderung des LondonerPaktes jede Aktion verhindert hätten — mir willscheinen, der Vorteil wäre kein einseitig den Mittelmächtenzugutekommender gewesen.Auch Pyrrhus siegte bei Asculum.An verschiedenen Stellen, welche während meiner Amtszeitberechtigter- und unberechtigterweise in die Politik hineingesprochenhaben, wurde mit dem Gedanken geliebäugelt,einen Keil zwischen Nord- und Süddeutschland zu treibenund letzteres im Gegensatz zu dem militaristischen Preußenzu der friedlichen Wiener Politik zu bekehren.Der Gedanke litt an verschiedenen Geburtsfehlern. Erstenswar—wie bereits entwickelt — das hervorragendste Friedenshindernisnicht nur der preußische Geist, sondern das Ententeprogrammunserer Zerstückelung, woran auch eine größereAnnäherung Bayerns und Sachsens an uns gar nichts geänderthätte. Zweitens war das sichtbar mehr und mehr zerfallendeÖsterreich-Ungarn kein Attraktionspunkt für Dresden undMünchen, welche zwar nicht preußisch, aber deutsch bis indie Knochen fühlen. Der unklare und uneingestandeneGedanke, auf die Zustände von der Zeit vor 1866 zurückzukommen,war ein Anachronismus. Drittens und26g
Eindrücke und Betrachtungenhauptsächlich aber waren alle Experimente gefährlich, welchebei der Entente den Eindruck erwecken mußten, der Vierbundlöse sich auf. Die Regie war daher bei einer solchen Politikvon kardinaler Wichtigkeit, und gerade daran fehlte esgewöhnlich an jenen Stellen.Etwas Gesundes war ja an dem Gedanken daran, und dieErnennung des bayrischen Grafen Hertling zum Reichskanzlererfolgte zwar nicht auf Wiener Betreiben, aber zuunserer größten Freude, und das Moment, eine Wahl zutreffen,welche auch in Wien befriedige, hat stets bei KaiserWilhelm mitgespielt. Mit Hertling und Kühlmann hattenzwei Bayern die Leitung des Deutschen Reiches übernommen,welche, abgesehen von ihren großen persönlichen Eigenschaften,durch ihre bayrische Abstammung ein gewissesnatürliches Gegengewicht gegen die preußische Hegemoniebildeten, — soweit es eben bei der Generalswirtschaft, dieeinmal eingerissen war, überhaupt noch möglich war. Aberweiter konnte man nicht gehen, ohne Schaden anzurichten.Ich habe mich mit dem Grafen Hertling sehr gut verstanden.Dieser kluge, abgeklärte alte Mann, welcher nurden einen Fehler hatte, zu alt und physisch nicht mehrgenügend resistenzfähig zu sein, hätte Deutschland gerettet,wenn es überhaupt im Jahre 1917 noch rettbar gewesen wäre.In dem reißenden Strudel, in welchem es seinem Untergangzuwirbelte, fand er keinen Halt mehr, um sich anzuklammern.In der letzten Zeit nahm seine Sehkraft ungemein ab.Auch ward er leicht müde, und die stunden- und stundenlangdauernden mühsamen Konferenzen und Beratungen warenüber seine Kräfte.
IX.Polen
:PatentMitvom 5. November 1916 haben die beidenKaiser das Königreich Polen als bestehend erklärt.Bei meinem Amtsantritte fand ich die Situation vor, daßdie Polen gereizt gegen meinen Amtsvorgänger waren, weilsie behaupteten, Deutschland habe uns das neugeschaffeneKönigreich Polen überlassen wollen, und Graf Burian hättedieses Angebot abgelehnt. Es scheinen bei dieser VersionMißverständnisse obgewaltet zu haben, denn Burian hatdiese Darstellung als falsch bezeichnet.Die Behandlung der polnischen Frage war, neben allemanderen, aus drei Gründen mit den allergrößten Schwierigkeitenverbunden. Der erste Grund war die ganz verschiedeneAuffassung, welche die kompetenten Faktoren der österreichisch-ungarischenMonarchie hierüber hatten. Währendsich das österreichische Ministerium der sogenannten austropolnischenLösung gegenüber wohlwollend verhielt, setzteGraf Tisza derselben den allergrößten Widerstand entgegen.Er stand auf dem Standpunkte, daß die politische Strukturder Monarchie durch die Angliederung Polens nicht geändertwerden dürfe, und daß Polen eventuell als österreichischeProvinz, aber niemals als trialistischer Faktor der Monarchieangeschlossen werden dürfe.Bezeichnend für seinen Gedankengang ist ein Brief, welchener mir am 22. Februar 191 7 — also sehr bald nach meinemAmtsantritte — de dato Budapest schrieb. Derselbe lautet18 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 273
Polen„Hochgeborener Graf!Es steht mir fern, Diskussionen über Fragen anzuregen,welche heute keine Aktualität besitzen und höchstwahrscheinlichauch bei Friedensschluß eine solche nicht erreichenwerden. Andererseits jedoch möchte ich die Gefahr vermeiden,daß irrtümliche Schlüsse aus dem Umstände abgeleitetwerden, daß ich gewisse, in der Korrespondenz unsererdiplomatischen Vertreter wahrgenommene Erscheinungenstillschweigend hingenommen habe.Ausschließlich von diesem Gesichtspunkte geleitet, beehreich mich, die Aufmerksamkeit Euer Exzellenz auf den Umstandzu lenken, daß die sogenannte austro-polnische Lösungder polnischen Frage wiederholt, so z. B. im Telegramm Nr. 63des Herrn von Ugron, als die trialistische bezeichnet wurde.Dieser Benennung gegenüber bin ich bemüßigt, auf denUmstand hinzuweisen, daß in der ersten Periode des Krieges,also zur Zeit, wo die austro-polnische Lösung im Vorder-kompetenten Faktoren der Monarchie sichgrund stand, alledarin geeinigt hatten, daß eine Angliederung Polens an dieMonarchie die dualistische Struktur derselben unterkeinen Umständen tangieren dürfe.Es wurde dieses Prinzip von den damaligen Leitern desMinisteriums des Äußern und den beiden Ministerpräsidentenausdrücklich anerkannt und von weil. Seiner MajestätKaiser und König Franz Joseph genehmigend zur Kenntnisgenommen. Ich hoffe, annehmen zu dürfen, daß dieseAuffassung auch von Euer Exzellenz geteilt wird, jedenfallsmuß ich aber, um Mißverständnissen vorzubeugen, erklären,daß die Königlich ungarische Regierung hierin einenGrundpfeiler ihres ganzen politischen Systems erachtet, vonwelchem sie unter keinen Umständen abzuweichen in derLage wäre.Es wäre dies unseres Erachtens nach verhängnisvoll fürdie ganze Monarchie. Bei der Unsicherheit der Situation im274
Polenösterreichischen Staate, wo das deutsche Element auchnach Abtrennung Galiziens eine höchst unsichere Stellungeinnehmen und sich mächtigen Strömungen gegenübergestelltbefinden würde, welche leicht die Oberhand gewinnen könnten,falls ein relativ geringerer Teil der Deutschen, sei es aussozialdemokratischen, sei es aus politisch-reaktionären oderkonfessionellen Gründen, sich von den übrigen deutschenParteien loslöst, würde die Einstellung des neuen polnischenElementes als eines mit Österreich und Ungarn gleichwertigendritten Faktors in unseren konstitutionellen Organismus einsolches Element von Unsicherheit bedeuten, wäre mit solchenRisiken für die weitere Orientierung der Politik der HabsburgischenGroßmacht verbunden, daß es mich vom Standpunkteder Großmachtstellung der Monarchie nur mit dengrößten Besorgnissen erfüllen würde, falls das neue, uns inso vielerHinsicht fremd gegenüberstehende, vom Gesichtspunkteder Lebensinteressen sowohl Österreichs als Ungarnsso wenig verläßliche russisch-polnische Element eine sopräponderante Rolle erhalten würde.Nur das Festhalten am Dualismus, laut welchem die Hälftedes politischen Einflusses auf die gemeinsamen AngelegenheitenbeiUngarnbleibt und das ungarische und deutscheElement vereint über die sichere Majorität in denDelegationen verfügt, kann sowohl der Dynastie als denbeiden unter ihrem Zepter verbundenen Staaten genügendeBürgschaft für die Zukunft geben.Es gibt keinen anderen Faktor in der Monarchie, dessensämtliche Lebensinteressen so ganz und gar mit denjenigender Dynastie und der Großmachtstellung der Monarchie verwachsenwären, als Ungarn. Auch die wenigen, bei denen dieklare Einsicht dieser Wahrheit während der letzten friedlichenJahrzehnte in Vergessenheit geraten war, sind durchden jetzigenKrieg eines Besseren belehrt.Die Aufrechterhaltung der Donaumonarchie als einerlebenskräftigen, aktionsfähigen Großmacht ist im wahrsteni8«275
PolenSinne des Wortes eine Lebensbedingung für die Existenz desungarischen Staates. Es war eine Fatalität für uns alle,daß gerade dieses mit so vielem staatlichen Sinn ausgestattete,für alle staatlichen und nationalen Ziele so opferfreudigeVolk sich Jahrhunderte lang nicht ganz dem Dienste dergemeinsamen Sache widmen konnte. Das Ringen um dieLösung des weltgeschichtlichen Problems, wie die Bedürfnisseder Großmachtstellung mit der Unabhängigkeit des ungarischenStaates in Einklang zu bringen seien, hat schwereErprobungen, jahrhundertelange Reibungen und Kämpfeheraufbeschworen.Der Drang Ungarns nach Unabhängigkeit hat nicht dieForm von Loslösungsbestrebungen angenommen. Die großenFührer unserer Freiheitskämpfe haben den Fortbestand derHabsburgischen Großmacht nicht angegriffen. Auch in denschweren Erprobungen dieser Kämpfe haben sie kein anderesZiel verfolgt, als die Sicherung der . verbrieften nationalenRechte von der Krone zu erhalten. •Frei und unabhängig wollte Ungarn unter dem Zepterder Habsburger bleiben, es wollte unter keine fremde Herrschaftgelangen, es wollte ein freies Volk bleiben, welchesvon seinem König nach seinen Gesetzen regiert wird undkeinem anderen Willen untergeordnet ist. Wiederholt wurdedies Prinzip in Staatsgrundgesetzen in feierlichster Formausgesprochen (so in den Jahren 1723 und 1791), und eswurde endlich im Ausgleiche des Jahres 1867 die Lösunggefunden, welche es zur lebendigen Wahrheit machte undseine Durchführung in einer für die Großmachtstellunggünstigen Weise sicherte.In der Vorbereitungsperiode des Siebenundsechziger Ausgleicheswar Ungarn ein armer und verhältnismäßig kleinerTeil der damaligen Monarchie, und es haben doch damals diegroßen Staatsmänner Ungarns ihren staatsrechtlichen Planauf den Dualismus und die Parität begründet, denn es istdies die einzige Möglichkeit, die bei so vielen Gelegenheiten276
Polenanerkannte und beschworene Unabhängigkeit Ungarns imRahmen des modernen konstitutionellen Staatslebens zuverwirklichen.Eine politische Struktur der Monarchie, welche die Möglichkeitfür Ungarn bedeuten würde, in den allerwich tigstenBeziehungen des Staatslebens majorisiert und hierdurcheinem fremden Willen unterworfen zu werden, würde wiederalles zunichte machen, was nach so vielem Ringen undLeiden, so vielem nutzlosen Kraftverlust endlich zum Wohlevon uns allen erreicht wurde und auch in diesem Kriegeseine segensreichen Früchte trägt. Es müßten sich dahergerade jene, die sich stets treu und fest für den 1867er Ausgleicheingesetzt hatten, gegen ein jedes trialistisches Experimentmit vollem Nachdrucke einsetzen.Ich würde es sehr bedauern, wenn bezüglich dieser FrageMeinungsverschiedenheiten unter den jetzigen verantwortlichenpolitischen Leitern der Monarchie vorliegen würden.Auch für diesen Fall hielte ich es für unnötig, diese nichtaktuelle Frage jetzt zum Austrage zu bringen. Jedenfallswären jedoch im Verkehre mit den Polen Ausdrücke zuvermeiden, welche für den, wenn auch nicht wahrscheinlichen,doch nicht unmöglichen Fall eines neuen Hervortretens deraustro-polnischen Lösung Erwartungen inihnen großziehenwürden, welche nur die schwersten Komplikationen zurFolge haben könnten.Die besonneneren Polen hatten sich ja damit abgefunden,daß die dualistische Struktur der Monarchie nicht angetastetwerden kann, und daß die Angliederung Polens in Formeines Anschlusses an den österreichischen Staat mit weitgehenderAutonomie zu erfolgen hätte, und es wäre inhöchstem Grade unvorsichtig und schädlich, Aspirationenneu zu beleben, deren Verwirklichung nicht nur vomungarischen Standpunkte, sondern auch vom Gesichtspunkteder Zukunft der Monarchie in höchstem Grade bedenklicherscheint.277
PolenGenehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichnetenHochachtung.Budapest, am 22. Februar 1917. T.r (tDie Frage, wie das zukünftige Polen zu der Monarchiegestellt werden würde, blieb immer ungeklärt; ich vertratunausgesetzt den Standpunkt, daß Polen als selbständigesReich angegliedert werden müsse, Tisza wollte eine Provinzdaraus machen. Als der Kaiser Tisza entließ, obzwar derselbedie Majorität des Parlamentes für sich hatte, änderte sichauch in der polnischen Frage die Situation nicht. DennWekerle mußte sich dem Standpunkte Tiszas in diesen wieungefähr in allen anderen Fragen anpassen, da er sonst inder Minorität war.Die Wahlreformfrage war nicht der eigentliche Grund derEntlassung Tiszas, denn seine Nachfolger konnten aus demoben angeführten Grunde nur so handeln, wie Tisza es befahl,und als Führer der Majorität, der er auch nach seiner Entlassungblieb, konnte gegen seinen Willen keine Wahlreformgemacht werden. Tisza dachte, daß der Kaiser eine koalierteMajorität gegen ihn zu schmieden gedenke, und fand dasnicht erfreulich,aber logisch.Die zweite Schwierigkeit war die Haltung der Deutschengegenüber Polen. Schon bei der Besetzung Polens hattenwir schlecht abgeschnitten, und die Deutschen hatten denüberwiegenden Teil des Landes mit Beschlag belegt. Siewaren dieStärkeren auf dem Schlachtfelde, immer und beijeder Gelegenheit, und sie zogen daraus die Konsequenz,auch bei jedem Erfolge den Löwenanteil für sich indaß sieAnspruch nahmen. Das war im Grunde nicht einmal unlogisch,aber die diplomatische und politische Tätigkeit wurde dadurchungemein erschwert, da sie stets durch die militärischenTatsachen präjudiziert und in die Hinterhand versetzt wurde.Deutschland also stand, als ich ins Amt trat,auf dem Standpunkte,es habe ein überwiegendes Recht auf Polen, und die278
Poleneinfachste Lösung wäre die, daß wir das von uns besetzteGebiet räumen. Es war selbstverständlich klar, daß ich einsolches Ansinnen nicht annehmen konnte und mich auf denStandpunkt stellen mußte, unsere Truppen würden unterkeinen Umständen Lublin verlassen.Die Deutschen fandensich nach langen Kontroversen tant bien que mal mitdieser Lösung ab. In der weiteren Entwicklung hat derdeutsche Standpunkt verschiedene Varianten durchgemacht.<strong>Im</strong> allgemeinen hat er stets zwischen zweien geschwankt:entweder müsse sich Polen an Deutschland angliedern— germano- polnische Lösung — oder aber große Teileseines Gebietes unter dem Titel von Grenzrektifikationenan Deutschland abtreten, der Rest werde uns oder sichselbst überlassen werden. Beide Lösungen waren für unsnicht akzeptabel, die erste deshalb, weil durch das Auftretender polnischen Frage unsere galizische in ein akutesStadium getreten und es ausgeschlossen gewesen wäre,Galizien getrennt von dem übrigen Polen dauernd bei derMonarchie zu erhalten. Nicht also aus Eroberungsgründen,sondern aus dem Wunsche heraus, Galizien nicht zweckloszu opfern, mußten wir uns gegen die germano-polnischeLösung wehren.Die zweite deutsche Variante war ebenso undurchführbar,weil ein durch die Grenzrektifikationen bis zur Unkenntlichkeitverstümmeltes Polen, auch wenn es mit Galizien vereintworden wäre, ein dermaßen unzufriedener Faktor gewesenwäre, daß es aussichtslos geschienen hätte, mit demselbenharmonisch auszukommen.Die dritte Schwierigkeit endlich boten die Polen selber,welche zwar natürlich den denkbar größten Profit aus ihrerdurch die Zentralmächte erfolgten Befreiung schlagen wollten,selbst jedoch sehr wenig zu ihrem zukünftigen Glück, soweitdie militärische Unterstützung in Betracht kam, beitrugen.Bei ihnen herrschten verschiedene Strömungen. Die erstewar für die Entente. Die zweite, so vor allem Bilinski,279
:Polenwar für die Mittelmächte besonders dann, wenn es unsmilitärisch gut ging.<strong>Im</strong> allgemeinen war die polnische Politik die, sich möglichstwenig für eine der Gruppen zu exponieren und sichzum Schlüsse den Siegern anzuschließen. Man muß zugeben,daß diese Taktik Erfolg gehabt hat.Abgesehen von diesen Schwierigkeiten herrschte in denpolnischen politischen Kreisen fast stets eine große nervöseErregung, welche ein ruhiges sachliches Verhandeln ungemeinerschwerte. Schon in der ersten Zeit traten Mißverständnissezwischen den polnischen Führern und meiner Wenigkeit überdas, was ich beabsichtigte, auf — Mißverständnisse, welchesich zum Schlüsse meiner Tätigkeit bis zu einer erbittertenFeindschaft der Polen gegen mich steigerten. Am 10. Februar1917, also ein volles Jahr vor Brest-Litowsk, erhieltich die Nachricht aus Warschau, daß Herr von Bilinskianscheinendin Verkennung meines durch die Tatsachen gegebenenStandpunktes Hoffnungen für Zusagen nehme unddadurch die polnischen Erwartungen über das berechtigteMaß steigere. Ich telegraphierte daher an unsern Vertreternachstehendes,,16. Februar 1917.Ich habe Herrn von Bilinski sowie verschiedenen anderenPolen erklärt, daß es unmöglich ist, bei der ungeklärteneuropäischen Situation polnische Projekte für die Zukunftüberhaupt zu machen. Ich habe erklärt, daßdie von allen unseren Polen ersehnte ,austro-polnischeLösung' auch meine Sympathie findet, daß ich aber nicht inder Lage sei, zu sagen, ob diese Lösung erreichbar sein wird,ebensowenig wie ich das Gegenteil heute voraussagen könnte.Ich habe endlich erklärt, daß unsere ganze Politik bezüglichPolens nur darin bestehen kann, uns für alle zukünftigenEventualitäten die Türen offen zu halten."Ich fügte bei, unser Vertreter möge sich bei dieser Richtigstellungauf meinen direkten Auftrag berufen.280
Polen<strong>Im</strong> Januar 1917 wurde über die polnische Frage beraten,eine Beratung, welche bezweckte, im großen und ganzen dieRichtlinien der einzuschlagenden Politik festzulegen. Ichentwickelte vorerst die Modalitäten des früher erwähntendeutschen Ansuchens, wir möchten Lublin räumen, undjene Gründe, welche mich verhalten hatten, diesem Wunschenicht Folge zu leisten.Ich betonte, daß es mir nicht wahrscheinlichschiene, daß der Krieg mit einem Diktatfriedenunsererseits beendigt werden würde, das hieße, aufPolen angewendet, daß wir auch die polnische Frage nichtohne Zutun der Entente würden lösen können, und daßes daher nicht viel Zweck habe, so lange der Krieg dauere,faits accomplis zu schaffen. Die Hauptsache sei, im Landedrinnen zu bleiben und bei Friedensschluß im Verhandlungs--wege gemeinsam mit der Entente und den Bundesgenossendie austro-polnische Lösung zu erreichen. In diesemSinne sei die Politik zu führen. Nach mir sprach GrafTisza, welcher mir darin zustimmte, dem deutschenPostulat nach der Räumung Lublins nicht nachgegebenzu haben. Bezüglich der Zukunft betonte der ungarischePremier, daß er stets auf dem Standpunkte gestanden sei,unser Anrecht auf Polen gegen wirtschaftliche und finanzielleKompensationen an Deutschland zu überlassen. Ersei aber seinerzeit mit dieser Ansicht nicht durchgedrungen.Das zur Zeit bestehende Kondominium sei vor allem wegender Sprunghaftigkeit der deutschen Politik unhaltbar, under, Graf Tisza, komme daher zu seiner bereits wiederholtbetonten Ansicht zurück, wir mögen trachten, uns baldigstmit Ehren aus der Affäre zu ziehen. Kein Kondominium,welches nur zu weiteren Reibungen führen müsse, sondernAbtretung unseres polnischen Teiles an Deutschland gegenwirtschaftliche Kompensationen.Der österreichische Ministerpräsident Graf Clam vertratdemgegenüber den österreichischen Standpunkt, nach welchemdie Vereinigung aller Polen unter Habsburgischem281
PolenZepter die einzig wünschenswerte Lösung und daher dieaustro-polnische Formel anzustreben sei.Die Debatte klang dahin aus, daß die Tür zu der austropolnischenLösung nicht zugeschlagen werden solle, und daßwir in Anbetracht der Unmöglichkeit einer momentanendefinitiven Lösung an der Politik festhalten sollten, welchedie zukünftige Vereinigung aller Polen unter HabsburgischemZepter ermögliche.Nach Ablehnung des Vorschlages seitens Deutschlands,Galizien als Kompensation für Elsaß-Lothringen zu benützen,ist über viele Phasen und Varianten hinüber an diesem Programmfestgehalten worden, bis die immer größer werdendendeutschen Grenzberichtigungswünsche eine Situationschufen, welche die Lebensfähigkeit des austro-polnischenGedankens stark in Zweifel zog. Wenn wir kein Polen schaffenkonnten, das sich dank der Vereinigung der erdrückendenMajorität aller Polen zufrieden und freiwillig der Monarchieanschloß, so wäre die austro-polnische Lösung kein Glückgewesen, denn wir hätten zu den vielen unzufriedenen Elementender Monarchie nur noch neue hinzugesellt. Da dervon General Ludendorff ausgehende Widerstand nicht zubrechen war, so trat in einem späteren Stadium vorübergehendder Gedanke auf, statt Polens den Anschluß Rumäniensan die Monarchie zu erstreben. Das war die Wiederaufnahmedes alten Gedankens Franz Ferdinands, die VereinigungRumäniens mit Siebenbürgen und des engenAnschlusses an die Monarchie. Wir hätten in diesem FalleGalizien an Polen verloren, hätten aber in Rumänien einegewisse Kompensation dafür erhalten, sowohl was Getreideals was Erdöl anbelangt, und für die Monarchie wie für diePolen schien es besser, letzteres geeint an Deutschland anzuschließen,als es <strong>info</strong>lge der Wien-Berliner Zwistigkeitenzu zerreißen.Dem Gedanken des rumänischen Anschlusses standen nunwieder fast unüberwindliche interne Schwierigkeiten gegenüber.282
Pol«nDank seiner geographischen Lage hätte dieser AnschlußRumäniens selbstverständlich an Ungarn erfolgen müssen.Tisza, welchem der Gedanke an und für sich nicht sympathischwar, hätte demselben zugestimmt, wenn das angegliederteRumänien von Pest aus und im magyarischen Sinne verwaltet,das heißt Ungarn inkorporiert worden wäre. Dasmußte aus naheliegenden Gründen den ganzen Gedankenillusorisch machen, denn die Rumänen hätten keinen Vorteilvon ihrer Vereinigung gehabt, wenn sie ihre nationaleSelbständigkeit dabei hätten einbüßen müssen. Auf deranderen Seite erhob das österreichische Ministerium berechtigteWidersprüche dagegen, daß an eine zukünftigeKombination gedacht werde, bei welcher Ungarn um einreiches und großes Land vergrößert, Österreich um einebensolches verkleinert werde, und verlangte Kompensationenin irgendeiner Form. Vorübergehend tauchte der Gedankeauf, Bosnien und die Herzegowina als Ersatz definitiv anÖsterreich anzuschließen — aber alle diese Gedanken undPläne waren mehr transitorischer Natur, geboren aus denin Berlin und Warschau stets sich erneuernden Schwierigkeiten,und sie wurden wieder fallen gelassen, als es sichherausstellte, daß die in dem Dualismus begründeten Hindernisseso groß seien, daß sie unüberwindlich schienen. Mankam auf den ursprünglichen Gedanken der austro-polnischenLösung zurück, obwohl es unmöglich war, eine positive Erklärungder Deutschen über eine akzeptable WestgrenzePolens zu erlangen. Erst in der allerletzten Zeit meinerAmtstätigkeit trat der rumänische Gedanke wieder in denVordergrund, teils wegen der über die Cholmer Frage erbittertenPolen, teils wegen der von Deutschland verlangten,die austro-polnische Lösung unmöglich machenden eigenenForderungen.Parallel mit diesen Bestrebungen ging das Projekt über dieZukunftskonstellation der Monarchie überhaupt. Der Kaiserstand auf dem, wie mir heute noch erscheint, richtigen383
PolenStandpunkte, daß das Gefüge der Monarchie auch nacheinem erträglichen Ausgang des Krieges werde geändertwerden müssen, und daß ein Neuaufbau auf einer viel ausgesprochenerennationalen Basis notwendig sein werde. Aufdie Polen angewendet hieß dieses Projekt eine TeilungOst- und Westgaliziens und eine selbständige Stellung desruthenischen Teiles.Als ich in Brest-Litowsk unter dem Drucke der ausbrechendenHungerrevolten nicht den ukrainischen Forderungenzustimmte, aber meine Zustimmung gab, die Frageder Teilung Galiziens dem österreichischen Kronratezu unterbreiten, leitete mich dabei der Gedanke, daß wirmit einer solchen Aktion streng in dem Bilde jenes Programmesblieben, welches überhaupt für die Monarchieprojektiertwar.Ich spreche des näheren über die Details dieser Frage indem nächsten Kapitel, doch will ich hier nur als Beispiel,welchen Grad die feindliche Verhetzung gegen mich annahm,folgenden Fall konstatieren. Von manchen Seiten wurde dasGerücht ausgesprengt, der Kaiser habe den Polen erklärt,„ich hätte den Frieden mit der Ukraine ohne sein Wissenund gegen seinen Willen geschlossen". Es ist ganz ausgeschlossen,daß der Kaiser eine solche Erklärung abgegebenhaben konnte, da ja die Friedensbedingungen mit Kiew dasResultat eines ad hoc einberufenen Kronrates waren, inwelchem — wie das Protokoll dies beweist — der Kaiser undDr. Seidler die Bedingungen befürworteten.Die große Empörung der Polen über mein Vorgehen inBrest-Litowsk war auch sonst unbegründet. Ich habe denPolen niemals den Cholmer Kreis versprochen, mich überhauptniemals auf bestimmte Grenzen festgelegt, und wennich dies getan hätte, so hätte ich bei den politisch sehr klugenpolnischen Führern keinen Glauben gefunden, denn siewußten sehr genau, daß diese Grenzen zum geringsten Teile284
Polenvon Wiener Beschlüssen abhängen.Verloren wir den Krieg,hatten wir nicht mehr mitzusprechen, kam es zu einemAusgleichsfrieden, so war Berlin der mächtigere Teil, welcherden größten Teil des Landes okkupiert hatte, — die Fragewäre aber dann auf der gemeinsamen Konferenz entschiedenworden.Ich habe immer wieder den verschiedenen polnischenFührern erklärt, daß ich ein möglichst zufriedenes, daherauch in seinen Grenzansprüchen denkbar saturiertes Polenerhoffe (es hat Momente gegeben, wo wir diesem Ziele sehrnahe schienen), aber nie ein Hehl darausgemacht, daß meinenWünschen durch alle möglichen Einflüsse sehr enge Grenzengezogen seien,- respektive daß sie auf sehr labiler Basisständen. Die Zweiteilung Galiziens war eine interne FrageÖsterreichs. Dr. Seidler setzte sich warm für dieselbe einund gab im Kronrate der Hoffnung Ausdruck, diese Maßregelauf parlamentarischem Wege und gegen den Widerspruchder Polen durchzusetzen.Auch über diese Frage spreche ich in dem nächstenKapitel.Eng mit der polnischen Frage hing das sogenannte „mitteleuropäische"Projekt zusammen.Deutschland hatte aus naheliegenden und sehr begreiflichenGründen ein lebhaftes Interesse an dem engeren Anschlüsse,und mich leitetestets der Gedanke, diese wichtigeKonzession im richtigen Momente zu verwerten, um eventuelledeutsche Opfer damit zu kompensieren und dergestalteinen Verständigungsfrieden zu fördern.In der ersten Zeit meiner Amtstätigkeit hoffte ich nocheine Revision des Londoner Paktes zu erreichen.Ich hoffte,wie schon erwähnt, die Entente werde nicht bei diesemgefaßten Beschlüsse der Zertrümmerung der Monarchiebleiben, und ich trat daher der mitteleuropäischen Fragenicht näher, weil deren Aufwerfen unsere Lage Paris undLondon gegenüber noch mehr kompliziert hätte. Als ich285
Polenspäter erkennen mußte, daß die Entente starr an den Beschlüssen,uns unter allen Umständen aufzuteilen, festhieltund eine Änderung ihrer Absichten, wenn überhaupt,so nur durch militärische Gewalt möglich sei, versuchteich, die Bedingungen des mitteleuropäischen Gedankensins Detail ausarbeiten und klarlegen zu lassen und sodanndiese fertiggestellte, an Deutschland zu vergebendeKonzession aufzubewahren und im richtigen Momenteauszuspielen.Dabei schien mir die Zollunion wenigstens vorerst untunlich,hingegen ein neuer engerer Handelsvertrag erwünscht,eine engere Verbindung der — hoffentlich nach dem Kriegestark reduzierten — Armeen jedoch ungefährlich. Ich warder Überzeugung, daß ein Verständigungsfrieden die Abrüstungmit sich bringen und daher die Wichtigkeit militärischerAbmachungen stark beeinflussen werde, ferner,daß der Friedensschluß ein anderes Verhältnis allerStaatenzueinander nach sich ziehen werde — daß also die politischenund militärischen Bestimmungen des mit Deutschland zutreffenden Abkommens nicht so wichtig seien wie die wirtschaftlichen.Die Ausarbeitung dieses Programmes begegnete jedoch demheftigsten Widerspruche des Kaisers. Insbesondere war erallen militärischen Annäherungen abgeneigt.Als der Versuch, der Frage näherzutreten, an der Resistenzder Krone scheiterte, ordnete ich auf eigene Faustdie Beratungen der wirtschaftlichen Fragen an. Der Kaiserschrieb mir darauf einen Brief, worin er weitere Verhandlungenuntersagte. Ich erwiderte dieses Schreiben durcheinen sachlichen Bericht, mit welchem ich die Notwendigkeit,die Verhandlungen fortzusetzen, betonte.Die Frage wurde dann zwischen dem Kaiser und mir zueinem „wunden Punkte". Er gab seine Erlaubnis zu weiterenVerhandlungen nicht; ich setzte sie jedoch trotzdem fort.Der Kaiser wußte dies, kam aber nicht mehr auf sein Verbot286
Polenzurück. Die großen Ansprüche der Deutschen erschwertendie Verhandlungen nebenbei ungemein, so daß sie sich mitgroßen Intervallen in schleppendem Tempo bis zu meinemAmtsaustritte hinzogen.Nach demselben fuhr der Kaiser mit Burian in das deutscheHauptquartier. Anschließend daran fanden dann die SalzburgerVerhandlungen, anscheinend in verstärkterem Tempo,ihren Fortgang.
X.Bresl>Lito\vsk19
<strong>Im</strong> Sommer 1917 bekamen wir Nachrichten, welche denbevorstehenden Frieden mit Rußland als wahrscheinlichschienen ließen. Ein Bericht vom 13. Juni 1917, welchen ichaus dem neutralen Auslande erhielt,lautete:„Die russische Presse, bürgerliche und sozialistische,spiegelt folgende Vorgänge wider:An der Front und im Hinterlande herrscht ein erbitterterMeinungsstreit über die von den Bundesgenossen geforderteund nun auch von Kerenski mit großem Aufwände vonReisereden propagierte Offensive gegen die Zentralmächte.Die Bolschewiki, also die Sozialdemokraten unter der FührungLenins, und ihre Presse treten in entschiedener Weisegegen eine solche Offensive auf. Aber auch ein großer Teilder Menschewiki, also der Partei Tscheidses, der diegegenwärtigenMinister Tseretelli und Skobelew angehören, istgegen die Offensive, und diese Meinungsverschiedenheit auchin dieser Frage bedroht die ohnehin nur mit Mühe gewahrteEinheit der Partei.Ein Teil der Menschewiki, die sogenanntenInternationalisten, weil sie die Internationale wiederherstellen wollen, auch Zimmerwalder oder Kienthaler genannt,unter der Führung des aus Amerika zurückgekehrtenTrotzki (recteBronstein), dann der aus der Schweiz zurückgekehrtenLarin, Martow, Martynow usw., steht in dieserFrage wie in der des Eintrittes der menschewistischenSozialdemokraten in die provisorische Regierung in19* 2QI
Bre^t-Litow-kentschiedenem Gegensatz zur Parteimajorität.Dafür ist LeoDeutsch, einer der Begründer der marxistischen Sozialdemokratie,offen am Parteitage aus der Partei ausgeschieden,weil sie ihm zu wenig patriotisch ist und nichtden Endsieg verlangt. Er ist mit Georgij Plechanow eineder Hauptstützen der russischen , Sozialpatrioten', die nachihrer Zeitung die Gruppe ,Echinstvo' heißt, aber weder anZahl noch an Einfluß irgendwie in Betracht kommt. Sokommt es, daß das offizielle Organ der Menschewiki, die,Rabocaja Gazeta', eine Mittelstellung einzunehmen gezwungenist und z. B. mehr Artikel bringt, die gegen eineOffensive Stimmung machen.Von der Partei der Sozialrevolutionäre, die der AckerbauministerTschernow im Kabinett vertritt,und die vielleichtdie stärkste russische Partei wird, weil es ihr gelungen ist,die ganze Bauernbewegung in ihre Bahnen zu leiten —wurden doch auf dem allrussischen Kongresse der Bauerndeputiertenüberwiegend Sozialrevolutionäre und kein Sozialdemokratin das Exekutivkomitee des Bauerndeputiertenratesgewählt —, ist auch ein Teil, und wie es scheint dergrößere und einflußreichere, entschieden gegen eine Offensive.Dies tritt deutlich in den Hauptorganen der Partei,Dclo Naroda' und ,Zemlja i Wolja' hervor. Nur ein kleinerund anscheinend einflußloser Teil, der um das Organ ,VoljaNaroda' gruppiert ist, tritt wie die Plechanowgruppe unbedingtfür eine Offensive zur Entlastung der Verbündetengleich der bürgerlichen Presse ein. Hingegen ist die ParteiKerenskis, die Trudowiki, wie auch die ihnen nahestehendenVolkssozialisten, die der Ernährungsminister Peschechonowim Kabinett vertritt, noch unentschieden, ob sie Kerenskiauf diesem Wege folgen soll. Mündliche Informationen undÄußerungen der russischen Presse, wie z. B. der ,Retschij',besagen, daß der Gesundheitszustand Kerenskis den Eintritteiner letalen Katastrophe in naher Zeit befürchten lasse.Dasoffizielle Organ des Arbeiter- und Soldatendeputiertenrates,292
Brest-Litowskdie .Iswestija', betont hingegen häufig sehr nachdrücklich,daß eine Offensive unbedingt gemacht werden müsse.Es ist bezeichnend, daß eine Rede des AckerbauministersTschernow am Bauernkongresse die Deutung erfuhr, daßer gegen die Offensive sei, und er genötigt war, sich gegenüberseinen Ministerkollegen wegen dieser Deutung zu rechtfertigen.Während also im Hinterlande über dieFrage einer Offensiveein heftiger Meinungsstreit herrscht, ist man an derFront nach den Meldungen der russischen Presse allerParteien, die diese Symptome teilweise mit Freude, teilweisemit Trauer kommentiert, wenig geneigt, eine solche Offensivezu machen. Vor allem ist die Infanterie gegen eine Offensive.Kriegsbegeisterung herrscht nur bei den Offizieren, derKavallerie oder einem Teile derselben und beider Artillerie.Bezeichnenderweise sind auch die Kosaken für den Krieg.Diese haben allerdings auch einen anderen Grund, durcheinen Erfolg an der Front eventuell das revolutionäre Regimezu stürzen. Während nämlich sonst die russischen Bauern meistüber kein Land über fünf Desjatinen verfügen, drei Millionensogariandlos sind, hat jeder Kosak vierzig Desjatinen, und beiErörterungen des Agrarproblemes wird auf diese Ungerechtigkeitimmer wieder hingewiesen. Das ist ein genügenderAnlaß für die Sonderstellung, die die Kosaken in der Revolutioneinnehmen und weshalb sie früher immer dietreuesten Stützen des Zaren waren.Äußerst bezeichnend für die Stimmung an der Front sindfolgendeEinzelheiten:In der Sitzung vom 30. Mai des Allrussischen Kongressesder Offiziersdelegierten machte nach den Mitteilungen der,Retschij' vom 31. Mai ein Vertreter der Offiziere des3. Elisa bethgrader Husarenregimentes, der für eine Offensiveeintrat, folgende charakteristische Mitteilung: ,Ihr alle wißt,welches Ausmaß dieUnordnung an der^ Front angenommenhat. Die Infanterie durchschneidet die Drahtleitungen, die293
Brest-Litow^ksie mit ihrer Batterie verbinden. Die Infanterie erklärt, daßSoldaten mehr als einen Monat an der Front nichtdiemehr bleiben, sondern nach Hause gehen würden.' •Sehr instruktiv ist auch der Bericht eines Frontdelegierten,der die französischen und englischen Mehrheitssozialisten andie Front begleitet hat. Diesen Bericht druckte das Organder Menschewiki, also Tscheidses, Tseretellis und Skobelews,die ,Rabocaja Gazeta', unter dem 18. und 19. Mai ab. Eswurde diesen Ententesozialisten mit aller Deutlichkeit ander Front gesagt, daß die russische Armee für die imperialisti-Englands und Frankreichs weder weiterkämpfenschen Zielewolle noch könne. Die Lage des Transportwesens, desProviantes und der Furage sowie die Gefährdung derrevolutionären Errungenschaften durch einen sich nochweiter hinziehenden Krieg erfordern die rasche Beendigungdes Krieges. Diese Stimmung an der Front sei von denenglischen und französischen sozialistischen Delegierten nichtohne Unwillen entgegengenommen worden. Nun wurde dazuvon ihnen verlangt, daß sie auch die Verpflichtung übernehmenmüßten, an der Westfront (in Frankreich) dieserussischen Erfahrungen mitzuteilen.Sehr üble Worte fielenauch über Amerika; russische Frontvertreter sprachen offenvon der Ausbeutungspolitik Amerikas gegenüber Europa undden Alliierten. Daneben wurde die rascheste Einberufungeiner internationalen sozialistischen Konferenz und derenBeschickung und Unterstützung von den englischen undfranzösischen Mehrheitssozialisten gefordert. In einer derVersammlungen an der Front wurde den französischen undenglischen Sozialisten folgende Antwort zuteil:,Teilen Sie Ihren Genossen mit, daß wir von Ihren Regierungenund Völkern feste Erklärungen über den Verzichtauf Eroberungen und Kontributionen erwarten. Wir werdenkeinen Tropfen Blutes für die <strong>Im</strong>perialisten, seien diesRussen, Deutsche oder Engländer, vergießen. Wir erwartenrascheste Übereinkunft unter den Arbeitenden aller Völker294
Brest-Litow«küber die Beendigung des schmählichen und für die russischeRevolution unheildrohenden, weil sich hinziehenden Krieges.Wir werden keinen Separatfrieden schließen, aber sagen Sieden Ihrigen, daß sie selbst rasch ihre Kriegsziele mitteilen.'Nach dem Berichte seien die französischen Sozialisten vollständigumgestimmt worden. Das scheint auch durch dieMeldungen über die Haltung Cachins und Moutets am französischenSozialistenkongreß bestätigt zu werden. Hingegenwaren die Engländer unnachgiebig bis auf Sanders, der sichden Russen etwas näherte.Nach einer privaten Information im hiesigen AuswärtigenAmte wurde auf den Munitionsminister Thomas ander russischen Front bei einer seiner Kriegsreden geschossen.Die Desorganisation an der Front schildert ein Frontsoldatoder Offizier Kuschin in derselben ,Rabocaja Gazeta' unterdem 26. Mai folgendermaßen:Jmmer klarer und deutlicher zeigt sich der leidenschaftlicheDrang nach einem Frieden, sei es welcher Friede immer, jaselbst einem Separatfrieden mit Verlust von zehnGouvernements, um nur von den Leiden des Kriegeserlöst zu werden. Davon träumt man leidenschaftlich, wennman davon auch noch nicht auf Versammlungen und inResolutionen spricht, wenn auch alle sich bewußten Elementeder Armee mit dieser Richtung des Dranges nacheinem Frieden kämpfen.' Um das zu paralysieren, gebe esnur einen Weg : daß die Soldaten den nachdrücklichen Kampfder Demokratie um einen Frieden und die rasche Beendigungdes Krieges sehen.Der am 1./14. Juni in Petersburg zusammentretende AllrussischeKongreß der Arbeiter- und Soldatendelegiertenräteund der Armeeorganisationen der Front hat als ersten Punktder Tagesordnung : Der Krieg. Fragen der Verteidigungund des Kampfes um den Frieden. Zu diesem Zeitpunktewird die Regierung wohl mit einer Erklärung über die inPetersburg schon vor Anfang Juni eingetroffene295
:Brsst-LitowskAntwort der Verbündeten wegen der Kriegszielehervortreten müssen. Dieser Kongreß wird auch wahrscheinlichdie Beschickung der Stockholmer Konferenzendgültig beschließen und die Vertreternominieren. Als Punkt 4 steht die Nationalitätenfrage aufZwischen dem Petersburger Arbeiter- undder Tagesordnung.Soldatendeputiertenrate und dem in Kiew tagenden ukrainischenSoldatenkongresse ist wegen der Formierung einerukrainischen Armee ein offener Konflikt ausgebrochen.DieEinsetzung eines eigenen ,Ukrainischen Heeresgeneralkomitees'hat diesen Konflikt noch vertieft.Über die zunehmende innere Verwirrung, die Verschärfungdes Nationalitätenstreites, die Zuspitzung der Agrar- undIndustriefrage sollspäter noch im Zusammenhang und ausführlicherberichtet werden."Ende November schrieb ich an einen meiner Freundenachstehenden Brief, welchen ich hier in extenso wiedergebe,weil er meine damalige Auffassung der Situation getreulichwiedergibtLieber Freund!„Wien, 17. November 1917.Nach einem langen Tage, reich an Sorge, Ärger und Mühen,will ich Dir noch schreiben, um Dir auf Deine so bemerkenswertenAusführungen zu antworten; ein Kontakt mit Dirbringt mich auf andere Gedanken und läßt mich wenigstensfür eine Weile dieMisere des Alltags vergessen.Du schreibst mir, Du hättest gehört, daß es zwischen demKaiser und mir nicht mehr gut gehe, und bedauerst es. Ja,ich bedauere es auch, schon deshalb, weil es die Friktionender täglichen Arbeitsmaschine bis zur Unerträglichkeitsteigert. Denn wie so etwas transpiriert — es transpiriertsehr rasch —,so stürzen sich alle männlichen und weiblichenFeinde mit erneuter Kraft auf den wunden Punkt in derHoffnung, mich zu stürzen; die guten Leute sind wie die206
;Brest-Litow^kAasgeier — das Aas bin ich — sie wittern auf Meilen, daßsie Beschäftigung finden können, und kommen angeflogen. Undwas für Lügen sie erfinden und was für Intrigen sie spinnen,um die bestehenden Differenzen zu vergrößern, ist bewunderungswürdig.Du fragst, welches denn meine so erpichtenFeinde sind?Vor allem die,welche Du selbst erratest.In zweiter Linie sind es die Feinde, die jeder Minister hat,und die in der großen Zahl derjenigen bestehen, die an seineStelle kommen wollen, und endlich ist es eine Zahl vonpolitischen Bajazzos aus dem Jockeyklub, die vergrämt sind,weil sie von mir persönliche Vorteile erhofften und ich siespazieren geschickt habe.Nr. 3 sind eine erheiternde Quantitenegligeable, Nr. 2 sind gefährlich, aber Nr. 1 sind tödlich.Lange wird es mit mir also auf keinen Fall mehr dauern.Gott sei Dank winkt die Erlösung. Ich möchte nur so gernnoch rasch mit Rußland fertigwerden und damit vielleichtdoch die Möglichkeit des allgemeinen Friedens schaffen. DieNachrichten aus Rußland verdichten sich alle dahin, daß diedortige Regierung unbedingt, und zwar schleunigst, Friedenmachen will. Die Deutschen aber sind für diesen Fall volleiZuversicht. Wenn sie ihre Massen nach dem Westen werfenkönnen, so bezweifeln sie nicht, daß sie durchbrechen, Parisund Calais nehmen und England direkt bedrohen werden.Ein solcher Erfolg aber kann den Frieden bringen, wennDeutschland dann seinerseits dazu zu bewegen ist, aufEroberungen zu verzichten. Ich kann mir wenigstens nichtvorstellen, daß die Entente nach einem Verluste von Parisund Calais nicht auf einen Frieden inter pares eingehen würdejedenfalls müßte man dann die denkbar größten Anstrengungenmachen. Hindenburg hat bis jetzt alles gehalten, was ervorausgesagt hat, das muß man ihm lassen, und ganz Deutschlandglaubt fest auch an seine bevorstehenden Erfolge imWesten — die Voraussetzung ist natürlich aber eine befreiteOstfront, d. h. der Friede mit Rußland. Der russische Friede297
Brest-Litow=kkann also die erste Sprosse auf der Leiter zum Weltfriedenwerden.Ich habe die letzten Tage verläßliche Nachrichten überdie Bolschewiken erhalten. Die Führer sind fast durchwegJuden mit ganz phantastischen Ideen, und ich beneide dasLand, das sie regieren, nicht. Aber uns interessiert natürlichin erster Linie ihr Friedenswunsch, und der scheint zu bestehen;sie können nicht weiter Krieg führen.<strong>Im</strong> Ministerium hier sind drei Richtungen vertreten; dieeine nimmt Lenin nicht ernst und hält ihn für eine Eintagsfliege,die zweite glaubt das zwar nicht, sträubt sich aberdagegen, mit einem Revolutionär dieser Sorte zu verhandeln,und die dritte besteht, soviel ich weiß, ungefähr aus mirallein und wird verhandeln, trotz möglicher Eintagsfliegeund zweifelloser Revolution. Je kürzer Lenin an der Machtbleibt, desto rascher muß verhandelt werden, denn keinespätere russische Regierung wird den Krieg wieder anfangen— und einen russischen Metternich als Partner kann ich mirnicht anschaffen, wenn er nicht da ist.Die Deutschen ,ziehen sich' und haben keine rechte Lust,zu den Verhandlungen mit Lenin zu gehen, wohl auch ausden früher erwähnten Gründen; dabei sind sie inkonsequentwie oft.Die deutschen Militärs — welche ja bekanntlich dieganze deutsche Politik leiten — haben, wie mir scheint,alles gemacht, um Kerenski zu stürzen und ,etwas anderes'an seine Stelle zu bringen. Dieses , andere' ist jetzt da undwill Frieden machen, also muß man zugreifen, wenn einemauch der Partner noch so viel Bedenken einflößt.Genaues über diese Bolschewiken ist nicht zu erfahren,d. h. besser gesagt, sehr vieles, aber widersprechendes. Siebeginnen damit, daß sie alles, was an Arbeit, Wohlstandund Kultur erinnert, zerstören und die Bourgeoisie ausrotten.Von ,Freiheit und Gleichheit' ist in ihrem Programme anscheinendkeine Rede mehr, sondern eine bestialische Unterdrückungvon allem, was nicht Proletariat ist. Die russische298
Brest-LitowskBourgeoisie ist fast so feig und dumm wie die unsere undläßt sich schlachten wie die Hammel.Gewiß ist dieser russische Bolschewismus eine europäischeGefahr, und wenn wir dieKraft hätten, außer einem erträglichenFrieden für uns auch noch gesetzliche Zustände infremden Ländern zu erzwingen, so wäre es richtig, mit diesenLeuten gar nicht zu verhandeln, nach Petersburg zu marschierenund Ordnung zu machen; diese Kraft haben wiraber nicht, denn wir brauchen den raschesten Frieden zuunserer Rettung und können den Frieden nicht erhalten,wenn die Deutschen nicht nach Paris kommen, sie könnenaber nur nach Paris, wenn wir die ganze Ostfront frei bekommen.Da schließt sich der Kreis. Alles das sind Dinge,die die deutschen Militärs selbst behaupten, und daher istes so unlogisch von ihnen, wenn sie sich jetzt anscheinendan der Person Lenins stoßen.Ich konnte vorgestern diesen Brief nicht mehr beendenund hole dies heute nach. Gestern ist wieder von einer Seite,die Du erraten wirst, der Versuch gemacht worden, mir dieVorteile eines Separatfriedens zu erklären. Ich habe mitdem Kaiser darüber gesprochen und ihm gesagt, daß diesder Vorgang eines Mannes wäre, welcher sich aus Angst vordem Tode erschießt. Ich könne es nicht machen, aber seisehr gern bereit, unter irgendeinem Motto zu gehen, undgewiß werde er Männer finden, die das zu versuchen bereitseien. Die Londoner Konferenz hat die Aufteilung der Monarchiebeschlossen, daran kann auch ein Separatfriede vonuns nichts mehr ändern. Rumänen, Serben und Italienererhalten riesige Stücke, Triest geht verloren — der Restzerfällt in einzelne Staaten, den tschechischen, polnischen,ungarischen und deutschen Teil. Der Kontakt zwischendiesen neuen Staaten wird ein sehr geringer sein — mitanderen Worten, ein Separatfriede hat das Resultat, daßdie erst verstümmelte Monarchie dann zerstückelt wird.Bis wir aber zu diesem Resultate kommen, müssen wir299
,Brest-Litowskweiterkämpfen, und zwar gegen Deutschland, welches natür- 'liehsofort mit Rußland Frieden schließen und die Monarchiebesetzen wird. Die deutschen Generale werden nicht sodumm sein, zu warten, bis die Entente über Österreich nachDeutschland einfällt, sondern dafür sorgen, daß Österreichzum Kriegsschauplatz wird. Wir beenden also damitden Krieg nicht, wir wechseln bloß den Gegner und lieferneinzelnebisher noch hiervon verschonte Provinzen, so Tirolund Böhmen, der Kriegsfurie aus, — um schließlich dochzertrümmert zu werden.Auf der anderen Seite können wir vielleicht in einigenMonaten den allgemeinen Frieden zusammen mit Deutschlandhaben — einen erträglichen Verständigungsfrieden —wenn die deutsche Offensive gelingt. Der Kaiser verhieltsich mehr schweigend. In seiner Umgebung zieht der einerechts, der andere links; wir gewinnen dabei nichts bei derEntente und verlieren immer mehr an Vertrauen in Berlin.Wenn man zum Feinde übergehen will, so möge man esmachen, le remede sera pire que le mal, aber fortwährendVerrat zu posieren, ohne ihn durchzuführen, kann ich nichtfür eine kluge Politik halten.Ich glaube, wir erreichen einen erträglichen Verständigungsfrieden;wir werden etwas an Italien verlieren und natürlichnichts anderes dafür gewinnen. Wir werden ferner diegesamte Struktur der Monarchie ändern müssen — nachArt der Föderation Danubienne, die sie in Frankreich wollen —und es ist mir allerdings noch unklar, wie man das gegenUngarn und Deutsche wird machen können. Aber ich hoffe,wir werden den Krieg überleben, und ich hoffe, sie werdendrüben die Bestimmungen ihrer Londoner Konferenz revidieren.Lasse nur erst einmal den alten Hindenburg inParis einziehen, dann wird die Entente das erlösende Wort,daß sie bereit ist, zu verhandeln, sprechen. In diesem Augenblickaber bin ich entschlossen, das Äußerste zu versuchenund öffentlich an die Völker der Mittelmächte zu appellieren300
Brest-Litowskund sie zu fragen, ob sie wegen Eroberungen weiterkämpfenoder Frieden haben wollen.So rasch wie möglich in Rußland fertig werden, dannden Vernichtungswillen der Entente brechen und einendas istFrieden — wenn auch mit Verlusten — schließen:mein Plan und die Hoffnung, von der ich lebe. Natürlichwird nach einer Einnahme von Paris alles , Maßgebende' —außer Kaiser Karl — einen ,guten' Frieden verlangen, undden bekommen wir auf keinen Fall — das Odium, ,denFrieden verdorben zu haben', werde ich auf mich nehmen.So, hoffe ich, kommen wir mit einem blauen Auge ausdem Kriege heraus. Aber die alten Zeiten kommennie mehr wieder. Eine neue Weltordnung wird unterKrämpfen und Schmerzen geboren. Ich habe das vor einigerZeit in meiner Budapester Rede unter ziemlich allgemeinerMißbilligung öffentlich gesagt.Lang ist der Brief geworden und der Abend spät. Lebewohl und lasse bald wieder von Dir hören.In alter FreundschaftDeinCzernin."Über die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk lasseich mein Tagebuch sprechen. Trotz mancher irrtümlicherAuffassungen, welche sich in den nachstehenden Aufzeichnungenfinden, und trotz verschiedener unwichtiger Detailskürze ich dieselben nicht, da sie in dieser Form ein, wie ichglaube, klares Bild der Entwicklung geben:19. Dezember 1917.Abreise von Wien, Mittwoch den 19., 4 Uhr, Nordbahnhof.Dort fand ich bereits die Herren versammelt, Gratz, Wiesner,Colloredo, Gautsch und Andrian, ferner den FeldmarschallleutnantCsicserics mit zwei Herren und Major Fleck vonBaden.Ich benützte die Reise, um Feldmarschalleutnant Csicserics301
Brest-I-itowskein Bild meiner Absichten und der einzuschlagenden Taktikzu geben. Ich erklärte ihm, daß meiner Überzeugung nachRußland den Vorschlag auf einen allgemeinen Friedenmachen werde, daß wir natürlich auf diesen Vorschlag eingehenmüßten. Ich hätte die Hoffnung, daß der allgemeineFriede in Brest angebahnt werde, noch lange nicht aufgegeben.Falls die Entente nicht annehme, dann werde derWeg wenigstens für einen Separatfrieden frei sein. Nachherhatte ich längere Unterredungen mit Sektionschef Gratz undGesandten von Wiesner, welche mehr oder weniger denganzen Tag ausfüllten.20. Dezember 1917.Um fünf Uhr einige Minuten trafen wir in Brest ein. Aufder Bahn hatte sich der Generalstabschef des Ob. Ost GeneralHoffmann mit ungefähr zehn Herren seines Gefolges, fernerder Gesandte von Rosenberg und Merey mit seinen Herreneingefunden.Ich begrüßte die Herren auf dem Perron, undnach kurzer Unterredung kam Merey mit mir in den Zug,um mir die Vorfälle der letzten Tage zu schildern. <strong>Im</strong> allgemeinenfaßt Merey die ganze Situation nicht ungünstigauf und glaubt, daß — unvorhergesehene Zwischenfälle ausgeschlossen— es uns gelingen kann, in absehbarer Zeiteinen grünen Zweig zu kommen.Um sechs Uhr fuhr ich zu General Hoffmann, um ihmmeinen Besuch abzustatten, und hörte von ihm interessanteDetails über die Psyche der russischen Delegierten und dieArt und Weise des von ihm so glücklich abgeschlossenenWaffenstillstandes.aufIch hatte den Eindruck, daß der Generalmit Sachkenntnis und Energie eine große Geschicklichkeitund Ruhe, aber auch viel preußische Brutalität verbindet,welche es ihm ermöglicht haben, die Russen trotz der anfänglicherhobenen Widerstände zu einem sehr günstigenWaffenstillstand zu bewegen. Einige Zeit darauf kam verabredetermaßenPrinz Leopold von Bayern, und ich hattemit ihm eine kurze, bedeutungslose Unterredung.302
Brest-LltowskWir gingen darauf gemeinsam zu dem Essen, an welchemder ganze an hundert Personen zählende Stab von Ob. Ostteilnimmt. Das Bild, welches dieses Diner bietet, ist wohleines der merkwürdigsten, das man sehen kann. Prinz vonBayern präsidiert. Neben dem Prinzen saß der Führer derrussischen Delegation, ein erst vor kurzem aus Sibirien entlassenerJude namens Joffe, an ihn schlössen sich die Generaleund die übrigen Delegierten. Abgesehen von dem erwähntenJoffe ist die markanteste Persönlichkeit der Delegation derSchwager des russischen Ministers des Äußern Trotzki,namens Kamenew, welcher, ebenfalls durch die Revolutionaus dem Gefängnis entlassen, nunmehr eine hervorragendeRolle spielt. Der dritte Delegierte ist die Madame Bizenko,eine Frau, die eine reiche Vergangenheit hinter sich hat.Mann ist ein kleiner Beamter, sie selbst trat frühzeitig derrevolutionären Bewegung bei. Vor zwölf Jahren ermordetesie den General Sacharow, welcher, Gouverneur irgendeinerrussischen Stadt, <strong>info</strong>lge seiner Energie von den Sozialistenzum Tode verurteilt worden war. Sie trat mit einem Bittgesuchbei dem General ein und hielt den Revolver unterihrer Schürze versteckt. Als der General das Bittgesuch zulesen begann, schoß sie ihm vier Kugeln in den Leib undtötete ihn auf der Stelle. Sie kam nach Sibirien, wo siezwölf Jahre teils in Einzelhaft, später in gemilderter Strafhaftihr Leben verbrachte, und auch ihr schenkte erst dieRevolution die Freiheit wieder. Diese merkwürdige Frau,die in Sibirien Französisch und Deutsch so weit erlerntIhrhat,daß sie lesen kann, ohne jedoch sprechen zu können, weilsie nicht weiß, wie man das Wort ausspricht, ist der Typusdes gebildeten russischen Proletariats.Sie ist ungeheuer stillund zurückgezogen, hat einen merkwürdigen entschlossenenZug um den Mund und zuweilen leidenschaftlich aufflammendeAugen. Alles, was um sie her vorgeht, scheint ihreigentlich gleichgültig. Nur wenn die Rede auf die großenPrinzipien der internationalen Revolution kommt, dann303
Brest-Litowskwacht sie plötzlich auf, ihr ganzer Ausdruck verändert sich,und sie erinnert an ein Raubtier, das plötzlich die Beutevor sich sieht und sich anschickt, sich auf dieselbe zu stürzen.Nach dem Essen hatte ich meine erste lange Unterredungmit Herrn Joffe. Seine ganze Theorie basiert darauf, dasSelbstbestimmungsrecht der Völker auf breitester Basis inder ganzen Welt einzuführen und diesebefreiten Völker zuveranlassen, sich dauernd gegenseitig zu lieben. Daß einsolcher Prozeß vorerst den Bürgerkrieg der ganzen Weltinvolvieren wird, leugnet Herr Joffe nicht, meint aber, einsolcher Krieg, der die Ideale der Menschheit realisierenwürde, sei gerecht und seines Zieles wert. Ich beschränktemich darauf, Herrn Joffe zu erklären, er müsse an Rußlandbeweisen, daß der Bolschewismus ein glückliches . Zeitalteranbahne, und wenn ihm dies gelingen werde, dann werde ermit seinen Ideen die Welt erobern. Bevor jedoch der Beweisauf das Exempel nicht erbracht sei,dürfte es Herrn Leninschwerlich gelingen, die Welt in seine Ideenkreise zu zwingen.Wir seien bereit, einen allgemeinen Frieden ohne Kontributionenund Annexionen zu schließen, und vollkommeneinverstanden, nachher die russischen Verhältnisse sich entwickelnzu lassen, wie es der russischen Regierung richtigscheint. Wir seien auch gern bereit, von Rußland etwas zulernen, und wenn er mit seiner Revolution reüssiere, so werdeer Europa in seinen Gedankenkreis zwingen, ob wir wollenoder nicht. Vorerst aber sei die größte Skepsis am Platze,und ich mache ihn aufmerksam, daß wir eine Nachahmungder russischen Verhältnisse nicht unternehmen würden unduns jede Einmengung inunsere internen Verhältnisse kategorischverbitten. Wenn er weiter an diesem utopischenStandpunkte, seine Ideen auch auf uns zu verpflanzen,festhalte, dann sei es besser, er würde gleich mit dem nächstenZuge wieder abreisen, denn dann sei der Friede nicht zumachen. Herr Joffe blickte mich erstaunt mit seinen sanftenAugen an, schwieg eine Weile und sagte dann in einem mir304
Brest-Litowskfür immer unvergeßlichen freundlichen, fast möchte ichsagen bittenden Ton:„Ich hoffe doch, daß es uns gelingenwird, auch bei Ihnen die Revolution zu entfesseln."Letzteres glaube ich auch, auch ohne die gütige MithilfeJoffes — das werden die Völker schon selbst besorgen, wenndie Entente auf ihrem Standpunkte verharrt, sich nichtausgleichen zu wollen.Merkwürdig sind diese Bolschewiken. Sie sprechen vonFreiheit und Völkerversöhnung, von Friede und Eintracht,und dabei sollen sie die grausamsten Tyrannen sein, welchedie Geschichte gekannt hat — sie rotten das Bürgertum einfachaus, und ihre Argumente sind Maschinengewehre undder Galgen. Das heutige Gespräch mit Joffe hat mir bewiesen,daß dieLeute nicht ehrlich sind und an Falschheitalles das übertreffen, was man der zünftigen Diplomatievorwirft — denn eine solche Unterdrückung des Bürgertumsbetreiben und gleichzeitig von weltbeglückender Freiheitsprechen,sind Lügen.21. Dezember 1917.Zu Mittag fuhr ich mit allen meinen Herren zum Frühstückbeim Prinzen von Bayern. Derselbe wohnt in einem kleinenSchlößchen, eine halbe Stunde Automobilfahrt von Brestentfernt. Er scheint sich viel mit den militärischen Angelegenheitenzu beschäftigen und ist viel im Dienst.Ich war die erste Nacht in meinem Zug geblieben, undwährend wir das Frühstück nahmen, übersiedelten unsereLeute mit dem Gepäck in unsere Wohnung. Wir bewohnenein kleines Haus, wo ich mit allen österreichisch-ungarischenHerren versammelt bin, unmittelbar neben dem Offizierskasino,und aller Komfort, den man sich hier wünschen kann,ist vorhanden. Den Nachmittag verbrachte ich in Arbeitenmit meinen Herren, und am Abend trafen die Delegiertender drei Verbündeten ein. Ich hatte an diesem Abend gleichdie erste Unterredung mit Kühlmarin unter vier Augen undstellte sofort positiv fest, daß gar kein Zweifel sei, daß die20 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 3^5
Br^st-LitowskRussen einen Vorschlag auf allgemeinen Frieden machenwürden, und daß wir denselben annehmen müßten. Kühlmannist so halb und halb meiner Ansicht; natürlich wirddie Formel lauten: „Niemand darf annektieren oder Kontributionfordern" — geht die Entente darauf ein, so sindwir am Ende dieses entsetzlichen Leidens. Wahrscheinlichist es leider nicht.22. Dezember 1917.Der Vormittag war der ersten Besprechung unter denAlliierten gewidmet, worin die soeben mitgeteilten, mitKühlmann besprochenen Grundlagen akademisch festgestelltwurden. Am Nachmittag fand die erste Plenarsitzung statt,welche vom Prinzen von Bayern eröffnet und sodann vonDr. Kühlmann geleitet wurde. Es war beschlossen worden, daßder Vorsitz alternierend nach dem lateinischen Alphabet derMächtenamen geführt wurde, also Allemagne, Autriche etc.Dr. Kühlmann ersuchte Herrn Joffe, uns die Prinzipien zuentwickeln, welche seiner Ansicht nach einem zukünftigenFrieden zugrunde gelegt werden sollten, und der russischeDelegierte entwickelte sodann die durch die Zeitungen bereitsbekannten sechs grundlegenden Richtlinien. Wir nahmenden Vorschlag zur Kenntnis und erklärten, nach stattgefundenerBeratung unter uns so bald wie möglich Antwortzu erteilen.des Friedenskongresses.Dies war der Verlauf der ersten kurzen Sitzung23. Dezember 1917.Zeitlich früh arbeiteten Kühlmann und ich unsere Antwortaus. Sie wird aus den Blättern bekannt. Es hatschwere Arbeit gekostet. Kühlmann ist persönlich für denallgemeinen Frieden, fürchtet aber den Einspruch der Militärs,welche erst Frieden machen wollen, wenn sie definitivgesiegt haben. Endlich ist es doch gelungen. Die Schwierigkeitbegann dann wieder mit den Türken.daß sieDiese erklärten,darauf bestehen müßten, daß sofort nach Friedensschlußmit Rußland der Kaukasus von den russischen Truppen306
Btest-Litowskgeräumt werde, ein Vorschlag, den die Deutschen nichtzugaben, weil sie damit implicite zugeben müßten, daß sieauch Polen, Kurland und Litauen gleichzeitig räumen, einbei Deutschland unmöglich zu erreichendes Verlangen. Nachhartem Kampfe und wiederholten Anstrengungen gelang eserst, die Türken von ihrem Postulat abzubringen. Das zweiteBedenken der Türken ging dahin, daß die Einmischung in dieinternen Verhältnisse seitens Rußlands nicht genügend klarabgelehnt sei. Der türkische Minister des Äußern erklärtejedoch, daß die internen Verhältnisse in Österreich-Ungarnein noch gefährlicherer Boden für russische Einmischungenseien alsdie türkischen, und wenn ich keine Bedenken trüge,so würde er auch die seinen zurückstellen.Die Bulgaren, welche durch den bulgarischen JustizministerPopow als Chef vertreten sind, und welche teilweisenicht Deutsch, teilweise kaum Französisch verstehen unddaher unser ganzes Elaborat erst später zu begreifen begannen,verschoben ihre Stellungnahme auf den 24.24. Dezember 1917.Vor- und Nachmittag stundenlange Konferenzen mit denBulgaren, in welchen Kühlmann und ich einerseits und die bulgarischenVertreter andererseits hart aneinandergerieten. Diebulgarischen Delegierten verlangten die Aufnahme einesPassus in das Elaborat, wonach für Bulgarien eine Ausnahmevon der annexionslosen Formel gemacht und zugestandenwerde, daß die Erwerbung rumänischer und serbischer Gebietefür Bulgarien nicht als Annexion gelten dürfe. DieseKlausel hätte selbstverständlich unsere ganze Arbeit nullund nichtig gemacht und konnte unter keinen Umständenzugegeben werden. Die Konversation war stellenweise sehrerregt, und die bulgarischen Delegierten verstiegen sich zu derDrohung, abzureisen, wenn wir nicht nachgeben würden.Kühlmann und meine Wenigkeit blieben vollkommen festund erklärten ihnen, wir hätten nichts gegen ihre Abreise,wir hätten auch nichts dagegen, daß sie eine selbständige307
Brest-LitowskAntwort geben, aber an dem von uns beiden redigiertenProtokoll würde nichts mehr geändert werden. Da zu keinemEnde zu kommen war, wurde die Plenarsitzung auf den 25.verschoben, und die bulgarischen Delegierten telegraphiertennach Sofia um neue Instruktionen.Die Bulgaren haben eine abschlägige Antwort und anscheinenddie von uns erwartete Nase erhalten. Sie warensehr gedrückt und machten weiter keine Geschichten, sichder allgemeinen Aktion anzuschließen. Das ist also so weitin Ordnung.Nachmittags hatte ich wieder Streit mit den Deutschen.Die deutschen Militärs ,, fürchten", daß die Entente auf denallgemeinen Frieden eingehen könnte, da sie den Krieg nicht,,ohne Profit" abschließen könnten. Nicht anzuhören istdieses Gewäsch.Wenn an der Westfront die von den deutschen Generalenbestimmt erwarteten großen Siege eintreten, wird ihre Anmaßungins Uferlose steigen und alle Verhandlungen nochmehr erschweren.25. Dezember 1917.Heute fand die Plenarsitzung statt, in welcher wir denRussen unsere Antwort auf ihr Friedensangebot erstatteten.Ich hatte den Vorsitz und gab die Antwort ab, worauf Joffeerwiderte. Das allgemeine Friedensangebot wirdalso gemacht und das Resultat abgewartet. Umkeine Zeit zu verlieren, wird jedoch in den Rußland betreffendenVerhandlungen fortgefahren. Damit wären wireinen großen Schritt weiter und vielleicht über dasSchwerste hinüber. Man kann nicht wissen, ob nicht dergestrige Tag einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichteder Welt bedeutet.26. Dezember 1917.Um neun Uhr früh begannen die SpezialVerhandlungen.Das von Kühlmann projektierte Programm, ausschließlichwirtschaftliche und Vertretungsfragen, wurde so rasch und308
Brest-Litowskglatt erledigt, daß bereits um elf Uhr die Sitzung aus Stoffmangelabgebrochen werden mußte. Vielleicht ein gutesVorzeichen.Der heutige Tag wird von unseren Herren dazu verwendetwerden, die Ergebnisse der Besprechung ineinem Protokollzusammenzufassen, da morgen die Fortsetzung stattfindet,wenn die territorialen Fragen zur Sprache kommen.26. Dezember 1917.Abends vor dem Essen hat Hoffmann den Russen diedeutschen Pläne betreffs der Randprovinzen mitgeteilt.Die Situation ist die: so lange der Krieg im Westen andauert,können die Deutschen Kurland und Litauen nicht räumen,denn abgesehen davon, daß sie dies als Faustpfand für dieallgemeinen Friedensverhandlungen behalten wollen, bildendiese Länder einen Teil ihrer RüstungsWerkstätten. DasBahnmaterial, die Fabriken, vor allem das Getreide sindunentbehrlich, so lange der Krieg anhält. Daß sie das jetztnicht sofort räumen können, ist natürlich. Kommt es zumFrieden, soll das Selbstbestimmungsrecht der besetzten Gebieteentscheiden. Da ist nun aber die große Schwierigkeit,wie dieseswird.Selbstbestimmungsrecht zum Ausdruck gebrachtDie Russen wollen natürlich nicht, daß die Abstimmungstattfindet, solange deutsche Bajonette im Lande sind —und die Deutschen sagen wieder, daß der beispiellosebolschewistische Terrorismus ein jedes Wahlresultat fälschenwird, da die „Bourgeois" ja nach Bolschewikenauffassungkeine Menschen sind.Meine Idee einer Kontrolle durch eine neutrale Machtlehnten eigentlich alle ab. Während des Krieges werde sichkeine neutrale Macht dazu hergeben, und bis zum allgemeinenEnde dürfe die deutsche Besatzung nicht bleiben. De factofürchten beide Streitteile den Terror der Gegenseite, undbeide wollen ihn selbstausüben,309
Brest-LitoubkMan hat hier Zeit. Einmal sind die Türken nicht fertig,dann wieder die Bulgaren, dann ziehen sich die Russen —und die Sitzung wird wieder verschoben oder, kaum begonnen,abgebrochen.Ich lese jetzt Memoiren aus der Französischen Revolution.Eine sehr zeitgemäße Lektüre in Anbetracht dessen, was inRußland ist und in ganz Europa kommen dürfte. Bolschewikihat es damals noch nicht gegeben, aber Männer, dieunter dem Schlagworte der Freiheit die Welt tyrannisieren,waren damals in Paris so gut wie heute in Petersburg. CharlotteCorday hat gesagt: „Nicht einen Menschen, sonderneine wilde Bestie habe ich getötet." — Verschwinden werdendiese Bolschewiken wieder, und wer weiß, ob sich nicht eineCorday für Trotzki finden wird.Einer der Russen erzählte mir von der Zarenfamilie und denangeblich dort herrschenden Zuständen. Er sprach mit großerAchtung von Nikolaj Nikolajewitsch, der ein ganzer Mannsei, von Energie und Mut, und den man anerkennen müsseauch als Gegner. Hingegen sei der Zar feig und falsch undverächtüch. Es beweise die Unfähigkeit der Bourgeois, daßsie einen solchen Kaiser ertragen hätten. Überhaupt seiendie Monarchen mehr oder weniger alle degeneriert, und erverstehe nicht, wie man eine Staatsform akzeptieren könne,bei welcher man der Gefahr eines degenerierten Regentenausgesetzt sei. Ich erwiderte ihm, die Monarchie habe vorallem den Vorteil, daß wenigstens eine Stelle im Staate derpersönlichen Streberei entzogen sei, und was die Degenerationanbelangt, so sei das manchmal Ansichtssache; es gäbe jaauch degenerierte ungekrönte Staatsoberhäupter. Mein Mitrednermeinte, wenn das Volk wähle, so sei die Gefahr nicht vorhanden.Ich replizierte, daß beispielsweise Herr Lenin nichtgewählt worden sei und es mir zweifelhaft scheine, ob er beieiner unbeeinflußten Wahl gewählt werden würde — vielleichtwürden sich in Rußland Menschen finden, die ihmihrerseits310Degeneration vorwerfen.
Brest-Litowsk27. Dezember 1917.Die Russen sind verzweifelt; wollten teilweise abreisen,sie dachten, daß die Deutschen einfach auf alles besetzteGebiet verzichten respektive dasselbe den Bolschewikenausliefern. Lange Sitzungen zwischen Russen, Kühlmannund mir, zeitweilig mit Hoffmann. Ich formulierte folgendes:1. Solange nicht ein allgemeiner Friede geschlossen ist,können wir das besetzte Gebiet nicht herausgeben; es gehörtzu unseren großen Rüstungswerkstätten (Fabriken, Bahnen,bebaute Felder usw.).2. Nach dem allgemeinen Frieden soll eine Volksabstimmungin Polen, Kurland und Litauen über das Los derenVölker entscheiden, die Form dieser Abstimmung ist nochzu diskutieren, damit die Russen die Sicherheit gewinnen,daß die Abstimmung ohne Zwang erfolge. Dies paßt anscheinendweder den einen noch den anderen.verschlechtert.Situation sehrNachmittag. Zunehmende Verschlechterung der Lage.Wütende Telegramme von Hindenburg über „Verzicht" aufalles, Ludendorff telephoniert alle Stunden; neug Wutanfälle.Hoffmann sehr gereizt. Kühlmann ,,kühl" wie immer. DieRussen erklären die unklaren Formulierungen Deutschlandsbezüglich der Freiheit der Abstimmung für unannehmbar.Ich habe Kühl- und Hoffmann erklärt, ich würde mitihnen bis zum Äußersten gehen, aber wenn ihre Bemühungenscheitern, so würde ich mit den Russen in separate Verhandlungeneintreten, denn Berlin wie Petersburg wollten ebenbeide keine unbeeinflußte Abstimmung. Österreich-Ungarnaber wolle ja nichts als endlich Frieden. Kühlmann verstehtmeinen Standpunkt und sagt, er würde selbst eher gehen,als es scheitern lassen. Ich solle ihm meinen Standpunktschriftlich geben, „das werde seine Position stärken". Istgeschehen. Er hat es dem Kaiser telegraphiert.Abends. Kühlmann glaubt, morgen kommt es zum Brucheoder zur Leimung.3il
Brest-Litow^k28. Dezember 1917.Stimmung flau. Neue empörte Ausbrüche aus Kreuznach.Hingegen zu Mittag ein Telegramm Bussches: Hertling habeKaiser Wilhelm Vortrag gehalten, und derselbe sei ganzzufrieden. Kühlmann sagt mir: „Der Kaiser ist der einzigevernünftige Mensch in ganz Deutschland."Wir haben uns schließlich auf die Kommissionsformelgeeinigt, d. h. es wird in Brest eine Ad-hoc-Kommission gebildet,welche den Plan der Räumung und Abstimmung imDetail ausarbeiten soll. Das ist tant bien que mal ein provisorischerAusweg. Alles fährt nach Hause referieren, und dienächste Sitzung findet am 5. Januar 1918 statt.Russen wieder etwas heiterer.Abends beim Diner hielt ich im Namen der Russen unddes Vierbundes eine Dankrede an den Prinzen Leopold.Er antwortete gleich und sehr nett, sagte mir aber dann:„Das war ja ein Überfall." Für mich war es auch einer,denn die Deutschen baten mich erst während des Diners,zu sprechen.Abends zehn Uhr Abreise nach Wien.Die Tage vom 29. bis 3. früh war ich in Wien. Zwei langeAudienzen beim Kaiser gaben mir die Gelegenheit, ihmüber Brest zu referieren. Er billigt selbstverständlich vollkommenden Standpunkt, den Frieden, wenn irgend möglich,zu erreichen.Ich habe einen verläßlichen Konfidenten nach den Randprovinzengeschickt, um zu ergründen, wie eigentlich dieStimmung dorten ist. Er berichtet, daß alles gegen dieBolschewiken ist, was nicht selbst Bolschewik ist. Das ganzeBürgertum, Bauern, kurz alles, was irgend etwas besitzt,zittert vor diesen roten Räubern und will zu Deutschland.Der Terror, den Lenin ausübt, soll unbeschreiblich sein.In Petersburg sogar wünscht alles sehnlichst den Einmarschdeutscher Truppen, um von diesen Leuten befreit zuwerden.312
Brest-Litowsk3. Januar 1918.Rückreise.Am Wege nach Brest, sechs Uhr nachmittags, erhielt ichauf einer Station folgendes Chiffretelegramm des in Brestzurückgebliebenen Baron Gautsch:„Von der russischen Delegation ist heute morgen nachstehendesHughestelegramm aus Petersburg eingelangt:,An General Hoffmann. Für die Herren Vertreter der deutschen,österreichisch-ungarischen, bulgarischen und türkischenDelegation. Die Regierung der russischen Republik hält esfür notwendig, die weiteren Verhandlungen auf neutralemBoden zu führen, und schlägt ihrerseits vor, die Verhandlungennach Stockholm zu verlegen.'Was die Stellungnahmezu den Vorschlägen betrifft, wie sie seitens der deutschenund österreichisch-ungarischen Delegation in Punkt 1 und 2gefaßt sind, so sind die Regierung der russischen Republikwie auch das allrussische Zentralexekutivkomitee der Räteder Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten in vollerÜbereinstimmung mit der von unserer Delegation ausgesprochenenMeinung der Ansicht, daß die Vorschläge demPrinzip der nationalen Selbstbestimmung sogar injener beschränktenFormulierung widersprechen, die in Punkt 3 derAntwortsdeklaration des Vierbundes vom 12. v. Mts. gegebenist. Der Vorsitzende der russischen Delegation: A. Joffe.'Major Brinkmann hat die bereits auf der Fahrt hierherbegriffene deutsche Delegation vom Vorstehenden telephonischverständigt. Herr von Kühlmann ließ zurücktelephonieren,er werde Reise fortsetzen und heute abend in Bresteintreffen."Ich fahre selbstverständlich auch weiter und halte dasManöver der Russen mehr für einen Bluff; sollten sie nichtkommen, so werden wir mit den Ukrainern verhandeln,welche schon in Brest sein sollen.In \\ len sah ich von Politikern Beck, Baernreither, Hauser,Wekerle, Seidler und einige andere. Das Resume ist von313
Bre.-t-Litowskallen: „Der Friede muß Zustandekommen — aber einSeparatfriede ohne Deutschland ist unmöglich."Wie ich dies machen soll, hat mir keiner gesagt, wennweder Deutschland noch Rußland Vernunft annimmt.4. Januar 1918.In der Nacht ein schauderhafter Schneesturm, die Heizungim Zuge eingefroren und der Aufenthalt daher wenig gemütlich.Früh beim Aufwachen in Brest standen auf Nebengleisendie Züge der Bulgaren und Türken. Es ist einprachtvoller Tag, kalt, die Luft wie in St. Moritz. Ich ginghinüber zu Kühlmann, frühstückte mit ihm und besprachdie Vorfälle in Berlin. Es scheint eine heillose Aufregunggeherrscht zu haben. Kühlmann hatte Ludendorff vorgeschlagen,mit nach Brest zu kommen und selbst mit zu verhandeln.Nach mehrstündigen Unterredungen aber stelltesich heraus, daß Ludendorff eigentlich selbst nicht rechtwußte, was er wollte, und spontan erklärte, er fände es überflüssig,mit nach Brest zu kommen, ,,er könne höchstens dortetwas verderben". Lieber Gott, gib dem Manne öfters solcheklare Augenblicke ! Es scheint, daß der ganze Groll mehr derEifersucht gegen Kühlmann als sachlichen Motiven entspringt,weil die Welt nicht den Eindruck bekommen soll,daß „diplomatische Geschicklichkeit", sondern ausschließlichmilitärische Erfolge den Frieden gebracht hätten. GeneralHoffmann scheint von Kaiser Wilhelm sehr ausgezeichnetworden zu sein, und er sowohl wie Kühlmann geben zu verstehen,daß sie mit dem Ergebnis ihrer Reise zufrieden sind.Wir besprachen das Antworttelegramm nach Petersburg,welches eine Konferenz in Stockholm ablehnt, und die weitereeventuelle Taktik. Wir kamen dahin überein, daß, falls dieRussen nicht kommen sollten, wir den Waffenstillstandkündigen und riskieren müßten, wie sich die Petersburgerdarauf benehmen. Es herrschte hierin vollständige Einigkeitzwischen Kühlmann und mir. Trotzdem war die Stimmung314
Breat-Litowsksowohl bei uns als bei den Deutschen eine recht gedrückte.Es ist kein Zweifel, daß, wenn die Russen definitiv abbrechen,die Situation eine sehr peinliche wird. Die einzige Rettung derSituation besteht inraschen und energischen Verhandlungenmit der ukrainischen Deputation, und wir begannen daherdiese Arbeit sofort am Nachmittage desselben Tages. Esist also Hoffnung vorhanden, daß wenigstens mit dieser inabsehbarer Zeit ein positives Ergebnis wird erreicht werdenkönnen.Am Abend nach dem Essen kam eine Depesche ausPetersburg, welche die Ankunft der Delegation inklusive desMinisters des Äußern Trotzki bekanntgab. Es war unterhaltendzu sehen, in welchen Jubel die ganzen Deutschenausbrachen, und erst die plötzlich und so stürmisch hervorbrechendeHeiterkeit bewies, wie stark der Druck, die Russenkönnten nicht kommen, doch auf ihnen gelastet hatte. Esist kein Zweifel, daß dies einen großen Fortschritt bedeutet,und wir alle haben das Gefühl, daß nunmehr der Friede tatsächlichauf dem Wege ist.5. Januar 1918.Früh sieben Uhr fuhren einige von uns mit dem PrinzenLeopold von Bayern auf die Jagd. Mittels Eisenbahnzugeswurde die ungefähr zwanzig bis dreißig Kilometer weiteStrecke zurückgelegt, von dort per offenen Autos in einenprachtvollen Urwald, der zwei- bis dreihundert Quadratkilometermißt. Wetter sehr kalt, aber schön, viel Schneeund angenehme Gesellschaft. Jagdlich war es unter allerErwartung. Ein Adjutant des Prinzen schweißte eine Sauein, ein anderer schoß zwei Hasen, das war alles. Rückkehrum sechs Uhr abends.6. Januar 1918.Heute fanden die ersten Unterredungen mit den ukrainischenDelegierten statt, welche bis auf ihren Chef vollständiganwesend sind.Die Ukrainer stechen stark von denrussischen Delegierten ab. Bedeutend weniger revolutionär,315
!Brest-Litowskhaben sie ungleich mehr Interesse für ihr eigenes Landund weniger Interesse für den allgemeinen Sozialismus. Sieinteressieren sich eigentlich nicht für Rußland, sondernausschließlich für die Ukraine, und ihr ganzes Bestreben gehtdahin, sich so rasch wie möglich selbständig zu machen. Obdie Selbständigkeit eine vollständige, internationale oder aberals eine im Rahmen des russischen Föderativstaates gedachtesein soll, scheint ihnen noch nicht klar zu sein. Offenbarhatten die sehr intelligenten ukrainischen Delegierten dieAbsicht, uns alsSprungbrett zu benutzen, von welchem siesich auf die Bolschewiki stürzen wollten. Ihre Tendenz gingdahin, wir möchten ihre Selbständigkeit anerkennen, dannwären sie mit diesem fait accompli vor die Bolschewikengetreten und hätten dieselben gezwungen, sie als gleichwertigeKompaziszenten hinzunehmen. Unser Interesse istaber, entweder die Ukrainer auf unsere Friedensbasis zubekommen oder aber einen Keil zwischen sie und die Petersburgerzu schlagen.Auf ihre Wünsche nach Selbständigkeiterklärten wir ihnen daher, daß wir bereit seien, dieselbenanzuerkennen, falls die Ukrainer ihrerseits folgende dreiPunkte akzeptieren: i. Beendigung der Verhandlungen inBrest-Litowsk und nicht in Stockholm; 2. Anerkennungder alten staatlichen Grenzen zwischen Österreich-Ungarnund der Ukraine, und 3. Nichteinmischung eines Staatesin die internen Angelegenheiten des anderen. Bezeichnenderweiseist auf diese Proposition bisher keine Antworterfolgt7. Januar 1918.Am Vormittag sind die ganzen Russen unter FührungTrotzkis angekommen. Sie haben sofort sagen lassen, siebitten zu entschuldigen, wenn sie nicht mehr zu den gemeinsamenMahlzeiten erscheinen. Auch sonst sieht man sie nicht,und es scheint ein wesentlich anderer Wind zu wehen alsdas letztemal. Der deutsche Offizier, welcher die russischeDelegation von Dünaburg hierhergebracht hat,316Hauptmann
Brest-LitowskBaron Lamezan, erzählte interessante Details hierüber.Erstens behauptete er, daß die Schützengräben vor Dünaburgvollständig verödet seien und sich außer ein paar Postenüberhaupt keine Russen mehr dort befänden, ferner daß aufzahllosen Stationen die Delegation von Deputierten erwartetworden sei, welche alle den Frieden verlangt hätten.Trotzki hätte stets in einer äußerst geschickten und verbindlichenArt geantwortet, sei aber immer mehr undmehr niedergeschlagen geworden. Baron Lamezan hat denEindruck, daß sich die Russen in einer ganz verzweifeltenStimmung befänden, weil sie nur die Wahl haben, entwederohne Frieden oder mit einem schlechten Frieden zurückzukommen,und in beiden Fällen weggefegt werden würden.Kühlmann sagte: ,,Ils n'ont que le choix ä quellesauce ils se feront manger." Ich antwortete ihm darauf:„Tout comme chez nous."Soeben kommt ein Telegramm über Demonstrationen inBudapest gegen Deutschland. <strong>Im</strong> deutschen Konsulat wurdendie Fenster eingeworfen, ein deutlicher Fingerzeig, wiedie Stimmung wäre, wenn an unseren Postulaten der Friedescheiternwürde.8. Januar 1918.Der türkische Großwesir Talaat Pascha ist in der .Nachtangekommen und hat mich soeben besucht. Er scheint unbedingtdafür zu sein, den Frieden abzuschließen, dürfteaber mehr die Absicht haben, mich bei einem eventuellenKonflikte mit Deutschland vorzuschieben und selbst imHintergrund zu bleiben. Talaat Pascha ist einer der fähigstentürkischen Köpfe und vielleicht der energischste.Er war vor der Revolution ein kleiner Telegraphenbeamterund gehörte dem revolutionären Komite an. Er fing alssolcher ein Telegramm der Regierung ab, welches ihm bewies,daß die revolutionären Bestrebungen entdeckt unddas Spiel verloren sei, wenn nicht sofort gehandelt werde.Er unterdrückte das Telegramm, warnte das revolutionäre317
Brest-LitowskKomite und bewog es, sofort loszuschlagen. Dies gelang;der Sultan wurde abgesetzt, und Talaat wurde Minister desInnern. Mit eiserner Energie ging er nun seinerseits gegendie Gegenbestrebungen vor. Später wurde er Großwesir undverkörperte zusammen mit Enver Pascha den Willen unddie Macht der Türkei.Heute nachmittag findet erst eine Besprechung der fünfChefs der Verbündeten und Rußlands statt. Nachher einePlenarsitzung.Die Sitzung wurde neuerlich verschoben, da die Ukrainerimmer noch nicht mit den Vorbereitungen fertig sind. Spätabends hatte ich eine Unterredung mit Kühlmann undHoffmann, in welcher wir uns bezüglich der Taktik ziemlichgut verstanden haben. Ich habe ihnen nochmals gesagt, daßich mit ihnen und für ihre Postnlate bis zum äußersten gehenwerde, in dem Augenblicke jedoch, wo die Deutschen mitRußland definitiv abbrechen, mir die Politik der freien Handvorbehalten müsse.Beide sclüenen meinen Standpunkt ziemlichzu verstehen, insbesondere Kühlmann, welcher, wenn esnach ihm ginge, bestimmt die Verhandlungen nicht scheiternlassen würde. <strong>Im</strong> Detail kamen wir darin überein, daß wirin einer ultimatumartigen Form die Fortsetzung der VerhandlungeninBrest-Litowsk verlangen würden.9. Januar 1918.Nach dem Prinzip, daß der Hieb die beste Parade ist,hatten wir beschlossen,den russischen Minister des Äußernerst gar nicht zu Wort kommen zu lassen, sondern sofortmit unserem Ultimatum loszuschießen.Trotzki war mit einer großen Rede gekommen, und derErfolg unserer Angriffe war so stark,daß er sofort um eineVertagung bat, da die neue Lage neue Beschlüsse erfordere.Die Verlegung der Konferenz nach Stockholm wäre unserEnde gewesen, denn es wäre ganz ausgeschlossen, die Bolschewikenaller Länder von dort fernzuhalten, und das, was wir3i8
Brest-Litowskseit Anfang an mit aller Kraft zu verhindern suchen, daß unsdie Zügel entwunden werden und diese Elemente die Führungübernehmen, wäre unvermeidlich eingetreten. Man muß jetztabwarten, was der morgige Tag bringen wird ; entweder einenSieg oder das definitive Ende der Verhandlungen.Trotzki ist zweifellos ein interessanter, gescheiter Menschund sehr gefährlicher Gegner. Er hat eine ganz hervorragendeRednergabe, eine Schnelligkeit und Geschicklichkeitder Replik, wie ich sie noch selten gesehen habe, und dabeidie ganze Frechheit, die seiner Rasse entspricht.10. Januar 1918.Die Sitzung hat soeben stattgefunden. Trotzki hat ineiner großen, für ganz Europa berechneten, in seiner Artwirklich schönen Rede vollständig nachgegeben. Er nimmt,wie er erklärt, das deutsch-österreichisch-ungarische „Ultimatum"an und bleibt in Brest-Litowsk, da er uns nicht denGefallen machen wolle, Rußland die Schuld an der Fortführungdes Krieges zuzuschieben.Anknüpfend an die Rede Trotzkis wurde sofort die Kom-'mission konstituiert, welche sich mit den heiklen territorialenFragen zu beschäftigen haben wird.Ich habe darauf gehalten,in die Kommission zu kommen, da ich eine fortgesetzteKontrolle der so wichtigen Verhandlungen haben will. Eswar dies nicht so leicht, da die vorliegenden Fragen ja eigentlichnur Kurland und Litauen, also nicht uns, sondernDeutschland betreffen.Am Abend hatte ich neuerlich eine lange Konferenz mitKühl- und Hoffmann, in welcher der General und der Staatssekretärrecht lebhaft aneinandergerieten. Durch den Erfolgunseres an Rußland gestellten Ultimatums berauscht,wünschte Hoffmann in dem gleichen Tone fortzufahren undden Russen „noch eineordentliche auf den Kopf zu schlagen".Kühlmann und ich vertraten den entgegengesetztenStandpunkt und verlangten, daß in ruhige und sachliche319
Brest-LitowskVerhandlungen eingetreten werde und Punkt für Punkt geklärtund die unklaren beiseitegeschoben würden. Erst bis dieseReinigungsarbeit durchgeführt, sollen dann die restierendenungeklärten Punkte zusammengefaßt und sodann eventuelltelegraphisch von den beiden Kaisern Direktiven für dieEntscheidung eingeholt werden. Es ist zweifellos der sichersteWeg, um einen Krach und eine Entgleisung zu verhindern.Ein neuer Konflikt ist ausgebrochen mit den Ukrainern.Dieselben verlangen die Anerkennung ihrer Selbständigkeitund erklären, abreisen zu wollen, falls diese nicht erfolgt.Adler erzählte mir in Wien, daß Trotzki seine Bibliothek,an der ihm viel liege, in Wien — ich glaube bei einem HerrnBauer — habe. Ich sagte Trotzki, daß ich ihm dieselbeschicken lassen würde, falls ihm daran läge. Ich empfahlihm dann einige Kriegsgefangene, so L. K. und W., vondenen es heißt, daß sie alle mehr oder weniger schlecht behandeltwerden. Trotzki nahm das zur Kenntnis, erklärte,daß er gegen die Mißhandlung der Kriegsgefangenen sei, undversprach, sich zu erkundigen; er betonte aber, daß dieserentgegenkommende Standpunkt in keinem Zusammenhangmit der Bibliotheksfrage stehe, er hätte mein Ersuchenunter allen Umständen berücksichtigt. Die Bibliothek willerhaben.II. Januar 1918.Vor- und Nachmittag lange Kommissionssitzungen über dieterritorialen Fragen. Von uns aus sind darin Kühlmann, Hoffmann,Rosenberg und ein Sekretär, ferner meine Wenigkeit,Csicserics, Wiesner und Colloredo, die Russen sind vollständiganwesend, jedoch ohne die Ukrainer. Ich habe Kühlmannerklärt, daß ich nur als Sekundant beiwohnen will, da die deutschenInteressen in dieser Frage unvergleichlich mehr tangiertsind als die unseren. Ich greife nur von Zeit zu Zeit ein.Trotzki hat nachmittags einen taktischen Fehler gemacht.In einer bis zur Heftigkeit gesteigerten Rede erklärte er uns,wir spielten ein falsches Spiel, wir wollten Annexionen und320
Brest-Litowskgäben diesen Annexionen den Mantel des Selbstbestimmungsrechtes.Niemals würde er dem zustimmen und lieber abbrechen,als so fortfahren. Wenn wir ehrlich wären, so würdenwir gestatten, daß Vertreter Polens, Kurlands undLitauens nach Brest kämen, um unbeeinflußt von uns ihreNun muß hierzu erwähnt werden,Ansichten auszusprechen.daß seit Beginn der Verhandlungen der Streit sich darum-dreht, ob die heute in den besetzten Gebieten bestehendenlegislativen Körperschaften berechtigt sind, im Namen ihrerrespektiven Völker zu sprechen, oder nicht, ein Punkt, denwir bejahen, die Russen verneinen. Wir haben sofort denVorschlag Trotzkis, Vertreter dieser Länder hierherkommenzu lassen, angenommen, aber hinzugefügt, daß, wenn wirihre Zeugenschaft akzeptieren, wir ihr Urteil dann auch füruns als maßgebend erachten.Es ist charakteristisch, zu beobachten, wie gerne Trotzkidas zurückgenommen hätte, was er gesagt. Er fand sichaber sofort in die neue Situation, behielt seine Kontenanceund ersuchte um Unterbrechung der Sitzung fürvierundzwanzig Stunden, da er sich auf unsere so weittragendeAntwort hin mit seinen Kollegen beraten müsse.Ich hoffe, Trotzki macht keine Schwierigkeit. Wenn die Polenzugezogen werden könnten, so wäre dies ein Vorteil. DasSchwierige ist, daß auch die Deutschen die Polen Hebernicht wollen, weil sie die antipreußische Stimmung derselbenkennen.ii. Januar 1918.Radek hat einen Auftritt mit dem deutschen Chauffeurgehabt, was ein Nachspiel hatte.General Hoffmann hat denRussen Autos zur Verfügung gestellt, damit fahren sie spazieren;diesmal nun war das Auto nicht rechtzeitig da, undRadek machte dem Chauffeur eine grobe Szene, letztererbeschwerte sich, und Hoffmann nahm den Chauffeur inSchutz. Trotzki scheint Hoffmanns Standpunkt berechtigtzu finden, und er hat der ganzen Delegation verboten,31 C*ernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> "321
Brest-Litowsküberhaupt noch spazieren zu fahren. Jetzt haben sie es.Recht geschieht ihnen.Keiner hat gemuckst. Überhaupt haben sie einenfheiligenRespekt vor Trotzki. Auch bei den Sitzungen darf keinerden Mund aufmachen, wenn Trotzki dabei ist.12. Januar 1918.Hoffmann hat seine unglückliche Rede gehalten. SeitTagen laboriert er daran und war auf den Erfolg sehr stolz.Kühlmann und ich haben ihm nicht verhehlt, daß er nichtsanderes damit erreicht, als das Hinterland gegen uns aufzuhetzen.Das hat einen gewissen Eindruck auf ihn gemacht,welcher jedoch durch das prompt eintreffende Lob Ludendorffsverwischt wurde. Die Situation ist jedenfalls verschärft,was überflüssig war.15. Januar 1918.Heute erhielt ich einen Brief eines unserer Statthalter,welcher mich darauf aufmerksam macht, daß die durchNahrungsmangel hervorgerufene Katastrophe unmittelbar vorder Tür stehe.Ich telegraphiere sofort an den Kaiser nachstehend:„Ich erhielt soeben einen Brief des Statthalters N. N.,welcher allemeine Eurer Majestät immer wiederholten Befürchtungenrechtfertigt und konstatiert, daß wir in derErnährungsfrage unmittelbar vor der Katastrophe stehen.Die durch die Frivolität und Unfähigkeit der Ministereingetretene Situation istfurchtbar, und ich fürchte,es ist bereits zu spät, um den völligen Niederbruch, welcherin den nächsten Wochen zu erwarten ist, aufzuhalten. MeinGewährsmann schreibt darüber: ,Von Ungarn erhalten wirnur geringe Mengen, von Rumänien noch zehntausendWaggons Mais, es bleibt dann ein Abgang von mindestensdreißigtausend Waggons Getreide, ohne welche wir einfachzugrundegehen müssen. Ich ging, als ich diese Sachlageerfahren habe, zum Ministerpräsidenten, um mit ihm hierüberzu sprechen. Ich sagte, wie die Situation ist, es wird322
Bre^t-Litowskin wenigen Wochen unsere Kriegsindustrie, unser Bahnverkehrstillstehen, die Versorgung der Armee wird unmöglichsein, sie muß zusammenbrechen, und diese Katastrophe mußzum Zusammenbruche Österreichs und <strong>info</strong>lgedessen auchUngarns führen. Er beantwortete mir jede einzelne dieserFragen mit Ja, so ist es' und fügte bei, es geschehe alles,um eine Änderung herbeizuführen, insbesondere bezüglichder ungarischen Lieferungen. Niemand aber, auch nichtSeiner Majestät, sei es gelungen, etwas zu erzielen. Mankönne nur hoffen, daß ein Deus ex machina uns vor demÄrgsten bewahren werde."'Ich fügtedem bei:,,Ich finde keine Worte, um den apathischen ZustandSeidlers richtig zu kennzeichnen. Wie oft und wie inständigsthabe ich Euer Majestät gebeten, endlich energisch einzugreifenund Seidler einerseits, Hadik andererseits z u zwingen,Ordnung zu machen. Noch von hier aus habe ich EuerMajestät schriftlich beschworen, zu handeln, solange es nochZeit ist. Alles war umsonst."Ich entwickelte sodann, daß die einzige Hilfe noch darinbestehen könne, raschestens eine Aushilfe aus Deutschlandzu bekommen und sodann die zweifellos in Ungarn nochvorhandenen Vorräte mit Gewalt zu requirieren, und ich batden Kaiser zum Schlüsse, dem österreichischen MinisterpräsidentenKenntnis von diesem Telegramm zu geben.16. Januar 1918.Verzweifelte Hilferufe aus Wien um Nahrungsmittel. Ichmöge mich sofort an Berlin um Hilfe wenden, da sonst dieKatastrophe vor der Tür stehe. Ich antwortete folgendesan General Landwehr:,,Dr. Kühlmann telegraphierte nach Berlin, hat jedochwenig Hoffnung auf Erfolg. Die einzige Hoffnung bestehtnoch darin, daß Seine Majestät, wie ich geraten habe, sofortund dringendst selbst an Kaiser Wilhelm telegraphiert.323
Brest-LitowskIch behalte mir vor, nach meiner Rückkehr vor SeinerMajestät meinen Standpunkt zu vertreten, dahingehend, daßes unmöglich ist, die äußere Politik noch weiterzuführen,wenn der Ernährungsapparat in der zutage getretenen Formversagt. Noch vor wenigen Wochen haben Euer Exzellenz ganzpositiv gesagt, daß wir bis zur neuen Ernte werden durchhaltenkönnen."Gleichzeitig telegraphierte ich an den Kaiser:„Die einlaufenden Telegramme beweisen, daß die Situationbei uns kritisch zu werden beginnt. Was die Nahrungsfrageanbelangt, so werden wir dem Niederbruch nur unter zweiBedingungen entgehen können: erstens, daß uns Deutschlandprovisorisch aushilft, zweitens daß wir dieses Provisoriumbenutzen, um in dem unter jeder Kritik funktionierendenErnährungsapparat Ordnung zu machen und dieUngarn noch bestehenden Vorräte noch zu erfassen.Ich habe Dr. Kühlmann soeben die ganze Situation geschildert,und derselbe wird nach Berlin telegraphieren. Ersieht jedoch sehr schwarz, da Deutschland selbst großenMangel besitzt. Ich glaube, die einzige Hoffnung auf einenErfolg dieser Demarche wäre die, daß Euer Majestät sofortein durch die militärischen Organe zu entsendendes Hughestelegrammdirekt an Kaiser Wilhelm schicken, worin Sie ihndringend bitten, selbst zu intervenieren, um durch ein Aushelfenan Getreide den sonst unvermeidlichen Ausbruch derRevolution zu hindern. Ich mache noch ganz ausdrücklichdarauf aufmerksam, daß der Beginn der Unruhen bei uns imHinterlande einen Friedensschluß hier definitiv unmöglichgemacht haben wird. Sowie die russischen Unterhändlermerken, daß die Revolution bei uns im Anzüge ist,inschließensie keinen Frieden, da ihre ganze Spekulation auf diesenFaktor berechnet ist."17. Januar 1918.Schlechte Nachrichten aus Wien und Umgebung; großeStreikbewegung, die auf gekürzte Mehlquote und auf den324
Brest-Litowskschleppenden Verlauf der Brester Verhandlungen zurückzuführenist. Die Schwäche des Wiener Ministeriums scheintinsAschgraue zu gehen.Ich habe nach Wien telegraphiert, daß ich Hoffnung habe,mit der Zeit Vorräte aus der Ukraine zu sichern, wenn esnur gelingt, noch die nächsten Wochen die Ruhe bei unsaufrechtzuerhalten, und habe die Herren beschworen, ihrmöglichstes zu tun, um den hiesigen Frieden nicht zu verderben.Am selben Tage abends telegraphierte ich an MinisterpräsidentDr. Seidler:„Ich bedauere lebhaft, nicht die Macht zu besitzen, umalle die Fehler, welche die mit der Ernährung betrautenRessorts gemacht haben, zu paralysieren.Deutschland erklärt kategorisch, nicht helfen zu können,da es selbst zu wenig besitze.Hätten Euer Exzellenz oder Ihre Ressorts rechtzeitigdarauf aufmerksam gemacht, so wäre noch dieMöglichkeitgewesen, rumänische Vorräte herbeizuschaffen. Wie dieDinge jetzt liegen, so sehe ich keinen anderen Ausweg, alsdurch brutalste Gewalt so lange ungarisches Getreide zu requirierenund nach Österreich zu schaffen, bis das rumänischeund hoffentlich auch ukrainische Getreide kommen kann."20. Januar 1918.Die Verhandlungen sind zu dem Ende gekommen, daßTrotzki erklärt, die für ihn unannehmbaren Forderungen derDeutschen in Petersburg vorlegen zu wollen, sich jedoch bindendverpflichtet, zurückzukehren. Die Zuziehung der Vertreteraus den Randprovinzen will er nur, wenn er sich diePersonen aussuchen kann. Das ist unannehmbar. Mit denUkrainern, welche sich trotz ihrer Jugend als gewachsen, diefür sie günstige Situation auszunutzen, entpuppen, gehen dieVerhandlungen auch nur mühsam vom Fleck. Erst verlangtensie Ostgalizien für die neue „Ukraina". Das war nicht diskutabel.Dann wurden sie bescheidener, aber seitdem bei325
Brest-Litowskuns Unruhen ausgebrochen sind, wissen sie, wie es bei unssteht , und daß wir Frieden schließen müssen, um Getreide zubekommen. Jetzt verlangen sie eine Sonderstellung Ostgaliziens.Die Frage muß in Wien entschieden werden, und das österreichischeMinisterium muß das entscheidende Wort sprechen.Seidler und Landwehr erklären nochmals telegraphisch,ohne ukrainisches Getreide sei die Katastrophe unmittelbarbevorstehend. In der Ukraine sind Lebensmittel, wenn wirsie herausbekommen, so kann das Ärgste vermieden werden.Die Situation ist folgende: Ohne Zuschübe von außenmuß — laut Seidler — das Massensterben in wenigen Wocheneinsetzen.Deutschland und Ungarn liefern nichts mehr. AlleBoten berichten, daß die Ukraine große Überschüsse hat.Die Frage ist nur, ob wir sie rechtzeitig herausbekommen.Ich hoffe es. Wenn wir aber nicht rasch zum Frieden kommen,so werden sich die Unruhen zu Hause wiederholen, undmit jeder Demonstration in Wien wird der Friede hier teurer— denn die Herren Sewrjuk und Lewicky lesen den Gradunserer Hungersnot an diesen Unmhen ab wie an einemThermometer. Wenn die Leute, die diese Demonstrationengemacht haben, wüßten, wie sehr sie sich damit die Zufuhrukrainischer Lebensmittel erschwert haben! Wir waren sonahe daran, abzuschließen!Die ostgalizische Frage werde ich dem österreichischenMinisterium überlassen ; die muß in Wien entschieden werden.Die Cholmer Frage nehme ich auf mich. Ich kann und darf,um uns die polnischen Sympathien zu erhalten, nicht zuschauen,wie Hunderttausende verhungern, solange noch eineMöglichkeit der Hilfe besteht.Reise nach Wien.21. Januar 1918.Der Eindruck der Wiener Unruhen istnoch größer, als ich dachte, und wirkt katastrophal. DieUkrainer verhandeln nicht mehr, sie diktieren!In der Bahn fand ich beim Nachlesen früherer Protokolledie Aufzeichnungen über die am 1. August mit Michaelis326
Brest-Litowskstattgehabten Besprechungen. Nach diesen sagte damalsUnterstaatssekretär von Stumm:„Das Auswärtige Amt stünde mit den Ukrainern in Verbindung,und sei die separatistische Bewegung in derZur Förderung ihrer Bewegung stelltenUkraine sehr stark.die Ukrainer das Verlangen,es möge ihnen die Vereinigungmit dem Gouvernement Cholm und mit den von Ukrainernbewohnten Gebieten Ostgaliziens zugesagt werden. Solangenun Galizien zu Österreich gehöre, sei das Verlangennach Ostgalizien unerfüllbar. Etwas anderes wäre es, wennGalizien mit Polen vereinigt sei, dann sei eine AbtretungOstgaliziens möglich."Es scheint, daß die leidige Angelegenheit schon seit langemdurch die Deutschen präjudiziert ist.Am 22. Januar fand die Beratung statt, welche über dieukrainische Frage entschieden hat. Der Kaiser leitete dieDebatte ein, worauf er mir das Wort erteilte.Ich entwickeltevorerst die Schwierigkeiten, welche sich einem Frieden mitPetersburg entgegenstellen, und welche aus den obigen Aufzeichnungenmeines Tagebuches bereits bekannt sind. Ichgab meinem Zweifel Ausdruck, ob es gelingen werde, zu einemallgemeinen Frieden unserer Gruppe mitPetersburg zu gelangen.Sodann entwickelte ich den Verlauf der Verhandlungenmit den Ukrainern.Ich berichtete, daß die Ukrainerursprünglich die Abtretung Ostgaliziens gefordert hätten,was ich abgelehnt habe. Ebenso hätten sie bezüglich derruthenischen Gebiete Ungarns Postulate gestellt, die anmeiner Weigerung gescheitert wären. Jetzt forderten sie dieZweiteilung Galiziens und dieSchaffung einer selbständigenösterreichischen Provinz aus Ostgalizien und der Bukowina.Ich betonte die schwerwiegenden Folgen, welche die Annahmedes ukrainischen Postulates auf die weitere Entwicklungder austro-polnischen Frage haben müsse. Die Gegenleistungder Ukrainer solle darin bestehen, daß in demFriedensinstrument ein Handelsabkommen getroffen werde,327
Brest-Litowskwelches uns den sofortigenBezug von Getreide ermöglicht.Ferner würde Österreich-Ungarn für die in der Ukrainelebenden Polen vollste Reziprozität fordern.Ich betonte ausdrücklich, daß ich es für meine Pflicht halte,über den Stand der Friedensverhandlungen zu referieren,daß die Entscheidung nicht bei mir liegen könne, sondernbei dem Gesamtministerium, vor allem beim österreichischenMinisterpräsidenten. Die österreichische Regierung müßteentscheiden, ob dieses Opfer gebracht werden könne odernicht, wobei ich allerdings den Herren keinen Zweifel darüberließ, daß wir bei Ablehnung der ukrainischen Wünsche wahrscheinlichauch mit diesem Lande zu keinem Ergebnis kommen,daher gezwungen sein würden, ohne irgendeinen Friedenvon Brest-Litowsk nach Hause zu kommen.Nach mir ergriff der Ministerpräsident Dr. von Seidlerdas Wort, betonte vor allem die Notwendigkeit eines sofortigenFriedensschlusses und beleuchtete sodann die Frageder Schaffung eines ukrainischen Kronlandes insbesonderevom parlamentarischen Standpunkte aus. Der Ministerpräsidentmeinte, er werde auch trotz der zu erwartendenheftigen Opposition der Polen eine Zweidrittelmajoritätfür die Annahme des einschlägigen Gesetzentwurfesin dem Hause finden. Er verschließe sich nichtder Wahrheit, daß die Lösung heftige parlamentarische Kämpfeheraufbeschwören werde, betonte jedoch nochmals seine Hoffnungauf die Erhaltung einer Zweidrittelmajorität selbst gegendie polnische Delegation. Nach Seidler sprach der ungarischeMinisterpräsident Dr. Wekerle. Er begrüßte vor allem, daßden Ukrainern keine Konzessionen betreffs der in Ungarnlebenden Ruthenen gemacht worden seien. Eine reinlicheAbgrenzung der Nationalitäten sei in Ungarn undurchführbar.Die ungarländischen Ruthenen seien nebenbei auf einernoch zu tiefen Kulturstufe, um ihnen nationale Selbständigkeitzu geben. Dr. Wekerle warnte nachdrücklichst, auchin Österreich eine Einmengung von außen zu gestatten,328
Brest-Litowskdie Gefahr eines solchen Schrittes sei sehr groß, wir kämendamit auf eine schiefe Ebene und müßten an dem Standpunktefesthalten, daß die Monarchie jedwede Einmengungvon außen konsequent ablehne. Resümierend sprach sichdoch Wekerle gegen den Standpunkt des österreichischenMinisterpräsidentenaus.Ich ergriff darauf ein zweites Mal das Wort, um zu erklären,daß ich mir der eminenten Tragweite und der großenGefahren, welche dieser Schritt involviere, vollständig bewußtsei. Es sei wahr, daß wir uns dadurch auf eine schiefeEbene begäben, aber wenn nicht alles trüge, so befändenwir uns bereits seitlanger Zeit aus Gründen des Krieges aufdieser schiefen Ebene und könnten nicht wissen, bis wohinwir noch hinabgleiten würden. Ich stellte die positiveFrage an Dr. Wekerle, was ein verantwortlicher Leiter deräußeren Politik machen solle, wenn ihm sowohl der österreichischeMinisterpräsident als die beiden Ernährungsministerübereinstimmend erklärten, die ungarische Aushilfe anNahrungsmitteln könne uns nur mehr über die nächsten zweiMonate hinweghelfen, und nach dieser Zeit sei der Zusammenbruchvollständig unvermeidlich, wenn wir nicht von irgendeineranderen Seite Getreidezuschübe erhielten. Als Dr. Wekerlemir bei diesen Ausführungen widersprechend ins Wort fiel,erklärte ich, daß, falls er, Wekerle, Getreide nach Österreichliefern würde, ich der erste wäre, mich mit Freude auf seinenStandpunkt zu stellen, solange er aber auf seiner kategorischenWeigerung verharre und uns nichts liefern zu können behaupte,befänden wir uns in der Situation eines Mannes,welcher im dritten Stock eines brennenden Hauses sei und,um sich zu retten, aus dem Fenster herausspringe. DerMann werde in diesem Augenblicke nicht daran denken, ober sich die Beine breche oder nicht, er werde den möglichenTod dem sicheren vorziehen. Wenn die Situation tatsächlichso sei, daß wir in zwei Monaten ohne alle Nahrungsmitteldastünden, dann müßten wir die Konsequenzen aus dieser329
Brest-LitowskSachlage ziehen. Dr. Seidler ergriff hierauf ein zweites Mal dasWort und stimmte meinen Ausführungen vollinhaltlich zu.<strong>Im</strong> Laufe der weiteren Debatte wurde die Wahrscheinlichkeitdes definitiven Scheiterns der austro-polnischen Lösungim Zusammenhang mit dem ukrainischen Frieden besprochenund die Frage ventiliert, welche neue Konstellation sich ausdiesem Scheitern ergeben würde. Sodann ergriff SektionschefDr. Gratz das Wort, um über diese Frage zu referieren.Dr. Gratz betonte, daß die austro-polnische Lösungauch ohne die Annahme der ukrainischen Forderungenscheitern müsse, da die deutschen Postulate die Lösungunmöglich machten. Die Deutschen forderten, abgesehenvon ganz enormen territorialen Beschneidungen Kongreß-Polens, die Niederhaltung der polnischen Industrie, dasMiteigentumsrecht bei den polnischen Eisenbahnen undStaatsdomänen sowie die Überwälzung eines Teiles derKriegsschuld auf die Polen. Ein so geschwächtes, kaumlebensfähiges Polen, welches naturgemäß äußerst unzufriedensein müsse, könnten wir nicht an uns anschließen.Dr. Gratzverfocht den Standpunkt, daß es klüger wäre, auf das schoneinmal in allgemeiner Form diskutierte Programm zurückzukommen,jenes Projekt, welches das vereinigte Polen anDeutschland überläßt und dafür den Anschluß Rumäniensan die Monarchie durchsetzen wollte.Dr. Gratz entwickeltedes längeren den diesbezüglichen Standpunkt. Der Kaiserresümierte sodann die zutagegetretenen Meinungen dahin,daß vor allem der Friede mit Petersburg und der Ukraineanzustreben und daß mit der Ukraine auf Grund der ZweiteilungGaliziens in Verhandlungen einzutreten sei. DieFrage, ob die austro-polnische Lösung definitiv fallen zulassen sei, wurde nicht endgültig gelöst, sondern vorerstzurückgestellt.Am Schlüsse ergriff noch der gemeinsame FinanzministerBurian das Wort/ welcher ebenso wie Dr. Wekerle vor demösterreichischen Standpunkte warnte. Burian betonte, daß330
Brest-Litowskder Krieg wohl die innere Struktur der Monarchie ändernwerde, diese Umformung aber müsse von innen und nichtvon außen kommen, falls sie der Monarchie zum Segengereichen solle. Er betonte ferner, daß, wenn der österreichischeStandpunkt der Zweiteilung Galiziens durchgehensollte, die hierbei einzuschlagende Form von großer Bedeutungsei. Baron Burian riet, eine diesbezügliche Klauselnicht in das Friedensinstrument aufzunehmen, sondern ineinem geheimen Annex festzulegen.In dieser Form sehe er,Burian, noch die einzige Möglichkeit, die schweren Folgendes von der österreichischen Regierung gewünschten Vorgehensabzuschwächen. —Soweit die in meinem Tagebuch vorhandenen Aufzeichnungender Beratung. Die österreichische Regierung wardaher von dem mit der Ukraine projektierten Abkommennicht nur rechtzeitig verständigt; es erfolgte dasselbe vielmehrauf ihren direkten Wunsch, auf ihre Ingerenz und unterihrerVerantwortung.Abends inTrotzki eingetroffen.Brest eingetroffen.28. Januar 1918.29. Januar 1918.30. Januar 1918.Die erste Plenarsitzung hat stattgefunden. Es ist keinZweifel, daß die revolutionären Vorgänge in Österreich undin Deutschland die Hoffnungen auch der Petersburger aufUmsturz ins Ungeheuerliche gesteigert haben, und es scheintmir so gut wie ausgeschlossen, mit den Russen noch zu einemResultate kommen zu können.Es transpiriert aus der Umgebungder Russen, daß sie den Ausbruch der Weltrevolutionpositiv für die nächsten Wochen in Aussicht stellen, undihre Taktik geht dahin, etwas Zeit zu gewinnen und diesenMoment abzuwarten. Die Konferenz bot kein besondereszwischen Kühlmann und Trotzki.Ergebnis, nur SticheleienHeute ist die erste Kommissionssitzung über territoriale331
Brest-LitowskFragen, wo ich den Vorsitz übernehmen und unsere territorialenAngelegenheiten behandeln werde.Das einzig Interessante an der neuen Konstellation scheintdas zu sein, daß das Verhältnis zwischen Petersburg undKiew sich bedeutend verschlechtert hat und die KiewerKommission überhaupt nicht mehr als selbständige von denBolschewiki anerkannt wird.i. Februar 1918.Sitzung unter meinem Vorsitz über territoriale Fragenmit den Petersburger Russen. Meine Absicht geht dahin,die Petersburger und die Ukrainer gegeneinander auszuspielenund wenigstens entweder mit den einen oder denanderen zum Frieden zu kommen. Ich habe dabei noch dieleise Hoffnung, daß der Friedensschluß mit der einen Parteieinen so starken Druck auf die andere ausüben wird, daß maneventuell doch mit beiden zu einem Frieden kommen kann.Wie zu erwarten, erklärte sich Trotzki auf meine Frage,ob er anerkenne, daß die Ukrainer allein über ihre Grenzemit uns verhandeln dürfen, auf das allerentschiedenste dagegen,worauf ich nach kurzer Hin- und Herrede vorschlug,die Sitzung zu vertagen und eine Plenarsitzung einzuberufen,damit die Kiewer und Petersburger die Fragen untereinanderbereinigen könnten.2. Februar 1918.Ich habe die Ukrainer ersucht, endlich einmal offen mitden Petersburgern zu sprechen, und der Erfolg war ein fastallzu großer.Die Grobheiten, die die ukrainischen Vertreterden Petersburgern heute an den Kopf geworfen haben, warendirekt grotesk und beweisen, welche Kluft zwischen diesenbeiden Regierungen liegt, und daß es nicht unsere Schuldist, wenn wir sie nicht unter einen Friedenshut bringenkönnen. Trotzki war in einem aufgelösten Zustande, daßer einem leid tun konnte. Ganz blaß, sah er krampfhaft vorsich hin und zeichnete nervös auf seinem Fließpapier. DickeSchweißtropfen perlten auf seiner Stirn herunter. Das332
Brest-Litowskpeinliche Gefühl, von den eigenen Mitbürgern in Gegenwart derFeinde beschimpft zu werden, muß er tief empfunden haben.Kürzlich waren die beiden Brüder Richthofen' hier. Derältere hat etliche sechzig, der jüngere „nur" etliche dreißigfeindliche Flieger im Luftkampfe abgeschossen. Der älterehat ein Gesicht wie ein junges, hübsches Mädchen. Er erzähltemir, ,,wie man das macht". Es sei sehr einfach; manmüsse nur ganz nahe an den feindlichen Flieger heran, vonrückwärts, und dann fest schießen — dann fiele der andereherunter. Nur müsse der Mensch den „eigenen Schweinehund"besiegen und sich nicht davor scheuen, ganz nahe anden Gegner heranzufliegen. Moderne Helden.Zwei hübsche Geschichten wurden anläßlich der beidenRichthofen erzählt:Die Engländer hatten einen Preis auf den Kopf des älterengesetzt. Als Richthofen dies erfuhr, ließ er ihnen durchFlugzettel sagen, um ihnen die Arbeit zu erleichtern, damitsie ihn leichter erkennen, werde sein Apparat von morgenan grellrot gestrichen sein. Als seine Staffel den nächstenMorgen aus dem Hangar herauskam, waren alle Apparategrellrot. Einer für alle und alle für einen.Die zweite Geschichte: Richthofen und ein Engländerkreisten umeinander und beschossen sich wie rasend. Siekamen immer näher, und schon konnten sie ganz deutlichgegenseitig ihre Gesichtszüge erkennen. Plötzlich spießt sichetwas an dem Maschinengewehre Richthofens, und er kannnicht mehr schießen. Der Engländer blickt erstaunt herüber,und als er die Lage Richthofens bemerkt, winkt er mit derHand, wendet ab und fliegt davon. Fair play! Ich möchtediesen Engländer kennen, um ihm zu sagen, daß er in meinenAugen größer ist als die Helden der Antike.3. Februar 1918.Abreise nach Berlin.Kühlmann, Hoffmann, Colloredo.333
Brest-LitowskAnkunft in Berlin.untereinander beraten.Den ganzen Tag Sitzung.4. Februar 1918.Nachmittags nichts, da die Deutschen5. Februar 1918.Ich geriet mehrmals heftig mitLudendorff aneinander. Die wünschenswerte Klarheit ist,wenn auch noch nicht erreicht, doch jedenfalls im Zuge. Eshandelt sich neben der Klarstellung der Taktik für Brestdarum, endlich einmal schriftlich festzulegen, daß wirnur für den vorkriegerischen Besitzstand Deutschlands zukämpfen verpflichtet sind. Ludendorff opponierte heftigund sagte: „Wenn Deutschland ohne Profit Frieden macht,so hat es den Krieg verloren."Als sich die Kontroverse immer mehr zuspitzte, stießmich Hertling an und flüsterte mir zu: „Lassen Sie ihn,wir zwei werden das zusammen machen ohne Ludendorff."Ich werde das Elaborat jetzt sofort ausarbeiten und Hertlingeinsenden.Abend: Essen beiHohenlohe.6. Februar 1918.Abends Ankunft in Brest. Wiesner hat unermüdlich undausgezeichnet gearbeitet; die Situation ist auch dadurchgeklärter, daß durch die gestern erfolgte Ankunft des österreichischenRuthenenführers Nikolay Wassilko,trotzdem er,offenbar angeeifert durch die Rolle, die seine russischukrainischenGenossen jetzt in Brest spielen, national hierviel chauvinistischer spricht, als ich ihn in Wien zu kennenglaubte, wir uns endlich über das Mindestmaß der ukrainischenForderungen klar sind. Ich habe in Berlin geraten,Dannmit den Ukrainern so rasch als möglich abzuschließen.würde ich im Namen Deutschlands mit Trotzki zu verhandelnbeginnen und sehen, ob ich nicht durch ein Gespräch untervier Augen mit ihm darüber Klarheit schaffen könne, ob eineEinigung möglich sei oder nicht. Das ist eine Idee von Gratz.Nach einigem Widerstreben gaben sie das zu, und am334
Brest-Litowsk7. Februar 1918fand meine Unterredung mit Trotzki statt. Ich habe Gratzmitgenommen, welcher alle meine an ihn gestellten Erwartungennoch weit übertroffen hat. Ich begann damit, Trotzkizu sagen, daß ich den Eindruck hätte, daß der Abbruch unddie Wiederaufnahme des Krieges unmittelbar bevorstünden,und wissen möchte, ob dies ganz unvermeidlich sei, bevorder folgenschwere Schritt getan sei. Ich bitte daher HerrnTrotzki, mir offen und klar jene Bedingungen zu sagen, dieer akzeptieren könne. Trotzki entwickelte darauf in sehroffener und klarer Weise, daß er gar nicht so naiv sei, wiewir anzunehmen schienen, daß er ganz genau wisse, daßdie Macht das stärkste aller Argumente sei, und daß dieZentralmächte imstande seien, Rußland die Provinzen zunehmen. Er habe mehrmals schon in Konferenzen Kühlmanndie Brücke bauen wollen und ihm gesagt, es handlesich nicht um das freieSelbstbestimmungsrecht der Völkerin den okkupierten Provinzen, sondern um nackte brutaleAnnexionen, und der Macht müsse er sich beugen.Niemalswerde er seine Prinzipien aufgeben, und niemals werde ererklären, er anerkenne diese Auslegung des Selbstbestimmungsrechtesder Völker. Die Deutschen mögen klipp undklar erklären, welche die Grenzen seien, die sie fordern, eiwerde darauf vor ganz Europa feststellen, daß es sich umeine brutale Annexion handle, daß Rußland aber zu schwachsei, um diese zu verteidigen. Bloß die Moonsund-Inselnscheinen ihm einen unverdaulichen Bissen darzustellen.zweiter Linie, und das ist sehr bezeichnend, erklärte Trotzki,er könne niemals zugeben, daß wir einen Frieden mit derUkraine schließen, denn die Ukraine sei nicht mehr in derHand der Rada, sondern in der seiner Truppen. Sie bildeeinen Teil Rußlands, und ein Friedensschluß mit dieserwürde eine Einmischung in die internen AngelegenheitenRußlands bedeuten. Die Angelegenheit scheint so zu stehen,daß vor zirka zehn Tagen tatsächlich die russischen TruppenIn335
Brest-Litowskin Kiew eingetroffen waren, seitdem aber wieder verjagtsind und die Rada nach wie vor wieder die Macht in Händenhat. Ob Trotzki über letzteres nicht <strong>info</strong>rmiert ist, oder ober absichtlich die Unwahrheit spricht, ist nicht sicher, dochscheint mir eher ersteres der Fall zu sein.Die letzte Hoffnung, mit Petersburg zu einer Verständigungzu kommen, ist geschwunden. In Berlin wurde eineAufforderung der Petersburger Regierung aufgefangen, welchedie deutschen Soldaten aufhetzt, den Kaiser und die Generalezu ermorden und sich mit den Sowjets zu verbrüdern.Daraufhin kam ein Telegramm Kaiser Wilhelms an Kühlmannmit dem Befehle, sofort Schluß zu machen und außerKurland und Litauen auch noch die unbesetzten GebieteLivlands und Estlands zu verlangen — alles, ohne das Selbstbestimmungsrechtder Völker zu berücksichtigen.Die Gemeinheit dieser Bolschewisten macht Verhandlungenunmöglich. Ich kann es Deutschland nicht verargen, daßdieses Vorgehen sie empört; aber der Auftrag von Berlindarf dennoch nicht durchgeführt werden.Livland und Estlandwollen wir nicht auch noch hineinziehen.8. Februar 1918.Heute abend soll der Friede mit der Ukraine unterschriebenwerden. Der erste Friede in diesem fürchterlichen Kriege.Ob nun die Rada wirklich noch in Kiew sitzt? Wassilkozeigt mir eine Hughesdepesche, datiert vom 6. d. M. ausKiew an die hiesige ukrainische Delegation, und Trotzkihat meinen Vorschlag, einen österreichischen Generalstabsoffizieran Ort und Stelle zu entsenden, damit er uns authentischeNachricht bringe, abgelehnt. Offenbar also war seineBehauptung, die Bolschewiken wären schon Herren derUkraine, doch nur eine List! Übrigens meldet Gratz, daßTrotzki, den er heute früh sprach, über unsere Absicht,doch heute den ukrainischen Frieden fertigzustellen, sehrdeprimiert sei. Das bestärkt mich in dem Entschluß, zu336
Brest-Litowskunterschreiben.Petersburgern vereinbart,Gratz hat für morgen eine Sitzung mit denda wird Klarheit geschaffen werden,ob eine Einigung möglich istoder der Abbruch unvermeidlich.Jedenfalls ist kein Zweifel, daß das Brester Intermezzomit großen Schritten seinem Ende entgegengeht.Nach Abschluß des Friedens mit der Ukraine erhieltvom Kaiser nachstehendes Telegramm:ich„Hofzug, 9. Februar 1918.Tief ergriffen und beglückt von der Nachricht über denAbschluß des Friedens mit der Ukraine sage Ich Ihnen, lieberGraf Czernin, aus vollem Herzen Dank für Ihre zielbewußteund erfolgreiche Arbeit.Sie haben Mir damit den schönsten Tag Meiner bisherrecht sorgenreichen Regierungszeit bereitet, und Ich flehezu Gott dem Allmächtigen, daß er Ihnen weiter helfen mögeauf dem harten Pfade — zum Wohle der Monarchie undihrer Völker. xr ...Karl.11. Februar 1918.Trotzki lehnt es ab, zu unterschreiben. Der Krieg ist aus,aber Friede istkeiner.Die desaströse Wirkung der W7iener Unruhen erhellt ausnachstehender Meldung des Herrn von Skrzynski, de datoMontreux vom 12. Februar 1918. Skrzynski schreibt: ,,Ichhöre von verläßlicher Quelle, daß Frankreich folgende Paroleausgegeben hat: On etait dejä tout dispose ä commencerä causer avec l'Autriche. .Maintenant on se demande, sieileest encore assez solide pour le röle qu'on voulait lui fairejouer. On craint de baser toute une politique sur un etatque menace dejä peut-etre le sort de la Russie." UndSkrzynski fügt bei: ,,In den allerletzten Tagen hörte ich:On s'estdecide d'attendre quelque temps."Unsere Situation während der Verhandlungen mit Petersburgwar demnach die folgende: Es war unmöglich, die22 Czernio, Ira <strong>Weltkriege</strong>337
Brest-LitowskDeutschen zu veranlassen, sich auf den Standpunkt des Verzichtesvon Kurland und Litauen zu stellen. Die physischeDer Druck, der von der OberstenMacht hatten wir nicht.Heeresleitung einerseits ausgeübt wurde, und das unaufrichtigeSpiel der Russen andererseits machte dies unmöglich.Wir standen daher vor der Alternative, entweder unsbei der Unterzeichnung des Friedens von Deutschland zutrennen und ein separates Friedensinstrument zu unterschreibenoder gemeinsam mit den drei Bundesgenossen denFrieden zu fertigen, welcher die versteckte Annexion derrussischen Randprovinzen enthielt.Die erstere Alternative involvierte die große Gefahr, daßder in dem Vierbunde bereits sichtbare Riß zur Kluft erweitertwerde. Der Vierbund vertrug solche Experimentenicht mehr. Wir standen vor der letztengewaltigen militärischen Anstrengung, und die Geschlossenheitdes Vierbundes durfte unter keiner Bedingung neuerlicherschüttert werden. Auf der anderen Seite war dieGefahr vorhanden, daß Wilson,der einzige Staatsmann derWelt, welcher bereit war, dem Gedanken eines Verständigungsfriedensnäherzutreten, durch den Friedensschlußein falsches Bild unserer Intentionen erhalte. Ich hofftedamals — und darin habe ich mich nicht getäuscht —,daßdieser eminente Kopf die Situation durchblicken und erkennenwerde, daß wir uns in einer Zwangslage befinden.Seine früher erwähnten, nach dem Brester Frieden an unsereAdresse gehaltenen Reden haben die Richtigkeit meinerVermutung bestätigt.Der Friede mit der Ukraine ist unter dem Drucke derausbrechenden Hungersnot zustandegekommen. Er trägtdas Charakteristiken seiner Geburt an sich. Das ist richtig.Aber ebenso richtig ist es, daß wir trotz des Faktums, daßwir bedeutend weniger aus der Ukraine erhalten haben alswir hofften, ohne diese Zuschübe überhaupt nicht hättenbis zur neuen Ernte leben können. Statistisch nachweisbar338
Brest-Litowsksind aus der Ukraine im Frühjahr und Sommer 1918 zweiundvierzigtausendWaggons eingetroffen. Es wäre unmöglichgewesen, diese Lebensmittel von irgendwo anderszu verschaffen. Millionen von Menschen sind dadurch vondem Hungertode gerettet worden, das mögen diejenigen bedenken,die den Frieden verurteilen.Es ist ferner zweifellos, daß dank der großen Vorräte, welchein der Ukraine vorhanden waren, eine unvergleichlich größereMenge nach Österreich hätte gelangen können, wenn derAufbringungs- und Transportapparat anders funktionierthätten.Der Herr Staatssekretär für Ernährungswesen hat mirauf mein Ersuchen im Mai 1919 folgende statistische Datenzur Veröffentlichung gegeben:„Kurze Darstellung der Organisation der Einfuhr von Getreideaus der Ukraine (auf Grund des Brest-LitowskerFriedens) und deren Ergebnisse:Nachdem es zunächst mit großen Anstrengungen gelungenwar, ein angemessenes Übereinkommen mit Deutschlandüber die Aufteilung der ukrainischen Bezügeherbeizuführen, wurde eine Mission nach Kiew abgesendet, inder nicht nur Regierungsbeamte, sondern auch die bestqualifiziertenund erfahrensten Fachleute, die die Regierung heranziehenkonnte, vertreten waren.Auch Deutschland und Ungarn hatten Fachleute entsendet,darunter Persönlichkeiten, die über eine dezennienlange Erfahrungim russischen Getreidegeschäfte verfügten, und dieim Dienste sowohl deutscher wie auch ententistischer Getreidefirmengestanden waren (so zum Beispiel ehemaligeAngestellte der maßgebenden französischen GetreidefirmaLouis Dreyfuß).Die offizielle Mission langte Mitte März in Kiew an undbegann sofort ihre Arbeit. Schon verhältnismäßig kurzeZeit genügte, um zu erkennen, daß sich dieser Arbeit ganzaußerordentliche Hindernisse entgegenstellten.339
Brest-LitowskDie ukrainische Regierung, die in Brest-Litowsk erklärthat, daß sehr große, angeblich eine Million Tonnen nochübersteigende Lebensmittelmengen ausfuhrfähig wären, warinzwischen von einem anderen Ministerium ersetztworden.Das am Ruder befindliche Kabinett zeigte keine besondereNeigung oder wenigstens Eile, um eine Verpflichtung indieser Höhe zu erfüllen, sondern war alsbald bemüht, zubeweisen, daß dies aus mannigfachen Gründen völlig unmöglichsei.Dazu kam, daß im Brester Frieden förmlich ein TauschZug um Zug, Ausfuhrware gegen Ausfuhrware, vorgesehenwar,aber weder Deutschland noch auch Österreich-Ungarnauch nur annähernd in der Lage waren, solche Warengegenwerte(verlangt wurden vor allem Textilien) zu hefern.Man mußte demnach daran denken, die aufzukaufendenWaren zunächst kreditiert zu erhalten, und die ukrainischeRegierung war auch nach längeren und keineswegs einfachenVerhandlungen geneigt, Valutakredite (gegen Gutschriftenvon Mark und Krone in Berlin und Wien) zur Verfügung zustellen. Die bezüglichen Verträge sind zum Abschlüssegelangt, und es wurden im ganzen von den beiden Mittelmächtensechshundertdreiundvierzig Millionen Karbowanezdarauf behoben.Dagegen hat das Rubelsyndikat, das unter der Führungder deutschen Hochfinanz von den bedeutendsten Berliner,Wiener und Budapester Banken geschlossen wurde, in denersten Monaten nur eine ganz geringe Tätigkeit entfaltenkönnen.Schon das Zustandekommen dieses Syndikates war mitgroßen Schwierigkeiten, vor allem Zeitverlusten, verbunden,und auch dann erwies sich dieser Apparat als sehr schwerfällig.Jedenfalls hatte er nur verhältnismäßig geringeRubelmengen aufgebracht, so daß die Einkaufsorganisationin der Ukraine besonders im Anfange unter chronischemMangel an Zahlungsmitteln litt.340
Brest-LitowskAllerdings hätte auch eine bessere Regelung der Geldfragedoch nur in einigen besser bevorrateten Bezirken eine entscheidendeÄnderung hervorgerufen, denn die grundlegendeSchwierigkeit war eben der Mangel an Vorräten. DieTatsache, daß Kiew und Odessa selbst ständig vor derGefahr einer Brotkrise standen, kennzeichnet wohl am bestendieLage.In der Ukraine machte sich eben die Tatsache der vierjährigenKriegswirren und der bolschewistischen Zerstörungen(November 1917 bis März 1918) im stärksten Maße bemerkbar;Anbau und Ertrag waren überall zurückgegangen; soweitaber Vorräte vorhanden waren, sind sie von den Bolschewikenbei ihrem Rückzuge nach Norden teils zerstört, teilsmitgenommen worden. <strong>Im</strong>merhin ergaben die im Lande angestelltenErhebungen das Vorhandensein gewisser, wennauch bescheidener Bestände, und es wurde nun an dem Aufbaueiner Einkaufsorganisation gearbeitet. Der ursprünglichvon uns und Deutschland geplante freie Einkauf in derUkraine konnte jedoch nicht in die Tat umgesetzt werden,denn die ukrainische Regierung erklärte, daß sie diese Organisationselbst aufstellen wolle, woran sie mit aller Eifersuchtund Hartnäckigkeit festhielt. Nun war aber im Lande eineAutorität durch die Revolution und dann durch den bolschewikischenEinbruch vernichtet, die Bauernschaft radikalisiert,die Güter von Revolutionären besetzt und zerstückelt.Die Autorität der Regierung war somit zur Getreideaufbringungganz und gar unzureichend; andererseits war sieaber immerhin (wie einzelne Fälle bewiesen) groß genug, umuns Hindernisse, ja unübersteigliche. Schwierigkeiten zu bereiten.Man mußte alsomit der Regierung zusammengehen, dasheißt ein Kompromiß mit ihr herbeiführen. Nach wochenlangenVerhandlungen kam dies schließlich unter stärkstemdiplomatischen Drucke zustande, und demgemäß wurde derVertrag vom 23. April 1918 unterzeichnet.34i
-Brest-LitowskEr sah die Errichtung einer deutsch-österreichischungarischenWirtschaftszentrale vor; praktisch gesprochen:ein großes Getreidekaufhaus, in das die Mittelmächteeine Reihe ihrer erfahrensten und mit den russischenVerhältnissen durch jahrelange Tätigkeit vertrauten Getreidefachleute entsendete.Während aber noch dieser ganze Apparat in Aufstellungdem Eindruckebegriffen war, hatte man in Wien (unterder Ergebnisse einer Kaiserreise in Nordböhmen) d i e G e d u 1 dverloren; militärische Faktoren glaubten, dem Arbeiten einerkommerziellen Zivilorganisation in der militärisch besetztenUkraine nicht länger zusehen zu sollen, und so wurde vomGeneralstabe ein kaiserlicher Befehl erwirkt, durch denösterreichisch-ungarische Heeresteile mit der Aufbringung inden von ihnen besetzten Bezirken betraut wurden. ZurDurchführung dieser Aktion wurde ein (bis dahin in Rumänientätiger) General nach Odessa entsendet, der nun von dort auseine militärische Separataktion einleitete.Als Zahlungsmittelwurden Kronen verwendet, die von Wien bezogenwurden. Die Kriegsgetreideverkehrsanstalt wurde durcheinen kaiserlichen, an die Regierung ergangenen Auftragveranlaßt, dem Kriegsministerium hundert Millionen Kronenzur Verfügung zu stellen, welche Mittel vom Finanzapparatdieser Anstalt tatsächlich beigestellt wurden.Diese militärische Aktion und ihre Durchführung hat dieZivilaktion während ihres Aufbaues sehr beeinträchtigt undweiters durch das starke Angebot an Kronennoten den Wertunserer Valuta in der Ukraine außerordentlich geschädigt.Überdies sind die so in der Ukraine in Verkehr gelangtenKronennoten durch Schmuggel über Schweden auf dieskandinavischen und holländischen Märkte gelangt undhaben dort einige Monate später zu dem bekannten Kurssturzder Krone ohne Zweifel beigetragen.Die österreichisch-ungarische militärische Separataktionfand auf deutscher Seite eine sehr abfällige Beurteilung,342
Brest-Litowgkund als wir in höchster Lebensmittelnot (Mitte Mai) deutscheAushilfen bis zur neuen Ernte erbitten mußten, wurden solchenur unter der Bedingung gewährt, daß militärische SonderaktionenÖsterreich-Ungarns in Zukunft unterbleiben und dieFührung in der Ukraine überhaupt an Deutschland übergeht.Man hoffte damals auf stärkere Zufuhren, insbesondereaus Bessarabien, wo von deutscher Seite eine Aufbringungsorganisationeingerichtet worden war, deren Förderung dierumänische Regierung versprochen hatte. Diese Hoffnungwurde aber ebenso enttäuscht, wie im Juni und Juli dieUkraine immer mehr versagte. Das Land war eben jedwedergrößeren Vorräte fast gänzlich entblößt; dabei ist der Aufbringungsapparatniemals ordentlich in Gang gekommen,da das System der Höchstpreise durch die Uberbietungendurch unser Militär vielfach gestörtwurde.Inzwischen waren alle Vorbereitungen für die Erfassungder Ernte 1918 getroffen worden.Die Aufbringungsorganisationwar inzwischen etwas fester fundiert und ausgebautworden, die notwendigen persönlichen Beziehungen warenvielfach geschaffen, und es wäre wohl möglich gewesen,größere Mengen aus dem Lande herauszubringen.Zunächst mußte aber der Bedarf der ukrainischen Städtegedeckt werden, wo vielfach geradezu Hungersnot herrschte,dann der Bedarf der ukrainischen und endlich der sehr bedeutendendeutschen und österreichisch-ungarischen Besatzungstruppen.Erst nach Schaffung gewisser Vorräte fürdiese Bedarfsgruppen wollte die ukrainische Regierung einenExport zulassen, welcher Standpunkt an sich gutgeheißenwerden mußte.Alsbald mußte allerdings erkannt werden, daß der Anbauim ganzen Lande außerordentlich zurückgegangen war —eine Folge der völlig unsicheren Rechtsverhältnisse, wie sienach der Agrarrevolution bestanden. Die lokalen Faktorenwaren nun unter dem Eindrucke dieser Tatsache weniggeneigt, Ausfuhren zu gestatten, und es kam förmlich zur343
Brest-Litowskbezirksweisen Absperrung — ganzähnlich, wie wir es auchbei uns erlebten.Vor allem aber machte sich die (schon vorher häufig bemerkbare)Agitation der Ententeagenten unter dem Eindruckeder deutschen militärischen Niederlagen nunmehraußerordentlich fühlbar.Die Stellung der von Deutschlandeingesetzten Kiewer Regierung war ungemein schwach.Auch arbeiteten die im ganzen Lande noch immer tätigenbolschewistischen Elemente mit steigendem Erfolg gegenunsere Organisation. Das alles erschwerte im September undOktober die Arbeit — und dann kam der Zusammenbruch.Auch die Schwierigkeiten, die das Transportproblem bot,waren ungeheure; die Zufuhren mußten entweder zumSchwarzen Meere, dann über dieses und schließlich von derDonaumündung herauf oder aber quer durch ganz Galizienabgewickelt werden. Hierzu fehlten mehrfach Waggons,auch in der Ukraine Kohle; es kam auch zu Resistenzen derdortigen Eisenbahner, die von Bolschewiken verhetzt waren,und ähnliches mehr.So sehr auch der Mangel an Vorräten in der Ukraine selbst,wie auch die Beschränktheit unserer russischen Zahlungsmitteldazu geführt haben, daß die Hoffnungen, die beim Abschlüssedes Friedens von Brest-Litowsk allgemein gehegtwurden, auch nicht annähernd in Erfüllung gegangen sind,so kann doch behauptet werden, daß zur Überwindung derunerhört großen Schwierigkeiten das Menschenmöglichegeleistet wurde. Insbesondere sind durch Einschaltung derberufensten und erfahrensten Firmen des Getreidehandelsdiese Kräfte so sehr als möglich ausgenützt worden.Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, daß die Einfuhrorganisationen— abgesehen von dem bereits erwähntenEingreifen der Militärverwaltung und der hierdurch verursachtenSystemschwankungen — vielfach durch einen sehrumfangreichen Schmuggelverkehr gestört wurden, der insbesonderevon Galizien aus betrieben wurde. Da bei diesem34-
.Brest-LitowskSchmuggelverkehr die hohe ukrainische Ausfuhrabgabe erspartwurde, wurden die von der ukrainischen Regierungfestgesetzten Höchstpreise immer wieder überboten. DieserSchmuggel wurde vielfach übrigens auch von Wiener maßgebendenFaktoren gefördert; überhaupt hatte die Nervosität,die in leitenden Wiener Regierungsstellen vielfach herrschteund die eigenen Organisationsmaßnahmen häufig öffentlichkritisierte oder kaum getroffene Verfügungen umstieß, bevorsie noch wirksam werden konnten, vielfach sehr geschadet.Es soll übrigens nicht unerwähnt bleiben, daß auch Deutschlandeinen nicht unbedeutenden, unoffiziell gefördertenSchmuggel betrieb, der auf die offiziellen Einfuhrorganisationenungünstig zurückwirkte und wieder die österreichischenStellen veranlaßte, ein Gleiches zu tun.Trotz aller Hindernisse hat der aufgestellte Apparat, wieaus der nachfolgenden Übersicht entnommen werden kann,immerhin nicht unbeträchtliche Mengen an Lebensmittelnan die Vertragsstaaten, im ganzen zirka zweiundvierzigtausendWaggons Lebensmittel, geliefert,wenn auch leider die eingeführten Mengen den ursprünglichgehegten Erwartungen nichtentsprachen.Übersichtder vom Beginn des Einsetzens der ukrainischen Einfuhren (Frühjahr1918) bis November 1918 aus der Ukraine durchgeführten Einfuhren.I. Artikel der Kriegsgetreideverkehrsanstalt(Getreide, Mahlprodukte, Hülsenfrüchte, Futtermittel, Sämereien).Insgesamt eingeführt für die Vertragsstaaten (Deutschland,Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei)113 421 Tonnenhiervon für Österreich - Ungarn 57382 Tonnen(Getreide und Mehl hiervon .... 46 225 Tonnen)345
Brest-LitowskII.Insgesamt:Artikel der österreichischen Zentraleinkaufsgesellschaft.Hiervon fürÖsterreich-Ungarn:Butter, Fett, Speck. 3329403 kg 2170437 kg. .öl, Speiseöl 1 802 847 kg 977 105 kgKäse, Quark 420818 kg 325103 kgFische,Fischkonserven,Heringe 1 213 961 kg 473 561 kgRinder 105 542 Stück 55 421 St.(36 834 885 kg) (19 505 760 kg)Pferde 95 976 Stück 40 027 St.(31 625 175 kg) (13 165 725 kg)Pökelfleisch 2 927 439 kg 1 571 569 kgEier 75 200 Kisten 32 433 Kst.Zucker 66 809 969 kg 24 973 443 kgDiverse Lebensmittel . .27 385 095 kg 7 836 287 kgZusammen 172 349 556 kg 61 528 220 kgund 75 200 Kst. Eier 32 433 Kst.(in insgesamt 30 757 Waggons)(in insges. 13 037 Wagg.).Die sub II. eingeführten Artikel repräsentiereneinen Wert von rund 450 Millionen Kronen.Der Umfang der im Schmuggelwege unoffiziell nachden Vertragsstaaten eingeführten Artikel wird auf 15 000Waggons (etwa die Hälfte der offiziellen Einfuhren) geschätzt.* **So endete diese Phase, eine Phase, die uns wichtig erschien,während wir sie erlebten, und die doch nichts andereswar als eine Phase ohne weitere Bedeutung, weil ohnedauernde Wirkung.346
Brest-LitowskDie Wellen des Krieges sind über den Brester Friedenhinübergegangen und haben ihn zerstört wie einen Sandbauam Meeresstrand, der von der Flut hinweggespült wird.Das Wort vom „Brotfrieden" ist nicht von mir geprägtworden,sondern von dem Bürgermeister Weiskirchner anläßlichmeines Empfanges durch den Wiener Gemeinderatam Nordbahnhofe. Die Millionen, denen die zweiundvierzigtausendWaggons das Leben gerettet haben, können seinWort ohne Hohn wiederholen.
XLDer Friede von Bukarest
Schonin Brest-Litowsk verdichteten sich die Nachrichten,daß Rumänien den Krieg nicht fortzusetzen gedenke.Diese Nachrichten nahmen einen ganz bestimmten Charakternach dem mit der Ukraine abgeschlossenen Frieden an.Sowohl dieser Friede als die Haltung Trotzkis ließen inBukarest keinen Zweifel darüber bestehen, daß Rumänienauf eine weitere Kooperation Rußlands nicht mehr zählenkönne, und dürfte bei den dortigen Machthabern zum Teilden Gedanken wachgerufen haben, einzulenken. Ich sagezum Teil, denn eine Gruppe war bis zum letzten Augenblickden Kampf fortzusetzen.Schon in der Brest-Litowsker Zeit begann ich mich mitdafür,den Führern des ungarischen Parlaments inVerbindung zusetzen, um eine Übereinstimmung in den Friedenszielen gegenRumänien zu erreichen. Es war klar, daß das Programmeinesannexionslosen Friedens gegenüber Rumänien schwierigerals gegen jeden anderen Staat durchzuführen sein werde,weil der verräterische Überfall der Rumänen in ganz Ungarnden Wunsch nach besseren strategischen Grenzen wachgerufenhatte. Ich stieß, wie zu erwarten, auf einen heftigenWiderspruch seitensder Ungarn, welche unter dem Nameneiner strategischen Grenzberichtigung tatsächlich größereAnnexionen wünschten. Der erste, mit dem ich verhandelte,war Stephan Tisza, welcher mit vieler Mühe seinen35i
:Der Friede von Bukarestursprünglichen Standpunkt modifizierte und schließlich soweit gebracht werden konnte, daß er die dem Frieden zugrundeliegendenGedanken als „erträglich" bezeichnete. Am27. Februar 1918 übergab er mir ein Promemoria mit demErsuchen, es dem Kaiser zu zeigen, in welchem er seinenbereits milderen Standpunkt darlegte, einen Standpunkt, welcherimmerhin noch ziemlich deutlich seine Unzufriedenheitmit meinen Intentionen erkennen ließ. Das Promemorialautete„Promemoria.«^ Leider kann Rumänien aus diesem Kriege nicht sogeschwächt hervorgehen, wie es sowohl die Gerechtigkeitals das berechtigte Interesse der Monarchie erheischenwürde.Der Verlust der Dobrudscha wird durch Territorialgewinnin Bessarabien wettgemacht, während die von uns verlangteGrenzrektifikation in keinem Verhältnisse mit der SchuldRumäniens und mit seiner militärischen Lage steht.Unsere Friedensbedingungen sind derart mild, daß sie alsgroßmütige Gabe dem besiegten Rumänien angeboten undgar nicht zum Gegenstande von Verhandlungengemacht werden sollten. Keinesfalls dürften diese Verhandlungenden Charakter eines Handelns oder Feilschensannehmen. Weigert sich Rumänien, auf der von uns angebotenenBasis Frieden zu schließen, so kann nur die Wiederaufnahmeder Feindseligkeiten unsere Antwort sein.Ich halte es für höchst wahrscheinlich, daß es die rumänischeRegierung hierauf ankommen lassen wird, um vor denWestmächten und der eigenen Bevölkerung den Beweis ihrerNotlage zu führen. Ebenso wahrscheinlich ist es aber, daßsie nach dem Abbruch der Verhandlungen raschestens einlenkenund sich vor unserer Übermacht beugen wird.Schlimmstenfalls würde einkurzer Feldzug den vollständigenZusammenbruch Rumäniens zur Folge haben.Es ist nach menschlicher Voraussicht beinahe sicher, daß352
Der Friede von Bukarestdie Entwicklung der Dinge einen der letzten Phase desFriedens mit Nordrußland ähnlichen Verlauf nehmen undeinen leichten und vollen Erfolg für die Zentralmächte bedeutenwürde. Daß wir die Grenzrektifikation als Conditiosine qua non durchsetzen, bildet ein berechtigtes, wichtigesInteresse der Monarchie rein defensiver Natur und ein energischesVerlangen der ganzen patriotischen öffentlichenMeinung Ungarns. Es scheint ausgeschlossen zu sein, daßein Minister des Äußern, welcher eine andere Haltung indieser Frage bekunden würde, sich in der Delegation haltenkönnte.Auch ist dieses Vorgehen — und hierauf soll das größteGewicht gelegt werden — absolut notwendig, um die Chancendes allgemeinen Friedens nicht zu kompromittieren.Es ist aus öffentlichen Erklärungen leitender Staatsmännerder Westmächte klar ersichtlich, daß sie zu einemannehmbaren Frieden darum nicht zu haben sind, weil siean unsere Fähigkeit und unseren festen Willen, durchzuhalten,nicht glauben. Alles, was sie in dieser Auffassungbestärkt, wirft uns weiter vom Frieden: der einzige Weg,der uns dem Frieden wirklich näherführt, istwelche geeignet ist, diesen Glauben zu zerstören.eine Haltung,Dies soll die Richtschnur in allen unseren Entschlüssenund Handlungen bilden. Auf den rumänischen Frieden angewendetist es klar, daß ein Nachgeben gegenüber Rumänienin der Grenzfrage — zumal wenn es aus Furcht vor Abbruchder Verhandlungen erfolgt — eine deplorable Wirkung aufunsere Einschätzung bei unseren Feinden haben müßte. Eswar gewiß richtig, die verzweifelte Lage Rumäniens nichtauszunutzen und gemäßigte Friedensbedingungen zu gewähren,welche mit unseren prinzipiellen Erklärungen imEinklänge stehen. Wenn wir aber auf dieser gemäßigtenBasis nicht mit der nötigen Festigkeit auftreten, so werdenwir die Westmächte in dem Glauben bestärken, daß eskeineswegs nötig sei, auf Grundlage der Integrität unseres23 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong>353
Der Friede von BukarestTerritoriums und unserer Souveränität mit uns Frieden zuschließen, und es werden schwere, blutige Kämpfe nötigsein, um sie eines Besseren zu belehren.27. Februar 1918.^„Ebenso verhielten sich Andrassy und Wekerle sehr ablehnendgegen eine mildere Behandlung Rumäniens, und sowar das ganze ungarische Parlament geeint in dieser Frage.Welchen Standpunkt Karolyi einnahm, ist mir nicht klar,und ich weiß nicht, ob in diesem Zeitpunkte seine „Tigerseele",welche er seinerzeit gegen Rumänien enthüllt hatte,oder seine pazifistische Seele, welche er später dem GeneralFranchet d'Esperey zu Füßen gelegt hat, dominierte.Schon in Brest-Litowsk also, als der rumänische Friedeam Horizont erschien, vertrat ich den Standpunkt, daßman jene Richtung, welche Friedensverhandlungen wünschte,stärken müsse.Es darf das Bild des rumänischen Friedens nicht aus demgroßen Bilde des Krieges herausgerissen werden. Der rumänischeFriede war genau so wie der Friede von Brest-Litowskvom militärischen Standpunkte aus eine Notwendigkeit, weiles notwendig schien, so rasch als möglich die Truppen imOsten freizubekommen, um sie nach Westen werfen zu können.Es war daher dringend erwünscht und wurde dies vonden Militärs immer wieder betont, daß wir mit Rumänienbaldmöglich zu Ende kommen mögen. Um dieses baldigeResultat zu erreichen, hatte ich schon von Brest-Litowskaus dem Kaiser geraten, auf einem geheimen Wege demKönig Ferdinand sagen zu lassen, daß er auf einen ehrenhaftenFrieden rechnen könne, falls er in Verhandlung einzutretenwünsche. Der Kaiser nahm diesen Rat an, undOberst Randa hatte eine oder zwei Begegnungen mit einemHerrn aus der Umgebung des Königs, welcher seinem Herrndie kaiserliche Botschaft übermittelte. Die Deutschen standenvom Anfang an auf dem Standpunkte, daß der354König
Der Friede von BukarestFerdinand „für seinen Verrat gestraft werden müsse" unddaher nicht mit ihm verhandelt werden dürfe. Aus diesemGrunde und um fruchtlose Kontroversen zu vermeiden,verständigte ich Herrn von Kühlmann erst von dem vollzogenenFaktum und teilte ihm mit, daß wir auf einemgeheimen Wege mit König Ferdinand in Verbindung getretenseien. Es entsprach dieser Vorgang vollständig derparitätischen Stellung innerhalb unserer Bundesgemeinschaft,nach welcher ein jeder Bundesgenosse berechtigt war, nachbestem Ermessen vorzugehen, und nur verpflichtet war, diebefreundeten Mächte über sein Vorgehen zu <strong>info</strong>rmieren.Wir hatten nicht die Pflicht, die Erlaubnis Deutschlandsanzusuchen, um einen solchen Schritt zu machen.Der Grund, warum ich in dieser Frage anderer Meinungals Deutschland war, war im Wesen ein dreifacher. Erstensstand ich auf dem Standpunkte, daß es nicht unsere Aufgabesei, göttliche Gerechtigkeit zu üben und eine Strafezu verhängen, sondern den Krieg denkbarst rasch zu beenden,und daß es daher meine Pflicht sei, jedes Mittel zu ergreifen,um eine weitere Fortsetzung des Kampfes zu verhindern.Es muß hierbei erwähnt werden, daß die in vielen Kreisenverbreitete Auffassung, als wenn die Rumänen ganz am Endeihrer Kraft gewesen wären und daher alle Bedingungen hättenannehmen müssen, eine gänzlich falsche war. Die Rumänenstanden in sehr starken Stellungen, die Moral ihrer Armeewar eine ausgezeichnete, und bei dem letzten großen Angriffevon Maracesci hatten sich Mackensens Truppen blutige Köpfegeholt. Dieser Erfolg war den Rumänen gewaltig zu Kopfegestiegen, und in den Reihen des rumänischen Heeres gab essehr viele und sehr maßgebende Stimmen, welche unbedingtauf der Seite jener standen, die den Kampf ä outrance weiterführenwollten.Sie rechneten dabei nicht so sehr auf einentatsächlichen Sieg, waren aber von der Hoffnung getragen,daß sie sich noch einige Zeit in der Verteidigungsstellungwürden halten können, und daß während dieser Zeit die355
Der Friede von Bukarestentscheidenden Erfolge ihrer westlichen Verbündeten ihnenden Sieg bringen würden. Sie fürchteten wohl auch dabei, daßein Friedensschluß mit uns sie dauernd in die Ungnade derEntente stürzen würde, daß sie daher die Freundschaft derEntente verHeren, die unsere nicht gewinnen und sich zwischenzwei Stühle setzen würden. Der zweite Grund, welcher michveranlaßte, unbedingt daran festzuhalten, mit dem Königezu verhandeln, war der, daß ich es vom dynastischen Standpunkteaus für äußerst unklug hielt, einen fremden König zuentthronen.Es herrschte damals bereits eine gewisse Baissein Königen auf dem europäischen Markte, und ich fürchtete,diese Baisse zur Deroute zu steigern, wenn wir noch weitereKönige auf den Markt warfen. Der dritte Grund ging dahin,daß wir, um einen Frieden zu schließen, einen vollwertigenKompaziszenten in Rumänien haben mußten. Wenn wir denKönig abgesetzt hätten, so hätten wir Rumänien in zweiLager gespalten und hätten im besten Fall nur einen illegitimenFrieden mit jener Richtung abschließen können, welchedie Entthronung des Königs angenommen hätte. Nur mitdem legitimen Oberhaupte Rumäniens war ein rascher undlegaler Friede zu schließen.In den einleitenden Unterredungen, die Oberst Randa mitdem Vertrauensmanne des Königs von Rumänien am 4. und5. Februar hatte, wurde von diesem die Frage gestellt, oballe Vierbundmächte sich dem in Rede stehenden Schritteanschließen und ob das besetzte Rumänien freigegeben werdenwürde. Ich wurde von dieser Anfrage des Königs verständigtund teilte demselben daraufhin mit, daß er meinerÜberzeugung nach auch von den übrigen Mittelmächten keineAblehnung erhalten werde, falls er sich zwecks Erlangungeines ehrenvollen Friedens an dieselben wenden würde. Überdie Frage des territorialen Besitzstandes erklärte ich michvorerst nicht äußern zu können, da dies den Gegenstand dereinzuleitenden Verhandlungen bilden müsse.Der Standpunkt, welcher von den deutschen Militärs in'356
Der Friede von BukarestÜbereinstimmung mit den ungarischen Politikern verfochtenwurde, daß Rumänien anders, und zwar bedeutend strengerals irgendein anderer Staat zu behandeln sei, war, wenn mandie ganze Frage vom Gesichtspunkte der Vergeltung betrachtet,selbstverständlich begründet. Rumäniens Verhalten unsgegenüber war noch bedeutend verräterischer als das Italiens.Italien konnte <strong>info</strong>lge seiner geographischen Lage und <strong>info</strong>lgedes Umstandes, daß es vollständig von den Westmächtenabhängig war, daß es schließlich durch eine Blockade gezwungenwerden konnte, sich den Postulaten der Westmächtezu fügen — Italien konnte in diesem <strong>Weltkriege</strong> sehrschwer neutral bleiben. Rumänien war nicht nur vollständigunabhängig, es war, wie schon früher betont, dank seiner reichenKornkammern im Übermaß versorgt. Sieht man davon ab,daß Rumänien durch seine eigene Schuld die Dinge so weitkommen ließ, daß Rußland schließlich in der Lage war,ihm ein Ultimatum zu stellen, um es in den Krieg zu treiben,so wird man zugeben müssen, daß Rumänien der Ententeingerenzbei weitem weniger zugänglich war als Italien. Aberauch das russische Ultimatum hätte niemals wirksam erfließenkönnen, wenn Rumänien sich nicht bewußt und gewolltpolitisch und militärisch in eine Lage begeben hätte,welche es der russischen Gewalt auslieferte. Bratianu hatmir in einer seiner letzten Unterredungen gesagt: „Rußlandmache es wie der Birkhahn, der vor seinen Hennen tanzt."Hält man an diesem treffenden Beispiele fest, so muß mansagen, daß das weibliche, nach Umarmung sich sehnendeWesen die schließliche Vergewaltigung direkt provoziert hat.Hätte Bratianu nicht die öffentliche Meinung seines Landesdurch zwei Jahre gegen uns aufpeitschen lassen, und hätte erschließlich seine russische Grenze nicht von allen Truppen entblößt,so wäre das russische Ultimatum wirkungslos geblieben.In Rumänien fanden wir ein Ministerium Averescu vor.Die erste Unterredung hatten Kühlmann und ich alleinmitAverescu am 24. Februar in dem Schlosse des Prinzen Stirbey357
Der Friede von Bukarestin Buftea. In dieser Unterredung, welche nur von kurzerDauer war, wurde ausschließlich über die Dobrudschafragegesprochen. Die Grenzrektifikationen, welche im österreichisch-ungarischenProgramm waren, wurden so gut wiegar nicht erwähnt und auch die wirtschaftlichen Fragen,welche später eine ziemlich bedeutende Rolle gespielt haben,nur gestreift. Averescu stand auf dem Standpunkte, daßein Abtreten der Dobrudscha ein Ding der Unmöglichkeit sei,und die Unterredung endete mit einem ,,non possumus" desrumänischen Generals, welches dem Abbruche der Verhandlungengleichkam. In der Dobrudschafrage waren wir ineiner Zwangslage. Die sogenannte „alte" Dobrudscha, dasist der Teil, welchen Rumänien im Jahre 1913 den Bulgarenabgenommen hatte, war den Bulgaren durch einen Vertrag,welcher noch auf Kaiser Franz Joseph zurückreichte, alsPreis ihrer Kooperation zugesagt, und das Stück Land,welches sich zwischen dieser Grenze und der Bahn Constanza—Cernavoda befindet, wurde von Bulgarien ungestüm begehrt.Die Bulgaren gingen in ihren Aspirationen noch viel weiter,sie verlangten die ganze Dobrudscha bis inklusive der Donaumündungen,und die später zu beschreibenden großen diesbezüglichenDifferenzen lassen erkennen, mit welcher Zähigkeitund Insistenz die Bulgaren an diesem Postulat festhielten.Da gleichzeitig die Gefahr vorhanden war, daß dieBulgaren, in ihren Aspirationen allzu stark enttäuscht, vonuns abspringen würden, so war es ein Ding der vollständigenUnmöglichkeit, den Rumänen die Dobrudscha zu belassen.Alles, was erstrebt werden konnte, war, den Rumänen einenfreien Zugang nach Constanza zu sichern und ferner einenAusweg aus jener Schwierigkeit zu finden, welche zwischenTürken und Bulgaren in bezug auf die Dobrudscha bestand.Um den kaum angesponnenen Faden nicht abreißen zulassen, schlug ich Averescu vor, er möge seinem König eineZusammenkunft mit mir proponieren. Mein Gedanke hierbeiwar der, dem König klarzumachen, daß er jetzt einen358
Der Friede von Bukarestallerdings mit gewissen Verlusten verbundenen Frieden schließenkönne, einen Frieden jedoch, welcher ihm seine Kroneerhalte, daß er hingegen bei Fortsetzung des Krieges nichtmehr auf eine Schonung seitens der Mittelmächte rechnenkönne. Ich hoffte, daß das Berühren dieser Saite eine Fortsetzungder Friedensverhandlungen ermöglichen würde.Ich traf den König am 27. Februar in einer kleinen Stationin der besetzten Moldau.Die Ankunft in Focsani erfolgte mittags, von da per Autobis zu den Linien, an denen auf der rumänischen Seite OberstRessel und einige rumänische Offiziere zu meiner Begrüßungerschienen waren. In den mir zur Verfügung gestelltendeutschen Kraftwagen durchfuhren wir die beiderseitigenStellungen, und die Fahrt wurde bis zur Bahnstation Padurenifortgesetzt. Dort war ein Salonwagen bereitgestellt, inwelchem die Fahrt nach Racaciuni fortgesetzt wurde, wo wirnach fünf Uhr eintrafen.Der rumänische Hofzug traf einige Minuten später ein,und ich ging sofort zum König hinüber.Meine Unterredung mit König Ferdinand dauerte beiläufigzwanzig Minuten.Da der König die Unterredung nicht begann, so leitete ichdieselbe ein und sagte ihm, daß ich nicht etwa gekommensei, um den Frieden zu erbitten, sondern lediglich im AuftrageKaiser Karls, der trotz des Verrates Rumäniens Mildeund Schonung üben wolle, wenn König Ferdinand sofortunter den von den Vierbundmächten vereinbarten Bedingungen,die bekanntzugeben Zweck meines heutigenKommens wäre, Frieden machen wolle.Ginge der König hierauf nicht ein, so sei die Fortsetzungdes Kampfes unausweichlich, und dies bedeute das EndeRumäniens und der Dynastie. Denn heute schon sei unseremilitärische Überlegenheit ganz bedeutend, und jetzt, wounsere Front von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer frei sei,wäre es uns ein leichtes, unsere jetzige Überlegenheit in359
Der Friede von Bukarestallerkürzester Zeit noch um ein bedeutendes zu steigern. Wirwüßten, daß Rumänien in Bälde keine Munition mehr habenkönne, und würde der Kampf aufgenommen, so hätten dasKönigreich und die Dynastie inlängstens sechs Wochen zuexistieren aufgehört.Der König widersprach im allgemeinen nicht, meinte aber,die Bedingungen wären furchtbar hart. Ohne die Dobrudschakönne Rumänien nicht atmen ; über die Wiederabtretung deralten Dobrudscha ließe sich allenfalls noch sprechen.Ich erwiderte dem König, wenn er sich über harte Bedingungenbeklage, so wolle ich ihn nur fragen, welche etwadie seinigen gewesen wären, falls seine Truppen nach Budapestgekommen wären; im übrigen sei ich bereit, ihm zugarantieren, daß Rumänien nicht vom Meere abgeschnitten,sondern einen freien Zugang nach Constanza erhalten werde.Der König klagte hierauf wieder über die Härte der ihmgestellten Bedingungen und meinte, er würde niemals einMinisterium finden, das dieselben annehmen werde.Ich wendete ein, daß die Kabinettsbildung eine innereAngelegenheit Rumäniens sei, daß aber meiner persönlichenMeinung nach ein Kabinett Marghilomann sich, um Rumänienzu retten, mit den gestellten Bedingungen abfinden würde.Ich könne nur wiederholen, daß an den dem König mitgeteiltenFriedensbedingungen des Vierbundes nichts zu ändernsei. Nähme der König sie nicht an, so bekämen wir in vierWochen einen weit besseren Frieden als den, den Rumänienheute zu erhalten sich glücklich schätzen könne.Wir seien bereit, Rumänien unsere diplomatische Unterstützungzur Erlangung Bessarabiens zu leihen, und Rumänienwerde daher viel mehr gewinnen als verlieren.Der König betonte, an Bessarabien liege »ihm nichts,das sei „bolschewistisch verseucht", und die Dobrudschakönne nicht abgetreten werden ; im übrigen habe er sich nurunter dem größten Zwang zu dem Kriege gegen die Mittelmächteentschlossen — kam dann aber wieder auf den ihm360
Der Friede von Bukarestzugesagten freien Zugang zum Meere zu sprechen, welcherihm die Abtretung wesentlich zu erleichtern schien.Wir sprachen dann über Details, und ich machte demKönige Vorwürfe über die entsetzliche Behandlung unsererInternierten in Rumänien, was der König zu beklagen vorgab.Schließlich ersuchte ich ihn, uns binnen achtundvierzigStunden eine klare Antwort zu geben, ob er auf der Basisunserer Vorschläge verhandeln wolle oder nicht.Das Resultat der Unterredung war die Ernennung desMinisteriums Marghilomann und die Fortsetzung der Verhandlungen.Bevor sich Marghilomann entschloß, die Regierung zu übernehmen,trat er mit mir in Verhandlungen, um die genauenBedingungen zu erfahren.Mit der ersten und schwersten Bedingung, der Abtretungder Dobrudscha, erklärte er sich einverstanden, weil er besserund rascher als der König einsah, daß dank unserer bindendenVerpflichtung gegenüber Bulgarien an diesem Punktenichts zu ändern sei. Was unsere territorialen Anforderungenanlangte, so erklärte ich Marghilomann, daß ich das Hauptgewichtdarauf lege, nach dem Frieden in ein dauerndesFreundschaftsverhältnis zu Rumänien zu kommen, und dahervon dem Wunsche beseelt sei, die verlangten Abtretungenauf jenes Maß zu reduzieren, welches Rumänien seinerseitsals erträglich bezeichnen würde. Auf der anderen Seite mögeer, Marghilomann, verstehen, daß ich den ungarischen Aspirationenwenigstens bis zu einem gewissen Grade Rechnungtragen müsse — und Marghilomann, welcher ein alter routinierterParlamentarier war, gab sich keinen Illusionen hinüber die Zwangslage, in der ich mich befand. Wir kamenschließlich dahin überein, daß die Abtretung der bevölkertenPlätze und Städte wie Turn-Severin und Okna nicht stattfindensolle und alles in allem die ursprünglichen Forderungenauf ungefähr die Hälfte reduziert werden sollten. DiesesKompromiß erklärte Marghilomann anzunehmen.361
Der Friede von BukarestEine große Rolle in den Verhandlungen spielte meinWunsch, mit Rumänien in eine dauernde Wirtschaftsgemeinschaft— oder wenigstens in ein dauerndes Wirtschaftsbündniszu treten. Ich war mir klar, daß dieses Postulatim österreichischen und nicht im ungarischen Interesse sei,glaube aber auch heute noch, daß es in diesem Falle meinePflicht war, obgleich gemeinsamer Minister, für die österreichischenInteressen einzutreten, weil der Mangel anNahrungsmitteln eine Erschließung der rumänischen Kornkammernunbedingt wünschenswert erscheinen ließ. Wienicht anders zu erwarten, stieß dieses Postulat in Ungarnauf den heftigsten Widerspruch und konnte dieses wenigstensim ersten Anlaufe nicht für den Gedanken gewonnen werden.Nichtsdestoweniger habe ich von diesem Postulate niemalsabgelassen, und ich war festentschlossen, den Frieden nichtzu unterschreiben, falls es nicht Wirklichkeit würde. Ichbin inmittender Friedensverhandlungen von meinem Postengeschieden, und mein Nachfolger hat diesem Moment nichtdie gleiche Bedeutung beigelegt wie ich.Auf deutscher Seite machte sich sofort jener unstillbareAppetit geltend, welchen man bereits inBrest-Litowsk hattebeobachten können. Die Deutschen wünschten eine Artindirekte Kriegsentschädigung dadurch zu erhalten, daßRumänien seine Petroleumgebiete, seine Domänen, Eisenbahnenund Hafenplätze deutschen Gesellschaften abtretenund sich einer dauernden Kontrolle seiner Finanzen durchDeutschland unterziehen sollte. Ich habe diese Forderungenvom ersten Moment an auf das allerentschiedenste bekämpft,weil ich der Überzeugung war, daß Bedingungen dieser Artein zukünftiges freundschaftliches Verhältnis vollständig ausschließen.Ich ging so weit, Kaiser Karl zu ersuchen, indieser Frage direkt an Kaiser Wilhelm zu telegraphieren,was auch mit einem gewissen Erfolg geschah. Schließlichwurden die deutschen Postulate um ungefähr fünfzig Prozentermäßigt und in362dieser gemilderten Form von Marghilomann
Der Friede von Bukarestauch angenommen.In der Petroleum frage einigte man sichauf eine neunzigjährige Pacht, in der Frage der Getreidelieferungsollte sich Rumänien verpflichten, seine landwirtschaftlichenProdukte durch eine Anzahl von Jahren denZentralmächten zu liefern. Der Gedanke einer ständigenKontrolle Deutschlands über die rumänischen Finanzen wurdefallengelassen. In der Preisfrage drang der rumänischeStandpunkt vollkommen durch.Die unmöglichste deutscheForderung, die Okkupation in Rumänien noch durch fünfbis sechs Jahre nach dem allgemeinen Friedensschlüsse aufrechtzuerhalten,hat uns große Schwierigkeiten bereitet. Eswar dies jener Punkt, der am alleren ergischsten von derDeutschen Obersten Heeresleitung verlangt wurde, und erstnach vieler Mühe und sehr heftigen Auseinandersetzungenwurde es erreicht, daß bei dem Friedensschlüsse im Prinzipdie gesamte legislative und exekutive Gewalt der rumänischenRegierung wiedergegeben werde und wir uns nur bezüglicheiner beschränkten Anzahl von Agenden ein gewisses Kontrollrechtbehalten, jedoch auch dieses nicht über den allgemeinenFrieden hinaus. Ich kann nicht positiv sagen, obdieser Standpunkt unter meinem Nachfolger in dem Friedensiristrumentvollkommen durchgedrungen ist — aber sicherist, daß Marghilomann die Ministerschaft nur unter der Bedingungübernommen hatte, daß ich mich ihm gegenüberverbürgte, daß dieser eben erwähnte Standpunkt von mirhonoriert werden würde.Wie bereits früher erwähnt, hat die Frage der Dobrudschain doppelter Hinsicht große Schwierigkeiten bereitet.Erstenswar die Abtretung jene Forderung, welche den Rumänenam allerschwersten gefallen ist und dem Frieden den Charaktereines Gewalt friedens gegeben hat, und zweitenshat die Frage einen Zwist zwischen Türken und Bulgarenhervorgerufen.%Die Bulgaren vertraten den Standpunkt, daß die ganzeDobrudscha bis inklusive der Donaumündungen ihnen363
Der Friede von Bukarestzugesprochen werden müsse, und mit einer Hartnäckigkeit,welcher ich noch selten begegnet bin, verfochten sie diesenStandpunkt. Sie gingen so weit, zu erklären, daß nicht nurdie gegenwärtige Regierung, auch keine andere Regierungimstande wäre, mit einem anderen Ergebnis nach Sofia zurückzukehren,und ließen deutlich durchblicken, daß wirbei Ablehnung ihres Postulates nicht mehr mit Bulgarienrechnen könnten. Die Türken auf der anderen Seite verfochtenmit gleicher Vehemenz den Standpunkt, daß dieDobrudscha mit Hilfe zweier türkischer Armeekorps erobertworden sei, daß es unmoralisch und ungerecht sei, daß derhauptsächlich durch türkische Kräfte gewonnene Profit nunausschließlich den Bulgaren zufalle, und daß sie nie undnimmer zugeben könnten, daß Bulgarien die ganze Dobrudschaerhalte, ohne daß die Türken hierfür eine Kompensation bekämen.Als Kompensation schwebte ihnen nicht nur jenesStück Land vor, welches sie bei Eintreten der Bulgaren inden Krieg an Bulgarien abgetreten hatten (Adrianopel),sondern noch ein beträchtliches Stück darüber hinaus.In den zahllosen Konferenzen, in welchen diese Fragebehandelt wurde, spielten Kühlmann und ich die Rolle derehrlichen Vermittler, welche alle Anstrengungen machten,die beiden so divergierenden Standpunkte unter einen Hutzu bringen. Wir waren uns beide darüber klar, daß der Abfallder Bulgaren oder der Türken das Resultat sein könne,falls ein Kompromiß nicht zustandekäme. Schließlich, nachvieler Mühe, gelang es uns, beiden Teilen eine Formel akzeptabelzu machen. Diese Formel lautete dahin, daß die alteDobrudscha sofort an Bulgarien auszuliefern sei, die übrigeDobrudscha jedoch in den Besitz der vereinigten Mittelmächteübergehe und deren definitive Bestimmung dahereinem späteren Zeitpunkte überlassen werde.Weder Türken noch Bulgaren war von diesem Schiedssprücheganz befriedigt,aber auch keiner der beiden Streitteilewar zur Verzweiflung getrieben, und es war, wie die364
Der Friede von BukarestDinge lagen, die einzige Möglichkeit, eine Brücke zwischenTürken und Bulgaren zu schlagen.[,- Ähnlich wie England und Frankreich den KriegseintrittItaliens durch den Londoner Pakt erreicht hatten, hattenKaiser Franz Joseph und Burian sowie die Berliner Regierungden Bulgaren bindende Versprechungen für ihre Kooperationgemacht, und diese Zusagen erwiesen sich späterdaß ein Staat in einem Kampfe auf Lebenals größtes Hindernis eines Verständigungsfriedens. Trotzdemkann kein vernünftiger Mensch leugnen, daß es selbstverständlichist,und Tod Bundesgenossen sucht und vorerst nicht danachfragt, ob ihm die Einhaltung der Versprechungen spätergrößere oder kleinere Schwierigkeiten bereiten wird. DieFeuerwehr, welche ein brennendes Haus löscht, fragt nichtdanach, ob der Wasserstrahl seinerseits etwas vernichtet.Als Rumänien uns in den Rücken fiel, war die Not sehr groß,das Haus brannte lichterloh, und die erste Sorge meinesAmtsvorgängers war natürlich und völligberechtigterweise,diese größte Gefahr zu bannen. Man kargte also nicht mitden Zusagen und versprach den Bulgaren die Dobrudscha.Ob und inwieweit die Türken ein Recht durch Zusagenhatten, das Territorium, welches sie ihrerseits an Bulgarienabgetreten hatten, zurückzufordern, ist bestritten. Sie behaupteten,mündliche Zusagen in Berlin erhalten zu haben —ein moralisches Recht hatten sie unbedingt.Bei dem rumänischen Frieden im Frühjahre 1918 wardann eine allzu starke Belastungsprobe der Bündnistreueder Bulgaren wie der Türken gefährlich ;erstere kokettiertenseit längerem geheim mit der Entente, und das Bündnismit der Türkei beruhte auf den zwei Männern Talaat undEnver. Talaat aber sagte mir in Bukarest ganz positiv, erwerde gezwungen sein, zu demissionieren, wenn er mit leerenHänden zurückkomme, und in diesem Falle wäre der Abfallder Türkei sehr wahrscheinlich geworden.So versuchten wir uns in Bukarest zwischen den365
Der Friede von Bukarestverschiedenen Klippen durchzuwinden — die Rumänen nichttödlich zu verwunden, den Charakter einesVerständigungsfriedenssoweit wie möglich zu wahren und uns dennoch dieBulgaren und Türken zu erhalten.Die Abtretung der Dobrudscha war eine furchtbar harteForderung an die Rumänen und wurde erst für dieselbenerträglich, als Kühlmann und ich ihnen mit größter Mühegegen den heftigsten bulgarischen Widerspruch den freienZugang zum Schwarzen Meer durchsetzten.Wenn uns nachher in einem Atem der doppelte Vorwurfgemacht worden ist, wir hätten den Rumänen einen Gewaltfriedenaufgezwungen und die bulgarischen Ansprüche undWünsche nicht genügend geschont — so ist der Widerspruchdieser Anklagen in die Augen springend. Weil wir Rücksichtauf Bulgarien und die Türkei nehmen mußten, mußtenwir die Dobrudscha fordern und die Rumänen härter anfassen,als wir es sonst getan hätten. Die Türken und Bulgarenwurden schließlich für unsere Vermittlungsvorschlägegewonnen, und, gemessen an dem Maße von Versailles, warder Bukarester Friede der einer Verständigung. Sowohl wasdie Form, wie was den Inhalt anbetrifft.Sowohl die Unterhändler der Mittelmächte in Versailles alsin St. Germain wären sehr zufrieden gewesen, wenn sie sowie das Ministerium Marghilomann behandelt worden wären.Die Rumänen verloren die Dobrudscha, behielten aberden gesicherten Zugang zum Meere, sie verloren einen Strei-unbewohnten Gebirges an uns und gewannen durchfen fastuns Bessarabien.Sie gewannen viel mehr als sie verloren.
XII.Schlußbetrachtung
Je weiter der Weltkrieg fortschritt, desto mehr verlor er) den Charakter eines von einzelnen Menschen geleitetenWerkes. Er nahm den Charakter eines kosmischen Ereignissesan, welches sich der Ingerenz der einzelnen —auch der Mächtigsten — mehr und mehr entwand.Die den Koalitionen zugrundeliegenden Abmachungenschmiedeten die Kabinette an bestimmte Kriegsziele; dieden eigenen Völkern gegebenen Versprechungen auf Ersatz,die aufgepeitschten Hoffnungen auf die* Vorteile des Endsieges,der künstlich gezüchtete maßlose Haß, die zunehmendeVerwilderung und Verrohung der Welt — alles das schuf eineSituation, welche jeden einzelnen zu einem kleinen Kieseleiner Steinlawine machte, die führer-, wähl- und ziellos herunterstürzt— die nicht mehr leitbar ist und von niemandemmehr geleitet wird."Der Versailler Viererrat hat eine Zeitlang versucht, derWelt glaubhaft zu machen, daß er die Macht besitze, Europanach seinen Ideen wieder aufzubauen. Nach seinen Ideen!Das waren vor allem vier grundverschiedene Ideen, denn inRom, Paris, London und Washington sah man vier verschiedeneWelten. Und die vier Vertreter — the big four,wie man sienannte — waren wieder jeder einzelne der Gefangeneseiner Programme, seiner Zusagen und seiner Völker.Die monatelangen Pariser Verhandlungen hinter geschlos*-senen Türen, welche der beste Vorspann der europäischen24 Cr. ernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 3ÖQ
SchlußbetrachtungAnarchie waren, hatten ihren guten Grund. Es war desStreites kein Ende, und deshalb mußten Türen und Fenstergeschlossen bleiben.Bei uns hat man Wilson verflucht und verhöhnt, weil ersein Programm in Stich gelassen hat; gewiß ist auch nichtdie geringste Ähnlichkeit zwischen den vierzehn Punktenund dem Frieden von Versailles und St. Germain, aberman vergißt, daß Wilson gar nicht mehr die Macht hatte,seinen Willen gegen die drei anderen durchzusetzen. Washinter den geschlossenen Türen vorgegangen ist,wissen wirnicht, aber wir können es ahnen, und Wilson hat wohlwochen- und monatelang um sein Programm gekämpft.Er hätte abbrechen und abreisen können! Gewiß hätte erdas können, aber wäre denn das Chaos geringer, wäre esbesser für die Welt gewesen, wenn der einzige, der nichtnur Eroberungsgier ausstrahlte, die Flinte in das Korn geworfenhätte ? Aber auch Clemenceau, der Antipode Wilsons,war nicht frei in seinem Handeln. Gewiß hat dieser Greis,der noch an seinen* Lebensende seinen Haß gegen die Deutschendes Jahres 1870 stillen konnte, diesen Triumph mitWollust geschlürft — aber abgesehen davon, wenn er versuchthätte,sich alleeinen ,,Wilson-Frieden" zu schließen, so hättengroßen und kleinen Rentner Frankreichs gegen ihnerhoben, denn ihnen war durch fünf Jahre erzählt worden:„que les boches payeront tout." Er tat das, was er tat, mitGenuß, aber tun mußte er es, oder Frankreich jagte ihndavon.Und Italien !Von Mailand bis Neapel hört man das unterirdischeRollen der sich ankündigenden Revolution; das einzigeMittel, den Umsturz aufzuhalten, schien der Regierungdarin gelegen, die Revolution in den nationalen Wogen zuertränken. Ich glaube, Italiens Regierung hätte im Jahre1917, als die allgemeine Unzufriedenheit noch viel geringerund seine Finanzen noch viel besser waren, viel eher denWilsonschen Standpunkt akzeptieren können als nach dem370
Schi u ßbetrachtungEndsiege. Damals wollte sie nicht — in Versailles war sieder Sklave ihrer Versprechungen. Und glaubt jemand, daßLloyd George in Versailles die Macht gehabt hätte, dasWilsonsche Prinzip des Selbstbestimmungsrechtes auf Irlandauszudehnen? Natürlich wollte er es gar nicht — ebensowenigwie Clemenceau nichts anderes wollte als das, waser tat — , aber darum handelt es sich hier nicht, sonderndarum, daß sie nicht viel anders gekonnt hätten, auch wennsie gewollt hätten. Mir scheint, wie bereits erwähnt, derhistorische Moment, in welchem Wilson die Macht verlorund der <strong>Im</strong>perialismus dieselbe an sich riß, das Jahr 1917,in welchem der Präsident der Vereinigten Staaten es unterließ,sein Programm den Bundesgenossen aufzuzwingen.Damals hatte er dank der sehnsüchtig erwarteten amerikanischenTruppen die Macht in der Hand, später, nachdem Sieg, nicht mehr.Und so kam das, was gekommen ist. Ein Diktatfriedefurchtbarster Art wurde geschlossen und damit der Grundgelegt für weitere unausdenkbare, fortgesetzte Störungen,Verwicklungen und Kriege.Trotz aller anscheinenden Macht, trotz siegreicher Armeen,trotz allem, was der Viererrat für sich in Anspruch nimmt,stirbt in Versailles eine Welt: die Welt des Militarismus.Ausgezogen, um den preußischen Militarismus zu vernichten,hat die Entente so gründlich gesiegt, daß alle äußerensich un-Schranken und Hemmungen entfallen sind und siegehemmt aller Strömungen der Gewalt, der Rache und derLeidenschaft hingeben kann. Und die Entente ist in ihremrachedurstenden Vernichtungsrausch dermaßen befangen,daß sie es gar nicht zu merken scheint, daß sie, währendsie noch zu herrschen und zu befehlen vermeint, bereits zerfallenist. Wie ein furchtbares Gespenst steht am Horizontedie Welthungersnot und daher die Weltrevolution. DerMangel an Kohlen und Nahrungsmitteln wird dieJahre fürchterliche Krisen zeitigen.nächsten
SchlußbetrachtungDie Entente, welche den Krieg nicht beendigen ließ unddie Hungerblockade noch monatelang nach Abschluß derFeindseligkeiten fortsetzte,hat die Anarchie zur Weltgefahrgemacht. Die Anarchie und der Bolschewismus sind Geschwister.Der Bolschewismus ist die fürchterlichste Fratzestaatlicher Einrichtungen. Der Krieg ist sein Vater, dieHungersnot seine Mutter, die Verzweiflung sein Pate.Versailles ist kein Ende des Krieges, es ist nur eine PhaseDer Krieg geht weiter, wenn auch in veränderterdesselben.Form. Ich glaube, daß die kommenden Generationen dasgroße Drama, welches seitfünf Jahren die Welt beherrscht,gar nicht den Weltkrieg nennen werden, sondern dieWeltrevolution,und wissen werden, daß diese Weltrevolution nurmit dem Weltkrieg begonnen hat.Weder Versailles noch St. Germain werden ein dauerndesWerk schaffen. In diesem Frieden liegt der zersetzendeKeim des Todes. Die Krämpfe, die Europa schütteln, sindnoch nicht im Abnehmen, so wie bei einem gewaltigen Erdbebendauert das unterirdische Grollen an. <strong>Im</strong>mer wiederwird sich bald hier, bald dort die Erde öffnen und Feuergegen den Himmel schleudern, immer wieder werden Ereignisseelementaren Charakters und elementarer Gewaltverheerend über die Länder stürmen. Bis alles das hinweggefegtist, was an den Wahnsinn dieses Krieges und diefranzösischen Frieden erinnert.Langsam, unter unsäglichen Qualen, wird eine neue Weltgeboren werden. Die kommenden Generationen werdenzurückblicken auf unsere Zeit wie auf einen langen bösenTraum, aber der schwärzesten Nacht folgt einmal der Tag.Generationen sind in das Grab gesunken, ermordet, verhungert,der Krankheit erlegen. Millionen sind gestorben indem Bestreben, zu vernichten und zu zerstören, Haß undMord im Herzen.Aber andere Generationen erstehen, und mit ihnenein neuer Geist. Sie werden aufbauen, was Krieg und372
Schlußbetrachtunj:Revolution zerstört haben. Jedem Winter folgt der Frühling.Auch das ist ein ewiges Gesetz im Kreislauf des Lebens,daß dem Tod die Auferstehung folgt.Wohl denen, die berufen sein werden, als Soldaten derArbeit die neue Welt mitaufzubauen.Juli 1919.
Anhang
:I.Die Beschlüsse der Londoner Konferenz vom 26. April 1915Am 28. Februar 1917 veröffentlichte die „Istvestija" den Text diesesAbkommens„Der italienische Botschafter in London, Marchese <strong>Im</strong>periali, hat aufBefehl seiner Regierung die Ehre, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten,Sir E. Grey, dem französischen Botschafter in London, HerrnCambon, und dem russischen Botschafter in London, Grafen Benckendorff,nachfolgende denkwürdige Aufzeichnung zu übermitteln:§ 1. Zwischen den Generalstäben von Frankreich, Großbritannien, Rußlandund Italien soll unverzüglich eine Militärkonvention geschlossenwerden. Diese Konvention bestimmt das Mindestmaß der Streitkräfte,welche Rußland gegen Österreich-Ungarn in dem Falle in Bewegung setzensoll, wenn dieses Land alle seine Kräfte gegen Italien richten sollte, sofernRußland sich entschließen würde, 'sich hauptsächlich auf Deutschland zustürzen. Durch die genannte Militärkonvention sollen in gleicher Weisedie einen Waffenstillstand betreffenden Fragen geregelt werden, soweitsolche ihrem Wesen nach zu dem Geschäftskreis des Armee-Oberkommandosgehören.§ 2. Seinerseits verpflichtet sich Italien, mit allen ihm zur Verfügungstehenden Mitteln den Feldzug einheitüch mit Frankreich, Großbritannienund Rußland gegen alle mit ihnen kriegführenden Staaten zu führen.§ 3. Die Seestreitkräfte Frankreichs und Großbritanniens sollen Italienungeschwächten aktiven Beistand bis zur Vernichtung der österreichischenFlotte oder bis zum Augenblick des Friedensschlusses gewähren.Zwischen Frankreich, Großbritannien und Italien soll unverzüglicheine Marinekonvention abgeschlossen werden.§ 4. Beim kommenden Friedensschluß soll Italien erhalten: Das Gebietdes Trentino, ganz Südtirol bis zu seiner natürlichen geographischenGrenze, als welche der Brenner anzusehen ist,Stadt und Gebiet von Triest, die Grafschaften Görz und Gradiska,ganz Istrien bis zum Quarnero mit Einschluß Voloscas undder istrischen Inseln C her so und Lussin und gleichfalls der kleinerenInseln Plawnica, Unie, Canidole, Palazzoli sowie der Inseln St. Peter vonNembi, Asinello und Gruica nebst den benachbarten Inseln.377
AnhancAnmerkung i: In Ergänzung des §4 soll die Grenze durch folgendePunkte gezogen werden: Vom Gipfel des Umbrail in nördlicher Richtungbis zum Stilfser Joch und weiter auf der Wasserscheide der RätischenAlpen bis zu den Quellen der Flüsse Etsch und Eisack, danach über dieReschen-Scheideck, den Brenner und ötztaler und Zillertaler Alpen. Danachsoll die Grenzlinie sich nach Süden wenden, das Gebirge von Toblachschneiden und bis zur jetzigen Grenze von Krain gehen, die sich auf denAlpen hinzieht; dieser folgend, wird sie bis zu den Bergen von Tarvisgehen, aber dann auf der Wasserscheide der Julischen Alpen über dieHöhe Predil, den Berg Mangart, die Berggruppe Triglav und die Pässevon Podbrda, Podlaneskan und Idria verlaufen. Von dort setzt sich dieGrenze in südöstlicher Richtung zum Schneeberg fort, so daß das Beckendes Flusses Save mit seinen Quellflüssen nicht in das italienische Gebietfällt. Vom Schneeberg zieht sich die Grenzlinie zur Küste hin, indemsie Castua, Matuglie und Volosca in die itaüenischen Besitzungen einschließt.§ 5. In gleicher Weise erhält Italien die Provinz Dalmatien inihrer jetzigen Gestalt mit Einschluß von Lissarik und Trebinje im Nordenund allen Besitzungen bis zu einer von der Küste bei Kap Planka nachOsten auf der Wasserscheide gezogenen Linie im Süden, so daß auf dieseWeise alle an dem Laufe der bei Sebenico mündenden Flüsse wie Cikola,Kerke und Budisnica mit allen an ihren Quellflüssen gelegenen Tälernin den italienischen Besitz fallen. In gleicher Weise werden Italien allenördlich und westlich der dalmatinischen Küste gelegenenInseln zugesprochen, beginnend mit den Inseln Premuda, Selve, Ulbo,Skerda, Maon, Pago und Puntadura usw., im Norden bis Melada, im Südenunter Hinzufügung der Inseln St. Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Torcola,Curzola, Cazza und Lagosta mit allen zu ihnen gehörigen Klippen undEilanden, sowie Pelagosa, aber ohne die Inseln Groß- und Klein-Zirona,Bua, Solta und Brazza.Der Neutralisierung unterliegen: 1. Die ganze Küste von KapPlanka im Norden bis zum Südende der Halbinsel Sabbioncello und imSüden mit Einschluß der ganzen genannten Halbinsel in das neutralisierteGebiet; 2. ein Teil der Küste, beginnend von einer zehn Werst südlichdes Kap Alt-Ragusa gelegenen Stelle bis zum Flusse Wojusa im Süden,so daß in die Grenzen der neutralisierten Zone die ganze Bucht vonCattaro mit ihren Häfen Antivari, Dulcigno, San Giovanni di Meduaund Durazzo fallen, wobei die aus der von den vertragschließenden Parteienim April und Mai 1909 aufgestellten Deklaration hervorgehenden RechteMontenegros nicht beeinträchtigt werden dürfen. In Anbetracht jedoch,daß diese Rechte nur für die gegenwärtigen Besitzungen Montenegros anerkanntwurden, dürfen sie in der Folge nicht auf diejenigen Länder oderHäfen ausgedehnt werden, welche in Zukunft Montenegro zugeteilt werdenkönnen. Auf diese Weise unterhegt auch in Zukunft der Neutralisierungkein Teil der jetzt Montenegro gehörenden Küste. In Kraft bleiben dieBeschränkungen betreffend den Hafen Antivari, mit welchen im Jahre 1909Montenegro selbst sich einverstanden erklärt hat; 3. endlich die Inseln,welche Italien nicht zugewiesen werden.Anmerkung 3: Die folgenden Länder im Adriatischen Meer werden vonden Mächten des Vierverbandes den Gebieten Kroatiens, Serbiensund Montenegros zugeteilt: <strong>Im</strong> Norden des Adriatischen Meeres dieganze Küste, beginnend von der Bucht Volosca an der GrenzeIstriens bis zur Nordgrenze Dalmatiens mit Einschluß der ganzen378
Anhangjetzt zu Ungarn gehörigen Küste, der ganzen Küste Kroatiens, des HafensFiume und der kleinen Häfen Novi und Carlopago sowie auch der InselnVena, Pervicchio, Gregorio, Goli und Arbe. <strong>Im</strong> Süden des AdriatischenMeeres, wo Serbien und Montenegro interessiert sind, die ganze Küstevon Kap Planka bis zum Flusse Drina mit den wichtigsten Häfen Spalato,Ragusa, Cattaro, Antivari, Dulcigno und San Giovanni diMedua und mit den Inseln Groß-Zirona, Bua, Solta, Brazza, Jaklianund Calamotta.Der Hafen Durazzo kann einem unabhängigen mohammedanischenStaate Albanien zugeteilt werden.§ 6. Italien erhält zu vollem Eigentum Valona, die Insel Sassenound ein genügend umfangreiches Gebiet, um es in militärischer Hinsichtzu sichern, annähernd von dem Flusse Vojusa im Norden und Osten biszur Grenze des Bezirkes Chimara im Süden.§ 7. Wenn Italien das Trentino und Istrien gemäß § 4, Dalmatien unddie Inseln des Adriatischen Meeres gemäß § 5 sowie den Busen von Valonaerhält, soll es im Falle der Bildung eines kleinen autonomen neutralisiertenStaates in Albanien sich nicht dem möglichen Wunsche Frankreichs,Großbritanniens und Rußlands nach Aufteilung der nördlichenund südlichen Grenzstriche Albaniens zwischen Montenegro,Serbien und Griechenland widersetzen. Der südliche Küstenstrichvon der Grenze des italienischen Gebietes Valona bis Kap Stiloa unterliegtder Neutralisie^ung.Italien wird das Recht in Aussicht gestellt, die äußeren BeziehungenAlbaniens zu leiten; in jedem Falle ist Italien verpflichtet, sichmit der Überlassung eines genügend umfangreichen Gebietes an Albanieneinverstanden zu erklären, so daß die Grenzen des letzteren westlich vondem Ochridasee mit den Grenzen Griechenlands und Serbiens zusammenstoßen.§ 8. Itaüen erhält zu vollem Eigentum alle von ihm jetzt besetztenInseln des Dodekanes.§ 9. Frankreich, Großbritannien und Rußland erkennen grundsätzlichdie Tatsache des Interesses Italiens an der Erhaltung des politischenGleichgewichtes im Mittelmeere an, sowie das Recht, beieiner Teilung der Türkei einen gleichen Anteil wie sie an demBassin des Mittelmeeres zu erhalten, und zwar in dem Teil, welcher an dieProvinz Adalia anstößt, wo Italien schon besondere Rechte erworbenund Interessen entwickelt hat, die in der itaüenisch-britischen Konventionerwähnt werden. Die danach in den Besitz Italiens fallende Zone wardseinerzeit genauer, entsprechend den Lebensinteressen Frankreichs undGroßbritanniens abgegrenzt werden. Auf gleiche Weise sollen die InteressenItaliens auch in dem Falle in Beachtung gezogen werden, wenndie territoriale Unversehrtheit der asiatischen Türkei durch die Mächteauch für einen weiteren Zeitabschnitt aufrechterhalten werden und wennnur eine Abgrenzung zwischen den Einflußsphären stattfinden sollte. Wennin jenem Falle Frankreich, Großbritannien und Rußland während desgegenwärtigen Krieges einige Gebiete der asiatischen Türkei besetzenwürden, soll das ganze an Italien grenzende und unten genauer bezeichneteGebiet an Italien überlassen werden, welches auch das Recht zu seinerBesetzung erhält.§ 10. In Libyen werden für Italien alle diejenigen Rechte und Ansprücheanerkannt, welche bis jetzt noch dem Sultan auf Grund des Vertragesvon Lausanne zustanden.379
5Anhang§ ii. Italien erhält denjenigen Teil der Kriegskontribution,welcher dem Maß seiner Opfer und Anstrengungen entspricht.§ 12. Italien tritt der von Frankreich, England und Rußland aufgestelltenDeklaration bei, nach welcher Arabien und die heiligen Stättender Mohammedaner einer unabhängigen mohammedanischenMacht überlassen sind.§ 1 3. <strong>Im</strong> Falle der Erweiterung des französischen und englischen Kolonialbesitzesin Afrika auf Kosten Deutschlands erkennen Frankreich undGroßbritannien grundsätzlich das Recht Italiens an, für sich gewisse Kompensationenim Sinne einer Erweiterung seiner Besitzungen in Erythräa,Somaliland, in Libyen und den mit Kolonien Frankreichs und Englandsgrenzenden Kolonialgebieten zu verlangen.§ 14. England verpflichtet sich, die unverzügliche Realisierung einerAnleihe in Höhe von nicht weniger als 50 Millionen Pfund Sterlingzu günstigen Bedingungen auf dem Londoner Markt zu erleichtern.§ 15. Frankreich, England und Rußland nehmen auf sich die Verpflichtungzur Unterstützung Italiens in der Angelegenheit der Nichtzulassungvon Vertretern des Heiligen Stuhles zu irgendwelchendiplomatischen Schritten, betreffend den Abschlußeines Friedens oder der Regulierung von Fragen, die mit dem gegenwärtigenKrieg zusammenhängen.§ 16. Der vorüegende Vertrag soll geheimgehalten werden. Wasden Anschluß Italiens an die Deklaration vom 5. September 1914 betrifft,so wird diese Deklaration der Öffentlichkeit übergeben werden, sobaldder Krieg durch Italien oder an Italien erklärt werden wird.Nach Kenntnisnahme der vorhegenden denkwürdigen Aufzeichnungsind die entsprechend hierzu bevollmächtigten Vertreter Frankreichs, Großbritanniensund Rußlands mit dem gleicherweise von seiner Regierungfür diese Angelegenheit bevollmächtigten Vertreter Italiens dahin übereingekommen:Frankreich, Großbritannien und Rußland erklären ihr vollesEinverständnis mit der vorhegenden denkwürdigen Aufzeichnung, die ihnendurch die italienische Regierung vorgelegt ist. In bezug auf die §§ 1, 2und 3, betreffend das Einvernehmen über die Heeres- und Flottenunternehmungenaller vier Mächte, erklärt Italien, daß es aktiv in möglichstnaher Zukunft und in jedem Falle nicht später als einen Monatnach Unterzeichnung des vorliegenden Dokuments durch die vertragschließendenTeile auftreten werde.Das Vorliegende haben in London in vier Exemplaren am 26. April 191unterzeichnet und mit ihren Siegeln beglaubigtSir Edward Grey,Cambon,Marchese <strong>Im</strong>periali,Graf Benckendorff."380
AnhaueILNote des Grafen Czernin an die amerikanische Regierungvom 5. März 1917„Dem Aide-Memoire der amerikanischen Botschaft in Wien vom 18.Februar1. J. ha± das k. u. k. Ministerium des Äußern entnommen, daß dasWashingtoner Kabinett angesichts der von der k. u. k. Regierung amio. Februar v. J.und am 31. Januar 1. J. abgegebenen Erklärungen Zweifeldarüber hegt, welche Haltung Österreich-Ungarn bei Führung des Unterseebootkriegesfortan einzunehmen gedenke, und ob die Zusicherung, welchedie k. u. k. Regierung dem Washingtoner Kabinett im Laufe der Verhandlungenüber die Fälle der Schiffe ,Ancona' und ,Persia' erteilt hat,nicht etwa durch die besagten Erklärungen abgeändert oder zurückgezogenwurde.Dem Wunsche der Bundesregierung, daß diese Zweifel durch eine endgültigeund klare Äußerung behoben werden, ist die k. u. k. Regierunggerne bereit zu entsprechen.Es sei hierbei gestattet, vorerst in aller Kürze die von den Ententemächtenin der Führung des Seekrieges geübten Methoden zu erörtern,weil diese den Ausgangspunkt des von Österreich-Ungarn und seinenVerbündeten ins Werk gesetzten verschärften Unterseebootkrieges bildenund von hier aus auch ein helles Licht auf die Haltung fällt, welche diek. u. k. Regierung in den sich daraus ergebenden Fragen bisher eingenommenhat.Als Großbritannien in den Kampf gegen die Zentralmächte eintrat,waren erst wenige Jahre seit jener denkwürdigen Zeit verstrichen, da esim Verein mit den übrigen Staaten im Haag die Fundamente eines modernenSeekriegsrechtes zu legen begonnen hatte; bald darauf hatte die englischeRegierung Vertreter der großen Seemächte in London versammelt, umdas Haager Werk, vornehmlich im Sinne eines billigen Ausgleiches zwischenden Interessen der Kriegführenden und der Neutralen, weiter auszubauen.Der ungeahnten Erfolge dieser Bestrebungen, welche nichts Geringereserzielten als die einvernehmliche Festsetzung von Rechtsnormen, diegeeignet waren, dem Grundsatze der Meeres freiheit und den Interessender Neutralen auch in Kriegszeiten Geltung zu verschaffen, sollten sichdie Völker nicht lange erfreuen.Kaum hatte sich das Vereinigte Königreich entschlossen, am Kriegeteilzunehmen, als es auch schon die Schranken zu durchbrechen begann,die ihm die Normen des Völkerrechtes setzten. Während die Zentralmächtesogleich bei Beginn des Krieges erklärt hatten, sich an die LondonerDeklaration, welche auch die Unterschrift des britischen Vertreterstrug, halten zu wollen, warf England die wichtigsten Bestimmungen derselbenüber Bord. <strong>Im</strong> Bestreben, die Zentralmächte von den Zufuhrenzur See abzuschneiden, erweiterte es Schritt für Schritt die Liste der Bannwaren,'bis nichts mehr von all dem darauf fehlte, dessen die Menschenheute zur Fristung des Lebens bedürfen. Sodann verhängte Großbritannienüber die Küsten der Nordsee, die auch für den Seehandel Österreich-Ungarns ein wichtige- Durchgangstor bilden, eine von ihm als .Blockade'bezeichnete Sperre, um allen Waren den Eintritt nach Deutschland zuwehren, die auf der Liste der Banngüter noch fehlten, sowie um jeden381
AnhangSchiffsverkehr der Neutralen mit jenen Küsten zu unterbinden und jeglicheAusfuhr über sie zu verhindern. Daß diese Sperre in grellstem Widerspruchzu den hergebrachten, durch internationale Verträge festgelegtenNormen des Blockaderechtes steht, hat gerade der Herr Präsident derVereinigten Staaten von Amerika in Worten dargetan, die in der Geschichte des Völkerrechtes fortleben werden. Durch die rechtswidrige Behinderungder Ausfuhr aus den Zentralmächten gedachte Großbritanniendie zahllosen Fabriken und Betriebe, die arbeitsame und hochentwickelteVölker im Herzen Europas geschaffen hatten, stillzulegen, ihre Arbeiterzum Feiern und damit zu Auflehnungen und Aufruhr zu bringen. Undals Österreich-Ungarns südlicher Nachbar in die Reihen der Feinde derMittelmächte trat, war sein Erstes, die gesamten Küsten seines Gegnersfür blockiert zu erklären, freilich, dem Beispiel des Bundesgenossen folgend,unter Mißachtung der Rechtsregeln, an deren Schaffung Italien kurz vorherwerktätigen Anteil genommen hatte. Österreich-Ungarn unterließnicht, den neutralen Mächten sogleich darzulegen, daß diese Blockadejeder Rechtswirksamkeit entbehre.Über zwei Jahre haben die Zentralmächte gezögert. Dann erst, undnachdem sie das Für und Wider lange und reiflich erwogen hatten, schrittensie daran, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und den Gegnern zur Seean den Leib zu rücken. Als einzige der Kriegführenden, die alles getanhatten, um die Geltung der Verträge zu sichern, die den Neutralen dieMeeresfreiheit gewährleisten sollten, empfanden sie bitteren Herzens denZwang der Stunde, der sie hieß, diese Freiheit zu verletzen; aber sie tatenden Schritt, um eine gebieterische Pflicht gegen ihre Völker zu erfüllen,und in der Überzeugung, daß er geeignet sei, der Freiheit der Meere schließlichzum Siege zu verhelfen. Die Erklärungen, die sie am letzten Januartagedieses Jahres erließen, richten sich nur scheinbar wider die Rechteder Neutralen ; in Wahrheit dienen sie der Wiederherstellung dieser Rechte,welche die Feinde unablässig verletzt haben, und die sie, wenn sie Siegerwären, für immer vernichten würden. So künden die Tauchboote, welcheEnglands Küsten umkreisen, den Völkern, die der See bedürfen — undwelche bedürften ihrer nicht? — , daß der Tag nicht mehr fern ist, da dieFlaggen aller Staaten im Glänze der neuerrungenen Freiheit friedlichüber den Meeren wehen.Es darf wohl die Hoffnung gehegt werden, daß diese Kunde überall,wo neutrale Völker wohnen, Widerhall finden, und daß sie insbesonderevom großen Volke der Vereinigten Staaten Amerikas werde verstandenwerden, dessen berufenster Vertreter im Laufe dieses Krieges mit flammendenWorten für die Freiheit des Meeres als der Straße aller Nationen eingetretenist. Wenn sich Volk und Regierung der Union vor Augen halten,daß die von Großbritannien verhängte , Blockade' bestimmt ist, nichtnur die Zentralmächte durch Hunger niederzuzwingen, sondern letztenEndes die Meere seiner Herrschaft zu unterwerfen und auf diesem Wegeseine Vogtei über alle Nationen zu begründen, während umgekehrt dieAbsperrung Englands und seiner Verbündeten nur dazu dient, diese Mächteeinem Frieden in Ehren zugänglich zu machen und allen Nationendie Freiheit der Schiffahrt und des Seehandels und damit eingesichertes Dasein zu verbürgen, dann ist die Frage, welche der beidenKriegsparteien das Recht auf ihrer Seite hat, auch schon entschieden.Wenn es den Zentralmächten auch fernliegt, in ihrem Kampfe um Bundesgenossenzu werben, so glauben sie doch darauf Anspruch erheben zudürfen, daß die Neutralen ihr Bestreben würdigen, die Grundsätze des382
AnhangVölkerrechtes und der Gleichberechtigung der Nationen im Interesse allerwieder aufleben zu lassen.Wenn nun die k. u. k. Regierung darangeht, die im bezogenen Aide-Memoire vom 18. Februar d. J. gestellte Frage zu beantworten, so seizunächst bemerkt, daß sie sich in dem Notenwechsel, der die Fälle ,Ancona'und ,Persia' betraf, darauf beschränkt hatte, zu den konkreten FragenStellung zu nehmen, die sich jeweils ergeben hatten, ohne ihre grundsätzlicheRechtsauffassung darzulegen. Sie hat sich aber in der auf denFall ,Ancona' bezüglichen Note vom 29. Dezember 1915 vorbehalten, dieschwierigen völkerrechtlichen Fragen, die mit dem Unterseebootkrieg zusammenhängen,in einem späteren Zeitpunkt zur Erörterung zu bringen.Wenn sie nunmehr auf diesen Vorbehalt zurückkommt und die Frageder Versenkung feindlicher Schiffe, auf die jenes Aide-Memoire anspielt,einer kurzen Besprechung unterzieht, so leitet sie hierbei der Wunsch,der amerikanischen Regierung darzutun, daß sie an der von ihrerteilten Zusicherung nach wie vor unverrückbar festhält,sowie das Bestreben, durch eine Klärung jener wichtigsten aus dem Unterseebootkriegsich ergebenden, weil an die Gebote der Menschlichkeit rührendenFrage Mißverständnissen zwischen der Monarchie und der amerikanischenUnion vorzubeugen.Vor allem möchte die k. u. k. Regierung betonen, daß auch ihrer Ansichtnach die von der amerikanischen Regierung aufgestellte und auch inmehreren gelehrten Schriften vertretene These, daß feindliche Handelsschiffe,abgesehen von den Fällen des Fluchtversuches und des Widerstandes,nicht vernichtet werden dürfen, ohne daß für die Sicherheit derPersonen an Bord gesorgt würde, sozusagen den Kern der ganzen Materiebildet. Von einer höheren Warte betrachtet, läßt sich diese These allerdingsin einen weiteren gedanklichen Zusammenhang eingliedern undsolcherart auch ihr Anwendungsgebiet genauer abstecken: Man kann ausden Geboten der Menschlichkeit, welche sich die k. u. k. Regierung unddas Washingtoner Kabinett in gleicher Weise zur Richtschnur nehmen,den allgemeineren Grundsatz ableiten, daß bei Ausübung des Rechtes derVernichtung feindlicher Handelsschiffe der Verlust von Menschenlebensoweit als irgend möglich vermieden werden soll. Diesem Grundsatz kannder Kriegführende nur dadurch gerecht werden, daß er vor der Ausübungdes Rechtes eine Warnung erläßt. Er kann hierbei den Weg einschlagen,den die besagte These der Unionsregierung weist, wonach der Befehlshaberdes Kriegsschiffes die Warnung an das zu versenkende Fahrzeugselbst richtet, damit sich Besatzung und Passagiere noch im letzten Augenblickin Sicherheit bringen können; oder aber es kann die Regierung deskriegführenden Staates, wenn sie dies als unabweisliche Kriegsnotwendigkeiterkannt hat, die Warnung mit voller Wirkung schon vor der Ausfahrtdes Schiffes erlassen, welches versenkt werden soll, oder schließlichsie kann sich, wenn sie eine umfassende Maßnahme zur Bekämpfung desfeindlichen Seehandels ins Werk setzt, einer allgemeinen, für alle in Betrachtkommenden feindlichen Schiffe bestimmten Warnung bedienen.Daß der Grundsatz, wonach für die Sicherheit der Personen an BordSorge zu tragen ist, Ausnahmen erleidet, hat die Unionsregierung selbstanerkannt. Die k. u. k. Regierung möchte aber glauben, daß die warnungsloseVernichtung nicht nur dann zulässig ist, wenn das Schiff flieht oderWiderstand leistet. Es scheint ihr, um nur ein Beispiel anzuführen, auchder Charakter des Schiffes selbst in Betracht gezogen werden zu müssen:Handels- oder sonstige Privatschiffe, welche sich in den Dienst der383
AnhamKriegführung stellen, etwa als Transport- oder Avisoschiffe, oder welchemilitärische Besatzung oder Waffen an Bord führen, um Feindseligkeitenirgendwelcher Art zu begehen, dürfen nach geltendem Recht wohl ohneweiteres vernichtet werden. Des Falles, daß der Kriegführende jeder Rücksichtauf Menschenleben entbunden ist, wenn sein Gegner feindliche Handelsschiffeohne jede vorgängige Warnung versenkt, wie dies in den bereitswiederholt gerügten Fällen der Schiffe ,Elektra', ,Dubrovnik', .Zagreb' usw.zutraf, braucht die k. u. k. Regierung nicht zu gedenken, da sie in dieserHinsicht trotz ihres unbestreitbaren Rechtes niemals Gleiches mit Gleichemvergolten hat. <strong>Im</strong> ganzen Verlauf des Krieges haben österreichisch-ungarischeKriegsschiffe nicht ein einziges feindliches Handelsschiff ohne vorherige,wenn auch generelle Warnung vernichtet.Die mehrerwähnte These der Bundesregierung läßt auch mehrere Deutungenzu, insofern nämlich, als danach fraglich ist, ob, wie von manchenSeiten behauptet wird, nur ein bewaffneter Widerstand die Vernichtungdes Schiffes mit den Personen an Bord rechtfertige oder auch ein Widerstandanderer Art, wie er etwa dann gegeben ist, wenn die Besatzunggeflissentlich unterläßt, die Passagiere auszubooten (Fall ,Ancona'), oderwenn die Passagiere selbst die Ausbootung verweigern. Nach der Meinungder k. u. k. Regierung ist auch in den Fällen der letzten Art die Vernichtungdes gewarnten Schiffes ohne Rettung der Personen an Bord zulässig, daes andernfalls in die Hände jedes Fahrgastes gelegt wäre, das dem Kriegführendenzustehende Recht der Versenkung zunichte zu machen. Übrigensdarf auch darauf hingewiesen werden, daß nicht einmal darüber Einmütigkeitbesteht, in welchen Fällen die Vernichtung feindlicher Handelsschiffeüberhaupt zulässig ist.Die Verpflichtung, die Warnung unmittelbar vor dem Versenken desSchiffes zu erlassen, führt nach Ansicht der k. u. k. Regierung einerseitszu Härten, die vermieden werden könnten, andererseits ist sie aber auchunter Umständen geeignet, berechtigten Interessen der KriegführendenAbbruch zu tun. Zunächst ist nämlich nicht zu verkennen, daß die Rettungder Personen auf See fast allemal dem blinden Ungefähr anheimgestelltist, da nur die Wahl bleibt, sie entweder an Bord des jeder feindlichenEinwirkung ausgesetzten Kriegsschiffes zu nehmen oder in kleinenBooten den Gefahren der Elemente preiszugeben, und daß es daherden Grundsätzen der Menschlichkeit weit besser entspricht, die Personendurch eine rechtzeitig erlassene Warnung von der Benutzung gefährdeterSchiffe abzuhalten. Des weiteren aber konnte sich die k. u. k.Regierung trotz reiflicher Überprüfung aller in Betracht kommendenRechtsfragen nicht davon überzeugen, daß Angehörige neutraler Staateneinen Anspruch darauf besitzen, auf feindlichen Schiffen unbehelligt zureisen.Der Grundsatz, daß die Neutralen auch in Kriegszeiten die Vorteileder Meeresfreiheit genießen, gilt nur für neutrale Schiffe, nicht auch fürneutrale Personen an Bord feindÜcher Schiffe. Denn die Kriegführendensind bekanntlich berechtigt, den feindlichen Schiffsverkehr, soweit sie esvermögen, zu unterbinden. <strong>Im</strong> Besitze der erforderlichen Kriegsmittel,dürfen sie hierbei, wenn sie es zur Erreichung ihrer Kriegsziele für nötigerachten, den feindlichen Handelsschiffen das Befahren der See bei sonstigersofortiger Vernichtung untersagen, wenn sie nur diese ihre Absicht vorherankündigen, damit jedermann, ob Feind oder Neutraler, in die Lage komme,eine Gefährdung seines Lebens zu vermeiden. Selbst wenn sich aber überdie Berechtigung eines derartigen Vorgehens Zweifel ergeben sollten und384
Anhangder Gegner etwa mit Vergeltung drohen würde, so wäre dies eineAngelegenheit, die unter den Kriegführenden allein auszutragen ist,iie anerkanntermaßen berechtigt sind, die hohe See zum Schauplatzihrer militärischen Unternehmungen zu machen, jede Störung dieserUnternehmungen abzuwehren und souverän zu entscheiden , welcheMaßnahmen wider die feindliche Schiffahrt zu ergreifen seien. DieNeutralen haben infeinem solchen Falle kein anderes legitimes Interesseund daher keinen andern Rechtsanspruch, als daß ihnen der Kriegführendedas an den Feind gerichtete Verbot rechtzeitig bekanntgibt, damitsie vermeiden können, ihre Person und ihr Eigen feindlichen Schiffenanzuvertrauen.Die k. u. k. Regierung darf wohl annehmen, daß das WashingtonerKabinett den vorstehenden, ihrer vollen Überzeugung nach unanfechtbarenAusführungen zustimmt, da eine Bestreitung ihrer Richtigkeit ohneZweifel darauf hinauslaufen würde, daß es — was der Ansicht der Bundesregierungsicher nicht entspricht — den Neutralen freistehe, sich in diemilitärischen Operationen der Kriegführenden einzumengen, ja letztenEndes sich geradezu zum Richter darüber aufzuwerfen, welche Kriegsmittelgegen den Feind in Anwendung gebracht werden dürfen. Auchschiene ein schreiendes Mißverhältnis gegeben, wenn eine neutrale Regierung,nur um ihren Angehörigen zu ermöglichen, auf feindüchen Schiffenzu reisen, während sie ebensogut, ja mit weit größerer Sicherheit neutraleSchiffe benützen könnten, einer kriegführenden Macht, die vielleicht umihr Dasein kämpft, in den Arm fiele. Nicht zu sprechen davon, daß denschwersten Mißbräuchen Tür und Tor geöffnet würde, wollte man einenKriegführenden zwingen, die Waffen vor jedem Neutralen zu senken, demes gerade beliebt, sich auf seinen Geschäfts- oder Vergnügungsreisen derfeindüchen Fahrzeuge zu bedienen. Niemals ist auch nur der leisesteZweifel darüber wach geworden, daß neutrale Staatsangehörige allenSchaden selbst zu tragen haben, den sie dadurch erleiden, daß sie zu Landeein Gebiet betreten, wo kriegerische Operationen stattfinden. Es liegtaugenscheinlich kein Grund vor, für den Seekrieg eine andere Norm geltenzu lassen, zumal die zweite Friedenskonferenz den Wunsch geäußert hat,die Mächte mögen bis zur Zeit, da der Seekrieg eine vertragsmäßige Regelunggefunden haben werde, das für den Landkrieg geltende Recht so weit alsmöglich auch im Seekriege anwenden.<strong>Im</strong> Sinne des Vorausgeschickten erleidet die Regel, daß die Warnungan das zu versenkende Schiff selbst zu richten ist, Ausnahmen verschiedenerArt: unter gewissen Umständen, wie beispielsweise in den von der Bundesregierungangeführten Fällen der Flucht und des Widerstandes, darf dasSchiff ohne jede Warnung vernichtet werden; in anderen bedarf es einerWarnung vor Ausfahrt des Schiffes. Die k. u. k. Regierung darf sonachfeststellen, daß sie, wie immer sich das Washingtoner Kabinett zu einzelnender hier aufgeworfenen Fragen stellen mag, doch gerade, was den Schutzder Neutralen gegen Gefährdung ihres Lebens anlangt, mit der Bundesregierungim Wesen eines Sinnes ist. Sie hat sich aber nicht daran genügenlassen, im Verlauf des jetzigen Krieges die von ihr vertretene Auffassungin die Tat umzusetzen, sondern, darüber hinausgehend, ihr Verhaltenmit peinlicher Sorgfalt der vom Washingtoner Kabinett aufgestelltenThese angepaßt, obwohl die von ihr erteilte Zusicherung nur dahingelautet hatte, daß sie der Anschauung der Bundesregierung ,im wesentlichenbeizupflichten vermag'. Mit besonderer Genugtuung würde es diek. u. k. Regierung begrüßen, wenn sich das Washingtoner Kabinett geneigt25 Czernin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong>^8^
Anhangfände, sie in ihrem von wärmster Menschenfreundlichkeit getragenenBestreben, amerikanische Bürger vor Gefährdung auf See zu bewahren,durch Belehrung und Warnung seiner Schutzbefohlenen zu unterstützen.Was nun die Zirkularverbalnote vom 10. Februar v. J., betreffend dieBehandlung bewaffneter feindücher Kauffahrteischiffe anlangt, muß diek. u. k. Regierung allerdings feststellen, daß sie, wie auch im vorstehendenangedeutet, der Ansicht ist, die Bewaffnung von Handelsfahrzeugen auchnur zum Zwecke der Verteidigung gegen die Ausübung des Beuterechtessei im modernen Völkerrecht nicht begründet. Ein Kriegsschiff ist inaller Regel verpflichtet, einem feindlichen Handelsfahrzeug in friedlicherForm zu begegnen. Es hat das Fahrzeug mittels bestimmter Zeichen anzuhalten,mit dem Kapitän in Verkehr zu treten, die Bordpapiere zuprüfen, ein Protokoll und gegebenenfalls ein Inventar aufzunehmen usf.Die Erfüllung dieser Pflichten setzt aber wohl als selbstverständlich voraus,daß das Kriegsschiff volle Gewißheit darüber besitzt, daß ihm dasHandelsschiff seinerseits friedlich begegne. Eine solche Gewißheit bestehtjedoch zweifellos nicht, wenn das Handelsschiff eine Bewaffnung führt,die zur Bekämpfung des Kriegsschiffes hinreicht. Einem Kriegsschiff kanndoch schwerlich zugemutet werden, unter den Mündungen feindlicherKanonen des Amtes zu handeln, mögen die Kanonen zu welchem Zweckeimmer an Bord gebracht worden sein. Ganz zu geschweigen der Tatsache,daß die Handelsschiffe der Ententemächte trotz aller gegenteiligen Beteuerungenerwiesenermaßen zu Angriffszwecken mit Geschützen versehensind und sich ihrer zu solchen Zwecken auch bedienen. Auch hieße esPflichten der Menschlichkeit verkennen, würde man die Besatzungen derKriegsschiffe verhalten, sich den Waffen der Feinde ohne Gegenwehrpreiszugeben. Kein Staat kann die Pflichten der Menschlichkeit widerdie berufenen Verteidiger des Vaterlandes niedriger einschätzen als diePflichten gegen die Angehörigen fremder Mächte.Die k. u. k. Regierung hätte daher nach ihrer Überzeugung davon ausgehenkönnen, daß sich ihre dem Washingtoner Kabinett gegebene Zusagevon vornherein nicht auf bewaffnete Handelsfahrzeuge erstrecke, dadiese nach den geltenden Rechtsnormen, welche die Feindseligkeiten aufdie organisierten Streitkräfte beschränken, als Freibeuterschiffe zu betrachtenseien, die ohne weiteres der Vernichtung unterliegen. Wie dieGeschichte lehrt, war es nach allgemeinem Völkerrecht niemals zugelassen,daß sich Handelsschiffe der Ausübung des Beuterechtes durch. Kriegsschiffewidersetzen. Selbst wenn aber eine Norm dieses Inhaltes aufgewiesenwerden könnte, so wäre damit noch nicht dargetan, daß sich dieSchiffe mit Waffen versehen dürfen. Es ist auch in Betracht zu ziehen,daß die Bewaffnung der Handelsschiffe die Kriegführung zur See völligumgestalten muß, und daß diese Umgestaltung nicht den Absichten dererentsprechen kann, die bemüht sind, im Seekrieg die Grundsätze der Menschlichkeitzur Geltung zu bringen. In der Tat hat seit der Abschaffungder Kaperei bis vor wenigen Jahren keine Regierung auch nur im entferntestendaran gedacht, Handelsschiffe zu bewaffnen. <strong>Im</strong> ganzen Verlaufder zweiten Friedenskonferenz, die sich mit allen Fragen des Seekriegsrechtesbefaßt hat, wurde der Bewaffnung von Kauffahrteischiffen mitkeinem Wort Erwähnung getan. Nur ein einziges Mal und gelegentlichfiel eine Äußerung, die für diese Frage von Interesse ist, und es ist bezeichnend,daß es ein hoher britischer Seeoffizier war, der unbefangenerklärte: ,Lorsqu'un navire de guerre se propose d'arreter et de visiter386
Anhangun vaisseau marchand, le commandant, avant de mettre une embarcationä la mer, fera tirer un coup de canon. Le coup de canon est la meilleuregarantie que l'on puisse donner. Les navires de commercen'ont pas decanons ä bord.'Nichtsdestoweniger hat Österreich-Ungarn auch in dieser Frage anseiner Zusage festgehalten; in der bezogenen Zirkularverbalnote wurdendie Neutralen rechtzeitig davor gewarnt, ihre Person und ihre Habe einembewaffneten Schiffe anzuvertrauen; auch wurde die angekündigte Maßnahmenicht sogleich ins Werk gesetzt, sondern ein Aufschub erteilt, umden Neutralen zu ermöglichen, bewaffnete Schiffe, die sie schon bestiegenhatten, wieder zu verlassen. Endlich sind die k. u. k. Kriegsschiffe angewiesen,selbst im Falle der Begegnung mit bewaffneten feindlichen Handelsschiffen,wenn es nach der Sachlage möglich sein sollte, auf Erlassungeiner Warnung und auf die Rettung der Personen an Bord bedaclftzu sein.Die Angabe der amerikanischen Botschaft, die bewaffneten britischenDampfer, Secondo' und ,Welsch Prince' seien von österreichisch-ungarischenTauchbooten ohne Warnung versenkt worden, beruht auf einem Irrtum.Der k. u. k. Regierung ist inzwischen die Mitteilung zugegangen, daß ander Versenkung dieser Dampfer k. u. k. Kriegsschiffe überhaupt nicht beteiligtwaren.In gleicher Weise wie in der mehrerwähnten Zirkularverbalnote hatdie k. u. k. Regierung — und damit kommt sie auf die zu Beginn dieserAide-Memoires erörterte Frage des verschärften Unterseebootkrieges zurück— auch in ihrer Erklärung vom 31. Januar d. J. eine an die Adresse desNeutralen gerichtete Warnung unter Festsetzung einer entsprechendenFrist erlassen; ja, die ganze Erklärung stellt ihrem Wesen nach nichtsanderes dar als eine Warnung des Inhalts, es möge kein Handelsschiffdie in der Erklärung genau bezeichneten Seegebiete befahren. Überdiessind die k. u. k. Kriegsschiffe beauftragt, womöglich auch in diesen Gebietenetwa angetroffene Handelsfahrzeuge zu warnen, sowie Besatzungund Fahrgäste in Sicherheit zu bringen.' Die k. u. k. Regierung ist dennauch im Besitze zahlreicher Meldungen, daß die Mannschaften und Passagierevon Schiffen, die in diesen Gebieten vernichtet worden sind, geborgenwurden. Für etwaige Verluste an Menschenleben, die gleichwohl bei Vernichtungbewaffneter oder in Sperrgebieten angetroffener Schiffe sich ergebensollten, vermag jedoch die k. u. k. Regierung eine Verantwortung nicht zuübernehmen. Übrigens darf bemerkt werden, daß die österreichisch-ungarischenTauchboote nur in der Adria und im Mittelmeere operieren, und daßdaher eine Beeinträchtigung amerikanischer Interessen durch k. u. k. Kriegsschiffekaum zu besorgen ist.Es bedarf wohl nach allem, was eingangs dieses Aide-Memoires ausgeführtwurde, nicht erst der Versicherung, daß die Absperrung der in derErklärung bezeichneten Seegebiete keineswegs der Absicht dient, Menschenlebenzu vernichten oder auch nur zu gefährden, sondern daß sie, abgesehenvom höheren Zweck, durch Abkürzung des Krieges derMenschheit weitere Leiden zu ersparen, nur dazu bestimmt ist,Großbritannien und dessen Verbündete, die — ohne eine rechtswirksameBlockade über die Küsten der Zentralmächte verhängt zu haben — denSeeverkehr der Neutralen mit diesen Mächten unterbinden, in die gleicheLage der Isolierung zu versetzen und sie durch diesen Druck einem Friedengefügig zu machen, der die Gewähr der Dauer in sich trägt. Daß sichÖsterreich-Ungarn hierbei anderer Kriegsmittel bedient als die Gegner,25*A387
Anhangliegtvorwiegend an Umständen, über welche den Menschen keine Machtgegeben ist. Die k. u. k. Regierung ist sich aber bewußt, daß sie alles,was sie vermochte, vorgekehrt hat, um Verlusten an Menschenleben vorzubeugen.Sie würde das mit der Absperrung der Westmächteangestrebte Ziel am schnellsten und sichersten erreichen,wenn in jenen Meeresteilen kein einziges Menschenlebenverlorenginge und kein einziges in Gefahr geriete.Zusammenfassend vermag die k. u. k. Regierung festzustellen, daß dieZusicherung, die sie dem Washingtoner Kabinett im Falle der ,Ancona'gegeben und im Falle ,Persia' erneuert hat, durch ihre Erklärungen vom10. Februar 191 6 und vom 31. Januar 19 17 weder aufgehoben noch eingeschränktwurde. <strong>Im</strong> Rahmen dieser Zusicherung wird sie, vereint mitihren Verbündeten, auch fürderhin alles daransetzen, daß die Völker derErde bald wieder der Segnungen des Friedens teilhaftig werden. Wennsie in Verfolgung dieses Zieles — das, wie ihr wohl bekannt, die volleSympathie des Washingtoner Kabinetts genießt — sich gezwungen sieht,auch die neutrale Schiffahrt in gewissen Seegebieten zu unterbinden, somöchte sie, um diese Maßnahme zu rechtfertigen, nicht so sehr auf dasVerhalten der Gegner hinweisen, das ihr nichts weniger denn nachahmenswertdünkt, als vielmehr darauf, daß Österreich-Ungarn durch die Hartnäckigkeitund Gehässigkeit seiner auf Vernichtung bedachten Feinde ineinen Zustand der Notwehr versetzt wurde, für welchen die Geschichtekein typischeres Beispiel kennt. Wie die k. u. k. Regierung Erhebungfindet in dem Bewußtsein, daß der Kampf, den Österreich-Ungarn führt,nicht nur der Wahrung seiner Lebensinteressen dient, sondern auch derVerwirklichung der Idee des gleichen Rechtes aller Staaten, so legt siein dieser letzten und schweren Phase des Krieges, die, wie sie tief beklagt,auch von den Freunden Opfer heischt, den größten Wert darauf, durchWort und Tat zu bekräftigen, daß ihr in gleicher Weise die Grundsätzeder Menschlichkeit voranleuchten, wie das Gebot der Achtung vor derWürde und den Interessen der neutralen Völker."III.Staatssekretär Helfferidi über den LUBootkriegDie „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" vom 1. Mai 1917 gibt die nachstehendeRede des Staatssekretärs Dr. Helfferich über die Wirtschaftliehen Wirkungen des U-Bootkrieges wieder, abgesehen von Teilen,die vertrauliche Ausführungen enthalten:„In der gestrigen Sitzung hat ein Abgeordneter mit Recht hervorgehoben,daß man technisch und wirtschaftlich in der Veranschlagungder Wirkungen des U-Bootkrieges vorsichtig gewesen sei. Technisch liegtdie Vorsicht in der Beurteilung des Erfolges klar zutage: Die Versenkungensind im ersten Monat um mehr als ein Viertel, im zweiten um fast dieHälfte über die veranschlagten 600 000 Tonnen hinausgegangen, und auchfür den laufenden Monat haben wir ein Recht auf die besten Erwartungen.Der technische Erfolg garantiert den wirtschaftlichen Erfolg mit nahezumathematischer Sicherheit. Freilich läßt sich der wirtschaftliche Erfolgzahlenmäßig nicht so leicht feststellen und in einer einzigen großen Zifferzusammenfassen wie die technische WTirkung in der Tonnenzahl der388
AnhangVersenkungen. Die wirtschaftlichen Wirkungen des U-Bootkrieges äußernsich auf einem vielgestaltigen Gebiet, dessen Unübersichtlichkeit der Feindnoch künstlich durch — ich möchte sagen: statistische Rauchentwicklungzu erhöhen trachtet.Die englische Statistik ist heute fast am interessantesten durch das,was sie weise verschweigt. Der Staatssekretär des Reichsmarineamts hatgestern schon darauf hingewiesen, wie rasch der Stolz der britischen Offenheitverblaßt ist. Die Engländer unterschlagen heute ihrer Öffentlichkeitunsere Berichte über unsere U-Booterfolge und unsere Mitteilungen überunsere U-Bootverluste, sie wagen nicht, den versenkten Schiffsraum bekanntzugeben,sondern mystifizieren das englische Publikum mit einerSchiffsstatistik, die in der englischen Presse selbst allgemeines Ärgerniserregt. Die englische Regierung läßt ihre Leute ruhig an die Phantasienglauben, daß statt der sechs versenkten U-Boote deren hundert auf demMeeresgrunde hegen. Sie enthält der Welt weiter vor, wie sich die Tonnagedes Ein- und Ausgangs der Seeschiffe in britischen Häfen seit dem Beginndes uneingeschränkten U-Bootkriegs gestaltet hat. Vor allem unterdrücktdie englische Regierung seit Februar auf das strengste alle Zahlen, dieauf die Lage des Getreidemarktes ein Licht werfen könnten. Bei derKohlenausfuhr werden die Angaben über die Bestimmungsländer unterdrückt.Die monatliche Handelspolitik, die sonst mit anerkennenswerterPromptheit stets etwa bereits am 10. des folgenden Monats veröffentlichtwurde, ist schon für den Februar verspätet und lückenhaft ausgegebenworden, für den März ist sie bis heute noch nicht erschienen. Es ist bedauerlich,daß uns durch diese plötzliche Zurückhaltung das Urteil überdie wirtschaftliche Wirkung des U-Bootkriegs erschwert wird; aber dieSache hat auch ihre erfreuliche Seite: es ist nicht anzunehmen, daß Englandplötzlich schweigsam wird, um seine Stärke zu verbergen.<strong>Im</strong> übrigen: was sichtbar bleibt, genügt, um uns ein Bild zu geben.Ich beginne mit dem Frachtraum. Sie wissen, daß in den ersten beidenMonaten des uneingeschränkten U-Bootkriegs mehr als i 600 000 Tonnenversenkt worden sind, wovon wohl erheblich mehr als 1 Million Tonnenauf die englische Flagge entfallen.Die Schätzungen über die heute noch verfügbare englische Handelstonnagegehen auseinander; aber einerlei, ob man höher oder niedrigerschätzt, ein Verlust von mehr als 1 Million Tonnen in zwei Monaten istfür England nur kurze Zeit erträglich. Ein auch nur annähernder Ersatzdurch Neubauten ist ausgeschlossen. <strong>Im</strong> Jahre 1914 hat England durchNeubau einen Zuwachs von 1 600 000 Tonnen gehabt; 191 5 waren es noch650000 Tonnen, 1916 nur noch 580000 Tonnen, trotz aller Anstrengungen.Dabei wurde der normale Abgang der englischen Handelsflotte in Friedenszeitenallein auf 700 000 bis 800 000 Tonnen geschätzt. Durch ein Forcierender Neubautätigkeit das Verhängnis aufhalten zu wollen, ist ein aussichtslosesBeginnen. Der Versuch, die neutrale Tonnage wieder durch Zuckerbrotund Peitsche in den britischen Dienst zu zwingen, mag zum Schadender Neutralen hier und dort Erfolg haben; aber auch hier sind in demInteresse der Neutralen an der Erhaltung einer eigenen Flotte für dieFriedenszeit enge Grenzen gezogen. Noch im Januar d. J.kamen rund30% des in britischen Häfen eingehenden Schiffsraums auf fremde Flaggen.Ich habe Schätzungen gehört, die für die Abschreckung der neutralenTonnage auf 80% kommen; wenn davon nur 50% richtig sind, ist daseine Verminderung des britischen Schiffsverkehrs um rund ein Sechstel.Zusammen mit den Versenkungen hat die Abschreckung die Ankünite in389
Anhangden britischen Häfen gering gerechnet bereits um ein Viertel, wahrscheinlichsogar um ein Drittel gegenüber dem Januar eingeschränkt. Die Ankünftebetrugen im Januar noch 2,2 Millionen Nettotonnen. Ich ergänzedie fehlende englische Statistik dahin, daß im März die Ankünfte nur noch1,5 bis 1,6 Millionen Nettotonnen betragen haben, und überlasse es Mr. Carson,mich zu dementieren. Die 1,5 bis 1,6 Millionen bedeuten gegenüberdem durchschnittlichen Eingang der Friedenszeit mit 4,2 Millionen nichtmehr ganz 40%. Diese schmale Rate wird sich progressiv weiter vermindern.Lloyd George hat zu Anfang des Krieges auf die letzte Milliardegesetzt. Das sind vergangene Zeiten. Dann hat er auf die Munition seinePläne gebaut. England hat auf diesem Gebiet, unterstützt von Amerika,Außerordentliches geleistet. Aber die Somme und Arras zeigen, daß esuns auch mit diesen gewaltigen Mitteln nicht zu zwingen vermag. Jetzt,in seiner Begrüßung des amerikanischen Bundesgenossen, hat Lloyd Georgeausgerufen: Schiffe, Schiffe und noch einmal Schiffe! Und diesesMal wird er recht behalten: An den Schiffen wird sich das Schicksal desbritischen Weltreichs entscheiden.Auch die Amerikaner haben begriffen. Sie wollen 1000 hölzerne3000-Tonnenschiffe bauen. Aber bis diese in Aktion treten können, werdensie, das hoffe ich zuversichtlich, nichts mehr zu retten haben.Ich schöpfe diese Zuversicht aus den Anzeichen, die bisher trotz allerenglischen Verdunkelungsversuche sichtbar geworden sind.Nehmen wir den britischen Gesamthandel ! Die Zahlen für den Märzfehlen noch ; aber auch der Februar sagt bereits genug.Die britische Einfuhr betrug im Januar d. J. 90 Millionen Lstr., imFebruar nur noch 70 Millionen Lstr., die Ausfuhr ist von 46 auf 37 MillionenLstr. gesunken — in Ein- und Ausfuhr ein Rückgang von mehr als 20% imersten Monat des U-Bootkriegs. Dabei hat sich die Steigerung aller Preiseseit dem Beginn des U-Bootkriegs in verschärftem Tempo fortgesetzt,so daß man den Rückgang der Einfuhrmengen von einem Monat auf denandern mit 25% wohl nicht zu hoch veranschlagt. Die Ziffern der EinundAusfuhr bestätigen also meine Annahme des Rückganges der Tonnagedes Seeverkehrs der britischen Häfen.Die britische Regierung hat mit drastischen Mitteln, mit rigorosenEinfuhrverboten für alle minder wichtigen Dinge versucht, die Schmälerungder Zufuhr von den lebenswichtigen Einfuhrgütern fernzuhalten. . DerVersuch kann nur unvollständig gelingen.<strong>Im</strong> Jahre 191 6 kamen von einer Gesamteinfuhrmenge von 42 MillionenTonnen allein auf die drei wichtigen Warengruppen : Nahrungs- und Genußmittel,Holz und Eisenerz rund 31 Millionen Tonnen, auf alle übrigenGüter, und darunter sind kriegswichtige Dinge, wie andere Erze und Metalle,Petroleum, Baumwolle und Wolle, Kautschuk, nur 11 Millionen Tonnen,also nur rund ein Viertel. Ein Rückgang der Einfuhrmenge um ein Viertel,wie ihn der erste Monat des uneingeschränkten U-Bootkriegs brachte,muß also auch die für die Kriegführung und das Leben unentbehrlichenDinge treffen.Der Rückgang der Einfuhren im' Februar 1917 gegenüber dem Februar19 16 beträgt:bei Wolle 17%, bei Baumwolle 27%, Flachs 38%, Hanf 48%, Jute 74%,bei Wollstoffen 83%;bei Kupfer und Kupfererz 49%, bei Eisen und Stahl 59%; über dieEinfuhr von Eisenerz werde ich genauere Zahlen mitteilen;390
:Anhangbei Kaffee 66%, bei Tee 41%:bei Rohzucker 10%, raffiniertem Zucker 90%;bei Rindfleisch 17%, bei Butter 21%, bei Schmalz 21%, bei Eiern 39%;bei Holz 42%.Nennenswerte Steigerungen weisen nur auf: Leder, Häute, Kautschuk,Zinn.Über die Warengruppe, die uns am meisten interessiert, über die verschiedenenGetreidearten, sind vom Februar an Mengenzahlen nicht mehrverö ffentlich -worden.Die bloße Gegenüberstellung zweier Vergleichsmomente gibt natürlichkein vollständiges Bild. Man muß sich vergegenwärtigen, daß der uneingeschränkteU-Bootkrieg bei seinem Beginn in England nicht mehreine normale, sondern eine durch zweieinhalb Kriegsjahre bereits starkgeschwächte Wirtschaftsverfassung traf. Ein richtiges Urteil ist also nurmöglich, wenn man die Gesamtentwicklung der Einfuhr während desKrieges mit berücksichtigt.Ich will nur die allerwichtigsten Waren heranholen.Beim Eisenerz hat England bisher seine Position noch am bestenbehauptetDie Einfuhr betrug im Jahre 191 3 7,4 Millionen Tonnen,im Januar„ „ 1916 6.9191 3 689000 Tonnen, im Februar 191 3 Tonnen,658000„ „ 1916 526000 „, „ „ 1916404000 „„ „ 1917 512000 „% , „ „ 1917 508000 „Gegenüber dem Friedensjahr 191 3 zeigen immerhin auch hier die MonateJanuar und Februar eine nicht unbeträchtliche Abnahme, wenn auch dieEinfuhr speziell im Februar 1917 größer war als im gleichen Monat 1916.Holzeinfuhr im Jahre 1913 10,1 Millionen Loadsii », 1916 5,9 „ „im Februar 191 3 406000 Loads„ „ 1916 286 000 „„ „ 1917 167000 „Was insbesondere das Grubenholz angeht, dessen Zufuhr von 3,5 MillionenLoads in 191 3 auf 2,0 in 1916 gefallen war, so weisen Dezember 19 16und Januar 191 7 mit 102000 und 107 000 Loads die niedrigsten Einfuhrzahlenauf, die seit Beginn des Jahres 191 3 festgestellt sind: für Februarfehlt eine Angabe über die Einfuhr von Grubenholz.Ehe ich mich zur Lebensmitteleinfuhr wende, ein Wort über dieKohlenausfuhr!Die gesamte Kohlenausfuhr ist von 78 Millionen Tonnen in 1913 auf46V2 Millionen Tonnen in 191 5 gefallen; im Jahre 1916 wurden nur nochrund 42 Millionen Tonnen ausgeführt. <strong>Im</strong> Dezember 1916 fiel die Ausfuhrmengezum ersten Male unter 3 Millionen Tonnen, während sie inden Monaten Januar bis November 19 16 sich zwischen 3,2 und 3,9 MillionenTonnen gehalten hatte. Jm Januar 191 7 wurden wieder 3,5 MillionenTonnen erreicht; um so bedeutsamer ist es, daß die Kohlenausfuhr, dieder Natur der Sache nach in den einzelnen Monaten nur verhältnismäßiggeringen Schwankungen unterliegt, im Februar 1917 wieder auf 2,9 MillionenTonnen (gegen 3,4 Millionen Tonnen im Februar des Vorjahres)gefallen ist und damit den bisherigen Tiefpunkt — Dezember 19 16 —beinahe wieder erreicht hat. Dabei ist hier wie bei allen anderen Ausfuhrwarenzu berücksichtigen, daß die versenkten Transporte in der englischenAusfuhrstatistik naturgemäß noch miterscheinen.391
•bei:AnhangEinzelheiten über die Bestimmungsländer der Kohlenausfuhr werdenseit dem Beginn dieses Jahres nicht mehr veröffentlicht. England willwohl den Franzosen und Italienern den Schmerz ersparen, den katastrophalenRückgang ihrer Kohlenversorgung auch fernerhin schwarz aufweiß in den amtlichen Ausweisen zu lesen. Wie stark dieser Rückgangbereits bis zum Ende des Jahres 19 16 war, ergibt sich aus folgendenZahlenEnglands Kohlenausfuhr nach Frankreich betrug im Dezember 1916nur 1 128 000 Tonnen gegen 1 369000 im Januar desselben Jahres; nachItalien wurden ausgeführt im Dezember 19 16 nur noch 278 000 Tonnengegen 431 000 Tonnen im Januar und rund 800 000 Tonnen im Monatsdurchschnittdes Friedensjahres 19 13.Über die Weiterentwicklung seit Ende Februar kann ich eine interessanteEinzelangabe machen. Die Kohlenausfuhr Schottlands hat in derersten Aprilwoche 103 000 Tonnen gegen 194 000 Tonnen im Vorjahr betragen,seit Beginn des Jahres 1 783 000 Tonnen gegen 2 486 000 Tonnenim Vorjahre. Dies läßt einen Rückschluß zu, wie der U-Bootkrieg dieEisenbahnen und Kriegsbetriebe der Verbündeten Englands an der Wurzeltrifft.Lloyd George hat in einer großen Rede am 22. Februar d. J. den Engländerngezeigt, wie sie sich durch Vermehrung der Produktion im eigenenLand gegen die Wirkungen des U- Bootkriegs schützen könnten. DieDurchführbarkeit und Wirkung seiner Ratschläge ist mehr als zweifelhaft.Er hat aber ganz darauf verzichtet, seinen Verbündeten zu sagen, welchesMittel er ihnen gegen die Drosselung der Kohlenzufuhr empfiehlt.Ich komme zum wichtigsten Punkte, zu der LebensmittelsituationEnglands.Zunächst möchte ich einige lapidare Ziffern über die AbhängigkeitEnglands von der überseeischen Lebensmittelzufuhr in Ihr Gedächtniszurückrufen.Der Anteil der Einfuhr am britischen Gesamtverbrauch betrug imDurchschnitt der letzten Friedensjähre:beim Brotgetreide nahezu 80%,dem Futtergetreide (Gerste, Hafer, Mais, die als Ersatz und zurStreckung von Brotgetreide verwendbar sind), 50%, beim Fleisch mehrals 40%, bei der Butter 60 bis 65%. Der Zuckerbedarf mußte mangelseiner einheimischen Erzeugung ganz durch die Einfuhr gedeckt werden.Ich erinnere weiter daran, daß unsere U-Boote, soweit Englands Nahrungssituationin Frage kommt, unter ganz besonders günstigen Bedingungenkämpfen: Der Weltrekordernte des Jahres 191 5 ist die Weltmißernte desJahres 1916 gefolgt — ein Minderertrag von 45 bis 50 Millionen Tonnenan Brot- und Futtergetreide. Am stärksten betroffen sind die für Englandam günstigsten gelegenen Bezugsgebiete Nordamerikas. Die Wirkungen tretenjetzt, nachdem die reichlichen Bestände aus der alten Ernte aufgezehrtsind, von Tag zu Tag und überall schärfer in Erscheinung. Argentinienhat ein Getreideausfuhrverbot erlassen. Wie in den Vereinigten Staatendie Dinge stehen, ergibt sich aus folgenden Zahlen:Das Ackerbaudepartement schätzt die Vorräte an Weizen, die sich am1. März 19 17 noch in den Händen der Farmer befänden, auf 101 MillionenBusheis, das sind wenig mehr als 2 1 /» Millionen Tonnen. Um dieselbe Zeitdes Vorjahres waren diese Bestände noch 241 Millionen Busheis. Niemals,soweit ich die Zahlen zurückverfolgt habe, waren die Bestände auch nurannähernd so gering. Für die Bestände an Mais gilt dasselbe. Einem392
!AnhangVorrat von i 138 000 Busheis am 1. März 1916 stehen in diesem Jahrenur 789 000 Busheis gegenüber.Die außerordentliche Knappheit der Vorräte spitzt sich zur Panik zu.Die Preisbewegung in den letzten Wochen ist geradezu phantastisch.Mais, der in Chicago Anfang Januar 1917 noch 95 Cents notierte, stiegbis Anfang April auf 127 Cents und bis zum 25. April weiter auf 148 Cents.Weizen in Neuyork, der im Juli 19 14 sich auf 87V4 Cents stellte und Anfang 19 17 bereits auf i9iV 2Cents angekommen war, stieg Anfang Aprilauf 229 Cents und notierte am 25. April gar 281 Cents — dreiundeinhalbmalso viel wie im Frieden! In deutschem Geld zum Friedenskurs bedeuten die 281 Cents etwa 440 Mark pro Tonne, zum jetzigen Dollarkursetwa 580 Mark pro Tonne.So sieht das Gebiet aus, das England in dem von ihm selbst freventlichbegonnenen Hungerkrieg helfen sollIn England selbst werden über Einfuhren und Bestände von Getreidekeine Ziffern mehr veröffentlicht. Ich kann aber folgendes sagen:An dem letzten Tage der Bestandsveröffentlichung, am 13. Januar 1917,betrugen die sichtbaren Weizenbestände Englands 5,3 Millionen Quartersgegen 6,3 und 5,9 Millionen Quarters in den beiden Vorjahren. VomJanuar bis zum Mai und Juni tritt regelmäßig eine starke Verringerungder Bestände ein, die Zufuhren decken in diesen Monaten auch in normalenJahren nicht den Verbrauch. <strong>Im</strong> Juni 1914 und 191 5 betrug der sichtbareBestand nur noch rund 2 Millionen Quarters, das entspricht einem Bedarfvon knapp drei Wochen.Wir haben keinen Grund, anzunehmen, daß in diesem Jahre sich dieDinge günstiger entwickelt haben sollten. Dafür sprechen die noch veröffentlichtenEinfuhrzahlen des Januar. Die Einfuhr an Brot- und Futtergetreide— ich nehme angesichts der englischen Streckungsvorschriftenalles zusammen — betrug nur 12,6 Millionen Quarters, gegen 19,8 und 19,2in den beiden Vorjahren.Für den Februar verzeichnet die englische Statistik eine Steigerungdes Einfuhrwertes der unbenannten Einfuhrmengen der sämtlichen Getreideartenvon 50% gegenüber dem Februar 1916. Dies gibt bei einerdem Januar entsprechenden Verteilung der Gesamtmenge auf die einzelnenGetreidearten angesichts der Preissteigerung, die inzwischen eingetretenist, ungefähr die gleiche Einfuhrmenge wie im Vorjahre. In Anbetrachtder stark zurückgegangenen Getreideverschiffungen Amerikas und angesichtsder geringen Menge, die aus Australien und Indien angekommensein kann, ist dieses Ergebnis wenig glaublich. Wir dürfen annehmen,daß der März eine weitere Verschlechterung gebracht hat, und daß heute,in einer Zeit, wo wir uns dem Dreiwochenbestand an sichtbarer Warenähern, die englischen Vorräte geringer sind als in den Vorjahren.Die Engländer selbst bestätigen dies. Lloyd George hat im Februargesagt, die britischen Getreidevorräte seien geringer als jemals seit Menschengedenken.Ein hoher Beamter des englischen Landwirtschaftsministeriums,Sir AUwyn Fellown, hat Anfang April in einer landwirtschaftlichen Versammlunghinzugefügt, er fürchte, daß <strong>info</strong>lge des für England überausernsten U- Bootkriegs diese Lage sich noch erheblich verschlechtert habe.Captain Bathurst vom britischen Kriegsernährungsamt hat kürzlich,am 19. April, ausgesprochen, der gegenwärtige Verbrauch an Brotstoffengehe um 50% über die vorhandenen und in Aussicht stehenden Vorrätehinaus. Eine Herabsetzung des Brotverbrauchs um ein volles Dritte)sei notwendig, um durchzukommen.393
AnhangKurz zuvor hatte Mr. Wallhead, der Abgeordnete für Manchester, aufder Konferenz der unabhängigen Arbeiterpartei in Leeds ausgeführt, nachseinen Informationen werde sich England in sechs bis acht Wochen im Zustandevölliger Hungersnot befinden.Die Kri-is, in der England sich befindet — wir können es heute schonruhig eine Krisis nennen — wird verschärft durch die Tatsache, daß dieVersorgung Englands mit den anderen wichtigen Nahrungsmitteln sichgleichfalls ungünstig gestaltet hat.Die Fleischeinfuhr zeigt im Februar 1917 den niedrigsten Standseit Jahren mit der ^inen Ausnahme des September 191 4.Der starke Rückgang der Buttereinfuhr — im Februar 19T7 nurhalb so viel als im Vorjahr — wird durch die von England mit allen Mittelngeförderte Margarineeinfuhr nicht entfernt wettgemacht.Auch die Einfuhr von Schmalz — Hauptbezugsland die VereinigtenStaaten — läßt unter der Einwirkung der schlechten amerikanischenFutterernte nach. Der Preis für Schmalz ist in Chi ago von 15V2 CentsAnfang Januar 1917 auf 21 1 /,, Cents am 25. April gestiegen, die Schweinepreisein derselben Zeit von 9,80 auf 15,65 Dollars.Die schlimmste Verschärfung der Getreidenot ist jedoch für Englandder geradezu katastrophale Kartoffelmangel. Die Ernte in Englandwar die schlechteste seit einem Menschenalter. Die Zufuhr istgänzlich unbedeutend. Captain Bathurst hat am 19. April erklärt, daßin etwa vier Wochen die Kartoffelvorräte Englands völlig aufgebrauchtseien.Der volle Ernst der Lage steht heute den englischen Staatsmännernvor Augen. Bisher haben sie geglaubt, mit freiwilliger Sparsamkeit dieGefahr beschwören zu können. Jetzt sehen sie sich zu Zwangsmaßnahmengenötigt. Ich glaube, es ist zu spät."Der Staatssekretär gibt eine ausführliche Darstellung der bisherigenenglischen Maßnahmen zur Lebensmittelversorgung und fährt fort:„Noch am 22. März hat der englische Lebensmitteldiktator, Lord Devonport,im Oberhaus erklärt, eine starke Verminderung des Brotverbrauchssei nötig, aber es würde ein nationales Unglück sein, wenn Englandzum Zwang greifen müsse.Sein Vertreter Bathurst hat um dieselbe Zeit gesagt: Wir wollen einso unenglisches System nicht einführen. Erstens, weil wir glauben,dem Patriotismus des Volkes unsere Sparsamkeitswünsche anvertrauenzu können, dann aber, weil — wie Deutschlands Beispiel zeige — dasZwangssystem keinen Erfolg verspricht; schließlich, weil ein solches Systemeinen zu verwackelten Verwaltungsapparat und ein zu umfangreichesPersonal von Männern und Frauen erfordert, das besser anderweitig beschäftigtwerden kann.Inzwischen hat die englische Regierung, wenn die letzten Nachrichtenzutreffen, sich entschlossen, zu diesem unenglischen, in Deutschland gescheitertenSystem überzugehen, und sie behauptet, daß die ganze Organisationbereitstehe.Ich hätte noch ein Wort zu sagen über die großzügigen Maßnahmen,die zur Förderung des Ackerbaues in England in die Wege geleitet wordensind. Ich unterlasse es, denn diese Maßnahmen werden weder bis zurnächsten Ernte noch für die nächste Ernte etwas helfen. Der Ausfallin der Winterbestellung wird selbst mit den größten Anstrengungen durchdie Frühjahrsbestellung kaum auszugleichen sein. Erst die Ernte 1918könnte bestenfalls einen Erfolg bringen. Bis dabin ist ein zu weiter Weg,394
Anhangein Leidensweg für England, für alle Länder, die auf Nahrungsmittelzufuhrangewiesen sind.Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird auf die Weltmißernte 1916 eineWeltmißernte 191 7 folgen. In den Vereinigten Staaten lautet die offizielleSaatenstandsschätzung schlechter denn je, auf 63,4 gegen 78,3 im Vorjahre.Der Ertrag des Winterweizens wird auf nur 430 Millionen BusheLveranschlagt gegen 492 Millionen im Vorjahr und 650 Millionen imJahre 191 5.Also auch die Perspektive des neuen Erntejahres ist trübe und versprichtunseren Feinden keine Rettung.Wie wir unsererseits stehen, ist den Herren bekannt: knapp, abersicher; denn wir stehen auf den eigenen Füßen. Heute können wir sagen:Der Hungerkrieg, dieses phantastische Verbrechen an der Menschheit, hatsich gegen seinen Urheber gewendet. Wir halten den Feind mit eisernemGriff. Niemand wird das Schicksal wenden. Auch nicht die Menschheitsaposteljenseits des großen Wassers, die den Schutz der kleinen Völkerjetzt dadurch zu betätigen beginnen, daß sie durch Ausfuhrverbote dieuns benachbarten Neutralen blockieren und so mit der Hungerpeitschein den Krieg gegen uns treiben wollen.Die Feinde spüren die Faust, die ihnen am Nacken sitzt. Sie suchendie Entscheidung zu erzwingen. England, die Beherrscherin der Meere,sucht die Entscheidung auf dem Lande, jagt seine Söhne zu Hunderttausendenin Tod und Verderben. Ist das ein England, das auf seinerInsel gemächlich warten kann, bis uns der Hunger zwingt, das warten kann,bis der große Bruder jenseits der Atlantik mit Schiffen und Millionenheerenauf dem Plan erscheint und mit alles erdrückender Übermacht zum vernichtendenSchlag ausholt? — Nein, meine Herren, unsere Feinde habenkeine Zeit mehr, zu warten. Die Zeit arbeitet jetzt für uns. Gewiß, dieProbe, auf die uns die Weltgeschichte stellt, ist ungeheuer. Was unsereTruppen leisten, was unsere blauen Jungen leisten, steht hoch über jedemVergleich. Aber sie werden es schaffen. Auch in der Heimat ist esschwer — lange nicht so schwer wie draußen, aber schwer genug. Auchdie Heimat muß und wird es schaffen. Wenn wir uns selbst treu bleiben,wenn wir das eigene Haus in Ordnung halten, wenn wir die innere Geschlossenheitbewahren, dann haben wir Dasein und Zukunft für unserVaterland gewonnen. Es geht ums Ganze. Das deutsche Volk hat in diesenentscheidungsschweren Wochen zu zeigen, daß es wert ist, zu bestehen."IV.Rede des Grafen Czernin in der Österreichischen Delegationam 24. Januar 1918Minister des Äußern Graf Czernin:„Hoher Ausschuß! Es ist meine Pflicht, den Herren ein getreues Bildder Friedensverhandlungen zu entwickeln, die verschiedenen Phasen derbisherigen Ergebnisse zu beleuchten und daraus jene Konklusionen zuziehen, die wahr, logisch und berechtigt sind.Es scheint mir vor allem, daß jene, welche den Verlauf der Verhandlungenanscheinend zu langsam finden, sich auch nicht annähernd eine395
Anhang;Vorstellung von den Schwierigkeiten machen können, denen wir naturgemäßauf Schritt und Tritt hierbei begegnen müssen. Ich werde mirim nachstehenden gestatten, diese Schwierigkeiten zu schildern, möchtenur gleich vorgreifend auf einen Kardinal unterschied hinweisen, welcherzwischen den Friedensverhandlungen von Brest-Litowsk und all denen,die jemals in der Geschichte stattgefunden haben, besteht. Niemals, sovielich weiß, haben Friedensverhandlungen bei offenen Fenstern stattgefunden.Es ist ganz ausgeschlossen, daß Verhandlungen, welche anUmfang und Tiefe den jetzigen gleichkommen, von der ersten Minutean glatt und ohne den geringsten Widerstand verlaufen könnten. Es gilt,eine neue Welt aufzubauen, alles das, was der erbarmungsloseste allerKriege zerstört und in den Boden gestampft hat. Bei allen Friedensverhandlungen,die wir kennen, haben sich deren verschiedene Phasen mehroder weniger bei verschlossenen Türen abgespielt, und erst nach Ablaufder Verhandlungen wurde der Welt das Ergebnis mitgeteilt. Aus allenBüchern der Geschichte geht hervor, es ist dies ja auch ganz selbstverständlich,daß der mühsame Weg solcher Friedensverhandlungen stetsüber Berg und Tal geführt hat, daß die Aussichten manchen Tag günstiger,manchen Tag weniger günstig schienen. Wenn aber diese verschiedenenPhasen, die Details des Einzeltages in die Welt hinaustelegraphiert werdenso ist es wieder ganz selbstverständlich, daß sie bei der die ganze Weltbeherrschenden Nervosität wie elektrische Schläge wirken und die öffentlicheMeinung aufpeitschen. Wir waren uns über den Nachteil diesesVorganges vollständig im klaren. Wir haben trotzdem dem Wunsche derrussischen Regierung nach dieser Öffentlichkeit sofort stattgegeben, weilwir uns entgegenkommend zeigen wollten, weil wir nichts zu versteckenhaben, und weil es einen falschen Eindruck hätte machen können, wenDwir an dem bisher bestandenen Modus der vorerstigen Geheimhaltungfestgehalten hätten. Aber die notwendige Kehrseite dieser vollständigenÖffentlichkeit der Verhandlungen ist die, daß diegroße Öffentlichkeit, daß das Hinterland und vor allem dieFührer ruhige Nerven behalten. Die Partie muß mit kaltem Blutezu Ende gespielt werden, und sie wird zu einem guten Ende kommenwenn die Völker der Monarchie ihre verantwortlichen Vertreter auf derFriedenskonferenz unterstützen.Vorweg sei es gesagt: die Basis, auf welcher Österreich-Ungarn mitden verschiedenen, neu entstandenen russischen Reichen verhandelt, istdie ,ohne Kompensationen und ohne Annexionen'. Das ist das Programm,welches ich vor einem Jahre knapp nach meiner Ernennung zumMinister denjenigen gegenüber, welche über den Frieden reden wollen,ausgesprochen habe, welches ich den russischen Machthabern auf ihrerstes Friedensangebot hin wiederholt habe und von dem ich nicht abweichenwerde. Diejenigen, die glauben, daß ich von dem Wege, den ichmir zu gehen vorgenommen habe, abzudrängen sei, sind schlechte Psychologen.Ich habe der Öffentlichkeit niemals einen Zweifel darüber gelassen,welchen Weg ich gehe, und ich habe mich niemals auch nur um einesHaares Breite von diesem Wege abdrängen lassen, weder nach rechtsoder nach links. Ich bin seitdem der unbestrittene Liebling der Alldeutschengeworden und derjenigen in der Monarchie, die die Alldeutschennachahmen. Ich werde gleichzeitig als Kriegshetzer von denen verschrien,die den Frieden um jeden Preis wollen, wie zahllose Briefe mir beweisen.Beides hat mich niemals geniert, im Gegenteü, diese doppelten Schimpfereiensind meine einzige Erheiterung in dieser ernsten Zeit. Ich erkläre hier396
Anhangnochmals, daß ich keinen Quadratmeter und keinen Kreuzer von Rußlandverlange, und daß, wenn Rußland, wie dies scheint, sich auf dengleichen Standpunkt stellt, der Friede zustande kommen muß. Diejenigen,welche den Frieden um jeden Preis wollen, könnten Zweifel an meinenannexionslosen Absichten gegenüber Rußland hegen, wenn ich ihnen nichtmit der gleichen rücksichtslosen Offenheit ins Gesicht sagen würde, daßich mich niemals dazu hergeben werde, einen Frieden zu schließen, welcherüber den eben skizzierten Rahmen hinausgeht. Wenn unsere russischenKompaziszenten von uns eine Gebietsabtreimung oder eine Kriegsentschädigungverlangen würden, so würde ich den Krieg fortsetzen,trotz des Friedenswunsches, den ich genau so gut habe wie Sie, oderich würde zurücktreten, wenn ich mit meiner Ansicht nicht durchdringenkönnte.Das vorausgeschickt und nochmals betont, daß für diese letzte pessimistischeAnnahme, daß der Friede scheitern wird, kein Grund vorliegt,da sich die verhandelnden Kommissionen auf der annexions- und kontributionslosenBasis vereinigt haben und nur neue Instruktionen derverschiedenen russischen Regierungen oder deren Verschwinden diese Basiszu verschieben imstande wären, gehe ich auf die zwei größten Schwierigkeitenüber, welche die Gründe enthalten, daß die Verhandlungen nichtso schnell, als wir alle möchten, verlaufen.Die erste Schwierigkeit ist, daß wir gar nicht mit einem russischenKompaziszenten, sondern mit verschiedenen neu entstandenen russischenReichen zu verhandeln haben, welche untereinander ihre Kompetenzsphärenoch gar nicht abgegrenzt und geklärt haben. Es kommen hierin Betracht: das von Petersburg geleitete Rußland, zweitens unser eigentlicherneuer Nachbarstaat, die große Ukraine, drittens Finnland undviertens der Kaukasus.Mit den ersten beiden Staaten verhandeln wir direkt, ich meine vonAngesicht zu Angesicht, mit den beiden anderen vorerst auf einem mehroder weniger indirekten Wege, weil sie zurzeit keine Unterhändler nachBrest-Litowsk geschickt haben. Diesen vier russischen Kompaziszentenstehen wir vier Mächte gegenüber, und beispielsweise der Fall des Kaukasus,in welchem wir direkt natürlich gar keine Schwierigkeiten zu bereinigenhaben, welcher aber im Konflikt mit der Türkei ist, beweist die Ausdehnungder Verhandlungsthemata.Was uns speziell in erster Linie interessieren muß, ist jener neu entstandenegroße Staat, an den wir in Zukunft grenzen werden, die Ukraine.Wir sind in den Verhandlungen mit dieser Delegation bereits sehr weitgekommen. Wir haben uns auf der obenerwähnten annexions- und kompensationslosenBasis geeinigt und sind in großen Zügen darüber klargeworden, daß und wie die Handelsbeziehungen mit der neuentstandenenRepublik wieder aufzunehmen seien. Aber gerade dieses Beispiel derUkraine zeigt eine der herrschenden Schwierigkeiten. Während die ukrainischeRepublik auf dem Standpunkte steht, daß sie vollkommen autonomund selbständig mit uns zu verhandeln berechtigt sei, steht die russischeDelegation auf der Basis, daß die Grenzen ihres Reiches und die der Ukrainenoch nicht fixiert seien, daß die Grenzen der Ukraine überhaupt nochnicht definitiv abgemacht seien, und daß Petersburg <strong>info</strong>lgedessen berechtigtsei, an diesen unseren Verhandlungen mit der Ukraine teilzunehmen,eine Ansicht, der sich die Herren der ukrainischen Delegationnicht anschließen wollen. Aber diese ungeklärte Lage der inneren VerhältnisseRußlands war der Grund einer gewaltigen Verzögerung. Wir397
Anhamwaren auch über diese Schwierigkeit hinübergekommen, und ich glaubte,daß die in einigen Tagen wieder aufzunehmenden Verhandlungen denWeg hier frei finden werden.Wie die Sache heute steht, weiß ich nicht; denn ich habe gestern vonmeinem Vertreter in Brest-Litowsk folgende zwei Telegramme erhalten:,Herr Joffe hat heute abend in seiner Eigenschaft als Präsident derrussischen Delegation an die Delegationen der vier verbündeten Mächteein Zirkularschreiben gerichtet, in welchem er bekanntgibt, daß die ,Arbeiter-und Bauernregierung der Ukrainischen Republik' beschlossen hat,zwei Delegierte nach Brest mit dem Auftrage zu entsenden, an den Friedens'Verhandlungen als Vertreter des Zentralkomitees der allukrainischeiArbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, jedoch innerhalb der russischenDelegation als ergänzender Bestandteil derselben, teilzunehmen. HerrJoffe fügt dieser Mitteilung hinzu, daß die russische Delegation bereit ist,diese ukrainischen Vertreter in ihren Bestand aufzunehmen. Obiger Mitteilungist die Kopie einer aus Charkow datierten, an den Vorsitzendender russischen Friedensdelegation in Brest gerichteten ,Erklärung' der^Arbeiter- und Bauernregierung der Ukrainischen Republik' beigeschlossen,in welcher bekanntgegeben wird, daß die Kiewer Zentrairada lediglichdie besitzenden Klassen vertrete und <strong>info</strong>lgedessen nicht im Namen desganzen ukrainischen Volkes handeln könne. Die ukrainische ArbeiterundBauernregierung erklärt, daß sie etwaige, ohne ihr Zutun zustandegekommeneAbmachungen der Delegierten der Kiewer Zentrairada nichtanerkenne, ihrerseits jedoch beschlossen habe, Vertreter nach Brest-Litowsk zu entsenden, die dort als ergänzende Bestandteile der russischenDelegation, welche sie als Bevollmächtigte der föderativen RegierungRußlands anerkennt, aufzutreten haben werden.'Ferner: ,Die deutsche Übersetzung des russischen Originaltextes desgestern abend erhaltenen Schreibens Herrn Joffes in Angelegenheit derDelegierten der Charkower ukrainischen Regierung sowie dessen zwei Beilagenlautet wie folgt:,An den Herrn Vorsitzenden der österreichisch-ungarischen Friedensdelegation.Herr Minister 1Indem ich anbei eine Kopie einer von mir erhaltenen Erklärung derDelegierten der Arbeiter- und Bauernregierung der Ukrainischen RepublikW. M. Schachrai und E. G. Medwjedew und ihrer Mandate übersende, habeich die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß die russische Delegation in vollerÜbereinstimmung mit dem von ihr wiederholt anerkannten Recht auffreie Selbstbestimmung aller Völker — darunter natürlich auch des ukrainischen— keinerlei Hindernisse für die Teilnahme der Vertreter derArbeiter- und Bauernregierung der Ukrainischen Republik an den Friedensverhandlungenerblickt und sie entsprechend dem von ihnen geäußertenWunsche mit in den Bestand der russischen Friedensdelegation aufnimmtals bevollmächtigte Vertreter der Arbeiter- und Bauernregierung derUkrainischen Republik. Indem ich dieses zu Ihrer Kenntnis bringe, bitteich Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtungentgegenzunehmen. Der Vorsitzende der russischen FriedensdelegationA. Joffe.'Beilage i. ,An den Herrn Vorsitzenden der Friedensdelegation derrussischen Republik. Erklärung.Wir, die Vertreter der Arbeiter- und Bauernregierung der UkrainischenRepublik, Volkskommissar für militärische Angelegenheiten W. M. Schachraiund der Vorsitzende des all ukrainischen Zentralexekutivkomitees der Räte398
. kategorischAnhangder Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputation E. G. Medwjedew, die wirnach Brest-Litowsk zur Führung von Friedensverhandlungen mit denVertretern Deutschlands, Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkeiin voller Übereinstimmung mit den Vertretern der Arbeiter- und Bauernregierungder russischen föderativen Republik delegiert worden sind, alswelcher der Rat der Volkskommissare anzusehen ist, erklären hiermitfolgendes: Das Generalsekretariat der ukrainischen Zentralrada kannkeinesfalls als Vertreter des ganzen ukrainischen Volkes anerkannt werden.<strong>Im</strong> Namen der ukrainischen Arbeiter, Soldaten und Bauern erklaren wirkategorisch, daß alle Beschlüsse, die das Generalsekretariat ohne Einigungmit uns gefaßt hat, vom ukrainischen Volk nicht anerkannt werden, nichtdurchgeführt werden können und keinesfalls in die Tat umgesetzt werdenkönnen.In voller Übereinstimmung mit dem Rate der Volkskommissare, folglichauch mit der Delegation der russischen Arbeiter- und Bauernregierung,werden wir in Zukunft die Friedensverhandlungen mit den Delegationendes Vierbundes zusammen mit der russischen Friedensdelegation führen.Dabei bringen wir folgende Resolution zu Ihrer Kenntnis, Herr Vorsitzender,welche von dem Zentralexekutivkomitee der allukrainischenRäte der Arbeiter-, Soldaten und Bauerndeputierten am 30. Dezember 1917(12. Januar 191 8) angenommen worden ist: Das Zentralexekutivkomiteehat beschlossen: ,Zur Teilnahme an den Friedensverhandlungen den Vorsitzendendes Zentralexekutivkomitees Genossen Medwjedew und die VolkssekretäreSatonski und Schachrai zu delegieren, die damit beauftragt sind,zu erklären, daß alle Versuche der ukrainischen Zentralrada,im Namen des ukrainischen Volkes aufzutreten, als eigenmächtigeSchritte der Bourgeoisgruppen der ukrainischen Bevölkerung gegen denWillen und die Interessen der arbeitenden Klassen der Ukraine anzusehensind, und daß keinerlei Beschlüsse, die die Zentralrada gefaßt hat, wedervon der ukrainischen Sowjetregierung noch von dem ukrainischen Volkeanerkannt werden, daß die ukrainische Arbeiter- und Bauernregierungden Rat der Volkskommissare als Organ der allrussischen Sowjetregierungfür berechtigt ansieht, im Namen der ganzen russischen Föderationaufzutreten, und daß die Delegation der ukrainischen Arbeiter- und Bauernregierung,die zu dem Zwecke entsandt worden ist, um die eigenmächtigenSchritte der ukrainischen Zentralrada aufzudecken, zusammen mit derallrussischen Delegation und in voller Übereinstimmung mit dieser auftretenwird.'Zusatz: Das von dem Volkssekretariat der ukrainischen Arbeiter- undBauernrepublik am 30. Dezember 19 17 erteilte Mandat.Anmerkung: Der Volkssekretär für Volksaufklärung Wladimir PetrowitschSatonski ist unterwegs erkrankt und daher nicht gleichzeitig mituns eingetroffen.Januar 1918.Der Vorsitzende des Zentralexekutivkomitees der ukrainischen Räteder Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten E. Medwjedew.Der Volkskommissar für militärische Angelegenheiten Schachrai.Mit dem Original übereinstimmend:Der Sekretär der Friedensdelegation Leo Karacho u.'Beilage II.,Auf Beschluß des Zentralexekutivkomitees der Räte der Arbeiter-,Bauern- und Soldatendeputierten der Ukraine bevollmächtigt das Volkssekretariatder Ukrainischen Republik im Namen der Arbeiter- und399
AnhangBauernregierung der Ukraine hierdurch den Vorsitzenden des Zentralexekutivkomiteesder Räte der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputiertender Ukraine Jefim Gregorjewitsch Medwjedew, den Volkssekretär fürmilitärische Angelegenheiten Wasili Matwjejewitsch Schachrai und denVolkssekretär für Volksaufklärung Wladimir Petrowitsch Satonski, imNamen der Ukrainischen Volksrepublik an den Verhandlungen mit denRegierungen Deutschlands, Österreich-Ungarns, der Türkei und Bulgariensüber die Friedensbedingungen zwischen den genannten Staaten und derrussischen föderativen Repubük teilzunehmen. Zu diesem Zwecke wirdden genannten Bevollmächtigten Jefim Gregorjewitsch Medwjedew,Wasili Matwjejewitsch Schachrai und Wladimir Petrowitsch Satonskidas Recht eingeräumt, in allen Fällen, wo sie dies für notwendig haltenwerden, Erklärungen abzugeben und Schriftstücke zu unterzeichnen imNamen der Arbeiter- und Bauernregierung der Ukrainischen Republik.Alle ihre Handlungen sind die Bevollmächtigten der ukrainischen ArbeiterundBauernregierung verpflichtet in Übereinstimmung zu bringen mitden Handlungen der Bevollmächtigten der Arbeiter- und Bauernregierunder russischen föderativen Repubük, als welche der Rat der Volkskommissareanzusehen ist.<strong>Im</strong> Namen der Arbeiter- und Bauernregierung der UkrainischenVolksrepublik die Volkssekretäre für internationale Angelegenheiten,für innere Angelegenheiten, militärische Angelegenheiten, für Justiz,für Arbeit, für Verpflegung.Der Geschäftsführer des Volkssekretariates.Charkow, den 30. Dezember 1917/12. Januar 1918.Mit der Kopie übereinstimmend:Der Vorsitzende der russischen Friedensdelegation:A. Joffe.'Das ist jedenfalls eine neue Schwierigkeit, denn wir könnenund wollen uns nicht in die internen Angelegenheiten Rußlandseinmischen.Ist aber dieser Weg einmal frei, so wird sich auch weiter keine Schwierigkeitbieten, wir werden übereinstimmend mit der Ukrainischen Republikkonstatieren, daß die alten Grenzen zwischen Osterreich - Ungarnund dem früheren Rußland auch zwischen uns und derUkrainegelten.PolenWas Polen betrifft, dessen Grenzen übrigens noch nicht genau fixiertsind, so wollen wir gar nichts von diesem neuen Staate. Freiund unbeeinflußt soll Polens Bevölkerung ihr eigenes Schicksal wählen.Ich lege dabei meinerseits gar keinen besonderen Wert auf die Form desdiesbezüglichen Volksvotums: je sicherer es den allgemeinen Volkswillenwiderspiegelt, desto lieber ist es mir. Denn ich will nurden freiwilligen Anschluß Polens — nur in dem diesbezüglichenWunsche Polens sehe ich die Gewähr einer dauernden Harmonie. Ichhalte unwiderruflich an dem Standpunkte fest, daß die polnische Frageden Friedensschluß nicht um einen Tag verlängern darf; wirdes nach Friedensschluß eine Anlehnung an uns suchen, so werden wires nicht abstoßen — den Frieden darf und wird die pol nische Fragenicht gefährden.Ich hätte es gerne gesehen, wenn die polnische Regierung an denVerhandlungen hätte teilnehmen können, denn meiner Auffassung400
Anhan?nach ist Polen ein selbständiger Staat. Die Petersburger Regierungaber steht auf dem Standpunkte, die heutige polnische Regierungsei nicht berechtigt, im Namen ihres Landes zu sprechen, sie anerkannte sienicht als kompetenten Exponenten des Landes, und daher standen wir vondem Vorhaben ab, um nicht einen etwaigen Konflikt zu erzeugen. DieFrage ist gewiß wichtig, aber wichtiger noch ist mir die Beseitigungaller Schwierigkeiten, welche den Abschluß der Verhandlungenverzögern.Die deutsch-russischen Differenzen über die besetzten GebieteDie zweite Schwierigkeit, welche vorliegt, die auch in den Blätternden größten Widerhall gefunden hat, ist die Meinungsdifferenzunseres deutschen Bundesgenossen und der PetersburgerRegierung über die Interpretation des Selbstbestimmungsrechtesder russischen Völker, nämlich jener Gebiete, die von deutschenTruppen besetzt sind. Deutschland steht auf dem Standpunkte, daß eskeine gewaltsamen Gebietserwerbungen von Rußland beabsichtigt,aber in zwei Worten gesagt ist die Meinungsdifferenz eine doppelte:Erstens steht Deutschland auf dem berechtigten Standpunkte, daßdie zahlreich erfolgten Willensäußerungen nach Selbständigkeitund Unabhängigkeit seitens der legislativen Korporationen, der Gemeindevertretungenusw. in den okkupierten Provinzen als provisorische Basisfür die Volksmeinung zu gelten hätten, welche nachher durch ein Volksvotumauf breiter Basis zu überprüfen seien — ein Standpunkt,welchem die russische Regierung vorerst noch ablehnend gegenübersteht,da sie den bestehenden Organen in Kurland und Litauen das Recht, imNamen dieser Provinzen zu sprechen, nicht zuerkennt, ebensowenig wieden polnischen.Zweitens: darin, daß Rußland verlangt, daß dieses Volksvotum stattfinde,nachdem sich sämtliche deutsche Truppen und Verwaltungsorganeaus den okkupierten Provinzen zurückgezogen haben,während Deutschland darauf hinweist, daß eine solche bis in die äußerstenKonsequenzen durchgeführte Evakuierung ein Vakuum schaffen würde,welches den Ausbruch der vollständigen Anarchie und der größten Notunwiderruflich hervorrufen müßte. Es muß hier erklärt werden, daß alles,was heute in den okkupierten Provinzen das staatliche Leben ermöglicht,deutscher Besitz ist. Die Bahnen, die Post, der Telegraph, die ganzenIndustrien, aber auch der ganze Verwaltungsapparat, die Polizei, dieRechtspflege, alles das liegt in deutschen Händen. Die plötzliche Zurückziehungdieses ganzen Apparates würde tatsächlich einen Zustand schaffen,der praktisch nicht haltbar erscheint.In beiden Fragen handelt es sich darum, einen Mittelweg zu finden,der gefunden werden muß. Die Differenzen bei beiden Standpunktensind meiner Ansicht nach nicht groß genug, um ein Scheitern der Verhandlungenrechtfertigen zu können.Aber solche Verhandlungen lassen sich nicht über Nacht beenden, siebrauchen Zeit.Sind wir einmal mit den Russen zum Frieden gekommen, so ist meinerAnsicht nach derallgemeineFriedenicht mehr lange zu verhindern, trotz aller Anstrengungen derwestlichen Ententestaatsmänner. Ich habe vernommen, es sei hier und26 Czemin, <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 401
Anhangdort nicht verstanden worden, warum ich in meiner ersten Rede nachder Wiederaufnahme der Verhandlungen erklärt hatte, daß es sich jetztin Brest nicht um einen allgemeinen, sondern um einen Separatfriedenmit Rußland handele. Das war die notwendige Konstatierung einerklaren Tatsache, welche auch Herr Trotz ki rückhaltlos anerkannt hat,und sie war notwendig, weil man auf einer anderen Basis verhandelt,d. h. in einem begrenzteren Rahmen, wenn es sich um einen Frieden mitRußland allein, als wenn es sich um einen allgemeinen Frieden handelt.Obwohl ich mich keinen Illusionen darüber hingebe, daß die Fruchtdes allgemeinen Friedens nicht über Nacht reifen wird, so binich dennoch überzeugt, daß sie im Reifen begriffen ist und daß es nureine Frage des Durchhaltens ist, ob wir einen allgemeinen, ehrenvollenFrieden erhalten oder nicht.Die Botschaft WilsonsIch bin in dieser Ansicht neuerdings bestärkt worden durch das Friedensangebot,welches der Herr Präsident der Vereinigten Staaten vonAmerika an die ganze Welt gerichtet hat. Es ist dies ein Friedensangebot;denn in 14 Punkten entwickelt Herr Wilson jene Grundlagen, auf welchener den allgemeinen Frieden herbeizuführen versucht. Es ist ganz selbstverständlich,daß kein solches Angebot ein Elaborat darstellen kann,welches in allen Details akzeptabel erscheint. Wäre dies der Fall,dann wären die Verhandlungen überhaupt überflüssig, dann könnte jader Friede durch eine einfache Annahme, durch ein einfaches Ja undAmen abgeschlossen werden. Das ist natürlich nicht der Fall.Aber ich nehme keinen Anstand, zu erklären, daß ich in den letzten Vorschlägendes Präsidenten Wilson eine bedeutende Annäherung anden österreichisch-ungarischen Standpunkt finde, und daß sichunter seinen Vorschlägen einzelne befinden, welchen wir sogar mit großerFreude zustimmen können.Wenn es mir nunmehr gestattet ist, auf diese Vorschläge des genauereneinzugehen, so muß ich zwei Dinge vorausschicken:Soweit sich die Vorschläge auf unsere Verbündeten beziehen — esist von dem deutschen Besitz von Belgien und von dem TürkischenReiche darin die Rede — , erkläre ich, daß ich, getreu den übernommenenBundespflichten, für die Verteidigung der Bundesgenossen bis zum äußerstenzu gehen fest entschlossen bin. Den vor kriegerischen Besitzstandunserer Bundesgenossen werden wir verteidigen wieden eigenen. Das ist der Standpunkt innerhalb der vier Alliierten beivollständiger Reziprozität.Zweitens habe ich zu bemerken, daß ich die Ratschläge, wie wir beiuns im Innern zu regieren haben, höflich, aber entschieden ablehne.Wir haben in Österreich ein Parlament des allgemeinen, gleichen, direktenund geheimen Wahlrechtes. Es gibt kein demokratischeres Parlament aufder Welt, und dieses Parlament zusammen mit den übrigen verfassungsmäßigberechtigten Faktoren allein hat das Recht, über interne AngelegenheitenÖsterreichs zu entscheiden. Ich spreche nur von Österreich, weilich in der österreichischen Delegation nicht über interne Angelegenheitendes ungarischen Staates spreche. Ich würde das nicht für verfassungsmäßighalten. Wir mischen uns auch nicht in amerikanische Dinge, aberwir wünschen ebensowenig eine ausländische Vormundschaft irgendeinesanderen Staates. Dies vorausgeschickt, erlaube ich mir, auf die nocherübrigenden Punkte folgendes zu erwidern:402
AnhangDie Antwort auf Wilsons VorschlägeZu dem Punkte, welcher von der Abschaffung der ,Geheimdiplomatie'und vollkommenen Offenheit der Verhandlungen spricht, habe ich nichtszu bemerken. Ich habe, soweit von öffentlicher Verhandlung dieRede ist, von meinem Standpunkte aus gegen eine solche Methode, soweitsie auf voller Reziprozität beruht, nichts einzuwenden, wenn ich auchlebhaften Zweifel hege, ob sie unter allen Umständen der praktischsteund schnellste Weg ist, zu einem Ergebnisse zu gelangen. DiplomatischeVerträge sind nichts anderes als Geschäfte. Nun kann ich mir leicht Fälledenken, wobei beispielsweise zwischen Staaten handelspolitische Abmachungenzu treffen wären, ohne daß es wünschenswert wäre, das nochunfertige Ergebnis der ganzen Welt im vorhinein mitzuteilen. Bei solchenVerhandlungen beginnen naturgemäß beide Teile damit, daß sie ihreWünsche möglichst hochschrauben, um nach- und nach den einen undden anderen Wunsch als Kompensation zu verwerten, bis endlich jenesGleichgewicht der gegenseitigen Interessen vorhanden ist, welcheserreicht werden muß, damit der Abschluß eines Vertrages möglich sei.Sollten solche Verhandlungen vor der großen Öffentlichkeit geführt werden,so läßt es sich nicht vermeiden, daß die Öffentlichkeit für jeden einzelnendieser Wünsche leidenschaftlich Stellung nimmt, worauf dann jeder Verzichtauf einen solchen Wunsch, selbst wenn er nur aus taktischen Gründengeäußert wurde, als eine Niederlage betrachtet würde. Wenn sich dieÖffentlichkeit für einen solchen Wunsch besonders stark exponiert, kanndadurch das Zustandekommen eines Vertrages unmögüch werden, oderder Vertrag wird, wenn er doch zustande kommt, als eine Niederlageempfunden werden, vielleicht auf beiden Seiten. Dadurch würde aber dasfriedliche Beisammenleben nicht gefördert, sondern im Gegenteil eine Vermehrungder Reibungen zwischen den Staaten bewirkt werden. Was aberfür Handelsverträge gilt, gilt auch für politische Abmachungen, die japolitische Geschäfte behandeln.Wenn mit der Abschaffung der Geheimdiplomatie gemeint ist, daß eskeine Geheimverträge geben sollte, daß Verträge ohne Wissen derÖffentlichkeit nicht bestehen können, so habe ich nichts dagegen einzuwenden,daß dieses Prinzip verwirklicht werde. Wie die Durchführungdieses Prinzips und seine Überwachung gedacht sind, weiß ich allerdingsnicht. Wenn die Regierungen zweier Staaten einig sind, werden sie immereine geheime Abmachung schließen können, ohne daß jemand etwas davonerfährt. Aber das sind Nebensachen. Ich klebe nicht an Formeln,und an einer mehr oder weniger formalen Frage wird von mir aus niemalsein vernünftiges Arrangement scheitern.Also über Punkt i läßt sich sprechen.Punkt 2 betrifft die Freiheit der Meere. Der Herr Präsident hatbei diesem Postulate allen aus dem Herzen gesprochen, und ich unterschreibediesen Wunsch Amerikas voll und ganz, insbesondere deshalb,weil der Herr Präsident die Klausel hinzufügt: ,Outside territorial waters',d. h. also die Freiheit des offenen Meeres, aber natürlich kein Gewalteingriffin die diesbezüglichen Hoheitsrechte unseres treuen türkischenBundesgenossen. Ihr Standpunkt in dieser Frage wird der unsere sein.Punkt 3, welcher sich definitiv gegen einen zukünftigen Wirtschaftskriegausspricht, ist so richtig, so vernünftig, so von uns verlangtworden, daß ich dem ebenfalls nichts hinzuzufügen habe.Punkt 4, welcher die allgemeine Abrüstung verlangt, erklärt in einer26*^Oß
Anhangbesonders guten, klaren Stilisierung die Notwendigkeit, die freie Rüstungskonkurrenznach diesem Kriege auf jenes Maß herunterzudrücken,welches die interne Sicherheit der Staaten erfordert. Herr Wilson sprichtdies klipp und klar aus. Ich habe mir gestattet, den gleichen Gedankenvor einigen Monaten in meiner Budapester Rede zu entwickeln, er bildeteinen Teil meines politischen Glaubensbekenntnisses, und einejede Stimme, welche sich in gleichem Sinne erhebt, begrüße ichdankbarst.Was den russischen Passus anbelangt, so beweisen wir bereits mitTaten, daß wir bestrebt sind, ein freundnachbarliches Verhältnis zu schaffen.Was Italien, Serbien, Rumänien und Montenegro betrifft, sokann ich nur den Standpunkt wiederholen, den ich bereits in der ungarischenDelegation zum Ausdruck gebracht habe.Ich weigere mich, als Assekuranz für feindliche Kriegsabenteuer zufigurieren.Ich weigere mich, unseren Feinden, welche hartnäckig auf dem Standpunkte,des Kampfes bis zum Endsiege' bleiben, einseitig Konzessionenzu machen, welche der Monarchie dauernd präjudizieren und den Feindenden unermeßlichen Vorteil geben, den Krieg relativ ohne Risiko ins Endloseweiterschleppen zu können.Möge Herr Wilson den großen Einfluß, den er zweifellos auf alle seineBundesgenossen ausübt, dazu benutzen, daß sie ihrerseits die Bedingungenerklären, unter denen sie zu sprechen bereit sind, so wird er sich das unermeßlicheVerdienst erworben haben, die allgemeinen Friedensverhandlungenins Leben gesetzt zu haben. Ebenso offen und ebenso frei wieich hier Herrn Wilson antworte, werde ich mit allen jenen sprechen, welcheauch selbst sprechen wollen, aber es ist ganz selbstverständlich, daß dieZeit und die Fortdauer des Krieges nicht ohne Einfluß auf die diesbezüglichenVerhältnisse bleiben können.Ich habe dies auch schon einmal gesagt, Italien ist hierfür ein sprechendesBeispiel. Italien hat vor dem Kriege die Gelegenheit gehabt, ohneeinen Schuß abzutun, einen großen territorialen Erwerb zu machen. Eshat dies abgelehnt, es ist in diesen Krieg eingetreten, es hat Hunderttausendevon Toten, Milliarden an Kriegskosten und zerstörten Wertenverloren, es hat Not und Elend über die eigene Bevölkerung gebracht.Und dieses alles nur, um einen Vorteil, den es einmal haben konnte, fürimmer zu verlieren.Was schließlich den Punkt 13 anbelangt, so ist es ein offenes Geheimnis,daß wir Anhänger des Gedankens sind, es möge ,ein unabhängigerpolnischer Staat, der die zweifellos von polnischer Bevölkerung bewohntenGebiete einschließen müßte', errichtet werden. Auch über diesenPunkt würden wir uns, so glaube ich, mit Herrn Wilson bald einigen.Und wenn der Präsident seine Vorschläge durch den Gedanken eines allgemeinenVölkerbundes krönt, so wird er wohl nirgends in einer österreichisch-ungarischenMonarchie dabei auf Widerstand stoßen.Wie sich aus dieser Vergleichung meiner Ansichten und jener HerrnWilsons ergibt, stimmen wir nicht nur in den großen Prinzipien, nachdenen die Welt mit Abschluß des Krieges neugeordnet werden soll, imwesentlichen überein, sondern unsere Auffassungen nähern sich auch inmehreren konkreten Friedensfragen. Die Differenzen, w r elche übrigbleiben, scheinen mir nicht so groß zu sein, daß eine Aussprache überdiese Punkte nicht zur Klärung und Annäherung führen könnte.Diese Situation, welche sich wohl daraus ergibt, daß Österreich-Ungarn404
Anhangeinerseits und die Vereinigten Staaten von Amerika andererseits jeneGroßmächte unter den beiden feindlichen Staatengruppen sind, derenInteressen aneinander am wenigsten widerstreiten, legt die Erwägungnahe, ob nicht gerade ein Gedankenaustausch zwischen diesenbeiden Mächten den Ausgangspunkt für eine versöhnliche Aussprachezwischen allen jenen Staaten bilden könnte, die noch nicht in Besprechungenüber den Frieden eingetreten sind. So viel über die Vorschläge Wilsons.Petersburg und dieUkraineUnd nun, meine Herren, eile ich zum Schluß. Aber dieser Schluß istvielleicht das Wichtigste, was ich überhaupt zu sagen habe. Ich arbeitean dem Frieden mit der Ukraine und Petersburg.Der Friede mit Petersburg ändert an unserer definitiven Lage garnichts. Nirgends stehen österreichisch-ungarische Truppen gegen die derPetersburger Regierung — wir haben die ukrainischen gegen uns — undexportieren kann man von Petersburg auch nichts, weil es selbst nichtshat als die Revolution und die Anarchie. Ein Exportartikel, den dieBolschewiki vielleicht gerne exportieren möchten, dessen Annahme ichaber höflichst ablehne. Trotzdem wül ich auch einen Frieden mit Petersburg,weil er uns dem allgemeinen Frieden näherbringt wie jeder Friedensschluß.Anders steht die Sache mit der Ukraine. Denn die Ukraine hat Vorrätean Lebensmitteln, die sie exportieren wird, wenn wir handelseins werden.Die Nahrungsfrage ist heute eine Geldsorge. Überall, bei unseren Gegnern,aber auch in den neutralen Staaten spielt sie eine hervorragende Rolle.Ich will den Friedensschluß mit jenen russischen Reichen, welche einExportquantum an Nahrungsmitteln besitzen, benutzen, um unsererBevölkerung zu helfen. Wir können und wir werden auch durchhaltenohne diesen Zuschuß. Aber ich, kenne meine Pflicht, und meinePflicht gebietet es mir, alles zu versuchen, um der notleidenden Bevölkerungdie Entbehrungen, die sie tragen muß, zu erleichtern, und darumwerde ich nicht aus irgendeiner hysterischen Nervosität heraus, um denFrieden ein paar Tage oder ein paar Wochen früher zu bringen, auf diesenVorteil für unsere Bevölkerung verzichten. Ein solcher Friede brauchtseine Zeit, über Nacht läßt sich das nicht machen. Denn es muß beieinem Friedensschlüsse festgestellt werden, ob, was und wie der russischeKompaziszent liefern wird, dies deshalb, weil die Ukraine ihrerseitsnicht nach, sondern bei dem Friedensschlüsse das Geschäft abzuschließenwünscht.Ich habe Ihnen bereits gesagt, daß die ungeklärten Verhältnissein diesen neuentstandenen Reichen eine große Erschwerung und einenaturgemäße Verzögerung der Verhandlungen involvieren.Appell an das HinterlandWenn Sie mir in den Rücken fallen, wenn Sie mich zwingen, Hals überKopf abzuschließen, dann werden wir keine wirtschaftlichen Vorteile haben,und dann muß eben unsere Bevölkerung auf den Vorteil, den sie aus demFriedensschlüsse haben könnte, verzichten.Wenn ein Arzt eine schwierige Operation ausführen muß, und hinterihm stehen Leute mit der Uhr in der Hand und zwingen ihn, die Operationin wenigen Minuten zu beenden, dann wird vielleicht die Operation mit405
Anhangeinem Zeitrekord abschließen, aber der Kranke wird sich nachher für dieArt der Ausführung bedanken.Wenn Sie bei unseren heutigen Gegnern den grundfalschen Eindruckerwecken, daß wir um jeden Preis und sofort abschließen müssen, bekommen wir keinen Meterzentner Getreide, und der Erfolg wird mehroder weniger ein platonischer sein. Es handelt sich gar nicht mehr inerster Linie um die Beendigung des Krieges an der ukrainischen Front,weder wir noch die Ukrainer haben die Absicht, den Krieg fortzusetzen,nachdem wir uns auf der annexionslosen Basis geeinigt haben. Es handeltsich — ich wiederhole es zum zehnten Male — nicht um imperialistische',nicht um annexionistische Pläne und Absichten, es handelt sich darum,unserer Bevölkerung endlich die verdiente Belohnung für standhaftesDurchhalten zu sichern und ihr jene Nahrungsmittel zuzuführen, die siegerne annehmen wird. Unsere Partner sind gute Rechner und beobachtengenau, ob ich durch Sie in eine Zwangslage versetzt werde oder nicht.Wenn Sie sich den Frieden verderben wollen, wenn Sie auf einenmich durch Reden,Getreidezuschub verzichten wollen, dann ist es logisch,durch Beschlüsse, durch Streik und Demonstrationen zu drängen, sonstnicht. Und es ist tausendmal nicht "wahr, daß wir in einer Lage sind,in der wir lieber heute einen schlechten Frieden ohne wirtschaftlicheVorteile als morgen einen guten mit wirtschaftlichen Vorteilen schließenmüßten.Die Nahrungsschwierigkeiten entsprechen in letzter Instanz nicht demMangel an Nahrungsmitteln, es sind Kohlen-, Transport- und Organisationskrisen,die behoben werden müssen. Wenn Sie im HinterlandeStreiks arrangieren, so bewegen Sie sich in einem Circulus vitiosus;die Streiks erhöhen und verschärfen die erwähnten Krisen und erschwerendie Zufuhr von Nahrungsmitteln und von Kohlen. Sie schneiden sichdamit in das eigene Fleisch, und alle die, die glauben, daß solche Mittelden Frieden beschleunigen, begehen einen furchtbaren Irrtum.Es sollen in der Monarchie Männer das Gerücht aussprengen, daß dieRegierung den Streiks nicht fernstehe. Ich überlasse diesen Leuten dieWahl, ob sie als verbrecherische Verleumder oder als Narren gelten wollen.Wenn Sie eine Regierung hätten, die einen anderen Frieden will alsden des erdrückenden Teiles der ganzen Bevölkerung, wenn Sie eine Regierunghätten, die aus Eroberungsabsichten den Krieg verlängert, dannwäre ein Kampf des Hinterlandes gegen die Regierung von dessen Standpunkteaus selbstverständlich. Da die Regierung genau dasselbe will wiedie Majorität der Monarchie, d. h. die baldigste Erreichung des ehrenvollenFriedens ohne annexionistische Ziele, so ist es ein Wahnsinn,ihr in den Rücken zu fallen, sie zu hemmen und sie zu stören. Die,die das machen, kämpfen nicht gegen die Regierung; sie kämpfen wiedie Blinden gegen die Völker, denen sie angeblich helfen wollen, und gegensich selbst.Sie, meine Herren, Sie haben nicht nur das Recht, Sie haben die Pflichtzu folgender Alternative: Entweder Sie haben das Vertrauen zu mir, dieFriedensverhandlungen weiterzuführen, dann müssen Sie mir helfen,oder Sie haben es nicht, dann müssen Sie mich stürzen. Ich binsicher, die Majorität der ungarischen Delegation hinter mir zu haben.Der ungarische Ausschuß hat mir das Vertrauen votiert. Wenn das gleichehier zweifelhaft ist, dann stellen Sie die Sache klar. Es soll die Vertrauensfragevorgelegt werden, und wenn ich die Majorität gegen mich habe,so werde ich sofort daraus die Konsequenzen ziehen. Die Freude aller406
Anhangderer, die mich von diesem Platze entfernen wollen, wird dann immernoch weit geringer sein als meine eigene. Mich hält nichts an diesemPlatze als das Pflichtgefühl, so lange zu bleiben, als ich das Vertrauen desKaisers und der Majorität der Delegationen habe. Ein anständigerSoldat desertiert nicht. Kein Minister des Äußern aber kann Verhandlungenvon dieser Tragweite führen, wenn er nicht weiß, wenn nichtalle Welt weiß, daß er durch das Vertrauen der Majorität der verfassungsmäßigenKorporationen getragen ist. Es geht ums Ganze. Sie habenVertrauen oder Sie haben es nicht. Sie müssen mir helfen oder mich stürzen;ein Drittes gibt es nicht. Ich bin zu Ende."Protokoll über die Friedensverhandlungen inV.Brest>Litowsk„Die österreichisch-ungarische Regierung ging mit der Absicht zu denFriedensverhandlungen nach Brest-Litowsk, dort so rasch als möglich zueinem Friedensvertrage zu gelangen, der, wenn er entgegen unserer Absichtnicht zum allgemeinen Frieden führen sollte, doch wenigstens nachdem Osten hin geordnete Verhältnisse zu schaffen hätte. Es wurde auchder Entwurf zu einem Präliminarfrieden nach Brest mitgenommen, derfolgende Punkte enthielt:i. Einstellung der Feindseligkeiten; wenn es nicht zum allgemeinenFrieden kommen sollte, gewährt keiner der vertragschließenden Teile denFeinden des anderen Teiles irgendwelche Unterstützung;2. keine Gebietsabtretung; Polen, Kurland und Livland erhalten dasRecht, ihr künftiges Schicksal selbst zu bestimmen;3. keine Entschädigung für Kriegskosten und für Schäden, die durchmilitärische Operationen verursacht sind;4. Einstellung des Wirtschaftskrieges und Gutmachung der durch denWirtschaftskrieg verursachten Schäden von Privatpersonen;5. Aufnahme des Handelsverkehres, und zwar provisorisch auf Grunddes alten Handelsvertrages, und zwanzigjährige Meistbegünstigung mit einerEinschränkung bezüglich der mit Nachbarländern etwa geschlossenen Zollbündnisse;6. gegenseitige Aushilfe in Rohstoffen und Industrieartikeln.In Aussicht genommen war ein weiterer Punkt über die Räumung derbesetzten Gebiete, dessen Formulierung jedoch bis nach Besprechung mitder Deutschen Obersten Heeresleitung aufgeschoben wurde, mit der wegender Vermischung deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen an derrussischen Front das Einvernehmen hergestellt werden mußte. Das Armee-Oberkommando hatte für die Räumung eine Frist von mindestens sechsMonaten als notwendig bezeichnet.Bei Besprechung dieses Entwurfes mit den deutschen Unterhändlernergaben sich besonders in zwei Punkten große Schwierigkeiten. Die einebetraf die Räumungsfrage. Die deutsche Heeresleitung erklärte kategorisch,daß sie einer Räumung der besetzten Gebiete vor Abschluß desallgemeinen Friedens unter keinen Umständen zustimmen könne.Der zweite Gegensatz tauchte in der Frage der Behandlung der besetztenGebiete auf. Deutschland bestand nämlich darauf, es solle im Friedensvertragemit Rußland bloß festgestellt werden, daß Rußland den407
Anhan»Völkerschaften auf seinen Gebieten das Selbstbestimmungsrecht gewährthabe, und daß diese Nationen von diesem Rechte bereits Gebrauch gemachthaben. Den in unserem Entwurf eingenommenen klaren Standpunkt vermochtenwir nicht durchzusetzen, obwohl dieser auch von den anderenVerbündeten geteilt wurde. <strong>Im</strong>merhin kam bei Redigierung der dannam 25. Dezember 19 16 auf die russischen Friedensvorschläge erteilten Antwortunter unserem beharrlichen Drängen eine Kompromißlösung zustande,die wenigstens vorerst den ablehnenden deutschen Standpunkt in diesenbeiden Fragen nicht zum Durchbruche kommen ließ. In der Frage derRäumung der besetzten Gebiete wurde deutscherseits das Zugeständnisgemacht, daß über die Zurückziehung einzelner Truppenteile eventuellschon vor dem allgemeinen Frieden Vereinbarungen getroffen werdenkönnten.In der Annexionsfrage konnte eine befriedigende Formulierung dadurcherzielt werden, daß sie nur auf den Fall des allgemeinen Friedens abgestelltwurde.Wäre damals die Entente zu einem allgemeinen Friedenbereit gewesen, so wäre das Prinzip ,keine Annexionen'vollkommen durchgedrungen.Obgleich diese von den Vierbundmächten auf die russischen Friedensvorschlägeerteilte Antwort den entgegenkommenden Auffassungen Rechnungtrug, die von unserer Seite zur Geltung gebracht wurden, war manim deutschen Hauptquartier über die abgegebenen Erklärungen äußerstungehalten. Verschiedene äußerst scharf gehaltene Telegramme der DeutschenObersten Heeresleitung an die deutschen Unterhändler bewiesendies. Der Leiter der deutschen Friedensdelegation geriet dadurch in Gefahr,gestürzt zu werden, in welchem Falle wahrscheinlich ein ausgesprochenerExponent der schärfsten militärischen Auffassungen die Leitung derdeutschen auswärtigen Politik in die Hände bekommen hätte. Da diesaber auf den weiteren Gang der Friedensverhandlungen nur eine ungünstigeWirkung ausüben konnte, mußte unsererseits alles aufgeboten werden,Herrn von Kühlmann zu halten. Zu diesem Zwecke wurde ihm zur Weitergabenach Berlin mitgeteilt, daß, wenn Deutschland bei seiner scharfenPolitik beharren würde, Österreich-Ungarn sich veranlaßt sehen würde,mit Rußland einen Separatfrieden abzuschließen. Diese Erklärung desMinisters des Äußern ist in Berlin nicht ohne Eindruck geblieben undhat wesentlich dazu beigetragen, daß Kühlmann sich damals behauptenkonnte.Diese schwierige Situation Kühlmanns und dessen Wunsch, seine Stellungwieder zu festigen, machte die Behandlung der Territorial fragen, die am27. Dezember zum erstenmal offiziell zur Sprache kamen, die aber schonfrüher in Privatunterredungen mit den russischen Delegierten erörtertworden waren, besonders heikel. Deutscherseits bestand man darauf, daßdie damalige russische Front erst ein halbes Jahr nach Abschluß des allgemeinenFriedens geräumt werde. Russischerseits war man bereit, diesanzunehmen, verlangte aber andererseits, daß über das Schicksal Polenserst nach erfolgter Räumung entschieden werde, und zwar im Wege desPlebiszits. Demgegenüber war man auf deutscher Seite geneigt, von demursprünglichen Standpunkte, daß nämlich die Bevölkerung der besetztenGebiete von dem ihr eingeräumten Selbstbestimmungsrechte bereits Gebrauchgemacht habe, abzugehen und eine neue Befragung der Bevölkerungzuzulassen, bestand jedoch darauf, daß diese Befragung noch währendder Besetzung der Gebiete stattfinden solle. In dieser Frage konnte einAusweg nicht gefunden werden, obwohl von österreichisch-ungarischer408
AnhangSeite wiederholt vermittelnd eingegriffen wurde. In diesem Stadium befandensich die Verhandlungen, als sie am 29. Dezember zum erstenmalunterbrochen wurden.Bei Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen am 6. Januar war dieLage wenig verändert. Die Stellung Kühlmanns hatte sich allerdingseinigermaßen gefestigt, doch nur um den Preis eines Entgegenkommensan den Standpunkt der deutschen militärischen Kreise. Unter diesenVerhältnissen führten die Verhandlungen, an denen auf russischer Seitenunmehr als Wortführer Trotzki teilnahm, zu durchaus unfruchtbaren,theoretischen Diskussionen über die Territorialfragen und das Recht derSelbstbestimmung, die keine Annäherung der beiderseits starr festgehaltenenStandpunkte bewirken konnten. Um die Verhandlungen über den totenPunkt hinwegzubringen, war man österreichischerseits fortgesetzt bemüht,ein Kompromiß zwischen dem deutschen und dem russischen Standpunktherbeizuführen, dies um so mehr, als es uns im allgemeinen und speziellauch wegen Polens durchaus erwünscht gewesen wäre, die Territorialfragenauf Grund des vollständigen Selbstbestimmungsrechtes zu lösen. UnsereVorschläge an die deutschen Unterhändler gingen dahin, dem russischenStandpunkt in der Weise entgegenzukommen, daß das von den Russenverlangte Plebiszit zwar, wie es deutscherseits verlangt wurde, noch währendder Besetzung der okkupierten Gebiete stattfinden, aber mit weitgehendenBürgschaften für die Freiheit der Willensäußerung der Völker ausgestattetwerden solle. Hierüber fanden mit den deutschen Unterhändlern wiederholtelangwierige Verhandlungen statt, denen von uns detailliert ausgearbeiteteEntwürfe zugrunde lagen.Diesen unseren Bemühungen blieb jedoch diesmal der Erfolg ganz versagt.Ereignisse, die sich in diesen Tagen in unserem Hinterlande abspielten,bilden die Gründe hierfür, ebenso wie für den Verlauf der inzwischeneingeleiteten Verhandlungen mit der ukrainischen Delegation.Diese hatte in der ersten Besprechung unter Ablehnung jeder Auseinandersetzungmit polnischen Vertretern die Zuerkennungdes ganzen Cholmer Landes und etwas verblümter die AbtretungOstgaliziens sowie der ukrainischen Gebiete nordöstlichUngarns verlangt, so daß die Verhandlungen knapp vor demAbbruche standen. In diesem Augenblicke brach in Österreich eine bisdahin dem Ministerium des Äußern in dieser Schärfe nicht bekannte Ernährungskriseaus, welche speziell Wien in Gefahr brachte, binnen wenigenTagen ohne Mehl dazustehen.Fast unmittelbar darauf setzte eine Streikbewegungein, welche bedrohlichen Charakter hatte. Diese Vorgänge imHinterlande der Monarchie schwächten die Stellung des Ministers desÄußern sowohl gegenüber dem deutschen Bundesgenossen als auch gegenüberden Verhandlungsgegnern — die er damals beide zu bekämpfen hatte —gerade im kritischsten Augenbücke in einem Maße, das aus der Entfernungkaum richtig abgeschätzt werden konnte. Von Deutschland, auf das ereinen Druck ausüben sollte, hatte der Minister des Äußern dringendstLebensmittelaushilfen nicht anzusprechen, sondern zu erbitten, sollteWien nicht in wenigen Tagen vor einer Ernährungskatastrophe stehen.Mit den Feinden aber mußte er im Hinblick auf die Situation im Hinterlandezu einem Frieden gelangen, der trotz der den Gegnern nicht verborgengebliebenen Ernährungskrise und Streikbewegung ein günstigersein sollte.Diese vollkommen veränderte Situation verschob die Grundlagen derVerhandlungsziele und Taktik des Ministers des Äußern. Er mußte von409
AnhangDeutschland die verlangte Getreideaushilfe erlangen und daher den politischenDruck auf dieses verringern, andererseits aber die Sowjetdelegiertenzur Fortsetzung der Verhandlungen veranlassen und schließüch sehen,unter möglichst akzeptablen Bedingungen auch mit der Ukraine zu einemFrieden zu gelangen, der — wenn möglich — den stets dringenderwerdenden Ernährungssorgen ein Ende bereiten würde.Unter diesen Verhältnissen konnte in diesem Zeitpunkte den deutschenUnterhändlern gegenüber der Gedanke nicht mehr ausgespielt werden,daß Österreich-Ungarn gegebenenfalls mit Rußland einen Separatfriedenschließen würde, wollte man nicht die deutsche Lebensmittelaushilfe gefährden— dies um so weniger, als der Vertreter der Deutschen OberstenHeeresleitung damals erklärte, es sei gleichgültig, obÖsterreich - Ungarn Frieden mache oder nicht; Deutschlandwerde unter allen Umständen nach Petersburg marschieren,falls die russische Regierung nicht nachgebe. Auf der anderen Seite bewogaber der Minister des Äußern den Führer der russischen Delegation, dieAusführung der von ihm kundgegebenen Absicht seiner Regierung inSchwebe zu lassen, welche dahin ging, die russischen Delegierten wegenmangelnder Aufrichtigkeit auf deutsch-österreichisch-ungarischer Seite abzuberufen.Gleichzeitig wurden die Verhandlungen mit der ukrainischen Delegationfortgesetzt. In langwierigen, mühevollen Konferenzen gelang es, derenForderungen auf ein äußerstenfalls mögliches Maß zu bringen und alsGegenleistung die Verpflichtung der Ukraine zur Lieferung von wenigstensi ooo ooo Tonnen Getreide bis August 191 8 zu erwirken. Von derForderung nach dem Cholmer Lande, die wir auf den Weg der Verhandlungenmit Polen gewiesen wissen wollten, waren die ukrainischen Bevollmächtigtennicht abzubringen, wobei sie offensichtlich die Unterstützungdes Generals Hoffmann besaßen. Überhaupt war manvon deutscher militärischer Seite den ukrainischen Forderungen sehrgeneigt, polnischen Ansprüchen gegenüber jedoch durchaus ablehnend,so daß wir die von uns wiederholt begehrte Zuziehung polnischer Vertreterzu den Verhandlungen nicht zu erreichen vermochten, dies um soweniger, als auch Trotzki sich weigerte, dieselben als gleichberechtigteKompaziszenten anzuerkennen. Das einzig erzielbare Ergebnis war, daßdie Ukrainer ihre Ansprüche auf Cholmland auf die von einer ukrainischenMajorität bewohnten Gebiete einschränkten und eine Korrektur der nurallgemein festgesetzten Grenzlinie durch eine gemischte Kommission unddie Wünsche der Bevölkerung zugestanden, also das Prinzip der nationalenAbgrenzung unter internationalem Schutze akzeptierten. Auf territorialeAnsprüche gegenüber der Monarchie leisteten die ukrainischen DelegiertenVerzicht, verlangten aber demgegenüber Sicherstellung der autonomenEntwicklung ihrer Konnationalen in Galizien. Zu diesen beiden schwerwiegendenKonzessionen erklärte sich der Minister des Äußern nur unterder Voraussetzung bereit, daß die Ukraine die von ihr übernommenePflicht zur Lieferung von Getreide termingemäß erfülle, und verlangtedie gegenseitige Bindung dieser Leistungen und Gegenleistungen derart,daß bei Nichterfüllung der einen die Gegenverpflichtung erlöschen sollte.Die Formulierung dieser Punkte, welche ukrainischerseits auf die größtenSchwierigkeiten stieß, wurde auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben.In diesem Stadium der Verhandlungen trat nun eine neue Pause ein,um den einzelnen Delegationen Gelegenheit zu bieten, ihren Regierungenüber die bisherigen Ergebnisse zu berichten und deren endgültige Weisungen4IO
Anhangeinzuholen. Der Minister des Äußern begab sich nach Wien und legteallen maßgebenden Stellen den Stand der Verhandlungen dar. Bei diesenBeratungen wurde seiner Politik, mit Rußland und mit der Ukraineauf Grund der in Aussicht genommenen Zugeständnisse zu einem Friedenzu gelangen, zugestimmt. Bei diesen Beratungen wurde auch die Fragebehandelt, ob die Monarchie äußerstenfalls mit Rußland einen Separatfriedenschließen sollte, wenn die Verhandlungen mit diesem Staate anden deutschen Forderungen scheitern sollten. Diese Frage wurde damalsin voller Erkenntnis aller dagegen sprechenden Gründe in thesi bejaht,da die Verhältnisse im Hinterlande der Monarchie keine andere Lösungzuzulassen schienen.Bei Wiederaufnahme der Verhandlungen in Brest-Litowsk wurde nochder Versuch erneuert, Deutschland unter Hinweis auf die Konsequenzenseiner starren Haltung zur Nachgiebigkeit zu bewegen. In den Besprechungen,die hierüber mit Herrn von Kühlmann stattfanden, gelang es mitschwerer Mühe, die Zustimmung der deutschen Unterhändler zu einemletzten Kompromißversuche zu erlangen, den der Minister des Äußernunternehmen wollte. Dem Kompromißvorschlag lag folgender Gedankengangzugrunde:Seit Monaten wird darüber gestritten:i. ob in jenen Gebieten, in denen <strong>info</strong>lge des Krieges staatsrechtlicheVeränderungen eintreten sollten, das Selbstbestimmungsrecht bereits ausgeübtsei oder eine Volksbefragung erst stattzufinden habe;2. ob eine eventuelle Befragung sich an eine Konstituante oder inForm eines Referendums an das Volk direkt wenden solle;3. ob diese Befragung vor oder nach Evakuierung der besetzten Gebietevor sich gehen solle; und4. welcher Art sie zu organisieren wäre (allgemeines Wahlrecht, Kurienwahlrechtusw.). Es wäre ratsam und würde auch den von russischerSeite vertretenen Grundsätzen entsprechen, die Entscheidung über allediese Fragen den Völkern selbst zu überlassen und sie in jene .temporärenSelbstverwaltungsorgane' zu verlegen, die auch nach dem russischen Vorschlag(Kameneff) sofort eingesetzt werden sollen. Die ganze Erörterungin den Friedensverhandlungen konnte dann auf einen einzigen Punktkonzentriert werden : auf die Frage der Zusammensetzung dieser temporärenOrgane. Hier ließe sich aber ein Kompromiß finden, indem Rußland zugebenkönnte, daß auch die von Deutschland in den Vordergrund geschobenenschon bestehenden Organe befugt seien, einen Teil des Volkswillenszum Ausdrucke zu bringen, während Deutschland sich einverstandenerklären würde, daß diese Organe während der Dauer der Besetzungdurch Elemente ergänzt werden, die, dem russischen Standpunktentsprechend, aus freier Wahl hervorgehen würden.Am 7. Februar, unmittelbar nachdem die Zustimmung Herrn von Kühlmannszu einer Vermittlung auf dieser Grundlage vorlag, wandte sich derMinister des Äußern an den Führer der russischen Delegation, Trotzki,mit dem es zu einer Reihe von Konversationen kam. Der eben entwickelteKompromißgedanke fand bei Trotzki wenig Anklang, und er erklärte, daßer gegen eine Behandlung der Frage des Selbstbestimmungsrechtes durchdie Vierbundmächte jedenfalls Protest einlegen würde. Dagegen ist es indiesen Besprechungen gelungen, eine andere Grundlage für die Beseitigungder aufgetauchten Schwierigkeiten zu finden. Es sollte der Streit darübernicht länger fortgesetzt werden, ob die territorialen Veränderungen, dieder Friedensschluß mit sich bringen würde, als , Annexionen' zu bezeichnen411
Anhangseien, wie es die russischen Delegierten wollten, oder als , Ausübung desSelbstbestimmungsrechtes', wie es Deutschland wollte, sondern es solltendie betreffenden territorialen Veränderungen im Friedensvertrag einfachaufgezählt werden. (.Rußland nimmt zur Kenntnis, daß . . .') Trotzkiknüpfte jedoch seine Bereitwilligkeit zum Abschluß eines solchen Vertragesan zwei Bedingungen: Die eine war, daß die Moonsund-Inseln unddie Ostseehäfen bei Rußland belassen werden, die andere, daß Deutschlandund Österreich-Ungarn mit der ukrainischen Volksrepublik, derenRegierung damals von den Bolschewiken heftig bedroht und nach einzelnenNachrichten schon gestürzt war, keinen selbständigen Frieden schließen.Der Minister des Äußern war nun bemüht, auch in dieser Frage zu einemKompromiß zu gelangen, wobei er bis zu einem gewissen Grade die UnterstützungHerrn von Kühlmanns fand, während General Hoffmann sichauf das schärfste gegen jedes weitere Nachgeben wandte.Alle diese Kompromißverhandlungen scheiterten daran, daß Herr vonKühlmann von der Deutschen Obersten Heeresleitung zu einem raschenVorgehen gezwungen wurde. Ludendorff erklärte, die Verhandlungenmit Rußland müßten binnen drei Tagen zu Ende sein,und als in Berlin ein Telegramm aus Petersburg aufgefangen wurde, welchesdie deutsche Armee zu revolutionieren versuchte, erhielt Herr von Kühlmannden strikten Auftrag, sich nicht nur mit den bisher verlangtenAbtretungen zu begnügen, sondern dazu auch noch die Abtretungder unbesetzten Gebiete Livlands und Estlands zuverlangen. Unter diesem Druck hatte der Führer der deutschen Unterhändlernicht die Kraft, ein Kompromiß durchzusetzen. Es kam daherzur Unterzeichnung des inzwischen mühevoll zu Ende verhandelten Vertragesmit der Ukraine. Damit schienen die Bemühungen des Ministersdes Äußern eigentlich schon gescheitert. Dennoch setzte dieser seine Besprechungenmit Trotzki fort, die jedoch fruchtlos blieben, weil dieserihn trotz wiederholt an ihn gerichteter Fragen bis zum letzten Momentim unklaren darüber ließ, ob er unter den gegebenen Verhältnissen einenFrieden mit den Vierbundmächten überhaupt unterzeichnen werde odernicht. Erst die Plenarsitzung vom 10. Februar brachte Klarheit hierüber;Rußland stellte die Feindseligkeiten ein, schloß aber keinen Friedensvertrag.Die durch diese Erklärungen geschaffene Situation bot keinen Anlaß,den seinerzeit ventilierten Gedanken eines Separatfriedens mit Rußlandaufzunehmen, da der Friede via ficti einzutreten schien. Eine am Abenddes 10. Februar stattgefundene Besprechung der diplomatischen undmilit arischen Unterhändler Österreich-Ungarns und Deutschlands über dennunmehr einzuschlagenden Weg ergab, von einer einzigen Stimme abgesehen,Übereinstimmung dahin, daß der durch die Erklärungen Trotzkisgeschaffene Zustand akzeptiert werden müsse. Die einzig abweichendeStimme, jene des Generals Hoffmann, lautete dahin, daß die ErklärungTrotzkis mit der Kündigung des Waffenstillstandes und mit dem Vormarschgegen Petersburg, ferner mit der offenen Unterstützung der Ukrainegegen Rußland beantwortet werden müsse. Obgleich nun in der feierlichenSchlußsitzung am n. Februar Herr von Kühlmann sich den vonder Majorität der Friedensdelegationen vertretenen Standpunkt zu eigenmachte und in einer sehr eindrucksvollen Rede hervorhob, wurde dochwenige Tage darauf, so wie es General Hoffmann ausgeführt hatte, derWaffenstillstand von deutscher Seite gekündigt, der Vormarsch der deutschenTruppen gegen Rußland angeordnet und jene Situation geschaffen412
Anhangwelche dann zur Unterzeichnung des Friedensvertrages führte, österreichungarischerseitswurde erklärt, daß wir an dieser Aktion nicht mitbeteiligtseien."VI.Protokoll über die Friedensverhandlungen inBukarest„Mit der Möglichkeit, zu Friedensverhandlungen mit Rumänien zu gelangen,wurde schon damals gerechnet, als die Verhandlungen mit derrussischen Friedensdelegation in Brest-Litowsk ihren Anfang nahmen. Umzu verhindern, daß auch Rumänien sich diesen Verhandlungen anschließe,ließ man deutscherseits die rumänische Regierung wissen, daß man mitdem gegenwärtigen König und der gegenwärtigen Regierung nicht verhandelnwolle. Dieser Schritt hatte jedoch nur den Zweck, gesonderteVerhandlungen mit Rumänien zu ermöglichen, da Deutschland befürchtete,daß die Einbeziehung der Rumänen in die Brester Verhandlungen dieChancen des Friedens gefährden könnte. Daraufhin schien der GedankeRumäniens, den Krieg dennoch fortführen zu wollen, die Oberhand zugewinnen. Ende Januar wurde daher seitens Österreich-Ungarns dieInitiative ergriffen, um die Verhandlungen mit Rumänien zu ermöglichen.Der Kaiser schickte den früheren Militärattache bei der rumänischenRegierung, Oberst Randa, zu dem König von Rumänien und versicherteihn seiner Bereitwilligkeit, Rumänien einen ehrenvollen Frieden zu bewilligen.Von ungarischer Seite wurde im Zusammenhang mit den Friedensverhandlungender Wunsch nach Grenzrektifikationen, die eine Wiederholungdes 1916er Einfalles der Rumänen in Siebenbürgen verhindernoder wenigstens erschweren sollten, trotz des Widerspruches des Ministersdes Äußern kategorisch erhoben. Die vom Armee-Oberkommando, welchesübrigens friedensstörende Eingriffe unterließ, gezogene strategische Grenzeverlief in einer Linie, bei welcher Turn-Severin, Sinaia, Ocna und mehrerewertvolle Erdölgebiete in der Moldau an Ungarn abzutreten gewesen wären.In der ungarischen öffentlichen Meinung wurden noch weitergehendereWünsche vertreten. Die ungarische Regierung war der Ansicht, daß dasParlament einem Frieden, der in diesem Punkte den allgemeinen Wünschennicht entspricht, die größten Schwierigkeiten machen würde, und führendeungarische Staatsmänner, auch oppositionelle Parteien, erklärten die Grenzrektifikationenals eine Conditio sine qua non des Friedens. So vor allemWekerle und Tisza. Trotz dieser entschiedenen Stellungnahme nahm dasMinisterium des Äußern in vollem Einvernehmen mit dem Kaiser nochvor Beginn der Verhandlungen, Mitte Februar, den Standpunkt ein, daßdie Grenzforderung kein Hindernis für den Friedensschluß sein dürfte.Die Grenzrektifikationen sollten daher nur insofern ernstlich vertretenwerden, als dies auf Grund einer loyalen, ein künftiges freundschaftlichesVerhältnis zu Rumänien nicht ausschließenden Verständigung mit Rumäniengeschehen könne.Ungarn betrachtete diese nachgiebige Haltung des Ministeriums desÄußern mit steigendem Mißfallen. Es wurde von uns darauf hingewiesen,daß eine Grenzlinie, bei welcher Städte und Erdölgebiete an Ungarn fallenwürden, in jeder Hinsicht verfehlt wäre. Innerpolitisch, weil dadurch dieZahl der Nichtungarn vermehrt wurde, militärisch, weil dadurch in dem413
Anhangan die Moldau grenzenden Teile Ungarns ein Grenzstreifen mit unzuverlässigerrumänischer Bevölkerung entstehen 'würde, und endlich vom Standpunkteder auswärtigen Politik, weil es sich dabei um Annexionen undum ein Hin- und Herschieben von Völkern handelt und weil dadurchüberdies jedes freundschaftliche Verhältnis zu Rumänien zur Unmöglichkeitwurde. An der ursprünglich ins Auge gefaßten Grenzlinie mußte trotzdemnoch eine Zeit festgehalten werden, weil die Frage zur Herbeiführungeines den Mittelmächten freundlicheren Regimes in Rumänien ausgenutztwerden sollte. Der Minister des Äußern suchte besonders dahin zu wirken,daß ein Kabinett Marghüomann zustande komme, welches eine uns freundlichePolitik inaugurieren sollte. Er glaubte, daß mit einem solchen Kabinettein Verständigungsfriede leichter zustande kommen werde, und war auchentschlossen, einen solchen Frieden durch weitgehende Zugeständnisse zuermöglichen, vor allem auch dadurch, daß er ihm seine diplomatischeUnterstützung in der bessarabischen Frage zusicherte.Er erklärte Marghüomannund gab ihm dies auch schriftlich, daß er einem Kabinett, an dessenSpitze er treten würde, weitgehende Zugeständnisse machen und insbesondereauf die Abtretung bevölkerter Plätze, wie Turn-Severin undOcna, verzichten würde. Als das Kabinett Marghüomann zustandekam,wurden dann auch die Grenzforderungen Österreich-Ungarns trotz deslebhaften Widerspruches der ungarischen Regierung um etwas mehr alsdie Hälfte reduziert. Die Unterhandlungen mit Rumänien spitzten sichbesonders in der Frage der Orte Azuga und Busteni sowie in der Fragedes Lotrugebietes zu. Am 24. März bereitete Graf Czernin diesen Verhandlungenein Ende, indem er erklärte, er sei bereit, auf Azuga undBusteni vollständig und daneben auch auf die Hälfte des strittigen Lotrugebieteszu verzichten, wenn Marghüomann bereit wäre, die Grenzfrageauf dieser Grundlage zu regeln. Marghüomann erklärte sich mit diesemKompromiß einverstanden. Am nächsten Tage wurde dasselbe jedochvon der ungarischen Regierung abgelehnt, und erst nach neuerlicher telegraphischerBerührung mit dem Kaiser und Wekerle konnte die Zustimmungaller kompetenten Faktoren zu dem Kompromiß erlangt werden,das übrigens in Ungarn von weiten Kreisen als unzulänglich betrachtetwurde.Eine zweite Forderung Österreich-Ungarns, die in den Bukarester Verhandlungeneine gewisse Rolle spielte, bezog sich auf den Plan, ein Wirtschaftsbündniszwischen Österreich-Ungarn und Rumänien abzuschließen.Für diese Forderung interessierte sich besonders die österreichische Regierung,welche für die Grenzforderungen, obgleich sie teilweise auch Österreichzugute kamen, kein Interesse hatte, sich im Gegenteil eher ablehnendzu ihnen verhielt. Der Plan eines solchen Wirtschaftsbündnisses stießjedoch in Ungarn auf Schwierigkeiten. Unmittelbar vor Beginn der BukaresterVerhandlungen wurde ein Versuch unternommen, diesen Widerstandder ungarischen Regierung zu überwinden und ihre Zustimmungdazu zu erlangen, daß wenigstens bedingungsweise, für den Fall der Verwirklichungdes geplanten Zollbündnisses mit Deutschland auch ein Wirtschaftsbündnismit Rumänien ins Auge gefaßt werde. Diese Zustimmungwar jedoch damals nicht zu erlangen. Die ungarische Regierung behieltes sich vor, zu der Frage später Stellung zu nehmen, und verständigteam 8. März ihre Vertreter in Bukarest, daß sie den Plan ablehnen müsse,weü das künftige wirtschaftliche Verhältnis zu Deutschland sich nochnicht überblicken lasse. Infolgedessen konnte diese Frage in den Friedensverhandlungenvorerst keine Rolle spielen, und man mußte sich damit4T4
Anhaügbegnügen, die maßgebenden rumänischen Persönlichkeiten lediglich privatzu sondieren, wie sie sich zu einem solchen Vorschlag verhalten würden.Die Anregung wurde auf rumänischer Seite im allgemeinen günstig aufgenommen,und man stellte sich auf den Standpunkt, daß ein solches Wirtschaftsbündnisim Interesse Rumäniens durchaus wünschenswert wäre.Infolgedessen wurde während der Pause, die nach der Paraphierung derFriedensabmachungen zu Ostern in den Verhandlungen eintrat, der Versuchwieder aufgenommen, den Widerstand der ungarischen Regierungzu überwinden, diese Verhandlungen waren jedoch noch im Zuge, als derMinister des Äußern von seinem Amte zurücktrat.Auf deutscher Seite wurde schon vor Beginn der Bukarester Verhandlungenin Aussicht genommen, Rumänien in den Friedensverhandlungen,besonders auf wirtschaftlichem Gebiete, eine Reihe von Verpflichtungenaufzuerlegen, die eine Art indirekter Kriegsentschädigung bilden sollten.Zunächst war beabsichtigt, die Okkupation der Walachei noch fünf bissechs Jahre nach dem allgemeinen Friedensschluß aufrechtzuerhalten.Dann sollte Rumänien seine Petroleumgebiete, seine Eisenbahnen, seineHafenplätze, seine Domänen deutschen Gesellschaften zu Eigentum abtretenund sich auch eine dauernde Kontrolle seiner Finanzen gefallenlassen, österreichisch-ungarischerseits wurden diese Forderungen von Anbeginnan bekämpft mit der Motivierung, daß mit einem wirtschaftlichso vollständig ausgeplünderten Rumänien freundschaftliche Beziehungenunmöglich sein werden, Österreich-Ungarn aber darauf angewiesen sei,mit Rumänien in guter Freundschaft zu leben. Besonders nachdrücklichund nicht ganz ohne Erfolg wurde dieser Standpunkt in einer am 5. Februarbei einer beim Reichskanzler stattgefundenen Konferenz vertreten. MitteFebruar wandte sich der Kaiser mit einer persönlichen Depesche an dendeutschen Kaiser, um vor diesen Plänen, die dem Abschluß eines Friedenshinderlich sein könnten, zu warnen. Den Rumänen wurden diese Forderungenerst in einem relativ späten Stadium der Verhandlungen, erstnach der Ernennung Marghilomanns, mitgeteilt. Bis dahin bildeten dieseFragen den Gegenstand unausgesetzter Erörterungen zwischen Deutschlandund Österreich-Ungarn. Letzteres war anhaltend bemüht, die ForderungenDeutschlands zu mildern, nicht nur im Interesse der Erreichungeines Verständigungsfriedens, sondern auch, weil ein Fußfassen Deutschlandsin Rumänien in dem ursprünglich beabsichtigten Umfang für dieösterreichisch-ungarischen wirtschaftlichen Interessen nachteilig gewesenwäre. Die Forderungen, die ursprünglich bezüglich der rumänischen Eisenbahnenund der Domänen ins Auge gefaßt waren, wurden denn auchdeutscherseits fallen gelassen, und auch der Plan einer Abtretung der rumänischenHafenplätze wurde in den Plan einer rumänisch-deutsch-österreichisch-ungarischenHafenbetriebsgesellschaft verwandelt, die übrigensschließlich nicht zustande kam. Auch in der Petroleumfrage wurde nichtmehr von einer Abtretung, sondern von einer neunzigjährigen Pacht derstaatlichen Erdölterrains und von der Errichtung einer unter deutscherLeitung stehenden Handelsmonopolgesellschaft für Erdöl gesprochen. Endlichwurde ein Wirtschaftsabkommen angebahnt, welches die landwirtschaftlichenProdukte Rumäniens für eine Reihe von Jahren den Zentralmächtensichern sollte. Die Idee einer ständigen Kontrolle Deutschlandsüber die rumänischen Finanzen wurde auf österreichisch-ungarischenWiderspruch ebenfalls fallen gelassen. Die Verhandlungen, die mit Marghilomannund seinen Vertretern über diese Fragen geführt wurden, zogensich stark in die Länge. Besonders große Differenzen gab es bei dem415
AnhangWirtschaftsabkommen in der Preisfrage ; diese konnten erst im letzten Augenblick,vor der am 28. März erfolgten Paraphierung des Vertrages, durchAnnahme des rumänischen Standpunktes beseitigt werden. In der Petroleumfrage,in welcher sich die Gegensätze besonders stark zuspitzten,einigte man sich schließlich gegenüber der ablehnenden Haltung der deutschenwirtschaftlichen Unterhändler einerseits und des rumänischen Ministersdes Äußern Arion andererseits auf eine Kompromißformel, wonach insbesondereüber die auf das Handelsmonopol bezüglichen Bestimmungendes Erdölabkommens neue Verhandlungen stattfinden sollen und derursprüngliche Entwurf nur in dem Falle in Kraft treten solle, wenn dieseVerhandlungen zu keinem Ergebnis führen.Auch die deutsche Forderung einer Verlängerung der Okkupation umfünf bis sechs Jahre nach dem allgemeinen Frieden spielte in mehrerenStadien der Verhandlungen eine große Rolle und wurde von österreichischungarischerSeite von Anbeginn an entschieden bekämpft. Österreich-Ungarn trat dafür ein, daß man Rumänien durch den Friedensschluß imPrinzip die gesamte legislative und exekutive Gewalt wiedergeben undsich nur bezüglich einer/ beschränkten Anzahl von Agenden ein gewissesKontrollrecht, jedoch nicht über den allgemeinen Frieden hinaus, vorbehaltenmüsse. Zur Unterstützung dieses Standpunktes führte der Ministerdes Äußern insbesondere an, daß das Aufkommen einer uns freundlichenRegierung in Rumänien (zu jenem Zeitpunkt bestand noch das KabinettAverescu) unmöglich wäre, wenn wir Rumänien dauernd in unserem Jochhalten wollen. Alle unsere Bestrebungen müssen vielmehr darauf gerichtetsein, daß das, was Rumänien gegenüber erreicht werden soll, durch eineVerständigung mit jenen Politikern erreicht werde, die eine den Mittelmächtenfreundliche Politik zu verfolgen bereit sind. Das Hauptziel unsererPolitik, solche Männer in Rumänien ans Ruder kommen zu lassen undihnen das Verbleiben in der Regierung zu ermöglichen, werde jedoch durchallzu scharfe Forderungen unerreichbar gemacht. Wir würden auf diesemWege etwas für einige Jahre erreichen und dafür mit der ganzen Zukunftbezählen. Es gelang uns auch, den deutschen Staatssekretär Kühlmannvon der Unrichtigkeit der auf die Verlängerung der Okkupation bezüglichenForderung, die besonders von der Deutschen Obersten Heeresleitungvertreten wurde, zu überzeugen. Tatsächlich erklärte nach dem RücktrittAverescus Marghilomann, daß diese Forderungen ihm die Bildungeines Kabinetts ganz unmöglich machen würden. Und nachdem manihm deutscherseits erklärte, daß die Deutsche Oberste Heeresleitung aufdieser Forderung verharre, willigte er in die Kabinettsbildung erst ein,als sich der österreichisch-ungarische Minister des Äußern verbürgte,daß eine günstige Lösung der Besatzungsfrage gefunden werden wird.Es ist dann später gelungen, auch in dieser Frage zu einer Verständigungmit Rumänien zu gelangen.Zu den entscheidenden Fragen des Friedensschlusses mit Rumäniengehörte endlich die Frage der Abtretung der Dobrudscha, die von bulgarischerSeite so stürmisch gefordert wurde, daß es unmöglich war, darüberhinwegzukommen. Das Ultimatum, das dem Präliminarfrieden von Bufteavorherging, mußte denn auch hauptsächlich auf die Dobrudschafrage abgestelltwerden, da Bulgarien bereits über Undankbarkeit der Zentralmächte,über die Enttäuschung Bulgariens und über die üblen Folgendieser Enttäuschung für die spätere Kriegführung sprach. Graf Czerninkonnte lediglich durchsetzen, daß den Rumänen für den Fall der Abtretungder Dobrudscha wenigstens eine sichere Zufahrt zum Hafen vonAl6
AnhangConstanza zugesagt werde. In der Hauptsache fand die Dobrudschafragebereits in Buftea ihre Erledigung. Als später bulgarischerseits der Wunschauftauchte, die Bestimmung des Präliminarvcrtrages, wonach die Dobrudschabis zur Donau abzutreten wäre, so auszulegen, daß damit dieAbtretung des Gebietes bis zum nördlichen Donauarm, dem Kiliaarm,gemeint sei, wurde dieser Forderung sowohl deutscherseits als auch österreichisch-ungarischerseitsder entschiedenste Widerstand entgegengesetzt,und es wurde im Friedensvertrag ausdrücklich ausgesprochen, daß dieDobrudscha nur bis zum St. Georgsarm abzutreten sei. Diese Stellungnahmehat bei den Bulgaren abermals verstimmt, war jedoch unvermeidlich,da die Aufstellung dieser neuen Forderung wahrscheinlich auch den Präliminarfriedenvon neuem aufgerollt hätte.In diesem Stadium befanden sich die Verhandlungen, als Graf Czerninvon seinem Amte zurücktrat."VII.Die vierzehn Punkte WilsonsDer erste Punkt ist, daß alle Friedensverträge öffentlich sindund öffentlich zustandegekommen sind, und daß danach keine geheimeninternationalen Vereinbarungen irgendwelcher Art mehr getroffen werdendürfen, sondern daß die Diplomatie immer offen und vor allerWelt getrieben werden soll.Der zweite Punkt ist: Vollkommene Freiheit der Schiffahrtauf dem Meere außerhalb der territorialen Gewässer im Frieden sowohlwie im Krieg, ausgenommen, daß das Meer ganz oder teilweise durch eineinternationale Handlung zwecks Durchsetzung internationaler Verträgegeschlossen werden könne.Der dritte Punkt ist die möglichste Beseitigung aller wirtschaftlichenSchranken und die Errichtung der Gleichheit der Handelsbedingungenaller Nationen, die sich dem Frieden anschließen und sichzu seiner Aufrechterhaltung vereinigen.Die vierte Bedingung ist, daß entsprechende Garantien gegeben undangenommen werden, daß die Rüstungen der Völker auf das niedrigstemit der inneren Sicherheit zu vereinbarende Maß herabgesetztwerden.Der fünfte Punkt ist die freie, aufrichtige und vollkommen unparteiischeOrdnung aller kolonialen Forderungen, die auf der strengen Be^"folgung des Grundsatzes begründet ist, daß bei der Entscheidung allerSouveränitätsfragen die Interessen der in Betracht kommenden Bevölkerungendas gleiche Gewicht haben müssen wie die berechtigten Forderungender Regierungen, deren Rechte abgegrenzt werden müssen.Der sechste Punkt betrifft die Räumung des ganzen russischenGebietes und eine solche Regelung aller Rußland betreffenden Fragen,die das beste und freieste Zusammenwirken der anderen Nationen derWelt sichert, um für Rußland die unbehinderte Gelegenheit zu erlangen,unabhängig über seine eigene politische Entwicklung und nationale Politikzu entscheiden und Rußland die aufrichtige, freundliche Aufnahme indie Gesellschaft der freien Nationen unter Gesetzen, wie es sie selbst will,zu sichern; und mehr als das: Unterstützung in allen Dingen, die Rußlandbraucht und selbst wünscht. Die Behandlung, die Rußland vonz: Czernin. <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong>417
Anhan»seinen Schwesternationen in den kommenden Monaten gewährt werdenwird, wird eine klare Probe auf ihren guten Willen sein und ihr Verständnisfür Rußlands Nöte zum Unterschied von ihren eigenen Interessen.Siebenter Punkt: Die ganze Welt wird zustimmen, daß Belgiengeräumt und wiederhergestellt werden muß, ohne daß irgendeinVersuch unternommen wird, seine Souveränität, deren es sich in Gemeinschaftmit allen anderen freien Nationen erfreut, zu beschränken. Keineeinzige andere Handlung wird so wie diese dazu dienen, das Vertrauenunter den Nationen in die Gesetze, die sie selbst zur Regelung ihrer Beziehungenuntereinander festgesetzt haben, wiederherzustellen. Ohne dieseversöhnende Handlung wäre das ganze Gefüge und die Kraft des internationalenVölkerrechtes für immer beeinträchtigt.Achter Punkt: Das ganze französische Gebiet soll befreit unddie besetzten Teile wiederhergestellt werden. Das Unrecht, dasFrankreich durch Preußen im Jahre 1871 in der elsaß-lothringischenFrage geschehen ist und das den Weltfrieden seit nahezu fünfzig Jahrenbeunruhigt hat, soll wieder gutgemacht werden, damit der Friedewieder im Interesse aller gesichert wird.Neunter Punkt: Die Berichtigung der Grenzen Italiens sollnach klar erkennbaren nationalen Linien vorgenommen werden.Zehnter Punkt: Den Völkern Österreich - Ungarns, deren Platzunter den Nationen wir geschützt und gesichert zu sehen wünschen, solldie erste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung gewährt werden.Elfter Punkt: Rumänien, Serbien und Montenegro sollen geräumtund die besetzten Gebiete wiederhergestellt werden. Serbien sollein freier und sicherer Zugang zum Meere gewährt werden. Die Beziehungender verschiedenen Balkanstaaten untereinander sollen durch freundlicheBesprechungen entsprechend der geschichtlich gegebenen Linien der Zugehörigkeitder Nationalität festgesetzt werden. Für die politische undwirtschaftliche Unabhängigkeit und die territoriale Unversehrtheit derverschiedenen Balkanstaaten sollen Garantien geschaffen werden.Zwölfter Punkt: Den türkischen Teilen des jetzigen Os manischenReiches sollte der sichere Genuß der Souveränität zugesichert werden,aber den anderen Nationalitäten, die sich jetzt unter türkischer Herrschaftbefinden, sollte ebenso unzweifelhaft Sicherheit des Lebens undabsolut unbelästigte Gelegenheit zu autonomer Entwicklung gesichertwerden. Die Dardanellen sollten als freie Durchfahrt für die Schiffeund den Handel aller Nationen unter internationalen Garantien geöffnetwerden.Dreizehnter Punkt: Ein unabhängiger polnischer Staat, derdie von zweifellos polnischer Bevölkerung bewohnten Gebiete einschließenmüßte, sollte errichtet werden. Er müßte freien Zugang zum Meere haben.Seine wirtschaftliche Unabhängigkeit und territoriale Integrität müßtedurch einen internationalen Vertrag garantiert werden.Vierzehnter Punkt: Ein allgemeiner Völkerbund muß errichtetwerden. Spezielle Verträge müssen für gegenseitige Garantien der politischenUnabhängigkeit und der territorialen Integrität für große undkleine Staaten in gleicher Weise sorgen.
47«Namen« und Sachregister
Abrüstung 8, 212, 213, 233, 238, 239,240, 241, 242, 246, 250, 267, 269,286, 403, 417.Adler, Dr. Viktor 34, 35, 228, 320.Adrianopel 364.Aehrenthal, Graf Lexa von, österreichisch-ungarischerMinister desÄußern (f 17- H. *9i2) 9, 52, 53>187.Albanien 11, 122, 379.Albrecht, Herzog von Württemberg5i-Alldeutsche 219, 251.Amerika 24, 26, 39, 70, 98, 153, 154,156, 158, 159, 160, 161, 163, 164,166, 168, 169, 171, 172, 173, 174,176, 177, 197, 201, 202, 205, 207,212, 255, 261, 267, 294, 381 ff.,390, 392.„Ancona" 172, 174, 176, 381, 383,384, 388.Andrassy, Graf Juüus, 25. X. bis3. XI. 19 18 österreichisch-ungarischerMinister des Äußern 31, 32,33, 39, 170, 354-Andrian, Leopold Freiherr v. A.-Werburg,Zivilgouverneur der von k.u. k. Truppen besetzten GebietePolens 301.Anschlußfrage 39, 285.Armand, Graf Abel 223, 231.Armenier 258.Asquith 245, 249.Ausgleich von 1867, österreichischungarischer257, ?.j6, 277.Australien 267.Austropolnische Lösung 185, 273,274, 277, 280, 281, 282, 283, 327,330.Averescu 357, 358, 416.Baernreither, Dr. Joseph Maria 313.Balkan 10, 11, 56, 61, 65.Balkankriege 10, 11, 89.,,Baralong"-Fall 179.Beck, Baron Wladimir, bis 1908österreichischer Ministerpräsident313.Belgien 7, 20, 22, 212, 213, 214,217, 219, 245, 246, 252, 261, 402,418.Belgische Neutralität 2off.Benckendorff, Graf, russischer Botschafterin London 377, 380.Benedikt XV., Papst 228, 237, 241,242.Berchtold, Graf Leopold, österreichisch-ungarischerMinister desÄußern vom Februar 191 2 bisFebruar 191 5 12, 13, 14, 15, i 7)19, 4i, 56, 57, 103, 105, 110, in,146, 187.Bessarabien 343, 352, 360, 366.Bethmann Hollweg 13, 17, 95, 96,152, 153, 155, 190, 196, 198, 204,210, 213.Bilinski, Dr. Leon v., österreichischungarischergemeinsamer Finanz-303, 304.minister 40, 279, 280.Bismarck 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6q,86, 96."Bizenko, Frau421
Namen- und SachregisterBlockade 178, 180, 267, 372, 381,387.Böhmen 31, 192, 300.Bolschewiki 70, 291, 298, 305, 309,310, 312, 316, 318, 332, 336, 341,344, 4°5-Bolschewismus 268, 299, 304, 372.Bosnien 234, 283.Bozen 38, 232.Bratianu, Joan 108, 109, in, 125,126, 127, 129, 130, 132, 135, 137,146, 357-Brest-Litowsk 76, 261, 280, 284,301 ff., 351, 354, 362, 396, 4©7ff-Briand 247.Briey 216, 220.Brinkmann, Major 313.Brotfrieden 347.Bülow, Fürst Bernhard v. 72.Bukarest, Friede von 109, 110, 130,351 ff., 41 3 ff.Bukowina 139, 234, 327.Bulgarien 10, 16, 97, 103, 110, 135,168, 222, 223, 224, 248, 307, 310,345, 358, 361, 363, 364, 365, 366,416, 417.Burian, Graf Stephan de Rajecz,191 5 bis 22. Dezember 1916 österreichisch-ungarischerMinister desÄußern, später gemeinsamer Finanzminister129, 139, 141, 151,152, 183, 190, 273, 287, 330, 331,365.Bussche, Freiherr von dem B.-Haddinghausen,deutscher Gesandterin Bukarest 139, 312.Byzantinismus 79, 81, 87.Cachin 295.Cambon, Paul, französischer Botschafterin London 377, 380.Capelle, von, Staatssekretär desdeutschen Reichsmarineamts 178.Carmen Sylva (Königin Elisabethvon Rumänien) 105, i2off.Carol, König von Rumänien (Carl I.)18, 19, 105, 106, 108, 112, 116,117, 119, 120, 122, 123, 124, 125,138.Carp 109, 116, 124.Catarau 118, 119.Cattaro 378, 379.Cholmer Frage 283, 284, 326, 327,409, 410.Clam-Martinic, Graf Heinrich, abDezember 1916 österreichischerMinisterpräsident 161, 229, 281.Clemenceau 247, 249, 250, 251, 252,259, 370, 37i-Colloredo - Mannsfeld, Graf H.,österreichisch-ungarischer Marineattachein Berlin 162,301,320,333.Conrad von Hötzendorf 57, 80, 161.Csicserics, v. Bacsany, k. u. k. Feldmarschalleutnant301, 302, 320.Czernin, Graf Otto, Bruder des Verfassers,k. u. k. Legationsrat, dannGesandter 12.Dalmatien 27, 378, 379.Dänemark 163.Debrecziner Attentat 118.Delegationen 183, 184, 247, 260, 275,353, 395-Deutsch, Leo 292.Deutsche Oberste Heeresleitung 23,24, 153, 179, 213, 217, 338, 363,407, 408, 410, 416.Deutscher Reichstag 93, 211, 213,216, 219, 225, 226.Deutschland 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 66,88, 89, 92, 93, 97, 98, 115, 155,156, 157, 165, 167, 168, 171, 172,174, 177, 178, 185, 191, 197,198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,207, 212, 213, 214, 216, 217, 218,219, 220, 221, 224, 225, 226, 227,231, 232, 233, 234, 235, 242, 244,245, 248, 249, 250, 252, 255, 367,269, 273, 279, 281, 282, 286, 297,300, 307, 311, 312, 317, 319, 323,422
1Namen- und Sachreg^ter324, 325, 326, 330, 331, 334, 335,336, 33«, 339, 340, 34i, 343, 344,345, 355, 362, 363, 377, 380, 381,401, 407ff-, 414, 415, 4iö.Deutschösterreich 33, 38, 39, 70, 244.Devonport, Lord, Lebensmitteldiktatorin England 206, 394.Dobrudscha 109, 352, 358, 360, 361,363, 364, 365, 366, 416, 417.Donauföderation 300.Dreyfuß, Louis 339.Dualismus 54, 64, 187, 188, 274, 275,276, 277, 283.Eduard VII. 5, 8, 82, 83.Elisabeth, Königin von Rumänien,s. Carmen Sylva.Ellenbogen, Dr. 33, 228.Elsaß-Lothringen 8, 21, 38, 92, 93,96, 97, 98, 197, 217, 225, 231, 232,234, 245, 246, 259, 269, 282, 418.Emser Depesche 19.England 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,19, 20, 2i, 22, 23, 26, 27, 40,82, 88, 89, 115, 154, 158, 159,162, 163, 164, 165, 169, 175, 188,189, 191, 194, 197, 203, 205, 206,207, 208, 217, 225, 226, 227, 228,235, 236, 243, 244, 245, 246, 247,249, 257, 267, 294, 365, 377, 379.380, 381 ff-, 388 ff.Enver 223, 318, 365.Erzberger 212, 220, 250.Esterhazy, Graf Paul, 19 18 ungarischerMinisterpräsident 186.Estland 336, 412.Eugen, Erzherzog 29.Fasciotti, Baron, ital. Gesandter inBukarest 18.Ferdinand, König von Bulgarien 66.Ferdinand, König von Rumänien112, 122, 123, 124, 130, 354, 355,356, 358, 359, 36o, 361.Filipescu, Nikolai 107.Fiume 379.Flandrische" Küste^2 17.Fleck, k. u. k. Major 301.Flotow, Baron, Dr. L., Sektionschefim k. u. k. Ministerium desÄußern 155, 157, 161, 162.Foch 251.Föderalismus 54, 64, 232.Franchet d'Esperey 354.Frankreich 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16,21, 22, 27, 88, 89, 92, 98, 158,159, 162, 163, 195, 196, 197, 205,208, 212, 217, 225, 226, 227, 231,245, 246, 247, 257, 260, 267, 268,294, 337, 365, 370, 377, 379, 380,392, 418.Franz Ferdinand 10, 40, 45 ff., 103,105, 106, 108, 110, 114, 115, 146,151, 187, 259, 282.Franz Joseph 6, 10, II, 13, 14, 17,18, 29, 47, 54, 55, 60, 61, 74,103, 105, 107, 110, in, 123, 129,138, 146, 259, 274, 358, 365.Freiheit der Meere 241, 403, 417.Freyberg - Eisenberg - Allmendingen,Freiherr von, Korv.-Kapt., deutscherMarineattache in Wien 162.Friedrich, Erzherzog 29, 94.Fürstenberg, Prinz Karl Emil, 191bis 1 9 1 3 österreichisch - ungarischerGesandter in Bukarest 103,146.Galizien 26, 98, 137, 184, 197, 217,234, 235, 269, 275, 279, 2S2, 284,285, 325, 326, 327, 330, 331, 344.Gautsch, Baron, Legationssekretär301, 313-Georg V., König von England 14,15, 13^Görz 27, 377.Goluchowski, Graf Agenor, £>is 1906österreichisch-ungarischerMinisterdes Äußern 47, 48.Gorlice 116, 127, 140.Goschen, Sir Edward, bis 19 14britischer Botschafter in Berlin20, 21.Gradiska 27, 377.423
Namen- und SachregisterGratz, Dr., Sektionschef im k. u. k.Ministerium des Äußern 301, 302,330, 334, 336, 337-Grey, Sir Edward 13, m, 380.Griechenland 188, 379.Hadik, Graf Johann, ungarischerErnährungsminister 323.Haus, Anton, österreichisch-ungarischerGroßadmiral 161, 166.Hauser, Prälat 313.Heinrich, Prinz von Preußen 14.Helfferich, Dr. Karl 89, 206, 220,388.Hertüng, Graf Dr. Georg von 84,220, 222, 262, 270, 312, 334.Herzegowina 234, 283.Hindenburg 24, 25, 152, 169, 170,227, 297, 300, 311.Hoffmann, General, Generalstabschefdes Ob. Ost 302, 309, 311,313, 314, 318, 319, 320, 321, 322,333, 4io, 412.Hohenberg, Herzogin Sophie von 41,Schillingsfürst,54, 57, 58, 59, 63, 105, 106, 114.Hohenlohe, Prinz Gottfried H.-österreichisch-ungarischerBotschafter in Berlin 84,152, 153, 155, 157, 162, 169, 171,334-Holland 163, 189.Holtzendorff, von, Admiral 161, 162,163, 202, 205.1 Hungerkatastrophe in Österreich322 ff.Iniperiali, Marchese, italienischerBotschafter in London 377, 380.Indien 267.Irland 258, 371.Isonzo 205.Istrien 27, 377, 379.Iswolsky, Alexander 17.Italien 7, 11, 18, 24, 26, 27, 28, 34,38, 98, 158, 162, 167, 190, 191,192, 198, 224, 226, 232, 234, 235,248, 255, 256, 257, 259, 260, 267,268, 299, 300, 357, 370, 377, 378,379, 380, 392, 404, 418.Jagow, Gottheb v., Staatssekretär 20.Japan 88, 159, 160, 164.Joffe 303, 304, 305, 306, 308, 313,398, 400.Jonescu, Take 114.Joseph, Erzherzog 29.Joseph Ferdinand, Erzherzog 80, 81.Kamenew 303, 411.Kanada 267.Karl, Kaiser 26, 37, 53, 54, 58, 63,74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 93, 97,151, 152, 161, 167, 177, 185, 186,197, 198, 204, 211, 223, 229, 259,262, 273, 278, 283, 284, 286, 287,299, 300, 301, 312, 320, 322, 323,324, 327, 330, 337, 352, 354, 359,362, 406, 413, 414, 415.Karolyi, Graf Michael 36, 188, 354.Kerenski 291, 292, 298.Kiderlen-Wächter, Alfred v., Staatssekretär83.Konfidentenberichte 195 f., 225.Kongreß-Polen 330.Konopischt 45 ff.Konstantinopel 10, 195, 248.Krieger, Dr. Bogdan 83.Kühlmann, Dr. Richard v., Staatssekretär270, 305, 306, 307, 308,311, 312, 313, 314, 317, 318, 319,320, 322, 323, 324, 331, 333, 335,336, 355, 357, 364, 408, 409, 4",412.Kurland 216, 218, 220, 307, 309,311, 319, 321, 336, 338, 401, 407.Lamezan, Baron, Hauptmann 317.Landwehr, General 323, 326.Lansdowne, Lord 249.Lansing 171.Larin 291.Lenin 291, 298, 299, 304, 310, 312.Leopold, Prinz von Bayern 302, 303,305, 306, 312, 315.424
Namen- und SachregisterLewicky 326.Lichnowsky, Fürst Karl Max 13.Litauen 216, 218, 220, 307, 309,311, 319, 321, 336, 338, 401, 407-Livland 336, 412.Lloyd George 224, 233, 242, 249,250, 251, 252, 371, 392, 393.Londoner Deklaration 381.Londoner Pakt (Londoner Konferenz)26, 27, 34, 35, 36, 37, 38,42, 198, 224, 231, 234, 244, 246,247, 248, 252, 255, 256, 257, 259,260, 269, 285, 299, 300, 365,377 ff-Longwy 216, 219.Lublin 279, 281.Luck 29, 81, 138, 142.Ludendorff 24, 25, 28, 79, 99, 152,169, 170, 171, 226, 227, 228, 251,252, 282, 311, 314, 322, 334, 412.Lueger, Dr. Karl 65.Lüttich 217.Luftangriffe 23, 228.„Lusitania" 164.Luxemburg 22.Mackensen 132, 137, 355.Majorescu 108, 109, 127, 139.Mandazescu 118.Marghilomann 127, 360, 361, 362,363, 366, 414, 415, 416.Marie, Königin von Rumänien 129,130.Marneschlacht 21, 24.Martow 291.Martynow 291.Menschewiki 291, 292, 294.Mensdorff, Graf, österreichisch-ungarischerBotschafter in London231.Meran 38, 232.Merey, v. Kaposmere, k. u. k. Botschafter302.Mexiko 154, 159, 164.Michaelis, Dr. Georg, deutscherReichskanzler 213, 214, 218, 219,220, 246, 326.Mitteleuropa 66, 234, 285, 286.Moltke, Graf Hellmuth 96.Montenegro 378, 379, 404, 418.Moonsund-Inseln 335.Moutet 295.Napoleon I. 23, 227, 236.Napoleon III. 96.Nationalversammlung Deutschösterreichs33.Nikolaus IL 7, 14, 91, 116, 146, 193,194, 310.Nikolaus Nikolajewitsch 6, 310.Orlando 259, 260.Österreich-ungarische Monarchie 6,", 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27,30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,4i, 42, 54, 56, 62, 64, 66, 89, 94,98, 103, 117, 145, 174, 183, 185,188, 191, 192, 197, 199, 205, 210,212, 213, 215, 218, 222, 232, 237,238, 239, 241, 244, 247, 255, 258,261, 262, 269, 273, 275, 276, 277,278, 283, 307, 311, 316, 327, 329,330, 33i, 337, 340, 343, 345, 352,353, 377, 381 ff-, 396, 407ff-,4i3ff., 418.Otto, Erzherzog 47, 48.Pallavicini, Markgraf Johann, k. u.k. Botschafter 10.Penfield, amerikanischer Botschafter in Wien 177.„Persia" 174, 381, 383, 388.Peschechonow 292.„Petrolite" 174.Plechanow 292.Poklewski, russischer Gesandter inBukarest 114.Polen 26, 37, 98, 138, 185, 197,198, 216, 217, 218, 219, 226, 234,235, 259, 261, 268, 269, 273, 274,278, 279, 280, 281, 282, 283, 285,307, 311, 321, 327, 330, 400, 401,404, 407, 408, 409, 418.Popow, bulgarischer Justizminister3"7-425
,Namen- und SachregisterRadek 321.Schönburg, Prinz Alois, k. u. k.Radoslawow 222.Generalmajor 80.Randa, Oberstleutnant, österreichisch-ungarischerMilitärattache Schwarzenberg, Fürst Karl 51, 52.Schönerer, Ritter von 65.in Bukarest 136, 137, 354, 356, Schweden 189, 342.413-Seidler, Dr. Ernst Ritter von, österreichischerMinisterpräsident 74,Renner, Dr. Karl 228.78, 284, 285, 313, 322, 323, 325,326, 328, 329, 330.Seitz, Karl 228.Selbstbestimmungsrecht 304, 309,313, 321, 335, 336, 371, 401, 408,409, 411.Separatfriede Österreich-Ungarns 2 5Ressel, Oberst 359.Revertera, Graf Nikolaus 223, 231.Revolution von 191 8 30.Ribot 208, 224.Richthofen, Manfred v. 333.Rosenberg, von, Gesandter 302, 320.Rotbuch über Rumänien 129, 151.Rudolf, Kronprinz 49.Rumänien (als Nationalität in Ungarn)50, 64, 257.Rumänien 7, 10, 11, 18, 19, 24, 26,27, 28, 30, 35, 36, 37, 38, 61, 64,93, io3ff., 151, 152, 163, 185,186, 187, 188, 195, 198, 201, 214,218, 219, 226, 232, 234, 252, 268,282, 283, 299, 322, 330, 342, 343,351» 352, 353, 354, 355, 356, 357,359, 360/361, 362, 363, 365, 366,404, 4i3 ff -> 4i8.Russische Revolution 138, 193, 194,195, 200, 205, 304, 305.Rußland 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15,16, 22, 27, 28, 30, 56, 65, 66, 88,89, 93, "7, "9, 127, 138, 145,146, 158, 189, 192, 195, 201, 209,210, 218, 226, 255, 291, 297, 301,302, 304, 307, 310, 314, 318, 319,Sacharow, General 303.Saint-Germain, Friede von 244, 259,366, 370, 372.Sanders 295.Sarajevo, Attentat von 11, 13, 40,114, 146.Sasonow 13, 116, 117, 146.Schiedsgerichtsbarkeit,426internationale238, 239, 241.335, 337, 35i, 357, 377, 379, 380,396, 397, 402, 407 ff-, 4i7-Ruthenen 257, 284, 327, 328.26, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 42,224, 225, 226, 231, 246, 247, 248,255, 299, 313-Serbien ioff., 27, 28, 35, 38, 65, 66,116, 117, 138, 185, 198, 226, 234,235, 252, 299, 378, 379, 404,418.Sewrjuk 326.Siebenbürgen 35, 64, 106, 107, 139,140, 141, 146, 184, 234, 259,282.Siegfriede 26, 30, 232.Sixtus, Prinz von Parma (Briefaffäre)74, 223.Skobelew 291, 294.Skrzynski, v. 337.Slowaken 50, 257.Smuts, General 231.Sofia 248.Somme 158.Sowjets 336.Spanien 189.Status quo 25, 36, 186, 216.Stirbey, Prinz 357.Stockholmer Sozialistenkonferenz228, 229, 230, 231, 296.Straßburg 248.Stürgkh, Karl Graf, November 191österreichischer Ministerpräsident(f21. X. 1916) 60, 139.Stumm, v. , Unterstaatssekretär 327Sturdza, Prinz, Oberleutnant 110,11 1,1
Namen- und SachregisterSüdekum, Dr. 212.Südslawischer Staat 232, 257, 268.Südtirol 27, 37, 224, 232, 377.Sylvester, Dr. 33.Talaat Pascha 195, 222, 223, 317,318, 365.Talleyrand 236.Tarnowski, Graf Adam, österreichisch-ungarischerGesandter inSofia, dann Botschafter in Washington143, 171, 172.Thomas 295.Tirol 31, 35, 170, 184, 224, 235, 244,256, 259, 300.Tirpitz 152.Tisza, Graf Stefan 15, 16, 17, 35,36, 37, 50, 63, 103, 104, 107, 108,109, 139, 140, 141, 142, 161, 164,166, I72ff., 183, 184, 185, 186,187, 188, 190, 210, 211, 228, 231,273, 278, 281, 283, 351, 352, 354,363» 413-Trentino 27, 98, 377, 379.Trialismus 185, 273, 274, 277.Trient 233 (s. Trentino).Triest 27, 38, 167, 224, 232, 248,299, 377-Trnka, Ottokar, österreichischer Arbeitsminister229.TrotzM 291, 302, 310, 315, 316,317, 3i8, 319, 320, 321, 322, 325,331, 332, 333, 334, 33S, 336, 337,351, 402, 409, 410, 411, 412.Trudowiki 292.Tschechen 31, 35, 257, 258, 259,268.Tscheidse 291, 294.Tschernow 292, 293.Tschirschky - Bögendorff, v., HeinrichLeonhard, deutscher Botschafterin Wien (f 16. XI. 1916)12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 40.Tseretelli 291, 294.Türkei 97, 125, 195, 212, 223, 261,306, 307, 310, 318, 345, 357, 364,365, 366, 379, 397, 402, 418.U-Bootkrieg 24, 151 ff., 194, 196,197, 202, 203, 205, 206, 207, 208,223, 242, 243, 246, 247, 381, 387,388 ff.Ugron, Stefan von, k. u. k. Gesandter274.Ukraine (russische) 284, 313, 315,316, 318, 320, 325, 326, 327, 328,330, 33i, 332, 334, 335, 336, 337,338, 339, 340, 341, 342, 343,344, 345, 35i, 397 ff-, 405, 406,407 ff.Ukrainer 184, 258, 268, 284.Ultimatum Englands an Deutschland20, 21, 23.Ultimatum Österreich-Ungarns anSerbien 12 ff., 115, 116, 119.Ungarn 32, 35, 36, 37, 49, 50, 61,104, 118, 127, 128, 139, 140, 183,184, 185, 187, 188, 192, 258, 268,274, 275, 276, 277, 283, 322, 323,326, 327, 328, 339, 351, 353, 354,362, 413, 414.Valona 379.Versailles, Friede von 227, 251,259, 268, 366, 369, 370, 371,372.Verständigungsfriede 26, 34, ^7, 232,237, 247, 251, 252, 255, 257, 285,286, 300, 338, 365, 366.Vierzehn Punkte 256, 258, 260, 261,370, 41 7 f.Völkerbund 418.Vredenburch, van, holländischer Gesandterin Bukarest' 136.Wassilko, Nikolay 334, 336.Wedel, Graf Botho, deutscher Botschafterin Wien 171, 212, 220.Weiskirchner, Dr. Richard 347.Wekerle, Dr. Alexander 35, 186,313, 328, 329, 330, 354, 413,414.Wied, Prinzessin von (Fürstin vonAlbanien) 122.427
Namen- und SachregisterWilson 32, 33, 156, 157, 160, 164,Wiesner, Freiherr von, k. u. k.94, 9
Ullstein&CoBerlin
DCzernin von und zu Chudenitz,523 Ottokar Theobald Otto Maria,C87 Graf1919 <strong>Im</strong> <strong>Weltkriege</strong> 2. Aufl.PLEASE DO NOT REMOVECARDS OR SLIPS FROM THIS POCKETUNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY