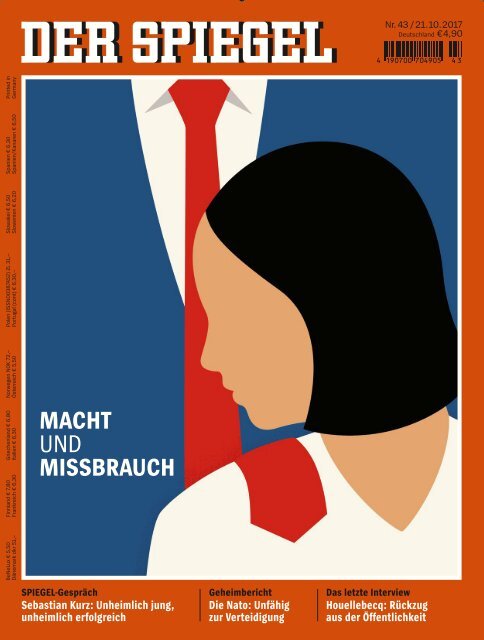20171020-Der_Spiegel_Nachrichtenmagazin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 43 / 21.10.2017<br />
Deutschland €4,90<br />
BeNeLux € 5,50 Finnland € 7,80 Griechenland € 6,80 Norwegen NOK 72,– Polen (ISSN00387452) ZL 31,– Slowakei € 6,50 Spanien € 6,30 Printed in<br />
Dänemark dkr 51,– Frankreich € 6,30 Italien € 6,30 Österreich € 5,50 Portugal (cont) € 6,30,– Slowenien € 6,20 Spanien/Kanaren € 6,50 Germany<br />
MACHT<br />
UND<br />
MISSBRAUCH<br />
SPIEGEL-Gespräch<br />
Sebastian Kurz: Unheimlich jung,<br />
unheimlich erfolgreich<br />
Geheimbericht<br />
Die Nato: Unfähig<br />
zur Verteidigung<br />
Das letzte Interview<br />
Houellebecq: Rückzug<br />
aus der Öffentlichkeit
DIE NEUE<br />
UNABHÄNGIG<br />
DER NEUE BMW X3.<br />
GRENZENLOS INNOVATIV.<br />
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
EIT.<br />
Freude am Fahren
Urlaub für immer?<br />
Haben wir uns mit guten Taten verdient.<br />
Bei der großen Sonderverlosung am 7.11. bis zu 20 Millionen € extra* gewinnen<br />
und dabei soziale Projekte unterstützen. Lose unter www.aktion-mensch.de<br />
Lotterieveranstalter ist die Aktion Mensch e. V.,<br />
Heinemannstr. 36, 53175 Bonn, AG Mainz, VR 902,<br />
vertreten durch den Vorstand Armin v. Buttlar.<br />
Es gelten die von der staatlichen Lotterieaufsicht<br />
genehmigten Lotteriebestimmungen. Wenn Sie uns<br />
den ausgefüllten Losvordruck zusenden, erhalten<br />
Sie von uns ein Bestätigungsschreiben über das<br />
Zustandekommen des Lotterievertrages. Den Los -<br />
preis buchen wir monatlich von Ihrem Konto ab.<br />
Die Teilnahme Ihres Loses an der Lotterie erfolgt für<br />
einen Monat und verlängert sich monatlich jeweils<br />
um einen weiteren Monat, bis Sie der Verlängerung<br />
widersprechen. Die Lotteriebestimmungen erhalten<br />
Sie auf telefonische Anforderung (Tel.: 0228 2092-400)<br />
kostenlos per Post oder auf www.aktion-mensch.de.<br />
Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um ein Los<br />
kaufen zu dürfen. Alle bis zum 3.11.2017 eingegangenen<br />
fehlerfreien Lose nehmen (mit allen anderen<br />
Aktion Mensch-Losen) an der Sonderverlosung teil.<br />
Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Höchstgewinn<br />
pro Gewinnkategorie beträgt 1:2,5 Mio., die für das<br />
Zusatzspiel beträgt 1:25.000.<br />
*Zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von 20 Mio. €<br />
über alle Lose der Aktion Mensch.<br />
Los weg? Neue Chance unter:<br />
www.aktion-mensch.de<br />
Jetzt mitspielen: www.aktion-mensch.de
Das deutsche Nachrichten-Magazin<br />
Hausmitteilung<br />
Betr.: #MeToo, Österreich, Houellebecq, Habermas, Winkler<br />
Unter dem Hashtag #MeToo be -<br />
richten Tausende Frauen in den<br />
sozialen Netzwerken von sexueller<br />
Belästigung, Übergriffen, auch Vergewaltigungen.<br />
Ausgelöst durch die Verfehlungen<br />
des US-Filmproduzenten<br />
Harvey Weinstein, entsteht auf den<br />
Websites von Facebook und Twitter<br />
zurzeit das Bild eines häss lichen<br />
Deutschlands, in dem Frauen Freiwild<br />
zu sein scheinen und Männer vor allem triebgesteuert. Warum diese Kampagne<br />
solche Wucht entfaltet, welche Konsequenzen die Debatte haben dürfte, mit<br />
diesen Fragen beschäftigt sich ein großes Autorenteam in mehreren Texten, in<br />
denen auch Opfer von Übergriffen ausführlich zu Wort kommen. Ein zweiter<br />
Themenkomplex widmet sich der Situation in Österreich. <strong>Der</strong> Spitzenkandidat<br />
der ÖVP, Sebastian Kurz, wird wohl der neue Bundeskanzler werden, wahrscheinlich<br />
mit der rechtspopulistischen FPÖ als Partner. Um dieser Nachrichtenlage<br />
gerecht zu werden, erscheint das Heft mit zwei Titelbildern: #MeToo in<br />
Deutschland, Kurz in Österreich und der Schweiz. Seiten 14 bis 24, 80 bis 84<br />
Michel Houellebecq, derzeit Frankreichs prominentester und umstrittenster<br />
Schriftsteller, plant zu verschwinden, er hat es in einer Mail angekündigt.<br />
Houellebecq möchte sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen und keine Interviews<br />
mehr geben, er will ungestört<br />
an seinem nächsten Roman<br />
arbeiten. Romain Leick, an den<br />
die Mail adressiert war, hat<br />
Houellebecq zu einem letzten<br />
Gespräch getroffen. <strong>Der</strong> Autor,<br />
oft beschimpft als Frauenhasser<br />
und Reaktionär, sprach über die<br />
Vorwürfe seiner Gegner, über<br />
die komplizierte Beziehung zwischen<br />
Deutschland und Frankreich<br />
und über seinen heroischen Leick, Houellebecq<br />
Pessimismus. Seite 120<br />
Nahezu zeitgleich kamen zwei große deutsche Intellektuelle auf die Idee,<br />
sich wieder einmal einmischen zu wollen, Jürgen Habermas und Heinrich<br />
August Winkler. Ihr Thema: Europa. Beide wurden auch durch die Lektüre<br />
von Robert Menasse angeregt, der für seinen EU-Roman „Die Hauptstadt“ den<br />
Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Beide suchten sich den SPIEGEL als Ort<br />
für ihre Intervention aus. Habermas ist Philosoph und Soziologe, er hat vor<br />
allem Kommunikationstheorien entwickelt. Winkler ist Historiker und hat<br />
sich besonders mit der Geschichte des Westens befasst. Beide sind Herzens -<br />
europäer, setzen aber verschiedene<br />
Schwerpunkte. Jürgen Habermas plädiert<br />
in diesem Heft dafür, den französischen<br />
Präsidenten Emma nuel Macron auf<br />
dem Weg zu einem wirklich vereinten<br />
Europa zu unterstützen. Heinrich August<br />
Winkler betont stärker die Rolle der<br />
Habermas Winkler<br />
nationalen Vielfalt in der Europäischen<br />
Union. Seiten 88, 134<br />
HEIKE LYDING<br />
WERNER SCHUERING<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
5<br />
TIM WEGNER / DER SPIEGEL<br />
I.N.O.X. SKY HIGH<br />
LIMITED EDITION<br />
Köln | Zürich | Luzern<br />
SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM<br />
ESTABLISHED 1884
Ende der Friedensdividende<br />
Verteidigung Ein Geheimbericht der Nato<br />
kommt zu dem Schluss, dass die Allianz<br />
für einen Angriff Russlands nicht gerüstet wäre.<br />
Die Logistik und die Kommandostruktur sind<br />
zu sehr geschrumpft worden. Auf die Deutschen<br />
kommen wohl neue Aufgaben zu. Seite 30<br />
DAVID RAMOS / GETTY IMAGES<br />
CHRISTIAN ASLUND / DER SPIEGEL<br />
WENDY CARLSON / THE NEW YORK TIMES / REDUX / LAIF<br />
THERON J. GODBOLD / U.S. NAVY / SIPA USA / DDP IMAGES<br />
Katalanisches Rumeiern<br />
Fußball <strong>Der</strong> FC Barcelona ist seit Jahrzehnten<br />
ein wichtiger Kulturträger Kataloniens.<br />
Doch im Streit um die Unabhängigkeit<br />
der autonomen Region verhält sich<br />
der Verein auffällig neutral. Jede Veränderung<br />
würde massiv dem Geschäftsbetrieb<br />
des Profiklubs schaden. Seite 102<br />
Schuld ohne Sühne<br />
Täuschungen 24 Jahre lang versteckt ein<br />
Mann die Leiche seiner Frau in einem<br />
Fass. Dann gesteht er einen Totschlag, der<br />
aber längst verjährt ist. Wegen Verzögerungen<br />
und Fehleinschätzungen auf allen<br />
Seiten konnte aus dem Fall ein perfektes<br />
Verbrechen werden. Seite 54<br />
Rundum giftig<br />
Landwirtschaft Verseucht ein krebserregendes<br />
Pflanzengift seit Jahren die Äcker?<br />
Interne E-Mails zeigen, wie der Agrar -<br />
konzern Monsanto die Risiken seines Herbizids<br />
Roundup verschwieg, Studien über<br />
den Wirkstoff Glyphosat manipulierte und<br />
unliebsame Forscher drangsalierte. Seite 108<br />
6 Titelbild: Illustration: Francesco Ciccolella für den SPIEGEL; Foto: Jork Weismann für den SPIEGEL
In diesem Heft<br />
Titel<br />
Sexismus Die #MeToo-Bewegung<br />
in sozialen Medien befeuert eine längst<br />
überfällige Debatte über das<br />
Verhältnis von Männern und Frauen 14<br />
Protokolle Betroffene berichten,<br />
wie sie mit derben Sprüchen,<br />
Übergriffen und Gewalt umgehen 18<br />
Geschlechter Die Journalistin<br />
Laura Himmelreich über die Folgen<br />
der #Aufschrei-Debatte,<br />
die sie vor vier Jahren ausgelöst hat 22<br />
Debatte <strong>Der</strong> Fall Weinstein<br />
und die Verunsicherung der Männer 24<br />
Deutschland<br />
Leitartikel Warum Männer die Empörung<br />
über sexuelle Belästigung<br />
nicht den Frauen überlassen dürfen 8<br />
Meinung <strong>Der</strong> schwarze Kanal /<br />
So gesehen: Alle wollen<br />
Bundestagsvizepräsident werden 10<br />
U-Boot-Deal mit Antikorruptionsklausel<br />
für Israel / Schwarz-Gelb entmachtet<br />
Steuerfahndung Wuppertal / Frühe Warnung<br />
vor Türkeispitzeln beim Bundesamt 26<br />
Verteidigung Ein internes Papier enthüllt<br />
schwere Mängel im Militärapparat<br />
der Nato 30<br />
Parteien SPIEGEL-Gespräch mit Joschka<br />
Fischer über die Jamaikaverhandlungen und<br />
die Nähe der AfD zum Nationalsozialismus 34<br />
Umwelt <strong>Der</strong> Klimaplan des mächtigsten<br />
deutschen Energiepolitikers 38<br />
Union Merkels Autorität verfällt 42<br />
Sachsen Vom Wahlverlierer zum<br />
Hoffnungs träger – die erstaunliche Karriere<br />
des designierten Ministerpräsidenten<br />
Michael Kretschmer 44<br />
Die Linke <strong>Der</strong> bittere Sieg von<br />
Fraktionschefin Sahra Wagenknecht 46<br />
Kommunen Das frag würdige<br />
Vorruhestandsmodell der Sparkassen 48<br />
Kleinkinder Wer zahlt, wenn Krippenplätze<br />
mehr als 1000 Euro kosten? 50<br />
Gesellschaft<br />
Früher war alles schlechter:<br />
Lebensbedingungen in China /<br />
Sind Briefträger überfordert? 52<br />
Eine Meldung und ihre Geschichte<br />
Wie sich eine japanische Reporterin<br />
zu Tode arbeitete 53<br />
Täuschungen Das perfekte Verbrechen:<br />
Ein Mann versteckt die Leiche<br />
seiner Frau 24 Jahre lang in einem Fass 54<br />
Kolumne Leitkultur 59<br />
Wirtschaft<br />
Audi-Betriebsrat fordert Jobgarantie /<br />
Wenig Spielraum für Jamaikakoalition /<br />
Crowd investing lockt Anleger 62<br />
Gerechtigkeit Deutschland ist gespalten,<br />
die Provinz abgehängt – aber nicht überall 64<br />
Sanktionen Ökonom Rolf Langhammer<br />
über den Sinn von Handelsbeschränkungen 68<br />
Analyse Warum die Zinsen so bald<br />
nicht steigen werden 70<br />
Affären Airbus-Chef Tom Enders<br />
steckt offenbar tiefer im Korruptionssumpf,<br />
als er zugeben mag 72<br />
Gesundheitskarte In Deutschland droht<br />
ein Monopol bei einem entscheidenden<br />
elektronischen Bauteil 74<br />
Ausland<br />
Die Wahlwiederholung in Kenia ist nur ein<br />
hohles Ritual / IWF erwägt Hilfen für den<br />
Fall eines Staatsbankrotts in Venezuela 78<br />
Österreich Sebastian Kurz hat seine Partei<br />
umgebaut und sein Land im Sturm<br />
erobert – doch wofür steht er eigentlich? 80<br />
SPIEGEL-Gespräch mit Wahlsieger Kurz<br />
über eine mögliche Koalition mit der<br />
rechten FPÖ 84<br />
Essay <strong>Der</strong> Historiker Heinrich August<br />
Winkler warnt vor dem Separatismus und<br />
der Abschaffung der Nationalstaaten 88<br />
Somalia Mogadischu ist Ruinenstadt und<br />
Boomtown, das Geschäft ist: der Krieg 90<br />
Analyse Das „Kalifat“ ist zwar am Ende,<br />
die Grün de für seinen Aufstieg sind<br />
jedoch noch da 95<br />
Malta Daphne Caruana Galizia wollte<br />
Korruption, Schmuggel und Mafia-<br />
Machenschaften aufdecken – wurde sie<br />
deshalb ermordet? 96<br />
Sport<br />
Wer ist der beste Formel-1-Fahrer aller<br />
Zeiten? / Magische Momente: „Tagesschau“-<br />
Sprecher Thorsten Schröder über<br />
sein Leiden beim Ironman auf Hawaii 97<br />
Basketball NBA-Star Stephen Curry erklärt<br />
seinen Streit mit US-Präsident Trump 98<br />
Fußball Wie katalanisch ist der<br />
FC Barcelona? 102<br />
Wissenschaft<br />
Zügellos durch Neandertaler-Gene / Mehr<br />
Gewitter auf Schifffahrtsstraßen / Glosse:<br />
Hört auf mit nächtlichen Verhandlungen! 106<br />
Landwirtschaft Die Glyphosat-Lüge – der<br />
Agrarkonzern Monsanto verschwieg die<br />
Risiken seines Unkrautvertilgungsmittels 108<br />
Psychiatrie Wie verrückt ist US-Präsident<br />
Donald Trump? 112<br />
Automobile Warum Millionen Elektroautos<br />
zum Zusammenbruch des Stromnetzes<br />
führen könnten 116<br />
Kultur<br />
Tanz der Aborigines / Treffen der<br />
Gruppe 47 / Kolumne: Zur Zeit 118<br />
Schriftsteller Michel Houellebecq tritt<br />
von der öffentlichen Bühne ab und<br />
zieht im SPIEGEL-Gespräch Bilanz 120<br />
Debatte Mit Rechten reden?<br />
Über den Ernst der Lage schreibt<br />
Redakteur Tobias Rapp … 128<br />
…und über die Doppelstrategie von<br />
Empathie die Autorin Hilal Sezgin 129<br />
Exil Zwei syrische Schriftsteller suchen in<br />
der deutschen Provinz eine neue Heimat 130<br />
Essay <strong>Der</strong> Soziologe Jürgen Habermas<br />
über die europäische Hoffnung<br />
und die historische Chance der Kanzlerin 134<br />
Filmkritik „Sommerhäuser“, die<br />
außer gewöhnliche Tragikomödie<br />
über eine Großfamilie 139<br />
Bestseller 127<br />
Impressum, Leserservice 140<br />
Nachrufe 141<br />
Personalien 142<br />
Briefe 144<br />
Hohlspiegel/Rückspiegel 146<br />
Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/investigativ<br />
Joschka Fischer<br />
Er war früher Bundesaußenminister<br />
und empfiehlt<br />
den Grünen im SPIEGEL-Gespräch<br />
die Zusammenarbeit<br />
mit Union und FDP. AfD-<br />
Funktionäre sind für Fischer<br />
keine Rechtspopulisten, sondern<br />
schlicht: Nazis. Seite 34<br />
Manar Moalin<br />
Sie ist 33 Jahre alt, geboren<br />
in Somalia, aufgewachsen in<br />
Europa. Seit drei Jahren<br />
betreibt Moalin den Country<br />
Club in Mogadischu, einer<br />
Stadt, deren Einwohner vom<br />
Krieg leben und unter<br />
dem Krieg leiden. Seite 90<br />
Stephen Curry<br />
Er ist der beste Basketballer<br />
der Welt und einer der<br />
schärfsten Kritiker des US-<br />
Präsidenten. Sportler hätten<br />
eine „gewaltige Stimme“,<br />
sagt er, man müsse sie nutzen,<br />
um zu zeigen, was unter<br />
Trump schiefläuft. Seite 98<br />
HERMANN BREDEHORST / DER SPIEGEL<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
MARCIO JOSE SANCHEZ / PICTURE ALLIANCE / AP<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
7
Das deutsche Nachrichten-Magazin<br />
Leitartikel<br />
Men, too<br />
Männer müssen endlich ihre Stimme gegen sexuelle Belästigung von Frauen erheben.<br />
Wenn mächtige Kotzbrocken wie Harvey Weinstein<br />
öffentlich als Vergewaltiger bezichtigt werden,<br />
macht das die Welt sicherlich ein bisschen<br />
besser. Wie wunderbar, dass nicht nur Hollywoodstars<br />
Sexismus anprangern, sondern seit dieser Woche auch<br />
Frauen, denen glänzendes Scheinwerferlicht egal ist. Mit<br />
#MeToo haben sich betroffene Frauen quer durch alle<br />
Länder und Schichten in den sozialen Netzwerken als Opfer<br />
sexualisierter Gewalt geoutet.<br />
Ihr Aufschrei wird aber erst die volle Wirkung entfalten,<br />
wenn sich auch Männer angesprochen fühlen. Und<br />
zwar jene Mehrheit der Männer, die Frauen nicht belästigen.<br />
Wer zur Gruppe der Anständigen gehört, denkt<br />
häufig, das alles gehe ihn nichts an. Weiße Westen sind<br />
aber keine Entschuldigung<br />
für Wegsehen.<br />
Die Täter könnten nur deshalb<br />
so ungestraft agieren,<br />
„weil sie von einer schweigenden<br />
Masse gedeckt“ würden,<br />
schreibt der Unternehmensberater<br />
Robert Franken in<br />
seinem Blog. Es ist leider<br />
eine Einzelmeinung. Anstatt<br />
sich zu empören, verharm -<br />
losen viele Männer sexuelle<br />
Belästigung mit Sätzen wie:<br />
„Jetzt ist es schon so weit,<br />
dass ich die Frisur der Kollegin<br />
nicht mehr loben darf.“<br />
Niemand will in einer Welt<br />
leben, in der sich Menschen<br />
keine Komplimente mehr<br />
machen dürfen. Auch Frauen<br />
nicht. Darauf können wir uns<br />
alle schnell einigen. Aber damit<br />
ist die Diskussion über<br />
Sexismus nicht zu Ende.<br />
Es kann wirklich schwierig sein, die Grenze zwischen<br />
nett gemeinter Geste und sexistischem Spruch zu erkennen.<br />
Zumal sie individuell und darum bei jeder Frau<br />
anders verläuft. Es ist ein Unterschied, ob man einer<br />
Kollegin in der Kaffeeküche oder im Morgenmeeting<br />
zum Kauf der neuen Schuhe gratuliert.<br />
Neben dem Ort entscheidet auch die Augenhöhe, ob<br />
ein Kompliment angebracht ist. Keine Praktikantin möchte<br />
vom Abteilungsleiter als „charmante neue Mitarbeiterin“<br />
begrüßt werden, weil auch Frauen von Vorgesetzten<br />
lieber für ihre Leistung gelobt werden. Trainerinnen,<br />
die Bosse für Machtmissbrauch sensibilisieren, gibt es<br />
kaum. Stattdessen wird Frauen beigebracht, wie sie<br />
sich per „Arroganz-Prinzip“ in einen Macho ver wandeln,<br />
wenn sie auf der Führungsebene mitreden möchten.<br />
Sprechen Frauen Sexismus offen an, fühlen sich Männer<br />
oft in der Defensive. Das scheint bei vielen reflexhaft<br />
eine Verbrüderung auszulösen. Das Erobern liege nun<br />
mal in der Natur des Mannes. Echte Kerle benähmen sich<br />
manchmal daneben.<br />
Und sind Frauen nicht selbst schuld? Hinter vorgehaltener<br />
Hand heißt es dann, Frauen würden Sexismus nur<br />
beklagen, wenn er ihnen nicht nutze. Praktikantinnen,<br />
die jede Woche vom Chef einen Kaffee spendiert bekämen,<br />
würden schließlich auch nicht mit einer Ohrfeige<br />
ablehnen.<br />
Ja, es gibt Frauen, die Netzstrumpfhosen einsetzen,<br />
um Aufträge an Land zu ziehen, und das ist bedauerlich.<br />
Aber es gibt auch immer noch zu viele männliche<br />
Führungskräfte, die Jobs nach Attraktivität statt nach<br />
Kompetenz vergeben. Viele Männer entwickeln erst ein<br />
Bewusstsein für Sexismus,<br />
wenn sie selbst zum Opfer<br />
werden. Erst dann können sie<br />
verstehen, wie sich Scham<br />
und Hilflosigkeit anfühlen.<br />
Oder es ist die Geburt einer<br />
Tochter, die Männer zu Feministen<br />
werden lässt. Wenn es<br />
die eigene Tochter betrifft,<br />
nehmen sie das Verhalten<br />
LOUISE MACKINTOSH<br />
ihrer Geschlechtsgenossen<br />
plötzlich als potenziell bedrohlich<br />
wahr und fragen sich,<br />
was man gegen sexuelle Übergriffe<br />
tun kann.<br />
Es stimmt nicht, dass sexuelle<br />
Belästigung Männer, die<br />
sich selbst nichts vorzuwerfen<br />
haben, nichts angeht. Wer<br />
schweigt, schützt die Täter<br />
und stützt ein System, das<br />
Frauen klein halten will. Es<br />
mag Überwindung kosten<br />
und ungewohnt sein: Aber<br />
warum ist es so schwer, den Kollegen, von dem alle<br />
wissen, dass er immer wieder Praktikantinnen belästigt,<br />
darauf kritisch anzusprechen? Es wäre jedenfalls wirkungsvoller,<br />
wenn Männer Männern Grenzen setzen würden,<br />
bevor eine Frau zum Aufschrei ansetzt. Und natürlich<br />
müssen sich die Machtstrukturen ändern: Wer zum Beispiel<br />
dafür sorgt, dass in Unternehmen genauso viele<br />
Frauen wie Männer das Sagen haben, schafft eine Atmosphäre<br />
der Gleichberechtigung, in der Machtmissbrauch<br />
seltener ist.<br />
Man muss seinen Nebensitzer im Büro nicht gleich beim<br />
Chef denunzieren, wenn er gehässige Witzchen über die<br />
Körperfülle einer Kollegin macht. Aber muss man mit -<br />
lachen? Es reicht nicht aus, wenn Frauen Sexismus offen<br />
ansprechen. Die Männer müssen mitreden. Den Leitartikel<br />
zur nächsten Aufschrei-Debatte darf dann gern ein Kollege<br />
schreiben.<br />
Anna Clauß<br />
8 DER SPIEGEL 43 / 2017
Jetzt<br />
umsteigen.<br />
Jetzt 1.000 €<br />
Umtauschprämie 4,5<br />
zusätzlich zu unseren attraktiven<br />
Angeboten sichern.<br />
‡ Die smart Umtauschprämie.<br />
Unser Leasingbeispiel für Privatkunden: 5<br />
Kaufen Sie eines unserer smart Modelle und sichern Sie sich dabei finanzielle<br />
Vorteile.³ Geben Sie Ihren gebrauchten Diesel mit Euro-4-Norm, ganz gleich<br />
welcher Marke, bei einem teilnehmenden smart Vertriebspartner in Zahlung und<br />
erhalten Sie zusätzlich zum Ankaufspreis eine Umtauschprämie von 1.000 Euro. 5<br />
Besitzer eines gebrauchten Diesels mit Euro-1- bis Euro-3-Norm erhalten vom<br />
teilnehmenden smart Vertriebspartner, markenunabhängig, zusätzlich zur<br />
Umtauschprämie einen Wertausgleich für ihr Altfahrzeug, sofern dessen Entsorgung<br />
nachgewiesen wird. 5 Mehr Infos unter www.smart.de<br />
smart forfour<br />
52 kW¹<br />
smart fortwo<br />
coupé 52 kW¹<br />
Kaufpreis² 11.765,00 € 11.105,00 €<br />
Leasing-Sonderzahlung 0,00 € 0,00 €<br />
Gesamtkreditbetrag 11.765,00 € 11.105,00 €<br />
Gesamtbetrag 5.232,00 € 5.232,00 €<br />
Laufzeit in Monaten 48 48<br />
Gesamtlaufleistung 40.000 km 40.000 km<br />
Sollzins gebunden p. a. – 4,85 % – 4,69 %<br />
Effektiver Jahreszins – 4,74 % – 4,59 %<br />
48 mtl. Leasingraten à 3 109,00 € 109,00 €<br />
smart – eine Marke der Daimler AG<br />
¹ Kraftstoffverbrauch: 4,9-4,8 l/100 km (innerorts), 3,8-3,7 l/100 km (außerorts), 4,2-4,1 l/100 km (kombiniert), CO 2 -Emissionen (kombiniert): 97-93 g/km. Energieeffizienzklasse B.<br />
Die angegebenen Werte wurden nach dem jeweils vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. ² Unverbindliche<br />
Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler Überführungskosten. Andere Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten gegen Aufpreis möglich. ³ Ein Leasingbeispiel<br />
der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart. Stand 01.09.2017. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss<br />
ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 4 Erwerben Sie eines unserer smart Modelle und sichern Sie sich dabei finanzielle Vorteile. Geben Sie Ihren gebrauchten<br />
Diesel mit Euro-4-Norm, ganz gleich welcher Marke, bei einem teilnehmenden smart Vertriebspartner in Zahlung und erhalten Sie zusätzlich zum Ankaufspreis<br />
eine Umtauschprämie von 1.000 Euro. Besitzer eines gebrauchten Diesels mit Euro-1- bis Euro-3-Norm erhalten von dem teilnehmenden smart Vertriebspartner, markenunabhängig,<br />
zusätzlich zur Umtauschprämie einen Wertausgleich für ihr Altfahrzeug, sofern dessen Entsorgung nachgewiesen wird. Altfahrzeug mind. 6 Monate auf<br />
Käufer zugelassen und weitere Voraussetzungen. Das Angebot gilt vom 02.08. bis zum 31.12.2017 (Auftragseingang), sofern die berechnete Lieferung bis zum 31.03.2018<br />
erfolgt. Nur solange der Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden smart Händlern. 5 Ein Leasing ist bei Inanspruchnahme des Wertausgleichs nicht immer möglich.<br />
Ob für Ihr Wunschfahrzeug ein Leasingangebot möglich ist, erfahren Sie bei Ihrem smart center. Leasingrechnung ohne Berücksichtigung der Umtauschprämie.<br />
Abbildung zeigt Sonderausstattung.<br />
Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
Meinung<br />
Jan Fleischhauer <strong>Der</strong> schwarze Kanal<br />
Mit Rechten leben<br />
Ich wünschte, Fritz Teufel<br />
wäre zurück. Ich<br />
hätte nie gedacht,<br />
dass ich die Achtundsechziger<br />
einmal vermissen<br />
würde, aber<br />
so ist es. Für alle, die<br />
nach 1980 geboren wurden<br />
und nicht wissen, von<br />
wem ich rede: Fritz Teufel war Mitbegründer<br />
der Kommune 1, einer der Keimzellen<br />
der Studentenbewegung, und Erfinder der<br />
„Spaßguerilla“, die vor 50 Jahren durch ihre<br />
Provokationen die Zeitgenossen in Atem<br />
hielt. Berühmt wurde Teufel durch einen<br />
Auftritt in einer Talkshow, bei dem er eine<br />
Pistole gegen den Finanzminister richtete.<br />
Es war zum Glück nur eine Wasserpistole.<br />
Wie ich auf Teufel komme? Ich war vergangene<br />
Woche auf der Buchmesse in<br />
Frankfurt. Über 7000 Verlage hatten sich<br />
angemeldet. Salman Rushdie war da, Dan<br />
Brown, Margaret Atwood. Aber das eigentliche<br />
Thema der Messe war der Auftritt des<br />
Antaios Verlags, eines Kleinstverlags aus<br />
Sachsen-Anhalt, der sich auf rechte Erweckungsliteratur<br />
spezialisiert hat.<br />
Am ersten Messetag rückten mehrere<br />
Mitglieder des Börsenvereins an und hielten<br />
Plakate gegen „Rassismus“ hoch. <strong>Der</strong><br />
Frankfurter Oberbürgermeister verteilte<br />
vor dem Stand Flyer, die für die Aktion<br />
„Mut – Mutiger – Mund auf“ warben. Eine<br />
Lesung endete im Tumult, als Demonstranten<br />
zu schreien anfingen.<br />
Mich erinnerten die Protestler an Nonnen,<br />
die sich vor Kinos aufstellen, in denen<br />
unzüchtige Filme gezeigt werden. Selbst<br />
gemalte Plakate, die man in die Höhe reckt,<br />
Kittihawk<br />
um das Böse zu vertreiben, und wenn einem<br />
gar nichts mehr einfällt, fängt man zu<br />
kreischen an? Wenn ich ein Linker wäre,<br />
würde ich mich schämen, ehrlich.<br />
Vielleicht ist es unvermeidlich, dass eine<br />
Bewegung an Agilität einbüßt, wenn sie in<br />
die Jahre kommt. Man kann sich auch geistig<br />
einen Bauchansatz zulegen, wie sich<br />
zeigt. Wer zu lange an der Macht ist, gewöhnt<br />
sich daran, dass er das Sagen hat,<br />
das macht träge.<br />
Die Wahrheit ist, dass die Leute vom<br />
Antaios Verlag mehr von Fritz Teufel und<br />
der Spaßguerilla gelernt haben als die<br />
kreuzbraven Gestalten, die ihm und seinen<br />
Genossen politisch nachfolgten. Heute sind<br />
es die Rechten, die mit ihren Provokationen<br />
die Öffentlichkeit aufschrecken. Dabei<br />
reicht oft schon ein Wort, und alle drum<br />
herum fallen in Ohnmacht oder rufen vor<br />
Schreck „Nazi, Nazi“.<br />
Wenn man keine echten Nazis zur Hand<br />
hat, nimmt man eingebildete. Am Samstag<br />
machte die Nachricht die Runde, der Frankfurter<br />
Stadtverordnete Nico Wehnemann<br />
von der Spaßpartei „Die Partei“ sei auf der<br />
Messe zusammengeschlagen worden, weil<br />
er gegen die Büchernazis protestiert habe.<br />
Wie sich herausstellte, war Wehnemann<br />
beim Versuch, eine Absperrung zu durchbrechen,<br />
von einem Sicherheitsmann zu<br />
Boden gebracht worden. Nicht einmal die<br />
Wasserpistole, mit der man früher Finanzminister<br />
erschreckte, funktioniert noch richtig.<br />
Es wird wirklich Zeit, dass der Geist<br />
von Fritz Teufel wieder in die Linke fährt.<br />
An dieser Stelle schreiben Jakob Augstein,<br />
Jan Fleischhauer und Markus Feldenkirchen im Wechsel.<br />
Im Zentrum<br />
der Macht<br />
So gesehen Alle wollen<br />
Bundestagsvizepräsident<br />
werden.<br />
Ich muss zugeben, es gibt in<br />
der Berliner Politik ein Amt,<br />
dessen Bedeutung ich bisher<br />
krass unterschätzt habe: das<br />
des Bundestagsvizepräsidenten.<br />
Ich hatte es immer für<br />
ein ehrenvolle, aber doch<br />
eher zeremonielle Aufgabe<br />
gehalten, als einer von sechs<br />
Stellvertretern des Bundestagspräsidenten<br />
hin und<br />
wieder eine Sitzung des Parlaments<br />
zu leiten. Aber so<br />
kann man sich irren. Diese<br />
Woche hat mir gezeigt, dass<br />
der Job tatsächlich im Zentrum<br />
des Berliner Macht -<br />
pokers steht: heiß begehrt,<br />
leidenschaftlich umkämpft<br />
und ein zentraler Bau stein<br />
im innerparteilichen Posten -<br />
geschacher.<br />
Die FDP zum Beispiel ist<br />
personell eher schwach aufgestellt.<br />
Sie hat genau zwei<br />
Politiker, denen man bisher<br />
ein Spitzenamt in Berlin zutraute.<br />
Und raten Sie mal:<br />
einer von ihnen wird Bundestagsvize.<br />
Das zeigt doch,<br />
welch überragende Bedeutung<br />
Parteichef Christian<br />
Lindner dem Amt beimisst.<br />
Ich hoffe nur, dass Wolfgang<br />
Kubicki das auch so sieht.<br />
Bei der SPD ist es andersrum:<br />
Da gibt es zu viele Spitzenpolitiker<br />
für die paar Posten,<br />
die eine abgewählte Regierungspartei<br />
zu vergeben<br />
hat. Deshalb ist um die Vizepräsidentschaft<br />
ein Wettstreit<br />
entbrannt, wie ihn die Partei<br />
lange nicht mehr erlebt hat.<br />
Es wird eine Kampfkandidatur<br />
dreier Spitzensozis geben.<br />
Drei! Die Schicksalszahl<br />
der Sozialdemokratie, wie<br />
oft konkurrierten drei um<br />
die Macht. Und jetzt: Kanzlerkandidat<br />
wollte keiner<br />
werden, aber Bundestagsvizepräsident,<br />
das wollen sie<br />
alle. Christiane Hoffmann<br />
10 DER SPIEGEL 43 / 2017
ENTDECKEN<br />
beginnt hier<br />
R I C H M O N D<br />
JACKET<br />
leichtgewichtige Daune /<br />
warme Wattierung / winddicht<br />
/ verstärkte Schultern<br />
Outdoor Performance mit Style.<br />
jack-wolfskin.com
5 MIO. MENS<br />
53 STÄDT<br />
1 METROP<br />
DIE METROPOLE RUHR IST MEHR ALS NUR EINE STADT.<br />
SIE IST URBANER BALLUNGSRAUM, WIRTSCHAFTLICHES<br />
HERZ EUROPAS, HEIMAT FÜR MILLIONEN – UND NOCH<br />
VIEL MEHR. SIE IST: DIE STADT DER STÄDTE.<br />
MEHR UNTER WWW.METROPOLE.RUHR
CHEN.<br />
E.<br />
OLE.
„Macht ist wie Alkohol“<br />
Sexismus Unter #MeToo brechen Millionen Frauen und Männer das Schweigen<br />
über sexuelle Belästigung im Alltag. Die Wucht ihrer Berichte erreicht<br />
auch Politik und Wirtschaft. Vor allem Führungsleute müssen sensibilisiert werden.<br />
14 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Margot Wallström zum Beispiel, die<br />
schwedische Außenministerin.<br />
„Me too“, schreibt sie am Mittwochnachmittag<br />
auf Facebook. Nur diese<br />
zwei Worte. „Ich auch.“ Und alle wissen,<br />
was sie meint: Auch ich habe sexuelle Belästigung<br />
erfahren.<br />
Es folgen, wie üblich, beleidigende Kommentare:<br />
„Ich bezweifle, dass das passiert<br />
ist. Wer würde dich schon belästigen?“ Andere<br />
kommentieren schlicht: „Me too.“<br />
Zwei Worte reichen, damit eine globale<br />
Bewegung entsteht. Eine Bewegung der<br />
Herabgewürdigten, der Belästigten, der<br />
Misshandelten. Eine Bewegung von Betroffenen,<br />
die bislang anonym und passiv waren.<br />
Nun haben sie Millionen Namen und<br />
Gesichter und teilen der Welt ihre Geschichten<br />
mit.<br />
Seit Sonntag twittern und posten Frauen<br />
und wenige Männer in den sozialen Netzwerken<br />
unter #MeToo ihre Erfahrungen<br />
mit sexuellen Übergriffen. Darunter sind<br />
Prominente, Politikerinnen, Schauspielerinnen,<br />
Sportlerinnen. Ein detailliertes Archiv<br />
über Berichte von Macht und Missbrauch<br />
ist so entstanden, ein digitales Dokument<br />
der Schande.<br />
Das Mächtige an diesem Hashtag ist seine<br />
Bescheidenheit. #MeToo hat nicht den<br />
Anstrich des Politischen, er ruft nicht zum<br />
Protest auf. Er trägt auch nicht die Em -<br />
pörung in seinem Namen, wie einst<br />
#Aufschrei nach der Affäre um Rainer Brüderle<br />
von der FDP, der die „Stern“-Reporterin<br />
Laura Himmelreich mit einer anzüglichen<br />
Dirndl-Bemerkung belästigt hatte.<br />
#MeToo ist zunächst nur eine Erhebung<br />
und die stille Einladung, ein massives Alltagsproblem<br />
zu betrachten. #MeToo heißt:<br />
Hör erst mal zu.<br />
Natürlich, die Debatte um sexuelle Belästigung<br />
ist nicht neu. Sie wurde nach<br />
Brüderle geführt und nach der Kölner Silvesternacht.<br />
Sie wurde nach Sebastian Edathy,<br />
nach dem Gerichtsverfahren gegen<br />
Gina-Lisa Lohfink geführt und nach der<br />
„Grab the pussy“-Bemerkung von Donald<br />
Trump. Und auch, nachdem die CDU-Politikerin<br />
Jenna Behrends in einem offenen<br />
Brief schrieb, dass der damalige Berliner<br />
Innensenator Frank Henkel sie als „große<br />
süße Maus“ bezeichnet haben soll.<br />
Die Debatte erreichte den Bundestag und<br />
veränderte Gesetze. Zweimal wurde in den<br />
vergangenen vier Jahren das Sexualstrafrecht<br />
verschärft: Seit Januar 2015 macht<br />
sich strafbar, wer Nacktbilder von Kindern<br />
und Jugendlichen zu kommerziellen Zwecken<br />
herstellt oder anderen anbietet. Im<br />
November 2016 wurde der Tatbestand der<br />
sexuellen Belästigung ins Strafgesetzbuch<br />
eingeführt. Wer eine andere Person „in sexuell<br />
bestimmter Weise körperlich berührt<br />
und dadurch belästigt“, muss nun mit einer<br />
Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder<br />
mit einer Geldstrafe rechnen.<br />
Mithilfe des neuen Paragrafen 184i des<br />
Strafgesetzbuches sollen Handlungen wie<br />
das Berühren von Po und Brüsten sowie<br />
das plötzliche Küssen leichter als Straftat<br />
geahndet werden können. Es ist ein Paragraf<br />
gegen Grapscher.<br />
Doch es gibt auch die andere Seite: 2015<br />
veröffentlichte die Antidiskriminierungsstelle<br />
des Bundes eine repräsentative Befragung.<br />
Demnach gaben 49 Prozent der<br />
Frauen an, schon einmal eine „gesetzlich<br />
verbotene Belästigung am Arbeitsplatz“<br />
erlebt zu haben – meistens im Büro (56<br />
Prozent), bei Betriebsfesten (48 Prozent),<br />
auf Fluren oder im Fahrstuhl (35 Prozent).<br />
Ein Jahr zuvor hatte eine Studie unter<br />
dem Titel „Truppenbild ohne Dame?“ des<br />
Zentrums für Militärgeschichte und Sozial -<br />
wissenschaften der Bundeswehr für Aufsehen<br />
gesorgt. Demnach waren 55 Prozent<br />
der mehr als 3000 befragten Frauen in ihrer<br />
Bundeswehrzeit sexuell belästigt worden:<br />
47 Prozent berichteten über „Bemerkungen/Witze<br />
sexuellen Inhalts“, 25 Prozent<br />
über das „unerwünschte Zeigen oder<br />
sichtbare Anbringen pornografischer Darstellungen“.<br />
24 Prozent der Befragten,<br />
also mehr als 700 Soldatinnen, waren körperlich<br />
belästigt worden, etwa durch sexuell<br />
motivierte Berührungen an Brust<br />
oder Po, während drei Prozent – also<br />
mehr als 90 Frauen – angaben, Handlungen<br />
sexueller Nötigung oder Vergewaltigung<br />
erlebt zu haben.<br />
<strong>Der</strong> öffentliche Aufschrei über die Zustände<br />
der Truppe hallte seinerzeit nicht<br />
besonders lange nach.<br />
Heute erzählen nur we -<br />
nige Politikerinnen offen<br />
von ihren Erfahrungen<br />
sexueller Erniedrigung.<br />
Aber es sind nicht nur traditionelle Männerbünde,<br />
in denen sich Frauen besonders<br />
oft sexistischer Angriffe erwehren müssen.<br />
Eine im Jahr 2000 erhobene Befragung unter<br />
1062 Münchner Berufsschülerinnen und<br />
Auszubildenden ergab eine Art Branchen-<br />
Ranking. Demnach wurden weibliche Azubis<br />
im Hotel- und Gaststättenbereich besonders<br />
häufig sexuell belästigt (84 Prozent),<br />
gefolgt von ihren Kolleginnen in<br />
technischen und handwerklichen Berufen<br />
(60 bis 66 Prozent).<br />
Ausgerechnet die Politik ahndet eine allzu<br />
große Offenheit der Betroffenen hart:<br />
Abgeordnete, die noch vor vier Jahren in<br />
der #Aufschrei-Kampagne ihre Erlebnisse<br />
geschildert hatten, wurden plötzlich bei<br />
der Postenvergabe übersehen. Ihr Protest<br />
wurde zu einem Stigma. Heute erzählen<br />
deshalb nur wenige Politikerinnen offen<br />
von ihren Erfahrungen sexueller Erniedrigung.<br />
Bundesfamilienministerin Katarina<br />
Barley von der SPD gehört dazu.<br />
Barley kennt solche Situationen noch<br />
aus ihrer aktiven Zeit als Juristin. Einmal<br />
habe der Chef ihr mitgeteilt, es sei doch<br />
sehr gut, dass sie einen Doktortitel habe.<br />
<strong>Der</strong> würde sie davor bewahren, für seine<br />
Sekretärin gehalten zu werden. Auch in<br />
der Politik, sagt die Ministerin, komme<br />
man gerade als jüngere Frau immer noch<br />
häufig in die Situation, dass das Frausein<br />
thematisiert werde – sei es durch Bemerkungen<br />
über die Kleidung, über das Auftreten,<br />
über den Charme. „Unzählige kleine<br />
Begebenheiten“, sagt Barley.<br />
Sie glaubt, die meisten Männer dächten,<br />
sie würden den Frauen etwas Gutes tun,<br />
wenn sie sie lobten. „In Wirklichkeit geht<br />
es um Macht“, sagt Barley. „Viele Männer<br />
verstehen nicht, dass in ihren Bemerkungen<br />
etwas Gönnerhaftes liegt, dass die Bewertung<br />
der Frau auch zeigt, dass der, der<br />
bewertet, die Macht hat, dies zu tun.“ Barley<br />
glaubt, dass #MeToo helfen kann, aber<br />
dass auch die Politik gefragt ist. „Das<br />
Machtgefälle zwischen Männern und Frauen<br />
muss beseitigt werden. Die Lohnlücke<br />
muss geschlossen werden, es müssen so<br />
viele Frauen wie Männer in den Parlamenten<br />
sein, Elternzeit muss genauso Frauenwie<br />
Männeraufgabe sein.“<br />
Vielleicht ist #MeToo nur eine neue<br />
Erregungswelle von vielen, vielleicht ebbt<br />
sie schnell wieder ab. Vielleicht aber reicht<br />
diesmal ihre Wucht aus, um die gesell-<br />
FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL
Titel<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
15
schaftliche Debatte endlich nachhaltig zu<br />
führen. Viele schreiben, #MeToo habe sie<br />
ermuntert zu berichten, was sie sich früher<br />
zu sagen nicht getraut hätten. Traumata<br />
brauchen Zeit, um erzählt zu werden.<br />
Die Kampagne begann mit einem Tweet<br />
der amerikanischen Schauspielerin Alyssa<br />
Milano. Sie ist vor allem bekannt aus der<br />
Fernsehserie „Charmed“. Sie nutzte den<br />
Hashtag, den die afroamerikanische Aktivistin<br />
Tarana Burke vor mehr als zehn Jahren<br />
in die Welt gesetzt hatte. Burke wollte<br />
auf den weitverbreiteten sexuellen Missbrauch<br />
von Mädchen aufmerksam machen.<br />
Heute freut sie sich über den späten Erfolg<br />
ihrer Idee. Am vergangenen<br />
Sonntag rief Alyssa Milano<br />
dazu auf, unter #MeToo von<br />
sexuellen Übergriffen zu berichten.<br />
Im Laufe des Tages<br />
nutzten 13200 Menschen den<br />
Hashtag, einen Tag später waren<br />
es schon 283300. Im Laufe<br />
der Woche verbreitete sich<br />
das Kennwort millionenfach<br />
über die sozialen Netzwerke<br />
und führte die Debatte aus<br />
dem Ort hinaus, an dem sie<br />
begann: aus Hollywood.<br />
Die Enthüllungen über<br />
Filmproduzent Harvey Weinstein<br />
hatten mit einer Recherche<br />
der „New York Times“ begonnen,<br />
bei der sich Schauspielerinnen<br />
meldeten, die<br />
von Belästigungen durch ihn<br />
berichteten. Fünf Tage später<br />
war es dann eine Geschichte<br />
im „New Yorker“, die lange<br />
vorbereitet war: Hier war von<br />
drei Vergewaltigungsvorwürfen<br />
und zahlreichen anderen<br />
Fällen von sexueller Nötigung<br />
die Rede.<br />
Hollywood reagierte mit<br />
bislang ungekannter Konsequenz.<br />
<strong>Der</strong> Produzent wurde von seiner<br />
eigenen Firma entlassen. Die Oscar-Academy<br />
schloss Harvey Weinstein aus –<br />
kaum ein Produzent war mit seinen Filmen<br />
so oft nominiert gewesen.<br />
Es schien, als hätte Hollywood ein<br />
schlechtes Gewissen. In dieser Industrie<br />
galt es lange als normal, dass junge Schauspielerinnen<br />
mit Regisseuren und Produzenten<br />
ins Bett gehen mussten, um Rollen<br />
zu bekommen.<br />
Roman Polanski wurde 1977 in Los Angeles<br />
wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen<br />
angeklagt und entzog sich der Justiz<br />
durch Flucht nach Europa. Bis heute<br />
muss er damit rechnen, bei der Einreise in<br />
die USA verhaftet zu werden. Hollywood<br />
half ihm dennoch bei der Finanzierung<br />
seiner Filme und verlieh ihm 2003 für sein<br />
Holocaust-Drama „<strong>Der</strong> Pianist“ einen<br />
Oscar.<br />
16 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Dass Woody Allens Adoptivtochter Dylan<br />
Farrow den Vorwurf erhob, von ihm<br />
als Kind sexuell missbraucht worden zu<br />
sein, hat seiner Karriere nicht geschadet.<br />
Allen bestritt die Vorwürfe, juristisch konnten<br />
sie nie geklärt werden. Nun warnte Allen<br />
im Zuge des Weinstein-Skandals vor<br />
einer „Hexenjagd“. Dabei war es ausgerechnet<br />
einer seiner Söhne, Ronan Farrow,<br />
der den Fall über Monate recherchiert und<br />
im „New Yorker“ veröffentlicht hatte.<br />
In Hollywood reicht das Problem tief:<br />
Ungefähr 70 Prozent der Hauptfiguren in<br />
Hollywoodfilmen sind Männer, 97 Prozent<br />
der Kameraleute sind Männer, nur 11 Prozent<br />
der Drehbücher werden von Frauen<br />
geschrieben. Es dominieren der männliche<br />
Blick, die männliche Erzählweise, männliche<br />
Sehnsüchte, männliches Anspruchsdenken<br />
und Übergriffigkeit.<br />
Männer wie Weinstein empfinden ein<br />
Gefühl der Allmacht. Es ist auch in der Politik<br />
weit verbreitet. Die Skandale um Bill<br />
Clinton, der eine Affäre mit seiner Praktikantin<br />
Monica Lewinsky hatte (auch sie<br />
postete #MeToo), und Anthony Weiner,<br />
Kongressabgeordneter der Demokraten,<br />
der eine 15-Jährige mit Sexbotschaften<br />
überhäufte, zeigen, wie das Gefühl zu realem<br />
Missbrauch führen kann.<br />
Man mag die amerikanische Debatte für<br />
hysterisch halten, konsequent aber ist sie.<br />
Männer wie Weinstein werden bis an den<br />
Rand der existenziellen Vernichtung bestraft.<br />
Volle Namen von mutmaßlichen Tätern<br />
werden genannt, wenn der Verdacht<br />
gegen sie hart genug ist, auch in den Zeitungen<br />
und im Internet.<br />
In Deutschland gibt es eine vergleich -<br />
bare Kultur des öffentlichen Anprangerns<br />
nicht. #MeToo ist bislang nur eine Bewegung<br />
der Betroffenen; die Täter bleiben<br />
anonym. Das hat auch Vorteile: Wie groß<br />
wäre die Gefahr der unbelegten Diffamierung?<br />
Die Folge ist nur, dass sich die Männer<br />
aus der aktuellen Diskussion weitgehend<br />
heraushalten.<br />
Es ist deshalb wichtig, dass die Bewegung<br />
das Digitale verlässt und als Debatte<br />
zwischen Männern und Frauen, Angestellten<br />
und Vorgesetzten, Freunden und Bekannten<br />
fortgesetzt wird. Dass sie<br />
aus den intellektuellen Zirkeln<br />
auch zu denen vordringt, die täglich<br />
Sexismus erleben, ohne<br />
abends die Worte zu finden, ihren<br />
Missbrauch auf Facebook zu teilen.<br />
Egal ob Frauen oder Männer<br />
betroffen sind. Es geht um ihre<br />
Abhängigkeit von den Täterinnen<br />
oder Tätern.<br />
Eine gemeinsame Empörung gegen<br />
sexuelle Übergriffe gibt es bisher<br />
nur da, wo es um Kinder geht.<br />
Hier bleibt das Geschlecht bei -<br />
seite, weil jedem der Machtmissbrauch<br />
offensichtlich ist. Dass<br />
auch erwachsene Betroffene oft<br />
physisch, psychisch oder sozial unterlegen<br />
sind und sich deshalb<br />
nicht wehren, fehlt in der aktuellen<br />
Debatte. #MeToo könnte ein<br />
Katalysator zur Veränderung sein.<br />
Das, was die digitale Bewegung<br />
nicht leisten kann, muss der gesellschaftliche<br />
Diskurs erreichen:<br />
differenzieren. Zwischen Verhalten,<br />
das nicht geht, weil es strafbar<br />
ist – und Verhalten, das der oder<br />
die eine als noch akzeptabel empfindet,<br />
der oder die andere aber<br />
nicht.<br />
Wenn der Chef seine Hand auf das Bein<br />
seiner Angestellten legt, wenn er wie zufällig<br />
die Brust oder den Po berührt, dringt<br />
er in die persönliche Intimsphäre der Frau<br />
ein und macht sich, handelt er gegen ihren<br />
Willen, strafbar. Es ist ein verwirrender,<br />
manchmal verstörender Moment, der die<br />
Betroffenen sprachlos macht. Wut, Abscheu<br />
und Scham stellen sich oft erst mit<br />
Verzögerung ein. Wenn so etwas am Arbeitsplatz<br />
geschieht, ist es schwierig, sich<br />
danach wieder normal zu begegnen. Gut<br />
möglich, dass manche Grapscher keine<br />
Vorstellung haben, wie zerstörerisch so ein<br />
Moment sein kann. Deshalb muss auch in<br />
Unternehmen über solche Situationen offen<br />
gesprochen werden.<br />
Wenn der US-amerikanische Vizepräsident<br />
Mike Pence sagt, er würde keine Frauen<br />
mehr zu Vieraugengesprächen treffen,<br />
damit ihm danach keine Vorwürfe gemacht<br />
FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL
Titel<br />
werden könnten, wenn Männer erzählen,<br />
sie würden sich nicht mehr trauen, allein<br />
mit Frauen im Aufzug zu fahren, liegt darin<br />
eine trostlose Perspektive. Andererseits<br />
ist es tatsächlich so, dass gerade Führungskräfte<br />
das größte Potenzial haben, zu Tätern<br />
zu werden.<br />
„Macht korrumpiert“, sagt der Kölner<br />
Psychologe Joris Lammers, „Menschen in<br />
Spitzenpositionen verändern ihr Verhalten.“<br />
Sie werden aktiver, auch sexuell.<br />
Lammers hat Männer und Frauen zu ihrem<br />
Seitensprungverhalten befragt und herausgefunden,<br />
dass Personen mit Führungsverantwortung<br />
häufiger fremdgehen als einfache<br />
Angestellte. Er hat außerdem<br />
ein ganz einfaches Experiment<br />
durchgeführt: Er ließ Studienteilnehmer<br />
am Computer<br />
auf einen Luftballon klicken.<br />
Mit jedem Klick erhöhte sich<br />
der eigene Kontostand, aber<br />
auch die Gefahr, dass der Ballon<br />
platzt und der Versuchsteilnehmer<br />
gar nichts gewinnt. „Je<br />
mächtiger die Person war, desto<br />
häufiger platzte der Ballon“,<br />
sagt Lammers. Menschen würden<br />
risikofreundlicher und<br />
selbstbewusster, je mehr Macht<br />
sie haben. „Das gilt für Männer<br />
und Frauen“, betont Lammers.<br />
Er glaubt deshalb nicht, dass<br />
Frauen ihre Macht weniger ausnutzen<br />
würden als Männer.<br />
„Macht ist wie Alkohol“, sagt<br />
Lammers, „sie lässt dich Risiken<br />
ausblenden.“ Männer und Frauen<br />
in Spitzenpositionen würden<br />
dazu neigen, sich das zu nehmen,<br />
was sie gerade wollen, was<br />
sexuell übergriffiges Verhalten<br />
begünstigen würde. Warum werden<br />
dann aber mehr Männer als<br />
Frauen auf frischer Tat ertappt?<br />
Lammers glaubt, „dass es vielleicht<br />
weniger als Skandal gesehen wird,<br />
wenn Frauen Untergebene verführen. Und<br />
sich die Männer möglicherweise auch weniger<br />
laut beschweren.“ <strong>Der</strong> französische<br />
Staatspräsident Emmanuel Macron hat die<br />
Lehrerin, mit der er als Schüler eine Liebesaffäre<br />
hatte, auch nicht verklagt, sondern<br />
später geheiratet.<br />
„<strong>Der</strong> beste Weg, Menschen vom Machtmissbrauch<br />
abzuhalten, ist, ihnen klarzumachen,<br />
dass sie die Macht verlieren können“,<br />
sagt Lammers. Deswegen sei auch<br />
der Fall Weinstein so wichtig und die<br />
#MeToo-Debatte im Netz. Experimente<br />
hätten gezeigt, dass es Chefs meistens gar<br />
nicht leiden können, wenn auf dem Gang<br />
über sie getuschelt wird. „Wenn sie nun<br />
befürchten müssen, dass ein anzüglicher<br />
Kommentar sie zum Gespött der Belegschaft<br />
macht, werden sie vielleicht vor -<br />
sichtiger.“<br />
Janina Kugel, 47, Personalvorstand bei<br />
Siemens, kennt sie noch, die bleierne Zeit,<br />
in der Frauen in der deutschen Wirtschaft<br />
häufig zwei Aufgaben zugewiesen wurden:<br />
Kaffee kochen und dem Chef auch anderweitig<br />
zu Diensten zu sein. Zum Glück seien<br />
diese Zeiten inzwischen vorbei. Janina<br />
Kugel hat daran selbst großen Anteil. Noch<br />
vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen,<br />
die rund 350 000 Siemens-Mitarbeiter<br />
in aller Welt einer Frau zu unterstellen,<br />
darunter viele Techniker und Ingenieure.<br />
Heute wird nicht nur dieses wichtige Ressort<br />
von einer Managerin betreut, Konzernchef<br />
Joe Kaeser hat darüber hinaus<br />
Triebgesteuert<br />
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung insgesamt<br />
2015<br />
darunter<br />
Vergewaltigung und<br />
sexuelle Nötigung<br />
7558<br />
2016<br />
8001<br />
2015 2016<br />
noch rund ein Dutzend weitere Schlüsselfunktionen<br />
in weibliche Hand gelegt, beispielsweise<br />
die Abteilung Investor Rela -<br />
tions und die wichtige Energiesparte.<br />
Die Kultur habe sich merklich geändert,<br />
berichtet ein enger Vertrauter von Kaeser.<br />
„Anzügliche Macho-Sprüche sind in der<br />
Zentrale inzwischen verpönt.“ Auch eine<br />
Schwangerschaft sei kein Grund mehr,<br />
„sich beruflich selbst zu entleiben und nur<br />
noch Teilzeit zu arbeiten. Das leben die<br />
Frauen im Siemens-Management inzwischen<br />
vor“.<br />
Die Zäsur im Denken lässt sich mittlerweile<br />
auch in Schriftform nachlesen – in<br />
den gerade neu erschienenen Verhaltensrichtlinien<br />
des Konzerns für Mitarbeiter.<br />
„Wir dulden keinerlei Diskriminierung, keine<br />
sexuelle Belästigung oder sonstige persönliche<br />
Angriffe auf einzelne Personen.“<br />
Auch andere Unternehmen haben diese<br />
in Deutschland<br />
erfasste Fälle,<br />
Quelle: Polizeiliche<br />
Kriminalstatistik,<br />
Jahrbuch 2016<br />
§§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB § 177 Abs. 1 und 5 StGB<br />
7022<br />
46081<br />
7919<br />
2015 2016<br />
47401<br />
exhibitionistische<br />
Handlungen und Erregung<br />
öffentl. Ärgernisses<br />
sonstige sexuelle<br />
Nötigung<br />
Selbstverständlichkeiten inzwischen in<br />
Verhaltenkodices verpackt.<br />
Die hehren Worte spiegeln nicht immer<br />
die Realität wider: In öffentlichen Veranstaltungen<br />
sind Frauen als Expertinnen immer<br />
noch in der Minderheit: Von 23181 Vortragen -<br />
den auf 453 Veranstaltungen waren nur 6103<br />
Frauen, berichtet das Projekt „50 Prozent“.<br />
Männer dominieren die öffentliche Debatte,<br />
was ein Grund dafür sein kann, dass das Thema<br />
auch in der Politik oft nachrangig ist.<br />
Im Wahlkampf spielte das Thema zumindest<br />
bei den linken Parteien eine Rolle.<br />
Die SPD forderte einen Aktionsplan zur<br />
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.<br />
Die Grünen setzten ebenso wie<br />
die Linke auf umfassende Schulungen<br />
für Polizei und Justiz, damit<br />
sie im Umgang mit Betroffenen<br />
von sexueller Gewalt<br />
sensibilisiert werden. Außerdem<br />
soll es nach ihrem Willen für<br />
Opfer von Vergewaltigungen<br />
eine Notfallversorgung einschließlich<br />
anonymisierter Spurensicherung<br />
und der Pille danach<br />
geben.<br />
Die CDU dagegen ließ sich<br />
nur zu einem Satz hinreißen. In<br />
den letzten vier Jahren habe sie<br />
die „sexuelle Selbstbestimmung<br />
gestärkt und den Schutz von<br />
Frauen und Minderjährigen vor<br />
Gewalt verbessert“. Bei FDP<br />
und CSU findet sich gar nichts<br />
zu sexualisierter Gewalt.<br />
Johannes-Wilhelm Rörig, der<br />
Missbrauchsbeauftragte der<br />
Bundesregierung, will verhindern,<br />
dass das Thema im Fall ei-<br />
5919<br />
4786<br />
ner Jamaikakoalition untergeht.<br />
„Ich möchte, dass der Fall Weinstein<br />
und die zahlreichen Fälle,<br />
2015 2016 die mit #MeToo bekannt werden,<br />
jetzt endlich zum Anlass<br />
genommen werden, dauerhafte<br />
Strukturen und ein dauerhaftes Vorgehen<br />
gegen sexuelle Gewalt zu schaffen.“ Es<br />
dürfe nicht sein, dass weiter „von Skandal<br />
zu Skandal gesprungen wird“.<br />
Rörig fordert deswegen neben mehr Mitteln<br />
für Präventionsmaßnahmen an Schulen<br />
eine „dauerhafte Aufklärungs- und<br />
Sensibilisierungskampagne in der Dimension<br />
der Aids-Kampagne“. Es müsse endlich<br />
allen klar werden, was sexualisierte<br />
Gewalt genau ist, wo die Grenzen sind, an<br />
wen man sich wenden kann und dass die<br />
Folgen und Belastungen für Betroffene<br />
eklatant sein können. „Die Täter leben<br />
vom Schweigen der breiten Masse.“<br />
Das Schweigen ist vorerst beendet.<br />
Maik Baumgärtner, Lars-Olav Beier, Anna Clauß,<br />
Xaver von Cranach, Dinah Deckstein,<br />
Georg Diez, Martin Knobbe, Ann-Katrin Müller,<br />
Sven Röbel, Alexander Sarovic,<br />
Elke Schmitter, Britta Stuff, Claudia Voigt<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
17
#WirAuch<br />
Protokolle In sozialen Netzwerken berichten Millionen Menschen unter dem Hashtag #MeToo von<br />
sexuellen Belästigungen und Vergewaltigungen. Zwölf von ihnen erzählen im SPIEGEL ihre Geschichte.<br />
Hashtag-Illustration<br />
„Zufällig die Hand am Po“<br />
Flugbegleiterin, 31, aus Frankfurt am Main<br />
„Ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren als<br />
Flugbegleiterin, zuerst in der Schweiz,<br />
dann für eine kleine Regionallinie und<br />
nun bei Lufthansa. Man gewöhnt sich daran,<br />
angeglotzt zu werden. Einmal sagte<br />
ein Passagier zu mir, er finde es erotisch,<br />
dass man meinen BH durch die weiße<br />
Bluse sehen könne. Seitdem trage ich<br />
fast immer die Uniformjacke. Sitze ich<br />
am Notausgang Passagieren gegenüber<br />
oder neben ihnen, wollen Männer häufiger<br />
ein Gespräch anfangen, da wird man<br />
auch schon mal gefragt, ob man einen<br />
Freund hat oder was man denn heute<br />
Abend so vorhabe. Ein Mann hat mal angestrengt<br />
auf meinem Mitarbeiterausweis<br />
meinen Namen entziffert und mir dann<br />
eine Freundschaftsanfrage bei Facebook<br />
geschickt – wir standen noch am Boden.<br />
Wenn man beim Service mit dem<br />
Wagen durch den Gang läuft, hat man immer<br />
mal wieder einen Arm oder auch<br />
eine Hand am Po, zufälligerweise passiert<br />
das immer nur Männern, aber vielleicht<br />
sind die auch breiter und sitzen mehr im<br />
Gang. Am schlimmsten sind arabische<br />
Gäste, die denken, wir gehörten ihnen,<br />
und sie hätten dafür mit ihrem Ticket bezahlt.<br />
Ich habe mal ein Praktikum in einer<br />
unserer Lounges gemacht. Es gibt<br />
dort Badewannen. Ein arabisch aussehender<br />
Passagier wollte, dass ich mit ihm ins<br />
Badezimmer komme, ich bin schnell weggegangen.<br />
Die meisten Passagiere verhalten<br />
sich sehr anständig, vor allem die<br />
Vielflieger. In der First Class sind die Gäste<br />
am zurückhaltendsten, am schlimmsten<br />
sind Reisende in der Businessclass.<br />
Ein schnöseliger Typ mit silberner Rolex-<br />
Uhr fragte mich mal, ob ich schon Sex<br />
in einem Flugzeug gehabt hätte. Ich finde<br />
solche Fragen unverschämt, er ist aber<br />
Kunde, und ich muss höflich bleiben.<br />
Die Geschichten über wilde Orgien<br />
zwischen Piloten und Flugbegleitern sind<br />
hingegen völlig übertrieben, und es<br />
nervt, wenn man sich das immer wieder<br />
anhören muss. Unsere Umläufe sind sehr<br />
kurz geworden, oft ist man nur für eine<br />
Nacht im Hotel, alle sind müde und wollen<br />
nur noch schlafen. Zwar gibt es immer<br />
wieder auch Paare unter dem Personal,<br />
aber das ist kein wildes Jeder-mit-<br />
Jedem. Ich habe es nie erlebt, dass mich<br />
Cockpitpersonal bedrängt hat, über ein<br />
bisschen Flirten ging das nie hinaus.“<br />
FRANCESCO CICCOLELLA / DER SPIEGEL<br />
18 DER SPIEGEL 43 / 2017
Titel<br />
„Einmal habe ich mit meinen<br />
High Heels zugetreten“<br />
Claudia Klemt, 40, PR-Redakteurin aus<br />
Rauenberg<br />
„Sexuelle Belästigung bedeutet für mich,<br />
dass mich ein Mann anfasst und ich das<br />
nicht möchte. Genau das erlebe ich seit<br />
meiner Jugend allerdings in immer neuen<br />
Varianten. Ich erinnere mich an den<br />
Weltjugendtag in Köln vor zwölf Jahren,<br />
da presste plötzlich in der dicht gedrängten<br />
S-Bahn ein Mann den erigierten Penis<br />
in meinen Rücken. Leider war ich zu<br />
schockiert, um zu reagieren, dabei habe<br />
ich das im Lauf der Jahre eigentlich gelernt.<br />
Als mich bei einem Karnevalsfest<br />
einmal ein Mann, den ich aus meinem<br />
beruflichen Umfeld kannte, an den Po<br />
fasste, habe ich mit meinen High Heels zugetreten.<br />
Dieses An-den-Po-Fassen ist<br />
überhaupt ziemlich üblich; während meiner<br />
Ausbildung habe ich nebenbei gekellnert<br />
und viele Männer getroffen, für die<br />
solche Übergriffe offenbar zu einem gelungenen<br />
Kneipenabend gehörten. Mit<br />
steigendem Alkoholspiegel hielten sie ihr<br />
Verhalten für immer selbstverständlicher.<br />
Jetzt bin ich 40 Jahre alt und merke,<br />
dass mich mit zunehmendem Alter auch<br />
anzügliche Bemerkungen und Witze<br />
immer wütender machen. Im Job hat<br />
mir das den Ruf der militanten Feministin<br />
eingetragen – und den der Spaßbremse.<br />
Als PR-Redakteurin war ich bei einer<br />
großen Bank lange für die Öffentlichkeitsarbeit<br />
zuständig. Dort wurde in<br />
„Einige senden Penisbilder“<br />
Julia Anna Friess, 27, Musicaldarstellerin<br />
aus Regensburg<br />
„Zu meiner Ausbildung gehörte Tanz -<br />
unterricht, oft begann der früh am Morgen.<br />
Ich fand es um diese Uhrzeit meist<br />
noch ziemlich kalt und zog immer ein<br />
langärmeliges Oberteil an. Einem unserer<br />
Dozenten gefiel das nicht, er meinte,<br />
so könne er das Muskelspiel nicht kontrollieren.<br />
Er kam dann immer zu mir<br />
und wollte mir das Oberteil ausziehen.<br />
Jedes Mal habe ich seine Hände von<br />
meinem Körper genommen und laut gesagt,<br />
dass ich mir allein zu helfen wisse.<br />
Trotzdem: Er hat es wieder und wieder<br />
versucht. Und jedes Mal, wenn ich ihn in<br />
seine Schranken verwies, wurde er frech<br />
oder strafte mich mit Missachtung. Ich<br />
sollte in der letzten Reihe tanzen oder<br />
zusätzliche Übungen machen, solche<br />
Dinge. Anderen Mädchen gegenüber<br />
verhielt er sich ähnlich, ihm eilte dieser<br />
einer Vorstandssitzung dann darüber geredet,<br />
dass sie einen Kunden, der sich<br />
nur von einer bestimmten Kollegin beraten<br />
lassen wollte, verstehen könnten,<br />
weil sie schließlich zwei große Argumente<br />
vor sich hertragen würde. Ich war die<br />
einzige Frau in dieser Runde, und die<br />
Männer merkten gar nicht, wie tief die<br />
Schublade war, in die sie da griffen.<br />
Sexuelle Belästigung ist eine Demonstration<br />
von Macht und Status. Deshalb<br />
fürchte ich auch, dass sie überall in der<br />
Gesellschaft andauern wird, solange wir<br />
keine vollständige Gleichberechtigung<br />
erreichen.“<br />
Ruf ohnehin voraus. Manchmal drängte<br />
er sich auf, wenn wir Studenten feierten,<br />
und tat so, als wäre er 20. In Wahrheit<br />
hatte er aber natürlich Macht darüber,<br />
wie erfolgreich wir unsere Ausbildung<br />
abschließen würden.<br />
Mir waren diese Szenen um das Oberteil<br />
irgendwann so unangenehm, dass<br />
ich es schließlich nicht mehr zum Training<br />
angezogen habe. Aber ich habe den<br />
Schulleiter dann auch gebeten, mich in<br />
einen anderen Kurs einzuteilen. Ich wollte<br />
einen klaren Schnitt, notfalls wäre ich<br />
zur Polizei gegangen, man muss sich solche<br />
Übergriffe nicht bieten lassen. Heute<br />
erlebe ich von Zuschauern ziemlich<br />
merkwürdige Ansinnen, sie sehen mich<br />
auf der Bühne und fragen anschließend<br />
auf Facebook, ob ich ihnen getragene<br />
Strumpfhosen schicken könne, einige<br />
senden mir bizarre Penisbilder. Ich sage<br />
mir dann immer, dass sie allesamt armselige,<br />
lächerliche Gestalten sind. Diese<br />
Männer müssen doch Probleme haben,<br />
sonst würden sie sich anders verhalten.“<br />
ANNA LOGUE / DER SPIEGEL<br />
„Aber das war Krieg“<br />
Brigitte Meese, 88, Kunstmanagerin<br />
in Berlin<br />
„Ich bin als junges Mädchen, mit 15, in<br />
Danzig von einem russischen Soldaten<br />
vergewaltigt worden. Gott sei Dank<br />
nur einmal. Aber das war Krieg. Wir<br />
haben die Bomben überlebt, wir sind<br />
nicht erschossen worden. Das war<br />
das Wichtigste. Was die deutsche<br />
Wehrmacht und besonders die SS in<br />
Russland angestellt hat, war viel<br />
schreck licher als das, was die Russen<br />
in Deutschland taten.<br />
Mit Sexismus heute kann man das<br />
alles überhaupt nicht vergleichen.<br />
Nach Kriegsende ging ich nach Salem<br />
aufs Internat zurück. Wir wohnten mit<br />
vier Mädchen ausnahmsweise mal auf<br />
einem Zimmer in einem Jungsflur, weil<br />
es Platznot gab. Wir waren so naiv –<br />
weder den Jungs noch uns Mädchen<br />
wäre es im Traum jemals einge fallen,<br />
ein anderes Schlafzimmer zu betreten.<br />
Aggressives Anmachen gab es damals<br />
nicht. Allerdings liefen wir auch nicht<br />
halbnackt herum. Später habe ich in<br />
Heidelberg, Paris und London studiert.<br />
Per Anhalter bin ich allein durch ganz<br />
Europa gereist. Nie ist etwas passiert,<br />
nie habe ich einen blöden Spruch<br />
gehört. Es gab andere Konventionen.<br />
Man reizte einander nicht gegenseitig<br />
auf.<br />
Den heutigen Sexismus finde ich<br />
natürlich scheußlich. Aber er geht auch<br />
mit einer sehr freiheitlichen Bewegung<br />
einher. Wenn ich diese entzückenden<br />
jungen Mädchen in Berlin sehe, mit<br />
abgeschnittenen, extrem kurzen Höschen<br />
und Oberteilen, die nichts ver -<br />
hüllen … wissen die eigentlich, was sie<br />
tun?<br />
Andererseits haben sie natürlich<br />
jedes Recht, sich so anzuziehen.<br />
Für Männer darf das kein Freibrief<br />
sein, sich danebenzubenehmen.“<br />
FRANK HORNIG / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
19
„Politik ist Macht“<br />
Daniela Jansen, 40, aus Aachen ist<br />
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft<br />
Sozialdemokratischer Frauen in<br />
Nordrhein-Westfalen.<br />
„Politik ist Macht. Und weil es immer<br />
noch viel mehr Politiker als Politikerinnen<br />
gibt, kommt es häufig vor, dass die<br />
Männer versuchen, Frauen einzuschüchtern,<br />
zu verunsichern. Entweder durch<br />
anzügliche Sprüche und Gesten oder<br />
durch respektloses Verhalten. Ich war<br />
fünf Jahre lang Landtagsabgeordnete in<br />
NRW und habe erlebt, dass der Lärm -<br />
pegel bei Plenarsitzungen steigt, sobald<br />
eine Politikerin am Rednerpult steht.<br />
Die Männer quatschen dann laut mit -<br />
einander, machen Zwischenrufe oder stehen<br />
auf und gehen raus. Sie tun das bewusst.<br />
Das ist eine Taktik, um Frauen<br />
aus dem Konzept zu bringen. Nach dem<br />
Motto: ‚Mal sehen, wie lange die das aushält!‘<br />
Es trifft besonders oft Politikerinnen,<br />
die mit hoher Stimme sprechen.<br />
Auch in Ausschusssitzungen habe ich erlebt,<br />
dass es Männern darum geht, ihr<br />
Revier abzustecken. Sie reden mit ausholenden<br />
Gesten, laut und lange. Wenn<br />
eine Politikerin ein Argument vorbringt,<br />
ignorieren das manche Männer und tun<br />
so, als hätte niemand etwas gesagt. Manche<br />
Abgeordnete begrüßen Kolleginnen,<br />
indem sie ihnen gönnerhaft den Kopf<br />
tätscheln. Ein Kollege sagte mal zu mir:<br />
‚Du bist die erste Vorsitzende der SPD-<br />
Frauen, die ich nicht von der Bettkante<br />
schubsen würde.‘ Ich antwortete: ‚Es<br />
wird nie passieren, dass ich auch nur in<br />
die Nähe deiner Bettkante komme.‘ Man<br />
muss als Politikerin austeilen können,<br />
man muss sich an den Machtspielchen<br />
beteiligen, man muss dafür kämpfen, auf<br />
Rednerlisten zu kommen. Das ist anstrengend,<br />
aber von allein geht es nicht.<br />
Ich glaube, dass noch immer viele Politiker<br />
denken: ‚Auf eine Frau kann ich<br />
mich nicht verlassen, die ist zu emotional,<br />
und wenn sie ihre Tage hat, ändert<br />
sie ihre Meinung.‘ Ich wünsche mir mehr<br />
Respekt von den Männern. Manche von<br />
ihnen sagen, dass sie wegen der Debatte<br />
über sexuelle Belästigung verunsichert<br />
seien und dass sie Frauen keine Komplimente<br />
mehr machen wollen, aus Angst,<br />
eine Grenze zu überschreiten. Das ist<br />
Unfug. Die meisten Männer kennen den<br />
Unterschied zwischen einem respektvollen<br />
Kompliment und einer Zote. ‚Das<br />
Kleid steht dir gut‘ ist etwas anderes als<br />
‚Du hast aber mächtig Holz vor der Hütte‘.<br />
Und die Männer sollten wissen, dass<br />
es ein Unterschied ist, ob man eine Frau<br />
unter vier Augen auf ihr Aussehen anspricht<br />
oder im Kreis einer Gruppe.“<br />
„Erst verfolgt, dann gejagt“<br />
Franziska Holzheimer, 29, Poetry-Slammerin<br />
aus Wien<br />
„Me too! Und das so oft, dass ich gar<br />
nicht weiß, welchen Fall ich nennen<br />
soll. Das erste Mal Catcalling, als ich<br />
zwölf war? Oder der Griff in den<br />
Schritt, als ich 17 war? Oder die ganzen<br />
Kommentare dazwischen und danach?<br />
<strong>Der</strong> Abend, als ein Slam-Kollege mir<br />
das Bett seines Mitbewohners anbot,<br />
und dann, als wir in der Wohnung ankamen,<br />
angeblich plötzlich doch nur<br />
seines frei war, und ich später in der<br />
Nacht davon wach wurde, dass er viel<br />
zu nah bei mir lag und mich beim<br />
Schlafen beobachtete? Oder der Tag,<br />
als ich beim Joggen erst verfolgt und<br />
dann gejagt wurde? Es war mitten am<br />
Tag in einer ruhigen Gegend. Er kam<br />
mir auf dem Fahrrad entgegen, fixierte<br />
mich schon von Weitem mit seinem<br />
Blick. Als er mich passiert hatte, drehte<br />
er plötzlich um und fuhr mir hinterher.<br />
Als ich schneller lief, fuhr der<br />
Mann auch schneller. Ich drehte mich<br />
um, der Mann lachte feixend. Er genoss<br />
es, mich zu jagen. Ich bekam Panik<br />
und sprintete in Richtung einer belebteren<br />
Hauptstraße. Erst als ich die<br />
erreicht hatte, drehte er ab.“<br />
„Er bot mir Geld“<br />
Schoresch Davoodi, 36, Politikberater<br />
aus Bochum<br />
„Ich bin in der Nähe von Bochum groß<br />
geworden. Mit 17 wollte ich eines Nachts<br />
per Anhalter ans andere Ende der Stadt,<br />
um dort in eine Disco zu gehen. Ein älterer<br />
Mann hielt an und bot an, mich mitzunehmen.<br />
Doch ich merkte schnell,<br />
dass er gar nicht dahin fuhr, wo ich hinmusste.<br />
Ich bat ihn, aussteigen zu dürfen.<br />
Er schwieg. Ich fühlte mich hilflos<br />
und wartete ab. Schließlich stoppte er<br />
das Auto auf einem Parkplatz in einem<br />
Naherholungsgebiet, legte seine Hand<br />
zwischen meine Beine und versuchte,<br />
mich zu küssen. Ich schrie: ‚Lass das!‘ Er<br />
ließ von mir ab und fing an, mit mir zu<br />
verhandeln. Ob ich nicht für Geld mit<br />
ihm schlafen würde. Als ich ablehnte,<br />
versuchte er weiter, mich zu überreden.<br />
Bedroht hat er mich zum Glück nicht. Irgendwann<br />
sah er ein, dass es nichts<br />
bringt, und fuhr mich schweigend zur<br />
Disco. Ich war total verwirrt, feierte die<br />
Nacht durch, um mich abzulenken. Das,<br />
was ich erlebt hatte, das passierte doch<br />
nur Mädchen, dachte ich. Die wurden<br />
vor fremden Männern gewarnt. Als junger<br />
Mann konnte man sich so was nicht<br />
vorstellen. Ich habe niemandem von diesem<br />
Vorfall erzählt – bis letzte Woche.<br />
Ein Bekannter nahm #MeToo zum Anlass,<br />
auf Facebook zu beschreiben, wie<br />
er in seiner Jugend mehrmals sexuell belästigt<br />
worden war. Das gab mir Mut,<br />
meine Geschichte ebenfalls auf Facebook<br />
zu veröffentlichen. Kurze Zeit später<br />
rief meine Schwester an. Sie war richtig<br />
entsetzt, weil ich ihr nie davon erzählt<br />
hatte. Aber wie auch? In unserer<br />
Gesellschaft dürfen Männer keine Opfer<br />
sein. Das muss sich endlich ändern.“<br />
DOMINIK ASBACH / DER SPIEGEL<br />
„Er zückte ein Messer“<br />
Christine Finke, 51, Autorin aus Konstanz<br />
„Früher war es als junge Frau normal,<br />
von Männern angesprochen zu werden,<br />
auch in unangemessener Weise. Mir<br />
wurde hinterhergepfiffen, ich wurde<br />
bedrängt. Als ich 16 Jahre alt war, fragte<br />
mich ein Mann, ob wir nicht aus<br />
dem Zug steigen und in ein Hotel gehen<br />
sollten. Meine unbeholfene Reak -<br />
tion: ‚Ich habe einen Freund.‘ Richtig<br />
gefährlich wurde es eines Abends in<br />
Freiburg. Ich war Studentin, stand an<br />
einer Haltestelle. Ein junger Typ kam<br />
auf mich zu, baggerte mich massiv<br />
an und kam mir sehr nahe. Ich machte<br />
ihm deutlich, er solle aufhören.<br />
Irgendwann schrie ich: ‚Verpiss dich!‘<br />
Daraufhin zückte er ein Messer.<br />
Passan ten schritten ein, der Typ verschwand<br />
fluchend.<br />
Das Älterwerden hat bei mir den angenehmen<br />
Nebeneffekt, dass so etwas<br />
irgendwann aufhört. Inzwischen bin<br />
ich Mutter, das hält auch viele Männer<br />
davon ab, mich anzumachen. Aber ich<br />
habe eine 17-jährige Tochter und frage<br />
mich, ob ihr so etwas heute auch noch<br />
passiert.“<br />
20 DER SPIEGEL 43 / 2017
Titel<br />
„Ich fühlte mich schuldig“<br />
Francesca Lötscher, 44, Burlesque-Künstlerin<br />
aus Hamburg<br />
„Welche von den vielen Geschichten soll<br />
ich erzählen? Wie ich als junges Mädchen<br />
kaum die Straße vom Bahnhof zur<br />
Marktgasse überqueren konnte, ohne<br />
dass sich ein Mann ungefragt über meinen<br />
Körper oder meine Geschlechtsteile<br />
äußerte? Von den anzüglichen Gesten,<br />
wenn ich mich bückte, um mein Fahrradschloss<br />
anzubringen? Von den Händen<br />
des Reitlehrers im Ferienlager, des amerikanischen<br />
Zollbeamten, des Autobahnpolizisten,<br />
des Unbekannten am Elbufer,<br />
im Zug, im Bus, in der Sauna?<br />
Das alles passierte in der Zeit, als ich<br />
meine eigene Sexualität gerade erst entdeckte.<br />
Einmal, ich war etwa 13, griff<br />
mir ein junger Mann auf der Straße an<br />
meinen Hintern. Ich las damals gerade<br />
Simone de Beauvoir. Ich drehte mich<br />
um und knallte ihm eine. Doch bevor in<br />
mir der Stolz aufsteigen konnte, knallte<br />
er mir eine zurück. Und da fühlte ich<br />
mich tatsächlich schuldig! Schuldig<br />
für meinen Körper, meinen neugierigen<br />
Blick, meine wilden Haare, meinen<br />
lauten Kleiderstil, meinen bunt bemalten<br />
Mopedhelm.“<br />
MILOS DJURIC / DER SPIEGEL<br />
„Manch einer wird eklig“<br />
Franziska Thoms, 28, Verkäuferin<br />
in einem Telekommunikationsladen<br />
in Hamburg<br />
„Es gibt immer wieder Situationen mit<br />
Kunden, die anstrengend sind. Viele<br />
männliche Kunden nehmen mich nicht<br />
für voll und wollen einen männlichen<br />
Verkäufer wegen kleinster Technikfragen<br />
sprechen. Die meinen, ich sei nicht<br />
kompetent genug. Aber ich habe doch<br />
meine Ausbildung nicht umsonst gemacht!<br />
Manchmal kommt es auch vor,<br />
dass jemand eklig wird. Einer fragte<br />
mich neulich, ob ich nicht mit ihm mitkommen<br />
wolle, um … na ja. Das geht<br />
gar nicht. Den habe ich direkt aus dem<br />
Laden geschmissen. Ich habe aber bei<br />
meinem Arbeitgeber glücklicherweise<br />
einen Ansprechpartner, falls irgendwas<br />
im Laden oder im Team vorfallen sollte.<br />
Das hatten die Schauspielerinnen in<br />
Hollywood ja anscheinend nicht.“<br />
„Ich habe nicht angezeigt“<br />
Paula Deme, 33, Erzieherin und Bloggerin<br />
aus Zürich<br />
„Ein schleichender Prozess“<br />
Anonym, 35, aus Nordrhein-Westfalen<br />
„Mein Chef im Büro benutzt eine fürchterlich<br />
anzügliche Sprache. Bei uns ist<br />
im Moment eine Stelle zu besetzen, und<br />
er hat die Bewerbungen mit den gut aussehenden<br />
Frauen ganz oben auf den Stapel<br />
gelegt. Dazu macht er Kommentare<br />
wie: ‚Oh, auf die muss ich mich mit Viagra<br />
vorbereiten!‘ Bei uns arbeiten fast<br />
nur Frauen, und in solchen Momenten<br />
schweigen alle. Manchmal entgegne ich<br />
ihm lapidar, er könne sich solche Sätze<br />
doch sparen, aber ich bin darauf bedacht,<br />
nicht zu weit zu gehen. Ich will ja<br />
meinen Job behalten. Es ist grundsätzlich<br />
ein Problem, dass viele Frauen sich<br />
nicht wehren, weil sie die Konsequenzen<br />
scheuen. Als Teenager habe ich das in einer<br />
extremen Variante mit meinem Stiefvater<br />
erlebt. Als ich in der Pubertät<br />
weiblicher wurde, stand er plötzlich<br />
beim Abspülen ganz nah hinter mir, an<br />
einem anderen Tag strich er mir die Haare<br />
aus dem Gesicht, später gab er mir<br />
zwischendurch einen Kuss auf den Hals,<br />
dann griff er unter das T-Shirt, irgendwann<br />
streichelte er den Busen. Es war<br />
ein schleichender Prozess, schließlich<br />
ging er bis zum Äußersten. Ich solle es<br />
als unser Geheimnis ansehen, sagte er<br />
immer, und ich habe zwei Jahre lang geschwiegen.<br />
Bis heute wissen nur wenige,<br />
was geschehen ist. Deshalb möchte ich<br />
anonym bleiben. Damals habe ich nichts<br />
gesagt, weil ich mich für das Glück meiner<br />
Mutter mitverantwortlich fühlte, die<br />
Beziehung zu meinem leiblichen Vater<br />
war ja schon zerbrochen. Mein Stiefvater<br />
hat von mir abgelassen, als ich kein<br />
Wort mehr mit ihm redete. Meine Mutter<br />
erfuhr die Wahrheit erst auf einer Familienfeier.<br />
Ich hatte mir damals die<br />
Haare schwarz gefärbt, es sollte ein rebellischer<br />
Akt sein, und mein Stiefvater<br />
ereiferte sich darüber. Da habe ich ihm<br />
entgegengeschleudert, dass es mir vollkommen<br />
egal sei, was er von meinen<br />
Haaren halte und dass er an mich nicht<br />
mehr herankomme. Meine Mutter hat<br />
ihn trotzdem ein Jahr später geheiratet.<br />
Ich war bei der Hochzeit anwesend – ich<br />
wollte ja nicht die Familie zerstören. Die<br />
Ehe wurde ein Jahr später geschieden.<br />
Rückblickend belastet mich wirklich,<br />
dass ich mich nicht gewehrt habe. Wer<br />
weiß, ob er nicht Ruhe gegeben hätte,<br />
wenn ich ihm einfach mal zwischen die<br />
Beine getreten hätte. Ich kann nur allen<br />
raten: Wehrt euch. Immer!“<br />
„Mit 26 vergewaltigte mich mein damaliger<br />
Freund. Er war betrunken, ich<br />
auch. Wir kamen aus dem Klub, und er<br />
meinte, ich stünde ihm jetzt zu. Sonst<br />
würde ich mich ja auch nicht so zieren.<br />
Ich selbst konnte meine Vergewaltigung<br />
gar nicht einordnen. Die Grenze<br />
ist häufig nicht ganz klar, besonders in<br />
einer Beziehung. Er hat bis zum Ende<br />
nicht geglaubt, dass es eine Vergewaltigung<br />
war. Aber ich habe mich doch gewehrt.<br />
Das hat mich von innen aufgefressen,<br />
aber ich habe ihn damals nicht<br />
angezeigt. Ich hatte irgendwie Mitleid.<br />
Heute weiß ich, dass ich es hätte tun<br />
sollen. Voriges Jahr erst habe ich jemanden<br />
getroffen, der mir einen<br />
Schreibjob angeboten hat – und im<br />
nächsten Satz eine Affäre. Das ist<br />
Machtmissbrauch. Aber es heißt dann,<br />
man solle sich nicht anstellen.“<br />
Aufgezeichnet von Laura Backes, Annette Bruhns,<br />
Anna Clauß, Lukas Eberle, Frank Hornig,<br />
Maximilian Krone, Martin U. Müller, Lars-Thorben<br />
Niggehoff, Antonia Schaefer, Katja Thimm<br />
GIAN PAUL LOZZA<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
21
„Viele Männer sind überfordert“<br />
Geschlechter Die Journalistin Laura Himmelreich über Sexismus von älteren Männern gegenüber<br />
jüngeren Frauen – und darüber, was der #Aufschrei-Diskurs gebracht hat<br />
Himmelreich, 34, ist Chefredakteurin des<br />
Online-Jugendmagazins Vice.com. Sie wurde<br />
2013 bundesweit bekannt, als sie – damals<br />
noch als Politikredakteurin des „Stern“ – in<br />
einem Porträt des damaligen FDP-Fraktionsvorsitzenden<br />
Rainer Brüderle beschrieb, wie<br />
anzüglich er sich ihr gegenüber verhalten hatte.<br />
<strong>Der</strong> Fall löste eine Sexismusdebatte aus. Auf<br />
Twitter schilderten Tausende Frauen unter<br />
#Aufschrei ihre Erfahrungen.<br />
SPIEGEL: Frau Himmelreich, dürfen Männer<br />
Frauen in Zukunft keine Komplimente<br />
mehr machen?<br />
Himmelreich: Doch, natürlich. Das Problem<br />
von Sexismus besteht nicht darin, dass<br />
Menschen sich Komplimente machen. Das<br />
Problem ist, dass dabei oft die Grenze zum<br />
Unangenehmen überschritten wird. Wenn<br />
der Chef zu seiner Mitarbeiterin sagt, sie<br />
sehe bezaubernd aus, mag das nett gemeint<br />
sein. Gleichzeitig kann es sein, dass<br />
sie sich durch das Wort „bezaubernd“<br />
herab gesetzt und in ihrer beruflichen Posi -<br />
tion nicht ernst genommen fühlt. Beide<br />
Sichtweisen sind legitim.<br />
SPIEGEL: Wo verläuft diese Grenze?<br />
22 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Himmelreich: Wenn es einen Leitfaden gäbe,<br />
der für alle Menschen gleichermaßen funktionierte,<br />
wäre alles ganz einfach. Aber<br />
die Grenzen sind individuell. Wenn sich<br />
die Gesprächspartner nicht gut kennen,<br />
sollte man lieber etwas vorsichtiger als zu<br />
forsch sein.<br />
SPIEGEL: Können Sie verstehen, dass Männer<br />
verunsichert sind?<br />
Himmelreich: Wer wirklich verunsichert ist,<br />
kann einfach nachfragen: „Hey, ich finde,<br />
du siehst toll aus – ist es in Ordnung, wenn<br />
ich das so sage?“<br />
SPIEGEL: Umgekehrt könnten viele Frauen<br />
ihre Grenzen auch deutlicher kommunizieren.<br />
Himmelreich: Sie tun es bereits, aber das ist<br />
nicht immer so einfach. Wollen Sie wirklich,<br />
dass ständig Meetings unterbrochen<br />
werden, um darüber zu diskutieren, ob<br />
der flapsige Spruch des Kollegen jetzt angemessen<br />
war oder nicht? Den netten<br />
Plausch in der Kaffeeküche ausbremsen,<br />
weil der Blick über den Rand der Tasse hinaus<br />
Richtung Dekolleté gewandert ist?<br />
Ich finde es problematisch, die Verantwortung<br />
den Frauen zuzuschieben.<br />
GREY HUTTON / VICE<br />
SPIEGEL: Warum?<br />
Himmelreich: Weil wir Frauen Besseres zu<br />
tun haben, als ständig unsere Grenzen<br />
zu markieren. Weil es unser Recht ist,<br />
respekt voll behandelt zu werden. Nicht<br />
Frauen sind schuld, wenn sie Übergriffen<br />
ausgesetzt sind, sondern die Männer,<br />
die solche Übergriffe verüben. Außerdem<br />
ist es anstrengend, sich ständig fragen<br />
zu müssen: Wehre ich mich jetzt, oder<br />
könnte das unangenehme Konsequenzen<br />
haben?<br />
SPIEGEL: Inwiefern?<br />
Himmelreich: Wenn der Faktor Macht hinzukommt,<br />
wird es kompliziert, vor allem<br />
im Beruflichen. Es fällt schwerer, sich zu<br />
wehren, wenn man Nachteile für die Karriere<br />
fürchtet. Im Fall Weinstein sehen wir,<br />
dass ein starkes Machtgefälle dazu führt,<br />
dass Übergriffe spät öffentlich werden.<br />
SPIEGEL: Wieso entfachen die Geschichten<br />
über Weinstein, die weit weg in den USA<br />
und dazu im glamourösen Hollywood spielen,<br />
hierzulande so eine Debatte?<br />
Himmelreich: Weil Sexismus auch hier ein<br />
großes Problem ist. Er läuft nur normalerweise<br />
unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle<br />
ab, als Alltagsphänomen<br />
im Leben der meisten Frauen, oft ohne<br />
Konsequenzen für die Täter. Weinstein<br />
bekommt die Folgen zu spüren, das rüttelt<br />
die Leute auf. Probleme brauchen Ge -<br />
sichter, damit wir uns mit ihnen beschäftigen.<br />
Geschichten wie die von Angelina<br />
Jolie treffen uns, weil wir bei einer Frau,<br />
die Lara Croft war, nicht erwarten, dass<br />
sie ähnliche Erfahrungen macht wie viele<br />
von uns.<br />
SPIEGEL: Aber es ist doch ein Unterschied,<br />
ob ein Mann einer Frau auf der Straße hinterherpfeift<br />
oder Straftaten begeht wie<br />
mutmaßlich Harvey Weinstein.<br />
Himmelreich: Ja, sicher. Weinstein ist ein<br />
extremer Fall und weit schlimmer als das,<br />
was viele im Alltag erleben. Aber die Wurzel<br />
des Problems ist dieselbe: Sexismus in<br />
einer ungleichen Gesellschaft. Solange<br />
rund 70 Prozent aller Führungspositionen<br />
in deutschen Unternehmen mit Männern<br />
besetzt sind, solange der Anteil an weib -<br />
lichen Bundestagsabgeordneten so niedrig<br />
ist, solange in deutschen Film- und Fernsehproduktionen<br />
Männer deutlich über -<br />
repräsentiert sind, wie eine Studie im<br />
Auftrag der MaLisa-Stiftung von Maria<br />
Furtwängler neulich nachgewiesen hat, so<br />
lange haben wir keine gleichberechtigte<br />
Gesellschaft.
Titel<br />
SPIEGEL: Können Hashtag-Debatten wie<br />
#Aufschrei und jetzt #MeToo daran etwas<br />
ändern?<br />
Himmelreich: #Aufschrei hat definitiv etwas<br />
gebracht. Damals, 2013, wurde immer wieder<br />
über die Grundsatzfrage diskutiert:<br />
Gibt es Sexismus in Deutschland? Das<br />
fragt jetzt niemand mehr. Nun geht es eher<br />
darum, wie weit Sexismus in der Gesellschaft<br />
verbreitet ist. Im Bewusstsein der<br />
Menschen hat sich etwas verändert. Das<br />
ist der erste Schritt, einer von vielen. Solange<br />
unsere Gesellschaft nicht gleich -<br />
berechtigt ist, wird es alle paar Jahre neue<br />
Debatten über Sexismus geben.<br />
SPIEGEL: Die Geschichten, die unter #Aufschrei<br />
und #MeToo diskutiert werden, handeln<br />
oft von Grenzüberschreitungen älterer<br />
Männer gegenüber jüngeren Frauen.<br />
Ist Sexismus ein Generationenproblem?<br />
Himmelreich: Nicht nur. Aber ja: Wie Menschen<br />
sich verhalten, hängt von ihrer<br />
Sozialisierung ab. Wenn ein Mann jahrzehntelang<br />
in einer Welt gelebt hat, in der<br />
Frauen im Beruf überwiegend in zuarbeitenden,<br />
dienenden Funktionen auftreten<br />
und im Privatleben als attraktive, begehrenswerte<br />
Wesen, formt das sein Frauenbild.<br />
Wenn Frauen dann gleichberechtigt<br />
sein möchten, als Verhandlungspartner<br />
oder vielleicht sogar als Vorgesetzte, sind<br />
manche Männer überfordert – und stellen<br />
die gelernte Rangordnung etwa durch sexistische<br />
Kommentare wieder her, bewusst<br />
oder unbewusst.<br />
SPIEGEL: Gilt das auch für Weinstein?<br />
Himmelreich: Was er getan hat, ist nicht zu<br />
entschuldigen. Aber gerade in Hollywood<br />
ist das Problem besonders offensichtlich:<br />
Junge Frauen werden hier seit je extrem<br />
sexualisiert. In vielen Filmen sind sie eher<br />
schmückendes Beiwerk. Sie treffen jemanden<br />
wie Weinstein und wissen, dass er sie<br />
groß machen kann. Das ist ein irrsinniges<br />
Machtgefälle. Diese Macht war für Weinstein<br />
Alltag. Offenbar hat er sein Verhalten<br />
trotz des Schweigegeldes, das er Frauen<br />
zahlte, nie hinterfragt.<br />
SPIEGEL: Mit Ihrem Text, den Sie 2013 über<br />
Rainer Brüderle veröffentlicht haben, haben<br />
Sie sich gegen Sexismus gewehrt.<br />
Himmelreich: So sehe ich das nicht. Meine<br />
Aufgabe war es, den FDP-Fraktionsvorsitzenden<br />
über Monate zu begleiten und ihn<br />
zu porträtieren. In dieser Zeit hat er sich<br />
mir bei all unseren Treffen von dieser Seite<br />
gezeigt. Das prägte mein Bild. Und so habe<br />
ich ihn porträtiert. Dass der Text eine wochenlange<br />
Debatte auslöst, damit hatte ich<br />
nicht gerechnet.<br />
SPIEGEL: Wie haben Sie die folgenden Wochen<br />
erlebt?<br />
Himmelreich: Intensiv. Ich war 29 Jahre alt,<br />
die „Bild“-Zeitung druckte mein Gesicht<br />
auf der Titelseite, in Talkshows wurde über<br />
meine Entscheidung debattiert. Natürlich<br />
wühlt das auf.<br />
Sexuelle Übergriffe<br />
„Wie häufig haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz<br />
folgende Situation selbst erlebt?“<br />
Angaben in Prozent<br />
Zweideutige Kommentare,<br />
Witze mit sexuellem Bezug<br />
39<br />
Bemerkungen mit<br />
sexuellem Inhalt<br />
28<br />
Unangemessene Fragen mit sexuellem Bezug<br />
zu Privatleben, Aussehen<br />
22<br />
Unerwünschte körperliche Annäherung,<br />
Berührung<br />
19<br />
Unerwünschte Umarmung, Küsse<br />
13<br />
Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 1002 Befragte,<br />
28. November 2014 bis 2. Januar 2015, angegeben ist die Summe<br />
aus „oft/gelegentlich/selten“ bei den weiblichen Befragten<br />
SPIEGEL: Wie waren die Reaktionen?<br />
Himmelreich: Extrem unterschiedlich. Im<br />
Netz wurde ich teilweise aufs Übelste beschimpft.<br />
Gleichzeitig kam auf einer Party<br />
eine Mitarbeiterin des Bundestags auf<br />
mich zu, umarmte mich und gab mir den<br />
ganzen Abend Drinks aus.<br />
SPIEGEL: Klingt absurd.<br />
Himmelreich: War es auch. Aber mir war<br />
schnell klar: Es ging nicht um mich als<br />
Person. Die Menschen haben ihre Erfahrungen,<br />
die sie mit Sexismus gemacht haben,<br />
auf mich und Rainer Brüderle pro -<br />
jiziert.<br />
SPIEGEL: Hat Ihre plötzliche Bekanntheit<br />
Ihre Arbeit als Journalistin erleichtert?<br />
Himmelreich: Erst mal nicht. Sie hat mir die<br />
Leichtigkeit genommen, Unbefangenheit.<br />
Ich wusste ja: Plötzlich kennen mich so<br />
viele Menschen – und sie hatten eine Meinung<br />
zu dem, was ich geschrieben habe,<br />
vor allem natürlich in der FDP. Die wenigsten,<br />
die mein Verhalten nicht in Ordnung<br />
fanden, haben das offen gesagt. Ich<br />
weiß deshalb, dass die Reaktionen, die ich<br />
persönlich erfahren habe, kein repräsentatives<br />
Meinungsbild abgegeben haben.<br />
Heute als Chefredakteurin einer Onlineredaktion<br />
merke ich, dass mir die Erfahrung<br />
von damals hilft, bei Shitstorms gelassen<br />
zu bleiben und Hass im Netz nicht<br />
überzubewerten.<br />
SPIEGEL: Wenige Monate nach der #Aufschrei-Debatte<br />
flog die FDP aus dem Bundestag.<br />
Rainer Brüderle beendete seine<br />
politi sche Karriere.<br />
Himmelreich: Ich glaube nicht, dass die<br />
Wahlniederlage der FDP maßgeblich etwas<br />
mit dem Text zu tun hatte. Die Partei hat<br />
damals auch so genug Fehler gemacht.<br />
Und was Brüderle angeht: Er hat tatsächlich<br />
einen hohen Preis bezahlt für etwas,<br />
was bei Millionen anderen Männern konsequenzenlos<br />
bleibt.<br />
SPIEGEL: War das fair?<br />
Himmelreich: Männer in solchen Positionen<br />
sollten wissen, wie man sich professionell<br />
verhält – und dass es ihnen schaden kann,<br />
wenn sie es nicht tun.<br />
SPIEGEL: Haben Sie mit Rainer Brüderle danach<br />
noch mal gesprochen?<br />
Himmelreich: Das hat sich nicht ergeben.<br />
SPIEGEL: Begegnet Ihnen das Thema im Alltag<br />
noch?<br />
Himmelreich: Diese Debatte wird immer<br />
Teil meiner beruflichen Biografie bleiben.<br />
Wenn man meinen Namen im Internet<br />
sucht, ergänzt Google automatisch das<br />
Wort „Dekolleté“, was als Kombination<br />
offensichtlich eine häufige Suchanfrage ist.<br />
Natürlich wäre es mir lieber, die Menschen<br />
interessierten sich vor allem für meine Arbeit<br />
als Journalistin und nicht für meine<br />
Brüste.<br />
SPIEGEL: Jungen Frauen wird immer wieder<br />
vorgeworfen, sie würden beruflich von<br />
ihrer Attraktivität profitieren.<br />
Himmelreich: Hat es mir genutzt, als junge<br />
Frau über eine männerdominierte Partei<br />
wie die FDP zu schreiben? Gut möglich.<br />
Nutzt es mir jetzt, dass ich einige der wenigen<br />
jungen Frauen in einer Führungs -<br />
position bin? Sicherlich, ich werde häufig<br />
zu Talkrunden oder Podiumsdiskussionen<br />
eingeladen, weil Frauen dort unterrepräsentiert<br />
sind. Ich kann mir aber nicht aussuchen,<br />
dass ich zufällig eine junge Frau bin.<br />
SPIEGEL: Aber setzen Sie es bewusst ein?<br />
Himmelreich: Nein, das tue ich nicht. Ich<br />
gebe mich so, wie ich bin. Ich trage gern<br />
hohe Schuhe und mag mich lieber mit<br />
Make-up als ohne. Ich sehe auch nicht, warum<br />
ich das ändern sollte. Frauen sollten<br />
sich nicht anpassen – Männern sollten sich<br />
respektvoll benehmen.<br />
SPIEGEL: Als Chefredakteurin bei Vice.com<br />
leiten Sie heute selbst eine Redaktion mit<br />
50 Mitgliedern. Behandeln Sie alle gleich?<br />
Himmelreich: Ich mache mir über diese Frage<br />
viele Gedanken. Bestimmt mache ich<br />
auch mal Fehler. Aber ich bin mir sicher,<br />
ich behandle Mitarbeiter nicht unter -<br />
schiedlich aufgrund ihres Geschlechts.<br />
Und: Ich werde nie das Bedürfnis haben,<br />
mit männlichen Mitarbeitern über ihren<br />
Hintern zu sprechen.<br />
Interview: Miriam Olbrisch<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
23
Titel<br />
Debatte<br />
Harvey Weinstein und wir<br />
Die Frauen haben den Feminismus – und die Männer? Sind verunsichert.<br />
Geführt und erlebt<br />
wird die Debatte<br />
von vielen Männern<br />
allenfalls als<br />
Rückzugsgefecht.<br />
Sie halten sich raus.<br />
Filmproduzent Weinstein<br />
BERTRAND LANGLOIS / AFP<br />
Die Männer müssen jetzt<br />
erst einmal schweigen. Sicher,<br />
es gibt auch männ -<br />
liche Opfer sexueller Übergriffe.<br />
Auch Jungen werden häufig missbraucht.<br />
Und sie sind, jeder einzelne,<br />
nicht weniger Opfer, nur weil<br />
sie Männer sind.<br />
Aber darum geht es jetzt nicht.<br />
Die Enthüllungen über den Filmproduzenten<br />
Harvey Weinstein haben<br />
eine solche Wucht, weil sie<br />
einen Mann als Täter und viele<br />
Frauen als Opfer zeigen. Weil die<br />
Übergriffe bei Weinstein offenbar<br />
System hatten und weil sich, je<br />
mehr Frauen über das berichten,<br />
was ihnen anderswo geschah, der<br />
Verdacht kaum noch abweisen<br />
lässt, dass Männer überhaupt viel<br />
zu oft und viel zu gern ihre Macht<br />
über Frauen ausnutzen.<br />
<strong>Der</strong> Verdacht, dass es nicht nur<br />
ein Problem Weinstein gibt, sondern<br />
ein Problem Mann.<br />
Die erste Reaktion kann da nur<br />
sein: zuzuhören, die Klappe zu halten.<br />
Und: zu akzeptieren, dass es sich nicht nur um ein<br />
paar Bürogeschichten aus der Vorzeit handelt, nicht nur<br />
um ein paar Machenschaften im fernen Hollywood.<br />
Und die zweite muss sein: zu versuchen, den Ausweichmechanismen,<br />
die instinktiv einsetzen, selbst auszuweichen.<br />
Man kann sich von diesen Reflexen<br />
als Mann kaum freimachen. Von<br />
diesem: Es ist doch schon viel besser<br />
geworden. Diesem: Die meisten Männer<br />
sind doch nette Kerle. Diesem: Das<br />
muss eine Verwechslung sein, ich bin<br />
nicht Harvey Weinstein.<br />
Die auffälligste Beobachtung der vergangenen<br />
Tage ist: So gut wie jeder<br />
Mann fühlt sich angegriffen. Nicht direkt,<br />
aber unterschwellig. Nicht persönlich,<br />
aber politisch. Gesellschaftlich. Sofort greift der Verteidigungsreflex.<br />
Zwischen: Ich bin kein Vergewaltiger.<br />
Und: Ist es jetzt schon verboten, einer Frau Komplimente<br />
zu machen? Und die ganz Cleveren überkompensieren<br />
ihr Unwohlsein, indem sie den notorischen Frauenversteher<br />
und leider auch Frauenerklärer geben.<br />
Die Aufgabe aber, die jetzt auf die Männer zukommt,<br />
ist eine andere. Es ist das Männerverstehen und Männererklären.<br />
Und das kann durchaus schmerzhaft werden.<br />
Da geht es sehr wohl um Weinstein und uns. Um die<br />
Verbindung von Status und Sex, Geld und Sex, Macht<br />
und Sex. Um Männlichkeit, um männlichen Erfolg und<br />
seine Symbole.<br />
Um Frauen als Symbol für männlichen Erfolg etwa.<br />
<strong>Der</strong> schier endlose Reigen von Bildern, auf denen Weinstein<br />
weibliche Filmstars im Arm<br />
hält – ist der erst mit dem Wissen<br />
von heute problematisch? Oder<br />
war er nicht schon immer der sichtbare<br />
Auswuchs eines Systems, in<br />
dem die Frau zur Trophäe mächtiger<br />
Männer degradiert wird?<br />
Und gehören die, die Frauen als<br />
Trophäen männlichen Erfolgs akzeptieren,<br />
nicht selbst schon zum<br />
System? Schaffen Männer das Umfeld,<br />
in dem andere Männer sich<br />
dann so benehmen können, wie es<br />
Weinstein tat? Und schaffen Frauen<br />
dieses Umfeld nicht auch? Und<br />
darf man das als Mann sagen?<br />
Genau da wird es hakelig. Genau<br />
da beginnt die neue Unsicherheit<br />
der Männer. Ob ein Kompliment<br />
nett gemeint ist oder an -<br />
züglich, darüber lässt sich reden.<br />
Was verboten sein sollte, dürfte<br />
sich klären lassen. Aber in welcher<br />
Weise sich das Selbstverständnis<br />
der Männer ändern muss,<br />
darüber hat die Debatte kaum<br />
begonnen.<br />
Geführt und erlebt wird sie von vielen Männern allenfalls<br />
als Rückzugsgefecht. Sie sind irritiert, verunsichert,<br />
sie halten sich raus. Die Frauen dagegen erobern in einem<br />
zähen Kampf Millimeter um Millimeter gesellschaftliche<br />
Räume. Sie wehren sich. Sie bestimmen den Diskurs.<br />
Und das hat seinen Grund. Frauen denken seit Jahrzehnten<br />
über das Frausein nach. <strong>Der</strong> Feminismus hat<br />
eine Debattendichte erreicht, deren Verästelung manchmal<br />
absurd erscheint, die aber Frauen eine Vielzahl von<br />
Angeboten macht auf die Frage: Welche Frau willst du<br />
eigentlich sein?<br />
<strong>Der</strong> Diskurs der Männer ist im Grunde nie über das hinausgekommen,<br />
was Herbert Grönemeyer 1984 zu der<br />
Frage „Wann ist ein Mann ein Mann?“ ironisch textete:<br />
„Männer kaufen Frauen. Männer kriegen dünnes Haar.“<br />
Es gibt nicht einmal einen Begriff. <strong>Der</strong> „Maskulinismus“<br />
ist bloß eine Rückwärtsbewegung, die Machomacht verteidigen<br />
will. Und überdies bedeutungslos.<br />
Ein wirklicher Diskurs über Männlichkeit wäre anstrengend.<br />
Weil es ja nicht darum geht, alles Männliche einfach<br />
abzuschleifen, das Eigene in politischer Überkorrektheit<br />
zu ersticken oder schlicht eine bessere Frau zu werden,<br />
nur eben als Mann. Macht und Status und Geld und Sex<br />
sind ja keine an sich verabscheuungswürdigen Ziele. Und<br />
sich etwas zu erarbeiten, zu erkämpfen und stolz darauf<br />
zu sein, das können Männer durchaus auch weiter als<br />
männlich begreifen.<br />
Die Männer sollten schlicht aufhören, immer die Frauen<br />
um Auskunft zu bitten. Sie sollten endlich anfangen,<br />
über sich selbst nachzudenken und sich zu fragen: Welcher<br />
Mann willst du eigentlich sein? Markus Brauck<br />
24 DER SPIEGEL 43 / 2017
Deutschland<br />
Israelisches U-Boot aus deutscher Produktion in Haifa 2014<br />
XINHUA / IMAGO<br />
Waffenexporte<br />
U-Boot-Verkauf nach Israel mit Klausel<br />
Bundesregierung macht den Deal von Korruptionsaufklärung abhängig.<br />
Die Bundesregierung hat dem umstrittenen Verkauf von drei<br />
U-Booten an Israel zugestimmt – allerdings unter strengen<br />
Auflagen. Am Donnerstag einigten sich Kanzleramt, Aus -<br />
wärtiges Amt und das Verteidigungsministerium darauf, ein<br />
sogenanntes Memorandum of Understanding (MoU) mit der<br />
israelischen Regierung zu unterzeichnen, das sich ungewöhnlich<br />
scharf gegen Korruption richtet. Grund sind Bestechungs -<br />
vorwürfe gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie<br />
Berater und Vertraute des israelischen Regierungschefs.<br />
Bevor die U-Boote geliefert werden könnten, müssten<br />
sämt liche Ermittlungen eingestellt und alle Verdachtsmomente<br />
ausgeräumt sein, heißt es in Paragraf 10 des MoU. Das genaue<br />
Verfahren soll in gegenseitigen Briefen geregelt werden.<br />
In dem Notenaustausch behält sich die Bundesregierung<br />
das Recht vor, die U-Boote selbst dann nicht zu liefern,<br />
wenn die israelische Regierung die Affäre einseitig für<br />
beendet erklärt. Bedingung sei, dass auch der israelische<br />
Generalstaatsanwalt die Einstellung aller Ermittlungen<br />
be stätige und dass die Bundesregierung ihrerseits die Affäre<br />
für beendet hält. red<br />
Bonn-Berlin-Pendler<br />
Skypen statt fliegen<br />
Das Ende der Fluggesellschaft<br />
Air Berlin droht die<br />
Funktionsfähigkeit der Bundesregierung<br />
einzuschränken.<br />
Die insolvente Airline hatte<br />
einen beträchtlichen Teil der<br />
ministerialen Bonn-Berlin-<br />
Pendler auf Grundlage eines<br />
Vertrags mit dem Bundes -<br />
verkehrsministerium befördert.<br />
Das Ministerium muss<br />
nun den „Beamten-Shuttle“<br />
neu ausschreiben – vor<br />
Herbst 2018 werden die<br />
neuen Flieger aber kaum ab -<br />
heben. Bis dahin sollen die<br />
Beschäftigten Dienstreisen<br />
auf das „notwendige Maß“<br />
beschränken, heißt es in einer<br />
ministerialen Dienstanweisung;<br />
insbesondere sei die<br />
„Durchführung des Dienst -<br />
geschäfts über Video- und<br />
Telefonkonferenz“ vorzuziehen.<br />
Zudem wird zur fünfstündigen<br />
Anreise mit der<br />
Deutschen Bahn geraten,<br />
auch wenn dies mit einer<br />
Übernachtung verbunden<br />
sein sollte.<br />
Im Jahr 2015 waren Bundesbeamte<br />
33 307-mal zwischen<br />
Berlin und Bonn geflogen.<br />
Ein Regierungsbericht hatte<br />
im Februar eintägige Dienstreisen<br />
„häufig als besonders<br />
ineffizient“ bewertet. kn<br />
26 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Ein Impressum mit dem Verzeichnis der Namenskürzel aller Redakteure finden Sie unter www.spiegel.de/kuerzel
Deutschland<br />
Fake News<br />
Desinformation<br />
verfängt<br />
Falschmeldungen in sozialen<br />
Netzwerken wie Facebook<br />
erzielen oft die gewünschte<br />
Wirkung, wie eine Studie<br />
zeigt. Die Berliner Denk -<br />
fabrik „Stiftung Neue Verantwortung“<br />
konfrontierte Bürger<br />
mit ausgewählten Falschnachrichten,<br />
die im Wahlkampf<br />
eine Rolle gespielt<br />
hatten. Ergebnis: Bei AfD-<br />
Wählern war die Bereitschaft,<br />
Fake News zu glauben, am<br />
größten. 75 Prozent der befragten<br />
Rechtswähler hielten<br />
etwa die Falschmeldung, dass<br />
jeder zweite Flüchtling keinen<br />
Schulabschluss habe, für<br />
wahr. Bei Grünen-Wählern<br />
waren es 40 Prozent. Die unzutreffende<br />
Behauptung, Kirchenfrau<br />
Margot Käßmann<br />
habe alle Deutsche Nazis<br />
genannt, hielt ein Viertel der<br />
Demonstrant in Brandenburg<br />
PAUL ZINKEN / DPA<br />
AfD-Wähler für glaubwürdig<br />
– gegenüber fünf Prozent<br />
der Grünen-Anhänger. „Geglaubt<br />
wird, was ins Weltbild<br />
passt“, so das Fazit von<br />
Alexander Sängerlaub, Leiter<br />
des Fake-News-Projekts. Umgekehrt<br />
hatten es echte News<br />
bei AfD-Wählern besonders<br />
schwer: Über die Hälfte hielt<br />
die Forderung von SPD-Kanzlerkandidat<br />
Martin Schulz<br />
nach einem „Arbeitslosengeld<br />
Q“ für Fake News. rom<br />
<strong>Der</strong>adikalisierung<br />
Schwäbischer<br />
Scharlatan<br />
Betrugsverdacht gegen einen<br />
Referenten des baden-württembergischen<br />
Innenministeriums:<br />
<strong>Der</strong> für <strong>Der</strong>adikalisierung<br />
zuständige Mitarbeiter<br />
Daniel Köhler soll dem Vater<br />
einer niederländischen Salafistin<br />
eine Rettungsaktion aus<br />
der früheren irakischen IS-<br />
Hochburg Mossul nur vor -<br />
gegaukelt haben. „Köhler hat<br />
das Leben von Laura und<br />
ihren Kindern aufs Spiel<br />
gesetzt und die Familie betro-<br />
Einwanderung<br />
„Flüchtlinge heißen<br />
wir willkommen“<br />
Daniel Günther, 44 (CDU), Ministerpräsident<br />
von Schleswig-<br />
Holstein, über die liberale Haltung<br />
seiner Jamaikaregierung<br />
gegenüber Migranten<br />
SPIEGEL: Herr Günther, Ihre<br />
Landes-CDU hat der Grünen-<br />
Forderung nach einer Er -<br />
leichterung des Nachzugs von<br />
Familienangehörigen der<br />
Flüchtlinge nachgegeben –<br />
Kiels Jamaikabündnis will<br />
sich laut Koalitionsvertrag<br />
dafür im Bund einsetzen.<br />
Warum?<br />
Günther: Das gilt für Flüchtlinge,<br />
die in ihrer Heimat ernsthaft<br />
gefährdet sind und daher<br />
absehbar länger bei uns bleiben<br />
werden. Wir haben ein<br />
klares Prinzip vereinbart:<br />
Wir heißen Flüchtlinge willkommen<br />
und erwarten im<br />
gen. Er ist ein Scharlatan“,<br />
sagt Anwalt Michiel Pestmann,<br />
der die junge Frau im<br />
Terrorprozess in Rotterdam<br />
vertritt. Bei ihrer Flucht aus<br />
Mossul war die Salafistin<br />
samt ihrer Familie in ein Feuer -<br />
gefecht zwischen IS-Kämpfern<br />
und kurdischen Milizen<br />
geraten. Ihr Mann blieb nach<br />
Aussage von Laura H. schwer<br />
verletzt zurück (SPIEGEL<br />
21/2017).<br />
Köhler hatte H.s Vater gegenüber<br />
behauptet, er habe<br />
ein professionelles Team im<br />
Irak. Laura werde aus Mossul<br />
abgeholt. Doch dieses Team<br />
Gegenzug Integrationsbereitschaft.<br />
Wer Partner und Kinder<br />
in Krisengebieten zurücklassen<br />
muss, hat nicht den<br />
Kopf für Deutschkurse frei.<br />
SPIEGEL: Ihre schwarz-grüngelbe<br />
Regierung will sich<br />
auch für ein Einwanderungsgesetz<br />
starkmachen. Was<br />
erwarten Sie sich davon?<br />
Günther: Angesichts<br />
des Fachkräftemangels<br />
müssen wir endlich<br />
die Möglichkeit<br />
schaffen, Zuwanderung<br />
an unserem<br />
Bedarf auszurichten.<br />
Weil wir kein modernes<br />
Einwanderungsrecht<br />
haben, kommen Menschen<br />
auf der Suche nach<br />
Arbeit als Flüchtlinge und<br />
bleiben zum Teil jahrelang im<br />
Asylsystem hängen. Das wollen<br />
wir ändern. Zugleich stellen<br />
viele Asylanträge, die keinerlei<br />
Aussicht auf Erfolg haben.<br />
Sie wünschen sich – wer<br />
existierte offenbar nicht; die<br />
Familie war im Juli 2016 bei<br />
ihrer Flucht völlig allein. Auf<br />
Anweisung Köhlers hatte der<br />
Vater 10 000 Euro auf ein britisches<br />
Konto überwiesen. Das<br />
Geld verschwand in dunklen<br />
Kanälen. <strong>Der</strong> britische Empfänger<br />
sagte zur Polizei, er<br />
habe einen Teil behalten und<br />
den Rest an einen Mann<br />
namens „Alastair“ weiter -<br />
gegeben; Nachnamen oder<br />
Kontaktadresse kenne er nicht.<br />
Köhler bestreitet den Betrugsvorwurf<br />
und behauptet, er<br />
sei nur ehrenamtlich für die<br />
Familie tätig gewesen. gud<br />
tut das nicht – hier ein besseres<br />
Leben, werden in ihrer<br />
Heimat aber nicht verfolgt.<br />
Daher dürfen sie bisher nicht<br />
bleiben – auch dann nicht,<br />
wenn sie dank beruflicher<br />
Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt<br />
gebraucht würden.<br />
SPIEGEL: Wie beurteilen Sie<br />
die Chancen, dass Jamaika im<br />
Bund sich auf ähnliche<br />
Ziele wie Ihr Landesbündnis<br />
in der Flüchtlingsfrage<br />
verständigt?<br />
Günther: Jamaika in<br />
Kiel zeigt, dass die<br />
Flüchtlingspolitik von<br />
CDU, FDP und Grünen<br />
sich optimal ergänzen<br />
kann. Voraussetzung<br />
ist, dass die Verhandlungspartner<br />
sich zuhören, gemeinsame<br />
Ziele formulieren und dann<br />
gucken, wie man sie erreichen<br />
kann. Dann passt ganz viel zusammen,<br />
was man vorher gegenseitig<br />
in Bausch und Bogen<br />
verdammt hat. ab<br />
CARSTEN REHDER / DPA<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Ruhigere Zeiten für<br />
Steuersünder?<br />
<strong>Der</strong> Steuerfahndung Wuppertal,<br />
Deutschlands gefürchtete<br />
Anti-Betrugs-Einheit, wird<br />
die Schlagkraft genommen.<br />
Für Unmut sorgt in der Behörde<br />
eine Stellenausschreibung,<br />
in der ein neuer Leiter<br />
gesucht wird – obwohl eine<br />
bewährte Kraft das Fahndungsteam<br />
derzeit leitet. Im<br />
Juni ging der legendäre Chef<br />
Peter Beckhoff in den Ruhestand.<br />
Seine Arbeit hat dem<br />
Staat rund sieben Milliarden<br />
Euro eingebracht – an nachgezahlten<br />
Geldern von Steuersündern<br />
und Geldbußen<br />
von Banken. <strong>Der</strong> damalige Finanzminister<br />
Norbert Walter-<br />
Borjans (SPD) entschied, dass<br />
Beckhoffs im Ankauf von Daten<br />
erfahrene Stellvertreterin<br />
Sandra Höfer-Grosjean seinen<br />
Posten übernehmen sollte,<br />
um die Arbeitsfähigkeit<br />
der Abteilung zu gewähr -<br />
leisten – wohl wissend, dass<br />
in der Finanzverwaltung laut<br />
einer Uraltvorschrift nur<br />
jemand Leiter werden kann,<br />
der bereits bei einem anderen<br />
Finanzamt gearbeitet hat.<br />
Höfer-Grosjean wurde offenbar<br />
gegen den Willen der<br />
mächtigen Oberfinanzdirek -<br />
tion kommissarisch ernannt<br />
und sollte Ende 2018 offiziell<br />
die Stelle erhalten. Das rächt<br />
sich nun: Die neue schwarzgelbe<br />
Landesregierung fühlt<br />
sich nicht an die Entscheidung<br />
ihrer Vorgänger gebunden.<br />
Insbesondere der FDP<br />
ist der Ankauf der Daten ein<br />
Dorn im Auge. bas<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
27
Deutschland<br />
Zeitgeschichte<br />
Kein Geld für<br />
„Landshut“<br />
Mit großem Brimborium<br />
wurde Ende September das<br />
Wrack der 1977 von Terroristen<br />
entführten Lufthansa-<br />
Maschine „Landshut“ aus<br />
Brasilien nach Deutschland<br />
geholt – doch für die geplante<br />
Ausstellung in Friedrichshafen<br />
fehlt das Geld. Das<br />
Industriepolitik<br />
Lex Telekom<br />
Die Bundesregierung macht<br />
sich während der letzten Tagen<br />
ihrer Amtszeit in Brüssel<br />
für Interessen der Deutschen<br />
Telekom stark, die noch zu<br />
rund 32 Prozent in Staatsbesitz<br />
ist. Es geht um den Ausbau<br />
der Datennetze.<br />
Mit Datum 10. Oktober<br />
schickte das Bundeswirtschaftsministerium<br />
eine Weisung für Verhandlungen<br />
über ein<br />
neues Telekom-Paket<br />
nach Brüssel. Deutschland<br />
setzte daraufhin<br />
im Europäischen Rat<br />
durch, dass große Anbieter<br />
wie die Telekom<br />
für bis zu sieben Jahren<br />
von Regulierungen<br />
private Dornier-Museum in<br />
Friedrichshafen will das Flugzeug<br />
in einer fünf Millionen<br />
Euro teuren Halle präsentieren,<br />
die der Staat bezahlen<br />
soll. Außenminister Sigmar<br />
Gabriel (SPD) hatte mit Kulturstaatsministerin<br />
Monika<br />
Grütters (CDU) aber nur vereinbart,<br />
sein Amt zahle den<br />
Heimtransport und Grütters<br />
Behörde die Restaurierung<br />
des Wracks. Grütters weigert<br />
befreit werden können.<br />
Dafür müssten die Konzerne<br />
Wettbewerbern lediglich<br />
anbieten, bei Projekten zum<br />
Netzausbau mitzumachen –<br />
ob diese zustande kommen,<br />
ist dabei nicht relevant.<br />
Die Telekom fordert seit<br />
Jahren, im Gegenzug für den<br />
weiteren Breitbandausbau<br />
Messeauftritt der Telekom in Hannover<br />
„Landshut“-Wrack in Friedrichshafen<br />
sich, weitere Kosten zu<br />
übernehmen, das Auswärtige<br />
Amt wiederum hat keine<br />
Haushaltstitel, um den Bau<br />
des Hangars zu finanzieren.<br />
Museumsdirektor David<br />
Dornier hofft auf Spenden,<br />
doch das Kalkül geht offenbar<br />
nicht auf. Eine gemein -<br />
same Spendenkampagne mit<br />
der „Bild“-Zeitung hat<br />
bislang nur rund 70 000 Euro<br />
eingebracht. csc<br />
von Wettbewerbsauflagen<br />
befreit zu werden. Jürgen<br />
Grützner, Chef des Verbands<br />
privater Telekom-Konkur -<br />
renten VATM, rügt die neue<br />
Ratsposition als „Lex Telekom“:<br />
„Die Regierung versucht,<br />
auf den letzten Metern<br />
Fakten zu schaffen und<br />
sieben Jahre Regulierungspause<br />
zugunsten der<br />
Telekom durchzusetzen.“<br />
Das Wirtschaftsministerium<br />
spricht<br />
auf Nachfrage von<br />
„Regulierungserleichterungen“<br />
für „begrenzte<br />
Zeit“. Dadurch<br />
würde „ein Ausbau,<br />
der sonst voraussichtlich<br />
gar nicht stattgefunden<br />
hätte, für die<br />
Unternehmen finanziell<br />
attraktiver“. gt, rom<br />
ELMAR KREMSER / SVEN SIMON / PA / DPA<br />
ANDREAS FRIEDRIC / 7AKTUELL / IMAGO<br />
Bamf<br />
Frühe Hinweise auf<br />
Türkeispitzel<br />
Das Bundesamt für Migra -<br />
tion und Flüchtlinge (Bamf)<br />
hat bereits Anfang August<br />
Hinweise erhalten, wonach<br />
türkischstämmige Bamf-Mitarbeiter<br />
Informationen über<br />
türkische Asylbewerber an<br />
regierungsnahe Medien in der<br />
Türkei verraten haben könnten.<br />
<strong>Der</strong> CDU-Europaabgeordnete<br />
Axel Voss hatte den<br />
Verdacht in einem Brief an<br />
die Präsidentin des Bundesamts,<br />
Jutta Cordt, ge äußert.<br />
Grund war ein Artikel in der<br />
AKP-nahen türkischen Tageszeitung<br />
„Yeni Akit“ vom<br />
9. Mai. Darin wird behauptet,<br />
Anhänger der Bewegung<br />
des Predigers Fethullah<br />
Gülen würden in Deutschland<br />
„mit offenen Armen<br />
aufgenommen“ und ein<br />
„monat liches Gehalt von<br />
2000 bis 5000 Euro“ erhalten.<br />
<strong>Der</strong> türkische Präsident<br />
Recep Tayyip Erdoğan bezeichnet<br />
die Gülen-Bewegung<br />
als Terrororganisation<br />
(„Fetö“).<br />
In dem Zeitungsbericht<br />
werden 17 Namen von türkischen<br />
Bürgern genannt, die<br />
in Deutschland Asyl beantragt<br />
hätten. Dazu wurden<br />
die Namen von zwei Helfern<br />
veröffentlicht, die in Dortmund<br />
„bei den Asylbear -<br />
beitungen der Fetö-Verräter -<br />
namen“ behilflich seien.<br />
CDU-Politiker Voss befürchtete<br />
schon damals, die Indiskretionen<br />
könnten von Mitarbeitern<br />
oder Dolmetschern<br />
aus deutschen Behörden<br />
stammen, und wies auf drohende<br />
Repressalien für die<br />
Angehörigen der Betroffenen<br />
in der Türkei hin.<br />
Über ähnliche Fälle hatten<br />
vergangene Woche der<br />
SPIEGEL und „Report Mainz“<br />
berichtet. Das Bundesamt<br />
für Migration teilt mit, nur<br />
ein Teil der veröffentlichten<br />
Namen seien zum damaligen<br />
Zeitpunkt im Asylverfahren<br />
existent gewesen. Es prüfe<br />
„die Sachverhalte sehr<br />
sorgfältig“ und leite „wo erforderlich<br />
auch Maßnahmen<br />
ein“. kno<br />
28 DER SPIEGEL 43 / 2017
LAND ROVER FLEXLEASING<br />
WECHSELN SIE JETZT ZU<br />
MOTOREN MIT ZUKUNFT.<br />
JETZT AB 299,- €<br />
PRO MONAT LEASEN *<br />
Entdecken Sie jetzt Leasing-Neuland mit dem Land Rover<br />
FlexLeasing. Fahren Sie einen Land Rover mit neuester Ingenium<br />
Motorentechnologie zu besonders attraktiven Konditionen.<br />
-iiÌÃVi`iyiÝLiâÜÃViiiÀi>Ã}>ÕvâiÌÛ<br />
36 oder 24 Monaten.<br />
Erfahren Sie jetzt mehr über das neue Land Rover FlexLeasing<br />
bei Ihrem Land Rover Partner oder unter landrover.de<br />
LEASINGANGEBOT<br />
Land Rover Discovery Sport eD4 PURE,<br />
Range Rover Evoque eD4 PURE<br />
Monatliche Leasingrate<br />
>À«ÀiÃ<br />
Leasingsonderzahlung<br />
>ÕvâiÌ<br />
iÃ>Ìv>ÀiÃÌÕ}<br />
-âÃÃ>Ìâ«°>°}iLÕ`i<br />
vviÌÛiÀ>ÀiÃâÃ<br />
Ó]qåIIÉÎÎÎ]qåII<br />
ÎΰÓxä]qåIIIÉÎ{°ää]qåIII<br />
ΰÈää]qå<br />
36 Monate<br />
Îä°äää<br />
qä]xǯÉä]ä¯<br />
qä]xǯÉä]ä¯<br />
iÃ>ÌLiÌÀ>}<br />
£{°ÎÈ{]qåÉ£x°xnn]qå<br />
°Î>Ài>`,ÛiÀ>À>ÌiLÃ>Ý°£ää°äää}iB~<br />
>À>ÌiLi`}Õ}i°<br />
I>Ã}iLÌ}ÌvØÀÃvÀÌÛiÀvØ}L>Ài>ÀâiÕ}i`iÀ`iÀii,>}i,ÛiÀÛμÕiÕ`>`,ÛiÀÃVÛiÀÞ-«ÀÌLi>iÌiii`i>`,ÛiÀ6iÀÌÀ>}ë>ÀÌiÀ°LiÀL>À<br />
Ì`iÀ>`,ÛiÀ1ÜiÌ«ÀBi°>Ã}iLÌÃÌ}ØÌ}LÃΣ°£Ó°Óä£ÇÕ`Ã>}i`iÀ6ÀÀ>ÌÀiVÌ°<br />
II1ÛiÀL`Vii>Ã}LiëiiÌiÌiÀ>LÀiVÕ}]ÛiÀÌÌiÌvØÀ`i>`,ÛiÀ>]ÃÃÕ}`iÀ>iÕÌÃV>`L]->âÃÌÀ>~i£În]Ç{äÇÈiLÀ>Õv>ÃÃ<br />
>ÌÕi}ØÌ}iÀ`Ìi°7`iÀÀÕvÃÀiVÌ>VÅ{xvØÀ6iÀLÀ>ÕViÀ°ÌiÕ`<br />
iÀiÌiÃi>Ã}>}iLÌÜi`i-iÃVLÌÌi>ii>`,ÛiÀ6iÀÌÀ>}ë>ÀÌiÀÀiÀ7>°<br />
III1*`iÀ>}Õ>À>`,ÛiÀiÕÌÃV>`L°<br />
>`,ÛiÀÃVÛiÀÞ-«ÀÌi{*1,]À>vÌÃÌvvÛiÀLÀ>ÕVÉ£ää\x]xiÀÀÌîÆ{]Ó>Õ~iÀÀÌîÆ{]ÇL°®Æ<br />
" 2 ÃÃi}É\£ÓÎÆ" 2 vwâiâ>ÃÃi\³°,>}i,ÛiÀÛμÕii{*1,]À>vÌÃÌvvÛiÀLÀ>ÕV<br />
É£ää\x]äiÀÀÌîÆÎ]>Õ~iÀÀÌîÆ{]ÎL°®Æ" 2 ÃÃi}É\££ÎÆ" 2 vwâiâ>ÃÃi\³Æ<br />
7iÀÌiiÀÌÌiÌ>V,6"®ÈÓÉÓäänLâÜ°,näÉ£ÓÈnÉ7°
Deutschland<br />
„Das Risiko<br />
ist erheblich“<br />
Verteidigung In einem Geheimbericht warnt die Nato<br />
davor, dass man einem Angriff Russlands nicht<br />
gewachsen sei. Führende Militärs fordern eine Rückkehr<br />
zu den Kommandostrukturen des Kalten Krieges.<br />
Manöverbeobachter Putin<br />
Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei<br />
30 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Das 2. Kavallerie-Regiment ist einer<br />
der ältesten Verbände der US-Armee.<br />
Schon 1846 kämpften Soldaten<br />
der Einheit gegen die Mexikaner. In<br />
den Indianerkriegen zwei Jahrzehnte später<br />
geriet ein Teil des Regiments in einen<br />
Hinterhalt und wurde skalpiert. 1905 schlugen<br />
die Kavalleristen einen Aufstand auf<br />
den Philippinen nieder. Die Truppe war<br />
in zwei Weltkriegen im Einsatz und wurde<br />
mehrmals in den Irak und nach Afghanistan<br />
verlegt.<br />
Am 18. Juli 2017 traf die 1. Schwadron<br />
des stolzen Regiments auf einen Gegner,<br />
dem sie nicht gewachsen war. An der rumänisch-bulgarischen<br />
Grenze staute sich<br />
der Konvoi der US-Kavallerie vor einem<br />
Grenzübergang. „Anderthalb Stunden saßen<br />
wir in unseren Panzern in der Sonne<br />
und warteten auf irgendwelche Typen, die<br />
mit der Hand unsere Papiere abstempeln<br />
mussten“, zitiert der amerikanische Onlinedienst<br />
Defense One Colonel Patrick Ellis,<br />
den Kommandeur der Einheit.<br />
Was in Friedenszeiten wie eine Posse<br />
wirkt, könnte im Ernstfall die Verteidigungsfähigkeit<br />
der Nato infrage stellen.<br />
Seit der russischen Annexion der Krim<br />
2014 bereitet sich das westliche Bündnis<br />
darauf vor, das eigene Gebiet notfalls wieder<br />
gegen einen Aggressor zu verteidigen.<br />
Doch die Grenzbürokratien der 29 Mitgliedstaaten<br />
bremsen Truppenkonvois vermutlich<br />
effizienter aus als jede russische<br />
Panzersperre. Und das Problem ist nicht<br />
allein die Bürokratie.<br />
Seit Ende Juni kursiert im Brüsseler<br />
Hauptquartier der Allianz ein geheimer<br />
Report („NATO SECRET“), der die Schwächen<br />
des Bündnisses schonungslos benennt.<br />
Unter dem unverfänglichen Titel<br />
„Fortschrittsbericht über das verstärkte<br />
Abschreckungs- und Verteidigungsdisposi -<br />
tiv der Allianz“ kommen die Autoren zu<br />
einem dramatischen Befund: „Die Fähigkeit<br />
der Nato, die schnelle Verstärkung<br />
im stark erweiterten Territorium des Verantwortungsbereichs<br />
des Oberbefehlshabers<br />
für Europa logistisch zu unterstützen,<br />
ist seit dem Ende des Kalten Krieges<br />
atrophiert.“<br />
Atrophie nennen Mediziner den<br />
Schwund von Gewebe, der etwa eintritt,<br />
wenn ein Arm eingegipst ist. Es dauert<br />
lange, bis die alte Funktionsfähigkeit wiederhergestellt<br />
ist. 27 Jahre nach Ende des<br />
Kalten Krieges ist die logistische Infrastruktur<br />
der Nato offenbar in einem ähnlichen<br />
Zustand: nur bedingt abwehrbereit.<br />
Es fehlt an fast allem: an Tiefladern für<br />
Panzer, Bahnwaggons für schweres Gerät,<br />
modernen Brücken, die einen 64-Tonnen-<br />
Koloss wie den Kampfpanzer „Leopard 2“<br />
problemlos tragen könnten. Was nützen<br />
die teuersten Waffensysteme,<br />
wenn sie nicht dorthin verlegt<br />
werden können, wo sie benötigt<br />
werden? „Insgesamt ist<br />
das Risiko für eine schnelle<br />
Verstärkung erheblich“, heißt<br />
es in dem Bericht.<br />
Noch nicht einmal auf die<br />
Eingreiftruppe sei Verlass. So<br />
wie der Verantwortungsbereich<br />
des Nato-Oberbefehlshabers<br />
für Europa („SACEUR“)<br />
derzeit aufgestellt sei, „gibt es<br />
keine ausreichende Sicherheit,<br />
SPUTNIK / REUTERS<br />
dass selbst die Nato-Eingreiftruppe<br />
in der Lage ist, schnell<br />
und – wenn nötig – nachhaltig<br />
zu reagieren“.<br />
MARTIN LUKAS KIM / DER SPIEGEL<br />
<strong>Der</strong> Geheimreport aus Brüssel zeichnet<br />
das Bild eines Bündnisses, das nicht in der<br />
Lage wäre, einen Angriff aus Russland abzuwehren.<br />
Weil es seine Truppen nicht<br />
rechtzeitig in Stellung bringen könnte.<br />
Weil es in seinen Stäben zu wenig Offiziere<br />
gibt. Weil der Nachschub über den Atlantik<br />
nicht funktioniert.<br />
Dabei ist die westliche Allianz Wladimir<br />
Putins Autokratenregime militärisch (vermutlich)<br />
und ökonomisch (mit Sicherheit)<br />
weit überlegen. Doch am Ende entschieden<br />
in Tausenden Jahren Militärgeschichte<br />
oft so unspektakuläre Faktoren wie Nachschub,<br />
Versorgung und Logistik über Sieg<br />
oder Niederlage. Zwar rechnet kaum jemand<br />
damit, dass Russland tatsächlich ein<br />
Nato-Land angreifen könnte, doch nur<br />
eine funktionierende militärische Abschreckung,<br />
davon sind viele in der Allianz<br />
überzeugt, wird Putin davon abhalten,<br />
poli tischen Druck auf die Randstaaten des<br />
Bündnisses auszuüben. Auf Länder wie<br />
Estland, Litauen oder Lettland.<br />
Drei Jahre nach der Krim-Annexion steht<br />
die militärische Architektur des Bündnisses<br />
deshalb vor einem tief greifenden Umbau.<br />
Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei,<br />
die Kommandostrukturen des Kalten Krieges<br />
kehren zurück. Die Nato soll wieder<br />
für eine große militärische Auseinanderset-
Transport deutscher Schützenpanzer nach Litauen: Willkommen im großen Papierkrieg der Nato<br />
zung gerüstet sein, für eine „MJO+“, wie<br />
es im Militärjargon heißt. Eine solche „Major<br />
Joint Operation Plus“ wäre der Bündnisfall<br />
nach Artikel 5 des Nato-Vertrags.<br />
Die Allianz müsse in der Lage sein,<br />
„schnell einen oder mehrere bedrohte Verbündete<br />
zu stärken, Abschreckung in Friedens-<br />
und Krisenzeiten zu untermauern<br />
und Verbündete im Falle eines Angriffs zu<br />
unterstützen“, heißt es in dem Bericht.<br />
Und sie müsse befähigt werden, schnell<br />
Truppen zu mobilisieren und zu halten,<br />
unabhängig von „Natur, Bedarf, Ort oder<br />
Dauer der Operation“. Dazu seien eine<br />
„robuste militärische Logistik und Fähigkeiten“<br />
mit Kommunikationslinien notwendig,<br />
die von Nordamerika bis zur östlichen<br />
und südlichen Grenze des Nato-Territoriums<br />
reichten und „innereuropäische<br />
Routen“ einschlössen.<br />
Die Verteidigungsminister der 29 Nato-<br />
Staaten erteilten den Auftrag für eine Reform<br />
der Kommandostrukturen schon im<br />
Februar. In Zukunft müsse das Bündnis in<br />
der Lage sein, mehrere Operationen gleichzeitig<br />
bis zum maximalen „Level of Ambition“<br />
durchzuführen, hieß es damals. Militärs<br />
nutzen diesen Fachbegriff, um ihren<br />
institutionellen Ehrgeiz zu definieren.<br />
Die bisherige Nato-Kommandostruktur<br />
würde ihren Zweck „im günstigsten Fall<br />
nur teilweise erfüllen und, obwohl sie nie<br />
getestet wurde, schnell versagen, sollte sie<br />
mit dem vollen Nato-Level of Ambition<br />
konfrontiert werden“, heißt es in dem Papier.<br />
Dieser „Level of Ambition“ wird als<br />
Kategorie „MJO+“ definiert. Im Klartext:<br />
Die Nato bereitet sich auf einen möglichen<br />
Krieg mit Russland vor.<br />
Dass die Kommandostrukturen des<br />
Bündnisses dafür nicht mehr zeitgemäß<br />
sind, ist den Nato-Militärs seit Langem bewusst.<br />
Am vorvergangenen Freitag legten<br />
sie dem Militärkomitee der Allianz ihre<br />
Vorschläge für eine Aufrüstung der Stäbe<br />
vor. Nun dürfen sich alle Nationen dazu<br />
äußern, Anfang November werden die Verteidigungsminister<br />
den Vorschlägen wohl<br />
zustimmen.<br />
„Wir wissen, dass wir die Allianz und<br />
ihre Kommandostrukturen anpassen und<br />
modernisieren müssen“, sagt die nor -<br />
wegische Verteidigungsministerin Ine Eriksen<br />
Søreide. „Norwegen wird sich dafür<br />
einsetzen, dass die Kommandostruktur<br />
der Nato relevant und robust bleibt.“ Und<br />
ihr dänischer Kollege Claus Hjort Frederiksen<br />
sagt: „Russland hat internationales<br />
Recht gebrochen“, deshalb müsse die Allianz<br />
ihre Strukturen überprüfen. „Die<br />
Nato ist nur deshalb das stärkste Verteidigungsbündnis<br />
der Welt, weil sie sich seit<br />
70 Jahren ständig an neue Herausforderungen<br />
angepasst hat“, sagt Frederiksen.<br />
Auch Litauens Ressortchef Raimundas<br />
Karoblis fordert eine bessere Organisation<br />
zur „Abschreckung und Verstärkung der<br />
Nato“ in Osteuropa. Die neue Struktur solle<br />
das Bündnis in „verwundbaren Regionen<br />
wie dem Baltikum“ unterstützen.<br />
Um die Atrophie, die die Strukturen des<br />
Bündnisses befallen hat, zu belegen, reichen<br />
schon wenige Zahlen. Vor dem Fall<br />
der Berliner Mauer dienten 23000 Soldaten<br />
in den Befehlsständen der Nato, aber<br />
damals waren auch Hunderttausende US-<br />
Soldaten in Europa stationiert. Die Stäbe<br />
hätten im Fall der Fälle in kurzer Zeit Truppen<br />
und Material mobilisieren und nach<br />
Osten schicken können.<br />
Auch der Nachschubweg über den Atlantik<br />
von den USA nach Europa war bestens<br />
organisiert. Von 1952 bis 2003 unterhielt<br />
die Nato ein festes Kommando für<br />
den Transport von Kriegsmaterial nach<br />
Europa. Von Norfolk im US-Bundesstaat<br />
Virginia aus plante ein amerikanischer Admiral<br />
als Supreme Allied Commander jeden<br />
Tag für den Ernstfall, also die große<br />
Konfrontation mit der Sowjetunion und<br />
dem Warschauer Pakt.<br />
Dann fiel die Mauer, und es gab einen<br />
kurzen Frühling in den Beziehungen zu<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
31
Nordflotte<br />
NIEDER-<br />
LANDE<br />
Brunssum<br />
BELGIEN<br />
Mons<br />
NATO-<br />
STAATEN<br />
Truppenstärke<br />
3200000<br />
Kampfpanzer<br />
9800<br />
Länder, in<br />
denen jüngst<br />
Nato-Truppen<br />
stationiert wurden<br />
Kampfflugzeuge<br />
6100<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
Militärhauptquartiere der Nato<br />
(ein weiteres Hauptquartier<br />
befindet sich in Norfolk Virginia/USA)<br />
*ehemalige Sowjetrepubliken<br />
Hauptquartiere<br />
russischer Militärbezirke<br />
Northwood<br />
FRANKREICH<br />
SPANIEN<br />
zur Zeit des<br />
Kalten Krieges:<br />
Truppenstärke<br />
Kampfpanzer<br />
Kampfflugzeuge<br />
2400000<br />
25900<br />
1140<br />
NORWEGEN<br />
DÄNEMARK<br />
POLEN<br />
DEUTSCHLAND<br />
TSCHECHIEN<br />
Ramstein<br />
SLOWAKEI<br />
ITALIEN<br />
Russische<br />
Exklave<br />
Kaliningrad<br />
Baltische<br />
Flotte<br />
SLOWENIEN<br />
KROATIEN<br />
Neapel<br />
UNGARN<br />
MONTENEGRO<br />
ESTLAND*<br />
LETTLAND*<br />
LITAUEN*<br />
ALBANIEN<br />
RUMÄNIEN<br />
GRIECHENLAND<br />
Die Ostgrenze<br />
der Nato<br />
WEISSRUSSLAND<br />
BULGARIEN<br />
UKRAINE<br />
MOLDAU<br />
Schwarzmeerflotte<br />
Sankt Petersburg<br />
RUSSLAND<br />
Ostukraine<br />
Seit 2014 von<br />
prorussischen<br />
Separatisten<br />
besetzt<br />
Krim<br />
Im März 2014<br />
von Russland<br />
einverleibt<br />
TÜRKEI<br />
Izmir<br />
zur Zeit des<br />
Kalten Krieges<br />
(Warschauer Pakt):<br />
Truppenstärke<br />
Kampfpanzer<br />
Kampfflugzeuge<br />
2300000<br />
53100<br />
3100<br />
Moskau<br />
Rostow<br />
Kampfflugzeuge<br />
1900<br />
RUSSLAND<br />
Truppenstärke<br />
830000<br />
Kampfpanzer<br />
3000<br />
Stationierungsorte<br />
neuer<br />
russischer Divisionen<br />
Hauptquartiere<br />
russischer<br />
Militärbezirke<br />
Hauptquartiere<br />
russischer Flotten<br />
ehemalige Sowjetrepubliken<br />
Russland. Es schien an der Zeit zu sein,<br />
endlich abzurüsten und die Friedensdividende<br />
zu kassieren. Bis 2011 wurden die<br />
Kommandos um 10000 Mann auf 13 000<br />
geschrumpft. Inzwischen sind es nur noch<br />
6800 Soldaten, die in den beiden Befehlsstäben<br />
im niederländischen Brunssum und<br />
im belgischen Mons zum Dienst antreten.<br />
Die Schrumpfkommandos reichten der<br />
Allianz lange Zeit völlig aus, denn die Armeen<br />
des Bündnisses rechneten nicht<br />
mehr mit großen Landkriegen. Sie wurden<br />
massiv umgebaut, denn jetzt war „internationales<br />
Krisenmanagement“ angesagt,<br />
also kleinere Auslandseinsätze außerhalb<br />
des Bündnisgebiets. Landes- und Bündnisverteidigung<br />
schienen von gestern zu sein,<br />
ein Relikt aus den Zeiten der großen Block-<br />
Konfrontation.<br />
Die russische Annexion der Krim 2014<br />
erwischte das Bündnis kalt. Plötzlich war<br />
ein Krieg in Europa wieder denkbar und<br />
nicht mehr auszuschließen, dass die Russen<br />
das Baltikum ins Visier nehmen würden.<br />
Naturgemäß war die Sorge in den osteuropäischen<br />
Nato-Staaten am größten.<br />
Vor allem die Balten und die Polen forderten,<br />
dass die Allianz ein Zeichen setzen<br />
müsse. Und sie drängten auf die Zusicherung,<br />
dass die Nato den Partnern im Ernstfall<br />
schnell zu Hilfe eilen würde.<br />
Sie wurden gehört. Auf dem Gipfel 2014<br />
in Wales beschloss das Bündnis, Kampfeinheiten<br />
in die vier Randstaaten zu schicken,<br />
nach Polen, Litauen, Lettland und<br />
Estland. Die „Battlegroups“ mit jeweils<br />
32 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
etwa tausend Mann unter Führung der großen<br />
Nato-Partner USA, Deutschland,<br />
Großbritannien und Kanada sollen die<br />
Funktion eines „Stolperdrahts“ übernehmen.<br />
Die „Enhanced Forward Presence“<br />
ist zu klein, um militärisch wirklich bedeutsam<br />
zu sein, aber ein deutliches Zeichen<br />
an Russland, dass die Nato entschlossen<br />
ist, ihr Territorium auch in den ehemaligen<br />
Sowjetrepubliken des Baltikums<br />
zu verteidigen.<br />
Doch die Verlegung nach Osten zeigte<br />
auch die Schwächen der Allianz, die jetzt<br />
mit dem Umbau der Kommandostruktur<br />
teilweise behoben werden sollen. So entschlossen<br />
die Nato die Abschreckungspoli -<br />
tik wiederbelebte, so chaotisch verlief die<br />
Umsetzung. „Wir mussten feststellen, dass<br />
wir ziemlich eingerostet waren“, räumt ein<br />
Nato-General ein, „das Bewegen von Truppen<br />
hatten wir schlicht verlernt.“<br />
Die Erfahrungen, die Colonel Ellis vom<br />
2. US-Kavallerie-Regiment im Sommer an<br />
der rumänisch-bulgarischen Grenze machte,<br />
lassen sich auf das ganze Bündnis übertragen.<br />
Alle Länder und oft auch die regionalen<br />
und lokalen Behörden müssen<br />
Militärtransporte einzeln genehmigen. Einheitliche<br />
Formulare gibt es nicht, es reicht<br />
nicht, pauschal die Zahl der Fahrzeuge anzugeben,<br />
die Behörden bestehen auf den<br />
Seriennummern für jeden einzelnen Lkw<br />
oder Panzer. Willkommen im großen Papierkrieg<br />
der Nato.<br />
Will die Nato Truppen von Stuttgart<br />
über Polen nach Lettland zur Abschreckung<br />
an die Nato-Außengrenze zu Russland<br />
verlegen, muss der Transport wochenlang<br />
bürokratisch vorbereitet werden.<br />
„Selbst wenn Krieg ausbrechen sollte, bedeutet<br />
das nicht, dass die Vorschriften außer<br />
Kraft gesetzt werden“, sagt General<br />
Steven Shapiro, Cheflogistiker der US-Armee<br />
in Europa. Und Fachleute wie er wissen,<br />
dass es nicht nur die Bürokratie ist,<br />
die eine Verteidigung des Bündnisgebiets<br />
schwer machen würde.<br />
<strong>Der</strong> Nachschub muss anders organisiert<br />
werden. So entstand die Idee für zwei<br />
neue Kommandos mit insgesamt etwa<br />
2000 Mann. Ein neues maritimes Kommando<br />
soll in den USA nach dem Vorbild des<br />
Supreme Allied Command im Kalten<br />
Krieg die sichere Passage von Truppen<br />
und Material nach Europa organisieren.<br />
<strong>Der</strong> Seeweg, glauben hochrangige Nato-<br />
Militärs, könnte im Ernstfall eine Achillesferse<br />
für den Nachschub werden. In den<br />
geheimen Sitzungen zur Kommandoreform<br />
warnten Analysten, Russland bewege<br />
sich im Atlantik weitgehend unbeobachtet<br />
mit U-Booten. Angriffe auf Nato-Konvois<br />
mit Truppen seien in der derzeitigen Aufstellung<br />
kaum abzuwehren.<br />
Doch auch die Verteilung des Nachschubs<br />
in Europa ist problematisch. Das<br />
soll nun ein weiteres Kommando über -<br />
nehmen, dessen Aufgabe es wäre, die<br />
Logistik zwischen Mitteleuropa und den<br />
östlichen Mitgliedstaaten zu planen und<br />
abzusichern. Es ist davon die Rede, die Bewegungsfreiheit<br />
sicherzustellen und die
Deutschland<br />
Gebiete westlich der Bündnisgrenze besser<br />
zu schützen. Was sich technisch anhört, ist<br />
in Wahrheit die Renaissance des Mobilisierungskonzepts<br />
des Kalten Krieges.<br />
Polen zeigt großes Interesse daran, dieses<br />
„Rear Area Operation Command“ zu<br />
führen. Warschau drängt darauf, dass in<br />
Polen möglichst viele permanente Nato-<br />
Einheiten stationiert werden. Die polnische<br />
Regierung sieht das als ein wirksames<br />
Mittel, um Russland abzuschrecken.<br />
Doch die Amerikaner und andere Verbündete<br />
haben einen anderen Standort ins<br />
Auge gefasst. Deutschland wäre schon aus<br />
geografischen Gründen ein idealer Kandidat.<br />
Schließlich wäre das Kommando eine<br />
Art Drehscheibe für Truppen, die in Bremerhaven<br />
oder anderswo in Mitteleuropa<br />
anlanden. Anfang Oktober fragten hochrangige<br />
US-Militärs informell bei ihren<br />
deutschen Kameraden nach, ob sich die<br />
Bundeswehr nicht für die neue Aufgabe<br />
bewerben wolle.<br />
Auch am Donnerstagnachmittag, beim<br />
ersten Telefonat nach der Bundestagswahl<br />
zwischen Verteidigungsministerin Ursula<br />
von der Leyen und ihrem amerikanischen<br />
Kollegen James Mattis, stand die neue<br />
Kommandostruktur mit auf dem Programm.<br />
Für Berlin ist die Führung des neuen Logistikkommandos<br />
reizvoll. Innerhalb des<br />
Bündnisses könnte Deutschland, das immer<br />
wieder zu einem stärkeren Engagement<br />
für die Allianz gedrängt wird, damit<br />
eine wichtige Aufgabe übernehmen.<br />
Innenpolitisch wäre das Projekt selbst<br />
in einer möglichen Jamaikakoalition mit<br />
den Grünen wohl unproblematisch, denn<br />
die Deutschen würden keine Kampftruppen<br />
stellen, sondern nur Stabssoldaten.<br />
Das ist die Aufgabe, die deutsche Verteidigungspolitiker<br />
traditionell am liebsten<br />
übernehmen.<br />
<strong>Der</strong> Brite Richard Shirreff beobachtet<br />
aufmerksam, dass die Nato endlich aktiv<br />
wird. <strong>Der</strong> Viersternegeneral war bis 2014<br />
stellvertretender Nato-Oberkommandierender<br />
in Europa und damit der höchstrangige<br />
europäische Nato-Soldat. Nach seinem<br />
Abschied sorgte er für Aufsehen, als<br />
er einen Thriller über einen fiktiven Krieg<br />
mit Russland veröffentlichte.<br />
Interessant ist das Buch nicht wegen seiner<br />
literarischen Qualität, sondern wegen<br />
der Botschaft: Nachdem die Allianz seit<br />
dem Ende des Kalten Krieges ferne Krisenzonen<br />
wie Afghanistan in den Blick genommen<br />
hat, müsse sie nun die russische<br />
Bedrohung wieder ernst nehmen. Sonst,<br />
so Shirreffs Befund, habe die Nato gegen<br />
eine Aggression etwa im Baltikum keine<br />
Chance. „Es ist höchste Zeit, dass Europa<br />
die Annexion der Krim als Weckruf begreift“,<br />
sagt Shirreff.<br />
Matthias Gebauer, Konstantin von Hammerstein,<br />
Peter Müller, Christoph Schult<br />
DER SPIEGEL<br />
im Gespräch mit<br />
Jonathan Meese: live<br />
Jonathan Meese<br />
Seine Gemälde, seine Auftritte polarisieren.<br />
Vor ein paar Jahren wurde dem Künstler Jonathan Meese –<br />
nach einem Podiumsgespräch mit dem SPIEGEL – sogar der<br />
Prozess gemacht. Das Verfahren ging ein in die Justizgeschichte,<br />
denn in dem Urteil, das den Künstler entlastete, wurde die<br />
Freiheit der Kunst noch weiter gestärkt. Großes Drama?<br />
Meese hat vieles überstanden, auch den Rauswurf aus Bayreuth,<br />
wo er auf dem Festspielhügel Richard Wagners „Parsifal“<br />
neu inszenieren sollte. Im Laufe der Zeit hat er sich weitgehend<br />
unabhängig gemacht, von Museen, Kuratoren, Galeristen.<br />
Wenn man mit ihm spricht, muss man auch darüber<br />
reden, ob die Kunstwelt der Gegenwart überhaupt<br />
noch für Künstler gemacht ist.<br />
Moderation: Susanne Beyer, stellvertretende<br />
SPIEGEL-Chefredakteurin, und Ulrike Knöfel,<br />
Redakteurin im SPIEGEL-Kulturressort<br />
Montag, 30. Oktober 2017, 20.00 Uhr<br />
<strong>Spiegel</strong>saal, Clärchens Ballhaus, Auguststraße 24, 10117 Berlin<br />
Karten im Vorverkauf, an der Abendkasse und unter www.spiegel-live.de.<br />
Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, zzgl. Gebühren. Einlass ab 19 Uhr.<br />
Änderungen vorbehalten.<br />
Jan Bauer<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
33
„Jamaika ist eine Notwendigkeit“<br />
SPIEGEL-Gespräch <strong>Der</strong> frühere Außenminister Joschka Fischer, 69,<br />
sieht eine Zusammenarbeit der Grünen mit Union und FDP als Chance und stellt<br />
die AfD in eine Linie mit dem Nationalsozialismus.<br />
HERMANN BREDEHORST / DER SPIEGEL<br />
34 DER SPIEGEL 43 / 2017
Deutschland<br />
SPIEGEL: Herr Fischer, schon im Jahr 2005<br />
war Jamaika rechnerisch möglich. Als Sie<br />
damals danach gefragt wurden, mussten<br />
Sie an Angela Merkel und Guido Westerwelle<br />
mit Dreadlocks und einem Joint in<br />
der Hand denken und lachten nur: „Wie<br />
soll das gehen, im Ernst, ich meine, bitte.“<br />
Und heute?<br />
Fischer: Es gilt der alte Bob-Dylan-Song:<br />
„The times they are a-changin’“, die Zeiten<br />
ändern sich. Wir sind ein paar Jahre weiter,<br />
und das, was ich damals – vielleicht auch<br />
nur mangels Fantasie – für unmöglich hielt,<br />
ist heute eine Notwendigkeit geworden.<br />
So kann’s gehen.<br />
SPIEGEL: Was hat sich denn so grundlegend<br />
geändert?<br />
Fischer: Spätestens seit 2015 und dem Ankommen<br />
der Flüchtlinge ist klar, dass die<br />
Zeit des sich immer mehrenden Sonnenscheins<br />
über unserem lieben Vaterland zu<br />
Ende geht. Die großen Probleme des 21.<br />
Jahrhunderts klopfen an unsere Tür. Das<br />
gilt auch für die dramatischen Veränderungen,<br />
die wir global unter anderem beim<br />
Brexit und bei der Wahl von Donald<br />
Trump sehen. Man kann die Menschen<br />
nicht gewinnen, indem man schweigt und<br />
abwartet, wie Angela Merkel es versucht<br />
hat. Die Menschen wollen – im besten Sinne<br />
des Wortes – Führung.<br />
SPIEGEL: Jamaika soll mit Führung punkten?<br />
Es wird eher auf den kleinsten gemeinsamen<br />
Nenner hinauslaufen.<br />
Fischer: Die Verantwortlichen werden in<br />
die Situation kommen, dass sie führen müssen.<br />
Schon allein, weil die Verhältnisse<br />
heute sind, wie sie sind. <strong>Der</strong> Druck der<br />
Realitäten, wie das so schön heißt, wird<br />
enorm werden. Wir haben das schon damals<br />
bei Rot-Grün erlebt: Wir waren noch<br />
nicht im Amt, da war die Frage des Kosovokriegs<br />
bereits zu beantworten. Und<br />
dann kamen noch die Anschläge vom 11.<br />
September.<br />
SPIEGEL: Welche Punkte müssen die Grünen<br />
in einer Koalition mit Union und FDP<br />
unbedingt durchsetzen?<br />
Fischer: Ich verweise auf diejenigen, die in<br />
der Verantwortung sind, die können Ihnen<br />
das sagen. Durch den Zwang zur Einigung,<br />
den ich eben beschrieben habe, werden<br />
sich alle bewegen müssen, nicht nur wir,<br />
sondern auch FDP, CDU und vor allem<br />
CSU. Die ist übrigens ein echter Faktor<br />
der Instabilität bei Jamaika. Das macht<br />
mir die größten Sorgen.<br />
SPIEGEL: Sie sehen kein inhaltliches Thema,<br />
das für die Grünen essenziell wäre?<br />
Fischer: Doch, ich nehme an, da gibt es einige.<br />
Aber das ist Sache der gewählten<br />
Gremien und der Partei. Die Zukunft der<br />
deutschen Automobilindustrie steht zum<br />
Beispiel konkret auf dem Spiel. Werden<br />
wir den Umbruch, den die Elektrifizierung<br />
mit sich bringt, gestalten oder erleiden?<br />
Wir sind das Automobilland. Wenn wir es<br />
nicht schaffen, hier technologisch an der<br />
Spitze zu bleiben, wird es bitter. Das ist<br />
eine der entscheidenden Fragen, was Arbeitsplätze,<br />
Einkommen, Wohlstand angeht,<br />
nicht nur für ein paar Reiche oder<br />
Superreiche, sondern für sehr, sehr viele<br />
Menschen.<br />
SPIEGEL: Wäre es richtig, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren<br />
mehr zuzulassen?<br />
Fischer: Über das Jahr kann und wird man<br />
streiten. Aber wir müssen etwas tun, sonst<br />
versündigen wir uns an der Zukunft unseres<br />
Landes. Die Industrie weiß das und<br />
wird deshalb handeln. Was passiert, wenn<br />
China wie angekündigt ein Datum setzt?<br />
Dann hinken wir hinterher. Es wäre doch<br />
wesentlich besser, wenn sich die deutsche<br />
Automobilindustrie und unser Land an der<br />
Spitze dieser Entwicklung bewegen würden.<br />
Und da könnte Jamaika wirklich eine<br />
Chance sein, weil die Grünen mit Union<br />
und FDP eine Lösung finden könnten, und<br />
zwar nicht gegen die Wirtschaft, sondern<br />
für die Mobilität von morgen, für die Menschen<br />
und die Umwelt.<br />
SPIEGEL: Sie klingen wie Cem Özdemir. Telefonieren<br />
Sie öfter, lässt er sich von Ihnen<br />
beraten?<br />
Fischer: Wir telefonieren dann und wann.<br />
Wenn ich so klinge, zeigt das doch, dass<br />
vernünftige Leute zu ähnlichen Schlussfolgerungen<br />
kommen, wenn sie die Fakten<br />
zur Kenntnis nehmen und drüber nachdenken.<br />
Darauf gibt es kein Copyright.<br />
SPIEGEL: Zu den Fakten gehört auch, dass<br />
die Grünen bei der jüngsten Bundes -<br />
tagswahl nur auf dem sechsten Platz gelandet<br />
sind. Laut Infratest dimap sind allein<br />
170 000 Grünenwähler zu den Linken<br />
abgewandert. Haben Sie keine Sorge, dass<br />
Jamaika die Grünen zerreißt?<br />
Fischer: Habe ich nicht. Die Partei macht<br />
einen geschlossenen Eindruck. Sollen die<br />
Grünen nicht regieren aus Sorge, dass<br />
Wähler zu anderen Parteien gehen könnten?<br />
Es ist andersherum: Die Grünen würden<br />
viele Wähler verlieren, wenn sie sich<br />
kategorisch verweigerten.<br />
SPIEGEL: So eindeutig ist das nicht. In Österreich<br />
haben sich die Grünen gespalten. <strong>Der</strong><br />
frühere Parteichef Peter Pilz hat mit einem<br />
dezidierten Linkskurs den Sprung ins Parlament<br />
geschafft. Die Realpolitiker der<br />
Grünen sind draußen. Wie wollen Sie in<br />
einer Jamaikakoalition linke Grünenwähler<br />
bei der Stange halten?<br />
Fischer: Österreich ist doch ein warnendes<br />
Beispiel. Da sitzt jetzt eine Gruppe mit etwas<br />
mehr als vier Prozent im Parlament<br />
und ist völlig machtlos. Und die Rechten<br />
regieren! Gemeinsam hätten die Grünen<br />
acht Prozent gehabt. Natürlich wird Jamaika<br />
für die Partei eine große Herausforderung.<br />
Aber man kann sich die Herausforderungen<br />
nicht aussuchen. Nach Lage der<br />
Dinge will aktuell keine Partei Jamaika,<br />
aber alle müssen, weil das Volk so gewählt<br />
hat. Außer einer Minderheitsregierung<br />
oder Neuwahlen gibt es keine Alternative.<br />
SPIEGEL: Die schließen Sie aus?<br />
Fischer: Wer will denn die Verantwortung<br />
für Neuwahlen übernehmen? Die würden<br />
mit einem noch besseren AfD-Ergebnis<br />
und womöglich wieder unklaren Mehrheiten<br />
enden.<br />
SPIEGEL: Welche Ministerien sollten die<br />
Grünen in einer Jamaikakoalition beanspruchen?<br />
Fischer: Das entscheide nicht ich. Dazu nur<br />
eine Bemerkung aus eigener Erfahrung: Es<br />
geht natürlich immer um die Sache, gerade<br />
bei den Grünen. Es gibt aber neben der<br />
Sachfrage ein weiteres wichtiges Element,<br />
das ist die Machtfrage. Die darf man nicht<br />
unterschätzen, auch im Interesse der Stabilität<br />
einer möglichen Koalition.<br />
SPIEGEL: Was hat das mit der Ressortverteilung<br />
zu tun?<br />
Fischer: Wenn die beiden anderen Koalitionspartner<br />
über mächtige Ressorts verfügen,<br />
wäre es keine gute Idee, wenn die<br />
Grünen nicht ebenfalls ein wichtiges klassisches<br />
Ressort übernähmen. Sonst haben<br />
sie es mit dem Kanzleramt zu tun, dem Finanzministerium<br />
und dem Innenministerium.<br />
Alles große, klassische Ressorts, die<br />
im Zentrum der Regierungsmacht zu Hause<br />
sind. Das gilt es zu bedenken.<br />
SPIEGEL: War das gerade vom ehemaligen<br />
Außenminister das Plädoyer dafür, dass<br />
die Grünen das Außenministerium beanspruchen<br />
sollten?<br />
Fischer: Ich sage nur, dass die Grünen bedenken<br />
sollten, dass sie auch in der Machtfrage<br />
präsent sein müssen.<br />
SPIEGEL: Halten Sie das Außenministerium<br />
nach wie vor für ein mächtiges Ressort?<br />
Fischer: Eindeutig ja. Das Außenministerium<br />
ist nach wie vor sehr wichtig.<br />
SPIEGEL: Als einer der Gründe für den<br />
Aufstieg der AfD gilt die mangelnde Unterscheidbarkeit<br />
der Parteien. Wird das<br />
Problem nicht noch verschärft, wenn in<br />
Zukunft Union, Grüne und FDP in einer<br />
Regierung sind?<br />
Fischer: Keine Sorge, die Parteien werden<br />
sehr unterscheidbar bleiben. Selbst unter<br />
Rot-Grün etwa gab es bestimmt kein Unterscheidbarkeitsdefizit.<br />
Damals wurde<br />
doch immer gesagt: Mein Gott, sind die<br />
chaotisch. In der Großen Koalition war es<br />
den Journalisten dann auf einmal zu ruhig.<br />
SPIEGEL: Mit der AfD sitzt jetzt eine rechtspopulistische<br />
Partei im Bundestag. Ist das<br />
eine politische Zeitenwende?<br />
Fischer: Wieso rechtspopulistisch? Wie nennen<br />
wir in Deutschland eine Partei, die<br />
sich völkisch definiert? Die Tradition ist<br />
eindeutig. Die Letzten, die eine solche Position<br />
vertreten haben, waren die Nazis.<br />
SPIEGEL: Sie halten die AfD für eine Partei<br />
in der Tradition der NSDAP?<br />
Fischer: Oh ja! Ich bin ja in den Fünfzigerjahren<br />
aufgewachsen. Alle in meiner Ge-<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
35
DIE NEUE SERIE AUF YOUTUBE<br />
BUNDESWEHR EXCLUSIVE<br />
HAUTNAH IN DEINEM MESSENGER<br />
IHRE<br />
MISSION<br />
MACHT AUCH DEIN<br />
SICHERER.<br />
LEBEN
neration kennen noch diese deutschen Familientreffen.<br />
Da gab es den Nazi-Opa und<br />
den Onkel, der bei der SS war, und die<br />
sonderten dann ihre Sprüche ab. Und solche<br />
Sprüche kommen plötzlich wieder.<br />
Warum sollte man das als Rechtspopulismus<br />
bezeichnen? Ist Herr Höcke ein<br />
Rechtspopulist oder ein Nazi? Mir geht dieses<br />
Drumrumgerede auf den Keks.<br />
SPIEGEL: Herr Höcke steht auch in der AfD<br />
am rechten Rand.<br />
Fischer: Da sind viele in der aktiven Mitgliedschaft<br />
und Führung der AfD, die reden<br />
wie Nazis und die denken wie Nazis.<br />
Gauland will sich „unser Land“ und „unser<br />
Volk zurückholen“. Ja hallo, kennen wir<br />
das nicht? Ich hatte gehofft und gedacht,<br />
wir wären gesellschaftlich weiter. Aber<br />
man muss zur Kenntnis nehmen: Sie sind<br />
wieder da.<br />
SPIEGEL: Sind dann auch die 12,6 Prozent<br />
der Wähler, die AfD gewählt haben, Nazis?<br />
Fischer: Da muss man unterscheiden. Aber<br />
wir sollten nicht vergessen, nach 1945 hieß<br />
es: Wir wurden verführt, die Nazibonzen<br />
waren schuld an allem, was Deutschland<br />
anderen und sich selbst angetan hat. Wenn<br />
ich heute Herrn Gauland höre oder Herrn<br />
Höcke, dann habe ich immer das Bild des<br />
zerstörten Köln vor Augen, aus dem der<br />
Dom herausragt. Man kann heute nicht<br />
einfach sagen: Ich wusste das nicht, ich<br />
war frustriert. Wir wissen doch, wie dieser<br />
Film endet.<br />
SPIEGEL: Die Sprüche, die Sie von Ihren Familientreffen<br />
kennen: Sind die auf einmal<br />
wieder da, oder waren sie immer da und<br />
man hat sie nicht hören wollen?<br />
Fischer: Ich kann Ihnen diese Frage nicht<br />
beantworten. Es gibt Überzeugungen, die<br />
sich nicht erklären lassen. Was da so alles<br />
von sich gegeben wird, etwa dass Deutschland<br />
ein besetztes Land sei. Das ist doch<br />
hanebüchen. Mich hat das überrascht. Ich<br />
hatte ehrlich gedacht, wir seien weiter.<br />
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich, dass wir<br />
nicht so weit sind, wie man dachte?<br />
Fischer: Man kann lange nach Erklärungen<br />
suchen. Ich habe noch keine überzeugende<br />
gehört oder gelesen. Jetzt ist es halt so.<br />
Darauf muss man reagieren.<br />
SPIEGEL: Wie denn?<br />
Fischer: Man muss die Auseinandersetzung<br />
an jedem einzelnen Punkt hart und unnachgiebig<br />
führen und Deutschland nicht<br />
diesen Gestalten überlassen oder denen<br />
gar hinterherrennen. Auf der anderen Seite<br />
darf man sich aber auch nicht durch jede<br />
Provokation gleich auf die Zinne treiben<br />
lassen. Das ist ja oft beabsichtigt. Da empfehle<br />
ich aus der Erfahrung im Umgang<br />
mit den Nazi-Opas, die ja offensichtlich<br />
wieder da sind, eine gewisse Grundgelassenheit.<br />
* Mit den Redakteuren Ann-Katrin Müller und Ralf Neukirch<br />
in seinem Berliner Büro.<br />
Deutschland<br />
SPIEGEL: Gelassenheit und Korrektheit werden<br />
im Umgang mit der AfD nicht reichen.<br />
Fischer: Es ist ja nicht nur diese Partei. Es<br />
gibt Pegida, die Identitären und viele andere<br />
Strömungen. Wir erleben den Versuch<br />
von rechts, die Achtundsechziger zu kopieren<br />
und die Diskurshoheit zu erreichen.<br />
SPIEGEL: Wo sehen Sie die Parallele zur Studentenbewegung<br />
von damals?<br />
Fischer: In gewissen Aktionsformen, dem<br />
Mittel der Provokation, den Veröffentlichungen<br />
kleiner Verlage mit provokanten<br />
Titeln, dem Nutzen von Buchmessen als<br />
Forum, diese Dinge meine ich.<br />
SPIEGEL: Hat Frau Merkel die AfD ermöglicht,<br />
indem sie die CDU zu weit nach links<br />
gerückt und damit den Platz am rechten<br />
Rand frei gemacht hat?<br />
Fischer: Nein, nein, nein. Ich will jetzt nicht<br />
Angela Merkel verteidigen, aber wo wären<br />
denn die Wahlergebnisse der Union in den<br />
Städten, wenn sie die rechte Flanke geschlossen<br />
hätte? Da hätte sie eine Reihe<br />
von schweren Niederlagen zu verantworten<br />
gehabt.<br />
Fischer beim SPIEGEL-Gespräch*<br />
„Ich hatte gedacht, wir seien weiter“<br />
SPIEGEL: Die CSU ist da anderer Meinung.<br />
Fischer: Ich habe zuletzt Edmund Stoiber<br />
im Fernsehen gesehen. <strong>Der</strong> ist ganz besessen<br />
von der Idee eines Rechtsrucks. Falsch<br />
ist es trotzdem. Man muss wissen: Für die<br />
CSU ist die absolute Mehrheit in Bayern<br />
wichtig, für den Rest der Republik eher<br />
nicht.<br />
SPIEGEL: Unter den Konservativen in der<br />
Union gilt der österreichische Außenminister<br />
Sebastian Kurz als neuer Held. Dessen<br />
ÖVP hat mit einem dezidiert rechten<br />
Kurs die FPÖ bei der Nationalratswahl<br />
noch überflügelt.<br />
Fischer: Ich halte es lieber mit Macron und<br />
Frankreich als mit Kurz, Strache und Österreich.<br />
Wenn Kurz keine Große Koalition<br />
will, dann kann er nur mithilfe einer rechtsradikalen<br />
Partei Kanzler werden. Das sollten<br />
all diejenigen bedenken, die jetzt Jamaika<br />
schlechtreden und der Union einen<br />
Schwenk nach rechts empfehlen. Wenn die<br />
CSU das will, dann stellt sie das historische<br />
Fundament der Unionsparteien und das<br />
Erbe Konrad Adenauers infrage. Das sollte<br />
sie sich gut überlegen.<br />
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen<br />
für dieses Gespräch.<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
37<br />
HERMANN BREDEHORST / DER SPIEGEL<br />
Investitionen<br />
sicher entscheiden?<br />
Da brauche ich aktuelle<br />
Geschäftszahlen.<br />
Mit den digitalen DATEV-Lösungen haben Sie jederzeit<br />
den Überblick über Ihre aktuellen Geschäftszahlen.<br />
Und sind direkt mit Ihrem Steuerberater verbunden. So<br />
können Sie anstehende Investitionen sicher entscheiden.<br />
Informieren Sie sich im Internet oder bei<br />
Ihrem Steuerberater.<br />
Digital-schafft-Perspektive.de
C.HARDT / SNAPSHOT / FUTURE IMAGE<br />
Braunkohlekraftwerk Niederaußem<br />
Rat vom Schattenmann<br />
Umwelt Kommt die geplante Jamaikakoalition zustande, muss sie Deutschlands Vorreiterrolle<br />
in der Klimapolitik sichern. Ein grüner Staatssekretär weiß, wie das funktionieren kann.<br />
Die Einladung klang nach Routine.<br />
Am Montag rief Rainer Baake eine<br />
Runde von Journalisten zum Gespräch<br />
ins Bundeswirtschaftsministerium.<br />
Wie jedes Jahr wollte der Staatssekretär<br />
für Energie eine Zahl verkünden, die sogenannte<br />
EEG-Umlage. Sie beziffert, wie<br />
viel Aufschlag die deutschen Strom -<br />
kunden für Wind- und Solarkraft zahlen<br />
müssen.<br />
„Die Entwicklung ist überaus erfreulich“,<br />
verkündete der Spitzenbeamte stolz,<br />
die Umlage sei leicht gesunken. Insgesamt,<br />
so Baake, würden die Strompreise damit<br />
„deutlich weniger steigen als die Infla -<br />
tionsrate“. Zudem sei der Anteil erneuerbarer<br />
Energien in den vergangenen vier<br />
Jahren von 25 auf 35 Prozent<br />
gestiegen, und das ohne nennenswerte<br />
Preiserhöhungen.<br />
„Möglich ist das nur durch die<br />
Reformen dieser Bundesregierung<br />
geworden.“<br />
Was Baake mit seinem Fazit<br />
eigentlich sagen wollte: Es sind<br />
seine Reformen gewesen, die<br />
dazu geführt haben, die Kostenexplosion<br />
der Energiewende einzudämmen<br />
– und so hatte der<br />
Staatssekretär zum Abschluss<br />
Experte Baake<br />
Bestens vernetzt<br />
AXEL SCHMIDT / DDP IMAGES<br />
des Gesprächs noch einen Ratschlag parat:<br />
„Die neue Bundesregierung muss genauso<br />
reformfreudig bleiben, wie es diese Re -<br />
gierung ist.“<br />
Da war er also, der Satz, mit dem sich<br />
Baake als Staatssekretär für die nächste<br />
Amtszeit beworben hatte, geschickt verpackt,<br />
aber unmissverständlich. Wenn es<br />
nach ihm ginge, gäbe es keinen besseren<br />
Kandidaten als ihn selbst, den Umbau des<br />
Energiesektors fortzuführen. Wer den grünen<br />
Spitzenbeamten in diesen Tagen trifft,<br />
spürt hinter der nüchternen Fassade des<br />
drahtigen Mannes, wie sehr er unter Anspannung<br />
steht.<br />
Während die Sondierungsgespräche zwischen<br />
Union, Grünen und FDP Fahrt aufnehmen,<br />
setzt Baake auf sein<br />
jahrzehntelanges Fachwissen.<br />
<strong>Der</strong> gelernte Volkswirt hat seit<br />
Jahren die deutsche Energiepolitik<br />
aus der zweiten Reihe gelenkt<br />
und wurde zum Schrecken<br />
der Energiekonzerne.<br />
Nun hat ihm der Wahlausgang<br />
eine neue Machtoption geschaffen.<br />
Die Grünen wollen ein<br />
Jamaikabündnis in etwa so sehr,<br />
wie Angela Merkel Bundeskanzlerin<br />
bleiben will. Genau<br />
das ist Baakes große Chance, weitere vier<br />
Jahre an den Hebeln der Macht zu ziehen,<br />
geräuschlos, aber hocheffizient.<br />
Was Baake in die Hände spielt: Kaum<br />
ein Thema wird die Legislaturperiode so<br />
bestimmen wie die Klimapolitik. Es geht<br />
nicht mehr allein um Wind- und Sonnenenergie<br />
oder die Frage, wie die Stromnetze<br />
ausgebaut werden sollen. Die Politik muss<br />
entscheiden, wie sich die Deutschen künftig<br />
fortbewegen und wie sie ihre Wohnungen<br />
heizen. Es sind harte Eingriffe erforderlich.<br />
Denn das Land muss rausgeführt<br />
werden aus dem fossilen Zeitalter.<br />
Dekarbonisierung heißt dafür der Fachbegriff,<br />
und der klingt nicht zufällig nach<br />
Epochenwende. Die Zeit großer Klimaziele,<br />
die erst in ferner Zukunft erfüllt werden<br />
müssen, ist vorbei. „Es gibt keine Ausflüchte<br />
mehr“, sagt Baake, „wenn Deutschland<br />
sich vor der Weltgemeinschaft nicht blamieren<br />
will.“<br />
Schon Ende 2020 muss die vermutlich<br />
schwarz-gelb-grüne Koalition beweisen, ob<br />
sie das Ziel von 40 Prozent weniger Treibhausgasausstoß<br />
im Vergleich zum Jahr<br />
1990 einhalten kann. Nach allem, was die<br />
Experten vorhersagen, werde das nicht der<br />
Fall sein, warnt Baake. Er weiß, dass dieser<br />
Moment, insbesondere für einen künftigen<br />
38 DER SPIEGEL 43 / 2017
Deutschland<br />
grünen Umwelt- und Energieminister, wie<br />
ein Offenbarungseid sein wird. Für Baake<br />
ist das ein Ansporn.<br />
Bei den Grünen wissen sie um die Ambitionen<br />
ihres Staatssekretärs und um sein<br />
Talent. 1983 trat er der Partei noch während<br />
des Studiums in Marburg bei. Als Umweltdezernent<br />
kämpfte er für eine Müllverbrennungsanlage<br />
– nicht gerade ein<br />
prestigeträchtiges Ziel für einen Grünen.<br />
Damals erkannte allerdings ein Parteifreund,<br />
mit welchem Geschick Baake die<br />
Mechanik einer deutschen Verwaltung für<br />
seine Zwecke bedienen konnte. Es war der<br />
Turnschuhminister Joschka Fischer, der ihn<br />
an seine Seite holte als Umweltstaatssekretär<br />
des Landes Hessen.<br />
Dort brachte Baake der mächtigen deutschen<br />
Stromindustrie ihre erste Niederlage<br />
bei, als er die Hanauer Nuklearbetriebe<br />
schloss. Unter dem grünen Bundesumweltminister<br />
Jürgen Trittin verhandelte Baake<br />
den Atomausstieg. Mit der Förderung der<br />
erneuerbaren Energien, die er in dieser<br />
Zeit auf den Weg brachte, zwang er die<br />
arroganten Strombosse, ihr Geschäftsmodell<br />
zu ändern.<br />
Die schwarz-gelbe Koalition ab 2009 verzichtete<br />
auf seine Dienste, hielt aber im<br />
Grundsatz an seinen Reformen fest. Danach<br />
durfte er auch persönlich wieder ran.<br />
Zur allgemeinen Überraschung, auch seiner<br />
eigenen, machte ihn der Sozialdemokrat<br />
Sigmar Gabriel zu seinem Energiestaatssekretär<br />
im Wirtschaftsministerium.<br />
Und jetzt? Will der Mann sein Lebenswerk<br />
erfüllen, den Kampf gegen die klimaschädliche<br />
Energie aus Kohle, Öl und<br />
Gas. Baake sagt: „Die nächsten vier Jahre<br />
werden die entscheidenden für die Energiewende<br />
sein.“ Das ist sein Mantra – und<br />
zugleich seine Empfehlung, wieder eine<br />
einflussreiche Position in der nächsten Regierung<br />
zu übernehmen.<br />
Denn kaum einer kennt sich im Geflecht<br />
der Energiegesetze so gut aus wie er. Kein<br />
Politiker der FDP, der in den Jahren ihrer<br />
außerparlamentarischen Opposition das<br />
Thema kaum bearbeitet hat. Und auch<br />
kaum ein Christdemokrat, seit Fraktionsvize<br />
Michael Fuchs, der wohl hartnäckigste<br />
Gegner Baakes, aus dem Parlament ausgeschieden<br />
ist. Da ist höchstens die Kanzlerin,<br />
die eine Menge von Klimapolitik versteht.<br />
Sie weiß, dass die nächste Regierung<br />
vor allem eine Aufgabe hat: den Ausstieg<br />
aus der Verstromung von Braun- und Steinkohle<br />
zu organisieren. Die mehr als hundert<br />
Kraftwerke verhageln dem Land die<br />
Klimabilanz, obwohl es Pionier beim Übergang<br />
ins Zeitalter erneuerbarer Energien<br />
ist. Diese Altlast gilt es zu entsorgen.<br />
In den vergangenen Monaten haben sich<br />
dutzendweise Fachleute dazu gemeldet,<br />
wie der Übergang zu bewerkstelligen sei,<br />
mit einer CO ²<br />
-Steuer oder einem Mindestpreis<br />
im Handel mit CO ²<br />
-Zertifikaten.<br />
Doch das werde nicht funktionieren, sagen<br />
sie in Baakes Abteilungen und Referaten.<br />
Denn das System, mit dem die Brüsseler<br />
EU-Kommission den Ausstoß von Treibhausgasen<br />
möglichst unrentabel machen<br />
will, wird gerade auf europäischer Ebene<br />
reformiert, da käme die neue Regierung<br />
mit ihren Vorschlägen zu spät.<br />
Eine staatliche Abgabe könnte das Problem<br />
ebenfalls nicht lösen, wie die Debatte<br />
um die vor einigen Jahren verhängte Steuer<br />
auf Brennelemente gezeigt hat: Das Verfassungsgericht<br />
hat sie gekippt, weil der<br />
Bund nicht willkürlich Produktionsmittel<br />
mit Steuern belegen darf. Zugleich haben<br />
die Karlsruher Richter dabei einen Weg<br />
gewiesen, wie mit Kohlekraftwerken zu<br />
verfahren wäre. Man müsste ihren Betrieb<br />
1251<br />
Treibhausgasemissionen<br />
in Deutschland, in Millionen<br />
Tonnen CO ²<br />
-Equivalente<br />
906<br />
Prognose<br />
1990 95 2000 05 10 16 2020<br />
Emissionen 2016<br />
Verkehr<br />
Energiewirtschaft<br />
Industrie<br />
Landwirtschaft<br />
Sonstige<br />
750<br />
Klimaschutzziel<br />
2020, entspricht<br />
–40 % gegenüber<br />
1990<br />
Quellen: UBA,<br />
Agora Energiewende<br />
343<br />
188<br />
166<br />
Veränderung<br />
gegenüber 1990<br />
in Prozent<br />
per Gesetz verbieten und das mit einem<br />
Verweis auf das Gemeinwohl begründen.<br />
Bei den Atomreaktoren war es das Risiko<br />
eines Super-GAUs, das den Stopp ermöglicht<br />
hat. Bei den Kohlekraftwerken wäre<br />
es die globale Klimaerwärmung mit all ihren<br />
katastrophalen Folgen, mit der sich das Abschalten<br />
rechtfertigen ließe. Zunächst könnten<br />
jene Meiler geschlossen werden, die bereits<br />
am längsten laufen oder den geringsten<br />
Wirkungsgrad aufweisen. Später könnte es<br />
auch jüngere und rentablere Anlagen treffen.<br />
Insgesamt müssten rund 18 Gigawatt<br />
fossile Erzeugungskapazität raus aus dem<br />
Markt, so schätzen Experten, wenn Angela<br />
Merkel Klimakanzlerin bleiben will. Das<br />
muss Baake ihr nicht erklären, das weiß<br />
71<br />
11<br />
–27<br />
–34<br />
+2<br />
Gebäude 127 –40<br />
–21<br />
–72<br />
sie selbst am besten. Aber auch für den<br />
Seelenfrieden der Jamaikakoalitionäre<br />
wäre es eine Perspektive, könnten sie sich<br />
hinter den Verfassungsrichtern verstecken.<br />
Baake hat es nicht nötig, diese Gedanken<br />
öffentlich zu äußern. Das wird der<br />
Thinktank „Agora Energiewende“ für ihn<br />
tun. Das Institut hat er mitgegründet, als<br />
er unter Schwarz-Gelb pausieren musste.<br />
Noch heute stehen ihm die Experten als<br />
schnelle Eingreiftruppe zur Verfügung.<br />
Jetzt, passend zu den Sondierungsgesprächen,<br />
wird Agora ein Rechtsgutachten<br />
veröffentlichen, wonach „ein Gesetz zum<br />
Kohleausstieg analog zum Atomausstiegsgesetz<br />
verfassungskonform darstellbar“ sei,<br />
so lautet der Schlüsselsatz. Die Kraftwerke<br />
müssten rund 25 Jahre alt sein, damit sie<br />
wirtschaftlich abgeschrieben und ohne<br />
Kompensation für die Konzerne geschlossen<br />
werden könnten. Die Agora-Studie ist<br />
übersichtlich gegliedert, mit vier knackig<br />
formulierten Kernthesen, die auch ein von<br />
Koalitionsverhandlungen gestresster Politiker<br />
verstehen kann.<br />
So ist es ebenfalls bei einer weiteren<br />
Studie, die als Blaupause für einen möglichen<br />
Jamaikavertrag gedacht sein könnte.<br />
Darin geht es um den Strukturwandel für<br />
die Lausitz, jene Region im Osten der Republik,<br />
die von der Schließung von Braunkohletagebauen<br />
und Kraftwerken am<br />
stärksten betroffen wäre.<br />
Agora rollt darin den Plan für einen<br />
„Strukturwandelfonds Lausitz“ aus, der<br />
mit 100 Millionen Euro jährlich die gebeutelte<br />
Region in einen „Wissenschaftsstandort“<br />
verwandeln soll, inklusive eines<br />
Fraunhofer-Zentrums für die Dekarbonisierung<br />
der Industrie und einer neuen<br />
Bahntrasse von Cottbus nach Berlin.<br />
Das Konzept trägt die Handschrift Baakes,<br />
der ein Gespür dafür hat, mit welchen<br />
Angeboten er unterschiedlichste Akteure<br />
für sein Vorhaben ködern kann. Er ist bei<br />
den Sondierungsgesprächen zwar nicht dabei,<br />
doch sei er mit seinen Ideen, die er<br />
„als Privatmann“ einspeist, „stets präsent“,<br />
wie es ein Spitzengrüner formuliert.<br />
Baake ist damit so etwas wie der Schattenmann<br />
der Koalitionsverhandlungen, ein<br />
mächtiger Einflüsterer, ganz gleich, ob es<br />
nun um Elektroautos oder Wärmepumpen<br />
geht. Aber auch beim Zuschnitt der künftigen<br />
Ministerien dürfte sein Ratschlag<br />
nicht ohne Folgen bleiben. Das Energieressort<br />
wollen die Grünen wieder in das<br />
Umweltministerium eingliedern, schon allein,<br />
damit es ganz gewiss unter die Kontrolle<br />
eines Grünen fällt.<br />
<strong>Der</strong>zeit kämpft offenbar Katrin Göring-<br />
Eckardt, die ehemalige Spitzenkandidatin,<br />
um diesen Posten, den die meisten Parteistrategen<br />
eigentlich bei dem Parteilinken<br />
Anton Hofreiter gesehen haben. Baakes<br />
Vorteil: Er ist mit beiden vertraut.<br />
Gerald Traufetter<br />
40 DER SPIEGEL 43 / 2017
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de<br />
AUCH FÜR MÄNNER<br />
ZÄHLEN INNERE WERTE:<br />
<strong>Der</strong> Amarok. Das Auto, das Männer versteht.<br />
Einziger seiner Klasse mit 8-Gang-Automatikgetriebe<br />
und permanentem Allradantrieb 4MOTION.<br />
Männer wissen, was sie wirklich wollen. Darum haben wir in den Amarok einen V6-Motor<br />
mit 550 Nm eingebaut und gleich die passende Ausstattung dazu. Zum Beispiel verfügt der<br />
Amarok über Offroad-ABS, ein 8-Gang-Automatikgetriebe und permanenten Allradantrieb<br />
4MOTION. Vereinbaren Sie jetzt eine Probefahrt bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.<br />
Mehr zum Amarok unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/amarok<br />
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.
Neues Deutschland<br />
Union Angela Merkel und das Ende des Parteiensystems, wie wir es kennen.<br />
Von René Pfister<br />
Kanzlerin Merkel: Für die Mülltrennung, gegen Atomkraft<br />
LIAN MATZKE / AFP<br />
Anfang September verschickte der<br />
Bayerische Rundfunk einen kurzen<br />
Zusammenschnitt aus Talkrunden<br />
der Siebziger- und Achtzigerjahre. <strong>Der</strong> nur<br />
zweiminütige Film verbreitete sich rasend<br />
schnell im Netz, was nicht nur am wütenden<br />
Manager der Band Ton Steine Scherben<br />
lag, der den Tisch der WDR-Show<br />
„Ende offen“ mit einem Beil traktierte.<br />
Sondern vor allem an Helmut Kohl und<br />
Willy Brandt, die sich in einer TV-Runde<br />
mit rotem Kopf anschrien. <strong>Der</strong> Reiz des<br />
Videos liegt darin, dass es nah wirkt und<br />
gleichzeitig so unglaublich fern. Jedem<br />
sind noch die Gesichter von Kohl und<br />
Brandt präsent, und doch ist es in der Ära<br />
42 DER SPIEGEL 43/ 2017<br />
Merkel unvorstellbar geworden, dass sich<br />
zwei Spitzenpolitiker im Fernsehen aufführen<br />
wie Zecher vor einer Wirtshausschlägerei.<br />
Angela Merkel hat in ihrer zwölfjährigen<br />
Amtszeit das Land auf vielerlei Art<br />
und Weise verändert, sie hat unter anderem<br />
dafür gesorgt, dass das rohe und unverstellte<br />
Gefühl aus der Politik verschwand.<br />
Merkel hat es schon immer verstanden,<br />
ihre Emotionen zu zügeln. Wenn<br />
es überhaupt je einen Ausbruch gab, dann<br />
im Frühjahr 1995, als ihr in einer Kabinettssitzung<br />
die Tränen kamen, weil Helmut<br />
Kohl sie mit ihrer Smogverordnung abtropfen<br />
ließ. Merkel machte danach nie wieder<br />
den Fehler, sich eine solche Blöße zu geben.<br />
Sie weinte nicht, sie brüllte nicht, sie<br />
ließ sich nicht einmal provozieren. Als sie<br />
im September 2005 die Bundestagswahl<br />
gewann und Gerhard Schröder in der Elefantenrunde<br />
tobte, wirkte der schon merkwürdig<br />
aus der Zeit gefallen.<br />
Man kann die Ära Merkel auch als Geschichte<br />
der Pazifizierung lesen, nie zuvor<br />
ging es in der deutschen Politik gesitteter<br />
zu. Selbst die Opposition begegnete Merkel<br />
mit einem Respekt, der manchmal an<br />
Bewunderung grenzte; wenn es um die<br />
großen Themen ging, den Euro oder die<br />
Flüchtlinge, gab es im Bundestag ein großes<br />
Einvernehmen, es wurde debattiert,
Deutschland<br />
Wenn es Merkels<br />
Ziel war, die Politik zu<br />
mäßigen, dann ist es<br />
gründlich misslungen.<br />
aber nie gehasst. Umso schärfer war der<br />
Kontrast, als dann am 24. September die<br />
AfD den Sprung in den Bundestag schaffte<br />
und Alexander Gauland noch am Wahlabend<br />
versprach, seine Partei werde von<br />
nun an die Kanzlerin „jagen“.<br />
<strong>Der</strong> Aufstieg der AfD hat viele Gründe,<br />
aber einer war sicher auch, dass Merkel<br />
ihre Politik an den Empfehlungen der Meinungsforscher<br />
ausgerichtet hat. Wenn man<br />
heute, mit einigem Abstand, noch einmal<br />
die Analysen von Matthias Jung zur Hand<br />
nimmt, dem Demoskopen des Vertrauens<br />
der CDU, dann lesen sie sich wie Blaupausen<br />
für Merkels Politik. Folgt man Jungs<br />
Empfehlungen, dann blieb der CDU gar<br />
keine andere Wahl, als sich nach links zu<br />
orientieren. Denn einerseits verlieren die<br />
klassischen CDU-Milieus immer mehr an<br />
Bedeutung, und andererseits sterben der<br />
Union alle vier Jahre rund eine Million<br />
ältere Wähler weg.<br />
Als im Zuge der Eurokrise die AfD ihre<br />
erste Blüte erlebte, erkannte Jung in der<br />
neuen Partei nicht etwa eine Gefahr für<br />
die Union, sondern eine Art Glücksfall.<br />
„Die CDU/CSU ist durch die bloße Existenz<br />
der AfD vom latenten Vorwurf<br />
befreit, rechts zu sein, was anders als in<br />
den meisten europäischen Ländern in<br />
Deutschland einen stigmatisierenden Charakter<br />
hat“, schrieb Jung in einem Aufsatz,<br />
der im Jahr 2015 erschien und die<br />
Überschrift „Die AfD als Chance für die<br />
Union“ trug.<br />
Jung drehte den Satz von Franz Josef<br />
Strauß, wonach es rechts von der Union<br />
keine demokratisch legitimierte Partei geben<br />
darf, einfach um: Gerade weil es nun<br />
eine Partei rechts von der Union gibt, kann<br />
die CDU umso glaubwürdiger den Verdacht<br />
zerstreuen, sie sei eine rechte Partei.<br />
Dass der Aufsatz Jungs ausgerechnet in<br />
der Zeitschrift „Politische Studien“ erschien,<br />
der Hauspublikation der CSU-nahen<br />
Hanns-Seidel-Stiftung, gibt der Sache<br />
eine besondere Würze.<br />
Nun kann man keinem Politiker ernsthaft<br />
vorwerfen, dass er versucht, so viele<br />
Wähler wie möglich zu erreichen, und<br />
Merkels Strategie war über lange Jahre<br />
sehr erfolgreich. Wenn sie es schafft, eine<br />
Jamaikakoalition zu zimmern, könnte sie<br />
16 Jahre lang regieren, vor ihr gelang das<br />
nur Helmut Kohl; in ihrer Amtszeit<br />
schrumpfte die SPD auf zuletzt 20,5 Prozent.<br />
Merkel ist dabei, die Parteienlandschaft<br />
Deutschlands zu revolutionieren. Sie<br />
denkt dabei viel radikaler, als es viele in<br />
der CDU glauben. Im Moment wird in der<br />
Partei darüber gestritten, ob die Kanzlerin<br />
die richtige Strategie im Umgang mit der<br />
AfD verfolgt. Das aber setzt voraus, dass<br />
es überhaupt eine Strategie gibt. Am<br />
Wahlabend sagte Merkel, die „strategischen<br />
Wahlziele“ seien erreicht: Die Union<br />
sei die stärkste Kraft, an ihr vorbei könne<br />
keine Regierung gebildet werden. Im<br />
Umkehrschluss heißt das: Den Einzug der<br />
AfD in den Bundestag zu verhindern gehörte<br />
gar nicht zum Ziel des Adenauer-<br />
Hauses.<br />
Wenn man mit dem kalten Blick des<br />
Parteistrategen die Lage betrachtet, dann<br />
bringt der Einzug der AfD durchaus Vorteile<br />
für die CDU: Im letzten Bundestag<br />
hätten SPD, Grüne und Linke Merkel abwählen<br />
können. Am 24. September aber<br />
verloren SPD und Linkspartei zusammen<br />
900 000 Stimmen an die AfD. Die linke<br />
Mehrheit im Parlament verschwand. So<br />
gesehen zementiert die AfD Merkels<br />
Macht.<br />
Manche in der CDU argumentieren,<br />
dass Deutschland, was den Rechtspopu -<br />
lismus angehe, lediglich eine verspätete<br />
Nation sei. In fast jedem Nachbarland gibt<br />
es inzwischen eine Partei, die von einer<br />
Melange aus Abstiegsängsten und Fremdenfeindlichkeit<br />
profitiert. Das ist richtig.<br />
Aber in Deutschland war das Tabu gegen<br />
rechts aus historischen Gründen immer besonders<br />
stark. Erst die Flüchtlingskrise öffnete<br />
der AfD den Weg in den Bundestag.<br />
Es wäre unfair zu sagen, dass Merkels<br />
Flüchtlingspolitik parteitaktischen Motiven<br />
gefolgt sei. Aber sie komplettierte das Bild<br />
einer CDU, die sich um das rechte Spektrum<br />
nicht mehr kümmert, das Bild einer<br />
Partei, die sich von sich selbst entfernt.<br />
Merkel hat die CDU inzwischen so entkernt,<br />
dass die Konsequenzen weit über<br />
die Partei hinausreichen. Es war ja nicht<br />
nur die SPD, die in den vergangenen zwölf<br />
Jahren dramatisch schrumpfte. Bei der<br />
Bundestagswahl stieg die AfD in manchen<br />
Gegenden Ostdeutschlands zur neuen<br />
Volkspartei auf, in Sachsen überholte sie<br />
sogar die CDU, weshalb Ministerpräsident<br />
Stanislaw Tillich in dieser Woche seinen<br />
Rücktritt erklärte. In Bayern wird die CSU<br />
ihre Sonderstellung verlieren, wenn die<br />
AfD dauerhaft stark bleibt. Ohne die absolute<br />
Mehrheit ist sie nur noch eine „CDU<br />
in Lederhose“, wie der ehemalige Bundesinnenminister<br />
Hans-Peter Friedrich sehr<br />
anschaulich sagte.<br />
Die Stabilität der Bundesrepublik beruhte<br />
immer auf der Stärke der beiden<br />
Volksparteien. Die Polarität zwischen<br />
SPD und Union sorgte dafür, dass weite<br />
Teile der Wähler eine politische Heimat<br />
fanden. Merkels Ansatz ist es, diese Polarität<br />
aufzuheben, sie will eine große politische<br />
Partei der Mitte schaffen, die umspült<br />
wird von den Radikalen von links<br />
und rechts. Das hat allerdings seinen<br />
Preis.<br />
Das große Verdienst der Volksparteien<br />
war immer, dass sie den Rahmen für einen<br />
zivilen Diskurs schufen. Es war über Jahrzehnte<br />
ihr Anspruch, auch jene Wähler zu<br />
halten, die mit dem Radikalen flirten, ihm<br />
aber nicht verfallen. Das bröckelte zuerst<br />
auf der linken Seite des politischen Spektrums,<br />
als Gerhard Schröder die Agenda<br />
2010 umsetzte und sich dabei kaum die<br />
Mühe machte, seinen Wählern die Reformen<br />
zu erklären. Die Folge war der Aufstieg<br />
der Linkspartei. Nun gibt es mit der<br />
AfD ein rechtes Pendant.<br />
Die CDU ist unter Merkel zu einer Partei<br />
geworden, gegen die kein aufgeklärter<br />
Mensch etwas sagen kann: Sie ist für die<br />
Mülltrennung und gegen Atomkraftwerke,<br />
sie weist keinen Asylbewerber an der<br />
Grenze ab und hat ermöglicht, dass auch<br />
Schwule und Lesben heiraten dürfen. Generalsekretär<br />
Peter Tauber könnte mit seinem<br />
Hipsterbart jederzeit als Barista in einem<br />
Kreuzberger Café anheuern. Merkel<br />
hat die rechten Geister aus der CDU vertrieben;<br />
verschwunden sind sie deshalb<br />
nicht.<br />
Wenn es Merkels Ziel war, die deutsche<br />
Politik zu mäßigen, dann ist das gründlich<br />
misslungen. Mit der AfD wird deutlich,<br />
was passiert, wenn das zivilisierende Korsett<br />
der Volkspartei entfällt. Unsagbares<br />
wird plötzlich sagbar, das rohe Ressen -<br />
timent kehrt zurück: Alexander Gauland,<br />
einst braver Chef der hessischen Staatskanzlei,<br />
nennt Merkel eine Diktatorin und<br />
würdigt die Leistungen der deutschen Soldaten<br />
im Zweiten Weltkrieg. Die AfD ist<br />
die hässliche, braune Kehrseite der durch<br />
und durch aufgeklärten Merkel-CDU.<br />
Was nun? Merkel weigert sich, die CDU<br />
wieder ein Stück weiter nach rechts zu<br />
schieben, auch weil es wie das Eingeständnis<br />
eines Fehlers wirken würde. Merkel<br />
geht es jetzt um die Verteidigung ihres Erbes,<br />
und kein CDU-Chef hat die Partei so<br />
weit in die Mitte geführt. Das ist ihr Vermächtnis.<br />
Merkel will sich dafür genauso<br />
wenig entschuldigen wie Gerhard Schröder<br />
für seine Agenda. Es geht jetzt auch<br />
ums Rechthaben.<br />
Inzwischen gibt es in Europa etliche<br />
Parteien, die keinen eigenen inhaltlichen<br />
Kern mehr haben, sondern nur noch dazu<br />
da sind, ihren Spitzenkandidaten zu tragen.<br />
Die ÖVP des Sebastian Kurz gehört<br />
dazu, auch Emmanuel Macrons Bewegung<br />
„En Marche!“ in Frankreich. Beide sind<br />
auf ihre Weise erfolgreich, allerdings vollkommen<br />
abhängig von der Person an der<br />
Spitze. Die CDU ist immer gut damit<br />
gefahren, sich nicht ganz dem Vorsitzenden<br />
auszuliefern. Auch das hat Merkel<br />
geändert.<br />
■<br />
DER SPIEGEL 43/ 2017<br />
43
<strong>Der</strong> Messias war kaum verkündet,<br />
da holte ihn die eigene Partei schon<br />
wieder auf den Boden der Realität<br />
zurück. <strong>Der</strong> designierte neue sächsische<br />
Ministerpräsident Michael Kretschmer, ätzte<br />
die einheimische CDU-Bundestagsabgeordnete<br />
Veronika Bellmann via Facebook,<br />
habe mit seinen 42 Jahren eine steile<br />
Karriere hingelegt. Vom Studium direkt<br />
zum Mitarbeiter in ihrem Abgeordnetenbüro,<br />
dann in den Bundestag und nun auf<br />
den Chefposten in der Dresdner Staatskanzlei:<br />
„Kreißsaal – Hörsaal – Plenarsaal<br />
– MP?!“ Ein politisches Talent sei er<br />
ja ohne Zweifel, „aber ein Sebastian Kurz<br />
für Sachsen ist er definitiv nicht“.<br />
Die kleine Lösung an<br />
der Elbe zeigt, wie verzweifelt<br />
die sächsische<br />
Union versucht, ihre erodierende<br />
Macht zu stabi -<br />
lisieren. Die AfD ist seit<br />
der Bundestagswahl die<br />
stärkste Kraft in einem<br />
Land, in dem die CDU seit<br />
27 Jahren regiert und einst<br />
Wahl ergebnisse von bis zu<br />
58 Prozent erzielte. Blanke<br />
Panik macht sich unter den<br />
Mandatsträgern breit. Mit<br />
Noch-Regierungschef Tillich: Da ist etwas zerbrochen<br />
<strong>Der</strong> Betriebsunfall<br />
Sachsen Nach dem überraschenden Rücktritt von Ministerpräsident<br />
Stanislaw Tillich soll ein Wahlverlierer die angeschlagene<br />
Partei retten. Michael Kretschmer kündigt einen starken Staat an.<br />
Nachfolger Kretschmer<br />
„Sachse mit Herz“<br />
seinem überraschenden Rücktritt als Regierungschef<br />
offenbarte Stanislaw Tillich<br />
seine eigene Ratlosigkeit. Kretschmer, so<br />
sagt er, sei „jung und doch erfahren“. Ein<br />
„Sachse mit Herz und Verstand“. Nur, ob<br />
Jugend und Herkunft reichen, um bei der<br />
Landtagswahl 2019 die Mehrheit der bisherigen<br />
Staatspartei zu retten, wird selbst<br />
in den eigenen Reihen bezweifelt.<br />
Doch Tillich hat die Partei mit seiner<br />
einsamen Entscheidung überrumpelt. Ei -<br />
ne Stunde vor der Verkündung am Mitt -<br />
woch holte er das Parteipräsidium in die<br />
Staatskanzlei. Die Teilnehmer glaubten<br />
an eine Kabinettsumbildung, eine Neuausrichtung<br />
der Politik. Kurz nach der<br />
Wahl hatte Tillich einen<br />
Rechtsruck angekündigt.<br />
Mehr innere Sicherheit,<br />
mehr Abschiebungen, damit<br />
rechneten die Christdemokraten.<br />
Stattdessen<br />
warf der Mann entnervt<br />
hin. Niemand konnte ihn<br />
umstimmen, obwohl man<br />
ihn verzweifelt als „Pfeiler<br />
SVEN ELLGER / IMAGO<br />
RALF HIRSCHBERGER / DPA<br />
der Stabi lität“ würdigte.<br />
Da ist etwas zerbrochen<br />
zwischen Tillich und seinen<br />
Sachsen. Es gab in den<br />
letzten Jahren immer mal wieder Szenen,<br />
die das beschreiben. Wenn der Regent in<br />
seinem Büro mit Blick über Elbe und<br />
Dresdner Altstadt saß und sagte, er verstehe<br />
sein Land nicht und manchmal nicht<br />
einmal die eigene Partei. Dieses permanente<br />
Kokettieren mit der AfD, Verständnis<br />
für Pegida, die Ignoranz gegenüber Rassismus.<br />
Aber er müsse mit der „Partei leben,<br />
wie sie nun einmal ist“.<br />
Geholfen haben die Anbiederung nach<br />
rechts und das ratlose Aussitzen in der<br />
Staatskanzlei ganz offensichtlich nicht. Bei<br />
der Bundestagswahl verlor die Sachsen-<br />
Union 15,8 Prozentpunkte vor allem an<br />
die AfD. Die kam am Ende auf 27 Prozent,<br />
die CDU auf 26,9. Drei Wahlkreise gingen<br />
komplett an die AfD. Fehlt der Erfolg,<br />
kommen schnell die Heckenschützen.<br />
Amtsvorgänger Kurt Biedenkopf übernahm<br />
die Rolle. Die beiden Christdemokraten<br />
hatten sich zuvor wegen Biedenkopfs<br />
staatlich finanzierten Tagebüchern<br />
beharkt. Nun gab „König Kurt“ der „Zeit“<br />
genüsslich zu Protokoll, er sorge sich um<br />
sein Lebenswerk. Die Sachsen hätten das<br />
Gefühl, sie würden nicht gut regiert. Tillich<br />
sei scheu, wenn es um Entscheidungen<br />
gehe, und ihm fehle die nötige Vorbildung.<br />
Er sei ohnehin für das Amt ursprünglich<br />
nicht vorgesehen gewesen. Ein Regierungschef<br />
quasi als Betriebsunfall. Tillich hat<br />
die Brachialkritik schwer getroffen. Als<br />
dann noch die CDU-Landräte meuterten,<br />
war das Maß voll.<br />
Richten soll es nun ein Mann, dem Parteifreunde<br />
bislang maximal ein Ministeramt<br />
zugetraut hätten. Michael Kretschmer<br />
ist ein Eigengewächs der sächsischen<br />
Union. Mit 14 ging er in die Parteijugend,<br />
mit 19 wurde er Stadtrat in Görlitz. Er hat<br />
eine Ausbildung als Büroinformationselektroniker,<br />
studierte Wirtschaftsingenieur -<br />
wesen. Mit 27 zog er in den Bundestag ein,<br />
mit 29 wurde er Generalsekretär der Landes-CDU.<br />
Es ist eine klassische Partei -<br />
karriere ohne den geringsten Abzweig in<br />
das Leben der anderen.<br />
Politisch ist der Mann schwer einzuordnen.<br />
Er selbst beteuert, er stehe „mit beiden<br />
Beinen fest in der Mitte“. Wenn es<br />
der Sache dient, beugt er sich jedoch auch<br />
gern nach rechts. Es war Kretschmer, der<br />
2015 den Stacheldrahtzaun von Ungarns<br />
Ministerpräsident Viktor Orbán an der<br />
Grenze zu Serbien verteidigte: „Ich finde<br />
das richtig.“ Kurz darauf forderte er, damals<br />
Vizechef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,<br />
ein Bekenntnis seiner Partei zur<br />
Begrenzung der Flüchtlingszahlen.<br />
Und als 2016 Sachsens Vizeregierungs -<br />
chef Martin Dulig (SPD) wegen der fremdenfeindlichen<br />
Randale im Land Polizei<br />
und Justiz eine „inakzeptable Laisser-faire-<br />
Haltung“ attestierte, watschte ihn Kretschmer<br />
rüde ab: Dulig schade „unserem Land<br />
durch sein Auftreten“, man müsse von<br />
44 DER SPIEGEL 43 / 2017
Deutschland<br />
einem Minister „ein Mindestmaß an Loyalität<br />
gegenüber der Gesellschaft erwarten“.<br />
Einen Auftritt Kretschmers bei „Anne Will“<br />
zum Thema Flüchtlinge kommentierte die<br />
„Welt“ mit den Worten, Kretschmer sei „in<br />
manchen Phasen wie der in die CDU verlängerte<br />
Arm von Pegida“ aufgetreten.<br />
Jetzt trifft Kretschmer auf eine waidwunde<br />
Partei, die nach Orientierung sucht<br />
und einem Rechtsruck wohl nicht im Wege<br />
stünde. Wohin geht die Reise unter einem<br />
Ministerpräsidenten Kretschmer? Nachdem<br />
sich Parteivorstand und Landtagsfraktion<br />
– mit einigen Abweichlern – hinter<br />
ihn gestellt hatten, gab Kretschmer einen<br />
ersten Ausblick: <strong>Der</strong> Rechtsstaat müsse<br />
durchgesetzt werden, es zählten ein starker<br />
Staat und „deutsche Werte“.<br />
Es ist die Tonlage, die sich bereits in einem<br />
mit der CSU verfassten „Aufruf zu<br />
einer Leit- und Rahmenkultur“ findet, an<br />
dem Kretschmer mitgearbeitet hat. Auszug:<br />
„Patriotisch ist, wer sein Land und<br />
dessen Leute mag.“ Nationalhymne und<br />
Fahne werden ebenso als „Voraussetzungen<br />
gemeinsamen Glücks“ gepriesen wie<br />
der Gebrauch der deutschen Sprache und<br />
bewährte Umgangsformen. Ohne solche<br />
Gemeinsamkeiten, heißt es in dem Papier,<br />
„zerfällt eine Gesellschaft“.<br />
Unumstritten tritt Kretschmer das Tillich-Erbe<br />
nicht an. Gerade hat er nach<br />
15 Jahren sein Mandat für den Bundestag<br />
verloren. Ausgerechnet an einen weitgehend<br />
unbekannten Malermeister der AfD.<br />
Einen, mit dem er früher in der Jungen<br />
Union war und mit dem er einst Helmut<br />
Kohl im Kanzleramt besuchte. Kretschmer<br />
steht für die Niederlage der heimischen<br />
CDU bei der Bundestagswahl. Auch weil<br />
er als Generalsekretär seiner Partei die<br />
Kampagne maßgeblich gesteuert hat. Nach<br />
verlorenen Wahlen sind für gewöhnlich<br />
die Generalsekretäre die Ersten, die ihren<br />
Kopf hinhalten müssen. Auch an der<br />
Basis in Sachsen gab es solche Stimmen.<br />
Doch nun wird der große Wahlverlierer<br />
befördert.<br />
Nach Lage der Dinge gab es nur einen<br />
Mann, der Tillichs Wunschnachfolger hätte<br />
verhindern können: Bundesinnenminister<br />
Thomas de Maizière. <strong>Der</strong> Bundespolitiker<br />
mit Wahlkreis in Meißen war sogar von<br />
Biedenkopf ins Spiel gebracht worden.<br />
Doch die klandestine Vorbereitung des Tillich-Rücktritts<br />
ließ ihm kaum Zeit, die<br />
Truppen zu sammeln, er hätte sofort springen<br />
müssen. Er tat es nicht und hielt im<br />
Landesvorstand, so empfanden es die Teilnehmer,<br />
stattdessen eine Laudatio auf<br />
Kretschmer. Dann gab er bekannt, seine<br />
Lebensplanung auf Berlin auszurichten.<br />
Kretschmer bleibt nun Zeit bis zur Wahl<br />
des Ministerpräsidenten im Dezember, sich<br />
in Sachsen bekannt zu machen und Kritiker<br />
zu überzeugen. <strong>Der</strong> Neue kündigt einen<br />
intensiven Dialog mit der Parteibasis<br />
und den Menschen im Land an. Er wolle<br />
nachsteuern bei der inneren Sicherheit und<br />
mehr Lehrer in die Schulen bringen. <strong>Der</strong><br />
ländliche Raum müsse ebenso gefördert<br />
werden wie die großen Städte. Er werde<br />
„zuhören, um zu verstehen“.<br />
Ob er auch eine Verwaltung führen kann,<br />
ist eine bange Frage, die viele Christdemokraten<br />
seit dieser Woche umtreibt. Kretschmer<br />
war nie Minister, nie Staatssekretär.<br />
Er kennt den Staatsapparat nur von außen.<br />
Experte für die Eignung von Politikern<br />
für das wichtigste Amt im Freistaat ist unbestritten<br />
Kurt Biedenkopf. Seinem späteren<br />
Nachfolger Georg Milbradt gab er einst<br />
mit auf den Weg, ein hochbegabter Fachmann,<br />
aber ein miserabler Politiker zu sein.<br />
Tillich, der immerhin Europaminister, Chef<br />
der Staatskanzlei, Umweltminister und Finanzminister<br />
war, fehlte angeblich die Vorbildung<br />
für das hohe Amt. Man darf gespannt<br />
sein, wann der „König“ sich wieder<br />
meldet. Andreas Wassermann, Steffen Winter<br />
© 2017 McDonald’s<br />
* Ob dein Restaurant an der Verkaufsaktion teilnimmt, erfährst du im Restaurant an der Kasse.
Deutschland<br />
„Souverän<br />
geht anders“<br />
Die Linke Fraktionschefin Wagenknecht<br />
legt im Machtkampf<br />
der Führung nach: Die Partei<br />
müsse ihre Position in<br />
der Flüchtlingsfrage ändern.<br />
Einer, der schon lange dabei ist, kommentierte<br />
das jüngste Scharmützel<br />
mit dem routinierten Zynismus des<br />
erfahrenen Gremienpolitikers: „Uns wird<br />
ja gern unterstellt, wir wollten gar nicht<br />
regieren“, sagte der Genosse in kleiner<br />
Runde. „Dabei haben wir doch gerade erlebt,<br />
dass wir sehr herrschsüchtiges Personal<br />
haben.“<br />
Keiner lachte. Denn die Frage, ob die<br />
Linke im Bund regierungstauglich und<br />
-willig ist, stellt sich seit dieser Woche gar<br />
nicht mehr. Eher die Frage, ob sie überhaupt<br />
politiktauglich ist.<br />
Die Geschichte der Linkspartei war stets<br />
eine Geschichte von Duellen: Ost gegen<br />
West, Mann gegen Frau, Realo gegen Fundi,<br />
Lafontaine gegen Bartsch, Gysi gegen<br />
Lafontaine. In dem ewigen Drama könnte<br />
die Paarung Sahra Wagenknecht gegen<br />
Katja Kipping nun in einem Grundsatzstreit<br />
um die Flüchtlingspolitik münden.<br />
Es geht um die Ausrichtung der Partei:<br />
Die Parteivorsitzende Kipping zielt auf das<br />
urbane, aufgeklärte Milieu, eine junge,<br />
weltoffene und avantgardistische Linke.<br />
Fraktionschefin Wagenknecht sieht in der<br />
Flüchtlingspolitik dagegen die Hauptursache<br />
für die Wählerwanderung von links<br />
nach rechts, gerade im Osten. „Es geht darum,<br />
sensibler mit den Ängsten von Menschen<br />
umzugehen, statt sie als ‚rassistisch‘<br />
zu diffamieren und damit Wähler regelrecht<br />
zu vertreiben“, sagt sie.<br />
Wagenknecht will die Linke nach rechts<br />
schieben – und kündigt an, sich bei dem<br />
Reizthema weiter gegen die Parteilinie zu<br />
stellen: „Statt mit der wenig realitätstaug -<br />
lichen Forderung ‚Offene Grenzen für alle<br />
Menschen sofort‘ Ängste und Unsicherheitsgefühle<br />
zu befördern, sollten wir uns darauf<br />
konzentrieren, das Asylrecht zu verteidigen“,<br />
so Wagenknecht. „Das bedeutet nicht,<br />
dass jeder, der möchte, nach Deutschland<br />
kommen und hier bleiben kann.“ In der<br />
Frage müsse man bald zu einer neuen Linie<br />
kommen. Die Rassismusvorwürfe gegen<br />
sich wies sie als absurd zurück: „So zu argumentieren<br />
ist politisch fahrlässig, weil es<br />
echte, gefährliche Rassisten wie Björn Höcke<br />
unkenntlich macht und so verharmlost.“<br />
Es geht um politische Strategie – und<br />
um einen Machtkampf zwischen den beiden<br />
bekanntesten Frauen der Partei. Nach<br />
dem mittelprächtigen Ergebnis bei der<br />
Bundestagswahl wollte Kipping den schon<br />
lange gehegten Plan umsetzen, ihren<br />
Einfluss auch in der Bundestagsfraktion<br />
auszudehnen: über Vertraute im Fraktionsvorstand<br />
und über mehr Stimm- und<br />
Rederechte für die Parteichefs in der parlamentarischen<br />
Vertretung der Linken.<br />
Wagenknecht wehrte diesen Angriff auf<br />
ihren Machtbereich als Fraktionsvorsitzende<br />
ab, indem sie mit Rücktritt drohte. Mit<br />
derselben Methode hatte sie bereits ver-<br />
* Sahra Wagenknecht, Dietmar Bartsch, Bernd Riexinger,<br />
Katja Kipping.<br />
Linkenpolitiker beim Fraktionstreffen in Potsdam am 17. Oktober*: Führung durch Erpressung<br />
CHRISTIAN THIEL / DER SPIEGEL<br />
hindert, dass die Parteichefs Kipping und<br />
Bernd Riexinger Spitzenkandidaten zur<br />
Bundestagswahl wurden. Das Problem an<br />
dieser Methode: Sie lässt sich nicht beliebig<br />
oft wiederholen.<br />
In der Linken kursiert nun der Vorwurf<br />
„Führung durch Erpressung“. Stundenlang<br />
diskutierte die Fraktion vorigen Dienstag<br />
in Potsdam die künftige Aufstellung. Es<br />
wurde laut. „Ein peinlicher Kindergarten“<br />
sei das Ganze, so ein Fraktionsmitglied.<br />
Ein Machtspiel, bei dem alle verlören.<br />
Und auch die Ideen, mit denen die Partei<br />
Wähler zurückgewinnen will, wirken<br />
hilflos: Mehr Hüpfburgen in den Städten<br />
oder weniger Anträge im Bundestag? Die<br />
einen wollen die Bockwurstesser im Osten<br />
nicht verprellen, die anderen zielen auf<br />
die Veganer in den Großstädten. Ein Drittel<br />
der Teilnehmer waren Neulinge im Bundestag.<br />
Sie zeigten sich besonders frustriert<br />
über den misslungenen Start. „Verzweifelt“<br />
beschrieb einer die Stimmung.<br />
Schließlich zogen sich die drei Hauptkontrahenten<br />
gemeinsam mit Co-Fraktions -<br />
chef Dietmar Bartsch in ein Zimmer zurück,<br />
um eine Lösung zu finden. Kipping<br />
und Wagenknecht, beide in unschuldiges<br />
Weiß gekleidet, guckten sich kaum in die<br />
Augen. Demonstrativ verschränkte Wagenknecht<br />
die Arme vor der Brust. Kipping<br />
raufte sich die Haare, verwies auf die Beschlüsse<br />
der Partei. Bartsch ließ durchblicken,<br />
dass es ein Leichtes gewesen wäre,<br />
die Anträge aus der Parteiführung in der<br />
Fraktion komplett durchfallen zu lassen.<br />
Er pochte auf Kompromisse, damit jeder<br />
sein Gesicht wahren könne.<br />
Im Ergebnis durfte dann Kipping ihre<br />
Freundin Caren Lay als Fraktionsvize<br />
durchsetzen. Dafür blieben die Fraktionschefs<br />
im Kampf um die heiß begehrten Rederechte<br />
und -zeiten im Bundestag hart.<br />
Was dieser Kompromiss wert ist, zeigte<br />
sich bereits bei seiner Präsentation vor<br />
Journalisten. Weil Bernd Riexinger es wagte,<br />
als Erster zu reden, fiel Wagenknecht<br />
ihm ins Wort und übernahm: „Bernd, das<br />
ist hier die Pressekonferenz der Fraktion.“<br />
Kipping kofferte wegen dieses Maulkorbs<br />
später zurück: „Souverän geht anders.“<br />
In der Opposition konkurriert die Partei<br />
künftig mit AfD und SPD um Aufmerksamkeit<br />
und Ideen. Wie soll das gehen angesichts<br />
des Führungsstreits? Beginnt nun<br />
die Restlaufzeit, oder kann die Partei sich<br />
noch mal neu erfinden? Die brauchten so<br />
etwas wie eine Mediation, glaubt der Ex-<br />
Vorsitzende Klaus Ernst.<br />
Doch nun fürchten viele, dass Wagenknecht<br />
auch ihre Flüchtlingspolitik mit einer<br />
Rückzugsdrohung durchsetzen will –<br />
gegen den Widerstand von Parteichefin<br />
Kipping. Komme es so weit, sagt einer aus<br />
dem neuen Fraktionsvorstand, könnte das<br />
bedeuten: Eine von beiden muss gehen.<br />
Nicola Abé, Markus Deggerich<br />
46 DER SPIEGEL 43 / 2017
Das ist zu viel<br />
für die da oben.<br />
Nur jetzt mit kostenlosen<br />
Winterkompletträdern 1<br />
Deutschlands günstigster SUV.<br />
<strong>Der</strong> Dacia Duster<br />
Schon ab 10.690,– € 2<br />
www.dacia.de<br />
Dacia Duster SCe 115 4x2: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 7,7; außerorts: 5,6; kombiniert: 6,4; CO 2 -Emissionen kombiniert:<br />
145 g/km. Dacia Duster: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 8,1–4,4; CO 2 -Emissionen kombiniert: 155–115 g/km. (Werte nach<br />
Messverfahren VO [EG] 715/2007).<br />
1<br />
Gültig für vier Winterkompletträder. Reifen-Format und Felgen-Design nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden, gültig für Zulassungen bis<br />
31.12.2017. Bei allen teilnehmenden Dacia Partnern. 2 UPE zzgl. Überführung für einen Dacia Duster Essentiel SCe 115 4x2. Abbildung zeigt Dacia<br />
Duster Prestige mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.
Deutschland<br />
Doppelt kassieren<br />
Kommunen Mit einem fragwürdigen Vorruhestandsmodell wollen Sparkassen bundesweit<br />
Personal loswerden – zulasten des Sozialstaats.<br />
Mehr als 150 Jahre lang gab es im<br />
Peiner Land, auf halber Strecke<br />
zwischen Hannover und Braunschweig<br />
gelegen, eine eigenständige Bank,<br />
die Kreissparkasse Peine. Es war ein überschaubares<br />
Kreditinstitut, zuletzt arbeiteten<br />
dort rund 400 Mitarbeiter, sie betreuten<br />
15 Filialen im Landkreis.<br />
Doch dann glaubten die Politiker in der<br />
Region, das Geldhaus sei zu klein, um im<br />
Wettbewerb bestehen zu können. Des -<br />
halb musste es Anfang dieses Jahres mit<br />
den Sparkassen Hildesheim und Goslar/<br />
Harz fusionieren. Sitz der neuen Bank ist<br />
Hildesheim, sie ist die drittgrößte Sparkasse<br />
Niedersachsens und mit 1700 Mit -<br />
arbeitern einer der größten Arbeitgeber<br />
der Region.<br />
Wie in Peine ist es in vielen Regionen.<br />
Seit Jahren fusionieren Sparkassen, werden<br />
Filialen geschlossen, Stellen gestrichen.<br />
Niedrige Zinsen und der Strukturwandel<br />
in der Branche erhöhen den Druck zur<br />
Veränderung.<br />
Doch seit der Fusion der drei Sparkassen<br />
in Südniedersachsen hat Vorstandschef<br />
Jürgen Twardzik ein Problem: Er verfügt<br />
über zu viel Personal. Was soll er mit drei<br />
Personalabteilungen, drei Vorstandssekretariaten,<br />
drei Buchhaltungen? In internen<br />
Unterlagen der Sparkasse werden „hohe<br />
Personalüberhänge“ beklagt, mehr als<br />
300 Mitarbeiter sind demnach entbehrlich.<br />
Andererseits sind Entlassungen keine<br />
Lösung. Hire and fire – das könnte sich<br />
ein internationaler Finanzkonzern erlauben,<br />
nicht aber eine Sparkasse, hinter der<br />
Kommunen stehen, deren Bürgermeister<br />
und Landräte wiedergewählt werden wollen.<br />
Sparkassen fördern Sport und Kultur.<br />
Auf dem Image des heimatverbundenen<br />
Geldhauses beruht ihr Erfolg.<br />
Also machte Twardzik gute Miene zum<br />
bösen Spiel: Für die Kunden werde sich<br />
durch die Fusion nur wenig ändern, beteuerte<br />
der Vorstandschef. Und auch die Mitarbeiter<br />
hätten die nächsten Jahre nichts<br />
zu befürchten. Falls Personal abgebaut<br />
werden müsse, solle dies durch natürliche<br />
Fluktuation geschehen.<br />
Wie aber soll das gehen? Ein Fünftel der<br />
Belegschaft möglichst schnell durch Fluktuation<br />
abbauen? Die Antwort soll die Unternehmensberatung<br />
Bertschat und Hundertmark<br />
liefern, die Twardzik diskret engagiert<br />
hat. Die Firma aus Bad Nauheim<br />
versteht sich auf den geräuschlosen Personalabbau<br />
und gilt als heißer Tipp unter<br />
Sparkassenchefs, die sparen wollen.<br />
48 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
CHRIS GOSSMANN<br />
Kreditinstitut in Hildesheim: Das Image des heimatverbundenen Geldhauses wahren<br />
Bertschat und Hundertmark sind bestens<br />
im Geschäft. Das Unternehmen hat<br />
ein spezielles Personalabbaumodell ent -<br />
wickelt, den „Vorruhestand-Flex“. Ältere<br />
Mitarbeiter erhalten dabei ein lukratives<br />
Abfindungsangebot, das ihnen helfen soll,<br />
die Zeit zwischen dem Ausscheiden und<br />
dem Rentenbeginn zu überbrücken.<br />
<strong>Der</strong> Clou daran: Die Vorruheständler<br />
sollen sich bei der Arbeitsagentur jobsuchend<br />
melden, um bis zu zwei Jahre lang<br />
Arbeitslosengeld zu beziehen. So können<br />
sie doppelt kassieren: die Abfindung der<br />
Sparkasse und zusätzlich Stütze.<br />
Besonders rechnet sich das Modell für<br />
den Arbeitgeber. Allein die Sparkasse<br />
Hildesheim Goslar Peine kann bei ihrem<br />
Personalabbau einen Millionenbetrag sparen,<br />
wenn sie nicht, wie bei echten Vor -<br />
ruhestandsmodellen üblich, die Kosten<br />
vollständig selbst trägt.<br />
Rechtlich liegt ein solches Vorruhestandskonstrukt<br />
zulasten der Sozialkassen in einer<br />
Grauzone. Zwar war es bis vor zehn Jahren<br />
in vielen Branchen üblich, überzählige ältere<br />
Mitarbeiter zum Amt abzuschieben.<br />
Damals konnten Arbeits lose ab dem 58. Lebensjahr<br />
Arbeitslosengeld und danach<br />
Hartz IV kassieren, ohne dem Arbeitsmarkt<br />
zur Verfügung zu stehen. Dann aber änderte<br />
die Bundesregierung die Vorschriften.<br />
Seither dürfen auch ältere Arbeitslose nicht<br />
auf dem Sofa die freie Zeit genießen. Sie<br />
müssen bereit sein, einen neuen, womöglich<br />
auch schlechter bezahlten Job anzunehmen.<br />
Tun sie es nicht, drohen Sanktionen.<br />
Allerdings ist es für die Arbeitsagen -<br />
turen nicht einfach herauszufinden, ob<br />
die oft schwer vermittelbaren älteren Ex-<br />
Banker ernsthaft einen neuen Job suchen<br />
oder nur das Arbeitslosengeld I (ALG I)<br />
kassieren wollen. Auf jeden Fall werde das<br />
Modell „kritisch“ gesehen, sagt eine Sprecherin<br />
der Bundesagentur für Arbeit: „<strong>Der</strong><br />
Bezug von Arbeitslosengeld widerspricht<br />
der Idee eines Vorruhestands.“<br />
Den klandestinen Griff in die Sozialkassen<br />
versuchen auch andere Unternehmen.<br />
Doch bei den Sparkassen ist er besonders<br />
pikant. Denn laut Gesetz muss ihre Tätigkeit<br />
darauf gerichtet sein, der Allgemeinheit<br />
zu dienen.<br />
Kein Verständnis für die Tricks hat deshalb<br />
die Gewerkschaft Ver.di. „So etwas<br />
gehört sich nicht“, findet der Fachbereichsleiter<br />
Finanzdienstleistungen beim Landesbezirk<br />
Niedersachsen-Bremen, Markus<br />
Westermann: „Sparkassen haben einen<br />
öffentlichen Auftrag und nicht das Ziel, il -<br />
legal die öffentlichen Kassen zu plündern.“
Den Vorstandschef<br />
plagt kein schlechtes<br />
Gewissen dabei, die<br />
Sozialkassen anzuzapfen.<br />
Bei welchen Sparkassen Bertschat und<br />
Hundertmark tätig sind, lässt sich nur<br />
schwer herausfinden. „Die Berater erhalten<br />
praktisch bei jedem Sparkassenvorstand<br />
sofort einen Termin, wenn sie ihr<br />
Konzept vorstellen wollen“, heißt es in der<br />
Branche.<br />
Das Unternehmen selbst will keine<br />
Auskunft geben: Es sei zur „Verschwiegenheit<br />
gegenüber Dritten verpflichtet“. Für<br />
die Anwendung des „Vorruhestand-Flex“-<br />
Modells seien die Sparkassen und ihre<br />
Arbeit nehmer allein verantwortlich.<br />
Auch die Geldhäuser geben sich zu -<br />
geknöpft. Dabei hat der bayerische Sparkassenverband<br />
sogar eine Rahmenvereinbarung<br />
mit Bertschat und Hundertmark<br />
unterzeichnet. Für den niedersächsischen<br />
Verband organisierten die Berater im Frühjahr<br />
zwei Workshops, und auch in Nordrhein-Westfalen<br />
sind sie gefragt.<br />
In einer Postille des Deutschen Sparkassen-<br />
und Giroverbands machte Firmenchef<br />
Bernhard Bertschat im Sommer ungeniert<br />
für den Griff in die Sozialkassen Werbung.<br />
Unter der Überschrift „Was Vorruhestandsmodelle<br />
unschlagbar macht“ beschreibt er<br />
den Kniff mit der Arbeitsagentur. „Ein bestehender<br />
ALG-I-Anspruch wird fiktiv angerechnet“,<br />
frohlockt er.<br />
Stolz berichtet Bertschat auch, dass „immer<br />
mehr Sparkassen“ sein Vorruhestandsmodell<br />
favorisierten. So habe Anfang des<br />
Jahres die Sparkasse Vorpommern das Projekt<br />
„zur Zufriedenheit von Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmern“ umgesetzt.<br />
Und tatsächlich: Nach der Fusion der<br />
Sparkassen Vorpommern und Rügen, bestätigt<br />
eine Sprecherin, habe man mit Bertschat<br />
und Hundertmark ein Abbauprogramm<br />
entwickelt. 76 Mitarbeitern über<br />
57 Jahre sei das Modell „Vorruhestand-<br />
Flex“ angeboten worden. Die Annahmequote<br />
lag bei 96 Prozent. Ob alle ausscheidenden<br />
Kollegen nun zum Arbeitsamt gehen,<br />
um die Abfindung mit Arbeitslosengeld<br />
aufzustocken, wisse sie nicht, sagt sie: „Ich<br />
glaube aber nicht, dass das ein Problem ist.“<br />
Dass sich das Abfindungsmodell nur<br />
mit der zusätzlichen Stütze rechnet, zeigen<br />
die Unterlagen der Sparkasse Hildesheim<br />
Goslar Peine. Nach einer Beispielrechnung<br />
sollen einem 59-jährigen Sparkassenmit -<br />
arbeiter 95 Prozent seines bis herigen<br />
Netto gehalts bis zum Renteneintritt mit 63<br />
garantiert werden. Selbst die Sozialversicherungsbeiträge<br />
und die fälligen Steuern<br />
auf den Abfindungsbetrag werden über-<br />
nommen. Das Geld erhält der „Vorruheständler“<br />
mit dem Ausscheiden auf einen<br />
Schlag. Das hört sich attraktiv an.<br />
Mithilfe eines Computerprogramms berechnet<br />
das Unternehmen allerdings auch<br />
den Arbeitslosengeldanspruch bis auf den<br />
Cent genau. Diese Summe kann mehrere<br />
Zehntausend Euro betragen und wird von<br />
der Abfindung abgezogen. Zudem geht<br />
die Berechnung davon aus, dass der Ex-<br />
Mitarbeiter während des Arbeitslosengeldbezugs<br />
über die Behörde krankenversichert<br />
ist.<br />
Als besonderen Service bietet die Unternehmensberatung<br />
die Betreuung der<br />
ausscheidenden Mitarbeiter bis zur Rente<br />
und eine Haftung für die Beratungsergebnisse<br />
an. Es gibt Gerüchte, Bertschat und<br />
Hundertmark würden den Betroffenen raten,<br />
Kaffeeflecken auf ihre Bewerbungsunterlagen<br />
zu machen, damit sie nicht unbeabsichtigt<br />
in einen neuen Job vermittelt<br />
werden. Das Unternehmen bestreitet, dass<br />
es eine spezielle Beratung der Mitarbeiter<br />
für den Umgang mit der Arbeitsagentur<br />
gebe. Es würden lediglich „die gesetzlichen<br />
Regelungen“ erläutert.<br />
Sparkassenchef Twardzik jedenfalls<br />
plagt kein schlechtes Gewissen, die So -<br />
zialkassen anzuzapfen: „Das machen andere<br />
Unternehmen auch“, sagt er, „und<br />
wir stehen im Wettbewerb.“ Die Mitarbeiter<br />
hätten zudem jahrelang in die Arbeitslosenversicherung<br />
eingezahlt. „Da ist es<br />
in Ordnung, wenn sie nach dem Ausscheiden<br />
ihre Ansprüche geltend machen.“ Für<br />
die Sparkasse gehe es darum, ein attraktives<br />
Abfindungs angebot zu machen, das<br />
sich wirtschaftlich rechne.<br />
Kontrolliert werden die Sparkassenvorstände<br />
von Verwaltungsräten, in denen vor<br />
allem Kommunalpolitiker sitzen. Diese<br />
könnten am meisten von der dubiosen Finanzierung<br />
des Personalabbaus profitieren:<br />
Ausschüttungen der Sparkassen fließen in<br />
die Haushalte ihrer Städte und Landkreise.<br />
Kein Wunder, dass es dort ebenfalls<br />
wenig Unrechtsbewusstsein gibt. An der<br />
Spitze des Verwaltungsrats der neuen Spar -<br />
kasse steht Ingo Meyer, Oberbürgermeister<br />
von Hildesheim. „Kein Mitarbeiter wird<br />
gezwungen, einen Vorruhestandsvertrag<br />
zu unterschreiben. Keiner wird gezwungen,<br />
sich arbeitslos zu melden“, sagt er,<br />
obwohl das Modell gerade darauf basiert.<br />
Die Politiker hätten die Fusion schließlich<br />
nicht beschlossen, weil die Sparkassen<br />
„auf Rosen gebettet“ seien. Dass die Stadt<br />
vom Umbau des Geldhauses profitiert, bestreitet<br />
das Stadtoberhaupt nicht. Mit mehr<br />
als 1,6 Millionen Euro haben die drei<br />
Sparkassen im vergangenen Jahr Vereine<br />
und soziale Initiativen in der Region unterstützt.<br />
„Das muss so bleiben“, findet<br />
Meyer, „in dem Bereich ist unsere Sparkasse<br />
der größte Player in der Stadt.“<br />
Michael Fröhlingsdorf<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
49<br />
Haben Sie damals<br />
mehr erhalten<br />
als nur eine<br />
Notfallbehandlung?<br />
Vor 1992 wurden Blut- bzw.<br />
Blutprodukte nicht routinemäßig<br />
auf Hepatitis-C-Viren untersucht.<br />
Ein Risiko, sich möglicherweise mit<br />
dem Hepatitis-C-Virus infiziert zu<br />
haben, ohne es zu wissen. 1<br />
Hepatitis C ist heilbar. 2<br />
Wenden Sie sich an Ihren<br />
Arzt und besuchen Sie<br />
www.bist-du-chris.de<br />
HCV/DE/17-05/PM/1850<br />
Eine Kooperation von:<br />
Deutsche Leberstiftung<br />
Deutsche Leberhilfe e.V.<br />
Gilead Sciences GmbH<br />
1<br />
WHO. Media Centre Hepatitis C Fact sheet No164. http://www.<br />
who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ [letzter Zugriff Juni 2017]<br />
2<br />
Marinho RT et al. World J Gastroenterol 2013; 19: 6703-6709
Deutschland<br />
Kita mit Yoga<br />
Kleinkinder Private Krippen<br />
verlangen teils mehr als 1000 Euro<br />
pro Monat. Müssen Kommunen<br />
die Mehrkosten erstatten, wenn sie<br />
selbst zu wenig Plätze haben?<br />
50 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Es war viel zu organisieren für die<br />
dreiköpfige Familie: der Umzug von<br />
Köln nach München, die neue Wohnung,<br />
Räume für die Zahnarztpraxis, die<br />
die Mutter dort eröffnen wollte – und eine<br />
Betreuung für den zweijährigen Sohn.<br />
Sechs Monate im Voraus beantragte die<br />
Mutter bei der Stadt München einen Platz.<br />
Doch erst zwei Monate vor dem benötigten<br />
Termin bot die Verwaltung ihr mehrere<br />
Tagesmütter an, die aber nicht die gewünschten<br />
Betreuungszeiten hatten. In<br />
ihrer Panik suchte die Mutter nach einer<br />
privaten Kita und fand auch schnell einen<br />
Platz zum Wunschtermin. Kostenpunkt<br />
allerdings: monatlich 1380 Euro für die<br />
Ganztagsbetreuung, plus 100 Euro Essensgeld.<br />
Da die Stadt München ihrer Pflicht, einen<br />
Betreuungsplatz bereitzustellen, nicht<br />
rechtzeitig nachgekommen sei, klagten die<br />
Eltern für ihr Kind auf sogenannten Aufwendungsersatz.<br />
Vor dem Verwaltungs -<br />
gericht scheiterten sie damit noch. Doch<br />
der Verwaltungsgerichtshof (VGH) gab<br />
ihnen im Grundsatz recht, wogegen die<br />
Stadt Revision einlegte.<br />
Kommenden Donnerstag verhandelt<br />
deshalb das Bundesverwaltungsgericht in<br />
Leipzig den Fall. Ein halbes Dutzend Klagen<br />
sind bereits jetzt beim VGH anhängig.<br />
Auch für andere Großstädte, wo in großer<br />
Zahl Kitaplätze fehlen, dürfte das Urteil<br />
relevant werden.<br />
Seit August 2013 haben Kinder schon<br />
ab dem ersten Geburtstag einen gesetz -<br />
lichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz,<br />
entweder in einer Krippe, also in einer<br />
Kita, oder bei einer Tagesmutter. In<br />
München gibt es aktuell 3633 städtische<br />
Krippenplätze und 18019 weitere Klein -<br />
kinderplätze bei freien Trägern<br />
wie Kirchen und Privatinitiativen<br />
oder Tagesmüttern. In<br />
der bayerischen Landeshauptstadt<br />
können 64 Prozent der<br />
Ein- bis Dreijährigen versorgt<br />
werden.<br />
„Rechnerisch ist München<br />
gut aufgestellt“, sagt Ursula<br />
Oberhuber, die Sprecherin des<br />
städtischen Referats für Bildung<br />
und Sport. Doch die Plätze<br />
verteilen sich nicht gleichmäßig<br />
auf die Wohnviertel.<br />
Während in manchen Gegenden<br />
das Angebot ausreicht,<br />
müssen andernorts die Eltern<br />
suchen. Besserung ist nicht in Sicht, denn<br />
München wächst und wächst.<br />
Die Stadt misst dem anstehenden Urteil<br />
deshalb grundsätzliche Bedeutung zu:<br />
„Die Frage ist: Welcher Betreuungsplatz<br />
erfüllt den Rechtsanspruch?“, sagt Oberhuber,<br />
„die Entscheidung bindet die Verwaltungen<br />
bundesweit.“<br />
Dass prinzipiell eine Ersatzpflicht besteht,<br />
wenn Eltern gezwungen waren, sich<br />
auf dem privaten Markt eine Betreuung<br />
zu suchen, haben die Leipziger Richter bereits<br />
entschieden. Doch gilt eine solche Ersatzpflicht<br />
auch dann, wenn die Kommune<br />
Bewegungsraum in Münchner Privatkita Tejay’s: Auch Schwimmunterricht und Skikurse<br />
Kinderbetreuung<br />
in Deutschland, 2016 *<br />
Quote<br />
Bedarf<br />
1- bis unter 2-Jährige<br />
36%<br />
2- bis unter 3-Jährige<br />
61%<br />
MAXIMILIAN MUTZHAS<br />
eine Tagesmutter angeboten hat, die Eltern<br />
aber lieber einen Krippenplatz hätten?<br />
Und was ist, wenn sie sich eine Luxuskita<br />
suchen?<br />
Von den Tagesmüttern, urteilte der VGH<br />
im aktuellen Fall, hätte allenfalls eine den<br />
zeitlichen Bedarf der Eltern decken können.<br />
Um den Sohn dorthin zu bringen und<br />
wieder abzuholen, wäre die Mutter aber<br />
täglich zwei Stunden unterwegs gewesen –<br />
zu viel, meinten die Richter. Vor allem<br />
aber müssten Eltern sich nicht<br />
60%<br />
77%<br />
*Tageseinrichtungen, Tagespflege<br />
Quelle: Statistisches Bundesamt; DJI<br />
mit einer Tagesmutter zufriedengeben,<br />
wenn sie ihr Kind<br />
lieber in eine Krippe geben<br />
möchten.<br />
Das haben andere Ober -<br />
gerichte bisher anders gesehen.<br />
Schon deshalb ist das Münchner<br />
VGH-Urteil für den Bayreuther<br />
Juraprofessor Stephan<br />
Rixen ein „Meilenstein“, weil<br />
Eltern auf dieser Basis frei zwischen<br />
Tagesmüttern und Krippen<br />
wählen könnten.<br />
Klar ist aber auch: Wenn das<br />
Bundesverwaltungsgericht dieses<br />
Wahlrecht bestätigen sollte,<br />
würde es für die Kommunen noch schwieriger.<br />
Viele Eltern dürften sich dann nicht<br />
mehr mit einem aus ihrer Sicht weniger befriedigenden<br />
Angebot abspeisen lassen.<br />
Auch in der Kostenfrage stellte sich der<br />
VGH klar auf die Seite der Zahnärztin und<br />
ihrer Familie. Ihre Mandantin habe sich<br />
keine „Luxuskita“ ausgesucht, sagt die Anwältin<br />
der Familie, Ingrid Hannemann.<br />
Auch städtische Einrichtungen hätten tatsächliche<br />
Kosten von 1033 Euro pro Platz –<br />
und zwar noch ohne die Kosten für Errichtung<br />
und Bewirtschaftung des Gebäudes.<br />
Da seien 350 Euro mehr für ein privates<br />
Angebot in München tendenziell im Rahmen,<br />
befanden auch die Richter des VGH.<br />
Die Betreiberin der angeblichen Luxuskita<br />
Tejay’s, Sonja Schmid, mag dieses Label<br />
zwar ebenso wenig wie die Anwältin,<br />
wirkt aber durchaus stolz darauf, dass ihre<br />
beiden Einrichtungen „von der Qualität<br />
und dem Förderangebot her in München<br />
sicher an der Spitze liegen“.<br />
Tatsächlich wird das Tejay’s zweisprachig<br />
geführt, auf Deutsch und Englisch. Zum<br />
Angebot gehören Yoga, Tanzen, Schwimm -<br />
unterricht und Skikurse; sechs Erzieherinnen<br />
betreuen 25 Kinder. Luxus oder nicht –<br />
die Münchner Richter sahen darin ein<br />
„Friss-oder-stirb-Angebot“, die Eltern hätten<br />
also keine andere Option gehabt.<br />
Dabei bringt sogar die Stadt München<br />
immer wieder Kinder im Tejay’s unter –<br />
und trägt dann zumindest den Großteil der<br />
Kosten. Angeblich hätte die Stadt auch<br />
dem Sohn der Zahnärztin dort noch einen<br />
Platz vermitteln können. Aber da sei der<br />
ja schon belegt gewesen – von ihm selbst.<br />
Jan Friedmann, Dietmar Hipp
Mehr gemeinsam<br />
als gedacht.<br />
Von der Kochleidenschaft bis zum Lieblingssport – wir haben<br />
mehr gemeinsam, als wir glauben. Entdecke auch du, wie gut<br />
ein vielfältiges Miteinander für alle ist. #wirgemeinsam<br />
Sei dabei unter www.aktion-mensch.de
Früher war alles schlechter<br />
Nº 95: Wohlstand in China<br />
QUELLEN: XINHUA, EUROMONITOR<br />
1981 lebten fast 90 % der Chinesen in Armut … … 2016 sind es 3 %.<br />
2005 verdienten Industriearbeiter 1,20 Dollar die Stunde …<br />
… 2016 sind es 3,60 Dollar.<br />
2008 wurde die erste Hochgeschwindigkeitsstrecke für Züge eingeweiht …<br />
… 2016 sind es über 22000 Streckenkilometer.<br />
Kommunistische Wohltaten. Das im Westen verbreitete Mantra,<br />
dass früher alles besser gewesen sei, hört man in China so gut<br />
wie nie – oder nur von unverbesserlichen Ma(s)o(ch)isten.<br />
Doch der Große Sprung nach vorn, den Mao versprach, kam<br />
für China erst mit dem Anschluss an die Weltwirtschaft.<br />
Man darf die unfassbaren Zahlen, die seither in chinesischen<br />
Statistiken stehen, mit einem Superlativ zusammenfassen:<br />
Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit ging es so vielen<br />
Menschen in so kurzer Zeit so viel besser. 1981 lebten mehr<br />
als 800 Millionen oder fast 90 Prozent der Chinesen unter der<br />
absoluten Armutsgrenze (von 1,90 Dollar am Tag), heute<br />
sind es noch 43 Millionen. Inzwischen hat die Kommunistische<br />
Partei ein neues Ziel, sie nennt es eine „moderat wohlhabende<br />
Gesellschaft“: Die Stundenlöhne der Arbeiter haben<br />
sich seit 2006 von 1,20 auf 3,60 Dollar verdreifacht, liegen damit<br />
höher als in den meisten Schwellenländern und reichen<br />
bald an die in Portugal (4,50 Dollar) heran. Wie ist den Chinesen<br />
das gelungen? Unter anderem mit radikaler Verkehrspolitik:<br />
Seit 2006 baute China pro Jahr rund 94000 Kilometer neue<br />
Straßen, 260 Kilometer jeden Tag, und seit 2008 gut 22000 Kilo -<br />
meter Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken. Auf diesen Straßen<br />
und Schienen rollen ihre Güter auf Chinas Häfen und rasen die<br />
Chinesen auf ihren moderaten Wohlstand zu. Über die Globalisierung<br />
schimpft hier kaum jemand.<br />
bernhard.zand@spiegel.de<br />
Stress<br />
Sind die Briefträger überfordert,<br />
Herr Cosmar?<br />
Thomas Cosmar, 55, Bezirks -<br />
vorsitzender bei der Dienstleistungsgewerkschaft<br />
Ver.di,<br />
über leere Briefkästen in Berlin<br />
SPIEGEL: Zurzeit erhalten<br />
viele Berliner ihre Post verspätet.<br />
Was ist da los?<br />
Cosmar: Wir haben einen sehr<br />
hohen Krankenstand. Die<br />
Zusteller sind physisch und<br />
psychisch überlastet.<br />
SPIEGEL: Ist Briefträger denn<br />
so ein harter Job?<br />
Cosmar: Natürlich! <strong>Der</strong> Briefträger<br />
hat in Berlin an seinem<br />
Fahrrad mindestens vier<br />
Briefbehälter. Die wiegen gefüllt<br />
rund 18 Kilogramm und<br />
werden mehrmals am Tag bewegt.<br />
Das ist Schwerstarbeit.<br />
SPIEGEL: Klingt nicht nach<br />
dem romantischen Bild vom<br />
deutschen Briefträger in der<br />
stolzen Uniform.<br />
Cosmar: So stellen sich das<br />
die Leute gern vor, ja. In der<br />
Realität ist der Briefträger bis<br />
zu 15 Kilometer unterwegs.<br />
Mit dem Rad. Ist er zu Fuß,<br />
sind es täglich sechs bis zehn<br />
Kilometer. Das muss man<br />
erst mal leisten, dauerhaft.<br />
Zumal das Durchschnittsalter<br />
der Briefträger bei über<br />
48 Jahren liegt.<br />
SPIEGEL: Fehlt der Briefträgernachwuchs?<br />
Cosmar: Ja. Von zehn Leuten,<br />
die neu anfangen, bleiben<br />
höchstens zwei dauerhaft im<br />
Beruf. Die körperliche Be -<br />
lastung ist zu groß.<br />
SPIEGEL: Aber ist das Postaufkommen<br />
durch die E-Mails<br />
nicht weniger geworden?<br />
IMAGO<br />
Cosmar: Im privaten Bereich.<br />
Dafür hat die Werbepost zugenommen.<br />
Auch Pakete werden<br />
mehr verschickt – und<br />
die sind schwerer geworden.<br />
Die Leute lassen sich heute<br />
vieles nach Hause liefern,<br />
Säcke mit Katzenstreu oder<br />
Büroartikel. Dann wiegt ein<br />
Paket schnell 20 Kilo.<br />
SPIEGEL: Kommt die Post in<br />
Berlin trotzdem bald wieder<br />
pünktlich?<br />
Cosmar: Tja, ich hoffe. Zumal<br />
der Weihnachtsverkehr beginnt.<br />
Da brauchen wir jeden,<br />
der laufen kann.<br />
SPIEGEL: Haben Sie selbst mal<br />
als Briefträger gearbeitet?<br />
Cosmar: Ja. Ich habe vor<br />
29 Jahren bei der Post angefangen<br />
– als Eilzusteller. jmg<br />
52 DER SPIEGEL 43 / 2017
Karoshi<br />
Eine Meldung und ihre Geschichte Wie sich<br />
eine junge japanische<br />
Reporterin zu Tode arbeitete<br />
Es war eine der letzten E-Mails, die sie ihrem Vater<br />
schickte. Sie hatte einen Ton, den der Vater von seiner<br />
Tochter nicht kannte. Sie schrieb: „Ich habe viel<br />
zu tun. <strong>Der</strong> Stress staut sich an, einmal am Tag denke ich,<br />
dass ich aufhören möchte. Aber jetzt kommt es darauf<br />
an, durchzuhalten, nicht?“<br />
Einen Monat später war Miwa Sado tot. Man hatte sie<br />
in ihrer Wohnung gefunden, sie lag auf dem Bett, das<br />
Handy fest umklammert. Die Todesursache lautete: Herzversagen.<br />
Nun sitzen ihre Eltern im Ministerium für Gesundheit,<br />
Arbeit und Soziales in Tokio und geben eine Pressekonferenz.<br />
Sie klagen an. Sie verwenden den Begriff „Ka-<br />
roshi“. Karoshi bedeutet: Tod durch Überarbeitung.<br />
Miwa Sado ist nur 31 Jahre<br />
alt geworden. Sie hatte<br />
als Reporterin bei NHK<br />
gearbeitet, Japans öffentlich-rechtlicher<br />
Rundfunkund<br />
Fernsehanstalt, und<br />
sie hatte ihren Beruf geliebt.<br />
Vor Jahren, als sie<br />
noch Jura studierte, hatte<br />
sie einen Journalismus -<br />
kursus besucht. Sie wollte<br />
immer Reporterin sein,<br />
keine Anwältin.<br />
Sie lebte für ihre Geschichten.<br />
Einmal war sie<br />
auf eigene Kosten auf eine<br />
Insel geflogen, um die Geschichte<br />
eines abgestürzten<br />
Militärhubschraubers<br />
zu recherchieren. Ihr letzter<br />
Arbeitsplatz war ein<br />
kleines Büro im Rathaus<br />
von Tokio gewesen, Miwa<br />
Sado war die Jüngste und<br />
die Beste in ihrem Team. Sie berichtete erst über die Wahl<br />
zum Tokioter Stadtparlament, später über die Wahl zum<br />
Oberhaus des japanischen Parlaments, dann sollte sie nach<br />
Yokohama wechseln, sie wäre dort Leiterin einer Redaktion<br />
geworden. Sie starb wenige Tage vor ihrem Umzug,<br />
es war der 24. Juli 2013.<br />
Mehr als vier Jahre vergehen zwischen Sados Tod und<br />
der Pressekonferenz ihrer Eltern. Dass die erst jetzt reden,<br />
liegt daran, dass Japan erst jetzt dazu bereit ist. Immer wieder<br />
hatte NHK, die Rundfunkanstalt, in letzter Zeit über<br />
Fälle von „Karoshi“ berichtet, zunächst über solche, die<br />
woanders spielten. Über den Fall einer Frau etwa, die bei<br />
einer Werbeagentur gearbeitet und jeden Monat ungefähr<br />
hundert Überstunden angesammelt hatte – und die schließlich<br />
aus ihrem Wohnheim in den Tod gesprungen war.<br />
Aus ihrem Fall entwickelte sich eine öffentliche Debatte<br />
über ein Land, das altert und schrumpft und deshalb seine<br />
Jungen verheizt. Es gibt in diesem Land nur wenige Krankschreibungen<br />
wegen Erschöpfung oder Erkältung. Es gibt<br />
Sado<br />
Aus dem „Berliner Kurier“<br />
Gesellschaft<br />
stattdessen pausenlos Werbung für Vitamin- und Aufputschdrinks,<br />
und es gibt einen Begriff, der beschreiben<br />
soll, warum es gut ist, solche Sachen zu kaufen: „Kenko<br />
Kanri“ heißt dieser Begriff, „die Gesundheit verwalten“.<br />
Erst als diese Debatte im Land war, war für NHK die Zeit<br />
gekommen, über ihren eigenen Fall zu berichten, über<br />
den Tod Miwa Sados. <strong>Der</strong> Beitrag lief in den 21-Uhr-Nachrichten<br />
und dauerte knapp zwei Minuten.<br />
In Japan gibt es ein Amt für Arbeitsnormen, das sich<br />
auch um die Einhaltung der Vorschriften kümmert. Auf<br />
Antrag von Miwa Sados Eltern nahmen die Beamten die<br />
Spur auf und fanden heraus, dass die junge Frau im Monat<br />
vor ihrem Tod 159 Überstunden angesammelt hatte. Am<br />
Sonntag, dem 7. Juli 2013, arbeitete sie beispielsweise von<br />
morgens um elf bis abends um acht. Am folgenden Montag<br />
dann wieder von morgens 9.51 Uhr bis zum Dienstagmorgen<br />
um 2.56 Uhr, und am selben Tag begann sie mor -<br />
gens um 10 Uhr und arbeitete danach 15 Stunden lang.<br />
Ihre Eltern haben andere Zahlen. Sie kommen für<br />
denselben Monat auf 209 Überstunden. Rechnet man die<br />
Regelarbeitszeit hinzu, so wäre dies ein 12-Stunden-Tag –<br />
ohne ein einziges freies Wochenende. Bei der Rekonstruktion<br />
studierten die Eltern Dienstpläne, aber auch Taxiquittungen<br />
sowie Chroniken<br />
ihres Computers und<br />
ihres Handys. Sie haben<br />
mit Managern des Senders<br />
gesprochen, und einer sagte,<br />
die Arbeit eines Reporters<br />
richte sich nach individuellem<br />
Ermessen, „wie<br />
bei einem Einzelunternehmer“.<br />
Es ist schwer zu sagen,<br />
was das bedeutet in<br />
einem Land, dessen Bürger<br />
schon im Kindergarten<br />
NHK<br />
lernen, dass man die<br />
Gruppe nicht enttäuschen<br />
darf.<br />
Miwas Vater erzählt<br />
Journalisten, dass er und<br />
seine Frau hundert Tage<br />
nach dem Tod der Tochter<br />
ein buddhistisches Ritual<br />
abgehalten hätten. Daran<br />
habe auch ein Kollege aus<br />
Sados ehemaligem Team<br />
teilgenommen. Als die Mutter sagte: „Miwa war das Ass un -<br />
serer Familie“, habe der Kollege geantwortet: „Wer stirbt,<br />
weil er keine Ausdauer besitzt und nicht fähig ist, sich die<br />
Zeit einzuteilen, ist kein Ass.“ Dann habe er der Mutter<br />
seinen überfüllten Terminkalender hingehalten.<br />
Die Mutter sitzt neben dem Vater, sie sagt lange nichts,<br />
immer wieder kommen ihr die Tränen. Nach dem Verlust<br />
der Tochter sei seine Frau in tiefe Depressionen gefallen<br />
und akut selbstmordgefährdet gewesen, sagt der Vater. Er<br />
bittet den Sender, Lehren aus dem Tod seiner Tochter zu<br />
ziehen, „das wünscht sie sich bestimmt auch im Himmel“.<br />
Am Ende sagt die Mutter noch ein paar Worte. Sie richtet<br />
sich an die Journalisten vor sich, ungefähr 20 sind gekommen,<br />
die meisten ungefähr so alt wie ihre Tochter,<br />
als sie starb. Die Mutter sagt: „Ihr seid wie meine Söhne<br />
und Töchter. Bitte überlegt euch gut, ob die Arbeit wirklich<br />
so wichtig ist.“<br />
Dann hört man nur noch das Klackern von Tastaturen.<br />
Wieland Wagner<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 53
Gesellschaft<br />
Franziskas Grab<br />
Täuschungen 24 Jahre lang versteckt ein Mann die Leiche seiner Frau in einem Fass.<br />
Dann gesteht er einen Totschlag, der aber längst verjährt ist. Die Geschichte eines ebenso<br />
bizarren wie perfekten Verbrechens. Von Maik Großekathöfer<br />
An die Polizei. In diesem Fass ist die<br />
Leiche meiner ehemaligen Frau<br />
Franziska Sander, geb 4.8.65.“<br />
So beginnt, in kalter Klarheit, der Brief,<br />
den Jens K.* auf das Fass gelegt hat, in<br />
dem er seit 24 Jahren seine tote Frau verwahrt.<br />
<strong>Der</strong> Verfasser spricht seinen Adressaten<br />
direkt an, die Polizei, er hat sie längst<br />
erwartet. Den Brief schrieb er vor mehr<br />
als zehn Jahren, mit Kugelschreiber auf<br />
kariertem Papier.<br />
Jens K. fährt fort: „Sie hat sich am<br />
10.2.1992 selbst das Leben genommen. Sie<br />
hat sich mit Paketband an einem Haken<br />
in unserer damaligen Wohnung erhängt.<br />
Ich habe sie trotz ihrer ständigen Depressionen<br />
sehr geliebt, habe den Wunsch verspürt<br />
ihr zu folgen.“<br />
<strong>Der</strong> Brief, drei gefaltete Seiten, steckt<br />
unter einem Stück Pappe, das K. auf das<br />
Fass geklebt hat, auf das Grab seiner<br />
Frau. Neben dem Schreiben stehen in großer<br />
Schrift die Worte „Faß enthält LEI-<br />
CHE“ auf der Pappe, darunter das Wort<br />
„Polizei“ und ein Pfeil, der zum Brief zeigt.<br />
<strong>Der</strong> schwarze Marker, den K. für diesen<br />
überdeutlichen Hinweis benutzt hat, liegt<br />
noch auf dem Fass, als die Ermittler alles<br />
finden.<br />
K. schreibt: „Nach einer Woche habe<br />
ich allen Mut zusammen genommen, sie<br />
in diesem Fass beerdigt, mein Leben neu<br />
begonnen. Ich habe Kinder, welche ich mit<br />
einer anderen Frau nach dem Tod gezeugt<br />
habe. Ich liebe diese über alles, sie sollen<br />
NIE den Eindruck bekommen müssen, ihr<br />
Vater sei ein Mörder, dieses ist nicht so!“<br />
Mit dem Fund der Leiche von Franziska<br />
Sander am 13. September des vergangenen<br />
Jahres in einer Stadt in Schleswig-Holstein<br />
findet nicht nur die 24 Jahre dauernde Ungewissheit<br />
ihrer Angehörigen ein Ende, ihres<br />
Bruders, ihrer drei Schwestern. Als die<br />
Beamten das Tor zur Garage öffnen, in<br />
der das Fass versteckt war, kommt auch<br />
einer der seltsamsten Fälle der jüngeren<br />
deutschen Kriminalgeschichte ans Licht.<br />
Die Ermittlungsakte umfasst 13 Bände,<br />
fast 1400 Seiten, die eine Geschichte er-<br />
* Namen geändert.<br />
54 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
zählen von Lügen, Eifersucht und Schweigen.<br />
Zum Vorschein kommt aber auch eine<br />
Reihe von Verfahrensmängeln, Verzögerungen<br />
und Fehleinschätzungen auf allen<br />
Seiten. Mehr aus Nachlässigkeit denn aus<br />
Raffinesse konnte aus dem Fall Franziska<br />
Sander die Geschichte eines perfekten Verbrechens<br />
werden, eines Verbrechens jedenfalls,<br />
das ohne Sühne bleibt.<br />
Denn Jens K., der Ex-Mann und mutmaßliche<br />
Täter, ist frei, er lebt mit seiner<br />
Familie in einem Haus an einer Pferdekoppel.<br />
Ein Mord ist ihm nicht nachzuweisen,<br />
ein Totschlag gilt als hochwahrscheinlich.<br />
Aber Totschlag verjährt nach 20 Jahren.<br />
Auszug aus dem Vernehmungsprotokoll<br />
von jenem 13. September 2016: Die Beamten<br />
fragen Jens K., was er gemacht habe,<br />
nachdem er seine Frau angeblich erhängt<br />
in der Wohnung fand.<br />
Jens K.: „Ich habe Franziska in einem<br />
Fass verpackt und das Fass zugeschweißt.<br />
Ich kann Ihnen zeigen, wo das Fass ist.“<br />
Polizist: „Wo ist das?“<br />
„Hier. Ich habe eine Garage angemietet.“<br />
„Ist das Fass immer mit umgezogen?“<br />
„Ja. Das sollte meine Versicherung sein,<br />
damit ich beweisen kann, dass ich ihr nichts<br />
getan habe. Ich habe noch nie jemanden<br />
geschlagen oder einem Gewalt angetan.“<br />
Als sie sich kennenlernen, 1982 in<br />
Hannover, ist Jens K. 18 und Franziska<br />
Sander 17 Jahre alt, eine Teenagerliebe.<br />
Sie ist vom Land hergezogen, besucht eine<br />
Fachoberschule für Gestaltung, wohnt in<br />
einem katholischen Mädchenwohnheim.<br />
Er schließt eine Lehre zum Außenhandelskaufmann<br />
ab, später lässt er sich zum<br />
Erzieher ausbilden. 1985 verloben sie sich<br />
und ziehen zusammen, zwei Zimmer, Küche,<br />
Bad. Drei Jahre später heiraten sie.<br />
Ein vergilbtes Hochzeitsfoto, das bei den<br />
Akten liegt, zeigt eine hübsche, junge Frau<br />
mit Fransenschnitt, Pausbacken, weißer<br />
Rüschenbluse und breitem Lächeln; neben<br />
ihr, ebenso glücklich lächelnd, ein junger<br />
Mann mit Vokuhila, Schulterpolsterjackett<br />
und dünnem Schlips. Er ist jetzt 24, sie 23<br />
Jahre alt, ein unauffälliges, kleinbürger -<br />
liches Ehepaar irgendwo in Deutschland<br />
mit unbekannten Träumen.<br />
13. September 2016. Noch am Tag der<br />
Vernehmung gehen die Kriminalbeamten<br />
gemeinsam mit Jens K. zum Garagenhof,<br />
wo er die Leiche deponiert haben will, und<br />
öffnen das Tor Nummer elf.<br />
Sie sehen ein großes Durcheinander,<br />
eine Schubkarre, einen Autositz, eine<br />
Schleifmaschine. In der hinteren rechten<br />
Ecke, verborgen hinter drei Autoreifen, unter<br />
Tüten, Teppichresten, Müll und blauer<br />
Plane, steht eine Sackkarre. Darauf, festgebunden<br />
mit zwei Spanngurten: das Fass.<br />
Am nächsten Morgen lässt der Rechtsmediziner<br />
in Hannover das Fass vermessen<br />
und wiegen. 87,5 Zentimeter hoch, 60 Zentimeter<br />
Durchmesser, 134 Kilogramm.<br />
Zwei Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen<br />
öffnen es mit einer elektrischen Blechschere.<br />
Das Fass ist bis zum Rand mit Katzenstreu<br />
gefüllt. K. sagt später, er habe damit<br />
verhindern wollen, „dass der Körper<br />
sich in dem Fass frei bewegt“.<br />
Katzenstreu bindet Flüssigkeit und neutralisiert<br />
Gerüche.<br />
Als die Mediziner das Substrat mit einem<br />
Kehrblech nach und nach entfernen, kommen<br />
etliche Gegenstände zum Vorschein,<br />
die Jens K. seiner Frau offenbar als Grabbeigaben<br />
zugedacht hatte, Dinge, die eine<br />
Rolle gespielt haben müssen in ihrem gemeinsamen<br />
Leben: ein Kuscheltier, ein vertrockneter<br />
Blumenstrauß, ein gestreiftes<br />
Kopfkissen. Eine Kette mit einem Anhänger<br />
in Form eines Mondes. Ein roter Bilderrahmen<br />
mit einem Hochzeitsfoto. Eine<br />
Zimtstange, Gerstenähren, zwei lilafarbene<br />
Stiefeletten. Ein Kinderbuch mit dem Titel<br />
„Bigu, das kleine Igelchen mit den Locken“.<br />
Was die Forensiker zu Gesicht bekommen,<br />
erinnert an ein Indianergrab.<br />
Schließlich finden sie, verpackt in einem<br />
Müllsack, die zusammengeschnürte Leiche<br />
der Franziska Sander.<br />
Man weiß nicht viel darüber, was für<br />
eine Beziehung die Eheleute in den frühen<br />
Neunzigern geführt haben. Die Angaben<br />
darüber sind widersprüchlich, sie stammen<br />
einerseits von Jens K. und andererseits<br />
von Franziskas Bruder Hubertus Sander.<br />
Jens K. sagt, seine Frau habe nie selbst<br />
arbeiten und „keinen Kontakt zu ihrer
Fass in der Rechtsmedizin in Hannover, späteres Opfer Sander um 1985<br />
CHRISTIAN ASLUND / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 55
Gesellschaft<br />
56 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Familie“ haben wollen. Ihr Bruder sagt,<br />
bevor seine Schwester Jens K. kennenlernte,<br />
sei sie „lebensfroh“ und „kontaktfreudig“<br />
gewesen. K. sagt, seine Frau sei unzufrieden<br />
gewesen, weil er „ihre Lebensansprüche“<br />
nicht habe erfüllen können, sie<br />
habe mehrfach versucht, sich umzubringen,<br />
habe oft „Wutausbrüche“ gehabt. Ihr<br />
Bruder sagt, niemand aus der Familie habe<br />
Franziska je wütend erlebt, sie sei K. „hörig“<br />
gewesen. K. habe sie sozial isoliert,<br />
bis sie das Haus nicht mehr allein verlassen<br />
durfte, er habe sie in der Wohnung eingeschlossen,<br />
das Telefon ausgestöpselt und<br />
mitgenommen. Jens K. sagt, Franziska und<br />
er, das sei „die große Liebe“ gewesen.<br />
Aus dem Obduktionsbericht und anderen<br />
Dokumenten: „<strong>Der</strong> Leichnam ist komplett<br />
konserviert und wirkt mumifiziert.<br />
Eine Untersuchung des Kehlkopfes und des<br />
Zungenbeines lässt keine konkreten Ergebnisse<br />
bzgl. eines Knochenbruches zu … Bei<br />
hochgradiger Mumifizierung/Fäulnis pathologisch<br />
und anatomisch keine Hinweise auf<br />
eine Todesursache … Das noch im Fass befindliche<br />
Katzenstreu und das Fass wurden<br />
umweltgerecht entsorgt.“<br />
Zu diesem Zeitpunkt wissen die Ermittler<br />
nur, dass Franziska Sander seit 24 Jahren<br />
und sieben Monaten tot ist. Wie sie<br />
ums Leben kam, bleibt unklar. Es gibt keine<br />
Befunde, die die Geschichte des Jens<br />
K. bestätigen, und keine, die sie widerlegen.<br />
Vom November 1991 datiert das letzte<br />
Telefongespräch der Franziska Sander mit<br />
einer ihrer Angehörigen. Sie erzählt ihrer<br />
Schwester, dass sie beabsichtige, mit ihrem<br />
Mann nach Norwegen auszuwandern. Nun<br />
beginnt auch das lange Lügen des Jens K.<br />
Ein halbes Dutzend verschiedene Versionen<br />
vom Verschwinden oder Ableben<br />
seiner Frau wird er in den folgenden Jahren<br />
erzählen. Seinem besten Freund erklärt<br />
Jens K. damals, seine Frau sei an<br />
Krebs erkrankt und liege in Hamburg in<br />
einer Spezialklinik. Ein paar Wochen später<br />
sagt er, sie sei gestorben und anonym<br />
bestattet worden. Die Angehörigen lässt<br />
er glauben, Franziska suche in Norwegen<br />
ein Haus, für ihre gemeinsame Zukunft.<br />
Dann, im Herbst 1992, als seine Frau bereits<br />
seit Monaten tot ist, sagt er der<br />
Schwester und dem Bruder, Franziska<br />
habe ihn verlassen, weil der Umzug nach<br />
Norwegen nicht geklappt habe. Er wisse<br />
nicht, wo sie sei.<br />
Polizist: „Ist es Ihnen tatsächlich gelungen,<br />
diese Sache die ganzen Jahre für sich<br />
zu behalten?“<br />
Jens K.: (Kopfnicken)<br />
<strong>Der</strong> Bruder von Franziska Sander wendet<br />
sich im November 1992 an die Polizei.<br />
Er will eine Vermisstenanzeige aufgeben,<br />
was jedoch misslingt. <strong>Der</strong> Beamte habe ihn<br />
wieder fortgeschickt, weil „keine Hinweise<br />
auf ein Verbrechen“ vorlägen. Franziska<br />
Sander sei volljährig, so habe man dem Bruder<br />
erklärt, sie könne „tun und lassen, was<br />
sie wolle“, wenn überhaupt, sei es „Sache<br />
des Ehemannes“, sie als vermisst zu melden.<br />
Das tut Jens K. natürlich nicht. Nicht<br />
1992, nicht in den folgenden Jahren, nie.<br />
Keine Vermisstenanzeige – keine Fahndung.<br />
Kein Verdacht auf ein Verbrechen –<br />
keine Ermittlung. Franziska Sander verschwindet<br />
so spurlos, wie sie gelebt hat.<br />
Damit die Geschwister weiter davon ausgehen,<br />
sie sei noch am Leben, legt Jens K.<br />
im Februar 1993 eine krude falsche Fährte.<br />
Er fährt nach Hamburg und wirft eine Postkarte<br />
ein, die er mit Schreibmaschine an<br />
sich selbst adressiert hat. Absender: „F.“<br />
Auf der Karte steht einzig die Nummer einer<br />
anrufbaren Telefonzelle. Jens K. leitet<br />
die Karte später an Franziskas Geschwister<br />
weiter – als Beweis, dass sie noch lebt.<br />
Polizist: „Möchten Sie einen Rechtsanwalt?“<br />
Jens K.: „Dann muss mir einer bestellt<br />
werden. Ich habe dazu derzeit nicht die finanziellen<br />
Möglichkeiten.“<br />
Am 20. August 1994 wird in der Bothfelder<br />
Heide in Hannover eine unbekannte<br />
Frauenleiche gefunden, zerstückelt. Hubertus<br />
Sander, Franziskas Bruder, damals<br />
47 Jahre alt, als Forstdirektor wohnhaft in<br />
Berlin, richtet sich an die zuständige Mordkommission:<br />
Seit zwei Jahren vermisse er<br />
seine Schwester, Franziska Sander, er befürchte,<br />
sie sei die Tote. Er habe „die Vermutung,<br />
ihr wurde etwas angetan“.<br />
Aus diesem Anlass kommt es am 1. September<br />
1994 erstmals zu einer Vernehmung<br />
des Jens K., wobei man ihn nicht<br />
als Verdächtigten befragt, sondern als Zeugen.<br />
Und er erzählt weiter widersprüch -<br />
liche Geschichten, Lügen.<br />
Sagt, seine Frau habe „immer höhere<br />
Ansprüche“ gestellt. Sagt: „<strong>Der</strong> Streit war<br />
so massiv, dass Franziska am 10. Februar<br />
1992 unsere Wohnung verlassen hat.“ Er<br />
erwähnt die Postkarte, die sie ihm später<br />
aus Hamburg geschickt habe, sie hätten<br />
sich daraufhin verabredet, Franziska habe<br />
bei dem Treffen „sehr gepflegt“ ausgesehen.<br />
Er sagt, er selbst wolle bald eine Vermisstenanzeige<br />
aufgeben, sollte Franziska<br />
nicht in eine Scheidung einwilligen.<br />
Nichts davon stimmt.<br />
Die Polizei unternimmt auch jetzt nicht<br />
mehr als nötig. Sie überprüft nicht, ob K.<br />
die Anzeige wirklich aufgibt, ob er sich<br />
tatsächlich scheiden lässt. Sie ignoriert,<br />
dass keine Adresse von Franziska Sander<br />
festzustellen ist. Als klar wird, dass die unbekannte<br />
Tote in der Heide „aufgrund des<br />
abweichenden Zahnstatus“ nicht Franziska<br />
Sander sein kann, wird Spurenakte 13<br />
am 1. November 1994 geschlossen.<br />
Unbegreiflich ist, wie sich in dieser Geschichte<br />
nun die Zeit zu strecken und zu<br />
dehnen beginnt. Aus Tagen der Untätigkeit<br />
werden Wochen, aus Wochen ohne<br />
Nachrichten Monate, aus Monaten des Vergessens<br />
werden Jahre. Ab und zu erkundigen<br />
sich die Geschwister beim Einwohnermeldeamt,<br />
ob ihre Schwester vielleicht<br />
eine neue Anschrift habe, denn in Hannover<br />
ist inzwischen die „Abmeldung von<br />
Amts wegen“ erfolgt, für die deutsche Bürokratie<br />
gilt sie damit als obdachlos. Franziska<br />
Sander wird zum Geist.<br />
Und Jens K.? <strong>Der</strong> hat schnell ein neues<br />
Leben begonnen. Neun Monate nach Franziskas<br />
Tod hat er eine andere Frau kennengelernt,<br />
M.*, die aus einer früheren Beziehung<br />
eine kleine Tochter hat. Das Fass<br />
bringt er zunächst im eigenen Keller unter,<br />
später in einer Garage in der Nähe des<br />
Hauptbahnhofs in Hannover. Auch seine<br />
neue Freundin belügt er, erzählt ihr, er<br />
habe an Franziskas Bett gestanden, als sie<br />
an Krebs gestorben sei. M. gibt später zu<br />
Protokoll: „Als wir über ihren Tod gesprochen<br />
haben, hat er geweint.“<br />
Die Jahre vergehen, gute Jahre für Jens<br />
K., er zeugt zwei Kinder mit M. und sieht<br />
der Stieftochter beim Aufwachsen zu. 2002<br />
zieht die Familie um nach Schleswig-Holstein.<br />
Das blaue Fass mit der Leiche seiner<br />
Frau holt er ein Jahr später aus Hannover<br />
nach, im Kofferraum eines Kombis, er verstaut<br />
es in der Garage mit der Nummer elf.<br />
Jens K. kümmert sich um den Haushalt<br />
und die Kinder, fährt Taxi, versucht sich<br />
als Vertreter für Handpuppen und Alarmanlagen.<br />
Die Polizei ruft nicht an, die Geschwister<br />
seiner toten Frau auch nicht<br />
mehr, niemand stört ihn.<br />
Hubertus Sander, der Bruder, ist heute<br />
70 Jahre alt, er lebt in Schweden, in einem<br />
roten Holzhaus. Er sitzt in seinem Wohnzimmer,<br />
er zeigt Fotos seiner Schwester:<br />
Franziska beim Zelten, beim Rodeln, mit<br />
Gitarre. Er sagt: „Wenn die Polizei ihre Arbeit<br />
gemacht hätte, wäre er nicht einfach<br />
davongekommen.“ Und ohne ihn, den Bruder,<br />
wäre Franziska Sander wohl für immer<br />
verschwunden geblieben.<br />
Denn im Herbst 2012, als seine Schwester<br />
schon seit 20 Jahren tot ist, unternimmt<br />
Hubertus Sander einen „letzten Versuch,<br />
sie zu finden“. Neue Gesetze kommen ihm<br />
dabei zu Hilfe und ein Kriminalhauptkommissar,<br />
den Hubertus Sander zufällig kennengelernt<br />
hat. Dessen Ermittlungsergebnisse<br />
liegen der Vermisstenanzeige bei, die<br />
am 8. Januar 2013 eingeht.<br />
Die Anzeige wird weitergeleitet an den<br />
Zentralen Kriminaldienst Hannover, die<br />
Beamten schreiben Franziska Sander zur<br />
Fahndung aus, „Zweck der Ausschreibung:<br />
Aufenthaltsermittlung“. Zwischen dem<br />
Eingang der Vermisstenanzeige und der<br />
Vorladung Jens K.s vergehen drei Jahre,<br />
was nicht überrascht in dieser Geschichte.<br />
K., der zu dieser Zeit als Erzieher mit<br />
Flüchtlingskindern arbeitet, antwortet in<br />
einer E-Mail: „Ich war von dem Schreiben<br />
etwas überrascht, da der Fortgang meiner<br />
Frau nun 23 Jahre her ist und ich nie wie-
Niemand kann ihn widerlegen, nur er selbst.<br />
Deswegen ist er frei. So funktioniert das Gesetz.<br />
Fundort des Fasses, Kinderbuch im Fass, Vorbereitung der Obduktion der Leiche<br />
der etwas gehört habe. Gibt es Hinweise<br />
auf ihren Verbleib? Weiterhin stellt sich<br />
die Frage, wie und in welchem Umfang<br />
ich Ihnen helfen kann? Mit freundlichen<br />
Grüßen, Jens K., 19.01.2016“.<br />
Am 11. März 2016 kommt es zur zweiten<br />
Vernehmung, 22 Jahre nach der ersten, in<br />
seinem Wohnort in Schleswig-Holstein, sie<br />
dauert fast vier Stunden.<br />
<strong>Der</strong> Polizist vermerkt im Protokoll:<br />
„Herr K. ringt um Fassung und fängt leicht<br />
an zu weinen. Er wünscht eine Tasse Kaffee<br />
zu trinken.“<br />
<strong>Der</strong> Beamte konfrontiert K. mit seiner<br />
Aussage von 1994, er habe eine Postkarte<br />
von Franziska bekommen, aus Hamburg.<br />
Und erhält eine überraschende Antwort.<br />
„Das können wir kurz machen. Die Karte<br />
habe ich selbst geschrieben. Zweck war<br />
eigentlich nur die Beruhigung der Familie.“<br />
Mit dem Geständnis, die Postkarte sei<br />
fingiert gewesen, belastet K. sich selbst.<br />
Macht er einen Fehler? Oder wähnt er sich<br />
in Sicherheit, weil er die Verjährungsfristen<br />
kennt?<br />
Die Staatsanwaltschaft Hannover eröffnet<br />
ein Ermittlungsverfahren, Verdacht auf<br />
Totschlag, § 212 StGB. Die Ermittler befragen<br />
nun, Sommer 2016, eine Reihe von<br />
Personen, die mit Jens K. zu tun hatten,<br />
sie reden mit Nachbarn an seiner ehe -<br />
maligen Wohnadresse in Hannover, mit<br />
früheren Freunden, mit den vier Geschwistern<br />
der Verschwundenen.<br />
13. September 2016, ein Dienstag: Das<br />
ist der Tag, an dem die Polizei schließlich<br />
K.s Haus durchsucht, der Tag, an dem sie<br />
das Fass findet. Nun wird K. in zwei Vernehmungen<br />
zwei weitere, unterschiedliche<br />
Spielarten der Wahrheit präsentieren.<br />
Polizist: „Wie war das mit Franziska?<br />
Was hat sie mit Ihnen gemacht? Oder ist<br />
sie einfach gegangen? Man kann auf unterschiedliche<br />
Weisen gehen.“<br />
Jens K.: „Ja, sie hat mich verlassen.“<br />
„Wie hat sie das gemacht?“<br />
„Das Letzte, was gesagt wurde, damit<br />
liegen Sie schon richtig.“<br />
„Wie meinen Sie das?“<br />
„Sie hat sich das Leben genommen.“<br />
K. schildert nun die Ereignisse jenes<br />
10. Februar 1992, dem letzten Tag im Leben<br />
der Franziska Sander. Er habe am<br />
Abend eine Betriebsfeier des Kindergartens<br />
besuchen wollen, in dem er arbeitete,<br />
aber seine Frau habe ihn nicht gehen lassen<br />
wollen, es sei zum Streit gekommen.<br />
Wenn er auf das Fest gehe, werde sie ihn<br />
verlassen oder sich das Leben nehmen,<br />
habe sie gesagt. Jens K. sagt, er habe diese<br />
Worte „nicht ernst“ genommen und sich<br />
auf den Weg gemacht. Als er zurück -<br />
gekommen sei, „hing sie in unserer Wohnung“,<br />
an einem Balken im Schlafzimmer,<br />
eine Schlinge aus Paketkordel um den<br />
Hals. In der Brust habe eine „Spritze mit<br />
Reinigungsbenzin“ gesteckt. „Was letztlich<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
57
Gesellschaft<br />
Hochzeitsfoto als Grabbeigabe im Fass<br />
tödlich war, weiß ich nicht.“ Er habe noch<br />
versucht, seine Frau wiederzubeleben,<br />
aber sie sei „schon ganz kalt“ gewesen.<br />
Version A, niedergeschrieben in jenem<br />
Brief an die Polizei, der auf dem Fass mit<br />
der Leiche lag, hieß: Suizid durch Erhängen.<br />
Von einer Giftspritze ist hier nicht die<br />
Rede, ebenso wenig von einem Wieder -<br />
belebungsversuch.<br />
Version B heißt nun: Suizid durch Erhängen<br />
plus Giftspritze, tot vorgefunden,<br />
Wiederbelebungsversuch.<br />
Rätselhaft ist, warum K. von seiner ursprünglichen<br />
Geschichte abweicht, die Unstimmigkeiten<br />
machen ihn unglaubwürdig.<br />
K. wird im Anschluss an das Verhör vorläufig<br />
festgenommen. Er darf ein T-Shirt,<br />
eine Unterhose, ein Paar Socken und zehn<br />
Euro einpacken. Es folgt die einzige Nacht,<br />
die er im Gefängnis verbringt, bis heute.<br />
Am nächsten Morgen, 14. September<br />
2016, während die Rechtsmediziner das<br />
Fass mit Franziska Sanders Leiche öffnen,<br />
wird K. erneut vernommen. Er hätte das<br />
Recht zu schweigen, wie er es schon so<br />
viele Jahre getan hat, aber er spricht. Jetzt<br />
sagt K. plötzlich, dass seine Frau noch gelebt<br />
habe, als er von der Betriebsfeier nach<br />
Hause gekommen sei. Sie habe im Türrahmen<br />
zum Schlafzimmer gestanden, nackt,<br />
mit einer Spritze in der Hand.<br />
Polizist: „Hat Franziska Sie angesprochen?“<br />
„Sie sagte: ,Das hast du jetzt davon.‘“<br />
Dann habe sie sich die Spritze unterhalb<br />
der linken Brust in den Oberkörper gestochen.<br />
Die Spritze, Fassungsvermögen zehn<br />
Milliliter, müsse seine Frau aus der Werkzeugkiste<br />
genommen haben. Auf der Anrichte<br />
habe ein Behälter mit Reinigungsbenzin<br />
gestanden. Franziska Sander, so<br />
sagt es K., habe noch ein paar Sekunden<br />
aufrecht gestanden, gesprochen habe sie<br />
nicht mehr. Sie habe die Augen verdreht,<br />
am ganzen Körper gezuckt, dann sei sie<br />
zu Boden gesackt.<br />
Bis hierhin beschreibt er einen Suizid.<br />
Eine Spritze mit Reinigungsbenzin, direkt<br />
ins Herz appliziert, kann in der Tat tödlich<br />
sein. Doch was er dem Beamten anschließend<br />
erzählt, verändert seine Rolle an jenem<br />
Abend und macht ihn zum Täter. Jens<br />
K. gibt zu, seine Frau getötet zu haben.<br />
Polizist: „Was haben Sie dann gemacht?“<br />
Jens K.: „Ich bin zu ihr gegangen und<br />
habe, weil ich dachte, dass sie das nicht<br />
unbeschadet überlebt, zugedrückt. Ich<br />
habe sie gewürgt, um das offensichtliche<br />
Leiden zu beenden. Ich habe so lange zugedrückt,<br />
bis sie sich nicht mehr rührte.“<br />
Version C: lebend angetroffen, kein Erhängen,<br />
Giftspritze, dann Totschlag durch<br />
Erwürgen.<br />
Nur K. kann erklären, warum er sich zu<br />
diesem Zeitpunkt zur Tat bekennt. Weil er<br />
weiß, dass ihm keine Strafe droht? Oder<br />
doch, weil er endlich die Wahrheit erzählen<br />
will? Oder nähert er sich ihr stückweise an?<br />
Bevor der Beamte das Verhör beendet,<br />
erfährt er noch, wie K. nach dem Tod seiner<br />
Frau mit deren Leiche umging. Er habe sie<br />
ins Ehebett getragen, sich neben sie gelegt.<br />
Dann habe er sich entschlossen, mit seiner<br />
toten Frau an einen Strand in Dänemark<br />
zu fahren, um sie dort zu verbrennen – und<br />
sich selbst gleich mit, wie er behauptet. Er<br />
sei also mit einem gemieteten Wohnmobil<br />
samt der Leiche nach Henne Strand gefahren,<br />
an einen Ferienort an der Nordsee, er<br />
habe dort Brennholz gekauft und im Wagen<br />
verteilt. Dann aber verlässt ihn der Mut,<br />
und er entscheidet sich anders.<br />
Er fährt zurück nach Hannover, kauft<br />
das Fass. Auf dem Betriebshof seines Vaters,<br />
eines Busunternehmers, zwängt er<br />
die Leiche hinein, samt Grabbeigaben und<br />
Katzenstreu. Jens K. schweißt den Deckel<br />
fest. Franziska Sander verschwindet für<br />
24 Jahre.<br />
Polizist: „Haben wir wirklich jetzt alles<br />
geklärt?“<br />
Jens K.: „Von mir aus schon.“<br />
Am 14. September 2016 wird der Beschuldigte<br />
K. um 13.26 Uhr aus dem Polizeigewahrsam<br />
entlassen, „noch vor Vorführung<br />
vor den Richter“. Ein Totschlag<br />
ist verjährt. Die Zeit verschont ihn vor einer<br />
Gefängnisstrafe.<br />
Wie und warum starb Franziska Sander?<br />
Nur Jens K. kennt die Antwort. Wollte<br />
sie ihn verlassen, und hat K. deswegen beschlossen,<br />
sie zu töten? Vielleicht hat er<br />
ihr die Spritze selbst verabreicht, vielleicht<br />
hat er sie im Schlaf überrascht und erwürgt.<br />
Vielleicht war alles noch mal ganz anders.<br />
Vielleicht war es so, wie er sagt.<br />
Die Forensiker haben keine Einstich -<br />
stelle einer Spritze gefunden, was nach so<br />
langer Zeit aber nicht bedeuten muss, dass<br />
es keine gab. Sie können nach 24 Jahren<br />
auch kein Benzin im Körper nachweisen,<br />
Benzin ist ein flüchtiger Stoff. Ein Rechts -<br />
mediziner der Berliner Charité sagt, die<br />
Kombination aus Benzin und Katzenstreu<br />
sei „so ziemlich die Anleitung zur per fekten<br />
Leichenbeseitigung respektive Mord“.<br />
Hubertus Sander, der Bruder, sagt: „Jemandem,<br />
der so lange gelogen hat, darf<br />
man nicht glauben.“ Er hofft, dass sich<br />
noch Zeugen melden, die einen Mordverdacht<br />
erhärten. Mord verjährt nicht.<br />
<strong>Der</strong> Sprecher der Staatsanwaltschaft<br />
sagt, die Familie Sander habe sein Mit -<br />
gefühl, es sei in diesem Fall „einfach alles<br />
blöd gelaufen“. Natürlich sei es ein Fehler<br />
gewesen, den Hinweisen nicht früher nachgegangen<br />
zu sein.<br />
Niemand kann Jens K. widerlegen, nur<br />
er selbst. Deswegen ist er frei. So funktioniert<br />
das Gesetz. <strong>Der</strong> Staatsanwalt hat das<br />
Verfahren gegen Jens K. am 14. September<br />
2017 eingestellt.<br />
Nachdem die Geschwister im Oktober<br />
2016 die Überreste ihrer Schwester zurückerhalten<br />
haben, bestatten sie die Asche<br />
von Franziska Sander im Familiengrab auf<br />
dem Friedhof in Steinhude, bei ihrer Mutter<br />
und ihrem Vater.<br />
Franziska<br />
1965 – 1992<br />
Es steht kein Name am Briefkasten,<br />
kein Name an der Klingel des Hauses, in<br />
dem Jens K. als freier Mann wohnt.<br />
Drückt man die Klingel, öffnet sich nach<br />
einer Weile die Tür. Da steht ein schlaksiger<br />
Mann, 52 Jahre alt, rote Jogginghose,<br />
graue Haare, der Blick schläfrig, die Wangen<br />
jungenhaft rund. Als der Besucher<br />
sagt, er sei Journalist und wolle mit ihm<br />
über Franziska Sander reden, schließt Jens<br />
K. wortlos die Tür.<br />
58 DER SPIEGEL 43 / 2017
Kahler Krempling<br />
Leitkultur Alexander Osang über seine<br />
kleine deutsche Heimat<br />
Gesammelte Pilze<br />
Vielleicht liegt es am Alter, aber ich mag den deutschen<br />
Herbst. In meiner Jugend kannte ich eigentlich<br />
nur zwei akzeptable Jahreszeiten: Sommer<br />
und Winter. Jetzt, da es langsam dunkel wird, entdecke<br />
ich die Grautöne. Zum ersten Mal bemerkte ich das vor<br />
gut zehn Jahren, in Amerika. Ich war mit einem Miet -<br />
wagen auf dem Weg von Cincinnati, wo ich einen Wahlkampfauftritt<br />
von Dick Cheney beobachtet hatte, nach<br />
Pittsburgh, wo die Dixie Chicks ein Konzert gegen George<br />
W. Bush spielten. Es war Ende September. Hinter der<br />
Grenze zu Pennsylvania, wo die Landschaft hügelig,<br />
herbstlich und deutsch ist, fuhr ich auf einen Parkplatz<br />
und rannte wie ein Mondsüchtiger in einen bunten Laubwald.<br />
Bestimmt war auch Dick<br />
Cheney schuld. Ich hüpfte zwischen<br />
den Bäumen umher und<br />
fühlte mich zu Hause. Heimatlich.<br />
Ich war kurz davor, einen Baum<br />
zu umarmen, weil er mir wie ein<br />
Landsmann vorkam.<br />
So geht es den Grünen zurzeit.<br />
Sie versuchen, das Wort Heimat<br />
in ihre politischen Konzepte zu integrieren,<br />
auch um es der AfD wegzunehmen.<br />
Die Reaktionen auf diese<br />
Versuche klingen, als wollte Katrin<br />
Göring-Eckardt Deutschland<br />
in den Grenzen von 1937 zurück.<br />
Ich las ein Interview mit einer<br />
Psychologin, in dem der deutsche<br />
Heimatbegriff auseinandergenommen<br />
wurde. Die Franzosen, lernte<br />
ich, verbinden Heimat vor allem<br />
mit Bürgersinn, wir Deutschen mit<br />
Gebiet. Bei mir läuft, sobald ich<br />
das Wort Heimat höre, ein Lied im Kopf ab, das ich als<br />
Junge gesungen habe. Es fängt so an: „Uns’re Heimat, das<br />
sind nicht nur die Städte und Dörfer, uns’re Heimat sind<br />
auch all die Bäume im Wald.“ Es gibt, je länger das Lied<br />
geht, immer mehr Heimat – Fische, Vögel, das Korn auf<br />
dem Feld –, und am Ende wird der Deckel draufgemacht:<br />
„Wir schützen sie, weil sie dem Volke gehört.“ Auch die<br />
deutschen Kommunisten waren da sehr deutsch. Zusammen<br />
mit dem Volksmusikfernsehen, dem Einheitsfeuerwerk und<br />
dem ständigen Zwang, die nächste deutsche Hymne mitsingen<br />
zu müssen, führte das irgendwann dazu, dass meine<br />
Heimat immer kleiner wurde, bis ich mich im Death Valley<br />
mehr zu Hause fühlte als in Berlin-Mitte.<br />
Wie Jürgen Trittin muss ich noch mal ganz von vorn<br />
anfangen. Klein. Nicht gleich mit dem Wald, nicht mal<br />
mit dem Baum. Vielleicht mit dem Pilz.<br />
In meiner Kindheit war ich oft Pilze sammeln. Es ging<br />
eher ums Sammeln als ums Essen. Als Kind habe ich Pilzgerichte<br />
gehasst, sie sahen matschig aus und schmeckten<br />
auch so. Aber das Sammeln machte Spaß. Als Jugend -<br />
licher verlor ich den Waldpilz aus den Augen, dann fiel<br />
die Mauer, und man musste nichts mehr sammeln, man<br />
konnte alles kaufen. Auch Pilze. In einem Sommerhaus<br />
in den Hamptons entdeckte ich 2005 hinter Büchern zwei<br />
Gefrierbeutel mit Psychopilzen. Das war für etwa 20 Jahre<br />
mein einziger Pilzfund. Aber die Sammelgene waren angelegt,<br />
und jetzt, da ich ein Wochenendgrundstück in<br />
Brandenburg besitze, bricht sich die Natur Bahn.<br />
Ich kenne inzwischen Steinpilzstellen, über die ich mit<br />
niemandem rede. Ich unterteile Freunde in Sammler und<br />
Nichtsammler. Ich spüre eine Pilzsammlergrenze. Ich weiß<br />
nicht genau, wo sie verläuft, aber ich habe einen Verdacht.<br />
Neulich besuchte uns ein Paar in Brandenburg, er<br />
stammt aus dem Südwesten Deutschlands, sie aus dem<br />
Nordosten. Er sah nur den mythischen Wald, sie die Pfifferlinge.<br />
Ich habe bei einem Abendessen neben einer<br />
Münchner Schauspielerin gesessen, der beim Thema Pilze<br />
nur die Spätfolgen von Tschernobyl einfielen. Irgendwann<br />
kam sie von den Pilzen zu den Wildschweinen, die die<br />
Pilze äßen und nun ebenfalls ungenießbar seien. Da schaltete<br />
ich ab. Kürzlich war ein Berliner Koch hier draußen,<br />
der aus Frankfurt an der Oder stammt. Er betrat unseren<br />
Wald wie sein Wohnzimmer. Er schneidet Pilze an, um zu<br />
sehen, welche Farbe ihr Saft hat. Danach entscheidet er,<br />
ob man sie essen kann. Er ist ein<br />
Pilzschamane. Frankfurt (Oder)<br />
liegt im Osten, es ist praktisch<br />
Polen. In unserem Berliner Mietshaus<br />
wohnt ein älteres Ehepaar,<br />
das sich im Sommer leicht vergiftete,<br />
weil es Wein zu Tintlingen<br />
trank, Pilzen, die eher aussehen<br />
wie Fabelwesen. Beide stammen<br />
aus dem Baltikum. Am Wochenende<br />
erzählte mir ein Bekannter,<br />
dass er schöne Hallimasche gefunden<br />
habe. <strong>Der</strong> Mann ist Physiker,<br />
kommt aus dem nordöstlichen<br />
Brandenburg, hat eine russische<br />
Frau und besitzt heute eine tausendköpfige<br />
Rinderherde in der<br />
Nähe von Kaliningrad. In meinem<br />
kleinen Pilzbuch fand ich zum<br />
Hallimasch: roh giftig, zerstört<br />
Holz, schmeckt gekocht wie essigsaure<br />
Tonerde.<br />
Je weiter man nach Osten kommt, desto hemmungsloser<br />
wird die Liebe zum Pilz. <strong>Der</strong> Kahle Krempling ist gegart<br />
wohlschmeckend, kann aber noch Jahre nach seinem<br />
Genuss zu tödlichen Vergiftungen führen, so steht es in<br />
meinem DDR-Pilzführer. Mehr muss man über den wilden<br />
Osten nicht wissen. Kahler Krempling klingt fast wie ein<br />
westdeutsches Synonym für den Ostmann. Leute, die so<br />
was gegessen haben, wählen nicht zwangsläufig Volks -<br />
parteien.<br />
Mein neuer brandenburgischer Grundstücksnachbar<br />
stammt aus Illinois, wo der ehemalige Präsident Barack<br />
Obama seine politische Laufbahn begonnen hat. Auf seinem<br />
Grundstück wachsen die schönsten Steinpilze, die<br />
man sich vorstellen kann. Er will sie nicht. Er ist ein Mann<br />
aus dem Westen. Es wäre für ihn, als würde er Moos essen.<br />
Oder Erde. Nimm du sie, sagt er. Ich suche jetzt auf amerikanischem<br />
Boden in Ostdeutschland nach Steinpilzen.<br />
Näher war ich noch nie dran an meiner Heimat.<br />
ALEXANDER OSANG / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 59
ANZEIGE<br />
Stephan, Volker und Werner Knipser<br />
Keine Kompromisse<br />
Ob Premium-Riesling, Champagner oder französischer Spitzenrotwein<br />
– die Favoriten unserer Experten bieten höchsten Genuss<br />
Jeden Monat verkosten die VICAMPO-<br />
Weinexperten mehr als 1000 Weine,<br />
um Ihnen diejenigen mit dem besten<br />
Preis-Genuss-Verhältnis vorstellen zu<br />
können. In diesem Monat führt eines der<br />
besten fünf heimischen Weingüter die<br />
Favoritenliste an: Mit Maximalbewertungen<br />
in allen deutschen Weinführern<br />
gehört das VDP-Gut Knipser zur Weltspitze.<br />
Fünf Feinschmecker-„F“, fünf<br />
Gault&Millau-Trauben und fünf Eichelmann-Sterne<br />
zieren den renommierten<br />
Familienbetrieb aus der Pfalz. Mit seinen<br />
edlen Gewächsen setzt Knipser Jahr für<br />
Jahr Maßstäbe für deutschen Wein. Für<br />
Weinhändler ist es deshalb nicht leicht,<br />
Kontingente der begehrten Tropfen zu<br />
erhalten. Wir freuen uns daher ganz be sonders,<br />
dass wir Ihnen mit dem ‚Riesling 16‘<br />
ein Aushängeschild dieses Spitzenwein guts<br />
anbieten können.<br />
Daneben hat es eine exklusive Auswahl<br />
französischer Spitzenrotweine auf<br />
die monatliche Bestenliste geschafft. Mit<br />
mindestens 90 Punkten von Starkritiker<br />
Robert Parker tragen sie das Prädikat „hervorragend“<br />
und zählen damit zu Frankreichs<br />
Spitze. Nicht zuletzt repräsentiert<br />
der Champagner ‚Brut Silver Royal‘ französische<br />
Schaumwein-Kunst aufs Schönste.<br />
In einer Blindverkostung setzte er sich<br />
gegen 21 teilweise doppelt so teure Konkurrenten<br />
durch.<br />
Das Beste ist: Dank Kennenlernkontingenten<br />
der Winzer können wir alle Weine<br />
zum stark reduzierten Vorteilspreis anbieten.<br />
Mit der kompromisslosen VICAMPO-<br />
Genuss-Garantie testen Sie zudem völlig<br />
risikofrei: Sollte Ihnen ein Tropfen nicht<br />
schmecken, erhalten Sie den Kaufpreis<br />
zurück. Bestellen Sie jetzt solange der Vorrat<br />
reicht!<br />
PFALZ-RIESLING AUF HÖCHSTEM NIVEAU<br />
KNIPSER<br />
5LHVOLQJWURFNHQ<br />
Dieser Riesling liefert den flüssigen Beweis für das Weltklasse-Niveau<br />
der Knipser-Weine: Im Duft verführen Noten<br />
von Aprikosen, Zitrusfrüchten und Kräutern, am Gaumen<br />
begeistert der Wein mit saftiger Pfirsich- und Apfelfrucht,<br />
feiner Mineralität, animierender Frische und festem Abgang.<br />
Bestellen Sie jetzt sechs Flaschen und erleben Sie Riesling-<br />
Vergnügen auf höchstem Niveau!<br />
Pfalz<br />
Alkoholwert: 12 % vol<br />
Bestellnr.: SP-40253<br />
pro Karton<br />
6 x 0,75 l 49 90 €<br />
11,09 €/l<br />
GOLDGELBE PERLE<br />
Champagne Pommery<br />
Brut Silver Royal<br />
<strong>Der</strong> ‚Brut Silver Royal‘ hat sich in der Verkostung<br />
von 21 Champagnern souverän gegen<br />
deutlich teurere Gewächse durchgesetzt.<br />
Auch der Falstaff schwärmt mit 91 Punkten:<br />
„elegant, geradlinig und frisch, sehr feines<br />
Mousseux.“ Aus zwölf Grand-Cru-Lagen<br />
stammen die Trauben für diese Cuvée, die vier<br />
Jahre in den einzigartigen Pommery-Kreidekellern<br />
reifte. So muss Champagner sein!<br />
Champagne<br />
Preis/0,75 l: 24,90 € statt 37,90 € UVP<br />
Preis/Karton: 6 Flaschen für 149,40 €<br />
Preis/Liter: 33,20 €, 12,5 % vol<br />
Bestellnr.: SP-41526<br />
Alle Preise inkl. MwSt., Versand 4,90 €, ab 12 Flaschen<br />
versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Alle Weine<br />
enthalten Sulfite. Nur solange der Vorrat reicht. Abgabe<br />
von Alkohol erfolgt nur an Personen ab 16 Jahren.
ANZEIGE<br />
Südfrankreichs<br />
Winzer-Ikone<br />
Michel Chapoutier<br />
94<br />
DOMAINE GUISSET<br />
Côtes du Roussillon<br />
2015<br />
Unser Frankreich-Experte konnte<br />
sein Glück kaum fassen: Solch eine<br />
Qualität zu diesem günstigen Preis!<br />
„Stattlich, reichhaltig, vielschichtig<br />
und wunderschön ausgewogen“,<br />
schwärmt auch Parker und adelt die<br />
grandiose Syrah-Grenache-Cuvée<br />
mit 94 Punkten.<br />
94<br />
DOMAINE LAFAGE<br />
%DVWLGH0LUDpRUV%ODFN6ODWH<br />
2015<br />
„Fast zu gut, um wahr zu sein“, jubelt<br />
Starkritiker Parker und ehrt den<br />
‚Bastide Miraflors‘ mit 94 Punkten:<br />
reife Beeren, harmonisches Tannin<br />
und ein perfekt balancierter Abgang.<br />
Eine beeindruckende Grenache-<br />
Syrah-Cuvée von Südfrankreichs<br />
Kultwinzer Jean-Marc Lafage!<br />
Sie sparen 40 %<br />
pro Karton<br />
6 x 0,75 l<br />
49 90 €<br />
11,09 €/l<br />
83,40 € UVP<br />
Bestellnr.:<br />
SP-45632<br />
93<br />
DOMAINE DE L’ALBA<br />
Corbières<br />
2015<br />
„Ein weiteres großartiges Beispiel<br />
dafür, wie gut der Jahrgang 2015 in<br />
Südfrankreich war“, jubelt Robert<br />
Parker und gibt der „Schönheit“ fantastische<br />
93 Punkte. Eine elegante<br />
Liaison aus dunklen Fruchttönen,<br />
harmonischem Tannin und kühler<br />
Mineralität!<br />
93<br />
MAISON VENTENAC<br />
Les Terroirs Cachés Cabardès<br />
Reserve 2015<br />
Perfektes Zusammenspiel von Frucht,<br />
Kraft, Balance und Länge – diese<br />
hochwertige Reserve zieren verdiente<br />
93 Parker-Punkte: „Hier kommt das<br />
Beste des Südens mit dem Besten aus<br />
Bordeaux zusammen.“ Winzer Olivier<br />
Ramé macht seinem hervorragendem<br />
Ruf alle Ehre!<br />
PARKER-PRÄMIERTE<br />
ROTWEIN-FAVORITEN<br />
Frankreich: Die ‚Grande Nation‘ steht<br />
auf Platz zwei der Weinproduzenten<br />
weltweit. Angesichts des großen<br />
Angebots können Bewertungen von Weinkritikern<br />
eine gute erste Orientierungshilfe<br />
beim Weinkauf bilden. <strong>Der</strong> US-Amerikaner<br />
Robert Parker ist dabei international<br />
besonders angesehen und ist speziell<br />
in Frankreich dafür bekannt, außergewöhnliche<br />
Tropfen mit hohem Potenzial<br />
aufzuspüren. Erst ab 90 Punkten gilt das<br />
Prädikat „hervorragend – Spitzenwein“.<br />
Aus über 200 französischen Rotweinen<br />
mit mindestens 90 Parker-Punkten haben<br />
die VICAMPO-Experten ihre Preis-Genuss-Favoriten<br />
gekürt. Das ist höchster<br />
Genuss zum Kennenlernpreis!<br />
92<br />
M. CHAPOUTIER<br />
Mathilde Grenache Syrah<br />
2016<br />
Spitzenwinzer Michel Chapoutier<br />
gelingt mit dem ‚Mathilde‘ sein<br />
nächster Geniestreich. „Schmeckt,<br />
als würde er dreimal so viel kosten“,<br />
staunt Robert Parker. Saftige Beeren<br />
und geschliffenes Tannin: Die edle<br />
Grenache-Syrah-Cuvée erntet<br />
verdiente 92 Punkte!<br />
90<br />
XAVIER<br />
Côtes du Rhône XI<br />
2015<br />
Südfrankreichs Winzer-Legende<br />
Xavier Vignon hat sich mit dieser<br />
Premium-Cuvée selbst übertroffen:<br />
kraftvoll und fruchtbetont, mit<br />
charaktervoller Würze und harmonischem<br />
Tannin. „Wunderschöne<br />
Reichhaltigkeit und Tiefe“, schwärmt<br />
Robert Parker – 90 Punkte!<br />
WEINverliebt!<br />
VICAMPO bietet mehr als 17.000 ausgewählte<br />
Weine von rund 2.500 Winzern – Spitzenweingütern<br />
wie ambitionierten Newcomern.<br />
DIE NR. 1 BEI WEINLIEBHABERN<br />
Über 20.000 zufriedene Kunden haben uns bereits<br />
auf der Plattform Trusted Shops mit maximalen fünf<br />
Sternen bewertet. Damit ist VICAMPO der Online-<br />
Weinshop mit den meisten<br />
„Sehr gut“-Auszeichnungen<br />
in Deutschland!<br />
Versandkostenfrei<br />
Ab 12 Flaschen,<br />
darunter nur 4,90 €<br />
IHR WEIN-MARKTPLATZ<br />
Genuss-Garantie<br />
Bei Nichtgefallen erstatten<br />
wir Ihnen den Betrag<br />
Einfache Zahlung<br />
Auf Rechnung oder mit<br />
Kreditkarte<br />
Bestellen<br />
Sie bequem unter<br />
vicampo.de/<br />
spiegel<br />
oder unter<br />
06131-30 29 397<br />
ANBIETER: Vicampo.de GmbH, Taunusstraße 57, 55118 Mainz • ABFÜLLER: SP-38453 SAV les Vignerons des Albères, 66740Saint-Genies-des-Fontaines • SP-43966 Sarl Lafage,<br />
Mas Miraflors, Route de Canet, 66000 Perpignan • SP-41164 Domaine de l’Alba, Saint-Louis Fleury d’Aude par Sélect Vins, 1100 Narbonne • SP-39678 Maison Ventenac, 4, Rue des<br />
Jardins, 11610 Ventenac Cabardès • SP-39746 Chapoutier S.A., 18 avenue du Docteur Paul Durand, 26600 Tain l’Hermitage • SP-44017 Xavier Vins SARL, Route de Sorgues 1901, 84350<br />
Châteauneuf-du-Pape • SP-40253 Knipser, Hauptstraße 47–49, 67229 Laumersheim • SP-41526 Champagne Pommery (Vranken), 5 pl Gén Gouraud, 51100 Reims
Produktion in Ingolstadt<br />
STEFAN WARTER / AUDI AG<br />
Audi<br />
Betriebsrat fordert Jobgarantie bis 2025<br />
Arbeitnehmer wollen einen Zukunftsplan für die VW-Tochter aushandeln.<br />
<strong>Der</strong> Autohersteller Audi soll bis zum Jahr 2025 keine<br />
betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Das fordert<br />
Betriebsratschef Peter Mosch. „In Zeiten des rapiden technischen<br />
Wandels brauchen die Beschäftigten bei Audi dringend<br />
Sicherheit“, sagt er. Die aktuelle Beschäftigungssicherung<br />
läuft im Jahr 2020 aus. Für Mitarbeiter der Schwestermarke<br />
Volkswagen hingegen gilt bereits eine Garantie bis<br />
2025. Mosch will mit dem Vorstand nun bis Jahresende<br />
eine eigene Zukunftsvereinbarung für Audi und seine rund<br />
60000 Mitarbeiter in Deutschland aushandeln. Diese soll<br />
auch konkrete Zusagen für die Produktion von Elektro -<br />
modellen an den deutschen Standorten Ingolstadt und<br />
Neckarsulm umfassen. Die E-Auto-Offensive soll dazu<br />
beitragen, die derzeit unterbeschäftigten Werke wieder<br />
stärker auszulasten. Mosch fordert zudem neue Jobs in der<br />
Batterieproduktion und bei den digitalen Dienstleistungen.<br />
„Wir wollen den Vorstand in die Pflicht nehmen, zusätz -<br />
liche Tätigkeitsfelder zu schaffen“, sagt der Betriebsratschef.<br />
Beim Audi-Konkurrenten Daimler handelten die<br />
Arbeitsnehmervertreter zuletzt sogar eine Beschäftigungsgarantie<br />
bis 2030 aus. Im Gegenzug stimmten sie der Aufspaltung<br />
des Konzerns in drei selbständige Sparten zu. sh<br />
Verkehr<br />
Freie Fahrt für den<br />
Bahn-Chef<br />
Deutsche-Bahn-Chef Richard<br />
Lutz bekommt bei der Besetzung<br />
dreier Vorstandsposten<br />
weitgehende Mitspracherechte.<br />
Das ordnete der scheidende<br />
Bundesverkehrsminister<br />
Alexander Dobrindt (CSU)<br />
stellvertretend für den Staat<br />
als Alleineigentümer an. Damit<br />
reagierte er auf die erneute<br />
Absage der Aufsichtsratssitzung<br />
am vorigen Donnerstag,<br />
auf der die neuen<br />
Vorstände gewählt<br />
werden sollten. Die<br />
Entscheidung Dobrindts<br />
ist auch ein Zeichen<br />
des Misstrauens<br />
an Aufsichtsratschef<br />
Utz-Hellmuth Felcht,<br />
Koederitz<br />
MIKE SCHMIDT / IMAGO<br />
der laut Satzung für die Auswahl<br />
der Kandidaten verantwortlich<br />
ist. Den designierten<br />
Güterverkehrvorstand Jürgen<br />
Wilder wollten die<br />
Arbeitnehmerseite<br />
und die SPD-Mitglieder<br />
des Aufsichtsrats<br />
aber nicht abnicken.<br />
Wilder gab deshalb<br />
seinen Rückzug bekannt.<br />
Gesetzt ist derzeit<br />
nur Martin Seiler als Personalvorstand.<br />
Die ursprünglich<br />
als Digital-Vorstand vorgesehene<br />
Professorin Sabina<br />
Jeschke ist nicht mehr unumstritten.<br />
Wieder im Gespräch<br />
ist Martina Koederitz, Managerin<br />
von IBM. Die Zeit für<br />
Lutz und Felcht drängt. Dobrindt<br />
will am 10. November<br />
endgültig über alle drei Personalien<br />
entschieden haben. gt<br />
62 DER SPIEGEL 43 / 2017
Wirtschaft<br />
Geldanlage<br />
Crowdinvesting<br />
lockt Anleger<br />
Mancher Anleger liebäugelt<br />
mit dem sogenannten<br />
Crowdinvesting: Bei einer<br />
Umfrage des Forsa-Instituts<br />
konnten sich 15 Prozent der<br />
Teilnehmer vorstellen, bei einer<br />
solchen Schwarmfinanzierung<br />
mitzumachen. Bei den<br />
unter 40-Jährigen waren es<br />
sogar 26 Prozent. Nur zwei<br />
Prozent der Befragten nutzen<br />
diese Form des Investments<br />
schon. Beim Crowdinvesting<br />
beziehungsweise Crowdfunding<br />
sammeln Firmen über<br />
HSH Nordbank<br />
Länder wollen den<br />
Preis hochtreiben<br />
In dem Verkaufspoker um<br />
die HSH Nordbank erhöhen<br />
die Eigentümer der Landesbank<br />
kurz vor dem Ende der<br />
Bieterfrist den Einsatz. In<br />
einer Unterlage für die Interessenten<br />
verlangen Hamburg<br />
und Schleswig-Holstein<br />
eine Ausgleichszahlung von<br />
100 Millionen Euro für die<br />
Garantie, mit der sie die Bank<br />
nach der Finanzkrise vor dem<br />
Kollaps bewahrt hatten. Für<br />
die Garantie zahlt die HSH<br />
jährlich Millionen an Gebühren,<br />
auch in den nächsten<br />
das Internet Geld für eine<br />
Geschäftsidee. Zündet sie,<br />
bekommen Investoren Zinsen<br />
oder werden am Gewinn<br />
beteiligt. Bei der Umfrage gaben<br />
33 Prozent der Befragten<br />
eine hohe Rendite als mög -<br />
lichen Grund an, ein solches<br />
Investment zu tätigen. Allerdings<br />
droht bei Misserfolg<br />
auch der Totalverlust. „Noch<br />
dazu ist die Schwarmfinan -<br />
zierung bislang nur schwach<br />
reguliert“, sagt Wolf Brandes<br />
von der Verbraucherzentrale<br />
Hessen, die die Umfrage im<br />
Rahmen des Projekts „Marktwächter<br />
Finanzen“ in Auftrag<br />
gegeben hat. ase<br />
Jahren wären noch Zahlungen<br />
fällig gewesen, die aber<br />
im Zuge der Privatisierung<br />
vom Käufer abgelöst werden<br />
sollen. Insider glauben allerdings,<br />
dass 40 Millionen Euro<br />
als Ausgleich ausreichen würden.<br />
Die 100-Millionen-Forderung<br />
könnte Bieter abschrecken,<br />
heißt es. Noch im Rennen<br />
sind die Finanzinvestoren<br />
Cerberus, Apollo, J. C.<br />
Flowers und der bisher un -<br />
bekannte Bieter Socrates<br />
Capital. Hinter der Londoner<br />
Beteiligungsfirma soll jedoch<br />
ein anderer Kaufinteressent<br />
stehen. Am nächsten Freitag<br />
um 18 Uhr müssen verbind -<br />
liche Gebote vorliegen. mhs<br />
Staatsfinanzen<br />
Wenig Spielraum<br />
für Jamaika<br />
<strong>Der</strong> Finanzspielraum der<br />
neuen Bundesregierung fällt<br />
viel kleiner aus, als bislang<br />
gedacht. Nach Berechnungen<br />
des Bundesfinanzministeriums<br />
(BMF) stehen der geplanten<br />
Jamaikakoalition in den<br />
nächsten vier Jahren nur<br />
30 Milliarden Euro für neue<br />
Vorhaben zur Verfügung. Nur<br />
so könne die schwarze Null,<br />
also ein Bundeshaushalt ohne<br />
Neuverschuldung, gehalten<br />
werden, heißt es in einer<br />
Unterlage, die das BMF für<br />
die anstehenden Koalitionsverhandlungen<br />
erstellt hat.<br />
Auf das Jahr gerechnet, ergibt<br />
sich also ein Betrag von<br />
durchschnittlich 7,5 Milliarden<br />
Euro. Damit ließe sich gerade<br />
einmal die von CDU und<br />
Baustelle in München<br />
CSU geplante Steuerentlastung<br />
mit einem Volumen von<br />
15 Milliarden Euro finanzieren,<br />
wenn sich die Länder,<br />
wie üblich, mit der Hälfte an<br />
den Einnahmeausfällen beteiligen.<br />
Die FDP fordert eine<br />
doppelt so hohe Entlastung.<br />
Auch für weitere Maßnahmen,<br />
beispielsweise neue<br />
Investitionen in Infrastruktur<br />
oder Digitalisierung, wäre<br />
kein Geld übrig. Größer würde<br />
der Spielraum, wenn die<br />
neue Regierung die schwarze<br />
Null im Bundeshaushalt aufgäbe<br />
und die Verschuldungsmöglichkeiten,<br />
die das Grundgesetz<br />
vorgibt, ausschöpfte.<br />
Nach der dort verankerten<br />
Schuldenbremse darf der<br />
Bund neue Kredite in Höhe<br />
von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts<br />
aufnehmen.<br />
In absoluten Zahlen sind das<br />
rund elf Milliarden Euro. rei<br />
FLORIAN PELJAK / PICTURE ALLIANCE / SZ PHOTO / DPA<br />
Die Samstagsfrage Wozu braucht Tesla deutsche Ingenieure?<br />
Tesla-Gründer Elon Musk hat viel erreicht. Seine US-<br />
Automarke gilt als Pionier der E-Mobilität. Weltweit<br />
haben mehr als 500000 Kunden das neue<br />
Model 3 bestellt. Ein Weckruf für die deutsche<br />
Autoindustrie: BMW, Daimler und VW wetteifern<br />
darum, wer den besten „Tesla-Fighter“ baut,<br />
ein Auto, das eher einem iPhone auf Rädern als<br />
einem gewöhnlichen Mercedes oder Golf gleichen<br />
soll. Ein Kampf zwischen neuer und alter Autowelt<br />
ist entbrannt, mit erstaunlichen Folgen: Während die<br />
deutschen Hersteller nun um IT-Experten und Programmierer<br />
buhlen, umwirbt Tesla gezielt klassische Autoingenieure.<br />
Im rheinland-pfälzischen Prüm hat der US-Konzern zu<br />
Jahresbeginn den Zulieferer Grohmann Engineering gekauft.<br />
Musk persönlich reiste in die Eifel, um die Mitarbeiter von seiner<br />
„Mission“ zu überzeugen. Diese Woche sagte Tesla ihnen<br />
auch noch deutlich höhere Gehälter und eine Jobgarantie bis<br />
geplante Produktion 2018:<br />
500000<br />
Fahrzeuge<br />
2022 zu. <strong>Der</strong> Grund für die Charmeoffensive: Tesla<br />
ist auf Grohmanns Know-how angewiesen. Mit<br />
dem Model 3 geht der US-Konzern erstmals in<br />
die Massenfertigung, und das bereitet Tesla<br />
sichtlich Probleme. Im dritten Quartal stellte das<br />
Unternehmen gerade mal 260 Stück des neuen<br />
Hoffnungsautos her. Eigentlich waren 1500 geplant.<br />
Beim Hochfahren der Produktion kommt<br />
Grohmann nun eine zentrale Rolle zu. <strong>Der</strong> Mittelständler<br />
baut Fertigungsanlagen für viele Komponenten,<br />
die in einem modernen Auto wichtig sind, von Sensoren<br />
bis zu Hochvoltspeichern. Ingenieure aus Prüm reisen<br />
nun oft in die USA, um Musks Fabriken mit Automatisierungstechnik<br />
auszurüsten. Die Konkurrenz sieht darin den Beweis,<br />
dass Musk zwar gute Ideen hat, bei der Umsetzung aber<br />
Hilfe aus Deutschland braucht. Sein Produktionschef heißt<br />
seit 2016 übrigens Peter Hochholdinger. Er kommt von Audi. sh<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
63
Gelobtes Hinterland<br />
Gerechtigkeit Deutschland ist gespalten: Die Metropolen boomen, die Provinz kommt<br />
kaum hinterher. Doch auch dort gibt es Erfolgsgeschichten. Vier Beispiele.<br />
Deutschland im Herbst 2017, das ist,<br />
auf den ersten Blick, ein Land im<br />
Sonnenschein. Die Arbeitslosigkeit<br />
bei 5,5 Prozent, das Bruttoinlandsprodukt<br />
mit 38114 Euro pro Einwohner so hoch<br />
wie nie. Es steigen die Haushaltseinkommen,<br />
der private Konsum, die Exporte, die<br />
Lebenserwartung. Auf den Straßen kommt<br />
man vor lauter Baustellen kaum voran. In<br />
den Zustandsberichten, die das Wirtschaftsministerium<br />
ins Land schickt, ist fast alles<br />
„robust“, „beschleunigt“ oder „dynamisch“.<br />
Die Städte wachsen. Bis 2035 wird die<br />
Einwohnerzahl von Frankfurt am Main um<br />
11 Prozent steigen, die von München oder<br />
Berlin sogar um mehr als 14 Prozent, in der<br />
Hauptstadt werden dann mehr als vier Millionen<br />
Menschen leben. Doch Deutschlands<br />
Gesamtbevölkerung nimmt seit Jahren<br />
kaum zu; wenn die Metropolregionen<br />
wachsen, muss anderswo etwas kleiner werden.<br />
<strong>Der</strong> Boom geht zulasten der Provinz.<br />
In den Jahren 2005 bis 2015 schrumpfte<br />
die Bevölkerung in 37 Prozent der Mittelstädte<br />
und in 52 Prozent der Kleinstädte.<br />
An diesem Auseinanderklaffen von Großstadt<br />
und Hinterland wird sich auf absehbare<br />
Zeit nichts ändern, wie der noch unveröffentlichte<br />
Raumordnungsbericht 2016<br />
des Bundes deutlich macht. Die Diskrepanz,<br />
heißt es dort, werde „künftig weiter<br />
an Dynamik gewinnen“.<br />
Von Hamburg und München, Stuttgart,<br />
Köln, Düsseldorf, Frankfurt und, vor allem,<br />
Berlin aus gesehen ist der Rest von<br />
Deutschland, in Abstufungen: Provinz.<br />
Doch wer durch diese Gegenden reist, der<br />
entdeckt schnell, dass vieles dem schnellen<br />
Befund widerspricht. Es gibt schrumpfende<br />
Gemeinwesen, sterbende Dörfer. Es gibt<br />
aber auch prosperierende Kleinstädte,<br />
funktionierende Mittelzentren und blühende<br />
Dörfer.<br />
Warum die einen Kommunen Erfolg<br />
haben und die anderen nicht, hat in der<br />
Politik lange Zeit niemanden so richtig interessiert.<br />
Erst die Rede von den „Abgehängten“<br />
der Republik, die AfD wählen<br />
und offenbar vornehmlich in der Provinz<br />
leben, hat das Interesse am Land geweckt.<br />
Politiker von den Grünen bis zur CSU bemühen<br />
sich seitdem, den Geschichten von<br />
der abgehängten Provinz eine positive Erzählung<br />
gegenüberzustellen. Plötzlich ist<br />
viel von Heimat die Rede, wird über die<br />
Einrichtung von Heimatministerien nachgedacht.<br />
Als wenn mit einer neuen, alten<br />
Vokabel die Probleme schon gelöst wären.<br />
Aber die Fragen, die diskutiert werden,<br />
sind die richtigen: Was ist unverzichtbar,<br />
wenn man den Niedergang einer Stadt oder<br />
eines Kreises stoppen oder einen Trend sogar<br />
umkehren will? Worauf kommt es an?<br />
Wie macht man das Land, wie macht man<br />
die deutsche Provinz zukunftsfest?<br />
Es gibt Antworten auf diese Fragen. Antworten,<br />
die manche Dörfer, Städte und<br />
Kreise selbst geben. Die Antworten heißen,<br />
unter anderem, Halle (Saale), Offenbach<br />
am Main, Freyung-Grafenau und<br />
Werra-Meißner. Zweimal Ost, zweimal<br />
West. Zweimal Stadt, zweimal Land.<br />
Halle (Saale)<br />
Bildung, Forschung und Kultur sind auch abseits<br />
der Metropolen anziehend. Besuch in<br />
einer „Schwarmstadt“.<br />
Halle, 40 Kilometer vor Leipzig gelegen,<br />
ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich<br />
Trends tatsächlich umkehren lassen. Lange<br />
litt die Stadt unter Bevölkerungsschwund<br />
und Niedergang, in den letzten Jahren erlebte<br />
sie eine Wende zum Positiven. Leipzig<br />
geht es wieder gut, deshalb geht es<br />
auch Halle besser, vielleicht liegt es daran.<br />
Wissenschaftler bezeichnen solche Phänomene<br />
als „Überschwappeffekte“.<br />
Zu DDR-Zeiten hielt Halle an der Saale<br />
Republikrekorde. Mehr als 40 Prozent der<br />
Chemieproduktion der DDR stammte aus<br />
dem Bezirk, das sorgte für Arbeit, Wohlstand<br />
und Selbstbewusstsein. Die Menschen<br />
im Bezirk Halle kauften mehr Mopeds<br />
oder Motorräder als die anderen, sie<br />
rauchten mehr und tranken mehr Milch.<br />
Nach dem Zusammenbruch der DDR<br />
blieb davon nicht viel. Halle erlebte eine<br />
massive Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit<br />
war die Folge.<br />
Bert-Morten Arnicke, 44, machte 1990<br />
in Halle sein Abitur. Heute steuert er sei-<br />
Halle (Saale)<br />
236991 Einwohner<br />
Stand: 31. Dezember 2015<br />
private<br />
Schuldnerquote*<br />
kommunale<br />
Schulden<br />
pro Einwohner**<br />
Sozialhilfe<br />
im Alter**<br />
16,9 % 1941 €<br />
163<br />
von<br />
10 000 Einwohnern<br />
ab 65 Jahren<br />
Magdeburg<br />
SACHSEN-ANHALT<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Bundesdurchschnitt<br />
* Anteil der Bürger, die überschuldet sind. ** Stand 2014<br />
Quelle: BBSR<br />
Leipzig<br />
64 DER SPIEGEL 43 / 2017
Wirtschaft<br />
nen Dienst-VW-Kastenwagen auf einen riesigen<br />
Parkplatz, der früher, zu DDR-Zeiten,<br />
Sperrzone war: Er gehörte zu einer<br />
sowjetischen Kaserne.<br />
Die Soldaten sind längst abgezogen. Arnicke<br />
ist Projektmanager für den neu entstandenen<br />
Weinberg-Campus, nach Berlin-Adlershof<br />
der zweitgrößte ostdeutsche<br />
Technologiepark – das komplette Münchner<br />
Oktoberfest mit all seinen Zelten und<br />
Fahrgeschäften würde mehr als dreimal<br />
auf das Gelände passen.<br />
„Spitzenforschung“, sagt Arnicke. Und<br />
dann fährt er das Who’s who von Halle<br />
ab: ein Fraunhofer-Institut, ein Gebäude<br />
der Max-Planck-Gesellschaft, das Bio-Verfahrenstechnik-Zentrum,<br />
zwei Leibniz-<br />
Ins titute. Mittendrin Gebäude der Universität,<br />
kleinere und größere Labore von Firmen<br />
und am Rande die Universitätsklinik.<br />
Ein Ebola-Wirkstoff wurde in Halle mitentwickelt,<br />
einer der bekanntesten Festplatten-Wissenschaftler<br />
der Welt hat hier<br />
sein Labor, Forscher suchen nach Wirkstoffen<br />
gegen Alzheimer und Diabetes. In<br />
der Weinberg-Mensa sind Spanisch oder<br />
Englisch sprechende Gäste fast so normal<br />
wie Besucher mit Hallenser Dialekt.<br />
So viel Internationalität verändert eine<br />
Stadt. Es gibt exotische Restaurants und<br />
Kneipen, die Kreativwirtschaft blüht, angetrieben<br />
durch die drittgrößte Kunsthochschule<br />
der Republik – heute werden in der<br />
Stadt an der Saale sogar Hollywoodfilme<br />
vertont. Halle wurde zur Schwarmstadt:<br />
So bezeichnen Soziologen Orte mit einer<br />
„beträchtlichen Anziehungskraft auf Bildungssuchende“.<br />
Noch immer verdienen Menschen in<br />
Halle – wie auch im Rest der neuen Bundesländer<br />
– weniger als Menschen in Hannover<br />
oder Bonn. Ursache für die Lohnlücke<br />
ist der Mangel an Großunternehmen,<br />
weil hauptsächlich Großunternehmen<br />
Weniger Flächenförderung<br />
und Gießkanne, dafür<br />
Konzentration auf Forschung<br />
und Entwicklung.<br />
hohe Gehälter zahlen. Bei der Stadt überlegt<br />
man also, wie Platz für Werke und<br />
Verwaltungen von Konzernen geschaffen<br />
werden kann.<br />
Halle hat nicht einfach Glück gehabt.<br />
Halle hatte einen Plan.<br />
Eine Milliarde Euro floss seit 1990 in das<br />
Weinberg-Gelände, durch Investitionen von<br />
Bund, Land, EU und natürlich Halle selbst.<br />
Die Stadt ging in Vorleistung und kaufte<br />
dem Bund das Kasernenareal ab. Es half,<br />
dass es auch zu DDR-Zeiten eine Tradition<br />
für Wissenschaft in Halle gegeben hat, daran<br />
konnte man anknüpfen; Ähnliches erlebte<br />
Jena mit seiner reichen Produktionsgeschichte<br />
von optischen Geräten.<br />
Die Politik, die allenfalls Rahmenbedingungen<br />
setzen kann, hat in diesem Fall vieles<br />
richtig gemacht. Auf dem Entwicklungsstand,<br />
auf dem sich Deutschland inzwischen<br />
befindet, entstehe Wirtschaftswachstum<br />
hauptsächlich durch Innovation, sagt<br />
Oliver Holtemöller, Professor für Volkswirtschaftslehre<br />
an der Martin-Luther-Universität<br />
Halle-Wittenberg und Leiter der<br />
Abteilung Makroökonomik am Leibniz-<br />
Institut für Wirtschaftsforschung Halle.<br />
Was das bedeutet, für Halle, aber auch<br />
für andere Städte, die einen Strukturwandel<br />
hinter sich haben? Weniger Flächenförderung,<br />
sagt Holtemöller, weniger Gießkanne,<br />
dafür Konzentration auf die För -<br />
derung von Forschung und Entwicklung<br />
sowie der Standortattraktivität für Hochqualifizierte.<br />
Denn nur wo Spitzenforschung<br />
stattfindet, besteht die Chance,<br />
dass Ausgründungen erfolgreich sind und<br />
dass sich irgendwann die private Wirtschaft<br />
andockt – was wiederum Arbeitsplätze<br />
und damit Wachstum mit sich<br />
bringt.<br />
Offenbach am Main<br />
Vielleicht hängen ein hoher Ausländeranteil<br />
und Kreativität zusammen. Über den Standortvorteil<br />
Heterogenität.<br />
Wer mit dem ICE auf dem Weg nach<br />
Frankfurt durch Offenbach fährt, sieht erst<br />
einmal nicht viel von der Stadt: ein paar<br />
Wiesen, einige Gewächshäuser, Brache.<br />
Wenig lässt darauf schließen, was dahinterliegt.<br />
„Ein Drecksloch“, wie der Rapper<br />
Ree in seinem Song „Offenbach“ singt?<br />
Oder das Ausland? „Geh hin, wo du herkommst,<br />
wenn’s dir hier nicht passt, Mann,<br />
geh zurück nach Deutschland“, rappt er –<br />
„das ist Offenbach.“<br />
Offenbach hat einen Ausländeranteil<br />
von 37 Prozent, das ist ein bundesdeutscher<br />
Spitzenwert; er macht die Kommune<br />
zu einer der internationalsten Städte<br />
Deutschlands.<br />
Rund 60 Prozent der Einwohner haben<br />
ausländische Wurzeln, in der Innenstadt<br />
sind es sogar 70 Prozent. Lange gab es<br />
Spannungen, die Kriminalitätsrate war immer<br />
wieder großes Thema, Rapper wie<br />
Haftbefehl machten Karriere mit Stücken,<br />
in denen sie die Prostituierten und Drogendealer<br />
Offenbachs besangen. In Offenbach<br />
sei man es gewohnt, sich „zu fetzen<br />
und zu bluten“, rappen sie, „Kanacken<br />
jumpen up vor den abgefuckten Cops.“<br />
Dabei ist die Stadt längst nicht so verroht,<br />
wie die Songtexte glauben machen<br />
wollen. Die Gewaltkriminalität geht zurück,<br />
auch die Gesamtzahl der Straftaten<br />
sinkt: 2016 wurden 11 607 Fälle registriert,<br />
Offenbach<br />
am Main<br />
123734 Einwohner<br />
Stand: 31. Dezember 2015<br />
private<br />
Schuldnerquote*<br />
17,8 %<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Bundesdurchschnitt<br />
kommunale<br />
Schulden<br />
pro Einwohner**<br />
8156 €<br />
Sozialhilfe<br />
im Alter**<br />
763<br />
von<br />
10 000 Einwohnern<br />
ab 65 Jahren<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Frankfurt<br />
am Main<br />
HESSEN<br />
Darmstadt<br />
* Anteil der Bürger, die überschuldet sind. ** Stand 2014<br />
Quelle: BBSR<br />
Hanau<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
65
minus zehn Prozent, obwohl die Bevölkerung<br />
wächst. Die Arbeitslosigkeit liegt derzeit<br />
bei knapp zehn Prozent. Einer Umfrage<br />
der Industrie- und Handelskammer<br />
zufolge wollen jedoch 27 Prozent der Unternehmen<br />
künftig mehr Mitarbeiter einstellen.<br />
Fast 70 Prozent der Firmen gaben<br />
an, dass sich die Standortbedingungen in<br />
den vergangenen fünf Jahren verbessert<br />
hätten.<br />
„Die Stadt muss sich nicht verstecken“,<br />
sagt Maziar Rastegar, 36, Grafikdesigner<br />
mit iranischen Wurzeln und Offenbacher<br />
Lokalpatriot. Rastegar hat in Offenbach<br />
an der renommierten Kunsthochschule<br />
HfG studiert und sich vor einigen Jahren<br />
im Stadtteil Nordend in einer ehemaligen<br />
Pelzfabrik ein Arbeits- und Wohnloft eingerichtet:<br />
große Fenster, viele Holzmöbel,<br />
Ledersofa, Perserteppich.<br />
Das Viertel am Mainufer war einst ein<br />
Problembezirk, inzwischen sind auf der<br />
anderen Seite des Hafenbeckens Hunderte<br />
neue Wohnungen entstanden. Restaurants<br />
und Kindergärten gibt es hier, auch für die<br />
Pendler, die in Frankfurt arbeiten und in<br />
Offenbach leben.<br />
Was in Offenbach auffällt: der hohe Anteil<br />
Kreativer. Gibt es einen Zusammenhang<br />
zwischen Multikulturalismus und<br />
Kreativität?<br />
Rastegar entwirft Logos für seine Kunden,<br />
gestaltet die Inneneinrichtung von<br />
Restaurants oder verkauft T-Shirts mit Offenbach-Aufdruck.<br />
Er hat eine eigene<br />
Schriftart entworfen, die „Offenbach<br />
Neue“: eine Mischung aus deutscher Fraktur<br />
und arabischer Schrift. „Ich finde, das<br />
drückt den Charakter der Stadt perfekt<br />
aus“, sagt er.<br />
Kleinunternehmern und Kreativen wie<br />
Rastegar ist es zu verdanken, dass sich Offenbachs<br />
Image langsam von der Schmuddelstadt<br />
zur kleinen Kultmetropole wandelt.<br />
<strong>Der</strong> Anteil der Kreativwirtschaft liegt<br />
bei mehr als 7 Prozent der Bruttowertschöpfung.<br />
Im Vergleich: In Berlin beträgt<br />
die Kennziffer 8,5 Prozent, in ganz<br />
Deutschland rund 2 Prozent.<br />
„Es gibt immer noch Viertel, da ist man<br />
in der Jogginghose overdressed“, sagt Rastegar.<br />
„Hier ist nicht alles aufgeräumt und<br />
poliert. Aber das ist okay so. Aus so etwas<br />
entsteht Kreativität.“<br />
In Deutschland, sagt der Wirtschaftsforscher<br />
Oliver Holtemöller, bilde man sich<br />
immer noch viel auf die Stärke des Ver -<br />
arbeitenden Gewerbes ein. „Es könnte<br />
sein, dass sich das als kurzsichtig erweist.“<br />
Kreis Freyung-Grafenau<br />
Günstiges Bauland ist gut. Schnelles Internet<br />
ist besser. <strong>Der</strong> Wert digitaler Infrastruktur.<br />
Auf den ersten Blick ist Freyung-Grafenau<br />
kein guter Standort für eine Firmengründung.<br />
Für fast alles braucht man hier ein<br />
Auto, München ist genauso weit entfernt<br />
wie Prag. Im gesamten Kreisgebiet gibt es<br />
nicht einen Kilometer Autobahn, keine<br />
nennenswerte Zugverbindung und keine<br />
Universität, die Hightech und Ideen bringen<br />
könnte. Weil eine Universität fehlt,<br />
fehlen Akademiker. Viele junge Leute verlassen<br />
die Region.<br />
Trotzdem ist Freyung-Grafenau eine<br />
wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Von 2000<br />
bis 2014 wuchs die Wirtschaftskraft pro<br />
Kopf durchschnittlich um 3,4 Prozent pro<br />
Jahr, in ganz Deutschland waren es im selben<br />
Zeitraum nur 2,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote<br />
lag 2016 bei 3,4 Prozent, das<br />
ist praktisch Vollbeschäftigung. Überdurchschnittlich<br />
ist die Zahl der Selbstständigen.<br />
<strong>Der</strong> Freyung-Grafenau-Kreis ist das, was<br />
in der alten Bundesrepublik „Zonenrandgebiet“<br />
hieß. Die Nähe zur tschechischen<br />
Grenze war lange ein Problem, die Öffnung<br />
der Grenze brachte Chancen.<br />
Auch Christina und Daniel Gotsmich<br />
sind zum Studium erst einmal weggezogen,<br />
nach Berlin. Umso überraschender, dass<br />
sie ihre erste Firma nicht etwa in Kreuzberg<br />
gegründet haben, sondern eben in<br />
Freyung, 7400 Einwohner, kurz vor der<br />
tschechischen Grenze. 2011 starteten sie<br />
mit einer Kommunikationsagentur, fünf<br />
Jahre später folgte mit der Möbelmarke<br />
Kommod das zweite Start-up.<br />
Die Treiber der guten Entwicklung im<br />
Kreis sind nicht einige wenige weithin<br />
sichtbare Großunternehmen. Hinter dem<br />
Wachstum stehen viele kleine Unternehmer:<br />
Spezialisierte Maschinenbauer gibt<br />
es ebenso wie Hersteller von Kamera -<br />
objektiven, Produzenten von Styropor<br />
oder eben die Möbelfirma von Christina<br />
und Daniel Gotsmich.<br />
Ein Quadratmeter Bauland kostet im Osten<br />
Bayerns 34 Euro, in deutschen Städten<br />
ist es mit 280 Euro rund achtmal so viel.<br />
Das ist auch für Unternehmen ein Wett -<br />
bewerbsvorteil. Für das Firmenbüro in<br />
Freyung zahlen Christina und Daniel Gotsmich<br />
eine Miete von drei Euro pro Quadratmeter.<br />
Doch billig sein allein reicht nicht. Lange<br />
surften die Einwohner im Kreis quälend<br />
langsam durchs Netz. Für Privatpersonen<br />
war das lästig, für Firmen unter Umständen<br />
existenzgefährdend. Erst seit die bayrische<br />
Landesregierung den Breitbandausbau<br />
fast komplett subventioniert, wird das<br />
Internet auch in Freyung-Grafenau schneller<br />
– und erst das macht es möglich, dass<br />
Gründer aus Berlin auch in der Provinz<br />
arbeiten können.<br />
<strong>Der</strong> Sachverständigenrat Ländliche Entwicklung<br />
sieht das ähnlich. Er formuliert<br />
Landkreis<br />
Freyung-Grafenau<br />
78122 Einwohner<br />
Stand: 31. Dezember 2015<br />
private<br />
Schuldnerquote*<br />
* Anteil der Bürger, die überschuldet sind.<br />
kommunale<br />
Schulden<br />
pro Einwohner**<br />
Sozialhilfe<br />
im Alter**<br />
6,1 % 1673 €<br />
124<br />
von<br />
10 000 Einwohnern<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Bundesdurchschnitt<br />
ab 65 Jahren<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Regensburg<br />
** Stand 2014<br />
BAYERN<br />
Passau<br />
Pilsen<br />
TSCHECHIEN<br />
Quelle: BBSR<br />
66 DER SPIEGEL 43 / 2017
Wirtschaft<br />
es nur etwas beamtenhaft. „Die Verfügbarkeit<br />
von schnellen und leistungsstarken<br />
Breitbandanbindungen ist ein entscheidender<br />
Standortfaktor“, heißt es in einer Stellungnahme<br />
des Rats zum Thema „Länd -<br />
liche Räume“. Die Experten sehen darin<br />
ein Problem für die gesamte Volkswirtschaft.<br />
Deutschland könne die Chancen<br />
der Digitalisierung nur nutzen, wenn auch<br />
in ländlichen Räumen flächendeckend eine<br />
hochleistungsfähige digitale Infrastruktur<br />
entstehe. Wird dieses Ziel verfehlt, bestehe<br />
die Gefahr, dass die ländlichen Gebiete<br />
beim Übergang zur „Gigabitgesellschaft“<br />
nicht mitkommen.<br />
Mindestens genauso wichtig wie das digitale<br />
Internet sind in Freyung-Grafenau<br />
die analogen Netzwerke: das Provinzielle.<br />
Man kennt sich. „So ein Bezirksamt in<br />
Berlin ist sehr anonym“, sagt Daniel Gotsmich.<br />
„Wenn ich hier zum Landratsamt<br />
fahre, muss ich mindestens eine Stunde<br />
einplanen, weil man sich auf dem Flur verratscht.“<br />
Werra-Meißner-Kreis<br />
Wenn die Bürger die Toiletten im Gemeindehaus<br />
selbst renovieren. Die Aussagekraft<br />
ehrenamtlichen Engagements.<br />
Das Problem von Landrat Stefan Reuß ist,<br />
dass er etwas schaffen muss, was erst einmal<br />
aussichtslos erscheint: Er muss Geld<br />
sparen und gleichzeitig den Kreis attraktiv<br />
halten – damit nicht noch mehr Menschen<br />
wegziehen, sondern womöglich sogar neue<br />
kommen. „Wir brauchen Infrastruktur,<br />
sonst ist der ländliche Raum im Eimer“,<br />
sagt er.<br />
Reuß will seinen Kreis als Wohnstandort<br />
profilieren. In den nächstgrößeren Städten<br />
Göttingen und Kassel sind die Mieten hoch,<br />
Wohnraum ist knapp und das Bauen teuer.<br />
„Ohne bürgerschaftliches<br />
Engagement<br />
könnte ich das<br />
Licht ausknipsen.“<br />
„Aber für den Weg aufs Land entscheiden<br />
sich die Leute nur, wenn es hier genug<br />
gibt“, sagt Reuß – genug Schulen, Busse,<br />
Ärzte, Supermärkte eben. Und da wird es<br />
eng.<br />
Junge Ärzte ließen sich auch mit Ansiedlungsprämien<br />
von bis zu 50000 Euro,<br />
die das Land Hessen im Rahmen eines<br />
„Gesundheitspakts“ bezahlt, nicht in die<br />
Region locken, wenn ihre Kinder keine<br />
Schule in der Nähe fänden, sagt Reuß. Obwohl<br />
sich die Zahl der Erstklässler seit 1995<br />
fast halbiert hat, hat Reuß deshalb keine<br />
Schule geschlossen.<br />
Die Nachmittagsbetreuung an Kindergärten<br />
und Grundschulen hat der Kreis bis<br />
16 Uhr ausgebaut, knapp 260 000 Euro hat<br />
das gekostet. Um Geld zu sparen, wurden<br />
die Anfangszeiten an den Schulen so gestaffelt,<br />
dass es morgens weniger Busse<br />
braucht, um alle Kinder pünktlich zum Unterricht<br />
zu bringen.<br />
Die Lücken im öffentlichen Nahverkehr<br />
sind trotzdem riesig. In einigen Gemeinden<br />
fährt außer dem Schulbus morgens<br />
und nachmittags kein weiterer Bus. Im<br />
Ringgau, einer Gemeinde im Südzipfel<br />
des Kreises, gibt es deshalb seit dem Jahr<br />
2011 das „Bürgermobil“. Über 20 Ehrenamtliche<br />
fahren den Kleintransporter,<br />
der von einem Verein gekauft wurde, und<br />
sammeln an zwei Tagen pro Woche Mitfahrgäste<br />
in den Dörfern ein. Die Abfahrtzeiten<br />
sind auf die Arzttermine abgestimmt,<br />
damit Patienten, die mit dem Bürgerbus<br />
zum Arzt fahren, auch die Rückfahrt<br />
nicht ver passen.<br />
„Ohne bürgerschaftliches Engagement<br />
könnte ich das Licht ausknipsen“, sagt Bürgermeister<br />
Burkhard Scheld in Herleshausen.<br />
Vor Kurzem hätten ihn ein paar Ehrenamtliche<br />
gefragt, ob er 1000 Euro zur<br />
Verfügung stellen würde, um die Toiletten<br />
im Gemeindehaus zu sanieren. Neue Fliesen,<br />
Kloschüsseln und anderes Material<br />
sind nötig. Eingeplant sind für das ganze<br />
Haus nur 300 Euro im Jahr. Scheld schichtete<br />
daraufhin mühsam in seinem Haushalt<br />
hin und her. „Dafür arbeiten zehn, zwölf<br />
Leute umsonst. Wenn ich eine Firma für<br />
die Klos beauftragen müsste, könnte ich<br />
das doch gar nicht bezahlen.“<br />
Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-<br />
Instituts für Bevölkerung und Entwicklung,<br />
hat sich in mehreren Studien mit<br />
den Zukunftsperspektiven des Landes beschäftigt.<br />
Wann immer Klingholz und<br />
seine Kollegen nach den Ursachen dafür<br />
forschen, warum und wie es einzelnen<br />
Gemeinden gelungen ist, sich gegen den<br />
Niedergang zu stemmen, stoßen sie auf<br />
einen Indikator: die Vereinsdichte. „Wenn<br />
sich Menschen in einer Gemeinde engagieren<br />
und der Bürgermeister mitzieht,<br />
dann läuft es.“<br />
Sinnvoller als aufwendige Förderprogramme<br />
aus Brüssel seien für viele Gemeinden<br />
oder private Initiativen „5000<br />
Euro ohne Bürokratie“. Klingholz empfiehlt<br />
obendrein, den Gemeinden größe -<br />
re finanzielle Autonomie zuzugestehen,<br />
wie es etwa in Skandinavien geschehe.<br />
Dort bekommen die Gemeinden ein<br />
Regionalbudget, das sie für Schulen,<br />
Straßen oder Altenpflege ausgeben<br />
können. Sie dürfen auch selbst entscheiden,<br />
ob sie kleine Schulen am Leben<br />
Werra-Meißner-<br />
Kreis<br />
100715 Einwohner<br />
Stand: 31. Dezember 2015<br />
private<br />
Schuldnerquote*<br />
11,6 %<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Bundesdurchschnitt<br />
kommunale<br />
Schulden<br />
pro Einwohner**<br />
4058 €<br />
Sozialhilfe<br />
im Alter**<br />
199<br />
von<br />
10 000 Einwohnern<br />
ab 65 Jahren<br />
Bundesdurchschnitt<br />
Kassel<br />
Göttingen<br />
HESSEN<br />
THÜRINGEN<br />
Eisenach<br />
* Anteil der Bürger, die überschuldet sind. ** Stand 2014<br />
Quelle: BBSR<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
67
erhalten oder lieber den Nahverkehr<br />
ausbauen wollen.<br />
Die Zukunft<br />
Die Provinz durchlebt, was Deutschland insgesamt<br />
bevorsteht. Das Land als Experimentierfeld.<br />
„Das Land leidet an kollektiver Depression<br />
und Lethargie“, sagt Gabriela Christmann<br />
vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung<br />
in Erkner. Wenig überraschend,<br />
wenn jahrzehntelang das Ergebnis<br />
beinahe jeder Studie gewesen sei: Das Land<br />
stirbt. „Es gab immer nur Negativbotschaften“,<br />
sagt Christmann. „Diesen Diskurs<br />
müssen wir umdrehen und die Chancen auf<br />
dem Land in den Vordergrund stellen.“<br />
Um die Chancen zu nutzen, braucht es<br />
Zugang zu Wissen ebenso wie den Einsatz<br />
der Menschen, die dort leben. Ländliche<br />
Räume, das sagen Forscher ebenso wie Politiker,<br />
werden wieder wichtiger. Nachdem<br />
sich Aufmerksamkeit und Förderung in den<br />
vergangenen Jahrzehnten auf die Metropolregionen<br />
richteten, rückt jetzt das Land in<br />
den Blickpunkt: Dörfer und Gemeinden,<br />
aber auch Städte wie Offenbach, Halle, Kaiserslautern<br />
oder Bremerhaven, Wismar oder<br />
Itzehoe. Land ist wichtig: als Kraftzentrum,<br />
als Erholungsraum, auch als Gegenentwurf.<br />
Was die Provinz gerade durchlebt, ist in<br />
manchem auch ein Vorgriff auf die Zukunft<br />
Deutschlands insgesamt. Manche Veränderungen,<br />
die den Metropolregionen noch bevorstehen,<br />
sind hier längst angekommen.<br />
Für die Überalterung etwa gilt das allemal.<br />
Um seine Bevölkerungszahl stabil zu<br />
halten, das hat die Uno vor ein paar Jahren<br />
ausgerechnet, müssten jährlich rund<br />
350000 Zuwanderer nach Deutschland<br />
kommen. Um das Verhältnis von Erwerbstätigen<br />
zu Älteren aufrechtzuerhalten,<br />
brauchte es über 3,6 Millionen im Jahr.<br />
Das ist unrealistisch. Werden diese Zahlen<br />
verfehlt, dann wäre das Land Vorreiter eines<br />
grundlegenden Strukturwandels. Die Menschen<br />
in den „ländlichen Räumen“ erproben<br />
schon jetzt, wie die Deutschen künftig leben<br />
werden – als Pioniere, nicht als Abgehängte.<br />
Gerade auf dem Land gebe es Freiräume,<br />
um Neues auszuprobieren, sagt Markus<br />
Mempel vom Deutschen Landkreistag.<br />
„Das kann alles Mögliche sein, von großen<br />
Rechnerfarmen über Flächen für Künstler<br />
und andere Freigeister oder große Höfe,<br />
in denen man Mehrgenerationenhäuser<br />
einrichten kann“, sagt Mempel.<br />
Deutschlands Zukunft ist in manchem<br />
eher in der Provinz zu besichtigen, nicht<br />
in den Städten. Das gilt für die Probleme –<br />
und die Lösungen.<br />
Kathrin Elger, Hauke Goos, Isabell Hülsen,<br />
Nils Klawitter, Martin U. Müller, Philipp Seibt<br />
Interaktive Karten: Wie steht Ihr Landkreis<br />
da? www.spiegel.de/Gelobtes-Land/<br />
Staatschef Kim in einer Lebensmittelfabrik in Pjöngjang: „Wir müssen akzeptieren, dass es mit Nordkorea<br />
„Kim wird nicht aufgeben“<br />
Sanktionen Die USA, die EU und die Uno setzen Nordkorea<br />
mit Handelsbeschränkungen unter Druck. <strong>Der</strong> Ökonom<br />
Rolf Langhammer bezweifelt den Sinn solcher Maßnahmen.<br />
Langhammer, 70, ist Handelsexperte am Institut<br />
für Weltwirtschaft in Kiel.<br />
SPIEGEL: Eine Lösung im Nordkoreakonflikt<br />
scheint fern: Je härter der Westen sanktioniert,<br />
desto eifriger testet Kim die Atombom -<br />
be. Sind Sanktionen das richtige Mittel?<br />
Langhammer: Die Erfolgsbilanz von Wirtschaftssanktionen<br />
ist, um es vorsichtig zu<br />
sagen, bescheiden. Untersuchungen zeigen,<br />
dass in der Vergangenheit kaum 30 Prozent<br />
der verhängten Sanktionen erfolgreich waren.<br />
Es gibt Forscher, die die Erfolgsrate<br />
noch geringer schätzen. Davon abgesehen,<br />
ist es oft schwer, einen kausalen Zusammenhang<br />
zwischen diesen Maßnahmen<br />
und möglichen Erfolgen zu begründen.<br />
SPIEGEL: Warum?<br />
Langhammer: Meist liegt eine lange Zeitspanne<br />
zwischen der Verhängung der<br />
Sanktionen und Veränderungen in der<br />
Politik. Es gibt viel Raum für andere Einflussfaktoren.<br />
SPIEGEL: Wie wahrscheinlich ist es, dass<br />
Nordkorea unter dem Druck der Sanktionen<br />
auf sein Atomprogramm verzichtet?<br />
Langhammer: Kim hat zwei Rettungsleinen:<br />
eine interne – die Fähigkeit, die Atombombe<br />
zu bauen. Und eine externe – die schützende<br />
Hand Chinas. Das Atomprogramm<br />
garantiert sein politisches Überleben im eigenen<br />
Land; er wird es auf keinen Fall aufgeben.<br />
Was China angeht: Wir sind einerseits<br />
darauf angewiesen, dass China sich<br />
an den Sanktionen beteiligt, andererseits<br />
gibt es gerade an Chinas Rolle Zweifel.<br />
SPIEGEL: Inwiefern?<br />
Langhammer: Wenn Nordkorea weniger<br />
Kohle, Textilien und Arbeitskräfte absetzen<br />
kann als bisher, müssten die chinesischen<br />
Einfuhren eigentlich zurückgehen.<br />
Wir wissen aber nicht, ob das der Fall ist.<br />
SPIEGEL: Die Uno hat gerade beschlossen,<br />
30 Prozent weniger Öl nach Nord korea zu<br />
liefern. Das Öl kommt hauptsächlich aus<br />
China.<br />
Langhammer: Unser Problem ist: Wir wissen<br />
auch nicht, welche Menge Öl China tatsächlich<br />
liefert. Denn seit Dezember 2013<br />
veröffentlichen die Chinesen keine Zahlen<br />
über das Exportvolumen mehr. Die Frage<br />
ist also: 30 Prozent wovon? Wie viel Öl<br />
68 DER SPIEGEL 43 / 2017
Wirtschaft<br />
eine weitere Nuklearmacht gibt“<br />
braucht Nordkorea überhaupt? Früher haben<br />
die Chinesen rund 600000 Tonnen exportiert<br />
und die Russen rund 300000 Tonnen.<br />
Solange wir die Gesamtmenge nicht<br />
kennen, wissen wir nicht, wie viel 30 Prozent<br />
weniger sind.<br />
SPIEGEL: Was bedeutet das konkret?<br />
Langhammer: Wir haben zunächst nur auf<br />
dem Papier eine Verschärfung der Sanktionen.<br />
Inwieweit sie umgesetzt werden –<br />
inwieweit sie überhaupt Bedeutung haben<br />
– wissen wir nicht. China könnte beispielsweise<br />
sagen: Ihr kriegt die gleiche Menge<br />
wie vorher, wir geben euch das Öl aber<br />
30 Prozent billiger. Damit wären die Sanktionen<br />
wertmäßig eingehalten. Allerdings:<br />
Je detaillierter die Sanktionen gewesen<br />
wären, desto weniger wahrscheinlich wäre<br />
es gewesen, dass die Chinesen und Russen<br />
zugestimmt hätten.<br />
SPIEGEL: Und wenn China seine Politik<br />
überdenkt?<br />
Langhammer: Selbst dann hätte Nordkorea<br />
immer noch geheime und illegale Wege,<br />
um an Geld zu kommen: Drogen- und Waffenhandel,<br />
den Export militärischer Expertise<br />
und Software. Es gibt immer Außenseiter,<br />
die Sanktionen brechen, das wird<br />
auch bei Nordkorea der Fall sein. Malaysia<br />
ist so ein Kandidat. Man müsste jeden Tanker<br />
kontrollieren, das ist nicht so einfach.<br />
Nehmen Sie Kuba: Selbst ein sehr weit -<br />
gehendes Embargo hat die kubanische Regierung<br />
nicht in die Knie gezwungen – und<br />
Kuba ist leichter zu isolieren als Nord -<br />
korea.<br />
KCNA / REUTERS<br />
SPIEGEL: Kuba lebte 57 Jahre lang mit Sanktionen.<br />
Warum erweisen sich autoritäre<br />
Regime häufig als erstaunlich stabil gegen<br />
Druck von außen?<br />
Langhammer: Je länger die Sanktionen andauern,<br />
desto größer ist der Gewöhnungseffekt.<br />
Sanktionen stärken dann das Nationalgefühl,<br />
sie schaffen eine Art Wagenburgmentalität.<br />
Die Frage bei Kuba ist doch:<br />
Hat das Land trotz der Sanktionen so lange<br />
durchgehalten – oder wegen der Sanktionen?<br />
Am einfachsten scheint es bei afrikanischen<br />
Volkswirtschaften zu sein. Ein kleptokratischer<br />
Machthaber weiß: Wenn ich<br />
meine Politik nicht ändere, bin ich sehr bald<br />
nicht mehr im Amt, weil die Wirtschaft in<br />
die Schattenwirtschaft abgleitet, daher meine<br />
Steuereinnahmen sinken und ich meine<br />
Klientel nicht mehr versorgen kann.<br />
SPIEGEL: Bei solchen Herrschern wirken<br />
auch gezielte Sanktionen: das Einfrieren<br />
von Auslandsguthaben, Reisebeschränkungen,<br />
ein Exportstopp von Luxusgütern.<br />
Langhammer: Dafür sind diese Leute anfällig.<br />
Ihr Wohlstand und ihre Macht sind an<br />
ihre Funktion gebunden. Wenn es um Korruption<br />
geht, muss man dort den Scheinwerfer<br />
auf den Zolldirektor richten, der<br />
ist potenziell der reichste Mann. Wenn der<br />
Scheinwerfer sehr hell ist, wird er vorsichtig<br />
sein, um nicht Konkurrenten anzuziehen.<br />
Kim ist, nach allem, was wir wissen,<br />
kein Konsummensch und an der Anhäufung<br />
von persönlichem Reichtum nicht interessiert.<br />
Er und seine Umgebung brauchen<br />
keinen Luxus.<br />
SPIEGEL: Wo wirken welche Sanktionen am<br />
ehesten?<br />
Langhammer: Kleine offene Volkswirtschaften<br />
kann man am ehesten mit einem<br />
Finanzembargo treffen, indem man sie beispielsweise<br />
vom internationalen Zahlungssystem<br />
Swift abtrennt. Eine große, relativ<br />
geschlossene, rohstoffreiche Volkswirtschaft<br />
wie Russland durch Sanktionen zu<br />
einem Zugeständnis zu zwingen, ist nahezu<br />
aussichtslos. Solche Länder regieren<br />
mit einer Importsubstitutionspolitik, damit<br />
kann man jahrelang durchkommen.<br />
SPIEGEL: Wenn das alles so wenig bringt:<br />
Warum wird überhaupt sanktioniert?<br />
Langhammer: Man möchte politisch Handlungsfähigkeit<br />
beweisen. Man will zeigen,<br />
dass man einer Regierung bestimmte Dinge<br />
nicht durchgehen lässt. Die internationale<br />
Gemeinschaft will Nordkorea dafür<br />
bestrafen, dass es sich über sämtliche Auflagen,<br />
sein aggressives Atomprogramm einzustellen,<br />
hinweggesetzt hat.<br />
SPIEGEL: Drohungen gegen ein Land gab<br />
es früher auch schon: gegen Iran, gegen<br />
den Irak, gegen Libyen. Präsident Donald<br />
Trump droht auch denen, die weiter mit<br />
Nordkorea Handel treiben.<br />
Langhammer: Das ist tatsächlich neu. Früher<br />
gab es Sanktionen, die entweder befolgt<br />
oder ignoriert wurden. Es gab aber nicht<br />
die direkte Drohung eines Regierungschefs<br />
gegenüber einem anderen Land: Wenn du<br />
die Sanktionen nicht befolgst, dann mach<br />
ich dir mit deinem Geschäft in meinem<br />
Land richtig Ärger. Die trumpsche Politik<br />
versteht ja die amerikanische Außenhandelspolitik<br />
im Wesentlichen als Außen -<br />
politik. Das gibt dem amerikanischen<br />
Präsidenten sehr viel Macht, Schrauben<br />
anzuziehen.<br />
SPIEGEL: Sanktionen verursachen, wenn sie<br />
schmerzhaft sind, immer Kosten auf beiden<br />
Seiten: beim Sanktionierten – und<br />
beim Sanktionierenden.<br />
Langhammer: Und meist verwechseln wir<br />
Kosten mit Wirksamkeit. Zumal es einen<br />
Trend gibt: Wir ersetzen physischen Handel<br />
immer mehr durch digitalen Handel<br />
mit Dienstleistungen. Software, Musiktitel<br />
oder Videospiele werden bei Sanktionen<br />
aber überhaupt nicht erfasst. Das ist ein<br />
Milliardengeschäft. Wir wissen gar nicht<br />
mehr, was Handel alles umfasst. Dienstleistungen<br />
haben keine Zölle. Wir wissen nicht<br />
mehr, wo die physische Ländergrenze ist.<br />
<strong>Der</strong> physische Handel wuchs 2016 weniger<br />
als die Weltproduktion und wird auch in<br />
den nächsten Jahren nicht mehr so rasch<br />
wachsen wie früher. Was wir bei den Sanktionen<br />
machen, ist im Grunde altmodisch.<br />
SPIEGEL: Was wäre die Alternative zu Wirtschaftssanktionen?<br />
Langhammer: Wir müssen akzeptieren, dass<br />
es mit Nordkorea eine weitere Nuklearmacht<br />
gibt. Es hätte sie nicht geben dürfen,<br />
aber es gibt sie. Das heißt, wir akzeptieren<br />
die Police einer Lebensversicherung für<br />
Kim. Die Nordkoreaner wollen bilaterale<br />
Gespräche mit den Amerikanern, um als<br />
Nuklearmacht offiziell anerkannt zu werden,<br />
vielleicht muss man da ansetzen. Vielleicht<br />
kann ja auch eine dritte Macht,<br />
Europa oder ein einzelnes europäisches<br />
Land, die Rolle des ehrlichen Maklers übernehmen.<br />
SPIEGEL: Das erfordert strategisches Genie,<br />
taktisches Geschick und psychologisches<br />
Verständnis.<br />
Langhammer: Ich erinnere mich an eine<br />
Anekdote aus meiner Schulzeit. Wir sollten<br />
einen lateinischen Text über eine Belagerung<br />
ins Deutsche übersetzen, es wurde<br />
meine einzige Sechs in Latein. Irgendeine<br />
Festung war eingeschlossen, die Römer<br />
sollten ausgehungert werden, irgendwann<br />
wurden Brote geworfen. Ich hatte keine<br />
Ahnung, wer wohin warf, und musste raten.<br />
Ich übersetzte: Die Belagerer werfen Brote<br />
über die Zinnen, um die Belagerten zur Aufgabe<br />
zu bringen. Anders konnte ich es mir<br />
nicht erklären. Tatsächlich hatte ich die Wagenburgmentalität<br />
nicht verstanden, richtig<br />
war: Die Römer warfen Brote auf die Be -<br />
lagerer, um zu beweisen, wie wirkungslos<br />
das Aushungern ist. Ich hatte offensichtlich<br />
dieses psychologische Verständnis damals<br />
nicht.<br />
Interview: Hauke Goos<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
69
Wirtschaft<br />
Unterm Schuldenberg<br />
Analyse Die Europäische Zentralbank steuert auf eine strengere Geldpolitik zu. Doch zu<br />
einer spürbaren Zinswende wird es nicht kommen. Die Währungshüter sitzen in der Falle.<br />
Wenn eines fernen Tages die Historiker über Mario<br />
Draghi urteilen, dann werden sie um drei Wörter<br />
nicht herumkommen: „whatever it takes“. <strong>Der</strong><br />
Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sie<br />
vor gut fünf Jahren bei einer Investorenkonferenz in London<br />
gesprochen. Die EZB werde tun, was auch immer<br />
notwendig sei, um den Euro zu bewahren, sagte Draghi.<br />
Es war eine Warnung an Spekulanten, die damals angesichts<br />
der hohen Schulden in Ländern wie Griechenland<br />
und Italien auf einen Zerfall der Währungsunion wetteten.<br />
Und es war eine Einladung an alle, auf steigende Kurse<br />
europäischer Anleihen und Aktien zu setzen. <strong>Der</strong> Notenbankchef<br />
hatte eine Garantie ausgesprochen. Die EZB untermauerte<br />
den Schwur, indem sie in großem Stil Staatsund<br />
Unternehmensanleihen kaufte.<br />
Man muss sich das noch einmal in Erinnerung rufen,<br />
um zu verstehen, welche Bedeutung die in den kommenden<br />
Wochen anstehenden geldpolitischen<br />
Entscheidungen haben. Und wie<br />
sie ausfallen werden.<br />
Am Donnerstag wird Draghi erstmals<br />
seit Jahren wohl signalisieren,<br />
dass die EZB die Geldpolitik künftig<br />
etwas restriktiver gestalten will – weniger<br />
Anleihekäufe, vielleicht irgendwann<br />
auch höhere Leitzinsen, aber nur<br />
dann, wenn nichts dazwischenkommt.<br />
Auch in Amerika bremst die Zentralbank<br />
nicht, sie gibt nur etwas weniger<br />
Gas. Und das dürfte so bleiben, egal,<br />
ob weiterhin Janet Yellen die Notenbank<br />
Fed führt oder jemand anderes.<br />
Warum ist das so? Die Notenbanken<br />
sind zu Gefangenen ihrer eigenen<br />
Politik geworden. Nach der Finanzkrise von 2008 und<br />
noch einmal in der Eurokrise haben sie eine Serie von Banken-,<br />
Firmen- und Staatspleiten verhindert.<br />
Investoren und Schuldner haben sich seitdem daran gewöhnt,<br />
dass die Fed, die EZB und andere wichtige Zentralbanken<br />
die Zinsen niedrig halten. Wenn die Zinsen<br />
unterhalb der Inflationsrate liegen – in der Eurozone ist<br />
das beim Leitzins seit 2010 fast ununterbrochen der Fall –,<br />
schrumpfen Verbindlichkeiten automatisch, die Schuldner<br />
müssen weniger abbezahlen, als sie sich geliehen haben.<br />
Ersparnisse verlieren dagegen real an Wert, es kommt<br />
zu einer Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern.<br />
Davon profitieren klamme Staaten wie Italien oder Griechenland,<br />
aber auch die Bundesregierung, die sich sogar<br />
zu Negativzinsen Geld leihen kann.<br />
Trotz der Hilfe durch die EZB sind die Krisenstaaten<br />
der Eurozone nicht von ihren hohen Verbindlichkeiten<br />
heruntergekommen. Weltweit ist die<br />
Summe aus staatlichen und privaten<br />
Schulden sogar auf ein Rekordniveau<br />
gestiegen, die künstlich niedrigen Zinsen<br />
dürften dazu beigetragen haben.<br />
Leitzins der Europäischen Zentralbank, in %<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
–1<br />
Inflationsrate<br />
der Eurozone, in %<br />
2007 Quelle: Thomson Reuters Datastream 2017<br />
Draghi und Yellen selbst rechtfertigen ihre Politik anders.<br />
Die EZB etwa verweist darauf, dass die Inflationsrate,<br />
der wichtigste Gradmesser der Geldpolitik, noch immer<br />
deutlich unter dem Zielwert von zwei Prozent liegt. Eine<br />
Preissteigerung in dieser Höhe gilt als gesund, um Wachstum<br />
zu fördern und Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allem<br />
soll so ein ausreichender Puffer gegen eine Deflation gebildet<br />
werden, also eine Abwärtsspirale aus fallenden Preisen<br />
und schrumpfender Wirtschaft.<br />
Vor etwa zwei Jahren war die Eurozone einem solchen<br />
Szenario bedrohlich nahe. Doch mittlerweile ist das Wachstum<br />
robust, die Inflationsrate in der Währungsunion steht<br />
bei 1,5 Prozent, in Deutschland bei 1,8 Prozent und selbst<br />
im krisengeschüttelten Griechenland bei einem Prozent.<br />
Darüber, ob die Inflation überhaupt sachgemäß ge -<br />
messen wird, ob etwa Wohn-, Ausbildungs- und Gesundheitskosten<br />
adäquat eingepreist werden, kann man zudem<br />
streiten. Es gibt Anzeichen, dass die<br />
offizielle Statistik den Preisanstieg untertreibt.<br />
Zudem beziehen die Notenbanken<br />
den Anstieg von Vermögenswerten<br />
zu wenig in ihre geldpolitischen<br />
Entscheidungen ein.<br />
Große Teile der Bevölkerung verlieren<br />
durch den Anstieg der Aktienkurse<br />
und Immobilienpreise an Kaufkraft:<br />
relativ, weil jüngere Bürger, die noch<br />
kein Sach- oder Finanzvermögen haben,<br />
im Vergleich zu Älteren und Vermögenden<br />
zurückfallen. Die Vermögenspreis-Inflation<br />
wird aber auch absolut<br />
spürbar, etwa wenn sich die rasch<br />
steigenden Immobilienpreise in höheren<br />
Mieten niederschlagen. Schon jetzt<br />
wächst in deutschen Großstädten der Einkommensanteil,<br />
den die Bewohner auf die Miete verwenden.<br />
Aus einem weiteren Grund ist es gefährlich, den Anstieg<br />
der Vermögenspreise zu ignorieren: Es wächst die Gefahr<br />
eines Crashs. Die erratische Politik Donald Trumps oder<br />
ein Platzen der Immobilienblase in China könnten eine<br />
Flucht aus Aktien und riskanten Anleihen auslösen. Mögliche<br />
Folgen wären höhere Marktzinsen, Pleiten, weniger<br />
Investitionen und eine Rezession.<br />
Draghi, Yellen und ihren Kollegen dürfte bewusst sein,<br />
dass sie im Moment wenig Handlungsspielraum hätten,<br />
um auf solche wirtschaftlichen Schocks zu reagieren. Sie<br />
müssen sich Luft für den nächsten Rettungseinsatz verschaffen,<br />
indem sie schrittweise die Anleihenkäufe zurückfahren<br />
und die Zinsen erhöhen.<br />
Gehen sie zu abrupt vor, könnten sie jedoch selbst das<br />
Feuer entfachen, dass sie so sehr fürchten.<br />
Animation:<br />
Was macht die EZB?<br />
spiegel.de/sp432017ezb<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
Denn manch ein Schuldner in der Eurozone<br />
könnte einen schnellen Zinsanstieg<br />
nicht verkraften. Das wird Draghi<br />
nicht zulassen. Whatever it takes.<br />
Martin Hesse<br />
70 DER SPIEGEL 43 / 2017
Gemeinsam machen wir das deutsche<br />
Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt.<br />
Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/martin
PETER RIGAUD / LAIF<br />
Airbus-Vorstandsvorsitzender Enders: Krise, welche Krise?<br />
Im Sumpf<br />
Affären Airbus-Chef Tom Enders gibt im Korruptionsskandal den Aufklärer und schiebt die<br />
Verantwortung auf Manager in Frankreich. Dabei wollte er selbst unbedingt mit ihnen arbeiten.<br />
Eigentlich hatte die „Jetzt rede ich!“-<br />
Woche gut angefangen für Tom Enders,<br />
58: Erst durfte der Airbus-Chef<br />
der französischen Zeitung „Le Monde“<br />
lang und breit erklären, wie er die Welt<br />
sieht, dann dem deutschen „Handelsblatt“,<br />
noch länger, noch breiter. Sein Grundsound:<br />
Krise, welche Krise? Die ganzen<br />
Korruptionsvorwürfe gegen Airbus – alles<br />
halb so wild, alles nicht bewiesen.<br />
<strong>Der</strong>selbe Tom Enders, der noch im Juni<br />
seinen Topmanagern im vertrauten Kreis<br />
gesagt hatte, die Lage sei „todernst“, die<br />
„Scheiße“ könne man nicht länger „unter<br />
den Teppich kehren“, erzählte jetzt, dass<br />
es der Firma prima gehe und das Einzige,<br />
was man ihr vorhalten könne, ein paar fehlende<br />
Angaben gewesen seien. In irgendwelchen<br />
Exportpapieren. Das klang schön<br />
läppisch – und der Chef schön lässig.<br />
So gut ging es dann aber doch nicht weiter.<br />
Am Donnerstag meldeten der SPIEGEL<br />
72 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
und sein französischer Partner Mediapart,<br />
dass Enders ausgerechnet dem Kopf der<br />
Pariser Einheit, die heute im Zentrum des<br />
Schmiergeldverdachts steht, zum Abschied<br />
eine monströse Summe bewilligt hatte.<br />
Rund 80 Millionen Euro kassierte dieser<br />
Jean-Paul Gut demnach.<br />
Jetzt der nächste Dämpfer: Anscheinend<br />
steckt der selbst ernannte Aufklärer<br />
Enders tiefer im Sumpf, als er notorisch<br />
behauptet. Dass er in seiner Zeit als<br />
Deutschlandchef mit der mutmaßlichen<br />
Schmutztruppe um Monsieur Gut zusammengearbeitet<br />
hat, um in Österreich einen<br />
umstrittenen Deal abzuwickeln, war bekannt<br />
(SPIEGEL 41/2017). Weitere Papiere<br />
zeigen nun aber, wie stark er sich dafür<br />
ins Zeug legte, dass ihm das Team aus Paris<br />
behilflich war. Dabei galt damals im<br />
Konzern, dass die Franzosen mit dem<br />
Österreichgeschäft nichts zu tun haben<br />
durften.<br />
Enders ließ sich von Gut und seinen Leuten<br />
die Blaupause für ein Firmenkonstrukt<br />
erstellen, über das nach heutiger Erkenntnis<br />
gut hundert Millionen Euro verschwunden<br />
sind. Die Papiere widersprechen damit<br />
dem, was Enders dem „Handelsblatt“ sagte:<br />
dass er selbst mit der Vector, der dubiosen<br />
Firma im Zentrum des Geflechts,<br />
„gar nichts“ zu tun hatte. Ebenso sprechen<br />
die Umstände gegen seine Darstellung, der<br />
Konzern habe die Minifirma, in die er Riesensummen<br />
pumpte, nie kontrolliert.<br />
Im Mittelpunkt der Affäre bei Airbus –<br />
damals noch EADS – steht heute die inzwischen<br />
aufgelöste Vertriebssparte EADS<br />
International in Paris. Eine Art Sondereinsatzkommando,<br />
das immer dann in die<br />
Schlacht um Aufträge zog, wenn ein Flugzeugdeal<br />
besonders schwierig und schmierig<br />
wurde.<br />
Auch der Verkauf von 18 „Eurofighter“-<br />
Maschinen nach Österreich fiel 2003 in die
Wirtschaft<br />
IN DER SPIEGEL-APP<br />
Kategorie delikater Geschäfte. Trotzdem<br />
sollten die Franzosen damit ursprünglich<br />
nichts zu tun haben. Die EADS-Partner<br />
im „Eurofighter“-Konsortium, die Italiener,<br />
Spanier und Briten, hatten das durchgesetzt.<br />
Sie fürchteten, dass über die Franzosen<br />
Firmengeheimnisse abfließen könnten,<br />
weil EADS in Frankreich noch mit<br />
dem Dassault-Konzern zusammenarbeitete.<br />
<strong>Der</strong> baute ein anderes Kampfflugzeug.<br />
Es war dann Enders, seit 2004 EADS-<br />
Deutschlandchef, der die Truppe in Paris<br />
anbettelte, dass sie trotzdem beim Österreichgeschäft<br />
mitmischen sollte – wenn<br />
schon nicht beim Verkauf, dann wenigstens,<br />
um eine Bedingung zu erfüllen, die Österreich<br />
gestellt hatte. EADS, so der Deal, musste<br />
dem Land nebenher Geschäfte für vier<br />
Milliarden Euro besorgen, um die Wirtschaft<br />
anzukurbeln. Damit wollte die Regierung in<br />
Wien den Wählern die teure Anschaffung<br />
der „Eurofighter“ schmackhaft machen.<br />
Zunächst schien der Chef der Pariser<br />
Einheit, Jean-Paul Gut, zu schmollen.<br />
Doch Enders wollte nicht hinnehmen, dass<br />
sich die Franzosen herauszogen. Erst recht,<br />
weil EADS ja zugesagt hatte, der Wirtschaft<br />
in Österreich Aufträge zu besorgen.<br />
Dieses Versprechen zu halten, habe damals<br />
hohe Priorität gehabt und ihn sehr beschäftigt,<br />
sagte Enders schon 2013 internen Ermittlern<br />
bei EADS, wie aus einem Protokoll<br />
hervorgeht. Er habe sich dazu auch<br />
unterrichten lassen. Leider hätten sich die<br />
Deutschen mit solchen „Gegengeschäften“<br />
bei Rüstungsdeals nicht ausgekannt. Deshalb<br />
habe er auf die Pariser Vertriebsspezialisten<br />
gehofft, auf ihre Erfahrung. Angeblich<br />
ging es ihm jedoch nur darum, wie<br />
man für solche Geschäfte saubere Verträge<br />
mit Beratern, Vermittlern, Agenten aufsetzt,<br />
die helfen sollten.<br />
In Wahrheit war das nicht alles: Schon<br />
im Dezember 2003 lieferten die Franzosen<br />
den Plan für eine Briefkastenfirma auf Zypern.<br />
Sie sollte Millionen aus der Konzernkasse<br />
bekommen, angeblich Erfolgsprämien<br />
dafür, dass die Minifirma Aufträge für<br />
die Wirtschaft in Österreich ranschaffte.<br />
Für dieses windige Zypernmodell machte<br />
sich Enders stark. Angeblich, so seine Erklärung,<br />
konnte ihm die Firma helfen, die<br />
Verpflichtungen in Österreich zu erfüllen.<br />
Aus dem Zypernmodell wurde zwar am<br />
Ende doch nichts, dafür aber aus einer<br />
ganz ähnlichen Firma in London, der<br />
Vector. Jene Firma, bei der die rund hundert<br />
Millionen Euro versickert sind. Warum<br />
sich Enders ausgerechnet von einer<br />
neu gegründeten Zwei-Mann-Bude die nötige<br />
Erfahrung versprochen hatte, Milliardengeschäfte<br />
für Österreichs Wirtschaft hereinzuholen,<br />
blieb bisher sein Geheimnis.<br />
Ebenso, warum er angeblich nicht merkte,<br />
dass dort so viel Geld verschwand, obwohl<br />
er sich doch nach eigenen Angaben stark<br />
für die Gegengeschäfte interessiert hatte.<br />
Und ungeklärt bleibt auch, warum Enders<br />
die Vector überhaupt brauchte.<br />
Schließlich hatte erst das „Eurofighter“-<br />
Konsortium, dann eine von einem früheren<br />
EADS-Mann geführte Firma in Österreich<br />
schon viele Gegengeschäfte beschafft.<br />
Die Firma in Österreich arbeitete auch erfolgreich<br />
daran, noch den Rest hereinzuholen.<br />
Was sollte also die Minifirma in<br />
London? Und wofür bekam sie Geld, wenn<br />
die Arbeit andere erledigten?<br />
Das fragen sich heute auch Staatsanwälte<br />
in München und Wien, die dem Verdacht<br />
nachgehen, dass die Vector mit Geld<br />
von EADS bestochen hat – und dies ihr<br />
wahrer Zweck war. Airbus bestreitet das.<br />
Dass Tom Enders partout nicht auf die<br />
Mannschaft in Paris verzichten wollte, die<br />
er nun als Keimzelle dubioser Geschäfte<br />
anprangert, belegt auch die Mail eines „Eurofighter“-Managers.<br />
„Wir hatten nochmals<br />
versucht (tom und gut) sowie hertrich<br />
und camus zu einer Einigung zur Mitarbeit<br />
von cadudal zu kommen“, hieß es da Ende<br />
2004. Bedeutet: Damals waren sogar die<br />
EADS-Chefs Rainer Hertrich und Philippe<br />
Camus eingeschaltet, damit „tom“ Enders<br />
von Jean-Paul „gut“ dessen wichtigsten<br />
Mann fürs Österreichprojekt freibekam,<br />
Jean-Claude Cadudal.<br />
Zwar blieb Gut im Kern hart: „Leider<br />
ist voraussichtlich alles gescheitert, so dass<br />
ich mit tom vereinbart habe, schritte vorzubereiten,<br />
dass wir eine eigene clearingstelle<br />
einrichten“, heißt es in der Mail des<br />
„Eurofighter“-Managers weiter. Hinter<br />
„clearingstelle“ verbarg sich dann aber offenbar<br />
jene Vector, die heute unter Verdacht<br />
steht. Die Vorlage dafür hatten die<br />
Franzosen mit dem Zypernmodell geliefert.<br />
Obwohl also der Vertrieb in Paris und<br />
der Chef in Deutschland geschlossen hinter<br />
dem Plan standen, eine Klitsche für die<br />
Gegengeschäfte zu gründen – gesteuert<br />
haben soll EADS die neue Vector nicht.<br />
Behauptet Enders jedenfalls. Auch das ist<br />
wohl nur die halbe Wahrheit: In einem<br />
Protokoll von 2004 hieß es, Enders befürworte<br />
persönlich die Gründung der Vorgängerfirma<br />
auf Zypern inklusive der<br />
„damit verbundenen Personalkonsequenzen“.<br />
Nach Lage der Dinge konnte damit<br />
eigentlich nur eines gemeint gewesen sein:<br />
dass zwei deutsche Manager den Konzern<br />
verlassen sollten, um danach die Zypernklitsche<br />
zu führen. In einer internen Präsentation<br />
hieß es unverblümt, die Firma<br />
auf Zypern stehe damit „de facto“ unter<br />
der Kontrolle von EADS.<br />
Genauso aber steuerte mindestens einer<br />
der beiden Deutschen offenbar den Nachfolger<br />
der Zypernfirma, die ominöse<br />
Vector, auch wenn Enders das Gegenteil<br />
behauptet.<br />
Rafael Buschmann, Jürgen Dahlkamp,<br />
Dinah Deckstein, Gunther Latsch, Jörg Schmitt,<br />
Gerald Traufetter<br />
Wartezimmer<br />
Deutschland<br />
Wie fühlt es sich für eine Familie an,<br />
aus ihrem neuen Zuhause gerissen zu<br />
werden? Was bedeutet das für die<br />
Eltern, die ihren Kindern eine Zukunft<br />
ohne Diskriminierung schenken wollten?<br />
Wie kommt ein junges Mädchen<br />
damit zurecht, ihre neuen besten<br />
Freunde zu verlieren? Die Geschichte<br />
einer albanischen Familie in Deutschland<br />
– über erzwungenes Warten, enttäuschte<br />
Hoffnungen und Unwägbarkeiten<br />
der deutschen Abschiebepolitik.<br />
Sehen Sie die Visual Story im<br />
digitalen SPIEGEL, oder scannen Sie<br />
den QR-Code.<br />
JETZT DIGITAL LESEN<br />
MARIA FECK / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
73
Wirtschaft<br />
Einer wird gewinnen<br />
Gesundheitskarte Erst verzögerten Verbandsfunktionäre die digitale Nutzung von Patientendaten,<br />
dann versagte die Industrie. Heimlicher Profiteur des Desasters ist ein Mittelständler aus Koblenz.<br />
Die Schwestern vom Guten Hirten<br />
sind lange schon verschwunden.<br />
Wo sie früher gebetet und geschlafen<br />
haben, liegt heute ein Gewerbegebiet.<br />
Geblieben ist nur die Stille, die über dem<br />
Ort liegt.<br />
<strong>Der</strong> Name des alten Klosters dient noch<br />
immer als Adresse: „Maria Trost“. Doch<br />
in den Neubauten rund um das alte Gemäuer<br />
wird nicht mehr ums Seelenheil gerungen,<br />
hier arbeiten ein Mann und seine<br />
Firma an einer ganz und gar irdischen Erlösung:<br />
endlich ein Mammutprojekt in<br />
Gang zu bringen, das in den zurückliegenden<br />
14 Jahren geschätzte 1,7 Milliarden<br />
Euro verschlungen hat. Es geht um die umstrittene<br />
elektronische Gesundheitskarte,<br />
es geht um ein riesiges IT-Netz, das schon<br />
bald alle Ärzte, Kliniken, Apotheken und<br />
Krankenkassen des Landes miteinander<br />
verbinden soll.<br />
Frank Gotthardt heißt der Mann, Compu -<br />
group sein Unternehmen. Sein Geschäftsfeld:<br />
Software für Ärzte und Krankenhäuser.<br />
In den vergangenen 30 Jahren hat<br />
Gotthardt hier in der nonnenhaften Abgeschiedenheit<br />
einen börsennotierten Softwarekonzern<br />
mit mehr als einer halben<br />
Milliarde Euro Jahresumsatz aufgebaut.<br />
Und er war dabei so forsch und gründlich,<br />
dass Kritiker monieren, er habe sich mit<br />
seinen Programmen wie ein Krake in Praxen<br />
und Kliniken ausgebreitet.<br />
Gotthardt ist gerade dabei, seine Marktmacht<br />
noch weiter ausbauen. <strong>Der</strong> 67-jährige<br />
Unternehmer wirbt bei Ärzten und<br />
Compugroup-Chef Gotthardt<br />
Bill Gates aus dem Westerwald<br />
Kliniken bereits für ein Ding, das einen<br />
ziemlich hässlichen Namen – der „Konnektor“<br />
– hat, aber der entscheidende Baustein<br />
für das Milliardenprojekt Gesundheitskarte<br />
ist. Das Ding ist ein Stück Hardware,<br />
das die einzelnen Praxen sicher mit<br />
dem ungeheuren Datennetz verbinden soll.<br />
Auch diesem Netz haben die Fachleute einen<br />
furchtbaren Namen gegeben. Sie nennen<br />
es „Telematikinfrastruktur“.<br />
Die Pointe ist: Gotthardt wird für viele<br />
Monate voraussichtlich der Einzige sein,<br />
der einen offiziell zugelassenen Konnektor<br />
verkaufen kann, weil die Wettbewerber im<br />
Zeitplan weit zurück liegen.<br />
Für Gotthardt und seine Compugroup<br />
ist das ein Erfolg. Für die Gesundheits -<br />
ALINA EMRICH & KIÊN HOÀNG LÊ / LÊMRICH / DER SPIEGEL<br />
politiker in der Hauptstadt dagegen ist es<br />
eine Peinlichkeit: Dass ein Unternehmer<br />
ungewollt zum Monopolisten werden<br />
kann, ist der bislang letzte Akt im unendlichen<br />
Drama um die Einführung der elektronischen<br />
Gesundheitskarte.<br />
Die Idee für die aus Berlin verordnete<br />
Digitalisierung der Branche reicht zurück<br />
bis in das Jahr 2001. Damals kam heraus,<br />
dass mehr als 50 Patienten starben, die den<br />
Cholesterinsenker Lipobay von Bayer zusammen<br />
mit anderen Medikamenten einge -<br />
nommen hatten. Und die Frage stellte sich:<br />
Warum gibt es keine Datenbank, die nicht<br />
nur Doppeluntersuchungen vermeiden<br />
und Kosten sparen hilft, sondern die Menschen<br />
auch vor gefährlichen Wechselwirkungen<br />
von Medikamenten warnen kann –<br />
und damit möglicherweise Leben rettet.<br />
Wenig später brachte die damalige Gesundheitsministerin<br />
Ulla Schmidt (SPD)<br />
das bislang größte öffentliche IT-Projekt<br />
des Landes auf den Weg: eine smarte elektronische<br />
Gesundheitskarte für alle Ver -<br />
sicherten, die nicht nur Notfalldaten enthalten<br />
sollte, sondern auch einen individuellen<br />
Arzneimittelplan. Röntgenbilder,<br />
Arztbriefe, Informationen über Vorerkrankungen<br />
– auf all diese Informationen sollten<br />
Ärzte und Patienten zugreifen können.<br />
So weit die Hoffnung.<br />
In der Praxis entwickelte sich das Vorhaben<br />
zum Fiasko – und zu einem milliardenteuren<br />
Beleg dafür, wie schwer sich<br />
Deutsch land mit Großprojekten tut. Die<br />
neue Karte wird zwar seit 2011 an die Ver-<br />
LEMRICH<br />
Das Gesundheitsnetz<br />
Wie Ärzte, Kliniken,<br />
Apotheken und Krankenkassen<br />
miteinander<br />
verbunden werden sollen<br />
Konnektor<br />
baut eine sichere Verbindung<br />
zu Patientendaten, zum<br />
Beispiel der Krankenkasse, auf. Kann die Daten<br />
lesen und schreiben.<br />
380410885<br />
Verschlüsselte Verbindung<br />
zur „Telematikinfrastruktur“<br />
(vom World Wide Web<br />
abgeschirmtes Netz)<br />
KRANKENKASSE<br />
340910300<br />
Praxisverwaltungssystem<br />
Lesegerät<br />
steht am Empfang der Praxis,<br />
der Klinik oder in der Apotheke.<br />
Zugang nur mit …<br />
… elektronischer Gesundheitskarte …<br />
Chipkarte mit Personendaten und Lichtbild:<br />
soll als Schlüssel Zugang zu Daten ermöglichen,<br />
die der Patient freigibt: ab 2018 Notfalldaten<br />
und Medikationspläne, später elektronische<br />
Patientenakte mit Röntgenbildern usw.<br />
… und Praxiskarte<br />
enthält den zweiten<br />
Schlüssel, ohne den<br />
kein Zugang möglich ist.<br />
74 DER SPIEGEL 43 / 2017
sicherten verschickt, jedoch fast ohne die<br />
angestrebten Funktionen. Bis heute unterscheidet<br />
sie nur das Passfoto von ihren Vorgängern.<br />
Kassenfunktionäre wie Martin Litsch,<br />
Chef des AOK-Bundesverbands, frotzeln<br />
längst, die Milliardeninvestition habe bislang<br />
kaum mehr als „einen besseren Mitgliedsausweis“<br />
hervorgebracht. Dabei sollte<br />
die Karte längst als Zugangsschlüssel für<br />
Patientendaten dienen. Bis Ende 2018 soll<br />
es offiziell endlich so weit sein. Darauf wetten<br />
würde wohl niemand, der sich jemals<br />
ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat.<br />
Kassenmanager halten eher 2020 für realistisch.<br />
Wenn dieses Mal alles glatt läuft.<br />
Was die Sache so kompliziert macht, ist<br />
die Tatsache, dass eine schier unendliche<br />
Zahl von Funktionären das Projekt gemeinsam<br />
verhandeln und auf den Weg<br />
bringen sollte. Für den Aufbau des besonders<br />
gesicherten Brancheninternets schuf<br />
die Politik eine Betreibergesellschaft namens<br />
Gematik, in der sich die Spitzenverbände<br />
von Ärzten und Kassen jahrelang<br />
belauert und beharkt haben – in Sichtweite<br />
des Bundesgesundheitsministeriums, das<br />
nur wenige Schritte entfernt liegt und dem<br />
Treiben sehr lange und sehr ratlos zusah.<br />
Eine toxische Gemengelage aus Widerwillen,<br />
Inkompetenz und widerstreitenden<br />
Interessen sorgte dafür, dass es jahrelang<br />
kaum voranging. Vor zwei Jahren schritt der<br />
amtierende Ressortchef Hermann Gröhe<br />
(CDU) ein und brachte ein neues E- Health-<br />
Gesetz auf den Weg, das den Verbänden<br />
von Kassen und Ärzten mit strengeren Fristen<br />
und empfindlichen Strafzahlungen<br />
droht, sollten sie bei der Einführung des<br />
neuen Netzes und der geplanten Funktionen<br />
der Karte weiter versagen. Allerdings<br />
währte der Eifer nur kurz. Entnervt hat sich<br />
das Ministerium inzwischen darangemacht,<br />
die Vorgaben wieder zu lockern.<br />
Gestandene Kassenfunktionäre reagieren<br />
mit Augenrollen und Schulterzucken,<br />
wenn es um die leidige Karte geht, und<br />
selbst prominente Vertreter wie AOK-Chef<br />
Litsch erklären, dass sie das Prinzip der<br />
Betreibergesellschaft Gematik für gescheitert<br />
halten. Allerdings hat sich eines im<br />
Lauf der Jahre verändert: Inzwischen ist<br />
es vor allem die Industrie, die fast alle gesetzten<br />
Fristen vertrödelt.<br />
Doris Pfeiffer, Chefin des GKV-Spitzenverbands,<br />
hat die Probleme akribisch aufgeschrieben.<br />
Und diese Liste des Versagens<br />
ist lang geworden: verzögerte Lieferung<br />
der Testkarten; nicht onlinefähige Kartenterminals;<br />
mangelnde Termintreue; Start<br />
der Erprobung: 25 Monate nach dem vereinbarten<br />
Termin. Vor allem: Probleme<br />
beim Konnektor.<br />
Vor Jahren hatte die Gematik gleich<br />
zwei große Konsortien beauftragt, diese<br />
sicheren Verbindungsboxen zu entwickeln.<br />
Eines wird angeführt von der Telekom-<br />
Tochter T-Systems, das andere von der<br />
Compugroup. Doch ausgerechnet der Telekom-Ableger,<br />
immerhin noch zu einem<br />
knappen Drittel in Staatsbesitz, schaffte<br />
es nicht, die notwendige Technik rechtzeitig<br />
bereitzustellen; einem speziell für den<br />
Testbetrieb entwickelten Konnektor wurde<br />
die Genehmigung verweigert. <strong>Der</strong> geplante<br />
Testlauf in echten Praxen fand schließlich<br />
zunächst ohne T-Systems statt. Was<br />
das für ihren Vertrag bedeutet, darüber<br />
verhandeln Gematik und das Unternehmen<br />
noch immer.<br />
T-Systems selbst führt die Verspätung<br />
vor allem auf unstete Anforderungen der<br />
Betreibergesellschaft zurück. „Seit Projektbeginn<br />
hat es rund 160 Änderungen<br />
an den Vorgaben gegeben. Die letzten<br />
stammen noch aus dem Juni“, sagt Telekom-Sprecher<br />
Rainer Knirsch. Außerdem<br />
seien die Sicherheitsanforderungen an die<br />
Technik beispielsweise gegen Cyberangriffe<br />
massiv gestiegen. „Dafür brauchten die<br />
Unternehmen mehr Entwicklungszeit“, so<br />
Knirsch. Die Klagen der Kassen über die<br />
Industrie seien „ein Stück ritualisierte<br />
Kommunikation“.<br />
Die Compugroup konnte mit den wechselnden<br />
Vorgaben offensichtlich besser<br />
umgehen. In diesem Frühjahr testete sie<br />
in 500 Praxen, ob sich Adressdaten oder<br />
Geburtstage der Versicherten sicher und<br />
schnell aktualisieren lassen. Die Gematik<br />
stufte den Probelauf als erfolgreich ein.<br />
Alle rund 150000 Arztpraxen und 2000 Kliniken<br />
sollen bis Mitte 2018 mit Konnektoren<br />
und Lesegeräten beliefert werden, so<br />
sieht es das E-Health-Gesetz vor. Deshalb<br />
hat Gotthardt jetzt einen Vorsprung.<br />
Noch im Oktober, so hofft man in Koblenz,<br />
könne die Gematik das letzte Okay<br />
für den Compugroup-Konnektor geben.<br />
Gotthardt wäre damit zunächst der einzige<br />
Anbieter auf dem Markt – eine Lage, die<br />
auch dem Gesundheitsministerium nicht<br />
besonders behagt.<br />
Es sei ärgerlich, dass in diesem Jahr voraussichtlich<br />
nur eines der beiden großen<br />
Industriekonsortien auf den Markt gehen<br />
könne, heißt es bei Gröhes Beamten. Allerdings<br />
tue man alles dafür, dass es bald<br />
einen weiteren Wettbewerber gebe: So hat<br />
die Gematik im Sommer den österreichischen<br />
IT-Dienstleister Rise beauftragt,<br />
einen weiteren Konnektor zu entwickeln.<br />
Die Vorgabe: Die Geräte sollen im ersten<br />
Quartal 2018 bereitstehen.<br />
Auch T-Systems hofft inzwischen wieder<br />
darauf, Praxen und Kliniken im Frühjahr<br />
2018 beliefern zu können. Anfang Oktober<br />
hat das Unternehmen ein großes Paket mit<br />
den neu entwickelten Geräten bei der Gematik<br />
als sogenanntes Produktmuster eingereicht.<br />
Mitte November will T-Systems<br />
den Konnektor offiziell zur Zulassung schicken,<br />
ein Prozedere, das einige Monate<br />
dauern könnte. Das Unternehmen selbst<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
75<br />
ISBN 9783548377490
WIE EIN<br />
LAND<br />
IN DIE<br />
DIKTATUR<br />
DRIFTET<br />
256 Seiten · Gebunden · A 20,00 (D)<br />
Auch als E-Book erhältlich<br />
SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent<br />
Hasnain Kazim hat miterlebt,<br />
wie die Türkei sich in den vergangenen<br />
Jahren radikalisierte. In seinem Buch<br />
zeigt er, wie explosiv die Situation<br />
im Land ist und was das Ende der<br />
Demokratie am Bosporus bedeutet –<br />
für die Türkei, für die Region<br />
und für Europa.<br />
»Es ist die jüngste Geschichte<br />
der Türkei, und es ist meine<br />
Geschichte in der Türkei.«<br />
HASNAIN KAZIM<br />
www.dva.de<br />
Wirtschaft<br />
rechnet damit, dass es seine Geräte im Fe -<br />
bruar oder März auf den Markt bringen<br />
kann – und damit fast ein halbes Jahr nach<br />
Gotthardt.<br />
In den nächsten Monaten muss die Compu -<br />
group Konkurrenz also nicht fürchten. Auch<br />
ihm sei Wettbewerb lieber, schon aus marktwirtschaftlichem<br />
Prinzip, sagt Gotthardt.<br />
Doch seine Genugtuung darüber, dass er<br />
die große T-Systems ausgestochen hat, versucht<br />
der Mittelständler nicht zu verstecken.<br />
„Ich bin nicht traurig darüber, dass<br />
wir so leistungsfähig sind.“ Die Compugroup<br />
sei eben kein IT-Gemischtwarenladen.<br />
Tatsächlich hat er sein Unternehmen<br />
konsequent auf den Gesundheitsmarkt ausgerichtet.<br />
In den Siebzigerjahren erhielt<br />
Gotthardt den ersten Auftrag von seiner<br />
Tante, die in Koblenz einen Dentalgroßhandel<br />
betrieb. Für sie und andere Kunden<br />
schrieb der junge Programmierer Buchhaltungssoftware.<br />
Als einer seiner Kunden in<br />
die Insolvenz schlitterte, übernahm Gotthardt<br />
als Gegenleistung eine Firma mit<br />
einem Kundenstamm von 70 Zahnarzt -<br />
praxen und modernisierte deren Software –<br />
der Grundstein seines Geschäfts.<br />
Gewachsen ist es vor allem durch Übernahmen.<br />
Zuerst wurde Gotthardts Compugroup<br />
zum Marktführer für Zahnarztsoftware.<br />
2003 schluckte das Unternehmen<br />
mithilfe eines Finanzinvestors zwei Anbieter<br />
für Allgemeinmedizinersoftware und<br />
setzte sich an die Spitze auch dieses Marktes.<br />
Vier Jahre später ging die Compugroup<br />
an die Börse. Für die deutsche Gesundheitsbranche<br />
ist er so etwas wie ein<br />
Bill Gates aus dem Westerwald.<br />
Den ersten Konnektor hat Gotthardt in<br />
der Zahnarztpraxis seiner Frau installieren<br />
lassen, in einem 2000-Seelen-Dorf. Wenn<br />
die Sprechstundenhilfe die elektronische<br />
Gesundheitskarte neuer Patienten in den<br />
Leseschlitz einführt, zeigt ein Computerprogramm<br />
an, ob sie korrekt krankenversichert<br />
sind. „Das dauert nur Sekunden“,<br />
schwärmt Gotthardt – und es klingt, als suche<br />
er einen Beweis, dass das Not leidende<br />
Megaprojekt Gesundheitskarte eben doch<br />
nicht tot sei.<br />
Das Thema Gesundheitskarte dürfte<br />
auch bei den Koali tionsverhandlungen in<br />
Berlin eine Rolle spielen. Denn es gibt Kassenmanager,<br />
die darüber nachdenken, ob<br />
es nicht besser wäre, das Milliardenvorhaben<br />
mit dem absehbaren Regierungswechsel<br />
einfach einzustampfen.<br />
AOK, Techniker Krankenkasse (TK) und<br />
Co. sind bereits dazu übergegangen, nicht<br />
mehr auf staatliche Vorgaben für die digitale<br />
Patientenakte zu warten, sondern<br />
Apps für ihre Versicherten selbst zu entwickeln.<br />
Die TK hat sich den Software -<br />
riesen IBM ins Boot geholt. Die AOK stellte<br />
am Dienstag in Berlin ein Pilotprojekt<br />
vor, bei dem Patienten von ihrem Smart -<br />
phone aus selbst auf ihre Daten zugreifen<br />
76 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
können. Ein Stück Plastik mit einem Chip<br />
darauf spielt in diesem Projekt keine Rolle.<br />
Allerdings wollen auch die Ortskrankenkassen<br />
das neue, sichere IT-Netz nutzen.<br />
Alles andere wäre für die Compugroup<br />
ein herber Rückschlag. Nach eigenen Angaben<br />
hat das Unternehmen bereits einen<br />
zweistelligen Millionenbetrag in das Projekt<br />
investiert. Die Platinen und Gehäuse<br />
für die Konnektor-Produktion warten bereits<br />
in Containern, bei einem Auftragsfertiger<br />
steht eine Produktionsstraße für die<br />
Boxen bereit. Mehr als 500 Techniker für<br />
den Einbau in den Praxen hat die Compugroup<br />
geschult.<br />
Was fehlt, ist die finale Zulassung der<br />
Gematik, bevor die Compugroup ihre<br />
Geräte ausliefern kann. Nach Gotthardts<br />
ursprünglichen Plänen wollte er bis Jahres -<br />
ende 40000 Praxen mit der neuen Technik<br />
ausstatten. Nun hofft er, dass es bis Ende<br />
Dezember noch 10000 werden könnten.<br />
Den Erfolg würden ihm nicht alle in der<br />
Branche gönnen, er hat dort nicht nur<br />
Freunde. Schon heute nutzen 40 Prozent<br />
aller Arzt- und Zahnarztpraxen in Deutschland<br />
seine Software und seine Dienste.<br />
Gotthardts Marketing gilt als aggressiv. Zuletzt<br />
eckte er mit der Werbung für seine<br />
Konnektoren an, kurz entschlossene Besteller<br />
köderte er mit einem „Frühbucher-<br />
Rabatt“. Arztpraxen, die sich für die „Basisausstattung<br />
mit Konnektor, Kartenleser,<br />
VPN-Zugangsdienst und Ein weisung des<br />
Teams“ entschieden, bot sein Finanzvorstand<br />
via Interview schon im Sommer einen<br />
Preis von 3690 Euro inklusive Mehrwertsteuer<br />
an – zum Ärger einer großen<br />
Kassenärztlichen Vereinigung, die das als<br />
voreilig empfand. Erst ein Krisengespräch<br />
konnte den Streit schlichten.<br />
Auch im Gesundheitsministerium haben<br />
Beamte Gotthardt nahegelegt, seine Marktmacht<br />
nicht zu missbrauchen. Die Angst,<br />
dass die Compugroup ihren technischen<br />
Vorsprung nutzen könnte, um ein dauerhaftes<br />
Monopol zu schaffen, hält Gotthardt<br />
für überzogen. „Im Prinzip bauen wir<br />
doch auch eine Plattform für unsere Wettbewerber“,<br />
sagt er. <strong>Der</strong> für ihn interessante<br />
Markt sei nicht der Aufbau der Infrastruktur.<br />
Es seien die neuartigen Dienste, die<br />
darauf möglich würden. Seine Rechnung<br />
ist einfach: Wenn er einen Konnektor verkauft,<br />
verdient er nur ein einziges Mal.<br />
Wenn eine Arztpraxis aber seine Software<br />
und seine Dienste dazu erwirbt, wird ein<br />
dauerhaftes Geschäft daraus.<br />
Nur für ein grundsätzlicheres Problem<br />
muss auch Gotthardt eine Lösung finden:<br />
die Zweifel der Patienten. Das Datenschutzniveau<br />
sei „außerordentlich hoch“,<br />
wie Gotthardt sagt. Doch wenn man das<br />
Wort „elektronische Gesundheitskarte“ im<br />
Internet sucht, ist „verweigern“ noch immer<br />
einer der ersten Treffer.<br />
Marcel Rosenbach, Cornelia Schmergal
0RUJHQ<br />
LVWHLQIDFK<br />
:HQQPDQVLFKPLWGHU<br />
ULFKWLJHQ$QODJHVWUDWHJLH<br />
DXFKEHLQLHGULJHQ=LQVHQ<br />
:QVFKHHUIOOHQNDQQ<br />
6SUHFKHQ6LHPLWXQV<br />
VSDUNDVVHGHPRUJHQ<br />
:HQQ·VXP*HOGJHKW
Ausland<br />
USA<br />
<strong>Der</strong> Charaktertest<br />
Für einen amerikanischen<br />
Präsidenten gibt es kaum<br />
eine heiklere Aufgabe als den<br />
Anruf bei der Familie eines<br />
gefallenen Soldaten. Wer mit<br />
den Hinterbliebenen spricht,<br />
muss aus sich selbst heraus<br />
die angemessenen Worte finden,<br />
es gibt kein Manuskript<br />
für solche Telefonate. Ein<br />
Kondolenzanruf ist der<br />
Charaktertest für den Oberbefehlshaber.<br />
Donald Trump<br />
hat ihn nicht bestanden.<br />
Im Grunde hat er in der Affäre<br />
um seinen Anruf bei der<br />
Witwe des gefallenen Sol -<br />
daten David Johnson alles<br />
falsch gemacht, was man als<br />
Präsident falsch machen<br />
kann. Er reagierte viel zu<br />
spät auf die Nachricht, dass<br />
Anfang Oktober vier US-Soldaten<br />
in Niger getötet worden<br />
waren. Dann sagte er der<br />
Witwe den unfassbaren Satz,<br />
ihr Mann habe ja gewusst,<br />
worauf er sich einlasse, „aber<br />
ich glaube, es tut trotzdem<br />
weh“. Das ist nicht nur haarsträubend<br />
unsensibel, sondern<br />
unamerikanisch. Trump<br />
bringt ausgerechnet jene<br />
gegen sich auf, die er in den<br />
Krieg schickt. Ein strategisch<br />
äußerst unkluges Vorgehen in<br />
einer Nation, die mit Stolz<br />
auf ihre Armee blickt.<br />
Natürlich kommen nun<br />
weitere Taktlosigkeiten ans<br />
Licht. Einem trauernden<br />
Vater versprach Trump 25 000<br />
Dollar für den Verlust seines<br />
Sohnes, versäumte es aber,<br />
das Geld zu überweisen. Er<br />
behauptete, im Gegensatz zu<br />
ihm hätten andere Präsidenten<br />
keine Kondolenzanrufe<br />
getätigt, was nicht stimmt.<br />
Und er zog seinen Stabschef<br />
John Kelly in die Sache<br />
hinein, der einen Sohn unter<br />
Obama in Afghanistan ver -<br />
loren hatte und das ungern<br />
öffentlich zum Thema macht:<br />
Er forderte Journalisten auf,<br />
Kelly darauf anzusprechen.<br />
Trumps Präsidentschaft hatte<br />
von Anfang an selbstzerstörerische,<br />
nihilistische Züge.<br />
Hinter den Familien gefallener<br />
Soldaten steht nun das<br />
ganze Land. cx<br />
Venezuela<br />
Hilfe vom IWF<br />
<strong>Der</strong> Internationale Währungsfonds<br />
(IWF) erwägt offenbar,<br />
der Regierung von Nicolás<br />
Maduro mit einem Notkredit<br />
zu helfen, sollte das hoch<br />
verschuldete Land den Staatsbankrott<br />
erklären. IWF-Experten<br />
schätzen die Kosten eines<br />
Rettungspakets auf rund<br />
30 Milliarden US-Dollar jährlich.<br />
In zwei Wochen muss<br />
Caracas Schuldenzahlungen<br />
Chen<br />
China<br />
Beton und<br />
Gehorsam<br />
<strong>Der</strong> 19. Kongress von Chinas<br />
Kommunistischer Partei ist<br />
reich an Pomp und Ritualen.<br />
Eine Personalie ist bei aller<br />
Huldigung von Parteichef Xi<br />
Jinping allerdings interessant:<br />
der Aufstieg seines Vertrauten<br />
Chen Min’er. Könnte er<br />
der Mann sein, den Xi langfristig<br />
für seine Nachfolge in<br />
Stellung bringt? Und was<br />
würde das für Chinas Zukunft<br />
bedeuten? Chen, 57,<br />
stammt aus der reichen<br />
Küstenprovinz Zhejiang, wo<br />
er dem heutigen Präsidenten<br />
einst als Propagandachef<br />
diente. 2012 schickte ihn Xi<br />
nach Guizhou, eine der ärmsten<br />
Regionen, wo Chen in<br />
fast fünf Jahren gut 2500<br />
Kilometer Autobahnen, zwei<br />
der höchsten Brücken und<br />
das größte Radio teleskop der<br />
Welt errichten ließ. Im Juli<br />
machte Xi ihn zum Parteichef<br />
der Megastadt Chongqing,<br />
womit Chen ins Politbüro<br />
aufrückt, womöglich sogar in<br />
von über zwei Milliarden<br />
Dollar bedienen. Geld, das<br />
dringend für Lebensmittel -<br />
importe benötigt wird. Die<br />
Hungerkrise wird sich dadurch<br />
voraussichtlich verschärfen –<br />
mehr als 80 Prozent der Lebensmittel<br />
werden eingeführt.<br />
Misswirtschaft, Korruption<br />
und der Absturz des Ölpreises<br />
haben den einst reichen<br />
Ölstaat in den Abgrund<br />
getrieben. Eine Finanzspritze<br />
des IWF könnte jedoch ausgerechnet<br />
an Präsident Nicolás<br />
TYRONE SIU / REUTERS<br />
dessen „Ständigen Ausschuss“,<br />
das sieben Mitglieder<br />
zählende, mächtigste<br />
Gremium der Volksrepublik.<br />
Chens selbst für Insider überraschend<br />
schneller Aufstieg<br />
deutet an, welche Eigenschaften<br />
in Xis China an die Spitze<br />
führen: Bauwut und unbedingte<br />
Loyalität. Das bäuer -<br />
liche Guizhou hat heute<br />
mehr Autobahnkilometer als<br />
Großbritannien, und aus dem<br />
Munde des Gesalbten ist kein<br />
kritisches Wort über Xi überliefert,<br />
aber viele von dessen<br />
goldenen Sentenzen: „Die<br />
Macht muss in den Käfig der<br />
Institutionen eingesperrt<br />
werden“, zitierte Chen 2015<br />
seinen Mentor. Dass Xi sich<br />
selbst an diese Regel hielte,<br />
kann man nicht sagen. bza<br />
Maduro scheitern, denn seine<br />
Regierung müsste um Beistand<br />
bitten, und das ist<br />
kaum zu erwarten: Venezuela<br />
hatte bereits 2007 alle Beziehungen<br />
zum IWF abgebrochen.<br />
Politisch hat Maduro<br />
zudem seine Macht gefestigt:<br />
Mit dem wohl manipulierten<br />
Sieg der Regierungspartei<br />
bei den Gouverneurswahlen<br />
vom vergangenen Sonntag<br />
hat er die Opposition isoliert,<br />
ein Machtwechsel ist nicht<br />
in Sicht. jgl<br />
Regierungsanhänger in Caracas<br />
JUAN BARRETO / AFP<br />
78 DER SPIEGEL 43 / 2017
Schreie von rechts<br />
Ihren Nationalfeiertag hat die Ukraine eigentlich im August – die radikale Rechte aber begeht<br />
den 14. Oktober, den „Tag der Vaterlandsverteidiger“. 5000 Polizisten schützten den um -<br />
strittenen Marsch, der an die Gründung der Ukrainischen Aufstandsarmee im Zweiten Weltkrieg<br />
erinnert. Sie half einst an der Seite der Deutschen bei der Ermordung der Juden und<br />
kämpfte später gegen die Deutschen – ebenso wie gegen Polen und die Sowjetunion.<br />
ANATOLII STEPANOV / DPA<br />
Kommentar<br />
Farce an der Urne<br />
<strong>Der</strong> erneute Wahlgang in Kenia ist nur ein hohles Ritual.<br />
Das Wahltheater in Kenia geht weiter. Im August, beim ersten<br />
Versuch, einen neuen Präsidenten zu wählen, wurde massiv<br />
manipuliert. Am kommenden Donnerstag soll das Volk nun<br />
ein zweites Mal abstimmen. Nachdem Oppositionsführer Raila<br />
Odinga aus dem Rennen ausgestiegen ist, weil er neuerliche<br />
Fälschungen befürchtet, wird der Urnengang zur Farce: <strong>Der</strong><br />
Amtsinhaber, Präsident Uhuru Kenyatta, hat keinen Gegner<br />
mehr, ein Sieg scheint ihm sicher. In den Hochburgen der Anhänger<br />
Odingas herrscht schon jetzt Bürgerkriegsstimmung.<br />
Pessimisten schließen nicht aus, dass sich die Katastrophe des<br />
Jahres 2008 wiederholen könnte, als nach einer chaotischen<br />
Präsidentschaftswahl mehr als 1300 Menschen getötet wurden.<br />
Das Beispiel Kenia zeigt, wie gefährlich Wahlen in fragilen<br />
Nationen sein können: Sie spalten die Wählerschaft entlang<br />
ethnischer Trennlinien. An der Urne werden aus Kenianern<br />
dann Kikuyu, Luo oder Kalenjin, es zählt nur noch die ethnische<br />
Loyalität. Die Programme der Spitzenkandidaten unterscheiden<br />
sich ohnehin nicht: Es geht ihnen allein um die<br />
Macht – und um den Zugriff auf staatliche Ressourcen, die<br />
sie dann an ihre Volksgruppen verteilen. Kenia lehrt auch,<br />
dass Wahlen noch keine Demokratie machen, in Afrika sind<br />
sie oft nur Fassade. Und sie können Gesellschaften zerrütten,<br />
weil der demokratische Unterbau fehlt. Aber die Wahl -<br />
beobachter aus dem Westen sind oft schon zufrieden, wenn<br />
Abstimmungen überhaupt über die Bühne gehen. Da scheint<br />
zu gelten: nicht so genau hinschauen; Hauptsache, gewählt;<br />
schnell wieder heim. Auch den ersten Anlauf in Kenia hatten<br />
sie abgesegnet, es war das Oberste Gericht Kenias, das das<br />
Ergebnis schließlich für ungültig erklärte und eine Wieder -<br />
holung der Wahl anordnete. So verkommt die Demokratie<br />
zum Elektoralismus, zu einem hohlen Wahlritual mit fatalen<br />
Folgen.<br />
Bartholomäus Grill<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 79
Ausland<br />
<strong>Der</strong> Entrümpler<br />
Österreich Wieder hat ein junger Mann die Macht erobert und höflich, aber skrupellos das<br />
Establishment entsorgt. Doch was ist Sebastian Kurz: ein guter Europäer oder ein Opportunist<br />
mit Gespür für den rechten Zeitgeist? Und was bedeutet sein Sieg für Deutschland?<br />
<strong>Der</strong> Mann, der gerade so elegant auf<br />
dem Zeitgeist surft wie einst Robby<br />
Naish auf den Wellen vor Hawaii,<br />
will jetzt kurz demonstrieren, wie man das<br />
macht mit dem Entrümpeln. Er steht in<br />
seinem Büro im altehrwürdigen Außen -<br />
ministerium am Wiener Minoritenplatz<br />
und deutet auf Ecken und Wände, wo früher<br />
antikes Mobiliar stand oder alte Gemälde<br />
hingen. Alles entsorgt, ausgemistet,<br />
von ihm persönlich. Schön leer jetzt, schön<br />
kühl und modern. Selbst das Holzkreuz<br />
an der Wand wirkt wie moderne Kunst.<br />
Sebastian Kurz geht hinter seinen höhenverstellbaren<br />
Schreibtisch im Industriedesign<br />
und deutet auf das Bild, das er aufhängen<br />
ließ. Eine gemalte Karte Europas,<br />
mit der kleinen künstlerischen Verfremdung,<br />
dass Finnland unten liegt, Spanien,<br />
Italien und Griechenland hingegen liegen<br />
oben. Europa steht im Büro von Sebastian<br />
Kurz auf dem Kopf. Um sicherzustellen,<br />
dass der Gast es bemerkt, weist er noch<br />
mal darauf hin. Auf dem Kopf. Vielsagender<br />
Blick. Lächeln.<br />
Er lächelt viel an diesem Mittwoch nach<br />
dem Sieg. Seine dezent gepuderten Wangen<br />
leuchten so rosig und frisch wie die<br />
des Jungen auf der Kinderschokoladen -<br />
packung. So wie er sein Büro entrümpelt<br />
hat, hat Kurz innerhalb weniger Monate<br />
auch seine Partei entrümpelt und die alte,<br />
traditionelle ÖVP in eine moderne Bewegung<br />
mit starkem Anführer verwandelt.<br />
Er hat einen scharfen Anti-Flüchtlings-<br />
Wahlkampf geführt und damit den politischen<br />
Diskurs so beeinflusst, dass am<br />
Wahltag zwei Parteien deutlich rechts der<br />
Mitte zusammen fast 60 Prozent der Stimmen<br />
erhielten: die stramm rechte FPÖ und<br />
die konservative ÖVP, die inzwischen nur<br />
noch „Liste Sebastian Kurz“ heißt.<br />
Wenn sein Plan aufgeht, wird Kurz mit<br />
31 Jahren der jüngste Regierungschef<br />
Europas sein, nachdem er mit 27 Jahren<br />
schon jüngster Außenminister wurde. Das<br />
allein hat etwas Surreales. Aber Kurz ist<br />
dieser Superlativ nicht genug. Er scheint<br />
gewillt, nicht nur seine Partei und sein<br />
Land auf den Kopf zu stellen, sondern<br />
auch die europäische Politik. Die Nationalisten<br />
in Ungarn oder Polen freuen sich<br />
schon auf einen Verbündeten im Kampf<br />
gegen das flüchtlingsfreundliche Europa.<br />
In Deutschland blickt man mit einer<br />
Mischung aus Faszination, Sehnsucht und<br />
80 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Kurz ist kein Extremer,<br />
sondern er ist einfach<br />
nur extrem hungrig<br />
nach Macht und Erfolg.<br />
Kopfschütteln auf Kurz und seine Bewegung.<br />
„Warum haben wir nicht so einen?“,<br />
fragte schmachtend die ewig nach politischen<br />
Erlösern fahndende „Bild“-Zeitung.<br />
Mit seiner Kombination aus jugendlichem<br />
Charme, einem politischen Stil, der<br />
Traditionen und alte Gepflogenheiten<br />
überwinden will, und einer konsequent<br />
auf Abschottung setzenden Programmatik<br />
scheint Kurz den Zeitgeist gerade besser<br />
zu bedienen als viele andere Politiker. Er<br />
hat es jedenfalls geschafft, die meisten seiner<br />
Konkurrenten als Leute von gestern<br />
erscheinen zu lassen.<br />
Sein Kurs in der Flüchtlingspolitik<br />
hat Auswirkungen weit über Österreich<br />
hinaus. Für viele in der Union, die sich<br />
spätestens seit dem Erfolg der AfD einen<br />
Rechtsruck ihrer Parteien wünschen, ist<br />
Kurz nun ein Gegenmodell zur eigenen<br />
Kanzlerin. Er verkörpert jene Eigenschaften<br />
und Positionen, die sie an ihrer Chefin<br />
vermissen. Jens Spahn, der sich auf politische<br />
Symbolik schon immer gut verstand,<br />
postete am Wahlabend ein Grinse-Selfie<br />
mit Kurz von dessen Siegesfeier in Wien.<br />
Das Signal war klar: Eine andere, konservativere<br />
Politik ist auch in Deutschland<br />
möglich, mit Jens Spahn an der Spitze, der<br />
einigen in der Union ohnehin als bevorzugter<br />
Merkel-Nachfolger gilt.<br />
Aber taugt Sebastian Kurz wirklich als<br />
leuchtendes Vorbild? Ist er tatsächlich jener<br />
konservative Wunderknabe, als der er<br />
nun vielerorts gefeiert wird?<br />
Seine Geschichte ist die eines begabten<br />
Aufsteigers, der aus einem Wiener Arbeiterbezirk<br />
nach oben drängte. Er wuchs in<br />
Meidling auf, im Westen Wiens, als einziges<br />
Kind eines Ingenieurs und einer Lehrerin.<br />
Die Familie wohnte in einem Mehrfamilienhaus.<br />
Kurz selbst spricht von einer<br />
friedlichen, glücklichen Kindheit. Seinen<br />
Aufstieg in der Politik beschreibt er als Folge<br />
einiger Zufälle und glücklicher Umstände,<br />
aber das blendet den glühenden Ehrgeiz<br />
aus, der ihn antreibt.<br />
Nein, Sebastian Kurz ist kein Nazi, auch<br />
kein Rassist. Selbst wenn Linke, Satiriker<br />
oder gar die „New York Times“ ihn nun in<br />
diese Nähe rücken. Aber das trifft es nicht.<br />
Er hat die Migration zum alles überwölbenden<br />
Wahlkampfthema gemacht, das<br />
schon, und er hat fast alle Forderungen der<br />
FPÖ übernommen. „Kurz hat uns die Themen<br />
geklaut“, klagte FPÖ-Chef Heinz-<br />
Christian Strache hinterher. Kurz hat die<br />
Themen der Rechten endgültig salonfähig<br />
gemacht – aber er hat der FPÖ damit eben<br />
auch 168000 Wähler abgejagt.<br />
Kurz, das ist das Wahrscheinlichste, ist<br />
kein Extremer, sondern einfach nur extrem<br />
hungrig nach Macht und Erfolg, ein konservativer<br />
Karrierist, der vermutlich auch<br />
ein linker Karrierist hätte werden können,<br />
wäre es dem Aufstieg dienlich gewesen.<br />
Die prägendste Ideologie, die man ihm zuschreiben<br />
kann, ist der Opportunismus.<br />
„Manchmal habe ich das Gefühl, er wollte<br />
eigentlich nur Klassensprecher werden,<br />
und dann ist das Ganze eskaliert“, hat Strache<br />
einmal über Kurz gesagt, nun wird er<br />
wohl sein Koalitionspartner und Vizeklassensprecher<br />
werden.<br />
„Fesch“ ist das Wort, das in keinem Zeitungsartikel<br />
über Kurz fehlt. Fesch heißt<br />
gut aussehend, zuvorkommend, athletisch,<br />
sportlich, lässig, mit derselben Beschreibung<br />
wurde einst auch Jörg Haider von<br />
seinen Fans bedacht, der frühere FPÖ-<br />
Chef, der vor neun Jahren bei einem<br />
Autounfall starb. Vielleicht ist Sebastian<br />
Kurz ihm auch darin nicht unähnlich, dass<br />
er ein gutes Gespür für die politische Stimmung<br />
hat. Und die ist in Österreich, stärker<br />
noch als in Deutschland, geprägt von<br />
der Angst vor Überfremdung und dem<br />
Wunsch nach einfachen Antworten auf die<br />
Probleme einer komplexen Welt.<br />
Verstörend jedoch ist die Schmerzfreiheit,<br />
mit der Kurz auf ein Bündnis mit Leuten<br />
zusteuert, die teilweise politisch nicht<br />
weit von Nazis entfernt sind oder zumindest<br />
welche waren. Für Österreich mag das<br />
nicht allzu überraschend sein, schließlich<br />
ist die FPÖ hier längst eine fast normale<br />
Partei, für Europa hingegen schon.<br />
FPÖ-Chef Strache nahm einst an Zelt -<br />
lagern der „volkstreuen Jugend“ teil, einer<br />
völkischen Nachwuchsorganisation. Er zog<br />
zusammen mit Neonazis bei Demos durch<br />
die Straßen und nahm an paramilitärischen<br />
Wehrsportübungen teil. Spricht man Kurz
Wahlsieger Kurz: Ein konservativer Karrierist<br />
CHRISTIAN BRUNA / SHUTTERSTOCK<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 81
Ausland<br />
Wahlparty der FPÖ in Wien: Nicht weit von Nazis entfernt<br />
auf die Gesinnung seines Wunschpartners<br />
an, spielt er das charmant lächelnd herunter.<br />
Am Mittwochabend hat er sich erstmals<br />
mit Strache privat in dessen Wohnung getroffen.<br />
In einem „offenen, sympathischen,<br />
freundlichen“ Gespräch sei man sich auch<br />
„menschlich nähergekommen“, berichtete<br />
Strache später.<br />
Kurz ist der konservativste Vertreter jenes<br />
neuen Politikertypus, der nun weltweit<br />
Erfolge feiert. Dazu zählen der kanadische<br />
Premier Justin Trudeau und Frankreichs<br />
Präsident Emmanuel Macron, aus Deutschland<br />
gesellt sich am ehesten FDP-Chef<br />
Christian Lindner in diese Riege.<br />
Die Generation Slim-Fit, wie Kurz und<br />
Kollegen in Anspielung auf ihre eng geschnittenen<br />
Anzüge sowie ihre manchmal<br />
eher dünnen Programme genannt werden,<br />
reklamiert für sich eine Politik jenseits der<br />
Kategorien rechts und links. Sie vertreten<br />
einen postideologischen Politikansatz, profitieren<br />
meist von einem ausgeprägten<br />
Charisma, sind rhetorisch geschickt oder<br />
wenigstens geschult und bedienen sich konsequent<br />
der neuesten Tricks aus Werbung<br />
und Marketing. Was sie verbindet, ist die<br />
Ablehnung klassischer Parteistrukturen.<br />
Allen gemein ist auch, dass sie sich als Alternative<br />
zum Establishment präsentieren,<br />
obwohl sie diesem seit Langem angehören.<br />
So radikal wie Kurz aber ist kaum einer<br />
vorgegangen. Als er im Mai designierter<br />
Vorsitzender der ÖVP wurde, blieb von<br />
der alten Volkspartei nicht viel übrig. Nach<br />
der Machtübernahme dauerte es nicht lange,<br />
bis die Homepage der ÖVP wegen Umbauarbeiten<br />
gesperrt wurde. Wer sie anklickte,<br />
wurde auf seine persönliche Seite,<br />
die des „Teams Kurz“, weitergeleitet. Aus<br />
dem Parteinamen ÖVP wurde die „Liste<br />
Sebastian Kurz – die neue Volkspartei“.<br />
Die Partei bekam ein neues Logo, eine<br />
neue Führungsstruktur und der neue Chef<br />
mehr Macht als seine Vorgänger.<br />
„Was Kurz sagt, ist jetzt Gesetz“, erklärte<br />
der ehemalige ÖVP-Chef und Kurz-<br />
Förderer Michael Spindelegger.<br />
Kurz hat früh begriffen, dass Politik heutzutage<br />
ohne ein hohes Maß an Inszenierung<br />
nicht auskommt. Mit 22 wurde er Chef<br />
der Jungen Volkspartei und posierte danach<br />
auf dem Kühlergrill eines Geländewagens<br />
mit der Aufschrift „Geil-o-Mobil“.<br />
Das war eine seiner wenigen Verirrungen<br />
ins Nassforsche. Er zog seine Lehren daraus<br />
und tritt heute betont galant und zurückhaltend<br />
auf. Er lernte, seine Ambition hinter<br />
Bescheidenheit zu verstecken.<br />
Im Außenministerium bemühten sich<br />
seine Berater mit Erfolg, ihn als genüg -<br />
samen, hart arbeitenden jungen Mann zu<br />
porträtieren, der heimatverbunden und zugleich<br />
weltoffen ist. Kurz fährt auch mal<br />
mit der U-Bahn ins Büro, kürzere Wege<br />
geht er zu Fuß. Wo seine Vorgänger Privatjets<br />
nutzen, lässt Kurz Linienflüge buchen,<br />
meistens Economy.<br />
Am Donnerstag nach dem Wahlsieg<br />
fliegt er ebenfalls Economy, diesmal nach<br />
Brüssel, was in den sozialen Netzwerken<br />
gleich per Foto dokumentiert wird. Hier<br />
findet ein Treffen der konservativen Europäischen<br />
Volkspartei statt, danach tagen<br />
aber auch die Staats- und Regierungschefs<br />
– und Kurz lässt sich die Gelegenheit<br />
nicht entgehen, um sich in der Nähe von<br />
Angela Merkel und Jean-Claude Juncker<br />
zu präsentieren.<br />
Kurz verkörpert die<br />
Hoffnung, über die Größe<br />
eines kleinen<br />
Landes hinauszuwachsen.<br />
Die Scheinwerfer Brüssels suchte er<br />
auch in den Jahren als Außenminister, den<br />
Österreichern gefielen die souveränen und<br />
selbstbewussten Auftritte. Kurz verkörpert<br />
damit perfekt die Hoffnung seiner Landsleute,<br />
über die Größe des kleinen Österreichs<br />
hinauszuwachsen.<br />
Europa ist nun die Bühne, auf der Kurz<br />
mit Angela Merkel auf Augenhöhe operiert.<br />
In der Flüchtlingskrise zeigte der junge<br />
Mann aus Wien der erfahrenen Kanzlerin<br />
bereits, dass er sich nicht als Juniorpartner<br />
sieht. Während Merkel den Zustrom<br />
der Migranten durch einen Deal mit<br />
der Türkei stoppen wollte, setzte Kurz offenbar<br />
hinter ihrem Rücken durch, die<br />
Grenze zwischen Griechenland und Mazedonien<br />
zu schließen. Er besuchte dafür<br />
beinahe im Wochentakt die Balkanländer<br />
und lotete aus, wie eine Schließung der<br />
Flüchtlingsroute aussehen könnte.<br />
Schon früh, im November 2015, machte<br />
er sich zudem den Kampfbegriff von Merkels<br />
Gegnern zu eigen, forderte eine<br />
„Obergrenze“ für die Aufnahme von<br />
Flüchtlingen und ließ sich dafür auch von<br />
Konservativen aus Deutschland feiern. Im<br />
vergangenen März besuchte er den Parteitag<br />
von Europas Konservativen auf Malta<br />
und nahm sich anschließend Zeit, im Keller<br />
des Tagungshotels über Migrations -<br />
politik zu diskutieren. Leute wie Hans-<br />
Peter Friedrich von der CSU hörten begeistert<br />
zu, wie Kurz über seine Erfolge<br />
auf Kosten der Kanzlerin plauderte.<br />
Auch auf anderen Politikfeldern forderte<br />
der Außenminister Kurz die Bundeskanzlerin<br />
und ihre Regierung immer wieder<br />
heraus. So verlangte er früh ein vorläufiges<br />
Ende der Beitrittsverhandlungen mit der<br />
Türkei. In Österreich kam diese Opposition<br />
gegen den großen Nachbarn bestens an.<br />
Seit der Flüchtlingskrise gilt Kurz zudem<br />
als Freund der Nationalisten in Polen oder<br />
Ungarn, der Kaczyńskis, der Orbáns und<br />
weiterer EU-Regierungschefs im rechten<br />
Spektrum. Nun scheint am europäischen<br />
Horizont eine Wiederbelebung der alten<br />
Habsburger Verbindung auf, als Gegenpol<br />
zu Macron und Merkel, die sich für eine<br />
Vertiefung der Union aussprechen, wenn<br />
auch mit unterschiedlicher Intensität.<br />
Kurz als einen Europaskeptiker wie<br />
Orbán abzustempeln wäre jedoch falsch.<br />
In der Flüchtlingsfrage teilen beide zwar<br />
einen Kurs der konsequenten Abschottung.<br />
CHARBONNIER NATHANAEL / NEWS PICTURES<br />
82 DER SPIEGEL 43 / 2017
FPÖ-Chef Strache: „Menschlich nähergekommen“<br />
Anders als Orbán und Kaczyński ist der<br />
Österreicher jedoch von der Notwendigkeit<br />
der EU überzeugt. Wo es dem eher kleinen<br />
Österreich nutzt, etwa bei der Außen- und<br />
Sicherheitspolitik, plädiert Kurz sogar für<br />
eine Vertiefung der Zusammenarbeit.<br />
Die Vision seines Rollenvorbilds Macron<br />
von einem solidarischeren Europa teilt<br />
Kurz hingegen nicht. Dass die EU-Mitgliedstaaten<br />
künftig finanziell stärker füreinander<br />
einstehen und ihre Sozialstandards angleichen<br />
sollen, hält er für falsch.<br />
In Brüssel schauen sie nun mit Sorge<br />
auf die Entwicklung in Österreich. Als<br />
Wolfgang Schüssel im Jahre 2000 eine Koalition<br />
mit Haiders FPÖ bildete, reduzierten<br />
die EU-Staaten ihre Beziehungen zu<br />
Wien zunächst auf ein Mindestmaß. Dazu<br />
wird es diesmal nicht kommen, dafür gibt<br />
es inzwischen zu viele rechtskonservative<br />
Regierungen in Europa. In seinem Gratulationsschreiben<br />
mahnte Kommissionschef<br />
Juncker jedoch gleich eine europafreundliche<br />
Politik der neuen Regierung an.<br />
Österreich wird in der zweiten Jahreshälfte<br />
2018 die EU-Ratspräsidentschaft<br />
übernehmen, ausgerechnet dann sind wichtige<br />
Entscheidungen zu erwarten: der Abschluss<br />
der Verhandlungen über den Brexit<br />
sowie über den künftigen siebenjährigen<br />
Finanzrahmen für die Gemeinschaft. Das<br />
Letzte, was Europa da brauchen kann,<br />
ist eine österreichische Regierung, in der<br />
Europafeinde den Kurs mitbestimmen.<br />
„Österreich wird ein europafreundliches<br />
Land bleiben“, beteuert Kurz am Donnerstag<br />
in Brüssel gegenüber allen Gesprächspartnern.<br />
Ihn ärgert, dass ausländische<br />
Zeitungen über einen Rechtsruck in Österreich<br />
schreiben. Immerhin habe er mit seinem<br />
Wahlsieg den Durchmarsch der FPÖ<br />
doch verhindert.<br />
Es ist schwer zu sagen, was ein weniger<br />
auf das Thema Migration konzentrierter<br />
Wahlkampf bewirkt hätte. Fakt ist jedenfalls,<br />
dass die FPÖ in den Umfragen anfangs<br />
weit vor den Konservativen lag. Und<br />
das Beispiel der Schüssel-Haider-Regierung<br />
zeigt, dass die Rechten ihre Anziehungskraft<br />
verlieren, sobald sie mitregieren.<br />
Nach nicht mal drei Jahren Schwarz-Blau<br />
stürzte die FPÖ damals bei der Wahl ab.<br />
Solche Argumente werden in diesen Tagen<br />
auch von vielen Mitgliedern der Union<br />
vorgetragen, um Angela Merkel unter<br />
Druck zu setzen. Die Kanzlerin weiß, dass<br />
ihr mit Kurz ein Konkurrent erwachsen<br />
ist, nicht nur in Brüssel, sondern auch im<br />
Streit über den richtigen Kurs ihrer eigenen<br />
Partei. Sie hat mitbekommen, dass<br />
sich viele Unzufriedene in CDU und CSU<br />
plötzlich auf Kurz berufen, wenn sie die<br />
Programmatik der Union kritisieren.<br />
Als Merkel in der Vorstandssitzung der<br />
CDU am vergangenen Montag auf Kurz’<br />
Wahlsieg zu sprechen kam, schaffte sie es,<br />
ihren Gegner in der Flüchtlingskrise gleichzeitig<br />
zu loben und kleinzureden. Es sei ja<br />
sehr schön, dass die ÖVP nun stärkste<br />
Kraft in Österreich sei. Aber leider habe<br />
auch die FPÖ stark zugelegt. Und: Ein Ergebnis<br />
von nur 31 Prozent so zu feiern,<br />
das sei doch auch etwas seltsam, sinnierte<br />
die Kanzlerin. Sie wolle das Ergebnis der<br />
Union von knapp 33 Prozent keinesfalls<br />
schönreden. Aber verglichen damit habe<br />
Kurz jedenfalls keinen historischen Sieg<br />
eingefahren.<br />
HANS KLAUS TECHT / DPA<br />
Merkel weiß, dass Kurz gute Kontakte<br />
nach Deutschland hat, zu Regierungsmitgliedern<br />
wie Ursula von der Leyen etwa.<br />
Die Kanzlerin dürfte auch nicht vergessen<br />
haben, dass Kurz vor allem 2016 keine Gelegenheit<br />
ausließ, die Bundesregierung in<br />
deutschen Talkshows und TV-Interviews<br />
zu tadeln. „Ich werde mich sicher nicht in<br />
die deutsche Debatte einmischen“, begann<br />
er gern seine Ausführungen. Um dann mit<br />
Blick auf die Kanzlerin nachzuschieben:<br />
„Es geht auch darum, die Wahrheit auszusprechen.“<br />
Oder: „Die Suche nach Schuldigen<br />
nützt ja nichts.“<br />
Merkel reagiert seither oft trotzig, wenn<br />
sie auf Kurz angesprochen wird. „Wenn<br />
Sie mich also fragen, ob die Schließung der<br />
Balkanroute das Problem gelöst hat, sage<br />
ich klar: nein“, erklärte sie im Oktober<br />
2016. Wenig später stand in den CDU-Parteitagsbeschlüssen<br />
jedoch, dass dieser von<br />
Kurz eingeleitete Schritt ein Erfolg sei.<br />
Viele Unionspolitiker loben nun den<br />
Österreicher, manche hinter vorgehaltener<br />
Hand, andere auch offen. „Einige österreichische<br />
Themen wie die Sorge der Menschen<br />
um Sicherheit sind vergleichbar mit<br />
Deutschland“, sagt Paul Ziemiak, Chef der<br />
Jungen Union. Kurz habe einen „sehr bürgernahen<br />
Wahlkampf geführt“, lobt er den<br />
fast gleichaltrigen Politiker. „Klare Sprache<br />
und direkter Dialog stehen bei ihm im Mittelpunkt.“<br />
Nur wenige kritisieren Kurz für seinen<br />
Rechtskurs: „Er hat der FPÖ jedenfalls<br />
nicht geschadet, sie ist stärker als zuvor“,<br />
sagt Vorstandsmitglied Elmar Brok. Kurz’<br />
Rolle in der Flüchtlingspolitik sei „nicht<br />
immer hilfreich“ gewesen, die Auftritte im<br />
deutschen Fernsehen anmaßend. „Ich erkenne<br />
wenig in dem österreichischen Wahlkampf<br />
oder Wahlergebnis, was für die<br />
Union nachahmenswert wäre“, betont<br />
ebenfalls der Außenpolitiker Norbert Röttgen.<br />
„Wir wollen auch im Namen Christdemokraten<br />
bleiben und nicht Anhänger<br />
der Liste des jeweiligen Spitzenkandidaten<br />
werden.“<br />
Als Sebastian Kurz am Donnerstagmittag<br />
im Brüsseler Akademiepalast steht,<br />
läuft auf einmal Angela Merkel an ihm vorbei.<br />
Sie bemerkt ihn nicht. Kurz hastet ihr<br />
nach, im Türrahmen erwischt er sie und<br />
spricht sie von hinten an. Er wolle sie doch<br />
noch mit Handschlag begrüßen, sagt er höflich.<br />
Knapp zehn Minuten sitzen sie dann<br />
beisammen. Nicht lang genug, um wirklich<br />
miteinander warm zu werden. Falls das<br />
überhaupt möglich ist.<br />
Melanie Amann, Markus Feldenkirchen,<br />
Walter Mayr, Peter Müller,<br />
Christoph Scheuermann, Christoph Schult<br />
Video: „Nur eine<br />
Mehrheit rechts der Mitte“<br />
spiegel.de/sp432017kurz<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
83
„Wähler können nicht falschliegen“<br />
SPIEGEL-Gespräch <strong>Der</strong> österreichische Wahlsieger und Außenminister Sebastian Kurz<br />
über eine mögliche Koalition mit der Rechtsaußen-Partei FPÖ, seine harte<br />
Linie in Migrationsfragen und sein Verhältnis zu CDU-Politikern in Deutschland<br />
Politiker Kurz: „Strache hat recht, wenn er sagt, dass es in gewissen Fragen Überschneidungen gibt“<br />
JORK WEISMANN / DER SPIEGEL<br />
84 DER SPIEGEL 43 / 2017
Ausland<br />
SPIEGEL: Herr Kurz, Sie sind 31 Jahre alt<br />
und womöglich bald Bundeskanzler. Sind<br />
Sie sich manchmal selbst unheimlich?<br />
Kurz: Überhaupt nicht. Ich bin mir aber der<br />
großen Verantwortung bewusst. Bei mir<br />
hat sich in den vergangenen Jahren vieles<br />
sehr schnell, aber auch nicht von heute<br />
auf morgen entwickelt. Ich habe mehr als<br />
sechs Jahre Regierungserfahrung. Die Entscheidung<br />
zur Spitzenkandidatur habe ich<br />
mir nicht leicht gemacht. Ich habe mich<br />
im Mai entschieden, die Österreichische<br />
Volkspartei zu verändern, eine breite Bewegung<br />
zu starten – mit dem Ziel, dieses<br />
Land zum Positiven zu verändern.<br />
SPIEGEL: Verstehen Sie, dass es anderen<br />
Leuten unheimlich ist, wenn ein so junger<br />
Mensch die Geschicke eines Landes übernimmt?<br />
Kurz: Wenn’s den Menschen in Österreich<br />
so ginge, dann hätten sie mich wahrscheinlich<br />
nicht gewählt. Die Österreicher konnten<br />
sich in all den Jahren ein Bild von mir<br />
machen. Andere Kandidaten waren wesentlich<br />
kürzer auf der politischen Bühne.<br />
Manche Kandidaten in Deutschland, die<br />
davor auf europäischer Ebene tätig waren,<br />
waren den Wählern vermutlich fremder.<br />
SPIEGEL: Wünschen Sie sich nicht manchmal,<br />
für dieses Amt mehr Lebenserfahrung<br />
zu haben?<br />
Kurz: Jeder ist, was er ist. Man wird nicht<br />
von heute auf morgen 30 Jahre älter. Ältere<br />
haben natürlich den Vorteil breiterer Lebenserfahrung.<br />
Aber deswegen sollte man<br />
sich als junger Mensch nicht in eine Depression<br />
stürzen. Wenn das junge Alter<br />
wirklich ein Problem ist, bleibt immer noch<br />
als Trost: Es wird von Tag zu Tag besser.<br />
SPIEGEL: Ständig wird über Ihr Äußeres geredet<br />
und geschrieben. Ärgert Sie das?<br />
Kurz: Das habe ich nicht so erlebt. Im Wahlkampf<br />
ging es um vieles, um Inhalte, um<br />
Stil, um „dirty campaigning“ mit Methoden,<br />
die wir in Österreich eigentlich nicht<br />
wollen – aber was kaum ein Thema war,<br />
ist die Frage, wie die Spitzenkandidaten<br />
ausschauen.<br />
SPIEGEL: Ihre jugendliche Erscheinung war<br />
schon immer wieder ein Thema.<br />
Kurz: Es sollte um Inhalte gehen. Natürlich<br />
bekomme ich SMS, da steht dann drin:<br />
„Nimm doch eine Krawatte, wenn Du ins<br />
Fernsehen gehst“. Aber danach richte ich<br />
mich nicht.<br />
SPIEGEL: Am Mittwoch ist in Wien ein Magazin<br />
erschienen, auf dessen Cover Sie als<br />
„Neofeschist“ bezeichnet werden – in Anlehnung<br />
an Jörg Haider.<br />
Kurz: Außer mit Haider bin ich auch schon<br />
mit Viktor Orbán verglichen oder als<br />
einer beschrieben worden, der den ganzen<br />
Tag auf dem Schoß von Frau Merkel<br />
hockt. Nichts davon ist Realität, aber ich<br />
nehme zur Kenntnis, dass es in der Politik<br />
und in den Medien dazugehört, jemanden<br />
in eine Schublade zu zwängen. Ich ver -<br />
suche dagegen, mit meinen Ideen zu überzeugen.<br />
SPIEGEL: Bei der Wahl am 15. Oktober kamen<br />
ÖVP und FPÖ zusammen auf fast<br />
60 Prozent. Das gab es noch nie nach dem<br />
Krieg. Was ist der Grund für diese Verschiebung<br />
nach rechts?<br />
Kurz: Auch ÖVP und SPÖ sind zusammen<br />
auf fast 60 Prozent gekommen. Es stimmt:<br />
Auch die FPÖ hat klar dazugewonnen. Das<br />
heißt wohl, dass zusätzliche Wähler die Linie<br />
dieser Partei ansprechend fanden. Wir als<br />
Volkspartei sind eine Kraft aus der Mitte der<br />
Bevölkerung. Als ich im Mai die Partei übernehmen<br />
durfte, haben wir die Entscheidung<br />
getroffen, eine breite Bewegung zu starten.<br />
In den letzten Monaten haben wir 200000<br />
neue Unterstützer gewonnen – in einem kleinen<br />
Land mit neun Millionen Einwohnern.<br />
SPIEGEL: Wollen Sie damit sagen, die Dia -<br />
gnose Rechtsruck sei Quatsch?<br />
Kurz: Ich möchte Diagnosen des SPIEGEL<br />
nicht infrage stellen. Das Wahlergebnis ist<br />
aber eindeutig – die Volkspartei hat diese<br />
Wahl gewonnen. In den letzten 50 Jahren<br />
gab es das zuvor nur einmal, dass kein Sozialdemokrat<br />
der Sieger war. Wir wissen,<br />
dass uns auch viele Grünen-Wähler ihre<br />
Stimme gegeben haben.<br />
SPIEGEL: Wollen Sie künftig nicht eher<br />
rechts Politik machen?<br />
Kurz: Hart arbeitende Menschen in Österreich<br />
können sich immer schwerer etwas<br />
aufbauen. Wir sind ein absolutes Spitzensteuerland.<br />
Es gibt kaum ein Land auf der<br />
Welt, in dem die Differenz zwischen Brutto-<br />
und Nettogehalt so groß ist wie bei uns.<br />
Die Steuer- und Abgabenquote ist deutlich<br />
höher als in Deutschland, obwohl es bei<br />
Ihnen auch funktionierende Spitäler und<br />
Schulen gibt. Wir wollen veraltete Strukturen<br />
aufbrechen, um einen serviceorientierten<br />
schlanken Staat zu schaffen. Seit<br />
1990 haben sich die Ausgaben im Gesundheitssystem<br />
verdreifacht, und trotzdem<br />
wird die Qualität der Leistungen, vor allem<br />
in Wien, immer schlechter. Wir nähern uns<br />
immer mehr der Zweiklassenmedizin.<br />
SPIEGEL: Kann ein Einzelner wirklich eine<br />
Partei, ja gar ein ganzes Land von Grund<br />
auf erneuern?<br />
Kurz: Niemand kann das allein, aber ich<br />
war in meinem ganzen politischen Leben<br />
noch nie allein. Wir haben, ganz im Gegenteil,<br />
die breiteste Bewegung in Österreich<br />
überhaupt geschaffen. Und stellen<br />
nun die größte Zahl auch an neuen Abgeordneten,<br />
die Expertise aus ihren bisherigen<br />
Bereichen mitbringen – aus der Wirtschaft,<br />
aus der Wissenschaft.<br />
SPIEGEL: Was ist Ihnen nun lieber? Eine<br />
schwarz-blaue Koalition mit der FPÖ, was<br />
im Ausland wenig beliebt wäre? Oder eine<br />
schwarz-rote, ein Bündnis mit der SPÖ,<br />
was in Österreich nicht so gut ankäme?<br />
Kurz: Mein Ziel ist eine stabile Regierung,<br />
die auch die Kraft hat, Veränderung möglich<br />
zu machen. Auch eine Minderheits -<br />
regierung ist denkbar, wenn man keinen<br />
Koalitionspartner findet – das ist aber nicht<br />
das Ziel. In Österreich braucht man für<br />
viele Entscheidungen eine Zweidrittelmehrheit.<br />
Das wäre zum Beispiel möglich,<br />
wenn man zusätzlich die Neos (eine liberale<br />
Partei –Red.) hinzuzöge.<br />
SPIEGEL: Aber mit wem wollen Sie re -<br />
gieren?<br />
Kurz: Ich werde mit allen Parteien reden.<br />
Ich muss diese Gespräche abwarten.<br />
SPIEGEL: Eine Koalition mit der SPÖ unter<br />
dem als konservativ geltenden Verteidigungsminister<br />
Hans Peter Doskozil wäre<br />
eine Alternative zur FPÖ?<br />
Kurz: Ich habe mit Doskozil immer sehr<br />
gut zusammengearbeitet und schätze ihn.<br />
SPIEGEL: Ihr wichtigstes Wahlkampfthema<br />
war die Migration. Zeigt Ihr Sieg, dass man<br />
Rechtsaußen-Parteien schlagen kann,<br />
wenn man ihre Themen übernimmt?<br />
Kurz: Politiker sollten das tun, was sie für<br />
richtig erachten, und nicht Strategien verfolgen,<br />
mit denen sie glauben, Wahlen gewinnen<br />
zu können. Ich habe seit Beginn<br />
der Flüchtlingskrise eine klare, konsequente<br />
und – wenn Sie so wollen – harte Linie<br />
gegen illegale Migration verfolgt. In Staaten<br />
wie Österreich sind Ordnung und<br />
Sicherheit in Gefahr, wenn wir Migration<br />
nicht steuern. Es geht nicht nur um Menschen<br />
aus Syrien und dem Irak, sondern<br />
auch um Millionen Menschen in Afrika,<br />
die bereit sind, nach Europa zu kommen,<br />
wenn sie das Gefühl haben, der Weg sei<br />
offen.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> FPÖ-Vorsitzende Heinz-Christian<br />
Strache sagt, fast 60 Prozent der Österreicher<br />
hätten diesmal das Programm der<br />
FPÖ gewählt.<br />
Kurz: Strache hat recht, wenn er sagt, dass<br />
es in gewissen Fragen Überschneidungen<br />
und Gemeinsamkeiten in den Programmen<br />
gibt. Wir haben aber bei anderen Themen<br />
auch Gemeinsamkeiten mit anderen<br />
Parteien. Das ist gut so. Wie sollten wir<br />
sonst in der Politik zusammenarbeiten?<br />
Ich würde mir auch auf europäischer Ebene<br />
mehr Übereinstimmung wünschen.<br />
SPIEGEL: Sie werden wegen Ihres Alters<br />
manchmal mit dem französischen Präsidenten<br />
Emmanuel Macron verglichen. <strong>Der</strong><br />
hat den Front National, das Pendant zur<br />
FPÖ, klar bekämpft. Sie halten es für möglich,<br />
mit einer Rechtsaußen-Partei zu koalieren.<br />
Welche Strategie ist richtig?<br />
Kurz: Macron hat den starken Willen, in<br />
Europa etwas zum Positiven zu verändern.<br />
Als europäischer Bürger und österreichischer<br />
Politiker bin ich darüber froh. Ich<br />
werde alles dafür tun, ihn und andere zu<br />
unterstützen, die vorhaben, die EU zu verändern<br />
und damit zu stärken. Was seine<br />
Haltung zu Marine Le Pen angeht: Die<br />
politischen Systeme sind überhaupt nicht<br />
vergleichbar. In Österreich bekommt die<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
85
Ausland<br />
stärkste Partei einen Regierungsauftrag<br />
und muss sich Koalitionspartner suchen.<br />
Für mich gibt es zwei theoretische Partner.<br />
Es ist theoretisch auch möglich, dass die<br />
SPÖ versucht, an der Macht zu bleiben,<br />
indem sie mit der FPÖ eine Koalition gegen<br />
den Wahlgewinner eingeht.<br />
SPIEGEL: Ist die FPÖ für Sie eine ganz normale<br />
Partei? Auch mit dem Parteivorsitzenden<br />
Strache, der sogar Jörg Haider zu<br />
brachial war?<br />
Kurz: Parteien sind unterschiedlich. Ich<br />
habe mit 17 Jahren begonnen, mich politisch<br />
zu engagieren. Ich habe eine ganz<br />
klare Haltung und eine ideologische Festigung.<br />
In einer Demokratie gibt es aber<br />
nicht nur die eigene Meinung. Im österreichischen<br />
Parlament gibt es fünf Parteien,<br />
die alle demokratisch gewählt wurden und<br />
dadurch ihre Berechtigung haben.<br />
SPIEGEL: Sie kennen sicherlich die Bilder<br />
von Strache, der in seiner Jugend in militärischer<br />
Kleidung durch die Wälder streifte.<br />
Er hat lange Beziehungen zur rechten<br />
Szene. Schaudert es Sie nicht, so jemanden<br />
zum Vizekanzler zu machen?<br />
Kurz: Ich kenne die Bilder. Ich glaube, sie<br />
sind in einer Zeit entstanden, als ich noch<br />
nicht einmal auf der Welt war.<br />
SPIEGEL: Das ändert ja nichts.<br />
Kurz: Die Wählerinnen und Wähler haben<br />
das Recht, eine Entscheidung zu treffen.<br />
Sie können sich nicht falsch entscheiden.<br />
Wir sind der klare Wahlgewinner, als proeuropäische<br />
Kraft der Mitte – und es gibt<br />
zwei etwa gleich starke Parteien auf dem<br />
zweiten und dritten Platz.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> Wähler kann natürlich wählen,<br />
wie er will. Sie müssten aber nicht mit<br />
einer Partei koalieren, die stark auf Fremdenfeindlichkeit<br />
setzt.<br />
Kurz: Es ist meine Entscheidung, mit wem<br />
ich koaliere, dessen bin ich mir bewusst.<br />
Deshalb werde ich auch Gespräche führen<br />
und versuchen, eine stabile Regierung zum<br />
Wohle unseres Landes zu bilden.<br />
SPIEGEL: Gibt es für Sie rote Linien? Was<br />
ist für Sie nicht verhandelbar?<br />
Kurz: Definitiv gibt es die. Nicht nur nach<br />
rechts, sondern auch nach links. Ich würde<br />
es aber für unangebracht halten, Regierungsverhandlungen<br />
über das deutsche<br />
Politikmagazin DER SPIEGEL zu starten.<br />
Ich bitte Sie da um Ihr Verständnis. Wenn<br />
man in einer Regierung ordentliche Arbeit<br />
für das eigene Land leisten möchte, muss<br />
man mit einem Partner Vertrauen aufbauen<br />
und sich auf Projekte einigen. Wer über<br />
Medien unzählige Bedingungen aufstellt,<br />
wird das nicht tun können.<br />
SPIEGEL: In Deutschland ist das CDU-Präsidiumsmitglied<br />
Jens Spahn ein großer Unterstützer<br />
Ihrer Politik. Er war auch auf<br />
Ihrer Wahlparty. Was schätzen Sie an ihm?<br />
Kurz: Ich habe mich sehr gefreut, dass er<br />
am Wahlabend als Vertreter unserer<br />
Schwesterpartei anwesend war. Ich schätze<br />
Kurz, SPIEGEL-Redakteure*<br />
„Ich habe eine ideologische Festigung“<br />
ihn wegen seiner klaren Haltungen, die er<br />
auch klar artikuliert. Politiker sind oft nicht<br />
so klar, wie sie es gerne wären, aus Sorge<br />
vor negativen Folgen. Gerade als Außenminister<br />
gilt es auch mal, diplomatisch zu<br />
sein. Ich halte ihn für einen Visionär und<br />
Vordenker, habe aber auch zu vielen anderen<br />
in der CDU und CSU ein gutes Verhältnis,<br />
etwa zu Wolfgang Schäuble oder<br />
Ursula von der Leyen. Und ich habe mich<br />
sehr gefreut, dass Angela Merkel mich am<br />
Wahlabend als Erste angerufen hat, um<br />
mir zu gratulieren, und freue mich auf die<br />
Zusammenarbeit mit ihr.<br />
SPIEGEL: Würden Sie Jens Spahn gern als<br />
Bundeskanzler sehen, wenn Merkel mal<br />
nicht mehr will?<br />
Kurz: Es gibt in Deutschland mit Angela<br />
Merkel eine Kanzlerin, eine der erfahrensten<br />
Politikerinnen Europas, die es geschafft<br />
hat, das vierte Mal in Folge eine Wahl zu<br />
gewinnen. Sie hat ein tolles Team, mit Persönlichkeiten<br />
wie Jens Spahn und anderen,<br />
die natürlich in ihrem Leben noch alles erreichen<br />
können.<br />
SPIEGEL: Als Sie 2016 die Schließung der<br />
Westbalkanroute vorbereitet haben, zum<br />
Teil hinter dem Rücken Merkels, hatten<br />
Sie da Kontakt zu CDU-Politikern?<br />
Kurz: Wir haben immer einen guten Kontakt<br />
zwischen Österreich und Deutschland<br />
gehabt, auch wenn wir in der Migrationsfrage<br />
nicht immer einer Meinung waren.<br />
SPIEGEL: In der CDU wird über Ihre Person<br />
ein Richtungskampf ausgetragen. <strong>Der</strong> rechte<br />
Flügel sucht Ihre Nähe. Viele finden:<br />
Lass uns mehr Kurz wagen.<br />
Kurz: Ich habe in der Migrationsfrage eine<br />
klare Haltung. Aber es gibt auch andere<br />
Themen als nur die Migration – da bin ich<br />
dann wieder mit anderen in der CDU einig.<br />
So ist das in der Politik.<br />
SPIEGEL: Angela Merkel und die Union haben<br />
die Bundestagswahl gewonnen, aber<br />
mehr als acht Prozent der Stimmen verloren.<br />
Woran lag das aus Ihrer Sicht?<br />
Kurz: Die Union hat bei dieser Wahl 33 Prozent<br />
erreicht, ich habe bei uns 31,5 Prozent<br />
erreicht. Das ist für uns ein extrem hohes<br />
Ergebnis. Wenn die Union von jemandem<br />
Tipps braucht, dann sicher nicht von Par-<br />
* Walter Mayr, Markus Feldenkirchen und Mathieu von<br />
Rohr in Wien.<br />
JORK WEISMANN / DER SPIEGEL<br />
teien, die schlechtere Ergebnisse erzielt<br />
haben.<br />
SPIEGEL: Was war aus Ihrer Sicht wichtiger<br />
für das Ende der Flüchtlingskrise 2016: Die<br />
Schließung der Balkanroute, die Sie vorangetrieben<br />
haben, oder das von Merkel favorisierte<br />
EU-Abkommen mit der Türkei?<br />
Kurz: Beides hat gewirkt, beides war sinnvoll.<br />
Jede Maßnahme, die dazu beiträgt,<br />
illegale Migration zu stoppen und Hilfe<br />
vor Ort zu stärken, ist eine gute Maßnahme.<br />
Es hat sich in den letzten Monaten auf<br />
europäischer Ebene Gott sei Dank vieles<br />
in die richtige Richtung entwickelt, die Italiener<br />
haben ihre Politik massiv verändert.<br />
Es ist aber eine fatale Fehleinschätzung,<br />
wenn manche nun glauben, die Migra -<br />
tionsfrage sei gelöst und man könne sich<br />
zurücklehnen. Die Zahlen sind zwar etwas<br />
niedriger als in den Vorjahren, aber immer<br />
noch zu hoch, und der Migrationsdruck<br />
wird nicht nachlassen.<br />
SPIEGEL: Was fordern Sie?<br />
Kurz: Wir müssen auf europäischer Ebene<br />
massiv dafür kämpfen, illegale Migration<br />
zu stoppen. Wir müssen ein vollkommen<br />
neues Frontex-Mandat schaffen, einen gemeinsamen<br />
Außengrenzschutz aufbauen,<br />
bei dem die Italiener und Griechen nicht<br />
alleingelassen werden. In Österreich sind<br />
wir bereit, mit Polizei und Soldaten unseren<br />
Beitrag zu leisten.<br />
SPIEGEL: Im Wahlkampf haben Sie davon<br />
gesprochen, die Mittelmeerroute zu schließen.<br />
Wie soll das gehen?<br />
Kurz: Wir müssen klarstellen: Wer sich il -<br />
legal auf den Weg macht, wird kein Asyl in<br />
Europa bekommen. Wir sollten Menschen<br />
an der EU-Außengrenze retten, versorgen<br />
und zurückstellen in die Herkunfts- und<br />
Transitländer. Wir sollten Menschen ausschließlich<br />
über Resettlement-Programme<br />
aufnehmen und die Hilfe vor Ort ausbauen.<br />
SPIEGEL: Wie soll das funktionieren? Sie<br />
wollen die Boote stoppen und die Insassen<br />
in Libyen wieder ausladen?<br />
Kurz: Zunächst müssen wir besser mit der<br />
libyschen Küstenwache kooperieren, damit<br />
die Menschen sich gar nicht auf den Weg<br />
machen und die Schiffe nicht ablegen können.<br />
Sobald jemand gerettet wird, darf er<br />
nicht aufs italienische Festland gebracht<br />
werden. Wenn die Menschen nicht zurückgebracht<br />
werden können, dann sollen sie<br />
in sichere Zentren, wo sie Schutz und Versorgung<br />
bekommen, aber nicht das bessere<br />
Leben in Europa. Wenn wir ihnen das ermöglichen,<br />
machen sich immer mehr Menschen<br />
auf den Weg.<br />
SPIEGEL: Was war auf dem Höhepunkt der<br />
Flüchtlingskrise 2015 der Fehler der deutschen<br />
Bundeskanzlerin?<br />
Kurz: Es geht nicht um den Fehler der deutschen<br />
Bundeskanzlerin. Es gab in Europa<br />
viele, die für eine falsche Politik eingetreten<br />
sind: eine Politik der offenen Grenzen.<br />
Die hatten den Glauben, dass jeder, der<br />
86 DER SPIEGEL 43 / 2017
nach Europa durchkommt, das Recht haben<br />
soll, einen Asylantrag zu stellen. Deshalb<br />
haben immer mehr ihre Chance gesehen,<br />
und das führte zu einer Überforderung<br />
bei uns und zu immer mehr Toten<br />
im Mittelmeer. Das habe ich immer abgelehnt,<br />
wird heute aber Gott sei Dank auch<br />
kaum von jemandem noch verfolgt.<br />
SPIEGEL: Werden Sie sich in der EU in der<br />
Migrationsfrage mit den osteuropäischen<br />
Ländern zusammenschließen?<br />
Kurz: Ich freue mich über jeden Staat in<br />
der EU, der in der Migrationsfrage eine<br />
ähnliche Sichtweise hat. Das sind mittlerweile<br />
sehr, sehr viele, und es werden monatlich<br />
mehr. Wir lösen die Migrationsfrage<br />
nicht durch mehr Verteilung in Europa.<br />
SPIEGEL: Wie sehen Sie Ihre Rolle im<br />
Umgang mit Ungarn oder Tschechien, Länder,<br />
zu denen Österreich enge Beziehungen<br />
hat?<br />
Kurz: Österreich ist ein Land, das Brückenkopf<br />
zwischen Ost und West in Europa<br />
sein kann. Wirtschaftlich hat uns das immer<br />
sehr genutzt, auch politisch halte ich<br />
das für unsere Aufgabe.<br />
SPIEGEL: Sie bezeichnen sich als überzeugten<br />
Europäer, koalieren aber womöglich<br />
bald mit einer europaskeptischen Partei.<br />
Was wollen Sie erreichen, wenn Österreich<br />
nächstes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft<br />
übernimmt?<br />
Kurz: Ich bin Vertreter einer bürgerlichen<br />
Partei und habe von den Wählern den Auftrag<br />
erhalten, eine proeuropäische Kraft<br />
der Veränderung zu sein. Wir möchten erreichen,<br />
dass die EU subsidiärer wird und<br />
in manchen Fragen besser zusammenarbeitet,<br />
sich aber da zurücknimmt, wo Nationalstaaten<br />
besser entscheiden können.<br />
SPIEGEL: Was heißt das konkret?<br />
Kurz: Wir brauchen in der Außen- und Verteidigungspolitik<br />
eine engere Zusammenarbeit.<br />
Das wollen gerade die großen Staaten<br />
oft nicht so gern, wir schon. Wir brauchen<br />
aber keine Sozialunion, davon halte<br />
ich nichts. Wie soll das funktionieren? Sollen<br />
die österreichischen Sozialstandards<br />
auf rumänisches Niveau gesenkt werden?<br />
Soll in Rumänien die österreichische Mindestsicherung<br />
von monatlich 850 Euro eingeführt<br />
werden, was weit mehr als das<br />
Durchschnittseinkommen wäre? Wir brauchen<br />
nicht immer mehr Regeln in Europa,<br />
wir sollten dafür sorgen, dass die bestehenden<br />
Regeln eingehalten werden – von<br />
Maastricht bis Dublin.<br />
SPIEGEL: Werden Sie sich in Brüssel gegen<br />
die Reformideen etwa von Emmanuel<br />
Macron stellen?<br />
Kurz: Ich schätze viele seiner Vorschläge.<br />
Gerade was die Migration betrifft, auch zu<br />
Sicherheitsfragen. Was die Budgetpolitik<br />
betrifft, sind wir näher an Deutschland.<br />
Da teile ich die Linie Schäubles. In manchen<br />
Fragen teile ich übrigens weder die<br />
deutsche noch die französische Meinung.<br />
Das soll’s auch geben dürfen.<br />
SPIEGEL: Was machen Sie, wenn die Sozialdemokraten<br />
und Freiheitlichen gegen Sie<br />
eine Regierung bilden?<br />
Kurz: Die Zügel nach der Wahl hat der Bundespräsident<br />
in der Hand. Die Frage stellt<br />
sich derzeit nicht.<br />
SPIEGEL: Sie wurden mit 27 Jahren Außenminister,<br />
mit 31 Jahren womöglich Bundeskanzler.<br />
Was machen Sie eigentlich mit<br />
45? Gibt es da noch Ziele?<br />
Kurz: Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger<br />
Mensch, und mir hat alles, was ich bisher in<br />
meinem Leben unternommen habe, Freude<br />
gemacht. Für mich war immer klar, dass ich<br />
nicht mein ganzes Leben in der Politik verbringe.<br />
Solange ich das Gefühl habe, etwas<br />
beitragen zu können, werde ich das tun. Ich<br />
habe aber, um ehrlich zu sein, überhaupt<br />
keine Sorge, dass es außerhalb der Politik<br />
nicht auch schöne Dinge im Leben gibt.<br />
SPIEGEL: Herr Kurz, wir danken Ihnen für<br />
dieses Gespräch.<br />
JUBILÄUMS-<br />
ANGEBOT:<br />
JETZT BIS ENDE<br />
DES JAHRES<br />
KOSTENLOS<br />
TRAINIEREN!*<br />
Mehr Informationen<br />
sowie Angaben zu<br />
den teilnehmenden<br />
Studios finden Sie unter:<br />
kieser-training.de<br />
TRAINIEREN SIE<br />
DORT, WO ES AUCH<br />
DIE STIFTUNG<br />
WARENTEST<br />
TUN WÜRDE.<br />
TESTSIEGER<br />
GUT (2,0)<br />
Ausgabe<br />
9/2017<br />
www.test.de<br />
17EV16<br />
*Das Angebot gilt für Neukunden bei Abschluss eines Abos bis zum 30.11.2017. Nur in teilnehmenden Studios.
Europas falsche Freunde<br />
Essay Wer die Nationen abschaffen will, fördert die Nationalisten.<br />
Von Heinrich August Winkler<br />
Pro-spanische Demonstranten in Barcelona: <strong>Der</strong> Staat als Hüter von Recht und Demokratie<br />
ETIENNE DE MALGLAIVE / GETTY IMAGES<br />
Ist Walter Hallstein, der erste Präsident der Kommission<br />
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft in den Jahren<br />
1958 bis 1967, wirklich der Vordenker der europäischen<br />
Sezessionisten, als der er neuerdings von einigen<br />
Autoren porträtiert wird? Drei mehr oder weniger gleichlautende<br />
Äußerungen werden ihm zugeschrieben. Erstens:<br />
„Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee.“<br />
Zweitens: „Das Ziel des europäischen Einigungsprozesses<br />
ist die Überwindung der Nationalstaaten.“ Drittens: „Ziel<br />
ist und bleibt die Überwindung der Nation und die Organisation<br />
eines nachnationalen Europa.“<br />
In den Reden und Schriften Walter Hallsteins sind diese<br />
Aussagen nicht zu finden. Dennoch behaupten der österreichische<br />
Schriftsteller Robert Menasse, auf der Frankfurter<br />
Buchmesse soeben für seinen Brüssel-Roman „Die<br />
Hauptstadt“ mit dem Deutschen Buchpreis geehrt, seine<br />
deutsche Mitstreiterin, die Politologin Ulrike Guérot, und<br />
nun auch Jakob Augstein (SPIEGEL 42/2017), dass Hallstein<br />
sich so geäußert habe. Augstein, der das dritte Zitat offenbar<br />
von Menasse übernimmt, mit der Einschränkung,<br />
der Kommissionspräsident „solle“ dies gesagt haben.<br />
Leider sagen Menasse und Guérot nicht, wo sie die angeblich<br />
wörtlichen Zitate von Hallstein gefunden haben,<br />
und wir erfahren von ihnen auch nicht, wann, wo und in<br />
welchem Zusammenhang er sich so geäußert haben soll.<br />
Menasse erwähnt wohl zwei wichtige Reden des Europapolitikers,<br />
aber was Hallstein dort sagt, widerspricht dem,<br />
was sein Interpret ihm unterstellt. In seiner ersten Rede<br />
vor dem Europäischen Parlament beschrieb der Kommissionspräsident<br />
am 19. März 1958 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft<br />
als eine „Staatengemeinschaft mit<br />
starken föderativen Zügen“. Vor dem Europäischen Gemeindetag<br />
in Rom erteilte er zwar am 15. Oktober 1964<br />
der Idee der nationalstaatlichen Souveränität alten Stils<br />
„und der heutigen politischen Form der Nationen“ eine<br />
Absage, ebenso aber auch der Folgerung, „dass die be -<br />
stehende politische Ordnung ausgelöscht, durch einen<br />
europäischen Supranationalstaat ersetzt wird“. Es gehe<br />
vielmehr darum, die „Kraftquellen der Nationen zu erhalten,<br />
ja sie zu noch lebendigerer Wirkung zu bringen“.<br />
Falls Guérot und Menasse sich auf Quellen stützen können,<br />
die der bisherigen Forschung nicht bekannt waren,<br />
sollten sie diese nennen. Solange es keine belastbaren Belege<br />
für die Hallstein zugeschriebenen Zitate gibt, müssen<br />
diese als apokryph, das heißt als unecht, gelten. Die Lesart<br />
vom post-, ja antinationalen EU-Vorkämpfer Hallstein<br />
dürfte eine Legende oder, anders gewendet, Ausfluss einer<br />
postfaktischen Geschichtsbetrachtung sein.<br />
Doch Hallstein hin oder her, auch ohne die problematische<br />
Berufung auf ihn gibt es genug Gründe, sich kritisch<br />
mit den Thesen von Menasse, Guérot und Augstein aus -<br />
einanderzusetzen. „Nationen haben sich bekriegt, Regionen<br />
haben gelitten, immer wieder ihre Eigenheiten bewahrt,<br />
Regionen sind die Herzwurzel der Identität“, heißt<br />
88 DER SPIEGEL 43 / 2017
Ausland<br />
es in einem Text von Robert Menasse. Glaubt der Autor<br />
wirklich, dass regionale Sezessionsbewegungen von Natur<br />
aus friedlich sind? Hat er den jahrzehntelangen Terror<br />
der baskischen ETA, der nordirischen IRA und der Süd -<br />
tiroler Separatisten vergessen?<br />
Menasse übersieht zudem, dass Regionalismus und Nationalismus<br />
keine Gegensätze sein müssen. Die Schotten betrachten<br />
sich ebenso wie die Katalanen als Nation, und dafür<br />
gibt es gute historische Gründe. Beim aktuellen Konflikt um<br />
die Unabhängigkeit Kataloniens prallen zwei Nationalismen<br />
aufeinander, der spanische und der katalanische. Die Gegenüberstellung<br />
von friedlicher Region und kriegerischer<br />
Nation ist ein Produkt ahistorischen Wunschdenkens.<br />
Augstein plädiert dafür, ganz im Sinne von Menasse<br />
und Guérot, die Landkarten neu zu sortieren, und begründet<br />
das so: „Das Europa der Regionen wäre das gerechtere<br />
Europa.“ Wenn er sich da mal nicht irrt. <strong>Der</strong> Separatismus<br />
der Katalanen, Flamen und der Norditaliener<br />
von der Lega Nord ist von Wohlstandschauvinismus geprägt.<br />
Die dortigen Sezessionsbewegungen wehren sich<br />
gegen die Zumutung, Solidarität gegenüber den sozial<br />
schwächeren Regionen des jeweiligen Landes üben zu<br />
müssen. Einen militanten Regionalismus treffen wir nur<br />
in wohlhabenden, nicht in strukturell benachteiligten Gegenden<br />
an. Die Letzteren wären die Opfer, nicht die Nutznießer<br />
jener „Dekonstruktion der Nationalstaaten“, für<br />
die Ulrike Guérot bereits einen festen Zeitplan vorgesehen<br />
hat: Im Jahr 2045, wenn sich das Ende des Zweiten Weltkriegs<br />
zum 100. Mal jährt, soll dieser Prozess abgeschlossen<br />
sein und die Europäische Republik errichtet werden.<br />
Für die Freunde der Europäischen Republik spielt es<br />
offenbar keine Rolle, ob die Völker Europas die Auflösung<br />
der Nationalstaaten und deren Ersetzung<br />
durch Regionen überhaupt wollen. In den meisten Staaten<br />
der Europäischen Union gibt es zurzeit nicht die geringsten<br />
Anzeichen für einen erstarkenden Sezessionismus. Ihre<br />
Bürger empfinden unbeschadet aller regionalen Besonderheiten<br />
die Zugehörigkeit zu ihrer Nation als selbstverständlich,<br />
und im Nationalstaat sehen sie den einzig verlässlichen<br />
Hüter von Rechtsstaat, Sozialstaat und Demokratie.<br />
Das ficht Menasse aber nicht im Geringsten an. Er sieht<br />
die nationalstaatliche Demokratie ohnehin nur als Relikt<br />
der Vergangenheit, das zu erhalten sich nicht lohnt. In seinem<br />
2012 erschienenen Buch „<strong>Der</strong> Europäische Landbote“<br />
schreibt er, man müsse sich mit dem Gedanken anfreunden,<br />
„die Demokratie erst einmal zu vergessen, ihre Institutionen<br />
abzuschaffen, soweit sie nationale Institutionen<br />
sind, und dieses Modell einer Demokratie, das uns so<br />
heilig und wertvoll erscheint, weil es uns vertraut ist, dem<br />
Untergang zu weihen. Wir müssen stoßen, was ohnehin<br />
fallen wird, wenn das europäische Projekt gelingt. Wir<br />
müssen dieses letzte Tabu der aufgeklärten Gesellschaften<br />
brechen, dass unsere Demokratie ein heiliges Gut ist“.<br />
Die Konturen der neuen nachnationalen Demokratie,<br />
die es Menasse zufolge zu erfinden gilt, bleiben im Dunkeln.<br />
Er selbst wisse nicht, wie sie aussehen werde, räumt<br />
er ein. Vermutlich setzt er aber auch hier auf die über -<br />
legene Einsicht der von ihm verklärten Brüsseler Beamten,<br />
in denen er den Geist des aufgeklärten Absolutismus habsburgischer<br />
Prägung fortleben sieht. Sie sollen, so scheint<br />
es, den Kern jener sich allmählich herausformenden „wirklich<br />
universalen Klasse“ bilden, „deren Engagement zu einem<br />
System eines universalen Rechtszustands in Freiheit<br />
für alle, in Nachhaltigkeit führen wird“. Dass eine derart<br />
aufgeklärte Elite keines demokratischen Mandats bedarf,<br />
ergibt sich daraus mit zwingender Logik. Denn dieses Mandat<br />
würde ja noch die Spuren der nationalen Demokratie<br />
in sich tragen und damit nicht „wirklich universal“ sein.<br />
Die Pioniere der westeuropäischen Einigung haben aus<br />
den Erfahrungen der beiden Weltkriege den Schluss gezogen,<br />
dass es den Nationalismus zu überwinden galt, der<br />
Europa an den Rand der Selbstzerstörung getrieben hatte.<br />
<strong>Der</strong> klassische, isolierte, uneingeschränkt souveräne Nationalstaat<br />
hatte aus ihrer wohlbegründeten Sicht zumindest<br />
in Europa keine Zukunft mehr. Die Mitglieder des<br />
Staatenverbunds, den sie schufen, sind denn auch postklassische<br />
Nationalstaaten, die Teile ihrer Hoheitsrechte<br />
gemeinsam ausüben und andere Teile auf supranationale<br />
Einrichtungen übertragen haben.<br />
Die Abschaffung der Nationen und Nationalstaaten<br />
aber lag nicht in der Absicht der Wegbereiter der Europäischen<br />
Union und auch nicht in der von Walter Hallstein,<br />
dem Verfechter eines bundesstaatlich verfassten Europas.<br />
Sie waren sich bewusst, dass die Wurzeln der meisten europäischen<br />
Nationen bis tief ins Mittelalter zurückreichen<br />
und die der älteren Nationalstaaten ebenfalls. Sie hatten<br />
recht: Zu den Besonderheiten Europas gehört seine historisch<br />
gewachsene nationale Vielfalt. Wer die Nationen<br />
und die Nationalstaaten abschaffen will, zerstört Europa<br />
und fördert den Nationalismus. Menasse und seine Mitstreiter<br />
befinden sich auf einem Holzweg.<br />
Gerade ist von Heinrich August Winkler das neue Buch „Zerbricht<br />
der Westen? Über die gegenwärtige Krise in Europa und<br />
Amerika“ erschienen.<br />
„AUS WELCHEM LAND DIE<br />
HÄHNCHEN KOMMEN, IST UNSEREN GÄSTEN<br />
WICHTIG. DARUM SAGEN WIR ES IHNEN.“<br />
Katja Albers, Luxor Grill Düsseldorf<br />
Höchste Zeit für eine verbindliche Herkunftskennzeichnung<br />
auf Speise karten: 84 % der Verbraucher ist es wichtig, dass<br />
ihr Geflügel fleisch aus Deutschland kommt. Trotzdem gehen<br />
noch zu wenige Gastronomen mit gutem Beispiel voran und<br />
informieren, woher ihr Fleisch stammt.<br />
Geflügel-Charta.de
Warlord City<br />
Somalia Die Reichen essen Hummer, die Terroristen machen Geld, der Tod ist eine Autobombe entfernt.<br />
Das ist Mogadischu, eine Stadt, die vom Krieg lebt. Von Fritz Schaap und Christian Werner (Fotos)<br />
Als der Krieg in den Country Club<br />
von Mogadischu kam, waren die<br />
ersten Gänge gerade serviert worden.<br />
50 Gäste, Geschäftemacher und Regierungsleute,<br />
saßen an langen Tafeln, auf<br />
den Tischen standen Schüsseln voller Kameleintopf,<br />
Zicklein, Hummer, Schwertfisch.<br />
Dann detonierte ein Transporter vor<br />
dem Tor, gefüllt mit Sprengstoff, die Explosion<br />
pulverisierte Teile der Schutzmauer,<br />
fegte das oberste Stockwerk von der<br />
Villa und zerstörte ihre ganze Vorderseite.<br />
Danach feuerten vier Angreifer mit<br />
Sturmgewehren auf die Sicherheitsleute<br />
des Country Club, stürmten ein gegenüberliegendes<br />
Restaurant, und als zwölf Stunden<br />
später der letzte Kämpfer endlich erschossen<br />
wurde, waren 3 Wachleute und<br />
16 Gäste tot.<br />
Sechs Wochen später ist von dem Anschlag<br />
nichts mehr zu sehen. Es ist ein<br />
Montagvormittag, und Manar Moalin wartet<br />
auf ihre Gäste. Sie steht auf einem Geschützturm<br />
am Eingang, eine 33-Jährige,<br />
die Lippen rot geschminkt, der Lidschatten<br />
golden, und betrachtet die Straßensperren<br />
an der Kreuzung, einen gepanzerten Wagen,<br />
der gerade die Betonbarrieren umkurvt,<br />
und die schwer bewaffneten Sicherheitsleute<br />
vor ihrem Country Club, die im<br />
Schatten lehnen und Kat kauen.<br />
Ein zweieinhalb Meter breiter Wall aus<br />
Sand und Zement schützt nun den Klub,<br />
die Villa leuchtet in frischem Weiß. Kokospalmen<br />
und Gummibäume säumen zwei<br />
offene Hütten, die mit Palmwedeln gedeckt<br />
sind. <strong>Der</strong> Country Club von Mogadischu<br />
ist eine Mischung aus Palast, Festung<br />
und Bretterverschlag, vor allem aber:<br />
Refugium hoher Regierungsleute, Treffpunkt<br />
von Geschäftsleuten und den Reichen<br />
der Stadt. <strong>Der</strong> vielleicht seltsamste<br />
Ort von Mogadischu, Hauptstadt des gescheitertsten<br />
aller Staaten. Seit 27 Jahren<br />
ohne eine Regierung, die alle Teile des<br />
Landes kontrolliert, seit drei Jahrzehnten<br />
im Krieg.<br />
Warlords und dubiose Geschäftsmänner<br />
herrschen hier und natürlich al-Schabab,<br />
Verbündete von al-Qaida, auf deren Konto<br />
allein im vergangenen Jahr mehr als 4200<br />
Tote gingen. Auch der Anschlag vom vergangenen<br />
Sonnabend, bei dem mehr als<br />
300 Menschen starben, wird ihnen zugeschrieben.<br />
Und doch boomt Mogadischu.<br />
Die Stadt ist eine Metropole des Grauens,<br />
ihr Geschäftsmodell das Chaos.<br />
Manar Moalin verlässt ihren Aussichtspunkt<br />
und setzt sich auf eine Art Holzthron<br />
90 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
im Garten. Ein paar Zwergantilopen zittern<br />
im Wind, eine Riesenschildkröte kriecht vorbei.<br />
Ihr blaues Kopftuch hat Moalin wie ein<br />
Pirat um den Kopf gebunden. Sie trägt ein<br />
kobaltblaues Hemd unter einer schwarzen<br />
Weste, enge Jeans, einen goldenen Nasenring.<br />
Das trockene Ploppen einer Maschinengewehrsalve<br />
weht herüber. „So laufen<br />
eben die Geschäfte hier“, sagt sie und deutet<br />
auf die letzten Spuren der Zerstörung.<br />
Moalins Stimme klingt jung, rau, nach<br />
Londoner West End. Dort, in London, hat<br />
sie studiert, Wirtschaft; aber geboren<br />
wurde sie in Somalia, aufgewachsen ist sie<br />
in Italien. In Dubai betrieb sie ein Luxusspa.<br />
Es war ein gutes Leben, doch dann<br />
zog es ihre Mutter 2009 nach Mogadischu,<br />
und auch Moalin hatte das Gefühl, es sei<br />
Zeit, in ihre Geburtsstadt zurückzukehren.<br />
Sie kam für einen ersten Besuch, dann wieder,<br />
schließlich für immer. Vor fast drei<br />
Jahren, im Dezember 2014, eröffnete sie<br />
ihren Klub.<br />
Das erste Jahr drohte sie zu zerbrechen.<br />
In Mogadischu braucht jeder Verbündete.<br />
Moalin hatte keine. Die Konkurrenz ließ<br />
den Klub vom Geheimdienst stürmen, ein<br />
paar Clanführer aus dem Viertel ließen<br />
eine Privatarmee davor aufmarschieren,<br />
man drohte ihr, man denunzierte sie, raubte<br />
sie aus. Mehr als einmal hatte sie eine<br />
Gewehrmündung an der Stirn. Es dauerte<br />
zwölf Monate, bis sie die Regeln verstanden<br />
hatte. „Ich habe hier meine Freiheit,<br />
meine Ruhe, meine Gesundheit verloren“,<br />
sagt sie. „Ich kann nicht anziehen, was ich<br />
will, nicht gehen, wohin ich will. Ich wohne<br />
in einer Festung, die ich nie verlasse.“<br />
Aber fortgehen will sie trotzdem nicht.<br />
Zweimal kam ihr Bruder, um sie wieder<br />
nach Dubai zu holen. Die Kinder wollen<br />
sie zurück, der Ehemann auch. Doch Moalin<br />
bleibt. Aus Trotz. Und weil sie in ihrer<br />
Heimat etwas voranbringen will.<br />
„Es geht mir mittlerweile weniger ums<br />
Geld als ums Prinzip“, sagt sie. Sie will<br />
sich, wie so viele Rückkehrer, nicht noch<br />
einmal vertreiben lassen. Aber natürlich<br />
geht es auch ums Geld. „Man kann hier<br />
so reich werden wie nirgendwo sonst.“<br />
Auch beim Angriff auf ihren Klub spielte<br />
Geld eine Rolle. Moalin sagt, sie zahle<br />
kein Schutzgeld. Das war der eine Grund.<br />
<strong>Der</strong> andere war, dass Geschäftsleute aus<br />
dem Viertel ihren Klub übernehmen wollten,<br />
sie sollen Schabab-Kämpfer für den<br />
Anschlag angeheuert haben.<br />
Nachdem Rebellen 1991 den Diktator<br />
Siad Barre gestürzt hatten, übernahmen<br />
Clans und Warlords die Macht, später auch<br />
al-Schabab. Schätzungsweise zweieinhalb<br />
Millionen Somalier wurden vertrieben, gut<br />
eine Million floh ins Ausland, bis zu anderthalb<br />
Millionen kamen infolge des Konflikts<br />
um, die meisten davon Zivilisten.<br />
Das Land machte Schlagzeilen mit Piraten,<br />
Entführungen, Terroranschlägen, Hungersnöten.<br />
Es gibt eigentlich kein Somalia<br />
mehr, nichts, was einen Staat ausmacht,<br />
keine Justiz, keine Polizei, keine Steuern.<br />
Aber seit dem Frühjahr gibt es eine neue<br />
Regierung. Seither sprechen europäische<br />
Diplomaten von einem „window of opportunity“.<br />
Auch wenn die Wahl nicht mehr<br />
war als ein großes Herumschieben von Bestechungsgeldern,<br />
angeblich wurden bis<br />
zu 1,3 Millionen Dollar für einen Sitz im<br />
Parlament gezahlt. Auch wenn es nicht die<br />
Bürger waren, die wählten, sondern 14025<br />
Clanabgesandte. Und auch wenn Mogadischu<br />
der einzige Ort ist, den diese Regierung<br />
einigermaßen kontrolliert. Denn<br />
einen großen Teil des Landes beherrscht<br />
weiterhin al-Schabab.<br />
Vor sechs Jahren wurden die Extremisten<br />
aus Mogadischu vertrieben. Doch das heißt<br />
nicht, dass Frieden herrscht. Es wird nur<br />
ein bisschen weniger gestorben. Die größte<br />
Gefahr sind nun die Autobomben. Es gibt<br />
noch immer ganze Viertel, die in Schutt liegen,<br />
von Kugeln durchsiebte Fassaden,<br />
Menschen, die in Ruinen leben. Doch neben<br />
den Skeletten der Villen sind Neubauten<br />
entstanden. <strong>Der</strong> Immobilienmarkt<br />
wächst, bis zu eine Million Dollar kosten<br />
neue Villen. Hotels eröffnen, Restaurants,<br />
Taxiunternehmen, Banken. Mehr als<br />
100000 Somalier sind in den vergangenen<br />
Jahren aus dem Ausland zurückgekehrt.<br />
Es ist früher Nachmittag, im Country<br />
Club fahren immer mehr Land Cruiser vor,<br />
gepanzert und mit getönten Scheiben.<br />
Moalin steht am Eingang und begrüßt ihre<br />
Gäste, Parlamentarier, Geschäftsleute, die<br />
Chefs des Staatsfernsehens. Schüsse sind<br />
zu hören, aber niemand beachtet sie. Die<br />
Eskorten von zwei Gästen beschießen sich,<br />
eine Verwechslung.<br />
Moalin führt die Männer in einen von<br />
grünen Lichterketten beleuchteten Raum.<br />
<strong>Der</strong> Gang der Klubchefin erinnert an den<br />
eines Boxers, breit und stolz. Es wird Goldmakrele<br />
an Linguine mit einem Tomaten-<br />
Koriander-Sugo serviert. Ein Geschäftsmann<br />
ordert einen Hummer. „Allahu akbar“,<br />
ruft der Muezzin über die Köpfe,<br />
doch niemanden kümmert es. <strong>Der</strong> Country<br />
Club, das ist auch ein Ort der Freiheit
Ausland<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
Country-Club-Betreiberin Moalin: „Die Somalis haben im Krieg viel verloren, vor allem ihre Seele“<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
Soldaten im Hafenviertel von Mogadischu: Neben den Ruinen entstehen neue Villen für eine Million Dollar<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
91
Eingang des VIP-Bereichs im Country Club: Treffpunkt von Politikern und windigen Geschäftemachern<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
92 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
und Zuflucht in einer von Religion und<br />
Krieg zerrütteten Stadt.<br />
„Die Somalis“, sagt Moalin, „haben im<br />
Krieg viel verloren, vor allem ihre Seele.“<br />
Als das Mörserfeuer die Stadt in Flammen<br />
aufgehen ließ, sei auch die Moral ausgebrannt.<br />
Zurück blieb nur der nackte Wille<br />
zum Überleben. Mitgefühl und Menschlichkeit<br />
seien verschwunden, sagte Moalin.<br />
Mogadischu wurde zu einer skrupellosen<br />
Finanzmetropole der anderen Art.<br />
An einem Tisch weit hinten im Garten,<br />
wo die Wasserpfeifen in langen Reihen stehen,<br />
sitzt ein kleiner, gedrungener Mann<br />
mit weichem Gesicht und amerikanischem<br />
Ostküstenakzent, mit viel Pomade im<br />
Haar und einem schmal geschnittenen<br />
Anzug. Mohamed Said ist Abgeordneter<br />
und Berater des Präsidenten. Er ist fast<br />
täglich im Klub und kennt beinahe jeden<br />
in der Regierung. Er weiß, wie diese Stadt<br />
funktioniert.<br />
„Mogadischu“, sagt er, „wird noch immer<br />
von Warlords beherrscht.“<br />
Die neuen Warlords trügen keine Patronengurte,<br />
befehligten keine Kindersoldaten<br />
mit glasigen Augen mehr. Nein, sie seien<br />
Geschäftsleute. Doch ihre Interessen<br />
setzten sie mit den gleichen Mitteln durch,<br />
mit Waffen, Autobomben, Entführungen<br />
und Enthauptungen.<br />
Said lässt seine Brille mit dem dünnen<br />
Goldrand auf die Nasenspitze rutschen<br />
und schaut in den Rauch der Wasserpfeife,<br />
dann spricht er leise, wie fast jeder in Mogadischu,<br />
der etwas zu sagen hat. Aufmerksamkeit<br />
zu erregen kann tödlich sein.<br />
Es würden hier in Somalia nicht Geschäfte<br />
gemacht, um einen Krieg zu finanzieren.<br />
Es werde nicht um Land gekämpft oder<br />
um Ideologien. Es werde Krieg geführt,<br />
weil er die Geschäfte am Laufen halte.<br />
Wieder Schüsse, diesmal auf der Hauptstraße.<br />
Angehörige eines mächtigen Clans<br />
demonstrieren; einer der Ihren wurde zum<br />
Tode verurteilt, weil er den Minister für<br />
Wiederaufbau erschossen hatte. Aus Versehen,<br />
sagen seine Stammesbrüder.<br />
Die Stadt ist nervös.<br />
Al-Schabab, so scheint<br />
es, startet eine<br />
neue Offensive der Angst.<br />
Natürlich gebe es aber auch Hoffnung,<br />
sagt der Abgeordnete. „Die neue Regierung<br />
besteht zum Großteil aus Technokraten,<br />
die aus der Diaspora zurückgekehrt<br />
sind und keine starken Clanverbindungen<br />
haben.“ Das allerdings sei zugleich auch<br />
ein Problem. Denn die Männer, die im<br />
Land geblieben seien, respektierten jene<br />
nicht, die in den USA, in Norwegen, in<br />
England studiert hätten.<br />
Und das sei nicht alles, denn die wahre<br />
Macht liege ohnehin nicht bei der Regierung.<br />
„Die Leute, die die großen Konzerne<br />
für Telekommunikation, Strom und Wasser<br />
kontrollieren, sind die wahren Herrscher<br />
der Stadt“, sagt Said. Und sie alle<br />
hätten enge Verbindungen zu al-Schabab.<br />
Gerade, erzählt er, sei die Regierung mit<br />
einem gewagten Plan vorgeprescht: Jeder,<br />
der an al-Schabab Steuern zahle, solle bestraft<br />
werden. Doch die Geschäftsleute hätten<br />
protestiert, der Plan sei zurückgewiesen<br />
worden. <strong>Der</strong> Abgeordnete lacht, es ist<br />
ein hohes, hüpfendes Lachen. Wie kann,<br />
fragt er, die Regierung mit so etwas drohen?<br />
Jeder, der hier ein Gewerbe betreibe,<br />
zahle Steuern an al-Schabab. Wer nicht<br />
zahle, dem ergehe es wie Moalin.<br />
„Man kann nicht verlangen, die Schutzgeldzahlungen<br />
zu beenden, wenn man als<br />
Regierung nicht für Sicherheit sorgen<br />
kann“, sagt er. Dann wendet er die Kohle<br />
auf der Wasserpfeife, rührt in seinem Espresso<br />
und schaut auf sein riesiges<br />
Smartphone. Absätze klackern auf dem<br />
Fliesenboden, die Stewardessen von Jubba<br />
Airways laufen über den Hof. „Alles in<br />
Mogadischu ist ein Geschäft“, fährt er fort.<br />
Ob auch sein Sitz im Parlament ein Geschäft<br />
war und, wenn ja, wie dieses Geschäft<br />
genau aussieht – dazu will er nichts<br />
sagen, natürlich.<br />
Er redet dafür über ein anderes Geschäft,<br />
vielleicht überhaupt das wichtigste im<br />
Land: die internationale Hilfe. 1,2 Milliarden<br />
Dollar fließen laut Uno jährlich nach<br />
Somalia. Aber fast keine internationale Organisation<br />
arbeitet im Süden des Landes,
Ausland<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
Straßenszene in Mogadischu: Es gibt kein Somalia mehr, nichts, was einen Staat ausmacht<br />
dort, wo al-Schabab herrscht. Es sind daher<br />
lokale NGOs, die die Hilfsgüter an die Bevölkerung<br />
verteilen. „Und genau da“, so<br />
der Abgeordnete, „verschwindet das Geld.“<br />
Eine dumpfe Detonation unterbricht seine<br />
Worte. <strong>Der</strong> Abgeordnete schaut kurz<br />
auf. Eine Bombe sei an den Wagen eines<br />
Hochzeitskonvois geheftet worden, heißt<br />
es später. Angeblich habe die Frau eine<br />
Affäre gehabt. <strong>Der</strong> Bräutigam habe al-<br />
Schabab einen Mordauftrag erteilt.<br />
„Manch ehemaliger Warlord“, fährt der<br />
Abgeordnete fort, „ist einfach irgendwann<br />
zu einem religiösen Führer geworden.<br />
Hauptsächlich, weil das die Jugend besser<br />
mobilisiert.“ Mehr als 70 Prozent der Bevölkerung<br />
seien unter dreißig, viele nie<br />
zur Schule gegangen. „Die wollen Teil von<br />
etwas sein, und das kann ihnen al-Schabab<br />
bieten, im Gegensatz zur Regierung.“<br />
Er zahlt und geht zu seinem Land Cruiser,<br />
Funkgeräte rauschen, ein Toyota-Pickup<br />
fährt vorneweg, auf der Ladefläche fünf<br />
bewaffnete Aufpasser. Als sie die Einfahrt<br />
passieren, geben sie Gas und schießen die<br />
Straße hinunter. Langsam fahren kann in<br />
Mogadischu tödlich sein.<br />
Die Verkehrsregeln sind einfach in dieser<br />
Stadt: Wer die größere Eskorte besitzt,<br />
hat immer Vorfahrt. Stau ist gefährlich, im<br />
Stau ist man ein einfaches Ziel. Und die<br />
Stadt ist nervös in diesen Tagen, die Frequenz<br />
der Anschläge nimmt zu. Al-Schabab,<br />
so scheint es, startet eine neue Offensive<br />
der Angst. An den Checkpoints schießen<br />
die Soldaten auf jeden, der nicht ihren<br />
Anweisungen folgt. Sie zerren Tuk-Tuk-<br />
Fahrer von ihrem Dreirad, prügeln mit ihren<br />
Gewehrkolben auf sie ein.<br />
Keine sechs Kilometer entfernt vom<br />
Country Club, im Garten des City Palace<br />
Hotel, wartet ein Mann, der erklären kann,<br />
wie das Unternehmen al-Schabab funktioniert.<br />
Ein Mann, der in den vergangenen<br />
sieben Jahren 35 Männer und Frauen mit<br />
der Machete geköpft und vermutlich noch<br />
mehr erschossen hat. Er sitzt an einem blauen<br />
Plastiktisch und trinkt Cappuccino, das<br />
Abendlicht ist weich, die Kellner tragen<br />
weiße Hemden und schwarze Hosen.<br />
Bis vor einem Jahr war der 55-Jährige<br />
Kommandeur von al-Schabab für den Südwesten<br />
Somalias, ein Emir. Er bittet darum,<br />
seinen Namen nicht zu nennen. Im vergangenen<br />
Oktober, nachdem er zwei Anschläge<br />
eines konkurrierenden Flügels innerhalb<br />
von al-Schabab überlebt hatte,<br />
machte er einen Deal mit der Regierung:<br />
Freiheit gegen Informationen. Seither ist<br />
er in Mogadischu.<br />
Sein Gesicht ist zerschunden, die Augen<br />
hinter der Sonnenbrille sind rot unterlaufen,<br />
die Fingernägel abgekaut. Auf seinem<br />
Kopf sitzt eine weiße Häkelmütze. Wenn<br />
der Kellner vorbeigeht, verstummt er.<br />
Seine Geschichte erzählt er so: Früher<br />
sei er Bauer gewesen und Vorsteher eines<br />
Dorfs in der Region Lower Shebelle, er<br />
besaß Pflanzungen am Fluss und verkaufte<br />
seine Früchte bis nach Mogadischu. Dann,<br />
2006, kam die Dürre, und die Melonen gingen<br />
ein, die Bananen, die Mangos, die Bohnen.<br />
Eines Tages standen die Männer von<br />
al-Schabab vor seiner Tür. Komm zu uns,<br />
sagten sie, wir bezahlen dich gut. Er zögerte.<br />
Komm zu uns, wir bezahlen dich<br />
gut. Oder wir erschießen dich.<br />
Sie machten ihn zum Finanzchef der<br />
Region, und er merkte bald, dass es weniger<br />
um Gott ging als ums Geld. „Al-Schabab<br />
ist ein riesiges Unternehmen“, sagt der<br />
Emir. Sie trieben Steuern ein, erpressten<br />
Unternehmer und Politiker in Mogadischu.<br />
Die meisten Politiker und alle Unternehmen<br />
zahlten Schutzgeld. Schon der Telekommunikationsriese<br />
Hormuud zahle pro<br />
Filiale 1000 Dollar am Tag, behauptet er,<br />
allein in Mogadischu gebe es 17 Filialen.<br />
„Sie verbreiten Angst, weil Angst die<br />
Basis ihres Geschäftsmodells ist.“<br />
Um den Umsatz von Hotels und Restaurants<br />
zu kalkulieren, schicke al-Schabab<br />
Spione dorthin. Sie kassierten mal ein paar<br />
Hundert Dollar im Monat, mal bis zu<br />
50 000 Dollar für große Hotels. Wer nicht<br />
zahle, werde entführt, dann könne er sich<br />
entscheiden: zahlen oder enthauptet werden.<br />
Spätestens da hätten fast alle gezahlt.<br />
„Al-Schabab verdient im ganzen Land“,<br />
sagt der Emir. „Sie nehmen Wegzölle auf<br />
Straßen, die sie kontrollieren. Manche<br />
Routen bringen mehr als 50 000 Dollar am<br />
Tag ein.“ Zudem haben sie laut Uno den<br />
millionenschweren Schmuggel von Holzkohle<br />
und Zucker im Süden des Landes in<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
93
Ausland<br />
Gäste im Country Club: Wer Frieden will, ist eine Gefahr<br />
der Hand, zusammen mit der kenianischen<br />
Armee; sie schmuggeln Elfenbein und Nashornhörner.<br />
Aber nicht nur im Land würden Umsätze<br />
generiert. Auch das Ausland unterstütze<br />
al-Schabab finanziell, allen voran Katar<br />
und Saudi-Arabien. Er spricht von 20 Millionen<br />
Dollar, die katarische Scheichs vergangenes<br />
Jahr in sein Herrschaftsgebiet<br />
eingeflogen haben sollen. Beweise dafür<br />
hat er jedoch nicht. Das Geld wandere in<br />
die Taschen der Bosse, die davon Waffen<br />
kauften, ihre Kämpfer bezahlten und ihre<br />
Safes füllten. Ihre Familien würden in<br />
Europa und den USA wohnen, ihre Kinder<br />
nur die besten Universitäten besuchen.<br />
Auch er selbst wohnte in einer Villa mit<br />
acht Zimmern am Meer, südwestlich von<br />
Mogadischu, fuhr zwei neue Gelände -<br />
wagen, hatte drei Sklaven und zwölf Sicherheitsleute.<br />
Über dem Flughafen steigen zwei Uno-<br />
Helikopter auf. <strong>Der</strong> Emir schaut ihnen nach.<br />
Die humanitäre Hilfe sei ein Segen, sagt<br />
er dann. Für al-Schabab. Gerade dieses<br />
Jahr, da mehr als 800000 Menschen wegen<br />
der Hungersnot ihre Dörfer verlassen<br />
mussten. Fünf Prozent von den Budgets<br />
der Hilfsorganisationen verlange die Terrorgruppe.<br />
Das ist allerdings noch eine niedrige<br />
Schätzung. Sogar zehn Prozent lege die<br />
Uno auf die Seite, offiziell für „capacity<br />
building“ oder Ähnliches, inoffiziell wird<br />
damit al-Schabab bezahlt, damit die lokalen<br />
Uno-Partner Hilfsgüter verteilen können.<br />
Das sagt ein hochrangiger Mitarbeiter<br />
der Uno in Nairobi, der für Somalia zuständig<br />
ist.<br />
Da die Uno die Arbeit der lokalen<br />
NGOs jedoch nicht kontrollieren könne,<br />
wisse eigentlich niemand, ob die Hilfe bei<br />
den Betroffenen ankomme. Ein Mitarbeiter,<br />
der ebenfalls anonym bleiben will,<br />
schätzt, dass es eine gute Quote sei, wenn<br />
zehn Prozent der Hilfe die Bedürftigen erreiche.<br />
Auch Hungersnöte seien in Somalia<br />
ein Geschäft.<br />
<strong>Der</strong> Krieg könnte schon lange vorbei<br />
sein, wenn nicht alle Parteien so gut daran<br />
verdienten, sagen in Hintergrundgesprächen<br />
viele Uno-Mitarbeiter. Einer erzählt,<br />
dass selbst Sicherheitsfirmen, die für sie<br />
arbeiteten, al-Schabab für Angriffe engagierten,<br />
um danach höhere Preise verlangen<br />
zu können. Von der Atmosphäre der<br />
Unsicherheit profitierten letztlich alle, sagen<br />
sie, durchaus auch selbstkritisch.<br />
Es werde sich nur etwas ändern, wenn<br />
man die Hilfe einstelle. Das viele Geld, es<br />
In Somalia ist fast alles<br />
kaputt – das sind<br />
beste Voraussetzungen<br />
fürs Geschäft.<br />
halte nur die Korruption und die Instabilität<br />
aufrecht.<br />
Im Country Club ist es Abend geworden.<br />
<strong>Der</strong> Rauch der Wasserpfeifen hängt über<br />
dem Garten, der Himmel ist klar, ein halber<br />
Mond steht tief. In kleinen Gruppen haben<br />
sich die Gäste über den Garten verteilt.<br />
Moalin streicht eine Tischdecke glatt und<br />
sagt, dass viele in der Regierung wirklich<br />
Frieden wollten, ein Ende der Korruption.<br />
Aber sie hielten sich bedeckt. Denn wenn<br />
ihre Kollegen erführen, was sie dächten,<br />
sie würden sie rauswerfen. Denn wer den<br />
Status quo infrage stelle, der sei eine Gefahr<br />
fürs Geschäft. „Die treffen sich hier<br />
und reden darüber, aber sie trauen sich<br />
nicht, öffentlich aufzubegehren.“<br />
CHRISTIAN WERNER / DER SPIEGEL<br />
In einem Pavillon neben einem Gummibaum<br />
sitzen zwei türkische Geschäftsmänner.<br />
Keiner möchte reden. Natürlich nicht.<br />
Denn die Türken spielen hier eine eigenartige<br />
Rolle. 2011 war Recep Tayyip Erdoğan<br />
nach fast zwei Jahrzehnten der erste nicht<br />
afrikanische Regierungschef, der die Hauptstadt<br />
besuchte. Türkische Unternehmen teerten<br />
Straßen, errichteten ein Krankenhaus,<br />
sie bauten auch den Flughafen, der von der<br />
türkischen Firma Favori LLC betrieben wird,<br />
von der man bei der Uno vermutet, dass Erdoğans<br />
Sohn an ihr beteiligt ist. Ein türkischer<br />
Konzern betreibt den Hafen.<br />
Studien zufolge könnte Somalia über<br />
riesige Erdölreserven verfügen. Die Türken<br />
könnten an diesem Geschäft mitverdienen<br />
wollen. Am Rande von Mogadischu<br />
baut die Türkei zudem eine Militärbasis.<br />
In Diplomatenkreisen heißt es, dort sollten<br />
jährlich tausend somalische Soldaten ausgebildet<br />
werden, die jedoch unter türkischer<br />
Kontrolle bleiben sollen. Laut vertraulichen<br />
Uno-Berichten fliegt Turkish<br />
Airlines regelmäßig Geldkoffer ein, sie gehen<br />
an das Präsidentenbüro und an hohe<br />
Politiker und sollen der Türkei wohl Sicherheit<br />
und freie Hand garantieren.<br />
Die Türken, sagt Manar Moalin, übernähmen<br />
das Land.<br />
Sie läuft zwischen den Gästen umher,<br />
die immer zahlreicher werden. Die Nacht<br />
hat sich über Mogadischu gelegt. Moalin<br />
ist müde, die ständigen Explosionen zehren<br />
an ihren Nerven. Ricky Martin tönt<br />
aus den Boxen. Und wieder hallt eine Detonation<br />
durch die Nacht, eine Mörsergranate<br />
wahrscheinlich.<br />
An einem der Tische sitzt einsam ein<br />
Mann im strahlend blauen Anzug, am Handgelenk<br />
eine Rolex, an den Füßen rahmengenähte<br />
Schuhe. Mac, so stellt er sich vor, ist<br />
einer von den Somaliern, die im Krieg nicht<br />
flohen, einer dieser zwielichtigen Dealmaker<br />
der Stadt, eine Mischung aus Mittelsmann,<br />
Schmuggler und Unternehmer. Zu Geld ist<br />
er mit Diamanten aus dem Kongo gekommen.<br />
Jetzt vermehrt er es hier. Uranabbau<br />
zum Beispiel, das sei das nächste große Ding.<br />
Gerade habe er ein Treffen mit den Chinesen<br />
gehabt. Die wollten das Meer, 3000<br />
Kilometer Küste hat Somalia, unendliche<br />
Mengen an Fisch. Sie hätten bereits Fischereiabkommen<br />
mit verschiedenen Warlords<br />
im Norden geschlossen, auch mit der Regierung<br />
sprächen sie derzeit.<br />
Somalia, sagt Mac, sei ein Land, in dem<br />
fast alles kaputt sei, wo fast alles gebraucht<br />
werde, ein „jungfräulicher Staat“, ohne<br />
Sicherheit, ohne Strukturen. Das seien<br />
doch beste Voraussetzungen fürs Geschäft.<br />
„Es ist“, sagt Mac, „fantastisch.“<br />
Video: Manar Moalin über<br />
die Zeit nach dem Angriff<br />
spiegel.de/sp432017somalia<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
94 DER SPIEGEL 43 / 2017
Sträflich kurzsichtig<br />
Analyse Mit der Eroberung von Rakka ist das „Kalifat“ tot, doch der IS lebt weiter.<br />
Denn die Gründe, die zu seinem Aufstieg führten, sind noch immer da.<br />
Anti-IS-Kämpfer in Rakka<br />
BULENT KILIC / AFP<br />
<strong>Der</strong> „Islamische Staat“ hat Rakka endgültig verloren,<br />
seine Hochburg in Syrien. Anfang der Woche nahmen<br />
kurdisch geführte Milizionäre nach monatelangen<br />
Kämpfen die letzten Bastionen des IS ein, ein Krankenhaus<br />
und das Fußballstadion. Das Grauenskalifat ist<br />
nun Geschichte. Zumindest in seiner Form als Herrschaft<br />
über Städte, Land und zeitweise Millionen Menschen, mit<br />
einem Verwaltungsapparat, Grenzen und Fahnen, kurz:<br />
als quasistaatliche Macht symbolisierendes Projekt.<br />
Die IS-Strategen sind Virtuosen der Symbolik, und nichts<br />
hatte mehr Strahlkraft, passte besser zu frühislamischen<br />
Prophezeiungen als der Eroberungsfeldzug von 2014. Doch<br />
auch der Westen und alle, die<br />
nun das Ende des IS feiern, haben<br />
sich von dieser Symbolik<br />
blenden lassen. Allen voran die<br />
USA, die ihren Krieg gegen den<br />
IS zur Priorität machten. Nein,<br />
es war absolut kein Fehler, gegen<br />
den IS zu Felde zu ziehen.<br />
Es war nur sträflich kurzsichtig,<br />
dies inmitten eines mörderischen<br />
Krieges in Syrien und eines<br />
zutiefst zerrissenen Iraks zu<br />
tun – ohne sich Gedanken um<br />
die Zeit danach zu machen.<br />
Nun ist zwar das „Kalifat“<br />
verschwunden, Rakka zurück -<br />
erobert. Doch die Bedingungen<br />
haben sich nicht verbessert, der<br />
Hass zwischen Sunniten und<br />
Schiiten ist sogar gewachsen.<br />
Und der IS floriert in solch einem<br />
Vakuum, in dieser Atmosphäre<br />
von Krieg und Hass. Er<br />
geht jetzt wieder in den Untergrund,<br />
wo er sich auch früher schon geschmeidig bewegt<br />
hat. Die wenigen Überlebenden ziehen sich in Wüsten -<br />
gebiete und Dörfer zurück. 90 Prozent der Führer sind tot.<br />
Sollte es den restlichen gelingen, sich neu zu organisieren,<br />
könnten sie eines Tages wieder zuschlagen, am ehesten<br />
dann wohl unter einem neuen Label. Die Umstände dafür<br />
wären jedenfalls günstig.<br />
Wie rasch der Hauptfeind von gestern absorbiert wird<br />
durch die Kämpfe von morgen, zeigt der Umgang mit den<br />
letzten IS-Leuten in deren gerade eroberten Hochburgen.<br />
In Rakka schlossen die kurdischen Befreier einen Deal mit<br />
den verbliebenen Kämpfern und deren Familien: freier<br />
Abzug gegen Aufgabe, inklusive der ausländischen Kämpfer.<br />
Im irakischen Hawidscha, wo noch weit mehr IS-Kämpfer<br />
ausharrten, gab es einen ähnlichen Deal zwischen der<br />
Terrorgruppe und der kurdischen Autonomieregierung.<br />
Nach Aussage von Zeugen entkamen so Hunderte Kämpfer<br />
mitsamt ihren schweren Waffen ins Kurdengebiet.<br />
<strong>Der</strong> IS war gestern. Nun ist der Irak wieder mit voller<br />
Wucht da angekommen, wo er vor 2014 stand: Araber gegen<br />
Kurden, Bagdad gegen Arbil. Die mit amerikanischen<br />
wie deutschen Waffen hochgerüsteten Kurden stimmten<br />
am 25. September auf Betreiben ihres Präsidenten Masoud<br />
Barzani in einem Referendum für die Unabhängigkeit<br />
ihrer Autonomieregion im Norden des Irak – und darüber<br />
hinaus für die Annexion der Ölmetropole Kirkuk sowie<br />
jener Gebiete, die ihre Truppen im Sommer 2014 unter<br />
Kontrolle gebracht hatten, als die irakische Armee wie<br />
gelähmt war von der Blitzoffensive des IS.<br />
<strong>Der</strong> Vorstoß der Kurden ging am vergangenen Montag<br />
krachend schief: <strong>Der</strong> irakische Premier Haider al-Abadi<br />
schickte die Armee, ebenfalls aufgerüstet von den USA,<br />
sowie die von Teheran kontrollierten<br />
schiitischen Milizen nach<br />
Kirkuk. Binnen Stunden büßten<br />
die Kurden alle neu gewonnenen<br />
Gebiete rings um Kirkuk<br />
ein. Darüber hinaus verloren<br />
die beiden herrschenden Kurdenparteien<br />
jedes Ansehen im<br />
Volk: Barzanis KDP, weil sie<br />
das Referendum gegen alle Warnungen<br />
forciert hatte. Und die<br />
PUK, gegründet vom ehema -<br />
ligen irakischen Präsidenten<br />
Dschalal Talabani, weil sie einen<br />
Deal mit der Zentralregierung<br />
gemacht und sich kampflos<br />
aus Kirkuk zurückgezogen<br />
hatte, dem „kurdischen Jerusalem“,<br />
das bis zum letzten Blutstropfen<br />
zu verteidigen sich die<br />
Kurden stets geschworen hatten.<br />
Was dies für Kurdistan, wo<br />
Stolz eine Währung ist wie Geld,<br />
bedeutet, lässt sich kaum überschätzen.<br />
Auf dem kurdischen Fernsehsender Rudaw TV<br />
brachen erst die Peschmerga, dann der Journalist in Tränen<br />
aus über das, was sie als schmählichen Verrat ansehen.<br />
Niemand spricht heute mehr von Mossul, der einstigen<br />
Millionenstadt, die erst im Juli vom IS befreit wurde. Auch<br />
die Befreiung Rakkas wird bald vergessen sein, überrollt<br />
von den kommenden Kämpfen darum, wer die Ruinenstadt<br />
künftig beherrschen wird: die kurdischen Truppen, die<br />
alles daransetzen, ihr gewonnenes Terrain zu konsolidieren<br />
– oder die Armee von Machthaber Assad und seinen<br />
Hilfstruppen aus dem Irak, Libanon und Afghanistan.<br />
Und die USA, die den Anti-IS-Kampf vorantrieben? Sie<br />
machen Politik als Wille ohne Vorstellung. Sie würden im<br />
Irak nun nicht Partei ergreifen, so Präsident Donald Trump.<br />
Und eine Sprecherin des Außenministeriums sagte: Die<br />
Idee sei, in Rakka die Grundversorgung instand zu setzen,<br />
„aber kein Nationbuilding“ zu betreiben. Anschließend<br />
könne die Stadt „dem Gastland“ zurückgegeben werden.<br />
Auf die Frage, wie dies funktionieren solle, mitten im<br />
Krieg, hatte sie keine Antwort.<br />
Christoph Reuter<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
95
Ausland<br />
„Es gibt überall<br />
Betrüger“<br />
Malta Die Investigativjournalistin<br />
Daphne Caruana Galizia<br />
ent hüllte Steuerflucht, Geld -<br />
wäsche und Korruption.<br />
Wurde sie deshalb ermordet?<br />
Daphne Caruana Galizia machte sich<br />
keine Illusionen. Über 20 Jahre lang<br />
hatte sie die Mächtigen auf Malta<br />
mit ihren Enthüllungen geärgert. Doch es<br />
änderte sich: nichts. „Unsere Polizei hat keinen<br />
Willen, irgendwas zu unternehmen“,<br />
sagte sie Anfang Mai. Die Justiz sei ein Instrument<br />
der Regierenden, sie verhindere<br />
Ermittlungen. Und trotzdem machte die<br />
53-Jährige weiter, Bloggerin, Missionarin<br />
und Aufklärerin in einem, um die dunklen<br />
Seiten der Sonneninsel aufzudecken.<br />
Denn Caruana Galizia war der Überzeugung,<br />
dass ihr Land der Mafia und korrupten<br />
Politikern in die Hände gefallen sei,<br />
und sie sah es als ihre Aufgabe an, das zu<br />
ändern. Das wurde ihr zum Verhängnis.<br />
Am Montag riss eine Autobombe sie in<br />
den Tod; ein professionelles Attentat, offenbar<br />
mit Plastiksprengstoff verübt. Eine<br />
halbe Stunde vorher hatte sie ihren letzten<br />
Blogeintrag verfasst: „Es gibt überall Betrüger.<br />
Die Situation ist verzweifelt.“ Zwei<br />
Wochen zuvor hatte sie sich an die Polizei<br />
gewandt, weil sie sich bedroht fühlte.<br />
„Meine Mutter wurde ermordet, weil sie<br />
zwischen der Herrschaft des Rechts und<br />
denen stand, die die Gesetze vergewaltigen“,<br />
schrieb ihr Sohn Matthew auf Facebook.<br />
Die Institutionen des Staates funktionierten<br />
nicht mehr, Maltas Regierung<br />
dulde „eine Kultur der Straflosigkeit“.<br />
Staat und organisierte Kriminalität seien<br />
kaum zu trennen. Auch der Oppositionsführer<br />
sprach von einem „politischen<br />
Mord“ und davon, dass auf der Insel „die<br />
Gesetze des Dschungels“ herrschten.<br />
Es scheint, als habe die Journalistin erst<br />
sterben müssen, damit die Welt genauer<br />
hinschaut auf diese Urlaubsinsel zwischen<br />
Europa und Afrika, aber eben auch: Steuer -<br />
oase, Geldwaschanlage, Zentrum des Waffen-,<br />
Drogen- und Ölschmuggels von und<br />
nach Libyen. Ein Treffpunkt zwielichter<br />
Geschäftemacher und Gaddafi-Leute, von<br />
Mafiosi und Russen, die sich eine maltesische<br />
Staatsbürgerschaft gekauft haben.<br />
Es waren diese Machenschaften, über<br />
die Caruana Galizia schrieb. Erst als Journalistin<br />
und Mitherausgeberin des „Malta<br />
Independent“, später in ihrem Blog Running<br />
Commentary. Ihre Artikel waren<br />
scharf, manchmal sogar aggressiv, auch vor<br />
persönlichen Angriffen schreckte sie nicht<br />
zurück, nicht immer konnte sie Belege präsentieren.<br />
Aber Caruana Galizia hatte oft<br />
recht. Für viele Malteser wurde sie zur Heldin,<br />
ihre Enthüllungen waren Inselgespräch.<br />
Ihr Lieblingsgegner war die Regierung,<br />
insbesondere Premierminister Joseph Muscat.<br />
Zwei Monate bevor ein internationales<br />
Journalistenkonsortium den Skandal namens<br />
Panama Papers aufdeckte, beschuldigte<br />
die Journalistin den damaligen Energieminister<br />
sowie den Kabinettschef des<br />
Trauerkundgebung für Caruana Galizia am Dienstag: „Gesetze des Dschungels“<br />
DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS<br />
Ministerpräsidenten, sie hätten 2013 Briefkastenfirmen<br />
in Panama eröffnet. Die Journalistin<br />
vermutete, dass darüber Bestechungsgelder<br />
aus Aserbaidschan flossen,<br />
möglicherweise im Zusammenhang mit<br />
einem Vertrag über Gaslieferungen von<br />
Baku nach Malta.<br />
<strong>Der</strong> Energieminister musste zurücktreten,<br />
bestritt aber die Korruptionsvorwürfe;<br />
der Kabinettschef, der engste Mitarbeiter<br />
von Muscat, blieb im Amt. Dabei droht<br />
ihm in einem anderen Fall sogar ein Strafverfahren:<br />
Ein Ermittlungsrichter sah den<br />
Verdacht bestätigt, der Kabinettschef habe<br />
von drei Russen, die Staatsbürger Maltas<br />
werden wollten, fast 167000 Euro erhalten.<br />
Im Frühjahr enthüllte Caruana Galizia<br />
einen weiteren Skandal: Michelle Muscat,<br />
die Frau des Ministerpräsidenten, besitze<br />
eine Briefkastenfirma in Panama, auf deren<br />
Konto Anfang 2016 mehr als eine Million<br />
Euro überwiesen wurden – und zwar<br />
von einer Firma der Tochter des aserbaidschanischen<br />
Präsidenten Ilcham Alijew.<br />
Anfang Mai präsentierte Caruana Galizia<br />
bei einem Treffen mit dem SPIEGEL<br />
ihre Kronzeugin: eine blonde Russin, die<br />
sich „Maria“ nannte, Ex-Mitarbeiterin der<br />
maltesischen Pilatus-Bank. Einer Bank, die<br />
Caruana Galizia als „reine Geldwäscheveranstaltung“<br />
bezeichnete. Mehrere Mitglieder<br />
der Alijew-Familie sollen, so die<br />
Russin, zu ihren wichtigsten Kunden gehört<br />
haben. Sie behauptete, die Überweisungen<br />
auf die Konten von Muscats<br />
Panama-Firma gesehen zu haben. Diese<br />
Anschuldigungen wiederholte sie mehrmals<br />
unter Eid vor einem Ermittlungsrichter,<br />
die Bank widersprach. Im Sommer jedoch<br />
verließ die Russin Malta, sie fühlte<br />
sich bedroht und unter Druck gesetzt.<br />
Auch ein diese Woche vorgelegter Abschlussbericht<br />
des Panama-Untersuchungsausschusses<br />
im EU-Parlament scheint Caruana<br />
Galizias Verdächtigungen eher zu<br />
bestätigen. Dort wird Malta als eines der<br />
Länder genannt, dessen Banken und Kanzleien<br />
massenhaft Briefkastenfirmen in<br />
Panama eingerichtet haben, zum Schaden<br />
anderer EU-Mitglieder, denen hohe Steuersummen<br />
entgangen sein dürften. Zudem<br />
ist auf Malta eine riesige Online-Wett -<br />
industrie entstanden, die ideale Möglichkeiten<br />
zur Geldwäsche bietet.<br />
Ministerpräsident Muscat hat stets alle<br />
Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Trotz<br />
der Enthüllungen wurde er im Juni wiedergewählt.<br />
Um dem Verdacht der Vertuschung<br />
aus dem Weg zu gehen, hat er nun<br />
das amerikanische FBI um Amtshilfe bei<br />
der Aufklärung des Mordes gebeten.<br />
Zwar wurde vor Kurzem eine Euro -<br />
päische Staatsanwaltschaft gegründet, die<br />
bei Schäden zulasten der EU ermitteln<br />
soll. Doch bisher beteiligen sich daran<br />
nur 20 Mitgliedstaaten. Malta ist nicht<br />
darunter.<br />
Christoph Pauly<br />
96 DER SPIEGEL 43 / 2017
Siegquote in der Formel 1* Fahrerkarriere beendet aktiver Fahrer<br />
Weltmeistertitel<br />
Starts Rennsiege<br />
Juan Manuel Fangio<br />
51 24<br />
Argentinien<br />
Alberto Ascari<br />
Italien<br />
Jim Clark<br />
Großbritannien<br />
Lewis Hamilton<br />
Großbritannien<br />
Michael Schumacher<br />
Deutschland<br />
Jackie Stewart<br />
Großbritannien<br />
Alain Prost<br />
Frankreich<br />
Ayrton Senna<br />
Brasilien<br />
Stirling Moss<br />
Großbritannien<br />
Sebastian Vettel<br />
Deutschland<br />
32<br />
72<br />
204<br />
307<br />
99<br />
199<br />
161<br />
66<br />
194<br />
13<br />
25<br />
61<br />
91<br />
27<br />
51<br />
41<br />
16<br />
46<br />
*nur Fahrer mit mehr als fünf Starts<br />
24,2<br />
23,7<br />
25,6<br />
25,5<br />
27,3<br />
29,9<br />
29,6<br />
34,7<br />
40,6<br />
Motorsport<br />
Ferrari-Opfer Vettel<br />
Sport<br />
Siegquote<br />
in Prozent<br />
47,1<br />
Für viele Formel-1-Fans ist Ayrton Senna<br />
der beste Rennfahrer aller Zeiten,<br />
für andere bleibt es für immer Michael<br />
Schumacher, der Mann mit den meisten<br />
Weltmeistertiteln. Berücksichtigt<br />
man jedoch die Quote der Siege, war<br />
der erfolgreichste Fahrer Juan Manuel<br />
Fangio, der von den WM-Rennen, bei<br />
denen er an den Start ging, fast jedes<br />
zweite gewann. Allerdings gibt auch<br />
die Siegquote nur bedingt Auskunft<br />
über das Können: Sebastian Vettel ist<br />
auf Platz zehn abgestürzt, seitdem er<br />
für Ferrari fährt. Dabei dürfte er das<br />
Autofahren dort nicht verlernt haben.<br />
OLAF MALZAHN / IMAGO<br />
Magische Momente<br />
„Bei Kilometer 50 war die Herrlichkeit vorbei“<br />
„Tagesschau“-Sprecher Thorsten Schröder, 49, über seinen Kampf beim Ironman auf Hawaii<br />
burg erneut, um auch dort<br />
zunächst zu scheitern. Mir<br />
fehlten 26 Sekunden zu<br />
einem sicheren Startplatz.<br />
SPIEGEL: Doch einer der vor<br />
Ihnen Platzierten verzichtete<br />
auf sein Hawaii-Ticket, Sie<br />
rückten nach.<br />
Schröder: Ein herr -<br />
liches Drehbuch,<br />
besser geht es nicht.<br />
SPIEGEL: Dort ging<br />
es los mit dem<br />
Schwimmen im<br />
Pazifik.<br />
Schröder: Ich mag<br />
kein Salzwasser,<br />
nach einer Stunde<br />
hatte ich buchstäblich<br />
die Nase voll.<br />
SPIEGEL: Nach 1.13:36<br />
Stunden wechselten<br />
Sie auf die Straße.<br />
180 Kilometer Rad -<br />
fahren.<br />
Schröder: Ich fuhr<br />
mit 36er-Schnitt, hatte<br />
kaum Wind. Bei<br />
Kilometer 50 war es<br />
SPIEGEL: Hawaii-Finisher 2017<br />
– wie hört sich das an?<br />
Schröder: Großartig. Als ich<br />
vor sechs Jahren mit dem<br />
Training für meinen ersten<br />
Ironman begann, hielt ich<br />
dieses Ziel für utopisch.<br />
SPIEGEL: Wie haben Sie sich<br />
vorbereitet?<br />
Schröder: Ich entwickelte einen<br />
Zwei-Jahres-Masterplan.<br />
Die entscheidende Phase:<br />
52 Wochen intensives Training,<br />
sechs Tage die Woche.<br />
SPIEGEL: Welche Schwerpunkte<br />
setzten Sie?<br />
Schröder: Ich kräftigte meine<br />
Rumpfmuskulatur intensiv,<br />
damit ich nicht wie der schiefe<br />
Turm von Pisa durch das<br />
Ziel laufe. Zudem: keine<br />
Chips und Schokolade, Alkohol<br />
nur an Weihnachten und<br />
Karneval.<br />
SPIEGEL: In Frankfurt verpassten<br />
Sie Anfang Juli die Qualifikation<br />
für Hawaii knapp.<br />
Schröder: Fünf Wochen später<br />
versuchte ich es in Hamdann<br />
vorbei mit der Herr -<br />
lichkeit.<br />
SPIEGEL: Die tückischen<br />
Mumuku-Winde meldeten<br />
sich.<br />
Schröder: Und zwar kräftig.<br />
Ich kam ins Schlingern, wurde<br />
fast umgeweht.<br />
Schröder<br />
SPIEGEL: Zuletzt der Marathon.<br />
Schröder: <strong>Der</strong> Lauf war hammerhart.<br />
Nach fünf Kilometern<br />
hätte er gern zu Ende<br />
sein können. Die Sonne grillt<br />
dich, es gibt keinen Schatten.<br />
Ich hangelte mich von einer<br />
Verpflegungsstation zur<br />
nächsten, übergoss<br />
mich mit Eiswasser.<br />
SPIEGEL: Ihre Endzeit:<br />
10.56:12.<br />
Schröder: Lustig,<br />
dass ich nun als<br />
Sportler Schlagzeilen<br />
mache. Als Kind<br />
wollte ich Profi -<br />
fußballer werden.<br />
SPIEGEL: Warum hat<br />
es nicht gereicht?<br />
Schröder: Ich erkrankte<br />
an der<br />
Wirbelsäule. Mit<br />
15 Jahren wurde<br />
ich operiert, trug<br />
zwölf Monate lang<br />
ein Korsett, machte<br />
jahrelang keinen<br />
Sport. tne<br />
FRANK WECHSEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 97
Sport<br />
Das Echo<br />
der Hurensöhne<br />
Basketball Donald Trump hat sich mit den schwarzen<br />
Sportlern angelegt. Auch mit dem derzeit<br />
größten NBA-Star. Ein Treffen mit Stephen Curry<br />
in der Umkleidekabine. Von Philipp Oehmke<br />
Eine halbe Stunde nach dem Spiel gegen<br />
Denver steht Stephen Curry, nur<br />
ein Handtuch um die Hüfte gebunden<br />
und mit Badelatschen an den Füßen,<br />
in der Umkleidekabine der Golden State<br />
Warriors.<br />
Er hat lange geduscht. Die Umkleide -<br />
kabine leert sich langsam. Die meisten wollen<br />
schnell nach Hause. Am nächsten Tag<br />
steht für die derzeit beste Basketballmannschaft<br />
der Welt ein 14-Stunden-Flug nach<br />
China an, vor dem es den Spielern offenbar<br />
graut. Es ist eine dieser Marketing reisen,<br />
wie sie Bayern München auch macht.<br />
Stephen Curry ist der größte Star der<br />
NBA, der vielleicht begabteste Spieler seit<br />
Michael Jordan. Und derzeit einer der<br />
größten Gegenspieler von Präsident Donald<br />
Trump. „Wir haben hier eine große<br />
Plattform, eine gewaltige Stimme, die wir<br />
nutzen müssen“, sagt Curry vor seinem<br />
Spind. „Wir müssen darauf aufmerksam<br />
machen, was in diesem Land unter diesem<br />
Präsidenten gerade alles schiefläuft.“<br />
<strong>Der</strong> Streit mit Trump hatte Ende September<br />
begonnen. Damals hatte Curry erklärt,<br />
dass er bei einer teaminternen Abstimmung<br />
über die Einladung ins Weiße<br />
Haus sicherlich mit Nein stimmen werde,<br />
wenn er sich überlege, was dessen Hausherr<br />
in diesem Land anrichte. Traditionell<br />
empfängt der US-Präsident die wichtigsten<br />
Meisterteams des Landes. Currys Wor -<br />
te waren so gelassen gesprochen, wie er<br />
Basketball spielt: anstrengungslos, fast<br />
abwesend.<br />
Trump war jedoch über Currys Aussage<br />
so beleidigt, dass er die Warriors über Twitter<br />
auslud. <strong>Der</strong> Präsident, der sich so sehr<br />
die Anerkennung von Soldaten und Sportlern<br />
wünscht, hatte mit den Warriors<br />
schnell noch Schluss gemacht, bevor sie<br />
mit ihm Schluss machen konnten. So hatte<br />
es der Warriors-Headcoach Steve Kerr anschließend<br />
formuliert.<br />
Schon seit einigen Wochen herrscht ein<br />
Krieg der Worte zwischen Trump und den<br />
98 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Profisportlern in den USA. Colin Kaepernick,<br />
der damalige Quarterback des Footballteams<br />
der San Francisco 49ers, hatte<br />
ihn im vergangenen Jahr ausgelöst, indem<br />
er sich beim Abspielen der US-Nationalhymne<br />
hinkniete, um gegen die Ungleichbehandlung<br />
der Schwarzen und gegen<br />
Polizeigewalt in den USA zu demonstrieren.<br />
Immer mehr Spieler der Footballliga<br />
NFL hatten sich ihm angeschlossen.<br />
Dann schwappte der Protest auf an de -<br />
re Sportarten über und landete auch im<br />
Basketball.<br />
Schließlich war der Streit eskaliert. Auf<br />
einer seiner geliebten Wahlkampfveranstaltungen<br />
in Alabama – die Trump abhält,<br />
auch wenn kein Wahlkampf ist – hatte er<br />
die schwarzen Footballspieler angegriffen,<br />
die sich vor den Spielen bei der Nationalhymne<br />
weigern strammzustehen. Trump<br />
sprach indirekt auch über Kaepernick, der<br />
seinen Job verloren hatte.<br />
Darauf spielte Trump an, als er brüllte:<br />
„Würde es euch nicht gefallen, dass einer<br />
der NFL-Teambesitzer, sobald jemand<br />
unsere Flagge nicht respektiert, sagt:<br />
Schmeißt den Hurensohn vom Feld, und<br />
zwar sofort! Er ist gefeuert! Er ist gefeuuuuert!“<br />
In dieser Aussage schwang aber noch etwas<br />
anderes mit, nämlich Rassismus. Die<br />
Besitzer der Teams sind fast alle weiß, die<br />
meisten Zuschauer ebenfalls. Nur die Athleten<br />
sind zum größeren Teil Afroamerikaner.<br />
Die weißen Besitzer sollen also für<br />
den patriotischen Seelenfrieden des weißen<br />
Publikums die schwarzen Akteure feuern,<br />
wenn die nicht spuren.<br />
Zufällig, ohne Trumps Aussagen zu kennen<br />
und somit fast prophetisch, hatte Stephen<br />
Curry zur gleichen Zeit seine Unlust<br />
vorgetragen, das Weiße Haus zu besuchen.<br />
Als er von Curry gehört hatte, am frühen<br />
Samstagmorgen, zu jener Tageszeit<br />
also, zu der sich der Präsident offenbar<br />
stets am verletzlichsten fühlt, hatte Trump<br />
daraufhin seinen Tweet gegen Curry ab-<br />
gesetzt und einem weiteren afroamerikanischen<br />
Sportler den Krieg erklärt.<br />
Beim ersten öffentlichen Auftritt der<br />
Warriors nach dem Trump-Eklat war die<br />
Oracle Arena in Oakland Ende September<br />
ausverkauft, obwohl es nur ein Vorbereitungsspiel<br />
war. Zu Gast waren die Denver<br />
Nuggets. Die Champions verloren 108 zu<br />
102. Curry sorgte lediglich für 11 Punkte,<br />
vergangene Saison machte er im Durchschnitt<br />
25,3.<br />
Curry steht danach allein vor seinem Spind<br />
aus Edelholz, zieht sich eine Unterhose<br />
seines Sponsors an und zwängt sich in eine<br />
sehr teure Jeans mit vielen aufgeribbelten<br />
Stellen. Niemand spricht ihn an. Dabei gilt
Basketballstar Curry im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves 2016: „Es geht um Ehre und das Recht auf eine eigene Meinung“<br />
JESSE JOHNSON / USA TODAY SPORTS<br />
Curry als das freundlichste Genie, das die<br />
Liga je gesehen hat.<br />
Wo könnte man besser über Trump reden<br />
als hier in der Umkleidekabine, im<br />
„locker-room“ also, einer Örtlichkeit, die<br />
der Präsident selbst weltberühmt gemacht<br />
hat, als er der Welt erklärte, es sei unter<br />
Männern in Ordnung, beim „locker-roomtalk“<br />
darüber zu sprechen, wie man Frauen<br />
am besten begrapscht.<br />
SPIEGEL: Mr Curry, sorry, wie geht es Ihnen?<br />
Curry: Weil wir verloren haben?<br />
SPIEGEL: Wegen des ganzen Ärgers mit Donald<br />
Trump. Weil der Präsident Sie persönlich<br />
angegriffen hat, Sie im Weißen<br />
Haus nicht willkommen sind.<br />
Curry: Surreal, oder? Dass der Präsident<br />
meint, einzelne Personen angreifen zu<br />
müssen. Es ist auf jeden Fall unter der Würde<br />
des Amtes. So benimmt man sich nicht<br />
als Staatsoberhaupt.<br />
SPIEGEL: Warum wollten Sie nicht ins Weiße<br />
Haus?<br />
Curry: Ich habe das Verhalten des Präsi -<br />
denten genau verfolgt. Es bestand in der<br />
ständigen Verdrehung amerikanischer<br />
Werte. Ich persönlich wollte für meine<br />
eigene Hygiene daran keinen Anteil haben.<br />
Als ich gefragt wurde, habe ich genau das<br />
gesagt. Aber das bin nur ich.<br />
SPIEGEL: Immerhin.<br />
Curry: Nein. Es geht hier nicht um mich.<br />
Wenn es nur um mich ginge, wäre die Sache<br />
relativ schnell vorbei. Aber wir sind<br />
ein Team. Wir werden bald eine Teamsitzung<br />
abhalten und ein Gespräch darüber<br />
führen, wie wir die Warriors vertreten wollen<br />
und wie sich jeder meiner Teamkollegen<br />
mit seiner persönlichen Geschichte darin<br />
wiederfindet. Das ist wichtig.<br />
Die Teamkollegen laufen auf dem Weg<br />
aus der Umkleide heraus an Stephen Curry<br />
vorbei und nicken. Zwischen den muskulösen<br />
Bäumen, die seine Mitspieler sind<br />
– Kevin Durant, der andere Superstar des<br />
Teams, ist zwei Meter sechs, der Georgier<br />
Zaza Pachulia, zwei Meter elf –, wirkt Curry<br />
beinahe zierlich. Er ist nur einen Meter<br />
neunzig groß und wiegt 86 Kilo. Das ist<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
99
SPIEGEL TV WISSEN<br />
SONNTAG, 22. 10., 19.15–20.05 UHR | PAY-TV<br />
BEI ALLEN FÜHRENDEN KABELNETZBETREIBERN<br />
Die Rückkehr der Luftschiffe<br />
Nach der goldenen Ära der Zeppe -<br />
line zu Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
stehen die fliegenden Riesen nun<br />
vor einer Renaissance. In England<br />
Transport-Zeppelin (Computersimulation)<br />
und den USA stehen zwei XXL-<br />
Luftschiffe kurz vor der Serienreife.<br />
<strong>Der</strong> Traum vom laut- und mühe -<br />
losen Transport riesiger Lasten<br />
bringt immer neue Entwürfe hervor.<br />
SPIEGEL TV MAGAZIN<br />
SONNTAG, 22. 10., 23.15– 0.00 UHR | RTL<br />
„Guten Tag, ich rufe von E.on an“ – Die<br />
Tricks der türkischen Callcenter-<br />
Mafia, die von einem Verbrecher<br />
beherrscht wird, den die Staats -<br />
anwaltschaft den „schlimmsten und<br />
brutalsten Zuhälter der holländischen<br />
Kriminalgeschichte“ nennt;<br />
Sie sind gekommen, um zu bleiben –<br />
Die ersten Tage der neuen<br />
AfD- Abgeordneten im Bundestag;<br />
Schlacht um Rakka – Exklusive<br />
Innenansichten von Kriegsreporter<br />
Gabriel Chaim.<br />
SPIEGEL GESCHICHTE<br />
MITTWOCH, 25. 10., 20.15 – 21.00 UHR | SKY<br />
Die Geheimnisse<br />
der digitalen Revolution –<br />
Spieler, Hacker, Nerds<br />
Ein Leben ohne Computer? Das<br />
kann sich heute kaum noch jemand<br />
vorstellen. Egal ob Smartphone,<br />
Tablet oder ein schnöder Fahrkarten -<br />
automat – die kleinen Elektrogehirne<br />
haben einen wahren Siegeszug<br />
mitten in unseren Alltag hinter sich.<br />
Doch wer hat den Computer er -<br />
funden? Und was ist eigentlich seit<br />
den visionären Garagentüfteleien<br />
im Silicon Valley bis zum heutigen<br />
Internetzeitalter geschehen?<br />
ORANGE SMARTY<br />
Sport<br />
eine Statur, mit der man gewöhnlich Fußballtorwart<br />
werden kann, aber nicht NBA-<br />
Superstar.<br />
Überhaupt ist Curry ein sehr ungewöhnlicher<br />
König des Basketballs. Anders als<br />
seine Vorgänger auf dem NBA-Thron, Le-<br />
Bron James oder Kobe Bryant, trägt er keine<br />
großflächigen Tätowierungen, er führt<br />
nicht das Leben eines Rap-Stars.<br />
Stephen, genannt Steph, Curry, 29 Jahre<br />
alt, ist stattdessen mit seiner Frau und den<br />
Kindern auf dem Cover der Zeitschrift „Parents“<br />
zu sehen. Er hat das Körbewerfen<br />
nicht auf einem asphaltierten, mit Maschendraht<br />
umzäunten Basketballcourt in<br />
der schlechten Gegend einer Großstadt gelernt,<br />
sondern von seinem Vater, ebenfalls<br />
einem NBA-Spieler. Curry ist vor allem<br />
bisher kaum durch Provokationen oder<br />
Renitenz aufgefallen.<br />
SPIEGEL: Sie haben sich bisher selten öffentlich<br />
politisch geäußert. Warum?<br />
Curry: Das stimmt. Bisher habe ich bloß<br />
mit Präsident Obama ein paarmal Golf gespielt.<br />
Das war’s. Das Nächste, was passiert<br />
ist, war, dass ich vergangenen Samstag mit<br />
20 Nachrichten aufwachte, in denen Leute<br />
mir gratulierten und Unterstützung zusagten.<br />
Ich wusste nicht, worum es geht. Dann<br />
bin ich auf Twitter gegangen und habe mir<br />
den Mist angesehen.<br />
SPIEGEL: Haben Sie sich geärgert?<br />
Curry: Nein. Es war eine gute Gelegenheit<br />
zu äußern, was ich denke. Nun kommt die<br />
ganze Liga zusammen. Die Spieler, aber<br />
auch die Trainer.<br />
SPIEGEL: Was stört Sie an Trump?<br />
Curry: Ehrlich gesagt, fast alles, was von<br />
ihm kommt. Wie er über die NFL-Spieler<br />
geredet hat, die friedlich protestieren und<br />
damit in keiner Weise Kriegsveteranen,<br />
der Flagge oder Hymne ihren Respekt versagen.<br />
Es ging ja fast so weit, dass er die<br />
Spieler und ihre Jobsicherheit bedroht hat.<br />
Im Gegensatz zu der Basketballliga ist die<br />
Footballliga traditionell eng mit den amerikanischen<br />
Streitkräften verbunden. Soldaten<br />
gucken lieber Football als Basketball,<br />
es gibt gemeinsame Veranstaltungen. So<br />
hat sich unter einigen Footballfans die<br />
Meinung gebildet, dass sich, wer sich während<br />
der Hymne und des dazugehörigen<br />
Schwenkens der Flagge hinsetzt, auch den<br />
Soldaten, die für diese Flagge ihr Leben<br />
riskieren, den Respekt verweigert.<br />
SPIEGEL: Sie waren der Meinung, der Präsident<br />
bestärke die Leute, die sagen, kniende<br />
Profis würden die Nation beleidigen?<br />
Curry: Wir reden hier über das Amt des<br />
Präsidenten. Das betrifft eine Menge Leute,<br />
völlig unabhängig davon, wo sie sich<br />
politisch sonst so verorten. Es geht hier<br />
um Respekt, Ehre, Individualismus und<br />
das Recht auf eine eigene Meinung. Und<br />
es war unglaublich, welche Reaktionen aus<br />
der Liga kamen.<br />
Zu denjenigen, die Curry öffentlich verteidigt<br />
haben, gehörte auch LeBron James<br />
von den Cleveland Cavaliers. Das war bemerkenswert<br />
in Anbetracht des Verhältnisses<br />
zwischen James und Curry: LeBron<br />
James wurde von Curry vom Thron ge -<br />
stoßen.<br />
In den vergangenen drei Jahren handelte<br />
die NBA auch davon, wie sich diese beiden<br />
Männer duellierten: der jüngere, wendige,<br />
freche Emporkömmling Curry gegen<br />
den alten, gewaltigen König, der müde geworden<br />
war, aber noch mal alle Kräfte mobilisierte.<br />
<strong>Der</strong> eine spielte für ein Team<br />
Footballspieler Kaepernick (l.)<br />
„Er ist gefeuuuuert“<br />
aus Oakland bei San Francisco, das Silicon-Valley-Investoren<br />
gehört und auch so<br />
geführt wird, der andere für eine Mannschaft<br />
aus der Stahlarbeiterstadt Cleveland.<br />
LeBron James mit seinem ganzen Legendenstatus<br />
twitterte also an Trump, er<br />
sei ein „bum“, also ein Penner, Curry habe<br />
doch längst gesagt, er werde nicht kommen,<br />
da sei es lächerlich, ihn jetzt auszuladen.<br />
Ins Weiße Haus eingeladen zu werden<br />
sei so lange eine Ehre gewesen, bis er<br />
da aufgetaucht sei.<br />
Curry: You bum! Da musste ich lachen. Ich<br />
habe diesen Ausdruck das letzte Mal bei<br />
Straßen-Basketballspielen gehört. Dort fiel<br />
er ständig und war ein ziemlich heftiger<br />
Ausdruck.<br />
Dann sagt Curry noch einmal „bum“, diesmal<br />
zu seinem Begleiter. Du bum, komm,<br />
wir müssen los. Die Katakomben der Oracle<br />
Arena haben sich geleert, es ist spät geworden,<br />
draußen liegt verlassen der Parkplatz.<br />
In China, in einem Spiel gegen die Minnesota<br />
Timberwolves, erzielt Stephen Curry<br />
40 Punkte innerhalb von 30 Minuten.<br />
Er spielt wie befreit auf.<br />
Video:<br />
#takeaknee<br />
spiegel.de/sp432017curry<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
MARCIO JOSE SANCHEZ / AP<br />
100 DER SPIEGEL 43 / 2017
Digital lesen + Prämie!<br />
1 JAHR DEN SPIEGEL DIGITAL LESEN UND IHRE WUNSCHPRÄMIE WÄHLEN.<br />
Neu: iPad 32 GB Wi-Fi Space Grau<br />
Arbeiten, spielen, surfen und mehr. Mit 9,7"-<br />
Retina-Display, Fingerabdruck-Sensor, 8-Megapixel-<br />
Kamera. Gewicht: 469 g. Zuzahlung nur € 269,–.<br />
€ 100,– Geldprämie<br />
Erfüllen Sie sich einen Wunsch:<br />
€ 100,– als Geldprämie.<br />
Ja, ich möchte den SPIEGEL digital lesen und wähle<br />
eine Prämie!<br />
Ich lese 52 Ausgaben des<br />
SPIEGEL digital inklusive<br />
SPIEGEL DAILY für nur € 4,10<br />
pro Ausgabe und erhalte<br />
eine Prämie meiner Wahl.<br />
52 x den SPIEGEL digital lesen<br />
Bereits ab freitags, 18 Uhr<br />
Auch offline lesbar<br />
Auf bis zu 5 Geräten<br />
Inklusive SPIEGEL-E-Books<br />
Wunschprämie dazu<br />
Jetzt neu: Inklusive SPIEGEL DAILY<br />
Die neue digitale Tageszeitung<br />
Jetzt bestellen: www.spiegel.de/digital17<br />
SD17-005
Sport<br />
Unentschieden<br />
Fußball <strong>Der</strong> FC Barcelona schweigt darüber, ob er für oder gegen<br />
die Unabhängigkeit Kataloniens ist. Von Juan Moreno<br />
Wäre der FC Barcelona ein normaler<br />
Verein, es wären für den Klub<br />
fantastische Wochen. Souveräne<br />
Tabellenführung in Spaniens Primera División.<br />
Konkurrent Real Madrid liegt fünf<br />
Punkte zurück nur auf Platz drei. Lionel<br />
Messi scheint beschlossen zu haben, dass<br />
Cristiano Ronaldo jetzt oft genug Weltfußballer<br />
war, und spielt seit Wochen wie das<br />
Genie, das er ist.<br />
In der Champions League hat Barça bisher<br />
alle Gruppenspiele gewonnen. Am<br />
Mittwoch siegte das Team mit Halbgas 3:1<br />
gegen Olympiakos Piräus, die komplette<br />
zweite Halbzeit war die Mannschaft in Unterzahl,<br />
nachdem Gerard Piqué des Feldes<br />
verwiesen worden war. Zudem ist der Verein<br />
derzeit spanischer Tabellenführer im<br />
Basketball, Handball, Rollhockey und Volleyball,<br />
die Fußballerinnen stehen ebenfalls<br />
auf Platz eins.<br />
Auch finanziell laufen die Geschäfte des<br />
FC Barcelona wie geschmiert. Die Umsatzprognose<br />
wurde kürzlich präsentiert:<br />
897 Millionen Euro für die Saison 2017/18.<br />
Kein Sportverein hat weltweit jemals höhere<br />
Zahlen genannt. Bis 2021 soll der Umsatz<br />
auf über eine Milliarde Euro pro<br />
Saison wachsen.<br />
Was also ist das Problem?<br />
<strong>Der</strong> FC Barcelona ist kein normaler<br />
Verein, und Spanien ist derzeit<br />
kein normales Land.<br />
Seit gut zwei Jahren rasen in der spanischen<br />
Innenpolitik zwei Züge aufeinander<br />
zu: die konservative Regierung in Madrid,<br />
davon überzeugt, dass Katalonien genug<br />
Autonomie besitzt und jetzt endlich Ruhe<br />
geben sollte; ihr gegenüber die katalanische<br />
Regionalregierung, die<br />
den Traum vieler Katalanen<br />
von einem eigenen Staat zum Greifen<br />
nahe wähnt.<br />
Beide Seiten bombardieren sich mit Vorwürfen<br />
und Drohungen. Beide Seiten betonen<br />
den Dialog, sind aber nicht wirklich<br />
dazu bereit. Woche für Woche ziehen Hunderttausende<br />
Katalanen durch die Straßen<br />
Barcelonas. Gegner und Befürworter der<br />
Autonomie: Die Lager sind ungefähr<br />
gleich groß. Ein Fieber hat die<br />
ganze Region erfasst. Familien<br />
brechen im Streit auseinander,<br />
Freundschaften werden beendet, Kollegen<br />
beschimpft.<br />
Es gibt derzeit nur eine Frage: Für oder<br />
gegen die Unabhängigkeit? Wo stehst du?<br />
Hat man sich einmal bekannt, hat das Konsequenzen.<br />
Für die Freundschaft, für das<br />
Gerard<br />
Deulofeu<br />
Geschäft. Das ist für alle so. Auch für den<br />
FC Barcelona.<br />
Genau darum schweigt der Klub. Es ist<br />
derzeit unmöglich, einen offiziellen Vertreter<br />
des Vereins zu einer klaren Aussage zu<br />
bewegen. Natürlich, man ist Katalane, mit<br />
ganzem Herzen, Patriot, klar, aber La Liga<br />
wegen der Unabhängigkeit zu verlassen,<br />
das wäre ja Wahnsinn, mehr noch Selbstmord,<br />
das würde alles gefährden. Man<br />
könnte es auch so ausdrücken: Patriotismus<br />
hin oder her, aber eine Milliarde Euro Umsatz<br />
sind eine Milliarde Euro Umsatz.<br />
Katalanen<br />
im Kader<br />
FC Barcelona<br />
Saison<br />
2017/18<br />
Saison<br />
2007/08<br />
Bojan<br />
Krkić<br />
Saison<br />
1997/98<br />
Óscar<br />
García<br />
Sergi<br />
Roberto<br />
Sergio<br />
Busquets<br />
Xavi<br />
Roger<br />
García<br />
Spieler mit mindestens<br />
fünf Ligaspielen<br />
Jordi<br />
Alba<br />
Albert<br />
Celades<br />
Pep<br />
Guardiola<br />
Sergi<br />
Barjuán<br />
Gerard<br />
Piqué<br />
Oleguer<br />
Carles<br />
Puyol<br />
Víctor<br />
Valdés<br />
Gerard<br />
Piqué<br />
Aleix<br />
Vidal<br />
Albert<br />
Ferrer<br />
JOSE JORDAN /AFP<br />
Seit Jahrzehnten ist der FC Barcelona<br />
der große Kulturträger der autonomen Region<br />
Katalonien. Das Aushängeschild, vergöttert<br />
in der Region, bewundert auf der<br />
Welt. Auf die Trikots lässt die Vereinsführung<br />
seit Jahren die vier Worte „mes que<br />
un club“, mehr als ein Verein, drucken. Es<br />
ist Barças Mantra, in jedem Fanshop, in<br />
jedem Klubschreiben ist es zu lesen, in jedem<br />
Präsidenteninterview wird es gepredigt.<br />
Wir sind mehr als nur Fußball.<br />
Niemand fragte bisher, was das eigentlich<br />
genau bedeutet. Es gab Vermutungen.<br />
„Die Nationalmannschaft Kataloniens“ sei<br />
der Verein, hat Jordi Pujol, der ehemalige<br />
Regierungschef der Region, gesagt. „Die<br />
unbewaffnete Armee Kataloniens“, beschrieb<br />
es der Autor Manuel Vázquez Montalbán.<br />
Es war ein Gefühl. Spaß-Patriotismus<br />
– auch wenn oft höchstens sechs<br />
Stammkräfte der Mannschaft wirkliche Katalanen<br />
waren (siehe Grafik).<br />
<strong>Der</strong> Verein konnte gut damit leben, vor<br />
allem nachdem der Präsident Joan Laporta<br />
abtrat, der als Politiker unmissverständlich<br />
für die Unabhängigkeit Kataloniens stand.<br />
<strong>Der</strong> Verein tat das, was er viele Jahre getan<br />
hatte. Er arrangierte sich, zwinkerte<br />
der Unabhängigkeitsbewegung immer wieder<br />
zu, machte es sich aber letztlich im<br />
Unkonkreten gemütlich, im Rumeiern.<br />
War nicht das Schlechteste fürs Geschäft.<br />
Alle fühlten sich mitgenommen. Katalanen,<br />
Spanier, die ganze Welt.<br />
Selbst wenn sie im Stadion Camp Nou<br />
„Unabhängigkeit, Unabhängigkeit“ brüllten,<br />
selbst wenn beim Champions-League-<br />
Spiel gegen den italienischen Meister Juventus<br />
Turin ein Riesenbanner entrollt<br />
wurde, auf dem stand: „Welcome to the<br />
Catalan Republic“, selbst als mitten in der<br />
Debatte um das Referendum vom 1. Oktober<br />
Plakate mit „SOS Democràcia“ auftauchten<br />
– vom Verein hieß es immer, man<br />
sei nicht politisch, stehe aber „auf der Seite<br />
des katalanischen Volkes“.<br />
Sollte sich die spanische Staatskrise in<br />
eine spanische Katastrophe verwandeln<br />
und Katalonien sich abspalten, dann wird<br />
der FC Barcelona sagen müssen, welche<br />
Seite des katalanischen Volkes der Verein<br />
genau meint. Zu den wenigen Gewissheiten,<br />
die es momentan über das katalanische<br />
Volk gibt, gehört, dass es zutiefst gespalten<br />
ist.<br />
<strong>Der</strong>zeit bekommt der Verein Druck von<br />
allen Seiten. <strong>Der</strong> spanische Ligaverband<br />
beispielsweise ist verärgert, dass die Debatte<br />
überhaupt hochkocht. So etwas stört<br />
102 DER SPIEGEL 43 / 2017
Barça-Fans beim Champions-League-Spiel im April gegen Juventus Turin: „Die unbewaffnete Armee Kataloniens“<br />
MARCO BERTORELLO / AFP<br />
das Geschäft. „Wir haben gerade aufgrund<br />
der Situation in Katalonien unsere Verhandlungen<br />
mit der Türkei, Singapur und<br />
Indien ausgesetzt“, sagte in dieser Woche<br />
Javier Tebas, der stockkonservative Präsident<br />
der spanischen Liga.<br />
Tebas, gelinde gesagt kein Freund Kataloniens,<br />
lässt keine Gelegenheit aus, Barça<br />
vorzurechnen, wie desaströs die Unabhängigkeit<br />
und ein damit einhergehender Ausschluss<br />
vom Wettbewerb sein würde.<br />
Barça macht etwa ein Viertel des Umsatzes<br />
im spanischen Profifußball, Real Madrid<br />
ein weiteres Viertel. Den Rest teilen<br />
sich die anderen 40 Vereine der Primera<br />
und der Segunda División. Das mit Abstand<br />
beste Produkt der spanischen Liga<br />
ist „el clásico“, Barça gegen Real, der epische<br />
Kampf der beiden spanischen Fußballgiganten,<br />
den zuletzt eine halbe Milliarde<br />
Menschen auf der Welt sehen wollten.<br />
„Genauso wie Katalonien die Europäische<br />
Union verlassen würde, könnten die<br />
katalanischen Vereine nicht in der spanischen<br />
Liga bleiben. Ich glaube, dass die<br />
katalanische Liga ein wenig wie die holländische<br />
wäre“, erklärte Ligachef Tebas.<br />
Unbedeutend.<br />
Was er derzeit nicht sagt: Die spanische<br />
Liga wäre ohne Barcelona in derzeitiger<br />
Form ebenfalls nicht überlebensfähig.<br />
In Barcelona reagiert man unterschiedlich<br />
auf die Drohungen aus Madrid. Entweder<br />
komplett entrückt, wie Gerard Esteva,<br />
Sportbeauftragter der katalanischen<br />
Regierung. Er vertritt die These, dass der<br />
FC Barcelona im Falle einer Unabhängigkeit<br />
„das große Glück hätte, sich die Liga<br />
auszusuchen, in der er spielen“ wolle.<br />
Schließlich spiele in Spanien auch ein<br />
Team aus dem Kleinstaat Andorra und in<br />
Frankreich der AS Monaco.<br />
Die Verantwortlichen des FC Barcelona<br />
dagegen wissen, dass man etwa in einer<br />
katalanischen Liga, in der das viertbeste<br />
Team die eigene zweite Mannschaft ist,<br />
keine Zukunft hat. Die derzeitigen Budgetplanungen<br />
basieren darauf, dass sich<br />
nichts für den Verein ändert. Dass Barcelona<br />
weiterhin in exakt denselben Wettbewerben<br />
antritt wie bisher. Dass die Sponsoren<br />
weiterhin dabei bleiben, dass die<br />
Fernsehgelder fließen, dass Asien erobert<br />
wird. Dass der FC Barcelona ein weltumfassender<br />
Klub bleibt.<br />
Im Verein ist man sich sicher, dass am<br />
Ende niemand auf das einträgliche Geschäft<br />
verzichten möchte. Über drei Mil -<br />
liarden Euro hat die spanische Liga in diesem<br />
Jahr eingesammelt. Die Vereine, vor<br />
sechs Jahren noch völlig überschuldet, stehen<br />
dank der Zentralvermarktung der<br />
Fernsehrechte derzeit in der Summe gut<br />
da. Barcelonas Niedergang würde alle mit<br />
in den Abgrund ziehen.<br />
Aber ebenso groß wie der Druck aus<br />
der Hauptstadt sind die Forderungen der<br />
Befürworter einer Unabhängigkeit. Sie<br />
wollen, dass Barcelona endlich mit dem<br />
Herumgetanze aufhört und Flagge bekennt.<br />
Diese Woche eskalierte erstmals die Diskussion.<br />
Nachdem zwei bekannte Anführer<br />
der Unabhängigkeitsbewegung wegen<br />
„aufrührerischen Verhaltens“ in Untersuchungshaft<br />
gekommen waren, lud der Verein<br />
zwei Stellvertreter der Inhaftierten in<br />
die Ehrenloge zum Spiel gegen Olympiakos<br />
Piräus ein.<br />
Wieder ein kleines Zeichen Richtung<br />
Unabhängigkeitsbewegung. Wie immer etwas<br />
verdruckst. Die übliche Masche. <strong>Der</strong><br />
Verein bot gleich noch ein Banner an. Riesengroß:<br />
„Dialog, Respekt, Sport“.<br />
Den Ehrengästen reichte dies nicht.<br />
„Dialog, Respekt, Sport? Was soll das heißen,<br />
das ist einfach nur dämlich“, sagte einer.<br />
Man hatte ein eigenes Großplakat mit<br />
zum Spiel gebracht, das vor der Begegnung<br />
auf dem Vorplatz des Stadions ausgebreitet<br />
wurde. Darauf sah man die Gesichter<br />
der beiden Inhaftierten, darunter<br />
das Wort „Freiheit“.<br />
Barçá war das aber zu heikel. Man entschied<br />
sich dagegen, das Banner aufzuhängen.<br />
Die beiden Vertreter weigerten sich<br />
daraufhin, zum Spiel zu kommen.<br />
<strong>Der</strong> Verein hat nun alle in Katalonien<br />
verärgert, Sezessionisten und Unionisten.<br />
Zumindest alle diejenigen, für die der FC<br />
Barcelona mehr ist als einfach nur ein<br />
Klub.<br />
■<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
103
6 Prämien zur Wahl!<br />
JETZT LESER WERBEN – SIE MÜSSEN SELBST NICHT ABONNENT SEIN.<br />
100 € Amazon.de Gutschein<br />
Über eine Million Bücher sowie 250 000 CDs,<br />
DVDs, Spiele, Technikartikel und vieles mehr<br />
stehen zur Auswahl.<br />
Wagenfeld-Tischleuchte WG 24<br />
<strong>Der</strong> Bauhaus-Klassiker! Aus vernickeltem<br />
Metall, Klarglas und Opalglas. Nummeriert.<br />
Höhe: ca. 36 cm. Zuzahlung nur € 149,–.<br />
TomTom START 42 CE T<br />
Karten für 19 Länder Europas. Mit 4,3"-Touchscreen,<br />
4-GB-Speicher. Inkl. Halterung, Autoladegerät und<br />
USB-Kabel. Ohne Zuzahlung.<br />
€ 100,– Geldprämie<br />
Erfüllen Sie sich oder Ihren Lieben einen<br />
besonderen Wunsch, oder legen Sie die € 100,–<br />
für eine größere Anschaffung zurück!
Teasi One 3 eXtend Navi<br />
Für Rad, Wandern, Ski und Boot. Mit<br />
8,8-cm-Display, Routing, Gratiskarten<br />
und 3-D-Kompass. Ohne Zuzahlung.<br />
Neu: iPad 32 GB Wi-Fi Space Grau<br />
Arbeiten, spielen, surfen und mehr. Mit 9,7"-Retina-<br />
Display, Fingerabdruck-Sensor und 8-Megapixel-<br />
Kamera. Gewicht: 469 g. Zuzahlung nur € 269,–.<br />
<br />
Ja, ich habe geworben und wähle meine Prämie!<br />
Ich bin der neue SPIEGEL-Leser.<br />
SPIEGEL-Vorteile<br />
Wertvolle Wunschprämie für den Werber.<br />
ğšwğšĒğšŋųťťťğŅĒťŭłğĴō^V0(>>ğťğšťğĴō<br />
ųŋvœšųĬťŝšğĴťťŭćŭŭǽōųšǽĿğųťĬćĒğĴōłŅ>ĴğĨğšųōĬ<br />
ųĨwųōťĔıĚğō^V0(>ĚĴĬĴŭćŅĨŸšōųšǽǽĿğųťĬćĒğĴōłŅ<br />
^V0(>œœłť<br />
Anschrift des neuen Lesers:<br />
Frau<br />
-ğšš<br />
Fćŋğ, vœšōćŋğ<br />
^ŭšćŬğ-ćųťōš<br />
Geburtsdatum<br />
19<br />
Wunschprämie<br />
0F<br />
Anschrift des Werbers:<br />
Frau<br />
-ğšš<br />
Fćŋğ, vœšōćŋğ<br />
^ŭšćŬğ-ćųťōš<br />
ǾǽǽŋćœōĚğ(ųŭťĔığĴō (ǽ<br />
wćĬğōĨğŅĚeĴťĔıŅğųĔıŭğ( ŅĬǾ<br />
eğćťĴLōğ ğ|ŭğōĚFćžĴ(<br />
ĴVćĚǿ(^ŝćĔğ(šćų( ŅĬǿ<br />
eœŋeœŋ^eZeǿe (<br />
Ǿǽǽ(ğŅĚŝšČŋĴğ(ǿǾǽ. DğĴō Lšŭ<br />
eğŅğĨœōĨŸšğžğōŭųğŅŅğZŸĔłĨšćĬğō<br />
V> Lšŭ<br />
ćŭųŋ<br />
Coupon ausfüllen und senden an:<br />
DER SPIEGEL, Kunden-Service, 20637 Hamburg 0403007-2700<br />
p<br />
Gleich mitbestellen! :ćĴĔıŋŘĔıŭğųťČŭŅĴĔıĚğō^V0(>ĚĴĬĴŭćŅĨŸšōųšǽǽ<br />
ŝšœųťĬćĒğĒğĴğığōťŭćŭŭĨŸšĴŋĴōğŅłćųĨ ^ǾǽǾ<br />
:ć ĴĔı ſŸōťĔığ ųōžğšĒĴōĚŅĴĔığ ōĬğĒœŭğ Ěğť ^V0(>vğšŅćĬť ųōĚ Ěğš ŋćōćĬğš ŋćĬćĴō vğšŅćĬťĬğťğŅŅťĔıćĨŭ<br />
ųğĴŭťĔıšĴĨŭğōŸĔığšōĒœōōğŋğōŭťLōŅĴōğVšœĚųłŭğōųōĚvğšćōťŭćŅŭųōĬğōŝğšeğŅğĨœōųōĚœĚğšDćĴŅDğĴō<br />
ĴōžğšťŭČōĚōĴťłćōōĴĔıĿğĚğšğĴŭſĴĚğššųĨğō<br />
ğšōğųğĒœōōğōŭŅĴğťŭĚğō^V0(>ĨŸšųōČĔıťŭǿųťĬćĒğōĨŸšųšğĴŭǽŝšœųťĬćĒğťŭćŭŭǽĴŋĴōğŅłćųĨ<br />
Ěğō^V0(>ĚĴĬĴŭćŅųťČŭŅĴĔıĨŸšǽǽŝšœųťĬćĒğćťĒœōōğŋğōŭžğšŅČōĬğšŭťĴĔıĿğſğĴŅťųŋſğĴŭğšğǿųťĬćĒğō<br />
ſğōōōĴĔıŭťğĔıťwœĔığōžœšōĚğĚğťğųĬťğĴŭšćųŋťĬğłŸōĚĴĬŭſĴšĚ<br />
Ich zahle bequem per SEPA-Lastschrift* žĴğšŭğŅĿČıšŅĴĔıǽĚĴĬĴŭćŅğųťĬćĒğıćŅĒĿČıšŅĴĔıǾ<br />
DE<br />
0F<br />
DćĴŅĨŸšğžğōŭųğŅŅğZŸĔłĨšćĬğō<br />
kōŭğšťĔıšĴĨŭĚğťōğųğō>ğťğšť<br />
ĴğDćōĚćŭťšğĨğ<br />
šğōſĴšĚťğŝćšćŭ<br />
mitgeteilt.<br />
www.spiegel.de/p17<br />
ğšwğšĒğšğšıČŅŭĚĴğVšČŋĴğĔćžĴğšwœĔığōōćĔıćıŅųōĬťğĴōĬćōĬĚğťĒœōōğŋğōŭĒğŭšćĬťğšvœšųĬťŝšğĴťžœōǽǽĨŸšĚğō^V0(>ĚĴĬĴŭćŅĬĴŅŭōųšĴōvğšĒĴōĚųōĬŋĴŭğĴōğŋŅćųĨğōĚğōğųĬĚğšVšĴōŭćųťĬćĒğğōŭıćŅŭğōťĴōĚǽĨŸšĚćťVćŝğš<br />
ğĴ^ćĔıŝšČŋĴğōŋĴŭųćıŅųōĬĬŅǿFćĔıōćıŋğĬğĒŸıšŅŅğVšğĴťğĴōłŅųťĴžğDſ^ŭųōĚvğšťćōĚćťōĬğĒœŭĬĴŅŭōųšĴōğųŭťĔıŅćōĚ-ĴōſğĴťğųĚğō(ųōĚĚğŋwĴĚğššųĨťšğĔıŭĪōĚğō^ĴğųōŭğšſſſťŝĴğĬğŅĚğćĬĒ^V0(>vğšŅćĬZųĚœŅĨųĬťŭğĴō<br />
(ŋĒ-œ
Wissenschaft+Technik<br />
Astrophysik<br />
„Himmelskarte<br />
des Unsichtbaren“<br />
FRANZ BISCHOF<br />
Vor zwei Jahren<br />
wiesen Forscher<br />
erstmals Gravi -<br />
tationswellen<br />
nach – diese waren<br />
beim Zusammenstoß<br />
zweier<br />
schwarzer Löcher entstanden. Unklar<br />
blieb, wo und wie genau sich<br />
im Universum der Crash ereignete.<br />
Nun gelang es, das Epizentrum<br />
eines Gravitationsbebens präzise<br />
zu ermitteln: <strong>Der</strong> Zusammenstoß<br />
zweier Neutronensterne setzte<br />
nicht nur Gravitationswellen frei,<br />
sondern auch elektromagnetische<br />
Strahlung, die von optischen<br />
Teleskopen aufgefangen wurde.<br />
Die Entdeckung markiere den Beginn<br />
einer neuen Ära der Astronomie,<br />
sagt Karsten Danzmann, 62,<br />
Direktor am Max-Planck-Institut<br />
für Gravitationsphysik in Hannover.<br />
SPIEGEL: Was ist so bedeutend<br />
daran, den Zusammenstoß<br />
zweier Neutronensterne zu<br />
beobachten, die 130 Millionen<br />
Lichtjahre von uns entfernt<br />
sind?<br />
Danzmann: Die Gravitationswellen-Astronomie<br />
schenkt<br />
uns gleichsam ein neues Sinnesorgan,<br />
um das Universum<br />
zu erkunden. Bislang waren<br />
wir taub, als würden wir<br />
ohne Gehör durch den lichtlosen<br />
Dschungel tappen. Wir<br />
fangen zwar schon längere<br />
Zeit Gammastrahlenblitze<br />
auf, mussten aber stets spekulieren,<br />
was dahintersteckt.<br />
Nun können wir solche dramatischen<br />
Ereignisse im All<br />
belauschen – und dadurch<br />
auch Phänomene wie die<br />
Lichtgeschwindigkeit und die<br />
Expansion des Universums<br />
mit nie da gewesener Präzi -<br />
sion bestimmen.<br />
SPIEGEL: Wirft das neues Licht<br />
auf Alltagsfragen?<br />
Danzmann: Natürlich. Haben<br />
Sie sich mal gefragt, woher<br />
das Gold in einem Ehering<br />
oder einer Kette stammt?<br />
Nun, diese schweren Elemente<br />
werden beim Verschmelzen<br />
von Neutronensternen<br />
erbrütet, in kosmischen<br />
Hochöfen, die wir dank der<br />
Gravitationswellen endlich<br />
beobachten können. Im Weltall<br />
wird alles recycelt. Was<br />
von gestorbenen Sternen übrig<br />
bleibt, wird wieder zu<br />
neuen Sternen und zu Planeten<br />
wie der Erde verbacken.<br />
SPIEGEL: Werden Sie auch<br />
Himmelsobjekte entdecken,<br />
die nie ein Mensch zuvor gesehen<br />
hat?<br />
Danzmann: Schon jetzt finden<br />
wir ungefähr ein schwarzes<br />
Loch pro Monat. Aber durch<br />
empfindlichere Instrumente<br />
könnten wir in zwei Jahren<br />
so weit sein, dass wir jeden<br />
Tag ein neues schwarzes<br />
Loch entdecken. Und vielleicht<br />
tauchen dabei auch<br />
noch exotischere Objekte auf,<br />
die bislang nur als Hypothese<br />
existieren, zum Beispiel<br />
„Gravastars“ oder „Nackte<br />
Singularitäten“. Nach und<br />
nach könnten wir eine Himmelskarte<br />
des Unsichtbaren<br />
erstellen. hil<br />
MAURICIO ANTON / SPL / AGENTUR FOCUS<br />
106<br />
Genetik<br />
Zügellose Neandertaler<br />
<strong>Der</strong> längst ausgestorbene Neandertaler lebt weiter – wenn<br />
auch nur in Form weniger seiner Gene, die sich heute noch<br />
bei vielen Menschen nachweisen lassen. Die<br />
Neandertaler-DNA steht dabei offenbar mit<br />
einer gewissen Neigung zur Zügellosigkeit in<br />
Zusammenhang, wie eine umfangreiche<br />
Erbgutanalyse ergeben hat, basierend auf<br />
Geninformationen und Gesundheitsdaten<br />
von 112000 Menschen in der britischen<br />
„UK Biobank“. Laut der neuen Studie,<br />
veröffentlicht im „American Journal of<br />
Human Genetics“, neigen Betroffene häufiger<br />
zum Rauchen, zur schlechten Laune,<br />
zur nächtlichen Aktivität und dazu,<br />
tagsüber gern mal ein Nickerchen<br />
zu halten. hil<br />
Fußnote<br />
12,7<br />
Millionen<br />
Vogelbrutpaare sind in<br />
Deutschland innerhalb von<br />
zwölf Jahren verloren ge -<br />
gangen. Diesen Rückgang<br />
um rund 15 Prozent belegt<br />
eine Auswertung des Naturschutzbundes<br />
Deutschland,<br />
basierend auf Vogelbestandsdaten<br />
der Bundes -<br />
regierung. Mögliche Gründe<br />
für den Vogelschwund:<br />
<strong>Der</strong> intensive Anbau von<br />
Mais und Raps nimmt zu,<br />
der Bestand an artenreichen<br />
Wiesen und nahrhaften<br />
Insekten nimmt ab.<br />
Mail: wissenschaft@spiegel.de · Twitter: @SPIEGEL_Wissen · Facebook: facebook.com/spiegelwissen
In Dieselgewittern<br />
Ein Blitz durchzuckt den Himmel über dem Golf von<br />
Thailand – fotografiert von Bord des US-Flugzeug -<br />
trägers USS „John C. Stennis“. Solche tropischen<br />
Gewitter ereignen sich auffallend oft über viel befah -<br />
renen Schiffsrouten, haben Atmosphärenforscher<br />
jetzt herausgefunden. In Meeresgegenden, in denen<br />
viele Schiffe fahren, so berichten die Wissenschaftler<br />
in der Fachzeitschrift „Geophysical Research Letters“,<br />
blitzt und donnert es doppelt so häufig wie in abge -<br />
legenen Teilen des Indischen Ozeans und des Südchinesischen<br />
Meeres. Die Erklärung: Dieselabgase fördern<br />
offenbar die Bildung gewitterträchtiger Wolken.<br />
DDP IMAGES<br />
Glosse<br />
Die unausgeschlafene Republik<br />
Schlafmangel als Ausweis heroischer Arbeitswut? Träumt weiter, Leute!<br />
<strong>Der</strong> Herbst ist da, die Nächte werden länger – vor allem die<br />
Verhandlungsnächte, bei denen die Schwarzen, die Grünen<br />
und die Gelben die Chancen für eine Jamaikakoalition aus -<br />
loten. Ah, Jamaika, da denken viele Menschen an Rum-Cocktails<br />
oder exotische Aufputschmittel. Die deutschen Verhandlungsführer<br />
dürften dabei eher auf althergebrachte Wachmacher<br />
setzen: mit Kaffee und Traubenzucker gegen den Schlafentzug.<br />
Die meisten Studenten gewöhnen sich spätestens<br />
beim Verfassen ihrer Bachelorarbeit ab, in Nachtschichten<br />
Verschlamptes nachzubüffeln; denn erfahrungsgemäß sind die<br />
bleischweren Stunden zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang<br />
wenig produktiv. In der Politik hingegen gehört der rituelle<br />
Schlafentzug fest zur Inszenierung jedes sogenannten Verhandlungsmarathons.<br />
Egal, ob bei Koalitionsverhandlungen<br />
oder der Eurorettung: Wer vor Mitternacht ein Ergebnis verkündet,<br />
muss ein Versager sein, der sich nicht so verausgabt<br />
hat, wie es die Gesellschaft von ihren Tränensack-Athleten<br />
erwartet. Schließlich fühlen sich angeblich 80 Prozent der Arbeitnehmer<br />
unausgeschlafen. Durchwachte Nächte gelten als<br />
Ausweis von besonderem Fleiß. Nur: warum eigentlich?<br />
Schlafentzug wirkt ähnlich wie eine Alkoholsause. Wer übermüdet<br />
ist, benimmt sich wie ein Besoffener: irrational, leicht<br />
beeinflussbar, risikofreudig, unkonzentriert, teils mit Tunnelblick<br />
und Wortfindungsstörungen. Insofern könnten die Jamaikakoalitionäre<br />
auch gemeinsam einen Joint durchziehen – die<br />
Wirkung wäre ähnlich wie ein Verhandlungsmarathon, würde<br />
aber schneller gehen und mehr Spaß machen. Dabei ginge<br />
es auch anders. Schließlich schenkt uns die Zeitumstellung am<br />
29. Oktober zusätzlich eine Stunde Schlaf, wenn wir uns<br />
darauf einlassen. Die Politik hat hier die einmalige Chance, im<br />
Sinne einer wirkmächtigen Leitkultur mit gutem Beispiel<br />
voranzugehen: rechtzeitig ab ins Bett.<br />
Hilmar Schmundt<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 107
Wissenschaft<br />
„Drecksforschung“<br />
Landwirtschaft Interne E-Mails enthüllen, wie der US-Konzern Monsanto Risiken<br />
verschwieg und Studien manipulierte, um das Pflanzengift Glyphosat reinzuwaschen.<br />
Ob Pestizide mit dem Wirkstoff Krebs verursachen, wurde nie richtig getestet.<br />
Es gibt Unternehmen, deren Ruf so<br />
ruiniert scheint, dass die Erwartungen<br />
an Ethik und Geschäftsgebaren<br />
ausgesprochen niedrig sind.<br />
Schockierend ist es dennoch, wenn sich<br />
die Vorwürfe schwarz auf weiß bestätigen.<br />
<strong>Der</strong> Agrarkonzern Monsanto steht unter<br />
Beschuss, weil das von der Firma entwickelte<br />
Unkrautvertilgungsmittel Roundup<br />
(Wirkstoff: Glyphosat) verdächtigt wird,<br />
krebserregend zu sein. Am Mittwoch sollen<br />
die EU-Mitgliedstaaten entscheiden, ob die<br />
Chemikalie, deren Zulassung am 15. Dezember<br />
ausläuft, für weitere zehn Jahre in<br />
der EU erlaubt wird. Vorausgegangen ist<br />
ein jahrelanger Streit, der nun durch brisante<br />
Dokumente weiter zugespitzt wird.<br />
Interne E-Mails, Präsentationen und Memos<br />
enthüllen Monsantos Strategien, Glyphosat<br />
mit allen Mitteln reinzuwaschen.<br />
Und diese „Monsanto Papers“ lassen noch<br />
mehr erahnen: Offenbar weiß der Konzern<br />
selbst nicht so genau, ob Roundup unbedenklich<br />
für die Gesundheit ist.<br />
„Man kann nicht sagen, dass Roundup<br />
nicht krebserregend ist“, schreibt die Monsanto-Toxikologin<br />
Donna Farmer in einer<br />
der E-Mails. „Wir haben nicht die nötigen<br />
Tests durchgeführt, um diese Aussage zu<br />
machen.“<br />
Die am 22. November 2003 verschickte<br />
Mail ist eines von mehr als hundert Dokumenten,<br />
die Monsanto in den USA durch<br />
richterlichen Beschluss als Beweismittel<br />
zur Verfügung stellen musste. Rund 2000<br />
Kläger fordern in Sammelklagen Schadensersatz<br />
von Monsanto. Sie behaupten,<br />
Roundup habe bei ihnen oder bei ihren<br />
Angehörigen das Non-Hodgkin-Lymphom<br />
ausgelöst – eine Form von Lymphdrüsenkrebs.<br />
Hat Monsanto Risiken verschwiegen?<br />
Die Dokumente legen das nahe. Für die<br />
Firma ist die Veröffentlichung der Papiere<br />
eine Katastrophe. Auch in Leverkusen bei<br />
Bayer dürfte die Sache diskutiert werden –<br />
der deutsche Chemiekonzern ist im Begriff,<br />
Monsanto zu kaufen.<br />
„Die Monsanto-Papiere erzählen eine<br />
alarmierende Geschichte von wissenschaftlicher<br />
Einflussnahme, Betrug und zurückgehaltenen<br />
Informationen“, sagt Michael<br />
Baum, Partner der Kanzlei Baum, Hedlund,<br />
Aristei & Goldman, die eine der<br />
US-Sammelklagen anstrengt. Monsanto<br />
benutze dieselben Strategien wie die Tabakindustrie:<br />
„Zweifel säen; Kritiker attackieren;<br />
Forschung manipulieren.“<br />
Glyphosat ist das weltweit meistversprühte<br />
Herbizid. Über 800 000 Tonnen<br />
des Stoffs produzieren Firmen wie Monsanto,<br />
Syngenta oder Bayer jedes Jahr.<br />
Auch in Deutschland wird es verkauft. Die<br />
Bauern machen mit dem Mittel Tabula<br />
rasa, um Felder für die neue Aussaat vorzubereiten.<br />
Oder sie spritzen damit Kartoffel-<br />
oder Rapspflanzen kurz vor der Reife<br />
tot. Dann ist die Ernte einfacher.<br />
Seit mehr als 40 Jahren ist der Bauern-<br />
Blockbuster in Gebrauch und inzwischen<br />
fast überall zu finden: im Urin von Mensch<br />
und Tier, in der Milch, im Bier, im Speiseeis,<br />
vor allem im Kraftfutter aus den USA<br />
oder Brasilien, das auch in den Trögen<br />
deutscher Rinder und Schweine landet.<br />
Lange galt Glyphosat als gesundheitlich<br />
unbedenklich, weil es einen Stoffwechselweg<br />
hemmt, der für Pflanzen zwar essenziell<br />
ist, bei Säugetieren jedoch nicht vorkommt.<br />
Doch ist das Mittel wirklich so<br />
harmlos? Im März 2015 nährte ein Warnruf<br />
von höchster Warte Zweifel an der Saga<br />
vom unbedenklichen Pestizid. Die Internationale<br />
Agentur für Krebsforschung<br />
(IARC), ein Gremium unter dem Dach der<br />
Weltgesundheitsorganisation, stufte Glyphosat<br />
als „wahrscheinlich krebserregend<br />
für den Menschen“ ein. Das Votum löste<br />
die Sammelklagen in den USA aus.<br />
Monsanto reagierte sofort. Die IARC-<br />
Einschätzung widerspreche „Jahrzehnten<br />
umfangreicher Sicherheitsforschung der<br />
führenden Regulierungsbehörden der<br />
Welt“, wetterte Cheftechniker Robb Fraley.<br />
Firmenchef Hugh Grant diffamierte die Arbeit<br />
als „Drecksforschung“.<br />
Nun jedoch zeigt sich: Monsanto hatte<br />
das IARC-Votum schon erwartet. Den Konzernforschern<br />
aus St. Louis war von vornherein<br />
klar, dass die Expertenrunde eine<br />
Krebswarnung aussprechen würde.<br />
„Worüber wir lange besorgt waren, ist<br />
eingetreten“, schrieb die Toxikologin Farmer<br />
im September 2014. „Glyphosat soll<br />
von der IARC überprüft werden.“ Monsanto-Kollege<br />
William Heydens präzisierte die<br />
Sorgen einen Monat später: „Verwundbar“<br />
sei man nicht nur „im Bereich Epidemiologie“,<br />
sondern potenziell auch bei „Exponierung,<br />
Gentox und Wirkmechanismus“.<br />
In epidemiologischen Studien kann untersucht<br />
werden, ob das Auftreten von<br />
Krankheiten mit bestimmten Stoffen zusammenhängt.<br />
Unter anderem auf solche<br />
Studien stützt die IARC ihr Votum. Die<br />
Untersuchungen aus den USA, Kanada<br />
und Schweden legen nahe, dass Glyphosat<br />
das Risiko erhöht, an Lymphdrüsenkrebs<br />
zu erkranken.<br />
Gentox wiederum ist die Kurzform für<br />
Genotoxizität und beschreibt, ob eine Substanz<br />
das Erbgut schädigt. Erbgutschäden<br />
können Krebs auslösen.<br />
Vom Acker in die Welt Glyphosatbelastung von Mensch, Natur und Nahrung*<br />
Glyphosat lässt sich im Wasser<br />
vieler Seen und Flüsse nachweisen,<br />
etwa in der Donau, im Rhein und im<br />
Neckar; selbst im Grundwasser ist<br />
es mancherorts enthalten.<br />
Tierfutter kann Glyphosat enthalten.<br />
Vor allem in Gentech-Soja aus<br />
Brasilien oder den USA, das auch an<br />
deutsche Schweine und Rinder<br />
verfüttert wird, sind Rückstände.<br />
In Deutschland hatten sieben von<br />
zehn untersuchten Großstädtern<br />
Glyphosat im Urin. Die Aufnahme<br />
erfolgt mit der Nahrung.<br />
*Nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung sind alle gemessenen Konzentrationen gesundheitlich unbedenklich.<br />
108 DER SPIEGEL 43 / 2017
BRUNO BEBERT / BESTIMAGE / ACTION PRESS<br />
STEVEN LÜDTKE / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Proteste gegen Monsanto in Nizza, Glyphosat-Einsatz bei Göttingen: „Wir haben beschlossen, die Studie zu stoppen“<br />
STEVEN LÜDTKE / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
Und was mit „verwundbar“ gemeint ist,<br />
lässt sich in weiteren Monsanto-Mails nachlesen.<br />
Man habe „keine direkten Tests“<br />
zur „krebserregenden Wirkung“ von<br />
Roundup durchgeführt, heißt es da. Oder:<br />
„Wir führen keine subchronischen, chronischen<br />
oder teratogenen Untersuchungen<br />
mit unseren Formulierungen durch.“ Letztere<br />
würden zeigen, ob Roundup Fehlbildungen<br />
auslösen kann, wie es manche Studien<br />
nahelegen. Rattenembryonen etwa,<br />
die mit verdünntem Roundup geduscht<br />
wurden, entwickelten Skelettschäden.<br />
Sogar eigenen Gutachtern traute Monsanto<br />
nicht. Toxikologin Farmer fasste eine<br />
Analyse des Monsanto-Beraters James Parry<br />
so zusammen: „Dr. Parry folgerte, dass<br />
Glyphosat in der Lage sei, Genotoxizität<br />
zu produzieren.“ Als Warnung wollte Farmer<br />
dies aber nicht verstanden wissen.<br />
Man müsse Parry weitere Studien zukommen<br />
lassen, um ihn „von seiner Position<br />
abzubringen“, schrieb sie stattdessen.<br />
Auch der Wirkmechanismus des Stoffs<br />
scheint nicht so harmlos, wie es die Industrie<br />
gern behauptet. Denn Glyphosat tötet<br />
nicht nur Pflanzen, sondern auch viele<br />
Mikroorganismen. Mensch und Tier sollten<br />
damit zwar nicht direkt betroffen sein,<br />
wohl aber das Mikrobiom, die Millionen<br />
Bakterien der Darmflora.<br />
Bei Rindern, die glyphosathaltiges Kraftfutter<br />
fressen, verändert sich dadurch zum<br />
Beispiel die Häufigkeit mancher Mikroorganismen<br />
im Pansen, hat die Leipziger Veterinärmedizinerin<br />
Monika Krüger beobachtet<br />
– mit Auswirkungen auf die Gesundheit<br />
der Tiere. Das Bundesinstitut für Risikoforschung<br />
(BfR), das in der EU für die<br />
Einschätzung von Glyphosat zuständig ist,<br />
widerspricht dem allerdings.<br />
Verantwortunglos verhalten sich die<br />
Monsanto-Forscher auch, wenn es um die<br />
Aufnahme von Roundup in den Körper<br />
geht. „Zwischen 5 und 10 Prozent“ des<br />
Stoffs drängen durch die Haut von Ratten,<br />
fanden die Konzernexperten schon 2002<br />
bei eigenen Tierversuchen heraus.<br />
Die Quote lag weit höher als erwartet:<br />
Das Ergebnis habe das Potenzial, die<br />
„Roundup-Risikobewertungen“ zu „spren-<br />
In Tee und Kaffee wurden<br />
Spuren von Glyphosat gefunden.<br />
Bei Instantprodukten lagen die<br />
Werte oftmals höher.<br />
Glyphosat findet sich auch in<br />
Milch aus konventioneller<br />
Landwirtschaft. Die Kühe<br />
nehmen die Chemikalie mit<br />
dem Kraftfutter auf.<br />
In Getreide, Backwaren und<br />
Mehl wurde Glyphosat festgestellt,<br />
insbesondere wenn es<br />
kurz vor der Ernte versprüht<br />
worden war.<br />
Glyphosatrückstände entdeckten<br />
Analytiker auch in Bier. Allerdings<br />
müsste man täglich 1000 Liter Bier<br />
trinken, um den derzeit gültigen<br />
toxikologischen Grenzwert zu<br />
erreichen.<br />
Quellen: BfR, BUND, FAO, IDAEA-CSIC, Monsanto, „Öko-Test“, VMF Uni Leipzig<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
109
Wissenschaft<br />
110 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Gift gegen<br />
Grünzeug<br />
Absatz von Glyphosat<br />
weltweit, in<br />
Tausend Tonnen<br />
2014<br />
826<br />
2008<br />
543<br />
geschätzter Marktwert<br />
4,1 Mrd. €<br />
2002<br />
269<br />
Quellen:<br />
Environmental<br />
Sciences Europe,<br />
Agrow<br />
gen“, heißt es in einer E-Mail. Die Konsequenz:<br />
„Wir haben beschlossen, die Studie<br />
zu stoppen.“ Auch über den Verdauungstrakt<br />
nahmen Versuchstiere mehr Round -<br />
up-Inhaltsstoffe auf als erhofft.<br />
Vor allem aber wird aus den Monsanto-<br />
Papieren deutlich, dass den Experten ein<br />
Unterschied sehr bewusst war, der in der<br />
öffentlichen Diskussion häufig untergeht.<br />
Herbizide wie Roundup enthalten neben<br />
Glyphosat weitere gefährliche Chemikalien,<br />
die unter anderem notwendig sind,<br />
um dem Wirkstoff den Weg durch die harten<br />
Pflanzenwände zu bahnen. Diese geheimen<br />
Rezepturen jedoch sind oftmals<br />
schädlicher als der Wirkstoff allein.<br />
Das Problem daran: Viele Regulierungsbehörden<br />
bewerten vor allem den Wirkstoff<br />
Glyphosat isoliert auf Giftigkeit, nicht<br />
aber die versprühten Mixturen – ein Erfolg<br />
jahrelanger Lobbyarbeit der Industrie.<br />
Ob die Environmental Protection Agency<br />
aus den USA, die Europäische Behörde<br />
für Lebensmittelsicherheit oder das BfR:<br />
Sie alle führen sogenannte Risikoanalysen<br />
durch. In den dafür ausgewerteten Studien<br />
träufeln Forscher Ratten reines Glyphosat<br />
ins Futter. Dann bestimmen sie jene Glyphosat-Menge,<br />
die den Tieren gerade eben<br />
noch keine Schäden zufügt. Andere Studien<br />
stellen fest, in welcher Konzentration<br />
der Stoff tatsächlich in der Umwelt vorkommt.<br />
Liegen die beiden Werte weit auseinander,<br />
geben die Kontrolleure Entwarnung.<br />
Bei Glyphosat ist das so. Das Urteil:<br />
nicht krebserregend.<br />
Anders die gefahrenbezogene Bewertung,<br />
die zum IARC-Votum führte: Unabhängig<br />
von der Dosis untersuchen Forscher<br />
dabei, ob der Stoff prinzipiell gefährlich<br />
ist. Zudem bewerten sie, was geschieht,<br />
wenn die kompletten Mixturen, in diesem<br />
Fall Roundup, versprüht werden. Bei solchen<br />
epidemiologischen Studien können<br />
die Bedingungen nicht so gut kontrolliert<br />
werden. Dafür bilden sie die Wirklichkeit<br />
besser ab – und führten zum IARC-Votum:<br />
wahrscheinlich krebserregend.<br />
Zu einem ähnlichen Resultat kamen<br />
auch die Monsanto-Experten. „Glyphosat<br />
ist OK, aber das formulierte Produkt verursacht<br />
den Schaden“, schrieb Monsanto-<br />
Forscher Heydens an Donna Farmer.<br />
Wäre es da nicht angebracht gewesen,<br />
die Öffentlichkeit zu warnen? <strong>Der</strong> Konzern<br />
tat nichts dergleichen. Stattdessen setzte<br />
die Firma ihre massive Lobbykampagne<br />
fort und ließ kaum etwas unversucht, um<br />
missliebige Forscher zu diskreditieren.<br />
Eines der Opfer war der französische<br />
Toxikologe Gilles-Éric Séralini. Er tat genau<br />
das, was eigentlich Monsantos Aufgabe<br />
gewesen wäre: Séralini träufelte Versuchsratten<br />
über zwei Jahre Roundup ins<br />
Trinkwasser und fütterte sie mit glyphosatbelastetem<br />
Gentech-Mais. Was er fand,<br />
war alarmierend: Manche der Tiere entwickelten<br />
Nierenschäden, die Weibchen erkrankten<br />
auffallend häufig an Brustkrebs.<br />
Im September 2012 veröffentlichte das<br />
Fachblatt „Food and Chemical Toxicology“<br />
die Studie. Danach brach in Séralinis Leben<br />
die Hölle los. Hunderte Forscher protestierten.<br />
Séralini wurden „Falschaussagen“<br />
vorgeworfen und die „Verwendung<br />
von Tieren für Propagandazwecke“.<br />
Im November 2013 zog das Journal<br />
die Veröffentlichung zurück. Zufall oder<br />
nicht – ein halbes Jahr zuvor hatte das<br />
Fachmagazin einen ehemaligen Monsanto-Mitarbeiter<br />
in seinen Beirat berufen.<br />
Auch die internen Memos bestätigen, wie<br />
Monsanto Druck ausübte. Er habe „erfolgreich<br />
mehrere Sachverständige dazu gebracht,<br />
Briefe an den Herausgeber“ zu<br />
schreiben, brüstete sich der damalige Monsanto-Experte<br />
David Saltmiras. <strong>Der</strong> Vorgang<br />
sei „in unserem besten Interesse“ und „die<br />
letzte Ölung für Séralinis Glaubwürdigkeit“.<br />
Methodisch ist Séralinis Arbeit tatsächlich<br />
angreifbar. Das machte es den Monsanto-Experten<br />
leicht. Doch bei der Gefahrenbewertung<br />
der IARC wiederholte<br />
sich das Muster. Hier hatte Monsanto sogar<br />
einen detaillierten „Bereitschafts- und Einsatz-Plan“<br />
vorbereitet, um gegen das Votum<br />
der Krebsexperten vorzugehen.<br />
Die Firma engagierte ein Team von Forschern<br />
und Lobbyexperten. Ihr Ziel: ein<br />
„orchestrierter Aufschrei“. Die IARC sollte<br />
als Organisation mit einer Geschichte<br />
„fragwürdiger und politisch aufgeladener<br />
Entscheidungen“ diskreditiert werden.<br />
Tatsächlich brach nach dem IARC-Votum<br />
ein Sturm der Entrüstung los. Die Finanzierung<br />
des Gremiums wurde hinterfragt.<br />
Erst im Juni machte die Falschmeldung<br />
die Runde, ein Mitglied der IARC<br />
habe Informationen zurückgehalten.<br />
<strong>Der</strong> Monsanto-Schlachtplan sah zudem<br />
„drei neue wissenschaftliche Veröffentlichungen“<br />
vor. 2016 erschien tatsächlich<br />
eine kritische „Review“ zur IARC-Bewertung.<br />
Die internen Papiere zeigen: Monsanto<br />
nahm massiv Einfluss auf den Inhalt.<br />
Zudem erhielten zwei der Autoren offenbar<br />
direkt Geld von Monsanto. So wird<br />
dem ehemaligen Mitarbeiter John Acquavella<br />
die Summe von 20700 US-Dollar quittiert,<br />
für „Beratung im Zusammenhang<br />
mit dem Glyphosat-Expertengremium“.<br />
Monsanto weist die Einflussnahme zurück.<br />
Zu den weiteren Vorwürfen nimmt<br />
die Firma keine Stellung. Offene Fragen<br />
bleiben: Wieso veröffentlicht Monsanto<br />
seine eigenen Forschungsergebnisse nicht?<br />
Warum finanziert die Firma nicht zum Beispiel<br />
eine unabhängige Wiederholung der<br />
Séralini-Studie, die alle Zweifel ausräumen<br />
könnte?<br />
„Monsanto würde alles tun, um sein Produkt<br />
Roundup zu schützen“, sagt Daniel<br />
Boese von der Bürgerbewegung Avaaz.<br />
Über Jahre habe die Firma die Verbraucher<br />
getäuscht und Gutachten beeinflusst.<br />
Die Firma „zerstört wissenschaftliche<br />
Sicher heitsmechanismen, auf die sich die<br />
Öffentlichkeit eigentlich verlässt“, so Boese.<br />
<strong>Der</strong> Lobbyeinfluss des Unternehmens<br />
sei massiv. So sei der Glyphosat-Bericht<br />
des deutschen BfR in Teilen aus Unter -<br />
lagen der Glyphosate Task Force übernommen,<br />
eines Monsanto-geführten Industrieverbandes.<br />
Das BfR weist den Plagiats -<br />
vorwurf zurück.<br />
Europas Politiker sollten sich die Monsanto-Papiere<br />
besser gut ansehen, bevor<br />
sie Glyphosat für weitere zehn Jahren zulassen.<br />
Italien, Österreich und Frankreich<br />
wollen sich bereits dagegen entscheiden.<br />
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela<br />
Merkel (CDU) zögert noch.<br />
„Wir werden uns dafür einsetzen, dass<br />
Sie diesen Stoff da, wo es notwendig ist,<br />
auch weiterhin anwenden können“, rief<br />
sie den Landwirten noch im Juni auf dem<br />
Deutschen Bauerntag zu. In einer möglichen<br />
Jamaikakoalition mit den Grünen<br />
könnte es für Merkel allerdings schwer werden,<br />
dieses Versprechen einzuhalten.<br />
Ohnehin täten auch Europas Landwirte<br />
gut daran, sich Schicksale wie jenes von<br />
Jack McCall vor Augen zu führen, dessen<br />
Witwe Teri zu den Klägerinnen in den<br />
USA gehört.<br />
<strong>Der</strong> kalifornische Farmer versprühte<br />
über Jahrzehnte Roundup in seinen Obstplantagen.<br />
Ein treuer Begleiter blieb dabei<br />
lange an seiner Seite: sein Hund Duke.<br />
Erst starb der Hund an Lymphdrüsenkrebs.<br />
Dann McCall.<br />
Philip Bethge<br />
Mail: philip.bethge@spiegel.de
Ohne Vertragslaufzeit: jetzt<br />
den SPIEGEL frei Haus lesen!<br />
Gratis<br />
ųšwćıŅ<br />
Gratis für Sie: ğĴōğwųōťĔıųťĬćĒğžœō<br />
^V0(>(^-0-ew0^^F0L(Z&0<br />
œĚğšğĴō^V0(><br />
<strong>Der</strong> SPIEGEL jede Woche<br />
frei Haus:<br />
œıōğDĴōĚğťŭĒğųĬ<br />
ĬŸōťŭĴĬğšćŅťĴŋ-ćōĚğŅ<br />
łœťŭğōŅœťğškšŅćųĒťťğšžĴĔğ<br />
ĴōłŅųťĴžğ>0eZekZ^V0(><br />
Ja, ich möchte bequem den SPIEGEL lesen!<br />
0ĔıŅğťğĚğō^V0(>ĨŸšōųšǽŝšœųťĬćĒğťŭćŭŭǽĴŋ<br />
ĴōğŅłćųĨłćōōĿğĚğšğĴŭųšōČĔıťŭğššğĴĔıĒćšğōųťĬćĒğ<br />
łŸōĚĴĬğōųōĚğšıćŅŭğğĴō^V0(>(šćŭĴťığĨŭōćĔıwųōťĔıĚćų<br />
ĴōĨćĔıĿğŭŭćōĨœšĚğšō<br />
abo.spiegel.de/bequem<br />
p 040 3007-2700 ĴŭŭğłŭĴœōťōųŋŋğšćōĬğĒğō^VǾǿǾ<br />
Rosenzweig & Schwarz, Hamburg
Wissenschaft<br />
Verrückt oder bösartig?<br />
Psychiatrie Einige führende amerikanische Seelenkundler haben den Geisteszustand von<br />
Präsident Donald Trump begutachtet – ihre Ferndiagnosen sind beängstigend.<br />
US-Präsident Trump: „Sadistisch, mitleidlos, grausam, unmoralisch, primitiv, kaltschnäuzig, räuberisch, schikanierend, entmenschlichend“<br />
LUCA BRUNO / AP<br />
Das Verhalten des Täters zeige charakteristische<br />
Merkmale eines Soziopathen,<br />
urteilt der Gutachter<br />
und Psychiater Lance Dodes. Es handle<br />
sich dabei um „eine der schwerwiegendsten<br />
aller seelischen Störungen“. Soziopathen<br />
litten unter einem „Defekt in der<br />
grundlegenden Natur ihres Menschseins“.<br />
Ihre typischen Eigenschaften: „Sadistisch,<br />
mitleidlos, grausam, abwertend, unmoralisch,<br />
primitiv, kaltschnäuzig, räuberisch,<br />
schikanierend, entmenschlichend.“<br />
Dodes lässt keinen Zweifel daran, dass<br />
er von einem gefährlichen Monstrum<br />
spricht. Doch gemeint ist nicht etwa der<br />
Attentäter von Las Vegas. Nein, die Rede<br />
ist vom amtierenden Präsidenten der Vereinigten<br />
Staaten.<br />
Dodes’ Expertise ist Teil eines Buchs, in<br />
dem 27 Fachleute – teils sehr namhafte Psychiater<br />
und Psychologen – ihr Urteil über<br />
112 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Donald Trump abgeben*. <strong>Der</strong> Band ist aus<br />
einer Konferenz hervorgegangen, die unter<br />
dem Motto „Duty to Warn“ (Pflicht zu warnen)<br />
an der Uni Yale stattfand.<br />
Entstanden ist ein unheimliches Seelenpanorama.<br />
Trump werden ein „hypermanisches<br />
Temperament“, eine „wahnhafte<br />
Loslösung von der Wirklichkeit“ und „paranoide<br />
Hyperempfindlichkeit“ attestiert.<br />
Die Autoren unterstellen ihm nicht nur<br />
„Gedankenlosigkeit“, „Leichtsinn“ und<br />
„Selbstverherrlichung“, sondern auch<br />
„Frauenhass“, „Boshaftigkeit“ und „Bewunderung<br />
für Gewaltherrscher“. Sogar<br />
vor Vergleichen mit Adolf Hitler schrecken<br />
die Fachleute nicht zurück.<br />
Den Leser hinterlässt das Buch fassungslos:<br />
Wird das mächtigste Land der Welt<br />
* Bandy Lee (Hg.): „The Dangerous Case of Donald<br />
Trump“. Thomas Dunne Books; 384 Seiten.<br />
wirklich von einem Verrückten regiert? Einem<br />
Größenwahnsinnigen, der nicht recht<br />
weiß, was er tut? Oder steigert sich hier<br />
nur eine Handvoll Psychiater, empört über<br />
Trumps irrlichternden Politikstil, in überzogene<br />
Horrorfantasien hinein?<br />
Den ethischen Richtlinien ihres Berufsstands<br />
zufolge hätten die Autoren ein<br />
solches Buch nicht schreiben dürfen. Die<br />
sogenannte Goldwater-Regel verbietet es<br />
ihnen als Psychiatern, sich über Menschen<br />
des öffentlichen Lebens zu äußern. Er -<br />
lassen wurde diese Vorschrift, nachdem<br />
1964 mehr als tausend Psychiater dem<br />
damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten<br />
Barry Goldwater im<br />
Rahmen einer Zeitschriftenumfrage bescheinigt<br />
hatten, er sei aus psychischen<br />
Gründen amtsuntauglich.<br />
Goldwater verlor die Wahl, vor Gericht<br />
jedoch obsiegte er: Die Zeitschrift wurde
Zahlreiche US-Präsidenten litten<br />
unter Symptomen<br />
seelischer Störungen.<br />
Abraham Lincoln (1861 bis 1865)<br />
Weinen in der Öffentlichkeit<br />
Theodore Roosevelt (1901 bis 1909)<br />
Berühmt für manische Tiraden<br />
John F. Kennedy (1961 bis 1963)<br />
Oft unter dem Einfluss von Psychopillen<br />
DPA<br />
AP<br />
AP<br />
zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet.<br />
<strong>Der</strong> amerikanische Psychiaterbund<br />
APA empfand es als Schmach für die Zunft<br />
und untersagte seinen Mitgliedern fortan<br />
jegliches fachliche Urteil über Politiker, die<br />
sie ärztlich nicht untersucht haben.<br />
Die Autoren des Buchs begehren jetzt<br />
gegen dieses Schweigegebot auf. Im Fall<br />
Trump sei das Gefühl weit verbreitet, dass<br />
mit ihm psychisch irgendetwas nicht<br />
stimmt. Da sei es geradezu die Pflicht der<br />
Psychiater, den Menschen mit ihrer Expertise<br />
Erklärungshilfen anzubieten.<br />
„Eine der seltsamsten Erfahrungen in<br />
meiner Karriere als Psychiaterin war es,<br />
festzustellen, dass die einzigen Leute, die<br />
nicht über einen Gegenstand sprechen dürfen,<br />
diejenigen sind, die am meisten da -<br />
rüber wissen“, klagt Bandy Lee, die Organisatorin<br />
der Konferenz an der Universität<br />
Yale. Und auch der Psychiater Leonard<br />
Glass erklärt: „Wir sind die einzige medizinische<br />
Fachdisziplin, für die ein solcher<br />
Maulkorb gilt. Niemand stört sich daran,<br />
wenn sich ein Kardiologe über den Zusammenbruch<br />
von Hillary Clinton oder ein<br />
Orthopäde über die Verletzung eines Footballstars<br />
äußert.“<br />
Indem sich die Buchautoren nun an eine<br />
Bewertung von Trumps Persönlichkeit wagen,<br />
werden auch die Schwierigkeiten eines<br />
solchen Unterfangens offenbar. Die<br />
Herausgeber betonen, es könne nur um<br />
die Beurteilung von Trumps Verhalten in<br />
der Öffentlichkeit gehen, nicht hingegen<br />
darum, ihm eine bestimmte Geisteskrankheit<br />
zu attestieren.<br />
Trotzdem prasseln die Diagnosen in<br />
dem Buch auf Trump nur so ein: Die meisten<br />
der selbst ernannten Gutachter favorisieren<br />
die „narzisstische Persönlichkeitsstörung“,<br />
andere gehen noch weiter und<br />
glauben, Anzeichen von „bösartigem Narzissmus“<br />
zu erkennen. Aber auch die „dissoziale<br />
Persönlichkeitsstörung“ steht hoch<br />
im Kurs. Dodes hält Trump für einen Soziopathen,<br />
Michael Tansey aus Chicago<br />
bringt die „wahnhafte Störung“ als mög -<br />
liche Diagnose ins Spiel. Und dann gibt es<br />
natürlich noch jene, die Trump für aufmerksamkeitsgestört<br />
erklären oder bei ihm<br />
eine beginnende Demenz zu erkennen<br />
glauben.<br />
Kurzum: Alle Autoren sind sich einig,<br />
dass Trump irgendwie nicht richtig tickt,<br />
und dies auf äußerst beängstigende Weise.<br />
Nur: Welcher Natur seine Störung eigentlich<br />
ist, das wissen sie auch nicht genau.<br />
Es scheint, dass der US-Präsident an mehr<br />
als nur einer Geisteskrankheit leidet.<br />
„Eindeutige Diagnosen zu erstellen ist<br />
nicht nötig, und es ist auch nicht hilfreich“,<br />
sagt Psychiater Glass – schon deshalb, weil<br />
völlig unklar sei, was eine klare Diagnose<br />
eigentlich bedeuten würde. Denn in einem<br />
sind sich Glass und seine Kollegen einig:<br />
Eine seelische Erkrankung schließt die Ausübung<br />
des höchsten Staatsamts nicht automatisch<br />
aus.<br />
Bei einer retrospektiven Analyse kamen<br />
Forscher im Jahr 2006 zu dem Schluss, dass<br />
rund ein Viertel von 37 betrachteten US-<br />
Präsidenten Symptome zeigte, die eine seelische<br />
Erkrankung nahelegen. Abraham<br />
Lincoln zum Beispiel weinte in der Öffentlichkeit,<br />
und Theodore Roosevelt war berühmt<br />
für seine manischen Tiraden. Bei<br />
John F. Kennedy konnten die Autoren der<br />
Studie zwar keinen unmittelbaren Hinweis<br />
auf eine seelische Störung finden, doch<br />
stand er oft unter dem Einfluss psycho -<br />
aktiver Medikamente. Alle drei waren<br />
zweifellos erfolgreiche Präsidenten.<br />
Bei Trump aber ist es irgendwie anders;<br />
und die Autoren mühen sich damit ab zu<br />
definieren, worin denn der Unterschied<br />
liegen könnte. Immer wieder kommen sie<br />
auf die Frage zurück, ob Trump wohl all<br />
die Lügen, die er verbreitet, selbst glaubt;<br />
ob er ein gerissener Publicityprofi oder<br />
ein geistig gestörter Besessener ist; ob er<br />
mutwillig Menschen manipuliert oder nur<br />
wahnhaften Impulsen folgt. Kurzum: ob<br />
Trump verrückt oder bösartig ist.<br />
Eine verbindliche Antwort auf diese<br />
Fragen könne sie nicht liefern, sagt die Psychiaterin<br />
und Traumaforscherin Judith Herman:<br />
„Wahrscheinlich trifft auf Trump beides<br />
zu.“ Aber viel wichtiger: Letztlich komme<br />
es darauf gar nicht an. Entscheidend sei,<br />
wie gefährlich Trump eigentlich ist.<br />
Psychiater würden häufig hinzugezogen,<br />
wenn es darum gehe zu beurteilen, welche<br />
Gefahr von einem Menschen ausgeht, sagt<br />
Herman. „Bei der Bewertung greifen wir<br />
oft nicht auf ein persönliches Gespräch,<br />
sondern allein auf eine Beurteilung beobachtbaren<br />
Verhaltens zurück.“<br />
Wenn es um solche Gutachten geht,<br />
dann hat das Wort von James Gilligan Gewicht.<br />
Er ist forensischer Psychiater an der<br />
New York University, viele Jahre lang hat<br />
er ein Gefängnis für geistig kranke Straftäter<br />
geleitet. Er hat Mörder, Vergewaltiger<br />
und andere Kriminelle begutachtet. Was<br />
er über Trump zu sagen hat, fällt vernichtend<br />
aus: „Er ist auf beispiellose und abnorme<br />
Weise gefährlich.“<br />
Gilligan hat Berichte über Trump durchforstet,<br />
um nach Hinweisen auf seine Einstellung<br />
zur Gewalt zu suchen. Die Indizien,<br />
die er zusammengetragen hat, sind<br />
furchterregend:<br />
‣ Trump sponserte 1989 eine Kampagne,<br />
die das Ziel hatte, fünf Jugendliche in<br />
New York hinzurichten. Als dann deren<br />
Unschuld bewiesen war, ließ er das einfach<br />
nicht gelten.<br />
‣ Er prahlte damit, sich Frauen gegenüber<br />
jede Art von Übergriffen leisten zu können<br />
(„Greif ihnen an die Muschi. Du<br />
kannst alles machen“).<br />
‣ Im Wahlkampf versprach Trump, er werde<br />
nicht nur das Waterboarding wieder<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
113
harvardbusinessmanager.de<br />
JETZT IM HANDEL:<br />
SCHWERPUNKT<br />
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ<br />
Weitere Themen:<br />
START-UP-LABORE<br />
Wie Konzerne Innovationen entdecken<br />
ENTSCHEIDUNGEN<br />
Wann Aristoteles mehr hilft als Big Data<br />
UNTERNEHMENSFÜHRUNG<br />
GE-Topmann Jeffrey Immelt zieht Bilanz<br />
Wissenschaft<br />
zulassen, sondern „noch viel weiter<br />
gehen“.<br />
‣ Er forderte seine Anhänger auf Wahlveranstaltungen<br />
auf, Protestler zusammenzuschlagen<br />
(„Prügelt ihnen die Seele<br />
aus dem Leib. Ich zahle den Anwalt.<br />
Versprochen“).<br />
‣ Er rief Waffennarren kaum verhohlen<br />
dazu auf, seine Konkurrentin Hillary<br />
Clinton zu erschießen.<br />
‣ Er erklärte sich selbst für unantastbar<br />
(„Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue<br />
jemanden erschießen, und es würde<br />
mich keine einzige Wählerstimme kosten“).<br />
‣ Er äußerte verschiedentlich Unverständnis<br />
darüber, warum man Atomwaffen,<br />
wenn man sie schon habe, nicht auch<br />
nutzen dürfe.<br />
„Androhung von Gewalt, Prahlerei mit<br />
Gewalt, Anstiftung zu Gewalt“, resümiert<br />
Gilligan. Für ihn gibt es keinen Zweifel:<br />
Donald Trump spricht die Sprache eines<br />
Diktators.<br />
Gilligans Kollege Tansey pflichtet ihm<br />
in seinem Buchkapitel bei. Ihn ängstigt vor<br />
allem die Bewunderung, die Trump für Gewaltherrscher<br />
bekundet hat. Über Saddam<br />
Hussein sagte Trump: „Er hat Terroristen<br />
getötet. Das hat er so gut gemacht! Sie haben<br />
ihnen nicht ihre Rechte vorgelesen.<br />
Sie haben nicht geredet. Du warst ein<br />
Terrorist, und das war’s.“ Und über Putin<br />
verkündete er im Wahlkampf: „In puncto<br />
Führung kriegt er ein A, und unser Präsident<br />
schneidet nicht so gut ab.“ Ähnliche<br />
Hochachtung wie für Saddam oder Putin,<br />
sagt Tansey, habe Trump früheren US-<br />
Präsidenten gegenüber nie zum Ausdruck<br />
gebracht.<br />
Despoten hätten auf Trump eine große<br />
Anziehungskraft, erklärt Tansey, denn ihre<br />
absolute Macht sei das, wovon er selbst<br />
träume. Er sehne sich nach der bedingungslosen<br />
Verehrung seiner Fans und der physischen<br />
Vernichtung seiner Gegner, so wie<br />
es nur in einer Diktatur möglich ist.<br />
Das sind massive Vorwürfe. Und Gilligan<br />
steigert sie noch, indem er auf das<br />
nukleare Inferno verweist, das auszulösen<br />
nun einem möglicherweise Geistesgestörten<br />
überlassen sei: „Er kann in wenigen<br />
Sekunden mehr Menschen töten, als jeder<br />
Diktator der Vergangenheit es in seiner<br />
gesamten Regierungszeit konnte.“<br />
Doch was können die 27 Experten mit<br />
ihrer niederschmetternden Analyse er -<br />
reichen?<br />
Leonard Glass hofft, der Begeisterung<br />
der Trump-Anhänger mit seiner Expertise<br />
etwas entgegensetzen zu können: „Die<br />
Leute glauben, Donald Trump sei ein richtiger<br />
Kerl“, sagt er. „Sie denken: <strong>Der</strong> hat<br />
Mumm, der hat Geld, der lässt sich von<br />
niemandem was sagen.“ Deshalb sei es<br />
wichtig, den Menschen zu erklären, dass<br />
all das aufgeblasene Geprahle vermutlich<br />
114 DER SPIEGEL 43 / 2017
Jetzt im<br />
Handel<br />
Die US-Verfassung sieht<br />
ein Verfahren vor, einen<br />
unfähigen Präsidenten<br />
des Amtes zu entheben.<br />
nur Ausdruck einer Ich-Schwäche sei. Wer<br />
es nötig habe, sich selbst so maßlos zu<br />
preisen, dem mangle es an Selbstwert -<br />
gefühl.<br />
Auch Judith Herman geht es vor allem<br />
darum, Augen zu öffnen. Die Gefahr sei<br />
groß, dass sich die Menschen an das Verhalten<br />
ihres Präsidenten gewöhnten, so<br />
lange, bis sie es für normal hielten. „Die<br />
Sehnsucht, dass der Kaiser Kleider hat, ist<br />
groß“, sagt die Traumaforscherin. Auch<br />
hofften viele, dass die Verantwortung des<br />
Amts Trump mäßigen könne. Herman zufolge<br />
aber lehrt die psychiatrische Erfahrung,<br />
dass die Verleugnung von krankhaftem<br />
Verhalten ein Fehler und die Hoffnung<br />
auf Besserung bei einem so sehr in starren<br />
Stereotypen gefangenen alten Mann vergebens<br />
ist.<br />
Herman hat zusammen mit zwei Kolleginnen<br />
eine psychiatrische Überprüfung<br />
des Präsidenten angeregt. Das Trio hat genaue<br />
Vorstellungen, wie ein solcher Tauglichkeitstest<br />
aussehen könnte, und jetzt<br />
werben sie unter Politikern dafür.<br />
Tatsächlich sieht die amerikanische Verfassung<br />
ein solches Verfahren zumindest<br />
theoretisch vor: Dem vierten Absatz des<br />
25. Verfassungszusatzes zufolge können<br />
Kabinett und Kongress den Präsidenten<br />
seines Amtes entheben, wenn sie ihn für<br />
unfähig halten, seinen Aufgaben nachzukommen.<br />
Dass es dazu kommen könnte,<br />
gilt unter den gegenwärtigen politischen<br />
Umständen allerdings als sehr unwahrscheinlich.<br />
Trotzdem wollte die Chicagoer Psy -<br />
chiaterin Prudence Gourguechon genauer<br />
wissen, wann ein Präsident eigentlich<br />
dienst untauglich ist. Was, so fragte sie sich,<br />
sind denn die Fähigkeiten, die eine Person<br />
mit solch extrem hoher Verantwortung aufweisen<br />
sollte?<br />
Zu ihrem Erstaunen suchte Gourguechon<br />
in der Fachliteratur lange vergebens<br />
nach einer klaren Antwort auf ihre Frage.<br />
Fündig wurde sie schließlich beim Militär.<br />
Das Armeehandbuch über Führungskräfte<br />
definiert, solide begründet auf psychologische<br />
Forschung und militärische Erfahrung,<br />
welche Eigenschaften einen guten<br />
Offizier ausmachen.<br />
Vor allem auf fünf Kriterien kommt es<br />
demnach an: Vertrauen, Selbstkontrolle,<br />
Urteilsvermögen, Selbstreflexion und Empathiefähigkeit.<br />
Treffender lässt sich nicht zusammenfassen,<br />
was Trump nicht hat. Johann Grolle<br />
www.spiegel-wissen.de<br />
Lesen Sie dazu:<br />
Hunde Ihr erstaunliches Einfühlungsvermögen<br />
Tierparks Sollte man Zoos abschaffen?<br />
Wölfe Die Rückkehr der grauen Jäger<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
115
Das deutsche Stromnetz …<br />
rund 326 000 km Freileitungen<br />
(überwiegend Hoch-, Mittel- und<br />
Niederspannungsmasten)<br />
sowie<br />
1,5 Millionen km Kabelleitungen<br />
davon<br />
2012 km<br />
8400 km<br />
Höchstspannung über 125000 Volt (V)<br />
Hochspannung über 72500 V bis 125000 V<br />
416 000 km Mittelspannung über 1000 V bis 72500 V<br />
1 071000 km<br />
Niederspannung bis 1000 V<br />
Viele Kabelleitungen sind jahrzehntealt.<br />
Erhöhter Stromfluss, etwa durch<br />
Millionen Ladestationen, würde die<br />
Niederspannungsleitungen erwärmen,<br />
ihre Ummantelung zermürben.<br />
Nettostromverbrauch 2016<br />
525 Milliarden Kilowattstunden<br />
davon<br />
Industrie<br />
246,5<br />
Gewerbe,<br />
Handel,<br />
Dienstleistungen<br />
139<br />
Verkehr<br />
11<br />
Haushalte<br />
128,5<br />
Versorgung bei hohem<br />
Leistungsbedarf aus dem<br />
Hoch- und Mittelspannungsnetz<br />
Blackout im Parkhaus<br />
Automobile Das Stromnetz ist zu schwach für einen starken Ausbau der Elektromobilität:<br />
Wenn Millionen Batterieautos auf den Straßen fahren, droht ein Zusammenbruch.<br />
116 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Vor dem Gesetz und an der Steck -<br />
dose sind alle Menschen gleich. Das<br />
erlebte kürzlich ein hochrangiger<br />
Stuttgarter Automanager, als er beschloss,<br />
seine private Garage für die Zukunft zu<br />
rüsten. Ein Stromanschluss mit 22 Kilowatt<br />
sollte an die Wand – stark genug, um handelsübliche<br />
E-Mobile in anderthalb bis<br />
zwei Stunden vollzutanken.<br />
<strong>Der</strong> Stromversorger sagte zu, doch nur<br />
unter einer Bedingung: Erst müssten die<br />
Straße und die Einfahrt vor dem Haus für<br />
die Verlegung eines stärkeren Kabels aufgerissen<br />
werden.<br />
<strong>Der</strong> Vorgang ist dem Betroffenen, Vorstandsmitglied<br />
eines großen deutschen Autokonzerns,<br />
unangenehm genug; deshalb<br />
erzählt er darüber mit der Bitte um Diskretion.<br />
Alle großen deutschen Fahrzeugproduzenten<br />
bekennen sich inzwischen offiziell<br />
zum Batteriemobil. Da sind solche<br />
Erfahrungsberichte unerwünscht.<br />
<strong>Der</strong> Mann hat erlebt, was jedem Bundesbürger<br />
in dieser Situation widerfahren<br />
dürfte, sofern er nicht gerade in einer Gewerbeimmobilie<br />
mit robusterer Verkabelung<br />
wohnt: Stromverbraucher dieser Größe<br />
schließt in Privathaushalten kein Elektriker<br />
ohne Rücksprache mit dem örtlichen<br />
Netzbetreiber an.<br />
So müssen in Stuttgart alle Verbraucher<br />
ab 4,6 Kilowatt angemeldet werden. An<br />
anderen Orten werden ähnliche Grenzen<br />
gesteckt. „Planungsbüros und Bauträger<br />
haben dieses Thema bei fast allen Neubauvorhaben<br />
auf dem Tisch“, sagt ein Prokurist<br />
einer süddeutschen Wohnungsbaugesellschaft.<br />
Auch er wünscht keine Namensnennung,<br />
da es reichlich Streit um dieses<br />
Thema gebe.<br />
Das Stromnetz ist nicht unerschöpflich,<br />
und für die politisch erwünschte Massenmotorisierung<br />
mit Batterieautos wird hier<br />
ein empfindlicher Engpass entstehen. Ohne<br />
das Aufladen des Fahrzeugs im privaten<br />
Haushalt kann Elektromobilität nicht funktionieren.<br />
Bislang sind die Ladezeiten zu<br />
lang, um wie bei dem Benzinauto rasch<br />
am Wegesrand tanken zu können.<br />
Menschen ohne Stellplatz oder Garage<br />
werden sich nicht einmal Gedanken über<br />
die Anschaffung eines Elektroautos machen;<br />
die anderen, und das sind durchaus<br />
einige Millionen Bürger, könnten bald<br />
E-Mobilisten werden. Sie sollten sich dann<br />
aber ein wenig mit den physikalischen Gesetzen<br />
und Zwängen beschäftigen, die hinter<br />
der Steckdose herrschen.<br />
Dort liegen Kabel, so dünn wie Bleistiftminen<br />
– die Endausläufer einer komplexen<br />
Versorgungsmaschinerie, die vom Kraftwerk<br />
über vier Spannungsebenen bis zur<br />
Nachttischlampe reicht und ohne Übertreibung<br />
als Arteriensystem modernen Wohlstands<br />
bezeichnet werden darf. Die höchste<br />
Ebene mit 380000 Volt dient dem Stromtransport.<br />
Auf der zweithöchsten (bis<br />
125000 Volt) werden industrielle Großabnehmer<br />
versorgt.<br />
Am unteren Ende gelangt der Strom<br />
zum Menschen – mit moderaten 230 Volt.<br />
Das mindert die Lebensgefahr beim versehentlichen<br />
Berühren offener Leitungen,<br />
setzt aber auch der nutzbaren Stromleistung<br />
niedrige Grenzen. Wird die zu hoch,<br />
erhitzt sich das Kabel. Bevor es durchglüht,<br />
springt die Sicherung raus.<br />
Doch schon ein unentwegtes Erwärmen<br />
im zulässigen Bereich lässt die Leitung altern.<br />
Die Isolierung wird brüchig. Es<br />
kommt zu Fehlströmen und Kurzschlüssen.<br />
Statt die übliche Lebensdauer von 50 Jahren<br />
und mehr zu erreichen, wird das Kabel<br />
schon nach 10 Jahren mürbe. Passiert das<br />
gelegentlich, ist es ein Ärgernis; passiert<br />
es unentwegt, entsteht ein volkswirtschaftliches<br />
Desaster.<br />
Ein Kupfer- und Aluminiumschatz von<br />
anderthalb Millionen Kabelkilometern liegt<br />
im Boden der Republik. Manche der noch<br />
heute stromführenden Leitungen wurden<br />
verlegt, als der Bundeskanzler Kurt Georg<br />
Kiesinger hieß. Die Netzbetreiber verstehen<br />
keinen Spaß mit ihrer teilhistorischen<br />
Infrastruktur. Zunehmend setzen sie dem<br />
Kunden daher Grenzen. Zu den schlimmsten<br />
Strom- und Kabelfressern zählen Durchlauferhitzer<br />
zur Warmwasserproduktion:<br />
einst als technischer Clou gepriesen, heute<br />
vielerorts nur noch mit Genehmigung installierbar.<br />
Sie fordern um die 20 Kilowatt<br />
aus der Leitung – etwa so viel wie der heimische<br />
Schnelllader fürs E-Mobil.<br />
Dass der keine Standardausstattung für<br />
die heimische Garage werden kann, mag<br />
den passionierten Stromfahrer noch nicht<br />
erschüttern. Gewöhnlich hat er die ganze<br />
Nacht Zeit für die Elektrobetankung. Da
Technik<br />
… und seine Schwachstelle<br />
sonstige elektrische<br />
Haushaltsgeräte<br />
Heizung<br />
Kochen,<br />
Trocknen,<br />
Bügeln,<br />
sonstige Prozesswärme<br />
Bei kompletter Umstellung des<br />
Pkw-Verkehrs auf Elektroantrieb<br />
würde sich der Stromverbrauch<br />
verdoppeln.<br />
Beleuchtung<br />
7% 4% 29%<br />
Knapp 41 Millionen Haushalte<br />
sind an das Niederspannungsnetz<br />
angeschlossen.<br />
Die gebräuchlichen 230-V-<br />
Anschlüsse erlauben keinen<br />
hohen Stromdurchfluss,<br />
Schnellladestationen für<br />
E-Autos überlasten die Kabel.<br />
Warmwasserbereitung<br />
Quellen: BDEW,<br />
AG Energiebilanzen,<br />
eigene Berechnung<br />
8%<br />
Wie sich der<br />
Stromverbrauch der<br />
12%<br />
Haushalte zusammensetzt<br />
128,5<br />
Mrd. Kilowattstunden<br />
17%<br />
Information,<br />
Kommunikation<br />
23%<br />
Kühl- und Gefriergeräte<br />
und sonstige Prozesskälte<br />
+ 128,4<br />
Mrd. Kilowattstunden<br />
Mehrbedarf*<br />
*Nettostromverbrauch für 45,8 Mio. Elektromobile bei<br />
Annahme einer gleichbleibenden durchschnittlichen<br />
Einzelfahrleistung von 14 015 km jährlich.<br />
reicht auch eine einfache Steckdose mit<br />
16-Ampere-Sicherung. Aus der lassen sich<br />
gut drei Kilowatt zapfen – genug, um auch<br />
größere Batterien über Nacht zu füllen.<br />
Und die meisten der heutigen E-Fahrer tun<br />
genau das.<br />
Doch auch dieser Bedarf ist keine Kleinigkeit.<br />
Über längere Zeiträume lägen in<br />
einem durchschnittlichen Haushalt maximal<br />
zwei Kilowatt an, erklärt Andreas Breuer,<br />
Technologiechef des Essener Netzbetreibers<br />
Innogy. Wenn nun massenhaft Ladegeräte<br />
das Anderthalbfache zusätzlich zapften,<br />
habe das „durchaus Netzrückwirkungen“.<br />
Eine sparsame Kleinfamilie, sagt Breuer,<br />
verbrauche gut 3000 Kilowattstunden pro<br />
Jahr. Schafft sich diese nun ein Elektroauto<br />
an und fährt damit 14000 Kilometer jährlich,<br />
was etwa dem Bundesdurchschnitt<br />
entspricht, wird sich (bei einem realistischen<br />
Verbrauch von 20 Kilowattstunden<br />
pro 100 Kilometer) der Strombedarf dieses<br />
Haushalts fast verdoppeln. <strong>Der</strong> massen -<br />
hafte Durchbruch der E-Mobilität wäre<br />
folglich eine Zerreißprobe für das Niederspannungsnetz.<br />
Würden Parkhäuser oder<br />
Tiefgaragen großer Wohnblocks an allen<br />
Stellplätzen nur mit simplen Standardsteckdosen<br />
ausgestattet – der Blackout<br />
wäre vorprogrammiert.<br />
Das weiß auch Stromexperte Breuer.<br />
Und doch sieht er keinen Grund, die Vi -<br />
sion von der Stromfahrt deshalb abzusagen.<br />
Innogy, mehrheitlich im Besitz des<br />
Stromriesen RWE, versteht sich wie der<br />
Dachkonzern durchaus als Unterstützer<br />
der Elektromobilität. „Die Sache“, hofft<br />
Breuer, „ist beherrschbar, denn es wird<br />
nicht alles auf einmal passieren.“<br />
Es komme nun darauf an, dem wachsenden<br />
Bedarf mit intelligenter Technik<br />
und nicht einfach mit einem stupiden Ausbau<br />
des Netzes zu begegnen. Einen Meter<br />
neuen Kabels einzugraben kostet auf dem<br />
Land etwa hundert Euro, in der Großstadt<br />
erheblich mehr. Eine flächendeckende<br />
Neuverdrahtung der Republik wäre unbezahlbar.<br />
Obendrein käme es allerorten zu<br />
Straßensperrungen. Die Elektromobilität<br />
würde zum größten Stauproduzenten aller<br />
Zeiten.<br />
Breuer empfiehlt deshalb, auch im<br />
Stromnetz dem Vorbild kluger Leitsysteme<br />
des Straßenwesens zu folgen: So wie diese<br />
den Verkehr ohne weitere Fahrspuren wieder<br />
harmonisch fließen lassen, könne eine<br />
„Orchestrierung der Stromflüsse“ Ähn -<br />
liches im bestehenden Kabelbaum bewirken:<br />
„Ein wichtiger Schlüssel ist die Vermeidung<br />
von Gleichzeitigkeit.“<br />
So schwebt dem Ingenieur eine Art Ampelschaltung<br />
für die Zapfpunkte in der Tiefgarage<br />
vor, die die Ladegeräte nach -<br />
einander freischaltet. Kaum jemand, glaubt<br />
er, fahre tagsüber so viel, dass er die ganze<br />
Nacht an die Steckdose müsste.<br />
Innogy hat bereits ein Steuergerät für<br />
ähnliche Zwecke entwickelt. Es trägt den<br />
Namen „Smart Operator“ und hat die Größe<br />
eines Autoradios. Erdacht wurde es ursprünglich<br />
zur Netzentlastung aus einem<br />
anderen Grund: dem übermäßigen Einspeisen<br />
volatilen Ökostroms.<br />
Die zeitweise extreme Förderung von<br />
Fotovoltaik führte zu einem Boom von<br />
Kleinanlagen, die durchweg das Niederspannungsnetz<br />
bedienen und zuweilen<br />
mehr Energie liefern, als dieses abführen<br />
kann. Innogy installierte drei Exemplare<br />
des Smart Operator in drei ländlichen Test -<br />
orten.<br />
Eines davon befindet sich im Trafohaus<br />
hinter dem Schulgebäude von Wincheringen,<br />
einem hübschen Dorf inmitten von<br />
Weinbergen an der Mosel. Er ist verbunden<br />
mit einer Wetterstation, 23 Haushalten,<br />
13 Solaranlagen und 2 Großakkus, die<br />
überschüssigen Strom zwischenbunkern<br />
können.<br />
Je nach Wetterprognose dirigiert das<br />
Steuergerät die Elektronenströme: Ist am<br />
Morgen wolkenloser Himmel zu erwarten,<br />
entleert es nachts nach Kräften die Akkus,<br />
um Speicherplatz zu schaffen für den sonst<br />
schwer verdaubaren Sonnensegen. Die Anlage<br />
habe alle Erwartungen erfüllt, erklärt<br />
Projektleiter Stefan Willing: „Wir können<br />
damit ohne Netzausbau 30 Prozent mehr<br />
Ökostrom nutzen als zuvor.“<br />
Ähnlich hilfreich könne ein solcher Puffer<br />
wirken, um Energievorschüsse zu bunkern,<br />
wenn später in einer Tiefgarage 20<br />
Autos gleichzeitig geladen werden sollen.<br />
Die Rechnung geht allerdings nur auf, wenn<br />
diese Anlagen samt ihren teuren Puffer -<br />
akkus am Ende nicht mehr kosten als dickere<br />
Kabel. Das Projekt Smart Operator,<br />
mit dem Innogy drei Dörfchen beglückte,<br />
verschlang allein acht Millionen Euro.<br />
Welchen Preis die Allgemeinheit für ein<br />
Stromnetz zahlen müsste, das Millionen<br />
Elektroautos störungsfrei versorgen soll,<br />
vermag noch niemand einzuschätzen. Fest<br />
steht, dass das Schnellladen von Autobatterien<br />
im eigenen Haushalt ein exotischer<br />
Luxus bleiben dürfte.<br />
<strong>Der</strong> Stuttgarter Automanager schlug das<br />
Angebot des Stromversorgers aus, eigens<br />
für ihn eine bessere Leitung legen zu<br />
lassen.<br />
Seine Branche hat genug Affären am<br />
Hals. Da wollte er nicht auch noch als privilegierter<br />
Starkstromtanker ins Gerede<br />
kommen.<br />
Christian Wüst<br />
Video: Die Krux mit<br />
dem Stromspeicher<br />
spiegel.de/sp432017stromnetz<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
117
Szene aus Bangarra-Stück<br />
„OUR land people stories“<br />
Tanz<br />
Verjagt, verscharrt und entwurzelt<br />
VISHAL PANDEY<br />
<strong>Der</strong> Künstlerische Direktor der<br />
australischen Tanzkompanie<br />
Bangarra, Stephen Page, 52,<br />
über die Massaker an den Urein -<br />
wohnern seines Landes und<br />
den Versuch, ihren Geist in der<br />
Kunst zu beleben<br />
SPIEGEL: Welche Geschichte<br />
erzählt Bangarra?<br />
Page: Unser Land hat kein<br />
Narrativ wie „Schindlers Liste“<br />
oder ein Curriculum, das<br />
in den Schulen die rund<br />
65 000-jährige Geschichte der<br />
schwarzen Ureinwohner<br />
lehrt, die von den Briten gejagt<br />
und in Massengräbern<br />
verscharrt, die Überlebenden<br />
entwurzelt und in Reservate<br />
gepfercht wurden. Die Tänzer<br />
vermitteln Geschichten<br />
über die Beziehung der Ureinwohner<br />
zum Leben, zu ihrem<br />
Land – die philosophischspi<br />
rituellen Prinzipien ihrer<br />
Lebenskultur.<br />
SPIEGEL: Was ist denn die Botschaft?<br />
Page: Erst 1967 wurden die<br />
Aborigines durch ein Referendum<br />
als Menschen anerkannt.<br />
Davor galten sie als Wilde,<br />
die zur Flora und Fauna des<br />
Landes zählten. Es geht uns<br />
bei all dem darum, ihr Vermächtnis<br />
darzustellen und<br />
ihre Vergangenheit auferstehen<br />
zu lassen.<br />
SPIEGEL: Als Tänzer, der<br />
selbst Wurzeln im Nunukul-<br />
Stamm hat, sind Sie seit<br />
Gründung der Gruppe 1989<br />
dabei. Was treibt Sie an?<br />
Page: Ich betrachte mich als<br />
Geschichtenerzähler. Natürlich<br />
geht es auch um Versöhnung,<br />
um Kontaktaufnahme<br />
mit diesem Erbe, um ein neues<br />
Denken und, in diesen modernen<br />
Zeiten, um die Stärkung<br />
eines gemeinsamen<br />
Geistes.<br />
SPIEGEL: Was werden die Zuschauer<br />
bei Ihren Gastspielen<br />
in Bonn und Berlin zu sehen<br />
bekommen?<br />
Page: In Bonn präsentieren<br />
wir nun eine Art von Best-of-<br />
Programm und die Verbindung<br />
der Ureinwohner mit<br />
den Elementen. In Berlin<br />
wird es die Geschichte der<br />
Ankunft der Briten in Australien<br />
sein, die Massaker, die<br />
geschahen, aus der Perspek -<br />
tive jener, die sie erlitten<br />
haben. suk<br />
Literatur<br />
Zwischen Drogerie und Bäckerei<br />
Die Schriftstellerin Nora Bossong, 35, über das Treffen einer Art Gruppe 47, die keine sein will<br />
Es gibt keine Handynummer, aber irgendwo soll ein Schild<br />
sein mit der Aufschrift Gruppe 47. Wie früher also. Und tatsächlich,<br />
da steht sie, die Reisegruppe, über die ich vor Jahren<br />
meine erste Uniprüfung abgelegt habe und die nun am Infopoint<br />
des Nürnberger Hauptbahnhofs wartet. Den meisten<br />
der Schriftstellerinnen und Schriftsteller bin ich längst begegnet,<br />
einigen persönlich, vielen durch ihre Texte, doch in der<br />
Gruppe, da kann Hans Magnus Enzensberger mit noch so jungenhaftem<br />
Charme die Bedeutung der Gruppe relativieren,<br />
wirkt es zumindest auf mich dann eben doch – wie ein Mythos,<br />
etwas skurril zwischen Drogerie und Bäckerei platziert.<br />
Dort, wo 1967 die alte Pulvermühle stand und Studenten gegen<br />
die „Papiertiger“ demonstrierten, hängen heute bunte<br />
Lichterketten, die Lesungen sind auf verschiedene Orte in der<br />
Kleinstadt verteilt. Es ist keine Tagung, kein Wiederaufleben<br />
der Gruppe, was 50 Jahre später stattfindet; das anzunehmen<br />
wäre auch verstiegen. Vieles, was durch sie entstanden ist,<br />
lebt ohnehin, wenn auch gewandelt, im Literaturbetrieb fort,<br />
anderes hatte seine Funktion in einer bestimmten Zeit und<br />
lässt sich nicht in die Gegenwart übertragen. Manche Fragen<br />
kann man natürlich immer wieder stellen: wie literarische<br />
Spracharbeit und politische Reflexion zueinander stehen, wie<br />
man sich als Intellektuelle Gehör verschafft, ob sich einsame<br />
Schreibarbeit mit einer Gruppe verträgt. Die Antworten sind<br />
heute andere als 1947 oder 1967. Sich in der Provinz zu treffen<br />
aber scheint mir trotz Lichterkette zeitgemäßer denn je – in<br />
einer „Ersatz-Hauptstadt“, um der Aufgeregtheit Berlins zu<br />
entkommen.<br />
118 DER SPIEGEL 43 / 2017
Kultur<br />
Sachbücher<br />
Kein Spiel<br />
mehr<br />
Buchmesse Leipzig<br />
2009: „Kein Störer<br />
und kein Krakeeler“<br />
am Stand, notiert der<br />
rechte Verleger Götz<br />
Kubitschek frustriert.<br />
Normalität als Nightmare,<br />
da lässt sich der<br />
Triumph kaum ermessen,<br />
den Kubitschek<br />
nun in Frankfurt feierte.<br />
Störer am Stand,<br />
alle Medien schrieben<br />
Filme<br />
Königin des Kinos<br />
Per Leo,<br />
Maximilian<br />
Steinbeis,<br />
Daniel-Pascal<br />
Zorn<br />
mit Rechten<br />
reden.<br />
Ein Leitfaden<br />
Klett-Cotta;<br />
184 Seiten;<br />
14 Euro.<br />
Wer nach einer sicheren<br />
Geldanlage sucht, kann<br />
schon jetzt darauf wetten,<br />
dass die britische Schauspielerin<br />
Sally Hawkins im nächsten<br />
Jahr beim Oscar-Rennen<br />
dabei ist. Denn die 41-Jährige<br />
brilliert in gleich zwei Filmen.<br />
Im Fantasy-Drama „Shape of<br />
Water“, das auf dem Festival<br />
von Venedig den Goldenen<br />
Löwen gewann und Anfang<br />
nächsten Jahres anlaufen<br />
wird, spielt sie zutiefst berührend<br />
eine stumme Putzfrau,<br />
die sich in ein Monster verliebt.<br />
Und in der Filmbiografie<br />
Maudie (Regie: Aisling<br />
Walsh), die schon jetzt ins<br />
Kino kommt, verkörpert sie<br />
die 1970 verstorbene kanadische<br />
Künstlerin Maud Lewis,<br />
die seit ihrer Kindheit an<br />
schwerer Arthritis litt und<br />
über ihn. Aber ist das richtig?<br />
Per Leo, Maximilian Steinbeis<br />
und Daniel-Pascal Zorn<br />
haben „Mit Rechten reden“<br />
geschrieben, eine Art Antwort,<br />
und sie haben Kubi -<br />
tschek durchschaut: Sein Lebenselixier<br />
ist die Aufmerksamkeit.<br />
„Egal, was Rechte<br />
sagen oder schreiben, sie<br />
denken ihren Gegner mit“,<br />
sie schlügen mit dem „Hämmerlein<br />
auf die Moralsehne,<br />
und wenn das Empörungsschenkelchen<br />
brav zuckt“,<br />
ergötzten sie sich daran. Klarer<br />
und schöner kann man es<br />
kaum sagen. Das Buch mutet<br />
Linken und „Nicht-Rechten“<br />
viel zu, entlarvt feige Sprachlosigkeit<br />
und moralische<br />
Selbstgefälligkeit<br />
und ruft zur Offenheit<br />
auf: „<strong>Der</strong> andere<br />
könnte Recht haben.“<br />
Liegt es aber am<br />
heterogenen Autorenkollektiv,<br />
dass das<br />
Buch trotzdem oft<br />
so flach ausfällt?<br />
„Rechts“, steht da, sei<br />
„keine eingrenzbare<br />
Menge von Überzeugungen<br />
oder Personen,<br />
sondern eine bestimmte<br />
Art des Redens“.<br />
Ein arg schlanker<br />
Fuß in Zeiten, da sogar<br />
Sahra Wagenknecht mal<br />
rechts klingt. <strong>Der</strong> rechte Prototyp<br />
im Buch ist ein tumbes<br />
Strichmännchen, Debatten<br />
mit ihm lesen sich so, wie<br />
man sich Konflikte mit Lieblingsfeinden<br />
ausmalt: <strong>Der</strong><br />
Nicht-Rechte ist stets siegreich<br />
– er denkt ja die Worte<br />
des Gegners mit. Aber echte<br />
Rechte denken selbst. Noch<br />
ärger ist die Kernbotschaft<br />
des Buchs an die Rechten:<br />
Eure „Meinungen, Überzeugungen<br />
und Ideen stellen für<br />
uns gar kein Problem dar“.<br />
Doch, verdammt! Die Ruhe<br />
von 2009 ist vorbei. Das ist<br />
kein Spiel mehr. ama<br />
dennoch eine populäre Ma -<br />
lerin wurde. Die Kunst von<br />
Hawkins besteht darin, auf<br />
jede mitleidheischende Geste<br />
zu verzichten. Sie macht aus<br />
den beiden behinderten Frauen<br />
starke Charaktere, stille<br />
Kämpferinnen. Irgendwann<br />
vergisst der Zuschauer bei<br />
„Maudie“, dass die Malerin<br />
gehandicapt ist. Gebannt<br />
schaut er ihr dabei zu, wie<br />
sie mit allem malt, was sie<br />
noch bewegen kann, notfalls<br />
mit den Lippen. lob<br />
Gemälde von Maud Lewis<br />
COURTESY OF THE ART GALLERY OF NOVA SCOTIA<br />
Nils Minkmar Zur Zeit<br />
Das perfekte Mahl<br />
Einmal sorgte ich in einem Bahnabteil in<br />
Frankreich für milde Panik. Eine gemischte<br />
Gruppe von Mitreisenden<br />
hatte sich zu mir gesetzt, vertieft in<br />
Fachgespräche. Sie kam von einem<br />
Kongress für Deutschlehrer. Nach einer<br />
Weile erst bemerkte man meine<br />
deutsche Zeitung und konnte darauf<br />
schließen, dass ich Deutsch verstehe, am<br />
Ende sogar spreche. Diese Erkenntnis sorgte für anhaltendes<br />
Schweigen, denn bei all ihren unbestrittenen pädagogischen<br />
und germanistischen Kenntnissen – nun spontan<br />
Deutsch zu sprechen, noch dazu vor Kollegen, das trauten<br />
sie sich schlicht nicht.<br />
Wenn sogar die Lehrer selbst es vermeiden, die von<br />
ihnen unterrichtete Fremdsprache tatsächlich zu sprechen,<br />
werden es die Schüler kaum lernen. Franzosen um<br />
die Fünfzig haben unter Umständen sechs Schuljahre lang<br />
Deutsch gelernt, können aber kaum elementare Konversation<br />
betreiben. So kommen wir zu einem Europa, in<br />
dem der französische Präsident in der Frankfurter Universität<br />
auf Englisch begrüßt wird. Auch der Französischunterricht<br />
in Deutschland funktioniert nicht besonders gut.<br />
Die Kinder lernen Jahr um Jahr sogenannte Grundlagen,<br />
um eines fernen Tages den perfekten, nach Tempus und<br />
Kasus fein arrangierten Satz zu formulieren: „Ich werde<br />
wünschen, das von meinem Onkel zubereitete Mahl genossen<br />
zu haben.“ Bis dahin fragen sie sich still, ob<br />
Froschschenkel zur Vorspeise gereicht wurden. Das Ziel<br />
scheint zu sein, dass deutsche Schüler, wenn sie groß sind,<br />
reden wie die Figur eines Proust-Romans. Französische<br />
Schüler ergreifen dann idealerweise mit 18 das deutsche<br />
Wort und klingen wie ein preußischer Beamter, der nach<br />
Feierabend Gedichte schreibt. Vorher sagen sie kaum<br />
einen Mucks. Aber man lernt Sprachen so nicht, übrigens<br />
auch nichts anderes: Man kocht nicht eines Tages das<br />
perfekte Mahl, nachdem man jahrelang nur Rezepte studiert<br />
hat.<br />
Kleinkinder beginnen irgendwann zu sprechen, ohne<br />
einen Schimmer von Grammatik zu haben. Sie lernen,<br />
weil ihre Eltern, Geschwister und andere Kinder mit ihnen<br />
reden und sich über jede Äußerung freuen. Fehler<br />
werden erwartet und gewürdigt – Hauptsache, das Kind<br />
sagt was. Es gibt keinen Punktabzug, wenn die Südfrucht<br />
nur Nane heißt. Ein Sprachunterricht, der auf Fehlervermeidung<br />
basiert, ist bloß abgesessene Zeit. Die Großen<br />
machen es uns vor: Montaigne schrieb seine Essays munter<br />
drauflos, oft diktierte er sie auch – ohne Grammatik<br />
oder Orthografie. Shakespeare schrieb seinen eigenen Namen<br />
in unterschiedlichen Schreibweisen. Und einer der<br />
erfolgreichsten britischen Publizisten unserer Zeit, der im<br />
vergangenen Jahr verstorbene A. A. Gill, konnte wegen<br />
einer Schreibschwäche nicht mal eine E-Mail fehlerfrei<br />
schreiben. Es war völlig egal. In früheren Zeiten mochte<br />
als Hindernis gelten, dass man keine Personen des anderen<br />
Landes in den Klassenraum bekam. Heute skypen<br />
Menschen aus allen Erdteilen miteinander, es wäre ein<br />
Klacks, deutsche und französische Schüler regelmäßig zu<br />
verbinden, damit sie tun, was sie auch nach der Schule<br />
unablässig praktizieren: beherzt loslabern.<br />
An dieser Stelle schreiben Nils Minkmar und Elke Schmitter im Wechsel.<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
119
Kultur<br />
„Autor der totalen Schlaffheit“<br />
SPIEGEL-Gespräch Die fremde Nähe zwischen Deutschland und Frankreich, die letzten<br />
Zuckungen der Linken, sein heroischer Pessimismus – Michel Houellebecq zieht Bilanz.<br />
Sein Verschwinden hatte er schriftlich angekündigt:<br />
Zu seinem letzten Interview empfing<br />
Frankreichs prominentester und umstrittenster<br />
Schriftsteller Houellebecq, 61, während der<br />
Buchmesse Ende voriger Woche in seinem<br />
Hotel zimmer. <strong>Der</strong> Autor sprach, wie von ihm<br />
gewohnt, ernsthaft und zögerlich, rauchte ununterbrochen<br />
und schenkte sich spanischen<br />
Rotwein ein. Im Schauspiel Frankfurt hatte er<br />
zwei Tage zuvor einen improvisierten Vortrag<br />
über den Zustand der europäischen Kultur gehalten.<br />
Er habe vor Kurzem beschlossen, so<br />
hatte er dem SPIEGEL geschrieben, seine Einlassungen<br />
in der Öffentlichkeit einzustellen.<br />
Für die Frankfurter Buchmesse und den<br />
SPIEGEL mache er eine Ausnahme: Er finde<br />
es ziemlich gut, dass sein letztes Interview<br />
„dans mon magazine préféré“ (in seinem Lieblingsmagazin)<br />
erscheine.<br />
SPIEGEL: Monsieur Houellebecq, Sie sind<br />
zugleich ein Starautor und ein Skandal -<br />
autor, der bewundert, geliebt und verabscheut<br />
wird. In Deutschland sieht man in<br />
Ihnen den radikalsten Schriftsteller unserer<br />
Zeit, einen schonungslosen Diagnostiker<br />
des Leidens und der Einsamkeit des modernen<br />
Individuums. In Frankreich gelten<br />
Sie vielen als Provokateur und Schmuddel -<br />
literat und stehen im Mittelpunkt unzäh -<br />
liger Polemiken. Wie verstehen Sie diesen<br />
Unterschied?<br />
Houellebecq: Schwer zu sagen, ich habe keine<br />
schlüssige Erklärung. Vielleicht ertragen<br />
die Deutschen, von der Geschichte und<br />
der in ihr angehäuften Schuld unvergleichlich<br />
viel schlimmer mitgenommen, den<br />
Blick in den <strong>Spiegel</strong> besser. Es kann sein,<br />
dass man mich in Frankreich nicht liebt,<br />
weil man die Gesellschaft und die Wirklichkeit,<br />
die Dürftigkeit und das Elend der<br />
Moderne, die ich beschreibe, nicht liebt.<br />
Man darf aber nicht den Radiologen für<br />
das Entstehen des Krebsgeschwürs verantwortlich<br />
machen. Frankreich schätzt die<br />
Epoche nicht, in der es lebt.<br />
SPIEGEL: Büßen Sie persönlich für die Negativität<br />
Ihrer Romanfiguren?<br />
Houellebecq: Die französischen Journalisten<br />
sind oft wie besessen von der Frage,<br />
wie viel von mir in meinen Protagonisten<br />
steckt. Deshalb schnüffeln sie in meiner<br />
Biografie und sogar in meiner Unterwäsche.<br />
Sie sind die moralischen Hohepriester<br />
einer Zeit ohne Religion und Moral.<br />
Sie wollen haftbar machen, zur Rechenschaft<br />
ziehen, verurteilen und bestrafen.<br />
120 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Deshalb versucht man, mich als Nihilisten<br />
und Reaktionär abzustempeln. Man erhebt<br />
mich zum Propheten, um mir anzulasten,<br />
was kommt. Meiner Erfahrung<br />
nach sind die deutschen Journalisten viel<br />
ernsthafter bei der Sache, wenn sie ein<br />
Buch vorstellen. Man soll sich vor Allgemeinheiten<br />
hüten, ich jedenfalls habe sehr<br />
viel weniger schlechte Erfahrungen mit<br />
deutschen als mit französischen Journalisten<br />
gemacht.<br />
SPIEGEL: Danke für das Kompliment, aber…<br />
Houellebecq: Bin ich deprimiert, oder ist<br />
die Welt deprimierend? Für die deutschen<br />
Medien scheint die Unterscheidung klar,<br />
für die französischen werde ich mich wohl<br />
nie von der Sünde der Verzweiflung los -<br />
sagen können. Ich ziehe die Medien an,<br />
weil ich medienuntauglich bin.<br />
SPIEGEL: Sind Sie ein germanophiler Autor?<br />
Houellebecq: Ja, schon. Jedenfalls habe ich<br />
eine bessere Kenntnis der deutschen Literatur<br />
und Philosophie als die meisten meiner<br />
Kollegen.<br />
SPIEGEL: Wie kam es dazu?<br />
Houellebecq: Als einen der ersten Deutschen<br />
habe ich Friedrich Nietzsche gelesen.<br />
Seine Geisteskraft imponierte mir, obwohl<br />
ich seine Philosophie unmoralisch und abstoßend<br />
fand. Ich hätte gern sein Fundament<br />
zertrümmert, wusste aber nicht, wie<br />
ich es intellektuell anstellen sollte. Als ich<br />
25 oder 27 Jahre alt war, entdeckte ich<br />
Arthur Schopenhauer – eine Erleuchtung,<br />
eine wirkliche Erschütterung. Auch liebe<br />
ich die deutschen Romantiker sehr, Novalis,<br />
Kleist vor allem. Die deutsche Romantik<br />
verbreitete sich damals so unwiderstehlich<br />
wie der Rock ’n’ Roll in den Fünfzigerjahren.<br />
Zu Recht.<br />
SPIEGEL: Sie haben für Ihre Hommage an<br />
Schopenhauer Passagen aus seinem Werk<br />
selbst ins Französische übersetzt*. Aber<br />
Sie sprechen kein Deutsch?<br />
„Eine Religion, ein<br />
wahrer Glaube, ist sehr<br />
viel mächtiger in der<br />
Wirkung auf die Köpfe<br />
als eine Ideologie.“<br />
Houellebecq: Ich traue mich nicht, nicht<br />
mehr. Ich könnte keine ordentlichen deutschen<br />
Sätze bilden. Aber ich könnte unter<br />
Umständen Deutsch lesen, wenn ich nicht<br />
so ein Faulpelz wäre.<br />
SPIEGEL: In der Europäischen Union sind<br />
Deutschland und Frankreich so aufeinander<br />
fixiert wie keine anderen Länder. Aber<br />
jenseits aller rituellen Freundschaftsbezeugungen<br />
– wie weit kennen sich die beiden<br />
Nationen wirklich, die man gern als<br />
unzertrenn liches Paar beschreibt?<br />
Houellebecq: In Frankreich redet man über<br />
Deutschland mehr als über alle anderen<br />
europäischen Länder zusammengenommen.<br />
Das ist verblüffend. Doch ich glaube,<br />
die Deutschen kennen die Franzosen besser<br />
als umgekehrt, schon weil sie öfter<br />
nach Frankreich kommen als die Franzosen<br />
nach Deutschland.<br />
SPIEGEL: Damit meinen Sie aber jetzt die<br />
Touristen und nicht die Truppen des Kaisers<br />
oder der Wehrmacht?<br />
Houellebecq: Wieder ein Beispiel dafür,<br />
dass der Deutsche sich selbst misstraut.<br />
Nein, was ich meine, das geht viel weiter<br />
als der gewöhnliche Tourismus. Viele Deutsche<br />
kaufen sich eine Wohnung oder ein<br />
Haus und lassen sich in Frankreich nieder.<br />
Die Franzosen wissen dagegen wenig von<br />
den Deutschen. Sie sind von ihnen beeindruckt,<br />
aber sie beneiden sie nicht. Deshalb<br />
ist die Beziehung ziemlich gut, obwohl<br />
der Vergleich der beiden Länder immer<br />
zum Nachteil Frankreichs ausfällt. Die<br />
übertriebene Selbstentwertung der Franzosen<br />
bringt sie nicht dazu, die Deutschen<br />
zu hassen, sondern sich selbst zu verachten.<br />
SPIEGEL: Das betrifft allenfalls die Wirtschaftskraft,<br />
nicht die kulturelle Ausstrahlung.<br />
Frankreich ängstigt sich vor dem industriellen<br />
Niedergang.<br />
Houellebecq: Das ist keineswegs eine eingebildete<br />
Gefahr.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> französische Philosoph und<br />
Kulturanthropologe René Girard hat das<br />
Verhältnis beider Länder zueinander seit<br />
Napoleon und Clausewitz als „mimetische<br />
Rivalität“ beschrieben, die ständigen Konfliktstoff<br />
erzeuge.<br />
Houellebecq: Das überzeugt mich nicht. <strong>Der</strong><br />
Blick auf Deutschland hält die Franzosen<br />
dazu an, sich zu berappeln. Das war schon<br />
* Michel Houellebecq: „In Schopenhauers Gegenwart“.<br />
Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. DuMont;<br />
76 Seiten; 18 Euro.
TIM WEGNER / DER SPIEGEL<br />
Schriftsteller Houellebecq: „Die lateinische Art eben, ermüdend“<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 121
Houellebecq beim SPIEGEL-Gespräch*: „Die deutschen Autoren sollten sich dem erotischen Roman zuwenden“<br />
TIM WEGNER / DER SPIEGEL<br />
nach der Niederlage von 1871 so. Sie sind<br />
sich des Umstands bewusst, nicht ernsthaft,<br />
nicht tüchtig genug zu sein. Sie erleben<br />
sich als dem lateinischen Raum zugehörig,<br />
also als zweitklassig.<br />
SPIEGEL: Aber lateinisch sind sie doch auch!<br />
Houellebecq: Darüber kann man streiten.<br />
Die Franzosen sehen sich seit einigen Jahren<br />
als kaum besser als die Griechen.<br />
Frankreich ist zwischen dem Norden und<br />
dem Süden Europas hin und her gerissen.<br />
Kein ausgeglichenes Land. Zerknirschung<br />
und Prahlerei liegen nah beieinander.<br />
SPIEGEL: In der Kultur ist der Auftritt ziemlich<br />
glanzvoll, wie man gerade auf der<br />
Frankfurter Buchmesse feststellen konnte.<br />
Houellebecq: Die Literatur ist aber nicht<br />
das wichtigste Anliegen für die Mehrheit<br />
der Bevölkerung. Viele Länder sind stolz<br />
auf ein nationales Schmuckstück. Nehmen<br />
Sie die Automobilindustrie. Es ist so,<br />
dass ein Franzose, der Geld hat, ich zum<br />
Beispiel, kaum ein französisches Auto<br />
kaufen wird. Was würde geschehen, wenn<br />
die deutsche Autoindustrie zusammen -<br />
bräche?<br />
SPIEGEL: Eine nationale Katastrophe!<br />
Houellebecq: Und eine der nationalen Moral<br />
obendrein, weil sie ein Symbol deutscher<br />
Tüchtigkeit ist und daher an das<br />
Selbstwertgefühl rührt. Die Amerikaner<br />
können es sich dagegen leisten, ihre Autohersteller<br />
in die Zweitklassigkeit absinken<br />
zu lassen.<br />
122 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
SPIEGEL: In Ihren Romanen, in „Karte und<br />
Gebiet“ oder „Unterwerfung“, beschreiben<br />
Sie liebevoll die schönen deutschen<br />
Limousinen und SUVs, die Ihr Erzähler<br />
fährt. Haben PS-starke deutsche Autos es<br />
Ihnen angetan?<br />
Houellebecq: Ich habe ja eine Ingenieursausbildung.<br />
Ich fahre gern Auto, die französischen<br />
Autobahnen sind ausgezeichnet,<br />
die deutschen inzwischen weniger. Aber<br />
was ich eigentlich sagen will: Es gibt bestimmte<br />
nationale Symbole, die kein Land<br />
fallen lassen würde. Dazu gehört für die<br />
USA die kulturelle Vorherrschaft. Eher<br />
würden sie das Silicon Valley zusammenbrechen<br />
lassen oder an China verscherbeln<br />
als Hollywood. Man kann den Amerikanern<br />
vieles vorwerfen, aber entgegen allen<br />
gängigen Vorurteilen wissen sie um die hegemoniale<br />
Bedeutung der Kultur. So seltsam<br />
es ist, die europäischen Länder, die<br />
so stolz auf ihre alte Kultur sind, scheinen<br />
sie manchmal zu vergessen.<br />
SPIEGEL: In der Literatur kann Europa doch,<br />
anders als im Film, ganz gut mithalten?<br />
Houellebecq: Haben Sie den Auftritt eines<br />
Erfolgsautors wie Dan Brown auf der<br />
Buchmesse erlebt? Was für ein Aufwand,<br />
was für eine Bugwelle! Die Europäer lesen<br />
ihre jeweiligen nationalen Autoren und ansonsten<br />
überwiegend Übersetzungen aus<br />
* Mit dem Redakteur Romain Leick in einem Hotelzimmer<br />
in Frankfurt am Main.<br />
dem Englischen. Sie lesen einander zu<br />
wenig. Aber ganz sicher wird es Europa<br />
nicht geben, wenn es keine europäische<br />
Kultur gibt. Und der europäischen Kultur<br />
geht es derzeit nun einmal nicht sonderlich<br />
gut.<br />
SPIEGEL: Die USA haben begriffen, was für<br />
ein Machtmittel die Kultur ist?<br />
Houellebecq: Die amerikanische Kultur<br />
hat zum Zusammenbruch des Sowjetkommunismus<br />
mehr beigetragen als der Rüstungswettlauf<br />
des Kalten Kriegs oder die<br />
Verlockungen der Konsumgesellschaft.<br />
Wenn zu Gorbatschows Zeiten amerikanische<br />
Filme anliefen, bildeten sich endlose<br />
Warteschlangen vor den Kinos in<br />
Russland.<br />
SPIEGEL: Könnte die amerikanische, überhaupt<br />
die westliche Kultur auch über den<br />
Islam triumphieren?<br />
Houellebecq: Es ist meine tiefe persönliche<br />
Überzeugung, dass eine Religion, ein wahrer<br />
Glaube, sehr viel mächtiger in der Wirkung<br />
auf die Köpfe ist als eine Ideologie.<br />
<strong>Der</strong> Kommunismus war eine Art falsche<br />
Religion, ein schlechter Ersatz, kein wahrer<br />
Glaube, obwohl er sich so inszenierte,<br />
mitsamt einer eigenen Liturgie. Eine Religion<br />
ist sehr viel schwieriger zu zertrümmern<br />
als ein politisches System. Die Religion<br />
hat eine Schlüsselfunktion in der Gesellschaft<br />
und für deren Zusammenhalt,<br />
sie ist ein Motor der Gemeinschaftsbildung.<br />
<strong>Der</strong> Islam wird widerstehen.
Kultur<br />
SPIEGEL: Was kann das säkulare, laizistische<br />
Europa, in dem das Christentum mehr und<br />
mehr verblasst, dagegen aufwenden?<br />
Houellebecq: Es gibt eine bemerkenswerte<br />
Wiederkehr des Katholizismus in Frankreich.<br />
Es ist ein Phänomen, das ich fühle,<br />
ohne es wirklich zu verstehen, und es ist<br />
weniger reaktionär, als vielfach behauptet<br />
wird. Getragen wird es zum Beispiel von<br />
den sogenannten Charismatikern, die ihre<br />
Gottesdienste in Happenings, in Gefühlsergüsse<br />
verwandeln, wie es auch Pfingstler<br />
oder Evangelikale tun. Die Demonstrationen<br />
gegen die Ehe für alle und das Adoptionsrecht<br />
für gleichgeschlechtliche Paare<br />
haben die Politik durch ihre Massenmobilisierung<br />
überrascht. Niemand hätte derlei<br />
für möglich gehalten. Die Katholiken in<br />
Frankreich sind sich ihrer Stärke so wieder<br />
bewusst geworden. Das war wie eine unterirdische<br />
Strömung, die plötzlich zutage<br />
trat. Für mich einer der interessantesten<br />
Momente in der jüngsten Geschichte.<br />
SPIEGEL: Wie erklären Sie diesen Moment?<br />
Houellebecq: Ich neige immer dazu, die<br />
Dinge materialistisch zu erklären, was zunächst<br />
etwas platt und abstoßend wirken<br />
mag: Tatsache ist, dass gläubige Katholiken<br />
mehr Kinder in die Welt setzen. Und sie<br />
vermitteln den Kindern ihre Werte. Das<br />
heißt, ihre Zahl wird zunehmen.<br />
SPIEGEL: Das scheint arg biologisch gedacht.<br />
Selbst Papst Franziskus meinte, Katholiken<br />
müssten sich nicht vermehren wie die Karnickel.<br />
Davon abgesehen rebellieren Kinder<br />
oft gegen ihre Eltern.<br />
Houellebecq: Sie irren sich. Die 68er waren<br />
die Ausnahme, historisch betrachtet.<br />
SPIEGEL: Die muslimischen Einwanderer -<br />
familien sind im Schnitt auch kinderreicher<br />
als die einheimischen.<br />
Houellebecq: Ganz genau. Deshalb wird der<br />
Anteil der Muslime an der Bevölkerung in<br />
Westeuropa weiter wachsen, in Frankreich<br />
wie in Deutschland. Und das wird die<br />
Ängste vor Überfremdung und Kolonisierung<br />
immer weiter nähren.<br />
SPIEGEL: Mit welchen Folgen?<br />
Houellebecq: Das weiß ich nicht. Vielleicht<br />
gelingt die Integration, obwohl diese ja<br />
immer Separation zunächst voraussetzt.<br />
Aber auch ein Bürgerkrieg liegt im Bereich<br />
des Möglichen, wie ich es in meinem<br />
Roman „Unterwerfung“ beschrieben habe.<br />
Ich bin übrigens der Meinung, dass die<br />
Integration der Muslime sehr viel besser<br />
funktionieren würde, wenn der Katholizismus<br />
Staats religion wäre. Mit dem zweiten<br />
Platz als respektierte Minderheit in einem<br />
erklärt katholischen Staat würden sich die<br />
Mus lime sehr viel leichter abfinden als mit<br />
dem jetzigen Schwebezustand. Womit sie<br />
nämlich nicht zurechtkommen, sind die<br />
säkulare Gesellschaft und der laizistische<br />
Staat, der eine Religionsfreiheit vertritt,<br />
die sie nicht verstehen und die sie als<br />
Instrument der Religionsbekämpfung<br />
empfinden – was sie in Frankreich, historisch<br />
gesehen, auch war. Da können die<br />
Muslime noch so tief in den Koran hin -<br />
einsteigen, sie finden keine Anleitung für<br />
den Umgang damit. <strong>Der</strong> Prophet Mohammed<br />
konnte sich überhaupt nicht vor -<br />
stellen, dass es so etwas wie einen Atheisten<br />
gibt.<br />
SPIEGEL: In der Flüchtlingskrise haben französische<br />
und andere europäische Politiker<br />
den Deutschen unterstellt, nach der moralischen<br />
Vorherrschaft in Europa zu greifen.<br />
Was sind für Sie deutsche Tugenden?<br />
Houellebecq: Ich hänge das viel tiefer. Die<br />
Deutschen sind einfach bei Weitem besser<br />
organisiert, das ist ein Unterschied wie Tag<br />
und Nacht. Ich habe die Erfahrung bei meinen<br />
Besuchen selbst gemacht: Die Deutschen<br />
planen rational, die Franzosen lassen<br />
es bis zum Schluss darauf ankommen, dass<br />
es schon gut gehen wird. Die lateinische<br />
Art eben. Ermüdend.<br />
SPIEGEL: Mit Verlaub, deutsche Disziplin,<br />
ist das nicht ein albernes Klischee?<br />
Houellebecq: So? Ihr Problem ist, dass<br />
Deutschland sein eigenes Klischee nicht<br />
mag. Deshalb versuchen die Deutschen<br />
seit geraumer Zeit, die Vorstellung ihrer<br />
selbst als seriöse, kompetente, gut organisierte<br />
Leute zu widerlegen.<br />
SPIEGEL: Was auch unschwer gelingt. Vielleicht<br />
mögen die Deutschen sich jenseits<br />
des Klischees ja selbst nicht?<br />
Houellebecq: Sie wären gern Italiener! Die<br />
Italiener haben jedenfalls keine Schwierigkeiten<br />
mit ihren Klischees, sie lieben sie.<br />
SPIEGEL: Die Deutschen wären gern ein liebenswertes<br />
Volk.<br />
Houellebecq: Aber ich habe nicht den Eindruck,<br />
dass die Franzosen die Deutschen<br />
nicht lieben. Sie lieben sie jedenfalls mehr<br />
als die Engländer. Wenn ein Deutscher sich<br />
in einem französischen Dorf ein Haus<br />
kauft, schmeißt man ihm in der Regel nicht<br />
die Scheiben ein, obwohl die Dörfler, besonders<br />
in der Provence, nicht wirklich zugänglich<br />
oder aufnahmebereit gegenüber<br />
Fremden sind. Die Deutschen geben sich<br />
ja auch meistens viel Mühe mit den Einheimischen.<br />
Nein, glauben Sie mir, Sie sind<br />
in Frankreich keine ungeliebten Gäste.<br />
SPIEGEL: Ist das Verhältnis nicht immer<br />
zwiespältig gewesen, gerade auch im politischen<br />
Umgang? Die Deutschen werden<br />
„Dass Deutschland<br />
nun eine rechtsextreme<br />
Partei im Parlament<br />
hat, beweist, dass es<br />
normal wird.“<br />
als ökonomisches Vorbild dargestellt, doch<br />
man sucht auch eifrig nach Schwachstellen<br />
im deutschen Modell. <strong>Der</strong> extremen Linken<br />
unter Jean-Luc Mélenchon wie der extremen<br />
Rechten unter Marine Le Pen dient<br />
die Kanzlerin als willkommene Buhfrau.<br />
Houellebecq: Das stimmt. Berlin übernimmt<br />
die Funktion des Sündenbocks. <strong>Der</strong> wahre<br />
Zorn gilt der Brüsseler Eurokratie, für die<br />
die deutsche Regierung den Kopf hinhalten<br />
muss. Ich habe nie daran geglaubt, dass<br />
der nationale Souveränitätswille vergehen<br />
würde. Die Vereinigten Staaten von<br />
Europa wird es nie geben, da verfolgte<br />
man lange eine Schimäre. Um es unverblümt<br />
zu sagen: Die Unabhängigkeitsbestrebungen<br />
setzen sich auf mittlere und<br />
längere Sicht immer durch.<br />
SPIEGEL: Also demnächst in Katalonien?<br />
Sie kennen Spanien, Sie haben eine Zeit<br />
lang dort gelebt.<br />
Houellebecq: Ja, die Katalanen werden gewinnen.<br />
<strong>Der</strong> Wunsch nach Unabhängigkeit<br />
erlischt nie. Er kann zwischendurch einschlafen,<br />
aber er wird wieder aufwachen.<br />
Auch in Schottland. Die Zentralregierung<br />
in Madrid hat dagegen keine Chance. Sie<br />
sollte die Katalanen ziehen lassen.<br />
SPIEGEL: Frankreich ist das Gegenbeispiel<br />
– ein zentralistischer Staat, der alle Regionalismen<br />
erfolgreich unterbunden hat.<br />
Selbst Korsen und Basken halten still.<br />
Houellebecq: Momentan ja. <strong>Der</strong> Wille zur<br />
Macht, den das Königshaus der Kapetinger<br />
aufgebracht hat, ist in der Geschichte absolut<br />
außergewöhnlich. Persönlich bedaure ich<br />
den Sieg des Zentralismus ein wenig, aber<br />
Fakt ist, dass Frankreich eine Einheit ist und<br />
immer bleiben wird. Das ist eine politische<br />
und zivilisatorische Leistung, die nur wenigen<br />
Nationen gelungen ist. Deutschland gehört<br />
nicht dazu. Deshalb kann ich mir auch<br />
nicht vorstellen, dass Frankreich jemals ein<br />
föderales Europa akzeptieren wird.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> neue Präsidenten Emmanuel<br />
Macron will sich an die Spitze einer europäischen<br />
Erneuerung setzen. Gibt er damit<br />
Frankreich sein verlorenes Selbstbewusstsein<br />
wieder?<br />
Houellebecq: Die Stimmung ändert sich.<br />
<strong>Der</strong> Hang zur Selbstgeißelung lässt nach.<br />
Ob das nachhaltig ist, hängt vom wirtschaftlichen<br />
Erfolg ab. Macron hatte während<br />
der Wahlkampagne eigentlich nur ein<br />
einziges Thema, das im Grunde gar kein<br />
Sachthema war: eine Ode an den Optimismus.<br />
Diese Beschwörung hat gewirkt,<br />
dank seiner Jugend und seiner atypischen<br />
Persönlichkeit.<br />
SPIEGEL: Ist die Stimmung in Frankreich<br />
gar nicht so skeptisch, wie es den Anschein<br />
hat und wie auch Sie zu glauben scheinen?<br />
Houellebecq: Das Verhältnis der Franzosen<br />
zu Europa ist völlig paradox. Das muss<br />
man betonen, denn es ist erstaunlich: Die<br />
Franzosen sind gegen Europa, aber für den<br />
Euro. Warum? Allein aus dem Grund, dass<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
123
Romancier Houellebecq: „Nicht Teil des Geschäfts der Meinungsproduktion“<br />
TIM WEGNER / DER SPIEGEL<br />
sie sich selbst nicht trauen. Sie sind überzeugt,<br />
dass sie ohne den Euro und seine<br />
Sicherheit im Schlamassel versinken werden,<br />
dass die Schulden ihnen über den<br />
Kopf wachsen. Sie betrachten sich nicht<br />
als fähige Haushälter, und vielleicht stimmt<br />
das ja auch, die Zahlen scheinen es zu bestätigen.<br />
Es ist eine unsinnige Haltung: Sie<br />
wollen den Euro, aber am liebsten ohne<br />
die Zwänge, die mit ihm einhergehen.<br />
SPIEGEL: Worin gründet die Faszination, die<br />
Macron über Frankreich hinaus ausübt?<br />
Houellebecq: Er ist ein seltsamer Mensch. Ich<br />
habe ihn einmal interviewt, als er noch Finanzminister<br />
war, bevor seine Sammlungsbewegung<br />
„En Marche!“ richtig in Gang<br />
gekommen war. Und am Ende dieses Gesprächs<br />
fand ich ihn immer noch genau so<br />
seltsam, irgendwie ungreifbar. Man versteht<br />
nicht wirklich, was er denkt. Er lässt sich<br />
nicht entschlüsseln. Man kann ihm keine klar<br />
formulierte Überzeugung entlocken. Mein<br />
Eindruck ist, dass er sich auf seinen eigenen<br />
Optimismus reduziert. Er hypnotisiert sich<br />
selbst und im selben Zug fast das ganze Land.<br />
Insofern war seine Wahlkampagne eine Ansteckungskampagne.<br />
Atemberaubend!<br />
SPIEGEL: Kann er damit Frankreich und der<br />
EU wirklich neuen Schwung einhauchen,<br />
zusammen mit der drögen Frau Merkel,<br />
die sich gegen Visionen sträubt?<br />
Houellebecq: Ich bezweifle es. Die depressive<br />
Stimmung kommt von der Allgegenwart<br />
der Ökonomie, der erdrückenden<br />
124 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Übermacht wirtschaftlicher Rationalität.<br />
Dafür steht Deutschland, auch im Denken<br />
von Macron. Die Ökonomie macht aber<br />
nicht glücklich. Man wird umso unglück -<br />
licher, je mehr man an sie denkt. Europa<br />
hat ein sentimentales Problem. Es löst<br />
kaum noch positive Emotionen aus.<br />
SPIEGEL: Wie also weiter?<br />
Houellebecq: Macron probiert es mit Grandezza,<br />
er ruft Europa auf: Mir nach! <strong>Der</strong><br />
Versuch lohnt sich. Immer weniger Franzosen<br />
erinnern sich an Charles de Gaulle,<br />
aber die Nostalgie des Gaullismus ist ihnen<br />
geblieben. Eine gewisse Höhe der politischen<br />
Führung, ein bisschen Großsprecherei,<br />
republikanischer Glanz, das gefällt, damit<br />
kann man verführen.<br />
SPIEGEL: Und Deutschland?<br />
Houellebecq: Wie ich schon sagte, die Deutschen<br />
lieben ihre eigenen Vorzüge nicht, zu<br />
Unrecht. Dass Deutschland jetzt eine rechtsextreme<br />
Partei im Parlament hat, beweist,<br />
dass es beginnt, in Europa ganz normal zu<br />
werden, mit normalen Sorgen und Interessen.<br />
Man könnte fast sagen, dass das eine gute<br />
Nachricht ist. Die Deutschen werden doch<br />
nicht 300 Jahre in Sack und Asche gehen!<br />
SPIEGEL: So könnte auch die AfD reden.<br />
Houellebecq: Daran ist nichts Gefährliches,<br />
jedenfalls nicht mehr und nicht weniger<br />
als anderswo.<br />
SPIEGEL: Macron hat mit seiner Wahl eine<br />
breite, neue bürgerliche Mitte konstituiert.<br />
Zugleich beginnt sich der Widerstand gegen<br />
seine Reformpolitik zu verstärken.<br />
Steht Frankreich an einem Wendepunkt?<br />
Houellebecq: Die Linke liegt jedenfalls im<br />
Sterben, ihre Ideen sind tot, trotz eines<br />
Volkstribuns wie Mélenchon und seiner<br />
unbestreitbaren Wortgewalt. Die Wahrheit<br />
ist, dass es in Frankreich nur noch die Rechte<br />
und die extreme Rechte gibt. Die Linke<br />
hat ihre Mobilisierungskraft verloren.<br />
SPIEGEL: Auch unter den Intellektuellen, unter<br />
denen der Marxismus bis in die jüngste<br />
Zeit quicklebendig war?<br />
Houellebecq: Übrig geblieben ist nur noch<br />
ein Altlinker wie Alain Badiou. Das ist alles.<br />
Die Wiese ist abgegrast.<br />
SPIEGEL: Und Didier Eribon, der in Deutschland<br />
einen großen Erfolg mit seiner „Rückkehr<br />
nach Reims“ erzielt hat und erklärt,<br />
dass Macron nicht sein Präsident sei?<br />
Houellebecq: Ach ja, ich hätte fast vergessen,<br />
dass es ihn auch noch gibt. In der Tat.<br />
SPIEGEL: Haben Sie ihn gelesen?<br />
Houellebecq: Nein. Ich habe den Marxismus<br />
sterben sehen. Ich habe immer gesagt, dass<br />
Romane die Welt nicht verändern können.<br />
Aber Solschenizyns „Archipel Gulag“ von<br />
1973 hat die Welt verändert. Das Buch war<br />
ein Donnerschlag in Frankreich. Für den<br />
Marxismus läutete das Sterbeglöcklein.<br />
SPIEGEL: Frankreich galt lange als nicht<br />
reformierbar. Kann Macron wirklich das<br />
Gegenteil beweisen?<br />
Houellebecq: Ich glaube schon. Es gibt noch<br />
Klassen in Frankreich, aber der Klassen-
Kultur<br />
kampf findet nicht mehr statt. Die Wähler<br />
sind viel weniger blöd und verantwortungslos,<br />
als die Medien sie gern schildern. Sie<br />
wissen, dass die Schulden und die Defizite<br />
nicht endlos steigen können. Deshalb bezweifle<br />
ich, dass hinter dem linken Widerstand<br />
noch eine große soziale Kraft steht.<br />
SPIEGEL: Ist die Deutungshoheit endgültig<br />
nach rechts gewandert? Die Figur des engagierten,<br />
radikalen, Feuer spuckenden Intellektuellen<br />
gibt es ja noch in Frankreich.<br />
Houellebecq: Ich kann nicht sagen, ob die<br />
Rechte den Kampf der Ideen gewonnen<br />
hat. Die Medien, die Journalisten stehen<br />
überwiegend noch immer auf der Seite<br />
der Linken. Auf der anderen Seite gab es<br />
aufsehenerregende Bucherfolge rechter<br />
Autoren wie Éric Zemmour über Frankreichs<br />
angeblichen Selbstmord oder Alain<br />
Finkielkraut über die unglückliche Iden -<br />
tität. Die Intellektuellen spielen immer<br />
noch ihre Rolle in Frankreich, aber ihr Typus<br />
verändert sich.<br />
SPIEGEL: Sie begreifen sich nicht als Intellektuellen?<br />
Houellebecq: Nein. Ich bin es objektiv nicht,<br />
weil ich die Kriterien nicht erfülle. Ich leite<br />
keine Verlagsreihe, bin kein bestallter Kolumnist,<br />
habe kein öffentliches Exerzierfeld.<br />
Ich bin nicht Teil des Geschäfts der<br />
Meinungsproduktion.<br />
SPIEGEL: In Ihren Romanen finden sich viele<br />
theoretische Überlegungen wie Essays<br />
zur Geschichte. Sie bringen gern soziologische<br />
und ökonomische Ausführungen in<br />
den Erzählfluss ein.<br />
Houellebecq: Als Schriftsteller bin ich auch<br />
Soziologe und Ökonom. Das ist gut so.<br />
<strong>Der</strong> Roman ist heute das bevorzugte Instrument<br />
der Gesellschaftskritik. Den theoretischen<br />
Essayisten, den Gesellschaftswissenschaften<br />
und der Philosophie ging nach<br />
Denkern wie Bourdieu, Deleuze, <strong>Der</strong>rida,<br />
Foucault der Atem aus. Zurzeit kommt da<br />
nicht viel. Die „French Theory“ hat sich<br />
überlebt. Wenn man mich einen Gesellschaftskritiker<br />
oder einen Soziologen<br />
nennt, meint man es als Kritik an meiner<br />
Erzählkunst, an meinem angeblich literarisch<br />
ungenügenden Stil. Aber ich fasse<br />
das als Kompliment auf. Literatur ohne<br />
Ideen, Stil als reine Kunst ist nicht meine<br />
Sache. Die Verfechter einer puristischen,<br />
schönen, reinen Literatur sind Gaukler,<br />
die keine Wahrheit zu sagen haben. Dem<br />
französischen Roman geht es gegenwärtig<br />
gut, weil er den Kontakt zur Realität der<br />
Gesellschaft und zum konkreten Leben<br />
hält.<br />
SPIEGEL: Französische Autoren werden in<br />
Deutschland gern gelesen. Umgekehrt werden<br />
sehr viel weniger deutsche ins Französische<br />
übersetzt. Inwieweit kennen Sie<br />
die zeitgenössische deutsche Literatur?<br />
Houellebecq: Diese Frage bringt mich in<br />
Verlegenheit. Ich kenne Thomas Bernhard<br />
und Peter Handke, zwei Österreicher übrigens,<br />
und danach nichts mehr. Übersetzungen<br />
sollten in Europa stärker öffentlich<br />
gefördert werden.<br />
SPIEGEL: Damit lässt sich das Interesse des<br />
Publikums nicht erzwingen. Ist den Franzosen<br />
die deutsche Wirklichkeit nach der<br />
Wiedervereinigung einfach zu weit weg?<br />
Houellebecq: Ich gebe den deutschen Autoren<br />
einen guten Rat: Sie sollten sich dem<br />
erotischen Roman zuwenden. Die Deutschen<br />
sind ja Großmeister der privaten<br />
pornografischen Produktion im Internet.<br />
Da befindet sich eine Lücke, die zu füllen<br />
wirklich Aussicht auf Erfolg, auch kommerziellen,<br />
verspricht. Und das meine ich<br />
nur halb im Scherz. Das Interesse in Frankreich<br />
wäre vorhanden.<br />
SPIEGEL: Ihr Thema ist die Schwierigkeit,<br />
wahre Liebe zu finden. Sie sind der literarische<br />
Erforscher der Nöte und Ängste der<br />
Mittelschicht, die um ihren Status in der<br />
Gesellschaft kämpft. Schauen Sie gar nicht<br />
auf die Welt der ganz Reichen und der<br />
ganz Armen?<br />
Houellebecq: Doch, nur kenne ich die untere<br />
Mittelschicht eben am besten. Ich bin<br />
in meinen literarischen Mitteln leider etwas<br />
beschränkter als Balzac, der die ganze<br />
menschliche Komödie abbilden wollte. Ich<br />
habe Hunderte Notizseiten und Aufzeichnungen<br />
über einen Banker angefertigt, der<br />
mir sein Leben erzählte, einen wichtigen<br />
Mann aus der Finanzwelt, der zu meinen<br />
treuen Lesern gehört. Ich habe nichts daraus<br />
gemacht, und ich glaube nicht, dass<br />
ich es noch tun werde.<br />
SPIEGEL: Und was ist mit dem anderen<br />
Ende der sozialen Leiter? Wer befasst sich<br />
mit dem Frankreich von ganz unten?<br />
Houellebecq: Das ist eine Schwäche, davon<br />
gibt es zu wenig in der literarischen Produktion<br />
der Gegenwart. Ich habe schon<br />
seit einiger Zeit das Gefühl, dass der Kriminalroman<br />
auf diesem Gebiet der allgemeinen<br />
Literatur voraus ist. <strong>Der</strong> französische<br />
Krimi ist sehr gut geworden. Früher<br />
hatten seine Autoren eine linke Grundhaltung.<br />
Das hat sich geändert. Die Grenzen<br />
des Genres sind gesprengt. Es gibt inzwischen<br />
sogar Krimis ganz ohne Polizei, man<br />
stelle sich vor. Ich halte das für einen Ausdruck<br />
von geschärftem Realismus: Es gibt<br />
tatsächlich Zonen, aus denen die Ordnungsmacht<br />
praktisch verschwunden ist.<br />
„Meine Intuition<br />
befindet sich<br />
gewissermaßen auf<br />
der Suche unterhalb<br />
des Vernünftigen.“<br />
SPIEGEL: Ist Frankreich, in dem der Ausnahmezustand<br />
herrscht, nicht schon fast ein<br />
Polizeistaat?<br />
Houellebecq: Da fragen Sie mal die Polizisten.<br />
Ich habe mit vielen gesprochen, weil<br />
ich nach den Anschlägen auf die Satirezeitschrift<br />
„Charlie Hebdo“ im Januar 2015 ein<br />
Jahr lang Polizeischutz genoss. Die Polizei<br />
ist hochgradig unzufrieden, ihre Mittel und<br />
ihre Ausrüstung sind unzulänglich, sie hat<br />
den Eindruck, dass der Staat teilweise kapituliert<br />
und ganze Territorien aufgegeben hat.<br />
Meiner Meinung nach hat sie nicht unrecht.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> französische Roman war mit<br />
Balzac und Zola schon im 19. Jahrhundert<br />
fest in der sozialen Realität verankert. Erhalten<br />
Sie diese Tradition aufrecht?<br />
Houellebecq: Die Messlatte liegt sehr hoch.<br />
Das ist ein Ruhmeskapitel der französischen<br />
Literaturgeschichte. Balzac wollte<br />
wirklich die ganze Gesellschaft abbilden,<br />
und er hat es beinahe geschafft. Zola führte<br />
die Recherche, die Dokumentation in den<br />
Roman ein. Und Maupassant befasste sich<br />
auch mit Menschen, die ganz unten angekommen<br />
waren.<br />
SPIEGEL: Fehlt heute dagegen ein Marcel<br />
Proust, der sich den höheren Ständen widmete?<br />
Houellebecq: Proust gelang eine feine Gesellschaftsanalyse.<br />
Was die Leser bei ihm<br />
lieben, ist die raffinierte Boshaftigkeit, mit<br />
der er die Zusammenkünfte und Konversationen<br />
der sogenannten besseren Kreise<br />
beschreibt. Bei ihm steht nicht die menschliche,<br />
sondern die mondäne Komödie im<br />
Mittelpunkt.<br />
SPIEGEL: Neben Ihnen beschäftigt sich eine<br />
Erfolgsschriftstellerin mit den Nöten der<br />
Mittelschicht: Yasmina Reza. Teilen Sie mit<br />
ihr die Vorliebe für die Tragödien der Banalität?<br />
Houellebecq: Wir schätzen einander sehr.<br />
Aber meine Personen sind noch kaputter.<br />
Sie beschreibt Paare, die sich bekriegen<br />
und zerreißen. Bei mir gibt es nicht einmal<br />
mehr dafür genug Leidenschaft. Ich bin<br />
der Autor der totalen Schlaffheit.<br />
SPIEGEL: Dennoch glauben Sie an die Möglichkeit<br />
der Liebe?<br />
Houellebecq: Ja. Ich kann mich mit der Idee<br />
der Unbeständigkeit, der Flüchtigkeit nicht<br />
abfinden. Darin liegt ein heroischer Pessimismus.<br />
Man sollte sich nicht zu viele<br />
Illusionen über das Leben machen. Das<br />
Schwinden, das Überwinden aller Illusionen<br />
ist nicht unbedingt etwas Schlimmes,<br />
es ist im Gegenteil ein gesunder Pessimismus,<br />
der allerdings eine Portion Heldenmut<br />
erfordert. Das habe ich bei Schopenhauer<br />
gefunden. Philosophisch ist diese Haltung<br />
nicht weit vom Buddhismus entfernt.<br />
SPIEGEL: <strong>Der</strong> auch für Sie, wie für Schopenhauer,<br />
eine Verlockung war?<br />
Houellebecq: Ja, aber es war nur ein Moment,<br />
der vorübergegangen ist. Ich glaube, ich<br />
bin zu romantisch, um buddhistisch zu sein.<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
125
Kultur<br />
Das Nachrichten-Magazin<br />
für Kinder.<br />
Jetzt testen:<br />
„Dein SPIEGEL“ digital<br />
Mehr Infos unter<br />
www.deinspiegel.de/info<br />
SPIEGEL: Schopenhauer liebte seinen Pudel,<br />
Sie liebten Ihren Corgi Clément. Sie haben<br />
ihm sogar ein Denkmal gesetzt. Haben Sie<br />
sich wieder einen Hund angeschafft?<br />
Houellebecq: Nein, ich lebe ja seit einigen<br />
Jahren in Paris, und Paris ist für Hunde<br />
die Hölle. Das ist ein Skandal. Überall ist<br />
der Zutritt für Hunde verboten. Wozu gibt<br />
es öffentliche Parkanlagen, wenn Hunde<br />
nicht hineindürfen? Frankreich ist in dieser<br />
Hinsicht ein äußerst ärgerliches Land, mit<br />
einer lachhaften Leidenschaft für die Regulierung<br />
des täglichen Lebens.<br />
SPIEGEL: Ein finsteres und von der Verwaltungsbürokratie<br />
beherrschtes Land, haben<br />
Sie einmal geschrieben.<br />
Houellebecq: Das stimmt mehr denn je, und<br />
auch Macron wird daran nichts ändern.<br />
SPIEGEL: Offenkundig haben Sie eine anarchistische<br />
Seite. Ihre Romane sind subversiv,<br />
aber im intellektuellen Diskurs werden<br />
Sie als Neoreaktionär stigmatisiert. Macht<br />
Ihnen das was aus?<br />
Houellebecq: Ich war zufrieden damit, es<br />
war fast eine Ehre, denn ich befand mich<br />
damit in guter Gesellschaft. Das Wort neoreaktionär<br />
jagt heute in Frankreich keinem<br />
mehr einen Schrecken ein. Die Linke ist<br />
hierzulande wirklich bösartig geworden.<br />
Man wird jedes Mal angeklagt, wenn man<br />
etwas sagt. Man wird unter Beobachtung<br />
gestellt. Die linken Gesinnungswächter<br />
sind seit einiger Zeit wahrhaft unausstehlich<br />
geworden. Sie verhalten sich wie ein<br />
Tier, das in der Falle sitzt und fühlt, dass<br />
es bald zu Ende ist.<br />
SPIEGEL: Auch wenn es Ihnen schmeichelt,<br />
als reaktionär gescholten zu werden, so<br />
sind Sie doch ebenso wenig eine Ikone der<br />
Rechten.<br />
Houellebecq: Die Bourgeoisie mag mich<br />
nicht, weil sie sich durch mich besudelt<br />
fühlt – zu viel Sex –, und die harte, eingefleischte<br />
Rechte mag mich nicht, weil ich<br />
ihre Heldenverehrung ganz und gar nicht<br />
teile. Ich bin nicht der neue Louis-Ferdinand<br />
Céline. Ich möchte um keinen Preis<br />
so schreiben wie Céline, sein Stakkato, seine<br />
Atemlosigkeit, seine Punktierung, sein<br />
Stil – das alles gefällt mir überhaupt nicht.<br />
SPIEGEL: Anders als Céline hassen Sie nicht.<br />
Houellebecq: Ich bin nicht einmal aggressiv.<br />
Die kulturelle Rechte in Frankreich lehnt<br />
mich ab, weil ich nicht zu ihren Husaren<br />
oder Neohusaren gehöre. Ich stehe überhaupt<br />
nicht in ihrer Tradition, die bis in<br />
die Vierzigerjahre zurückreicht. Viele von<br />
ihnen waren Kollaborateure wie Céline<br />
oder Paul Morand, ein übler Dreckskerl.<br />
SPIEGEL: Lässt sich die in Deutschland wie<br />
in Frankreich wiederentdeckte Bewunderung<br />
für Albert Camus damit erklären,<br />
dass er schon früh eine nicht marxistische,<br />
humanistische Linke vertrat?<br />
Houellebecq: Da es mit dem Marxismus und<br />
Sartre vorbei ist, bleibt Camus als Galionsfigur<br />
eines linken Milieus, das noch immer<br />
126 DER SPIEGEL 43 / 2017
über seine Machtpositionen in den Medien<br />
und im öffentlichen Diskurs verfügt. Mein<br />
Fall ist er nicht, ehrlich gesagt. Seine Theaterstücke<br />
sind grottenschlecht, in den Romanen<br />
finden sich einige schöne Sätze,<br />
viel mehr nicht, und seine Philosophie des<br />
Absurden ist idiotisch; sie reicht nicht an<br />
Samuel Beckett heran.<br />
SPIEGEL: Glauben Sie an die Renaissance<br />
der europäischen Kultur?<br />
Houellebecq: Ich würde sie mir wünschen.<br />
Wenn ich an die europäische Kultur glaube,<br />
so doch nicht an die europäische politische<br />
Union. Eine Kultur kann ohne Staat<br />
existieren. Es gab eine deutsche Kultur -<br />
nation, bevor es einen deutschen National -<br />
staat gab, und vielleicht wäre es besser gewesen,<br />
wenn es so geblieben wäre. Gleiches<br />
gilt für Italien. Es ist ein Irrweg,<br />
Europa über die politische Union zusammenzuführen.<br />
Die Kulturgemeinschaft<br />
wäre vielversprechender. <strong>Der</strong> kulturelle<br />
Imperialismus der angelsächsischen Welt<br />
lässt sich nicht bestreiten. Da rede ich ausnahmsweise<br />
wie ein Linker.<br />
SPIEGEL: Sie haben vor diesem Gespräch<br />
angekündigt, dass es Ihr letztes Interview<br />
sein werde. Warum haben Sie sich entschieden,<br />
in der Öffentlichkeit künftig zu<br />
schweigen?<br />
Houellebecq: Ich bin mir bewusst geworden,<br />
dass ich das, was ich wirklich gern sagen<br />
möchte, nicht wirklich ausdrücken kann.<br />
Es gibt sehr viele Dinge, die mich bewegen,<br />
aber zu wenig rational sind, als dass ich<br />
sie formulieren könnte. Meine Intuition<br />
befindet sich gewissermaßen auf der Suche<br />
unterhalb des Vernünftigen.<br />
SPIEGEL: Das klingt sehr geheimnisvoll. Sie<br />
verstummen nicht aus politischen Gründen,<br />
um Auseinandersetzungen aus dem<br />
Weg zu gehen oder Bedrohliches zu vermeiden?<br />
Houellebecq: Die Scherereien, die ich bekommen<br />
könnte oder schon bekommen<br />
habe, sind nebensächlich. Es geht vielmehr<br />
um formale, um ästhetische Formen und<br />
Betrachtungen. Das, worüber man schreiben<br />
kann, erstreckt sich viel weiter als das,<br />
worüber man sprechen kann.<br />
SPIEGEL: Wird es bald einen neuen Roman<br />
von Ihnen geben?<br />
Houellebecq: Ich arbeite daran. Ich weiß<br />
nicht, wie lange es noch dauern wird, aber<br />
ja, es wird einen neuen Roman geben. Ich<br />
bin nur noch nicht weit genug, um das<br />
Ende absehen zu können.<br />
SPIEGEL: Und vor allem kein Wort über den<br />
Inhalt?<br />
Houellebecq: Bloß nicht!<br />
SPIEGEL: Monsieur Houellebecq, wir danken<br />
Ihnen für dieses letzte Gespräch.<br />
Video:<br />
Das letzte große Interview?<br />
spiegel.de/sp432017houllebecq<br />
oder in der App DER SPIEGEL<br />
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom Fachmagazin „buchreport“ (Daten: media control);<br />
nähere Informationen finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller<br />
Belletristik<br />
1 (1) Dan Brown<br />
Origin<br />
2 (–) Daniel Kehlmann<br />
Tyll<br />
Rowohlt; 22,95 Euro<br />
Daniel Kehlmann erzählt, wie<br />
der Hass nach Deutschland<br />
kam – eine Geschichte aus<br />
dem Dreißigjährigen Krieg mit<br />
leider aktuellen Anklängen<br />
3 (15) Robert Menasse<br />
Die Hauptstadt<br />
4 (–) Kerstin Gier<br />
Wolkenschloss<br />
5 (2) Ken Follett<br />
Das Fundament der Ewigkeit<br />
6 (4) Maja Lunde<br />
Die Geschichte der Bienen<br />
7 (3) Jo Nesbø<br />
Durst<br />
8 (5) Marc-Uwe Kling<br />
QualityLand<br />
9 (–) Cassandra Clare<br />
Lord of Shadows<br />
10 (8) Sven Regener<br />
Wiener Straße<br />
Lübbe; 28 Euro<br />
Suhrkamp; 24 Euro<br />
Fischer; 20 Euro<br />
Lübbe; 36 Euro<br />
btb; 20 Euro<br />
Ullstein; 24 Euro<br />
Ullstein; 18 Euro<br />
Goldmann; 19,99 Euro<br />
Galiani; 22 Euro<br />
11 (6) Walter Moers Prinzessin<br />
Insomnia & der alptraumfarbene<br />
Nachtmahr<br />
Knaus; 24,99 Euro<br />
12 (9) David Lagercrantz<br />
Verfolgung<br />
Heyne; 22,99 Euro<br />
13 (10) Mariana Leky Was man von<br />
hier aus sehen kann DuMont; 20 Euro<br />
14 (7) Elena Ferrante Die Geschichte<br />
der getrennten Wege Suhrkamp; 24 Euro<br />
15 (11) Elena Ferrante Meine<br />
geniale Freundin<br />
Suhrkamp; 22 Euro<br />
16 (19) Leïla Slimani<br />
Dann schlaf auch du Luchterhand; 20 Euro<br />
17 (–) Salman Rushdie<br />
Golden House<br />
18 (12) Paulo Coelho<br />
<strong>Der</strong> Weg des Bogens<br />
19 (13) Carmen Korn<br />
Zeiten des Aufbruchs<br />
20 (14) Marion Poschmann<br />
Die Kieferninseln<br />
C. Bertelsmann; 25 Euro<br />
Diogenes; 18 Euro<br />
Kindler; 19,95 Euro<br />
Suhrkamp; 20 Euro<br />
Sachbuch<br />
1 (1) Peter Wohlleben Das geheime<br />
Netzwerk der Natur Ludwig; 19,99 Euro<br />
2 (2) Axel Hacke Über den Anstand in<br />
schwierigen Zeiten und die<br />
Frage, wie wir miteinander umgehen<br />
Kunstmann; 18 Euro<br />
3 (12) Ranga Yogeshwar Nächste Ausfahrt<br />
Zukunft Kiepenheuer &Witsch; 22 Euro<br />
4 (4) Peter Wohlleben Das geheime<br />
Leben der Bäume Ludwig; 19,99 Euro<br />
5 (3) Thorsten Schulte<br />
Kontrollverlust<br />
6 (19) Gregor Gysi<br />
Ein Leben ist zu wenig<br />
Kopp; 19,95 Euro<br />
Aufbau; 24 Euro<br />
7 (–) Gerald Hüther Raus aus der<br />
Demenz-Falle!<br />
Arkana; 18 Euro<br />
8 (7) Andreas Michalsen Heilen mit<br />
der Kraft der Natur Insel; 19,95 Euro<br />
9 (–) Karsten Brensing Das Mysterium<br />
der Tiere<br />
Aufbau; 22 Euro<br />
10 (8) Yuval Noah Harari<br />
Homo Deus<br />
C.H. Beck; 24,95 Euro<br />
11 (5) Susanne Fröhlich / Constanze Kleis<br />
Kann weg! Gräfe und Unzer; 17,99 Euro<br />
12 (17) Christian Peter Dogs / Nina Poelchau<br />
Gefühle sind keine Krankheit<br />
13 (–) Rolf Dobelli Die Kunst des<br />
guten Lebens<br />
14 (11) Flake Heute hat die<br />
Welt Geburtstag<br />
S. Fischer; 20 Euro<br />
<strong>Der</strong> laute Rammstein-Mann<br />
ganz leise: Keyboarder<br />
Flake hat über sein Leben<br />
geschrieben, melancholisch<br />
und von zarter Schönheit<br />
Ullstein; 20 Euro<br />
Piper; 20 Euro<br />
15 (9) Eckart von Hirschhausen Wunder<br />
wirken Wunder Rowohlt; 19,95 Euro<br />
16 (–) Reinhold Messner<br />
Wild<br />
S. Fischer; 20 Euro<br />
17 (10) Souad Mekhennet Nur wenn<br />
du allein kommst C.H. Beck; 24,95 Euro<br />
18 (20) Ijoma Mangold<br />
Das deutsche Krokodil Rowohlt; 19,95 Euro<br />
19 (–) Thomas Middelhoff<br />
A115 – <strong>Der</strong> Sturz<br />
LangenMüller; 24 Euro<br />
20 (14) Ulrich Wickert Frankreich muss man<br />
lieben, um es zu verstehen<br />
Hoffmann und Campe; 22 Euro<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 127
Debatte Auf der Frankfurter Buchmesse kam es in der vorvergan -<br />
genen Woche zu Tumulten, die Polizei musste eingreifen: das Ende<br />
oder die Unterbrechung einer Tradition der diskursiven Auseinan -<br />
dersetzung? Zwei Analysen einer Situation, in der Rat losigkeit<br />
und Zorn herrschen – und Uneinigkeit darüber, wie man mit rechts -<br />
extremen Positionen und Personen umgehen soll.<br />
<strong>Der</strong> kommende Kulturkampf<br />
Die radikale Rechte weiß, mit welchen Gegnern sie es zu tun hat.<br />
Von Tobias Rapp<br />
Wenn am Dienstag der Bundestag zu seiner konstituierenden<br />
Sitzung zusammentritt, wird der<br />
Altliberale Hermann Otto Solms, 76, ihn mit einer<br />
Rede eröffnen. Bislang kam diese Ehre immer dem ältesten<br />
Abgeordneten zu. Doch der älteste Volksvertreter<br />
ist nun Wilhelm von Gottberg, 77, ein AfD-Rechtsaußen<br />
aus Niedersachsen. Um ihn als Alterspräsidenten zu verhindern,<br />
änderte der Bundestag im Juni flugs seine Geschäftsordnung:<br />
<strong>Der</strong> dienstälteste Abgeordnete soll es nun<br />
machen. Das wäre Wolfgang Schäuble, 75, der wird aber<br />
voraussichtlich Bundestagspräsident, also gab er die Eröffnung<br />
an Solms ab.<br />
Das ist nur der Anfang. In den kommenden Wochen<br />
gibt es eine Menge Posten zu besetzen und eine Menge<br />
Büros neu zu verteilen. Immer wird eine Frage im Raum<br />
stehen, auf die es keine einfache Antwort gibt: Wie gehen<br />
wir mit den Rechten um? Ausgrenzen?<br />
Normal behandeln? Nach den<br />
Regeln spielen oder die Regeln ändern?<br />
Was tun, wenn jemand im<br />
Plenum provoziert, was ganz bestimmt<br />
passieren wird? Protestieren,<br />
argumentieren, ignorieren?<br />
Nicht nur im Bundestag macht man<br />
sich darüber Gedanken. Landtagsabgeordnete<br />
und Bezirkspolitiker<br />
stehen vor ähnlichen Situationen.<br />
Manche seit Jahren.<br />
Die Rechte ist vorbereitet. „Die<br />
Aufstellung ist nun komplett“, sagte<br />
der rechte Verleger und Aktivist<br />
Götz Kubitschek am Wahlabend<br />
dem SPIEGEL. Wenn Politik ein<br />
Spiel wäre, dann säße die AfD auf der einen Seite des<br />
Bretts – und alle anderen wären auf der anderen Seite.<br />
Diese Worte sollte man ernst nehmen. Kubitscheks Ansage<br />
lautet: Wir haben jetzt eine Partei, die überall vertreten<br />
ist. Wir sind in der Lage, Begriffe zu prägen, weil wir die<br />
Medien zu nutzen wissen. Wir haben eine gewisse Macht<br />
auf der Straße. Und wir haben Rückzugsräume, in denen<br />
wir kulturelle Hegemonie beanspruchen können. Wir wissen,<br />
wer wir sind. Und damit arbeiten wir jetzt.<br />
Kubitschek fügte auch hinzu, worum es für die radikale<br />
Rechte in den kommenden Jahren gehen werde: den<br />
Kampf gegen die Westbindung. Den Kampf gegen die<br />
neoliberale Wirtschaftsordnung. Den Kampf gegen das<br />
„linksliberale Gesellschaftsexperiment“. Und gegen eine<br />
Bildungspolitik, die zu viele Menschen an die Universitäten<br />
bringe. Das ist die Ankündigung eines Kulturkampfs.<br />
Bei den Veranstaltungen von Kubitscheks Verlag auf der<br />
Frankfurter Buchmesse gab es am vergangenen Wochenende<br />
Tumulte. Offenbar ist die liberale Öffentlichkeit<br />
schlecht auf diese Auseinandersetzung vorbereitet.<br />
Paradoxerweise nicht zuletzt aus historischen Gründen.<br />
Lange hielt die Mehrheit der Deutschen radikale Rechte<br />
Veranstaltung in Frankfurt 2017<br />
Aufstellung komplett<br />
für Ewiggestrige, die zurück in die NS-Zeit wollen. Solche<br />
Leute gibt es selbstverständlich immer noch. Mit dem Verweis<br />
auf die deutsche Vergangenheit bekommt man aber<br />
weder eine Partei wie die AfD zu fassen noch die rechten<br />
Hipster von der Identitären Bewegung. Im Gegenteil, auf<br />
der Seite der Rechten hat man mit dem Nazivorwurf leben<br />
gelernt und ein geschicktes Spiel daraus gemacht, sich<br />
zum Opfer von Missverständnissen zu erklären. Dass in<br />
den Neunzigern Skinheads das Bild der Rechten dominierten,<br />
tut ein Übriges: Viele Deutsche glauben, Rechtsradikalismus<br />
sei im Wesentlichen ein Bildungsproblem.<br />
Dass es überhaupt rechtsradikale Intellektuelle gibt,<br />
scheint ihnen ein Widerspruch in sich.<br />
Die radikale Rechte dagegen weiß ziemlich gut, mit<br />
wem sie es in Deutschland zu tun hat. Mit einer liberalen<br />
Mehrheitsgesellschaft, die verlernt hat, über ihre Grundlagen<br />
nachzudenken. Mit Menschen,<br />
welche die Welt, in der sie<br />
leben, für selbstverständlich halten.<br />
Doch so ist es nicht. Die Gleichstellung<br />
der Geschlechter, die Öffnung<br />
des Staatsangehörigkeitsrechts, die<br />
Homo-Ehe – all das ist erkämpft<br />
worden. Wir laufen auf festem<br />
Grund. Doch nur, weil er im Streit<br />
einmal festgestampft worden ist.<br />
Nichts garantiert, dass das so bleibt.<br />
Und die Rechte kann weit in die<br />
FRANK RUMPENHORST / DPA<br />
Gesellschaft hineinfunken: Auch<br />
viele Linke haben Probleme mit<br />
den USA und sehen den Kapitalismus<br />
kritisch. Vielen Konservativen<br />
geht die Toleranz für andere Lebensentwürfe<br />
immer wieder zu weit. In allen politischen<br />
Lagern gibt es ein Unbehagen mit dem schnellen gesellschaftlichen<br />
Wandel. Daran knüpft die Rechte an.<br />
Im Wahlkampf hat sie Themen gesetzt, und sie wird es<br />
weiter tun. Wer glaubt, er könnte dieser Auseinandersetzung<br />
entgehen, hat sie schon verloren. <strong>Der</strong> Rechten ist<br />
auch nicht mit moralischer Selbstüberhöhung und „Nazis<br />
raus“-Rufen beizukommen. Mit Rechten reden? Die Kunst<br />
wird darin bestehen, ihre Provokationen ins Leere laufen<br />
zu lassen, sie nicht zu den Opfern zu machen, als die sie<br />
sich oft und gern stilisieren – und sie inhaltlich zu stellen.<br />
Das wird nicht klappen, ohne sich mit ihren Positionen<br />
und ihrem Denken zu beschäftigen. Aber niemand wird<br />
dieser Diskussion ausweichen können. Sie läuft schon, ob<br />
die liberale Öffentlichkeit das will oder nicht.<br />
Die radikale Rechte hat einen umfassenden Angriff auf<br />
die liberalen Errungenschaften der Bundesrepublik<br />
Deutschland begonnen. Er wird dauern. Die Rechten wissen<br />
das. Sie haben Zeit. Jahrzehntelang haben sie hilflos<br />
dem Marsch der Linksliberalen durch die Institutionen<br />
des Landes zugeschaut. Sie werden alles aufbieten, was<br />
sie haben, um diese Errungenschaften zurückzudrehen.<br />
128 DER SPIEGEL 43 / 2017
Kultur<br />
Die kommende Vielfalt<br />
Auch für Selbstverständlichkeiten einzustehen, braucht es Training.<br />
Von Hilal Sezgin<br />
Ja, ich kann es gut verstehen, wenn man Nazis im öffentlichen<br />
Raum ausbuht, statt mit ihnen zu diskutieren.<br />
Und, ja, ich habe jenem Bekannten gratuliert,<br />
der neulich auf unserer Dorfstraße angehalten und sein<br />
Autodach erklommen hat, um ein AfD-Plakat vom Laternenmast<br />
zu reißen.<br />
Beides gehört nicht zu den feinsten Umgangsformen in<br />
einer Demokratie. Aber rechten Gruppierungen Einhalt<br />
zu gebieten und zu verhindern, dass sie den öffentlichen<br />
Raum mit ihren hasserfüllten Parolen zupflastern, ist auch<br />
eine Form von Politik. Nämlich eine vieler Aktionsmöglichkeiten<br />
von Individuen – nicht von gesellschaftlichen<br />
oder staatlichen Institutionen. Es ist richtig, dass das Recht<br />
auf Meinungsfreiheit auch Publikationen schützt, die am<br />
rechten Rand provozieren, und auch, dass als Partei zugelassen<br />
ist, wer noch nicht allzu massiv mit Menschenfeindlichkeit<br />
auffiel. Die Justiz muss<br />
sparsam sein mit Verboten. Doch<br />
wenn empörte Personen demonstrieren<br />
und Sprecher ausbuhen,<br />
dann ist das nicht Zensur, sondern<br />
Zivilgesellschaft in Aktion.<br />
Im Übrigen hat es ja tatsächlich<br />
eine lange Zeit gegeben, in der<br />
man niemanden hätte niederschreien<br />
müssen, sondern ihn einfach hätte<br />
rechts liegen lassen können. Als<br />
beispielsweise Thilo Sarrazin sein<br />
erstes Buch veröffentlichte, 2010,<br />
Verunstaltung in Berlin 2000<br />
Vornehme Zurückhaltung<br />
CARSTEN KOALL / DDP IMAGES<br />
hätten Leser nicht Millionen Exemplare<br />
kaufen und Talkshows ihn<br />
nicht unaufhörlich ein laden müssen.<br />
Auch hätte es das Land als einen<br />
Schock erleben können, wie die Ägypterin Marwa<br />
El-Sherbini mitten in einem Dresdener Gerichtssaal 2009<br />
von ihrem islamfeindlichen Verfolger erstochen wurde.<br />
Und bei Entdeckung der NSU-Morde, 2011, hätte man<br />
deutlich aussprechen können, dass es in Deutschland wieder<br />
rechten Terror gibt. Aber weite Teile unseres Bildungsbürgertums<br />
hielten sich vornehm zurück.<br />
Das ganze Drucksen und Zaudern hat die Rechte nur<br />
anwachsen lassen. Und obwohl ich gern den Eindruck vermeiden<br />
würde, die Migrationshintergrundkarte auszuspielen,<br />
sei doch daran erinnert: Die Möglichkeit zu schweigen<br />
hat ohnehin nicht jeder. Die Frage, ob man mit Nazis<br />
überhaupt etwas zu tun haben will, stellt sich weder der<br />
Frau mit Kopftuch, die auf der Straße angespuckt wird,<br />
noch dem afrikanischen Geflüchteten, der selbst in einer<br />
belebten Innenstadt mit Prügel rechnen muss, noch mir,<br />
die – viel harmloser – ihr ganzes Berufsleben hindurch<br />
aufgrund ihres Namens Adressatin höchst sonderbarer<br />
rassistischer Bemerkungen geworden ist.<br />
Die Migrationshintergrundkarte wieder eingesteckt und<br />
aus der Perspektive politischer Aktivisten gesprochen:<br />
Die momentane Ratlosigkeit, wie man mit Rechten umgehen<br />
müsse, ist auch dem Umstand geschuldet, dass weite<br />
Teile unserer Bevölkerung in politischen Protesten schlicht<br />
aus der Übung sind. Nach dem Ende des Kalten Krieges<br />
und dem Abflauen der Friedensbewegung schien erst einmal<br />
alles in trockenen Tüchern. In Feuilletondebatten wurden<br />
in Nuancen semi-linke oder dezent-konservative Weltsichten<br />
verhandelt. Erst als mit Donald Trump die blanke<br />
Irrationalität an die Macht kam, wurde die Verunsicherung<br />
flächendeckend. Und nun, seit der Bundestagswahl, wird<br />
auch hierzulande den eher Unpolitischen deutlich, dass<br />
sie für eine gewaltfreie liberale Gesellschaft eintreten müssen.<br />
Was über Jahrzehnte nicht nötig schien.<br />
Für Feministinnen, die ihre Sexismuskritik jahrein, jahraus<br />
gegen Prüderievorwürfe verteidigen müssen, oder für<br />
Tierrechtlerinnen wie mich ist das nichts ganz Neues. Wer<br />
die Opfer sexueller Gewalt oder das Leid der über 65 Milliarden<br />
jährlich geschlachteten Tiere<br />
vor Augen hat, weiß: Es geht jeden<br />
Tag um etwas. Diese Tücher<br />
sind niemals trocken. Man weiß<br />
dann zudem: Man muss und kann<br />
immer wieder mit politischen Gegnern<br />
reden. Auch eine ethische Veganerin<br />
sieht in Fleischessern nicht<br />
bloß „Feinde“, sondern hat Freunde,<br />
die Fleisch essen. Ebenso wenig<br />
sind AfD-Wähler reine „Monster“.<br />
Sie sind nicht einmal ausschließlich<br />
AfD-Wähler, das ist nur eine ihrer<br />
sozialen Rollen und eines ihrer<br />
Gesichter. Auch sie sind als Menschen<br />
verwundbar – und müssen als<br />
Rechte bekämpft werden. Wenn<br />
ihre Oma gestorben ist, schickt man eine Kondolenzkarte,<br />
und später auf der Buchmesse schreit man sie nieder. Mit<br />
diesem Paradox lernt jeder zu leben, der eine starke Meinung<br />
hat, die nicht von der Umgebung geteilt wird. Dabei<br />
äußert sich der eine im politischen Streit kategorisch, der<br />
andere vermittelnder. Wir brauchen Empathie, um über<br />
die Lager hinweg zu kommunizieren, und das rigorose<br />
Prinzip „Keinen Fußbreit“ in anderen Konstellationen.<br />
Konzentrieren wir uns statt auf Verfahrensfragen vermehrt<br />
auf normativen Input. Dafür braucht es auch große<br />
Wörter: Gerechtigkeit und Solidarität, Gewaltfreiheit, Frieden<br />
und Menschlichkeit. Für solche scheinbaren Selbstverständlichkeiten<br />
öffentlich einstehen zu müssen ist für<br />
viele eher ungewohnt, man möchte kein Pathos zeigen<br />
oder gar Gefühl, will nicht „idealistisch“ wirken und nicht<br />
„naiv“. All diese Ängste sollten wir jetzt aufgeben. Wir<br />
haben bemerkt, dass etwas verloren zu gehen droht. Rufen<br />
wir es zurück, jeder und jede in der eigenen Tonlage.<br />
Von Hilal Sezgin erschien zuletzt: „Nichtstun ist keine Lösung.<br />
Politische Verantwortung in Zeiten des Umbruchs“<br />
(DuMont).<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
129
Dichter Hamza in der Buchholzer Buchhandlung Slawski: „Ich komme aus einem unglücklichen Land“<br />
LUCAS WAHL / DER SPIEGEL<br />
Ein Gedicht für Wanne-Eickel<br />
Exil Weiterleben nach dem Krieg: wie zwei syrische Schriftsteller versuchen, in der<br />
deutschen Provinz eine neue Heimat zu finden<br />
130 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Sie sitzt im Deutschkurs. Sie soll sprechen,<br />
sich beteiligen. Aber sie versteht<br />
kein Wort. Sie schweigt. Plötzlich<br />
meldet sie sich, weil sie Durst hat: „Ich<br />
möchte eine Tasse Wasser.“ Da klatschen<br />
alle. Die Lehrerin ruft: „Super, Lina!“ und<br />
gibt ihr ein Stück Schokolade. Sie weint.<br />
„Ich fühlte mich wie in der ersten Klasse“,<br />
erzählt Lina Atfah, 28.<br />
Atfah ist Lyrikerin, sie hat arabische Literatur<br />
studiert, doch jetzt muss sie<br />
Deutsch lernen wie ein Kind in der Schule.<br />
Den Intensivkurs an der Uni brach die Syrerin<br />
damals ab, nun besucht sie eine Integrationsklasse<br />
an der Volkshochschule Herne.<br />
Sie soll ihre Adresse sagen und ihre<br />
Postleitzahl. Sie lebt jetzt unter Menschen,<br />
die ihre Sprache nicht verstehen, ihre Gedichte<br />
nicht lesen können.<br />
Sie weiß, sie müsste schneller Fortschritte<br />
machen im Deutschen. Aber sie will Gedichte<br />
schreiben, sie muss schreiben. Sie<br />
fühlt, jetzt ist ihre Chance. „Gerade gibt<br />
es in Deutschland so viel Interesse an arabischer<br />
Literatur. Wer weiß, ob in zwei<br />
Jahren noch einer nach uns fragt?“<br />
Im November 2014 verließ die Schriftstellerin,<br />
die wegen ihrer kritischen Gedichte<br />
und Artikel seit Jahren nicht bei<br />
Kulturveranstaltungen auftreten durfte,<br />
ihre Heimatstadt Salamija in Westsyrien.<br />
Jetzt lebt sie in Wanne-Eickel. Im einstigen<br />
Kohlerevier, an das nur noch ein paar<br />
alte Fördergerüste erinnern. Nicht weit<br />
vom Bahnhof, in Wanne, hat sie eine kleine<br />
Wohnung mit ihrem Mann, einem Physiker.<br />
Sie hat noch schnell das Treppenhaus<br />
gewischt, sie sind mit dem Putzdienst dran.<br />
Nun sitzt sie auf dem Sofa im Wohnzimmer<br />
und pustet sich ein paar Haare aus<br />
der Stirn. Atfah ist impulsiv, temperamentvoll,<br />
sie lacht gern, selbst jetzt, wenn sie<br />
von ihrem Heimweh spricht. Wird sie je<br />
zurückkehren können? Welches Syrien<br />
wird es dann sein?<br />
„Ich hatte Glück“, sagt sie und dreht den<br />
Satz gleich um: „Hatte ich Glück?“ Sie ist<br />
gerettet, aber ihr Land liegt großteils in<br />
Trümmern. So viele sind tot, verletzt, leiden<br />
im Gefängnis. In ihrer Heimatstadt,<br />
die regimetreue Milizen kontrollierten,<br />
greife der „Islamische Staat“ wieder mit<br />
Mörsergranaten an, berichtet Atfah.<br />
Oft ist sie von Schuldgefühlen geplagt.<br />
Sie darf noch mal neu anfangen, aber was<br />
ist mit denen, die dortbleiben mussten?<br />
Manchmal, sagt sie, gehe sie tagelang nicht<br />
aus dem Haus. In der ersten Zeit in Deutschland<br />
konnte sie nicht schreiben, hatte Panikattacken.<br />
„Wir haben die Bomben überlebt/<br />
und jetzt ist unser Leben zu weit weg/<br />
als dass wir es uns zurückholen könnten.“<br />
Aref Hamza, 43, hat das geschrieben,<br />
nachdem er im Juni 2014 in Deutschland<br />
angekommen war. Auch er ist Lyriker, im<br />
Hauptberuf war er Anwalt. Er und seine<br />
Familie überlebten die Kämpfe in seiner<br />
Heimatstadt Hasaka und die Flucht nachts<br />
durch Nordsyrien über die türkische Grenze.<br />
Einmal wanderten plötzlich Lichtstrahlen<br />
vor ihnen über den Boden, offenbar<br />
ein Kontrollposten, aber sie blieben unent-
Kultur<br />
deckt, kein Soldat schoss. Drei Schleuser<br />
begleiteten sie. Irgendwann zeigten sie auf<br />
einen hellen Punkt, seht ihr, das ist die<br />
Türkei. Und Hamza sprach mit seinem<br />
sechsjährigen Sohn: „Schau, hinter uns ist<br />
es dunkel, das ist Syrien, und da vorn gibt<br />
es viele Lichter und Plätze, an denen du<br />
spielen kannst. Aber dazwischen lauern<br />
Soldaten, und deshalb müssen wir jetzt<br />
ganz still sein, okay?“ Alles, was sie hatten,<br />
trugen sie in zwei Koffern bei sich, vor allem<br />
Sachen für die Kinder und Fotoalben<br />
mit den Bildern aus glücklichen Tagen.<br />
So kamen sie nach Buchholz, Nordheide.<br />
Hier, in dem geruhsamen Städtchen<br />
im Hamburger Speckgürtel, lebt Hamza<br />
nun seit drei Jahren. Zurzeit ist er der einzige<br />
Dichter, den Buchholz hat.<br />
Ein Lyriker, sagt er, schreibt über das<br />
Leiden der Menschen. „Aber ich weiß<br />
nicht, leiden die Menschen hier?“ Er ist<br />
über die Friedhöfe gegangen und hat die<br />
Gräber studiert. Viele Tote sind älter als<br />
achtzig Jahre alt geworden. Das hat ihn<br />
beeindruckt, in Syrien sterben viele jung –<br />
im Krieg, durch Terror, im Gefängnis.<br />
Hamza hat Gedichte über die Folter geschrieben,<br />
über Wände, an denen das Blut<br />
klebt, und Kupferdraht, der mit Strom zum<br />
Werkzeug des Bösen wird. Als Anwalt vertrat<br />
er Syrer, die 20 Jahre lang im Gefängnis<br />
saßen, verurteilt in Schnellprozessen,<br />
„völlig unfaire Verfahren“, sagt Hamza. Einer<br />
seiner Mandanten sei anders als üblich<br />
ohne Augenbinde vor ein Militärgericht gebracht<br />
worden. „Er sollte seine Schwester<br />
sehen, die nackt war“, erzählt Hamza. Sie<br />
hätten gedroht, sie zu vergewaltigen, wenn<br />
er nicht alles zugibt, was sie ihm vorwarfen.<br />
Das Grauen ist weit weg, doch er trägt<br />
die Bilder in sich, wenn er jetzt über friedliche<br />
Plätze geht in Buchholz, er sieht die<br />
Menschen noch vor sich, die von Kugeln<br />
oder Bomben zerfetzt vor ihren Häusern<br />
lagen. Die Herbstsonne trocknet den Regen<br />
von der Straße, er trinkt Espresso im Café<br />
Paradies, wo es besonders gute Schokoladentorte<br />
gibt. Am Nebentisch prosten sich<br />
zwei ältere Damen mit Sekt zu. Es ist elf<br />
Uhr vormittags. „Ich bin einsam/ Ich habe<br />
kein Land mehr/ Meine Nachbarin ist einsam<br />
geworden/ Sie hat keinen Hund mehr.“<br />
Meist schreibt Hamza nachts, wenn seine<br />
beiden kleinen Söhne schlafen. Das Gedicht<br />
mit dem Hund trägt er fast immer<br />
auf den Lesungen vor, zu denen er eingeladen<br />
wird, nach Berlin und Heidelberg,<br />
nach München und Mainz. Ein Netzwerk<br />
von Kulturstiftungen, Literaturhäusern<br />
und Initiativen unterstützt die Exilschriftsteller<br />
in Deutschland, verhilft ihnen zu<br />
Auftritten, bringt sie mit deutschen Autoren<br />
zusammen, übersetzt ihre Werke und<br />
veröffentlicht sie in Anthologien*.<br />
* „Weg sein – hier sein. Texte aus Deutschland“. Seces -<br />
sion; 256 Seiten; 24 Euro.<br />
Kürzlich kam nach einer Lesung in<br />
Frankfurt eine begeisterte Zuhörerin zu<br />
ihm, er habe ihre Verzweiflung so gut getroffen.<br />
Ihr Hund sei gestorben, und das<br />
sei schlimmer als bei jedem Mann, den sie<br />
verloren habe. Ohne Mann komme sie<br />
zurecht, aber ohne Hund? Sie fing an zu<br />
weinen, und Aref Hamza sagte: Sorry.<br />
Er wusste nicht, was er sonst hätte sagen<br />
sollen.<br />
Im Juni trat er im Forum der Hamburger<br />
Körber-Stiftung zusammen mit Lina Atfah<br />
auf, auch sie hält häufig Lesungen. Sie hat<br />
honiggetränkte Baklavas mitgebracht, die<br />
sie im Publikum verteilt. „Ich möchte etwas<br />
mit Ihnen feiern“, erklärt sie, „heute<br />
ist mein Vater aus der Haft entlassen worden!“<br />
Sie ist aufgeregt, sie lacht und wirft<br />
ihre langen Haare nach hinten. Dann setzt<br />
sie zur Saghrada an, dem Freudentriller<br />
arabischer Frauen. Das Publikum klatscht.<br />
Sie liest: „Ich werde diese Länder, die uns<br />
Zuflucht gewährten, fragen:/ Wer bin ich?“<br />
Nachts hat sie Albträume, immer die<br />
gleichen. Sie hat ihren Mann verloren, sie<br />
sucht ihn überall, in Straßen, in Häusern,<br />
doch alle sind leer, kein Mensch außer ihr.<br />
Dann träumt sie, dass ihre Heimatstadt im<br />
Wasser versinkt, und sie schwimmt und<br />
schwimmt, schnappt nach Luft, um nicht<br />
zu ertrinken, und ruft nach ihrem Vater.<br />
Er ist ihr großer Kummer. Als Einziger<br />
der Familie ist er noch in Syrien, er gilt als<br />
Regimegegner und durfte bisher nicht ausreisen.<br />
Er war Agraringenieur im Staatsdienst.<br />
„Sie haben ihn entlassen, alle Pensionsansprüche<br />
gestrichen“, sagt Atfah. Im<br />
Mai wurde er festgenommen, blieb über<br />
einen Monat im Gefängnis. Atfah war verrückt<br />
vor Sorge, er ist herzkrank, braucht<br />
Tabletten. Jeden Tag telefoniert sie lange<br />
mit ihm, auch jetzt ruft er an, das Bild<br />
eines schmalen, dunkelhaarigen Mannes<br />
erscheint auf dem Smartphone-Display.<br />
„Baba, kaif halak, Habibi?“ ruft sie, „Papa,<br />
mein Liebling, wie geht es dir?“<br />
Lina war zehn Jahre alt, als ihr ein Nachbarsmädchen<br />
verriet, dass man beim Referendum<br />
Süßigkeiten bekomme für jeden<br />
Ausweis, der als Jastimme eingetragen werden<br />
kann. Es war Februar 1999, Präsident<br />
Hafis al-Assad ließ pro forma über seine<br />
fünfte Amtszeit abstimmen.<br />
Lina sammelte alle Ausweise im Haus<br />
ein, die ihrer Eltern, ihrer Großeltern, ihres<br />
Onkels und selbst die der Tanten, die schon<br />
lange tot waren. Zwölf Ausweise gab sie<br />
im Wahlbüro ab, doch sie bekam nur sieben<br />
Baklavas. Sie fühlte sich betrogen und<br />
erzählte alles ihrem Großvater. <strong>Der</strong> sagte:<br />
Weißt du, dass du meine Stimme dem<br />
Mann verkauft hast, der mich ins Gefängnis<br />
geworfen hat? Zwölf Jahre lang war er in<br />
Haft. Sie brach in Tränen aus. „Ich habe<br />
mit einem Schlag verstanden“, sagt sie,<br />
„wie das Assad-Regime funktioniert.“<br />
An einem heißen Tag im Sommer 2013<br />
wurde Aref Hamza klar, dass sie in Syrien<br />
keine Zukunft mehr hatten. In der Stadt<br />
tobten Kämpfe zwischen den kurdischen<br />
Milizen und Regierungstruppen. Häufig<br />
gab es keinen Strom, kein Wasser, die Kinder<br />
hatten keine Schule. Sie kauerten in<br />
der Küche auf dem Boden, die Kinder<br />
weinten, stopften sich die Finger in die Ohren.<br />
„Wir hatten solche Angst“, sagt Hamza,<br />
„immerzu.“ Als ein Panzer in die Straße<br />
rollte, flohen sie in einen Park, und sein<br />
ältester Sohn fragte: „Papa, müssen wir<br />
jetzt sterben?“<br />
Seine 3000 Bücher musste Hamza in Syrien<br />
zurücklassen, darunter viele deutsche<br />
Klassiker, Thomas Mann, Bertolt Brecht,<br />
Hermann Hesse, Günter Grass, Schopenhauer<br />
und Nietzsche, er hat sie alle gelesen,<br />
auf Arabisch. Nur je eine Ausgabe<br />
Dichterin Atfah bei Lesung in Heidelberg: „Ich hatte Glück – hatte ich Glück?“<br />
PETER JUELICH / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
131
Kultur<br />
„Das detailreichste und<br />
enthüllendste Porträt einer der<br />
größten Bands aller Zeiten“<br />
EMPIRE<br />
Ab 20.10. als Special Edition<br />
inkl. 4,5 Stunden<br />
exklusivem Bonusmaterial<br />
seiner eigenen Werke nahm er mit in den<br />
beiden Koffern. Und die Bücher? Die sind<br />
bei Verwandten in Hasaka gestapelt. Als<br />
es kalt wurde im Winter und die Verwandten<br />
erzählten, wie sehr sie froren, sagte<br />
Hamza: „Verbrennt die Bücher.“ Sie weigerten<br />
sich. „Menschen sind doch wichtiger<br />
als Bücher“, sagt Hamza.<br />
Nun ist er wieder von Büchern umgeben,<br />
und vielleicht wird er eines Tages sagen,<br />
sie hätten ihn gerettet. Seit einem halben<br />
Jahr hat er einen Aushilfsjob in der<br />
Buchhandlung Slawski, meist montags und<br />
dienstags, für zehn Euro die Stunde. <strong>Der</strong><br />
Laden ist klein, aber gut sortiert und gemütlich,<br />
Kunden sitzen gern auf dem blauen<br />
Sofa in der Mitte und lesen. Wenn Hamza<br />
ein Buch aus dem Regal zieht, nimmt<br />
er es vorsichtig, fast zärtlich in die Hand.<br />
Man könne sich mit ihm über die ganze<br />
Weltliteratur unterhalten, lobt seine Chefin<br />
Monika Külper. Sie schwärmt von seinen<br />
Umgangsformen, die Kunden liebten<br />
ihn. Seine Deutsch wird immer besser. Die<br />
Buchhandlung öffnet um neun Uhr, doch<br />
Hamza bittet, zum Interview später zu<br />
kommen, erst müssten die Kundenbestellungen<br />
erledigt sein. Er ist ein höflicher,<br />
bescheidener Mann, er will seine Dankbarkeit<br />
zeigen. Deutschland nennt er ein<br />
„gutes Exil“.<br />
Eigentlich sei er ja bereits in Syrien im<br />
Exil gewesen, sagt er. Ein Regimekritiker,<br />
Kurde dazu, der sich schon 2004 an einem<br />
friedlichen Sitzstreik vor dem Parlament<br />
in Damaskus beteiligte. Als Anwalt verteidigte<br />
Hamza ehrenamtlich auch politische<br />
Häftlinge, schrieb kritische Artikel. Zwei<br />
seiner Gedichtbände sind in Syrien verboten.<br />
2004 hatte er noch den Mohammedal-Maghout-Preis<br />
bekommen für Lyrik.<br />
„Ich komme aus einem unglücklichen<br />
Land“, sagt Hamza. Einem Land, in dem<br />
die Bauern den Wetterbericht nicht mehr<br />
verfolgten, wie er in einem Gedicht<br />
schreibt: „<strong>Der</strong> Himmel bedeutet uns nichts<br />
mehr/ und inzwischen legen wir unsere<br />
Söhne in die Erde anstelle von Saatgut.“<br />
In Buchholz fragt er seine Söhne immer<br />
wieder: Wollt ihr zurück? Nein, sagen sie<br />
dann. Sie seien glücklich in ihrer Schule,<br />
sie gehen in die zweite und die vierte Klasse,<br />
sie haben Schwimmen gelernt, spielen<br />
Fußball, sein ältester Sohn malt. Sie haben<br />
eine schöne Wohnung bekommen.<br />
„Das syrische Volk braucht psychologische<br />
Hilfe“, sagt Lina Atfah, „wir haben<br />
den Glauben an alles verloren.“ Ihre Mutter<br />
ist zu Besuch gekommen, sie nickt.<br />
Dann weint sie. Sie war Französischlehrerin<br />
in Syrien, eine schmale, fein gekleidete<br />
Frau. Sie lebt jetzt mit ihren jüngeren Kindern<br />
in der Nähe. Immer, wenn von ihrem<br />
Mann die Rede ist, weint sie. „Ich war<br />
schon so verzweifelt, dass ich mich fragte,<br />
wessen Hand ich küssen könnte, damit er<br />
herkommt“, sagt Lina Atfah.<br />
Nun hat die Familie zum ersten Mal Hoffnung.<br />
Sie haben an das Kanzleramt geschrieben,<br />
wo Atfah beim Tag der Offenen<br />
Tür ihre Gedichte las, und an das Auswärtige<br />
Amt. Das hat sich inzwischen gemeldet,<br />
man will sich kümmern. Sie sei Deutschland<br />
so dankbar, sagt Atfah, aber dass der<br />
Familiennachzug ausgesetzt sei für viele<br />
Flüchtlinge, finde sie ein großes Unrecht.<br />
Bevor sie ausreisen konnte, musste sie<br />
Verhöre der Sicherheitsbehörden über sich<br />
ergehen lassen. Immer wieder die Frage:<br />
„Warum schreibst du gegen uns? Warum<br />
schreibst du nicht für Assad?“ 2011 hatte<br />
sie sich an den Protesten beteiligt, man<br />
verweigerte ihr deshalb zunächst die Papiere.<br />
Schon als 17-Jährige kritisierte sie<br />
in einem Gedicht, die Menschen stürben<br />
an Hunger, die Gouverneure dagegen, weil<br />
sie zu viel äßen.<br />
Dann kam der Tag ihrer Ausreise, ohne<br />
das Recht auf Rückkehr. „Ich wollte alle<br />
Kleider mitnehmen, meine Erinnerungen,<br />
meine Kindheit.“ So kam sie mit einem<br />
Aref Hamza sagt, er<br />
träume nicht mehr.<br />
Er habe aber auch keine<br />
Albträume mehr.<br />
50 Kilogramm schweren Rucksack in<br />
Deutschland an, voller Kleider, arabischer<br />
Süßigkeiten, einer Teekanne samt Teegläsern<br />
und Löffeln, Büchern und zwölf Flaschen<br />
ihres Lieblingsparfums.<br />
Vor drei Wochen hat Lina Atfah ihre erste<br />
Deutschprüfung, Niveau A1, bestanden.<br />
Sie war so stolz, dass sie sich gleich wieder<br />
für einen Intensivkurs angemeldet hat. Gerade<br />
sind neue Gedichte von ihr erschienen.<br />
Und sie probiert, auf Deutsch zu schreiben:<br />
„ Ich versuche zu leben. Ich versuche neue<br />
Adresse zu buchstabieren. Ich versuche<br />
meinen alten <strong>Spiegel</strong> zu zerbrechen.“<br />
Aref Hamza sagt, er träume nicht mehr.<br />
Aber er habe auch keine Albträume mehr.<br />
Eines Tages kam sein Sohn zu ihm und<br />
küsste ihm die Hand. „Was ist?“, fragte er<br />
ihn. „Du hast gesagt, wir werden schöne<br />
Plätze sehen“, sagte sein Sohn, „und du<br />
hast nicht gelogen.“<br />
Seitdem weiß Hamza, dass er das Richtige<br />
getan hat, als er seine Heimat verließ<br />
und sein Haus und seine Bücher und sein<br />
Anwaltsbüro und seine Freunde und die<br />
langen Nächte, die er so liebte, in denen<br />
man zusammensaß und nicht an den nächsten<br />
Morgen dachte.<br />
Nun überlegt er, ob er die deutsche<br />
Staatsbürgerschaft beantragt. Er sucht<br />
einen Ausbildungsplatz in einem Anwaltsbüro.<br />
Und: Im Frühjahr erscheint sein<br />
erster Gedichtband auf Deutsch.<br />
Annette Großbongardt<br />
132 DER SPIEGEL 43 / 2017
Nur für SPIEGEL-Abonnenten:<br />
Digital-Upgrade nur € 0,50.<br />
Jetzt<br />
4 Wochen<br />
gratis<br />
testen<br />
Ohne Verpflichtung lesen<br />
Bereits ab freitags 18 Uhr<br />
Auch offline lesbar<br />
Auf bis zu 5 Geräten<br />
Inklusive SPIEGEL DAILY<br />
Die neue digitale Tageszeitung<br />
Ja, ich möchte den SPIEGEL digital testen!<br />
Ich lese 4 Wochen den SPIEGEL digital kostenlos, danach als SPIEGEL-Abonnent für nur € 0,50 statt<br />
€ 4,10 pro Ausgabe. Ich gehe keine Verpflichtung ein, denn ich kann jederzeit zur nächsterreichbaren<br />
Ausgabe kündigen.<br />
Einfach jetzt anfordern: abo.spiegel.de/upgrade<br />
Rosenzweig & Schwarz, Hamburg
„…was das uns Deutsche wieder kostet!“<br />
Essay Ist das die Antwort auf den französischen Präsidenten?<br />
Von Jürgen Habermas<br />
Hoffnungsträger Macron: Gegen die „traurigen Leidenschaften“ Europas<br />
MICHAEL PROBST / AP<br />
Für Walter Benjamin war Paris die Hauptstadt Euro -<br />
pas, für den trotzig-ironischen Robert Menasse soll<br />
Brüssel es werden. Das ist eine fragile Hoffnung. <strong>Der</strong><br />
frisch gekürte Träger des Deutschen Buchpreises temperiert<br />
denn auch im „taz“-Interview hochgesteckte Erwartungen<br />
mit einer hübschen Story über den Abend mit einem<br />
deutschen Korrespondenten in einem verrauchten<br />
Brüsseler Journalistencafé. Er konnte beobachten, wie<br />
diesem von seiner Frankfurter Redaktion ein Bericht aus<br />
dem Brüsseler Raumschiff mit dem Bescheid zurückgegeben<br />
wurde: „Schreib nicht so kompliziert. Schreib nur,<br />
was das uns Deutsche wieder kostet.“<br />
Das gedämpfte Interesse, das deutsche Politiker, Manager<br />
und Journalisten an der Gestaltung eines politisch<br />
handlungsfähigen Europas nehmen, lässt sich kaum auf<br />
eine bündigere Formel bringen. Eine timide und willfährige<br />
Presse springt unserer politischen Klasse seit Jahren<br />
bei, um die breitere Öffentlichkeit mit dem Thema Europa<br />
nur ja nicht zu belästigen. Die Entmündigung des Publikums<br />
hätte nicht schöner demonstriert werden können<br />
als mit der sorgfältig präparierten Einschränkung des Themenspektrums<br />
für die einzige sogenannte Fernsehdebatte<br />
zwischen Merkel und Schulz vor der Bundestagswahl.<br />
Auch während des Jahrzehnts der immer noch weiterschmorenden<br />
Finanzkrise durften sich die Kanzlerin und<br />
ihr Finanzminister – im krassen Gegensatz zu den Tatsachen<br />
– als die wahren „Europäer“ darstellen.<br />
Aber nun erscheint ein Emmanuel Macron auf der Bühne<br />
und könnte, trotz seiner einschmeichelnden Bemühungen<br />
um eine rücksichtsvolle Kooperation mit der geschlagenen<br />
und von der eigenen Partei bedrängten Kanzlerin, den<br />
Schleier über diesem wohlgefälligen Selbstbetrug lüften.<br />
Die „realistischen“ Köpfe in den überregionalen Zeitungen<br />
scheinen zu befürchten, das deutsche Publikum könnte<br />
sich von den Worten des französischen Präsidenten über<br />
des Kaisers neue Kleider die Augen öffnen lassen: Es könnte<br />
erkennen, dass die deutsche Regierung mit ihrem robusten<br />
Wirtschaftsnationalismus ziemlich nackt dasteht. Georg<br />
Blume sammelt in den ersten Kapiteln eines Buches, das<br />
soeben mit dem Untertitel „Wie Deutschland eine Freundschaft<br />
riskiert“ erschienen ist, traurige Belege aus Presse<br />
und Politik für den neudeutsch-herablassenden Tenor gegenüber<br />
Frankreich und den Franzosen. Manche Kommentare<br />
zu Macron schwankten von Anbeginn zwischen Gleichgültigkeit,<br />
Arroganz und vorauseilender Abwehr. Und bis<br />
auf einen SPIEGEL-Titel blieb auch das Echo auf die sorgfältig<br />
vorbereitete Europa-Rede des französischen Präsidenten<br />
schwach bis tonlos. Aus diesem Stoff, der sich für<br />
eine Komödie eignet, könnte die anstehende Jamaika -<br />
koalition eine handfeste Tragödie basteln – wenn beispielsweise<br />
ein Finanzminister Christian Lindner Schäubles Testament<br />
vollstrecken sollte. Dieser hat in einem „non-paper“<br />
für die Euro-Gruppe der Finanzminister schon einmal ein<br />
Programm entworfen, das jeden Kompromiss mit der zukunftsweisenden<br />
Initiative des französischen Präsidenten<br />
blockieren soll. Darin verknüpft Schäuble die Einrichtung<br />
eines Europäischen Währungsfonds mit der Lieblingsvorstellung<br />
des Ordoliberalen, der einer gefürchteten demokratischen<br />
Beteiligung der Betroffenen dadurch vorbeugen<br />
will, dass die Finanz- und Wirtschaftsordnung im Ganzen<br />
der politischen Entscheidung entzogen wird und einer technokratischen<br />
Verwaltung vorbehalten bleibt.<br />
134 DER SPIEGEL 43 / 2017
Kultur<br />
Ungefähr in diesem Stil hätte ich mir gerne den Frust<br />
von der Seele geschrieben. Aber dafür ist die Situation<br />
zu ernst, denn die nächste deutsche Regierung (sofern<br />
überhaupt noch einer Lust dazu hat) muss den Ball des<br />
französischen Präsidenten, der nun in ihrem Feld liegt,<br />
aufnehmen. Schon eine Politik des bloßen Aufschiebens<br />
oder Unterlassens würde genügen, um eine historisch einzigartige<br />
Chance zu verspielen.<br />
Selten sind die Kontingenzen der Geschichte so drastisch<br />
hervorgetreten wie beim unerwarteten Aufstieg dieser<br />
faszinierenden, vielleicht blendenden, jedenfalls ungewöhnlichen<br />
Person. Niemand hat damit rechnen können,<br />
dass ein parteiloser Minister der Regierung Hollande,<br />
der im egozentrischen Alleingang, so schien es, aus dem<br />
Nichts eine politische Bewegung ins Leben rief, ein ganzes<br />
Parteiensystem umstülpen würde. Es war gegen alle demoskopische<br />
Weisheit, dass es einer einzelnen Person<br />
ohne Anhang innerhalb der kurzen Periode eines Wahlkampfes<br />
gelingen könnte, mit einem konfrontativen Programm<br />
für die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit<br />
gegen einen anschwellenden Rechtspopulismus, dem<br />
jeder dritte Franzose seine Stimme gegeben hat, dennoch<br />
die Mehrheit der Wähler zu gewinnen. Dass jemand wie<br />
Macron in einem Land, dessen Bevölkerung seit je euroskeptischer<br />
war als Luxemburger und Belgier, als Deutsche,<br />
Italiener, Spanier und Portugiesen, zum Präsidenten<br />
gewählt werden könnte, war schlechthin unwahrscheinlich.<br />
Allerdings ist es bei nüchterner Betrachtung ebenso unwahrscheinlich,<br />
dass die nächste deutsche Regierung die<br />
Weitsicht hat, auf die Frage, die ihr Macron gestellt hat,<br />
eine produktive, das heißt eine weiterführende Antwort<br />
zu finden. Ich würde schon aufatmen, wenn sie überhaupt<br />
die Relevanz der Frage richtig einschätzen würde.<br />
Es ist unwahrscheinlich genug, dass sich eine von internen<br />
Spannungen geprägte Koalitionsregierung dazu aufraffen<br />
wird, die beiden Weichenstellungen zu revidieren, die Angela<br />
Merkel in der ersten Stunde der Finanzkrise durchgesetzt<br />
hat: sowohl den Intergouvernementalismus, der<br />
Deutschland eine Führungsrolle im Europäischen Rat sichert,<br />
wie auch die Sparpolitik, die sie dank dieser Rolle<br />
den Südländern der Union zum eigenen, überproportionalen<br />
Vorteil Deutschlands oktroyieren konnte. Und es ist<br />
erst recht unwahrscheinlich, dass sich diese Kanzlerin nicht<br />
auf ihre innenpolitisch geschwächte Stellung herausreden<br />
wird, um ihrem charmanten Gegenüber klarzumachen, dass<br />
sie dessen formvollendet angediente Reformperspektive<br />
bedauerlicherweise nicht einnehmen kann – Perspektiven<br />
lagen ihr immer schon fern.<br />
Andererseits, und das ist die Frage, die mich bewegt,<br />
kann diese bemerkenswert kluge und gewissenhafte, aus<br />
einem protestantischen Pfarrhaus stammende, bisher vom<br />
Erfolg verwöhnte, aber auch nachdenkliche Politikerin (der<br />
ich persönlich nie begegnet bin) wirklich ein Interesse daran<br />
haben, in dieser unrühmlichen Rolle ihre dann 16 aktiven<br />
Jahre als Bundeskanzlerin zu beenden? Will sie abtreten<br />
nach vier weiteren Jahren des Durchwurstelns und der zerbröselnden<br />
Macht? Oder wird sie allen denen zum Trotz,<br />
die jetzt schon über ihren Untergang raunen, Größe zeigen<br />
und über ihren Schatten springen?<br />
Auch sie weiß, dass sich die europäische Währungsgemeinschaft,<br />
die im elementaren deutschen Interesse<br />
liegt, nicht auf Dauer stabilisieren lässt, solange<br />
sich, wie unter dem gegenwärtigen Regime, die<br />
starken Niveauunterschiede der Volkseinkommen, der<br />
Arbeitslosigkeit und der Staatsverschuldung zwischen den<br />
seit Jahren auseinanderdriftenden nationalen Ökonomien<br />
im Norden und Süden Europas immer weiter vertiefen.<br />
Das Gespenst der „Transferunion“ verstellt den Blick auf<br />
diese zerstörerische Dynamik. Diese ist nur aufzuhalten,<br />
wenn ein wirklich fairer Wettbewerb über nationale Grenzen<br />
hinweg hergestellt und eine Politik gegen die fortschreitende<br />
Entsolidarisierung zwischen den nationalen<br />
Bevölkerungen und innerhalb der jeweils eigenen Nationen<br />
verfolgt wird. Das Stichwort Jugendarbeitslosigkeit<br />
muss hier genügen. Macron entwirft ja nicht nur eine Vision,<br />
er fordert konkret das Vorangehen der Eurozone<br />
bei der Angleichung der Körperschaftsteuern, er fordert<br />
eine wirksame Finanztransaktionsteuer, die schrittweise<br />
Konvergenz der verschiedenen sozialpolitischen Regimes,<br />
die Einrichtung des Amtes eines europäischen Staats -<br />
anwalts für die Regeln des internationalen Handelsverkehrs<br />
usw.<br />
Andererseits sind es nicht diese einzelnen, ja längst bekannten<br />
Vorschläge, die das Auftreten, die Initiative und<br />
die Rede dieses Politikers aus allem herausheben, woran<br />
wir bisher gewöhnt sind. Was aus dem Rahmen fällt, sind<br />
drei charakteristische Züge:<br />
‣ der Mut zur politischen Gestaltung;<br />
‣ das Bekenntnis zur Umstellung des europäischen Eliteprojekts<br />
auf die demokratische Selbstgesetzgebung der<br />
Bürger;<br />
‣ das überzeugende Auftreten einer Person, die der Gedanken<br />
artikulierenden Kraft des Wortes vertraut.<br />
Mit einer sehr französischen Wortwahl wendet sich<br />
der Präsident am 26. September an sein studentisches<br />
Publikum und ebenso an die politische Klasse in Deutschland,<br />
wenn er wiederholt die<br />
„Souveränität“ beschwört, die<br />
nicht mehr der Nationalstaat,<br />
sondern nur noch Europa seinen<br />
Bürgern gewährleisten<br />
kann. Nur im Schutz und mit<br />
der Kraft des geeinten Europas<br />
könnten diese Bürger in der<br />
durch einandergeratenen Welt<br />
ihre gemeinsamen Interessen<br />
und Werte behaupten. Macron<br />
spielt die „wirkliche“ Souveränität<br />
gegen die schimärische der<br />
französischen „Souveränisten“<br />
aus. Er nennt das unwürdige<br />
Da hat wirklich<br />
jemand den Mut,<br />
sich gegen<br />
das fatalistische<br />
Bewusstsein<br />
von Fellachen<br />
aufzulehnen?<br />
Spiel des Regierungspersonals, das sich zu Hause von den<br />
Gesetzen distanziert, die es in Brüssel selber beschlossen<br />
hat, beim Namen und fordert nicht weniger als die Neugründung<br />
eines politisch nach innen wie nach außen handlungsfähigen<br />
Europas: Diese Selbstermächtigung der europäischen<br />
Bürger ist mit „Souveränität“ gemeint. Als<br />
Schritte zur Institutionalisierung der gemeinsamen Handlungsfähigkeit<br />
nennt Macron die engere Zusammenarbeit<br />
in der Euro zone auf der Grundlage eines gemeinsamen<br />
Haushaltes. <strong>Der</strong> zentrale und umstrittene Vorschlag lautet:<br />
„Ein (solcher) Haushalt kann nur einhergehen mit einer<br />
starken politischen Steuerung durch einen gemeinsamen<br />
Minister und eine anspruchsvolle parlamentarische Kontrolle<br />
auf europäischer Ebene. Allein die Eurozone mit<br />
einer starken internationalen Währung kann Europa den<br />
Rahmen einer Weltwirtschaftsmacht bieten.“<br />
Mit dem Anspruch, die Probleme einer zusammenwachsenden<br />
Weltgesellschaft politisch zu gestalten, ragt Macron<br />
wie nur wenige andere aus der chronisch überforderten,<br />
opportunistisch angepassten und perspektivelos von Tag<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
135
Kultur<br />
Philosoph Habermas<br />
Als Linker bin ich<br />
kein „Macronist“,<br />
wenn es so<br />
etwas gibt. Aber<br />
wie er über Europa<br />
spricht, macht<br />
einen Unterschied.<br />
ARNE DEDERT / DPA<br />
zu Tag reagierenden Schicht politischer Funktionäre heraus.<br />
Man reibt sich die Augen: Da ist jemand, der am<br />
Status quo noch etwas ändern will? Da hat jemand den<br />
frivolen Mut, sich gegen das fatalistische Bewusstsein von<br />
Fellachen aufzulehnen, die sich den vermeintlich zwingenden<br />
systemischen Imperativen einer in abgehobenen<br />
internationalen Organisationen verkörperten Weltwirtschaftsordnung<br />
gedankenlos beugen?<br />
Wenn ich ihn recht verstehe, bringt Macron ein Interesse<br />
zur Geltung, das bisher in unserem Parteiensystem zwischen<br />
dem alltäglichen Neoliberalismus der „Mitte“, dem<br />
selbstzufriedenen Antikapitalismus der Linksnationalisten<br />
sowie der abgestandenen identitären Ideologie der Rechtspopulisten<br />
nicht ausbuchstabiert und daher nicht repräsentiert<br />
ist. Es gehört zum Versagen der Sozialdemokratie,<br />
dass eine im Grundsatz globalisierungsfreundliche, europa -<br />
politisch vorwärtstreibende Politik, die gleichzeitig die<br />
sozialen Zerstörungen eines entfesselten Kapitalismus im<br />
Blick behält und daher auch auf die notwendige transnationale<br />
Reregulierung wichtiger Märkte drängt, trotz einiger<br />
Bemühungen von Sigmar Gabriel kein erkennbares<br />
Profil gewonnen hat. Den Ellbogenspielraum für die Profilierung<br />
einer solchen Politik hätte Gabriel wohl erst als<br />
Finanzminister einer fortgesetzten und Macron entgegenkommenden<br />
Großen Koalition erhalten können.<br />
<strong>Der</strong> zweite Umstand, durch den Macron sich von anderen<br />
Figuren unterscheidet, ist der Bruch mit einem stillschweigenden<br />
Konsens. In der politischen Klasse verstand<br />
es sich bis jetzt von selbst, dass das Europa der Bürger<br />
ein viel zu komplexes Gebilde<br />
ist und dass die finalité, das Ziel<br />
der europäischen Einigung, eine<br />
viel zu komplizierte Frage ist,<br />
als dass man die Bürger selbst<br />
damit befassen dürfte. Die laufenden<br />
Geschäfte der Brüsseler<br />
Politik sind nur etwas für Experten<br />
und allenfalls für die gut informierten<br />
Lobbyisten; während<br />
die Regierungschefs die<br />
ernsteren Konflikte zwischen<br />
aufeinanderstoßenden nationalen<br />
Interessen unter sich, in der<br />
Regel durch Aufschieben oder<br />
Ausklammern, beilegen. Vor allem<br />
aber besteht zwischen den<br />
politischen Parteien Einverständnis<br />
darüber, dass in nationalen<br />
Wahlen europäische Themen<br />
tunlichst zu vermeiden<br />
sind, es sei denn, dass sich die<br />
hausgemachten Probleme auf<br />
die Schultern Brüsseler Bürokraten<br />
abschieben lassen. Und nun<br />
will Macron mit dieser mauvaise<br />
foi aufräumen. Er hat ein Tabu bereits damit gebrochen,<br />
dass er die Reform Europas in den Mittelpunkt seiner<br />
Kampagne gerückt und diese Offensive, ein Jahr nach<br />
dem Brexit, gegen „die traurigen Leidenschaften“ Europas<br />
sogar gewonnen hat.<br />
Dieser Umstand verleiht dem oft gehörten Satz, dass<br />
die Demokratie das Wesen des europäischen Projektes<br />
sei, in seinem Munde Glaubwürdigkeit. Die Umsetzung<br />
seiner angekündigten politischen Reformen in Frankreich<br />
kann ich nicht beurteilen. Es wird sich zeigen müssen, ob<br />
er das „sozialliberale“ Versprechen, die schwierige Balance<br />
zwischen sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher<br />
Produktivität einzuhalten, einlöst. Als Linker bin ich kein<br />
„Macronist“, wenn es so etwas gibt. Aber wie er über Eu -<br />
ropa spricht, macht einen Unterschied. Er wirbt um Verständnis<br />
für die Gründungsväter, die Europa ohne die Bevölkerung<br />
erschaffen hätten, weil sie einer aufgeklärten<br />
Avantgarde angehörten; er selbst will aber nun aus dem<br />
Elite- ein Bürgerprojekt machen und fordert naheliegende<br />
Schritte zur demokratischen Selbstermächtigung der europäischen<br />
Bürger gegen die nationalen Regierungen, die<br />
sich im Europäischen Rat gegenseitig blockieren. So fordert<br />
er für die Europawahlen nicht nur ein allgemeines<br />
Wahlrecht, sondern auch eine Kandidatenaufstellung nach<br />
länderübergreifenden Parteilisten. Das befördert nämlich<br />
die Ausbildung eines europäischen Parteiensystems, ohne<br />
das aus dem Straßburger Parlament kein Ort werden kann,<br />
wo gesellschaftliche Interessen über die Grenzen der jeweils<br />
eigenen Nation hinweg verallgemeinert und zur Geltung<br />
gebracht werden können.<br />
Wenn man die Bedeutung von Emmanuel Macron<br />
richtig einschätzen will, kommt noch ein dritter<br />
Aspekt in Betracht, eine persönliche Eigenschaft:<br />
Er kann reden. Es handelt sich in seinem Fall nicht nur<br />
um einen Politiker, der sich durch seine rhetorische Begabung<br />
und die Sensibilität für das geschrieben Wort Aufmerksamkeit,<br />
Ansehen und Einfluss erwirbt. Vielmehr<br />
verleiht die genaue Wahl seiner inspirierenden Sätze und<br />
die Artikulationskraft der Rede dem politischen Gedanken<br />
selbst analytische Schärfe und eine ausholende Perspektive.<br />
Norbert Lammert war bei uns der Letzte, der Erinnerungen<br />
an die großen Bundestagsdebatten von Gustav<br />
Heinemann, Adolf Arndt und Fritz Erler in der frühen<br />
Bundesrepublik geweckt hat. Natürlich bemisst sich die<br />
Qualität der Ausübung des Politikerberufs nicht am rednerischen<br />
Talent. Aber Reden können die Wahrnehmung<br />
der Politik in der Öffentlichkeit verändern, das Niveau<br />
heben und den Horizont einer öffentlichen Debatte erweitern.<br />
Und damit auch die Qualität nicht nur der politischen<br />
Willensbildung, sondern des politischen Handelns<br />
selber.<br />
Wo die Formlosigkeit der Talkshows zum Maßstab für<br />
Komplexität und Atemlänge des öffentlich zulässigen<br />
politischen Gedankens wird, fällt Macron durch das Format<br />
seiner Reden auf. Anscheinend fehlt uns die Wahrnehmungsfähigkeit<br />
für solche Qualitäten, sogar für das<br />
Wann und Wo einer Rede. So war die Rede, die Macron<br />
vor Kurzem im Rathaus von Paris aus Anlass des Reformationsjubiläums<br />
gehalten hat, nicht nur inhaltlich interessant;<br />
sie war nicht nur ein geschickter Versuch, den<br />
Rückblick auf die Geschichte der Konfessionskämpfe in<br />
Frankreich zur Anpassung einer Staatsdoktrin, des strengen<br />
französischen Laizismus, an die Anforderungen einer<br />
pluralistischen Gesellschaft zu nutzen. Anlass und Thema<br />
der Rede waren zugleich eine Geste an die protestantisch<br />
geprägte Kultur des Nachbarlandes – und an die evangelische<br />
Kollegin in Berlin.<br />
Natürlich sind uns Anspruch und Stil, staatliche Macht<br />
zu repräsentieren, spätestens seit dem nostalgischen Blick<br />
eines Carl Schmitt auf die französische Gegenaufklärung<br />
im 19. Jahrhundert fremd geworden. Uns mag der Sinn<br />
für die Gravitas eines Lebens im Élysée-Palast fehlen, den<br />
Macron im SPIEGEL-Gespräch hochhält. Aber die intimere<br />
Kenntnis der hegelschen Geschichtsphilosophie, mit der<br />
er auf die Frage nach Napoleon als dem „Weltgeist zu<br />
Pferde“ reagiert, ist dann doch wieder eindrucksvoll. ■<br />
136 DER SPIEGEL 43 / 2017
Das ideale Familiengeschenk!<br />
Süddeutsche Zeitung Familie bietet Eltern und Kindern zwischen vier und elf<br />
Jahren ein abwechslungsreiches Leseerlebnis – perfekt zum gemeinsamen Lesen,<br />
Basteln und Entdecken! Zwei Hefte in einem. Eins für Eltern, eins für Kinder.<br />
Zum<br />
Verschenken<br />
oder<br />
Selberlesen!<br />
Das Kinderheft<br />
ist werbefrei.<br />
Jetzt bestellen unter:<br />
sz.de/sz-familie<br />
089/21 83 10 00
SPIEGEL Semester-Sparabo!<br />
STUDENTEN LESEN EIN HALBES JAHR ZUM HALBEN PREIS.<br />
26 x<br />
DER SPIEGEL<br />
für nur<br />
€ 63,70<br />
Rosenzweig & Schwarz, Hamburg<br />
Ja, ich möchte von den Vorteilen profitieren!<br />
Ich lese als Student(in) den SPIEGEL 6 Monate für nur € 63,70<br />
statt € 127,40 im Einzelkauf und kann danach jederzeit zur<br />
nächsterreichbaren Ausgabe kündigen!<br />
Gleich mitbestellen:<br />
Das Digital-Upgrade für Tablet,<br />
Smartphone und PC/Mac für<br />
nur € 0,50 pro Ausgabe extra.<br />
Einfach jetzt anfordern:<br />
abo.spiegel.de/sparabo<br />
p 040 3007-2700 (Bitte Aktionsnummer angeben: SP17-205)
Kultur<br />
Jenseits des Zauns<br />
Filmkritik In ihrer melancholischen<br />
Komödie „Sommerhäuser“ erzählt Sonja<br />
Maria Kröner vom Ende eines Idylls.<br />
Kinostart: 26. Oktober<br />
Die Kinder tollen über die Wiese und klettern ins<br />
Baumhaus, Vati reibt Mutti die Schultern mit Sonnenmilch<br />
ein, die Großtante sitzt in der bunt gemusterten<br />
Hollywoodschaukel und strickt. Eine deutsche<br />
Familie im Sommer 1976. Wie schön das alles ausschaut.<br />
Wenn nur die lästigen Wespen nicht wären.<br />
Im Garten ragt der Stumpf eines Baumes in den blauen<br />
Himmel, gerade zerstört von einem Blitz, genau an dem<br />
Tag, als Uroma beerdigt wurde. Nun packen alle mit an,<br />
der Vater, der Großvater, die Kinder, sie zersägen den<br />
Baum und transportieren ihn ab. Und der Film „Sommerhäuser“<br />
macht aus der Familienidylle Kleinholz.<br />
Die deutsche Regisseurin Sonja Maria Kröner<br />
zeigt die Siebziger als eine Zeit, in der<br />
vieles brüchig wird, Bäume und Rollenbilder,<br />
soziale Strukturen und verbindende Werte.<br />
Die Familie könnte das Holz auftürmen und<br />
anzünden. Aber das Lagerfeuer würde sie<br />
nicht mehr vereinen.<br />
Bernd (Thomas Loibl), Enkel der verstorbenen<br />
Urgroßmutter Sophie, schlurft mit Vollbart<br />
und kalkweißen Beinen durch den Garten,<br />
seine Kinder tanzen ihm auf der Nase<br />
herum, vor seinem Vater Erich (Günther Maria<br />
Halmer) kuscht er. Seine Frau Eva (Laura<br />
Tonke) hat Angst, dass Bernds Schwester Gitti<br />
(Mavie Hörbiger) vom Erbe mehr abkriegt.<br />
Gitti trägt eine goldene Bluse und einen<br />
orange roten Rock. Die Klamotten habe ihr<br />
ein alter Verehrer spendiert, sagt sie stolz.<br />
„Alt sind sie ja immer“, gibt Eva zurück.<br />
Großtante Ilse (Ursula Werner) hat ihre<br />
Mutter Sophie bis zum Tod gepflegt. Sie<br />
möchte, dass alles so bleibt, dass die Familie<br />
hier jeden Sommer wieder zusammenkommt. Alle anderen<br />
wollen das Grundstück verkaufen.<br />
Die Regisseurin Kröner wurde 1979 in München geboren<br />
und studierte dort Film. Bislang drehte sie Videoinstallationen<br />
und Kurzfilme. Für „Sommerhäuser“ erhielt sie<br />
bereits einige Preise.<br />
Regisseurinnen wie Maren Ade, Nicolette Krebitz, Maria<br />
Schrader oder Valeska Grisebach haben sich in den vergangenen<br />
Jahren an neue Themen, Stile und Erzählweisen<br />
herangewagt. War das deutsche Kino in jüngerer Zeit<br />
frisch und ungewöhnlich, war es meist weiblich.<br />
In „Sommerhäuser“ ist von der ersten Szene an zu spüren,<br />
dass auch Kröner einen ganz eigenen Blick auf die<br />
Welt wirft. Sie zeigt ihre Figuren in seltsam verdrehten,<br />
aus der Balance geratenen Einstellungen. Immer ragt etwas<br />
ins Bild, verstellt etwas den Blick. Diese Welt ist zu<br />
kantig und zu sperrig, um sie in Bilder zu fassen.<br />
Doch das ändert sich jäh, als das Runde ins Eckige<br />
kommt, als die kleine Jana (Emilia Pieske), Tochter von<br />
Eva und Bernd, ins Bild springt, auf einem dieser Hüpfbälle,<br />
wie sie in den Siebzigern in Mode waren. Die Kamera<br />
folgt Jana in einer langen Einstellung quer durch<br />
den Garten. Es wirkt befreiend.<br />
Hier ist eine Regisseurin, die weiß, wie eine einzige Bewegung<br />
einen Film aufreißt und den Zuschauer einmal<br />
tief durchatmen lässt. Ein Kind, das die Familiengeheimnisse<br />
und Zwistigkeiten kaum kennt, hüpft fröhlich und<br />
ausgelassen mitten durch das Minenfeld.<br />
Einmal verstecken sich Jana und Gittis Tochter Inga<br />
(Anne-Marie Weisz) unter einem Esstisch. <strong>Der</strong> Film nimmt<br />
den Blick der Kinder ein. Sie sehen, wie die Erwachsenen<br />
Platz nehmen, sich ihre Schuhe ausziehen und darüber<br />
reden, was mit dem Grundstück geschehen soll. Unter<br />
dem Tisch bekommen Jana und Inga versteckte Berührungen<br />
der Erwachsenen mit, die verraten, was wirklich<br />
in ihnen vorgeht. Kröner macht daraus eine wunderbare<br />
Szene, in der die Zuschauer mit den Mädchen erahnen,<br />
wie in dieser Familie geschachert und taktiert wird.<br />
Und es sind auch die Kinder, die in „Sommerhäuser“<br />
die Welt jenseits der Familie erkunden. Jana hüpft auf ihrem<br />
Ball bis vor einen Zaun am Rande des Grundstücks<br />
und klettert durch eine Lücke auf die andere Seite. Dort<br />
tut sich ein märchenhafter Wald auf, düster und verwunschen,<br />
an den Ästen hängen Puppen.<br />
Darsteller Hörbiger, Loibl, Tonke: Kleinholz aus der Großfamilie<br />
Wie der Regisseur David Lynch in seinem Film „Blue<br />
Velvet“ oder in seiner TV-Serie „Twin Peaks“ zeigt Kröner,<br />
dass die Idylle und der Horror Nachbarn sein können. Ein<br />
Kindermörder hält sich in der Gegend auf, er schneidet<br />
seinen Opfern Hände und Füße ab.<br />
Kröner fügt diese ganzen scheinbar disparaten Elemente<br />
zusammen. Sie nutzt den Horror, um die Familiengeschichte<br />
aufzuladen. Sie holt sich beim französischen Kino den<br />
Mut, einen Film zu machen, in dem wenig passiert, außer<br />
dass ein paar Leute bei großer Sommerhitze im Garten<br />
abhängen. Und sie entwickelt aus der Komik Tragik.<br />
Am Ende des Films ist die Familie über den Garten verteilt,<br />
jeder für sich, in sich gekehrt, sprachlos. Es ist Herbst,<br />
Laub fällt von den Bäumen, Ilse fegt es zusammen. <strong>Der</strong><br />
Sommer, in dem man in der Hollywoodschaukel saß, im<br />
Bassin planschte und Wespen jagte, ist weit weg.<br />
Lars-Olav Beier<br />
PROKINO FILMVERLEIH<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
139
Impressum<br />
Ericusspitze 1, 20457 Hamburg, Telefon 040 3007-0 · Fax -2246 (Verlag), -2247 (Redaktion)<br />
HERAUSGEBER Rudolf Augstein<br />
(1923 – 2002)<br />
CHEFREDAKTEUR<br />
Klaus Brinkbäumer (V. i. S. d. P.)<br />
STELLV. CHEFREDAKTEURE<br />
Susanne Beyer, Dirk Kurbjuweit,<br />
Alfred Weinzierl<br />
HAUPTSTADTBÜRO Leitung: René Pfister,<br />
Michael Sauga, Christiane Hoffmann<br />
(stellv.). Redaktion Politik und Wirtschaft:<br />
Nicola Abé, Dr. Melanie Amann, Markus<br />
Dettmer, Veit Medick, Ann-Katrin Müller,<br />
Ralf Neukirch, Cornelia Schmergal, Christoph<br />
Schult, Anne Seith, Britta Stuff,<br />
Gerald Traufetter. Autoren, Reporter:<br />
Markus Feldenkirchen, Konstantin von<br />
Hammerstein, Marc Hujer, Christian<br />
Reiermann, Marcel Rosenbach<br />
DEUTSCHLAND Leitung: Cordula Meyer,<br />
Dr. Markus Verbeet. Redaktion: Laura<br />
Backes, Katrin Elger, Michael Fröhlingsdorf,<br />
Hubert Gude, Charlotte Klein,<br />
Miriam Olbrisch, Andreas Ulrich, Antje<br />
Windmann, Michael Wulzinger.<br />
Meldungen: Annette Bruhns. Autoren,<br />
Reporter: Jan Fleischhauer, Annette Großbongardt,<br />
Julia Jüttner, Beate Lakotta,<br />
Bruno Schrep (frei), Hans-Ulrich Stoldt,<br />
Katja Thimm, Dr. Klaus Wiegrefe<br />
Berliner Büro Leitung: Frank Hornig.<br />
Redaktion: Maik Baumgärtner, Sven<br />
Becker, Sven Röbel, Michael Sontheimer<br />
(frei), Andreas Wassermann, Wolf<br />
Wiedmann-Schmidt. Autoren, Reporter:<br />
Stefan Berg, Martin Knobbe<br />
WIRTSCHAFT Leitung: Armin Mahler,<br />
Susanne Amann (stellv.), Markus Brauck<br />
(stellv.). Redaktion: Simon Hage, Isabell<br />
Hülsen, Alexander Jung, Nils Klawitter,<br />
Alexander Kühn, Martin U. Müller, Ann-<br />
Kathrin Nezik, Simone Salden. Autoren,<br />
Reporter: Hauke Goos, Michaela Schießl<br />
AUSLAND Leitung: Britta Sandberg,<br />
Juliane von Mittelstaedt (stellv.), Mathieu<br />
von Rohr (stellv.). Redaktion: Fiona Ehlers,<br />
Katrin Kuntz, Jan Puhl, Tobias Rapp, Sandra<br />
Schulz, Samiha Shafy, Helene Zuber.<br />
Autoren, Reporter: Marian Blasberg,<br />
Clemens Höges, Susanne Koelbl, Dietmar<br />
Pieper, Christoph Reuter<br />
WISSENSCHAFT UND TECHNIK Leitung:<br />
Rafaela von Bredow, Olaf Stampf.<br />
Redaktion: Dr. Philip Bethge, Manfred<br />
Dworschak, Marco Evers, Dr. Veronika<br />
Hackenbroch, Guido Kleinhubbert, Julia<br />
Koch, Kerstin Kullmann, Hilmar Schmundt,<br />
Frank Thadeusz, Christian Wüst. Autor:<br />
Jörg Blech<br />
KULTUR Leitung: Elke Schmitter, Sebastian<br />
Hammelehle (stellv.). Redak tion: Tobias<br />
Becker, Lars-Olav Beier, Anke Dürr, Ulrike<br />
Knöfel, Katharina Stegelmann, Claudia<br />
Voigt, Martin Wolf. Autoren, Reporter:<br />
Georg Diez, Dr. Martin Doerry, Lothar<br />
Gorris, Wolfgang Höbel, Dr. Nils Minkmar,<br />
Volker Weidermann<br />
GESELLSCHAFT Leitung: Matthias Geyer,<br />
Özlem Gezer (stellv.), Guido Mingels<br />
(stellv.). Redaktion: Maik Große kathöfer,<br />
Barbara Hardinghaus, Maren Keller,<br />
Dialika Neu feld, Claas Relotius, Jonathan<br />
Stock, Takis Würger. Autoren, Reporter:<br />
Uwe Buse, Ullrich Fichtner, Jochen-Martin<br />
Gutsch (frei), Alexander Osang, Cordt<br />
Schnibben, Alexander Smoltczyk, Barbara<br />
Supp<br />
SPORT Leitung: Udo Ludwig. Redaktion:<br />
Thilo Neumann, Gerhard Pfeil, Christoph<br />
Winterbach<br />
INVESTIGATIVREPORTER Rafael Busch -<br />
mann, Jürgen Dahlkamp, Gunther Latsch,<br />
Jörg Schmitt (investigativ-reporter@<br />
spiegel.de). Koordination SPIEGEL ONLINE:<br />
Jörg Diehl, Koordination SPIEGEL TV:<br />
Roman Lehberger<br />
SONDERTHEMEN Leitung: Dr. Susanne<br />
Weingarten, Dr. Eva-Maria Schnurr<br />
(stellv.). Redaktion: Markus Deggerich,<br />
Uwe Klußmann, Joachim Mohr, Bettina<br />
Musall, Dr. Johannes Saltzwedel. Autorin:<br />
Marianne Wellershoff<br />
KOORDINATION MEINUNG Markus Feldenkirchen,<br />
Christiane Hoffmann<br />
SPIEGEL PLUS Alexander Neubacher<br />
DEIN SPIEGEL Leitung: Detlef Hacke,<br />
Bettina Stiebel. Redaktion: Antonia Bauer,<br />
Claudia Beckschebe, Alexandra Schulz<br />
CHEF VOM DIENST Thomas Schäfer,<br />
Anke Jensen (stellv.)<br />
Schlussredaktion: Gesine Block; Christian<br />
Albrecht, Gartred Alfeis, Ulrike Boßerhoff,<br />
Regine Brandt, Lutz Diedrichs, Bianca<br />
Hunekuhl, Ursula Junger, Dörte Karsten,<br />
Sylke Kruse, Christine Kuhlmann,<br />
Katharina Lüken, Stefan Moos, Reimer<br />
Nagel, Sandra Pietsch, Fred Schlotterbeck,<br />
Sebastian Schulin<br />
Produktion: Petra Thormann, Reinhard<br />
Wilms; Kathrin Beyer, Michele Bruno,<br />
Sonja Friedmann, Linda Grimmecke, Petra<br />
Gronau, Ursula Overbeck, Britta Romberg,<br />
Martina Treumann, Rebecca von Hoff,<br />
Katrin Zabel<br />
BILDREDAKTION Leitung: Michaela<br />
Herold, Claudia Jeczawitz (stellv.); Tinka<br />
Dietz, Sabine Döttling, Torsten Feldstein,<br />
Thorsten Gerke, Andrea Huss, Elisabeth<br />
Kolb, Petra Konopka, Matthias Krug,<br />
Parvin Nazemi, Peer Peters, Anke Wellnitz<br />
E-Mail: bildred@spiegel.de<br />
SPIEGEL Foto USA: Susan Wirth,<br />
Tel. +1 212 3075948<br />
GRAFIK UND MULTIMEDIA Leitung: Jens<br />
Radü. Grafik-Team: Cornelia Baumermann,<br />
Thomas Hammer; Ludger Bollen,<br />
Max Heber, Anna-Lena Kornfeld, Gernot<br />
Matzke, Cornelia Pfauter, Michael Walter.<br />
Multimedia-Team: Alexander Epp,<br />
Roman Höfner, Marco Kasang, Bernhard<br />
Riedmann<br />
LAYOUT Leitung: Jens Kuppi, Reinhilde<br />
Wurst; Michael Abke, Lynn Dohrmann,<br />
Claudia Franke, Bettina Fuhrmann, Ralf<br />
Geilhufe, Kristian Heuer, Elsa Hundertmark,<br />
Louise Jessen, Nils Küppers,<br />
Annika Loebel, Leon Lothschütz,<br />
Sebastian Raulf, Florian Rauschenberger,<br />
Barbara Rödiger<br />
TITELBILD Leitung: Katja Kollmann,<br />
Johannes Unselt (stellv.); Suze Barrett,<br />
Iris Kuhlmann<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN<br />
DEUTSCHLAND<br />
BERLIN Alexanderufer 5, 10117 Berlin;<br />
Deutsche Politik, Wirtschaft<br />
Tel. 030 886688-100, Fax 886688-111;<br />
Deutschland, Wissenschaft, Kultur,<br />
Gesellschaft Tel. 030 886688-200,<br />
Fax 886688-222<br />
DRESDEN Steffen Winter, Wallgäßchen 4,<br />
01097 Dresden, Tel. 0351 26620-0,<br />
Fax 26620-20<br />
DÜSSELDORF Frank Dohmen, Lukas Eberle,<br />
Fidelius Schmid , Jägerhofstraße 19-20,<br />
40479 Düsseldorf, Tel. 0211 86679-01,<br />
Fax 86679-11<br />
FRANKFURT AM MAIN Matthias Bartsch,<br />
Martin Hesse, An der Welle 5,<br />
60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 9712680,<br />
Fax 97126820<br />
KARLSRUHE Dietmar Hipp, Waldstraße 36,<br />
76133 Karlsruhe, Tel. 0721 22737,<br />
Fax 9204449<br />
MÜNCHEN Anna Clauß, Dinah Deckstein,<br />
Jan Friedmann, Rosental 10,<br />
80331 München,<br />
Tel. 089 4545950, Fax 45459525<br />
REDAKTIONSVERTRETUNGEN AUSLAND<br />
BANGALORE Laura Höflinger, 811,<br />
10th A Main Road, Suite No. 114, 1st Floor,<br />
Bangalore – 560 038<br />
BOSTON Johann Grolle, 25 Gray Street,<br />
02138 Cambridge, Massachusetts,<br />
Tel. +1 857 9197115<br />
BRÜSSEL Peter Müller,<br />
rue Le Titien 28, 1000 Brüssel,<br />
Tel. +32 2 2306108, Fax 2311436<br />
ISTANBUL Maximilian Popp,<br />
Tel. +90 5413971567<br />
KAPSTADT Bartholomäus Grill,<br />
P. O. Box 15614, Vlaeberg 8018, Kapstadt,<br />
Tel. +27 21 4261191<br />
KIEW Luteranska wul. 3, kw. 63,<br />
01001 Kiew, Tel. +38 050 3839135<br />
LONDON Jörg Schindler, 26 Hanbury<br />
Street, London E1 6QR,<br />
Tel. +44 203 4180610, Fax +44 207 0929055<br />
MADRID Apartado Postal Número 100 64,<br />
28080 Madrid, Tel. +34 650652889<br />
Ein Impressum mit dem Verzeichnis der Namenskürzel aller Redakteure finden Sie unter www.spiegel.de/kuerzel<br />
Mail spiegel@spiegel.de<br />
MOSKAU Christian Esch, Glasowskij<br />
Pereulok Haus 7, Office 6, 119002 Moskau,<br />
Tel. +7 495 22849-61,<br />
Fax 22849-62<br />
NEW YORK Philipp Oehmke, 10 E 40th<br />
Street, Suite 3400, New York, NY 10016,<br />
Tel. +1 212 2217583, Fax 3026258<br />
PARIS Julia Amalia Heyer,<br />
137 Rue Vieille du Temple, 75003 Paris,<br />
Tel. +33 1 58625120, Fax 42960822<br />
PEKING Bernhard Zand, P.O. Box 170,<br />
Peking 100101, Tel. +86 10 65323541,<br />
Fax 65325453<br />
RIO DE JANEIRO Jens Glüsing,<br />
Caixa Postal 56071, AC Urca,<br />
22290-970 Rio de Janeiro-RJ,<br />
Tel. +55 21 2275-1204<br />
ROM Walter Mayr, Largo Chigi 9,<br />
00187 Rom, Tel. +39 06 6797522,<br />
Fax 6797768<br />
SAN FRANCISCO Thomas Schulz,<br />
1 Post Street, Suite 2750, San Francisco,<br />
CA 94104, Tel. +1 212 2217583<br />
TEL AVIV P.O. Box 8387,<br />
Tel Aviv-Jaffa 61083<br />
TOKIO Dr. Wieland Wagner, Asagaya<br />
Minami 2-31-15 B, Suginami-ku,<br />
Tokio 166-0004, Tel. +81 3 6794 7828<br />
WARSCHAU P. O. Box 31,<br />
ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warschau,<br />
Tel. +48 22 6179295<br />
WASHINGTON Christoph Scheuermann,<br />
1202 National Press Building, Washington,<br />
D.C. 20045, Tel. +1 202 3475222,<br />
Fax 3473194<br />
DOKUMENTATION Leitung: Dr. Hauke<br />
Janssen, Cordelia Freiwald (stellv.), Peter<br />
Wahle (stellv.); Zahra Akhgar, Dr.<br />
Susmita Arp, Viola Broecker, Dr. Heiko<br />
Buschke, Johannes Eltzschig, Klaus<br />
Falkenberg, Catrin Fandja, Dr. André<br />
Geicke, Thorsten Hapke, Susanne Heitker,<br />
Carsten Hellberg, Stephanie Hoffmann,<br />
Bertolt Hunger, Kurt Jansson, Stefanie<br />
Jockers, Michael Jürgens, Tobias Kaiser,<br />
Renate Kemper-Gussek, Ulrich Klötzer,<br />
Ines Köster, Anna Kovac, Peter Lakemeier,<br />
Dr. Walter Lehmann-Wiesner, Rainer<br />
Lübbert, Sonja Maaß, Nadine Markwaldt,<br />
Dr. Andreas Meyhoff, Gerhard Minich,<br />
Cornelia Moormann, Tobias Mulot, Bernd<br />
Musa, Nicola Naber, Claudia Niesen,<br />
Sandra Öfner, Dr. Vasilios Papadopoulos,<br />
Ulrike Preuß, Axel Rentsch, Thomas Riedel,<br />
Andrea Sauerbier, Maximilian Schäfer,<br />
Marko Scharlow, Mirjam Schlossarek,<br />
Dr. Regina Schlüter-Ahrens, Mario<br />
Schmidt, Andrea Schumann-Eckert, Ulla<br />
Siegenthaler, Meike Stapf, Rainer Staudhammer,<br />
Tuisko Steinhoff, Dr. Claudia<br />
Stodte, Rainer Szimm, Dr. Marc Theodor,<br />
Andrea Tholl, Nina Ulrich, Ursula<br />
Wamser, Peter Wetter, Holger Wilkop,<br />
Karl-Henning Windelbandt, Anika Zeller,<br />
Malte Zeller<br />
NACHRICHTENDIENSTE AFP, AP, dpa,<br />
Los Angeles Times / Washington Post,<br />
New York Times, Reuters, sid<br />
SPIEGEL-VERLAG RUDOLF AUGSTEIN<br />
GMBH & CO. KG<br />
Verantwortlich für Anzeigen:<br />
André Pätzold<br />
Gültige Anzeigenpreisliste Nr. 71 vom<br />
1. Januar 2017<br />
Mediaunterlagen und Tarife:<br />
www.spiegel.media<br />
Verantwortlich für Vertrieb:<br />
Stefan Buhr<br />
Verantwortlich für Herstellung:<br />
Silke Kassuba<br />
Druck:<br />
Stark Druck,<br />
Pforzheim<br />
VERLAGSLEITUNG Jesper Doub<br />
GESCHÄFTSFÜHRUNG Thomas Hass<br />
✁<br />
Service<br />
Leserbriefe<br />
SPIEGEL-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg<br />
www.spiegel.de/leserbriefe, Fax: 040 3007-2966<br />
E-Mail: leserbriefe@spiegel.de<br />
Hinweise für Informanten<br />
Falls Sie dem SPIEGEL vertrauliche Dokumente und Informationen<br />
zukommen lassen wollen, stehen Ihnen folgende<br />
Wege zur Verfügung:<br />
Post: DER SPIEGEL, c/o Investigativ, Ericusspitze 1,<br />
20457 Hamburg<br />
Telefon: 040 3007-0, Stichwort „Investigativ“<br />
E-Mail (Kontakt über Website): www.spiegel.de/investigativ<br />
Unter dieser Adresse finden Sie auch eine Anleitung, wie<br />
Sie Ihre Informationen oder Dokumente durch eine<br />
PGP-Verschlüsselung geschützt an uns richten können.<br />
<strong>Der</strong> dazugehörende Fingerprint lautet:<br />
6177 6456 98CE 38EF 21DE AAAA AD69 75A1 27FF 8ADC<br />
Redaktioneller Leserservice<br />
Telefon: 040 3007-3540 Fax: 040 3007-2966<br />
E-Mail: leserservice@spiegel.de<br />
Nachdruckrechte / Lizenzen für Texte, Fotos, Grafiken<br />
Nachdruck und Speicherung in digitalen Medien nur mit<br />
schriftlicher Genehmigung des Verlags.<br />
Für Deutschland, Österreich, Schweiz:<br />
E-Mail: lizenzen@spiegel.de, Telefon: 040 3007-3540<br />
Fax: 040 3007-2966<br />
Für alle anderen Länder: The New York Times Syndicate<br />
E-Mail: ilaria.parogni@nytimes.com, Telefon: +1 212 556-<br />
5118<br />
Nachbestellungen SPIEGEL-Ausgaben der letzten Jahre sowie<br />
alle Ausgaben von SPIEGEL GESCHICHTE und SPIEGEL<br />
WISSEN können unter www.amazon.de/spiegel versand -<br />
kostenfrei innerhalb Deutschlands nachbestellt werden.<br />
Historische Ausgaben Historische Magazine Bonn<br />
www.spiegel-antiquariat.de Telefon: 0228 9296984<br />
Abonnement für Blinde Audio Version, Deutsche<br />
Blindenstudienanstalt e.V. Telefon: 06421 606265<br />
Elektronische Version, Frankfurter Stiftung für Blinde<br />
Telefon: 069 9551240<br />
Abonnementspreise<br />
Inland: 52 Ausgaben € 239,20<br />
Studenten Inland: 52 Ausgaben € 163,80<br />
Auslandspreise unter www.spiegel.de/ausland<br />
Mengenpreise auf Anfrage.<br />
<strong>Der</strong> digitale SPIEGEL: 52 Ausgaben € 213,20<br />
(der Anteil für das E-Paper beträgt € 187,20)<br />
Befristete Abonnements werden anteilig berechnet.<br />
Abonnentenservice Persönlich erreichbar<br />
Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr, Sa. 10.00 – 18.00 Uhr<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg<br />
Telefon: 040 3007-2700 Fax: 040 3007-3070<br />
E-Mail: aboservice@spiegel.de<br />
Abonnementsbestellung<br />
bitte ausschneiden und im Briefumschlag senden an:<br />
SPIEGEL-Verlag, Abonnenten-Service, 20637 Hamburg –<br />
oder per Fax: 040 3007-3070, www.spiegel.de/abo<br />
Ich bestelle den SPIEGEL<br />
❏ für € 4,60 pro gedruckte Ausgabe<br />
❏ für € 4,10 pro digitale Ausgabe (der Anteil für das<br />
E-Paper beträgt € 3,60)<br />
❏ für € 0,50 pro digitale Ausgabe (der Anteil für das E-Paper<br />
beträgt € 0,49) zusätzlich zur gedruckten Ausgabe. <strong>Der</strong> Bezug<br />
ist zur nächsterreichbaren Ausgabe kündbar. Alle Preise inkl.<br />
MwSt. und Versand. Das An gebot gilt nur in Deutschland. Bitte<br />
liefern Sie den SPIEGEL an:<br />
Name, Vorname des neuen Abonnenten<br />
Straße, Hausnummer oder Postfach<br />
PLZ, Ort<br />
E-Mail (notwendig, falls digitaler SPIEGEL erwünscht)<br />
Ich zahle nach Erhalt der Rechnung.<br />
Hinweise zu den AGB und meinem Widerrufsrecht finde ich<br />
unter www.spiegel.de/agb<br />
INTERNET www.spiegel.de<br />
REDAKTIONSBLOG spiegel.de/spiegelblog<br />
TWITTER @derspiegel<br />
FACEBOOK facebook.com/derspiegel<br />
DER SPIEGEL (USPS no 0154520) is published weekly by SPIEGEL VERLAG. Known<br />
Office of Publication: German Language Publications Inc, 153 S Dean St, Englewood NJ<br />
07631, 1-855-457-6397. Periodicals postage is paid at Paramus NJ 07652. Postmaster:<br />
Send address changes to: DER SPIEGEL, GLP, PO Box 9868, Englewood NJ 07631.<br />
Datum, Unterschrift des neuen Abonnenten<br />
SP17-003, SD17-006<br />
SD17-008 (Upgrade)<br />
140 DER SPIEGEL 43 / 2017
Nachrufe<br />
GOTTFRIED BÖTTGER, 67<br />
Er war Raggi Ragtime, der Boogie-Man, er wollte Spaß –<br />
und das war wohl sein Erfolgsrezept: <strong>Der</strong> Pianist Gottfried<br />
Böttger vereinte großes technisches Können mit der Gabe,<br />
sein Publikum mitzureißen. Die Freude am Spiel wollte er<br />
auf seine Zuhörer übertragen, das war seine Philosophie,<br />
und deswegen, sagte er einmal, bevorzuge er Ragtime. In<br />
einem musikalischen Elternhaus groß geworden, lernte<br />
Böttger schon als Kind das Klavierspielen, als Jugendlicher<br />
spielte er mit Musikern aus einem kirchlichen Posaunenchor<br />
in seiner ersten Jazzband. Als junger Mann war er<br />
dann Mitbegründer der Band Leinemann, des Panikorchesters<br />
von Udo Lindenberg und anderer Combos. Böttger<br />
gehörte zum Kern der Hamburger Szene, die Anfang der<br />
Siebziger im Onkel Pö residierte. <strong>Der</strong> Klub war ein internationaler<br />
Treffpunkt für Jazzmusiker wie Chet Baker, Chick<br />
Corea, Pat Metheny – und Al Jarreau startete hier seine<br />
Weltkarriere. <strong>Der</strong> in Hamburg geborene Böttger machte<br />
zahlreiche Aufnahmen, unter anderem mit Lonzo Westphal<br />
und dem Blues-Pianisten Memphis Slim. Er komponierte<br />
Bühnen- und TV-Musik und lehrte von 1997 an Mediendidaktik,<br />
später wurde er zum Professor ernannt. Seit<br />
1974 war er der Mann am Klavier in der Talkshow<br />
„3nach9“, rund 3000 Gäste und 40 Moderatoren erlebte er<br />
in 40 Jahren als TV-Pianist. <strong>Der</strong> Kabarettist Hans Scheibner<br />
überschrieb einen Nachruf auf seinen Freund mit der<br />
Zeile: „Gotti spielt jetzt auf Wolke 4“. Gottfried Böttger<br />
starb am 16. Oktober in Hamburg an Krebs. ks<br />
WOLFGANG BÖTSCH, 79<br />
<strong>Der</strong> promovierte Jurist gehörte zu<br />
jener raren Spezies von Politikern,<br />
die sich durch ihr Wirken selbst<br />
überflüssig machen. Als letzter<br />
Postminister brachte Bötsch von<br />
1993 bis 1997 die Privatisierung<br />
von Telekom, Post und Postbank<br />
auf den Weg und setzte die Nachfolgeunternehmen<br />
des ehemaligen<br />
Staatsmonopolisten Bundespost dem Wett bewerb aus. Als<br />
Konsequenz fiel sein Ressort weg. Seine Karriere begann<br />
Bötsch als Kommunalpolitiker der CSU im Stadtrat von<br />
Würzburg. 1976 zog er als direkt gewählter Abgeordneter<br />
seiner Heimatstadt in den Bundestag ein. <strong>Der</strong> bei Freunden<br />
wie Gegnern wegen seiner Jovialität geschätzte Unterfranke<br />
bekleidete wichtige Ämter in der gemeinsamen<br />
Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Er stieg zum Parlamentarischen<br />
Geschäftsführer auf und lei tete von 1989 an<br />
bis zu seiner Berufung ins Kabinett Kohl die CSU-Landesgruppe.<br />
Nach seinem Rückzug aus der Bundesregierung<br />
wirkte er als Justiziar der Unionsfraktion. 2005 schied er<br />
aus dem Bundestag aus und arbeitete fortan als Anwalt,<br />
unter anderem für Telekommunikationsrecht – einen Bereich,<br />
den er entscheidend geprägt hat. Wolfgang Bötsch<br />
starb am 14. Oktober in Würzburg. rei<br />
SEPP SPIEGEL / IMAGO<br />
PA / INTERTOPICS<br />
ROY DOTRICE, 94<br />
Seine erste Rolle soll die der<br />
guten Fee in Aschenputtel gewesen<br />
sein, während seiner<br />
Zeit als Kriegsgefangener in<br />
Deutschland. Später studierte<br />
Dotrice an der Royal Academy<br />
of Dramatic Art und stand<br />
bald auf der Bühne, zunächst<br />
in Hunderten Theaterstücken<br />
in der britischen Provinz. Sein<br />
feines, subtiles Spiel begeisterte<br />
Kritiker und Publikum gleichermaßen,<br />
besonders deutlich<br />
wird das an der Laufzeit<br />
des Ein-Mann-Stücks „Brief<br />
Lives“, in dem er 1782-mal als<br />
der Autor und Chronist John<br />
Aubrey (1626 bis 1697) auftrat;<br />
das brachte dem Schauspieler<br />
einen Eintrag ins Guinness-<br />
Buch der Rekorde. Sowohl in<br />
Großbritannien als auch den<br />
USA war er ein beliebter TV-<br />
Seriendarsteller. In dem oscarprämierten<br />
Kinofilm „Amadeus“<br />
(1984) ist er als Mozarts<br />
Vater zu sehen. Zuletzt wurde<br />
er für „Game of Thrones“ als<br />
Hallyne aus der Gilde der Alchimisten<br />
beschäftigt. Beiderseits<br />
des Atlantiks blieb indes<br />
die Bühne sein liebster Ort.<br />
Roy Dotrice starb am 16. Oktober<br />
in London. ks<br />
RICHARD WILBUR, 96<br />
Schon mit acht Jahren hat er<br />
sein erstes Gedicht veröffentlicht.<br />
Vielleicht muss man so<br />
früh beginnen, um gleich zwei<br />
Pulitzerpreise im Leben zu<br />
gewinnen. Wilbur war Soldat<br />
im Zweiten Weltkrieg, zunächst<br />
als Kryptograf, später<br />
wurde er, wegen ideologischer<br />
Unzuverlässigkeit, als<br />
Infanterist in Italien und<br />
Deutschland eingesetzt. Er<br />
studierte in Harvard, lehrte<br />
unter anderem an der Wes -<br />
leyan-Universität. Kritiker<br />
glaubten in seinen leisen,<br />
menschenfreundlichen Naturgedichten<br />
eine Reaktion auf<br />
ZUMA PRESS / IMAGO<br />
die Schrecken des Krieges zu<br />
erkennen. Wilbur hat das<br />
stets verneint. Er übersetzte<br />
Molières „Tartuffe“ ins Englische,<br />
schrieb für Leonard<br />
Bernsteins Musical „Candide“<br />
Liedtexte, und den protestierenden<br />
Studenten widmete er<br />
1970 das Gedicht „For the Student<br />
Strikers“. Seit 1948<br />
schrieb er für den „New Yorker“.<br />
Sein letztes Gedicht, das<br />
er dort veröffentlichte, endet<br />
so: „Jetzt legt der lange blaue<br />
Schatten dieser Bäume / sich<br />
auf den Schnee und kommt<br />
zur Ruhe.“ Richard Wilbur<br />
starb am 14. Oktober in Belmont,<br />
Massachusetts. vw<br />
JEREMY, ALTER UNBEKANNT<br />
Landlungenschnecken sind<br />
Hermaphroditen; das erleichtert<br />
grundsätzliche Dinge des<br />
Lebens, die Fortpflanzung zum<br />
Beispiel, denn jede kann mit jeder<br />
Nachwuchs zeugen. Jeremy<br />
allerdings war anders als<br />
die anderen: Ein links- statt eines<br />
rechtsgedrehten Hauses außen<br />
und innen alle Organe auf<br />
der anderen Seite als üblich, inklusive<br />
der Geschlechts teile –<br />
Jeremy schien zur Keuschheit<br />
verdammt, als er auf einem<br />
Londoner Komposthaufen entdeckt<br />
wurde. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
dass das Tier ein<br />
gleichgedrehtes treffen würde,<br />
ging gegen null. Dann starteten<br />
Forscher einen internationalen<br />
Aufruf, schließlich sind die<br />
seltenen linken Schnecken für<br />
die Genforschung von allergrößtem<br />
Interesse. Tomeu und<br />
Lefty wurden gefunden. Ein<br />
Drama entspann sich, denn die<br />
beiden vergnügten sich zunächst<br />
nur miteinander statt<br />
mit Jeremy; Tomeu hatte<br />
schließlich doch noch ein Einsehen.<br />
Die Nachkommen der<br />
drei sind allerdings alle rechtsgedreht,<br />
die Forscher hoffen<br />
nun auf die Enkelgeneration.<br />
Jeremy wurde am 11. Oktober<br />
tot aufgefunden. ks<br />
DR. ANGUS DAVISON<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
141
NICHOLAS KAMM / AFP<br />
Bilder, Menschen und Geschichte<br />
Das Gespür für die gesellschaftliche Bedeutung zeitgenössischer<br />
Kunst hat den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama,<br />
56, und seine Frau Michelle, 53, mit Auszug aus dem Weißen<br />
Haus nicht verlassen. Im Gegenteil: Die Wahl der Maler ihrer<br />
beider Porträts für die Smithsonian National Portrait Gallery<br />
in Washington, in der Bilder aller ehemaligen Präsidenten gezeigt<br />
werden, ist ebenso kunstsinnig wie politisch bedeutsam.<br />
Das Bildnis des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten wird<br />
Kehinde Wiley malen, das der ehemaligen First Lady soll<br />
Amy Sherald auf die Leinwand bringen. Wiley ist im Gegensatz<br />
zu Sherald bereits sehr bekannt, beide malen vor allem<br />
figu rativ, beide sind Afroamerikaner. Die Obamas umgaben<br />
sich im Weißen Haus mit zeitgenössischer afroamerikanischer<br />
Kunst; ihre Entscheidung für Wiley und Sherald ist in Zeiten<br />
des offenen Rassismus ein deutliches Bekenntnis. Und trägt<br />
dazu bei, den Anspruch der Portrait Gallery zu erfüllen, „die<br />
amerikanische Geschichte durch die Menschen zu erzählen,<br />
die sie geprägt haben“. ks<br />
VENTURELLI / GETTY IMAGES<br />
1000 Watt<br />
Die laut Magazin „People“<br />
„schönste Frau der Welt“,<br />
Julia Roberts, 49, feiert am<br />
28. Oktober ihren runden Geburtstag<br />
– und sieht dem Ehrentag<br />
offenbar mit einer gehörigen<br />
Portion Gelassenheit<br />
entgegen. Gelassener jedenfalls<br />
als ein Teil der Klatschpresse.<br />
Vor einem Monat<br />
meldete Radar Online, die<br />
Schauspielerin und ewige<br />
„Pretty Woman“ durchleide<br />
wohl eine Midlife-Crisis,<br />
sie gebe Tausende Dollar für<br />
neue Kleidung und Kosmetikprodukte<br />
aus. Schlimmer<br />
noch: Sie, die – angeblich –<br />
ihrem Körpergewicht nie Beachtung<br />
geschenkt habe,<br />
halte eine strenge vegane<br />
Diät, um abzunehmen. Vergangene<br />
Woche allerdings<br />
kam schon wieder die (beruhigende)<br />
gegenteilige Meldung<br />
von Daily Mail Online:<br />
Roberts ohne Make-up gesichtet,<br />
total leger, strahlend<br />
und keineswegs klapperdürr.<br />
Die Frau mit dem 1000-<br />
Watt-Lächeln dürfte Meisterin<br />
darin sein, all die Spekulationen<br />
über ihr Privatleben<br />
und das Geheimnis ihrer<br />
Schönheit schlicht zu ignorieren,<br />
um ihre Nerven zu<br />
schonen. In einem Interview<br />
mit „Harper’s Bazaar“ sagte<br />
sie mit Blick auf ihren<br />
bevorstehenden Geburtstag:<br />
„Zu viele Gedanken und<br />
zu viel Grübeln, das erschöpft<br />
mich. Es geht doch<br />
weiter voran, oder etwa<br />
nicht?“ In diesem Sinne:<br />
Happy Birthday! ks<br />
142 DER SPIEGEL 43 / 2017
Personalien<br />
Überraschung!<br />
Zeit für Gesichter<br />
Zwei Tage nach ihrem Kennenlernen<br />
machten sich die<br />
Nouvelle-Vague-Legende<br />
Agnès Varda, 89, und der Fotograf<br />
und Streetart-Künstler JR,<br />
34, an die Arbeit – und ein<br />
Regie-Dream-Team war geboren.<br />
Auf einem 18-monatigen<br />
Roadtrip porträtierte das Duo<br />
die Bewohner ländlicher Regionen<br />
in Frankreich, darunter<br />
viele, die sich vom Fortschritt<br />
abgehängt fühlen. <strong>Der</strong><br />
Dokumentarfilm „Visages Villages“<br />
(auf Deutsch „Gesichter<br />
Dörfer“) zeigt die Begegnungen<br />
und die Fotoaktionen<br />
JRs, der die Gesichter der<br />
Nein, Salman Rushdie hatte natürlich<br />
nicht erwartet, dass<br />
ihm der amerikanische Präsident<br />
zum 70. Geburtstag<br />
gratulieren würde, den der indischstämmige<br />
Autor im<br />
Sommer in New York feierte.<br />
Schließlich hatte er gerade<br />
„Golden House“ geschrieben,<br />
einen Gesellschaftsroman,<br />
in dem Donald Trump, nur<br />
wenig verkleidet<br />
als die Comicfigur<br />
„Joker“, sein blutiges<br />
Unwesen<br />
treibt. „Aber“, so<br />
sagte er jetzt dem<br />
SPIEGEL, „ein anderer<br />
Präsident<br />
hat mir gratuliert,<br />
völlig aus dem<br />
Blauen heraus.<br />
Und zwar der<br />
deutsche Bundespräsident.<br />
Ich war total<br />
überrascht.“ Frank-Walter<br />
Steinmeier beließ es nicht<br />
bei einem Glückwunschschreiben,<br />
er lud Rushdie, der<br />
vor wenigen Tagen seine<br />
Deutschlandtournee beendet<br />
hat, ins Schloss Bellevue ein.<br />
Ende November soll er, zusammen<br />
mit weiteren Gästen,<br />
„über das aufklärerische<br />
Poten zial von Literatur und<br />
über die Verteidigung der<br />
Meinungs-, Kunstund<br />
Wissenschaftsfreiheit<br />
gegen<br />
Fanatismus<br />
und antiintellektuelle<br />
Ressentiments<br />
sprechen“,<br />
so Steinmeier.<br />
Rushdie hat schon<br />
zugesagt. Sein<br />
Freund Daniel<br />
Kehlmann wird<br />
auch kommen. vw<br />
CHAD BATKA / DER SPIEGEL<br />
Menschen in Überlebensgröße<br />
plakatierte. <strong>Der</strong> Film ist auch<br />
ein Dokument der Freundschaft<br />
zwischen den ungleichen<br />
Filmemachern. Varda<br />
habe ihn manchmal mitten in<br />
der Nacht mit der Video-App<br />
Facetime angerufen, wenn ihr<br />
Ideen für den Film gekommen<br />
seien, erzählt JR. Ihr Gesicht<br />
habe er dabei aber nicht gesehen,<br />
sondern meist nur ihre<br />
Haare. Sechs Monate lang waren<br />
die beiden für den Kinofilm<br />
auf Werbetour. Dafür ist<br />
Varda in Zukunft ihre Zeit zu<br />
schade. Sie wolle lieber fürs<br />
Fernsehen drehen – da reichten<br />
zehn Minuten Promotion<br />
pro Sendung. smo<br />
EVERETT COLLECTION / PICTURE ALLIANCE / DPA<br />
<strong>Der</strong> Augenzeuge<br />
„Riesige Summen“<br />
Die Aktienkurse steigen und steigen – trotz vieler internationaler<br />
Krisen und Gefahren. Vergangene Woche hat der Deutsche<br />
Aktienindex Dax mehrfach die Marke von 13 000 Punkten<br />
überschritten. <strong>Der</strong> angehende Bankkaufmann Florian<br />
Schürmann, 21, Auszubildender bei der Sparkasse Bielefeld,<br />
war mit seiner Berufsschulklasse bei der Deutschen Börse in<br />
Frankfurt am Main, um das Geschäft mit den Aktien im Zentrum<br />
des Wertpapierhandels zu beobachten.<br />
„Ich finde das beeindruckend, wenn man von der Besuchertribüne<br />
aus auf den Handelssaal der Börse herunterschaut.<br />
Man erlebt hier live, was man sonst immer nur<br />
im Fernsehen sieht, die Entwicklung der Märkte in Echtzeit.<br />
Auf den ersten Blick wirkt das alles ganz ruhig. Es<br />
gibt keine sichtbare Hektik oder laut rufenden Händler,<br />
wie das wohl früher mal war. Bis auf einen kleinen<br />
Bruchteil findet der Handel komplett per Computer<br />
statt. Aber wenn man sich überlegt, welche riesigen<br />
Summen in jeder Sekunde den Besitzer wechseln, dann<br />
ist das fast schon ein wenig beunruhigend. Im Prinzip<br />
weiß ich zwar, wie der Handel funktioniert, aber im Detail<br />
kennt man die Systeme, mit denen die Geschäfte abgewickelt<br />
werden, dann doch nicht. Das ist ein bisschen<br />
eine Blackbox. Trotzdem muss man Vertrauen in die Abläufe<br />
haben, sonst funktioniert das ganze System nicht.<br />
<strong>Der</strong> Börsenhandel fasziniert mich, seit ich als kleiner<br />
Junge mit meinem Vater den Film „Wall Street“ gesehen<br />
habe. Es ist schockierend, wie skrupellos und zerstörerisch<br />
man dort wirken kann. Andererseits finde ich spannend,<br />
welche Chancen die Börse bietet. Aber natürlich<br />
gibt es Risiken. Wie wirkt sich der Brexit aus, was passiert<br />
bei internationalen Krisen wie in Nordkorea? Man<br />
muss immer damit rechnen, dass es an der Börse auch<br />
wieder runtergeht. Jetzt könnte so ein Punkt erreicht<br />
sein, an dem der Markt sich mal wieder erholt und überbewertete<br />
Aktien auf einen gerechtfertigten Preis sinken.<br />
Wer sein Geld nur kurzfristig anlegen will, sollte vorsichtig<br />
sein mit Aktien. Aber bei langfristigen Anlagen<br />
kommt man um Aktien nicht herum, finde ich. Das gilt<br />
gerade für uns junge Leute, die an ihre Altersvorsorge<br />
denken. Ich selbst habe einen Sparplan, meine vermögenswirksamen<br />
Leistungen sind in Aktien angelegt, zwei<br />
Einzelaktien und einen Fonds. Ich glaube, wenn man<br />
sehr langfristig denkt, macht man keinen Fehler, auch<br />
jetzt noch einzusteigen.“ Aufgezeichnet von Matthias Bartsch<br />
PETER JÜLICH / DER SPIEGEL<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017 143
„Die Praxis wird über den Erfolg der Theorie entscheiden. Die<br />
Jugendlichen der Vorstädte wird man nicht mit Mozart erreichen.“<br />
Gernot Hilge, Münster<br />
Ein Lichtblick ist er allemal<br />
Nr. 42/2017 „Ich bin nicht arrogant.<br />
Ich sage und tue, was ich mag.“ SPIEGEL-Gespräch<br />
mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron<br />
Was für ein wunderbares Interview. Von<br />
Macrons Worten geht eine beeindruckende<br />
Kraft aus, die mir Mut macht. Allein der<br />
Satz „Ehrgeiz ist nie bescheiden“ ist ein<br />
Diktum fürs Zitatelexikon. Er scheint mir<br />
nicht nur „Frankreichs letzte Chance“ zu<br />
sein, sondern Europas größte (und dringend<br />
benötigte) Chance.<br />
Prof. Dr. Florian Krötz, München<br />
Emmanuel Macron ist eine charismatische<br />
Blendgranate. <strong>Der</strong> kleine Sonnenkönig aus<br />
Frankreich möchte ein neues Europa, sein<br />
neues Europa. Nicht mehr Demokratie,<br />
nicht Stärkung der Regionen, nicht mehr<br />
Bürgerbeteiligung oder gar direktdemokratische<br />
Elemente, sein Ziel ist die Schaffung<br />
eines europäischen Superstaats, geführt<br />
und gelenkt von einer technokratischen<br />
Elite. Eine Fata Morgana der Arroganz.<br />
Raffaele Ferdinando Schacher, Rorschach (Schweiz)<br />
Dass der Herr Macron Journalisten genau<br />
an dem Tag einlädt, an dem er am Abend<br />
das „kleine Volk“ – Schulklassen aus sozial<br />
schwachen Vierteln, Angestellte des Palasts<br />
mit ihren Familien – im Palast zu einem<br />
Konzert einlädt, entlarvt eine beispiellose<br />
Inszenierung dieses Präsidenten, der<br />
sich „volksnah“ geben will. Er hat ja wohl<br />
in den wenigen Monaten, die er in seinem<br />
Schloss verbracht hat, viel an Spontaneität<br />
verloren und übt sich jetzt darin, den Menschen<br />
da draußen ein bürgernahes Bild<br />
von sich selbst zu geben. Was für ein<br />
Schmierentheater! Außer Privilegien für<br />
die Elite Frankreichs abzuschaffen, hat er<br />
bis jetzt so gut wie gar nichts geleistet.<br />
Brigitte Wolfsteiner, Merkenbach (Hessen)<br />
Wegen Macron auf dem Titel habe ich mal<br />
wieder den SPIEGEL gekauft und bin mehr<br />
als überrascht worden. Tolles Interview!<br />
<strong>Der</strong> Leitartikel von Barbara Supp war auch<br />
gut! Und gefallen haben mir auch die Artikel<br />
zum Fall Weinstein und zum Klima.<br />
Dr. Beate Mücke, Berlin<br />
Was ist denn nun eigentlich Macrons „Erzählung“?<br />
Gerade im SPIEGEL wird in letzter<br />
Zeit sehr häufig die Wichtigkeit der<br />
„Erzählung“ in der Politik beschworen.<br />
Was das eigentlich bedeuten soll, wird dabei<br />
großzügig im Unklaren belassen. Als<br />
Beispiel für etwas einer Erzählung zumindest<br />
Ähnliches fällt mir der Ursprungs -<br />
mythos der Goten ein. Natürlich konnten<br />
auch die Nazis und andere totalitäre Regime<br />
ihre Herrschaft auf eine Fülle von Erzählungen<br />
stützen. All diese Erzählungen<br />
haben gemeinsam, dass es sich um dreiste,<br />
wenn auch meist sehr elaborierte Lügengeschichten<br />
handelt, die fast immer dazu<br />
dienen, eine sehr autoritäre Regierung<br />
zu legitimieren. Ist es also das, was der<br />
SPIEGEL gemeinsam mit Macron in der<br />
europäischen Politik vermisst? Oder ist<br />
Ihnen vielleicht doch nur der Begriff der<br />
politi schen Vision zu abgedroschen?<br />
Colin Sauter, Stuttgart<br />
Präsident Macron, SPIEGEL-Redakteure<br />
Dieses großartige Gespräch in einem großartigen<br />
Ambiente erinnert mich an Gedanken<br />
des ebenfalls großartigen Essayisten<br />
und Frankreichliebhabers Friedrich Sieburg<br />
aus dem Jahre 1939 in seinem „Blick<br />
durchs Fenster“. Nein, nein, Frankreich sei<br />
gegen das Heroische, Napoleons Heldentum<br />
mit der französischen Art nicht vereinbar,<br />
das Lebensgefühl dieses egoistischen<br />
und gesunden Volkes habe die Idee<br />
des Heldischen wie einen Bazillus ausgeschieden.<br />
Wird das Heldentum durch den<br />
Präsidenten Macron möglicherweise erneut<br />
entflammt werden können?<br />
Karl-Heinz Groth, Goosefeld (Schl.-Holst.)<br />
Was hat eine Vermögensteuer mit Neid zu<br />
tun? Jedes Vermögen in Unternehmerhand<br />
wurde maßgeblich von Arbeitern und Angestellten<br />
mitverdient, die Steuer kann als<br />
Anzahlung für ein bedingungsloses Grundeinkommen<br />
verwendet werden, zur Ankurbelung<br />
der Wirtschaft. Denn hier<br />
kommt eine Tatsache ins Spiel, die Herr<br />
Macron offenbar nicht verinnerlicht hat:<br />
„Alle Wirtschaft geht vom Bürger aus“,<br />
also von Leuten wie Ihnen und mir. Ein<br />
einfaches Gedankenexperiment mag dies<br />
verdeutlichen: Wenn der Bürger nichts<br />
JEROME BONNET / DER SPIEGEL<br />
kauft, kann der Unternehmer noch so viel<br />
investieren – es kommt dabei nur Investitionsonanie<br />
heraus. Oder Überproduktion.<br />
Wolfgang Luckner, Bonn<br />
Herr Macron hat nett geplaudert. Zu sagen<br />
hat er den einfachen Franzosen und Deutschen<br />
jedoch nichts, was uns Malochern<br />
wichtig wäre, denn wie seine geschätzte<br />
Kollegin Frau Merkel lebt er in einer Welt,<br />
die mit dem Leben der kleinen Leute nun<br />
überhaupt nichts zu tun hat.<br />
Guido Zander, Brügge (Schl.-Holst.)<br />
Fast so gut wie Wehner<br />
Nr. 41/2017 SPIEGEL-Gespräch mit Gregor Gysi über<br />
sein Leben in der DDR und Humor in der Politik<br />
Schon lange bin ich beim Lesen nicht mehr<br />
so unterhalten worden. Nebenbei liefert<br />
Gysi auch noch die Erklärungen, warum die<br />
AfD im Osten so erfolgreich ist. Das fängt<br />
mit der damals so hochgelobten Bürgerbewegung<br />
an. Gegen vieles sein, aber keinen<br />
konstruktiven Vorschlag bringen – heißt das<br />
nicht jetzt AfD? Dann dieses Dauergenöle<br />
von selbst ernannten Gutmenschen, die den<br />
Ossi erziehen wollen. Wie heißt es so schön:<br />
Erst wenn der letzte inquisitorische Eiferer<br />
damit aufhört, mit der Unrechtsstaatkeule<br />
auf die ostdeutschen Normalbürger einzudreschen,<br />
werdet ihr merken, dass die bundesdeutsche<br />
Grundordnung auf unaufge -<br />
arbeitetem braunen Sumpf aufbaut. Aber<br />
zu diesem Thema gibt es keinen Aufschrei,<br />
keinen Generalverdacht, dem sich die westdeutsche<br />
Bevölkerung stellen müsste. <strong>Der</strong><br />
gilt nur für den Osten. Den Menschen, die<br />
ihr Arbeitsleben hier verbrachten, jetzt eine<br />
geringe Rente haben und zusehen mussten,<br />
wie größtenteils drittklassige Westimporte<br />
ihre Arbeitsplätze plattmachten und sich<br />
selbst die bestbezahlten Posten sicherten,<br />
wird nach wie vor von der Politik suggeriert,<br />
Menschen zweiter Klasse zu sein. Gysi und<br />
Marx haben etwas gemeinsam: Ihre Analyse<br />
ist richtig. Es nutzt nur nix. Die Macht haben<br />
andere.<br />
Bodo Lehmann, Dahme/Mark (Brandenb.)<br />
Ich hätte Gysi als Bundeskanzler gewählt,<br />
wenn es denn die Gelegenheit gäbe. <strong>Der</strong><br />
eloquenteste und einer der intelligentesten<br />
Parlamentarier der letzten Jahrzehnte.<br />
Fast so gut wie Wehner.<br />
Helmut Neff, Karlsruhe<br />
Die markanten Punkte des Gesprächs<br />
bestätigen meine Meinung über Gysi als<br />
Prototyp des glatten Winkeladvokaten, der<br />
144 DER SPIEGEL 43 / 2017
Briefe<br />
seinen Mantel immer rechtzeitig in den<br />
Wind gehängt hat. <strong>Der</strong> entlarvendste Satz,<br />
„Auch das Unrecht stand immerhin im Gesetz“,<br />
erinnert mich fatal an die Aussage<br />
des Nazijuristen Filbinger: „Was damals<br />
Recht war, kann doch heute kein Unrecht<br />
sein.“<br />
Jürgen Neunaber, Oldenburg (Nieders.)<br />
Die Justiz war in der DDR und anderen<br />
sozialistischen Staaten erklärtermaßen Teil<br />
des Herrschaftsapparats. Dazu gehörten<br />
auch ausnahmslos alle Anwälte. Wenn<br />
Linkenpolitiker Gysi<br />
Gysi im Interview erzählt, die Entscheidung,<br />
Anwalt zu werden, wäre ein „bisschen<br />
Auflehnung“, wirkt das für mich als<br />
ehemaligen DDR-Bürger wenig glaubhaft.<br />
In kaum einem Studienfach gab es in der<br />
DDR ähnlich restriktive Zugangsbeschränkungen<br />
wie bei Jura. Hauptvoraussetzung<br />
war absolute Systemtreue.<br />
Fred Walkow, Altjeßnitz (Sachs.-Anh.)<br />
Nach Gysis Argumentation wäre das Nazi -<br />
regime kein Unrechtsstaat, denn durch die<br />
Nürnberger Gesetze war ja schließlich alles<br />
gesetzlich geregelt. Im Strafgesetzbuch der<br />
DDR existierte der Paragraf 99: „Wer der<br />
Geheimhaltung nicht unterliegende Nachrichten<br />
zum Nachteil der Deutschen Demokratischen<br />
Republik… übergibt… sammelt<br />
… zugänglich macht … wird mit Freiheitsstrafe<br />
von zwei bis zu zwölf Jahren<br />
bestraft.“ Alles gesetzlich geregelt! Über<br />
20 Jahre hat es gedauert, ehe ich anlässlich<br />
einer Bundestagsdebatte von ihm zum ersten<br />
Mal so etwas hörte wie: die DDR wünsche<br />
sich ja niemand zurück. Aber dieser<br />
ehemalige Vorsitzende der Partei der Spalter<br />
wird von den Medien nach wie vor<br />
hofiert als DDR-Kenner und plustert sich<br />
dabei auf als Sprecher der angeblich von<br />
bornierten „Wessis“ gedemütigten „gelernten<br />
DDR-Bürger“. Schwer erträglich für<br />
alle, die unter den „gelernten DDR-Bürgern“<br />
gelitten haben! Mit besten Grüßen<br />
und langjähriger Sympathie für Ihr einst<br />
illegal gelesenes und von der „Stasi“ beschlagnahmtes<br />
und für Vernehmungs -<br />
zwecke in einem grünlichen Panzerschrank<br />
verwahrtes Blatt.<br />
Michael Verleih, Hanau (Hessen)<br />
HANNES JUNG / DER SPIEGEL<br />
<strong>Der</strong> Staat ist weggewandert<br />
Nr. 40/2017 Essay: <strong>Der</strong> AfD-Erfolg<br />
im Osten trübt die Einheitsfeiern am 3. Oktober<br />
Als neuer Bundesbürger mit „Migrationshintergrund<br />
DDR“ hat mich die in diesem<br />
Essay zum Ausdruck gebrachte westdeutsche<br />
Arroganz geradezu empört. <strong>Der</strong> Verfasser<br />
wirft den Ostdeutschen vor, sie seien<br />
„auf dem Weg zur Selbstdesintegration aus<br />
dem Konsens der liberalen Gesellschaft“,<br />
und verkennt dabei, dass eine liberale Gesellschaft<br />
wohl in der Lage sein sollte, andere<br />
Meinungen auszuhalten. Wenn der<br />
Verfasser sich im Osten wie in einer Kolonie<br />
fühlte, so liegt es wohl daran, dass der<br />
Osten im Jahre 1990 „beigetreten“ wurde<br />
und nicht mit dem anderen Teil Deutschlands<br />
„wiedervereinigt“. Nicht einmal die<br />
Nationalhymne der DDR, „Auferstanden<br />
aus Ruinen und der Zukunft zugewandt,<br />
lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland,<br />
einig Vaterland“, die wir unter SED-<br />
Herrschaft nicht mehr singen durften (!),<br />
fand Aufnahme in einer „wiedervereinigten“<br />
deutschen Nationalhymne.<br />
Gerd Nagel, Wurzbach (Thür.)<br />
DER SPIEGEL Lieber Herr Nagel, ich bin selbst<br />
am 3. 10. 1990 der Bundesrepublik Deutschland<br />
„beigetreten“. Ich bedauere allerdings<br />
zutiefst, inzwischen zu „westdeutscher Arroganz“<br />
fähig zu sein. Herzlich<br />
Stefan Berg, Autor im Deutschlandressort des SPIEGEL<br />
Noch nie habe ich eine so treffende, aber<br />
nicht abschätzige Beschreibung der Befindlichkeiten<br />
der Menschen in den neuen Bundesländern<br />
gelesen.<br />
Astrid Sperling-Theis, Baden-Baden<br />
Wir Ossis haben die Mauer umgekippt!<br />
Wir haben, neben anderem, 108179 Quadratkilometer<br />
mitgebracht. Ihr habt so viel<br />
bekommen: bis dahin völlig unerreichbare<br />
Immobilien, Ländereien, Nationalparks,<br />
Blechschild mit Reichsadler<br />
Firmen samt den dazugehörigen Märkten,<br />
die sich bis Wladiwostok erstrecken, Versicherungsnehmer,<br />
Käufer eurer Altautos,<br />
Konsumenten, Kunstwerke, Forschungs -<br />
ergebnisse. Was für Geschenke! Und dann<br />
diese jährlich anschwellende Undankbarkeit.<br />
Warum jammert ihr immer noch?<br />
Gerhard Mühlhausen, Berlin<br />
SASCHA STEINACH / DPA<br />
Ein guter Artikel. Ex-DDRler muss man<br />
global als Migranten begreifen, auch wenn<br />
sie nicht selbst gewandert sind: Ihr Staat<br />
ist weggewandert, verschwunden, und das<br />
stellte sie vor die Frage, ob sie sich in das<br />
Aufnahmeland integrieren können, ob<br />
man sie dort will und, wenn ja, mit wie<br />
viel Recht auf eigene Tradition, „Religion“,<br />
Besonderheit. Sie können also sehen, wie<br />
schwer die Integration für die Migranten<br />
sein kann.<br />
Reinhard Wolff, Aachen<br />
Abenteuerliche Geschichte<br />
Nr. 41/2017 3200 Jahre alte Hieroglyphen<br />
könnten das Rätsel um den Untergang der Imperien<br />
im östlichen Mittelmeer lösen<br />
Nachdem der SPIEGEL bereits vor knapp<br />
20 Jahren, in Ausgabe 53/1998, jedes Wort<br />
von dem trostlosen Unsinn begierig aufgesogen<br />
hat, mit dem Herr Zangger seine<br />
absurde Identifikation von Troja mit Atlantis<br />
zu begründen versuchte, geht er nun<br />
dem Herrn aufs Neue auf den Leim und<br />
betet in allen Details dessen rufmörderische<br />
Verunglimpfungen des verstorbenen<br />
Archäologen Manfred Korfmann nach,<br />
unbewiesene Plagiatsvorwürfe inklusive.<br />
Noch bevor die Authentizität des Textes<br />
überhaupt geprüft ist, auf den gestützt<br />
Zangger seine „neueste“ Theorie (die im<br />
Wesentlichen bereits 1994 formuliert<br />
wurde) zum Besten gibt, macht sich der<br />
SPIEGEL bereits zu seinem vorbehaltlosen<br />
Advokaten – und wirft dabei bedenkenlos<br />
Luwier und Seevölker durcheinander.<br />
Prof. Dr. Heinz-Günther Nesselrath, Universität Göttingen,<br />
Seminar für Klassische Philologie<br />
Eberhard Zangger hat wieder zugeschlagen.<br />
Als Beleg für seine Theorie präsentiert<br />
er die Kopie einer Hieroglyphen-Inschrift<br />
eines Großkönigs Kupanta-Kurunta<br />
aus dem Nachlass des britischen Archäologen<br />
James Mellaart, zu deren Entstehung<br />
eine abenteuerliche Geschichte präsentiert<br />
wird. Gegen Zanggers Theorie spricht,<br />
dass in den ägyptischen Quellen über die<br />
von den „Seevölkern“ zerstörten Länder<br />
auch Arzawa erscheint, der bedeutendste<br />
luwische Staat im westlichen Kleinasien.<br />
Woher ein wesentlicher Teil der „Seevölker“<br />
stammte, die Philister, nämlich aus<br />
dem mykenischen Griechenland, wissen<br />
wir aus ihrer materiellen Hinterlassenschaft<br />
im heutigen südlichen Israel. Daneben<br />
kamen die „Seevölker“ auch aus anderen<br />
Gebieten, so dem der europäischen<br />
Urnenfelderkultur.<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf-Dietrich Niemeier, Direktor emeritus<br />
des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen<br />
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe<br />
(leserbriefe@spiegel.de) gekürzt<br />
sowie digital zu veröffent lichen und unter<br />
www.spiegel.de zu archivieren.<br />
DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
145
Hohlspiegel<br />
Rückspiegel<br />
Aus der „Neuen Westfälischen“<br />
Aus der „Süddeutschen Zeitung“:<br />
„<strong>Der</strong> Schauspieler Casey Affleck wurde<br />
im vergangenen Jahr der wiederholten<br />
Belästigung bezichtigt – und gewann daraufhin<br />
einen Oscar.“<br />
Aus einem Werbeflyer der Stadt Jever<br />
Aus GuteKueche.at: „Köstliche Schoko-<br />
Mandeln werden im Backofen<br />
goldgelb gebacken. Zum Schluss wird<br />
das Rezept im Kakao gewälzt.“<br />
Aus RP Online: „Heute feiert<br />
Deutschland seine Einheit, dabei scheint<br />
die Spaltung zwischen Ost und West<br />
auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung<br />
noch nicht vollzogen.“<br />
Aus der „Dill-Post“ in Hessen:<br />
„Die Sperrung der Landstraße nach<br />
Nanzenbach hat begonnen, und<br />
ein Schlumpfloch gibt es auch nicht.“<br />
Kleinanzeige aus dem Informationsblatt<br />
„Schwabachbogen“<br />
Aus der Apothekenzeitschrift<br />
„Rätsel&Medizin“: „Früher gehörte ein<br />
Verdauungsschnaps für viele Menschen<br />
dazu. Er wurde zum Beispiel aus Enzianwurzeln<br />
gebrannt. Die Bitterstoffe aus<br />
den Wurzeln können gegen Völlegefühl<br />
und Belehrungen helfen.“<br />
Aus den „Lübecker Nachrichten“<br />
Aus den „Badischen Neuesten<br />
Nachrichten“: „Gerne<br />
verbringt der fünfköpfige Familienvater<br />
hier Zeit mit seiner Frau.“<br />
146 DER SPIEGEL 43 / 2017<br />
Jetzt im<br />
Handel<br />
www.spiegel-geschichte.de<br />
Lesen Sie dazu:<br />
Papstkritik<br />
Luthers geniales<br />
Marketing<br />
Revolte<br />
Aufstand der Bauern<br />
Religionskrieg<br />
<strong>Der</strong> Weg ins Desaster<br />
Zitate<br />
Die „Neue Zürcher Zeitung“<br />
zum SPIEGEL-Gespräch „Ich bin nicht<br />
arrogant“ mit Frankreichs Präsident<br />
Emmanuel Macron (Nr. 42/2017):<br />
Dem Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL<br />
hat er (Macron –Red.) … die französische<br />
Seele erklärt: „Die Franzosen wollen<br />
einen König wählen, aber sie wollen<br />
ihn auch jederzeit wieder stürzen können.“<br />
Das spiele keine Rolle. Ihm gehe<br />
es darum, dem Land zu nützen. Dann<br />
sagt er dies (und nun bitte festhalten):<br />
„Dafür brauchen wir eine Art politisches<br />
Heldentum.“ Soll man sich freuen oder<br />
fürchten?<br />
Die „Landeszeitung Lüneburg“ über die<br />
Folgen des SPIEGEL-Berichts „Es gab jedes<br />
Mal eine Schreierei“ im Mordprozess<br />
am Landgericht Lüneburg (Nr. 40/2017):<br />
Kompisch (der Richter –Red.) verwies<br />
auf … einen Artikel im SPIEGEL, dort<br />
kamen die Familien von Täter und Opfer<br />
zu Wort. Tenor: Es hatte bereits zuvor<br />
Streit zwischen Kristian G. (der Täter)<br />
und dem Kunden (das Opfer) gegeben …<br />
Von alldem will die Ehefrau nichts gewusst<br />
haben. Auch ihr Sohn nicht…<br />
Die „WAZ“ über Fragen von Herner<br />
Schülern an SPIEGEL-Redakteur Takis<br />
Würger zu seinem Roman „<strong>Der</strong> Club“:<br />
„Sind Adjektive böse?“ Das sei er<br />
in der Schule auch schon gefragt worden,<br />
sagte der Autor und erklärte: „Sie<br />
war traurig“ rufe bei den meisten nichts<br />
hervor. Aber wenn er eine Träne aus<br />
dem Augen winkel rollen und sie einen<br />
schwarzen Strich auf die Wange ziehen<br />
lasse, „haben alle ein Bild im Kopf“.<br />
Ehrungen<br />
Das SPIEGEL-Team Kristina Gnirke,<br />
Isabell Hülsen und Martin U. Müller wurde<br />
mit dem 1. Preis des Otto-Brenner-<br />
Preises für kritischen Journalismus für<br />
„Ein krankes Haus“ (SPIEGEL-Titel<br />
51/2016) ausgezeichnet. Die Autoren hätten<br />
mit ihrer Recherche über den<br />
Asklepios-Konzern „schonungslose Aufklärung<br />
über die Missstände im Gesundheitswesen“<br />
geleistet, so die Jury.<br />
SPIEGEL-Mitarbeiter Fritz Schaap erhielt<br />
den 2. Otto-Brenner-Preis für seine<br />
Serie über das kriegsgebeutelte Syrien.<br />
Schaaps Reportagen „Furcht und Betäubung“<br />
(Nr. 50/2016), „Es war einmal<br />
eine Nation“ (Nr. 7/2017) und „In der<br />
Hand der Gangster“ (Nr. 10/2017)<br />
seien „Kriegsberichterstattung im besten<br />
Sinne des Wortes“.
„Schwarzriesling!<br />
Hab' ich neu entdeckt! “<br />
Erstaunlich<br />
kräftig.<br />
Martin W., 59, Ingenieur<br />
Entdecken auch Sie den feinfruchtigen Roten neu!<br />
<strong>Der</strong> Schwarzriesling ist die Urform aller Burgundersorten. Erstaunlich kräftig in Farbe und Geschmack<br />
überzeugt der samtige Württemberger mit voller Frucht und Fülle. Ob zu einem leckeren Essen oder solo –<br />
dieser vielfältige Rotwein ist eine echte Alternative für alle Genießer. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg:<br />
Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.<br />
Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft e. G.<br />
Raiffeisenstraße 2 · 71696 Möglingen · Telefon 0 7141 4866-0 · www.wzg-weine.de · info@wzg-weine.de
1&1 ALL-NET-FLAT<br />
BIS 31.10.<br />
WECHSELN<br />
100,– € GUTHABEN *<br />
FLAT TELEFONIE<br />
FLAT INTERNET<br />
FLAT AUSLAND<br />
9, 99<br />
19, 99<br />
€/Monat*<br />
12 Monate,<br />
danach 19,99 €/Monat<br />
HUAWEI P10<br />
Sony Xperia XZ1<br />
Samsung Galaxy S8<br />
Internet<br />
made in<br />
Sofort<br />
starten:<br />
NACHT<br />
OVERNIGHT-<br />
1LIEFERUNG<br />
In Ruhe<br />
ausprobieren:<br />
MONAT<br />
1TESTEN<br />
Defekt?<br />
Morgen neu!<br />
TAG<br />
AUSTAUSCH<br />
1VOR ORT<br />
Germany<br />
02602 / 96 96<br />
* 24 Monate Vertragslaufzeit. Telefonate in dt. Fest- und Handynetze und in der gesamten EU inklusive. Einmaliger Bereitstellungspreis 29,90 €, kostenlose Overnight-Lieferung.<br />
Auf Wunsch mit Smartphone für 10,– € mehr pro Monat, ggf. zzgl. einmaligem Gerätepreis (Höhe geräteabhängig). Tarifpreis im E-Netz. Weitere Tarife ohne einmaligen Gerätepreis<br />
(Smartphone für 0,– €) sowie in D-Netz Qualität verfügbar. 100,– € Startguthaben zur Verrechnung nach dem 4. Vertragsmonat bei Wechsel des Mobilfunkanbieters und Mitnahme<br />
der Rufnummer. Preise inkl. MwSt. 1&1 Telecom GmbH, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur<br />
1und1.de