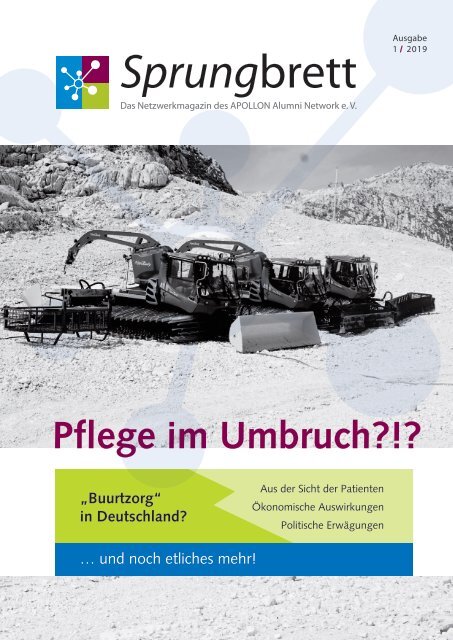Sprungbrett_Ausgabe 2019_01
Das Netzwerkmagazin des APOLLON Alumni Network e.V. Die aktuelle Auflage beschäftigt sich mit dem Thema "Buurtzorg" - ein niederländisches Pflegemodell und ob man so etwas auch in Deutschland implementieren kann. Wer Lust auf verschieden Sichtweisen dazu hat, ist in diesem Heft goldrichtig :-).
Das Netzwerkmagazin des APOLLON Alumni Network e.V.
Die aktuelle Auflage beschäftigt sich mit dem Thema "Buurtzorg" - ein niederländisches Pflegemodell und ob man so etwas auch in Deutschland implementieren kann.
Wer Lust auf verschieden Sichtweisen dazu hat, ist in diesem Heft goldrichtig :-).
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Sprungbrett</strong><br />
<strong>Ausgabe</strong><br />
1 / <strong>2<strong>01</strong>9</strong><br />
Das Netzwerkmagazin des APOLLON Alumni Network e. V.<br />
Pflege im Umbruch?!?<br />
„Buurtzorg“<br />
in Deutschland?<br />
Aus der Sicht der Patienten<br />
Ökonomische Auswirkungen<br />
Politische Erwägungen<br />
… und noch etliches mehr!
Editorial<br />
DIE VIERTE AUSGABE<br />
Liebe Vereinsmitglieder,<br />
liebe AbsolventInnen der APOLLON Hochschule,<br />
liebe APOLLONianerInnen, liebe LeserInnen,<br />
wir freuen uns, die mittlerweile vierte <strong>Ausgabe</strong> unseres Netzwerkmagazins zu veröffentlichen.<br />
Die Idee des Magazins entstand in unserem ersten BarCamp im Mai 2<strong>01</strong>7. Es lebt durch die<br />
Veröffentlichung von Artikeln von FachautorInnen aus unseren eigenen APOLLON Alumni-Reihen.<br />
Im letzten Jahr gesellte sich zu den Aktivitäten des Vereins ein weiteres Format im Nachgang des<br />
Apollon Symposiums hinzu: Unser erstes APOLLON Alumni World Café! Thema dieser Erstauflage<br />
war Buurtzorg, ein Projekt in den Niederlanden, das aktuell in Deutschland in die Modellphase<br />
läuft. So entstand das Thema für diese <strong>Sprungbrett</strong>-<strong>Ausgabe</strong>. Die AutorInnen beschäftigen<br />
sich in ihren Artikeln mit verschiedenen Aspekten des niederländischen Vorbilds sowie den<br />
Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Übertragbarkeit in die deutsche Versorgungslandschaft.<br />
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der vierten <strong>Ausgabe</strong> unseres Magazins.<br />
Sollten Sie in unserer <strong>Ausgabe</strong> noch kleinere Ecken und Kanten finden, ein Thema so interessant<br />
oder sogar abwegig finden und uns etwas dazu sagen wollen, dann freuen wir uns über ein<br />
offenes Feedback. Am besten direkt per E-Mail an info@apollon-alumni.de.<br />
Ihr Vorstand des APOLLON Alumni Network<br />
Michael Walch<br />
Schatzmeister<br />
Sabrina Reinhart<br />
Erste Vorsitzende<br />
Tobias Ulamec<br />
Zweiter Vorsitzender<br />
Die <strong>Sprungbrett</strong> <strong>Ausgabe</strong> 2/<strong>2<strong>01</strong>9</strong> erscheint im Oktober.<br />
2<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Lernen wir endlich von anderen?<br />
Alexandra Berendes 4<br />
Agilität und Selbstorganisation aus Patientensicht<br />
Janina Ehlers 8<br />
Agile Qualität<br />
Janina Ehlers 10<br />
Das Buurtzorg-Modell – ein Modell zur Kostensenkung in<br />
der ambulanten Pflege?<br />
Cornelia Baudisch 12<br />
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Dr. Barbara Mayerhofer MBA 15<br />
Ambulante Pflege in Deutschland nach dem Vorbild von Buurtzorg<br />
Dr. Felix Hoffmann 18<br />
Politische Überlegungen zu Buurtzorg in Deutschland<br />
Florian Bechtel 21<br />
Ob das gut gehen kann.<br />
Tobias Ulamec 24<br />
Unsere AutorInnen und Mitwirkenden in dieser <strong>Ausgabe</strong> 25<br />
Antrag auf Mitgliedschaft 26<br />
Wo möglich verwenden unsere AutorInnen Personenbezeichnungen, die alle Geschlechter einbeziehen.<br />
Aus Gründen der Lesbarkeit wird an anderen Stellen aber auf separate Benennungen verzichtet, es sind aber<br />
ausdrücklich alle Geschlechter gemeint.<br />
Impressum<br />
©: APOLLON Alumni Network e. V. – <strong>Ausgabe</strong> 1/<strong>2<strong>01</strong>9</strong><br />
Umschlagsgestaltung & Layout: APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft<br />
Bilder: Tobias Ulamec – Lektorat: Alexandra Berendes<br />
AutorInnen: Cornelia Baudisch, Florian Bechtel, Alexandra Berendes, Janina Ehlers, Dr. Felix Hoffmann,<br />
Dr. Barbara Mayerhofer, Tobias Ulamec<br />
Weitere Mitwirkende: Sabrina Reinhart, Michael Walch<br />
Verlag: APOLLON Alumni Network e.V. / Bremen – Druck: APOLLON Alumni Network e.V. / Bremen<br />
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung<br />
des Verlags und der Autorin bzw. des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder<br />
sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.<br />
www.apollon-alumni.de 3
Lernen wir endlich von anderen?<br />
Lernen wir endlich von anderen?<br />
Alexandra Berendes<br />
Der Pflegenotstand und die Unzufriedenheit eines ganzen Berufsstandes lassen sich nicht mehr wegdiskutieren. Ist<br />
ein niederländisches Vorbild mit hoher Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit bei nachgewiesener Effizienz für den<br />
deutschen Markt adaptierbar?<br />
Auch in der Pflege gilt<br />
der Grundsatz: ambulant<br />
vor stationär. In Anbetracht<br />
des Wunsches<br />
der allermeisten Menschen,<br />
auch als Pflegefall<br />
in ihrem eigenen<br />
Zuhause alt zu werden,<br />
[1] durchaus sinnvoll.<br />
Ein Blick auf die aktuellen<br />
Verhältnisse<br />
Unsere demografische<br />
und auch die soziale<br />
Entwicklung bedingen<br />
allerdings, dass immer<br />
mehr alte und potenziell<br />
damit auch kränkere Menschen<br />
alleine leben.<br />
Gerade in städtischen Ballungsräumen<br />
drohen genau diese Menschen<br />
absurderweise zu vereinsamen: die<br />
sozialen Gefüge sind hier weniger<br />
existent, geschweige denn belastbar.<br />
Der Mensch wird zum anonymen Wesen.<br />
Der „Nachbar“ hat nicht denselben<br />
Stellenwert wie noch in ländlich<br />
geprägten Strukturen.<br />
Reflex dieser Entwicklungen sind rasant<br />
steigende Pflegebedarfe, vor<br />
allem in der ambulanten Pflege.<br />
Demgegenüber stehen bereits Mitte<br />
2<strong>01</strong>8 36.000 unbesetzte Stellen<br />
in der Alten- und Krankenpflege, [2]<br />
Tendenz steigend. Dabei hat sich in<br />
der ambulanten Pflege die Anzahl<br />
der Beschäftigten zwischen 20<strong>01</strong> und<br />
2<strong>01</strong>7 mehr als verdoppelt. Allerdings<br />
arbeiten gerade mal 28% der ambulant<br />
tätigen Pflegenden in Vollzeit. [3]<br />
Die Altenpflege verzeichnet zudem<br />
im Vergleich der Gesundheitsberufe<br />
Jeder dieser Pflegedienste<br />
muss einen eigenen<br />
Vertrag mit den<br />
Pflegekassen abschließen,<br />
um Leistungen<br />
der ambulanten Pflege<br />
abrechnen zu können.<br />
Die Pflegekassen haben<br />
sich zwar im Gegensatz<br />
zu den gesetzlichen<br />
Krankenkassen<br />
zusammengeschlossen,<br />
haben aber die Zuständigkeiten<br />
– je nach<br />
Bundesland variierend<br />
Abbildung 1 aus: 6. Pflegebericht, S. 27.<br />
– aufgeteilt: Für den<br />
Vertrag mit den Pflegekassen<br />
im Kreis Münster (Stadt) ist also<br />
die meisten Arbeitsunfähigkeitstage.<br />
[4] Auch steigen viele Pflegende aus eine andere Kasse zuständig als etwa<br />
ihrem Beruf aus.<br />
für einen Vertrag im Kreis Steinfurt.<br />
Deutschlandweit agieren mehr als Die Abrechnung der Leistungen erfolgt<br />
nach sog. Leistungskomple-<br />
14.000 ambulante Pflegedienste, die<br />
im Schnitt je 59 Pflegebedürftige betreuen,<br />
allein in NRW sind 2.823 tätig Kleine Körperpflege etc. Hier muss<br />
xen, wie etwa Hilfe beim Aufstehen,<br />
mit einer durchschnittlich betreuten alles einzeln dokumentiert und vom<br />
Anzahl von 64,5 Kunden. [5]<br />
Leistungsempfänger gegengezeichnet<br />
werden. Und natürlich muss für<br />
Abbildung 2 aus: 6. Pflegebericht, S. 26.<br />
4<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Lernen wir endlich von anderen?<br />
jede diese Leistungen ein Zeitrahmen<br />
eingehalten werden, damit die Pflege<br />
rentabel bleibt.<br />
Aber nicht alles an ambulanter Pflege<br />
wird mit den Pflegekassen abgerechnet.<br />
Ambulante Pflegeleistungen lassen<br />
sich in zwei große Bereiche unterscheiden:<br />
zum einen die Leistungen<br />
nach SGB XI, dem Sozialgesetzbuch<br />
zur Sozialen Pflegeversicherung. Der<br />
Anspruch auf diese Leistungen begründet<br />
sich in der Feststellung eines<br />
Pflegegrades. Diese Leistungen werden<br />
als Grundpflege bezeichnet und<br />
umfassen Körperpflege, Ernährung,<br />
Mobilität, Vorbeugung (Prophylaxen),<br />
die Förderung von Eigenständigkeit<br />
und Kommunikation. Ist der Pflegegrad<br />
durch die Pflegekasse bewilligt<br />
und hat der ambulante Pflegedienst<br />
seinen Vertrag mit den Pflegekassen,<br />
muss jetzt zusätzlich ein Vertrag mit<br />
dem Pflegebedürftigen abgeschlossen<br />
werden, ggf. auch ein zusätzlicher<br />
Vertrag zur Privatliquidation sollten<br />
die Leistungen den Rahmen der bewilligten<br />
Pflege nach SGB XI überschreiten.<br />
Zum anderen werden Leistungen<br />
nach SGB V abgerufen, die also die<br />
Abbildung 3: Leistungskomplexe und Punkte – Beispielbild aus: Übersicht über ambulante<br />
Leistungskomplexe 2<strong>01</strong>5, Anlage H zum sechsten Pflegebericht<br />
gesetzliche Krankenkasse trägt. Diese<br />
sog. Behandlungspflege beinhaltet<br />
ausschließlich medizinische Leistungen,<br />
die ein Arzt bzw. eine Ärztin<br />
verordnet haben muss. Ausgeführt<br />
werden dürfen diese nur durch examinierte<br />
Pflegekräfte, die aber im<br />
Gegensatz zur Betreuung im Rahmen<br />
des SGB XI keinerlei Einfluss darauf haben,<br />
was angemessen ist.<br />
Die meisten ambulanten Pflegedienste<br />
müssen daher mit zwei Abrechnungsstellen<br />
und ggf. zusätzlich<br />
den Pflegebedürftigen oder deren gesetzlichen<br />
Vertretern kommunizieren.<br />
Das Modell Buurtzorg<br />
Im Zentrum der seit 2006 nach dem<br />
Vorbild der community nurses arbeitenden<br />
Buurtzorg-Teams stehen die<br />
Bedürfnisse des Patienten.<br />
Im Idealfall hat der Patient Kontakt zu<br />
genau zwei zuständigen Pflegenden,<br />
die um ihn herum ein Netzwerk aus<br />
Familie, Quartiersangeboten, Ärzten<br />
und Therapeuten aufbauen.<br />
Die kleinen Teams mit maximal 12<br />
Mitgliedern und einem klar begrenzten<br />
örtlichen Zuständigkeitsbereich<br />
organisieren sich komplett selbst, unterstützt<br />
durch den Einsatz von IT und,<br />
bei Bedarf, durch einen Coach. Pflegedienstleiter<br />
sind in diesem Konzept<br />
überflüssig. Der Einsatz wird stundenweise<br />
vergütet.<br />
Der Erfolg ist überwältigend. Inzwischen<br />
hat die „Nachbarschaftshilfe“<br />
über 900 Teams, die Effizienz konnte<br />
nachgewiesen werden, Mitarbeitende<br />
und Betreute zeigen hohe Zufriedenheitswerte.<br />
[6] Inzwischen werden<br />
40% der ambulanten Leistungen in<br />
den Niederlanden nach diesem Modell<br />
erbracht.<br />
Auffällig ist, dass die Pflegekräfte eine<br />
hoch eigenständige Verantwortung<br />
für die Betreuten übernehmen. Auch<br />
wenn sie nicht Gemeindeschwester,<br />
VERAH oder case manager betitelt<br />
werden, letztendlich sind die Pflegenden<br />
hier genau die „Kümmerer“, nach<br />
denen in vielen Diskussionen unter<br />
immer anderen Namen und in unterschiedlichen<br />
Positionen im Gesundheitswesen<br />
verlangt wird. Und vielleicht<br />
meint diese Position genau das,<br />
was im Grunde jeder Pflegende nach<br />
seiner ursprünglichen Vorstellung in<br />
seinem Beruf leisten will.<br />
Buurtzorg Deutschland<br />
Natürlich ist das niederländische Modell<br />
nicht 1 zu 1 auf unsere deutschen<br />
Verhältnisse übertragbar.<br />
Um ein besseres Bild von Buurtzorg<br />
Deutschland über die im Netz zu<br />
findenden Infos hinaus zu erhalten,<br />
führte die Autorin ein Gespräch mit<br />
dem Geschäftsführer, Herrn Technau.<br />
Die wesentlichen Informationen sollen<br />
hier zusammengefasst und teilweise<br />
ergänzt wiedergegeben werden.<br />
In NRW wagen Teams der Sander Pflege<br />
und des Impulse Pflegedienstes<br />
das Modell Buurtzorg.<br />
Die ländlichen Projekte laufen seit<br />
2<strong>01</strong>7, seit Oktober 2<strong>01</strong>8 hat auch ein<br />
Team in Münster die Arbeit aufgenommen.<br />
Insgesamt sind es 4 Projekte<br />
im Großraum Münster bzw. in ganz<br />
NRW. Problematisch ist die Vertragsgestaltung<br />
für Modellprojekte in Bezug<br />
auf die Pflegekassen-Beteiligung.<br />
Eine Lösung scheint aber gefunden,<br />
so dass vielleicht noch in diesem Jahr<br />
weitere Teams in NRW entstehen können.<br />
Zwischenzeitlich ist in Sachsen in<br />
Leipzig ein 5. Team gestartet.<br />
www.apollon-alumni.de 5
Lernen wir endlich von anderen?<br />
Nach Möglichkeit sollen nur 2 Pfleger<br />
pro Patient im Einsatz sein. Die aktuellen<br />
Teamgrößen liegen zwischen<br />
4 und 10 Mitarbeitern. Die Anforderungen<br />
hinsichtlich der Qualifikationen<br />
sind dieselben wie sonst auch.<br />
Bevorzugt werden eher examinierte<br />
Pflegekräfte eingestellt, da es dann<br />
keine Einschränkungen für die Einsetzbarkeit<br />
gibt. Dadurch, dass beide Pflegedienste<br />
auch weiterhin gleichzeitig<br />
die klassische ambulante Pflege anbieten,<br />
ist ein Wechsel aus den Buurtzorg-<br />
in die „normalen“ Strukturen generell<br />
jederzeit möglich. So kann den<br />
Bewerbern die Angst vor dem neuen<br />
System genommen werden.<br />
Die notwendigen Schulungen der<br />
Teams übernehmen die Coaches. Der<br />
Zeitaufwand ist vorab nicht klar zu<br />
definieren, weil dieser stark von dem<br />
jeweiligen Team bzw. den Persönlichkeiten<br />
darin abhängt. Das eine Team<br />
kann nach 3 Monaten selbständig<br />
arbeiten, ein anderes kann aber auch<br />
nach 6 Monaten noch etwas Betreuung<br />
brauchen.<br />
Geschult werden wesentlich Kommunikationsfähigkeiten,<br />
aber auch der<br />
Umgang mit der Software, Dienstpläne<br />
erstellen und Abrechnungsmanagement.<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
ist ein wesentlicher Punkt, denn<br />
das Modell erfordert ein hohes Maß<br />
an Eigenverantwortung und Verantwortungsübernahme<br />
für den Patienten.<br />
Die Rolle ändert sich: der Blick<br />
für Bedarfe des Patienten muss geschärft<br />
werden, gleichzeitig muss ein<br />
Augenmaß beibehalten werden, für<br />
das, was wirklich notwendig ist. Es soll<br />
keine Zeit verschwendet und der Patient<br />
auch nicht weniger selbständig<br />
gemacht werden als er sein kann.<br />
Digitalisierung ist ein ganz wesentlicher<br />
Faktor für die Selbstorganisation.<br />
Die Eigenorganisation der Teams<br />
basiert auf gemeinsamer Planung,<br />
die aktuell über die Software Medifox<br />
über Handy und PC läuft. Geplant<br />
ist eine Plattform zur weiteren<br />
Vernetzung der Teams untereinander,<br />
perspektivisch auch die<br />
Anbindung von Schnittstellen<br />
für Praxen/Ärzte, aber auch von<br />
Software zur elektronischen<br />
Bereitstellung von Messdaten,<br />
eRezept usw., um Prozesse innerhalb<br />
der Versorgung weiter<br />
zu digitalisieren. Problem dabei<br />
ist aktuell aber noch die TI bzw.<br />
das Fehlen von definierten einheitlichen<br />
Schnittstellen. Um<br />
aber eine den Niederlanden vergleichbare<br />
Struktur aufbauen zu<br />
können (nur 21 Coaches, 50 Verwaltungsmitarbeiter<br />
bei knapp<br />
1000 Teams), ist die Digitalisierung<br />
Grundvoraussetzung.<br />
Prinzipiell werden alle SGB<br />
XI-Leistungen (Hauswirtschaft,<br />
Betreuung, Pflege) per Stundensatz<br />
vergütet. Der Stundensatz<br />
liegt bei derzeit 32€ in NRW.<br />
Wenn die Modellphase des<br />
Modellprojekts nach §8 SGB XI<br />
anläuft (mit einer Laufzeit von<br />
2,5 Jahren), gibt es einen Modellzuschlag<br />
in Höhe von 10%.<br />
Die Vergütungsregularien sind<br />
ansonsten ähnlich wie im herkömmlichen<br />
System. Anhand<br />
erfasster Parameter wird der Bedarf<br />
bestimmt, also ein Stundenkontingent<br />
vereinbart. Wenn<br />
einer der Pflegenden die Wohnung<br />
betritt, läuft die Zeit. Der<br />
Patient oder ggf. Angehörige<br />
zeichnet am Ende ab, wie lange<br />
der Pfleger da war. Diese Teile<br />
sind weiterhin Papierdokumentation.<br />
Wenn Behandlungspflege<br />
nach SGB V dazu kommt bzw.<br />
den Anfangspunkt bildet, kann und<br />
soll die Pflege von denselben Teams<br />
geleistet werden – allerdings müssen<br />
sie die Leistungen dann herkömmlich<br />
verrichtungsbezogen dokumentieren<br />
und abrechnen, was aber wenigstens<br />
in derselben Software machbar ist.<br />
Warum pflegen Pflegende?<br />
Oder warum eben nicht?<br />
Die Entscheidung, in der Pflege tätig<br />
zu werden, hat einen zutiefst sozial,<br />
vielleicht sogar altruistisch motivierten,<br />
auf jeden Fall aber idealistischen<br />
Hintergrund: den Wunsch,<br />
sich um andere zu kümmern.<br />
Die Umfrageergebnisse einer Gelegenheitsstichprobe<br />
von 4.439 Pflegenden<br />
aus dem Jahr 2<strong>01</strong>6, rekrutiert<br />
über Fachverband- und Gruppenansprachen,<br />
die offizielle Website der Initiatorin<br />
Elisabeth Scharfenberg sowie<br />
Pressemitteilungen und per Schneeballprinzip<br />
ausgeweitet, bestätigen<br />
dies exemplarisch: Fast alle Befragten<br />
(98 Prozent) stimmen der Aussage<br />
zu, dass sie mit Menschen arbeiten<br />
wollten. 96 Prozent sagen, dass sie<br />
etwas Sinnvolles mit ihrer Arbeit tun<br />
wollen. 42% gaben bei der Frage nach<br />
dem Grund ihrer Berufswahl an, sehr<br />
eigenverantwortlich arbeiten zu wollen;<br />
60% geben, befragt zur täglichen<br />
Motivation für die Arbeit, „eigenverantwortliches<br />
Arbeiten“ an. [8]<br />
Die größten täglichen Ärgernisse lagen<br />
im Zeitdruck, den 87% als Auslöser<br />
für Unzufriedenheit in der Arbeit<br />
angaben, und der Personalausstattung<br />
im direkten Umfeld (82%). [8]<br />
Symptomatisch für die Pflege: 74%<br />
der Befragten waren Frauen. Als Gründe<br />
für die Teilzeitbeschäftigung wurde<br />
mit großer Mehrheit die Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf genannt (40%),<br />
aber immerhin auch 11% gaben ein,<br />
keine Vollzeitstelle zu bekommen, obwohl<br />
sie diese gerne hätten. [8]<br />
Bleiben Teile der errechneten Bedarfszeit<br />
über, kann diese ggf. neu gesetzt<br />
werden. Der Pfleger muss entscheiden,<br />
ob andere Verrichtungen in der<br />
„übrigen Zeit“ notwendig sind. Bei<br />
Grauzonen definiert das Team den<br />
Umgang gemeinsam. Generell sollen<br />
6<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Lernen wir endlich von anderen?<br />
Betreuungszeiten durch Anleitungen<br />
zum Selbstmanagement oder Drittmanagement<br />
verkürzt werden. Hilfe<br />
zur Selbständigkeit beinhaltet wegen<br />
der mangelnden informellen Netzwerke<br />
oft auch die Vermittlung in<br />
Angebote von Stadtteilen oder Pflegeeinrichtungen.<br />
Manche Patienten<br />
haben Angst zu lernen, sich z.B. den<br />
Blutdruck zu messen oder die Augentropfen<br />
einzuträufeln, denn dann<br />
kommt keiner mehr. Dazu muss die<br />
soziale Integration gelingen, um die<br />
Leistungen der Pflege zurückfahren zu<br />
können, der Patient muss sich aufgehoben<br />
fühlen. Der Einbezug existenter<br />
Zentren der Quartiere für Betreuungsleistungen,<br />
wie Gemeindezentren, ist<br />
also erklärtes Ziel. Der Kontakt zum<br />
Buurtzorg-Pflegedient bleibt zusätzlich<br />
vorhanden, es werden turnusmäßige<br />
Kontrollbesuche vereinbart. In<br />
der herkömmlichen Pflege ist der Vertrag<br />
an der Stelle, an der die Selbstversorgung<br />
gelernt wurde, beendet, und<br />
wenn nochmal ein Bedarf entsteht,<br />
muss neu nach einem Pflegedienst<br />
mit freiem Kontingent gesucht werden.<br />
Ambulante Pflege ist gemeinhin eher<br />
als Teilzeitjob ausgelegt und die Beschäftigten<br />
sind Großteils Frauen. Oft<br />
wird z.B. wegen der Familie in Teilzeit<br />
zu arbeiten gewünscht. Die Mitarbeiter<br />
der Buurtzorg-Teams sollen<br />
idealerweise in Vollzeit arbeiten. Dabei<br />
werden 60% der Arbeitszeit beim<br />
Patienten geleistet, 22% wesentlich<br />
am Schreibtisch, aber hierin sind auch<br />
Zeiten für Wege und Netzwerkarbeit<br />
subsummiert. Die übrigen 18% werden<br />
für Abwesenheit gerechnet, wegen<br />
Urlaub, Krankheit, Feiertag und<br />
Fortbildung. [7]<br />
Eventuell wird durch diese Vollzeitoption<br />
der Job auch attraktiver für<br />
Männer, in der klassischen Rolle als<br />
Familienernährer. Zum Ist-Zustand der<br />
Zusammensetzung der Teams gibt es<br />
aber noch keine Erhebung.<br />
Nach Einschätzung von Herrn Technau<br />
ist Buurtzorg vielleicht nicht die<br />
Lösung für den Pflegenotstand, aber<br />
für viele ein Weg zurück in das System<br />
Pflege, da der soziale Aspekt, den Pfleger<br />
in ihrer Ausbildung berücksichtigen<br />
gelernt haben, und der für viele<br />
wichtig ist bei der Berufswahl, zurück<br />
in den Fokus genommen wird, und<br />
auch weil mehr eigene Organisation<br />
und Entscheidung möglich ist.<br />
Herzlichen Dank an den Geschäftsführer<br />
von Buurtzorg Deutschland, Herrn<br />
Johannes Technau, für das interessante<br />
Gespräch!<br />
Literaturverzeichnis:<br />
[1] www.presseportal.de/pm/52278/3666109 (28.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[2] www.zeit.de/wirtschaft/2<strong>01</strong>8-04/pflege-kranke-altenheime-kliniken-notstand-bundesregierung (28.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[3] https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Pflege/Tabellen/PersonalPflegeeinrichtungen.<br />
html;jsessionid=C5C4A607A2C5857992F8964D37EF94F7.InternetLive1 (28.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[4] Kliner K, Rennert D, Richter M (Hrsg.) (2<strong>01</strong>7). BKK Gesundheitsatlas 2<strong>01</strong>7. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin.<br />
[5] Statistisches Bundesamt (Destatis) (2<strong>01</strong>8). Pflegestatistik. Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung Ländervergleich – Ambulante Pflegedienste.<br />
[6] https://awblog.at/das-buurtzorg-modell/ (28.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[7] CAREkonkret 32/2<strong>01</strong>8.<br />
[8] Scharfenberg E (2<strong>01</strong>6). Was beschäftigt Pflegekräfte? Ausgewählte Ergebnisse der Umfrage von Elisabeth Scharfenberg, MdB, 2<strong>01</strong>6.<br />
Erhebungszeitraum: 05.04. bis 16.05.2<strong>01</strong>6.<br />
[9] Bundesministerium für Gesundheit (2<strong>01</strong>6). Sechster Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der<br />
pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland.<br />
[10] Bundesministerium für Gesundheit (2<strong>01</strong>6). Sechster Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand<br />
der pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland. Anlage H zum sechsten Pflegebericht. Übersicht über vereinbarte ambulante<br />
Leistungskomplexe in den Ländern (Stand: 31.12.2<strong>01</strong>5)<br />
www.apollon-alumni.de 7
Agilität und Selbstorganisation aus Patientensicht<br />
Agilität und Selbstorganisation aus Patientensicht<br />
Janina Ehlers<br />
Der Vorrang der ambulanten vor einer stationären Versorgung gilt seit langem als gesundheits- und sozialpolitische<br />
Maxime und trifft den Wunsch der meisten Menschen, im Fall von Krankheit und Pflegebedürftigkeit so lange wie<br />
möglich in der häuslichen Umgebung zu verbleiben. [1]<br />
Relevanz der<br />
Patientenperspektive<br />
Bis weit ins 20. Jahrhundert war die<br />
Medizin und Pflege von ausgeprägter<br />
Wissensasymmetrie charakterisiert.<br />
Diese weicht im Laufe der Zeit dem<br />
autonomen, aufgeklärten Patienten.<br />
[2] Die Informiertheit der Menschen<br />
hinsichtlich der Leistungen aus Pflege-<br />
und Krankenversicherung nimmt<br />
zu, wenngleich auch die Gesundheitskompetenz<br />
der Menschen demografisch<br />
sehr unterschiedlich ist. [3]<br />
Darüber hinaus wird den Bedarfen<br />
und Wünschen der Patienten durch<br />
die Verortung von Interessengruppen<br />
im Gesundheitssystem vermehrt<br />
Rechnung getragen z.B. nehmen Vertreter<br />
von Patientenorganisationen<br />
an den Sitzungen des Gemeinsamen<br />
Bundesausschusses teil und haben<br />
dort ein Mitberatungs- und Antragsrecht.<br />
Im Weiteren sind gesetzliche<br />
Wege eingeschlagen, um die Würde<br />
und Integrität als Patient zu achten,<br />
Selbstbestimmungsrecht und das<br />
Recht auf Privatsphäre zu respektieren.<br />
[3] Dies soll u.a. durch das Patientenrechtegesetz<br />
(2<strong>01</strong>3) gewährleistet<br />
sein. Es wird deutlich, dass wir es mit<br />
„anderen“ Patienten zu tun haben.<br />
Die Patientenperspektive spielt in der<br />
Gesundheitsversorgung und der Qualitätssicherung<br />
laut einer Studie von<br />
Ludt; et. al. (2<strong>01</strong>3) eine entscheidende<br />
Rolle. Demnach können Patienten<br />
qualitätsrelevante Aspekte identifizieren<br />
und aufzeigen, bspw. die unzureichende<br />
Kommunikation und Koordination.<br />
[4] Des Weiteren möchten<br />
die Pflegebedürftigen als gleichberechtigte<br />
Partner anerkannt werden,<br />
indem sie und ihre Angehörigen informiert<br />
werden und bei der Pflege<br />
eigenverantwortlich Mitbestimmung<br />
erfahren [12].<br />
Infolgedessen bedarf es einer strikten<br />
Patientenorientierung, Fürsorge und<br />
Empathie.<br />
Interessant in diesem Kontext wäre<br />
die aktuelle Zufriedenheit der Pflegebedürftigen<br />
im Zusammenhang<br />
mit der Versorgungsqualität in der<br />
ambulanten Pflege, welche jedoch<br />
empirisch nicht ohne weiteres hergestellt<br />
werden kann. Hierfür sind gemäß<br />
der Pflege-Qualitätsberichte des<br />
MDS methodische Gründe (sozial erwünschtes<br />
Antwortverhalten, Abhängigkeitsverhältnis,<br />
Generationenfrage)<br />
verantwortlich. [5] Darüber hinaus ist<br />
noch kein wissenschaftlicher Beweis<br />
vorhanden, dass die Zufriedenheit<br />
der Pflegebedürftigen in Deutschland<br />
steigt, wenn nach dem „Buurtzorg“<br />
Konzept gepflegt wird, aber es können<br />
Vor- und Nachteile angemaßt<br />
werden.<br />
Nachteile aus Patientensicht<br />
Bei Buurtzorg geht es nicht nur um<br />
Pflege. Es geht um vielschichtige Betreuung,<br />
um Unterstützung, Beratung<br />
und Begleitung. Eine solche Individualität<br />
ist in Deutschland kaum vorstellbar.<br />
Die Sozialhilfeträger setzen<br />
vielfach Abrechnungs- und Leistungskontrollen<br />
ein, um Individualität zu<br />
konterkarieren. Das Misstrauen steht<br />
im Vordergrund. Trotzdem bietet<br />
Buurt zorg die Chance über bessere<br />
Patientenorientierung nachzudenken;<br />
mit dem Ziel der Wahrung der Eigenständigkeit<br />
und der Unterstützung der<br />
Unabhängigkeit der Patienten und<br />
Pflegebedürftigen. [11]<br />
Es wird deutlich, dass direkte Nachteile<br />
aus der Patientenperspektive nicht ermittelt<br />
werden können. Es stellt vielfach<br />
eher ein gesundheitspolitisches<br />
Problem dar.<br />
Vorteile aus Patientensicht<br />
Hochwertig gestaltete pflegerische<br />
Leistungen können dazu beitragen,<br />
das selbstverantwortliche Gesundheitsverhalten<br />
der Patienten positiv zu<br />
beeinflussen [2] und folglich die Gesundheitskompetenz<br />
steigern.<br />
Das Buurtzorg- Konzept in den Niederlanden<br />
konnte nachgewiesen die<br />
Zufriedenheit der Pflegebedürftigen<br />
in der ambulanten Versorgung steigern.<br />
Darüber hinaus wird auch seitens<br />
der niedergelassenen ÄrztInnen<br />
und der Gemeinden eine große Zufriedenheit<br />
bezüglich der Kooperation<br />
mit den Buurtzorg-Teams bescheinigt.<br />
[9] Die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
wird gesteigert. Dies hat unmittelbare<br />
positive Folgen für die Patientensicherheit<br />
und Patientenorientierung.<br />
In der täglichen Arbeit ist die Autonomie<br />
der Buurtzorg-Teams weitreichend,<br />
da es keine hierarchische Zwischenebenen<br />
gibt, sodass die Teams<br />
bspw. selbst über ihre Fortbildungsaktivitäten<br />
entscheiden, wenn z.B. festgestellt<br />
wird, dass zunehmend mehr<br />
8<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Agilität und Selbstorganisation aus Patientensicht<br />
Pflegebedürftige Palliativpflege bedürfen<br />
oder Teammitglieder meinen,<br />
dass sie im Umgang mit Pflegebedürftigen<br />
mit Demenz noch Weiterbildungsbedarf<br />
haben. Im Pflegeprozess<br />
werden Kommunikation und die integrierte<br />
Zusammenarbeit mit anderen<br />
lokalen professionell und informell<br />
Pflegenden und Betreuenden in den<br />
Mittelpunkt gestellt. Darüber hinaus<br />
baut das Modell auf die Aktivierung<br />
von Selbst-Pflege, d.h. die Mobilisierung<br />
und Nutzung der Ressourcen der<br />
Pflegebedürftigen. Ein Team versorgt<br />
etwa 50-60 Pflegebedürftige, ist diese<br />
Kapazität ausgefüllt, wird im nächsten<br />
Quartier ein neues Team gebildet.<br />
[9] Dies hat zur Folge, dass die Arbeit<br />
übersichtlich und persönlich bleibt.<br />
Daran wird deutlich, dass die vollständige<br />
pflegerische Leistung sich<br />
am Pflegebedürftigen – dem Kunden<br />
– orientiert und nicht anders herum.<br />
Die strikte Ausrichtung auf die Bedarfe<br />
des Kunden schafft auf allen Ebenen<br />
Fürsorge, Empathie und eine sichere<br />
sowie effiziente Versorgung. Ein entsprechender<br />
und übertragender Ansatz<br />
ist für das sektorale, deutsche<br />
Gesundheitssystem erstrebenswert.<br />
Bisher haben sich einige Pflegeunternehmen<br />
auf diesen Weg begeben,<br />
bspw. die Sander Pflege GmbH in<br />
Emsdetten.<br />
Die Literaturangaben zu diesem Artikel<br />
finden Sie im Literaturverzeichnis des folgenden<br />
Artikels ‚Agile Qualität‘<br />
www.apollon-alumni.de 9
Agile Qualität<br />
Agile Qualität<br />
Janina Ehlers<br />
Die Qualität der ambulanten, pflegerischen Versorgung in Deutschland weist unterschiedliche Entwicklungs- und<br />
Umsetzungsstände in Deutschland auf. Einer der Gründe für die nachrangige Betrachtung der Qualität der ambulanten<br />
Pflege ist, dass die Zuschreibung einer professionellen Verantwortung für die Versorgungsqualität leichter fällt,<br />
wenn die professionellen Akteure eine tatsächliche Steuerungsverantwortung haben, um folglich das Geschehen<br />
maßgeblich beeinflussen zu können [1]. Aber ist dies nicht ein Widerspruch in sich? Wie können Agilität und Qualität<br />
in der ambulanten Pflege zusammenfinden?<br />
Der grundlegende Zweck von Qualitätsmanagement<br />
in der ambulanten<br />
Pflege ist die bestmögliche Pflege<br />
der Kunden zu erreichen. Soweit die<br />
Theorie – in der Praxis tritt Qualitätsmanagement<br />
oft als Hemmschuh<br />
und Ballast, als Infantilisierung ihrer<br />
Tätigkeit auf. In der ambulanten Pflege<br />
arbeiten sie mit einem Menschen,<br />
mit persönlichen Nuancen und unterschiedlichen<br />
Reaktionen. Zudem<br />
trifft professionelle Handlungsautonomie<br />
der Pflegekräfte auf staatliche<br />
Reglementierung. Richtlinien und<br />
Erlöse werden fern von Patienten<br />
und Pflegekräften festgelegt. Starre<br />
Qualitätsindikatoren von außen, u.a.<br />
durch den MDK, können mitunter<br />
eine Fehlsteuerung verursachen. Darüber<br />
hinaus gelten weitere Standards<br />
und Verfahrensweisungen des eigenen<br />
Unternehmens. Die Pflegekräfte<br />
arbeiten unter starren Rahmenbedingungen<br />
mit wenig Gestaltungspielraum<br />
– so der Eindruck. Und wo steht<br />
die Qualität der geleitsteten Arbeit?<br />
Der Qualitätsbericht des MDS zeigt<br />
u. a. die Überprüfung von Wundversorgung<br />
unter Berücksichtigung des<br />
aktuellen Stands des Wissens: Bei 86,9<br />
Prozent der betroffenen Pflegebedürftigen<br />
war das Kriterium erfüllt (85,7 %),<br />
bei 13,1 Prozent dieser Personen war<br />
das Kriterium nicht erfüllt, das heißt z.<br />
B., dass die Prinzipien der Druckentlastung<br />
(bei Dekubitus) oder der Kompression<br />
(bei Ulcus cruris venosum)<br />
nicht berücksichtigt, hygienische<br />
Grundsätze missachtet wurden (z. B.<br />
keine sterile Wundabdeckung) oder<br />
trotz Erfordernis keine feuchte Wundabdeckung<br />
erfolgte. [5]<br />
Ist die Qualität in der ambulanten Pflege<br />
als schlecht zu beurteilen? Nein, in<br />
diesem Kontext soll deutlich werden,<br />
dass Pflegekräfte viel Zeit ihrer Arbeitszeit<br />
mit Zertifizierungen und überflüssigen<br />
Prozessbeschreibungen,<br />
schlecht gestalteten Dokumentationsbögen<br />
und nutzlosen Managementbewertungen<br />
verbringen. Durch<br />
diesen Grad der Überformalisierung<br />
brechen Pflegekräfte teilweise Regeln,<br />
um das Tagesgeschäft aufrecht zu erhalten.<br />
Dies ist mitunter für die unterschiedlichen<br />
Parteien sehr gefährlich.<br />
Eine entsprechende Abrüstung und<br />
ein Überdenken der Systeme sollten<br />
stattfinden. [10]<br />
10<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Agile Qualität<br />
Aufbruch zur agilen Qualität<br />
Agilität und Qualität dürfen nicht im<br />
Widerspruch zueinander stehen.<br />
Nach Hofert ist: „Agilität (…) die Fähigkeit<br />
von Teams und Organisationen, in<br />
einem unsicheren, sich veränderndem<br />
und dynamischen Umfeld flexibel, anpassungsfähig<br />
und schnell zu agieren.<br />
Dazu greift Agilität auf verschiedene<br />
Methoden zurück, die es Menschen<br />
einfacher machen, sich so zu verhalten.“<br />
[6]<br />
Diese Annahme von Agilität in der<br />
Pflege ist nicht neu. Pflegekräfte treffen<br />
in der täglichen Arbeit häufig Entscheidungen<br />
für das Wohl ihres anvertrauten<br />
Kunden und dies mit einer<br />
hohen intrinsischen Motivation.<br />
Demnach muss das Qualitätsmanagement<br />
in der ambulanten Pflege pflegerischtherapeutische<br />
Wirksamkeit<br />
unterstützen und gleichzeitig Fehler<br />
und Verschwendung minimieren. Für<br />
die Suche nach Verbesserungspotenzialen<br />
ist es notwendig, organisatorische<br />
Rahmenbedingungen für einen<br />
kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
in der Gesamtorganisation zu<br />
implementieren und die Mitarbeiter<br />
in diesen Prozess mit einzubinden.<br />
Die Einstellung der Beteiligten muss<br />
hierzu zielgerichtet aktiviert werden,<br />
wie bspw. beim Buurtzorg Konzept.<br />
[7] Die Mitarbeitenden erhalten einerseits<br />
die notwendige Stabilität<br />
in Form von groben Rahmenbedingungen<br />
wie der zentralen Verwaltung<br />
für administrative Tätigkeiten<br />
und dem Coaching der Teams, [8] [9]<br />
und anderseits Flexibilität. indem die<br />
Mitarbeitenden durch ihr Wissen Prozesse<br />
gestalten. [6] Die Auswirkungen<br />
dieser Organisationsform werden<br />
in den Niederlanden als positiv bestätigt.<br />
Dies ist u. a. auf das hohe Engagement<br />
der mitarbeitenden Pflegekräfte<br />
zurückzuführen. Infolgedessen<br />
können in vielen Fällen mit weniger<br />
Kosten (Betreuungsstunden) bessere<br />
Ergebnisse erzielt werden, wenn gut<br />
ausgebildetes Pflegepersonal in die<br />
Lage versetzt wird, ganzheitliche Betreuung<br />
zu erbringen. Die Arbeit von<br />
Buurtzorg ist durch eine Reihe von<br />
Evaluationsstudien sowie durch internes<br />
Qualitätsmanagement nach dem<br />
sogenannten Omaha-System belegt.<br />
[9] Es wird deutlich, dass agiles QM<br />
Mitarbeitende unterstützen kann, ihre<br />
Arbeit mit Freude zu verrichten, die<br />
Effektivität bei Routineaufgaben steigern<br />
und Zeit und Aufmerksamkeit für<br />
die Kür schaffen kann, um es letztlich<br />
dem Kunden zugutekommen zu lassen<br />
und eine strikte Patientenorientierung<br />
einhalten zu können.<br />
Es gilt nun, diese Wirkungsweisen von<br />
Agilität und QM um konkrete Ideen<br />
und Hinweise zu ergänzen, damit<br />
Beides auch die Pflege in Deutschland<br />
neu beleben kann. [10]<br />
Literaturv erzeichnis<br />
[1] Büscher, A.; Krebs, M. (2<strong>01</strong>8): Qualität in der ambulanten Pflege. In: Jacobs, K.; Kuhlmey, A.; Greß, S.; Klauber, J.; Schwinger, A. (Hrsg.): Pflege Report<br />
2<strong>01</strong>8. Qualität in der Pflege. S. 127ff.<br />
[2] Horneber, M.; Deges, S. (Hrsg.) (2<strong>01</strong>8): Revolution Hospital. Digitale Transformation und Innovation Leadership. Melsungen: Bibliomed.<br />
[3] Bundesministerium für Gesundheit (2<strong>01</strong>7): Patientenrechte. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/<br />
patientenrechte/patientenrechte.html (23.<strong>01</strong>.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[4] Ludt, F.; Heiss, K.; Glassen, S.; Noest, A.; Klingenberg, D. Ose, J. (2<strong>01</strong>3): Die Patientenperspektive jenseits ambulant-stationärer Sektorengrenzen –<br />
Was ist Patientinnen und Patienten in der sektorenübergreifenden Versorgung wichtig? https://www.researchgate.net/profile/Anja_Klingenberg/<br />
publication/250920317_Patients‘_Perspectives_beyond_Sectoral_Borders_between_Inpatient_and_Outpatient_Care_-_Patients‘_Experiences_<br />
and_Preferences_along_Cross-Sectoral_Episodes_of_Care/links/55<strong>01</strong>61030cf2aee14b595ed2.pdf (20.<strong>01</strong>.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[5] Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) (Hrsg.) (2<strong>01</strong>7): 5. PFLEGE-QUALITÄTSBERICHT DES MDS NACH §<br />
114A ABS. 6 SGB X. Qualität in der ambulanten und stationären Pflege. https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/<br />
SPV/MDS-Qualitaetsberichte/_5._PflegeQualita__tsbericht_des_MDS_Lesezeichen.pdf (22.<strong>01</strong>.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[6] Hofert, S. (2<strong>01</strong>6): Agiler führen. Einfache Maßnahmen für bessere Teamarbeit, mehr Leistung und höhere Kreativität. Wiesbaden: Springer<br />
Fachmedien.<br />
[7] Kerka, F.; Kriegesmann, B. (2007): Innovationskulturen für den Aufbruch zu Neuem: Missverständnisse– Praktische Erfahrungen – Handlungsfelder<br />
des Innovationsmanagements. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.<br />
[8] Armutat, S.; Dorny, H.-J.; Ehmann, H.-M.; Eisele, D.; Frick, G.; Grunwald, C.; Heßling, K.-H.; Hillebrand, H.; Skottki, B. (2<strong>01</strong>6): Agile Unternehmen – Agiles<br />
Personalmanagement. In: DGFP-Praxispapiere. Best Practices (<strong>01</strong>).<br />
[9] Leichsenring, K. (2<strong>01</strong>5): Buurtzorg Nederland – Ein innovatives Modell der Langzeitpflege revolutioniert die Hauskrankenpflege: In: ProCare –<br />
Aktuelle Information, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege, 20(8), S. 20-24.<br />
[10] Holtel, M.; Pilz, S.; Sommerhoff, B. (2<strong>01</strong>8): Von Softwareschmieden Agilität lernen. In: MBZ, 15, S. 6.<br />
[11] Meißner, T.; et. al. (2<strong>01</strong>8): Buurtzorg– Revolution in der ambulanten Pflege. In: Heilberufe / Das Pflegemagazin, 70 (1), S. 54-55.<br />
[12] Pfaff, H.; Brinkmann, A.; Jung, J.; Steffen, P. (2009): Qualitätserhebungen im Gesundheitswesen. Der Patient als Partner in der Evaluation von<br />
Qualität. In: Gehrlach C, Altenhöner T, Schwappach D (Hrsg.): Der Patients’ Experience Questionnaire. Patientenerfahrungen vergleichbar machen.<br />
Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, S. 30–39.<br />
www.apollon-alumni.de 11
Das Buurtzorg-Modell – ein Modell zur Kostensenkung in der ambulanten Pflege?<br />
Das Buurtzorg-Modell – ein Modell zur Kostensenkung in der<br />
ambulanten Pflege?<br />
Cornelia Baudisch<br />
Die Frage der nachhaltigen Finanzierbarkeit der gesetzlichen Pflegeversicherung ist in Deutschland derzeit eine vielfach<br />
diskutierte.<br />
Demographiebedingt steigt die Anzahl<br />
der Leistungsempfänger, zudem<br />
wurden weiterhin die Leistungen<br />
dieses Versicherungszweiges in den<br />
letzten Jahren deutlich ausgeweitet.<br />
Die Leistungsausgaben der gesetzlichen<br />
Pflegeversicherung stiegen daher<br />
in den Jahren 20<strong>01</strong> bis 2<strong>01</strong>7 von<br />
16,03 Mrd. € auf 35,54 Mrd. €, wobei<br />
der Sprung von 28,29 Mrd. € auf 35,54<br />
Mrd. € allein vom Jahr 2<strong>01</strong>6 zu 2<strong>01</strong>7 zu<br />
beobachten war [1]. Erhöhungen des<br />
Beitragssatzes, wie zuletzt auch zum<br />
Jahresbeginn <strong>2<strong>01</strong>9</strong>, werden nicht unendlich<br />
durchsetzbar sein und auch<br />
steuer-mitfinanzierte Modelle finden<br />
derzeit keine politische oder gesellschaftliche<br />
Mehrheit.<br />
Das Buurtzorg-Modell aus den<br />
Niederlanden zeigt Auswege auf<br />
Auf zunehmendes Interesse auch<br />
hierzulande stößt das niederländische<br />
Buurtzorg-Modell zur wohnortnahen<br />
Hauskrankenpflege. Neben einer im<br />
Vergleich zu traditionellen Anbietern<br />
häuslicher Krankenpflege deutlichen<br />
Kostensenkung beeindruckt insbesondere<br />
auch die hohe Mitarbeiterund<br />
Klientenzufriedenheit. Es scheint,<br />
das niederländische Modell sei geeignet,<br />
sowohl dem Finanzierungsproblem<br />
der (ambulanten) Pflege etwas<br />
entgegensetzen zu können als auch<br />
den Pflegeberuf positiv zu besetzen<br />
und somit die Attraktivität des Berufes<br />
zu erhöhen. Kein Wunder, dass das<br />
Buurtzorg-Modell auch hierzulande<br />
intensiv diskutiert und auf eine Übertragbarkeit<br />
in das deutsche System<br />
geprüft wird.<br />
12<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Das Buurtzorg-Modell – ein Modell zur Kostensenkung in der ambulanten Pflege?<br />
Buurtzorg-Pflegedienste sparen<br />
bewilligte Pflegestunden ein<br />
Die staatlich-finanzierte Hauskrankenpflege<br />
in den Niederlanden wird<br />
entsprechend des Pflegebedarfs des<br />
Klienten in Zeitstunden bewilligt. Eine<br />
Studie von Ernst und Young aus dem<br />
Jahr 2009 fand heraus, dass Pflegeanbieter,<br />
die nach dem Buurtzorg-Modell<br />
vorgehen, im Durchschnitt lediglich<br />
40 % der bewilligten Zeitstunden<br />
benötigten, um die Bedarfe der<br />
Klienten zu erfüllen, im Vergleich zu<br />
anderen Pflegedienstleistern, die 70%<br />
der bewilligten Zeitstunden benötigten.<br />
Weiterhin wurde festgestellt,<br />
dass die Klienten schneller wieder<br />
selbstständig wurden, weniger Krankenhausaufenthalte<br />
hatten und nach<br />
Krankenhausaufenthalten schneller<br />
wieder entlassen werden konnten.<br />
Hinzu kamen deutlich geringere Fixkosten,<br />
niedrigere Krankenquote und<br />
eine geringere Fluktuation bei den<br />
Mitarbeitenden der Buurtzorg-Pflegedienste<br />
[2]. Eine im Auftrage des<br />
niederländischen Ministeriums für<br />
Gesundheit, Wohlfahrt und Sport<br />
im Jahre 2<strong>01</strong>5 veröffentlichte Studie<br />
von KPMG bestätigte den Kostenvorteil<br />
der Buurtzorg-Pflegeanbieter im<br />
Vergleich zu den durchschnittlichen<br />
Kosten traditioneller Anbieter und<br />
widerlegte mittels einer Case-Mix-adjustierten<br />
Analyse zugleich die Kritik,<br />
Buurtzorg-Anbieter wählten bewusst<br />
Klienten mit hohem Deckungsbeitrag.<br />
Auch unter Berücksichtigung weiterer<br />
Kostenarten wie individueller ( Folge-)<br />
Kosten für medizinische Versorgung<br />
bestand der Kostenvorteil der Buurtzorg-Anbieter<br />
weiter. Aufgrund deutlich<br />
höherer Kosten für medizinische<br />
Versorgung verminderte sich dieser<br />
jedoch insgesamt deutlich. Die<br />
Case-Mix-adjustierten Gesamtausgaben<br />
je Klient lagen somit ungefähr<br />
im Bereich der durchschnittlichen<br />
Gesamtausgaben je Klient der übrigen<br />
niederländischen Anbieter für<br />
Hauskrankenpflege. Die KPMG-Studie<br />
bestätigte neben der Kosteneffizienz<br />
auch die Klienten- und die Zufriedenheit<br />
der Mitarbeitenden [3].<br />
Kostenvorteile sind insbesondere<br />
strukturbedingt<br />
Buurtzorg-Pflegeanbieter sind als<br />
gemeinnützige Unternehmen organisiert<br />
und verfolgen eine professionelle,<br />
häusliche und wohnortnahe<br />
Versorgung von Pflegebedürftigen.<br />
Dabei wird in hohem Maße mit Nachbarn,<br />
sozialen Diensten, Ärzten und<br />
Angehörigen zusammen gearbeitet.<br />
Die Klienten werden, wo immer möglich,<br />
zur Selbsthilfe aktiviert, Nachbarn<br />
und Angehörige bei nicht-pflegerischen<br />
Tätigkeiten als Unterstützung<br />
herangezogen. Die Pflegeteams von<br />
aus bis zu 12 Mitarbeitenden arbeiten<br />
autonom und ohne hierarchische Zwischenstufen.<br />
Eine zentrale Verwaltung<br />
unterstützt bei bürokratischen Prozessen<br />
und organisiert Coachings für<br />
die Teams. Durch den umfassenden<br />
Einsatz von IT bei der Planung, Dokumentation<br />
und Datensammlung können<br />
die Zeitaufwände der Mitarbeitenden<br />
für diese Tätigkeiten deutlich<br />
gesenkt und die Arbeitszeit der Pflegenden<br />
effizient für die Klientenbetreuung<br />
eingesetzt werden. Aufgrund<br />
des kleinen Versorgungsgebietes der<br />
Teams entfallen Wegezeiten, sodass<br />
auch hier mehr Arbeitszeit für die Versorgung<br />
der Klienten zur Verfügung<br />
steht. Insgesamt ist festzustellen, dass<br />
die Mitarbeitenden sich fokussiert auf<br />
die Pflege der Klienten konzentrieren<br />
und Zeitaufwände für Wegestrecken,<br />
Planung und Dokumentation auf ein<br />
Minimum reduziert werden können.<br />
Durch den gezielten Aufbau von<br />
Netzwerken sowohl im privaten Umfeld<br />
der Klienten als auch im medizinischen<br />
Versorgungsbereich ergeben<br />
sich ebenfalls große Synergien, die<br />
die Pflegenden maßgeblich entlasten.<br />
Neben den positiven Auswirkungen<br />
auf die Kosteneffizienz dürften in diesen<br />
Punkten wohl auch Hinweise für<br />
die Zufriedenheit der Pflegenden und<br />
auch der Klienten zu finden sein.<br />
Integrierte versus tayloristische<br />
Betreuung der Pflegebedürftigen<br />
Als Auslöser für die Entwicklung des<br />
Buurtzorg-Modells wird die Unzufriedenheit<br />
der Pflegenden mit der traditionellen<br />
Form der Hauskrankenpflege<br />
benannt, welche auf der sogenannten<br />
tayloristischen Aufgabenverteilung<br />
beruht. Fehlende Kommunikation<br />
zwischen den verschiedenen Professionen<br />
und Anbietern von Gesundheits-<br />
und Pflegeleistungen, häufig<br />
verbunden mit geringer Wertschätzung<br />
der Pflegenden, erschwerten<br />
eine ganzheitliche Pflege und Betreuung<br />
der Hilfsbedürftigen [4]. Die tayloristische<br />
Aufgabenteilung ist auch<br />
im Pflegesystem in Deutschland das<br />
überwiegend praktizierte Modell.<br />
Neben der deutlichen interprofessionellen<br />
Aufgabenabgrenzung wird<br />
dies auch in der Vergütungsweise der<br />
Pflegeleistungen deutlich. Die Vergütung<br />
von Pflegeleistungen erfolgt im<br />
Regelfall (SGB XI) je Leistungskomplex<br />
wie Waschen, Lagern oder das Verabreichen<br />
von Arzneimitteln.<br />
Buurtzorg-Modellprojekte sind<br />
auch in Deutschland am Start<br />
Auch in Deutschland wird das Buurtzorg-Modell<br />
von Pflegediensten zunehmend<br />
aufgegriffen und der ganzheitliche<br />
Pflege- und Betreuungsansatz<br />
wieder in den Fokus gerückt. Im<br />
nordrhein-westfälischen Emsdetten<br />
rechnen bereits zwei private Pflegedienste<br />
auf Stundenbasis mit den Pflegekassen<br />
ab [5]. Weiterhin ist in Nordrhein-Westfalen<br />
zwischen den Buurtzorg-Deutschland-Pflegediensten<br />
und den regionalen Pflegekassen ein<br />
Modellprojekt nach § 8 Abs. 3 SGB XI<br />
geplant, in dem geprüft werden soll,<br />
wie sich ein Pflege-Zeitbudget anstel-<br />
www.apollon-alumni.de 13
Das Buurtzorg-Modell – ein Modell zur Kostensenkung in der ambulanten Pflege?<br />
le einer auf Leistungskomplexe bezogenen<br />
Vergütung auf die Pflegenden<br />
sowie die Pflegebedürftigen auswirkt<br />
[6]. Wenn auch das Zeitbudget aus<br />
den erforderlichen Pflegeleistungen<br />
errechnet wird, so sind die Pflegenden<br />
dennoch etwas freier in der konkreten<br />
Umsetzung und können individueller<br />
auf die akuten Bedürfnisse des Klienten<br />
eingehen.<br />
Ob Kostenvorteile realisiert werden<br />
können, bleibt abzuwarten<br />
Pflegekräftemangel, Demographiewandel<br />
und die Frage nach der Finanzierbarkeit<br />
von Pflegeleis tungen<br />
stellen enorme Herausforderungen<br />
für die Gesellschaft dar. Das niederländische<br />
Buurtzorg-Konzept macht<br />
Hoffnung, dass die Herausforderungen<br />
zu meistern sind. Ob das<br />
niederländische Konzept diese Hoffnung<br />
erfüllt, bleibt vorerst sicherlich<br />
abzuwarten. Insbesondere ist derzeit<br />
noch vollständig unklar, ob durch das<br />
Modell auch finanzielle Vorteile für<br />
die Pflegekräfte und für das Gesundheits-<br />
und Pflegesystem insgesamt<br />
möglich sind. Denkbar scheint hingegen,<br />
dass der stärkere Fokus auf die<br />
ganzheitliche Betreuung der Klienten<br />
bei gleichzeitiger Entlastung von bürokratischen<br />
Aufgaben zu einer Aufwertung<br />
und Attraktivitätssteigerung<br />
des Pflegeberufes beitragen kann. Das<br />
Buurtzorg-Modell stellt die Leitwerte<br />
von Pflege und des humanitären Umgangs<br />
mit Hilfsbedürftigen in den<br />
Vordergrund [4]. In den Niederlanden<br />
sind die Buurtzorg-Pflegeanbieter<br />
als gemeinnützige Organisationen<br />
organisiert. Unabhängig von der Unternehmensform<br />
ist der Ansatz von<br />
ganzheitlicher und Klientenzentrierter<br />
Pflege einer, von dem auch die Hilfsbedürftigen<br />
in Deutschland profitieren<br />
sollten.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
[1] GKV-Spitzenverband (Hrsg.) (2<strong>01</strong>8): Kennzahlen der Sozialen Pflegeversicherung. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/grafiken/pflege_<br />
kennzahlen/spv_kennzahlen_03_2<strong>01</strong>8/SPV_Kennzahlen_Booklet_03-2<strong>01</strong>8_300dpi_2<strong>01</strong>8-03-15.pdf (20.<strong>01</strong>.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>)<br />
[2] Maatschappelijke Business Case (mbc) (2009): Buurtzorg Nederland, Rotterdam. Ernst & Young.<br />
[3] KPMG (2<strong>01</strong>5): The Added Value of Buurtzorg Relative to Other Providers of Home Care. A Quantitative Analysis of Home Care in the Netherlands in<br />
2<strong>01</strong>3.<br />
[4} Kai Leichsenring (2<strong>01</strong>5): Buurtzorg Nederland – Ein innovatives Modell der Langzeitpflege revolutioniert die Hauskrankenpflege. In: ProCare –<br />
Aktuelle Information, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege 20(8), 20-24.<br />
DOI: 10.1007/s00735-<strong>01</strong>5-0548-9 (03.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[5] Theresa Krinninger (2<strong>01</strong>8): Das soziale Netzwerk pflegt mit. In: Zeit-Online. https://www.zeit.de/wirtschaft/2<strong>01</strong>8-06/<br />
ambulante-pflegedienste-soziale-netzwerke-personal-mangel-niederlande-zeitdruck/komplettansicht (09.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[6] Jens Kohrs (<strong>2<strong>01</strong>9</strong>): Ambulante Pflege nach Buurtzorg – Spaß statt Fließband!<br />
https://www.pflegen-online.de/ambulante-pflege-nach-buurtzorg-spass-statt-fliessband (09.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
Anzeige<br />
14<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Dr. Barbara Mayerhofer MBA<br />
Die Anzahl der Patienten, die zu Hause versorgt werden, steigt stetig an. Die meist älteren Patienten und ihre Angehörigen<br />
erwarten eine effektive Versorgung, die auf einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen dem Pflegedienst<br />
und dem Hausarzt sowie weiteren Therapeuten gründen sollte. Diese Erwartungen werden oftmals nicht erfüllt, da<br />
die interprofessionelle Zusammenarbeit, bei der alle Beteiligten auf gleicher Ebene mit den Klienten zusammenarbeiten,<br />
an Schwierigkeiten in der Kommunikation, nicht abgesprochenen Prozessen und einer nicht einheitlichen<br />
Dokumentation scheitert.<br />
In Befragungen beurteilen Ärzte die<br />
Versorgung nach dem Buurtzorg Prinzip<br />
„…signifikant höher als die Arbeit<br />
anderer Pflegeorganisationen.“[1]<br />
Wie kommt es zu dieser Einschätzung,<br />
die, aufgrund bislang fehlender Studien,<br />
nicht weiter untermauert werden<br />
kann?<br />
Buurtzorg geht einen neuen Weg<br />
der ambulanten Pflege. Ziel der Versorgung<br />
ist, die Selbstständigkeit der<br />
meist alten und kranken Patienten<br />
wiederherzustellen bzw. zu optimieren,<br />
so dass sie zufrieden, selbstbestimmt<br />
und möglichst gesund leben<br />
können. Dies steht so in § 2 Abs. 1 Satz<br />
1 SGB XI – und wird doch nicht immer<br />
berücksichtigt, da Pflegedienste, ausgerichtet<br />
an der Pflegebedürftigkeit<br />
der Menschen, wirtschaftlich denken<br />
und arbeiten. [2]<br />
Bei der zielführenden Beratung der<br />
Patienten durch die Pflegenden steht<br />
nunmehr die Wiedererlangung bzw.<br />
Erhaltung der Selbstständigkeit im<br />
www.apollon-alumni.de 15
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Vordergrund. Selbstständigkeit entspricht<br />
nach Kruse einer „altersfreundlichen<br />
Kultur…“, die durch eine auf<br />
den Patienten abgestimmte Dienstleistung<br />
gefördert wird. [3]<br />
Buurtzorg trägt durch den Erhalt der<br />
Selbstbestimmung als Teil der Selbstständigkeit<br />
dazu bei, Patienten in den<br />
gesamten Versorgungprozess einzubeziehen,<br />
wobei deren subjektive<br />
Wünsche nach Möglichkeit umgesetzt<br />
werden. [4]<br />
Pflegebedürftige Personen verfügen<br />
über unterschiedliche Ressourcen,<br />
die sie in Abhängigkeit von ihrem<br />
Gesundheitszustand abrufen können.<br />
Nicht zwangsläufig werden sie durch<br />
die Pflegebedürftigkeit von Anderen<br />
abhängig. Oftmals trägt eine gut gemeinte<br />
„Überversorgung“ zum Vergessen<br />
der Ressourcen und damit<br />
zur Trägheit der Patienten bei. Die<br />
Motivation des Patienten und seiner<br />
Angehörigen, am Behandlungs- und<br />
Pflegeprozess teilnehmen zu können,<br />
verringert Risikofaktoren, wie bspw.<br />
Isolation und Einsamkeit, und erhöht<br />
die Bereitschaft, sich auf neue Wege<br />
einzulassen. [5]<br />
Zur Förderung der dynamischen Prozesse<br />
innerhalb der Prozessorganisation<br />
ist eine systematische Vernetzung<br />
zwischen allen Beteiligten unabdingbar.<br />
Netzwerke werden oftmals mehr<br />
mit der IT in Verbindung gebracht als<br />
mit Organisationsentwicklung in sozialen<br />
Bereichen. „Netzwerken“ wird<br />
bei Buurtzorg verstanden als gelingende<br />
Form der Zusammenarbeit auf<br />
gemeinschaftlicher Basis, wobei sich<br />
die Mitglieder auf Augenhöhe begegnen.<br />
[6]<br />
Betreuung heißt nicht nur Schaffung<br />
einer patientenzentrierten Alltagsstruktur,<br />
sondern auch Einbeziehung<br />
der Familienangehörigen,<br />
Freunde oder Nachbarn. Besteht<br />
dieses informelle Netzwerk, wird ein<br />
weiteres Netzwerk entwickelt, das<br />
aus Hausärzten und Therapeuten,<br />
Dienstleistern wie Apotheke, Sanitätshaus<br />
und Krankenhaus besteht. Bei<br />
Bedarf werden auch weiterreichende<br />
Dienstleister eingebunden, die für die<br />
Versorgung der Patienten notwendig<br />
sind. [7]<br />
Vorteil von Netzwerken ist der Zugriff<br />
auf unterschiedliche Expertisen,<br />
womit eine Vergrößerung des Kompetenzpools<br />
angestrebt und auch<br />
erreicht wird. Für die Mitarbeiter der<br />
ambulanten Station bedeutet dies<br />
im Sinne der Lernenden Organisation<br />
aber auch, dass sie bereit sind, weiter<br />
bzw. neu „zu lernen“, um ihr Wissen<br />
stetig erweitern.<br />
Die reibungslose Zusammenarbeit<br />
zwischen Therapeuten und Pflegenden<br />
ist Voraussetzung für eine funktionierende<br />
Netzwerkarbeit, bei der<br />
es um die gemeinsame Lösung von<br />
komplexen Problemen geht, die mit<br />
Blick auf den Patienten nicht von einer<br />
Profession alleine zufriedenstellend<br />
bearbeitet werden können. [8] Zum<br />
Gelingen tragen eine behutsame<br />
Kommunikation und die abgestimmte<br />
Einbeziehung der am Netzwerk teilnehmenden<br />
Personen bei. [1]<br />
Aber auch Netzwerke müssen geführt<br />
werden. Netzwerkmanagement<br />
weicht vom traditionellen Management,<br />
das auf Kontrolle, Hierarchie<br />
und Verwaltung beruht, ab. Es geht<br />
vielmehr um gegenseitiges Vertrauen,<br />
Autonomie, Flexibilität und Kooperation<br />
und entspricht damit der Buurtzorg-Philosophie.<br />
[9]<br />
Dazu ist es notwendig, dass sich ambulante<br />
Dienste nicht nur nach außen<br />
öffnen, sondern auch immer wieder<br />
reflektieren, um innerhalb des Netzwerkes<br />
bestehen zu können. [10]<br />
In gut geführten Netzwerken gelingt<br />
es, mit einer differenzierten Abstimmung<br />
zwischen Therapeuten und<br />
Pflegenden, den Versorgungsbedarf<br />
der Patienten zu reduzieren und Kosten<br />
zu sparen, und so mit einer geringeren<br />
Anzahl an Pflegekräften auszukommen.<br />
Dieser Ansatz ist neu, denn<br />
in den herkömmlichen Pflegediensten<br />
gilt im Allgemeinen die Devise, so<br />
viele Leistungen wie möglich zu „verkaufen“,<br />
um die Arbeitsplätze der Pflegenden<br />
zu sichern. [1]<br />
Für einen gelingenden Netzwerkaufbau<br />
mit Therapeuten ist möglicherweise<br />
eine Umstellung der Beteiligten<br />
im Umgang miteinander notwendig.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass sich Pflegende<br />
in der Kommunikation mit<br />
Therapeuten, vor mit allem Ärzten,<br />
schwertun. Der Arzt ordnet an, die<br />
Pflegekraft führt aus. Auch wenn sich<br />
das Verhältnis zwischen Arzt und Pflegekraft<br />
in den letzten Jahren positiv<br />
verändert hat, fühlen sich Pflegende<br />
oftmals nicht ausreichend wertgeschätzt,<br />
was auch an einer mangelnden<br />
Wertschätzung des Berufsstandes<br />
in der Bevölkerung liegt. [11]<br />
Buurtzorg heißt, Begegnung auf Augenhöhe<br />
ohne Akzeptanzprobleme.<br />
Die Begegnung zwischen Arzt und<br />
Patient läuft meist (noch) genauso ab<br />
wie bei anderen ambulanten Diensten.<br />
Es wird angestrebt, dass medizinische<br />
und pflegerische Diagnosen<br />
sowie unterschiedliche Konzepte<br />
nicht länger als konkurrierend und<br />
möglicherweise differierend, sondern<br />
im Sinne des Patienten als gemeinsames<br />
Vorhaben, mit dem Ziel der<br />
Wiederherstellung der Selbstständigkeit,<br />
verstanden werden. Die Abstimmung<br />
von Betreuungs- und Behandlungsplänen<br />
mit allen Beteiligten er-<br />
16<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
folgt kompetenzgesteuert und richtet<br />
sich, soweit wie möglich, nach den<br />
Wünschen des Patienten. Die professionelle<br />
Haltung ermöglicht eine Kommunikation<br />
mit den beteiligten Therapeuten<br />
auf Augenhöhe. [6] Pflegende,<br />
die sich ihrer Kompetenz bewusst<br />
sind, übernehmen Verantwortung für<br />
sich und den Patienten. [12]<br />
Nicht nur Pflegebedürftige profitieren<br />
von einer abgestimmten Kommunikation,<br />
die sich positiv auf den Genesungsprozess<br />
auswirkt, sondern auch<br />
Pflegende, deren Stressbelastung<br />
nachhaltig reduziert wird. [13]<br />
Buurtzorg verändert die interprofessionelle<br />
Kommunikation, die auf<br />
Ritualen und Rollenverständnissen<br />
der Berufsgruppen gründet. Kirchner<br />
empfiehlt als Grundlage der Kommunikation<br />
nur 3 Regeln: „1.Achte auf deine<br />
Gedanken, denn sie werden Worte.<br />
2. Worte, die den Mund verlassen haben,<br />
kann man nicht zurück holen. 3.<br />
Lasse Deine Worte durch drei Siebe<br />
laufen. Das erste Sieb ist die Frage: ist<br />
es wahr? Das zweite Sieb ist die Frage:<br />
ist es notwendig? Das dritte Sieb ist<br />
die Frage: ist es freundlich?“ [7]<br />
Gerade dann werden Respekt und<br />
Anerkennung deutlich, wenn alle beteiligten<br />
Professionen sich mit Zugewandtheit,<br />
Aufmerksamkeit und Interesse<br />
begegnen. [6]<br />
Die interne Kommunikation, für die<br />
das Team verantwortlich ist, zeichnet<br />
sich durch eine hohe Transparenz aus.<br />
Alle Mitarbeiter können jederzeit auf<br />
alle Informationen zugreifen. Dieses<br />
Vertrauen, das auf der Prämisse es „…<br />
gibt keine unwichtigen Menschen …“<br />
gründet, ermöglicht teamübergreifend<br />
einen angstfreien Umgang mit<br />
Daten und Fakten. Dies zeigt sich vor<br />
allem in schwierigen Situationen,<br />
wenn Pflegende und Therapeuten gemeinsam<br />
nach Lösungen suchen. [1]<br />
Netzwerken, interprofessionelle Zusammenarbeit<br />
und das Miteinander<br />
auf Augenhöhe erfordern einen Paradigmenwechsel,<br />
der durch das Buurtzorg-System<br />
derzeit erfolgreich umgesetzt<br />
wird.<br />
Literatur:<br />
[1] Laloux, F. (2<strong>01</strong>5). Reinventing Organizations. Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Franz Vahlen.<br />
[2] Bosold Gmbh (<strong>2<strong>01</strong>9</strong>). Buurtzorg, die Revolution in der ambulanten Pflege. https://www.pflege-in-leipzig.de/buurtzorg.html (12.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[3] Kruse, A. (<strong>2<strong>01</strong>9</strong>). Anforderungen der Gerontologie an die Planung für ältere Menschen. In: Schubert, H. (Hrsg.): Integrierte Sozialplanung für die<br />
Versorgung im Alter. Grundlagen–Bausteine-Praxisbeispiele. Wiesbaden: Springer. S. 19-41.<br />
[4] Kammerer, K.; Falk; K.; Heusinger, J.; Kümpers, S. (2<strong>01</strong>2). Selbstbestimmung bei Pflegebedürftigkeit. Drei Fallbeispiele zu individuellen und<br />
sozialräumlichen Ressourcen älterer Menschen. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 45 (10.2<strong>01</strong>2), S. 624-629.<br />
[5] Luthe, E.W. (2<strong>01</strong>7). Wissenschaftliche Perspektiven: der sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche und ökonomische Blickwinkel. In:<br />
Brandhorst, A.; Hildebrandt, H.; Luthe, E.W. (Hrsg.): Kooperation und Integration – das unvollendete Projekt des Gesundheitssystems. S. 33-82.<br />
Wiesbaden: Springer.<br />
[6] Forster, A. (2<strong>01</strong>7). Visite! – Kommunikation auf Augenhöhe im interdisziplinären Team. Berlin: Springer.<br />
[7] Kirchner, U. (2<strong>01</strong>6). Wie kommt das buurtzorg-modell nach deutschland? Ambulante Pflege aus Holland.<br />
http://www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/ (03.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[8] Partecke, M.; Heß, U.; Schäper, C.; Meißner, K. (2<strong>01</strong>8). Interprofessionelles Lernen als Voraussetzung für interprofessionelle Zusammenarbeit<br />
Herausforderungen und Maßnahmen zur Optimierung effektiver Kommunikation in klinischen Notfallsituationen. In: Simon, A. (Hrsg.): Akademisch<br />
ausgebildetes Pflegefachpersonal. Entwicklung und Chancen. Berlin: Springer, S. 146-154.<br />
[9] Howaldt, J. (<strong>2<strong>01</strong>9</strong>). Soziale Innovation im Fokus nachhaltiger Entwicklung – Die Bedeutung von Kooperationen und Netzwerken für den Erfolg<br />
sozialer Innovationen. In: In: Neugebauer, C.; Pawel, S.; Biritz, H.: Netzwerke und soziale Innovationen Lösungsansätze für gesellschaftliche<br />
Herausforderungen? Wiesbaden: Springer, S. 19-30.<br />
[10] Krainz, E.E. (<strong>2<strong>01</strong>9</strong>). Vorwort des Reihenherausgebers. Netzwerke – eine neue Form der Organisation? In: Neugebauer, C.; Pawel, S.; Biritz, H.:<br />
Netzwerke und soziale Innovationen Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen? Wiesbaden: Springer, S. V-X.<br />
[11] Hibbeler, B. (2<strong>01</strong>1). Ärzte und Pflegekräfte: Ein chronischer Konflikt. Deutsches Ärzteblatt 41 (10.2<strong>01</strong>1), S. A 2138-A 2148.<br />
[12] Fliedner, M.C.; Eychmüller, S. (2<strong>01</strong>6). Ansprüche an die interprofessionelle Zusammenarbeit. Die anderen und ich. Der Onkologe 9 (6.2<strong>01</strong>6),<br />
S. 631‐637.<br />
[13] Tewes, R. (2<strong>01</strong>5). Schulen Sie Ihr Personal. Interprofessionelle Kommunikation will gelernt sein. Heilberufe/Das Pflegemagazin 67, S. 20-22.<br />
www.apollon-alumni.de 17
Ambulante Pflege in Deutschland nach dem Vorbild von Buurtzorg<br />
Ambulante Pflege in Deutschland nach dem Vorbild von Buurtzorg –<br />
Überlegungen zu Rechtsform und Organisation<br />
Dr. Felix Hoffmann<br />
Die Idee von Buurtzorg gilt als revolutionär: Pflegekräfte pflegen nicht, sondern unterstützen pflegebedürftige Menschen<br />
dabei, zu einem selbstbestimmten Leben zurück zu finden.<br />
Buurtzorg zeigt, dass ein agil organisierter<br />
Pflegedienst ein großes Potential<br />
entfalten kann. Aber lässt sich ein<br />
ambulanter Pflegedienst nach Buurtzorgschem<br />
Vorbild auch auf Deutschland<br />
übertragen?<br />
Nachfolgende Gedanken sollen einen<br />
möglichen Weg dorthin skizzieren.<br />
Unternehmensziel<br />
Zunächst soll die Frage beantwortet<br />
werden, worin das Unternehmensziel<br />
von Buurtzorg überhaupt besteht.<br />
Gemäß dem Slogan „Humanity over<br />
bureaucracy” verfolgt Buurtzorg das<br />
Ziel, ohne bürokratischen Aufwand<br />
pflegebedürftigen Menschen die<br />
Zuwendung zukommen zu lassen,<br />
die sie benötigen. Das Ziel ist jedoch<br />
nicht, einen Menschen zu pflegen,<br />
sondern Unterstützung für ein möglichst<br />
selbstbestimmtes Leben zu geben.<br />
[1]<br />
Durch diese einfache Veränderung der<br />
Sichtweise konnte nach Angaben von<br />
Buurtzorg erreicht werden, dass viele<br />
Patienten ein deutlich selbstbestimmteres<br />
Leben führen können und der<br />
Pflegeaufwand oftmals reduziert werden<br />
kann.<br />
Buurtzorg richtet seinen Blick jedoch<br />
nicht nur auf die Patienten, sondern<br />
gleichermaßen auch auf die Pflegekräfte.<br />
Die professionelle Pflegetätigkeit<br />
soll nicht nur Selbstzweck sein,<br />
sondern die Mitarbeitenden auch<br />
glücklich machen.<br />
Zielerreichung<br />
Wie gelingt es Buurtzorg nun, dass<br />
diese Unternehmensziele tatsächlich<br />
erreicht und gelebt werden?<br />
In herkömmlichen Organisationen<br />
fehlen den Entscheidungsträgern oft<br />
die nötigen Informationen für eine<br />
sinnvolle Entscheidung. Die Konsequenz<br />
können Fehlentscheidungen<br />
sein. Buurtzorg zeichnet sich hingegen<br />
durch agile Unternehmensstrukturen<br />
aus. Viele kleine Teams agieren<br />
eigenständig, die Firmenzentrale<br />
übernimmt die Aufgabe einer internen<br />
Beratungsabteilung und unterstützt<br />
die Teams bei ihrer Arbeit oder<br />
bei Projekten.<br />
Entscheidungen werden nicht von<br />
den Vorgesetzten getroffen (die es<br />
bei Buurtzorg ohnehin kaum gibt),<br />
sondern von den betroffenen Mitarbeitenden<br />
selbst. Auf diese Weise ist<br />
sichergestellt, dass genau die Menschen<br />
eine Entscheidung treffen, die<br />
von dieser Entscheidung auch direkt<br />
betroffen sind und deshalb über den<br />
größten Wissensschatz zum jeweiligen<br />
Sachverhalt verfügen.<br />
Natürlich existieren auch bei Buurtzorg<br />
Regeln, welche für alle Mitarbeitenden<br />
gültig sind. Diese sind jedoch<br />
nicht in Stein gemeißelt, sondern können<br />
verändert werden. Die Initiative<br />
hierzu kann von jedem Mitarbeitenden<br />
ausgehen. [2]<br />
18<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Marktanalyse<br />
Das Unternehmensziel wurde nun formuliert,<br />
aber besteht überhaupt ein<br />
Bedarf auf dem Markt?<br />
Im Rahmen einer Marktanalyse wird<br />
der konkrete Bedarf für einen ambulanten<br />
Pflegedienst ermittelt. Wenn<br />
bereits sehr viele Pflegedienste existieren,<br />
wird es auch für einen innovativen<br />
Pflegedienst schwer werden, sich zu<br />
etablieren. Möglicherweise bietet sich<br />
dann die Gelegenheit, die Ideen in<br />
Kooperation mit einem bereits existierenden<br />
Pflegedienst umzusetzen.<br />
Möglicherweise bietet es sich auch an,<br />
eine bestimmte pflegerische Nische<br />
zu bedienen, für die aktuell ein Bedarf<br />
besteht.<br />
Gründung<br />
Teamwork oder Einzelgänger?<br />
Wenngleich es möglich ist, ein Unternehmen<br />
im Alleingang zu gründen,<br />
so fällt dies doch mit einem kompetenten<br />
Team wesentlich leichter.<br />
In erster Linie sollten natürlich erfahrene<br />
Pflegekräfte in das Team aufgenommen<br />
werden, die schließlich<br />
später die Kernleistungen erbringen.<br />
Darüber hinaus kann das Team durch<br />
Personen mit medizinischer, ökonomischer<br />
und juristischer Expertise bereichert<br />
werden. Nicht zuletzt sollte<br />
das gesamte Team mit dem agilen Ansatz<br />
von Buurtzorg vertraut und offen<br />
für andere innovative Ideen sein.<br />
Ist die Rechtsform einer GmbH<br />
sinnvoll?<br />
Rechtsform und Unternehmensziel<br />
müssen zueinander passen.<br />
In einer Kapitalgesellschaft treffen<br />
in der Regel die Eigentümer die wesentlichen,<br />
meist strategischen Entscheidungen.<br />
Obwohl diese – wie bei<br />
Buurt zorg – delegiert werden können,<br />
ist das Mitspracherecht der Angestellten<br />
bei strategischen Entscheidungen<br />
jedoch eher gering.<br />
Diese Diskrepanz zwischen entscheidungskompetenten<br />
Mitarbeitenden<br />
auf der einen Seite und entscheidungsberechtigten<br />
Führungskräften<br />
auf der anderen Seite widerspricht<br />
dem agilen Organisationsgedanken.<br />
Dass Buurtzorg trotzdem funktioniert,<br />
liegt an der großen intrinsischen Motivation<br />
des Eigentümers Jos de Blok,<br />
die agilen Prinzipien zu leben. Ein<br />
Nachfolger hätte jedoch prinzipiell die<br />
Möglichkeit, andere Führungsstrukturen<br />
einzuführen. Agile Prinzipien<br />
stehen und fallen somit mit der Leitungsposition.<br />
Genossenschaft als Alternative!<br />
Für eine langfristige Resilienz eines<br />
agilen Unternehmens gegen die unternehmensfernen<br />
Interessen Einzelner<br />
ist es erforderlich, das agile Mindset<br />
auch rechtlich in der Organisation<br />
des Unternehmens zu verankern.<br />
Die Rechtsform einer Genossenschaft<br />
bietet sich hier als sinnvolle Alternative<br />
zu den weit verbreiteten Kapitalgesellschaften<br />
an, da die Mitarbeitenden zugleich<br />
Eigentümer des Unternehmens<br />
sind und daher auch bei wichtigen<br />
Entscheidungen demokratisch mitbestimmen<br />
können.<br />
Auf diese Weise haben alle Mitarbeitenden<br />
die Möglichkeit, auf die künftige<br />
Ausrichtung des Unternehmens<br />
Einfluss zu nehmen. Eine Beeinflussung<br />
des Unternehmens durch Dritte<br />
ist nicht unbedingt ausgeschlossen,<br />
aber deutlich erschwert.<br />
Per Satzung kann geregelt werden,<br />
wer zum Erwerb von Genossenschaftsanteilen<br />
berechtigt ist und wer<br />
welche Entscheidungen treffen darf.<br />
Entscheidungen, die die DNA des Unternehmens<br />
betreffen, sollten nur von<br />
einer Generalversammlung getroffen<br />
werden können. Für größere Entscheidungen<br />
sollten leistungsfähige Entscheidungsstrukturen<br />
etabliert werden,<br />
kleine Entscheidungen einzelner<br />
Teams werden informell innerhalb der<br />
Teams getroffen.<br />
Finanzierung<br />
Über die Verwendung der Unternehmensgewinne<br />
kann die Genossenschaft<br />
gemäß § 19 Abs. 2 GenG<br />
frei verfügen. Gemäß dem Prinzip<br />
„Leistung und Gegenleistung müssen<br />
sich entsprechen“ könnten die<br />
Gewinne beispielsweise nach einem<br />
leistungsorientierten Schlüssel an die<br />
Mitarbeitenden ausgeschüttet werden.<br />
Auf diese Weise bleibt das Geld<br />
bei den Menschen, die es in zweierlei<br />
Bedeutung auch verdient haben.<br />
Ein Nachteil dieser Gewinnverteilung<br />
besteht darin, dass Kapitalinvestoren<br />
einen geringeren Anreiz haben, in<br />
eine Genossenschaft zu investieren.<br />
Dies kann potenziell eher zu Liquiditätsengpässen<br />
führen als in Kapitalgesellschaften.<br />
Andererseits bestehen<br />
viele innovative Möglichkeiten, Geld<br />
zu beschaffen. Diese reichen von klassischen<br />
Krediten über Crowdfunding<br />
bis nicht zuletzt hin zu den Genossenschaftsanteilen<br />
selbst.<br />
Das Crowdfunding bietet den Investoren<br />
nicht nur die Möglichkeit, zu<br />
einem vergleichsweise attraktiven<br />
Zinssatz ihr Geld anzulegen, sondern<br />
darüber hinaus auch ein Unternehmen<br />
zu fördern, dessen Ziele sie schätzen.<br />
Das Unternehmen hat den Vorteil,<br />
dass nach Rückzahlung des Kredits<br />
keine weiteren Verpflichtungen mehr<br />
bestehen und Unternehmensgewinne<br />
langfristig im Unternehmen<br />
verbleiben.<br />
Strukturen und Prozesse<br />
Buurtzorg ist als agile Organisation<br />
dazu in der Lage, rasch auf Veränderungen<br />
einer sich stetig wandelnden<br />
Arbeitswelt zu reagieren. Für die tägliche<br />
Arbeit sind jedoch feste Strukturen<br />
und Prozesse erforderlich, an<br />
denen sich die Mitarbeitenden orientieren<br />
können.<br />
www.apollon-alumni.de 19
Burtzoorg aus der Sicht anderer medizinischer Berufsgruppen<br />
Der Wert dieser Strukturen und Prozesse<br />
kann daran bemessen werden,<br />
wie groß der Anteil der Wertschöpfung<br />
an der Gesamtheit der Aktivitäten<br />
ist. Alle nicht wertschöpfenden<br />
Prozessschritte (also solche, die nicht<br />
der Erreichung des Unternehmensziels<br />
dienen) gelten als Verschwendung<br />
und sollten nach Möglichkeit<br />
minimiert werden. Lean Management<br />
kann als Unternehmenskultur schlanker<br />
Prozesse verstanden werden und<br />
ist somit eine sinnvolle Ergänzung zur<br />
Agilität.<br />
Agilität wirkt anders als das Lean Management<br />
nicht auf dem Prozess<br />
selbst ein, sondern auf die Art und<br />
Weise, wie ein Prozess verändert werden<br />
kann. Gewissermaßen ist Lean<br />
Management der Schlüssel zu schlanken<br />
Prozessen und Agilität der Schlüssel<br />
dazu, diese bedarfsgerecht zu verändern.<br />
Mitarbeitende<br />
Die Menschen aus dem Gründungsteam<br />
können der späteren Belegschaft<br />
angehören, müssen es aber<br />
nicht. Viele Menschen haben Freude<br />
daran, ein Unternehmen zu gründen,<br />
möchten aber nicht dauerhaft darin<br />
mitarbeiten. Andere wiederum sehen<br />
in der Gründung eine langfristige berufliche<br />
Perspektive.<br />
Unabhängig davon wird es früher<br />
oder später erforderlich sein, neue<br />
Mitarbeitende zu finden. Mögliche<br />
Wege sind Zeitungsanzeigen oder<br />
Job-Börsen. Aber auch das persönliche<br />
Netzwerk der Mitarbeitenden<br />
sollte nicht unterschätzt werden.<br />
Gehalt<br />
Es gibt Unternehmen, die eine transparente<br />
Gehaltspolitik eingeführt<br />
haben. Die Gehälter aller Mitarbeitenden<br />
sind bekannt, im Rahmen einer<br />
Gehaltsverhandlung kann jeder Mitarbeitende<br />
unter Berücksichtigung<br />
der folgenden Aspekte sein eigenes<br />
Gehalt festlegen.<br />
1. Wie viel Geld brauche ich?<br />
2. Wie viel Geld bekommen meine<br />
Kollegen in einer vergleichbaren<br />
Position?<br />
3. Wie viel Geld würde ich bei einem<br />
anderen Unternehmen für eine vergleichbare<br />
Tätigkeit bekommen?<br />
4. Was kann sich das Unternehmen<br />
leisten?<br />
Nach der Erfahrung vieler Unternehmen,<br />
die die Gehälter auf diese Weise<br />
festlegen, wird diese außergewöhnliche<br />
Art der Gehaltsfindung nicht<br />
ausgenutzt, sondern vielmehr als sehr<br />
fair empfunden. [3]<br />
Die Vergütung des gewählten Vorstands,<br />
dem in einer Genossenschaft<br />
die Managementaufgaben obliegen,<br />
darf an den gleichen Maßstäben bemessen<br />
werden wie die Vergütung<br />
aller anderen Beschäftigten. Auch hier<br />
gilt der Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit.<br />
Welche Rolle spielt das<br />
Management?<br />
Auch ein genossenschaftlich organisiertes<br />
agiles Unternehmen kommt<br />
nicht gänzlich ohne ein Management<br />
aus.<br />
Bei Buurtzorg besteht die Aufgabe des<br />
Managements vor allem in der Unterstützung<br />
der Teams, beispielsweise<br />
bei Projekten oder bei der Bewältigung<br />
von Herausforderungen. Auch<br />
allgemeine Verwaltungsaufgaben wie<br />
die Personalverwaltung und das Marketing<br />
werden bei Buurtzorg zentral<br />
organisiert. Es handelt sich bei der<br />
Verwaltung demnach um ein Team<br />
mit Sonderaufgaben, welches mit den<br />
Pflegeteams auf Augenhöhe agiert.<br />
Marketing<br />
Spätestens beim Marketing muss die<br />
Frage gestellt werden, welches Ziel<br />
am Markt verfolgt werden soll.<br />
Das Marketing vieler klassischer Organisationen<br />
ist darauf ausgerichtet, ein<br />
möglichst großes Wachstum zu erreichen.<br />
Das hat allerdings auch Nachteile,<br />
denn ein zu schnelles Wachstum<br />
kann eine Organisation überfordern<br />
und sich negativ auf Arbeitsqualität,<br />
Zufriedenheit und langfristige Effizienz<br />
auswirken.<br />
Einige Unternehmen verfolgen das<br />
Konzept des gesunden Wachstums,<br />
welches durchaus die Notwendigkeit<br />
kennt, neue Kunden zu akquirieren.<br />
Andererseits kennen diese Organisationen<br />
auch eine Grenze des Wachstums,<br />
welche nicht überschritten werden<br />
sollte. [4]<br />
Fazit: Als Rechtsform für agile Unternehmen<br />
bietet sich die Genossenschaft<br />
an, da diese das agile Mindset<br />
bereits beinhaltet.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
[1] Gray BHG, Sarnak DOS, Burgers JSB: Home Care by Self-Governing Nursing Teams: The Netherlands‘ Buurtzorg Model: The Commonwealth Fund<br />
2<strong>01</strong>5.<br />
[2] Laloux F, Kauschke M: Reinventing organisations: Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Vahlen 2<strong>01</strong>5.<br />
[3] Pein M: New Work, New Pay? In: managerSeminare Verlags GmbH (ed.): manager-Seminare 246: Das Weiterbildungsmagazin. Bonn:<br />
managerSeminare Verlags GmbH 2<strong>01</strong>8; 20–26.<br />
[4] Wegner O: Wachsen statt Platzen: Gesunde Unternehmensentwicklung. In: manager-Seminare Verlags GmbH (ed.): managerSeminare 246: Das<br />
Weiterbildungsmagazin. Bonn: managerSeminare Verlags GmbH 2<strong>01</strong>8; 28–35.<br />
20<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Politische Überlegungen zu Buurtzorg in Deutschland<br />
Politische Überlegungen zu Buurtzorg in Deutschland<br />
Florian Bechtel<br />
Ein Konzept à la Buurtzorg würde angesichts der momentanen Personalsituation in der professionellen Pflege und<br />
auch der pflegenden Angehörigen guttun. Politisch tut sich jedoch wenig in diese Richtung.<br />
Trend geht zur Entprofessionalisierung<br />
Eine Organisationsstruktur, in der sich<br />
die Teams völlig autark gestalten und<br />
entwickeln, erfordert von ihren Mitgliedern<br />
entsprechende Fähigkeiten,<br />
um diese Aufgaben auch bewerkstelligen<br />
zu können.<br />
Diese müssten sowohl pflegerischer<br />
als auch ökonomischer und auch organisatorischer<br />
Natur sein, um das<br />
Spektrum an Aufgaben abzudecken,<br />
welche ein solches System mit sich<br />
bringen würde. Allerdings lässt sich<br />
momentan in einigen Bundesländern<br />
eher eine Entwicklung beobachten,<br />
die das Kompetenzspektrum der professionellen<br />
Pflege nicht erweitert,<br />
sondern durch geminderte Zugangsvoraussetzungen<br />
[1] und 150-stündige<br />
„Weiterqualifizierungen“ für Behandlungspflege<br />
[2], besonders in der<br />
Altenpflege, einer Entprofessionalisierungskampagne<br />
gleicht. Hier scheint<br />
das Motto eher „Masse statt Klasse“ zu<br />
sein. Womit wir uns in Deutschland in<br />
Bezug auf das Kompetenzprofil eher<br />
von der Selbstorganisation distanzieren.<br />
Akademisierung ist der Schlüssel<br />
Für eine zukunftsfähige professionelle<br />
Pflege braucht es akademisch<br />
ausgebildete Pflegefachpersonen.<br />
Nur so kann sichergestellt werden,<br />
dass in selbstorganisierten Teams das<br />
gesamte Kompetenzspektrum abgedeckt<br />
wird, welches die qualitativ<br />
hochwertige und pflegewissenschaftlich<br />
fundierte Versorgung der Patienten<br />
erfordert. Allerdings gilt es hier,<br />
die Studiengänge den Erfordernissen<br />
der neuen Pflegelandschaft anzupassen<br />
und nicht andersherum. Dies ist<br />
der einzige Weg eine bedarfsgerechte<br />
und sinnvolle Akademisierung zu garantieren<br />
und zu verhindern, dass die<br />
Ausbildung am Bedarf der Leistungsbezieher<br />
und auch an den Bedürfnissen<br />
der Leistungserbringer vorbei implementiert<br />
wird.<br />
www.apollon-alumni.de 21
Politische Überlegungen zu Buurtzorg in Deutschland<br />
Haben wir genug Vertrauen in die<br />
professionelle Pflege?<br />
Die Form der Selbstorganisation, welche<br />
bei Buurtzorg umgesetzt wurde,<br />
erfordert ein hohes Maß an Vertrauen<br />
auf allen Ebenen. „Wenn man sich als<br />
Geschäftsführer für einen selbst organisierten<br />
Betrieb entscheidet, setzt das<br />
Vertrauen in die Menschen und ihre<br />
Fähigkeiten voraus.“ sagt der Organisationsforscher<br />
Christoph Minnig. [3]<br />
Da das Thema Pflege und Pflegebedürftigkeit<br />
ein sehr sensibles ist, bedarf<br />
es aber vor allem des Vertrauens<br />
des Patienten gegenüber allen, die an<br />
seiner Versorgung beteiligt sind. Auch<br />
hier füllt die professionelle Pflege wieder<br />
eine Schlüsselrolle aus, da ihr die<br />
Aufgabe zukommt, die Versorgung<br />
umfassend und ganzheitlich zu koordinieren.<br />
Deshalb müssen auch die<br />
versorgenden Ärzte und insbesondere<br />
die Kostenträger ein Mindestmaß an<br />
Vertrauen in die Kompetenz der Pflege<br />
mitbringen, damit dieses System<br />
funktionieren kann.<br />
Evaluation der Prozesse und<br />
Neuordnung der Kompetenzen<br />
Grundsätzlich gilt es, insbesondere in<br />
der ambulanten Pflege, die interdisziplinären<br />
Prozesse genauer anzuschauen,<br />
sie auf ihre Effizienz und Sinnhaftigkeit<br />
zu überprüfen, um sie gegebenenfalls<br />
im Sinne der Vereinfachung<br />
zu verändern. Hier ist disruptives Denken<br />
gefragt! Ist es beispielsweise sinnvoll,<br />
dass bei einem Patienten, der zu<br />
Hause pflegerisch ambulant versorgt<br />
wird, alle Anordnungskompetenzen<br />
beim behandelnden Hausarzt liegen?<br />
Oder macht es nicht mehr Sinn, wenn<br />
z.B. die (entsprechend weitergebildete)<br />
Pflegekraft, welche die Wundversorgung<br />
mehrmals wöchentlich<br />
übernimmt, auch das entsprechende<br />
Wundmaterial verordnen darf? Grundsätzlich<br />
sollte, meiner Meinung nach,<br />
die Profession, welche am nächsten<br />
am Patienten ist, die Koordination<br />
von dessen Behandlung im Sinne des<br />
Case-Managements übernehmen.<br />
Entsprechend den nötigen Kompetenzen<br />
können dann die Behandlungsteams<br />
zusammengestellt werden.<br />
Warum also nicht die Handlungskompetenzen<br />
auch juristisch dort bündeln,<br />
wo Fachexpertise und Patientennähe<br />
zusammenkommen?<br />
In den Niederlanden profitiert auch<br />
die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
von der Selbstorganisation des<br />
Pflegedienstes: Die niedergelassenen<br />
Ärzte zeigen sich in einer qualitativen<br />
Befragung sehr zufrieden ob der Kooperation<br />
mit den Pflegeteams. [5]<br />
Vom Selbstmitleid zum<br />
Selbstvertrauen<br />
Eine andere Form des Vertrauens, die<br />
ebenfalls dringend benötigt wird, um<br />
ein solches System konsequent zu etablieren,<br />
ist Selbstvertrauen. Dies beinhaltet<br />
auch den Mut, diese Verantwortung<br />
der Selbstorganisation tragen<br />
zu können. Und das ist ein Punkt, an<br />
dem die Profession Pflege zusammen<br />
mit den politischen Akteuren arbeiten<br />
muss.<br />
Die Selbstverständlichkeit, etwas<br />
selbst zu organisieren, zu entwickeln<br />
und dafür auch die Verantwortung<br />
zu tragen, ohne dass ein Vorgesetzter<br />
da ist, auf den man diese abwälzen<br />
kann, ist etwas, woran die Pflegenden<br />
in Deutschland nicht gewöhnt sind.<br />
Dass besonders der Berufsstand der<br />
Pflegenden sich mit Eigenverantwortung<br />
noch sehr schwertut, zeigen die<br />
aktuellen Diskussionen über die berufliche<br />
Selbstverwaltung in Form von<br />
Pflegekammern, wie man sie gerade<br />
besonders in Niedersachsen beobachten<br />
kann.<br />
Unternehmen ohne Hierarchie –<br />
können wir das?<br />
Hierarchien in Unternehmen gab es irgendwie<br />
schon immer – und jetzt soll<br />
das plötzlich völlig ohne „Führung von<br />
oben“ funktionieren. Es würde sicherlich<br />
seine Zeit brauchen, bis sich die<br />
Struktur ohne klare Hackordnung etabliert.<br />
Zu sehr sind klare Hierarchien<br />
in unserer Kultur und besonders in<br />
Unternehmen verwurzelt. Hier gilt es,<br />
erst einmal ein gesundes Mittelmaß<br />
zwischen altehrwürdiger „Befehlskette“<br />
und Überforderung der Mitarbeiter<br />
zu finden. Plötzlich sein eigener Chef<br />
zu sein, wäre für viele eine große Aufgabe,<br />
die es erst einmal zu bewältigen<br />
gilt. Aber bekanntlich wächst man an<br />
seinen Herausforderungen.<br />
Moderne Führung ist viel mehr als Anweisungen<br />
zu geben, wer was wie zu<br />
machen hat. Vielmehr geht es darum,<br />
seinen Mitarbeiter zu befähigen, die<br />
Ziele auf die eigene Weise zu erreichen.<br />
Die Führungskraft muss dem Mitarbeiter<br />
lediglich die „Werkzeuge“ an die<br />
Hand geben und ihm unterstützend<br />
zu Seite stehen. So können ungeahnte<br />
Potenziale entfaltet werden, von denen<br />
das Unternehmen, der Mitarbeiter<br />
und, wie im Fall Buurtzorg, auch<br />
der Leistungsempfänger profitieren<br />
kann.<br />
Dass dieser Wandel Mut und Geduld<br />
erfordert, steht außer Frage. Allerdings<br />
braucht das deutsche Gesundheitssystem<br />
in seiner aktuellen Situation<br />
genau das: Mut und Innovationsgeist.<br />
Pilotprojekte entstehen bisher<br />
nur aus Eigeninitiative<br />
Projekte, wie eine Organisation nach<br />
dem Vorbild von Buurtzorg zu implementieren,<br />
stehen momentan nicht<br />
besonders weit oben auf der gesundheitspolitischen<br />
Agenda. Allgemein<br />
fällt auf, dass die Bereiche ambulante<br />
pflegerische Versorgung und Rehabilitation<br />
bei all den Reformen etwas<br />
zu kurz kommen. Deshalb nehmen<br />
einige kleine Pflegedienste ihr Glück<br />
selbst in die Hand und starten zusammen<br />
mit den Kostenträgern Mo-<br />
22<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Politische Überlegungen zu Buurtzorg in Deutschland<br />
dellprojekte von selbstorganisierten<br />
Pflegeteams. Um diese jedoch bundesweit<br />
auszurollen, bedarf es einer<br />
politischen Angleichung der Rahmenbedingungen<br />
in den einzelnen Bundesländern.<br />
Jedoch zeigen sich besonders<br />
die Kassen gesprächsbereit,<br />
Projekte dieser Art mitzutragen. [4]<br />
Immerhin führte das „System Buurtzorg“<br />
in den Niederlanden dazu, dass<br />
die Leistungsbezieher doppelt so<br />
schnell aus der Pflege entlassen werden<br />
konnten und die Arbeitsstunden<br />
pro Patienten 40 % weniger betrugen,<br />
als bei vergleichbaren Leistungserbringern.<br />
Also auch wirtschaftlich ist das Prinzip<br />
der Selbstorganisation ein Erfolg. Angesichts<br />
der enormen Belastung, die<br />
unser Gesundheits- und Sozialsystem<br />
im Zuge des demografischen Wandels<br />
erwartet, durchaus eine Überlegung<br />
wert!<br />
Im Vordergrund sollte jedoch weiterhin<br />
das Wohl der Patienten stehen! Die<br />
zeigen sich im Übrigen auch sehr zufrieden<br />
mit Buurtzorg in den Niederlanden:<br />
bei der Nutzerzufriedenheit<br />
steht Buurtzorg an der Spitze aller mobilen<br />
Anbieter. [5]<br />
Eigentlich scheint es in diesem System<br />
nur Gewinner zu geben. Es bleibt abzuwarten,<br />
wann politisch der Weg<br />
für ein flächendeckendes Pilotprojekt<br />
geebnet wird.<br />
Dazu braucht es pflegepolitisch viel<br />
Mut und Durchsetzungsvermögen.<br />
Angefangen bei der, am besten bundesweiten,<br />
Angleichung der Aus-,<br />
Fort- und Weiterbildungsordnungen,<br />
die von Fachpersonen (mit)gestaltet<br />
werden sollten, welche ihre Expertise<br />
am Patienten noch täglich unter Beweis<br />
stellen. Außerdem muss es gelingen,<br />
alle Stakeholder an einen Tisch<br />
zu bekommen, um die ökonomischen<br />
Rahmenbedingungen zu schaffen.<br />
In den Niederlanden hat das Projekt<br />
schon bewiesen, dass es sich mit etwas<br />
Geduld selbst tragen kann und<br />
letztendlich durch seine Effektivität,<br />
in Form der Reduzierung der Pflegestunden<br />
und der früheren Entlassung<br />
aus der Pflege, zu signifikanten Einsparungen<br />
führt.<br />
Und das Wichtigste ist, dass der<br />
Leistungsbezieher davon profitiert!<br />
Bei all dem (berechtigten) Reformwahn<br />
im Gesundheitswesen scheinen<br />
die Beteiligten nämlich manchmal zu<br />
vergessen, worum es wirklich geht:<br />
Die Genesung und Lebensqualität des<br />
Patienten.<br />
Literaturverzeichnis<br />
[1] bpa (2009). Direkter Einstieg in die Altenpflegeausbildung künftig auch für Hauptschüler möglich.<br />
https://www.presseportal.de/pm/17920/1424586 (11.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[2] Schlütersche Verlagsgesellschaft (Hrsg.) (2<strong>01</strong>8). Pflegehelfer für Behandlungspflege qualifizieren?<br />
https://www.pflegen-online.de/pflegehelfer-fuer-behandlungspflege-qualifizieren (11.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[3] Machac, L. (2<strong>01</strong>6). Erfolg braucht kein Management. https://www.bernerzeitung.ch/articles/18170366 (11.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>).<br />
[4] Hertel, Y. (2<strong>01</strong>8). Interview: Pilotprojekt Buurtzorg in Deutschland.<br />
https://www.pflegemarkt.cco/2<strong>01</strong>8/08/29/interview-pilotprojekt-buurtzorg-in-deutschland/ (11.02.<strong>2<strong>01</strong>9</strong>)<br />
[5] Leichsenring, K., (2<strong>01</strong>5).„Buurtzorg Nederland“ – Ein innovatives Modell der Langzeitpflege revolutioniert die Hauskrankenpflege. Erschienen in:<br />
ProCare – Aktuelle Information, Fort- und Weiterbildung für die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflege, 20(8), 20-24.<br />
Anzeige<br />
Master per Fernstudium!<br />
MBA Health Economics & Management<br />
4 Wochen<br />
kostenlos<br />
testen!<br />
Master of Health Management (MaHM)<br />
Master Gesundheitsökonomie (M. A.)<br />
Master Angewandte Gerontologie (M. A.)<br />
Zertifikatskurse! U. a. Ernährungsberater, Grundlagenmedizin für Nichtmediziner<br />
Kostenlose Infos: 0800 3427655 (gebührenfrei)<br />
www.apollon-hochschule.de<br />
Ein Unternehmen der Klett Gruppe<br />
www.apollon-alumni.de 23
Ob das gut gehen kann.<br />
Ob das gut gehen kann.<br />
Tobias Ulamec<br />
Okay, dann oute ich mich halt mal. Nach meinem Studium an<br />
der APOLLON habe ich leider nur einen Job an einer Schule bekommen.<br />
Nix anderes hatte Erfolg und meine Familie hatte Hunger.<br />
Der einzige Ausweg – eine Stelle als Schulleiter.<br />
Jetzt bin ich Herr über 28 Lehrerinnen<br />
und Lehrer sowie eine Sekretärin und<br />
ca. 320 Schülerinnen und Schüler. Der<br />
Altersdurchschnitt meiner 320 Bildungsinsassen<br />
liegt zwischen 15 und<br />
22 Jahren, die sich entweder um einen<br />
Hauptschul-, Realschulabschluss oder<br />
gar um das Abitur bemühen. Soviel zu<br />
den harten Fakten. Viel interessanter<br />
ist aber, was die Bildungsinsassen für<br />
Träume haben und was sie im Moment<br />
dafür tun.<br />
Die Träume sind vermutlich allen<br />
klar und decken sich im Großen und<br />
Ganzen mit den Idealen, die wir schon<br />
als Schüler hatten. Eigenheim, dickes<br />
Auto, coole Familie und viel Freizeit<br />
zum Reisen. Das einzige was keine<br />
Erwähnung mehr findet ist das Thema<br />
Haustier – zu betreuungsintensiv.<br />
Womit wir auch schon bei den ersten<br />
beiden Problemen der aktuellen Thematik<br />
Pflege wären.<br />
Problem 1<br />
Eigenheim, dickes Auto, Freizeit und<br />
Familie sind mittlerweile eher Luxusgüter<br />
als Basics eines normal im Leben<br />
stehenden, arbeitenden Menschen.<br />
Eine 2-Zimmer-Wohnung am Rande<br />
von Stuttgart kostet demnächst soviel<br />
wie ein 32 ha Anwesen mit kompletter<br />
Dienerschaft in der Walachei in England<br />
(Der Brexit wird es möglich machen).<br />
Da man sich je nach Fahrverbot-Offensive<br />
ein neues Auto kaufen<br />
muss, wird auch das „heilige Blechle“<br />
nicht mehr im bezahlbaren Rahmen<br />
sein und was ist mit Freizeit und Familie<br />
… PFFFTTT … da bleibt mir als<br />
3-fachem Vater die Luft weg. Weiß<br />
einer was das kostet?!?<br />
Hier eine Maßnahme für<br />
frühkindliche Sprachentwicklung,<br />
da ein Termin<br />
beim Kinderpsychologen, auf Grund<br />
einer Abneigung gegen Gemüse, und<br />
nicht zu vergessen die „geringen“ Kosten<br />
für die All-Inklusive Urlaube rund<br />
um die Welt mit Animation – meine<br />
Kinder sollen ja nicht als Außenseiter<br />
in der Klasse gehandelt werden. Aber<br />
geht das Ganze mit dem Gehalt einer<br />
Pflegefachkraft? Vermutlich nicht.<br />
Problem 2<br />
Dann doch lieber auf ein Haustier<br />
umsteigen. Ach nee, geht auch nicht<br />
– wie vorher schon erwähnt, zu betreuungsintensiv.<br />
Aber wenn ein eigenes<br />
Haustier schon nicht in der Lage<br />
ist, die rudimentären sozialen und<br />
pflegerischen Eigenschaften eines<br />
Menschen hervorzuholen, dann frag<br />
ich mich allen Ernstes, wie das in der<br />
bezahlten Pflege laufen soll.<br />
Spannend ist auch die Frage, was die<br />
Bildungsinsassen für ihre Träume investieren.<br />
Und hier eine gute Nachricht<br />
vorne weg – mindestens 20% sind tatsächlich<br />
aktiv für ihren Schulabschluss<br />
tätig. Der Rest „chillt“, in der Hoffnung,<br />
dass die Prüfung „easy“ wird. Gut, das<br />
war bei uns auch schon so. Bei uns<br />
hieß die Devise „hab Mut zur Lücke“ –<br />
so im Nachhinein betrachtet, der volle<br />
Blödsinn. Komischerweise kam immer<br />
das dran, was ich nicht gelernt hatte.<br />
Problem 3<br />
Aber sei´s drum. Allgegenwärtig ist das<br />
Thema „Chillen“ und Shisha rauchen.<br />
Eine grundsolide Lebenseinstellung,<br />
wenn es im Pflegeberuf nicht immens<br />
wichtig wäre, was zu tun. Natürlich<br />
kann man den Hilfsbedürftigen auch<br />
klar machen, dass Chillen nur eine<br />
Vorstufe auf das weitere Leben nach<br />
dem Tode ist und ein benebelter Geist<br />
offene Füße, einen künstlichen Darmausgang<br />
oder auch ein Paraplegie in<br />
einem anderen Licht erscheinen lässt.<br />
Aber zielführend kann das nicht sein.<br />
Und auch die Kostendeckung durch<br />
die in Arbeit stehenden Beitragszahler<br />
wird vermutlich durch solch ein Modell<br />
eher in die Höhe schießen.<br />
Was also tun?<br />
Nun ist es wie es ist und wir werden<br />
vermutlich nix dagegen machen können.<br />
Ist auch nicht nötig. Wenn ich an<br />
meine prä- und postpubertäre Zeit<br />
zurück denke, weiß ich noch, dass<br />
viele dachten, der Langhaartyp wird<br />
sicherlich als abgehalfterter Möchtegern-Rockstar<br />
auf der Straße enden.<br />
Und was ist passiert – er hat eine<br />
grundsolide Ausbildung gemacht, ein<br />
Studium absolviert und neben Eigenheim<br />
und Haustier sogar 3 halbwegs<br />
vernünftige Kinder in die Welt gesetzt…(Okay<br />
das mit dem Schulleiter<br />
ist vielleicht nicht so weit weg von der<br />
Geschichte mit dem abgehalfterten<br />
Rockstar).<br />
Es besteht also Hoffnung, egal<br />
welches Pflegemodell unsere Zukunft<br />
bringen wird.<br />
24<br />
<strong>Sprungbrett</strong> … <strong>01</strong>/<strong>2<strong>01</strong>9</strong>
Unsere AutorInnen und Mitwirkenden in dieser <strong>Ausgabe</strong><br />
Unsere AutorInnen und Mitwirkenden in dieser <strong>Ausgabe</strong><br />
Cornelia Baudisch<br />
Apothekerin; MaHM<br />
Strategisches Arzneimittelmanagement bei<br />
der AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen<br />
connybaudisch@gmx.de<br />
Florian Bechtel<br />
Gesundheits- und Krankenpfleger<br />
Herz- und Gefäßchirurgische ITS –<br />
Universitätsherzzentrum Bad Krozingen<br />
Student 2. Semester Management im<br />
Gesundheitswesen –<br />
Katholische Hochschule Freiburg<br />
Gründungsmitglied Hashtag<br />
Gesundheit e.V.<br />
florian.bechtel@hashtag-gesundheit.de<br />
Alexandra Berendes M.A., MaHM.<br />
Alexandra Berendes studierte<br />
germanistische Linguistik und Health<br />
Management. Sie ist als Junior Project<br />
Managerin beim Institut Medical Netcare<br />
in Münster tätig.<br />
berendes@m-nc.de<br />
Janina Ehlers<br />
Pflegemanagement B.A.; Exam.<br />
Gesundheits- und Krankenpflegerin;<br />
Qualitäts managementbeauftragte (DEKRA)<br />
Derzeit beschäftigt als Lehrkraft/Kursleitung<br />
sowie QmB an einer Gesundheits- und<br />
Krankenpflegeschule sowie freiberufliche<br />
Dozentin/Beraterin<br />
janina.ehlers@gmail.com<br />
Felix Hoffmann<br />
ist Facharzt für Orthopädie und<br />
Unfallchirurgie und derzeit als Oberarzt<br />
in der Notaufnahme des evangelischen<br />
Krankenhauses Mülheim tätig. Neben<br />
der Notfallmedizin beschäftigt er sich mit<br />
der Arbeitswelt der Zukunft, innovativen<br />
Versorgungskonzepten und der digitalen<br />
Transformation im Gesundheitswesen.<br />
Felix.Hoffmann@uni-duesseldorf.de<br />
Dr. Barbara Mayerhofer MBA<br />
lehrt nebenberuflich seit 2009<br />
an der APOLLON Hochschule für<br />
Gesundheitswirtschaft in Bremen und<br />
ist seit 2<strong>01</strong>2 als Studiengangsleitung für<br />
Pflegemanagement eingesetzt.<br />
Außerdem ist sie als Lehrbeauftragte an<br />
der Hochschule Osnabrück in der Fakultät<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften<br />
(Pflegewissenschaft/Pflegemanagement)<br />
tätig. Ein weiterer Tätigkeitsbereich ist die<br />
Beratung von ambulanten und stationären<br />
Pflegeeinrichtungen.<br />
bgmayerhofer@t-online.de<br />
Sabrina Reinhart<br />
Gesundheitsökonomin M. A.;<br />
Kaufmännische Assistentin für<br />
Fremdsprachen und Korrespondenz;<br />
Examinierte Krankenschwester<br />
Derzeit beschäftigt im Strategischen<br />
Beschaffungs management am<br />
Universitätsklinikum Münster<br />
Vorsitzende APOLLON Alumni Network e. V.<br />
sabrina.reinhart@t-online.de<br />
Tobias Ulamec<br />
Gesundheitsökonom B.A., Fachwirt im<br />
Sozial- und Gesundheitswesen<br />
Inhaber & Gründer der Personalideenschmiede<br />
Blutsbruder²<br />
Schulleiter ProGenius Göppingen<br />
(Private Berufliche Schule)<br />
Stellv. Vorsitzender APOLLON Alumni<br />
Network e.V.<br />
tobias@blutsbruder2.de<br />
Michael Walch<br />
Gesundheitsökonom (M. A.)<br />
gepr. Personalmanager (DAM)<br />
Corporate Governance and Compliance<br />
(DAM)<br />
Leiter Vertrieb bei der BKK Pfalz<br />
Kassierer APOLLON Alumni Network e.V.<br />
https://www.xing.com/profile/ Michael_<br />
Walch13<br />
www.apollon-alumni.de 25
Antrag auf Mitgliedschaft<br />
Bitte per E-Mail an info@apollon-alumni.de<br />
Zum Download auf unserer Homepage verfügbar<br />
Pflichtangaben<br />
Absolventin / Absolvent<br />
Bachelor-/ Masterstudium<br />
Mitgliedsbeitrag 40 € / Jahr³<br />
Studentin / Student<br />
mit mind. 2/3 der Credits eines<br />
Bachelor-/ Masterstudiums<br />
Mitgliedsbeitrag 40 € / Jahr<br />
Fördermitglied¹<br />
Beitrag ........... € / Jahr<br />
Ehrenmitglied²<br />
Beitragsfrei<br />
Anrede Frau Herr Titel<br />
Vorname<br />
Geburtsdatum<br />
Kontaktdaten privat:<br />
Straße / Hausnr.<br />
Name<br />
Studiengang<br />
PLZ / Ort<br />
E-Mailadresse<br />
Festnetz (optional)<br />
Handy (optional)<br />
1 Der Beitrag für Fördermitglieder beträgt mindestens 50 Euro pro Jahr<br />
2 Ehrenmitglieder können ausschließlich vom Vorstand ernannt werden<br />
3 Mitglieder, die keinen Lastschriftauftrag erteilen, wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro in Rechnung gestellt.<br />
Als Mitglied des APOLLON Alumni Network e. V. erkenne ich die Satzung des Vereins an. Ich erkläre mich damit einverstanden,<br />
dass meine Daten zur Erfüllung des Zwecks des Vereins gemäß § 1 Absatz 1 sowie §14 der Satzung und<br />
gemäß der Datenschutzerklärung des Vereins verwendet werden.<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift<br />
Einverständnis (bitte ankreuzen)<br />
Ich bin damit einverstanden, dass mir regelmäßig Informationen über und zum Verein per E-Mail und / oder Post<br />
zugeschickt werden.<br />
Ich möchte das Netzwerkmagazin „<strong>Sprungbrett</strong>“ zusätzlich zur Online-<strong>Ausgabe</strong>, die vom Verein per E-Mail verschickt<br />
wird, per Post erhalten.<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift<br />
Lastschriftauftrag<br />
Ich bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag von meinem nachstehend angegebenen<br />
Bankkonto vom APOLLON Alumni Network e. V., 28359 Bremen, eingezogen wird. Die Einzugsermächtigung<br />
erlischt durch Widerruf oder Austritt aus dem Verein.<br />
Name des Kontoinhabers<br />
IBAN<br />
BIC<br />
Bank / Ort<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift<br />
APOLLON Alumni Network e.V. wird vertreten durch:<br />
Sabrina Reinhart (1. Vorsitzende), Tobias Ulamec (2. Vorsitzender), Michael Walch (Schatzmeister)<br />
Ansprechpartnerin an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Katrin Frey / Tanja Schuster<br />
Universitätsallee 18 | 28359 Bremen | E-Mail: info@apollon-alumni.de | www.apollon-alumni.de<br />
Netzwerker im Gesundheitswesen
Antrag auf Mitgliedschaft<br />
www.apollon-alumni.de 27
Anzeige