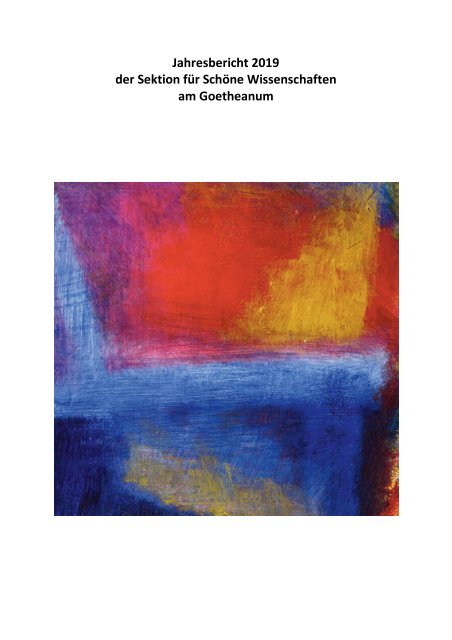Jahresbericht 2019
Update I
Update I
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2019</strong><br />
der Sektion für Schöne Wissenschaften<br />
am Goetheanum
Kunst, Kultur, Dichtung und das Werk Rudolf Steiners<br />
Die Schönen Wissenschaften verbinden Wissenschaft und Schönheit, Erkenntnis und<br />
schöpferische Phantasie. Da Wissenschaft mehr auf das Allgemeine, Gesetzmässige zielt, die<br />
Kunst hingegen auf den individuellen Ausdruck, wird in der methodischen Verbindung beider<br />
Bereiche die Erkenntnis an den Menschen rückgebunden, wie umgekehrt die Kunst über den<br />
Einzelnen herausgehoben.<br />
Kernaufgabe der Schönen Wissenschaften ist ein Verständnis der Gesamterscheinung<br />
kultureller Vergangenheit, der Mysterien, ihrer Kulte und der Hochkulturen,<br />
Ursprungsmythen und heiligen Texte der Religionen, der Philosophie, Ästhetik und der<br />
Literatur und Sprache bis in die Gegenwart. Die Sektion ist ein Forum für Menschen, die sich<br />
für die Vermittlungsarbeit von Anthroposophie, Kunst und Wissenschaft engagieren.<br />
Zeitgeschehen<br />
Das Ende des Menschen? Die Herausforderung transhumanistischer Zukunftsvisionen –<br />
Tagungsimpuls und Forschungsthema<br />
Im Jahr 2018 stand mit der Tagung «Das Ende des Menschen? Die Herausforderungen<br />
transhumanistischer Zukunftsvisionen?» (mit Roland Benedikter, Yaroslawa Black-Terletzka,<br />
Ariane Eichenberg, Christiane Haid, Michael Hauskeller, Christian Kreiß, Sibylle<br />
Lewitscharoff, René Madeleyn, Patrick Roth und Galsan Tschinag) eine Diagnose der<br />
kulturellen Zeitsituation im Mittelpunkt. Die zweite Tagung zum Transhumanismus <strong>2019</strong><br />
«Das Ende des Menschen? II – Wege durch und aus dem Transhumanismus» (mit Marica<br />
Bodrožić, Ariane Eichenberg, Matthias Girke, Michaela Glöckler, Christiane Haid, Stefan<br />
Hasler, Michael Hauskeller, Edwin Hübner, Johannes Kühl, Sebastian Lorenz, René Madeleyn,<br />
und Claus-Peter Röh) hat die Fragen nach dem Menschsein und Zukunftsgestaltung im<br />
Zeichen des Transhumanismus in den einzelnen Lebensbereichen – Pädagogik, Medizin,<br />
Naturwissenschaften/Technik und Kunst – vertieft. Ein künstlerischer Höhepunkt der<br />
Tagung waren Vortrag und Lesung der Autorin Marica Bodrožić «Sprache als Brücke zum<br />
Kosmos – Das Wasser unserer Träume». Für ihre Bücher erhielt sie zahlreiche<br />
Auszeichnungen, zuletzt den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und den Ricarda-<br />
Huch-Preis. Einige ihrer Gedichte kamen während der Tagung in der Eurythmie-Darbietung<br />
»Sterne sprachen einst zu Menschen« des Goetheanum-Eurythmie-Ensembles zur<br />
Aufführung. Weitere Details und diverse Berichte zur Tagung finden Sie auf der Website der<br />
Sektion (https://ssw.goetheanum.org/).<br />
Eine Publikation, die die Beiträge beider Tagungen zusammenfasst, ist in Vorbereitung und<br />
wird noch 2020 erscheinen.<br />
Sehr eindrücklich wurde auf allen Ebenen deutlich, dass die rasanten Entwicklungen der<br />
Technik von jedem einzelnem Menschen fordern, sich konkret mit den veränderten<br />
Lebensverhältnissen im Alltag auseinanderzusetzen. Rückzug oder Ignoranz führen nicht<br />
weiter: «Es wäre das Allerfalscheste, wenn man sagen würde, da müsse man sich sträuben<br />
gegen das, was nun einmal die Technik uns in dem modernen Leben gebracht hat, man müsse<br />
sich hüten vor dem Ahriman, man müsse sich zurückziehen von diesem modernen Leben. Das<br />
würde in gewissem Sinne eine spirituelle Feigheit bedeuten. Das wahre Heilmittel besteht<br />
darinnen, nicht die Kräfte der modernen Seele schwächen zu lassen und sich zurückzuziehen<br />
von dem modernen Leben, sondern Kräfte der Seele stark zu machen, damit das moderne<br />
Leben ertragen werden kann… deshalb hat die Geisteswissenschaft diesen eigentümlichen<br />
2
Charakter, dass sie … intensive Anstrengungen von der menschlichen Seele fordert.» (Rudolf<br />
Steiner, GA 275, 28. Dezember 1914, S. 24f.)<br />
Als Arbeitsrichtung hat sich ein Forschungskolloquium gebildet, an dem Professoren<br />
unterschiedlicher Universitäten mitwirken, um aus anthroposophischer Perspektive weiter an<br />
den Fragen und Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten. Es geht darum, das, was Rudolf Steiner vor<br />
100 Jahren zur Technik gesagt hat, mit den aktuellen Fragestellungen zum Transhumanismus<br />
zu verbinden.<br />
Zudem fand vom 5.-6. Februar 2020 eine Jugendtagung in Zusammenarbeit mit dem Zweig in<br />
Bayreuth und der Universität Bayreuth an der Universität in Bayreuth zu Transhumanismus<br />
und Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit statt.<br />
Grundlagenarbeit und Forschung<br />
Die Fragen zum Transhumanismus haben sich aus unserem seit vier Jahren laufenden<br />
Forschungsprojekt zur «Humanisierung des Menschen durch Literatur» ergeben. Denn sollen<br />
die Qualitäten und die Bedeutung, die Literatur für den Menschen hat, herausgearbeitet<br />
werden, so kann man nicht ignorieren, dass der Mensch durch milliardenschwere Forschung<br />
in vielen Fachbereichen ersetzt und teilweise überflüssig gemacht werden soll. Auf der Folie<br />
des Transhumanismus hat sich gezeigt, dass Literatur und Sprache nicht etwas für Freizeit<br />
und Sofa sind, sondern in besonderer Weise die Existenzgrundlage unserer Menschlichkeit<br />
und Verantwortung für die Welt aufzeigen.<br />
Dass die Sprache in enger Beziehung zum Kosmos steht, wurde in alten Kulturen noch als<br />
selbstverständlich angesehen. Worte bezeichneten nicht Dinge, sondern Sternenkonstellationen.<br />
Im Sprechen versetzten sich die Menschen in eine Seelengemeinschaft mit<br />
dem Kosmischen. Sie wussten, dass der Mensch, der geboren wird, durch Fixsterngruppierungen<br />
und den Planetenhimmel hindurchgeht, dass diese sich ihm als eine Art<br />
Weltenalphabet einprägen und im Sprechen des Alphabets der gesamte Mensch erscheint.<br />
Sprechen wir, so sprechen wir den Menschen als kosmischen Menschen aus. Im Sprechen<br />
erscheint das Universum. Sprache stellt in diesem Sinne Geistes-Gegenwart her. Wir haben<br />
diese Art des Bewusstseins nicht mehr, da Sprache und Wort heute meist auf ihren<br />
Informationsgehalt reduziert sind. Und doch gibt es immer noch Räume, in denen die<br />
Sternenperspektive bis in die Gegenwart erhalten bleibt – die Literatur ist einer davon. In ihr<br />
kann sichtbar werden, wie sie über Atem und Blutzirkulation bis in unsere Physiologie<br />
hineinwirkt. Wir werden durch sie leiblich, seelisch und geistig gebildet.<br />
Diesen Bewegungen gehen wir in unseren Untersuchungen zu Texten vom 12. Jahrhundert<br />
bis heute nach. Grundlage ist hierfür zudem auch Rudolf Steiners Sprachverständnis.<br />
Literatur<br />
Christian Morgenstern, Johann Wolfgang von Goethe und Albert Steffen<br />
<strong>2019</strong> bildeten zwei Tagungen – zum literarischen Werk von Christian Morgenstern und der<br />
Vergleich der beiden grossen Lebenswerke von Goethe, Faust und Wilhelm Meister, – einen<br />
Schwerpunkt.<br />
«Meine Liebe ist groß wie die weite Welt, und nichts ist außer ihr» – Zum Werk Christian<br />
Morgensterns (Mit Ariane Eichenberg, Waldemar Fromm, Christiane Haid, Agnes Harder,<br />
Ernst Kretschmer, Sebastiaan de Vries, Anthony T. Wilson und Bernd Richert).<br />
3
Bei Christian Morgenstern war der Blick auf seinen Lebensweg und sein doppelsinniges<br />
Verhältnis zur Sprache gerichtet. Die Begegnung mit der Anthroposophie und die<br />
Auseinandersetzung mit der Sprachkritik des 20. Jahrhunderts bildeten ein reibungsvolles<br />
und widersprüchliches Verhältnis. Hier spricht sich das grundlegende Problem und Ringen<br />
aus, ob es «anthroposophische» Kunst gibt oder nicht. Während der Tagung wurde der<br />
neunte und letzte Band der Stuttgarter Ausgabe mit den Briefen Christian Morgensterns von<br />
1909 bis 1914 durch die Herausgeberin Agnes Harder präsentiert und vorgestellt. Eine sehr<br />
schöne Eurythmieaufführung mit Texten Christian Morgensterns und Musikstücken von<br />
Robert Schumann bildeten den Auftakt.<br />
«Faust und Wilhelm Meister als zwei Seiten eines Ich»<br />
(Mit Andre Bartoniczek, Ariane Eichenberg, Bernhard Glose, Christiane Haid,<br />
Steffen Hartmann, Frank Hörtreiter, Jens Bodo Meier, Markus Schönen,<br />
Catherine Ann Schmid, Barbara Stuten, Sebastiaan de Vries und Marret Winger)<br />
Die Pfingsttagung <strong>2019</strong> stellte Faust und Wilhelm Meister als zwei Seiten eines Ich ins<br />
Zentrum. Goethe hat sein ganzes Leben lang an Faust und Wilhelm Meister im Wechsel<br />
gearbeitet. Faust und Wilhelm Meister sind zwei polare Figuren, deren geheimer Sinn sich<br />
erst durch ihr Miteinander und Gegenüber offenbart. Weiten wir dieses Gestaltungsprinzip<br />
aus, so wird unmittelbar anschaulich, dass Goethes gesamter Schaffensprozess als<br />
Gegenüberstellung und Spiegelprozess zu begreifen ist – Naturwissenschaft und Dichtung<br />
gehören zusammen und repräsentieren letztlich zwei Strömungen der<br />
Menschheitsgeschichte. Dieses Miteinander und Wechselspiel wurde in den zwei szenischen<br />
Lesungen zu Faust und Wilhelm Meister eindrucksvoll erfahrbar.<br />
«Paulus, Damaskus und die lange Bank»<br />
Tagung zum Werk Albert Steffens in Zusammenarbeit mit der Albert Steffen Stiftung –<br />
mit Gerardo Cohrs, Christine Engels, Peter Engels, Christiane Haid, Klaus Hartmann, Michael<br />
Kurtz, Martin van Ledden und Felix von Verschuer.<br />
Anhand von Steffens Friedenstragödie, die den historischen Vorgängen um den Vertrag von<br />
Versailles gewidmet ist, wurden Bezüge zur Zeitgeschichte hergestellt. Dazu kamen Beiträge<br />
zum dichterischen Werk Albert Steffens und zu seiner Biographie.<br />
Das Werk Rudolf Steiners<br />
Anthroposophie ein Fragment, Die Geheimwissenschaft im Umriss und der Vortragszyklus<br />
Das Matthäus-Evangelium<br />
«Von der Metamorphose der Sinne» – Zu Rudolf Steiners Werk «Anthroposophie ein<br />
Fragment» und seiner Anschauung der Sinne<br />
(Mit Torsten Arncken, Martin Basfeld, Christiane Haid, Detlef Hardorp, Constanza Kaliks,<br />
Salvatore Lavecchia, Jaap Sijmons und Seija Zimmermann)<br />
Die Möglichkeit, eine vertiefende Begegnung mit dem Werk Rudolf Steiners zu geben, ist<br />
eine der Aufgaben der Sektion für Schöne Wissenschaften. Die zweite Tagung «Vom Sinn der<br />
Sinne. Rudolf Steiners Anthroposophie ein Fragment» hatte das Ziel, aufgrund des grossen<br />
Interesses der Teilnehmer der Tagung 2018, dieses zu den schwersten und am wenigsten<br />
bearbeiteten Werken zählende Buch weiter zu erschliessen. Rudolf Steiner bezeichnete die<br />
Betrachtung der Sinne als das ‘erste Kapitel der Anthroposophie’. Sie sind Grundlage und<br />
unumgehbare Voraussetzung geistiger Tätigkeit. Nur durch die Sinne kann sich der Mensch<br />
4
in der Welt beheimaten und ein freies Ich entwickeln. Gerade in unserer Zeit, in der wir zwar<br />
mit allen Sinnen nach aussen gerichtet sind, aber paradoxerweise immer mehr den Bezug zu<br />
den Wahrnehmungen und ihrer Qualität verlieren, ist der Blick auf die Gesamtheit der Sinne<br />
von grosser Bedeutung. 2021 wird diese Arbeit weiter fortgesetzt.<br />
«Der Mensch und die Entwicklung der Welt – Rudolf Steiners Geheimwissenschaft im Umriss»<br />
(Mit Elena Borer, Michael Debus, Esther Gerster, Michaele Ghodes, Christiane Haid, Christian<br />
Hitsch, Ewgenija Naumenko, Jaap Sijmons, Margrethe Solstad, Trond Solstad, Barbara Stuten<br />
und Ursula Zimmermann)<br />
In Die Geheimwissenschaft im Umriss, 1909 erschienen, findet sich das grösste Panorama<br />
der Entwicklung des Menschen und der Welt, das Rudolf Steiner je skizziert hat. Noch im<br />
Januar 1925 betont er, dass das Buch ‚die Umrisse der Anthroposophie als ein Ganzes<br />
enthält‘. Das umfassende Kapitel ‚Die Weltentwicklung und der Mensch‘ ist beinahe ein Buch<br />
für sich. Die Intensivwoche war diesem Kapitel gewidmet. Ausgangspunkt war die Frage, wie<br />
die Welt- und Menschentwicklung vom alten Saturn bis zum Vulkan als objektiver<br />
Gegenstand für die geistige Forschung fassbar werden, wie im Menschen gleichsam die<br />
Weltalter zusammengedrängt sind. Methodisch wurden die wichtigsten<br />
Entwicklungsthemen des Kapitels erschlossen: Der Ursprung der Elemente, ihre Rhythmen<br />
im Zusammenhang mit dem Kosmos, das Wesen der Zeit, die schaffenden Hierarchien und<br />
ihre Mitschöpfung des Menschen, die Entwicklung des Bewusstseins in den Hierarchien und<br />
im werdenden Menschen. In Vorträgen, Gesprächen, plastischem Arbeiten,<br />
Bildbetrachtungen, künstlerischen Übungen, Eurythmie und Textarbeit wurden diese<br />
zentralen Themen erarbeitet. Aufgrund des grossen Interesses der Teilnehmer findet im<br />
Sommer 2020 eine weitere Intensivwoche zur Geheimwissenschaft statt.<br />
«Das Matthäus-Evangelium»<br />
(Mit Michaela Glöckler, Christiane Haid, Wolf-Ulrich Klünker, Stefan Hasler, Sebastian<br />
Lorenz, Mechtild Oltmann und Sebastiaan de Vries)<br />
Rudolf Steiners Vortragsreihe zum Matthäus-Evangelium hat im September 1910 in Bern<br />
stattgefunden. Der Mensch erscheint hier durch die Perspektive des Christus-Lichtes in einer<br />
besonderen Entwicklungssituation: Von oben her berührt das Geistselbst das menschliche<br />
Ich – die geistige Bewegung, in der der göttliche Geist und der Geist der Engelwesen<br />
persönlich und menschlich wird. Umgekehrt kann das menschliche Ich, gleichsam von unten<br />
her, eine Lebensgrundlage ausbilden, die sich seelisch, leiblich und zwischenmenschlich aus<br />
dem Geist erneuert. Die Geistselbst-Berührung des Ich setzt eine bestimmte Leibesgrundlage<br />
voraus. Der physische und der ätherische Organismus müssen in der Lage sein, ein seelisches<br />
Empfinden aufzunehmen, dass sich geistverbunden selbst erfassen kann: eine<br />
Astralorganisation, die geistselbstfähig ist. Eine solche physisch-ätherische Leibesgrundlage<br />
des Ich wird im Matthäus-Evangelium für die Jesus-Gestalt beschrieben, während das Lukas-<br />
Evangelium die empfindende Seele hervorhebt, die sich später als Geistselbst begreifen<br />
kann. In der Perspektive des Matthäus-Evangeliums liegen Ansatzpunkte für ein neues<br />
Verständnis des physischen und des ätherischen Leibes in Gesundheit und Krankheit. Das<br />
Matthäus-Evangelium bietet eine Hilfe zu verstehen, wie Christus für das Ich durch<br />
Inspiration und Selbstentwicklung einen seelischen Empfindungsraum eröffnet, der die<br />
Lebenskräfte und den Organismus neu belebt. – Die Beiträge zu unserer Studientagung<br />
verdeutlichten, wie sich das Ich in seiner Entwicklung in diesem Sinne als Christus-getragen<br />
erfahren kann.<br />
5
Eine eindrucksvolle Eurythmieaufführung des Eurythmeum CH unter der Mitwirkung der<br />
Studierenden des Eurythmeum brachte zentrale Stellen des Evangeliums zur Aufführung. Die<br />
Arbeit wird 2020 mit den beiden Zyklen zum Markus-Evangelium weiter fortgesetzt.<br />
Kolloquien und Hochschularbeit<br />
Der fachspezifischen Arbeit der Sektion sind die verschiedenen Kolloquien gewidmet, die<br />
eine anthroposophische Durchdringung des jeweiligen Gebietes zum Ziel haben.<br />
Sprachwissenschaftliches Kolloquium<br />
Die sprachwissenschaftlichen Kolloquien wenden sich an alle, denen sprachliche Phänomene<br />
zu denken geben und die sich über Fragen und Ergebnisse aus ihrem jeweiligen<br />
Arbeitsgebiet austauschen wollen. Themen des 18. Kolloquiums zur Sprachwissenschaft<br />
<strong>2019</strong> waren das Sprachverständnis von Wilhelm von Humboldt, Ernst Cassierer und Hans<br />
Georg Gadamer.<br />
Kolloquium zur Sprache Rudolf Steiners<br />
In den zweimal jährlich stattfindenden Treffen wird der spezifische Stil und die besondere<br />
Sprachauffassung Rudolf Steiners bearbeitet. Kontinuierliches Thema der letzten Treffen war<br />
die Frage nach dem Studium der Anthroposophie anhand von Texten Rudolf Steiners. Dazu<br />
werden verschiedene Zugangsweisen untersucht. Im Vordergrund steht der<br />
Schulungscharakter, den ein solches Textstudium haben kann. Dem dient auch die<br />
Beschäftigung mit dem Grundstein-Spruch, der die Treffen jeweils eröffnet.<br />
Kolloquium zur Sprache in der Poesie<br />
Seit 1991 widmet sich diese Gesprächsarbeit lyrischen Werken moderner oder klassischer<br />
Autoren, oft auch grösseren Kompositionen oder Zyklen wie in den letzten Jahren den<br />
‹Duineser Elegien› und den ‹Sonetten an Orpheus› von Rainer Maria Rilke oder den späten<br />
Hymnen von Friedrich Hölderlin. Der Teilnehmerkreis ist fliessend, die Teilnehmenden<br />
erarbeiten sich die literarischen Texte vor allem im Austausch. Das Kolloquium findet aktuell<br />
einmal jährlich in Salem am Bodensee statt.<br />
Märchenkolloquium<br />
Die Arbeit mit Volksmärchen aus anthroposophischen Gesichtspunkten steht für die seit<br />
Jahren aktive Gruppe von Märchenforschern im Zentrum. Textarbeit an Werken Rudolf<br />
Steiners, Arbeitsberichte und Gespräche zu bestimmten Themen wie Erzählen, Sprachstil,<br />
Symbolik, Bildbewusstsein u.a. sind Gegenstand der zweimal im Jahr stattfindenden Treffen.<br />
Kunstwissenschaftliches Kolloquium<br />
Rudolf Steiners Ästhetik, der anthroposophische Kunstimpuls, Werke der Gegenwartskunst<br />
in allen Kunstgattungen sind Thema der jährlichen Zusammenkünfte. Museumsbesuche, und<br />
Werkbetrachtungen vertiefen die Arbeit an konkreten Objekten. Der Kreis versteht sich als<br />
Forschungszusammenhang, in dem die Teilnehmer Beiträge geben. Das Kolloquium findet<br />
abwechselnd in Berlin und Dornach statt.<br />
«Sympoetisieren» – Dichter im Gespräch / Die Poesie des Anderen erleben<br />
Zusammenkunft von Dichtern und Schriftstellern in der sich seit einigen Jahren<br />
Literaturschaffende zum gemeinsamen Austausch am Goetheanum treffen. Im Mittelpunkt<br />
stehen Beiträge aus der eigenen Arbeit, Erfahrungen und Einschätzungen zum kulturellen<br />
6
und literarischen Leben der Gegenwart, Entdeckungen in der Poesie. In der Vertiefung eines<br />
Gedichts Albert Steffens beschäftigte den Kreis <strong>2019</strong> der Zusammenhang von Wort, Stille<br />
und Ruhe. Reinhart Moritzen besuchte den mehrtägigen Frankfurter Kongress «Fokus Lyrik»<br />
und brachte davon ein Positionspapier mit zur Lage und Zukunft der Lyrik. Die nächste<br />
Zusammenkunft ist im Frühjahr 2021 vorgesehen.<br />
Hochschularbeit<br />
Seit 15 Jahren widmen wir jeweils fortlaufend ein Wochenende einer Klassenstunde. Freie<br />
und gelesene Klassenstunden, Textarbeit, Sprach-, Bild- und Naturbetrachtungen,<br />
entsprechend der Themen, die durch die Mantrengruppe gegeben sind, sind Elemente, die<br />
die Arbeit vertiefen. Im gemeinsamen Austausch suchen wir aus der Perspektive des Wortes,<br />
der Sprache, der Bildgestaltungen und der Tafelzeichnungen uns in künstlerischer und<br />
methodisch transparenter Weise auszutauschen und die Sektionsthemen zu vertiefen. Das<br />
Wochenende dient auch dem Austausch über die Arbeit in den Fach- und Ländergruppen.<br />
Zu Gast im Kunstmuseum Basel<br />
Zwei Abende im Kunstmuseum Basel zum Thema ‹Raunächte› als ‹Dialoge zur<br />
Weihnachtszeit› beschlossen das Jahr der Sektion. Am 4. und 18. Dezember führte Christiane<br />
Haid anhand ausgewählter Bildbetrachtungen im Dialog mit den Besucherinnen und<br />
Besuchern Bildende Kunst und Literatur zusammen. Unterstützt wurde sie dabei von Barbara<br />
Stuten und Jens Bodo Meier, die einigen ausgewählten Texten ihre Stimme gaben. Die erste<br />
Kooperation zwischen dem Goetheanum und dem Kunstmuseum fand im Sommer statt. Am<br />
15. Juni öffnete das Goetheanum für die Workshopreihe ‹Living Archive› seine Türen für das<br />
Kunstmuseum. Im Dezember war es umgekehrt.<br />
Leben der Sektion weltweit<br />
Seit rund 20 Jahren gibt es in verschiedenen Ländern Initiativen für die Sektionsarbeit, die<br />
sich aus den Fähigkeiten und Bedürfnissen der örtlichen Gruppen gestalten. In den USA und<br />
England bestehen seit Ende der 90er Jahren Gruppen, dazu kamen in den letzten Jahren<br />
Gruppen in den Niederlanden, Australien, Canada, Finnland und Belgien mit<br />
unterschiedlicher thematischer Ausrichtung. Vorbereitungen zu weiteren Gruppen gibt es in<br />
Italien und Israel. Im Dezember <strong>2019</strong> wurde in Antwerpen das erste Jahrbuch der belgischen<br />
Sektion für Schöne Wissenschaften publiziert. Die Buchpräsentation war umrahmt von<br />
Lesungen und verschiedenen Beiträgen zur Dichtung.<br />
Die Sektion<br />
Mitarbeiter der Sektion sind Christiane Haid (Leitung), Ariane Eichenberg mit einem<br />
Forschungsdeputat von 20 %, Isabelle Böhmler als Assistentin mit 40% und Monika Clément<br />
für Website und Soziale Medien mit 20%. Der Verlag am Goetheanum und die<br />
Wochenschrift Das Goetheanum sind zwei weitere Arbeitsfelder, in denen Christiane Haid<br />
für die Programmgestaltung und in der Redaktion tätig ist.<br />
Website, Social Media und Newsletter<br />
Aktuelles aus der Sektion erfahren Sie auf unserer Website https://ssw.goetheanum.org/und<br />
auf Facebook http://www.facebook.com/schoenewissenschaften/ Ausserdem versenden wir<br />
in regelmässigen Abständen unseren Newsletter, der über kommende Tagungen und<br />
7
Aktivitäten informiert. Sollten Sie an der Zusendung interessiert sein, schreiben Sie uns bitte<br />
an: ssw@goetheanum.ch<br />
Sektion für Schöne Wissenschaften<br />
Goetheanum<br />
Postfach,<br />
CH-4143 Dornach<br />
Tel. +41 61 706 43 82<br />
8