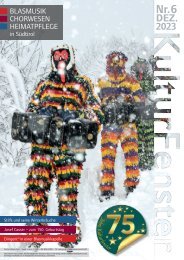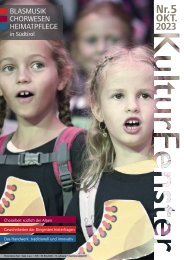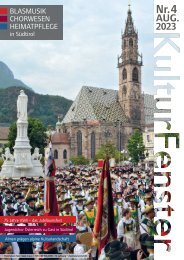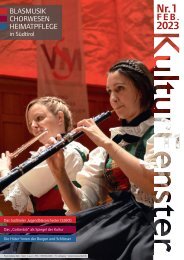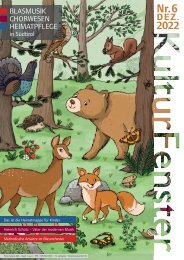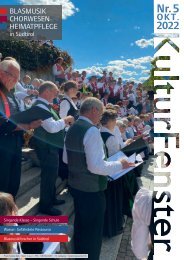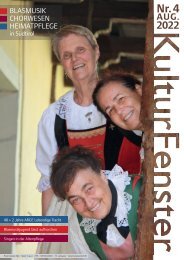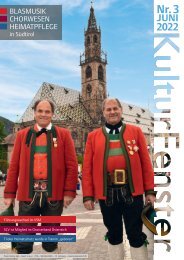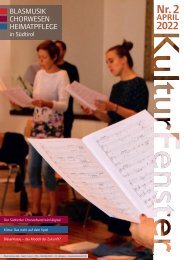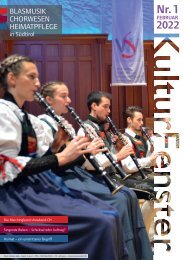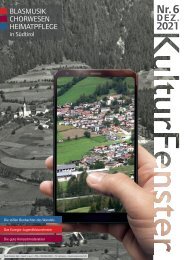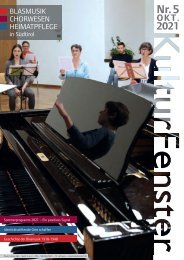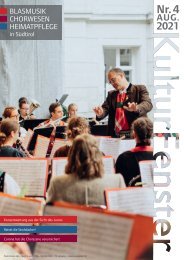Kulturfenster Nr. 06|2019 - Dezember 2019
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Poste Italiane SpA – Sped. in a.p.
-70% – NE BOLZANO – 71. Jahrgang
Nr. 6 | DEZEMBER | 2019
Zweimonatszeitschrift
KulturFenster
Blasmusik, Chorwesen und Heimatpflege in Südtirol
IP
Heimatpfleger mit Bischof Muser
Tiroler Wertungssingen – Großer Erfolg
Pepi Fauster: Rückblick und Ausblick
• Geleitwort •
• Inhalt •
• Heimatpflege
Heimatpfleger mit Bischof auf
Franziskusweg in Sand 3
Weihnachten – ein Fest der Freude 5
Wer bringt zu Weihnachten
die Geschenke? 6
Was nicht passt, wir passend gemacht 7
Es gibt keinen Planeten B 8
Schluss mit dem Geknalle! 10
Die „Allianz der Kultur“ 11
Historische Schätze und
moderne Sünden 12
Ortsbegehung in Burgstall 14
Nachhaltigkeitspolitik Marke Südtirol 16
„Die Kapitalisierung der Bergwelt“ 17
Traditionelles Kulturgut
braucht Förderung 18
Die Pfoat 20
Bischof Muser im Einklang mit Heimatpflegern
• Chorwesen
Bewertungen der am
Tiroler Wertungssingen
teilnehmenden Chöre 21
Tiroler Chorkultur auf
höchstem Niveau 23
Konzert in Memoriam
Willi Tschenett 25
Männerchor Neustift:
Rudi Chizzali nimmt nach
30 Jahren Abschied 26
35 Jahre
Ultner Bänkelsänger – Rückblick 27
Kirchenchor Afing: Chorleiterin
oder Chorleiter gesucht 28
Laudato si – So lautet der Titel einer Enzyklika,
mit der Papst Franziskus im Jahre
2015 die Menschen aufgefordert hatte, sich
verstärkt der bedrohten Natur und Umwelt
anzunehmen. In diesem Sinne hat der Heimatpflegeverband
unlängst mit Bischof Muser
zu einer Wallfahrt auf dem Franziskusweg
in Sand in Taufers geladen. Die Obfrau
des Heimatpflegeverbandes Claudia Plaikner
wollte damit ein Zeichen setzen und den
Bischof um Unterstützung des Bemühens
um die Bewahrung der Schöpfung bitten.
Der Bischof zeigte sich sehr angetan von
der Initiative und plädierte für das Staunen
und die Demut gegenüber der Schöpfung.
,,Es ist auch einmal genug“, betonte der Bischof
mit Blick auf jene, die nie genug und
immer noch mehr haben wollen.
Tiroler Chorkultur auf höchstem Niveau
wurde beim 7. Gesamttiroler Wertungssingen
in Auer geboten. 25 Chöre aus den drei
Tiroler Landesteilen nahmen an dem Wettstreit
teil. Die Jury bewertete die technische
und künstlerische Ausführung und die Bühnenpräsenz.
Elf Chöre erhielten die Bewertung
,,ausgezeichnet“, acht wurden mit dem
Prädikat ,,sehr gut“ bewertet. Der Vorsitzende
der Jury Jürgen Faßbender (Deutschland)
zeigte sich erfreut über die Leistungen der
Chöre und die hervorragende Organisation.
Er regte an, die Chöre sollten mehr auf die
Suche nach neuer Literatur gehen. Werke,
die niemand kennt, ,,machen neugierig“,
meine Faßbender. Auch Erich Deltedesco,
Obmann der SCV, zeigte sich erfreut über
das hervorragende Ergebnis des Wertungssingens.
LR Philipp Achammer dankte den
Chören dafür, dass sie der Bevölkerung ,,den
Staub von der Seele wischen“.
Der Verbandsobmann des VSM Pepi Fauster
dankt allen für das Engagement im
Jahre 2019, für das neue Jahr wünscht er
viel Musizierfreude und Lust in der musizierenden
Gemeinschaft. Verbandsjugendleiter
Manfred Windisch zitiert im Hinblick
auf Weihnachten Friedrich Nietzsche, der
einmal sagte, die schönsten Momente in
der Musik seien nicht die lautesten ,,sondern
oft die ganz leisen“.
Alfons Gruber
• Blasmusik
Auf ins neue Musikjahr 2020 29
Entscheidend ist die Passion
zur Blasmusik 30
Wie kann man der Musik in
Bewegung mehr Klang verleihen? 31
Bezirk Meran ehrt
6 langgediente Funktionäre
mit Dankesfeier 35
Niederösterreich:
Bürgerkapelle Gries und
Jugendkapelle Villnöß erfolgreich 36
MK Prissian: Abendkonzert beim
Ansitz „Unterbäck“ 38
Hans Obkircher 80 39
Josef Hochkofler (1895-1969) 40
Musikpanorama 41
Titelbild: Ortsteil Kapl in Langtaufers mit der Karlesspitze, von wo aus die geplante Skiverbindung auf das Karlesjoch (links vom Gipfel) führen soll.
2
KulturFenster
Heimatpflege
„Laudato si“
Die Obfrau des Heimatplegeverbandes fordert
Unterstützung für die „Bewahrung der Schöpfung“.
Reserven übrig. 10 Jahre später überstieg
der jährliche Verbrauch die global zur Verfügung
stehenden nachwachsenden Ressourcen
das erste Mal und dieser Trend ist
seit 1971 stetig ansteigend, sodass heuer
genau am 29. Juli – mein Geburtstag – der
Welterschöpfungstag anstand, also der Tag,
von dem weg wir der Erde mehr wegnehmen
als sie uns auf Dauer geben kann; wir
beuten sie also aus, zum großen Schaden
auch der nachkommenden Generationen.
Claudia Plaikner forderte anlässlich einer
Wallfahrt auf dem Franziskusweg in Sand in
Taufers, zu der die Heimatpfleger Bischof Ivo
Muser eingeladen hatten, eine stärkere Zusammenarbeit
zwischen Kurie und Heimatpflegern.
Von dieser erhofft sie sich eine Signalwirkung
nach außen, um Menschen für
einen sorgsameren Umgang mit der Natur
zu sensibilisieren.
Kulturfenster: Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
die Kirche als Partnerin in Ihrer
Arbeit für Heimat und Umwelt zu gewinnen?
Claudia Plaikner: Die katholische Kirche
hat sich spätestens seit der 2015 erschienenen
ersten Umweltenzyklika der Kirchengeschichte
von Papst Franziskus, die auch
den Lobgesang des Hl. Franziskus „Laudato
si“ als Titel trägt, intensiv und programmatisch
mit dem Gedanken um die Verantwortung
des Menschen für die Erde befasst.
Und es war hier in Südtirol das Verdienst
des Moraltheologen und späteren Bischofs
Karl Golser, dass sich auch in Südtirols Kirche
langsam eine ökologische Denkweise
anbahnte. Und die von der Diözese Bozen-Brixen
kürzlich in einer zweiten Auflage
herausgegebene Umweltfibel ist eine
nützliche Hilfe, um einen bewussteren, ressourcensparenden
Lebensstil anzunehmen.
KF: Wo sehen Sie konkret Berührungspunkte?
Claudia P.: Wir versuchen im Gespräch mit
den politisch Verantwortlichen für Entscheidungen
zu plädieren, die das Gesamte, den
Ausgleich der Interessen und nicht nur die
Wirtschaft und das Profitdenken im Auge
behält. Auch Papst Franziskus warnt in seiner
Umweltenzyklika davor, nur nach dem
Nutzen der Dinge zu fragen.
KF: Welche Fragen muss sich, Ihrer
Meinung nach, jemand stellen, der
das Wort des Papstes ernst nimmt?
Claudia P.: Die Fragen sollten lauten:
ob wir das alles brauchen, was
wir kaufen können, ob wir nachhaltig
leben, ob wir auf Kosten anderer
Menschen leben, ob wir deren
Ressourcen ausbeuten, ob wir
durch unser Verhalten unserer Jugend
eine Zukunft ermöglichen, ob
wir für den Frieden arbeiten, indem
wir die Klage der Armen ernst nehmen,
ob wir den Klimawandel ernst
nehmen und ob wir solidarisch gegenüber
den Menschen sind, die
aus unterschiedlichsten Gründen
ihre Heimat verlassen und hier eine
neue Heimat suchen.
KF: Sie haben in Ihrer Rede zur
Wallfahrt die fortschreitende Erschöpfung
der Welt an Ihren persönlichen
Daten festgemacht…
Claudia P.: Im Jahr meiner Geburt
1961 ließ die globale jährliche Ressourceninanspruchnahme
durch
den Menschen noch knapp 1 %
KF: Apropos nachkommende Generationen:
Die ganz Jungen setzen sich ja langsam
zur Wehr..
Claudia P.: Ja, es hat mir sehr gut gefallen,
dass im Septmeber bei der „Fridays-for-future“-
Veranstaltung für einen konsequenten
Klimaschutz in Bozen eine Jugendliche vom
„Heimatplaneten“ geredet hat, den es zu
retten gilt: Welch ein schönes und aussagekräftiges
Bild: Hier ist unsere Heimat,
nicht auf dem Mars; hier sind wir aufgerufen
zu gestalten, indem wir im Einklang
mit der Natur, mit uns selbst und mit unserer
Mitwelt leben. Und die Wahrung dieser
wunderbaren Schöpfung ist – nehme
ich mit Gewissheit an – ein gemeinsames
Anliegen von uns allen.
Dr Weg
Der Weg der ins durchs Lebm fiahrt,
isch oft nöt glótt und nöt markiert,
miar mian über vieles drübersteign,
mian unnemmen und oft schweign.
Der Weg fiahrt übr Schtock und Schtoan,
oft fühlt man sich verlóssn und alloan,
es rauscht der Boch nebm ins gonz wild,
und niamand isch der insr Sehnenschtillt.
Es gibt aa ólm wiedr schiana Schtundn,
Kummer und Sorgn sein verschwundn,
Hella und Liacht in gonzn Haus,
man holtet des Glück nor foscht net aus.
Des isch´s Löibm, miar kemmen net aus,
und mochn so hólt s`Beschte draus,
mit Liab im Herzn und Zuversicht,
schaugn miar dem Löibm ins Gsicht.
Anna Steinacher
Nr. 06 | Dezember 2019 3
Das Thema
„Wir brauchen sensible, aufmerksame,
staunende und dankbare Menschen“
Wallfahrt des Heimatpflegeverbandes mit Bischof Ivo Muser
Über den wunderbar angelegten Franziskusweg ging die Pilgergruppe von Sand in Taufers aus vorbei an den Reinbach-Wasserfällen
zur Toblkapelle, die dem Heiligen Franz von Assisi und Klara gewidmet ist. Dort übermittelte der Bischof den Pilgern eindrückliche
Botschaften, die wir hier in Auszügen abdrucken.
„Unser Umgang mit der Schöpfung, unser
Umgang mit den Geschöpfen, unser
Umgang mit dem Menschen hat ganz viel
damit zu tun, ob wir noch im Stande sind
zu staunen. Gerade wir in Südtirol leben
in einem begnadeten Flecken von Gottes
Schöpfung, der uns das Staunen wirklich
nicht schwer macht.“
„Dann müssen wir endlich wieder einsehen,
dass wir nicht alles tun dürfen, was wir heute
tun können. Das sind die entscheidenden
Haltungen. Das Staunen, die Demut, das
tiefe Anerkennen, dass nicht einfach alles
getan werden kann. Und besonders problematisch
ist eine Haltung, die in unserer
Gesellschaft weit verbreitet ist: Immer mehr,
immer weiter, immer schneller, immer perfekter,
immer reicher, immer aufwändiger.
Was wir brauchen, sind sensible, aufmerksame,
staunende und dankbare Menschen.“
„Das Wort des Innehaltens. Das Wort,
das in diese Gesellschaft hineinsagt: Es
ist auch einmal genug. Und Franz von
Assisi ist uns auch noch in einer anderen
Haltung ein ganz großes Beispiel und
ich würde sagen auch eine gewaltige Herausforderung.
Franz von Assisi war mit Sicherheit eine
Zumutung für seine damalige Gesellschaft,
er war auch eine gewaltige Zumutung
für die Kirche seiner Zeit. Aber
wisst ihr, was Franz von Assisi nie macht
– das ist wirklich der Heilige – Er wird in
all seinen Äußerungen und vor allem in
seiner ganz radikalen Lebensweise nie
gewalttätig.“
Bischof Ivo Muser, anlässlich der Wallfahrt
der Heimatpfleger auf dem Franziskusweg
in Sand in Taufers am 5. Oktober 2019
4
KulturFenster
Heimatpflege
Weihnachten - ein Fest der Freude …
Josef Oberhofer, Geschäftsführer des HPV, macht sich so seine eigenen
Gedanken zum bevorstehenden Weihnachtsfest…
Die Erwartungshaltung eines Kindes an ein
gelungenes Fest beschränkt sich vor allem
auf die Geschenke. Je älter man wird, desto
wichtiger wird das Festessen. Während
ich es als kleiner Junge fast als Zumutung
empfand, von meinem neuen Spielzeug getrennt
zu werden, um ohne jegliches Hungergefühl
vor einem übervollen Teller zu sitzen,
macht genau das heute den Reiz des
Festes aus. Das Essen, das es in dieser Güte
nur an einem einzigen Tag im Jahr gibt, das
lange Zusammensein von mehreren Generationen
an einem Tisch, das so selten geworden
ist, dass ich mich Wochen vorher
darauf einstelle.
Der Weihnachtstisch ist die Verdichtung
eines labilen, komplexen Systems,
dessen Zusammenhalt allein von Stimmung
und Emotionen abhängt. Der Weihnachtstisch
ist vermutlich der einzige Ort,
an dem man gleichzeitig mit Menschen
zusammenkommt, die man sehr mag –
oder ganz bewusst nur an einem Tag im
Jahr sieht. An diesem Tisch wird einem
vor Augen geführt, dass man sich seine
Familie nicht aussuchen kann. Hier ist
man Chefdiplomat und Schauspieler zugleich,
und die Performance dabei kann
über Wohl und Gedeih des Abends entscheiden.
Denn das System wird instabil,
sobald eines der Glieder aus dem Takt gerät.
Weihnachten ist das wichtigste Fest,
das wir haben. Jeder hat eine konkrete
Erwartungshaltung, die oft mit verklärten
Erinnerungen an Weihnachtsfeste aus der
Kindheit zusammenhängen. An diesem
Tag muss alles so sein, wie man sich das
ideale Weihnachten Vorstellt: Harmonie allerorts,
selig lächelnde Gesichter, die Geschenke
allesamt ein Volltreffer, und der
Baum steht auch am richtigen Platz. Schon
die kleinste Veränderung, das Abweichen
von der Ideallinie, sorgt für Stress. Uns ist
Weihnachten so bedeutsam, weil es seit
unserer Kindheit ein Glücksversprechen
ist, ein Fest, das mit Wärme wirbt, wenn
es draußen am kältesten ist. Deshalb hat
jede Enttäuschung an Weihnachten eine
so hochemotionale Dimension. Zum Fest,
und das macht die Aufrechterhaltung des
Glücksversprechens nicht leichter, herrscht
eine Nähe, die uns das ganze Jahr über
fremd ist. Familien leben nicht mehr zusammen,
nicht mehr unter einem Dach.
Sie sind weit verteilt, die Enkel wohnen in
eigenen Wohnungen, die Kinder sowieso,
und die Großeltern werden häufig allein gelassen.
Mit jedem Jahr werden wir alle am
Tisch älter und verändern uns. Jeder hat
seine eigene Geschichte und nun findet
man sich in einer Momentaufnahme mit
Menschen, die einem so nah sein sollten
und doch fremd sind. Der Weihnachtstisch,
das ist ein emotionaler Ort, der uns
wie auf Knopfdruck zusammenbringt. An
dem wir unvernünftig viel essen, bis der
oberste Hosenknopf geöffnet werden muss.
Am Weihnachtstisch ist alles künstlich inszeniert.
Das beste Porzellan. Stoffservietten
mit Goldkante. Teure Weine. Ein Ort,
der ganz besonders sein will – und dadurch
so gefährlich wird.
Weihnachten - ein Fest der Freude.
Leider wird dabei so wenig gelacht
(Jean-Paul Sartre)
Der Druck, dass alles besonders sein
muss, heizt in diesem gnadenlosen Heile-
Welt-Wettbewerb so die Stimmung auf,
dass man irgendwann Druck vom Kessel
nehmen muss. Streit an Weihnachtstischen
entsteht, weil jeder einzelne nicht
nur seinen Hunger, sondern auch Hoffnungen
mitbringt. Der eine freut sich auf
eine allgemeine Familienharmonie und
reagiert äußerst sensibel auf jede Verstimmung.
Der andere freut sich, nichts
tun zu müssen und reagiert bockig und
genervt, wenn er animiert wird, sich aktiv
am Geschehen zu beteiligen. Wieder
ein andrer will einfach nur erzählen und
rote Wangen vom Prosecco bekommen.
Und so entstehen kleinere und größere
Konflikte, die allesamt keinen tieferen
Ursprung haben, sondern nur eine Ventilfunktion
für das Fest der Freude in der
Familie haben.
Nr. 06 | Dezember 2019 5
Das Thema
Wer bringt zu Weihnachten die Geschenke:
Das Christkind oder der Weihnachtsmann?
Gastkommentar von Prof. Martin M. Lintner
Kulturhistorisch gesehen ist der Brauch des
Weihnachtsgeschenkes relativ jung. Er entwickelte
sich erst im Lauf der Neuzeit in den
mittel- und nordeuropäischen Ländern (im
italienischen Kulturkreis hingegen bringt
bis heute die „Befana“ die Geschenke zur
Epiphanie, also zu „Dreikönig“, dem Fest
der Erscheinung des Herrn).
Ursprünglich hat er mit dem Usus im
bäuerlichen Kontext zu tun, dass zu Martini,
also am 11. November, die Mägde,
Knechte und Bediensteten für die Arbeit
während des Sommers ausbezahlt worden
sind. Man konnte sich also in der Zeit danach
etwas leisten und sich auch gegenseitig
durch ein kleines Geschenk eine
Freude bereiten. Im bürgerlichen Milieu
wurde dieser Brauch dann übernommen,
hat allerdings anfangs einen pädagogischen
Zweck erfüllt: Kinder sollten für ihr gutes
Benehmen belohnt werden, bzw. die Aussicht
auf ein Geschenk sollte Anreiz sein,
artig zu sein. Im katholischen Kontext waren
die Gedenktage von unterschiedlichen
Heiligen, die als Vorbilder der freigiebigen
Nächstenliebe verehrt werden – wie der hl.
Martin und der hl. Nikolaus – geeignete Anlässe,
um ein Geschenk zu machen. Besonders
das populäre Fest des Bischofs
Nikolaus von Myra am 6. Dezember, um
dessen Leben sich viele Legenden ranken,
die in der einen oder anderen Form
mit Schenken zu tun haben, spielte eine
wichtige Rolle. Vielleicht auch deshalb, weil
nach dem Konzil von Trient die Bischöfe
angehalten waren, die Pfarren zu visitieren
und nach dem Rechten zu sehen, also zu
loben und zu tadeln, wurde der hl. Bischof
Nikolaus zu jenem, der schlechtes Benehmen
getadelt, gutes hingegen mit kleinen
Gaben belohnt hat. Im Unterschied nämlich
zu St. Martin von Tours, der zwar auch
Bischof war, aber meist ohne bischöfliche
Insignien, sondern als Soldat hoch zu Ross
dargestellt wird, der mit dem Bettler seinen
Mantel teilt, wurde Nikolaus immer mit der
Bischofsmitra, dem Hirtenstab und den liturgischen
Gewändern dargestellt.
Warum Geschenke?
Schließlich hat sich Weihnachten zum
Fest der Geschenke entwickelt. Der Hintergrund
ist neben der Entwicklung dieses
Festes zum trauten Familienfest im bürgerlichen
Milieu auch ein theologischer:
Das gläubige Bekenntnis, dass uns im
Christkind Gott seinen Sohn schenkt, das
größte aller Geschenke, hat dazu geführt,
dass die Freude darüber – wohl auch, um
das Fest der Geburt Christi aufzuwerten –
zum Ausdruck gebracht worden ist, indem
man sich gegenseitig beschenkt. Nicht
mehr nur Kinder, auch Erwachsene werden
beschenkt. So hat das Christkind die
Heiligen in der Rolle, Gaben zu bringen,
zusehends abgelöst. Besonders in den
evangelisch geprägten Gegenden war man
darauf bedacht, um die Aufmerksamkeit
weg von den Heiligen, deren Verehrung
in den evangelischen Kirchen als problematisch
angesehen wird, auf Christus hin
zu lenken.
Lange Tradition
Auch der Weihnachtsmann hat eine
lange Tradition. Er wurde ursprünglich
nicht, wie oft irrtümlich angenommen wird,
als antichristliche Figur eingeführt, die das
Christkind ablösen sollte. Vielmehr hat er
sich heraus entwickelt aus unterschiedlichen
Sagenfiguren aus den nordischen
Ländern, die damit „christianisiert“ worden
sind. Wiederum geschah es besonders in
evangelisch geprägten Ländern, dass man
an die Stelle der Heiligen den Weihnachtsmann
gesetzt hat, um damit der aus theologischen
Gründen abgelehnten Heiligenverehrung
etwas entgegenzusetzen.
Als dann europäische Auswanderer nach
Nordamerika auch den Brauch des Weihnachtsgeschenkes
in die „neue Welt“ mitgenommen
haben, hat sich dort die Figur
des Weihnachtsmannes auch losgelöst von
der christlichen Tradition entwickelt. Hier
geschah es dann, dass der Weihnachtsmann
auch dezidiert in einer kritischen
Abgrenzung vom christlichen Glauben
dargestellt worden ist als die Figur, die zu
Weihnachten Geschenke bringt. In einem
mehr und mehr säkular geprägten Kontext
übernimmt der Weihnachtsmann also die
Rolle der christlichen „Gabenbringer“ –
des hl. Nikolaus ebenso wie des Christkindes.
Spätestens seit Coca-Cola ab den
1930er-Jahren den Weihnachtsmann für
Werbezwecke eingesetzt hat, ist der Weihnachtsmann
zum Symbol für das kommerzialisierte,
entchristlichte Weihnachten geworden.
Und den Unterschied zwischen
dem Weihnachtsmann und St. Nikolaus
kennt auch hierzulande nicht mehr jeder,
wenn etwa der Nikolo mit den Attributen
des Weihnachtsmannes und ohne bischöfliche
Insignien dargestellt wird.
Wer bringt nun die Geschenke zu Weinachten?
Wir Menschen, die wir uns gegenseitig
beschenken und eine Freude bereiten.
Ein solches Geschenk spiegelt etwas
vom Heilsereignis wider, das wir zu Weihnachten
begehen: Das Gott uns im Christkind,
dessen Geburt wir feiern, seinen
Sohn geschenkt hat, um uns seine Liebe
und Zuwendung zu offenbaren. Immer
dann, wenn in einem Geschenk auf der
zwischenmenschlichen Ebene etwas von
dieser göttlichen Zuwendung und Liebe erfahrbar
wird, wird ein Geschenk im wahrsten
Sinn des Wortes zu einem Weihnachtsgeschenk
– wer immer es gebracht hat.
Prof. Martin M. Lintner,
Philosophisch-theologische
Hochschule Brixen
6
KulturFenster
Informiert und Reflektiert
Heimatpflege
Was nicht passt, wird
passend gemacht
Die unendliche Geschichte der Skiverbindung
Langtaufers-Kaunertal
Damit wäre die Entscheidung eigentlich
klar gewesen, doch plötzlich war das sozioökonomische
Gutachten nicht mehr
gültig, weil es einen Befangenheitsverdacht
gegen ein Mitglied der sozioökonomischen
Kommission gegeben hätte.
Ein neues sozioökonomisches Gutachten
wurde angeordnet.
Das Amt für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung empfiehlt
die Ablehnung
Für die Sitzung der Landesregierung am
Dienstag hat das zuständige Amt laut Tagesordnung
die Ablehnung des Projekts
empfohlen. Doch dazu kam es nicht. Die
Entscheidung wurde vertagt, weil das neue
sozioökonomische Gutachten für einige
Landesregierungsmitglieder – im Gegensatz
zu den Experten im zuständigen Amt
– nicht eindeutig genug war.
Die geplante Ablehnung der Skiverbindung
Langtaufers-Kaunertal in der Sitzung der
Landesregierung vom Dienstag, 15. Oktober,
hat wieder nicht stattgefunden. Die Entscheidung
ist verschoben worden. Obwohl
alle Argumente gegen das Projekt sprechen
und sogar der Bürgermeister von Graun sich
inzwischen dagegenstellt, treiben die Projektwerber
die Skiverbindung weiter voran
und die Landesregierung kann sich nicht
zu einer klaren Entscheidung durchringen.
Chronologie der Ereignisse
Im Jahr 2017 hat die Landesregierung
über die Zusammenlegung der beiden
Skigebiete Kaunertal und Langtaufers entschieden
und dem damals vorgelegten Projekt
eine Absage erteilt. Wegen rechtlicher
Widrigkeiten zog die Landesregierung den
Beschluss 1423/2017 im Frühjahr 2018
zurück. Somit musste das Projekt nochmals
vom Umweltbeirat behandelt werden.
Foto: Alpenverein Südtirol
Negative Gutachten
Das Gutachten des Umweltbeirates fiel
auch bei der erneuten Überprüfung eindeutig
negativ aus: Man rechnet mit massiven
Umwelteinwirkungen und einem negativen
Einfluss auf eine Vielzahl von Lebensräumen,
so zum Beispiel auf gefährdete Arten
wie dem Schnee- und dem Steinhuhn.
Doch auch das sozioökonomische Gutachten
– das von der Politik meistens eingesetzt
wird, um den Umweltgutachten
etwas entgegensetzen zu können – fiel
eindeutig negativ aus: „Unter Berücksichtigung
[…] der zu erwartenden sozioökonomischen
und touristischen Auswirkungen
sowie der Mobilitätsaspekte wird das Projekt
negativ begutachtet.“
Plötzlich Befangenheitsverdacht
Was nicht passt, wird passend
gemacht
Der Verdacht liegt auf der Hand: Es werden
so lange neue Gutachten gemacht
und Verfahrenstricks angewendet, bis das
Projekt gegen alle Widerstände durchgedrückt
werden kann. Gleichzeitig werden
die Kritiker durch die Verzögerungstaktik
mürbe gemacht.
Einen Präzedenzfall für dieses Vorgehen
gab es heuer schon: Auch die
umstrittene Neuerschließung im Skigebiet
Gitschberg-Jochtal wurde auf ähnliche
Weise schlussendlich genehmigt.
Die Landesregierung täte gut daran, von
dieser undemokratischen Taktik Abstand
zu nehmen.
Kein „ergänzender Eingriff“,
sondern eine Neuerschließung
Verkauft wird das Projekt als „ergänzender
Eingriff“, tatsächlich wird hier
aber ein komplett neues Skigebiet mit all
seinen Folgewirkungen aus dem Boden
gestampft. Gleichzeitig ist der volkswirtschaftliche
Nutzen für die Bevölkerung
laut sozioökonomischem Gutachten mehr
als bescheiden. Der Alpenverein Südtirol,
der Dachverband für Natur- und Umweltschutz,
der Heimatpflegeverband und die
Umweltschutzgruppe Vinschgau fordern
die Landesregierung erneut auf, den Fakten
Rechnung zu tragen und die Skiverbindung
Langtaufers-Kaunertal endgültig
abzulehnen.
Nr. 06 | Dezember 2019 7
Informiert und Refl ektiert
Es gibt keinen Planeten B
Der Sonderbericht über die Ozeane und die Kryosphäre
Weltweit leben 380 Mio. Menschen
unter fünf Metern Meereshöhe. Bei
3,2 Grad Celsius Erderwärmung bis
zum Ende dieses Jahrhunderts wird
der Meeresspiegel 110 cm steigen.
Im heurigen September ist der Sonderbericht
des Weltklimarates IPCC über die Ozeane
und die Kryosphäre, also die Eisgebiete unseres
Planeten, erschienen. Ich habe schon
wiederholt über die Erderwärmung, den Klimawandel
und das beschleunigte Abschmelzen
der Gletscher in den Alpen als das auffälligste
Signal dieses Wandels berichtet.
Heute will ich über die Weltmeere berichten,
auch wenn wir hunderte Kilometer davon
entfernt wohnen.
Wenn Sie weiterlesen, werden Sie erkennen,
warum der Zustand auch über diese
entfernten Habitate interessieren muss. So
wie derzeit Armut und Krieg Flüchtlingsströme
und Migrationswellen auslösen,
wird in Zukunft die Zahl der Klimaflüchtlinge
der Politik eine neue Gesellschaftsordnung
abfordern oder auch diktieren.
Und diese neue Ordnung wird auch das
Binnenland weitab von den Meeresküsten
betreffen. Der Anstieg des Meeresspiegels
wird soziale, wirtschaftliche und
politische Auswirkungen haben. Mehr als
sieben Zehntel der Erdoberfläche sind von
Meeren bedeckt und rund ein Zehntel der
Landfläche liegt dauerhaft unter Eis.
Wie hoch steigt das Meer?
Bei zwei Grad Celsius globaler Erwärmung
im Vergleich zur vorindustriellen Zeit steigt
der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 laut
Einschätzung der Klimaforscher um zusätzliche
30 – 60 cm an. Bei über 2° C Erderwärmung
steigt das Wasser der Meere um
60 – 110 cm an. Dies sagt Hans Otto Pörtner
vom Alfred-Wegener-Institut für Polarund
Meeresforschung in Bremerhaven. Pörtner
ist einer der Hauptautoren des neuen
Berichtes über die Ozeane und Eisflächen.
104 Wissenschaftler des Weltklimarates aus
36 Nationen haben auf 900 Seiten des Berichtes
den Wissenstand aus 6.981 Fachveröffentlichungen
zusammengefasst. Dass
die globale Erwärmung bis zur Jahrhundertwende
um mehr als 2° C zunehmen wird,
ist keine abwegige und zu pessimistische
Annahme. Bei Einhaltung aller Selbstverpflichtungen
und Ziele wird die Menschheit
auch in Zukunft mehr Kohlendioxid
ausstoßen als bisher. Laut Pörtner steuert
die Menschheit auf 3,2° C Erwärmung bis
zum Ende dieses Jahrhunderts zu. Der Anstieg
des Meeresspiegels erfolgt nicht nur
wegen der Eisabschmelze, sondern auch
weil sich warmes Wasser ausdehnt.
Klimaflüchtlinge
Klimaflüchtlinge heißt das bedeutendste soziale
Stichwort, wenn wir an die mittel- und
langfristigsten Folgen der Erderwärmung
denken. Hierzu eine statistische Einordnung:
Rund 380 Millionen Menschen leben
weltweit weniger als fünf Meter über dem
Meeresspiegel, 680 Millionen weniger als
10 m darüber. Auch wenn der Meeresspiegel
langsam und verzögert steigt, er steigt
stetig und unaufhaltsam. In unserem derzeitigen
Jahrhundert wird nicht der durchschnittliche
Pegelstand das Problem sein,
sondern die Fluten und Stürme als Extrem-
8
KulturFenster
Heimatpflege
ereignisse. Mit steigenden Meeren werden
Sturmfluten höher an den Küsten anbranden.
Die Autoren des Berichtes sind sich
sicher, dass mit dem Anstieg der Wasserpegel
auch die Häufigkeit extremer Wasserstände
an den meisten Orten steigt. Was
vormals eine Jahrhundertflut war, werde
künftig jährlich vorkommen. Einige Inselatolle
erleben dies bereits jetzt.
An den Küsten leben Menschen in großer
Dichte. Vielerorts, nicht überall, haben sie
Reichtum angesammelt. Beide, Menschen
und Wohlstand zu schützen, wird teuer.
Arme Staaten wie etwa Bangladesch werden
sich den Schutz vor Flutschäden nicht
leisten können. Und der aktuelle IPCC- Bericht
hält fest: „Einige Inselstaaten werden
wahrscheinlich unbewohnbar.“
Weitere Folgen
Bei weiterhin stärkerem Treibhauseffekt als
Folge des noch immer steigenden CO2-
Gehaltes in der Erdatmosphäre werden
nicht nur der Meeresspiegel steigen und
die Sturmfluten häufiger werden, sondern
sich weitere schwerwiegende Folgen einstellen.
So etwa:
• in der Polarregion werden Meereis
schmelzen und Gletscher verschwinden;
• Permafrost-Gebiete werden auftauen,
erhebliche Mengen Kohlendioxid in die
Atmosphäre freisetzen und damit den
Treibhauseffekt noch verstärken;
• in den gemäßigten Gebieten werden Gebirgsgletscher
schwinden, die Verdunstung
zunehmen und heute schiffbare
Flüsse weniger Wasser führen;
• in den Tropen werden die Versauerung
und ozeanische Hitzewellen die Korallenriffe
abtöten und die Artenvielfalt
von Pflanzen und Tieren verringern.
Menschengemacht
Weil Klimaskeptiker den menschengemachten
Klimawandel immer noch bezweifeln
oder gar leugnen, zum Schluss
noch ein paar statistische Angaben, die
nachdenklich machen und zu überzeugten
Verhaltensänderungen bei jedem Einzelnen
von uns führen sollen:
• 1970 bestiegen weltweit 310 Millionen
Menschen ein Flugzeug. 2018 waren
es mehr als 4 Milliarden, fast dreizehnmal
so viele.
• Bei den globalen CO2- Emissionen lagen
die Luftfahrt und die Schifffahrt mit
je 750 Megatonnen CO2 (2015) etwa
gleichauf.
• Beim Vergleich der Verkehrsmittel in
Deutschland liegt der Reisebus überraschenderweise
als sauberstes Verkehrsmittel
vor der Bahn: Er erzeugt 32
Gramm CO2 pro Person und Kilometer
(bei 60% Auslastung), die Eisenbahn
36 g (Auslastung 56%), der Personenkraftwagen
139 g (Auslastung 1,5 Personen
pro PKW), das Flugzeug 201 g
(Auslastung 82%).
• Fliegen wäre auch schonender möglich:
Aus Kondensstreifen der Flugabgase
bilden sich Cirrus-Wolken. Beide
sind klimaschädlich. Die Bildung von
Kondensstreifen ließe sich verringern,
wenn Transatlantikflieger nicht mehr in
der Stratosphäre oberhalb von 10 km
flögen, sondern in der unteren Troposphäre
auf etwa 7 km Höhe. Momentan
wird die größere Flughöhe von den
Fluglinien wegen der niedrigeren Kosten
bevorzugt.
Gastkommentar von Wolfgang Platter,
aus „Vinschgerwind“ Nr. 21./2019
vom 17.10.19
Kondensstreifen von Flugzeugen: 1970 bestiegen weltweit 310 Millionen Menschen ein Flugzeug, 2018 waren es mehr als 4
Milliarden. Kondensstreifen werden zu Cirrus-Wolken, beide sind klimaschädlich, weil treibhausverstärkend.
Nr. 06 | Dezember 2019 9
Informiert und Refl ektiert
Schluss mit dem Geknalle!
Pusterer Appell an die BürgermeisterInnen, Feuerwerke zu verbieten
Bitte verzichtet auf Feuerwerke
Uns Tieren zuliebe!
Im Frühjahr 2019 erhielten alle BürgermeisterInnen
des Landes ein Schreiben von
der Initiativgruppe Feuerwerkfreies Südtirol.
„Unsere Initiative soll sensibilisieren
und aufzeigen, dass große Teile der Bevölkerung
Feuerwerke ablehnen, da der Spaß
– für relativ wenige – Umwelt und Tiere
schädigt und die Lebensqualität vieler beeinträchtigt“,
hieß es. Jetzt haben die Initiatoren
Bilanz über den bisherigen Erfolg
ihrer Initiative gezogen.
Die Feinstaubbelastung durch Feuerwerke
ist erheblich. Zahlen aus Deutschland
berichten von 15 % des jährlichen
Straßenverkehrs. Daher schien der Gruppe
allein in Hinblick auf den Klimawandel der
Zeitpunkt für ein Umdenken richtig.
Einen weiteren guten Grund für ein feuerwerkfreies
Südtirol sehen die Pusterer InitiatorInnen
im Tierschutz. Für Haus- und
Nutztiere, für Wild und Vögel ist ein Feuerwerk
ein großer Stressfaktor, der bis zum
Tod führen kann.
Und schließlich führen sie auch soziale
Aspekte an. Vielfach werden Feuerwerkskörper
von Kindern unter gefährlichen Bedingungen
in armen Ländern hergestellt.
Immer wieder kommt es zu Unfällen und
Verletzungen, nicht nur bei der Herstellung.
Die Gruppe aus dem Raum Bruneck
wird von vielen Organisationen und mitgliedsstarken
Vereinen unterstützt. Wie
die Sprecher der Gruppe Richard Kammerer
und Caroline von Mersi berichten,
haben sich viele große Landesorganisationen
hinter das Ansuchen gestellt: Alpenverein
Südtirol, Südtiroler Pfadfinderschaft,
Heimatpflegeverband Südtirol, Tierärztekammer,
die Grünen, Tierschutzvereine,
die OEW. Auch in den Bezirken haben
namhafte Institutionen und Umweltgruppen
das Schreiben mitunterzeichnet. So
z. B. im Pustertal das Dekanat Bruneck,
der Naturtreff Eisvogel, der Pustertaler
Reit- und Fahrverein, der Grundschulsprengel,
der Familienverband, der Jugenddienst,
Hundeschulen.
Nach einem halben Jahr ziehen die
InitiatorInnen nun Bilanz:
Von 117 Gemeinden konnten 34 Rückmeldungen
eingeholt werden. Davon konnten
22 als positiv gewertet werden. Fünf
lehnen die Initiative ab, sieben verhalten
sich neutral, bzw. antworten ohne konkrete
Stellungnahme.
„Mit Freude konnten wir die Rückmeldungen
der Stadtgemeinden Bruneck,
Sterzing und Brixen entgegennehmen, die
auf Feuerwerke zukünftig verzichten. Danken
möchten wir auch dem Bürgermeister
von Meran, der in seinem Schreiben
unsere Aktion lobte und weiterhin keine
Feuerwerke genehmigen wird,“ heißt es
in der Mitteilung.
Und weiter schreiben Richard Kammerer
und Alexandra von Mersi im Namen
der Initiative „Feuerwerkfreies Südtirol“:
„Unser nächstes Bemühen wird es
sein, an die Gemeinden zu appellieren,
auf ihren Internetseiten und Gemeindeblättern
auf die Genehmigunspflicht
für Feuerwerke hinzuweisen,
da sonst jene „bestraft“ werden, die
ansuchen, jene, die Feuerwerke abfeuern
ohne anzusuchen, aber nicht
belangt werden.“
Kontakt: feuerwerkfrei@gmail.com
10
KulturFenster
Aus Verband und Bezirken
Heimatpflege
Die „Allianz der Kultur“
Zusammenschluss und Sprachrohr der Südtiroler Kulturvereine
2017 lud Landesrat Philipp Achammer
die Kulturvereine und -gruppen Südtirols
unter dem Titel „Kulturperspektiven“
zu gemeinsamen Workshops in
ganz Südtirol ein, dabei wurde die
Idee eines Zusammenschlusses geboren.
Eine Initiativgruppe formte daraus
die Allianz der Kultur, der zurzeit
23 Verbände, Vereine und Gruppen
angehören.
Kulturfenster: Wozu braucht es diese „Allianz“?
Florian Trojer: Um den vielen Kulturtreibenden
in Südtirol eine gemeinsame
Stimme zu geben.
KF: Nun haben Kulturvereine doch ganz
unterschiedliche Aufgaben und Anliegen.
Welches ist der kleinste gemeinsame Nenner
in dieser neuen Allianz?
Florian Trojer: Auch wenn die verschiedenen
Verbände, Vereine und Gruppen sich mit
ganz unterschiedlichen
Inhalten beschäftigen,
haben sie doch vieles gemeinsam.
Alle Kulturtreibenden
zusammen garantieren
die kulturelle Vielfalt
des Landes. Sie schaffen
Möglichkeiten, dass sich
Menschen kulturell betätigen
und beteiligen und
Freude an den vielfältigen
Angeboten haben. Kultur
ist Ausdruck davon,
wie es den Menschen in
unserem Land geht, was
ihre Identität ist, was sie
interessiert und wofür sie
sich engagieren.
Dieser Einsatz für die Kultur
ist allen Vereinen und Gruppen – auch
in ihren ganz unterschiedlichen Ausprägungen
– gemeinsam. Nicht zuletzt hängen
viele Kulturvereine von Förderungen
öffentlicher Stellen ab und sehen sich einer
zunehmenden Bürokratisierung gegenüber.
Auch hier ist eine gemeinsame
Stimme wichtig und notwendig.
KF: Der HPV ist durch Sie in der Steuerungsgruppe
vertreten. Was bedeutet diese
neue Aufgabe für Sie?
Florian Trojer: Ich bin nicht als Vertreter
des HPV in die Steuerungsgruppe gelost
worden, sondern als ein Vertreter aller
beteiligten Kulturvereine und -gruppen.
Und so sehe ich auch meine Aufgabe:
die Interessen der Kulturtreibenden zu
vertreten und gemeinsame Anliegen voranzutreiben.
Die Steuerungsgruppe der Allianz:
v.l. Christine Menghin, Ferruccio
Delle Cave, Hannes Egger, Monika
Rottensteiner, Christian Schwarz,
Florian Trojer und Sonja Plank
(nicht im Bild)
Foto: Allianz der Kultur
KF: Können die Themen der Heimatpflege
durch die Mitgliedschaft in
der „Allianz“ aufgewertet werden? Inwiefern?
Florian T.: Auf jeden Fall. Der naheliegendste
Vorteil ist die Vernetzung untereinander.
Der HPV bekommt die
Möglichkeit ganz unterschiedliche
Perspektiven und Vorgehensweisen
in der direkten Zusammenarbeit kennenzulernen
und daraus zu profitieren.
Vielleicht ergeben sich daraus in Zukunft
gemeinsame Projekte mit Partnern,
an die man bisher gar nicht gedacht hätte.
Zusätzlich gibt es ganz praktische Vorteile.
Viele Probleme die man in der Kultur- und
Vereinsarbeit hat, sind vielleicht bei anderen
schon aufgetreten oder bereits gelöst worden.
Daraus kann man lernen.
Und natürlich stärkt das gemeinsame Auftreten
bei Anliegen, die alle betreffen, auch
den HPV als Einzelverband.
KF: Welches sind die ersten
Themen, welche die
Allianz bearbeiten/voranbringen
will?
Florian Trojer: Bisher gibt
es die Allianz der Kultur
vor allem als gemeinsame
Idee. Nun gilt es praktische
Schritte zu setzen. Ein zentrales
Thema ist die interne
Vernetzung untereinander.
Eine Möglichkeit ist hier
ein gemeinsames Weiterbildungsangebot
zu schaffen.
Das heißt, Themen,
die für alle interessant sein
könnten wie zum Beispiel
„Lobbyarbeit in der Kulturarbeit“
oder ähnliches,
könnten als Fortbildungen angeboten werden.
Wichtig ist auch die Netzwerkarbeit nach
außen, das heißt, die Kontakte mit Politik,
Gemeinden und Interessensgruppen auszubauen
und zu pflegen. Eine Hauptaufgabe
wird auch sein, etwaige Änderungen in der
Kulturförderungspolitik zu beobachten und
darauf Einfluss zu nehmen.
Nr. 06 | Dezember 2019 11
Aus Verband und Bezirken
Historische Schätze und
moderne Sünden
Dorfbegehung in St. Pankraz
Zu einer Dorfbegehung hat der Verein für
Kultur- und Heimatpflege St. Pankraz, Ulten,
im September in Zusammenarbeit mit
dem Heimatpflegeverband Südtirol geladen.
Kunsthistoriker Martin Laimer führte
zu den zahlreichen historischen Bauten im
Dorfkern. Die Obfrau des Heimatpflegeverbandes
Südtirol, Claudia Plaikner, unterstrich
die Bedeutung der ehrenamtlichen
Tätigkeit der Heimatpflegevereine in den
einzelnen Orten. In unserer Zeit, in der immer
mehr historische Bauten dem Zeitgeist
geopfert werden, sei es besonders wichtig,
die Bevölkerung durch derartige Veranstaltungen
zu sensibilisieren.
Am Brunnenplatz wurde die Gruppe
von der Obfrau des Ortsvereines Roberta
Fait begrüßt. Der Brunnenplatz wurde bewusst
als Ausgangspunkt gewählt, da man
von dort einen schönen Blick auf Schloss
Eschenlohe, früher Burg Ulten, Geburtsstätte
des Grafen Ulrich I, Begründer des
Hauses Württemberg, hat. Ein Gedenkstein
erinnert an diese für St. Pankraz sehr bedeutsame
Persönlichkeit. Georg Gamper,
Ortschronist, sprach kurz über die Entstehung
des Gedenksteines.
Dorfbegehung
Am Innerwirtsplatz in St. Pankraz, Ulten
Danach begann die eigentliche Dorfführung
mit Martin Laimer. Er erläuterte den
historischen Dorfkern, beginnend mit der
Pfarrkirche und ihrem gotischen Turm,
umgeben von historischen Bauten verschiedener
Epochen. Diese Pfarrkirche
hat einst das ganze Tal versorgt, hier haben
über Jahrhunderte die Bewohner
des ganzen Tales ihren Glauben gelebt,
bezeugt und bei Hochfesten kein Opfer
gescheut, den weiten Weg zur Hauptkirche
zu gehen.
Die zweigeschossige Sebastiankapelle
neben der Pfarrkirche, im Osten des alten
Friedhofs gelegen, wurde 1348 erbaut und
1636 als Dank für das Ende der furchtbaren
Pestseuche erneuert. Das Pfarrhaus,
an der Ostseite des Dorfzentrums,
überrascht wegen seiner Größe. Hier waren
einst die Seelsorger der Mutterpfarre
für das ganze Tal untergebracht. Ein regelmäßiger
Bau, mit einem großen Mittelfl
ur, der heutige Erweiterungsbau dürfte
auf Thomas Marsoner zurückgehen, vermutlich
auf einem spätmittelalterlichen
Vorgängerbau.
Weiter ging es zum „Innerwirt“, westlich
der Pfarrkirche, einem altehrwürdigen Gebäude,
das vor Jahren mit viel Verständnis
und Sensibilität renoviert wurde und
jetzt eine Pension ist. Hier wurde der Historiker
Josef Egger geboren, der unter
anderem eine 3-bändige Geschichte Tirols
verfasst hat.
Das „Pfleghaus“, das ehemalige Gerichtsgebäude,
ein geschichtlich bedeutsamer
Bau aus dem 18. Jahrhundert, geht
auf einen älteren Vorgängerbau zurück.
Die barocke Dekorationsmalereien
an Fenstern und Türen und auf der Südseite
das Wappen der Grafen Trapp, wurden
vor ca. 20 Jahren mit Hilfe der Stiftung
Messerschmitt gründlich renoviert.
Dem Haus gegenüber steht das ehemalige
Gerichtsarchiv aus der Barockzeit.
Der „Außerwirt“ und das „Messnerhaus“
schließen den historischen Kreis der Altbauten
um die Pfarrkirche. Das Messnerhaus,
ein spätmittelalterlicher Bau,
über Jahrhunderte Unterkunft für den
Messner, wurde vor einigen Jahren sehr
gefühlvoll renoviert.
Der neue Friedhof unterhalb des Dorfes
wird aufgrund seiner stufenförmigen Anlage
sehr bewundert und wurde dafür
auch mit dem Steinzeichen des Heimatpflegeverbandes
ausgezeichnet. Die Friedhofserweiterung
mit den Urnengräbern
traf hingegen auf unterschiedliche Meinungen,
hauptsächlich wegen der allzu
hohen Bergmauer.
Das Fachwerkhaus im Ortsteil „Auf der
Station“, westlich vom Friedhof, wurde
12
KulturFenster
Heimatpflege
vor einigen Jahren in vorbildlicher Weise
und mit viel Liebe zum Detail restauriert,
es ist der einzige Bau dieser Art in Ulten.
In diesem Haus wohnte von 1965
bis 1991 Blasius Marsoner, Übersetzer
der „Divina Commedia“ von Dante Alighieri.
Nach der Volksschule hatte Marsoner
sich als Autodidakt ein umfangreiches
Wissen angeeignet, und hat im Laufe seines
Lebens mehrere Gedichte, eine philosophische
Abhandlung und eine Zusammenfassung
zur Geschichte Ultens
verfasst. Er war ein Verfechter von Traditionen
und echter Werte, wurde aber
vielfach im Dorf nicht ernst genommen.
Das „Beckenchristlhaus“ am Ende der
Runde war eine Überraschung für alle
Beteiligten, ein Beispiel für eine gelungene
Altbausanierung. Die hohe Grundmauer,
steil im Hang gebaut, die schöne
Steinlagerung, dann der Keller mit dem
alten tragenden Holzpfeiler, ein Bau des
13. und 14. Jahrhundert, ein Juwel mitten
im Dorf. Fachleute vermuten darin
einen mittelalterlichen Adelssitz. Ein besonderer
Dank wurde den Besitzern, der
Familie Alber/Schwienbacher, gezollt, die
so viel Sensibilität und Gespür für die Sanierung
ihrer Bauruine aufbrachten, trotz
bürokratischer und technischer Hürden,
wirklich vorbildhaft.
Vor dem historischen Gebäude "Beckenchristl", Beispiel einer gelungenen
Altbausanierung
Mit Bedauern stellten alle Beteiligten
fest, dass die Umfahrungsstraße das Dorf
zerschneidet. Heute würde eine Tunnellösung
solche urbanistischen Fehler wohl vermeiden.
Für das abschließende Gespräch
wäre kein anderer Ort besser geeignet gewesen,
als das erwähnte „Beckenchristlhaus“.
In der gemütlichen Stube kam Frau
Plaikner auf die Sorgen und Probleme der
Heimatpfleger zu sprechen und würdigte
gleichzeitig die Tätigkeit der vielen Ehrenamtlichen
im ganzen Land. Mit einem Umtrunk
endete der Rundgang.
Heimatpflegeverein St. Pankraz
Fotowettbewerb
„Heimat im Fokus / Natur-Denkmal-Mensch / offen-kritisch-spielerisch“
Weg von den Klischees, hin zum kritischen Blick
Als Auftaktveranstaltung hat das „Netzwerk Kulturerbe“ (s.o.) einen Fotowettbewerb zum
Thema „Heimat im Fokus / Natur-Denkmal-Mensch / offen-kritisch-spielerisch“ ausgeschrieben,
der am 1. Juni 2019 gestartet ist und am 29. Februar 2020 endet.
Der Wettbewerb richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Er hat das Ziel, ein neues, kritisches
Bewusstsein für die Natur, die Umwelt und die Landschaft, die Bräuche und Traditionen,
die Baukultur und die Geschichte sowie das Zusammenwirken all dieser Bereiche
zu entwickeln. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Trampelpfade der Klischeebilder
zu verlassen und sich auf die Suche nach der „gefühlten“ Heimat zu machen – mit ihren
schönen, aber auch mit ihren problematischen Seiten.
Das Reglement des Fotowettbewerbs fi nden Sie auf der Homepage des Heimatpflegeverbandes
unter www.hpv.bz.it/fotowettbewerb-p39.html
Nr. 06 | Dezember 2019 13
Aus Verband und Bezirken
Viel Lob und ein paar
Anregungen
Die Ortsbegehung im September in Burgstall nutzte der Heimatpflegeverein Burgstall
hauptsächlich dazu, die neuere Dorfentwicklung kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und
weil der Blick von außen immer besonders hilfreich für kritische Reflexion ist, wurden die
Burgstaller von ExpertInnen des Heimatverbandes Südtirol begleitet.
Gut sanierter Alter Widum
Ortsbegehung im September in Burgstall
Vom Sparkassengebäude bis zur Villa America (l.) bedroht ein geplanter Baukoloss
anstelle der bestehenden Einzelgebäude zusätzlich das bereits lädierte Ortsbild.
Der Beirat für Baukultur sollte unbedingt einbezogen werden. Auch das monotone
rasterförmige Gebäude (r.) sollte neu strukturiert, abwechslungsreicher und
ortsbildgerechter gestaltet werden.
Widum: Die Renovierung des „alten“ Widums
wurde als lobend hervorgehoben.
Seine Ursprünglichkeit ist erhalten geblieben
und er wurde liebevoll saniert. Auch
die Idee, die Reste des Widum-Stadels in
ein Amphitheater zu verwandeln, wurde
gut geheißen. Der Vorschlag, am Widum-
Areal eine Informationstafel anzubringen,
fand regen Zuspruch.
Zypressen neben der Kirche: Positiv ist die
Unterschutzstellung der mehr als 100
Jahre alten Zypressen neben der Kirche,
mit der sie ein schönes Ensemble bilden.
Alte Volksschule: Verwunderung gab es
darüber, dass es für die alte Volksschule
keinen Ensembleschutz gibt. Die Vertreter
der Heimatpflege stufen sie als unbedingt
erhaltenswert ein. Die Bauzeit der alten
Volkschule wird gleich eingeschätzt, wie
jene des alten Gemeindehauses, welches
noch gut erhalten ist (ca. 1910). Der Maulbeerbaum
neben der Schule ist wohl der
letzte Zeuge einer Seidenraupenzucht in
Burgstall.
Friedhof: Das Friedhof-Areal neben der
Ruine wurde als sehr schönes Ensemble
gelobt. Auch das Thema Urnenbestattung
wurde in Burgstall gut gelöst, die Urnen
sollten niemals abseits der Gräber ihren
Platz finden. Auch die Leichenkapelle ist
sehr gut integriert.
Kirchsteig / Rösslwirtssteig: Die letzte verbleibende
Pappel sollte unbedingt geschützt
werden. Da zurzeit eine starke Verbauung
im unteren Bereich des Kirchsteiges im
Gange ist, sollte darauf geachtet werden,
dass der Durchgang für alle Bürger gesichert
bleibt. Zudem dient der Steig zahlreichen
Kindern als Schulweg.
Straßenraum: Der Straßenraum sollte in
erster Linie für Fußgänger, Radfahrer und
dann erst für Fahrzeuge attraktiv sein. Hohe
Gehsteige sind unbequem und manchmal
auch gefährlich für Fußgänger und
Fahrradfahrer. Besser wäre es, wenn die
Gehsteige breiter und auf gleicher Höhe
wie die Straße eingezeichnet werden. Optisch
könnte der Bereich der Fußgänger
mit einem anderen Straßenbelag hervorgehoben
werden.
Landschaftsgestaltung: In Burgstall gibt es
eine vielfältige Flora. Es wachsen neben
einheimischen Pflanzen auch Palmen, Olivenbäume
usw. Trotzdem sollten wir darauf
achten, typische Bäume und Pflanzen,
wie z.B. die „Zurgelen“(Zürgelbaum),
Flaumeichen und Mannaeschen in unserem
Landschaftsbild zu erhalten.
14
KulturFenster
Heimatpflege
Geplantes Projekt: Villa America / Ausserpflanzer
/ Ex- Pizzeria / Sparkasse
Eine durchgehende Häusergruppe soll im
Bereich der Villa America bis zur Sparkasse
entstehen. Der Durchführungsplan wurde
bereits genehmigt. Er sieht eine sehr hohe
Baudichte und damit eine große Veränderung
für das Dorfzentrum vor. Die Vertreter
des Heimatverbandes Südtirol machen
den Vorschlag, unbedingt den Landesbeirat
für Baukultur und Landschaft bei der
Planung miteinzubeziehen.
Maiergasse: In der Maiergasse gibt es ein
Parkplatzproblem und aus diesem Grund
können schöne Begegnungsorte, wie z.B.
der Platz in der Mitte, leider nicht genutzt
werden, da sie zugeparkt sind. Kleine Wege
zwischen den Gebäuden sind zwar vorhanden,
aber teilweise Sackgassen. Das
ist sehr schade, da kürzere Verbindungen/
Durchgänge für Fußgänger generell wünschenswert
sind.
Reith-Siedlung: Die Straße in der Reith-
Siedlung bildet mit dem Gehweg eine
Ebene. Das und der unterschiedliche Straßenbelag
wurden lobend hervorgehoben.
Wünschenswert wären eventuell mehrere
Bäume in der Mitte des Rondells, um eine
Positive Gestaltung der Hauptstraße: Gehsteige, Radwege und geschützte
Fußgängerübergänge durch Mittelinsel als Tempobremse
grüne Oase entstehen zu lassen. Bei dieser
Begehung konnte nur rund ein Drittel des
Dorfes besichtigt werden. Zu einem späteren
Zeitpunkt sollen auch der nördliche
und der südliche Teil besichtigt werden. Im
nördlichen Teil von Burgstall ist ja bekanntlich
die Errichtung einer großen Thermenanlage
mit Hotels geplant, die für Burgstall
sicherlich eine große Veränderung bedeuten
würde. Auch dieses Thema wurde noch
angeschnitten.
Martin Ratschiller und Heidi Gruber
MARMOR – das weiße Gold im Vinschgau
Exkursion zum Laaser Marmorbruch
Auf Initiative vom Bezirksobmann Franz
Fliri und durch Vermittlung und mit Führung
von Ludwig Platter konnten VertreterInnen
von Heimatpflegeverband Südtirol
und Bezirk Vinschgau den Produktionsbetrieb
der „Lasa Marmo GmbH“ besichtigen.
Im fernen Jahre 1865 gründete Carl
Steinhäuser mit Sohn Johannes die
„Marmorwerke Laas“. Seither wird unter
wechselnden Besitzern Marmor im
„Weißwasserbruch“ abgebaut und über
verschiedene Transportvorrichtungen zu
Tal befördert, darunter auch über die im
Jahre 1929 errichtete Schrägbahn. Der
Laaser Marmor gilt als einzigartig und wird
weltweit für zahllose Bauten und Kunstwerke
eingesetzt.
Ein herzlicher Dank dafür geht an die
„Lasa Marmo GmbH“.
Nr. 06 | Dezember 2019 15
Aus Verband und Bezirken
Nachhaltigkeitspolitik Marke Südtirol
In der politischen Arbeit ist wenig von den großspurigen Ankündigungen zu spüren
Die großen Heimat- und Naturschutzverbände
in Südtirol spielen mit verteilten Rollen,
aber sie ziehen alle an einem Strang und
kämpfen für dieselben Werte und Ziele… In
diesem Sinne drucken wir hier eine Pressemitteilung
des Dachverbandes für Natur-
und Umweltschutz ab, die uns aus der
Seele spricht…
„Eine gemeinsame Pressekonferenz
von Landeshauptmann Arno Kompatscher,
Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler
und Landesrätin für Landschaftsschutz
Maria Hochgruber-Kuenzer Anfang Juni
mit einer klaren Botschaft: Das Land Südtirol
setzt auf Artenvielfalt. Südtirol würde
künftig noch stärker auf das Thema Artenvielfalt
setzen. ... um Lebensräume zu
erhalten und diese auch für die kommenden
Generationen in ihrer Vielfalt abzusichern.
... künftige Bemühungen, um Artenvielfalt
in Südtirol weiter zu festigen und
auszubauen. ... Man sei sich der Verantwortung
und der Herausforderungen dieses
umfassenden Themas bewusst, doch
man müsse und vor allem wolle man die
Artenvielfalt auf breiter Front angehen und
das Thema aktiv besetzen,“ sagte Landeshauptmann
Kompatscher.
Zufällig waren Zeitpunkt und Inhalt der
Pressekonferenz nicht gewählt. Nur wenige
Tage zuvor wurde der Internationale Biodiversitätsbericht
der IBPES veröffentlicht,
Die übermäßige Düngung von Bergwiesen schadet der biologische Vielfalt.
der einen dramatischen menschengemachten
Artenschwund weltweit konstatierte.
Wenige Monate nach der gemeinsamen
Pressekonferenz schaut die Realität in Südtirol
leider anders aus. In der konkreten
politischen Arbeit ist wenig von den großspurigen
Ankündigungen zu spüren. Im
Pustertal will man ein geschütztes Biotop
an der aufgewerteten Ilstener Au in
ein Landwirtschaftsgebiet umwandeln. In
Brixen wird die Umwandlung von 16,5ha
Wald in Landwirtschaftsgebiet diskutiert.
Diese konkreten Vorhaben stehen in
krassem Widerspruch zu den Aussagen
der drei Landesregierungsmitglieder während
der erwähnten Pressekonferenz. Da-
her kann die Landesregierung in diesen
beiden Fällen gar nicht anders, als diese
Vorhaben klar und kategorisch ablehnen.
Leider vermissen wir in der anhaltenden
Diskussion um die beiden Vorhaben eine
klare Aussage und Positionierung der drei
Politiker ebenso wie in den Fällen einer illegalen
Zerstörung eines Moores in Olang,
oder der Degradierung von Bergwiesen
durch übermäßige Düngung wie zuletzt
im oberen Vinschgau auf den Arlui-Wiesen
geschehen.
Unser Appell an die drei: „Halten Sie
sich in diesen Fällen so klar und unmissverständlich
an ihre eigenen Positionen, die Sie
Anfang Juni öffentlich propagiert haben!“
Termin zum Vormerken:
70. Vollversammlung des Heimatpflegeverbandes
Die 70. Vollversammlung des Heimatpflegeverbandes findet am Samstag, 4. April 2020, mit voraussichtlichem Beginn
um 14 Uhr im Theatersaal des Raiffeisenhauses in Terlan statt.
Wichtiger Tagesordnungspunkt: Neuwahl der Verbandsorgane.
16
KulturFenster
Heimatpflege
„Die Kapitalisierung
der Bergwelt“
„Andermatt - Global Village“ Dokumentarfilm von
Leonidas Bieri und Robin Burgaue
noch nicht solche Ausmaße
an, wie in Andermatt,
aber das Muster ist
dasselbe.
KF: Welches „Muster“
meinen Sie?
Franz Fliri: "Fremdinvestition
heisst Fremdbestimmung",
das ist eine
der Aussagen des Filmes.
Wer einem Fremdinvestor
die Tür öffnet, ist nicht
mehr Herr im eigenen
Haus. Abgesehen davon,
dass bei uns Grund und
Boden nicht beliebig zur
Verfügung stehen, müssen
wir auch aufpassen,
was gesellschaftlich passiert.
Das gewachsene
soziale Dorfgefüge darf
nicht geopfert werden.
KF: Sehen Sie im Vinschgau aktuell eine
solche Gefahr…?
Franz Fliri: Die Langtauferer müssten sich
diesen Film anschauen…
Zum Film:
Der ägyptische Geschäftsmann Samih
Sawiris kauft sich massiv in das Dorf Andermatt
im Herzen der Schweizer Alpen
ein und will fast das ganze Dorf in ein Luxusresort
verwandeln. Die von Abwanderung
geplagte Dorfbevölkerung hofft auf
Investitionen und bessere Zeiten. Widerspenstige
Bauern werden charmant ausgebootet,
dann kommen die Bagger und
stampfen ein Luxusresort für den internationalen
Jetset aus dem Boden. Über
mehrere Jahre begleitete der Regisseur
die Umwandlung von Andermatt in ein
„Ferienparadies“.
Die Kapitalisierung der Bergwelt
Andermatt - Global Village
Dauer: 85 Min. – Land: D/CH 2015
Regie: Leonidas Bieri
Co-Regie: Robin Burgauer
Das Schönherr Kino Schlanders zeigte im
Oktober „Andermatt - Global Village“ von
Leonidas Bieri. Der Film dokumentiert die
Umwandlung des Bergdorfes Andermatt in
ein „Ferienparadies“. Mitorganisiert hat
den Filmabend der Heimatpflegverband
Südtirol, Bezirk Vinschgau. Für Obmann
Franz Fliri ist der Film eine anschauliche
Warnung vor Fremdbestimmung durch Investoren.
KF: Der Film stellt auch
die Frage nach dem Risiko
im Falle eines Misserfolges…
Franz Fliri: Ja genau. Das ist der nächste
Grund, warum mit Fremdinvestoren sehr
vorsichtig umzugehen ist: Wenn`s nicht
klappt, dann sind diese weg und hinterlassen
einen Scherbenhaufen.
Franz Fliri
Kulturfenster: Warum zeigen Sie im Vinschgau
den Film über ein Investitonsobjekt
in der Schweiz?
Franz Fliri: Wir sind auch in Südtirol und im
Vinschgau vor den Gelüsten von Fremdinvestoren
nicht sicher. Das nimmt zwar
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=o0NjZjWpXyw
Nr. 06 | Dezember 2019 17
Aus Verband und Bezirken
Traditionelles Kulturgut braucht Förderung
Bei der Herbsttagung der Sachbearbeiter
standen heuer Fragen
rund um die grundsätzliche
Sinnhaftigkeit von Förderungen
im Mittelpunkt
460 bearbeitete Beitragsansuchen
für die Sanierung und
Wiedererrichtung von bäuerlichen
Kleindenkmälern (Holzzäune,
Schindeldächer, Trockensteinmauern
etc.) im Jahr 2019
und rund 1,2 Millionen Euro an
Beiträgen: Dies ist die erfreuliche
Bilanz, die Verbandsgeschäftsführer
Josef Oberhofer
unlängst bei der alljährlichen Herbsttagung
der Sachbearbeiter präsentieren konnte.
Das Treffen fand heuer im Bersntol (Fersental),
in Garait (Gereut), statt. Zuvor besuchten
die 15 Sachbearbeiter im Heimatpflegeverband
das Bersntoler Kulturinstitut
und besichtigten den als Schaumuseum
sanierten Filzerhof.
Die deutsche Sprachinsel Bersntol hatte
auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg einen
schweren Stand. Wie von vielen anderen
Minderheiten bekannt, wurde auch
das Bersentolerische nicht als Bereicherung
gesehen, sondern vielfach als Makel,
der in einer modernen Welt nur den Fortschritt
behinderte. In den Familien wurde
die traditionsreiche Sprache immer weniger
gesprochen, um dem Nachwuchs durch
die bessere Erlernung der Mehrheitssprache
– scheinbar – mehr Chancen im Leben
zu eröffnen. Das Bersntolerische drohte –
zusammen mit dem ganzen zugehörigen
Kulturerbe – zu verschwinden. Erst mit
der Änderung der öffentlichen Kulturpolitik
im Trentino ab Mitte der 1980er Jahre
ging es wieder aufwärts. Das Bersntoler
Kulturinstitut wurde gegründet und wird
seither angemessen gefördert. Dazu gehört
auch, dass im Fernsehen Nachrichten
auf Bersntolerisch ausgestrahlt werden
und eine eigene Zeitschrift herausgegeben
wird. Seit einigen Jahren wird Bersntolerisch
sogar in den Schulen unterrichtet.
Heute sprechen die meisten Bersntoler
wieder selbstbewusst ihre Sprache, die in
allen Bereichen des öffentlichen und privaten
Lebens fix etabliert ist.
Die Geschichte der Bersntoler in den letzten
Jahrzehnten macht deutlich, wie wichtig
die öffentliche Förderung und Wertschätzung
für das immaterielle, aber vor allem
auch das materielle Kulturerbe ist. Aus
den Erfahrungen der Bersntoler
ließen sich viele Parallelen zu der
Förderung der bäuerlichen Kleindenkmäler
in Südtirol ziehen, so
der Konsens bei der Diskussion
in Garait. Auch bei der Sanierung
und Wiedererrichtung von Holzzäunen,
Schindeldächern, Trockensteinmauern
etc. geht es nicht um
kosmetische Eingriffe für eine touristische
Scheinwelt, sondern um
eine selbstbewusst gelebte Kultur.
Eine moderne Gesellschaft profitiert
mehr von der Förderung traditioneller
Kulturtechniken, als durch
kurzfristig gedachte Rationalisierung. Die
kapillare Förderung von bäuerlichen Kleindenkmälern
in ganz Südtirol ist deshalb ein
erfolgreicher Gegenentwurf zur Musealisierung
von längst nicht mehr gelebter Kultur
in wenigen Beispielgebieten.
Landesobfrau Claudia Plaikner, die am
diesjährigen Treffen teilgenommen hat,
dankte den Sachbearbeitern für ihre wertvolle
Tätigkeit zur Erhaltung und Aufwertung
des traditionellen Landschaftsbildes und der
Landesverwaltung, insbesondere der Abteilung
Natur, Landschaft und Raumentwicklung,
für die gute Zusammenarbeit. Sie betonte
abschließend, dass es ihr ein großes
Anliegen ist, mit dieser Aktion keine Landschaftskosmetik
betreiben zu wollen, sondern
eine Tradition zu pflegen und weiterzuführen.
Dies soll selbstverständlich im
Einvernehmen mit den Menschen geschehen,
die die Objekte pflegen und erhalten.
In der Gemeinde Stilfs gibt es keine funktionierende
Mühle mehr. In der Nähe der
Höfegruppe Vallatsches befindet sich aber
noch eine Mühle in einem relativ guten
Zustand, die sich eignen würde, dass sie
saniert wird und damit der Allgemeinheit,
z.B. durch Führungen mit Schaumahlen für
Schulen, Interessierte, Touristen usw. zugänglich
gemacht wird.
Diese „Alte Mühle“ ist eine Interessentschaftsmühle
mit fünf Besitzern, zu welchen
auch die Eigenverwaltung B.N.R.
Mühle retten! Geld ist da!
der Gemeinde Stilfs gehört. Dem Einsatz
des Ortsbeauftragten des Heimatpflegeverbandes,
Roland Angerer, ist es zu verdanken,
dass alle fünf Besitzer sich bereit
erklärt haben, an „ihrer Mühle“ Sanierungsarbeiten
durchführen zu lassen.
Die Projektunterlagen sind seit einiger
Zeit erstellt. Mit den Sanierungsarbeiten
müsste unmittelbar begonnen werden, da
ansonsten die bereitstehenden Geldbeträge
vom Nationalpark Stilfserjoch und von
der Eigenverwaltung B.N.R der Gemeinde
Stilfs verfallen würden. Der Heimatpflegeverband
Südtirol ruft daher die Eigenverwaltung
B.N.R der Gemeinde Stilfs als
Projektträgerin dringend auf, mit den Sanierungsarbeiten
unmittelbar zu beginnen.
Mühle Vallatsches
18
KulturFenster
Heimatpflege
•Büchertisch•
Reinhold Stecher – Herausgegeben von Paul Ladurner
Der blaue Himmel trügt
Erinnerungen an Diktatur und Krieg – Mit Aquarellen und Zeichnungen des Autors
Erinnern – gedenken – mahnen
Wie Bischof Reinhold Stecher die NS-
Diktatur und den Krieg erlebt hat
Achtzig Jahre nach dem Beginn des
Zweiten Weltkriegs ist und bleibt es geboten,
die Erinnerung an die Gräuel und
die Folgen des nationalsozialistischen
Terrorregimes wach zu halten. Bischof
Reinhold Stecher hat das als Zeitzeuge
dieser „unseligen Zeit, die kein Altgold
heroischer Verklärung verdient“, immer
wieder mahnend getan.
Dieses Buch spannt den Bogen von der
Programnacht des 9./10. November
1938 in Innsbruck bis zur Rückkehr Stechers
nach Österreich im Herbst 1945.
1941 wurde er von der Gestapo verhaftet,
1942 als Funker eines Gebirgsjäger-
Regiments bei Ramuschewo (Russland)
verletzt und 1943 an der fi nnisch-russischen
Grenze eingesetzt, ehe er nach
tausenden Kilometern Rückzug im Fjord
von Trondheim (Norwegen) das Kriegsende
erleben durfte. In Stechers Erinnerungen
reicht, wie er schreibt, „die Skala
der wechselnden Gefühle von Entsetzen
und Zorn über kritisches Bedenken
und ehrfurchtsvoller Verneigung bis zur
hoffnungsvollen Veränderung mit dem
Blick auf die Verwirklichung einer Zivilisation
der Liebe“. So sind seine kurzen
Geschichten und Gedanken – typisch für
ihn – oft herzergreifend und demaskierend,
aber auch voller Hoffnung und immer wieder
gemildert von einer Portion unverwüstlichen
Humors, getragen von seiner Liebe
zu Mensch und Natur und seiner Zuversicht
auf eine göttliche Vorsehung.
Illustriert ist das Buch mit dem eindrucksvollen
Aquarell-Zyklus „14 Stationen 1938-
1945“ des Malers Reinhold Stecher
160 Seiten, 16 farb. Abb. und 3 sw.
Zeichnungen, 15 x 22,5 cm, gebunden
mit Schutzumschlag, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien
2018, 19,95 Euro (Auch
als E-Book erhältlich)
Der Autor:
REINHOLD STECHER (1921–2013) war
von 1981 bis 1997 Bischof seiner Heimatstadt
Innsbruck. Er hat das kirchliche
und gesellschaftliche Leben in Tirol über
Jahrzehnte mitgestaltet und sich stets
für ein Klima der Toleranz und des Dialogs
eingesetzt. Auch mit seinen Büchern
und Bildern hat Bischof Stecher
vielen Menschen Hoffnung geschenkt
und sozial-karitative Projekte unterstützt.
Die CD zum Buch
Dieses Hörbuch ergänzt die Lesungen
von Bischof Stecher aus seinem Buch
„Der blaue Himmel trügt“ durch ein
Interview mit ihm über sein Erleben.
Reinhold Stecher liest, eingeleitet von
Peter Jungmann mit Musik von Peter
Ratzenbeck. Herausgegeben von Paul
Ladurner und dem Bischof-Stecher-Gedächtnisverein
67:20 Minuten, Tyrolia-
Verlag, Innsbruck-Wien 2019, 14,95 Euro
Reinhold Stecher
Bildkalender 2020
Ausblicke und Einblicke
Bischof Stecher aquarelliert in leuchtenden Farben stimmungsvolle Landschaften;
Berge, Sonne und Wasser sind dabei seine bevorzugten Motive. Auf den Kalenderblättern
deuten hintergründige Gedanken aus Literatur und Spiritualität die Bilder
und führen den Betrachter weiter. So ist dieser Kalender ein ansprechend-besinnlicher
Wegbegleiter durch das Jahr.
Reinhold Stecher, 2019 Tyrolia, 15 Seiten,
13 farb. Abb. (Aquarelle), 2 cm x 34 cm, 22.95 EUR
Nr. 06 | Dezember 2019 19
Arge Lebendige Tracht
Die Pfoat
Uralter Bestandteil der Männertracht
Zwei Formen von Pfoaten
Heute noch unterscheiden wir grundsätzlich
zwei Formen von Pfoaten: die nach altem
Schnitt ohne Kragen und die neuere
Form mit Umlegekragen. Die ältere Form
ist kragenlos, mit einem kleinen Bündchen
am Hals, das mit einem Haftl geschlossen
wird. Vorne ist ein Schlitz, damit man sich
die Pfoat über den Kopf ziehen kann. Erst
um die Mitte des 19. Jahrhunderts kam
die neuere Form mit dem Umlegekragen
und dem Verschluss mit Knöpfen auf. Um
1900 wird damit begonnen, den Hemdkragen
mit Hexenstich, Beinchenstich, Blümchenmuster
in den Ecken oder Hohlsaum
zu verzieren.
Pustertal: Pfoat mit Umlegekragen
Der Pfoat, also dem Hemd, wird bei der Männertracht
oft zu wenig Beachtung geschenkt.
Wer weiß schon, dass gerade dieses Trachtenteil
eine uralte Geschichte aufzuweisen
hat. Aus einem ursprünglich strapazierfähigen,
groben Arbeitskittel wurde im Laufe
der Geschichte ein feiner, schneidertechnisch
interessanter Bestandteil unserer
Männertrachten.
Woher kommt das Wort „Pfóat“
Hans Fink (1912-2003), der unvergessene
Volkskundler aus Brixen, ist dem Ausdruck
Pfoat nachgegangen und hat dabei herausgefunden,
dass das Wort in Kleinasien als
baitá seinen Ursprung hat. Aus dem Griechischen
baité (=Hirtenrock) wurde dann
im Gotischen paida, und schließlich pfeid.
Wer Hemden schneiderte, war ein Pfeidler.
Das einfache Volk trug ursprünglich keine
Unterwäsche. Als Pfoat bezeichnete man
das Oberkleid. Erst als Leibwäsche üblich
wurde, meinte man mit Pfoat unser heutiges
Trachtenhemd.
Unterschiede in Material
und Schnitt
Ursprünglich hingen Material und Schnitt
einer Pfoat vom jeweiligen gesellschaftlichen
Stand des Trägers ab. Rupfene, werchene
oder harbene Leinenpfoaten trug der arme
Mann, solche aus feinem Leinen oder Seide
trugen hingegen die wohlhabenden Leute.
Der Arbeitskittel war weit geschnitten, um
möglichst viel Bewegungsfreiheit zu haben.
Auch reichte er fast bis zum Knie.
Ritten: rote Hohlsaumverzieung
Prachtstück Pfoat
Heute werden Pfoaten am besten aus
Halbleinen oder fester Baumwolle genäht.
Reines Leinen ist zwar edel, wetzt sich aber
leicht ab. Typisch ist nach wie vor der weite
Schnitt mit Sattel, die bauschigen Ärmel
mit der reichen Fältelung an Achseln und
Ärmelbündchen. Empfohlen werden Perlmuttknöpfe.
Ein schönes Trachtenhemd hat
seinen Preis. Sauber und ordentlich gebügelt,
ist es aber auf jeden Fall ein Hingucker,
wenn Mann zur warmen Jahreszeit
hemdsärmelig geht.
Kutscher- und Hirtenhemden gehören nicht
zu unseren Trachten.
Agnes Andergassen
Gries: zarte Hexenstichstickerei
20
KulturFenster
Vorweg
Chorwesen
Großer Erfolg für die
Chöre Gesamttirols
Die 25 Chöre, die am 7. Gesamttiroler Wertungssingen teilgenommen haben,
haben folgende Prädikate erhalten
Wie viele andere Chöre erhielt auch der Landesjugendchor
Südtirol das Prädikat „ausgezeichnet“.
Kategorie Pop-Jazz-Gospel – Klasse II
Prädikat sehr gut
Freizeitchor Radein (Chorleiter Günther Gurndin, Obmann Matthias Gurndin)
Kategorie A (leichte Chorliteratur)
Prädikat „mit Erfolg teilgenommen“
Oswald Milser Chor (Chorleiter Christian Wagner, Obmann Paul Ried)
Kammerchor der Tiroler Steuerberater (Chorleiterin Nina Redlich, Obmann Klaus Hilber)
Prädikat „mit gutem Erfolg teilgenommen“
Kirchenchor „St. Wolfgang“ Radein (Chorleiter Matthias Gurndin, Obmann Günther Gurndin)
Männerchor Terfens (Chorleiter Gottfried Köchler, Obmann Ludwig Klingler)
Kirchenchor Tulfes (Chorleiter Wilhelm Ghetta, Obmann Ludwig Kössler)
Nr. 06 | Dezember 2019 21
Vorweg
Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“
Mandochor Ehrenburg (Chorleiterin Maria Elisabeth Brunner, Obmann Stefan Brunner)
Gemischer Chor Schmirn (Chorleiterin Bernadette Eller, Obfrau Claudia Wessiack)
Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“
Kirchenchor St. Margareth/Schabs (Chorleiterin Angela Palfrader, Obfrau Petra Jobstreibizer)
Kategorie B (mittelschwere Chorliteratur)
Prädikat „mit gutem Erfolg teilgenommen“
Männerchor Stegen (Chorleiter Paul Denicoló, Obmann Albin Pramstaller)
Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“
Ensemble „vox jubilans“ Riffian (Chorleiter Hans Schmidhammer, Obmann Anton Gögele)
Kirchenchor Auer (Chorleiter Matthias Mayr, Obmann Lorenz Amplatz)
Männergesangsverein Liederkranz Telfs (Chorleiter Michael Gerhold, Obmann Walter Maierhofer)
Chor „daChor“ Niederau (Chorleiterin Annemarie Eder, Obmann Thomas Naschberger)
Chorwerkstatt Telfs (Chorleiter Viktor Schellhorn, Obmann Roland Pfeifer)
Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“
Frauensinggruppe „vox jubilans“ Riffian (Chorleiter Hans Schmidhammer, Obfrau Katalin Schmidhammer)
Kirchenchor „St. Oswald“ Mauls (Chorleiter Wolfgang Girtler, Obfrau Priska Forer)
4teenFrauen Toblach (Chorleiterin Annelies Oberschmied, Obmann Josef Feichter)
Chor CHORrekt Hintertux/Achensee (Chorleiter und Obmann Thomas Walder)
Chor St. Marien, Lienz (Chorleiter und Obmann Alois Lorenz Wendlinger)
Kategorie C (anspruchsvolle Chorliteratur)
Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg teilgenommen“
Cor Sasslong Gröden (Chorleiter Samuel Runggaldier, Obmann Lukas Perathoner)
Frauenchor Gaudium Gröden (Chorleiter Sebald Goller, Obfrau Margot Demetz)
brummnet – der Männerchor Bruneck (Chorleiter/in Clara Sattler/Johannes van der Sandt, Obmann Sieghard Amhof)
Landesjugendchor Südtirol (Chorleiter Johannes van der Sandt)
Tiroler Landesjugendchor (Chorleiter und Obmann Oliver Felipe Armas)
Landesjugendchor Tirol
22
KulturFenster
Das Thema
Chorwesen
Tiroler Chorkultur auf
höchstem Niveau
7. Gesamttiroler Wertungssingen in Auer war wieder ein Erfolg
Frauenchor Gaudium
Gemischter Chor Schmirn aus Tirol
Im Interview Landesrat Philipp Achammer
mit Moderatorin Sigrun Falkensteiner.
„Gesamttirol kann unglaublich stolz sein auf
das Niveau seiner Chöre!“ Mit diesem Satz
brachte Juryvorsitzender Jürgen Faßbender
den Erfolg des Wertungssingens und der Tiroler
Chorkultur auf den Punkt.
Mit einem Festakt und der Verleihung
der Diplome in der Aula Magna von Auer
endete am 10. November das 7. Gesamttiroler
Wertungssingen, das der Tiroler Sängerbund
und der Südtiroler Chorverband
organisiert hatten. 25 Chöre aus Nord-,
Ost- und Südtirol hatten sich am Samstag
und am Sonntag dem Urteil einer hochkarätigen
Jury gestellt. Dabei kamen 14
Chöre aus Südtirol und elf aus dem Bundesland
Tirol zusammen. Sie sangen dabei
ein Pflichtlied und selbst gewählte Lieder.
Die Jury bewertete die technische und die
künstlerische Ausführung sowie die Bühnenpräsenz.
Verbandsobmann Erich Deltedesco
betonte die Ziele des Wertungssingens:
„Chöre bereiten sich auf ein
Wertungssingen besonders sorgfältig vor
und in dieser Vorbereitung liegt der große
Wert einer solchen Initiative, denn es hat
schon einen Reiz sich mit anderen Chören
zu messen.“ Schlussendlich sei aber nicht
die Bewertung das Wichtigste, sondern das
was sich vorher und nachher im Chor tut.
Die Chöre sollten neue Literatur kennenlernen,
zu intensiver Chorarbeit motiviert
werden, voneinander lernen und nicht zuletzt
andere Chöre kennenlernen und die
Gemeinschaft im Singen zu erleben. „Besonders
wertvoll ist die schriftliche Rückmeldung
der Jury, die jedem Chor zugesendet
wird“, sagte der Obmann. Zur Jury
gehörten die Chorexperten Jürgen Faßbender
(Deutschland), Winnie Brückner
(Deutschland), Richter Grimbeek (Österreich)
und Hansruedi Kämpfen (Schweiz).
Lieder sind auch sprachliche
Kunstwerke!
Beim Festakt betonte der Juryvorsitzende
Jürgen Faßbender, dass die Chöre den Juroren
„große Freude“ bereitet hatten. „Die
Chöre der Kategorie anspruchsvolle Chorliteratur
würden etwa bei Wettbewerben weltweit
hervorragend abschneiden!“ Besonders
bewundert hätten die Juroren die Kirchenchöre,
die neben ihrer Aufgabe beim Gottesdienst
sich die Zeit genommen hätten,
sich auf das Wertungssingen vorzubereiten
und so gute Ergebnisse erzielt hätten.
Faßbender lobte aber auch die hervorragende
Organisation der Veranstaltung, die
auf jeden Fall „das Prädikat ausgezeichnet“
verdient. Die Juroren hätten sich sehr
wohl gefühlt. Bei der Bewertung habe es
nie Unstimmigkeiten oder größere Debatten
gegeben: „Die Bewertungen sind also
ein repräsentatives Ergebnis.“ Faßbender
betonte, dass die Jury die ganze Skala an
Prädikaten genutzt habe: „Alle mit sehr gut
zu bewerten wäre sinnlos.“ Die Jury habe
sich große Mühe bei der Punktevergabe
gegeben. Innerhalb der Prädikate gebe es
durchaus unterschiedliche Punktezahlen.
Die Punkte wurden bei der Diplomverleihung
nicht bekannt gegeben, doch natürlich
erfährt sie jeder Chor. Faßbender gab
den Chören als Ergebnis des Wertungssingens
mit, dass sie mehr die Möglichkeiten
nutzen sollten, neue Literatur zu suchen
und kennenzulernen. „Es ist noch nie so
einfach gewesen, neue Literatur zu finden“,
sagte der Juror und erinnerte an die Möglichkeiten
im Internet. Der Chorleiter dürfe
mit der Literatur den Chor nicht überfordern,
sehr wohl aber fordern. Es sollten
nicht die immer gleichen Lieder aus der
Mottenkiste geholt werden: „Machen Sie
Nr. 06 | Dezember 2019 23
Das Thema
uns neugierig mit neuen Stücken, die niemand
kennt. Überraschen Sie uns!“ Besonders
hob er hervor, dass jedes Lied auch
ein sprachliches Kunstwerk ist: „Der Chor
muss nicht nur die Musik, sondern auch
die sprachlichen Regeln umsetzen, Aussprache,
Phrasierung und Deklamation
gehören wesentlich zu einem gelungenen
Vortrag dazu.“ So sei es wichtig, dass die
Sängerinnen und Sänger nicht Buchstaben
oder Wörter, sondern ganze Sätze singen.
Verbandsobmann Erich Deltedesco
dankte allen Chören für ihren Einsatz und
die Teilnahme am Wertungssingen. Insgesamt
erhielten von den 25 Chören elf das
Prädikat ausgezeichnet und acht das Prädikat
sehr gut. Unter den Zuhörerinnen und
Zuhörern gesellten sich auch auch Landesrat
Philipp Achammer und Tirols Landesrat
für Traditionswesen, Johannes Tratter,
die von Moderatorin Sigrun Falkensteiner
interviewt wurden. Beide erzählten von ihren
Erfahrungen mit dem Chorgesang und
der Musik. So bezeichnete sich etwa Landesrat
Philipp Achammer als „Sänger im
Wartestand“. Achammer dankte den Chören
und bezog sich auf ein altes Sprichwort,
dass Musik es schaffen würde, „der
Bevölkerung den Staub von der Seele zu
wischen“. Er wies auf die verbindenden
Elemente zwischen den drei Tiroler Landesteilen
hin. Der Bürgermeister von Auer,
Roland Pichler, zeigte sich in seinen Grußworten
geehrt, dass der Chorverband Auer
als Austragungsort für diese wichtige Veranstaltung
ausgewählt hat. Musikalisch
umrahmt wurde der Festakt vom Posaunenquartett
SonOro aus Kaltern, dem Vokalensemble
Viva Voce aus Innsbruck und
dem Vokalensemble AllaBreve aus Brixen.
Der Festakt schloss mit dem gemeinsamen
Schlusslied „I sing mei Liadl“ unter der
Leitung von Verbandschorleiterin Renater
Unterthiner.
„vox jubilans“ aus Riffian
Das Vokalensemble AllaBreve aus Brixen umrahmte unter der Leitung von Nataliya
Lukina den Festakt des 7. Gesamttiroler Wertungssingens.
brummnet – der Männerchor
Ein Schmuckstück der Tiroler
Chorkultur“ nannte Sigrun Falkensteiner
den Chor Viva Voce aus Innsbruck, der
ebenfalls den Festakt umrahmte.
Cor Sasslong aus Gröden
Verbandsobmann Erich Deltedesco
betonte, dass das Wertungssingen vor
allem eine nachhaltige Wirkung für den
Chor hat.
24
KulturFenster
Aus Verband & Bezirken
Chorwesen
Ein Haus voll Glorie schauet
Konzert in Memoriam Willi Tschenett
„Ein Haus voll Glorie schauet“ - Unter diesem
Titel stand das geistliche Konzert in Memoriam
Willi Tschenett, das vom Pfarrchor
und -orchester Kaltern am Sonntag, den 20.
Oktober 2019 in der Pfarrkirche Kaltern dargeboten
wurde.
Mit diesem Konzert wollte man vor allem
des langjährigen Chorleiters des Pfarrchores
Kaltern gedenken, der heuer im Sommer
unerwartet verstorben ist. Willi Tschenett
kam 1983 als Organist nach Kaltern und
übernahm auch bald den Pfarrchor, den er
bis 2001 leitete. Daraufhin wurde er zum
Ehrenchorleiter ernannt. Zu diesem Gedenkkonzert
hatten sich seine Frau Luise
Gallmetzer, viele Verwandte, Bekannte und
Freunde des ehemaligen Chorleiters eingefunden.
Die Kalterer Pfarrkirche war bis
auf den letzten Platz gefüllt. Robert Mur,
der den Pfarrchor seit dem Jahr 2005 leitet,
hatte ein anspruchsvolles Konzertprogramm
zusammengestellt, das von
profunder Kenntnis der kirchenmusikalischen
Literatur zeugt. Zu Beginn ist es
Robert Mur durch das bekannte Kirchenlied
„Ein Haus voll Glorie schauet“ gelungen,
das gesamte Publikum aktiv in das
Kirchenkonzert einzubeziehen. Abwechselnd
zwischen Gemeinde und Chor, und
am Ende gemeinsam mit Gemeinde, Überund
Zusatzstimmen des Chores, des Orchesters
und der Orgel entwickelte sich
ein beeindruckendes Crescendo von der
ersten bis zur fünften Strophe mit einem
überaus klangkräftigen Abschluss.
Anschließend wurde den Zuhörern ein
seltenes, aber sehr ansprechendes Werk
des Tiroler Komponisten Matthäus Nagiller
(1815 - 1874) dargeboten. Dieser Komponist,
der sogar einige Jahre am Pariser
Konservatorium als Kompositionslehrer
tätig war, war auch in Südtirol tätig, bevor
er sich 1866 definitiv als Kapellmeister in
Innsbruck niederließ. Manfred Schneider
schreibt zu diesem Werk, nämlich zur Festmesse
in B-Dur, die übrigens dem Brixner
Fürstbischof Bernhard Galura gewidmet
ist, dass es „ein groß angelegtes, repräsentatives
Werk ist, das an der Tradition
der symphonischen Messe festhält“. Dies
Die Pfarrkirche von Kaltern war beim Gedenkkonzert bis auf den letzten Platz gefüllt.
merkt man gleich zu Beginn des Kyries, wo
das Orchester, mit Streichern und Bläsern
besetzt, mit zunehmender Intensität den
Einsatz des Chores vorbereitet. Die Besetzung
dieser Messe mit Soli, Chor und Orchester
lässt keine Wünsche übrig. Majestätisch
und schwungvoll präsentiert sich
das Gloria, farbig und durchsichtig in den
Solostimmen der Sängerinnen und Sänger
und der Instrumente; das Benediktus ruhig,
friedlich und erlösend das Agnus Dei.
Robert Mur gelang es hervorragend, dieses
romantische Werk mit den vielen schönen
Melodien sowohl in den Sängerstimmen
als auch in den Instrumentalpartien stilgerecht
wiederzugeben. Die dynamische
Bandbreite reichte vom engelhaften Piano
der Streicher am Beginn des Sanktus bis
zum grandiosen Fortissimo des Amens am
Schluss des Glorias.
Im Anschluss an diese Festmesse wurden
drei weitere Kompositionen aufgeführt,
die hierzulande noch kaum oder noch überhaupt
nicht zu hören waren, aber die es
auf alle Fälle verdienen, in unseren Kirchen
öfters aufgeführt zu werden.
Das Laudate Dominum ist ein Werk des
brasilianischen Komponisten José Maurício
Nunes Garcia. Nunes Garcia war ein
Zeitgenosse Mozarts und schrieb dieses
Werk 1813 in Rio de Janeiro. Es ist eines
jener Werke, die ob ihrer Offenheit, Freudigkeit
und Strahlungskraft auf Anhieb die
Herzen der Zuhörer erobern. Nach diesem
schwungvollen Werk folgte ein inniges Ave
Maria, das der Komponist August Duck
1843, zwei Jahre vor seinem Tode schrieb.
Man merkt an diesem Werke, dass sich
der Komponist Zeit seines Lebens für eine
echte, verinnerlichte Kirchenmusik zuerst
in Graz und dann in Wien als Nachfolger
von Ferdinand Schubert eingesetzt hat.
Als krönenden Abschluss hat Robert Mur
das Cantate Domino für Chor, Orchester
und Orgel des französischen Komponisten
Théodore Dubois ausgewählt. Es war ein
Wagnis, soweit auseinanderstehende Instrumente
wie die große Orgel auf der Empore
und das Orchester vorne im Kirchenschiff
zusammenspielen zu lassen. Aber
das Wagnis hat sich gelohnt. Die ganze Kirche
wurde von der glanzvollen Musik des
Lobgesanges erfüllt und die Zuhörerinnen
und Zuhörer konnten spüren, was die Bibel
meint, wenn im 150. Psalm steht: „
… lobt ihn mit dem Schall der Hörner, …
lobt ihn mit Pauken … lobt ihn mit Flöten
und Saitenspiel! Lobt ihn mit hellen Zimbeln
… Alles, was atmet, lobe den Herrn!“
Es war ein schöner Konzertabend und
ein würdiges Konzert in Memoriam des verstorbenen
Ehrenchorleiters Willi Tschenett.
Nr. 06 | Dezember 2019 25
Aus Verband und Bezirken
Abschieds- und Jubiläumskonzert
Chorleiter Rudi Chizzali verabschiedet sich nach 30 Jahren vom
Männerchor Neustift
Rudi Chizzali verabschiedet sich nach
30 Jahren vom Männerchor Neustift.
Zahlreiche Musik- und Chorbegeisterte aus
nah und fern waren am 5. Oktober 2019 in
die Stiftskirche von Neustift gekommen, um
einem geistlichen Konzert beizuwohnen. Es
war nicht nur das Jubiläumskonzert anlässlich
des 60-Jahr-Jubiläums des Männerchores
Neustift, sondern gleichzeitig die Abschiedsfeier
für den Chorleiter Rudi Chizzali.
Es war das Jahr 1988, als Rudi Chizzali
den Männerchor übernahm und ihn
dann, mit kurzer Unterbrechung, bis zum
Herbst 2019 leitete. In all den Jahren erlebte
der Chor viele Erfolge und unzählige
schöne Momente bei geistlichen und
weltlichen Konzerten, bei der Mitgestaltung
Heiliger Messen und beim Neustifter
Sternsingen, bei Singspielen und bei
Wettbewerben. Als einer von vielen Höhepunkten
gilt die Teilnahme am Internationalen
Schubert-Wettbewerb in Wien. Dabei
erreichte der Männerchor Neustift den
ersten Preis in der Kategorie „Männerchor“
und den Preis für die beste Schubertinterpretation.
Chizzalis Geduld
und pädagogische
Fähigkeiten kamen
dem Männerchor
stets zugute.
Es lag ihm
sehr am Herzen,
in den Chormitgliedern
Begeisterung
für das Singen
zu wecken und ihnen
eine Welt der
Musik zu eröffnen,
die von Freude und
Harmonie gekennzeichnet
ist. Zudem
war es ihm
immer wichtig, den
Sängerinnen und
Sängern mit Respekt
zu begegnen.
Rudi Chizzali
wurde 1944 in Welschellen
geboren.
Nach der Matura am Vinzentinum studierte
er Theologie, dann absolvierte er
ein Gesangsstudium am Bozner Konservatorium,
das er mit Auszeichnung abschloss.
Anschließend sang er als Opernsänger
an der Bayerischen Staatsoper und
an den Städtischen Bühnen in Freiburg
im Breisgau. Im Jahre 1988 kehrte er
nach Südtirol zurück, wo er u.a. die musikalische
Leitung des Vinzentiner Knabenchores
und des Männerchores Neustift
übernahm. Gemeinsam mit Konrad
Bergmeister gründete er im Jahre 2007
die Neustifter Singschule. Rudi Chizzali
leitet auch erfolgreich den Stiftschor Neustift
und ist landesweit für seine Kantorenund
Lektorenschulungen sowie für seine
Stimmbildungskurse bekannt.
Das Abschiedskonzert wurde zu einer
bewegenden und gleichzeitig gelungenen
Feier, bei der im anschließenden gemütlichen
Beisammensein Rudi Chizzalis Arbeit
gewürdigt wurde. Als Dank für sein
langjähriges Wirken als Chorleiter über-
Der neue Chorleiter Benedikt Baldauf
reichte Chorobmann Luis Habicher Chizzali
einen Blumenstrauß und einen Gutschein
für eine mehrtägige Fahrt nach
Hamburg mit Eintrittskarten für ein Konzert
in der Elbphilharmonie. Die Chormitglieder
Walter Niederstätter und Sepp
Mulser trugen für den scheidenden Chorleiter
unterhaltsame Anekdoten über die
gemeinsam verbrachten 30 Jahre vor.
Auch Rudi Chizzali ließ noch einmal
das Revue passieren, was ihn in dieser
Zeit besonders gefreut hat, und dankte
allen Menschen, die ihn dabei unterstützt
und begleitet haben. Er hob besonders
die gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Chorausschüssen und deren Obleuten
hervor. Ein letztes Mal sang der Männerchor
Neustift unter seiner Führung in
geselliger Runde u.a. die Lieder „Harmonie“,
„I hon di gern“ und „In Mondes
Schimmer“.
Der Männerchor Neustift spricht Rudi
Chizzali einen aufrichtigen Dank für sein
menschliches und professionelles Wirken
im Dienste des Vereines aus.
Nachfolger von Rudi Chizzali als Chorleiter
ist der 29-jährige studierte Kirchenmusiker
Benedikt Baldauf.
26
KulturFenster
Chorwesen
35 Jahre Ultner Bänkelsänger
Die Sänger aus Ulten halten Rückblick
Die Ultner Bänkelsänger können auf ein reiches Wirken zurückblicken und sind ein fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in Ulten.
Zu unserem 35-jährigen Jubiläum möchten
wir eine kleine Rückschau unserer Tätigkeit
halten. In all den Jahren, von den Anfängen
1984 bis herauf in unseren Tagen, sind so
viele Tätigkeiten bzw. Veranstaltungen zusammengekommen,
von denen es einige
vielleicht verdienen, noch einmal aus der
Vergangenheit in Erinnerung gerufen bzw.
erwähnt zu werden.
Die Freude am Singen hat uns zusammengeführt.
Unser Ziel war und ist es, unseren
Mitmenschen durch unsere Konzerte
und musikalischen Darbietungen einige
heitere, fröhliche aber auch besinnliche
Stunden zu bieten. Höhepunkte unserer
Tätigkeit im Jahreslauf waren zweifelsohne
unsere Konzerte, meistens im Herbst. Ein
Tätigkeitsjahr ohne Höhepunkt (Konzert)
wäre wohl eine Wanderung ohne Ziel, „wia
a Bam ohne Blüa“ oder „wia a Brunn' ohne
Wosser“, wie es so treffend in einem bekannten
Lied heißt. Unser Chorleiter Franz
Marsoner versteht es immer wieder, gute
bekannte Musikantinnen und Musikanten
und Gruppen mit einzuladen; damit ist einerseits
für Abwechslung gesorgt und andererseits
wird es auch für uns nicht zu
viel. Singen, Musik, Theater und Showeinlagen
sind wesentliche Elemente unserer
Konzerte, wobei uns stets ein eingespieltes
Instrumentalistenteam und unsere Theatergruppe
St. Walburg gerne unterstützen.
So führten wir unser Publikum auf unseren
musikalischen Ausflügen einmal in
den Wilden Westen, in den Orient oder
nach Russland, Spanien und Brasilien.
Ein anderes Mal waren es Lieder aus bekannten
Operetten und Opern, deutsche
Volkslieder, Matrosenlieder... .
Mit unseren Weihnachtskonzerten am
Christtag (Heilitog) wollten wir, nachdem
der Hl. Abend im engen Familienkreise gefeiert
wird, das Fest der Liebe, der Freude
und des Friedens auch in einem größeren
Rahmen mit unserer Dorfgemeinschaft feiern:
Unter der Leitung von Peter Marsoner
haben wir uns zusammen mit Chören
unseres Tales an drei Gemeinschaftskonzerten
mit Orchesterbegleitung beteiligt.
So führten wir das Oratorium „Abschied
Jesu zu Bethanien“ im Jahre 2000 auf, gestalteten
ein Geistliches Konzert im Jahre
2005 und „Musik zu Allerseelen“ im Jahre
2009. Zu Allerheiligen 2018 haben wir ein
weiteres Gemeinschaftskonzert zusammen
mit der Niklaser Musi und mit Unterstützung
von Frauenstimmen des Gemischten
Chores St. Walburg, des Kirchenchores St.
Nikolaus und der Singgruppe Melos in St.
Walburg und in Marling aufgeführt. Unter
der Leitung von Prof. Richard J.Sigmund
haben wir Bänkelsänger uns auch an größere
Werke heran gewagt. Den Anfang dieser
Serie machte das Musical „Anatevka“,
in welchem wir Bänkelsänger eine Gasthausszene
zu bestreiten hatten, was uns
gar nicht so schwer fiel. Mit dem wohl anspruchvollsten
Werk, der Oper „Vinzenz und
Louise“ von Prof. Sigmund zum 350sten
Todestag dieser beiden Heiligen und Ordensgründer
der Barmherzigen Schwestern,
tourten wir 2010 durch Europa. Aufführungsorte
waren Paris, München, Zams,
Innsbruck, Linz, Graz und die Kapuzinerkirche
in Meran vor heimischem Publikum.
Nr. 06 | Dezember 2019 27
Aus Verband und Bezirken
Die Leidensgeschichte Jesu, das Oratorium
Passio, als Benefizkonzert „Lights of
Africa“ wurde 2015 bei uns in der Pfarrkirche
St.Walburg und in der Kapuzinerkirche
Meran aufgeführt.
Das letzte Werk aus der Feder von Prof.
Sigmund, an welchem wir Bänkelsänger
mitwirkten, trug den Titel „Im Zeichen des
Tau“ und ist eine musikalisch szenische
Reise durch 400 Jahre Kapuziner in Meran.
Es wird an das Leben und Wirken der Ordensbrüder
im Dienste der Kranken und in
der Seelsorge im Geiste des Hl. Franziskus
herauf durch die wechselvollen Ereignisse
(Kriege, Hungersnot, Pest...) der vergangenen
Jahrhunderte erinnert. Für uns Bänkelsänger
war dies eine besondere Erfahrung
und Herausforderung. In „Paterkuttn“ gehüllt
mussten wir uns der Buße und dem
Gebet widmen. Beim Überfall, Sturm auf
das Kloster 1806 durch die Bayern (das
Kloster sollte aufgehoben werden), wurde
Pater Albuin (Ivan Lösch) von einem Soldaten
als „Schtinketer Kuttnprunzer“ beschimpft.
Die rauhen Umgangstöne haben
sich leider bis in unsere Zeit herauf kaum
verändert. Eine Aufführung erfolgte im Raiffeisensaal
in St.Walburg, die andere natürlich
in der Kapuzinerkirche Meran, beide
im Oktober 2017.
Zu einem wahrlich bunten musikalischen
Blumenstrauß gestalteten sich die zwei
großen „Sängertreffen & Volkstanz“ in Kuppelwies
und Walburg, zu denen wir Nachbarchöre,
Chöre unseres Bezirkes und die
Volkstanzgruppe Ulten eingeladen haben.
Nachhaltige Zeugen unserer musikalischen
Tätigkeiten sind folgende drei Tonträger:
Ich kenn ein Tal (1994), Weihnachten bin
ich zu Haus (2004) und WWW Wild Wein
Weib (2014). Unsere Weihnachts-CD wurde
zum beliebtesten Tonträger, der in der eher
hektischen und lauten Advents- und Weihnachtszeit
wohl in sehr vielen Familien zu
Besinnlichkeit, Frieden und wahrer Freude
einlädt. Im Rundfunk RAI Sender Bozen
sind „Lieder in der Weihnachtszeit“ fast
täglich zu hören.
In bestimmten Zeitabständen zog es
uns Bänkelsänger auch hinaus in die
weite Welt. Die erste große Reise führte
uns 1998 nach Südafrika zur Missionsstation
Sizanani von P. Karl Kuppelwieser.
Weitere folgten nach Spanien (Barcelona),
nach Irland (2003) und auch nach Russland.
Mit unseren russischen Freunden
aus Petersburg haben wir 2014 zusammen
in St. Nikolaus ein Adventskonzert
und am Tag darauf in St. Walburg einen
Gemeinschaftsgottesdienst gestaltet. Seit
es uns gibt, ist die Mitgestaltung des Gottesdienstes
in St. Nikolaus am Stephanstag
(26. Dezember) ein fi xer Programmpunkt
unserer Tätigkeit. Der 8. Dezember,
Fest der Unbefleckten Empfängnis Marias,
ist seit 20 Jahren der Tag, an dem wir den
Gemeinschaftsgottesdienst in St. Walburg
mit adventlichen Weisen umrahmen und
anschließend in mehreren Gruppen von
Haus zu Haus ziehen, um Hoffnung und
Freude über die baldige Ankunft unseres
Erlösers zu verkünden. “Mei liabste Ultner
Weis“ ist unser jüngstes Projekt, mittlerweile
auch schon mit vier Auflagen. Diese
Veranstaltung ist der Sendung „Mei liabste
Weis“ von Franz Posch im ORF abgeschaut.
Die Idee dazu stammt von Dietmar
Staffler. Weil die mitwirkenden Gruppen
fast ausschließlich aus Ulten stammen, ist
der Titel in „Mei liabste Ultner Weis“ abgeändert
worden.
Unsere Gruppe ist in all den Jahren
recht kompakt geblieben. Einige haben
uns im Laufe der Zeit verlassen, andere
Jüngere sind wieder nachgerückt. Leider
sind zwei liebe Sängerkollegen für immer
von uns gegangen: Hubert Wallnöfer (gestorben
am 11.02.2017) und Rudolf Ties
(Förster Rudl, gestorben am 29.04.2018).
Ihre Stimmen sind für immer verstummt.
Sie, so hoffen wir, verstärken nun mit ihren
Stimmen den Himmelschor, bis auch
wir ihnen einst nachfolgen.
An dieser Stelle möchten wir allen unseren
Freunden und Gönnern für ihr Wohlwollen,
ihre Unterstützung und ihre Treue
von ganzem Herzen danken. Wir wollen
aber auch jenen danken, die die Einladungen
zu unseren Veranstaltungen stets
gerne angenommen haben. Ein aufrichtiger
Dank geht auch an unsere Gemeinde und
Raiffeisenkasse, die stets ein offenes Ohr
und eine offene Hand für unsere Anliegen
haben. Ein ganz besonderer Dank und ein
großes Lob gilt natürlich unserem Chorleiter
Franz Marsoner, dem die Ideen nie ausgehen
und der es immer wieder schafft, Jung
und Alt gleichermaßen zu begeistern. Für
seine Mühe, Plage, Geduld und Nachsicht
sagen wir ihm ein ganz großes Vergelt's Gott.
Wir hoffen und bitten, dass er uns weiterhin
als Chorleiter erhalten bleibt. Unsere
Obmänner Peter Preims, Hans Marsoner,
Ivan Lösch (jetziger Obmann), allen voran
Daniel Breitenberger und Martin Pircher,
verdienen ebenso einen ganz großen Dank
für ihren unermüdlichen Einsatz bei der
Organisation unserer Tätigkeiten. In allen
technischen Belangen ist unser Maurus unschlagbar.
Nicht zuletzt möchten wir auch
unseren Sponsoren für ihre Unterstützung
danken: Bierlieferant Engl, Kellerei Martini
& Sohn, DESPAR Kofler, ebenso auch Ultner
Brot für die großzügig gewährten Rabatte.
Zum Abschluss möchten wir noch auf
die zwei nächsten Veranstaltungen hinweisen.
Das ist einmal das Weihnachtskonzert
am Christtag, 25. Dezember 2019 (Heilitog)
und „Mei liabste Ultner Weis“ am 01.
Februar 2020. Alle sind wieder ganz herzlich
dazu eingeladen.
Für die Bänkelsänger: Karl Kainz
Chorleiter/in gesucht!
Der Kirchenchor St. Nikolaus/Afing sucht eine/n Chorleiter/in. Interessierte melden
sich bitte unter: helga.oberkofler@outlook.com oder Handy: 347 5793835
28
KulturFenster
Vorweg
Chorwesen Blasmusik
Auf ins neue Musikjahr 2020
Verbandsobmann
Pepi Fauster
So schnell ist
ein Jahr wieder
um, bald schreiben
wir 2020 in
unseren Daten.
Wenn wir an die
wichtigsten Ereignisse
des vergangenen Jahres zurückschauen,
fallen uns sofort die Neuwahlen
in den sechs Bezirksausschüssen
und im Verbandsvorstand ein, die die
immer größer werdenden Schwierigkeiten,
Menschen für die einzelnen -
meist ehrenamtlichen - Funktionen, zu
finden, zeigten.
Die neuen Datenschutzbestimmungen
mussten umgesetzt werden. Die Vorgaben
und Auflagen des neuen Gesetzes
im Dritten Sektor brachten einen zusätzlichen
großen bürokratischen Aufwand
und leider viel Unsicherheit. Diese ist
vom italienischen Gesetzgeber immer
noch nicht ausgeräumt, auch wenn die
Eintragung vorläufig bis Ende Juni 2020
verlängert wurde.
Zum Glück können wir auch auf Positives
und Schönes zurückblicken. Auf
die Online-Umfrage zum KulturFenster
haben erfreulicherweise ca. 2500 Mitglieder
geantwortet; die Ergebnisse werden
bald veröffentlicht. Die lang ersehnten Blasmusiksätze
zum neuen Gotteslob wurden
nun ausgeliefert und erfreuen sich großer
Beliebtheit. Im heurigen Jahr konnte an
zwei Musikanten das neue Ehrenzeichen
für 70-jährige Mitgliedschaft in der Musikkapelle
verliehen werden.
Nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass
unsere Musikkapellen und Ensembles wieder
bei ihren vielen mannigfaltigen Auftritten
– im In- und Ausland - gezeigt
haben, dass sie sich um ein niveauvolles
Musizieren und Auftreten sowie
um eine zukunftsorientierte Vereinsarbeit
bemühen.
Ich sage allen dafür meinen aufrichtigen
Dank und schätze das besondere Engagement
sehr. Für 2020 wünsche ich allen
viel Musizierfreude und Lust in der
musizierenden Gemeinschaft und freue
mich auf viel Neues und Interessantes.
Die schönsten Momente in der Musik
sind oft die ganz leisen
Verbandskapellmeister
Meinhard Windisch
„Die größten Ereignisse,
das sind
nicht unsere lautesten,
sondern unsere
stillsten Stunden.“
– Dieses Zitat von Friedrich Nietzsche
kann man wohl auch auf die Musik übertragen.
Die schönsten Momente in der
Musik sind oft die ganz leisen. Auch wir
befinden uns in der vorweihnachtlichen
Zeit. Wie heißt es da in einem Lied? „Das
ist die stillste Zeit im Jahr…..“ Die Realität:
Rummel auf den Weihnachtsmärkten,
überfüllte Straßen, gestresste Menschen
in den Einkaufszentren. Achten
wir mal ganz bewusst auf die leisen Stellen
in der Musik und vielleicht spüren wir
dann auch einen Hauch von Weihnachten,
wie es im Lied weiter heißt, „da treten
wir gerne in die Stube ein und rücken zusammen
bei Kerzen Schein … da macht
uns nicht Nacht und Winter mehr bang, im
Herzen hallt wieder der heimliche Klang“.
In diesem Sinne frohe Weihnachten und
ein gesegnetes neues Jahr.
Nr. 06 | Dezember 2019 29
Vorweg
Entscheidend ist die Passion zur Blasmusik
Verbandsjugendleiter
Hans Finatzer
Das Jahr neigt sich
dem Ende zu, die
stille Zeit hält in unseren
Gemütern,
Familien und im
öffentlichen Leben
Einzug. In dieser
Zeit sind Kinder und Jugendliche besonders
motiviert Musik zu machen, wenn es
darum geht, ein bekanntes Advent- oder
Weihnachtslied auf dem eigenen Instrument
nachzuspielen. Diese Zeit bietet auch
Jugendkapellen, Bläsergruppen und Registern
von Musikkapellen die Möglichkeit,
bei den verschiedenen Anlässen aufzutreten.
Gerade in der Weihnachtszeit steht die
Bläsermusik hoch im Kurs, die Gunst der
Stunde kann man als Jugendleiter*in geschickt
nutzen, mit den eigenen Jugendlichen
an verschiedenen Locations aufzutreten.
Der Notenmarkt bietet breitgestreute
Literatur von alpenländischen Weisen bis
hin zum fetzigen Jazzarrangement. Junge
Menschen suchen die Herausforderungund
sie suchen vor allem Anerkennung
und Genugtuung in der Musik.
Alle dies vereint das Musizieren, vor allem
das Gruppenmusizieren motiviert die jungen
Musikerinnen und Musiker oft am meisten.
Am 15. Februar 2020 organisiert der VSM
wieder in Auer den Wettbewerb „Spiel in
kleinen Gruppen“. Dieser Wettbewerb soll
kein Gradmesser der absoluten Qualität sein,
sondern in erster Linie der Förderung von
gepflegtem Ensemblespiel dienen. Wettbewerbe
sind punktuelle Momentaufnahmen,
wobei nur die kurze Zeit auf der Bühne bewertet
werden kann.
An einem Wettbewerbstag spielen neben der
guten Vorbereitung die Tagesverfassung eine
wichtige Rolle, welche dann und wann einen
Streich spielen kann. Aus gutem Grund kann
ein Prädikat niemals das widerspiegeln, was
ein Musiker wirklich imstande ist zu leisten.
Viele dieser Kompetenzen, ein Konzert oder
einen Wettbewerb optimal durchzustehen,
lassen sich bei einem der Module der neuen
Funktionärsausbildung aneignen. Die Palette
an Fortbildungsmöglichkeit des VSM ist breit
gefächert und kann gerne bei einem der zahlreich
angebotenen Module der neuen Funktionärsausbildung
erlernt und vertieft werden.
Entscheidend ist aber die Passion
zur Blasmusik, sie lässt Ideen sprießen
und tolle Projekte entstehen. In diesem
Sinne wünsche ich frohe Weihnachten
und ein erfülltes Jahr 2020 mit vielen guten
musikalischen Momenten.
Das Jugendblasorchester im
Haus Unterland, Neumarkt
Zum Jahresende
Verbandsstabführer
Klaus Fischnaller
Wieder neigt sich
ein Jahr dem Ende
zu. Mit diesem Vorweg
bedanke ich
mich bei euch Kapellen
für eure tollen
Auftritte, für das
Mitgestalten von weltlichen und kirchlichen
Festen, Jubiläen, Abschieden usw. – ja
überall wo Musik in Bewegung einfach
nicht fehlen darf und kann.
Besonders erfreut war ich über eure zahlreiche
Teilnahme bei unseren Fortbildungsangeboten.
Wir konnten in allen Bezirken
Stabführerfortbildungen abhalten; in toller
Erinnerung geblieben ist der lehrreiche
Vortrag mit Nora Mackh.
Hervorzuheben sind auch jene Kapellen,
welche sich einer Marschmusikbewertung
gestellt haben. Dies ist nicht selbstverständlich,
bedeutet es ja vermehrten
Marschierproben-Besuch. Ich bin mir jedoch
sicher, dass jede Beteiligung für die
Kapelle auch wiederum viel Motivation und
neuen Schwung bringt. Ein großes Lob an
alle Stabführer, welche mit viel Idealismus
vor einer Kapelle stehen. Werte Vereinsvorstände,
stellt euch hinter eure Stabführer
und unterstützt sie, wo ihr könnt. Für das
neue Jahr freue ich mich wieder auf eine
rege Beteiligung und eure Rückmeldungen.
Ich wünsche euch alles Liebe und habt
eine gute Zeit.
Die MK Prad am Stilfser Joch bei der Marschmusikbewertung 2019 in Latsch
30
KulturFenster
Das Thema
Blasmusik
Wie kann man der Musik in
Bewegung mehr Klang verleihen?
Grundsätzliche Anregungen von Kapellmeister Hermann Seiwald
Auch für die Marschmusik gilt: Jede Musikkapelle ist gut beraten, den eigenen Klang
„als Marke“ zu entwickeln (im Bild die Stadtmusikkapelle Glurns).
In meiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Kapellmeister der Bürgerkorpskapelle Hallein (Bundesland
Salzburg/Österreich) konnte ich zahlreiche Ideen zur Verbesserung des Gesamtklangs
beim Marschieren meiner Musikkapelle im Freien mehrmals erfolgreich umsetzen.
Mittlerweile sind im Bewusstsein der Musikantinnen
und Musikanten einzelne Probeninhalte
und Details auf dem Weg zum
besten gemeinsamen Klangergebnis fest
verankert: Marschproben im Freien gehören
zum fixen Probenplan im Jahreskreis
und werden konsequent weiterentwickelt
und ausgebaut.
Hermann Seiwald empfiehlt, dass Marschproben im Freien zum fixen Probenplan
im Jahreskreis gehören und konsequent weiterentwickelt sowie ausgebaut werden
sollten (im Bild die Bürgerkapelle Brixen bei einer Marschierprobe).
Jede Musikkapelle hat ihren individuellen
Klang, der sich aus Besetzung, der
Marschblockaufstellung, dem spieltechnischen
Niveau und anderen Faktoren ergibt.
Deshalb kann nicht nur von einem
Idealklang für eine Musikkapelle ausgegangen
werden. Es sollte immer spannend
und herausfordernd sein, den eigenen
Klang „als Marke“ zu entwickeln.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich
bei Musik in Bewegung für die Ausführenden
spezielle Situationen und Probleme
ergeben, die sich nicht vermeiden lassen.
Beim Spielen und Marschieren im
Freien müssen sich die Musikantinnen
und Musikanten auf die physikalischen
Gegebenheiten der Akustik anders einstellen
als im Proberaum oder auf der Konzertbühne.
Nachdem für die Ausbreitung
von Schallwellen die Beschaffenheit und
die Temperatur des Mediums wichtig sind,
breiten sich Schallwellen z.B. bei kälteren
Temperaturen im Freien viel langsamer
aus. Hinzu kommen beim Marschieren
ständig sich verändernde, reflektierende
Objekte: die freie Wiese wirkt als Schallschlucker,
beim Marschieren zwischen
Häuserfronten werden die Schallwellen
durch Reflexion, Absorption, Beugung
und Brechung beeinflusst.
Aufgrund dieser akustischen Bedingungen
im Freien wird von den Musikantinnen
und Musikanten beim Marschieren
und Spielen insgesamt körperlich und
spieltechnisch mehr Einsatz und Energie
gefordert als beim Spielen im Raum.
Durch das Gehen mit dem Instrument
ändern sich die Körperhaltung und das
Zusammenspiel der Muskulatur in Bezug
auf ihre Lockerheit und Flexibilität.
Dadurch ergeben sich Auswirkungen auf
die Bläser-Spieltechnik, vor allem bei den
Instrumenten in der Marschbegleitung:
durch angespannte Muskeln im Mund-,
Zungen- und Kehlkopfbereich erklingen
die mit gestauter Ausatemluft erzeugten
Töne oft zu kurz und bedingen einen
Nr. 06 | Dezember 2019 31
Das Thema
Funktionen zu berücksichtigen: Melodie,
Begleitung und Schlagwerk.
Im Vordergrund sollte dabei stehen,
dass möglichst viele Musikantinnen und
Musikanten beim Spielen die Melodie hören
und mitverfolgen können.
Ebenfalls sind die Positionen des Begleitapparats
mit Tuba-, Horn- und Posaunenregister
so festzulegen, dass ihre
Aufstellung in geringer Entfernung bestmögliche
Bedingungen für das Zusammen-Hören
schafft.
Für das Schlagwerk gilt: Je besser das
Register als Schlagwerkgruppe trainiert ist
und als Einheit selbständig auftritt, desto
verlässlicher kann es das ganze Blasorchester
in Hinblick auf gleichbleibendes
Tempo und Rhythmik beim Marschieren
unterstützen.
Hinsichtlich der Klangverbesserung ist die Marschblockaufstellung ein wichtiges
Thema (im Bild die Musikkapelle Vahrn beim Landesmusikfest 2015).
spröden Gesamtklang in der Marschbegleitung.
Dabei stimmt das Verhältnis zwischen
Luftdruck und Luftmenge nicht:
mit zu viel Druck gelangt zu wenig Luft
in das Instrument.
Das Ziel sollte aber sein, viel Luftmenge
in das Instrument zu bringen, denn nur
so kann ein Ton zum Klingen gebracht
werden. Die Auseinandersetzung mit
von mir entwickelten Übungstechniken,
z.B. für das Zusammenspiel zwischen
Zunge und Luftführung, kann ein schöneres
Klangergebnis speziell für die Begleitstimmen
ergeben.
Zur Klangverbesserung ist das Thema
Marschblockaufstellung ein sehr wichtiger
Teil. Vergleicht man die Orchesteraufstellung
auf der Konzertbühne und die
Marschblockaufstellung im Freien, gibt
es eigentlich wenige Gemeinsamkeiten.
Meiner Meinung nach sind bei einer
optimalen Marschblockaufstellung drei
Weiters gilt es folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Ansatz und Atmung
• Spielen in Koordination mit der Bewegung
• Marschliteratur: Arrangement und Instrumentation
von Märschen in Hinblick
auf den Klang im Freien, unterschiedliche
Schwierigkeitsstufen
• Qualität und Ausstattung der Marschbücher,
Marschbuchhalterung auf
dem Instrument
• Probenkonzept zum Thema „Marschliteratur
und Straßenmarsch“ in der
Jahresplanung und Qualität der Probenarbeit
Neue Ideen machen die Musik in Bewegung auch für die Jugend interessant –
im Bild die „Afinger Jungdudler“.
Dem Schlagzeugregister kommt
bei der Musik in Bewegung eine
bedeutende Rolle zu; deshalb fordert
Hermann Seiwald eine gut trainierte
Schlagwerkgruppe, die als Einheit auftritt
(im Bild oben das Schlagzeugregister bei
einer Stabführertagung)
32
KulturFenster
Blasmusik
Musik in Bewegung kann auf verschiedene Weise durchaus auch „kreativ“ gestaltet werden, wie die Musikkapelle Rodeneck zeigt.
„Ich freue mich darauf, als Referent auf Einladung des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen beim Workshop im Mai 2020 mein Grundkonzept und meine
Ideen zum Thema „Musik in Bewegung Klang verleihen“ an viele interessierte
Kapellmeisterinnen und Kapellmeister, Stabführerinnen und Stabführer und
Musikantinnen und Musikanten weitergeben zu dürfen!“
Zum Autor:
Hermann Seiwald
Hallein/Österreich, Jahrgang 1971
• Studium Konzertfach Trompete an der Hochschule Mozarteum/Salzburg
sowie an der Bruckner-Universität/Linz
• Seit 1993 Unterrichtstätigkeit am Musikum Salzburg als Lehrer im Fach
Trompete und Flügelhorn
• Studium der Blasorchesterleitung am Landeskonservatorium/Innsbruck
• Seit 2001 Kapellmeister der Bürgerkorpskapelle Hallein/Salzburg
• Tätigkeit als Bezirkskapellmeister für den Salzburger Blasmusikverband
im Tennengau sowie als Referent bei Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen
KulturFenster
Redaktion KulturFenster
Ihre Beiträge (Texte und Bilder) für die Blasmusikseiten senden Sie bitte an: kulturfenster@vsm.bz.it
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des KulturFensters ist Freitag, 17. Januar 2020.
Nr. 06 | Dezember 2019 33
Aus Verband und Bezirken
Die Freude am Musizieren wecken
6. Südtiroler Dirigenten-Werkstatt mit Walter Ratzek
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der 6. Südtiroler Dirigenten-Werkstatt in
Bruneck – in der 1. Reihe die sechs aktiven Teilnehmer mit dem Gastreferenten
Walter Ratzek (Bildmitte)
Mit sechs der Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer hat er am Dirigentenpult
gearbeitet und in Lehrproben mit den Musikkapellen
von St. Georgen und Stegen
das zuvor in der Theorie Gesagte in der
Praxis aufgezeigt. VSM-Verbandskapellmeister
Meinhard Windisch freute sich
über die rege Teilnahme an diesem Kursangebot
des Verbandes. Es sei wichtig,
dass sich die Kapellmeisterinnen und Kapellmeister
untereinander vernetzen und
regelmäßig treffen, denn „wir alle gemeinsam
sind das Kapellmeister-Team
Südtirols“. Er dankte auch den beiden
Übungskapellen, dass sie sich für diese
aufwändigen und intensiven Lehrproben
zur Verfügung gestellt haben. Jeder Musiker
habe jederzeit sein Instrument zur
Hand, um zu üben: „Der Kapellmeister
hingegen sei auf ein Orchester angewiesen,
mit dem er üben kann!“
Bereits zum 6. Mal hat der Verband Südtiroler
Musikkapellen (VSM) zur Dirigentenwerkstatt
mit einem renommierten Fachmann
geladen. 21 Kapellmeisterinnen und
Kapellmeister haben daran teilgenommen
und mit dem heurigen Gastreferenten Walter
Ratzek die verschiedenen musikalischen,
psychologischen, physikalischen und organisatorischen
Aspekte der Arbeit eines Dirigenten
analysiert.
Die Freude am gemeinsamen Musizieren
stehe an oberster Stelle, unterstreicht
Walter Ratzek seine Philosophie. Er ist Pianist,
war jahrelang Leiter des Musikkorps
der Deutschen Bundeswehr und ist derzeit
Professor am Konservatorium in Bozen für
den Studienlehrgang der Blasorchesterleitung.
Gemeinsam mit den Kursteilnehmern
hat er zwei Tage lang die Arbeit des
Dirigenten analysiert. Mit seiner großen Erfahrung,
seinem Praxiswissen und seinem
schwäbischen Humor hat er viele Facetten
aufgezeigt und Fenster geöffnet, die das
weitreichende Spektrum der Arbeit am Dirigentenpult
und die musikalische und pädagogische
Arbeit mit den Musikantinnen und
Musikanten umfassen: „Wenn erst einmal
die Spielfreude geweckt ist, dann kann die
Arbeit an Rhythmus, Intonation, Klang, Balance
und Interpretation beginnen“. Dazu
hat der Referent auch zahlreiche Beispiele
aus seinem reichen Schatz an Erfahrungen
mitgebracht und aus seiner jahrzehntelangen
Praxis erzählt: „Auch ich hatte – und
habe immer noch meine Marotten und
musste aus den Fehlern lernen.“
Drei Fragen an …
Walter Ratzek
KulturFenster: Wie erleben Sie die Südtiroler
Blasmusikszene?
Walter Ratzek: Der Südtiroler Musiker hat
die zum Musizieren notwendige Emotion
durch die geografische Nähe zur südländischen
Kultur viel mehr im Blut wie
seine nördlichen Kollegen. Dieses „Espressivo“
muss nur geweckt und gefördert
werden. Und hier kommt der Dirigent
ins Spiel.
KulturFenster: Wie kann dies gelingen?
Walter Ratzek: In erster Linie ist es die
Spielfreude, die bei den Musikantinnen
und Musikanten geweckt werden muss.
Dann springt der berühmte Funke auch
auf das Publikum über, denn der Zuhörer
braucht Musik mit Emotionen, ansonsten
bleibt er unberührt.
Die Südt. Dirigenten-Werkstätten:
1. 2014 mit Miguel Etchecongelay
2. 2015 mit Isabelle Ruf-Weber
3. 2016 mit Alex Schillings
4. 2017 mit Jan Cober
5. 2018 mit Franco Cesarini
6. 2019 mit Walter Ratzek
7. geplant: 2020 mit Björn Bus
KulturFenster: Was hat sie überrascht?
Walter Ratzek: Ich bin etwas überrascht,
dass die Musikkapellen sehr großen
Wert auf die Tradition legen, wenn es
um die Tracht geht. Im Instrumentarium
vermisse ich das ein wenig, denn man
lässt und sieht zu, wie das Flügelhorn
und das Tenorhorn zusehends von den
angloamerikanischen Instrumentenbauweisen
verdrängt werden. Somit verlieren
wir in der Blasmusik allmählich diese
ureigenste musikalische Klangfarbe des
Alpenraums.
Stephan Niederegger
34
KulturFenster
Dank für
unbezahlbaren Einsatz
15.02.2020
Blasmusik
12. VSM - Landeswettbewerb
„Musik in kleinen
Gruppen“ 2020
www.vsm.bz.it/fachbereiche/jugend
VSM-Bezirk Meran ehrt sechs langgediente
Bezirksfunktionäre mit Dankesfeier
Die Verdienste der ehemaligen Funktionäre des VSM-Bezirkes Meran wurden in einer Dankesfeier gewürdigt.
Sechs langjährigen Funktionären „Danke“
sagen für viele Jahre ehrenamtlichen Einsatzes
für die Musikantinnen und Musikanten
im Bezirk Meran - das wollte der
Vorstand des VSM-Bezirks Meran mit einer
Dankesfeier in Partschins.
Im Jänner dieses Jahres gingen bei
den Wahlen zum Bezirksvorstand des Verbandes
Südtiroler Musikkapellen (VSM)
gleich mehrere Ären zu Ende. Der Großteil
des „alten“ Vorstandes stellte sich
nicht mehr der Wahl – darunter Bezirksobmann
Albert Klotzner, Bezirkskapellmeister
Stefan Aichner, Bezirksstabführer
Andreas Lanthaler, Bezirkskapellmeister-
Stellvertreter Patrick Gruber sowie die
Vorstandsmitglieder Christof Reiterer und
Bernhard Mairhofer. Der neu gewählte
Vorstand unter der Leitung von Obmann
Andreas Augscheller wollte vor allem diesen
langgedienten Funktionären für ihren
langjährigen selbstlosen Einsatz im Sinne
der Blasmusik danken und lud sie daher
gemeinsam mit ihren Ehefrauen und
Partnerinnen zu einer Feier im Hotel „Botango“
auf der Töll ein. Alle erhielten von
Bezirksobmann Augscheller ein kleines
Geschenk als Zeichen des Dankes. Für
die Ehefrauen und Partnerinnen gab es
Blumen von Bezirksobmann-Stellvertreter
Albert Zerzer.
Albert Klotzner aus Meran/Obermais war
28 Jahre lang Bezirksfunktionär – davon
von 2004 bis 2019 15 Jahre lang Bezirksobmann.
In dieser Zeit scheute er keine
Mühen, wenn es darum ging, den Kapellen
im Bezirk in verschiedenen Belangen weiterzuhelfen.
Verbandsobmann Pepi Fauster
hob in seiner Laudatio vor allem die Loyalität
und die stets lösungsorientierte und
ausgleichende Art Klotzners hervor: „Vor
allem bei der Organisation der diversen
Landesmusikfeste in Meran konnten wir
uns stets auf Albert verlassen.“
Andreas Lanthaler aus Walten im Passeiertal
war von 2006 bis 2019 13 Jahre
lang Bezirks-Stabführer und hatte maßgeblichen
Anteil daran, dass die Musik
in Bewegung im Bezirk und im ganzen
Land einen großen Aufschwung erlebt
hat. Verbandsstabführer Klaus Fischnaller
lobte seinen langjährigen Weggefährten
für seinen Weitblick und seinen unermüdlichen
Einsatz: „Du warst für uns immer
ein großes Vorbild – in fachlicher und in
menschlicher Hinsicht gleichermaßen.“
Stefan Aichner aus Vöran war neun Jahre
lang Bezirks-Kapellmeister des VSM-Bezirks
Meran. Er hat in dieser Zeit vor allem
in der Aus- und Weiterbildung der Kapellmeisterinnen
und Kapellmeister und
der Organisation von Großprojekten bleibende
Akzente gesetzt. Verbandskapellmeister
Meinhard Windisch ging vor allem
auf Aichners Fachkompetenz und seine
große Geduld ein: „Du hast es mit deinem
unermüdlichen Einsatz und deinem Weitblick
immer geschafft, andere zu begeistern.
Dafür gebührt dir unser aller Dank!“
Für die drei übrigen ehemaligen Funktionäre
sprach Bezirksobmann Andreas
Augscheller Worte des Dankes: Christof
Reiterer aus Vöran war ganze 18 Jahre
lang Mitglied des Bezirksvorstandes, davon
15 Jahre lang Schriftführer; Patrick Gruber
aus Hafl ing war neun Jahre lang im Bezirksvorstand,
davon drei Jahre lang Bezirks-Kapellmeisterstellvertreter;
Bernhard
Mairhofer aus Proveis vertrat sechs Jahre
lang als Gebietsvertreter die Kapellen aus
Ulten und vom Deutschnonsberg.
Bezirksobmann Augscheller dankte besonders
auch den Ehefrauen und Partnerinnen
der Geehrten: „Ohne euer Verständnis
und euren Rückhalt hätten diese
sechs Männer niemals so viel für die Blasmusik
in unserem Bezirk leisten können
– und sie würden heute nicht hier stehen.“
Verbandsobmann Pepi Fauster lobte
den Bezirksvorstand für die Initiative, die
Dankesfeier zu organisieren: „Eine solche
Dankesfeier hat es in meiner ganzen Zeit
als Verbandsfunktionär auf Bezirks- und
Landesebene noch in keinem Bezirk gegeben.
Das ist ein Zeichen hoher Wertschätzung
für jene, die vor euch Verantwortung
übernommen haben und hat auf
jeden Fall Vorbildcharakter.“
Bernhard Christanell
Nr. 06 | Dezember 2019 35
Blasmusik International
Südtirols Blasmusik punktet in
Niederösterreich
Bürgerkapelle Gries und die Jugendkapelle Villnöß „auf dem Stockerl“
Die Jugendkapelle Villnöß mit
ihrer Leiterin Brigit Profanter
(vorne links) freute sich über den
2. Platz beim Österreichischen
Jugendblasorchester-Wettbewerb
Rund um das heurige Wochenende zum
österreichischen Nationalfeiertag am vergangenen
26. Oktober fand im Auditorium
Grafenegg in Niederösterreich ein blasmusikalischer
Marathon statt. Die Bürgerkapelle
Gries und die Jugendkapelle Villnöß
nahmen daran teil und punkteten mit innovativen
Ideen und überzeugendem Auftritt.
Mehr als 1500 Musikerinnen und Musiker
nahmen am „1. Österreichischen Blasorchesterwettbewerb
der Höchststufe“
am „9. Österreichischen Jugendblasorchester-Wettbewerbes“
sowie an der Verleihung
des JUVENTUS-Preises der Österreichischen
Blasmusikjugend (ÖBJ) teil.
Beim Jugendblasorchester-Wettbewerb
traten 20 Orchester aus den neun österreichischen
Bundesländern sowie den Partnerverbänden
Liechtenstein und Südtirol
in vier Altersstufen an. Sie mussten neben
einem Pflichtstück auch ein Selbstwahlstück
desselben Schwierigkeitsgrades
vortragen. In der Jury saßen der Juryvorsitzende
Gerhard Forman, Isabelle Ruf-
Weber, Günther Reisegger und Martin A.
Fuchsberger. Sie bewerteten die Orchester
nach zehn unterschiedlichen Kriterien.
Den Gesamtsieg erreichte „Landeck
Wind“, das Jugendblasorchester der Landesmusikschule
Landeck unter der Leitung
von Stefan Köhle mit 93,60 Punkten.
Im vergangenen April qualifizierte
sich die Jugendkapelle Villnöß unter der
Leitung von Birgit Profanter beim Südtiroler
Jugendkapellen-Wettbewerb in Auer für
diesen Bundeswettbewerb. Sie holte sich
mit 90,10 Punkten den 2. Platz in ihrer Alterskategorie
BJ.
Voller Stolz zeigen die beiden Jüngsten
der Jugendkapelle Villnöß mit ihrer
Dirigentin Birgit Profanter (Bildmitte)
den gewonnenen Gutschein – v.l.
Jeremia Aichner (9 Jahre) und Alina
Psaier (10 Jahre)
36
KulturFenster
Bereits zum 4. Mal hat die Österreichische
Blasmusikjugend den Würdigungspreis
„Juventus Music Award“ für besonders
nachhaltige und musikalisch-gemeinschaftlich
fördernde Projekte ausgeschrieben.
Insgesamt 23 Projekte wurden eingereicht.
Die Bürgerkapelle Gries erreichte
mit ihrem generationsübergreifenden Musik-
und Zirkusprojekt für Teilnehmer und
Zuschauer „Manage frei – Bürgerkapelle
Gries“ den 1. Platz.
Unter der Leitung von Karl Geroldinger
konnte sich das Sinfonische Blasorchester
Ried vor dem Sinfonischen Blasorchester
Tirol (Bernhard Schlögl) und dem Voestalpinen
Blasorchester (Alois Papst) durchsetzen
und gewann den Wettbewerb mit
einer herausragenden Punktezahl von 96,8
Punkten. Südtirol hat zu diesem Wettbewerb
keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer
entsandt.
Pepi Fauster, der Obmann des Verbandes
Südtiroler Musikkapellen (VSM),
Verbandskapellmeister Meinhard Windisch
und Verbandsjugendleiter Hans Fi-
natzer begleiteten die Südtiroler Teilnehmerinnen
und Teilnehmer und gratulierten
zu den hervorragenden Erfolgen.
Stephan Niederegger
Blasmusik
20.01. - 28.12.2020
VSM-Motiviert und fit?
Funktionärsausbildung
2020 (NFA)
ÖBV-Präsident Erich Riegler (rechts) und ÖBV-Bundesjugendreferent Helmut Schmid
(links) gratulieren der Bürgerkapelle Gries zum „Juventus Music Award 2019“
www.vsm.bz.it
Neues
„Concert Rondo“ für Klavier und Orchester
von W. A. Mozart
Arrangiert für kleines Blasorchester von Gottfried Veit
In gekonnter und fachlich passender Manier
hat Gottfried Veit das Concert Rondo
KV 382 in D-Dur von Wolfgang Amadeus
Mozart aufgegriffen und für kleines Blasorchester
eingerichtet. Der Part des Solo-
Klaviers wurde natürlich in der Originalfassung
belassen. Dieses Werk für Klavier
und Orchester wurde bei Breitkopf & Härtel
als „Achtundzwanzigstes Concert“ mit
der KV Nummer 382 gedruckt.
Gottfried Veit verwendet sämtliche in der
Originalpartitur vorgeschriebenen Bläserstimmen
plus Pauken, fügt lediglich eine
Tuba hinzu und überträgt den Streichersatz
auf das Klarinetten- und Saxophonregister.
Um dem Originalklang möglichst nahe zu
kommen, sieht das Arrangement auch einen
Kontrabass und ein Violoncello vor.
Erschienen ist diese interessante Bearbeitung
beim Baton Verlag in den Niederlanden.
„Concert Rondo“ KV 382
Für Klavier und Orchester von
Wolfgang Amadeus Mozart
Arrangiert für kleines Blasorchester
von Gottfried Veit
Verlag: Baton Music, Eindhoven,
The Netherlands, BM924
Schwierigkeitsgrad für Pianist und
Blasorchester: mittelschwer
Dauer: zirka 10 Minuten
Walter Cazzanelli
Nr. 06 | Dezember 2019 37
Blasmusik International
29.02.2020
CON.BRIO
Kapellmeisterwettbewerb
Stadttheater Sterzing
http://www.vsm.bz.it/
2019/09/04/con-brio-west/
Kritisch hingehört
MK Prissian spielt an
geschichtsträchtigem Ort
Abendkonzert beim Ansitz „Unterbäck“
Beim Abendkonzert der Musikkapelle Prissian an geschichtsträchtigem Ort schilderte Rudi Gamper seine Erfahrungen aus der
Zeit der Option.
Eine Premiere stellte das Abendkonzert der
Musikkapelle Prissian Ende August dar. Es
fand nicht wie gewohnt am Musikpavillon
im Dorfzentrum statt, sondern zum ersten
Male beim Ansitz „Unterbäck“, auch „Esserhof“
genannt, „zu unterst“ von Prissian,
wie es in den alten Büchern heißt.
Die neue Besitzerfamilie Raimund Holzner
vom Mohrenwirt, die den altehrwürdigen
Ansitz erworben hat, lud dazu herzlich
ein. Der Ansitz, bereits im 13. Jahrhundert
urkundlich erwähnt, hat als Mühle,
Säge und zeitweise sogar als Gerichtssitz
schon immer eine bedeutende Rolle im
Dorf gespielt. In diesem Sinne will Holzner
das Anwesen, das besonders in letzter
Zeit zu verfallen drohte, sanieren und
wieder einer sinnvollen Nutzung zuführen.
Zu dieser Premiere, vor beeindruckender
Kulisse, waren viele Zuhörerinnen und Zuhörer
gekommen. Auch zahlreiche Ehrengäste,
unter anderem Bürgermeister Christoph
Matscher, der ehemalige Koordinator
von RAI-Südtirol, Rudi Gamper, und der
Ehrenobmann des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen, Gottfried Furgler, waren
anwesend.
Kapellmeister Elmar Windegger hat ein
passendes, abwechslungsreiches Programm
mit Werken von hauptsächlich Tiroler
Komponisten wie Florian Pedarnig, Andreas
Kofler, Albert Brunner, Sepp Tanzer
bis Sepp Thaler zusammengestellt. Einlagen
gaben das Gesangsduo Renate und
Sonja Wallnöfer mit sehr schönen Volksliedern,
sowie die Fanfaren- und Weisenbläser
der Musikkapelle.
Josef Mair führte durch das Programm,
wobei er auch den geschichtlichen Werdegang
des Ansitzes „Unterbäck“ nachzeichnete.
Historisch bedeutsam ist, dass sich
nur einen Steinwurf vom Ansitz entfernt
der „Stegschmied“ befindet, wo 1885 der
große Südtiroler Kanonikus Michael Gamper
geboren wurde. Gamper hat sich in
schwerer Zeit unerschrocken für die Be-
lange der Südtiroler eingesetzt und dafür
gekämpft, die deutsche Sprache, Kultur
und Tradition aufrecht zu erhalten.
Er machte sich zudem für das Dableiben
bei der Option stark, die vor genau 80
Jahren beschlossen wurde und das wohl
dunkelste Kapitel der Geschichte Südtirols
einleitete. Die Option entzweite das
Land. Dörfer, Vereine und Familien - die
gesamte Gesellschaft wurde in Optanten
und Dableiber gespalten. Rudi Gamper,
dessen Familie ausgewandert war, erzählte
als Zeitzeuge nicht nur über seine Erfahrungen
als „Optantenkind“ in der Ferne,
sondern auch über seine Erlebnisse, als
er nach der Option wieder nach Südtirol
zurückkehrte.
Die Premiere beim „Unterbäck“ gestaltete
sich zu einem interessanten, gut gelungenen
Konzertabend, bei dem an historischer
Stätte Musik und Zeitgeschichte
verbunden werden konnte.
Josef Mair
38
KulturFenster
Zur Person
Blasmusik
„Auf ein Glasl mit dem Hans“
Zum 80er von Prof. Hans Obkircher - der „Versuch einer Würdigung“
von Sigisbert Mutschlechner
Hans Obkircher, den man zu Recht als
„Allroundmusiker“ bezeichnen kann, ist
auch noch mit 80 neugierig und voller
Tatendrang.
Hans Obkircher (links im Bild) als
Student am Konservatorium in Bozen
mit Karl Pramstaller, der später Direktor
der Musikschule Bruneck wurde.
Hans Obkircher ist ein Urgestein der Südtiroler
(Blas)Musikszene. Zum 80-sten hier
der Versuch einer Würdigung. Oder lieber ein
kleiner, feiner Bericht. „Würdigung“ würde
dem Hans nicht gefallen.
Geboren 1939 in Völser Aicha, war sein
Weg schon vorbestimmt. Der Ortspfarrer
erkannte seine herausragende Begabung
und erteilte ihm Klavierunterricht. So gut er
halt konnte. Da war der Hans sieben. Mit
elf Jahren war er bereits Dorforganist. Sein
musikalischer Weg ging weiter am Bozner
Konservatorium, wo er Klarinette studierte
und 1961 den Abschluss machte. Für die
damalige Zeit absolut visionär, bildete er
sich am Mozarteum in Salzburg in Musikerziehung
weiter. Alles Pädagogische war
und ist ihm wichtig in seiner Arbeit. Weiter
ging es dann mit der Dirigentenausbildung,
die er von Hans Swarowsky erhielt. Durch
dessen Schule gingen unter anderem auch
Claudio Abbado und Giuseppe Sinopoli.
1963 gründete Hans Obkircher das Orchester
der Musikfreunde Meran, das er 36
Jahre lang leitete. Seine Intention war es,
Amateurmusikerinnen und Amateurmusiker
das Mitwirken in einem
Orchester zu ermöglichen. Seine
Zusammenarbeit mit jungen Instrumental-
und Vokalsolisten aus dem
Land und Südtiroler Chören gilt als
vorbildlich. Bis heute unvergessliche
Konzertabende für Orchester
und Publikum waren das Ergebnis
dieser Arbeit.
Ebenso geprägt hat er die Kapellmeisterausbildung
des Verbandes
Südtiroler Musikkapellen und – man
höre und staune – die Kapellmeisterausbildung
in der Emilia Romagna.
In Südtirol war Hans Obkircher
als Kapellmeister der Musikkapellen
Völser-Aicha, Obermais, Untermais
und Lana tätig. Er war Juror bei zahlreichen
Wettbewerben und ist bis
heute als Komponist und Arrangeur
für die verschiedensten Besetzungen und
Stilrichtungen, hauptsächlich aber für Holzbläser
ein gefragter Mann. Sein bislang letzter
großer „Wurf“ ist die Instrumentierung
des Diözesanteiles des „neuen Gotteslobs“.
Hans Obkircher war nicht nur ehrenamtlich
in verschiedenen Bereichen tätig, er
hatte auch einen – natürlich musikalischen
– Beruf. Als einer der Gründer der Musikschulen
des Landes wirkte er zuerst als
Lehrer, dann als Direktor der Musikschule
Meran und bis zu seiner Pensionierung als
Inspektor am Institut für Musikerziehung.
Sie wundern sich jetzt wahrscheinlich,
warum mein Bericht „Auf ein Glasl
mit dem Hans“ heißt. Der heißt so, weil
ich manchmal auf ein Glasl mit dem Hans
gehe. Wenn er seinen Sommerurlaub in
Olang verbringt, treffen wir uns auf der
Terrasse des Hotel Markushof und trinken
nicht nur ein Glasl miteinander. Oder
gerne auch einen Cappuccino. Mit dabei
seine bezaubernde Frau Linde. Gemeinsam
erzählen sie aus ihrem schier unerschöpflichen
Fundus an Anekdoten. Wie
bei der Kapellmeisterausbildung in der
Emilia Romagna das Essen zelebriert und
die Pausen gnadenlos überzogen wurden
oder wie relativ Pünktlichkeit ist.
Ich bin selber Musiker und weiß jede
Menge. Wenn ich etwas nicht weiß – vor
allem im literarischen Bereich – ist der Hans
mein erster Ansprechpartner. Er weiß, nun
ja, alles. Und wenn er etwas nicht weiß, oder
wenn es etwas nicht so gibt, wie
ich es möchte, dann gibt er nicht
auf, bis er es herausgefunden hat,
oder er setzt sich an den Computer
und macht das, was es nicht
so gibt, wie ich es möchte. Seine
80 Jahre sieht man ihm nicht an.
Er erscheint jünger als so mancher
40-Jähriger. Das mag an seiner
Frau und seiner Familie liegen,
das liegt aber ganz sicher auch
daran, dass er lebenslang gelernt
hat und noch immer neugierig ist.
Der Verband Südtirol Musikkapellen
und ich möchten uns
auf diesem Weg für deine Arbeit
und deinen Einsatz im Dienste der
Blasmusik recht herzlich bedanken.
80 Jahre sind kein Grund die
Hände in den Schoß zu legen. Wir
brauchen dich auch weiterhin.
Alles Gute Hans!
Das nächste Glasl ist uns gewiss!
Nr. 06 | Dezember 2019 39
Zur Person
Josef Hochkofler (1895-1969)
Der Kapellmeister und Komponist aus Niederdorf ist vor 50 Jahren verstorben.
Der Name „Hochkofler“ ist eng mit der musikalischen
Geschichte in Niederdorf und
darüber hinaus verbunden. Am vergangenen
2. Juni jährte sich zum 75. Mal der
Todestag von Florian Hochkofler, am 9.
Dezember zum 50. Mal der Todestag seines
Sohnes Josef Hochkofler.
Josef Hochkofler wurde am 30. Juni
1895 in Niederdorf geboren und war Lehrer,
Kaufmann, Hotelier, Organist, Chorleiter,
Kapellmeister und Komponist. Sein
bekanntestes Werk ist der Konzertmarsch
„Gruß aus den Dolomiten“, der ihn über
Südtirol hinaus unsterblich gemacht hat.
Er wurde von seinem Vater Florian,
dem damaligen Kapellmeister bereits im
Alter von 9 Jahren zur Musikkapelle geholt.
Zunächst spielte er die kleine Trommel
und die Becken - später die Klarinette,
bis er 1933 selbst den Taktstock
übernahm. Nach dem Zweiten Weltkrieg
leistete er große musikalische Aufbauarbeit.
Im September 1951 legte er das Kapellmeisteramt
allerdings aufgrund ständiger
Unstimmigkeiten nieder. 6 Jahre
später kehrte er an das Dirigentenpult
zurück und leitete die Kapelle bis zu seinem
plötzlichen Tod.
Zudem wirkte Hochkofler auch im Verband
Südtiroler Musikkapellen als Referent
bei Bezirksveranstaltungen und
als Verbandsarchivar. 1969 wurde er für
seine Verdienste um das Südtiroler Blasmusikwesen
mit dem VSM-Verdienstabzeichen
in Gold geehrt.
Die Tageszeitung „Dolomiten“ widmete
dem Verstorbenen in ihrer Ausgabe
vom 27./28. Dezember 1969 folgenden
Nachruf:
„Josef Hochkofler studierte an der Lehrerbildungsanstalt
und wirkte kurze Zeit
als Lehrer in Meran, Außermühlwald und
in seinem Heimatdorf. Der Erste Weltkrieg
rief ihn mit den Kaiserschützen an
die Südfront wo er zum Leutnant aufrückte
… Er scheute keine Mühen, keinen
Zeit- und Kostenaufwand, um festliche
Gottesdienste mit Werken großer
Meister würdig zu umrahmen und weltliche
Feste mit Musik festlich zu gestalten.
Die Leistungen seiner Musikkapelle
standen auf beachtlichem Niveau; sie
konnte sich mit ihren Darbietungen in
der Heimat und im Ausland hören lassen
… Überall schätzte man seinen Charakter,
seine Gewissenhaftigkeit, seinen
realen Sinn und seine Treue zu Heimat
und Volk. Niederdorf wird die Persönlichkeit
Josef Hochkofler sehr vermissen,
wird ihm aber in Dankbarkeit ein treues
Andenken bewahren.“
Diese Verpflichtung hat sich die Musikkapelle
Niederdorf seither auf ihre
Fahne geschrieben. Im Archiv der Kapelle
liegen zahlreiche handschriftliche
Noten aus seiner Schaffenszeit. Großteils
handelt es sich dabei um Bläsersätze für
kleine Besetzungen. Das unvollständige
Manuskript des Marsches „Mit leichtem
Schritt“ hat der Kärntner Musiker und
Komponist Karl Safaric vor 2 Jahren im
Auftrag der Kapelle neu bearbeitet. Diese
Neubearbeitung wurde beim Frühjahrskonzert
2017 erstmals aufgeführt und
zählt mit dem „Gruß aus den Dolomiten“
zum musikalischen Markenzeichen der
Musikkapelle Niederdorf.
Josef Hochkofler 1895-1969 Florian Hochkofler 1853-1944
Neben dem 50. Todestag von Josef Hochkofler
gedenkt die Musikkapelle heuer
auch des 75. Todestages seines Vaters
Florian (1853-1944), der die Kapelle 50
Jahre lang, von 1883 bis 1933 dirigierte.
Stephan Niederegger
Kpm. MK Niederdorf
Grabstätte von Josef Hochkofler am
Friedhof in Niederdorf
40
KulturFenster
Blasmusik
14.03.2020
72. Jahreshauptversammlung
2020
www.vsm.bz.it
Bereits zum 2. Mal war die
Musikkapelle Welschnofen zu Gast
beim Europäischen Blasmusikfestival in
Bad Schlema.
•Musikpanorama
MK Welschnofen beim Europäischen
Blasmusikfestival in Bad Schlema (D)
Festumzug und vier Konzerte vor begeistertem Publikum
Zum 22. Mal stand Aue-Bad Schlema in
Sachsen ganz im Zeichen des Europäischen
Blasmusikfestivals. Orchester und
Kapellen aus elf verschiedenen europäischen
Nationen trafen sich vom 20. bis 22.
September 2019 zu diesem alljährlichen
Highlight für Freunde der Blasmusik.
Wie bereits im Jahre 2015 hatte das Bergmannsblasorchester
Kurbad Schlema
auch die Musikkapelle aus Welschnofen
unter der Leitung von Kapellmeister Karl
Stuppner und Obmann Jörg Seehauser
eingeladen, um den Staat Italien und das
Land Südtirol bei diesem Festival zu vertreten.
Zur Eröffnung konzertierte die Musikkapelle
Welschnofen beim Bürgermeisterempfang.
Anschließend marschierten
alle am Festival teilnehmenden Musikerinnen
und Musiker bei einem Festumzug
durch den Kurort. Im Festzelt mit über
4.000 Sitzplätzen erklang in der Folge ein
Gemeinschaftskonzert, bei dem verschiedene
regionale und internationale Musikklassiker
dargeboten wurden.
In einem Nonstop-Programm auf zwei
Bühnen wechselten sich die verschiedenen
Orchester und Kapellen ab. Die
Musikkapelle Welschnofen gab insgesamt
vier Konzerte zum Besten und sorgte somit
für heitere Stimmung und für Gänsehautfeeling
bei den Zuhörerinnen und
Zuhörern.
Am Sonntagmorgen fand ein weiterer
großer Festumzug statt. Nach dem Abschlusskonzert
verabschiedete sich die
Musikkapelle Welschnofen gemeinsam
mit der Stadtmusikkapelle Amras aus Tirol
beim Publikum.
Den Musikantinnen und Musikanten der
Musikkapelle Welschnofen werden diese
sehr intensiven, aber fröhlichen Tage sicher
noch lange in Erinnerung bleiben.
Einen bleibenden Eindruck bei den Zuhörern
haben sie auf alle Fälle hinterlassen.
MK Welschnofen
Nr. 06 | Dezember 2019 41
Musikpanorama
Musikkapelle Steinegg zu Gast
beim Musikverein Dalkingen (D)
Musikalischer Freundschaftsbesuch in Baden Württemberg
Die Musikkapelle Steinegg war im Oktober zu Gast in Dalkingen.
Am 12. Oktober startete der mit den Steinegger
Musikantinnen und Musikanten fast
vollbesetzte Bus Richtung Baden Württemberg.
Nach der Mittagspause in Ulm wurden
die Südtirolerinnen und Südtiroler im rund
80 Kilometer entfernten Dalkingen bereits
von Dirigent Kurt Sturm vom Musikverein
Dalkingen mit einigen seiner Musikkollegen
beim Musikantenstadl erwartet.Dort gab die
MK Steinegg unter der bewährten Leitung
von Kapellmeister Christoph Rieder um
19.30 Uhr ein zweistündiges Konzert. Der
Saal war vollbesetzt und die Stimmung ausgesprochen
gut. Der Obmann der MK Steinegg,
Ulfried Falser, begrüßte die Gastgeber
und das Publikum herzlich und Sprecher
Albert Rieder führte anschließend durchs
Konzertprogramm. Dieses bot eine ganze
Reihe musikalischer Höhepunkte, und die
Musikantinnen überraschten sogar mit einer
Schuhplattlereinlage. Nach dem Konzert
hatte man noch die Gelegenheit, mit
alten Freunden zu plaudern und gemeinsam
zu feiern. Neben zwei kleineren Musikgruppen
nahmen auch einige der Steinegger
Musikantinnen und Musikanten
nochmals die Instrumente zur Hand und
sorgten bis zu später Stunde für gute Stimmung.
Am nächsten Tag trafen sich Gäste
und Gastgeber zum gemeinsamen Frühstück
und gegen Mittag war es wieder Zeit,
sich zu verabschieden und die Heimfahrt
anzutreten
MK Steinegg
Musikkapelle Zwölfmalgreien eröffnet den
Leipziger Opernball
Vereine von Bozen bei glanzvollem Wochenende in Sachsen vertreten
Zu einer ganz besonderen Ehre kam am
letzten Oktoberwochenende die Musikkapelle
Zwölfmalgreien. Da stand nämlich die
25. Ausgabe des Leipziger Opernballs an.
Zu dieser Jubiläumsausgabe wählten die
Organisatoren das Motto „La Dolce Vita
in Südtirol“ und holten in Zusammenarbeit
mit dem Verkehrsamt der Stadt Bozen
mehrere Südtiroler Vereine und Gruppen
nach Leipzig. Der MK Zwölfmalgreien
kam die Ehre zu, den Ball musikalisch zu
eröffnen. Spannend für die Zwölfmalgreiner
war es auch, sich unter die Stargäste
wie Tennislegende Boris Becker, Ex-Boxer
Axel Schulz, Schauspieler Dieter Hallervorden,
Tatort-Kommissar Richy Müller und
die Moderatorin des Abends, Birgit Schrowange,
mischen zu können.Als kulturellen
Höhepunkt für die Musikantinnen und Musikanten
gab es am Samstagvormitttag eine
Die Zwölfmalgreiner Musikantinnen und Musikanten konnten in Leipzig das „Rote-
Teppich-Feeling“ erleben. (Foto © MK Zwölfmalgreien)
private Führung durch das weltberühmte
Leipziger Gewandhaus mit seinem imposanten
Konzertsaal, welcher bis zu 1.900
Zuhörerinnen und Zuhörern Platz bietet.
Alles in allem war es für die Zwölfmalgreiner
ein ereignisreiches Wochenende mit
viel Spaß und einzigartigen Erlebnissen.
MK Zwölfmalgreien, Wolfgang Kranzer
42
KulturFenster
Blasmusik
„Goldener Nachwuchs“ bei der
Musikkapelle St. Leonhard in Passeier
Vier junge Musikantinnen und Musikanten mit Leistungsabzeichen in Gold – 2 Neuzugänge
Obmann Thomas Pichler (li.) und Kapellmeister Erich Abler (re.) freuen sich über
ihre talentierten Mitglieder: Josef Zipperle, Theresa Holzknecht, Daniela Pichler und
Verena Hofer (v. l.).
Schwungvoll und abwechslungsreich ließ
die Musikkapelle Andreas Hofer aus St. Leonhard
ihre Konzertsaison ausklingen. Der
Auftakt im Frühjahr erfolgte traditionsgemäß
mit dem Osterkonzert. Dem folgten mehrere
Konzerte auf dem Raiffeisenplatz, kirchliche
Feiern wurden mitgestaltet und einige Gastkonzerte
außerhalb gespielt.
Die MK – Andreas Hofer ist eine Kapelle mit
großteils jungen Mitgliedern. Viele davon haben
bereits das Leistungsabzeichen in Bronze
und Silber erlangt. Zur Freude von Kapellmeister
Erich Abler und Obmann Thomas
Pichler haben Josef Zipperle (Trompete), Verena
Hofer (Klarinette) sowie Theresa Holzknecht
und Daniela Pichler (Querflöte) das
Leistungsabzeichen in Gold erhalten. Soloeinlagen
von Theresa Holzknecht und Josef
Zipperle sind schon seit Längerem fester Bestandteil
eines jeden Konzertes und sie beweisen
damit ihr außergewöhnliches Talent.
Josef Zipperle hat bereits bei mehreren Wettbewerben
von „prima la musica“ teilgenommen
und diese mit Bravour gewonnen. Als
kleine Anerkennung für den ausgezeichneten
Erfolg der jungen Musikerinnen und Musiker
wurde allen ein Gutschein überreicht.
Seit dem Frühjahr bereichern mit der Oboistin
Emma Hofer und der Klarinettistin Felicitas
Righi zwei Neuzugänge die Musikkapelle.
Die Ausbildung der Musikantinnen und Musikanten
erfolgt über die Musikschule Meran/
Passeier und durch die Teilnahme an den
Jungbläserwochen des VSM. Instrumente er-
halten sie kostenlos von der Musikkapelle.
Es finden sich auch immer wieder Sponsoren,
die durch ihre finanzielle Unterstützung
einen Ankauf von Instrumenten möglich
machen. So durfte sich beispielsweise
heuer im Frühjahr Emma Hofer über eine
neue Oboe freuen.
Text / Foto: Bernadette Pfeifer
Frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr
Der Verband Südtiroler Musikkapellen (VSM),
der Heimatpflegeverband Südtirol (HPV),
der Südtiroler Chorverband (SCV)
sowie die Schriftleitung mit den Redaktionen
der Zeitschrift KULTURFENSTER
wünschen allen frohe, gesegnete Weihnachten
und viel Glück und Segen im neuen Jahr 2020.
Nr. 06 | Dezember 2019 43
Impressum
Mitteilungsblatt des Verbandes Südtiroler
Musikkapellen, des Südtiroler Chorverbandes
und des Heimapflegeverbandes Südtirol
Eigentümer und Herausgeber:
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen
Ermächtigung Landesgericht Bozen
Nr. 27/1948
Schriftleiter und im Sinne des Pressegesetzes
verantwortlich:
Dr. Alfons Gruber
Als Pressereferenten für die Darstellung der
entsprechenden Verbandsarbeit zuständig:
VSM: Stephan Niederegger,
E-Mail: kulturfenster@vsm.bz.it
SCV: Paul Bertagnolli,
E-Mail: info@scv.bz.it
HPV: Josef Oberhofer (interimsmäßig),
E-Mail: josef@hpv.bz.it
Unverlangt eingesandte Bilder und Texte
werden nicht zurückerstattet.
Redaktion und Verwaltung:
Verband Südtiroler Musikkapellen,
I-39100 Bozen, Schlernstraße 1, Waltherhaus
Tel. 0471 976387 - Fax 0471 976347
E-Mail: info@vsm.bz.it
Einzahlungen sind zu richten an:
Verband Südtiroler Musikkapellen, Bozen,
Waltherhaus
Raiffeisen-Landesbank, BZ
IBAN: IT 60S03493 11600 0003000 11771
SWIFT-BIC: RZSBIT2B
Jahresbezugspreis: Euro 20
Gefördert von der Kulturabteilung
der Südtiroler Landesregierung.
Druck: Ferrari-Auer, Bozen
Das Blatt erscheint als Zweimonatszeitschrift,
und zwar jeweils am 15. Februar, April, Juni,
August, Oktober und Dezember.
Redaktionsschluss ist der 15. des jeweiligen
Vormonats.
44
KulturFenster