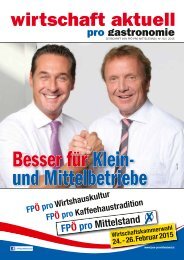An der blauen Donau - Die Freiheitlichen in Wien
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ANDREAS MÖLZER
(HG.)
AN DER BLAUEN
1848 2020
DONAU
DIE FREIHEITLICHEN IN WIEN
ISBN 978-3-9504350-5-4
© 2020
Freiheitliche Akademie Wien
Schmerlingplatz 2
A-1010 Wien
Rathausklub der Wiener FPÖ
Felderstraße 1 Stiege 6/HS/234
1082 Wien
Texterstellung, Layout und Herstellung:
Edition K3-Gesellschaft für Sozialpolitische Studien,
Verlags- und Beratungs-Ges.m.b.H.
Vorwort
Vizebürgermeister Dominik Nepp 5
Zum Geleit
Herausgeber Andreas Mölzer 6
2019–2020 Die neue Wiener FPÖ 9
Die Freiheitlichen nach Ibiza
Dominik Nepp im Gespräch 16
2004–2020 Im Rathaus gegen das „Rote Wien“ 19
Maximilian Krauuss im Gespräch 22
Toni Mahdalik im Gespräch 26
Ulrike Nittmann im Gespräch 30
Michael Stumpf im Gespräch 34
2004–2019 Herausforderer des „roten Wiens“ 39
Martin Graf im Gespräch 45
Martin Hobek im Gespräch 48
Ursular Stenzel im Gespräch 52
Ute Meyer im Gespräch 57
1990–2004 Der Aufstieg zur zweiten Kraft 61
Die Wiener FPÖ von 1990–2004
Alexander Pawkowicz im Gespräch 68
Hilmar Kabas im Gespräch 76
Johann Herzog im Gespräch 86
1956–1990 Klein, aber fein 91
Von den Anfängen der Wiener Freiheitlichen
Norbert Steger im Gespräch 100
Erwin Hirnschall im Gespräch 110
1947–1956 Der Verband der Unabhängigen in Wien 117
Von Fritz Stüber zu Willfried Gredler
Lothar Höbelt im Gespräch 133
1918–1938 Das Dritte Lager im Wien der I. Republik 137
Vom „Roten Wien“ zum Anschluss
1859–1918 Die Nationalliberalen in der Kaiserstadt 157
Von Kajetan Felder zu Karl Lueger
1848/49 Wie alles Begann 181
Die Revolution in der Kaiserlichen
Haupt- und Residenzstadt
Anhang 199
Ergebnisse der Kommunalwahlen
in Wien seit 1945
4
An der blauen Donau
Die Freiheitlichen in Wien
Liebe Leserinnen
und Leser!
Die Machtaufteilung von SPÖ
und ÖVP hat seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges in allen
staatlichen und halbstaatlichen
Bereichen bis zum heutigen Tage
eine große Beständigkeit. Diese
rot–schwarze Machtfülle war die
Vorwort
von Dominik Nepp
Vizebürgermeister von Wien
Basis für ein Gegengewicht, das sogenannte Dritte Lager. Viele Bürger
waren auf der Suche nach einer wählbaren politischen Kraft jenseits
von Rot und Schwarz.
Die FPÖ füllt als rot–weiß–rote Partei seit über 60 Jahren diese Lücke.
Besonders in Wien ist es in den vergangenen 30 Jahren gelungen,
die FPÖ als starken politischen Ausgleich zur SPÖ-Allmacht zu positionieren.
Ein Hauptgrund für den Erfolg waren und sind die zigtausenden
ehrenamtlichen Mitstreiter, die unermüdlich seit vielen Jahrzehnten dafür
politisch kämpfen, dass wir uns in Wien noch heimisch fühlen können.
Denn die regierenden Sozialdemokraten haben es mit ihrer schrankenlosen
Zuwanderungspolitik zu verantworten, dass die Österreicher
zu Bürgern zweiter Klasse werden.
Die FPÖ wird auch in Zukunft die einzige Kraft sein, die ihr politisches
Handeln der „Österreicher zuerst“ Politik unterordnet. Sowohl
in guten, als auch in weniger guten Zeiten bleiben wir unseren Grundsätzen
treu. Davon wird uns nichts abhalten können, weder der politische
Mitbewerber, noch Störversuche durch Spaltprodukte.
Daher: besinnen wir uns unserer freiheitlichen Grundwerte, halten
wir zusammen und gehen wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft.
Für unsere Heimat Österreich. Für unsere Heimatstadt Wien.
In diesem Sinne,
Glück auf!
Dominik Nepp
5
An der blauen Donau
Die Freiheit ist eine Wienerin
Zum Geleit
von Andreas Mölzer
Für das nationalfreiheitliche
Lager und für jene Parteien,
die im Laufe seiner 170-jährigen
Geschichte dieses Lager vertraten,
war die Stadt Wien immer ein
ebenso fruchtbarer wie schwieriger
Boden. Als kaiserliche Haupt- und
Residenzstadt war Wien im Jahre
1848 ein Zentrum der nationalliberalen
Revolutionsbewegung. Auf
die Ereignisse dieser Revolution,
auf die Ideale, für die damals gekämpft wurde, führt sich dieses Lager
bis auf den heutigen Tag zurück. Die Persönlichkeiten, die damals im
Revolutionsjahr hervorgetreten sind, vom Bauernbefreier Hans Kudlich
bis hin zum Paulskirchenabgeordneten Robert Blum, bleiben bis zum
heutigen Tag Heldengestalten des freiheitlichen Lagers.
In den letzten Jahrzehnten der Habsburger Monarchie war es die
große Ära der liberalen Bürgermeister, die die Hauptstadt der Monarchie
geprägt hat. Von Bau des neugotischen Wiener Rathauses bis zur Errichtung
des Zentralfriedhofs, von der Donauregulierung bis zum Bau
der Hochquellenwasserleitung haben diese nationalliberalen Bürgermeister,
deren wichtigster zweifellos Cajetan Felder war, die Metropole der
Habsburger Monarchie geprägt. Unter ihrer Regentschaft wurde Wien
zur Weltstadt.
In der Ersten Republik wurde es für die Nationalliberalen in der
Bundeshauptstadt wesentlich schwieriger. Während die Bundesregierung
von einer bürgerlichen Koalition, bestehend aus christlich-sozialen
und nationalliberalen Parteien, getragen wurde, herrschte im roten
Wien die Sozialdemokratie. Sich hier auch nur einigermaßen zu behaupten,
war für die damalige politische Partei des Dritten Lagers, für die
Großdeutsche Volkspartei, oder gar für den Landbund fast unmöglich.
Nach dem Scheitern der Demokratie und der Ersten Republik mit der
Ausschaltung des Parlaments und der Machtübernahme durch den austrofaschistischen
Ständestaat wandten sich Teile des nationalliberalen
Lagers dem Nationalsozialismus zu. Sie hatten für diesen totalitären
Irrweg bitter zu büßen. Nachdem nahezu alle Bereiche der politischen
Landschaft der Ersten Republik, insbesondere die Sozialdemokraten,
aber auch die Christlichsozialen, den Anschlusswunsch an Deutschland
intensiv verfolgt hatten, waren es die Nationalliberalen, die sich in erster
Linie deshalb dem Nationalsozialismus zuwandten. Nur so sahen sie
den Anschluss, der das eigentliche Staatsziel der Ersten Republik war,
gewährleistet.
Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung
vom totalitären NS-Regime dauert es Jahre, bis sich das Dritte Lager
neu formieren konnte. Der Verband der Unabhängigen (VdU) konnte
auch in Wien Fuß fassen und war dort in erster Linie durch die historisch
gewachsenen Verbände des nationalliberalen Bereichs dominiert:
Die waffenstudentischen Korporationen, danach die Nachfolgevereinigungen
des Deutschen Schulvereins und andere Vereinigungen bildeten
die Basis dieses Lagers. Der VdU in Wien selbst wurde allerdings bald
durch Streitigkeiten und interne Zwiste geschwächt. Die dominierende
Persönlichkeit von Fritz Stüber hatte das althergebrachte Prinzip der
„deutschen Zwietracht“ zur Grundlage ihrer Politik gemacht.
6
Mit der Gründung der Freiheitlichen Partei im Jahre 1956 allerdings
sollte sich das ändern.
Die Freiheitlichen in Wien
Unter dem Obmann Tassilo Broesigke, einem wirklichen politischen
Gentleman, sowie dann unter der Führung von Norbert Steger und
schließlich von Erwin Hirnschall konnte sich die Freiheitliche Partei
nach dem Motto „klein, aber fein“ als nationalliberale Honoratiorenpartei
in der Bundeshauptstadt etablieren.
Der politische Aufstieg zur zweiten Kraft in Wien folgt dann allerdings
erst in den neunziger Jahren unter der Führung des Architekten
Rainer Pawkowicz. Pawkowicz, Hilmar Kabas und Johann Herzog
schafften es, die Wiener Freiheitlichen zu einem wirklich gestaltenden
politischen Faktor im Wiener Rathaus zu machen und gleichzeitig die
Wiener Landesgruppe zu einer bestimmenden Kraft innerhalb der FPÖ.
Diese wurde ja unter Jörg Haider zu einer Mittelpartei, die schließlich
auch noch in die Bundesregierung kommen sollte. Eine Vielzahl von
Gemeinderäten beziehungsweise Wiener Landtagsabgeordneten sowie
nicht amtsführende Stadträte und sogar ein Vizebürgermeister konnten
als Erfolg für die Politik von Pawkowicz und später von Hilmar Karas
verbucht werden.
Letzterer sorgte für eine geordnete Amtsübergabe und konnte
trotz der Turbulenzen, die Jörg Haider in der Bundes-FPÖ durch seine
BZÖ-Abspaltung verursachte, eine geschlossene Partei an seinen
Nachfolger Heinz-Christian Strache übergeben. Dieser wurde gemeinsam
mit seinen Mitstreitern wie Johann Gudenus, David Lasar, Eduard
Schock und vielen anderen wirklich zum politischen Herausforderer des
roten Wiens und von Bürgermeister Häupl beziehungsweise in der Folge
von Bürgermeister Ludwig. Im Jahre 2015, im Zuge der Krise durch
die Massenmigration, vermochten die Wiener Freiheitlichen dann, sogar
über 30 Prozent der Wähler für sich zu gewinnen.
Die Katastrophe von Ibiza und das Fehlverhalten zweier Spitzenfunktionäre
sollten diesen Aufschwung je unterbrechen. Eine neue junge
Führungsmannschaft rund um Dominik Nepp wie Toni Mahdalik,
Maximilian Krauss, Ulli Nittmann und Alexander Pawkowicz musste
die im öffentlichen Ansehen schwer geschädigte Wiener Partei unter
schwierigsten Umständen übernehmen. Und obwohl die gegnerischen
Medien und die politischen Mitbewerber die durch den Ibiza-Skandal
und dessen Protagonisten in schwere Bedrängnis geratene Wiener FPÖ
mit großer Häme und Heuchelei bekämpfen, wird nationalliberales
Denken und freiheitliche Politik an der blauen Donau erhalten bleiben.
Die Freiheit ist eben eine Wienerin und sie wird es auch immer bleiben. ◆
7
8
An der blauen Donau
Die Freiheitlichen in Wien
Für das nationalfreiheitliche
Lager und für jene
Parteien, die im Laufe seiner
170-jährigen Geschichte dieses
Lager vertraten, war die Stadt Wien immer
ein ebenso fruchtbarer wie schwieriger Boden.
Als kaiserliche Haupt- und Residenzstadt war
Wien im Jahre 1848 ein Zentrum der nationalliberalen
Revolutionsbewegung. Auf die Ereignisse
dieser Revolution, auf die Ideale, für die
damals gekämpft wurde, führt sich dieses Lager
bis auf den heutigen Tag zurück. Dann, in den
letzten Jahrzehnten der Habsburger Monarchie,
war es die große Ära der liberalen Bürgermeister,
die die Hauptstadt der Monarchie geprägt
1848–2020
Die Freiheit ist eine Wienerin
hat. In der Ersten Republik wurde es für die
Nationalliberalen in der Bundeshauptstadt wesentlich
schwieriger: Im roten Wien herrschte
die Sozialdemokratie.
So spannt sich der Bogen weiter bis zum heutigen
Tag: Die FPÖ, als zweite Kraft in der Stadt,
hat nun ein hartes Erbe angetreten und es wird
sich zeigen, ob die Freiheitlichen ihren Ansprüchen
genügen können.
Es wird sich zeigen, ob die Freiheit wirklich
eine Wienerin ist!
AN DER BLAUEN DONAU
◆
DIE FREIHEITLICHEN IN WIEN
◆
◆
9
10
An der blauen Donau
2019–2020
2019–2020
DIE NEUE WIENER FPÖ
DIE FREIHEITLICHEN
NACH IBIZA
9
An der blauen Donau
Hoffnungsträger Dominik Nepp
Die Umstände waren denkbar schwierig, als Dominik Nepp nach
dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache im Zuge der Veröffentlichung
des Ibiza-Videos am 18. Mai 2019 die Führung der Wiener
FPÖ übernahm. Die Republik war im politischen Ausnahmezustand,
und gegen die Freiheitlichen hatte eine regelrechte mediale Hexenjagd
eingesetzt. Am 20. Mai 2019 wurde der 37-jährige Vizebürgermeister
einstimmig vom Landesparteivorstand zum neuen Landesparteiobmann
bestellt.
FPÖ-Landesparteiobmann
Dominik
Nepp im intensiven
Bürgerkontakt
Trotz der nicht einfachen Umstände der Übernahme der Wiener
FPÖ zeigte sich Nepp in einem ersten Interview mit dem ORF optimistisch:
„Jetzt geht es los, jetzt erst recht. Durch so eine Dirty-Campaigning-Kampagne
lassen wir uns nicht auseinanderdividieren. Die
Landesgruppe steht geschlossen da.“ Nepp dankte seinem Vorgänger
Strache für dessen 15-jährige Tätigkeit als Obmann der Wiener FPÖ
10
2019–2020
und forderte Aufklärung in Bezug auf die Hintergründe
zum Ibiza-Video.
Zudem kündigte der neue Landesparteiobmann
an, dass die Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt
auch künftig ihren Kernthemen treu
bleiben werden: „Das ist Sicherheit, das ist der
Kampf gegen den politischen Islam, aber es
ist hier auch die Reform der Mindestsicherung
umzusetzen, wo sich Stadtrat Hacker (SPÖ)
weigert, das rechtskonform zu tun.“ Die rot–
grüne Stadtregierung weigerte sich, die von der
früheren türkis–grünen Bundesregierung beschlossene
Kürzung der Mindestsicherung für
Asylwerber und sogenannte subsidiär Schutzberechtigte
umzusetzen. Überhaupt versprach
Nepp, dass die FPÖ auch weiterhin gegen die
rot–grünen Missstände in Wien kämpfen und die Politik für die Wiener,
sie sich von Rot und Grün im Stich gelassen fühlen, weiterführen
werde. Dazu zähle auch „soziale Fairness, etwa auch im geförderten
Wohnbereich.“ Damit meinen die Wiener Freiheitlichen etwa, dass die
Staatsbürgerschaft das Hauptkriterium für den Anspruch auf eine Gemeindewohnung
sein, es also zu einer Bevorzugung der Österreicher
gegenüber Migranten kommen müsse. Und nicht zuletzt stand die erste
Plakatserie der Wiener FPÖ im Wahljahr 2020 unter dem Motto „Holen
wir unser Wien zurück…“
„
Der neue Landesparteiobmann
kündigte
an, dass die Freiheitlichen
in der Bundeshauptstadt
auch künftig ihren
Kernthemen treu bleiben
werden.
11
An der blauen Donau
„
Trotz des Optimismus
von Nepp waren die
ersten Monate seiner
Obmannschaft keine
einfache Zeit.
Nepp wurde am 14. Februar 1982 in Wien geboren. Er absolvierte
den Masterlehrgang Führung, Politik und Management an der
FH Wien und war als Gesellschafter eines Handelsunternehmens tätig.
Seine berufliche Laufbahn führte ihn vom
Ring Freiheitlicher Jugend über das Döblinger
Bezirksparlament und den Landtag bis ins Amt
des Vizebürgermeisters, das er 2017 von Johann
Gudenus übernahm. Diesem war Nepp
schon nach der Wien-Wahl im Herbst 2015 als
Klubobmann im Rathaus nachgefolgt. Im Landesparteivorstand
der Wiener FPÖ wird der
verheiratete Vater zweier Töchter von Johann
Herzog, dem Präsidenten der Freiheitlichen
Akademie Wien, der zweiten Landtagspräsidentin
Veronika Matiasek, den Nationalratsabgeordneten
Dagmar Belakowitsch-Jenewein,
Harald Stefan und Martin Graf, EU-Abgeordnetem
Harald Vilimsky sowie den Landtagsabgeordneten
Dietbert Kowarik, Wolfgang Seidl
und Gerhard Haslinger unterstützt.
Stadtrat Maximilian
Krauss
Trotz des Optimismus von Nepp waren die ersten Monate seiner
Obmannschaft keine einfache Zeit. Bei der Nationalratswahl am 29.
September 2019 sackte die Wiener FPÖ um 8,5 Prozent auf nunmehr
12,8 Prozent ab, womit das Ergebnis in der Bundeshauptstadt deutlich
unter dem Österreich-Durchschnitt von 16,2 Prozent lag. Und in den
Innenstadtbezirken, die schon bei vorangegangenen Wahlgängen kein
einfaches Pflaster für die FPÖ war, mussten sich die Freiheitlichen mit
Ergebnissen im einstelligen
Bereich zufrieden geben.
Nepp erklärte die Wahlniederlage
damit, dass „viele
unserer Wähler zu Hause
geblieben sind, da sie ob der
Ereignisse verunsichert waren.
Es ist aber nicht so, dass
sie bei einer anderen Partei
eine neue politische Heimat
gefunden haben“.
Tatsächlich schufen die
Ibiza-Affäre und der kurz vor
Nationalratswahl von den linken
Medien breit ausgewalzte
mutmaßliche Spesen skandal
rund um den früheren Bundesparteiobmann
und Wiener
Landesparteiobmann
Strache eine denkbar ungünstige
Ausgangslage. Nach der
Nationalratswahl erwiesen
sich Straches entgegen seiner
Ankündigung vom 1. Oktober
2019, sich vollständig aus
der Politik zurückzuziehen,
12
2019–2020
vor allem über Facebook geäußerte politische Kommentare als wenig
hilfreich, weshalb der frühere Parteichef am 13. Dezember 2019 vom
Wiener Landesparteiobmann einstimmig aus der FPÖ ausgeschlossen
wurde.
Tags zuvor hatten drei der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte
freiheitliche Wiener Landtagsabgeordnete die Gründung einer eigenen
Partei mit dem Namen „Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) verkündet.
Am 15. Mai 2020 gab Strache bekannt, bei der Wiener Wahl im Herbst
2020 als Spitzenkandidat für die in „Team HC Strache – Allianz für
Österreich“ umbenannte blaue Abspaltung antreten zu wollen. Bis auf
ein paar Überläufer aus den Bezirksvertretungen konnte die Abspaltung
jedoch keine Zuwächse aus dem blauen Funktionärsbereich verzeichnen,
was die innerparteiliche Geschlossenheit der Wiener Freiheitlichen
unter der Führung von Dominik Nepp unterstreicht.
Inhaltlich fuhren die Wiener Freiheitlichen im „Jahr nach Ibiza“
unter Parteiobmann Nepp und Klubobmann Anton „Toni“ Mahdalik
einen kantigen, aber dennoch sachlich orientierten Oppositionskurs.
Sie zeigten die negativen Folgen der von der rot–grünen Koalition zu
verantwortenden Willkommenspolitik für die „echten Wiener“ auf,
thematisierten die steigenden Kosten, vor allem im Bereich Wohnen,
die Gewalt an den Schulen und das steigende Sicherheitsdefizit. Tatsächlich
gerät die Wiener Identität immer mehr in die Defensive, und
in drei Bezirken ist „Mohammed“ bereits der beliebteste Vorname für
neugeborene Buben. Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der Mindestsicherungsbezieher
in Wien bereits Ausländer sind und Sozialgelder
in der rot–grün regierten Hauptstadt teilweise sogar ohne korrekte
Anspruchs prüfung an Migranten ausbezahlt werden. Folglich betont
Nepp: „Unser Standpunkt ist klar: Keine weitere Zuwanderung aus
Dominik Nepp
wird auch Spitzenkandidat
für
die Landtagswahl
in Wien
13
An der blauen Donau
muslimischen Ländern, sofortige Abschiebung aller integrationsunwilligen
Migranten und all jener, die straffällig geworden sind.“ Umgekehrt
würde in Wien unter freiheitlicher Regierungsverantwortung das Motto
„Österreicher zuerst!“ gelten.
Des Weiteren leistete die Wiener FPÖ erfolgreiche Aufdeckungsarbeit,
insbesondere rund um dem Skandal um die Errichtung des Krankenhauses
Nord (KH Nord), wo unter der politischen Verantwortung
der SPÖ fast eine Milliarde Euro an Steuergeld in den Sand gesetzt wurde,
oder um das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt, welches
den UNESCO-Weltkulturerbe-Status der Wiener Innenstadt ernsthaft
bedroht sowie gegen Autofahrerschikanen seitens der Grünen.
Ein weiterer freiheitlicher Schwerpunkt war das Aufdecken der
rot–grünen Verschwendungspolitik, vor allem im Subventionsbereich,
wo sich die nicht amtsführende Stadträtin Ulrike Nittmann besonders
engagierte. Maximilian Krauss als Bildungssprecher der Wiener
FPÖ kümmerte sich wiederum um die Missstände an den Schulen in
der Bundeshauptstadt. Zu nennen sind hier insbesondere fehlende
Deutschkenntnisse, was eine Folge der gescheiterten rot–grünen Integrationspolitik
ist und dazu führt, dass in Wien laut Zahlen der Denkfabrik
„Agenda Austria“ die Schüler im Vergleich zu anderen Bundesländern
einen deutlichen Lernrückstand haben.
Trotz heftiger
Angriffe: Dominik
Nepp bleibt
immer sachlich
und gelassen
Darüber hinaus ist es Nepp gelungen, die Wiener FPÖ noch stärker
als zuvor als Kontrollpartei zu positionieren. Anfang Dezember
2019 nahm die von den Freiheitlichen auf Schiene gebrachte gemeinderätliche
Untersuchungskommission betreffend „Missstand bei der
Gewährung und Überprüfung der widmungsgemäßen Nutzung von
Fördergeldern durch die Gemeinde Wien“ ihre Arbeit auf. „Mangelnde
Information der Gemeinderäte, nicht nachvollziehbare Gewährung
14
2019–2020
von Fördermitteln und äußerst schlampige Nachkontrolle des Mitteleinsatzes
sind fast die Regel und nicht die Ausnahme!“, begründete Nepp
die Notwendigkeit dieser freiheitlichen Initiative.
Bei dieser Untersuchungskommission wird
besonderes Augenmerk gelegt auf den Verein
„s2arch“ des ehemaligen Grün-Gemeinderates
Christoph Chorherr, der 450.000 Euro
Förderungen – und damit Steuergeld – für
ein Schulprojekt in Südafrika erhalten hatte.
Die Unterlagen dieses Vereins zur Abrechnung
erwiesen sich als unbrauchbar. Weitere
Gegenstände der Untersuchungskommission
waren Subventionen im Umfeld der Gattin des
roten Urgesteins Harry Kopietz, die Missstände
beim Verein Freunde der Donauinsel, beim
SPÖ-Donauinsel-Verein Wiener KulturService,
beim ÖVP-Verein Wiener Stadtfeste,
beim grünen Verein zur Förderung der Stadtbenutzung
und bei vielen anderen Institutionen.
Insgesamt ortet Klubobmann Mahdalik
einen „riesigen rot–grünen Spendensumpf“,
den es trockenzulegen gelte.
„
Mit der Bildung
der türkis–grünen Bundesregierung
Anfang
Jänner 2020 taten sich
neue Chancen für die
Wiener Freiheitlichen
auf, weil die ÖVP ihr
wahres Gesicht zeigte.
Mit der Bildung der türkis–grünen Bundesregierung Anfang Jänner
2020 taten sich neue Chancen für die Wiener Freiheitlichen auf, weil die
ÖVP ihr wahres Gesicht zeigte. Sie brachten im Wiener Gemeinderat
Anträge ein, die dem ehemaligen schwarz–blauen Regierungsprogramm
entsprachen, die aber allesamt von der ÖVP abgelehnt wurden. Die
FPÖ erwies sich daher, wie Nepp betonte, im Kampf gegen politischen
Islam und Ausländerkriminalität und für Fairness für die Österreicher
als „der einzige verlässliche und konsequente Partner“.
Mit der Corona-Krise im Frühjahr 2020 konnten sich die Wiener
FPÖ genauso wie die Bundes-FPÖ als Freiheitspartei positionieren.
Mit dem Abflachen der Infektionszahlen forderte man ein Ende der
freiheitseinschränkenden Maßnahmen, zumal „die Grundregeln unseres
Rechtsstaates missbraucht werden“, wie Parteichef Nepp am 20. Mai
2020 bei einer Kundgebung unter dem Motto „Freiheit für Österreich
– gegen den Corona-Wahnsinn“ sagte. Darüber hinaus zeigten die Freiheitlichen
Verfehlungen und Versäumnisse, insbesondere am Beginn
der Coronakrise – etwa einen Mangel an Schutzausrüstung für medizinisches
Personal – auf und wiesen als einzige Partei darauf hin, dass
sich Asylwerberheime zu regelrechten Covid-19-Brennpunkten entwickelt
hatten.
Mit ihrer Schwerpunktsetzung auf Schutz und Bewahrung der Identität
der autochthonen Wiener sowie auf soziale Themen setzt die FPÖ
Wien unter der Führung von Dominik Nepp ihren Kurs als „soziale
Heimatpartei“ fort. Und in Sachen Coronakrise wurde die FPÖ erneut
ihrem Ruf als Freiheitspartei gerecht.
◆
15
An der blauen Donau
„Die FPÖ ist das Sprachrohr der echten Wiener“
Dominik Nepp, Landesparteiobmann der Wiener FPÖ
und Vizebürgermeister der Stadt Wien, über die Rolle
der Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt und seinen
Kampf gegen den rot–grünen Machtapparat in Wien
Herr Landesparteiobmann, die Wiener Freiheitlichen
können auf lange und erfolgreiche Geschichte zurückblicken.
Die wesentliche Konstante dabei ist, dass
man immer DIE Oppositionkraft gegen die sozialistischen
Machthaber in der Bundeshauptstadt war. Wenn
Sie an der Spitze heuer im Herbst in einen ob der Umstände
schwierigen Wahlgang schreiten, was sind denn die
vorrangigen Ziele der FPÖ?
Dominik Nepp: Die aktuellen Umstände
führen dazu, dass eine starke FPÖ wichtiger
dass wir eine Wiederauflage von Rot–Grün, aber
auch eine mögliche rot–schwarze Koalition in
Wien zu verhindern suchen.
Seit Jahrzehnten leidet Wien an der Massenzuwanderung.
Als externer Beobachter muss man festhalten,
dass sich das Gesicht der Stadt seit den 1980er-Jahren
stark verändert hat. Wo liegen denn die Ursachen dafür,
wer trägt die Verantwortung für diese einschneidenden
Veränderungen?
16
denn je ist. Wien leidet unter einer rot–grünen
Stadtregierung, welche sich ausschließlich mit
Radlwegen und Geschenken an Zuwanderer beschäftigt,
und ganz Österreich leidet unter einer
schwarz–grünen Bundesregierung, die mit allen
ihren Maßnahmen für eine Rekordarbeitslosigkeit
und eine Wirtschaftskrise sorgt. Es ist offensichtlich,
dass eine Veränderung nur durch eine
starke FPÖ möglich ist. Unser Ziel ist es somit,
Nepp: Unsere Warnungen wurden über
Jahrzehnte negiert. Wer eine Islamisierung Wiens
heute noch bestreitet, versteckt sich entweder vor
der Realität oder lügt den Menschen ins Gesicht.
Die Hauptschuld dafür liegt natürlich bei der
Wiener SPÖ. Das „S“ in SPÖ steht inzwischen
mehr für Salafismus als für Sozialdemokratie.
Man hat Zuwanderer mit Sozialgeschenken nach
Wien gelockt und vor einigen Jahren sogar die
2019–2020
Gemeindebauten für Migranten aus aller Welt geöffnet.
Leider hat auch die ÖVP jahrelang diese
falsche Willkommenskultur unterstützt und ist
ebenso hauptverantwortlich für diese Entwicklung
Ẇir sagen klar: Keine weitere Zuwanderung
aus islamischen Ländern und so viele illegale
und kriminelle Migranten abschieben wie nur
möglich!
Die größten Probleme, die dieser Massenzuwanderung
zu „verdanken“ sind, liegen einerseits im Bereich
des Bildungswesens, aber auch in Fragen der sozialen
Sicherheit und im Bereich der Kriminalität. Was wären
denn für die FPÖ die wichtigsten Maßnahmen, um dem
beizukommen?
Nepp: Das Problem beginnt bei der Masse
an Zuwanderern. SPÖ, ÖVP und Grüne haben
eine Anzahl an Migranten nach Österreich
und Wien geholt, welche
schlicht nicht integrierbar ist. Ein hoher
Anteil an muslimischen Zuwanderern
ist auch gar nicht bereit, sich
zu integrieren. Mein Standpunkt ist
bekannt: Wer sich nicht integrieren
will, soll sofort in sein Herkunftsland
zurückgehen.
In den Wiener Schulen haben
wir das Problem, dass mehr als die
Hälfte der Schüler nicht Deutsch
als Umgangssprache hat. Oftmals
gibt es Klassen, wo nur noch
ein oder zwei Kinder Deutsch als
Muttersprache haben. Das sind katastrophale
Entwicklungen, die dazu führen, dass das Bildungsniveau
im Gesamten leidet. Deutsch
muss nicht nur die Unterrichtssprache sein,
sondern auch die vorgeschriebene Sprache in
den Pausen. Es braucht eine Deutschpflicht
am Schulhof!
Im Bereich der sozialen Sicherheit hat die
Zuwanderung zu einer empörenden Ungerechtigkeit
geführt: Wenn eine alleinerziehende
österreichische Mutter, die beispielsweise als
Kassiererin arbeitet und gleichzeitig ihren Erziehungspflichten
nachkommt, am Monatsende
mit weniger Geld in der Tasche aussteigt als
eine fünfköpfige Tschetschenenfamilie, die es
sich in der Wiener Sozialhängematte gemütlich
gemacht hat, dann versteht das kein Mensch.
Wir brauchen in Wien das Credo „Österreicher
zuerst!“, damit endlich wieder Fairness in dieser
Stadt herrscht.
Wenn man in die jüngere Vergangenheit der Wiener
FPÖ blickt, ist da zunächst die Ära Strache, in der man
einige beachtliche und historische Wahlerfolge feiern konnte.
Warum ist es aus Ihrer Sicht aber dennoch nicht gelungen,
die linke Mehrheit in der Stadt zu durchbrechen?
Nepp: Die Erfolge der Wiener FPÖ in
den letzten 15 Jahren sind mehr als beachtlich.
Wir haben immer als Team agiert, und das
hat sich bezahlt gemacht. Es ist vor allem die
Arbeit aller Funktionäre und aller ehrenamtlicher
Helfer, die täglich Zetteln verteilen oder
Plakate kleben, die solche Erfolge erst möglich
machen. Viele von diesen sind natürlich
enttäuscht, wenn sie dann von manchen Abtrünnigen
plötzlich als entbehrlich dargestellt
werden. Doch wir werden gemeinsam unseren
Weg unbeirrt fortsetzen und unser Zusammenhalt
wird uns auch zu alter Stärke zurückführen.
Dieser Weg wird ein beständiger sein,
der früher oder später auch die linke Mehrheit
in dieser Stadt aufbrechen wird.
Auch davor, in den 1990er-Jahren, war die FPÖ
„
In den Wiener Schulen
haben wir das Problem, dass
mehr als die Hälfte der Schüler
Deutsch nicht als Umgangssprache
hat.
in der Bundeshauptstadt bereits stark im Aufwind und
konnte unter Rainer Pawkowicz erhebliche Erfolge erzielen.
Fußt auf diesen bereits historischen Verdiensten der
Erfolg der letzten Jahre?
Nepp: Damals wurde sicherlich die Basis geschaffen,
welche den Grundstein für die nachfolgenden
Erfolge gebildet hat. Ich bin ausgesprochen
froh und dankbar, dass die Vertreter dieser
Ära nach wie vor wichtige Bestandteile der freiheitlichen
Familie sind.
Ein Blick in die Gegenwart und in die Zukunft:
Warum sind und warum werden die Wiener Freiheitlichen
immer ein notwendiger und wesentlicher Faktor in
Wien sein?
Nepp: Die FPÖ ist die einzige Kraft, die sich
klar und konsequent gegen die Willkommenskultur
ausspricht, die für den Erhalt unserer Werte
und unserer Identität kämpft, die Traditionen
und Familie als Basis unserer Gesellschaft sieht.
Alle anderen Parteien bilden in Wahrheit einen
Einheitsbrei aus politischer Korrektheit, EU-Hörigkeit
und Willkommensklatschern. Wir sind die
Korrektur in dieser Stadt, das Sprachrohr der
echten Wiener. Und das werden wir immer bleiben.
◆
17
18
An der blauen Donau
2004–2020
2004–2020
IM RATHAUS GEGEN
DAS „ROTE WIEN“
19
An der blauen Donau
Aktivitäten des FPÖ-Rathausklubs
Die Aktivitäten des freiheitlichen Klubs im Wiener Landtag und
Gemeinderat wiesen spätestens mit der Übernahme der Obmannschaft
der Wiener Landesgruppe durch Heinz-Christian Strache im Jahr
2004 auch eine große Übereinstimmung mit jenen der Bundespartei
auf. Kein Wunder, sind doch gerade die „klassischen“ freiheitlichen
Kernthemen Sicherheit und Migration gerade in der Bundeshauptstadt
von besonderer Bedeutung. Aber dennoch versuchte die Wiener Landespartei,
auch kommunalpolitisch Akzente zu setzen und fand in der
absoluten Mehrheit der SPÖ eine willkommene Angriffsfläche.
Waren es laufende Gebührenerhöhungen, etwa für Kanal und Wasser,
oder auch regelmäßige Erhöhungen der Fahrpreise der Wiener Linien,
versuchte man, die Freiheitlichen als „Partei des kleinen Mannes“
20
2004–2020
und als unentbehrliche Schutzmacht gegenüber dem „Gebührenwahn“
des Roten Wien zu positionieren. Beispielsweise wurden die Gebührenerhöhungen
aufgrund des Wiener „Valorisierungsgesetzes“ als „Anschlag
auf die hart arbeitende Wiener Bevölkerung“ kritisiert. Dies vor
dem Hintergrund, dass der Rechnungshof das Wiener Valorierungsgesetz
als intransparent bezeichnet hatte und dass unter Verantwortung
roter Finanzstadträte die Verschuldung Wiens jährlich stieg – zwischen
2008 und 2018 von 2,2 Milliarden Euro auf 7,5 Milliarden Euro.
Gegen das Rote Wien und
gegen die Große Koalition
Der damalige Landesparteiobmann Strache pflegte dieses Image der
„sozialen Kälte“ des roten Wien durch seinen häufig bei Reden getätigten
Reim „Wo Rot regiert, wird abkassiert“ zu untermauern. Dies
sei besonders in bis dato roten Hochburgen in Wien, beispielsweise in
Favoriten und Simmering erwähnt. Die Veränderung des Wahlverhaltens
in diesen ehemaligen roten Hochburgen verdeutlicht, dass es der
FPÖ gelungen war, sich erfolgreich als „Arbeiterpartei neuen Typs“ zu
positionieren. Vermehrte Auftritte der FPÖ am Viktor-Adler-Markt, ein
aus Sicht der äußerst symbolträchtiger Platz, ist er bekanntlich nach dem
Fortsetzung auf Seite 24 ▶
Der Freiheitliche
Rathausklub
auf Klausur im
Burgenland
21
An der blauen Donau
„Die FPÖ ist in Wien der Gegenpol“
Stadtrat Maximilian Krauss im Gespräch über
die Faszination der Freiheitlichen für junge Menschen
und die verfehlte SPÖ-Schulpolitik in Wien
22
Herr Stadtrat, Sie sind seit mehr als einem Jahrzehnt
bei den Wiener Freiheitlichen engagiert, was hat Sie
damals als sehr jungen Menschen dazu bewogen, sich so
aktiv einzubringen?
Maximilian Krauss: Als junger Mensch waren
es eigentlich zwei Dinge, die dazu geführt haben,
dass ich der FPÖ beziehungsweise der Freiheitlichen
Jugend zuerst und dann der Wiener
FPÖ beigetreten bin. Nämlich einerseits, dass es
im roten Wien extrem viele offensichtliche Probleme
gegeben hat, von denen man schon mal
als junger Mensch betroffen war, wenn man sich
in Parks nicht mehr sicher gefühlt hat, wenn man
dort das Gefühl hatte, dass man auch als junger
Mensch zur Minderheit in der eigenen Heimat
wird und dass es viele Fehlentwicklungen gibt,
die man politisch verändern sollte. Und dann hat
die FPÖ eins geschafft, was mich damals fasziniert
hat, nämlich erstens hat sie die richtigen
Themen angesprochen und zweitens hat sie diese
Themen auch jung und modern kommuniziert
und auf mich so den Eindruck gemacht, dass
man nicht junge Menschen nur belächelt und die
Anliegen nicht ernst nimmt, sondern direkt auf
Augenhöhe mit ihnen kommuniziert und auch
wirklich versucht, echte Probleme zu lösen. Und
dieses Zusammenspiel war für mich ausschlaggebend,
dass ich dann in erster Linie der Freiheitlichen
Jugend beigetreten bin und in Folge dann
auch der FPÖ.
Die Wiener FPÖ ist eine Partei mit einer langen
und interessanten Geschichte, die in der Bundeshauptstadt
manchmal in den fünfziger und sechziger Jahren eine kleinere
Rolle, aber immer eine wesentliche Rolle gespielt hat,
wenn man dann an die letzten
20 bis 30 Jahre denkt. Woher
kommt, Ihres Erachtens, diese
Stärke gegen die Dominanz der
Sozialisten?
Krauss: Ich bin der
Überzeugung, dass die FPÖ
der einzige verlässliche oppositionelle
Faktor in Wien
ist und das seit Jahrzehnten.
Wir erleben ja in Wien in
den letzten 50 Jahren, dass
es fast immer eine SPÖ-Alleinherrschaft
gegeben hat,
mit 50 Prozent plus, wo man
über alles drüber gefahren
ist, wo man alle Posten rot
eingefärbt hat, wo man alle
stadtnahen Betriebe rot eingefärbt
hat und bei den wenigen
Wahlen, wo es keine
absolute SPÖ-Mehrheit gegeben
hat, da hat man sich
dann einen Handlanger geholt,
meistens einen billigen
Jakob, jetzt in letzten zehn
Jahren waren es die Grünen,
vor einigen Jahren war es die ÖVP, die dann
ein bisschen am Verteilungskuchen der Wiener
Roten mitnaschen durften, die auch ein paar Förderungen
bekommen haben, die auch ein paar
Vereine subventioniert bekommen haben, die
dann aber im Wesentlichen, sobald sie eine Regierung
waren, sofort Teil dieses roten Systems
geworden sind und nicht mehr diesen Anspruch,
den eine Oppositionskraft und eine Veränderungskraft
haben muss, nämlich dieses System
aufzubrechen und endlich etwas Neues und Bes-
2004–2020
seres für Wien zu bewegen, gelebt haben, sondern
sie sofort Teil dieses alten Apparats, dieses
Systems geworden sind und da ist die aktuelle Beteiligung
der Grünen in der Regierung seit neun
Jahren das beste Beispiel. Und hier ist die FPÖ
eben der Gegenpol, wir sind die Partei, die sich
nie mit den Roten ins Bett gelegt hat, die immer
grundsatztreu und prinzipientreu geblieben ist
und die deswegen auch von der SPÖ seit über 50
Jahren im Vor hinein bereits als Koalitionspartner
ausgeschlossen wird. Ich glaub aber, dass diese
harte Oppositionspolitik, diese kantige Oppositionspolitik
und dieses Bewahren der Werte, die
die FPÖ ausmachen, viel wichtiger sind und dass
die Leute das deswegen auch mehr schätzen, als
vielleicht kurz in eine Regierung zu kommen und
sich so wie die anderen Parteien von den Roten
einkaufen zu lassen und dann zielsicher
wieder in der Bedeutungslosigkeit zu
verschwinden.
Sie selbst sind ja stark, nicht nur, aber vor
allem in der Wiener Bildungspolitik engagiert.
Wie bewerten Sie denn die Lage in den Wiener
Schulen?
Krauss: Katastrophal! Die Fehlentwicklungen
der letzten Jahre und Jahrzehnte,
Stichwort Massen Zuwanderung,
Stichwort Willkommenspolitik, Stichwort
nicht eingeforderte Integrationsleistung,
die sich in so vielen politischen
Bereichen widerspiegeln, sind natürlich
auch im Bildungs- und im Schulbereich ganz
massiv erkennbar. Wir haben seit einigen Tagen
erst die Studie, dass, wenn man Wiens Schulen
gesamt betrachtet, 52 Prozent Deutsch nicht als
Umgangssprache verwenden, d.h. also, dass nicht
nur die Mehrheit nicht Österreicher als Elternteil
hat, sondern, dass sie auch, soweit nicht hier angekommen
sind als Zuwandererkinder, dass sie
Deutsch als Umgangssprache annehmen und mit
ihren Eltern, mit den Freunden sprechen, sondern,
dass über 50 Prozent, mehr als jeder zweite
Schüler, angibt, dass er Deutsch in Wahrheit nur
für den Unterricht verwendet, aber in der Pause,
im Schulhof und zu Hause nicht Deutsch
spricht. Und das sind verheerende Zahlen. Das
sind über 50 Prozent! In Problembezirken sogar
über 70 Prozent und da sind, wenn man sich den
Bereich der Pflichtschulen und der neuen Mittelschulen
anschaut, teilweise über 90 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler, die Deutsch nicht
als Umgangssprache verwenden. Und wenn wir
da noch sehen, dass in manchem Wiener Bezirk
der häufigst gewählte Name Mohammed ist, das
heißt, auch die Eltern hier schon zeigen, dass sie
nicht mit der Namensfindung ein Zeichen zur
Integration setzen, sondern ganz massiv auf der
Kultur, auf den Namen, auf den Werten beharren,
dann ist das der nächste Beweis dafür, dass
die Integrationsleistung, die jemand seitens der
Politik einverlangen hätte müssen, nicht gelebt
wird und dass das nur zu einem Chaos, auch im
Bildungsbereich führen kann und führen wird.
Und das sehen wir auch in den Zahlen, die daraus
resultieren. Wien ist überall im Bildungsbereich
Schlusslicht, wir haben die höchsten Schulabbrecherraten,
wir haben in der Folge die höchste
jugendliche Arbeitslosigkeit, das alles sind Ergebnisse
von nicht eingeforderten Integrationsleistungen
dieser rot–grünen Politik.
Was muss man anders machen, im Umkehrschluss
gefragt?
Krauss: Anders machen müsste man, dass
„
Ich bin der Überzeugung,
dass die FPÖ der einzige verlässliche
oppositionelle Faktor
in Wien ist und das seit
Jahrzehnten.
die Politik endlich dazu übergeht, Leistungen
einzufordern, wieder zu einer Leistungsgesellschaft,
auch in der Schule, zukommen. Die FPÖ
hat in ihrer Regierungsbeteiligung in den Jahren
2017–2019 einen ganz wesentlichen Pfeiler
schon einmal eingeschlagen, in dem sie unsere
alte Forderung für deutsche Schulen, nach eigenen
Deutschkleinklassen umgesetzt hat und
diesen Kurs müsste man jetzt ganz konsequent
weiterfahren und ausbauen. Deutsch ist auch
als Umgangssprache in Schulen verpflichtend
einführen! Man müsste dafür sorgen, dass hier
eine weitere Integrationsbereitschaft bei den Familien,
bei den Eltern eingefordert wird, dass
Eltern, die ihre Schüler nicht in die Schule schicken,
die keinen Pflichtschulabschluss machen,
auch sanktioniert werden, dass man hier mit der
Familienbeihilfe und mit anderen Sozialleistungen
ansetzt und hier eine Spirale des Drucks zur
Leistungsbereitschaft weiter aufbaut und nicht
den linken Kuschelkurs fährt, Noten abschaffen,
Durchfallen abschaffen, wo am Ende eine Generation
heraus kommt, die auch nicht davon profitiert,
wenn sie die Arbeitslosen von morgen sind.
Wie in jeder Partei gibt es ja auch in der FPÖ Höhen
und Tiefen, da ist sicher der kommende Wahlgang
23
An der blauen Donau
unter den Umständen nicht ganz einfach. Was würden Sie
sich denn für die Wiener Freiheitlichen wünschen, wenn
Sie in diesen Herbst 2020 blicken?
Krauss: Ich wünsche mir und ich gehe davon
aus, dass wir als geschlossene Landespartei
mit Unterstützung auch der gesamten Bundespartei
aus dieser schwierigen Situation das beste
Ergebnis für die Wiener FPÖ herausholen. Es ist
sicherlich der schwierigste Wahlgang seit langem
und ich glaube, dass es doch eine Bewährungsprobe
für die FPÖ sein wird. Ich glaube aber
auch, dass wir mit Dominik Nepp einem Politiker
jetzt an der Spitze haben, der vor einem Jahr die
FPÖ in einer ähnlichen Situation übernommen
hat wie Heinz Christian Strache die FPÖ 2005.
Und genau so, wie es damals gelungen ist, die
FPÖ als Original zu etablieren, zu zeigen, dass
die FPÖ die einzige verlässliche Kraft ist, die auf
der Seite der Wienerinnen und Wiener steht, seit
über 50 Jahren, und dass das Original sich immer
durchsetzt. Das wird die Aufgabe sein und das
wird gelingen und ich glaube, dass wir ein deutliches
Lebenszeichen mit 15 Prozent plus schaffen
können und damit unsere Gegner wieder mal
überraschen werden.
◆
Michael Stumpf,
Dominik Nepp und
Maximilian Krauss
Gründer der heimischen Sozialdemokratie benannt, sollten dieses neue
Image weiter verstärken.
Außerdem zeigten die Wiener Freiheitlichen in jenen Jahren, genauso
wie die Bundes-FPÖ, verstärkt die Verfehlungen der nunmehr auf
Bundesebene regierenden rot–schwarzen Koalition und deren Auswirkungen
auf die Wiener Bevölkerung auf. So hätten etwa die negativen
Folgen der Zuwanderung (die durch die EU-Osterweiterung und die
Masseneinwanderung des Jahres 2015 verstärkt worden seien) auch
24
2004–2020
in den Wiener Schulen nun unübersehbare Spuren hinterlassen. In einer
Aussendung des nichtamtsführenden FPÖ-Stadtrates Maximilian
Krauss vom 9. Mai 2018 heißt es, „dass 51 Prozent der Wiener Schüler
in ihrer Freizeit nicht Deutsch sprechen, sei ein weiterer Beweis für das
völlige Versagen aller Integrationsbemühungen der rot–grünen Stadtregierung,
die außer Milliardenkosten, Jobs für Freunde und Lockrufen
an weitere Zuwanderer wenig weitergebracht hat“. Und Krauss, der Bildungssprecher
der Wiener Freiheitlichen, wird mit den Worten zitiert:
„Es ist ein Gesamtbild, das Wiens Schulen zeichnet: Kaum Deutsch,
sinkende Lernerfolge, dafür steigende Gewalt“.
Und bereits am 25. April 2007 kritisierte die damalige Wiener
FPÖ-Schulsprecherin und Bundesrätin Monika Mühlwerth in einer
Presseaussendung, dass nach neun Schuljahren 20 Prozent der Wiener
Schüler nicht in einem ausreichenden Maße lesen und schreiben
könnten: „Die besondere Chance, die die Stadtschulratspräsidentin
Brandsteidl in der Vielfalt der ausländischen Schüler sieht, ist im roten
Wien gescheitert. 160 muttersprachliche Lehrerinnen haben es nicht geschafft,
dass die Schüler nach Ablauf der Schulzeit auch wirklich ausreichend
lesen und schreiben können“.
Hintergrund dieser zum Ausdruck gebrachten
Zweifel war, dass unter der neuen,
nun rot–schwarzen, Bundesregierung Überlegungen
zur Einführung der Gesamtschule ins
Rollen gekommen waren. Dies vor allem, da
das SPÖ-geführte Bildungsressort unter Ministerin
Claudia Schmied vermeintliche Chancenungleichheiten
mit dem angeblichen Allheilmittel
der Gesamtschule beseitigen wollte.
ÖVP und FPÖ standen Plänen zur Einführung
einer sogenannten Gesamtschule aller 10- bis
14-Jährigen (und der damit verbundenen Abschaffung
des Gymnasiums) ablehnend gegenüber,
während die SPÖ versuchte, hier ihre
ideologischen Vorstellungen umzusetzen. Insbesondere
befürchteten Schwarz und Blau eine
weitere Nivellierung des heimischen Bildungswesens.
Die „große Koalition“ im Bund sollte für
die Wiener Freiheitlichen in weiterer Folge
noch ein beliebtes Ziel der Kritik werden und
maßgeblich zum Erstarken der Blauen in der Opposition beitragen. Die
gesellschaftspolitischen unterschiedlichen Vorstellungen der beiden ehemaligen
Großparteien sollten besonders in den Bereichen Bildung und
Zuwanderung noch öfters zum Vorschein kommen und ein Dauerthema
bis zum Zusammenbruch dieser Koalition im Jahr 2017 bleiben.
Währenddessen gelang es Strache, die FPÖ wieder neu aufzubauen und
ansehnliche Wahlergebnisse einzufahren – bei der Wiener Landtagswahl
2010 schaffte er ein Plus von knapp elf Prozent auf 25,8 Prozent, was
27 Mandate bedeutete. Eine gute Ausgangsbasis. Die SPÖ musste erstmals
seit langem wieder mit einem Koalitionspartner regieren – wenngleich
sie mit 49 von 100 Mandaten eher auf einen Steigbügelhalter als
auf einen gestaltungswilligen Partner angewiesen war. Diesen fand sie in
Die „Große
Koalition“ im Bund sollte
für die Wiener Freiheitlichen
in weiterer Folge
noch ein beliebtes Ziel
der Kritik werden und
maßgeblich zum Erstarken
der Blauen in der
Opposition beitragen.
Fortsetzung auf Seite 27 ▶
„
25
An der blauen Donau
„Die FPÖ wird es immer geben.“
Wiens FPÖ-Klubobmann Toni Mahdalik über die zentralen
Leistungen des freiheitlichen Rathausklubs in Wien
26
Herr Klubobmann, wenn Sie die Leistungen der
Freiheitlichen in der letzten Legislaturperiode im Wiener
Landtag, bzw. Gemeinderat auf die wesentlichsten Themen
reduzieren müssten: Was wären diese?
Toni Mahdalik: Wir haben unsere altbewährten
Stärken als Kontrollpartei voll ausgespielt
und als Anwalt der Wiener Bevölkerung
die rot–grün–
schwarze Packelei
auf allen
Ebenen
bekämpft. Wir
haben insbesondere
mit der von
uns eingesetzten
U-Kommission
zum systematischen
Fördergeldmissbrauch
durch parteinahe
Vereine von
SPÖ, ÖVP und
Grünen einen
großen Erfolg
landen können.
Wir haben nicht
nur skandalöse
Praktiken aufdecken, sondern auch markante
Verbesserungen beim willkürlichen Fördersystem
zum Wohle der Steuerzahler erreichen können.
Die FPÖ hat in den letzten drei Jahrzehnten in
Wien wahre Höhenflüge vollbracht. Dennoch ist es nicht
gelungen, die linke Mehrheit zu druchbrechen. Woran
liegt das?
Mahdalik: Die SPÖ hat in diesen Jahren
mit massiven und vor allem vorzeitigen Einbürgerungen
vor allem muslimischer Zuwanderer
einen Wähleraustausch betrieben und diese mit
hunderten Steuermillionen über diverse Vereine
gefügig gemacht. Die SPÖ pfeift schon lange
auf die einheimische Bevölkerung und hat ihre
Mehrheitsbeschaffer insbesondere aus der Türkei
in die Stadt geschafft. Diese unsauberen Praktiken
konnten wir leider auch durch massive Zugewinne
nicht wettmachen.
Sie sind nunmehr auch schon gut 25 Jahre bei der
FPÖ engagiert – in dieser Zeit hat die Partei viele Höhen,
aber auch manche Tiefen durchmachen müssen. Was
zeichnet die Freiheitlichen aus, dass man immer wieder
reüssieren kann?
Mahdalik: Die FPÖ ist Gott sei Dank nicht
nur eine Partei, sondern eine Gesinnungsgemeinschaft
mit klar definierten Zielen vor allem
im gesellschaftspolitischen Bereich. Wir sind
eine Familie, die gerade in schwierigen Zeiten
mit Feinden sonder Zahl eisern zusammenhält.
Flugsand, der beim leisesten Gegenwind
auch gleich wieder weg ist, ist bei unserer ideologischen
Substanz und Standhaftigkeit ohne
Schäden zu verkraften. Die FPÖ ist nicht umzubringen,
auch wenn es das System zum wiederholten
Male probiert. Die FPÖ wird es immer
geben.
Bezogen auf Wien: Die FPÖ geht auf eine entscheidenden
Wahlgang zu, der bekanntlich nicht einfach
werden wird. Wie kann man das beste aus der Situation
machen?
Mahdalik: Wir bleiben thematisch voll auf
Linie und weichen gerade in der aktuellen Situation
keinen Zentimeter vor der Gutmenschen-Kamarilla
zurück. Wir sind seit 60 Jahren das Original,
und die Menschen wissen genau, was sie von
uns erwarten können. Die harte Linie mag nicht
jedem zusagen, ist aber im Interesse unserer Heimatstadt
unerlässlich.
Wie schon erwähnt regieren in Wien seit über sieben
Jahrzehnten die Sozialisten. Was sind denn die gröbsten
Versäumnisse, die sich in diesen Jahrzehnten aufgebaut
haben?
Mahdalik: Neben dem sauteuren Wähleraustausch
sind vor allem die von der SPÖ geförderten,
muslimischen Parallelgesellschaften
ein massives Problem. Hohe Arbeitslosigkeit und
Kriminalität sind ebenso ein Ausfluss dieser besorgniserregenden
Entwicklung wie Ghettos, wo
sich die Einheimischen wie Fremde im eigenen
Land fühlen.
Abschließend: Wo stehen die Freiheitlichen in Wien
in einem Jahr?
Mahdalik: Dort wo sie immer gestanden
sind, an der Seite der arbeitenden Bevölkerung.
Wir werden einmal mehr gestärkt aus einer
schwierigen Situation herausgehen und der Stachel
im Fleisch des rot–schwarz–grünen Proporzes
sein. Die FPÖ mit Hilfe unsere treuen
Mitkämpfer wird wieder stetig wachsen und ein
Bollwerk gegen den radikalen Islam, die parteipolitische
Packelei oder die Regenbogen-Mafia
sein.
◆
2004–2020
den Grünen, die bis heute gemeinsam mit der
SPÖ die Exekutive in Wien darstellen.
Alternativen zur
rot–grünen
Stadtregierung
Für den freiheitlichen Rathausklub stellte
diese Zusammensetzung der Koalition vielfach
das Schreckensmodell einer politischen Regierung
dar, auch die Medien lieben die Vergleiche
(und noch mehr die Gegensätze) rot–grüner und schwarz–blauer Bündnisse.
Auch Bürgermeister Michael Häupl, der Chef der Wiener SPÖ,
der in der Heftigkeit seiner Aversion den Freiheitlichen gegenüber stets
eine persönliche Stärke sah, war in der Folge in Wien mit ihm nicht ganz
geheuren Plänen seines grünen Koalitionspartners konfrontiert. Dies
betraf insbesondere die Verkehrspolitik und grüne Forderungen, Straßen
in Radwege umzubauen und der fortwährende Kampf gegen die
Autofahrer, denen man doch auch durch die schrittweise Reduktion der
Parkflächen (auch Tiefgaragen waren und sind den Grünen nach wie
vor ein Dorn im Auge) den Garaus machen könnte, begleiteten von nun
den Bürgermeister, der sich noch sichtlich an die unbequeme Situation,
nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit regieren zu können, gewöhnen
musste. Umgekehrt verstärkten die Wiener Freiheitlichen den Kampf
gegen die „Autofahrerschikanen“ und die „Parkplatzvernichtung“, wie
sie es nannten. Zudem sagte die FPÖ dem bei vielen Radfahrern verbreiteten
Rowdytum den Kampf an, etwa mit der Forderung, für Fahrräder
Nummerntafenl einschließlich einer
monatlichen Haftpflichtversicherung
von fünf bis zehn Euro einzuführen.
„Beseitigung bestehender, das örtliche
Gemeinschaftsleben störender
Missstände, hervorgerufen durch
Fahrrad-Rowdies“, lautete der Titel
eines von der FPÖ bei der Gemeinderatssitzung
am 4. Oktober 2012
eingebrachten Dringlichen Antrags.
Zusätzlich zu diesem ideologischen
Gegensatz konnte die Wiener
FPÖ auch von der Schwäche
der anderen Oppositionspartei, der
ÖVP, profitieren, die bei der Wahl
2010 auf knapp 14 Prozent abgestürzt
war und nun die kleinste Fraktion
im Landtag blieb. Oder anders
ausgedrückt: Aufgrund ihrer Stärke
waren in die Freiheitlichen die Opposition
schlechthin, während die
Volkspartei in der öffentlichen und
medialen Wahrnehmung nur am
Rande vorkam.
„
Die Wiener
Freiheitlichen verstärkten
den Kampf gegen die
„Autofahrerschikanen“
und „Parkplatzvernichtung“
der Grünen.
Udo Guggenbichler:
als Organisator des
Wiener Akademikerballs
machte er
sich einen Namen
27
An der blauen Donau
Mahdalik und Nepp:
Mit den anderen
freiheitlichen
Ratsmitgliedern
fordern sie eine
Beendigung des
Corona-Wahnsinns
In Wien mit seinen vielen sozialen Brennpunkten begann sich die
Wiener FPÖ verstärkt als Sozialpartei und damit auch als Alternative
zur SPÖ zu positionieren. Dies geschah durch ein Bekenntnis zum Sozialstaat
und den damit verbundenen finanziellen Zuwendungen. Im Gegensatz
zur SPÖ legte man in freiheitlichen Kreisen jedoch Wert darauf,
dass diese Leistungen – etwa die Vergabe von Gemeindewohnungen
– bevorzugt für eigene Staatsbürger zur Verfügung zu stellen seien.
Einwanderung sei zu reglementieren und stets an einen Leistungsgedanken
zu knüpfen. Gerade in der Bundeshauptstadt, die österreichweit
in vielen Bereichen in puncto Sozialleistungen als besonders großzügig
gilt, stieß man mit dieser Themensetzung auf fruchtbaren Boden. Das
konsequente Beibehalten dieses Kurses sollte 2015 für die Wiener FPÖ
auch zu einem freudigen Ergebnis bei der Landtagswahl 2015 führen:
Fast 31 Prozent und 34 Mandate, zweistärkste Kraft und auch Anspruch
auf das Amt des zweiten Wiener Vizebürgermeisters, das bis 2017 Johann
Gudenus und danach Dominik Nepp bekleiden sollten. Auch auf
Bezirksebene konnte sich die FPÖ in bis dato roten Hochburgen beeindruckender
Zuwachsraten erfreuen, in Floridsdorf und Simmering
erreichte man gar die relative Mehrheit. In Simmering war das Ergebnis
so gut, dass man seither mit Paul Stadler erstmals einen blauen Bezirksvorsteher
stellt.
In der Folge setzte Bürgermeister
und SPÖ-Chef
Häupl die Koalition mit den
Grünen fort, während die
Freiheitlichen – nicht zuletzt
aufgrund der personellen und
finanziellen Verstärkung aufgrund
des hervorragenden
Wahlergebnisses – die kantige
Oppositionsarbeit intensivierten.
Mit Sprechstunden
im Rathaus, einem eigenen
Bürgerservice und regelmäßigen
Stammtischen in den
Bezirksgruppen versucht
man nicht nur, einen Kontrapunkt
zu der von vielen
als abgehoben empfundenen
SPÖ zu setzen, sondern auch
die Interessen der Wienerinnen
und Wiener in die politische
Arbeit einfließen zu
lassen.
Über mangelnden Zuspruch
konnten sich die Freiheitlichen
nicht beklagen,
gaben doch sonderbare Aktionen
der rot–grünen Stadtregierung
häufig Anlass zur
Verwunderung und spiegeln
sicher nicht immer die Meinungen
der Wiener Bevölke-
28
2004–2020
rung wider. So ist im Regierungsabkommen festgehalten, Wien unter
anderem bis 2020 zur „Regenbogenhauptstadt Europas“ zu machen. In
geschriebener Form liest sich dies auf der Webpräsenz der Stadt Wien
folgendermaßen: „Egal ob lesbisch, schwul,
bi, trans, inter oder hetero – Wien steht zu dir!
Unser Ziel ist es, Wien bis 2020 zur Regenbogenhauptstadt
Europas zu machen, die für ihr
gesellschaftliches Klima der Offenheit, Solidarität
und Akzeptanz geschätzt wird“
Auch das Wort „Kriminalität“ sucht man
im Abkommen vergeblich, es wird lediglich
verklausuliert davon geschrieben, dass „regelmäßiger
Informationsaustausch und eine gute
Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft
und Exekutive die Basis für Vertrauen und Sicherheit“
seien. Und wer schon einmal Bekanntschaft mit importierter
Kriminalität gemacht hat, etwa in Form eines ungebetenen Besuches in
den eigenen vier Wänden durch „Kulturbereicherer“, wird sich zusätzlich
darüber freuen, diese ethnische Vielfalt künftig auch verstärkt in
den Reihen der Exekutive vorfinden zu können, denn auch dies war offensichtlich
wichtig genug, im Regierungspakt festgehalten zu werden:
„(…) Gleichzeitig soll besonderes Augenmerk darauf gelegt werden,
dass sich die Demografie der Bevölkerung verstärkt im Personal der
Exekutive widerspiegelt und die Aufnahme insbesondere von Frauen
und zugewanderten Menschen in den Exekutivdienst gefördert wird.“
„
Der Anteil der
fremden Tatverdächtigen
lag somit bei
51,4 Prozent.
Punkten mit dem Migrationsthema
Nicht nur die Freiheitlichen, sondern auch zahlreiche Wienerinnen
und Wiener stellten, wie die Wahlergebnisse bestätigen, fest, dass das
Verschließen der Augen vor den Folgen unkontrollierter Einwanderung,
zu denen nun einmal die steigende Kriminalität zählt, zu einem der
gravierendsten Missstände der rot–grünen Stadtregierung gehört. So
teilt etwa die Wiener Landespolizeidirektion in einer Aussendung im
August 2018 zwar mit, dass die Kriminalität insgesamt rückgängig sei,
sehr wohl aber Ausländer überproportional häufig zu den Tatverdächtigen
gehörten: „Bis Ende Juni 2018 konnte die Wiener Polizei insgesamt
38.726 Tatverdächtige ausforschen und anzeigen, darunter 19.895
fremde Tatverdächtige. Der Anteil der fremden Tatverdächtigen lag somit
bei 51,4 Prozent. 2017 lag er bei 52,4 Prozent. Zu den häufigsten
Herkunftsländern der fremden Tatverdächtigen zählten bis Ende Juni
2018 Serbien (3.007 Tatverdächtige), Rumänien (1.511 Tatverdächtige),
Afghanistan (1.325 Tatverdächtige), Türkei (1.280 Tatverdächtige) und
Slowakei (937 Tatverdächtige).“
Um der steigenden Kriminalität Herr zu werden, forderten die Wiener
Freiheitlichen die konsequente Abschiebung ausländischer Straftäter,
die Aufstockung der Wiener Polizei um 1.500 Beamte, den Aufbau
einer eigenen U-Bahn-Polizei und die Bildung einer Sicherheitswacht
zur Unterstützung der Polizei wie etwa in München. Auf Bezirksebene
wurden unter anderem Alkoholverbote an Brennpunkten wie etwa dem
Reumannplatz in Favoriten gefordert. Seit 2018 gibt es eine Alkohol-
Fortsetzung auf Seite 31 ▶
29
An der blauen Donau
„Die FPÖ ist die einzige Alternative“
Stadträtin Ulrike Nittmann über die Rolle der
Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt
30
Frau Stadträtin, warum ist die Wiener FPÖ ein
wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die linke Macht in
der Bundeshauptstadt im Zaum zu halten?
Ulrike Nittmann: Die FPÖ hat in Wien eine
jahrzehntelange Erfahrung in der Kontroll- und
Oppositionsarbeit. Wir sind nicht, wie viele anderen,
vom SPÖ-System
abhängig, sondern schauen
den Mächtigen auf die
Finger. Unser Schwerpunkt
ist seit Jahrzehnten
die Einwanderungspolitik,
die seit vielen Jahren
in Wien aus dem Ruder
läuft. Die SPÖ hat zu
viele Menschen aus aller
Herren Länder nach
Wien eingeladen, die
bis heute nicht bereit
sind, sich zu integrieren.
Wir haben schon
in den neunziger Jahren
mit dem Volksbegehren
„Österreich zuerst“ diese
virulenten Probleme angesprochen.
Was wir damals
vorhergesehen haben, wurde zur traurigen
Realität. Die FPÖ ist als soziale Heimatpartei mit
einer klaren rot–weiß–roten Handschrift das einzige
Bollwerk gegen diese rote Migrationspolitik.
Für uns war und ist immer wichtig, dass sich die
Österreicher in ihrer Stadt noch heimisch fühlen.
Die „nichtamtsführenden Stadträte“ in Wien sind
immer wieder in der Kritik der medialen Öffentlichkeit.
Wie begegnet man dem?
Nittmann: Die SPÖ hat in dieser Frage schon
vor vielen Jahrzehnten mittels Verfassungstrick
die Bundesverfassung ausgehebelt. Auch in Wien
haben alle Parteien im Gemeinderat nach Maßgabe
ihrer Stärke Anspruch darauf, im Stadtsenat
vertreten zu sein. Damit ist natürlich eine integrative
Mitwirkung der Parteien gemeint. Die
FPÖ hat in Wien immer darum gekämpft, eigene
Ressorts zugeteilt zu bekommen, um aktiv in
der Wiener Landesregierung auch Maßnahmen
umsetzen zu können. Etwa im Bereich der Sicherheitspolitik,
aber auch in der Gesundheits-,
Frauen- und Spzialpolitik. Dies wurde uns von
der SPÖ immer verwehrt, weil sie die alleinige
Macht an sich reißen wollte. Das Ergebnis sehen
wir am Chaos im Wiener Gesundheitsbereich –
Stichwort Skandalbau KH Nord – aber auch in
der Kriminalitätsentwicklung. Trotz allem machen
wir aus unserer Stärke heraus eine effiziente
Oppositionspolitik und decken zahlreiche
Skandale auf. Unser Team kann eine gewaltige
Leistungsbilanz vorzeigen.
Wo sehen Sie denn die wesentlichen Themenschwerpunkte
der Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt?
Nittmann: Der Hauptschwerpunkt liegt
selbstverständlich auf der verfehlten Einwanderungspolitik,
die Einfluss auf all unsere Lebensbereiche
hat. Im Bereich der Sicherheit wollen wir
eine Stadt, in der sich Frauen zu jeder Tages- und
Nachtzeit auf Wiens Straßen frei bewegen können,
ohne Angst haben zu müssen. Sehr wichtig
ist die Bildung, wo es Schulklassen gibt, in denen
kein einziges österreichisches Kind unterrichtet
wird. Wir haben Schulen mit einem über fünfzigprozentigen
Anteil von Kindern mit nichtdeutscher
Muttersprache, was zu weniger Chancen am
Arbeitsmarkt und hoher Arbeitslosigkeit für die
Jugendlichen und für Frauen führt. Das Gesundheitssystem
platzt aus allen Nähten und steht vor
einem dauernden Kollaps, qualitativ wie quantitativ.
Äußerst wichtig ist für mich auch die Frauenpolitik.
Durch die – von der SPÖ verursachte –
zunehmende Islamisierung der Stadt werden viele
Frauen an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Aber auch die Coronavirus-Krise hat ganz deutlich
gezeigt, dass die Hauptleidtragenden Frauen
in systemrelevanten Berufen waren, die ihren Job,
die Kinderbetreuung und das Homeschooling der
Kinder unter einen Hut bringen mussten. Solange
Gleichberechtigung nur am Papier steht, ist Frauenpolitik
wichtiger denn je. Die Politik ist gefordert
Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es
Frauen und Männern ermöglicht wird, Familie
und Beruf optimal zu vereinen.
Wie kann man denn das Jahrzehnte alte Netzwerk
der Macht der Sozialisten, nunmehr gepaart mit grünen
Versatzstücken, in Wien durchbrechen?
Nittmann: Indem man die roten Machenschaften
weiter konsequent aufzeigt und den
Menschen eine glaubwürdige Alternative anbietet.
Und die FPÖ ist die einzige Alternative zur
rot–schwarz–grünen Einheitspolitik in Wien. Ein
freiheitlicher Bürgermeister, der das verstaubte
SPÖ-System aufbricht und wieder eine Politik für
die Österreicher macht, würde dieser Stadt sehr
gut tun.
◆
2004–2020
verbotszone im Bereich des Pratersterns. Dieses wurde erst beschlossen,
nachdem zuvor lange Zeit entsprechende Anträge der FPÖ von
der SPÖ abgelehnt worden waren. Aber offenbar führte der wachsende
Unmut der Bevölkerung über die Zustände an diesem wichtigen Umsteigebahnhof
wie Alkoholexzesse von Obdachlosen, viele davon aus
Osteuropa, zu einem Meinungsumschwung bei den Genossen. Oder
anders ausgedrückt: Die Hartnäckigkeit der Freiheitlichen machte sich
letzten Endes bezahlt. Und FPÖ-Innenminister Herbert Kickl ordnete
im Mai 2019 die Wiedererrichtung einer Polizeiinspektion am Praterstern
an und setzte damit eine langjährige Forderung der Wiener Freiheitlichen
zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung um.
Mit einer Vielzahl von Anträgen im Gemeinderat sowie in den Bezirksvertretungen
unterstrichen die Wiener Freiheitlichen darüber hinaus
ihre Forderungen im Sicherheitsbereich sowie bei anderen Themen.
Eine weitere Folge der schrankenlosen
Einwanderung ist die schleichende Islamisierung
Wiens, die zahlreiche besorgte Wiener
nicht als kulturelle Bereicherung auffassen,
sondern als Bedrohung ihrer kulturellen Identität.
Denn in keinem anderen Bundesland als
in Wien zeigen sich die drastischen Folgen dieser
Entwicklung so eindeutig. In den Wiener
Hauptschulen (bzw. den „Neuen Mittelschulen“)
ist der Islam mittlerweile deutlich in der
Mehrheit: So schreibt orf.at in einer Meldung
vom 9. September 2019, dass von rund 30.000
Mittelschülern in Wien bereits 40 Prozent dem
Islam angehörten – Katholiken würden nur
noch 25 Prozent in diesem Schultyp stellen.
„
Außerdem wurden
2018 mehrere Fälle islamischer
Kindergärten
bekannt, die großzügige
Förderungen der Stadt
Wien erhalten.
Außerdem wurde, 2018 mehrere Fälle islamischer Kindergärten bekannt,
die großzügige Förderungen der Stadt Wien erhalten. Nicht nur
die politische Opposition in Wien, sondern auch unabhängige Experten
wie der Islamforscher Ednan Aslan von der Universität Wien hielten
vielfach fest, dass in Teilen dieser Einrichtungen weder ein interkultureller
oder interreligiöser Dialog unter den Kindern stattfinde noch dass
nach westlichen Maßstäben pädagogische Mindeststandards eingehalten
würden. „Die Interviews mit den Betreibern belegen auch, dass der
Koran- und Religionsunterricht eine zentrale Aufgabe der Kindergärten
und -gruppen und wesentlicher Bestandteil des Unterrichts war“, ist in
der Studie zu lesen. Und die islamistische Ausrichtung war der Stadt
Wien offenkundig egal: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
muslimischen Betreiber mit ihren öffentlich einsehbaren Konzepten,
Alltagsprogrammen und Werbeaktionen die Stadt offen über ihre religiöse
Ausrichtung informiert haben.“ Aslan berichtet auch von einem
Aktenvermerk, der ein „ernüchterndes Bild von der Kontrollkompetenz
der Inspektoren zeichnet“. So liste das Förderkontrollreferat einige Kindergärten
und -gruppen mit dem Vermerk auf, dass in den erwähnten
Kindergärten, „unzureichend Deutschkenntnisse vermittelt werden“.
Die FPÖ Wien sah sich in ihren Warnungen vor einer Islamisierung
bestätigt und kritisierte scharf die SPÖ, die mit ihrer Politik diese Entwicklung
ermöglicht habe. Insbesondere forderten die Freiheitlichen
eine Streichung der Subventionen für Kindergärten, in denen die Kin-
31
An der blauen Donau
„
Mit der schrankenlosen
Masseneinwanderung
des Jahres 2015
wurde die Einwanderung
in den österreichischen
Sozialstaat noch mehr
zu einem Thema der Wiener
Freiheitlichen.
der religiös-islamistisch indoktriniert werden. „Ein Kindergarten, der
in seinem Bildungsprogramm die Bedeutung des Türkentums und des
Islam betont, hat keinerlei Ansprüche auf öffentliche Förderung“, hieß
es 2018 aus dem freiheitlichen Rathausklub.
Mit der schrankenlosen Masseneinwanderung des Jahres 2015 wurde
die Einwanderung in den österreichischen Sozialstaat noch mehr zu
einem Thema der Wiener Freiheitlichen. Schließlich bedeutete diese
Entwicklung auch eine massive Belastung der Steuerzahler. Laut einem
Bericht der Stadt Wien lag die Zahl der Bezieher
der Mindestsicherung Ende Dezember 2018 bei
130.746 Personen. Gegenüber Dezember 2017
bedeutete das zwar einen Rückgang von 669 Personen
bzw. ein Prozent, aber dem stand ein deutlicher
Anstieg der Mindestsicherungsbezieher mit
Asylstatus gegenüber. Im Dezember bezogen in
Wien 40.432 Asylberechtigte Mindestsicherung,
gegenüber 36.952 im Dezember 2017. Rechnet
man auch noch die Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten,
kommt man auf 46.799 Mindestsicherungsbezieher
und Asyl-Hintergrund.
Und im Mindestsicherungsbericht der Stadt
Wien ist zu lesen: „2017 besaßen 49 Prozent der
WMS-Bezieher (WMS=Wiener Mindestsicherung)
die österreichische Staatsbürgerschaft.
Rund 29 Prozent waren Personen aus Drittstaaten
und 14 Prozent der Personen in der WMS
hatten eine unbekannte Staatsbürgerschaft (Asylund
subsidiär Schutzberechtigte).“ Im Jahr 2017 verschlang in Wien die
Mindestsicherung laut dem von der Magistratsabteilung 40 veröffentlichten
Zahlen 561,43 Millionen Euro. Dazu kamen noch Ausgaben
in Höhe von 44,87 Millionen Euro für ergänzenden Wohnbedarf
(Mietenmehrbedarf) und 31,66 Millionen Euro an Krankenversicherungsbeiträgen.
Bei ihrer Klubklausur 2016 forderte die Wiener FPÖ
angesichts der dramatisch steigenden Kosten eine Streichung Mindestsicherung
für Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte. Während der
türkis–blauen Bundesregierung (2017-2019) kam es dann – nicht zuletzt
aufgrund der Vorbereitungsarbeiten der Wiener Freiheitlichen, die auf
den Erfahrungen in der Bundeshauptstadt beruhen – zu einer massiven
Kürzung der Mindestsicherung für integrationsunwillige Einwanderer.
Bei schlechten Deutsch- oder Englischkenntnissen oder bei Fehlen
eines Pflichtschulabschlusses soll der Betrag von 863 Euro um 300 Euro
gekürzt werden. Für die Umsetzung sind aufgrund der Kompetenzverteilung
der Bundesverfassung die Bundesländer zuständig, wobei das
rot–grün regierte Wien säumig blieb.
Oppositions- und Kontrollpartei
32
Als Oppositionspartei konnten die Wiener Freiheitlichen oft nicht
viel mehr tun als nur Forderungen zu stellen. Das konnte die FPÖ aber
nicht daran hindern, ihrem Ruf als Kontrollpartei gerecht zu werden.
Dies betraf zuletzt vor allem den SPÖ-Skandal um die Errichtung des
Fortsetzung auf Seite 25 ▶
2004–2020
Krankenhauses Nord (KH Nord), der im Rahmen einer Untersuchungskommission
des Gemeinderates aufgerollt wurde. Die Baukosten von
ursprünglich 825 Millionen Euro hatten sich auf 1,6 Milliarden Euro
fast verdoppelt und die Inbetriebnahme musste mehrfach verschoben
werden.
Vor allem aber ist das KH Nord ein Musterbeispiel für die Geldverschwendung
und Günstlingswirtschaft der SPÖ. Der Architekt hatte
keine Erfahrungen in der Planung von Spitälern, war aber, so der
„Kurier“, ein „SPÖ-naher Haus- und Hofarchitekt der Stadt Wien“.
Die Folgen waren, wie ein Sachverständigengutachten ergab, „gravierende
Planungsfehler“. Abgerundet wird die Sache vom Rechnungshof,
der dem Krankenanstaltenverbund und damit der SPÖ ein vernicht-
Die Wiener FPÖ:
Vizebürgermeister
Nepp sitzt mittlerweile
fest im Sattel
33
An der blauen Donau
„Zusammenhalt ist unsere Stärke“
Wiens FPÖ-Landesparteisekretär Michael
Stumpf über die Chancen und die zentralen
Themen der Wiener Freiheitlichen
34
Herr Landesparteisekretär, der Wiener FPÖ steht
im Herbst 2020 ob der Umstände ein schwieriger Wahlgang
bevor. Was sind denn die größten Herausforderungen?
Michael Stumpf: Die Wiener FPÖ ist dank
ihrer organisatorischen und personellen Struktur
stark genug, in einem direkten Straßenwahlkampf
im persönlichen Austausch mit der Wiener
Bevölkerung punkten zu können. Die größte
Herausforderung sehen wir darin, mit unseren
politischen Botschaften und unserem Programm
auch auf medialer Ebene Gehör zu finden. Die
tendenziöse Hofberichterstattung hat sich seit
der „Ibiza-Affäre“ nahezu überall durchgezogen
– entweder wird über die FPÖ nicht berichtet,
oder sie wird, ähnlich wie in einem Vernichtungskrieg,
mit allen Mitteln bekämpft. Derzeit mit
Sachthemen durchzukommen ist fast unmöglich,
vor allem seit die schwarz–grüne Bundesregierung
sich mit einer um etliche Millionen erhöhten
‚Presseförderung‘ angenehme Berichterstattung
erkauft hat. Daher werden wir auf einen
sehr starken Straßenwahlkampf setzen, denn das
bewährteste Rezept ist immer noch der direkte
Kontakt mit den Menschen.
Welche inhaltlichen Themen sehen Sie denn am wichtigsten
für die FPÖ, rückblickend, aber auch in die Zukunft
gedacht?
Stumpf: Im Hinblick auf die Corona-Verordnungen
ist es ohne Zweifel der Schutz von
Grund- und Freiheitsrechten. Die Bürger haben
ein Recht auf Freiheit, Sicherheit und Planbarkeit
ihres Lebens! Diese bestehen unter anderem
in einer Stärkung der Regionalität, der eigenständigen
Versorgung mit Lebensmitteln und
Energie sowie in einer Abkehr von der dogmatischen
Gleichsetzung von Globalisierung und
Fortschritt. Es braucht eine Arbeitsplatzgarantie
für alle Arbeitnehmer und einen vollen Ersatz
der durch die Coronavirus-Epidemie verursachten
Einbußen, so wie es im Epidemiegesetz ursprünglich
vorgesehen war. Klar ist auch geworden,
dass auf die Europäische Union in solchen
Krisenzeiten kein Verlass ist.
Darüber hinaus setzen wir selbstverständlich
auf unsere Kernthemen Sicherheits-, Zuwanderungs-,
Verkehrs- und Gesundheitspolitik.
Blicken wir in die jüngere Vergangenheit: Wo waren
für Sie persönlich die historischen Höhepunkte der letzten
Jahre?
Stumpf: Seit 2015 verfügt die FPÖ im Wiener
Gemeinderat und Landtag als einzige Kontrollkraft
mit ihrer Stärke über die Möglichkeit,
im Alleingang den Verfassungsgerichtshof,
den Bundesrechnungshof oder den Stadtrechnungshof
anzurufen. Auch die Einsetzung von
Untersuchungskommissionen, wie etwa zum
Milliardengrab Krankenhaus Nord oder zu den
Fördermissständen bei SPÖ- und Grün-nahen
Vereinen, geht auf die Initiative der FPÖ zurück.
Deswegen ist es so wichtig, sich dessen bewusst
zu sein, dass nur mit einer Stimme für die FPÖ
eine echte Kontrolle der Stadtregierung sichergestellt
werden kann.
Ich empfand aber auch die Regierungsbeteiligung
der FPÖ auf Bundesebene als Höhepunkt,
da dadurch wichtige Projekte wie etwa die Einführung
des „Familienbonus Plus“, die Verhinderung
des UN-Migrationspaktes, aber auch eine
greifende Sicherheitsoffensive sichergestellt werden
konnte.
Was macht denn die wesentliche Stärke der Wiener
FPÖ aus, in guten, wie in schlechten Zeiten?
Stumpf: Das ist definitiv der Zusammenhalt
innerhalb der Wiener Landesgruppe, auch wenn
uns manche Medien genau diesen Zusammen-
2004–2020
halt absprechen oder ins Lächerliche ziehen wollen.
Ich kann versichern: Wir Freiheitliche, die
wir uns nichts vorzuwerfen haben, halten jetzt
mehr denn je zusammen und verfolgen umso
entschlossener unsere freiheitlichen Ziele. Und
dieser ungebrochene Kampfgeist stärkt uns, unseren
Fokus nicht zu verlieren: Nämlich Wien
für uns Wiener wieder in eine bessere Zukunft
zu führen, wo sich die Wiener Bevölkerung nicht
mehr als Fremde in ihrer eigenen Stadt fühlt.
Wo sehen Sie die Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt
in einem Jahr?
Stumpf: In einem Jahr wird es mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit eine
rot–schwarze Stadtregierung geben. Das bedeutet
Stillstand, weitere Schulden und Vereinsförderungsskandale.
Die Probleme in unserer Stadt
wie etwa Wohnungsnot, Kriminalität, Willkommenskultur,
Gesundheitsnotstand, Bildungsmisere,
Islamisierung und so weiter werden ja durch
Rot-Schwarz genauso wenig gelöst werden wie
bisher von Rot–Grün. Man sieht ja jetzt schon im
Gemeinderat, wie sich die ÖVP – entgegen der
Bundeslinie – in Wien an die SPÖ anbiedert und
bei vielen Themen mit Rot-Grün stimmt, während
Kurz den Wählern eine genau entgegengesetzte
ÖVP-Position verkaufen will. In dieser
Situation wird es in einem Jahr noch wichtiger
sein, dass hier eine starke FPÖ in Wien als kontrollierendes
Gegengewicht dieser rot–schwarzen
Packelei auf die Finger schaut. Denn es ist
jetzt schon klar, dass auch nach der Wien-Wahl
nur die FPÖ die Interessen der Wiener vertreten
wird, während die SPÖ die Gewerkschaft der
Migranten, Asylanten und Linkslinken spielt und
die ÖVP sowieso nur ihre eigenen Interessen verfolgen
wird.
◆
endes Zeugnis ausstellt, was die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
betrifft. Unter anderem ist von fehlenden Ressourcen und fehlendem
Know-how und 8.186 Baufehlern im angeblich „modernsten Krankenhaus
Europas“ die Rede. Die Baumängel konnte auch jener „Bewusstseins-Choach“
nicht verhindern, der für wohlfeile 95.000 Euro einen
„Energie-Ring“ um die Baustelle des KH Nord zog und die „Schwingungen
am Spitalsgrundstück erhöhen“ wollte.
Im Zuge der U-Kommission des Gemeinderates konnte die blaue
Fraktion wichtige Aufdeckungsarbeit leisten und kam in ihrem Endbericht
zu dem Schluss: „Das Untersuchungsergebnis des Skandalbaus
ist eine Verkettung aus Unwissenheit, Inkompetenz sowie mangelnder
FP-General sekretär
Schnedlitz und
FP-Gemeinderat
Kohlbauer
35
An der blauen Donau
Toni Mahdalik und
Dominik Nepp
Kommunikation der politischen Verantwortungsträger.“ Zudem ist die
FPÖ überzeugt, dass es SPÖ und Grünen im Zuge der U-Kommission
nicht gelungen sei, die Bürger hinters Licht zu führen, um sich von den
Vorwürfen reinzuwaschen. Das KH-Nord gilt als größter Bauskandal
der jüngeren Vergangenheit, die politisch Verantwortlichen vor allem in
den Reihen der SPÖ seien überführt. „Das Wichtigste ist, diese beiden
Parteien in Zukunft davon abzuhalten, jemals wieder ein Bauprojekt
dieser Größe und in dieser Form ‚managen‘ zu lassen. Bei der nächsten
Wien-Wahl haben die Wiener die Gelegenheit, der Stadtregierung
die blaue Karte zu zeigen“, erklärte der freiheitliche Klubobmann Toni
Mahdalik Ende April 2019 in einer Aussendung.
Ein anderer Bereich, in welchem große Summen an Steuergeld
verpulvert werden, ist das Subventionswesen. Insbesondere die SPÖ
bedient hier ihre in Vereinen organisierte Klientel, und in kleinerem
Ausmaß auch ÖVP und Grüne. Um auch im undurchsichtigen Subventionsdschungel
Licht ins Dunkel zu bringen, nahm Ende 2019 die
auf Initiative der Freiheitlichen ins Leben gerufene gemeinderätliche
Untersuchungskommission zu Fördervergaben an Wiener Vereine ihre
Tätigkeit auf. Die Freiheitlichen wiesen darauf hin, dass die Prüfung
des Rechnungshofs bestätigt habe, was die Wiener Freiheitlichen schon
lange vermuten, nämlich Unstimmigkeiten hinsichtlich regelmäßiger
Subventionen zahlreicher Parteifeste von SPÖ, ÖVP und Grünen.
„Undurchsichtige Vergabe von Fördergeldern, dubiose Förderanträge
36
2004–2020
parteinaher Vereine und fehlende Transparenz
beim Einsatz öffentlicher Mittel werden immer
offensichtlicher. Die von der Wiener FPÖ beantragte
U-Kommission wird die Flüsse von
Subventionen an parteinahe Vereine schonungslos
aufdecken“, erklärte der blaue Vizebürgermeister
Dominik Nepp. Die Stadt Wien
schütte jährlich hunderte Millionen Euro an
Förderungen an unzählige private Vereine aus.
„Unter den Nutznießern findet man zahlreiche
Vorfeldorganisationen und Vereine von SPÖ,
ÖVP und Grünen“, erinnerte Nepp an die
großzügige Unterstützung der Stadt für zum
Beispiel das Donauinselfest (SPÖ), das Stadtfest
(ÖVP) oder das Kulturfestival Wienwoche
(Grüne).
„
Der freiheitliche
Parlamentsklub hat
wichtige Arbeit auf einem
sehr breiten Themenfeld
im Interesse der
Steuerzahler und zum
Wohle der Wienerinnen
und Wiener geleistet.
Im Mai 2020 konnte die Wiener FPÖ bereits
eine erste positive Zwischenbilanz dieser
Untersuchungskommission ziehen. So hätten etwa „durch geschickte
Fragestellung und unnachgiebiges Nachhaken rasch grobe Probleme
freigelegt und angesprochen werden können.“ Zudem habe die Arbeit
im Gremium bereits zu „konkreten Änderungen in der magistratsinternen
Organisation“ gemündet.
Eine Rückschau auf die Jahre von 2010 bis 2020 verdeutlicht, dass
der freiheitliche Parlamentsklub wichtige Arbeit auf einem sehr breiten
Themenfeld im Interesse der Steuerzahler und zum Wohle der Wienerinnen
und Wiener geleistet hat.
◆
37
38
An der blauen Donau
2004–2019
2004–2019
HERAUSFORDERER
DES „ROTEN WIENS“
39
An der blauen Donau
Die „Wiener FPÖ“
in der Ära Strache
„
Der politisch
sehr erfahrene Kabas
blieb Klubobmann und
unterstützte in dieser
Funktion den erst 35-jährigen
Strache.
Der 28. Februar 2004 bedeutete für die FPÖ Wien den Beginn einer
neuen Ära. Auf dem 28. ordentlichen Landesparteitag der Freiheitlichen
wurde Heinz-Christian Strache mit 84,6 Prozent der Stimmen zum
Nachfolger von Hilmar Kabas als Landesparteiobmann gewählt. Zu Straches
Stellvertretern wurden Johann Herzog, Eduard Schock und Veronika
Matiasek gewählt. Der politisch sehr erfahrene Kabas blieb Klubobmann
und unterstützte in dieser Funktion den erst 35-jährigen Strache.
Viele politische Beobachter fragten
sich damals, wer denn Heinz-Christian
Strache – der ein gutes Jahr später, nach
der Abspaltung des orangen „Bündnis
Zukunft Österreich“ (BZÖ) von Jörg
Haider auch die Führung der Bundes-
FPÖ in einer politisch äußerst schwierigen
Lage übernehmen sollte – eigentlich
sei. „HC“,
wie ihn Freunde
und politische
Weggefährten
nannten, erblickte
am 12.
Juni 1969 in einer
bürgerlichen
Familie das
Licht der Welt.
Der Großvater
– nach 1945 mit
seiner Familie
aus Reichenberg
(Sudetenland)
vertrieben – studierte
Hochund
Tiefbau.
Die Mutter mit Wurzeln im baden-württembergischen
Heidelberg war bis zu ihrer
Pension Drogistin in Wien. Strache, der
als Einzelkind in Wien-Landstraße aufwuchs,
besuchte die Neulandschule in
Wien und später das private Internat der
Schulbrüder in Strebersdorf.
Nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker
und abgeleistetem Präsenz-
40
2004–2019
dienst zog es Strache schon sehr bald in die Politik. 1991 wird er zum
jüngsten Bezirksrat in Wien gewählt und verdient sich seine ersten politischen
Sporen in der Bezirksvertretung. Wenig später gründet er seine
eigene Firma und macht sich als Zahntechniker mit eigenem Labor selbständig.
1993 wird er mit 24 Jahren im 3. Bezirk zum Bezirksparteiobmann
gewählt und macht die Freiheitlichen in der Landstraße zur stärksten
Bezirksgruppe der Wiener FPÖ. 1996 beginnt Strache als einer der
jüngsten im Wiener Stadtparlament, und ein Jahr später holt ihn Rainer
Pawkowicz in den Wiener Landesparteivorstand. Vom politischen Gegner
wurde der neue FPÖ-Landesparteiobmann, der als pennaler Burschenschafter
mit den Werten der Bürgerlichen Revolution von 1848
durchaus vertraut ist, rasch als „Hardliner“ abgestempelt.
Am 23. Oktober 2005 hatte Strache mit der Wiener Landtags- und
Gemeinderatswahl seine politische Feuertaufe zu bestehen. Das politische
Umfeld war nach der Abspaltung des BZÖ, das der (Bundes-)
FPÖ einen großen Schuldenberg hinterlassen hatte, denkbar ungünstig.
Zudem forderte Strache Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) zum „Duell
um Wien“ heraus. Auf Plakaten stand unter dem Konterfei Häupls
Gipfelstürmer
Vilimsky, Strache,
Gudenus und Kickl
41
An der blauen Donau
„Mehr Geld für Asylanten“, „EU-Kriegseinsätze“ sowie „Türkei zur
EU“, und unter jenem des freiheitlichen Herausforderers „Mehr Geld
für echte Wiener“, „Neutralität schützen“ und „Türkei-Beitritt verhindern“.
Beim Wiener Wahlkampf 2005 wurde deutlich sichtbar, dass die
FPÖ – auch bundespolitisch – die Entwicklung hin zur „sozialen Heimatpartei“
einschlägt.
Islamisches Zentrum
in Wien im
21. Bezirk: Islamisierung
war – und
ist – ein wichtiges
Thema der FPÖ
Das „Duell um Wien“
Mehr noch als das „Duell um Wien“ sorgten verschiedene freiheitliche
Wahlkampfslogans für Aufsehen – und vor allem für Kritik aus
politisch korrekten Kreisen, zumal die FPÖ die Themen Islamisierung
und Überfremdung zu ihren Wahlkampfschwerpunkten machte. Die
politische Konkurrenz, Gralshüter
der politischen Korrektheit sowie
linkskirchliche Kreise mokierten
sich über Sprüche wie „Freie
Frauen statt Kopftuchzwang“,
„Pummerin statt Muezzin“ oder
„Daham statt Islam“. Dies sei
ausländer- bzw. islamfeindlich, behaupteten
die Gegner der Freiheitlichen,
die eifrig die Rassismuskeule
schwangen. Die FPÖ betonte
hingegen die Identität Österreichs
bzw. der autochthonen Wiener gegenüber
den Gefahren einer ungezügelten
Zuwanderung, für welche
die in der Bundeshauptstadt damals
mit absoluter Mehrheit regierende
SPÖ verantwortlich gemacht wurde.
Die Österreicher bzw. die echten
Wiener sollten wieder „Herr
im eigenen Haus“ sein, während
die SPÖ in Wien „für noch mehr
Zuwanderung, für mehr Geld für
Asylwerber und Zuwanderer steht
und die Wienerinnen und Wiener
vielfach im Regen stehen lässt“, wie
Strache in einem Interview sagte.
Hinter ihm als Spitzenkandidaten
folgten auf der Landesliste Eduard
Schock, Veronika Matiasek, Harald
Stefan, Gerald Ebinger, Johann
Gudenus, Johann Herzog und Toni
Mahdalik.
Verstärkt wurde die Furcht
vor der drohenden Islamisierung
durch die 2005 beschlossene Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der
Türkei seitens der Europäischen Union. Laut Angaben der Stadt Wien
waren in jenem Jahr bereits 29,7 Prozent der Bevölkerung ausländischer
Herkunft, und der Anstieg des Bevölkerungsanteils mit „Migrationshintergrund“
auf 40,7 Prozent im Jahr 2019 sollte im Nachhinein die
42
2004–2019
Richtigkeit der Warnungen der Wiener FPÖ
bestätigen.
Im Wiener Wahlkampf 2005 – und
auch in folgenden Wahlkämpfen – war der
Viktor-Adler-Markt in Favoriten Schauplatz
freiheitlicher Kundgebungen. Damit sendeten
Strache und seine Mitstreiter ein zweifaches
Signal aus: Einerseits wollte man an die Erfolge
der Ära Haider anknüpfen, zumal auch
der damaligen Kärntner Landeshauptmann
in den 1990er-Jahren am Viktor-Adler-Markt
Wahlkampfauftritte abgehalten hatte, und andererseits
sollte man wie einst Haider der Wiener
SPÖ im Herzen Favoritens und damit einer
ihrer Hochburgen unmittelbar den Kampf
ansagen.
„
Im Wiener Wahl --
kampf 2005 – und auch
in folgenden Wahlkämpfen
– war der Viktor-Adler-Markt
in Favoriten
Schauplatz freiheitlicher
Kundgebungen.
Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl am 23. Oktober 2005 verlor
die Wiener FPÖ zwar 5,3 Prozent gegenüber der Wahl 2001 und
erreichte 14,8 Prozent, aber angesichts der ein knappes halbes Jahr zurückliegenden
orangen Abspaltung wurde dieses Ergebnis dennoch als
großer Erfolg gefeiert, zumal das BZÖ mit gerade einmal 1,15 Prozent
Slogans für erfolgreiche
Wahlkämpfe
der Stimmen den Einzug in den Landtag und Gemeinderat klar verfehlte.
Bei den gleichzeitig stattfindenden Bezirksvertretungswahlen erzielte
die FPÖ in Favoriten und Simmering mit 19,5 Prozent bzw. 18,2 Prozent
überdurchschnittlich gute Ergebnisse.
Konsolidierung in schwieriger Zeit
Das Wiener Wahlergebnis bedeutete deshalb auch eine bedeutende
Stärkung der seit 23. April 2005 von Strache geführten Bundes-FPÖ
bzw. des national-freiheitlichen Lagers, dies nicht zuletzt auch deshalb,
weil die Freiheitlichen im Nationalrat nur mehr mit zwei Abgeordneten
(Barbara Rosenkranz und Reinhard Eugen Bösch) vertreten waren und
die FPÖ drei Wochen zuvor, am 2. Oktober 2005, bei der Wahl in der
43
An der blauen Donau
44
Strache ahmt
Haiders Triumph
beim Innsbrucker
Parteitag nach
Steiermark, einem ihrer Kernländer,
den Einzug in den Landtag knapp,
aber doch, verfehlt hatte. Schließlich
zeigte das Wiener Wahlergebnis,
dass die FPÖ aufgrund der Rückbesinnung
auf ihre traditionellen Werte
wieder zu einer wählbaren Alternative
geworden war.
Von den anderen Parteien konnte
die SPÖ um 2,2 Prozent auf 49,1
Prozent zulegen, was aufgrund des
Wiener Wahlrechts eine satte absolute
Mandatsmehrheit von 55 der
100 Sitze im Gemeinderat bedeutete.
Die ÖVP legte um 2,4 Prozent
auf 18,8 Prozent zu und verdrängte
die FPÖ vom zweiten Platz, und die
Grünen konnten sich um 2,2 Prozent
auf 14,6 Prozent steigern.
Das Wahlergebnis vom Oktober
2005 spiegelte sich ein gutes
halbes Jahr später, beim 30. ordentlichen
Landesparteitag der FPÖ
Wien, wieder, als Strache im Austria
Center 93,75 Prozent der Delegiertenstimmen
auf sich vereinigen
konnte. Inhaltlich stand dieser
Landesparteitag im Wahljahr 2006
(für den Herbst standen Nationalratswahlen
ins Haus) im Zeichen
der Abrechnung mit dem BZÖ
und den verschiedenen Skandalen
im Dunstkreis von SPÖ und ÖGB
(BAWAG). Außerdem hatten die
Delegierten über 42 Anträge abzustimmen,
die sich mit Themen wie
den heimatvertriebenen Volksdeutschen, der Stadtplanung oder dem
Asylwesen beschäftigten.
Das Ergebnis der Nationalratswahl vom 1. Oktober 2006 (die FPÖ
erreichte elf Prozent) und der Wechsel von Bundesparteiobmann Strache
in den Nationalrat machten großangelegte Personalrochaden bei
den Wiener Freiheitlichen notwendig. Nachfolger Straches als Wiener
FPÖ-Klubobmann wurde der bisherige Stadtrat Eduard Schock,
der als Wirtschaftssprecher und Obmann der starken FPÖ Favoriten
bereits in den Jahren zuvor wichtige Positionen in der Partei besetzt
hatte. Landtagsabgeordneter Johann Herzog kehrte in seine Funktion
als Stadtrat, die er bereits über zwei Legislaturperioden ausgeübt
hatte, zurück. Statt Strache zog der FPÖ-Bezirksparteiobmann von
Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietbert Kowarik, in den Gemeinderat ein.
Nachfolgerin von Generalsekretär Harald Vilimsky, der vom Bundesrat
in den Nationalrat wechselte, wurde Stadtschulratsvizepräsidetin
Monika Mühlwerth. Neu in den Landtag und Gemeinderat zog auch
Fortsetzung auf Seite 46 ▶
2004–2019
„Grundfesten sind für Erfolg wesentlich“
Dr. Martin Graf über die Rolle der Waffenstudenten in
der Wiener FPÖ und freiheitliche Zukunftsperspektiven
Die Wiener Freiheitlichen sind immer ein starker
Faktor in Wien. Dabei ist bekannt, dass auch Waffenstudenten
in der Wiener FPÖ eine nicht unwesentliche
Rolle spielen – von den Medien oft angefeindet. Wie bewerten
Sie denn als prominenter schlagender Burschenschafter
diese Rolle?
Martin Graf: Nicht wegen, sondern trotz der
Zugehörigkeit zu einer studentischen Korporation
machen auch Burschenschafter Karriere in der
Parteipolitik. Die wenigsten Mitglieder einer Korporation
engagieren sich parteipolitisch. Durch
deren Grundausbildung in Bezug auf die national
freiheitlichen Grundsätze und deren überdurchschnittlichen
Leidensfähigkeit (im positiven Sinne)
sind Mitglieder einer Korporation auch in der Parteipolitik
überdurchschnittlich konkurrenzfähig.
Historisch betrachtet, wie hat sich denn diese Rolle
der Schlagenden in der Partei entwickelt, auch zurückgehend
zu den Wurzeln des Lagers im 19. Jahrhundert?
Graf: Mitglieder schlagender Studentenverbindung
nehmen bei der Gründung von Parteien
seit Beginn führende Rollen ein. Auch die
Sozialdemokratie und der Marxismus sind durch
Burschenschafter gegründet worden. Mitglieder
national freiheitlicher Studentenverbindungen
findet man in allen Parteien bis in die Zeit Bruno
Kreiskys – egal ob bei der FPÖ, bei den Sozialdemokraten,
der ÖVP, oder dem Liberalen Forum,
später dann dem BZÖ. Danach nur mehr in den
Parteien wie der FPÖ, dem LIF, oder dem BZÖ,
welche auch ein Bekenntnis zur deutschen Volksund
Kulturgemeinschaft zulassen. Insofern haben
sich mit Ausnahme der FPÖ alle Parteien in
Österreich programmatisch verengt, oder anders
gesagt, diskriminieren die anderen Parteien aufgrund
eines Volkstumbekenntnisses Mitglieder
national freiheitlicher Korporationen.
Warum sind die Burschenschaften denn für die FPÖ
– nicht nur in Wien – so wichtig?
Graf: Alle Mitglieder der FPÖ sind gleich
wichtig. Diejenigen, die gefestigt in den Grundsätzen
sind und Engagement, Fleiß und Führungsqualität
mitbringen, machen auch in der FPÖ Karriere.
Dies gilt auch für Burschenschafter.
Wen würden Sie im Laufe der Zeit in diesem Zusammenhang
als die prominentesten Waffenstudenten in
den Reihen der Wiener FPÖ sehen?
Graf: In der jüngeren Vergangenheit war in
diesem Sinne der leider zu früh verstorbene Rainer
Pawkowicz die prägendste Figur in der Wiener
FPÖ.
Die Wiener FPÖ steht vor einem herausfordernden
Wahlgang, der Gegenwind ist bekanntlich groß. Was
würden Sie sich wünschen, wie die Freiheitlichen in der
Bundeshauptstadt in einem Jahr aufgestellt sind?
Graf: Die FPÖ ist ein nicht wegzudenkender
Faktor in Wien und das wird auch so bleiben. Wir
sind es gewohnt, dass nach einem politischen Höhenflug
(gemessen am Wählerzuspruch) es auch
wieder bergab gehen kann. Im Moment sieht es
danach aus, dass wir um den 2. Platz in der Wählergunst
mit der ÖVP und den Grünen rittern.
Parallel dazu kommt auch Konkurrenz aus dem
eigenen Lager hinzu, welches vom Establishment,
den Medien und auch unseren Mitbewerbern bewusst
aufgebaut wird, um der FPÖ insgesamt zu
schaden. In diesem Zusammenhang ist es umso
wichtiger, dass die FPÖ um jede Stimme kämpft
und aus den Fehlern der jüngeren Vergangenheit
lernt. Wenn die FPÖ Wien in ihren Grundfesten
erkennbar bleibt, ist mir auch nicht bange.
Dr. Martin Graf ist Abgeordneter zum Nationalrat und
war Dritter Präsident des Nationalrates.
45
An der blauen Donau
„
Zu Straches Stellvertretern
wurden die
Landtagsabgeordneten
Harald Stefan, Veronika
Matiasek sowie Klubobmann
Eduard Schock
und Stadtrat Johann Herzog
gewählt.
RFJ-Bundesparteiobmann Johann Gudenus, der zuvor Bezirksrat auf
der Wieden war, ein.
In der folgenden Legislaturperiode war der Schwerpunkt der Wiener
Freiheitlichen das Aufzeigen von Missständen, für welche die mit absoluter
Mehrheit regierende SPÖ verantwortlich gemacht wurde. So stand
die Frühjahrskampagne 2007 unter dem Motto „Wo Rot regiert, wird abkassiert!“
Bei einer Pressekonferenz erklärten Klubobmann Schock und
Landesparteisekretär Hans-Jörg Jenewein, Ziel dieser
Kampagne sei, die Wiener Bevölkerung über
die jüngsten Verteuerungen bei den Parkgebühren
und den öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuklären.
Darüber hinaus machte sich Schock für eine neue
Wiener Lehrlingspolitik stark. Des Weiteren forderten
die Freiheitlichen – angesichts des vor allem
durch Zuwanderung aus dem Ausland bedingten
starken Anwachsens der Einwohnerzahl der Bundeshauptstadt
– eine Wohnbauoffensive.
Aufgrund dieser und zahlreicher anderer Missstände
im „roten Wien“ – Zuwanderungsproblematik
und hohe Arbeitslosigkeit – setzten sich die
Wiener Freiheitlichen das Ziel, bei der nächsten
Gemeinderatswahl (wieder) zweitstärkste Kraft zu
werden und dem Dritten Lager die Chance zu geben,
erstmals seit Cajetan Felder (1868–1878) den
Wiener Bürgermeister zu stellen – und damit die
seit 1945 dauernde Ära der roten Bürgermeister zu
beenden. Diese Stadt, so Strache, benötige dringend einen Paradigmenwechsel
in ihrer Politik und weniger SPÖ-Umklammerung. Daher werde
die FPÖ auch alles daran setzen, den Bürgermeistersessel nach der
nächsten Wien-Wahl freiheitlich zu besetzen. Die Wiener Freiheitlichen
scharten sich hinter ihrem Obmann, Strache wurde im Mai 2008 beim
31. ordentlichen Landesparteitag mit 99,38 Prozent in seiner Funktion
bestätigt. Zu Straches Stellvertretern wurden die Landtagsabgeordneten
Harald Stefan, Veronika Matiasek sowie Klubobmann Eduard Schock
und Stadtrat Johann Herzog gewählt.
Kampfansage an die rote Allmacht
Das Jahr 2010 stand dann auch politisch vollkommen im Zeichen
der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl am 10. Oktober. Die
Freiheitlichen starteten mit großer Zuversicht in die Wahlauseinandersetzung,
dies nicht zuletzt wegen der Ergebnisse der Nationalratswahl
2008, als es gelungen war, in den einstigen SPÖ-Hochburgen Favoriten,
Simmering und Floridsdorf mehr als 30 Prozent der Stimmen zu bekommen.
Dabei trat vor allem eine Entwicklung immer deutlicher zutage:
Der Gemeindebau – das Sinnbild der Wiener Sozialdemokratie
– drohte den Sozialisten völlig zu entgleiten. Und sollte Wien keinen
roten Bürgermeister bzw. Landeshauptmann mehr haben, dann steht
die Existenzfrage der SPÖ im Raum.
Inhaltlich ging es für die Freiheitlichen bei der Wien-Wahl 2010
darum, einerseits an die seit 2005 erzielten Wahlerfolge anzuschlie-
46
2004–2019
ßen, und andererseits, die blauen
Kernthemen zu pflegen und
das inhaltliche Profil als soziale
Heimatpartei weiter zu schärfen
sowie mit Themen wie Mittelstandspolitik
und Familienpolitik
weitere Wählersegmente anzusprechen.
Deshalb rief Strache
bereits zu Jahresbeginn das „Duell
um Wien“ aus. Dem freiheitlichen
Erneuerer wurde der seit
1994 amtierende Bürgermeister
Michael Häupl als Sinnbild für
von der SPÖ zu verantwortenden
Stillstand und Fehlentwicklungen
gegenübergestellt. Neben der hohen
Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt
und der Zuwanderungsproblematik
thematisierte
die FPÖ verschiedene Skandale
im Umfeld der Sozialdemokratie
wie das umstrittene Cross-Border-Leasing
und in geradezu prophetischer
Vorausahnung sprach
die blaue Opposition vom „sich
anbahnenden Finanzchaos beim
Krankenhaus Nord“. Ein weiterer
freiheitlicher Themenschwerpunkt
war die Sicherheit. Während
österreichweit die Kriminalität
2009 um knapp drei Prozent
anstieg, musste Wien eine Steigerung
von etwa sieben Prozent
verzeichnen. Insbesondere forderte
die FPÖ Wien vehement
eine deutliche personelle Aufstockung der Polizei um 1.500 Beamte.
Vor Beginn des „Duells um Wien“ zeigten die Freiheitlichen innere
Geschlossenheit. Am 32. ordentlichen Landesparteitag am 20. Juni
2010 wurde Strache mit 99,12 Prozent als Landesparteiobmann bestätigt.
339 der 342 abgegeben Stimmen entfielen auf den blauen Spitzenkandidaten,
die restlichen drei Stimmen waren ungültig. Die „alten“ und
„neuen“ Stellvertreter, Stadtrat Johann Herzog Landtagsabgeordnete
Veronika Matiasek, Klubobmann Eduard Schock und Nationalratsabgeordneter
Harald Stefan wurden klar mit 89 bis 96 Prozent wiedergewählt.
Blauer Herausforderer
des roten
Bürgermeisters
Im Spätsommer stellte die FPÖ zudem ihre Kandidatenliste für die
Wahl vor. Hinter Spitzenkandidat Strache folgten Landtagsabgeordneter
Johann Gudenus, Nationalratsabgeordneter und Generalsekretär
Harald Vilimsky, Landtagsabgeordnete Veronika Matiasek, Klubobmann
Eduard Schock, die Unternehmerin Barbara Kappel, die 2014
ins Europäische Parlament wechseln sollte, Stadtrat Johann Herzog, der
Landtagsabgeordnete David und die ausgewiesene Kulturexpertin Heidemarie
Unterreiner.
Fortsetzung auf Seite 49 ▶
47
An der blauen Donau
„Strache hat neue Wählerschichten erschlossen“
Martin Hobek im Gespräch über die Ära Strache in Wien
48
Wenn Sie die Ära Strache in der Wiener FPÖ
rückblickend betrachten: Was waren denn die Höhepunkte
der Obmannschaft von Strache?
Martin Hobek: Das waren aus meiner Sicht
die Wien-Wahlen 2005 und 2015. Sein Antreten
2005 bedeutete die überraschende Rettung der
Partei wie „Phönix aus der Asche“. 2015 schaffte
er es tatsächlich, den Triumph von Rainer Pawkowicz
in der
Haider-Ära (29
Mandate von 100
im Jahre 1996)
noch zu übertreffen
(34 Mandate)
und erstmals
einen Vizebürgermeister-
und
einen Bezirksvorstehersessel
zu erobern.
War es eine der
wesentlichen Stärken
der Wiener
FPÖ damals, vor
allem in der Phase
der Turbulenzen
auf Bundesebene,
dass Hilmar Kabas
die Obmannschaft
an Strache friedlich
übergeben hat?
Hobek: Das
war sehr gescheit,
aber ich
würde es trotzdem
nicht idealisieren.
Kabas
war ja zwei Jahre
älter als sein legendärer
Vorgänger und nie als Landesobmann
vorgesehen. Er musste in die Bresche springen,
weil Rainer Pawkowicz 1998 unerwartet mit nur
54 Jahren gestorben war. Als 2004 mit Strache
jemand spektakulär die Bühne betreten hatte, der
34 Jahre jung und trotzdem schon sieben Jahre
lang Landtagsabgeordneter war, erschien diese
harmonische Übergabe nur allzu logisch.
Warum konnten Strache und die Wiener FPÖ
denn von Wahlsieg zu Wahlsieg eilen? War das nur der
charismatische Obmann, oder halfen auch die Umstände
mit?
Hobek: Definitiv beides. Unter den Kanzlerschaften
von Gusenbauer (2006-08), sowie
Faymann (2008-16) wuchs der Verdruss an der
rot-schwarzen Bundesregierung ins Unermessliche.
Das zeigte sich letztlich bei der Bundespräsidentenwahl
2016 als die Kandidaten der beiden
ehemaligen „Reichshälften“ nur mehr die Plätze
4 und 5 belegten mit jeweils mickrigen 11 Prozent…
Gleichzeitig war sich in Wien Bürgermeister
Häupl seines Denkmalstatus bewusst und
ließ die Zügel völlig entgleiten. Während seine
roten Stadträtinnen Brauner und Wehsely die
Schulden vervielfachten bzw. das Gesundheitssystem
ruinierten, schikanierte seine grüne Vizebürgermeisterin
alle Verkehrsteilnehmer bis auf
die Radfahrer.
Wo sehen Sie denn die größten Verdienste Straches
für die Wiener FPÖ?
Hobek: Er holte nicht nur die „leichte Beute“
wie Raucher und Hundebesitzer ab, er erschloss
der Partei völlig neue Wählerschichten
wie Frauen, Jugendliche und Migranten, insbesondere
die Serben. Strache ist völlig zu Recht zu
einer Unperson in der FPÖ geworden, man sollte
die Modernisierungselemente der Strache-FPÖ
dennoch nicht über Bord werfen.
Was sind denn Ihres Erachtens die Ursachen dafür,
dass die FPÖ in Wien zwar seit gut drei Jahrzehnten
einen Wahlerfolg nach dem anderen einfahren konnte, es
aber dennoch nie gelang, die linke Mehrheit in der Bundeshauptstadt
zu durchbrechen?
Hobek: Die Gründe dafür sind mannigfaltig
und selbst eine oberflächliche Aufzählung würde
den Rahmen sprengen. Die Hauptursache liegt
aber darin, dass sie Sozialdemokratie in Wien
noch heute von ihren unleugbaren Verdiensten
der Jahre 1918-34 lebt und von dem damals geschaffenen
strukturellen Fundament.
Ein kleiner Ausblick in die Zukunft: Wo werden
denn die Freiheitlichen in einem Jahr stehen?
Hobek: Die Turbulenzen werden dann erst
so richtig begonnen haben. Selbst wenn Straches
vorprogrammiertes endgültiges Scheitern bereits
im Oktober 2020 stattfinden sollte, muss die
FPÖ-Wien ungeachtet dessen befürchten, brutalst
zusammengestutzt und in die 1980er-Jahre
zurückkatapultiert zu werden. Die Situation stellt
sich für die FPÖ wesentlich dramatischer dar als
1986, 2002 und 2005. Ich kann nur sagen: Hoffentlich
irre ich mich…
◆
2004–2019
Im August 2010 sorgte die erste Plakatwelle der Freiheitlichen für
einen Aufschrei der vereinten Gutmenschenfront. Zu sehen war das
Konterfei des Spitzenkandidaten und der Schriftzug „Mehr Mut für unser
Wiener Blut“, und in kleinerer Schrift der Hinweis: „Zuviel Fremdes
tut niemandem gut“. Während die Grünen
sofort mit der Nazikeule und zur Stelle waren
und vom Rückgriff auf die nationalsozialistische
Blut- und Bodenideologie sprachen,
sagte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl, der
Begriff „Wiener Blut“ sei ein Synonym für die
Tradition in der Bundeshauptstadt, wenngleich
man allerdings sehr wohl eine Zuwanderungsdebatte,
„die wir nicht ausgelöst haben“ führen
wolle. Teil dieser Zuwanderungsdebatte waren
etwa die freiheitlichen Forderungen, dass es
ohne Deutschkenntnisse keinen Eintritt in den
Regelschulbetrieb geben dürfe und dass die
Zahl der Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache
auf höchstens 30 Prozent zu begrenzen
sei.
Linke Hexenjagd
blieb ohne Erfolg
Ihr Ziel konnte die vereinigte Gutmenschenfront
freilich nicht erreichen: Nicht zuletzt
durch die Hexenjagd auf den bundesdeutschen Islam- und Zuwanderungskritiker
Thilo Sarrazin und durch die Forderungen des
damaligen Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Anas
Schakfeh, nach Errichtung von Moscheen mit Minaretten in jeder Landeshauptstadt,
konnten die Freiheitlichen die Themenführerschaft im
Wahlkampf erringen. Den Wienern wurde eben täglich vor Augen geführt,
was unter sozialistischer Herrschaft alles schiefläuft. Dass etwa der
autochthone Wiener Gefahr läuft, mittelfristig zur Minderheit zu werden,
dass sich in manchen Stadtteilen islamische Parallelgesellschaften
etabliert haben, dass manche Volksschulen bereits einen Ausländeranteil
von mehr als 90 Prozent aufweisen,
dass Deutsch zu einer
Zweit-, wenn nicht sogar zu
einer Drittsprache herabgesunken
ist und dass für die
SPÖ, vom Glanz des „Roten
Wien“ der Zwischenkriegszeit
zehrend, der Erhalt der
eigenen Macht zur obersten
politischen Maxime geworden
ist.
Als am Abend des 10.
Oktober 2010 die erste
Hochrechnung veröffentlicht
wurde, blieb den Gutmenschen
aller Couleurs das
„
Vor Beginn des
„Duells um Wien“ zeigten
die Freiheitlichen innere
Geschlossenheit. Am
32. ordentlichen Landesparteitag
am 20.
Juni 2010 wurde Strache
mit 99,12 Prozent
als Landes parteiobmann
bestätigt.
Antifa versus FPÖ
49
An der blauen Donau
„
Die Freiheitlichen
konnten hervorragend
mobilisieren, und am
auffälligsten wurde
der blaue Erdrutschsieg
in traditionellen
Arbeiterbezirken.
Die FPÖ
profitierte von der
Migrations krise
2015
Lachen im Hals stecken. Die Freiheitlichen waren der eindeutige und
unbestrittene Wahlsieger. Die FPÖ konnte um 10,94 Prozent auf 25,77
Prozent zulegen und wurde klar zweistärkste Partei hinter der SPÖ, die
44,34 Prozent (minus 4,75 Prozent) erreichte. Auch für ÖVP und Grüne,
die auf 13,99 Prozent bzw. 12,64 Prozent kamen, setzte es Verluste
(minus 4,78 Prozent bzw. minus 1,99 Prozent). Darüber hinaus war die
FPÖ nur mehr knapp von ihrem Allzeithoch
aus dem Jahr 1996 (27,94 Prozent) entfernt.
Die Freiheitlichen konnten hervorragend
mobilisieren, und am auffälligsten wurde der
blaue Erdrutschsieg in traditionellen Arbeiterbezirken
wie Favoriten, Simmering oder
Floridsdorf, wo die Freiheitlichen Ergebnisse
an oder jenseits der 30-Prozent-Marke einfahren
konnten, wenngleich es bei den gleichzeitig
stattfindenden Bezirksvertretungswahlen
(noch) nicht für den ersten blauen Bezirksvorsteher
Wiens gereicht hat. Umgekehrt mussten
die Genossen in ihren ehemaligen Hochburgen
Verluste an die Freiheitlichen im teilweise zweistelligen
Bereich hinnehmen, sodass sich wieder
einmal die Frage stellte, ob nicht die FPÖ eine
„Arbeiterpartei neuen Typs“ sei. Tatsächlich
konnte die Freiheitliche Partei – wie auch bei
der Nationalratswahl 2013 und bei der Wien-Wahl 2015 – besonders bei
einfachen Arbeitnehmern, die angesichts der Globalisierung um ihren
Arbeitsplatz fürchten müssen und die vom politischen und medialen
Establishment herablassend als „Modernisierungsverlierer“ bezeichnet
werden, punkten. Als Wermutstropfen erwies sich hingegen das Abschneiden
in den „hippen“ Innenstadtbezirken, wo besonders viele
„Bobos“ und Grün-affine Bürgerliche leben. Im Wahlkreis Innen-West,
50
2004–2019
der die Bezirke Neubau, Josefstadt und Alsergrund umfasst, kamen die
Freiheitlichen bloß auf bescheidene 14,15 Prozent und lagen hinter
SPÖ, Grünen und ÖVP nur an der vierten Stelle.
Nach der Wien-Wahl 2010, bei der die blaue Riege im Rathaus auf
27 Mandatare gewachsen war, gab es auch personelle Veränderung. Johann
Gudenus übernahm von Eduard Schock, der Stadtrat wurde, den
Klubvorsitz. Die Gemeinderäte Veronika Matiasek und David Lasar
rückten in die Riege der Stadträte auf. Durch ihren Stimmenzuwachs
konnte die FPÖ das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten bekleiden,
welches Johann Herzog übernahm. Vizepräsidentin im Wiener Stadtschulrat
wurde die freiheitliche Fraktionsvorsitzende im Bundesrat,
Monika Mühlwerth, die dieses Amt bereits zwischen 2001 und 2006
bekleidet hatte. In den blauen Rängen im Rathaus befanden sich neben
bekannten Gesichtern wie Wolfgang Jung, Herbert Eisenstein, Henriette
Frank oder Dietbert Kowarik auch Neueinsteiger wie die Unternehmerin
Barbara Kappel oder AKH-Mediziner Peter Frigo. Als Vertreter
der Wiener FPÖ zogen Landesparteisekretär Hans-Jörg Jenewein, Reinhard
Pisec von „FPÖ pro Mittelstand“ sowie Herbert Madejski in den
Bundesrat ein.
FPÖ am Viktor
Adler Markt:
Wahlkampfabschlusskundgebung
anlässlich der Nationalratswahl
2017
In der neuen Legislaturperiode regierte die SPÖ, die die absolute
Mehrheit verloren hatte, in einer Koalition mit den Grünen. Neo-
Klubobmann Gudenus warnte eindringlich vor Rot–Grün und kündigte
an, die Politik des „Bürgermeisters der Herzen“ (Strache, Anm.) nahtlos
fortsetzen zu wollen. Gudenus, der 1976 als Spross einer ehemals
adeligen Familie in Wien geboren wurde, war seit seiner Jugend tief
in der freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft verankert. Seine ersten
politischen Sporen verdiente sich der Sohn des früheren FPÖ-Nationalratsabgeordneten
und Bundesrates John Gudenus als Obmann des
Rings Freiheitlicher Jugend, bevor er 2005 in den Wiener Landtag und
Gemeinderat einzog. Gudenus, der auch Mitglied einer pennal-konservativen
Burschenschaft ist, studierte Rechtswissenschaften und besuchte
ein Master-Studium an der Diplomatischen Akademie Wien.
Unter der Führung von Gudenus setzte der blaue Ratshausklub seinen
Fortsetzung auf Seite 53 ▶
51
An der blauen Donau
„Die satten Mehrheiten der SPÖ
gehören der Geschichte an“
Die freiheitliche Stadträtin Ursula Stenzel im Gespräch
über ihre Beweggründe, sich bei den
Freiheitlichen in Wien zu engagieren
52
Frau Stadträtin, Sie sind
nunmehr fünf Jahre in der Wiener
FPÖ. Wie beurteilen Sie
denn die aktuelle Lage der Freiheitlichen
in der Bundeshauptstadt?
Ursula Stenzel: Unter
den gegebenen Umständen
macht Dominik Nepp einen
sehr guten Job. Er hat
die Partei in einer äußerst
schwierigen Situation nach
dem Platzen des Ibiza-Skandals
und dem „Hin und Her“
durch H.-C. Strache übernommen
und hier Ruhe und
Ordnung in die Mann- und Frauenschaft der Freiheitlichen
Wiens gebracht. Er ist ein sehr konsequenter
und auch bewiesener Stadtpolitiker, der es
versteht, die jetzige Durststrecke unter diesen Umständen
optimal, muss ich sagen, zu überwinden.
Wie Sie vor fünf Jahren zu den Freiheitlichen gewechselt
sind, was waren denn damals die Beweggründe?
Stenzel: Ich kann eigentlich mit dem Slogan
der heutigen Wiener FPÖ antworten, nämlich:
„Wir sind das Gegengewicht.“ Ich habe damals
in der ÖVP – das war noch die Zeit der Großen
Koalition auf Wiener Ebene – nicht das nötige
Gegengewicht zu einer immer dominierenderen
SPÖ gesehen. Diese Politik der Profillosigkeit
war aus meiner Sicht absolut abzulehnen. Die
ÖVP hat in der Koalition mit der SPÖ damals
ihre Werte beiseite geschoben, dazu kam dann
noch das Drama der Flüchtlingsströme im Sommer
2015, wo ich damals – unter Außenminister
Kurz – in keinster Weise die richtige Antwort auf
diese gewaltige Herausforderung gesehen habe.
Das gab für mich den Ausschlag, zur FPÖ zu
wechseln.
Wenn Sie die erdrückende rote Dominanz in der
Bundeshauptstadt ansprechen: Warum gelingt es denn seit
Jahrzehnten, nicht, diesen Machtfilz zu durchbrechen?
Stenzel: Es ist wohl leider eine historische
Gewohnheit. Aber die satten Mehrheiten der
SPÖ gehören doch schon der Geschichte an, sie
ist meines Erachtens jetzt außerordentlich geschwächt,
durch innere Zerrissenheit, durch eine
gewisse Machtarroganz, durch viele Fehler und
Skandale, die passiert sind. Wir müssen hier nur
an das Krankenhaus Nord denken, wir müssen
nur an massive Fehlplanungen denken, auch im
Verkehr, wo Bürgermeister Ludwig ja nahezu
willenlos zusieht, wie hier die grüne Stadträtin
Hebein auf Kosten der Allgemeinheit herumfuhrwerkt.
Es gibt bekanntlich einen riesigen
Bau- und Investitionsskandal in der Wiener City,
wo das historische Weltkulturerbe Wiens riskiert
und aufs Spiel gesetzt wird, und so weiter und so
fort. Ein mannigfaltige Problemfeld für die Stadt
also, wo es genügend Ansatzpunkte gibt, um dagegen
aufzubegehren.
Zurück zu den Freiheitlichen: Wie glauben Sie denn,
dass die FPÖ in Anbetracht der schwierigen Lage reüssieren
wird können?
Stenzel: Ganz klar: Wir sind ganz deutlich
für einen Schutz der Wienerinnen und Wiener,
und zwar vor einer zügellosen Migrationspolitik,
die die Stadt in eine Schuldenkrise getrieben hat,
die sich jetzt durch die Kollateralschäden und die
notwendigen Finanzierungen im Zusammenhang
mit der Coronakrise nochmals verschärfen wird.
Hier kumulieren sich in dieser Krise die schweren
Fehler der Vergangenheit. Hätte man in der Vergangenheit
in Wien besser gewirtschaftet, würde
es die Stadt natürlich viel weniger treffen, als das
nun der Fall sein könnte. Durch diese verantwortungslose
„Willkommenspolitik“ und das Füllen
der Gemeindebauten mit völlig kulturfremden
Menschen, die sich schwer integrieren können
– ich denke hier vor allem an den radikalen und
politischen Islam, der eine unsägliche Rolle spielt
– hat man große Probleme verursacht. Dagegen
hat das rote Wien nichts unternommen. Man hat
aber auch in der Integrationspolitik versagt, wie
man etwa an den Brennpunktschulen sieht, wo
eine massive Bildungsmisere zu Tage tritt. Dazu
kommt eine Spittals- und eine Wohnmisere, weil
man diesen großen Herausforderungen viel zu
spät begegnet ist. Eine Alternative kann hier nur
die FPÖ glaubhaft demonstrieren, und wenn diese
Botschaft bei den Wählerinnen und Wählern
ankommt, sehe ich der Wahl im Herbst 2020 mit
Zuversicht entgegen.
◆
2004–2019
kantigen Kurs fort, insbesondere was die Zuwanderungspolitik und die
Behebung von Missständen betrag, für welche die SPÖ die politische
Verantwortung trug. Ein solches Thema war etwa die Aufklärung von
Missbrauchsfällen in Wiener Kinderheimen, hier forderte die FPÖ die
Einsetzung einer gemeinderätlichen Untersuchungskommission. In
Wien entwickelte sich Gudenus immer mehr zur rechten Hand Straches,
um den Bundesparteiobmann vom politischen Tagesgeschäft in
der Hauptstadt zu entlasten. Und wie Strache geriet auch Gudenus ins
Visier der linken Jagdgesellschaft – etwa, als er 2018 die einwanderungsfördernden
Aktivitäten des US-amerikanischen Spekulanten George
Soros thematisierte.
Landesparteitag
2017: Strache wurde
mit 99,12 Prozent
im Amt bestätigt
Auf dem 33. ordentlichen Landesparteitag am 11. Juni 2012 wurde
Strache wie zwei Jahre zuvor mit 99,12 Prozent als Chef der Wiener Freiheitlichen
bestätigt. Inhaltlich standen jene „Flut an Grausamkeiten“ im
Mittelpunkt, die Rot–Grün den Wienern beschert hat. Gemeint waren
damit Gebührenerhöhungen, weshalb die FPÖ in einem Leitantrag einen
Gebührenstopp bis zum Ende der Legislaturperiode forderte. Weiters
gefordert wurden demokratiepolitische Maßnahmen wie die Einführung
einer Veto-Volksabstimmung gegen geplante Gesetzes- oder
Verwaltungsvorhaben der Stadt. Als „Tragödie für Wien“ wurde in dem
Leitantrag die rot–grüne Ausländerpolitik in der Bundeshauptstadt bezeichnet,
und die Freiheitlichen kündigten an, sich für einen Zuwanderungsstopp,
jedenfalls für Nicht-EU-Bürger, stark zu machen.
53
An der blauen Donau
„
Der Wahlkampf
2015 stand ganz im
Zeichen der illegalen
Masseneinwanderung,
die im Spätsommer eingesetzt
hatte.
Starke Opposition gegen Rot–Grün
Jedenfalls bot die rot–grüne Rathauskoalition den Freiheitlichen
genügend Angriffsflächen. Neben den bekannten Kritikpunkten kam
2013/14 ein weiterer hinzu – der Umbau der Mariahilfer Straße, ein
Prestigeprojekt der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassiliakou. Hier
kritisierte die FPÖ nicht nur die hohen Kosten von 25 Millionen Euro,
sondern vor allem auch die von SPÖ und Grünen im Vorfeld durchgeführte
„Volksbefragung“, bei der nur in den Bezirken Mariahilf und
Neubau lebende Bürger und EU-Bürger teilnehmen
durften. „Bei dieser Pseudo-Volksbefragung,
die rechtlich nicht gedeckt ist, ist Missbrauch Tür
und Tor geöffnet“, bemängelte Klubobmann Gudenus.
Darüber hinaus kämpfte die FPÖ Wien im
Allgemeinen verstärkt gegen Autofahrerschikanen,
für die vor allem die Grünen verantwortlich
zeichneten.
Wasser auf die Mühlen der Freiheitlichen, weil
ihre Warnungen vor einer schleichenden Islamisierung
Wiens bestätigt wurden, war die 2014 veröffentlichte
Studie des Islamwissenschafters Ednan
Aslan. Demnach stehen von 150 islamischen Kindergärten
in Wien nahezu alle unter dem Einfluss
radikaler Islamisten und der Muslimbruderschaft.
Inzwischen warf auch die nächste Landtags- und Gemeinderatswahl,
die am 11. Oktober 2015 stattfinden sollte, ihre Schatten voraus.
Auf dem 34. Landesparteitag der FPÖ Wien am 23. November 2014
sagte Strache, „heute findet der Startschuss statt, dass wir eines in Angriff
nehmen, nämlich das historisch beste Ergebnis für die FPÖ in
Wien. 30 bis 40 Prozent brauchen wir, um Häupl und Rot–Grün zu
überwinden“. Zudem wurde Strache mit 99,23 Prozent – 388 von 391
gültigen Stimmen – als Landesparteiobmann bestätigt. Klubobmann
Johann Gudenus, Stadträtin Veronika Matiasek sowie Nationalratsabgeordneter
Harald Stefan wurden zu seinen Stellvertretern gewählt.
Der Wahlkampf 2015 stand ganz im Zeichen der illegalen Masseneinwanderung,
die im Spätsommer eingesetzt hatte und Österreich zum
Ziel oder zum Transitland für viele Hunderttausend Syrer, Afghanen,
Iraker usw. machten, die ins „gelobte Land“, in die Bundesrepublik
Deutschland, zogen. Hinzu kam, dass mit Stichtag 1. Jänner 2015 die
Bundeshauptstadt laut Statistik Austria bereits einen Ausländeranteil
von 25,6 Prozent – knapp 200.000 Einwohner aus anderen EU-Staaten
und rund 260.000 Einwohner aus Drittländern – aufzuweisen hatte. Die
rot–grüne Stadtregierung, die dezidiert eine „Willkommenspolitik“ betrieb,
schwang gegen die Freiheitlichen einmal mehr die Rassismuskeule,
und SPÖ-Bürgermeister Häupl vereinnahmte sogar den „Charakter“
für seine Partei.
Jedenfalls gab der Massenansturm auf Europa den Wiener Freiheitlichen
genauso Rückenwind wie die teilweise erdrutschartigen Erfolge
der FPÖ bei den bisherigen Landtagswahlen, insbesondere in der Steiermark
und in Oberösterreich, wo die Blauen im zweistelligen Bereich
zulegen konnten. Parteichef Strache ging als Spitzenkandidat in die
54
2004–2019
Wahl, ihm folgten auf den Plätzen Klubobmann Gudenus, Stadträtin
Matiasek, Maximilian Kraus, der geschäftsführende Landesobmann des
RFJ-Wien und Bezirksparteiobmann Wien-Josefstadt, die Nationalratsabgeordneten
Dagmar Belakowitsch-Jenewein und Petra Steger sowie
Dominik Nepp, der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Döbling, der 2010
in den Gemeinderat eingezogen war. Zudem konnte der freiheitliche
Klub im Rathaus mit Ursula Stenzel einen prominenten Neuzugang
aufweisen. Die ehemalige ORF-Nachrichtenmoderatorin hatte sich als
langjährige ÖVP-Bezirksvorsteherin der Inneren Stadt sowie als streitbare
Kämpferin für das von der rot–grünen Rathauskoalition bedrohte
UNESCO-Weltkulturerbe der Wiener Innenstadt einen Namen gemacht.
Ein Triumph in Blau
Erneut könnte die Hetze des vereinigten linken Gutmenschentums
einen großartigen freiheitlichen Wahlerfolg nicht verhindern. Mit 30,8
Prozent (plus fünf Prozent)
übersprang die FPÖ die
30-Prozent-Marke, während
die SPÖ von Bürgermeister
Häupl einen herben Verlust
von 4,8 Prozent einstecken
musste und auf 39,6 Prozent
absackte. Damit lag die SPÖ
nur mehr knapp über ihrem
historischen Tiefststand von
39,2 Prozent im Jahr 1996.
Besonders schmerzen musste
die Genossen die Tatsache,
dass die FPÖ in ihren
traditionellen Hochburgen
Simmering und Floridsdorf
zur (relativ) stärksten Partei
geworden war. Deutliche Verluste
(minus 4,75 Prozent) gab
es neben der SPÖ auch für die
ÖVP, die in die Einstelligkeit
schrumpfte (9,2 Prozent) und
ein leichtes Minus von 0,8
Prozent gab es auch für die
Grünen, die auf 11,8 Prozent
kamen. Mit 6,2 Prozent zogen
die Neos erstmals in den Wiener Landtag und Gemeinderat ein.
Dominik Nepp und
Johann Gudenus
fuhren 2015
einen triumphalen
Wahlsieg ein
Mit diesem Wahlerfolg wuchs die Zahl der blauen Gemeinderäte
auf 34, womit die FPÖ die Sperrminorität in Bezug auf Änderungen
der Stadtverfassung erlangt hatte. Außerdem hatte die FPÖ erstmals
Anrecht auf das Amt des Vizebürgermeisters, welches der bisherige
Klubobmann Gudenus übernahm. Neuer Klubobmann wurde der
Döblinger Gemeinderat Dominik Nepp.
Grund zum Jubeln gab es aus blauer Sicht auch bei den gleichzeitig
stattfindenden Bezirksvertretungswahlen. In Simmering wurde die FPÖ
55
An der blauen Donau
„
Auf die Wahl vom
11. Oktober 2015 folgte
eine Neuauflage der
rot–grünen
(Verlierer-)Koalition.
mit 41,8 Prozent knapp stärkste Kraft vor der SPÖ (40,8 Prozent) und
konnte mit Paul Stadler erstmals in der Geschichte Wiens einen Bezirksvorsteher
stellen. Und in Favoriten und in Floridsdorf gelang es den
Freiheitlichen, auf weniger als zwei Prozent an die SPÖ heranzurücken.
Als Wermutstropfen erwies sich für die Freiheitlichen jedoch erneut das
bescheidene Abschneiden in den Innenstadt- sowie in den sogenannten
Nobelbezirken. In der Josefstadt erreichte man gerade einmal zehn
Prozent.
Auf die Wahl vom 11. Oktober 2015 folgte eine Neuauflage der
rot–grünen (Verlierer-)Koalition. Auf der anderen Seite hatte Wien von
Monat zu Monat neue Arbeitslosenrekorde zu
verzeichnen, mehr als 400.000 Wienerinnen und
Wiener mussten ihr Leben unter der Armutsgrenze
fristen, darunter 120.000 Kinder und Jugendliche.
Zudem stellte die Bundeshauptstadt fast zwei
Drittel der Mindestsicherungsbezieher Österreichs,
und immer deutlicher wurde, dass es um die
Errichtung des Krankenhaus Nord einen roten
Skandal gab, der zur Vernichtung von hunderten
Millionen Euro an Steuergeld führt – und das, obwohl
die Stadt unter der politischen Verantwortung
von roten Finanzstadträten einen Schuldenberg
in Höhe von 16 Milliarden Euro angehäuft
hatte. Kurz, für die Freiheitlichen als Kontrollpartei
gab es auch in der neuen Legislaturperiode viel
zu tun, wobei insbesondere zwei mit der unkontrollierten
Masseneinwanderung des Jahres 2015 verbundene Auswirkungen
in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung rückten:
der teilweise dramatische Anstieg der Kriminalität sowie die Mehrkosten
in vielfacher Millionenhöhe, die durch in der Mindestsicherung befindliche
Asylwerber der Stadt entstanden. Die SPÖ lehnte Kürzungen der
Mindestsicherung für sogenannte anerkannte Flüchtlinge vehement ab.
Erster Warnschuss für
die Freiheitlichen
Das Jahr 2017, besser gesagt die Nationalratswahl am 15. Oktober,
brachte einen Warnschuss für die bis dahin so erfolgreichen Wiener
Freiheitlichen. Zwar konnte man leicht um 0,79 Prozent auf 21,35 Prozent
zulegen, aber das Wiener Ergebnis lag doch deutlich unter dem
Ergebnis des Bundes-FPÖ, die um 5,46 Prozent auf 25,97 Prozent zulegen
konnte. Und noch deutlicher lag das blaue Ergebnis der Nationalratswahl
2017 unter dem triumphalen Wahlsieg, den man bei der
Wien-Wahl zwei Jahre zuvor einfahren hätte können. Und wieder erwiesen
sich die Innenstadtbezirke als „Baustellen“. In Neubau machten nur
knapp neun Prozent der Wähler ihr Kreuz bei der FPÖ.
56
Darüber hinaus hatte die Nationalratswahl 2017 mittelbare Auswirkungen
auf die Wiener FPÖ, weil die Freiheitlichen auf Bundesebene
eine Koalition mit der ÖVP bildeten. Daher stand der Landesparteitag
der FPÖ am 19. November 2017 auch im Zeichen der Regierungsverhandlungen
auf Bundesebene. Strache, der mit 99,12 Prozent als Lan-
Fortsetzung auf Seite 58 ▶
2004–2019
„Freiheitliche Grundsätze leben“
Landtagsabgeordnete a.D. Ute Meyer im Gespräch über
Höhepunkte der jüngeren freiheitlichen Geschichte
und wesentliche Schwerpunkte für die FPÖ
Frau Abgeordnete, Sie sind nunmehr nicht mehr im
Wiener Landtag vertreten, haben, wenn man so will, also
eine Außenschau. Wie sehen Sie denn die Lage der Wiener
Freiheitlichen?
Ute Meyer: Durch klare und fleißige Arbeit
der freiheitlichen Abgeordneten , Geschlossenheit
und nachvollziehbare Vorbildwirkung ist es
der Partei gelungen, eine immer größer werdende
Zahl von Wählern zu überzeugen , die Grundsätze
unserer politischen Bewegung zu unterstützen
und uns mit immer größer werdenden Vertrauen
auszustatten. Das äußere Zeichen dafür war – die
erstmalige – Erringung eines freiheitlichen Vizebürgermeisters
an der Spitze der Bundeshauptstadt.
Durch einen politischen Vertrauensbruch
und eine schandhafte „Trickserei“ durch den türkisen
Koalitionspartner auf Bundesebene wurde die
FPÖ in das Oppositionslager „verbannt“ und ab
diesem Zeitpunkt – obwohl die „Volksmehrheit“
noch hinter uns stand – öffentlich diffamiert und
schlecht gemacht. Gleichzeitig „explodierte“ die
Causa Ibiza, die vor allem nur das Fehlverhalten
eines freiheitlichen Spitzenpolitikers betraf. Und
auch die Wiener FPÖ wurde zu Unrecht in diesen
politischen Sumpf hineingezogen. Damit ist die
Ausgangslage vor der kommenden Landtagswahl
im Oktober 2020 denkbar ungünstig. Durch ihre
gelungene politische Arbeit haben sie – die FPÖ
Abgeordneten – mögliche kommende Verluste
nicht verdient. Sie haben ehrenvoll gekämpft und
das Vertrauen der Wähler gerechtfertigt.
Wenn Sie auf ihre politische Karriere zurückblicken,
wo würden Sie denn die Höhepunkte nicht nur in Ihrer
Laufbahn, sondern auch der FPÖ da in dieser Zeit sehen?
Meyer: Fünf Jahre habe ich mit massiver
Wählerunterstützung mein Mandat im Wiener
Rathaus ausgeübt und mich vor allem für Kulturangelegenheiten
und demokratiepolitische
Fragen engagiert. Vor und nach meiner Zeit im
Landtag war ich Bezirksrat der FPÖ in der bürgerlichen
Festung Wien Döbling. Mit dem Niedergang
der – damals noch schwarzen – Partei
erfolgte der Aufstieg der Freiheitlichen. Stolz bin
ich darauf, dass es mir gelang, in dieser konservativen
Festung erstmals als Klubobfrau ein FPÖ
Grundmandat zu erreichen.
Warum ist so schwierig, den roten Filz und die
Machtnetzwerke der SPÖ zu durchbrechen?
Meyer: Die Sozialisten oder Sozialdemokraten
besitzen seit 1918 (!) eine gut gepolsterte
Mehrheit – auch wenn sie stetig schrumpft. Und
diese langfristigen
roten Machtstrukturen
hinterlassen
ihre Spuren. Wenn
es für die Sozialisten
nicht mehr reicht, verbünden
sie sich mit
den gesellschaftspolitischen
Revolutionären
– den Grünen.
Was mit diesem politischen
Bündnis auf
die armen Wiener
noch zukommt – die
werden sich noch alle
wundern (und um
ihre verlorenen Stimmen
weinen!) Aber zu
spät. Damit das rote
Stimmenlager nicht
ausstirbt – was sonst
wahrscheinlich wäre – werden fleißig neue Einbürgerungen
mit Asylanten und „Flüchtlingen“
praktiziert. Diese werden politisch „eingelullt“,
reich versorgt und beschenkt – und was glauben
Sie, wen diese „Neodemokraten“ wählen werden?
Wahrscheinlich die roten „Gutmenschen“ – alles
klar?
Wo sollte denn die FPÖ inhaltlich ihre Schwerpunkte
hinlegen, um zu reüssieren?
Meyer: Schwerpunkte? Auf das freiheitliche
Grundsatzprogramm – dieses leben und vorleben!
Und bitte nicht auf das Stimmenmaximieren
die Zukunft aufbauen. Das ist alles politischer
Flugsand – der uns als Erster verlässt. Wir
haben in Geschichte und Vergangenheit gezeigt,
dass wir eine angesehene und honorige politische
Bewegung waren und sind. Dort müssen wir
wieder hin. Keine Disco-Partei, keine Querulantenvereinigung
und keine Zeitgeistanbeter. Seriosität,
Leistung, Heimattreue und Geschichtsbewusstsein
müssen und sollen unsere Wegbegleiter
sein. Gestern wie heute. Der Wähler wird es uns
honorieren! Damit wird es wieder aufwärts gehen.
Mit neuen und erfolgreichen Leitbildern an
der Spitze.
◆ 57
An der blauen Donau
desparteiobmann bestätigt wurde, versicherte den Delegierten, dass er
auf „50 Prozent freiheitliche Inhalte“ im Regierungsprogramm bestehen
werde. Vizebürgermeister Johann Gudenus betonte, wie die FPÖ
ihre Kontrollmöglichkeiten bereits genutzt hat: „Mit Stolz kann ich behaupten,
dass sich der stärkste Wiener FPÖ-Landtagsklub aller Zeiten
seiner Verantwortung bewusst ist und dieser katastrophalen Stadtregierung
mehr als unangenehm wird. Als zweitgrößter Klub im Rathaus
haben wir in den vergangenen zwei Jahren die meisten Anfragen und
Anträge zu verzeichnen. Wir scheuen uns nicht vor der Arbeit, stellen
zahlreiche Dringliche Anfragen und Anträge, verlangen von der Stadtregierung
Antworten und nutzen sämtliche gebotenen Kontrollmechanismen.“
Die Bildung der türkis–blauen Bundesregierung am 18. Dezember
2017 machte auch personelle Veränderungen bei den Wiener Freiheitlichen
erforderlich. Vizebürgermeister und Stadtrat ohne Ressort Gudenus
wechselte in den Nationalrat, wo er geschäftsführender Klubobmann
der FPÖ wurde. Ihm folgte als Vizebürgermeister Dominik Nepp
nach, dessen Funktion als Obmann des freiheitlichen Wiener Rathausklubs
Anton „Toni“ Mahdalik übernahm.
Schluss mit Lustig:
Die Ereignisse rund
um Ibiza stürzten
auch die Wiener FPÖ
in eine tiefe Krise
In der politischen Arbeit der Wiener Freiheitlichen änderte sich
nichts, als am 24. Mai 2018 Michael Ludwig Michael Häupl als Bürgermeister
und Landeshauptmann von Wien folgte, was Gudenus Anfang
2019 in einem Interview wie folgt umschrieb: „Es geht nichts weiter,
es wird einfach nur die rot–grüne Zusammenarbeit bis zum letztmöglichen
Zeitpunkt zum Zwecke des Machterhalts aufrechterhalten und
verlängert.“ Steigende Kriminalität, hohe Arbeitslosigkeit und teilweise
explodierende Mieten waren die Sorgen, welche die Wiener plagten,
während SPÖ und Grüne eine Kürzung der Mindestsicherung für Asyl-
58
2004–2019
werber, wie von der damaligen türkis–blauen
Bundesregierung gefordert, strikt ablehnten.
Das Bekanntwerden des Ibizavideos vom
Juli 2017 sorgte im Mai 2019 für ein gewaltiges
innenpolitisches Erdbeben, dessen Auswirkungen
auch in Wien deutlich zu spüren
waren. Am 18. Mai gaben Vizekanzler Strache
und Nationalratsklubobmann Gudenus ihren
Rücktritt aus allen politischen Ämtern und
somit auch jenen der Wiener FPÖ bekannt.
Nachfolger Straches als Wiener Landesparteiobmann
wurde Vizebürgermeister Nepp.
Auch wenn damit die „Ära Strache“ zu Ende
war, sollten sich die Wiener Freiheitlichen dennoch
weiterhin mit ihrem ehemaligen Obmann
beschäftigen. Nachdem sich Strache entgegen
seiner Zusicherung, sich vollständig aus der
Politik zurückzuziehen, im Herbst 2019 insbesondere
über Facebook öffentlich Kritik an der
Wiener FPÖ geübt hatte, wurde er am 13. Dezember 2019 einstimmig
vom Wiener Landesparteivorstand aus der Partei ausgeschlossen. In der
Folge trat Strache wiederholt bei Veranstaltungen der Wiener FPÖ-Abspaltung
„Die Allianz für Österreich“ (DAÖ) an und verkündete am 15.
Mai 2020, mit dieser unter dem Namen „Team HC Strache – Allianz für
Österreich“ bei der Wien-Wahl im Oktober 2020 anzutreten. Mit dieser
Entscheidung hat Strache einem Lebenswerk, zu dem auch der Aufstieg
der Wiener FPÖ zählt, beträchtlichen Schaden zugefügt.
In der politischen
Arbeit der Wiener
Freiheitlichen änderte
sich nichts, als Michael
Ludwig am 24. Mai
2018 Michael Häupl
als Bürgermeister und
Landeshauptmann von
Wien folgte.
◆
„
59
60
An der blauen Donau
1990–2004
1990–2004
DER AUFSTIEG
ZUR ZWEITEN KRAFT
DIE WIENER FPÖ VON 1990–2004
61
An der blauen Donau
Die Wiener FPÖ unter
Rainer Pawkowicz
und Hilmar Kabas
Rainer Pawkowicz
Rainer Pawkowicz war ein Kriegskind. Er wurde im gleichen Jahr
wie Norbert Steger, sein Vorvorgänger als Wiener Obmann, im 44er
Jahr in Wien III geboren, und zwar am 23. Jänner. Als Sohn eines Eisenbahners.
Seine Familie begab sich nach dem Krieg, um den Sowjets
aus dem Weg zu gehen, in die Steiermark, und so besuchte Rainer die
Volksschule in Knittelfeld. Die Mittelschule konnte er dann bereits in
Wien absolvieren, wo er auch sein Studium begann. Es war das Architekturstudium
an der Technischen Universität. Dieses schloss er in Wien
mit dem Titel eines Diplomingenieurs im Jahr 1973 ab. Dies allerdings,
um nach Graz zu übersiedeln und dort das Doktoratsstudium anzuschließen.
1978 promovierte er in Graz zum Doktor der Technik. Es
war dies wohl eine Reminiszenz an seine steiermärkische Jugend.
Das akademische Interesse Pawkowicz´ galt
aber Wien, wo er 1962, also bereits als achtzehnjähriger
Aldanenfuchs wurde. Später aber
trat er auch der Olympia bei und war für kurze
Zeit auch Vandale. Während seiner Aktivzeit
übte er auch zweimal das Amt als Vorsitzender
des Wiener Korporationsringes (WKR) aus. In
diesem Kreis sollte er Jahre später, es war 1996,
auch als Festredner zutage treten. Beim Ostarrichi-Kommers
in der Hofburg zur Feier von
1000 Jahre Österreich (996 – Ostarrichi Urkunde)
war es ihm vorbehalten, auf Einladung der
Korporierten die Lobrede zu halten.
Rainer Pawkowicz:
Architekt und
Politstratege
Die ausführlichen Einzelheiten zu seiner
akademischen Laufbahn sind dem Interview
mit seinem Sohn Alexander (Jahrgang 1975) zu
entnehmen. Hervorzuheben ist dabei allerdings
die Tätigkeit des jungen Rainer Pawkowicz
für die Olympen. Im Zusammenhang mit den
Südtirolaktivitäten einzelner Olympen hatten
die damaligen Olympen-Alten Herren einen
Beschluss gefasst, der den Aktivisten finanziell
Rechtsberatung und rechtliche Unterstützung
zusichern sollte. Dieser Beschluss, man würde es heute wahrscheinlich
gar nicht für möglich halten, wurde von der Behörde als „nicht satzungskonform“
erachtet. Und weil die Olympen in der „politischen Auslage“
gestanden sind, nahm die Vereinsbehörde dieses „Vorkommnis“ zum
Anlass, den Bund, wegen „Überschreitung des satzungsmäßigen Ver-
62
1990–2004
einszweckes“ aus formellen Gründen vereinsrechtlich aufzulösen. Zu
gegebener Stunde, die Olympischen Spiele 1972 in München standen
vor der Türe und boten den Anlass. Nach dem einen und anderen vergeblichen
Versuch wurde die Wiedereröffnung der Olympia nun wieder
konkret ins Auge gefasst. Dazu aber bedurfte es Persönlichkeiten, die
in die Umlaufbeschlussangelegenheit, die zur Auflösung geführt hatte,
nicht eingebunden waren. Mit den beiden Freunden bei den Aldanen,
Rainer Pawkowicz und Werner Götzhaber, waren die beiden gefunden.
Als nach den Sommerferien die Beamten den zur Eintragung eingereichten
Verein wieder auflösen wollten, war es zu spät. Die gesetzlich vorgeschriebene
Frist war verstrichen und das Ergebnis, die eingetragene
„Neue Olympia“ war somit amtlich. Als Eintragungszeitpunkt beim
Vereinsregister gilt der 22. März 1971. Einige Zeit später konnte sie
ihren Aktivbetrieb wieder aufnehmen und bereichert bis zum heutigen
Tag den Wiener Boden der schlagenden Korporationen. Pawkowicz ist
dann in weiterer Folge, im Zuge von Auseinandersetzungen wegen Norbert
Burger, 1988 wieder aus der Olympia ausgetreten.
Rainer Pawkowicz
und Jörg Haider
hatten stets eine
gute Gesprächsbasis
mit Bürgermeister
Helmut ZIlk
63
An der blauen Donau
„
Trotz seiner ergiebigen
burschenschaftlichen
Tätigkeit, wird man
Pawkowicz alles in allem
gesehen, wohl als Liberalen
bezeichnen.
Neben dem Sohn Alexander hatte Rainer Pawkowicz auch noch
eine heute 40-jährige Tochter. Sie hat bereits sehr früh geheiratet. Dieser
ihrer ersten Ehe entstammt ein Kind. Bis zum heutigen Tag sind
noch drei weitere Kinder, alle drei auf einmal,
dazu gekommen. Sie hat in zweiter Ehe mit
dem FPÖ-Abgeordneten Werner Herbert auch
noch Drillinge bekommen und arbeitet mittlerweile
bei Präsident Johann Herzog in der Wiener
Freiheitlichen Akademie als Büroleiterin.
Rainer Pawkowicz konnte aber leider keines der
vier Enkelkinder mehr persönlich kennenlernen.
Er ist knapp vor der ersten Geburt verstorben.
Trotz seiner ergiebigen burschenschaftlichen
Tätigkeit wird man Pawkowicz, alles in
allem gesehen, wohl als Liberalen bezeichnen.
Das allerdings in bestem, freidenkerischem
Sinn. Bereits als Jugendlichen und Studenten
trieb es ihn in die Welt hinaus, um andere Länder,
andere Sitten und vor allem auch andere
Kulturen kennenzulernen. Reisen mit allen möglichen Gefährten in und
auf die verschiedensten Kontinente sind hier verbrieft. So auch seine
nicht gerade gewöhnliche Reise mit seinem Schwager (dem Bruder des
Ehemannes seiner Schwester) nach Indien über die Türkei und Vorderasien..
Das Geld dafür verdiente er sich wiederum auf ganz besondere
Art. Der Tausendsassa war nämlich auch noch künstlerisch tätig. Er
malte gerne und ganz offenbar auch gut. Zu seiner Studienzeit gab es im
ersten Wiener Bezirk einen sogenannten Kulturtreffpunkt. Es war die
Gallerie des „Jazzlands“. Sie stellte junge aufstrebende österreichische
Künstler aus. So auch die Werke von Rainer Pawkowicz. Und es blieb
nicht bei der Ausstellung alleine. Die Bilder wurden auch gekauft. Das
Geld wiederum investierte Rainer dann in seine Auslandsreisen, zum
Beispiel auch jene nach Vorderasien und Indien. Das war aber nicht die
einzige „nebenberufliche Aktivität.“ So wusste auch sein Nachfolger als
Wiener Landesparteiobmann Hilmar Kabas zu berichten, wie Pawkowicz
als Leichtmatrose die Donau entlang zum Schwarzen Meer tingelte.
Eine Geschichte die Rainer selbst immer wieder gerne zum Besten
gab. Das aber waren nur zwei wenige der zahlreichen „Tramperreisen“,
die der junge Rainer Pawkowicz unternahm. Die erste, die Schwarzmeerreise
diente noch dazu als Studentenjob, also in erster Linie wohl
dem Gelderwerb in den Ferien.
Aus dem Gedanken des Freidenkertums heraus ist es auch verständlich,
dass Pawkowicz und seine „Clique“, wenn man sie so bezeichnen
möchte, Aldanen geworden waren. Sie hatten sich eine Reihe von Bünden,
darunter auch für einige Zeit die Landsmannschaft Cimbria, angeschaut,
um sich schließlich als „Block“ gewissermaßen den Aldanen
zuzuwenden. Dieser Bund war kleiner und in den Beziehungen auch
persönlicher. Pawkowicz, der wohl auch in dieser Beziehung der Tonangebende
gewesen war, wollte wohl lieber eine Vereinigung, die für ihn
mehr Gestaltungsmöglichkeiten versprach als ein anderer Bund.
„National“, als scheinbarer Gegensatz zu „liberal“, wie man heute
im Nachhinein, bezogen auf die historische FPÖ gerne urteilt, war da-
64
1990–2004
mals, Anfang der 60-iger Jahre, wohl von einer anderen Perspektive aus
zu sehen. Natürlich gab es diesen ewigen Zwiespalt auch bereits beim
VdU und bei den Anfängen der FPÖ. Allerdings handelte es sich dabei
keineswegs um unversöhnliche Standpunkte, sondern vielmehr um
Positionen, die von den einzelnen Proponenten eingenommen wurden.
Die jeweilige Abstempelung ist dann wohl, so wie es auch heute in vielerlei
Hinsicht passiert, von den Medien vorgenommen worden.
Das beste Beispiel dafür ist wohl die Person des legendären Parteiobmannes
Jörg Hader. Haider galt in seiner Jugend, vor allem beim RFJ,
eigentlich als Liberaler und war dies auch noch lange Zeit, als er bereits
für die FPÖ 1979 in den Nationalrat eingezogen war. Dort war er nicht
nur der jüngste Parlamentarier, sondern auch, noch bevor er als Landesparteisekretär
nach Kärnten
ging, bezeichnenderweise Sozialsprecher
seiner Partei.
Rainer Pawkowicz
war auch begnadeter
Maler: Eine
rote oder eine
gelbe aufgehende
Sonne, die ihn im
indischen Dschungel
regelmäßig
fasziniert hat und
die er in den Siebzigern
gemalt hat
Nun, Kärnten macht
scheinbar alles anders und
so wandelte sich Haider unter
Mario Ferrari Brunnenfeld
zum Nationalen. Es war
schließlich jenes Bundesland,
dessen damaliger sozialistische
Landeshauptmann,
Leopold Wagner, von sich
aus bedauerte, selbst niemals
bei der Napola, der Elitemittelschule
der Nationalsozialisten
gewesen zu sein,
der aber stolz beteuerte, ein
hochrangiger Hitlerjunge gewesen
zu sein.
Dass damals ein Wandel
mit Haider passierte, oder
war es vielleicht eine geeignete
Anpassung nach außen
hin, dürfte wohl auch in erster
Linie einen gewichtigen
Grund gehabt haben. Es
wird wohl auch darauf zurückzuführen
sein, dass Norbert
Steger es nicht zustande
brachte oder auch gar nicht
zustande bringen wollte, Jörg
Haider in der Regierung mit
Sinowatz zum Sozialminister
zu machen. Haider wurde
schließlich zum Super-Nationalen
und er war das auch
weitgehend. Jedenfalls hat
er als späterer Landeshauptmann
unter anderem die eindeutig
konsequenteste Linie
65
An der blauen Donau
Rainer Pawkowicz
beim Empfang
von PLO-Chef
Yasi Arafat im
Wiener Rathaus
den Slowenen gegenüber vertreten, mit den eindeutig am schwerwiegendsten,
oft überraschenden Weigerungen auch gegenüber dem Verfassungsgerichtshof.
Nichtsdestoweniger zeigt gerade das Beispiel Haider, wie leicht es
gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, zwischen den
scheinbaren Fronten zu wechseln und sich entsprechend auf der einen
oder der anderen Seite zu positionieren. Wenn man Rainer Pawkowicz
für diese Zeit als „Liberalen“ einordnet, so hat das eine andere Bedeutung,
als sie es heute hätte. Freiheitlich hatte jedenfalls sehr viel mit
„freigeistig“ zu tun und nicht nur mit „liberal denkend“. Nehmen wir da
nur einmal ein weiteres Beispiel von Rainer Pawkowicz aus der Wiener
66
1990–2004
Politik. Wir alle kennen die heutigen Bemühungen der obersten Staatsautoritäten,
inklusive jene des Herrn Bundespräsidenten, um den 8. Mai.
Jener Tag, der das Kriegsende 1945 in Europa bedeutet, wird von den
österreichischen Offiziellen als der große „Befreiungstag“ gefeiert, was
immerhin bemerkenswert erscheint, sprach doch Leopold Figl in seiner
denkwürdigen Rede nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages
im Jahre 1955 vom oberen Belvedere den Satz: „Österreich ist frei“,
Es dürfte dem damaligen Außenminister wohl entgangen sein, was die
österreichischen Medien heute so gerne immer wieder zu berichten wissen,
dass Österreich ja bereits zehn Jahre vorher befreit worden sei.
Mit diesem Tag als Gedenken an den eben beendeten Zweiten Weltkrieg
hat in Wien die Burschenschaft begonnen. Und das auf eine Initiative,
die von dem Wiener FPÖ-Politiker Rainer Pawkowicz ausgegangen
ist. Seit 1993 legte die Burschenschaft mit der Vorsitzenden des WKR an
der Spitze zum Totengedenken einen Kranz nieder. Zuerst beim Denkmal
für die Gefallenen am äußeren Burgtor, dann als das von den aufgehetzten
Behörden verboten wurde, an anderen Stellen. Nun, Rainer Pawkowicz
war nicht nur der Initiator dieses burschenschaftlichen Aktes,
sondern auch eines Antrags, diesen 8. Mai zum
Staatsfeiertag zu erklären. Eine Initiative, die
damals allerdings von Rot und Schwarz abgeschmettert
worden war. Eines allerdings zeigt
auch dieses Ereignis. Der scheinbar „liberale“
Pawkowicz hat es in gutem freiheitlichem Sinn
durchaus verstanden, politische Akzente zu
setzen, die jeder der nach heutigen Maßstäben
von den Leitmedien „Gebildeten“ als „erznational“
bezeichnet werden würde.
Bemerkenswert für den FPÖ-Politiker ist
aber auch noch seine weit über die politischen
Erfordernisse hinauswirkende Agilität. Nicht
nur in burschenschaftlicher Hinsicht handelte
der Politiker stets zukunftsorientiert, auch
in beruflicher Hinsicht war das so. Bereits in
den Jahren des Studiums agierte er immer wieder als Werkstudent.
Er arbeitete in seinem Fach bei verschiedenen Baufirmen und Architektenbüros
als Planer und Bauleiter. Nach Abschluss des Studiums
kam er schließlich zur Akademie der Wissenschaften und führte
deren Bauprojekte.1996, knapp vor seinem Tode, wurde er noch
Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten.
Ein Arbeitsplatz allerdings, der viel Ehr‘, aber kein Geld
einbrachte. Er war aufgrund seiner Tätigkeit im Wiener Rathaus ohne
Bezüge karenziert.
„
Nach Abschluss
des Studiums kam er
schließlich zur Akademie
der Wissenschaften und
führte deren Bauprojekte
durch.
Studium, Burschenschaft und Werkstudentum waren aber nicht
die einzigen Betätigungen von Rainer Pawkowicz. Auf der Universität
stürzte er sich bereits in den jungen Jahren seines Studiums in politische
Aktivitäten. Seine Arbeit beim Ring Freiheitlicher Studenten war eine
sehr ausgedehnte. Er war Mandatar des Fachausschusses für Architektur
und Ingenieurwesen an der Technischen Universität (damals noch
Hochschule) und brachte es dort bis zum stellvertretenden Vorsitzenden.
Als solcher wurde er auch Mitglied des Zentralausschusses der österreichischen
Hochschülerschaft. Es ist wohl müßig zu sagen, dass er in
Fortsetzung auf Seite 73 ▶
67
An der blauen Donau
Ein „liberaler Freidenker mit nationalen Wurzeln“
Der Wiener Gemeinderat Alexander Pawkowicz über seinen
Vater Rainer Pawkowicz und dessen politische Positionen
68
Herr Pawkowicz, als Sohn eines berühmten Vaters
hat es sie ebenfalls in die Politik verschlagen…
Alexander Pawkowicz: Im Grunde ist die
ganze Familie Pawkowicz eine durch und durch
politische Familie. Meine Schwester Katharina
beispielsweise ist Bezirksrätin im 15. Wiener Gemeindebezirk
und Büroleiterin in der Freiheitlichen
Akademie Wien.
Mein Vater hat aber vor allem durch sein
gelebtes Vorbild mein eigenes Selbstverständnis
von Politik als Dienst an der Gemeinschaft geprägt.
Er hat damit zweifellos einen großen Anteil
an meinem eigenen politischen Leben. Das
gilt aber auch für seine engeren politischen Wegbegleiter,
wie Hilmar Kabas oder Johann Herzog.
Johann Herzog ist auch im Hinblick auf Ihren Vater
ein durchaus interessanter Mann.
Selbstverständlich. Immerhin haben die beiden
zusammen im Gymnasium in der Waltergasse
im 4. Bezirk maturiert. Mit den weiteren Klassenkollegen
Peter Engl und Werner Götzhaber
sind sie dann zu viert in die akademische Burschenschaft
Aldania eingetreten.
Ihr Vater war aber meines Wissens nicht nur Aldane,
sondern auch Olympe!
Pawkowicz: Zunächst war er Aldane, weil
dieser Bund damals sehr klein war, und mein Vater
gestalten wollte. Aber auch in der Olympia
sah er eine Herausforderung, die ihn brennend
interessierte. In beiden Bünden waren tatkräftige
junge Männer gefragt, die sich trauten, Neues
wiederaufzubauen.
Das gilt wohl ganz besonders für die
Olympia, die zu diesem Zeitpunkt ja so
etwas wie „vertagt“ war.
Pawkowicz: Die Olympia
war damals aus formalen Gründen
vereinsrechtlich aufgelöst
– politisch „verboten“, wie heutzutage
oftmals kolportiert wird,
war sie nie. Konkret ging es dabei
um die Geschichte Südtirols, das
ja bekanntlich nach dem ersten
Weltkrieg von Österreich abgetrennt
worden war. Die Olympen
hatten einen Beschluss gefasst,
wonach jedes Mitglied eine Umlage
für die gerichtliche Vertretung
von Bundesbrüdern in Italien
leisten sollte. So eine Umlage war
aber durch die Satzung nicht gedeckt
und ermöglichte der Behörde
die formale Auflösung des Vereins
„wegen Überschreitung des
satzungsmäßigen Vereinszwecks“.
Und die Olympen sind dann nach
der Auflösung Vandalen geworden.
Pawkowicz: Nein, auch das ist eine leichte
Unschärfe. Die akademische Burschenschaft
Vandalia – nicht verwandt mit der gleichnamigen
Mittelschulverbindung – gab es längst. Das war
allerdings ein anderer Bund. Die meisten Olympen
haben nach der vereinsrechtlichen Auflösung
ihres eigenen Bundes sozusagen „Asyl“ in
der Vandalia erhalten und wurden dort Mitglied.
Und Rainer Pawkowicz war also auch Vandale?
Pawkowicz: Nicht zu diesem Zeitpunkt.
Trotzdem haben wir bei den Vorbereitungen zu
seinem Begräbnis 1998 zu Hause drei Couleurs
gefunden. Da war neben dem Aldanen- und dem
Fortsetzung auf Seite 154 ▶
1990–2004
Olympencouleur zu unserer Überraschung eben
auch die Vandalen-Mütze dabei.
Wie wurde er also Olympe, oder Vandale?
Pawkowicz: Im Grunde hat sich mein Vater
nur sehr schlau die Eigenheiten des österreichischen
Beamtenapparates zunutze gemacht. Und
so, wie er die Geschichte oft launisch erzählt
hat, hatte er wohl eine diebische Freude daran:
Die Olympia ist nämlich jahrelang bei zahlreichen
Versuchen der Wiedergründung an der
Vereinsbehörde gescheitert. In Österreich darf
ja bekanntlich zwar jeder ganz einfach einen
Verein gründen, danach hat die Vereinsbehörde
aber einige Wochen Zeit, die Zulassung zu versagen.
Tut sie das nicht – sprich, wenn sich die
Behörde in der Frist nicht meldet -, gilt
der Verein als genehmigt.
Für das, was folgte, muss man zunächst
wissen, dass mein Vater der Behörde
nicht bekannt war. Er war ja nie
Olympe gewesen und in diesem Sinne
„unauffällig“. Diesen Umstand, und
den gleichzeitigen Beginn der Sommerferien
machte er sich also zunutze.
Im Juli 1970 reichten zwei unbescholtene,
behördlich unbekannte
Studenten – Rainer Pawkowicz und
Werner Götzhaber – die Vereinsgründung
für die neue „Olympia“ ein. Und
bis der politische Beamtenapparat von der Sache
Wind bekommen hatte, waren die Sommerferien
zu Ende. Im September 1970 stand
dann eines morgens ein Staatspolizist vor der
Wohnungstüre meines Vaters in der Schwendergasse
und forderte ihn auf, den Antrag
zurückzuziehen. Da war die Frist aber längst
abgelaufen und der Herr musste unverrichteter
Dinge abziehen. Nach einigen erfolglosen
behördlichen Verzögerungen wurde die Olympia
mit 22. März 1971 dann ins Vereinsregister
eingetragen.
Das heißt, die Olympia hat von diesem
Zeitpunkt an, dem Ablauf der möglichen Einspruchsfrist,
wieder neu zu existieren begonnen.
Die Olympia war damit auch formal wieder
gegründet. Zum Dank erhielten mein Vater und
Werner Götzhaber dann die Bänder von Olympia
und Vandalia.
Im Jahr 1987, als mein Vater als „nicht amtsführender
Stadtrat“ Mitglied der Wiener Landesregierung
wurde, ist er allerdings aufgrund
von Auffassungsunterschieden im Zusammenhang
mit Norbert Burger wieder ausgetreten. In
diesem Sinne war er also tatsächlich nur Aldane.
Ihr Vater hat seine Kindheit in Knittelfeld in der
Steiermark verbracht, obwohl er in Wien geboren ist. Wie
kam es dazu?
Pawkowicz: Er war ein Kriegskind. Als
mein Vater im Jänner 1944 auf die Welt kam,
so erzählte es meine Großmutter, war es wieder
einmal eine fürchterliche Nacht in Wien. Die
Stadt wurde gerade wieder einmal bombardiert.
Und so zog meine Großmutter mit dem Säugling
und dessen sechsjähriger Schwester – das
ist meine Tante – Mitte 1944 zunächst zu ihren
Verwandten – allesamt Eisenbahner – auf den
Semmering, wo mein Großvater in den Zwanziger
Jahren ursprünglich ebenfalls eine Eisenbahnerkarriere
als Bahnhofsvorstand begonnen
hatte. Um den einfallenden Sowjettruppen zu
entgehen, flohen die Frauen und Kinder meiner
Familie dann weiter westwärts, zunächst nach
Oberzeiring nördlich von Judenburg, und 1946
„
Mein Vater hat sich, so
wie ich ihn wahrgenommen
habe, als „liberaler Freidenker
mit nationalen Wurzeln“
gesehen.
schließlich nach Knittelfeld. Mein Großvater
hatte dort eine neue Dienststelle zugewiesen
bekommen. Die anderen Eisenbahnerverwandten
fanden neue Dienststellen in Wels, Villach
und in anderen Eisenbahnerstädten. Das ist
der Hauptgrund, warum meine durchwegs politische
Verwandtschaft in ganz Österreich verstreut
lebt.
Und wann kam er zurück nach Wien?
Pawkowicz: Mein Großvater bekam 1953
eine Stelle in der ÖBB-Generaldirektion in Wien
und eine Eisenbahner-Dienstwohnung im 3. Bezirk
am Landstraßer Gürtel. Ein Jahr später, am
Ende der Volksschule, folgte ihm dann meine
Großmutter mit den Kindern. Als „Zugeraster“
bekam mein Vater dann zunächst einen Platz
an einer Hauptschule im 3. Bezirk zugewiesen.
Aufgrund seiner Leistungen und dem forschen
Drängen meines Großvaters konnte er im Folgejahr
in eine Zweite Klasse ins Gymnasium „Rainergasse“
im 5. Bezirk wechseln. Ab der Oberstufe
besuchte er dann als eher technisch denn
sprachlich versierter Schüler das Realgymnasium
Waltergasse, ebenfalls im 4. Bezirk, und maturierte
dort im Jahr 1962.
Das ist natürlich spannend, zieht man seine Klassenkollegen
aus dieser Zeit in Betracht.
69
An der blauen Donau
70
Pawkowicz: Ja das ist ein wichtiger Punkt.
Werner Götzhaber war da dabei, wie auch Johann
Herzog, beide haben mit meinem Vater maturiert.
Götzhaber hat später seine Freundin Karin
geheiratet, die mein Vater unter dem Familiennamen
„Landauer“ Jahre später in das Rathaus holte.
Sein Klassenkollege Peter Engl war nur ganz
kurz im Gemeinderat und bevorzugte eine Karriere
in der Privatwirtschaft. Das war in Summe
eine starke Kameradschaft, die – gemeinsam mit
anderen frühen Weggefährten – den Grundstein
für die spätere gemeinsame Karriere bildete.
Nochmals zurück zum privaten Bereich, haben Sie
außer ihrer Schwester Katharina noch weitere Geschwister?
Pawkowicz: Nein, Katharina ist fünf Jahre
jünger als ich und meine einzige Schwester. Sie
hat sehr früh geheiratet und aus dieser Beziehung
„
Während der restliche
Saal applaudiert und jubelt,
verharren die Wiener regungslos
und enthalten sich jeglicher
Beifallskundgebung.
meine bezaubernde Nichte Stephanie, die heute
als Referentin im Wiener Seniorenring arbeitet,
großgezogen. Mit ihrem zweiten Mann, Werner
Herbert, kamen dann gleich drei Kinder dazu –
gleichzeitig. Die Drillinge sind heute ein dominierender
Faktor in unserer Familie.
Ein wesentlicher Punkt in der politischen Laufbahn
war wohl die Entscheidung Ihres Vaters zwischen der politischen
Linie und der Person Norbert Stegers einerseits
und jener von Jörg Haider andererseits. Wo war da Ihr
Vater angesiedelt?
Pawkowicz: Aus meiner Sicht war das eigentlich
eine ideale Verbindung. Mein Vater hat
sich, so wie ich ihn wahrgenommen habe, als
„liberaler Freidenker mit nationalen Wurzeln“
gesehen. „Liberal“ im ureigensten Sinn! Er hat
im Laufe seines Lebens unzählige Reisen unternommen.
Schon als Student war er oft monatelang
unterwegs, einerseits aus Studiengründen,
aber auch zur Erweiterung seines persönlichen
Horizonts. Da ging es beispielsweise mit dem
Rucksack per Autostopp, Moped und Leihauto
über die Türkei, den Iran, Afghanistan und Pakistan
bis ins entfernte Indien. Ohne Flug! Das ist
bei der heutigen Klimadebatte fast schon wieder
modern, entstand aber damals wohl eher aus der
finanziellen Situation heraus. Begleitet wurde er
dabei zumeist von meinem Onkel Claudius, der
ebenfalls „ Aldane“ ist. Seine Reisen führten in
später aber auch bis Brasilien und Paraguay an
einem Ende der Welt, und nach Australien und
Neuseeland am anderen Ende der Welt.
Zurück zu der Frage der Positionierung zwischen
„Liberal und National.“
Pawkowicz: Das ist eine interessante Frage.
Einerseits war er Mitglied des liberalen „Atterseekreises“
der FPÖ, andererseits war er Burschenschafter.
Obwohl einige Burschenschafter
sicherlich so ihre Not mit dem jungen Pawkowicz
hatten – lange Haare, langer Bart, dazu noch
Architekt mit einem Hang zur Malerei.
Nichtsdestoweniger, das „liberale Band“ wird
die Nachwelt ihrem Vater wohl umhängen?
Pawkowicz: Eines ist mir allerdings
bewusst und das deutet eindeutig auf eine
eher liberale Ausrichtung hin: Unmittelbar
nach seinem Architekturstudium trat er eine
Stelle bei einem Arabischen Architekturbüro
mit Dependance in Wien an. Wir haben
zu Hause immer noch zahlreiche Pläne für
Bauten in Abu Dhabi (VAE), Jeddah (Saudi
Arabien) oder Kairo (Ägypten). Ich erinnere
mich gut daran, weil ich schon als Kind bei
einige Reisen in die Wüstenregionen mit dabei
sein durfte. Die waren damals allerdings
um einiges „westlicher“ als heute – mein erstes
Cola habe ich als Kind auf der Terrasse eines
arabischen Architekten in Kairo getrunken.
Sein Augenmerk war aber auch damals in erster
Line auf Österreich ausgerichtet?
Pawkowicz: Ja natürlich. Er ist dann in
weiterer Folge in die Österreichische Akademie
der Wissenschaften gewechselt und wurde dort
schließlich Leiter des Baureferates. Ich war als
Volksschüler manches Mal dabei, wenn er für diverse
Umbauten der Akademie die großen österreichischen
Wissenschafter aller Fachrichtungen
betreut hat. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Besonders eng war er mit Konrad Lorenz
und dessen Schüler, Otto König, verbunden. An
den süßen Biber im Vorgartengehege von Konrad
Lorenz erinnere ich mich gut. Aus dieser Zeit
stammen auch zahlreiche persönlich gewidmete
Bücher in unsere Hausbibliothek.
Nun, diese beiden gelten wieder, zumindest heute,
eher als national…
Pawkowicz: Ich muss in diesem Zusammenhang
allerdings auch an den Bundesparteitag
in Innsbruck 1986 erinnern. Da muss man
1990–2004
die Fernsehaufnahmen des ORF kennen, die
aber selten in voller Länge gezeigt werden. Die
bekannte Sequenz ist jene von Jörg Haider, als
dieser von seinen Anhängern in den Saal getragen
wird. Nur selten wiederholt wird aber das
Ende derselben Sequenz: In der ersten Reihe
vorne sitzt da die gesamte Wiener Landesgruppe.
Neben Steger sitzt mein Vater. Während der
restliche Saal applaudiert und jubelt, verharren
die Wiener – auch mein Vater – regungslos und
enthalten sich jeglicher Beifallskundgebung.
Haben Sie eigentlich jemals mit Ihrem Vater darüber
geredet?
Pawkowicz: Als Jugendlicher, da war Jörg
Haider schon längst Bundesparteiobmann, habe
ich das einmal im Fernsehen gesehen und meinen
Vater darauf angesprochen. Er antwortete
aber ausweichend diplomatisch: „Daran kann ich
mich gar nicht erinnern, da habe ich mich wahrscheinlich
gerade unterhalten“.
Wie war nun aber die Beziehung von Rainer
Pawkowicz zum späteren Seriensieger Jörg
Haider tatsächlich?
Pawkowicz: Mein Vater hat mit
Haider immer einen Konflikt ausgetragen
– und umgekehrt. Das war aber stets
hinter verschlossenen Türen.
Ein bisschen war da wohl die Befürchtung
Haiders, dass bei den Wiener Wahlen die Erfolge
dem Wiener Obmann Pawkowicz zugeschrieben
würden, auch wenn österreichweit Jörg
Haider als Erfolgsgarantie galt?
Pawkowicz: Das ist die eine Sichtweise.
Es gibt aber auch eine andere
Sichtweise am Beispiel der Gemeinderatswahlen
1996. Diese fand gleichzeitig
mit der EU-Wahl statt. Das heißt, am selben
Tag in derselben Wahlzelle hatten die weitgehend
selben Wahlberechtigten sowohl eine bundespolitische
Entscheidung (EU-Wahl), als auch eine
landespolitische (Landtag und Gemeinderat) zu
treffen. Und spätestens seither wissen wir, dass
die Wählerinnen und Wähler sehr genau unterscheiden,
welche Funktion und welche Person sie
wählen.
Man hat damals ja geglaubt, alles Positive in der
FPÖ käme nur von Jörg Haider
Pawkowicz: Aus der so genannten „Buberlpartie“
kam damals die sinngemäße Meldung an
meinen Vater: „Na, mit Deinem Aussehen kann
man wohl kaum eine Wahl gewinnen“. Worauf
mein Vater geantwortet haben soll: „Na mit
Deinem Aussehen und mit meiner Intelligenz
wären wir dann beide unschlagbar.“ Faktum ist
aber, dass bei der Wahl 1996 die Bundespartei
den Wienern die Unterstützung verweigert hatte
und Jörg Haider nicht ein einziges Mal für eine
Wienveranstaltung zur Verfügung gestanden war.
Mein Vater plakatierte unterdessen mit seinem
Konterfei: „Wir bleiben dabei: Wien darf nicht
Chicago werden“. Also eine Fortsetzung der erfolgreichen
Kampagne aus 1991.
Und die Wahl brachte dann ja ein überraschendes
Ergebnis…
Pawkowicz: So ist es. Nämlich fast 28 % für
die Wiener FPÖ im Landtag, aber nur 24 % in
Wien für Jörg Haiders Team bei der EU-Wahl –
wohlgemerkt am selben Tag, in denselben Wahlzellen
von denselben Wahlberechtigten.
Ein Tag, der nicht ganz einfach war für Ihren Vater?
Pawkowicz: Ich kann mich noch genau an
die Nervosität meines Vaters an diesem Tag erinnern.
Nur wusste ich ja damals noch nichts
von den internen Auseinandersetzungen und
verstand daher seine Nervosität nicht. Ich begleitete
also damals meinen Vater ins Rathaus und
„
Aus der so genannten
„Buberlpartie“ kam damals
die sinngemäße Meldung an
meinen Vater: „Na, mit
Deinem Aussehen kann man
wohl kaum eine Wahl
gewinnen.“
er sperrte uns in seinem großen Büro ein. Es
konnte an diesem Wahlabend niemand zu ihm.
Nicht die zahlreichen Medienvertreter, nicht die
wartenden Funktionäre, ja nicht einmal seine Assistentin.
Und er tat etwas, was ich von ihm bis
dahin auch nicht kannte: Er hat Zigaretten geraucht.
Eine nach der anderen. Jahre später habe
ich dann erfahren, dass er immer wieder in Wahlkampfzeiten
geraucht hat, nach den Wahlen aber
war er wieder monatelang Nicht-Raucher.
Und von der freiheitlichen Führungsspitze gab es
auch niemanden, der zu ihm durfte?
Pawkowicz: Der einzige, der ebenfalls einen
Schlüssel für meines Vaters Büro hatte und daher
durch eine Hintertüre gelegentlich hereinkam,
war Hilmar Kabas. Ab 18 Uhr war schon klar,
dass die FPÖ bei der EU-Wahl ein respektables
Ergebnis einfahren würde. Und mein Vater wurde
immer noch nervöser. Weil es um 19 Uhr
beim ersten ORF-Live-Einstieg noch immer kei-
71
An der blauen Donau
72
ne Hochrechnung für Wien gab, schickte er Hilmar
Kabas zum Interviewtermin und blieb selber
eingesperrt. Um 19.20 Uhr kam dann endlich die
erste Wiener Hochrechnung: Erwartet wurden
unglaubliche 27,5 Prozent, also ziemlich genau
das spätere Endergebnis. Während draußen im
Büro Jubelschreie zu hören waren, blickte mein
Vater eine gefühlte Ewigkeit ungläubig und regungslos
in den Fernseher. Dann kam abermals
Hilmar Kabas mit ersten Teilergebnissen herein
und seine Freude und Erleichterung war spürbar
und unbeschreiblich.
„
Es gab auch damals
schon in den anderen Bundesländer
Leute, die sich mit Haider
überworfen hatten
Das hat nun aber zu einer Zäsur geführt…
Pawkowicz: Ja tatsächlich, nach diesem Sieg
ist mein Vater zum Bundesparteiobmann-Stellvertreter
aufgestiegen. Es gab auch damals schon
in den anderen Bundesländer Leute, die sich mit
Haider überworfen hatten und neben diesem
gerne einen personellen Gegenpol gesehen haben.
Das hat mein Vater aber stets abgelehnt.
Wusste Ihr Vater eigentlich damals schon von seiner
todbringenden Krankheit?
Pawkowicz: Nein, das kam für alle überraschend.
Noch im Jänner 1997 erfolgte eine mehrtägige,
routinemäßige Gesunden- Untersuchung,
bei der noch alles in Ordnung war. Anfang Mai
1997 kamen dann die ersten Kopfschmerzen und
über Betreiben von Universitätsprofessor Pendl
wurde dann im SMZ-Ost ein schnell wachsender
Gehirntumor, ein so genanntes „Glioblastom“,
festgestellt, das aufgrund seiner Lage kaum zu
operieren war. Wenige Monate später, am 28.
März 1998, war er tot.
Ich habe Rainer Pawkowicz als genialen Politiker
für den parteiinternen Bereich kennengelernt. Er hat es
verstanden, alle 23 Bezirke in Wien unter einen, seinen
Hut zu bringen. Was aber war Ihrer Meinung nach sein
wichtigstes „außenpolitisches“ Anliegen in Wien?
Pawkowicz: In Wien war sein Steckenpferd
die Stadtentwicklung und der Tourismussektor.
Er war auch eine Zeitlang Vizepräsident des
Wiener Tourismusverbandes. Er hat sich sehr
intensiv mit dem Ausbau der S-Bahn und der
U-Bahn, und vor allem für die Schaffung eines
eigenen Wiener Zentralbahnhofes anstelle der
zahlreichen damaligen Kopfbahnhöfe eingesetzt.
Damit konnte man als Oppositionspartei aber
kaum Wählerstimmen bekommen. Das gelang
dann schon viel mehr mit dem „Chicago-Wahlspruch“.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Pawkowicz: Das ist eine interessante Frage.
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und der
Öffnung der Grenzen ab 1989 kam es auch zu einer
einsetzenden Zunahme der Kriminalität. Daher
sollte der Spruch eigentlich auf „New York“
lauten, dass damals die Hochburg der amerikanischen
Kriminalität war. Testbefragungen haben
aber gezeigt, das New York trotz der Kriminalität
als pulsierende Wirtschaftsmetropole und
sehr positiv gesehen wurde. Daraufhin fiel
die Wahl auf „Chicago“, weil zu dieser Zeit
gerade die Fernsehserie „Chicago 1930“ lief
und diese Stadt von den Wienern vor allem
mit „Al Capone“ und hoher Kriminalität in
Verbindung gebracht wurde.
Gab es auch, abgesehen von der Wien-Wahl
1996, vielleicht unerwartete, außergewöhnliche Erfolge?
Pawkowicz: Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft
an den berühmten Psychotherapeuten
Victor Frankl war sicherlich ein ganz
besonderer Erfolg. Mein Vater kannte Victor
Frankl aus seiner Zeit als Bauleiter in der Akademie
der Wissenschaften. Frankl war zu diesem
Zeitpunkt zwar international höchst anerkannt,
vielfacher Ehrendoktor und hochdekoriert, aber
ausgerechnet in seiner Heimat Österreich war
er eigentlich nur unter Akademikern bekannt.
In der linken Szene war er umstritten, weil er
als Ausschwitz-Überlebender trotzdem keinen
Zorn hegte und auch immer über alle ideologischen
Grenzen hinweg das Gemeinsame über
das Trennende stellte. Nach einiger Vorbereitung
war es 1995 dann soweit, und Frankl konnte die
Ehrenbürgerwürde übernehmen. Bei uns zuhause
erinnern zahlreiche Briefwechsel Frankls mit
meinem Vater, Widmungen in Büchern und natürlich
die Fotos von zahlreichen privaten Treffen
an diese Zeit.
Zu dem Wiener Bürgermeister Helmut Zilk gab es
ein ausgesprochen gutes Verhältnis?
Pawkowicz: Ja das war legendär. Die beiden
trafen sich beispielsweise immer an den Abenden
vor den Gemeinderatssitzungen in einem Kämmerchen
im Restaurant des Rathauskeller, das
nur dem Bürgermeister vorbehalten ist, um gemeinsam
die kommende Sitzung durchzugehen
und um Grenzen auszuloten. Das wäre heute unvorstellbar.
Mit Häupl war das Verhältnis deutlich
1949–1955
kühler. Es war daher Helmut Zilk, der – obwohl
schon im Ruhestand – als Vertreter der Stadt
Wien die Ehrenrede am Wiener Zentralfriedhof
beim Begräbnis meines Vaters gehalten hat.
Hatte ihr Vater auch noch übergeordnete Ziele?
Pawkowicz: Er hatte schon Ideale, die sehr
stark burschenschaftlich geprägt waren. Politisch
war ihm aber in erster Linie Wien am Herzen
gelegen. Dafür hat er auch seine internationalen
Kontakte und Erfahrungen eingesetzt. Ehrlich
gesagt, glaube ich, dass ihn aber die Bundespolitik
nie sonderlich interessiert hat. Deshalb ist er auch
sehr schnell wieder aus dem Nationalrat ausgeschieden.
Alexander Pawkowicz ist seit 2015 Abgeordneter zum Wiener
Landtag und Gemeinderat in Wien. Davor war er von 1996 bis
2015 Mitglied des Bezirksparlamentes in Wien-Meidling, davon
fünf Jahre in der Funktion des Bezirksvorsteher-Stellvertreters.
Ab 1993 war er Vorstandsmitglied im Ring Freiheitlicher Jugend
in Wien. Beruflich studierte er Immobilienwirtschaft und ist seit
mehr als zwanzig Jahren in unterschiedlichsten Funktionen bei
zahlreichen Bauträgern in Mittel- und Osteuropa tätig.
dieser Funktion an der politischen Fraktion der Hochschülerschaft auch
seine Freunde der Aldania nachzog.
Gleiches gilt zumindest teilweise auch für die FPÖ. Am 3. November
1983 zog er als Gemeinderat in das Wiener Rathaus ein., Die
Bundes-FPÖ begab sich in diesem Jahr mit Pawkowicz-Vorgänger als
Wiener Obmann Norbert Steger in die Koalition mit Fred Sinowatz,
dem Kanzler von Kreiskys Gnaden. Die erste Periode absolvierte Pawkowicz
noch mit Erwin Hirnschall als Partner-Mandatar zu zweit im
Wiener Landtag. Bei den Wahlen im November 1987 stießen dann weitere
sieben Mandatare dazu. Die anfangs kleine Wiener Gruppe hatte
Treffen anlässlich der
Verleihung der Ehrenbürgerwürde
an Viktor
Frankl (1995): Eleonore
„Elly“ Schwindt (Viktor
Frankls Ehefrau), Viktor
Frankl, Jörg Haider, Hilmar
Kabas, Karin Landauer,
Rainer Pawkowicz
73
An der blauen Donau
„
Die Stadtrat
Tätigkeit von Rainer
Pawkowicz war auf einen
nichtamts führenden
Regierungssitz
beschränkt.
sich also vervierfacht. Mit der Bedeutung der FPÖ im Wiener Landtag
stieg auch die Bedeutung von Rainer Pawkowicz. Er konnte nicht nur
auf eine stärkere Truppe im Gemeinderat zurückblicken, sondern wurde
auch noch Stadtrat von Wien unter dem legendären Bürgermeister
Helmut Zilk von der SPÖ. Ein Landesherr, mit dem sich Pawkowicz besonders
gut verstehen sollte. Zilk war es auch gewesen, der 1997 bei der
Beisetzung von Rainer Pawkowicz die ehrenden Worte der „Laudatio“
am Wiener Zentralfriedhof gesprochen hatte.
Die Stadtrat Tätigkeit war auf einen nichtamtsführenden Regierungssitz
beschränkt. Wie es das Wiener Wahlrecht für nichtkoalierende
Parteien vorsieht, geschah dies stets ohne
bestimmtes Ressort. Der springende Punkt aber
war, dass auch die nichtamtsführenden Stadträte
an den Regierungssitzungen in Wien teilnahmen,
und daher wesentlich enger am Geschehen waren
als reine Abgeordnete. Mit dieser Funktion war es
aber für Pawkowicz noch nicht getan. Er wechselte
1990 in den Nationalrat, dem er bis zum Dezember
1991 angehörte. In dieser Zeit hatte sein
Stellvertreter Hilmar Kabas die Position des Stadtrates
in Wien übernommen. Interessanterweise
fällt auch in diese Zeit eine interessante Episode.
Ja, interessanterweise bei einem Arafat-Besuch in
Wien. Jassir Arafat war auf Staatsbesuch in Wien.
Plötzlich, nachdem ihm von einem seiner Mitarbeiter
etwas ins Ohr geflüstert wurde, meinte
Arafat, dem FPÖ-Politiker huldigen zu müssen.
Wie sich später herausstellte, ging das offenbar darauf zurück, dass sich
Pawkowicz öfters, schon aus dem freiheitlichen Selbstverständnis heraus,
im Nationalrat für die Selbständigkeit der Palästinenser ausgesprochen
hatte.
Mit der erfolgreichen Wien-Wahlen 1991 noch unter der Obmannschaft
von Erwin Hirnschall kehrte Pawkowicz nach Wien zurück. Ihm
hatte es im Nationalrat nie richtig gut gefallen hatte. Er erhielt in Wien
die Klubobmannschaft und wurde, da sich Hirnschall bereits auf sein
Altenteil vorbereitete, auch Landesparteiobmann der Wiener FPÖ. Zu
der innerösterreichischen politischen Tätigkeit gesellte sich bereits ein
Jahr später eine internationale. 1992 wurde er Mitglied der österreichischen
Delegation des Europarates in Straßburg.
In Wien gab es indessen viel zu tun. Mit der bundespolitischen Perspektive,
über die Pawkowicz nun verfügte, galt es nun, den auf sagenhafte
23 Mitglieder angewachsenen Klub der FPÖ im Wiener Gemeinderat
zu konsolidieren und zu führen. Und dann stand da die Wien-Wahl
1996 vor der Türe. Am gleichen Tag sollten in ganz Österreich die EU-
Wahl stattfinden. Das parallele Wien-Ergebnis stand dennoch im Blickpunkt
des Interesses in ganz Österreich. Alle in diesem Lande wussten,
dass sich Pawkowicz und Haider nicht besonders hold waren, Konflikte
wurden zwar ausschließlich hinter verschlossenen Türen ausgetragen,
aber dennoch war es bis in die letzten Winkel Österreichs durchgedrungen,
dass Haider in Wien lieber einen anderen Spitzenkandidaten gehabt
hätte. Scheibner beispielsweise oder Westenthaler standen bereit.
Schließlich kam es zu dem Abkommen, dass Haider in Wien Rainer
74
1990–2004
Pawkowicz die Wahl bestreiten lassen würde. Das allerdings unter der
Voraussetzung, dass er, Pawkowicz, das alleine würde machen müssen.
Tatsächlich gab es während des gesamten Wahlkampfs keinen einzigen
Haider-Auftritt in Wien zur Unterstützung der Wiener FPÖ. Man kann
sich die Nervosität des Rainer Pawkowicz am Wahltag vorstellen. Immerhin
war an diesem Tag der direkte Vergleich mit den EU-Wahl bei
der sich Haider selbst ganz massiv ins Spiel gebracht hatte. Nun, das Ergebnis
ist bekannt. Während die FPÖ in Wien bei den Europawahl mit
24,4 Prozent ganz hervorragend abgeschlossen hatte, erreichte der am
Wahltag völlig entnervte Rainer Pawkowicz mit 27,9 Prozent ein noch
viel besseres Ergebnis und eine weitere unglaubliche Steigerung zu den
Vorwahlen. Mit diesem Ergebnis war das große Ziel erreicht. Die FPÖ
hatte in Wien die Position der zweitstärksten Kraft nicht nur gehalten,
sondern mit einem Plus von über 44.000 Stimmen auch noch kräftig
ausgebaut. An Mandaten konnte Pawkowicz zu den ohnehin schon
starken 23, mit denen er am Beginn seiner Obmannschaft in Wien 1991
hätte rechnen können, noch weitere sechs dazu gewinnen.
Hilmar Kabas
Der Einstieg von Hilmar Kabas in das Amt des Wiener Landesparteiobmannes
erfolgte abrupt, wenn auch nicht ganz unvorbereitet.
Bereits im Mai 1996 nur ein knappes halbes Jahr nach seiner Gesunden-Untersuchung
klagte Pawkowicz
über stärkere Kopfschmerzen.
Auch die Behandlung durch
den angesehenen Neurochirurgen
Prof. Hans Pendl konnte
schließlich das Blatt nicht mehr
wenden und so kam es letzten
Endes zur schicksalshaften Ablöse
an der Spitze der Wiener FPÖ.
Hilmar Kabas war der
politische Erbe von
Rainer Pawkowicz
Hilmar Kabas war natürlich
in Wien kein Unbekannter. Bereits
Erwin Hirnschall aus dem
Waldviertel, der Mitbegründer
der Wiener Freiheitlichen war ein
Förderer von Kabas gewesen. Als
Landesjugendreferent der Wiener
FPÖ war er ja auch der erste Ansprechpartner.
Er war es auch gewesen,
der Kabas auf beruflicher
Ebene den Anstoß gab und ihn
ins Finanzressort gebracht hatte.
Und er war es auch, der ihn zu
verstärkter politischer Aktivität in
der Wiener FPÖ, der Kabas bereits
1961 beigetreten war, anregen konnte. Der Kontakt zu den Freiheitlichen
hat schon in jungen Jahren die Mutter von Hilmar Kabas
hergestellt. Sie, der Vater war 1945 im Krieg gefallen, hatte ihren Sohn
zu den Veranstaltungen der FPÖ im alten Wimberger am Gürtel mitgenommen.
Fortsetzung auf Seite 80 ▶
75
An der blauen Donau
„Ich war nie in der Gnade Jörg Haiders“
FPÖ-Ehrenobmann Hilmar Kabas über die
Geschichte der Wiener Freiheitlichen
innern. Es war, wenn ich mich recht erinnere,
im Jahr 1961, dass ich der FPÖ beigetreten
bin. Natürlich der Wiener Landesgruppe.
Da war Broesigke Obmann. Da gab es Erwin
Hirnschall, alles lauter honorige freiheitliche
Persönlichkeiten. Ich will aber auch nicht verhehlen,
dass für mich schwerpunktmäßig Dr.
Hirnschall geworben hatte. Er hatte damals
auch den Anstoß gegeben, dass ich in weiterer
Folge zur Finanz gegangen bin.
Gab es vielleicht auch eine familiäre Bindung zur
FPÖ.
Kabas: Ja, das kann man durchaus so sagen.
Die FPÖ hatte damals immer wieder
Veranstaltungen im alten Wimberger durchgeführt.
Und zu einzelnen dieser Veranstaltungen
hat mich meine Mutter mitgenommen. Sie hatte
die sehr honorigen Männer wie Gredler, Van
Tongel oder Broesigke sehr geschätzt. Sie hatte
die ganze Last meiner Erziehung zu tragen,
nachdem mein Vater 1945 gefallen war. Erwin
Hirnschall war damals deutlich jünger. Er kam
über den RFS zur FPÖ. Dort hatte ich mich
auch ein wenig engagiert. Ein bisschen allerdings
nur. Im Vordergrund standen damals
wohl der Ring Freiheitlicher Jugend und mein
Jus-Studium.
76
Herr Mag. Kabas, Sie sind so etwas wie ein freiheitliches
Urgestein, können Sie sich noch erinnern, wie alles
angefangen hat?
Hilmar Kabas: Das ist schon so lange
her, da fällt es manchmal schwer sich zu er-
Wann haben Sie eigentlich die Matura abgeschlossen?
Kabas: Das war 1960 im 5. Bezirk im BG5
in der Rainergasse. Das Gymnasium war an der
Grenze zum 4. Bezirk, was vielleicht bezeichnend
war, schließlich bin auch ich ein bisschen
so etwas wie ein Grenzgänger. Aufgewachsen
bin ich in der Kettenbrückengasse, ganz in der
Nähe.
Pawkowicz und Herzog waren ja auch nicht allzuweit
entfernt.
Kabas: Ja, die waren beide in der Waltergasse.
Sie haben meines Wissens zwei Jahre
später maturiert. Ich jedenfalls ging an das Juridikum
und zum Ring Freiheitlicher Jugend
(RFJ). Diesen habe ich zusammen mit Helmut
und Bruder Günter Lebisch an dieser Fakultät
aufgebaut. Wir konnten der Partei damals
in diesen Funktionen gute Dienste leisten. Ich
wurde auch RFJ-Obmann, was damals noch
Landesjugendführer geheißen hat.
Hirnschall. Ihr Förderer war ja beim RFS gewesen,
haben Sie sich dort ebenfalls eingebracht?
Kabas: Ich war schon auch beim RFS,
hatte aber kein nennenswertes Mandat. Mein
Schwerpunkt war ganz eindeutig bei der frei-
1990–2004
heitlichen Jugend. Wir hatten damals uns eine
Bude auf der Mölkerbastei erkämpft und haben
auch eine Zeitung herausgegeben, das war damals
„Der Jungfreiheitliche“. Diese Zeitschrift
geht im Wesentlichen auf Günther Lebisch
zurück, der an der WH diesen viersemestrigen
Kurs für Werbung und Verkauf gemacht hat.
Er war später auch als Werbefachmann recht
erfolgreich.
Wie ging es nun mit ihrer politischen Laufbahn weiter?
Kabas: Nun, die Arbeit beim RFJ ging bei
mir bis zu den Jahren 1967/68 weiter. Dann
wurde ich recht bald Bezirksrat im 9.Bezirk.
Ich habe dann schon sehr bald geheiratet und
wurde Vater.
Irgendwann kam dann auch im Wiener Vorstand
der Sprung auf den Posten des Obmannes?
Kabas: Ja, das hat aber noch eine
geraume Zeit gedauert. Vorher war ich
auch noch im österreichischen Nationalrat.
Im Parlament war ich als Jurist
auch Sprecher der FPÖ im Justizausschuss
und auch dessen Obmann.
Das alles unter einem Bundesminister
Harald Ofner. Mit diesem war ich beruflich
sehr verbunden und ich habe
auch mit ihm auf das Engste zusammengearbeitet.
Eine äußerst interessante
Zeit. Harald Ofner war nicht nur
ein ausgezeichneter Minister, sondern
auch ein wirklich guter Politiker, der
trotz der Abstimmungsniederlage gegen Norbert
Steger damals zur Spitze der FPÖ gehört
hat. Für mich war das auch schon deshalb interessant,
weil ich ja vier Jahre lang Mitarbeiter
von Gustav Zeilinger war, der ja auch vor mir
der Vorsitzende des Justizausschusses im Parlament
gewesen war.
es sich nicht irgendwann einmal mit der Partei
spießen könnte.
Nun, eine Möglichkeit des „Spießens“ bot ja innerhalb
der FPÖ der Konflikt zwischen „Liberal“ und
„National“.
Kabas: Natürlich gab es unterschiedliche
Meinungen. Andere Standpunkte beispielsweise
von Otto Scrinzi und Gustav Zeilinger. Es
wurde aber niemals in der Öffentlichkeit gestritten,
wie das heute so oft der Fall ist. In Bezug
auf „national und Liberal“ ist aber immer
sehr viel von außen in die Partei hineingetragen
worden. Natürlich war Zeilinger ein ganz
anderer Typ als etwa Emil van Tongel der die
Schutzengelapotheke auf der Wiedner Hauptstraße
besessen hatte. So musste dieser also
praktisch nie mit Existenzängsten kämpfen.
Zeilinger hatte zwar die Rechtsanwaltsprüfung
„
Natürlich gab es unterschiedliche
Meinungen.
Andere Standpunkte beispielsweise
von Otto Scrinzi
und Gustav Zeilinger.
abgeschlossen, diesen Beruf aber nie wirklich
ausgeübt. Dafür war er ein begnadeter Redner
und Politiker. Christian Broda hat schließlich
dafür gesorgt, dass Zeilinger Vorsitzender des
Justizausschusses wurde. Mit ihm hat dann
Broda, im guten Einvernehmen mit der FPÖ
stehend, die Strafrechtsreform durchgezogen.
Das muss aber wohl eine Generation zuvor gewesen
sein?
Kabas: Ja, ich habe nach meinem Eintritt
bei der Finanz meine Buchhaltungsprüfungen
gemacht. Das muss so 1968/69 gewesen sein.
Im Anschluss daran hat mich der damalige erste
Klubsekretär Mario Erschen bewogen, 1970 als
Mitarbeiter in den Parlamentsklub zu gehen.
Daraufhin wurde ich bei der Finanz dienstfreigestellt
und bin als öffentlich Bediensteter
in den Parlamentsklub der FPÖ übersiedelt.
Nach der öffentlichen Dienstprüfung wurde
ich dann Parlamentsbeamter. Ich sage das deshalb,
weil ich immer darauf bedacht war, nicht
in eine unmittelbare Abhängigkeit der FPÖ zu
kommen. Mir war es wichtig, Beamter im Parlament
zu sein. Man konnte ja nicht wissen, ob
Das überrascht eigentlich, vom Erzsozialisten Christian
Broda hätte man das nicht erwartet.
Kabas: Ja, es war zwar die Kreisky-Alleinregierung,
Broda war aber immer bemüht,
die Opposition stets mit einzubeziehen. Er
war überhaupt sehr kooperativ und das hat
schließlich auch Zeilinger geholfen. Broda hat
da ganz offensichtlich weit über den Horizont
hinausgesehen. Der Bruch kam dann allerdings
mit der Fristenlösung. Aber auch hier wurde
schließlich eine diplomatische Lösung gefunden.
Wie war das möglich?
Kabas: Man hat sich mit den Sozialisten
darauf geeinigt, dass die Fristenlösung aus der
Reform ausgeklammert und gesondert abge-
77
An der blauen Donau
stimmt wurde. Das Ergebnis ist bekannt. Die
Reform wurde einstimmig beschlossen, bei der
Fristenlösung waren dann ÖVP und FPÖ dagegen.
Welche Unterschiede gab es eigentlich zwischen der
Partei von damals und der heutigen?
Kabas: Schon ganz beachtliche. Die Abgeordneten
waren damals nahezu alle ganz
bedeutende Persönlichkeiten. Es ist natürlich
ein Unterschied, ob man zehn Abgeordnete
hat oder fünfzig. Denken Sie zum Beispiel
nur an Otto Scrinzi, weil wir ihn angesprochen
haben. Er war Neurologe und hat diesen
Beruf auch als Politiker weiterhin ausgeübt.
Als solcher wurde er auch immer wieder
Er war, so glaube ich, auch beim politischen Gegner
sehr geschätzt.
Kabas: Kreisky hat ihn sehr geschätzt
und hat letzten Endes auch dafür gesorgt,
dass er 1980 Rechnungshofpräsident geworden
ist. Das wurde, so glaube ich, ein wirklich
sehr schöner Abschluss seiner politischen
Laufbahn.
Kommen wir nun aber auch wieder ein bisschen zu
Ihnen zurück. Wie ist es nach Ihrer Tätigkeit im Nationalrat
weiter gegangen?
Kabas: Hervorzuheben wäre in diesem
Zusammenhang wäre wohl der Atterseekreis.
Ich war einer der Mitbegründer desselben.
Bei einer Enquete im Bundeskanzleramt habe
ich Friedhelm Frischenschlager getroffen. Ich
kannte ihn schon von früher her, hatte aber
keinen besonderen Kontakt zu Ihm. Er aber
hatte damals offenbar schon das Konzept des
Atterseekreises im Kopf und hat mich daraufhin
angesprochen
78
„
Broesigke war sicher
einer der am meisten Gebildeten
und Gescheitesten. Es
war wirklich bewundernswert.
als Sachverständiger von der Justiz herangezogen.
Also eine durchaus beeindruckende
Persönlichkeit.
Die FPÖ war damals also so etwas wie ein Intellektuellenstammtisch?
Kabas: Ja, das kann man so sagen. Die
FPÖ war damals wohl auch ein bisschen großdeutsch.
Sie war ganz sicher noch deutlich von
dieser Zeit gefärbt.
Der Wiener Obmann Broesigke kam ja aus dem
altösterreichischen Böhmen.
Kabas: Ja natürlich, er hat das auch nie
geleugnet. Broesigke war sicher einer der am
meisten Gebildeten und Gescheitesten. Es war
wirklich bewundernswert. Man konnte ansprechen,
was man wollte, ob es die Mathematik
war oder Geschichte, er zeigte sich stets beflissen
und bewandert darin. Und das auch noch
gänzlich ohne Allüren. Wenn man ihn näher
kannte, konnte man nur ein großer Anhänger
von ihm werden.
Da war doch Norbert Steger der erste Vorsitzende?
Kabas: Nein, das war Friedhelm Frischenschlager.
Steger war niemals Obmann,
er gehörte aber, wie manch anderer
auch zum Inneren Kreis. Ich möchte
ihn nicht in irgendeiner Weise reduzieren,
aber Obmann war er nicht. Sehr wohl aber
hat der Innere Kreis, dem Steger angehört
hatte, den Kontakt zur Partei gepflegt und
dort auch die Politik, die Ideen und Konzepte
des Attterseekreises „verkauft“.
Steger wurde dann aber Bundesobmann und er ist aus
dem Atterseekreis hervorgegangen?
Kabas: Ja, dem ist der provozierte Krach
mit Alexander Götz vorangegangen. Götz war
eigentlich eine sehr positive Erscheinung, hat
sich dann aber als Übergangslösung herausgestellt.
Dabei muss man es auch erst einmal
schaffen, Bürgermeister in Graz zu werden.
Jedenfalls ist es Steger dann gelungen, in einer
Kampfabstimmung gegen Harald Ofner die
Obmannschaft der österreichischen Bundes-
FPÖ an sich zu bringen. Da hat sich gezeigt,
dass der Atterseekreis vielschichtig war. Einerseits
hat er der Partei Ideen und Konzepte geliefert,
auf der anderen Seite hat er aber auch
für personellen Nachschub gesorgt.
Dazu kam, zumindest anfangs, natürlich auch die
Unterstützung von Friedrich Peter.
Kabas: Ja natürlich, Peter war ein cleverer
Politiker. Kreisky, mit dem Peter koalieren
wollte, hat von Peter eine liberale Komponente
der FPÖ gefordert. Und diesen Teil sollte
der Atterseekreis ausfüllen. Er ist damals einen
ganzen Nachmittag lang ins freiheitliche
Bildungsheim in Baden gekommen und hat
diesbezüglich mit uns Jungen diskutiert. Es
kam damals zwar nicht unmittelbar zu einer
Koalition, weil Kreisky die absolute Mehrheit
1990–2004
geschafft hatte, aber ein paar Jahre später war
es dann soweit.
Mit welchem Politiker gab es für Sie dann, nach
Hirnschall, in Wien den engsten Kontakt?
Kabas: Da muss man wohl vorausschicken,
dass ich nicht in der Gnade von Jörg Haider
gestanden bin. Ich hatte damals die Linie
vertreten, dass ein Ausscheiden aus dieser ersten
Regierung mit freiheitlicher Beteiligung eigentlich
ein Blödsinn war. Das heißt die Ablöse
von Norbert Steger hätte nach meinem Empfinden
nicht passieren dürfen. Das hatte mir
den „Bannfluch“ Haiders eingebracht, obwohl
wir davor und auch dann danach ein gutes Verhältnis
hatten. Dazu kam, dass ich mich auch
Steger vom Atterseekreis her verpflichtet gefühlt
habe. Haider hat dann dafür gesorgt, dass
ich 1986 aus dem Nationalrat geflogen bin.
Da stellt sich die Frage nach dem Finanzreferenten,
der Sie ja lange Zeit in Wien waren.
Kabas: Das war schon früher, das war bereits
1977/78. Das war keine Erfindung des
Pawkowicz, das ist schon älter, und es hat auch
nichts mit meinen Wechseln zwischen Gemeinderat
und Parlament zu tun.
Wie war ihrer Meinung nach die Beziehung, die Pawkowicz
zu dem scheinbar allmächtig gewordenen Haider
hatte?
Kabas: Also Pawkowicz hat mich fast
immer mitgenommen, wenn es zu einem Gespräch
mit Haider kam. Ich kann nur sagen,
dass diese von einer wechselseitigen Achtung
getragen waren. Auch Haider hatte bei Pawkowicz
ständig das Gefühl, dass er so leicht gegen
ihn nicht ankonnte. Er wusste, dass Pawkowicz
– im Unterschied von anderen in der Partei
Was dann in weiterer Folge zur Aufnahme
in den Wiener Gemeinderat geführt hat.
Kabas: Hirnschall war damals so
fair, dass er mir daraufhin angeboten
hatte, in den Gemeinderat zu kommen.
Ich war damals bereits Bezirksobmann
des 1. Bezirkes. Die Aktivität Hirnschalls
für mich ist also keineswegs mit
„Krampf“ erfolgt. Es hat damals aber
auch schon Rainer Pawkowicz mitgewirkt.
Er war eigentliche der erste aus
dem Kreis der Atterseer gewesen, der
in den Gemeinderat gekommen ist. Das war
bereits 1983. Bei meiner Bestellung 1987, wo
dann schon acht Mandatare einziehen konnten,
hatte Pawkowicz in meinem Fall sicher auch
schon etwas nachgeholfen.
Daraus hat sich dann offenbar auch Ihre Freundschaft
mit Rainer Pawkowicz entwickelt?
Kabas: Die gab es schon früher. Pawkowicz
war ja auch im Atterseekreis gewesen.
Die Abende dort mit ihm sind unvergessen.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie
er beispielsweise von seiner Ferialarbeit als
Leichtmatrose erzählt hat. Er ist damals mit
einem Donaudampfer, mit einem Frachtschiff,
zum Schwarzen Meer gefahren ist.
Oder auch seine Reisen nach Afghanistan
und in andere Gebiete Vorderasiens, alles das
waren Erzählungen, die unvergesslich geblieben
sind. Nicht zuletzt wegen seines umwerfenden
Humors. Das war aber auch schon die
nachfolgende Generation. Es war daher auch
logisch, dass Pawkowicz in Wien schließlich
Klubobmann und auch Landesparteiobmann
geworden ist. Hirnschall, den ich, wie gesagt,
auch sehr geschätzt hatte, wurde dann Landtagspräsident.
„
Auch Haider hatte bei
Pawkowicz ständig das Gefühl,
dass er so leicht gegen
ihn nicht ankonnte.
kein reiner Befehlsempfänger war. Und so hat
er sich ihm gegenüber auch verhalten. Pawkowicz
führte meistens die feine Klinge, und das
hat Haider sich dann auch gefallen lassen.
Rainer Pawkowicz, war dann wohl so etwas wie ein
politisches Vorbild für Sie?
Kabas: Das kann man durchaus sagen.
Was er gesagt und getan hat, hatte für mich
immer so viel Hand und Fuß, dass man kaum
widersprechen konnte. Es war auch stets ausgerichtet
auf das Allgemeinwohl, dass es leicht
war, es mitzutragen. Ich kann aber durchaus
auch sagen, dass Pawkowicz für mich so etwas
wie ein guter Freund war. Ich weiß nicht wie es
ihm diesbezüglich, ergangen ist. Ich habe ihn
eigentlich nie danach gefragt.
Schlimm muss es dann ja für Sie gekommen sein, als
Pawkowicz verstorben ist.
Kabas: Ja, das war schlimm, es war so, als
ob ein Bruder von mir verstorben wäre. Ich
musste das ja eine Zeitlang mitansehen. Er
hatte schon längere Zeit über Kopfschmerzen
geklagt, aber auch die beste Betreuung, durch
Professor Pendl etwa, konnte in seinem Fall
nicht mehr helfen.
79
An der Blauen Donau
Das heißt aber, die Übernahme der Parteiführung in
Wien war dann auch nicht die reine Freude für Sie?
Kabas: Nein das ist irgendwie an mir vorübergezogen.
Auch der Widerstand Jörg Haiders
gegen meine Person hielt sich in Grenzen. Er
hätte immerhin Scheibner und Westenthaler in
der Hinterhand gehabt. In dem persönlichen
Gespräch mit ihm hat er mich eigentlich nur
gefragt, ob ich das auch wirklich machen wollte.
Ich wusste mich natürlich von den Anhängern
Pawkowicz´ unterstützt und habe „Ja“ gesagt.
Seine Antwort darauf war lakonisch: „Na,
dann mache es halt“ hat er nur gesagt.
Damit war dann aber auch der Wiener Parteitag für
Sie gelaufen!
Kabas: Na ja, so genau kann man das nie
sagen. Bei dreihundert Delegierten kann alles
Mögliche passieren. Aber so wie Pawkowicz
war auch die Wiener Basis nicht zum „Ja-Sagen“
geboren. Und damit war das Ergebnis eigentlich
nicht schwer vorherzusagen.
Dann aber musste einmal der große Krach kommen?
Kabas: Es hat wohl mehrerer „Kräche“
während meiner Parteiführung gegeben. Ich
war schon so lange in der FPÖ tätig, dass ich
eigentlich diese Position nicht gebraucht hätte.
Mein Vorsitz in Wien hat immerhin sechs Jahre
gedauert, und ich war dann froh, als ich ihn
abgeben konnte.
Himar Kabas hat in jungen Jahren den RFJ Wien aufgebaut und
war auch eine Zeit lang dessen Vorsitzender. Seine frühe Parteimitgliedschaft
ließ ihn alle Stufen in der Partei durchlaufen.
Wiener Gemeinderat, Landesparteiobmann von Wien, Nationalrat
und auch interimistischer Bundesparteiobmann, waren
genauso Stufen seiner politischen Laufbahn wie auch Präsident
der Freiheitlichen Akademie und Volksanwalt der FPÖ.
Es war damals, Kabas hatte 1960 in der Rainergasse maturiert, die
Zeit von Tassilo Broesigke, Emil van Tongel, der aus dem sudetendeutschen
Leitmeritz abstammete, und Erwin Hirnschall, der bereits 1953
den RFS auf Wiener Boden aufgebaut hatte. Kabas allerdings ging zum
Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ), den er zusammen mit Helmut und
Günter Lebisch aufbaute. Er wurde in weiterer Folge auch RFJ-Obmann
von Wien. Diese Funktion hieß damals allerdings noch Wiener
Landesjugendführer.
Hilmar Kabas bei
einer Parteitagsrede
Jedenfalls konnten Kabas und seine Mannschaft damals als Jugendorganisation
wertvolle Beiträge für die Gesamtpartei der FPÖ einbrin-
80
1990–2004
gen. RFJ und die Wiener Landes Partei der FPÖ blieben aber nicht
die einzigen Betätigungsfelder von Hilmar Kabas. Im Nachhinein
betrachtet, wird man in dieser Hinsicht wohl auch seine Tätigkeit im
österreichischen Parlament ansehen müssen. Es war dies nicht nur eine
Institution, in der Kabas als Justizsprecher der FPÖ agierte, sondern
auch und vor allem als enger Mitarbeiter des damaligen Justizministers
Harald Ofner. Man darf dabei nicht übersehen, wie schwer es Ofner
als Justizminister eigentlich gehabt hat, Nicht nur seine Niederlage im
Posten um den Bundesparteiobmann gegen Norbert Steger hatte ihn
geschwächt, sondern wohl auch seine Nachfolge der SPÖ-Ikone Christian
Broda. Dieser war nicht nur SPÖ-Langzeit-Justizminister gewesen,
er hatte sich sehr wohl mit der Reform des österreichischen Strafrechts
zumindest in sozialistischen Kreisen, vor allem aber beim Sonnenkönig
Bruno Kreisky einen Namen gemacht. Ofner sah sich zu dieser Zeit
auch mit einem Lob Norbert Burgers konfrontiert, der ihm zugestanden
hatte, dass manche seiner Sätze durchaus dem Parteiprogramm der
NDP (Burgers rechtsgerichtete Partei die 1988 verboten und aufgelöst
wurde) entnommen worden sein könnten.
In der Nachfolge Brodas hatte Ofner einen schweren Rucksack zu
tragen. Umso mehr brauchte er daher einen starken und verlässlichen
Rückhalt im österreichischen Parlament. Und dieser Rückhalt war Hilmar
Kabas. Kabas konnte damals schon auf eine reichhaltige Erfahrung
im Justizressort zurückblicken. Er war zuvor bereits vier Jahre lang
der Mitarbeiter von Gustav Zeilinger gewesen.
Und dieser war, wie später auch Kabas, der
Leiter des Justizausschusses im Parlament gewesen.
Eine Funktion übrigens, für die damals
der rote Christian Broda gesorgt hatte. Es ist
vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für
die Charakteristik des Hilmar Kabas, dass sich
dieser nicht gerne auf die FPÖ alleine verlassen
wollte. Als er seinerzeit von der Finanz in
den Klub der FPÖ gewechselt war, tat er das
nicht als Angestellter der FPÖ, sondern als Öffentlich
Bediensteter, als Beamter also. Er hatte
den Wechsel übrigens auf Anraten von Mario
Erschen getan, der zu diesem Zeitpunkt erster
Klubsekretär der Freiheitlichen im Parlament
gewesen war. Dieses kleine bisschen Unabhängigkeit
von der FPÖ war aber für Kabas damals
wohl sehr wichtig. Schließlich konnte man nie
wissen, ob es sich bei der damals noch sehr kleinen Partei nicht einmal
richtig „spießen“ könnte. Den Konflikt zwischen „National“ und „Liberal“
hat Kabas eigentlich nie als wirklich dramatisch erachtet, für ihn
war das eher ein Empfinden, das von außen in die Partei hineingetragen
wurde. Natürlich hat auch er die unterschiedlichen Standpunkte der
einzelnen Funktionäre wahrgenommen. Der Unterschied zur heutigen
Situation, denken wir nur einmal an Strache, Baron oder Kops, war aber,
dass Meinungsverschiedenheiten hinter verschlossenen Türen ausgetragen
wurden und nicht in der Öffentlichkeit, womöglich über böswillige
Medien. Dazu kam, dass die FPÖ zur damaligen Zeit klein war und so
als „Intellektuellenstammtisch“ gelten konnte. Die damaligen wenigen
Mandatare waren hoch angesehene Persönlichkeiten auch in ihren Zivilberufen.
„
Jedenfalls konnten
Kabas und seine Mannschaft
damals als
Jugendorganisation
wertvolle Beiträge für die
Gesamtpartei der FPÖ
einbringen.
81
An der blauen Donau
„
Ein nicht unwesentlicher
Teil in der
Entwicklung von Kabas
zum FPÖ-Funktionär hatte
der Atterseekreis zu
verzeichnen.
Einen nicht unwesentlichen Anteil an in der Entwicklung von Kabas
zum FPÖ-Funktionär hatte der Atterseekreis. Bei einer Enquete im
Bundeskanzleramt wurde Kabas als beamteter Mitarbeiter von Gustav
Zeilinger vom Salzburger Friedhelm Frischenschlager daraufhin angesprochen
und wirkte in weiterer Folge als Mitbegründer des Atterseekreises.
Diese Art liberale Denkfabrik entsprach ganz dem Hilmar
Kabas, der eigentlich immer ein derartiges Ansinnen empfunden hatte,
etwas Neues bewirken zu können. Kabas, damals in den jungen Jahren
eines aufstrebenden Politikers, hatte schon immer das Gefühl gehabt,
etwas Solides für die FPÖ bewirken zu können. Nach dem Erfolg mit
dem RFJ in Wien, konnte nun mit dem Atterseekreis Ähnliches geschehen.
Die Rechnung ist auch im Wesentlichen aufgegangen – mit Steger
an der Spitze kam Kabas in den Nationalrat. Das hatte natürlich auch
zur Folge, dass nach dessen Abwahl „der Ofen aus war“ unter dem neuen
Jörg Haider. Hirnschall aber, der Freund aus den allerersten Tagen,
sorgte dafür, dass Kabas schon wenig später in den Wiener Gemeinderat
einziehen konnte. Dort traf er auf einen
alten Bekannten. Rainer Pawkowicz war schon
aus den Tagen des Atterseekreises ein guter
Freund von Kabas geworden. Nicht nur dessen
Humor, kann man sagen, hat Hilmar positiv
beeinflusst, es war wohl auch das Bewusstsein,
dass sich hier eine neue Generation eröffnete,
die schon sehr bald die Führung in Wien übernehmen
würde.
Und so ist es auch gekommen. Nach dem
großen Erfolg 1991 übernahm Pawkowicz die
Klubobmannschaft und auch den Vorsitz der
Wiener Landesgruppe. Hirnschall konnte zum
krönenden Abschluss seines Politikerlebens für
die letzten fünf Jahre in das Präsidium des Wiener
Landtages wechseln.
Nicht berührt von den Wechseln zwischen Parlament und Gemeinderat
war stets die Funktion des Wiener Finanzreferenten. Dies Aufgabe
hatte er bereits 1977 übernommen und auch über die Jahre hinweg
behalten.
Nach dem tragischen Ableben von Rainer Pawkowicz übernahm
schließlich Hilmar Kabas die Parteiführung in Wien. Dies durchaus mit
der Zustimmung Jörg Haiders, der immerhin auch Herbert Scheibner
oder Peter Westenthaler in der Hinterhand für diesen Posten gehabt hätte.
Er wusste aber auch um die Unterstützung, die Kabas bei den zahlreichen
Anhängern von Rainer Pawkowicz gehabt hatte. Und Haider
war schlau genug, um nicht einen innerparteilichen Konflikt in einem
bedeutenden Bundesland heranzuzüchten.
Eine, wahrscheinlich die wesentlichste, Aufgabe von Hilmar Kabas
sollte in den Apriltagen des Jahres 2005 kommen. Jörg Haider war damals
nicht nur Landeshauptmann von Kärnten, sondern auch der nicht
gewählte, aber zwar heimliche Parteiobmann der Freiheitlichen von Österreich.
Er begründete mit einzelnen höheren Funktionären, mit dabei
waren alle FPÖ-Minister und – bis auf Barbara Rosenkranz und Reinhard
Bösch – allen Nationalratsabgeordneten, das „Bündnis für die Zu-
82
1990–2004
kunft Österreichs“ (BZÖ). In dieser Zeit, in der Haider sicherlich damit
gerechnet hatte, dass die Alt-FPÖler in allen Bundesländern in Scharen
zu ihm überlaufen würden, ist Hilmar Kabas, durchaus mit Unterstützung
des einstigen Rottweilers von Jörg Haider und des EU-Abgeordneten
Andreas Mölzer, helfend eingesprungen. Haider hatte offensichtlich
wohl in Regierung und Parlament gute Vorarbeit geliefert, was die
Abspaltung betraf, weniger jedoch in den Bundesländern. So konnte es
dem Wiener Obmann Hilmar Kabas mit großem persönlichem Einsatz
gelingen, die FPÖ auch auf Bundesebene zusammen zu halten. Natürlich
gab es überall Verunsicherung und da oder dort auch Abspaltungstendenzen,
durch das entschlossene Eintreten von Kabas konnte
allerdings das Schlimmste verhindert werden.
Hilmar Kabas war in
der Parteiorganisation
sehr beliebt
Ohne zu zögern, schloss Hilmar Kabas als interimistischer Bundesparteiobmann
nicht nur Landeshauptmann Jörg Haider, sondern auch
den Kärntner Landesparteiobmann Martin Strutz und den Klubobmann
im Kärntner Landtag Kurt Scheuch, den „Reißwolf von Knittelfeld“,
aus der FPÖ aus. Diese drei Personen hätten laut Kabas die
Einheit der Partei nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Ländern
gefährdet. Und dies ist laut FPÖ-Satzung ein klarer Ausschlussgrund.
Ein Ausschluss könne demnach durchgeführt werden, wenn ein
83
An der blauen Donau
Hilmar Kabas im unermüdlichen
Einsatz
für die Wiener FPÖ
Parteimitglied einer anderen politischen Partei angehört bzw. dessen
Verhalten geeignet ist, das Ansehen und den Zusammenhalt der Partei
zu schädigen. Interessant ist auch der interimistische Leiter der FPÖ
Kärnten, den Kabas mit der Fortführung der Geschäfte betraute. Es
war Alois Huber, der ehemalige Nationalrat und Sohn des Gründers
der FPÖ Kärnten. Er sowie auch die ehemalige Landtagspräsidentin
Kriemhild Trattnig und einige andere sind auch damals nicht mit Haider
mitgegangen und sind nicht zum BZÖ gewechselt.
Kabas´ große Leistung auf Bundesebene hat ihr Abbild aber natürlich
auch im Wiener Landtag gehabt. Zwar war dieser einigermaßen besänftigt,
weil einer der ihren auf dem interimistischen Bundesthron gelandet
war, doch auch hier herrschte schwerwiegende Verunsicherung.
Immerhin hatte mit Jörg Haider an der Bundesspitze auch in Wien ein
Höhenflug begonnen. Ja, nach der Wahl im Jahr 1987 war der Erfolg
sogar so groß gewesen, dass sich wohl spätestens von diesem Zeitpunkt
an Haider auch in Wien als so etwas wie eine Ikone darstellte. Die restlichen
Wahlen in ganz Österreich zeigten nicht umsonst die „Siegermentalität“
des ehemaligen FPÖ-Chefs auf. Nicht zuletzt kamen dazu
noch die Meinungsforscher und Politberater. Diese hatten unmittelbar
nach der Abspaltung Haiders davon gesprochen, dass es auch in Wien
nur eine Partei des Dritten Lagers wird geben können. Und wir können
durchaus davon ausgehen, dass sich damals nicht wenige gedacht haben
werden, dieser Sieger würde wieder einmal Jörg Haider heißen.
Das heißt, die Verlockung war relativ groß, und Haider hatte mit
Sicherheit damit gerechnet, dass sein Erfolg in Kärnten zu einem bundesweiten
Sogeffekt führen würde, sich dem neuen Bündnis anzuschlie-
84
1990–2004
ßen. Es hatte nicht viel gefehlt oder es hätte nur der falsche Mann mit
einem falschen Signal sein müssen, der die ganze Situation in eine andere
Richtung hätte kippen lassen. Allein Hilmar Kabas war genau der
richtige Mann zu richtiger Stunde am richtigen Fleck, um die Situation
vor allem auch in Wien nicht nur zu beruhigen, sondern auch nachhaltig
zu konsolidieren.
Einen weiteren entscheidenden Schritt tätigte
Kabas kurz nach seinem Ausscheiden als
Landesparteiobmann. Damals, in der Übergangsphase
von ihm zu H.-C. Strache in der
Wiener FPÖ im Frühjahr 2004 fanden auch
die EU-Wahl der Europa-Parlamentarier statt.
Zumindest der vorgelagerte Wahlkampf war
in Wien noch ganz entscheidend von Kabas
beeinflusst. Wie bei allen Dingen, so auch bei
der EU-Wahl, setzte auf Bundesebene Jörg
Haider seinen Kopf durch. Er erstellte die
Liste der Kandidaten so, dass noch vor dem
FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer der ehemals
rote Grossmann als zweiter auf die FPÖ-Liste
kam und der ehemalige Grüne Kronberger
als Spitzenkandidat. Da zu erwarten war, dass
von der FPÖ nur ein Kandidat, im allerbesten
Fall vielleicht auch noch ein zweiter schaffen würde, konnte sich Mölzer
ausrechnen, dass er selbst im besten Fall nicht dabei sein würde Er
startete daraufhin einen Vorzugsstimmen-Wahlkampf. Nach unserem
Wahlrecht muss ein Kandidat 7 Prozent der Parteistimmen erreichen,
um mit diesen Vorzugsstimmen vorgereiht zu werden. Mölzer gelang
dies mit 22.000 Vorzugsstimmen! Der Erfolg war deshalb überzeugend,
weil er damit nicht nur die vorgeschriebenen 7 Prozent erreicht hatte,
sondern beinahe das Doppelte, nämlich 14 Prozent. Sehr wesentlich an
diesem Erfolg beteiligt waren damals die Wiener mit ihrer Landesgruppe.
Diese hatte Mölzer unterstützt und diese Unterstützung auch mit
eigenen Wahlplakaten untermauert. Man kann an diese Stelle wohl mit
Fug und Recht behaupten, dass sie es im Verein mit Andreas Mölzer
waren, die damals dem so erfolgsverwöhnten Jörg Haider eine äußerst
empfindliche Niederlage beschert hatten. Dies erfolgte natürlich mit der
Zustimmung ihres gerade zum Altobmann gewordenen Hilmar Kabas.
„
Allein Hilmar
Kabas war genau der
richtige Mann zu richtiger
Stunde am richtigen
Fleck, um die Situation
vor allem auch in Wien zu
beruhigen.
Was nun allerdings folgte, war eine Zeit mit Auf- und Abwärtsbewegungen
des neuen Obmannes in Wien Heinz-Christian Strache.
Schwankungen, für die man nicht einmal ihm selbst die Schuld geben
konnte, sondern dem damals noch übermächtigen Jörg Haider.
◆
85
An der blauen Donau
„Am engsten mit Kabas zusammengearbeitet“
Johann Herzog, Stadtrat a. D., über die
Entwicklung der Wiener Freiheitlichen
Können Sie kurz beschreiben, wie sich Ihr Weg zur
FPÖ gestaltet hat?
Johann Herzog: Ja, wenn man zu dieser Zeit
bei einer schlagenden Korporation war, ich war
beispielsweise Aldane, hatte man schon aufgrund
dieser Mitgliedschaft automatisch einen Zugang
zur FPÖ. Dieses Verhältnis ist zur damaligen
Zeit auch durchaus ein Gespanntes gewesen.
Die Korporationen waren damals teilweise auf
Gegnerschaft, weil es in der FPÖ Personen gab,
die die Linie mitbestimmt hatten. Eine Linie und
Personen, die bei den Korporationen nicht so gut
angekommen sind. Allerdings gab es seitens der
Herzog: Ja das stimmt. Bereits damals war
ich mit Rainer Pawkowicz in der gleichen Klasse,
wir haben gemeinsam maturiert und sind
dann in die gleiche Korporation gekommen.
Und schließlich hat es sich ergeben, dass wir
schließlich auch den gleichen gemeinsamen
Weg in die politische Partei gefunden haben.
Wann seid Ihr gemeinsam bei den Aldanen eingesprungen?
Herzog: Das war 1962. Es waren damals
nicht nur wir beide, sondern aus derselben
Klasse auch Peter Engel und Werner Götzhaber,
der aber dann leider gestorben ist.
Und der Initiator für diesen Beitritt zu den
Aldanen war Rainer Pawkowicz?
Herzog: Ja, wir haben lang und
breit diskutiert, wohin wir gehen würden.
Nachdem wir in verschiedenen Bereichen
geschnuppert haben, sind wir
schließlich bei den Aldanen gelandet.
Den Ausschlag hat wohl gegeben, dass
die Aldanen damals ein kleiner Bund
waren und daher auch die persönlichen
Beziehungen untereinander enger waren
als woanders. Und damit waren auch die
Gestaltungsmöglichkeiten für die Jungen
in diesem Bund erheblich größer.
86
Burschenschaften zumeist die Mitarbeit im RFS,
dem Ring Freiheitlicher Studenten. Über diese
Tätigkeit im Studentenverband war dann auch
der Schritt zur tagespolitisch aktiven Partei nicht
mehr so weit. So war es auch bei mir, dass mein
Weg schließlich in der FPÖ geendet hat.
Ihr Weg in diese Richtung hat allerdings, soviel ich
weiß, schon wesentlich früher begonnen. Bereits im Gymnasium,
in ihrem Fall in der Waltergasse im vierten Bezirk,
ging es in diese Richtung.
Rainer Pawkowicz hat dann ja eine relativ
bedeutende Rolle bei der Wiedereröffnung der
Olympia gespielt, waren Sie damals auch dabei?
Herzog: Nein, ich war nicht dabei.
Pawkowicz war damals wohl in erster
Linie für den RFS tätig. In dieser Hinsicht
haben wir damals eng zusammengearbeitet.
Aber es stimmt, er war
damals sehr wesentlich bei der Wiedereröffnung
der Olympia beteiligt.
Die Aldania hat damals gut funktioniert?
Herzog: Ja, die hat funktioniert. Wir waren
damals gut aufgestellt. Wir hatten vor allem
junge Leute.
Sie haben den RFS erwähnt. Wann und wo sind Sie
dieser Vereinigung beigetreten?
Herzog: Das war an der Hauptuniversität
Wien. Da war ich auch zwei bis drei Jahre
1990–2004
lang. Sowohl im RfS als auch einige Zeit an der
juridischen Fakultät war ich im Vorsitz. Diese
Tätigkeit war für mich wohl auch die Entscheidende,
warum ich dann schließlich bei der
FPÖ weitergemacht habe.
Der Weg führte also vom RFS zur FPÖ, gab es da
irgendeinen Proponenten, von dem auch Sie sagen konnten,
mit dem möchte ich unbedingt zusammenarbeiten?
Herzog: Nein, so kann man das nicht sagen.
Wir waren damals alles junge Leute und haben
gemeint, wir müssten die Partei völlig erneuern.
Broesigke, Dr. Schmidt waren da und auch Erwin
Hirnschall, die Altvorderen also. Wir sind
damals in relativ großer Schar der FPÖ beigetreten
und haben damit relativ viel Unruhe verbreitet.
Das war, zumindest für uns damals
der Start zu einer neuen Generation in
der Politik der Freiheitlichen.
Damals spielte ja bereits Norbert Steger
eine Rolle, der hat bis 1970 studiert…
Herzog: …der kam etwas später.
Er war aber sicher bereits im RFS tätig.
Dort haben wir einander auch kennengelernt.
Wir haben einander immer gut
verstanden, auch wenn Steger zu der
damaligen Zeit sich immer deutlich anders
gab als die meisten andern.
Wien gesessen ist. Dann kam allerdings die Obmannschaft
von Norbert Steger, können Sie sich daran noch
erinnern?
Herzog: Ja natürlich, ich kann mich sehr gut
daran erinnern. Das war eine Obmannschaft,
die zu Beginn einmal aus einer Konfrontation
mit Harald Ofner entstanden ist. Die gab es
auch in Wien. Steger hat auf Bundesebene da
mit einer Mehrheit von deutlich über fünfzig
Prozent gewonnen. Beim nächsten Mal waren
es dann schon über 80 Prozent.
Da kam es gewissermaßen zu einem Paradigmenwechsel…
Herzog: …ja, das war natürlich ein Kurs,
der so nicht in vollem Umfang durchsetzbar
„
Der Atterseekreis war
damals ein geistiges Zentrum,
das die Politik der gesamten
FPÖ beeinflusst und
geformt hat.
1971 gab es dann die Entwicklung hin
zum Atterseekreis, an dem sich auch Rainer Pawkowicz
und Hilmar Kabas aus Wien beteiligt hatten, waren Sie
da auch dabei?
Herzog: Nein, das hat sich nicht so ergeben,
ich bin da außerhalb desselben geblieben.
Das war in erster Linie eine Angelegenheit von
Friedhelm Frischenschlager, Norbert Steger
und Helmut Krünes natürlich. Ich hatte mich
auf Wien konzentriert und dort relativ bald die
Obmannschaft im 6. Bezirk, Mariahilf übernommen.
Das wurde dann auch zur Bastion
in Wien, zusammen mit dem 15. Bezirk von
Pawkowicz und dem 12. von Madejsky. Damit
setzte sich auch schön langsam die neue Richtung
in der FPÖ Wien durch.
Kann man da schon von einer nachhaltigen Konsequenz
für die Wiener Landesgruppe sprechen?
Herzog: Ich glaube, das war einfach einmal
ein „Durchstarten“. Mit jungen neuen Leuten, die
auch mehr Engagement gezeigt haben. Es war
vielleicht nicht unbedingt inhaltlich eine andere
Positionierung, sondern einfach einmal ein anderes
Auftreten, auch eine andere Strahlung nach außen
aufgrund der Jugend der betroffenen Personen.
Broesigke war ja relativ lange Obmann von Wien
– auch noch, als er bereits lange im Nationalrat von
war. In Österreich waren, vielleicht im Unterschied
zu Deutschland, die liberalen Strukturen
traditionell so nicht gegeben. Das musste er damals
wohl einsehen.
Kann man sagen, dass Steger vom Atterseekreis her
Unterstützung bekam?
Herzog: Das war ganz sicher so. Der Atterseekreis
war damals ein geistiges Zentrum, das
die Politik der gesamten FPÖ beeinflusst und
geformt hat. Man kann auch guten Gewissens
sagen, dass der Atterseekreis Steger bei dem
Erringen der Bundesobmannschaft erheblich
geholfen hat.
Bei der Schaffung der ersten Regierung mit freiheitlicher
Beteiligung sind damals die beiden Wiener Gegenpole
Steger und Ofner in die Regierung gekommen.
Herzog: Ja, Ofner war ein ganz bedeutender
Justizminister. Er war vor allem programmatisch
ein ganz wesentlicher Mann. Er
hatte ja seinerzeit bereits an der Strafrechtsreform
von Christian Broda mitgearbeitet.
Es gab dann ja auch den Konflikt zwischen Steger
und Haider, der mittlerweile ja nach Kärnten gegangen
war. Habt Ihr da in Wien von dieser Auseinandersetzung
auch etwas mitbekommen?
87
An der blauen Donau
Herzog: Zweifelsfrei, auch Wien ist davon
nicht unberührt geblieben. Es war ja so, dass
die Position Stegers keineswegs unbestritten
war. Seine politischen Versuche, in Richtung
Liberalismus zu gehen, fanden nicht überall
Anklang. Das wurde nicht goutiert von einer
Vielzahl der Wähler und letzten Endes auch
nicht von der Basis. Letzteres hat man dann
ja auch am Parteitag von Innsbruck gesehen,
wo auch ein Teil der Wiener Fraktion, etwa
ein Drittel war es wohl, nicht hinter ihm gestanden
ist.
Hirnschall hat dann 1987 den ersten großen Erfolg
für die FPÖ in Wien eingefahren.
Herzog: Ja wir hatten über 9 Prozent und
8 Abgeordnete und Rainer Pawkowicz kam als
Stadtrat in die Wiener Stadtregierung.
Der ganz große Erfolg von Erwin Hirnschall und
wohl auch schon von Rainer Pawkowicz kam dann aber
fünf Jahre später.
Herzog: Ja, das war dann der große Durchbruch.
Wir haben damals in Wien über 22,5
Prozent und 23 Abgeordnete erreicht.
88
So sehr sich Steger innenpolitisch nach oben arbeiten
konnte, sowenig ist seine Politik beim Wähler angekommen.
Herzog: Nun, die Freiheitlichen sind zu
dieser Zeit immer schon in einem Bereich von
7 bis 8 Prozent und auch darunter gewesen.
„
Das wird man nach 36
Jahren in der FPÖ wohl sein
dürfen. Jedenfalls hatte Pawkowicz
von allem Anfang an
das Heft in der Hand, auch inhaltlich.
Er war der treibende
Motor der Wiener Partei.
Das war schon seit der Gründung der FPÖ so.
Schon damals konnten nicht alle Wähler vom
VdU mitgenommen werden. Aber es stimmt,
der absolute Tiefpunkt war 1983 unter Steger,
wo im Bund nicht einmal mehr die 5 Prozent
erreicht werden konnten. Auch in Wien hat es
nicht gut ausgesehen. Wir hatten gerade einmal
zwei Abgeordnete. Ein eigener Klub für zwei
Abgeordnete musste erst geschaffen werden.
Nach Steger kam in Wien dann Erwin Hirnschall.
Warum kam der eigentlich nicht früher zum Zug, er war
ja in Wien von allem Anfang an dabei?
Herzog: Auf der einen Seite war Steger
ein geschickter Taktiker und auf der anderen
Seite war er auch der jüngere, was damals sicher
auch eine Rolle gespielt hat. Warum genau
Hirnschall es nicht schon früher wurde, kann
ich jetzt nicht sagen. Hirnschall ist jedenfalls
nach Steger ein verbindendes Element für alle
Gruppen geworden. Er hat dann eigentlich alles
konsolidiert.
Jedenfalls hat Hirnschall dann an Pawkowicz die
Wien-Obmannschaft übergeben. Kann man sagen, dass
er schon ein bisschen amtsmüde geworden war.?
Herzog: Das wird man nach 36 Jahren in
der FPÖ wohl sein dürfen. Jedenfalls hatte
Pawkowicz von allem Anfang an das Heft in
der Hand, auch inhaltlich. Er war der treibende
Motor der Wiener Partei.
Gab es da künftig nicht auch eine Auseinandersetzung
zwischen Pawkowicz und Jörg Haider?
Herzog: Auseinandersetzung ist in
diesem Zusammenhang wohl zu viel gesagt.
Man kann ohne Zweifel davon sprechen,
dass Haider aufgrund seiner Erfolge
in Kärnten, aber auch in ganz Österreich,
eine gewisse Dominanz entwickelt hatte.
Und da war Rainer Pawkowicz natürlich
ein gewisses Gegengewicht in Wien, was
eigentlich ganz gut war, auch für Wien.
Und 1996 kam es dann zu der legendären
Wahl, bei der die Wiener Partei auf über 27,9
Prozent gekommen ist.
Herzog: Das war eigentlich bis zu dieser
Zeit der weitaus größte Erfolg.
Mitauslöser für diesen Wahlerfolg könnte auch die
bereits 1991 eingesetzte und 1996 fortgeführte Werbekampagne
„Wien darf nicht Chicago werden“ gewesen
sein. Wie sind Sie dazu gestanden?
Herzog: Ich war natürlich ganz eindeutig
dafür. Die Kampagne war indessen nicht unumstritten.
Aber es war eine klare Ansage und
eine deutliche Absage an die Zuwanderer aus
dem Osten. Vor allem aber, hat sie damals,
wie eigentlich auch heute, ganz eindeutig dem
Wunsch der Bevölkerung entsprochen.
Es fand 1996 ja am gleichen Tag die EU-Wahl
statt. Da gab es natürlich den direkten Vergleich zwischen
Haider und Wien an dessen Wahlwerbung sich
Haider nicht beteiligt hatte.
Herzog: Das war damals auch gut so. So
konnte Pawkowicz die großstädtische Orientierung
der FPÖ stärker hervorkehren. Er war
1990–2004
ein großartiger Stratege und hat sich bemüht,
das auch in der Wahlbewegung umzusetzen.
Wie war dann Ihr Weg in den Wiener Gemeinderat?
Herzog: Das war 1990, ich bin schon etwas
vor der Wahl 1991 in den Gemeinderat gekommen,
weil ein anderer ausgeschieden ist. Ich
war dann sieben Jahre lang Gemeinderat und
wurde dann Stadtrat. Von 2010 bis 2015 bin ich
dann andtagspräsident gewesen.
Ein weiteres Thema ist ja der ehemalige Landesparteiobmann
von Wien Hilmar Kabas. Was können Sie zu
seiner Person sagen?
Herzog: Ja, wir haben eng zusammengearbeitet.
Er war einer, der mit der Übernahme
der Parteiführung eine unglaubliche Konsolidierung
zusammengebracht hat. Und das nicht
nur in Wien, sondern auch gegenüber der Bundespartei.
Er hat damals die Klippen,
die zweifelsohne vorhanden waren,
großartig umschifft und er ist damit
für die Partei lebensrettend aufgetreten.
Er hat ja auch dann, als Jörg Haider mit
dem BZÖ die Partei gespalten hat, zumindest
kurzfristig die Bundesparteiführung übernommen.
Herzog: Ja natürlich, er hat damit
die wesentliche Aufgabe erfüllt, dass
die Bundespartei erhalten geblieben
ist. Sieht man von Kärnten ab, wo ja
Haider in seinem Kernland gewerkt
hatte, ist ihm das auch im Großen und
Ganzen geglückt. Aber nicht nur auf
Bundesebene ist das in dieser Form gelaufen.
Auch in der FPÖ Wien gab es damals
eine ganze Reihe Abspaltungstendenzen die
Hilmar Kabas unterbunden und damit auch ein
Zerbrechen der Landespartei verhindert hat.
Er war es also, der die Partei ans rettende Ufer
gebracht hatte. Wir dürfen schließlich nicht
vergessen, dass die Beliebtheit beim Wähler
auch zu Schüssels Zeiten nicht so schlecht waren.
Wir hätten ohne Hilmar sicher erheblich
verloren.
Kann man Hilmar Kabas als so etwas wie einen
Strache-Macher bezeichnen?
Herzog: Er hat das Unterfangen mit Sicherheit
weitgehend mitunterstützt. Er hat damals
genau gewusst, was er zu machen hatte.
Diese Unterstützung ist allerdings auf breiter
Basis erfolgt, es ist nicht so, dass wir in Wien,
alleine dagegengestanden wären.
Es gab in dieser Zeit, zum Beginn der Tausender-Jahre,
ja den Vorzugstimmen-Wahlkampf von Andreas
Mölzer. Dieser wurde intensiv gegen die Interessen Haiders
von Wien unterstützt. Wie können Sie sich noch
daran erinnern?
Herzog: Ja, das stimmt, es war dies eine
Entscheidung der Landesgruppe, die ja 2004
im Umbruch von Hilmar Kabas zu H.-C.
Strache stand. Nimmt man die bescheidene
Wahlbeteiligung, die wir in Österreich bei
EU-Wahlen haben, waren die Vorzugstimmen
von Andreas Mölzer gewaltig. Sicher war das
damals auch ein Erfolg der Wiener Landesgruppe.
„
Auch in der FPÖ Wien
gab es damals eine ganze
Reihe Abspaltungstendenzen
die Hilmar Kabas unterbunden
und damit auch ein Zerbrechen
der Landespartei verhindert
hat.
Was lässt sich zum Thema Strache, der ja von Kabas
übernommen hatte, von Ihrer Seite aus noch sagen?
Herzog: Ich habe ihn als Funktionär des
3. Bezirkes kennengelernt. Schon bei seinen
ersten Auftritten vor größeren Menschenansammlungen
hatte er bereits massive Zustimmung
gefunden. Da war eigentlich klar, dass
aus ihm etwas werden musste. Er hat dann
schließlich die Partei aus einer Situation heraus
übernommen, als diese an einem Tiefpunkt
sondergleichen angekommen war. Und
er konnte dann trotzdem bei den bald nach der
BZÖ-Abspaltung 2005 folgenden Gemeinderatswahlen
auf ein durchaus respektables Ergebnis
von über 14,8 Prozent zurückblicken.
Damit konnte der Erfolgskurs wieder aufgenommen
werden. Und das nicht nur in Wien,
sondern dann auch in ganz Österreich. Leider
hat er dann durch die Vorfälle von Ibiza auch
den Abstieg der FPÖ vor allem auch in Wien
bewirkt.
Johann Herzog war langjähriger Bezirksobmann der FPÖ
von Mariahilf, Gemeinderat und Mitglied des Wiener Landtages,
schließlich auch Stadtrat der Wiener Regierung und
schließlich 2.Präsident des Wiener Landtages. Heute ist
Herzog Präsident der Freiheitlichen Akademie Wien und
Obmann des Wiener Seniorenrings.
89
90
An der blauen Donau
1956–1990
1956–1990
KLEIN, ABER FEIN
VON DEN ANFÄNGEN DER
WIENER FREIHEITLICHEN
91
An der blauen Donau
Die FPÖ unter Broesigke,
Steger und Hirnschall
Die führenden Persönlichtkeiten, bzw. Parteiobmänner der Wiener
Landesgruppe der FPÖ waren hochkarätige Politiker, die auch in
der Bundespartei eine wichtige Rolle spielten!
Tassilo Broesigke
Der Erste Weltkrieg war gerade einmal überstanden. Kaiser Karl I.
befand sich im Exil in der Schweiz. Dies kurz vor seiner Abreise nach
der portugiesischen Insel Madeira. Der Ort, der nicht nur Exil, sondern
letzten Endes auch die Schlussstation seines irdischen Lebens werden
sollte. Der letzte österreichische Kaiser starb hier im heutigen Stadtteil
Monte an einer Lungenentzündung und wurde schließlich 2004 von
Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.
In jener Zeit aber kam im, mittlerweile vom
Reststaat Österreich losgelösten, tschechischen
Ort Meierhöfen (in der heutigen Tschechischen
Republik heißt er Dovny) bei Karlsbad (Karlovy)
der Altösterreicher Tassilo Broesigke am
8. Juni 1919 zur Welt.
Tassilo entstammte dem märkischen Uraltadel
derer von Broesigke, deren erste geschichtliche
Erwähnung bereits auf das Jahr 927 zurückgeht.
Der Chronist Andreas Angelus erwähnt in
seinen „Annales Marchiae Brandenburgicae“
von 1598, dass die Herren von Broesigke, zusammen
mit Mitgliedern weiterer Adelsgeschlechter,
bereits im Jahre 927 während eines
Wendenfeldzuges von König Heinrich I. in die
Mark Brandenburg kamen und sich dort dauerhaft
niederließen.
Tassilo Broesigke
Ahnherr Maximilian Friedrich von Broesigke
(1649–1696), auf Breitenfeld, Radegast,
Cammer und Grebs, wurde Domherr zu Brandenburg.
Er heiratete 1678 in Kammer die entfernte Verwandte Martha
Elisabeth von Broesigke (1657–1741) und hinterließ drei Söhne, die Begründer
der drei Linien der Familie Broesigke wurden. Eine offizielle
Erhebung in den Freiherrnstand oder gar in den eines Barons ist nicht
bekannt. Allerdings titulierte Johann Wolfgang von Gothe den weiteren
92
1956–1990
Ahnherrn Tassilos, Friedrich Leberecht von
Broesigke, als „Baron von Broesigke“. Später
wurde der Besitz der Familie entschädigungslos
enteignet, und der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hat den Antrag auf
Aufhebung der Enteignung abgelehnt. Eine
Entscheidung, die niemand, der die Familie
Broesigke näher kannte oder auch nur annähernd
kennt, verstehen kann.
Die späteren österreichischen Familienmitglieder,
wie auch Tassilo Broesigke, führten seit
1919, als das gesetzliche Verbot in Kraft getreten
war, den Familiennamen ohne das Prädikat
beziehungsweise den Namensbestandteil
„von“. Für Tassilo war der Adelstitel niemals ein Thema. Er schien
auch, zumindest offiziell, dem enteigneten Besitz nicht nachzuweinen,
zumindest fand er sich mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte weitgehend ab. Das einzige „Vorrecht“,
das sich Tassilo Broesigke, wohl auch ein bisschen aus seiner subtil zur
Schau getragenen Extravaganz heraus, angeeignet hatte, war das Tragen
des Siegelringes seines Vaters, mit dem Wappen der Adelsfamilie.
„
Am 7. April 1956
wurde in der Wiener
Josefstadt die FPÖ als
Nachfolgepartei des VdU
mit Anton Reinthaller an
der Spitze gegründet.
Nach dem Ersten Weltkrieg studierte Tassilo am Gymnasium in
Hollabrunn von 1929–1937. Die Familie war mittlerweile aus der Tschechischen
Republik in die auf das deutsche Land und darüber hinaus
reduzierte Republik Österreich gezogen.
Broesigke und
Bundespräsident
Kirchschläger
93
An der blauen Donau
„
Aufgrund des Wiener
Wahlrechts, das die
Mehrheitspartei stark
begünstigt, langten die 8
Prozent FPÖ-Wien allerdings
gerade einmal für
vier der insgesamt 100
Abgeordneten.
Danach ging er an die Universitäten in Heidelberg, München und
Wien, um vorerst Philosophie und dann Rechtwissenschaften zu studieren.
Es folgen Kriegsdienst und letzten Endes auch eine kurze Kriegsgefangenschaft.
Das Gerichtsjahr konnte er allerdings
erst 1946–1947 absolvieren. 1947 dann, also
nach dem Gerichtsjahr, wurde er in Wien zum
Dr. Juris promoviert. Bereits vier Jahre später,
1951 gründete er seine eigene Rechtsanwaltskanzlei.
Sein Sohn Bertram ist heute noch
Geschäftsführer derselben, und auch dessen
Nachwuchs wird dafür Sorge tragen, dass das
Unternehmen auch in fernerer Zukunft fortgeführt
wird.
Relativ bald nach der Kanzleieröffnung begann
die politische Laufbahn des bis an sein
Lebensende eher trocken, aber völlig untadelig
und unbestechlich verbliebenen Tassilo Broesigke.
Selbst der rote, zu dieser Zeit noch zweite
Präsident des Nationalrates und spätere Bundespräsident,
Heinz Fischer verwies in seiner
Lobrede anlässlich des Ablebens Broesigkes
auf dessen unbestechliche Geradlinigkeit.
Tassilo Broesigke war bereits 1949 Mitglied des Verbandes der Unabhängigen
(VdU) geworden. Nachdem die Alliierten nicht bereit waren,
zwischen Nationalsozialismus und nationalliberalem Bewusstsein
zu unterscheiden, durfte es
bis dahin auch keine politische
Vertretung geben. So
war diese, später als Drittes
Lager beschriebene Gruppe
selbst bei den ersten Wahlen
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Erst bei der Nationalratswahl
1949 konnte
die unter der Bezeichnung
VdU kandidierende Partei
teilnehmen und das mit
überraschend großem Erfolg.
Mit knapp einer halben
Million Stimmen, die 11,7
Prozent der abgegebenen
entsprachen, zog sie mit 16
Abgeordneten ins Parlament
als „Dritte Kraft“ ein – deutlich
vor den damals für stark
gehaltenen Kommunisten.
Allerdings sollte der solcherart
hervorragend gestarteten
Partei, wie bereits im Vorfeld
geschildert, nicht der langfristige
Erfolg, den sie sich er-
94
1956–1990
wartet hatte, beschieden sein. Bereits 1956, der VdU war bereits weitgehend
zerbröckelt, kam es zu einer Neugründung.
Am 7. April 1956 wurde die FPÖ in der Wiener Josefstadt, dem
8. Wiener Gemeindebezirk, als Nachfolgepartei des VdU mit Anton
Reinthaller an der Spitze gegründet. Tassilo Broesigke hatte bereits
davor die Wiener Landesgruppe mitbegründet, die er an diesem Tage
in die Bundes-FPÖ einbrachte. Somit war er auch Mitbegründer der
FPÖ-Bundespartei. Als Parteiobmann der Wiener Freiheitlichen
musste er allerdings noch bis 1959 warten, bis er auch in die Wiener
Landespolitik als Abgeordneter der FPÖ eingreifen konnte. Bei der
Wahl, die am Vorabend des heutigen Staatsfeiertages, am 25. Oktober,
stattfand, erreichte Broesigke mit seinen Wiener Freiheitlichen
8 Prozent der Stimmen. Im Vergleich dazu, bei der Vorgängerwahl
1954, war der FPÖ-Vorgänger, die Wahlpartei der Unabhängigen
(WDU), nur auf etwas mehr als die Hälfte der Stimmen gekommen
und mit 4,63 Prozent noch knapp an der 5 Prozent Hürde gescheitert.
Aufgrund des Wiener Wahlrechts, das die Mehrheitspartei stark begünstigt,
langten die 8 Prozent der FPÖ-Wien allerdings gerade einmal
für vier, der insgesamt 100 Abgeordneten. Im Vergleich dazu bekamen
die Wiener Sozialisten mit ihren 54,61 Prozent, die sie bei der Wahl an
Stimmen erreichen konnten, die stolze Zahl von 60 Mandaten.
Broesigke blieb bis 1963 Wiener Landtagsabgeordneter. Danach war
im Nationalrat Not am Mann. Wilfried Gredler, der überragende Diplomat
und Präsidentschaftskandidat der FPÖ im viel späteren Wahlkampf
gegen Rudolf Kirchschläger (Kandidat der SPÖ in seinem Antreten zur
zweiten Amtsperiode), wechselte
in den Europarat. Auch
wenn Broesigke im Wiener
Landtag sein Mandat aufgab,
blieb er selbstverständlich
Obmann der Wiener
Landesgruppe. Dies noch
bis ins Jahr 1977, als er sich
längst als Abgeordneter der
FPÖ zum Nationalrat profiliert
und mit seinen Leistungen
die Arbeit der FPÖ auf
Bundesebene erheblich verstärkt
hatte. Seine absolute
Seriosität schließlich 1980 der
Grund dafür, dass er vom damaligen,
als „Sonnenkönig“
gefeierten Bundeskanzler
Kreisky zum Präsidenten des
österreichischen Rechnungshofes,
dem Finanzkontrollorgan
der Bundes- Landesund
Gemeindetätigkeiten
der Regierungen und Ämter,
vorgeschlagen wurde. Der
Nationalrat hatte Broesigke
FPÖ-Gründungsobmann
Anton
Reinthaller
95
An der blauen Donau
damals einstimmig die vorgesehene
Periode von zwölf
Jahren gewählt.
Die erste Nummer
der „Neuen Front“
Das antimarxistische
Element
war in der frühen
FPÖ überaus
stark vertreten
Als Nationalratsabgeordneter
war er Obmann des
Justizausschusses und zweier
Unterausschüsse. Augenscheinlich
waren dabei vor
allem seine Prüfungstätigkeiten
beim Wiener AKH,
dem wohl skandalträchtigsten
Ereignis der Zweiten
Republik bei dem es um die
mutwillige Verschleuderung
von Steuergeldmilliarden
ging. Während Broesigkes
Amtszeit ging es aber auch
noch um eine ganze Reihe
anderer Skandale, die damals das Land erschütterten. So zum Beispiel
jener des Milchwirtschaftsfonds. Landwirtschaftsminister war damals
der Sozialist und ehemalige Angehörige der NSDAP, Günther Haiden.
Die Länderbank-Kontrolle – die erste Prüfung im Zusammenhang mit
dem Klimatechnik-Skandal – fiel ebenso in Broesigkes Amtszeit wie
auch die Prüfungen der ÖBB. Die Länderbank, die es heute nicht mehr
gibt, sie ging bekanntlich in die Wiener Zentralsparkasse und später
in die Creditanstalt (CA) auf, war ebenso eine sozialistische Domäne
mit Hannes Androsch und später Franz Vranitzky an der Spitze, wie es
die Bundesbahn war, und – sieht man von Arnold Schiefer als Finanzvorstand
ab – auch heute noch ist. Die Prüfungsergebnisse über die
Straßenbausondergesellschaften beschäftigten lange die Gerichte, jenes
über die sozialistische Volkshilfe führte zu einer erstinstanzlichen Verurteilung
ihres sozialistischen Ex-Generalsekretärs Erich Weisbier wegen
Betrugs und Untreue. Unter anderem auch Tassilo Broesigkes als oberstes
Kontrollorgan der Republik
beschäftigte in diesen
Fällen nicht nur die Politiker,
sondern auch die österreichischen
Gerichte.
Der Neubau des Allgemeinen
Krankenhauses in
Wien war bereits 1955 beschlossen
worden. Die projektierten
Kosten umfassten
damals eine Milliarde Schilling
und eine Bauzeit von 10
Jahren. Durch Kostenexplosionen
und Schmiergeldaffären
begann die Bautätigkeit
dann allerdings erst 1974.
Die endgültige Fertigstellung
erfolgte dann erst 1994 und
die tatsächlich aufgewendeten
Kosten von 45 Milliarden
96
1956–1990
Schilling machten das AKH zum teuersten Krankenhaus Europas. Zum
Hauptverantwortlichen neben zehn weiteren Beschuldigten, stempelte
man den hochrangigen Beamten der Wiener SPÖ-Stadtregierung Adolf
Winter, der zum technischen Direktor des AKH aufgestiegen war. Ihm
wurde Geschenkannahme, bzw. Schmiergeld im Ausmaß von 30 Millionen
Schilling unterstellt. Das endgültige Urteil lautete schließlich
acht Jahre wegen Geschenkannahme. Damit wurde die ursprünglich
vorgeworfene Untreue etwas abgemildert, was sich auch in einer herabgesetzten
Freiheitsstrafe um ein Jahr ausgewirkt hatte. Bemerkenswert
in diesem Zusammenhang ist allerdings auch die Involvierung von
Hannes Androsch. Drehscheibe für diese Malversationen war nämlich
die AKPE, eine 1974 auf Betreiben Winters errichtete Krankenhauserrichtungsgesellschaft.
Sie gehörte zur Hälfte der Stadt Wien und zur anderen
Hälfte der Republik Österreich und kooperierte mit der Arbeitsgemeinschaft
Odelga-ÖKODATA des AKH Chefs Adolf Winter. Die
Steuerberatungskanzlei des Finanzministers Hannes Androsch (SPÖ),
Consultatio, war eng mit diesem Netzwerk verbunden. Ein Großteil der
Akteure hatte – laut dem Politologen Anton Pelinka – ein Nahverhältnis
zur SPÖ, so dass dieser veritable Skandal von der Opposition wohl ganz
eindeutig als „rotes Netzwerk“ bezeichnet werden
konnte.
Der einstige SPÖ-Vizekanzler und seinerzeit
lauthals verkündete Kronprinz des
Bundeskanzlers Kreisky Hannes Androsch
wurde 1988 wegen Falschaussage vor dem parlamentarischen
AKH-Ausschuss verurteilt und
musste als Direktor der CA. der damals bedeutendsten
Bank Österreichs, zurücktreten.
Auch Tassilo Broesigke war in Wien natürlich
von dem scheinbaren Zwiespalt zwischen
„national“ auf der einen Seite und „liberal“
auf der anderen betroffen. Immerhin gehörte
damals der überaus bekannte und klar profilierte
nationale Apotheker Emil von Tongel
zur Wiener Gruppe. Van Tongel stammte aus
Leitmeritz, dem heutigen Tschechien, und war
1959 zum FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat
geworden.
Broesigkes ganzer Art aber entsprach es, einen Ausgleich, soweit das
immerhin möglich war, zu schaffen. Dazu kam es, dass er eher dem Vermächtnis
des liberalen Kraus nachhing, der immer wieder erklärt hatte,
dass es unter anderem auch die Aufgabe der FPÖ wäre, ein Sammelbecken
zu werden. Und zwar für all jene, die sich einer Elite zugehörig
fühlten und schon aufgrund dieses Status von den beiden Volksparteien
nicht oder zumindest nicht ausreichend bedient werden könnten. Natürlich
wusste auch Broesigke, dass mit Eliten allein keine Wahlen gewonnen
werden konnten. Er wusste aber auch, dass gerade noch in den
siebziger und achtziger Jahren in breiten Schichten der Bevölkerung ein
gebührendes Obrigkeitsdenken vorhanden war.
Es war noch lange nicht soweit, die „breite Masse“ mit ihren bildungsfernen
Schichten anzusprechen, das war etwas, was schließlich
„
Auch Tassilo
Broesigke war in Wien
natürlich von dem
scheinbaren Zwiespalt
zwischen „national“
auf der einen Seite und
„liberal“ auf der anderen
betroffen.
97
An der blauen Donau
„
Mit Broesigkes
Wechsel in den Nationalrat
wurde schön langsam
eine Änderung an der
Wiener Spitze notwendig.
dem legendären Wahl-Kärntner Jörg Haider vorbehalten bleiben sollte.
Es wäre aber bei weitem zu viel, zu einfach gedacht und es liegt auch
in der Form, wie es heutzutage geschildert wird, völlig daneben, davon
auszugehen, es wären nur latent nationale, um nicht zu sagen nationalsozialistische
Kräfte, die Haider anzusprechen in der Lage gewesen
wäre. Diese vornehmlich von sogenannten „Experten“ geäußerte Behauptung
geht auch in Kärnten, das immer wieder als vereinfachendes
Beispiel genannt wurde, völlig daneben. In diesem Teich von Fischen
hatten bereits vor Haider die Landeshauptleute
Wedenig, mit Abstrichen Sima, aber auch und
vor allem Leopold Wagner zu fischen begonnen.
Wagner hatte bekanntlich den legendären
Satz geprägt, er wäre zwar leider nicht bei der
Napola gewesen, dagegen aber ein „hochrangiger
Hitlerjunge“ gewesen. Und der Kanaltaler
Hans Sima, das wird heute sehr gerne vergessen,
war derjenige Landeshauptmann, unter
dessen Ägide es gelungen war endlich die in
den dreißiger Jahren von Agnes Millonig geschriebene
vierte Strophe der Landeshymne im
Kärntner Landtag „offiziell“ beschließen zu lassen.
Es war jene Strophe der Landeshymne, die
vom Blut sprach, mit dem man nun die Grenze
schrieb, und dem Mannesmut und der Frauen
Treu, die die Einheit des Landes aufs Neue definieren würden.
Tatsächlich war die junge Parteigründung im Süden der Republik
weiterhin stark vom alten Landbund geprägt, während sie im Osten des
Bundesgebiets, also auch in Broesigkes Wien viele Berührungspunkte
zum alten, katholischen, konservativen und monarchistischen Bereich
aufzuweisen hatte. Vordringliches Ziel, auch in Wien, war es für Broesigke
wohl, die damals noch vorherrschende sozialistische absolute
Mehrheit von deutlich über 50 Prozent zu brechen. Dieses Ergebnis
konnte allerdings erst 1991 erreicht werden. Es war dies das letzte volle
Jahr Broesigkes als Rechnungshofpräsident.
Mit Broesigkes Wechsel in den Nationalrat wurde einmal eine Änderung
an der Wiener Spitze notwendig. Die Lücke, die Wilfried Gredler
seinerzeit im Nationalrat riss, um für Broesigke Platz zu schaffen, tat
sich, Jahr für Jahr immer mehr, auch in Wien auf. Es soll hier keineswegs
gesagt werden, dass Broesigke sich nicht ausreichend um sein Amt
in Wien gekümmert hätte, rotzdem bedurfte es hier aber eines neuen
Obmannes, der sich voll und ganz auf die gewiss anspruchsvolle Aufgabe
konzentrieren konnte, eine schlagkräftige Landesgruppe auszufüllen
und zu führen.
Norbert Steger
Natürlich hätte sich jeder Außenstehende eine Nominierung des
Wiener Parteiobmannes aus dem kleinen, aber feinen Kreis der Wiener
Abgeordneten erwartet. In erster Linie hätte sich da wohl der langjährige
Abgeordnete Erwin Hirnschall, der „Zuagraste“ aus dem Waldviertel,
angeboten oder der langjährige Abgeordnete Holger Bauer oder
98
1956–1990
aber auch der junge, umtriebige Rainer Pawkowitz, der in Wien bereits
vor der Türe stand. Die Partei jedoch hatte anderes vor. Sie hob Norbert
Steger auf den Schild, der Rechtsanwalt war, aber keinerlei Erfahrung in
den Wiener Gepflogenheiten hatte, die sich auf Landtag und Gemeinderat
beziehen würden. Gewiss gab es da andere, die sich nur auf die
Wiener Landespolitik beschränken wollten. Überlegungen der Partei,
aber auch solche von Norbert Steger selbst richteten sich auf die Bundespolik.
Dieser wusste wohl bereits damals schon, dass sein endgültiges
politisches Ziel nicht der Landtagsklub des Wiener Gemeinderates
und Landtags sein würde.
Steger allerdings war darüber hinaus eines, was man an dieser Stelle
durchaus anführen sollte: Er war ein echtes Wiener Kind mit eindeutigem
Hang zu Höherem. Am 6. März 1944, also noch mitten im
Zweiten Weltkrieg geboren, schlug er bereits als Kleinkind die Laufbahn
eines privilegierten Wiener Erdenbürgers ein. Mit dem entsprechenden
Organ ausgestattet, gelangte Norbert Steger nach der vierjährigen
Volksschule als einer der wenigen Bevorzugten aufs Gymnasium
der Wiener Sängerknaben. Die Institution im Wiener Augarten ist heute
Fortsetzung auf Seite 102 ▶
Norbert Steger:
Langzeitobmann
der Wiener FPÖ,
löste Alexander
Götz als Bundesparteiobmann
ab
99
An der blauen Donau
„Die FPÖ brauchte damals eine Verjüngung“
Vizekanzler a.D. Dr. Norbert Steger, von 1977 bis 1987
auch Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, im Gespräch
über die Entwicklung der Partei in seiner Ära als Obmann.
100
Herr Dr. Steger, Sie wurden 1977 zum Obmann
der Wiener Freiheitlichen gewählt. Wie war denn damals,
in den 70er-Jahren, die Stimmung in der Wiener FPÖ?
Norbert Steger: Die Entwicklung der
FPÖ ist nur verständlich, wenn man die Geschichte
ab 1945 kennt: „Belastete“ – konkrete
Straftaten in der NS-Zeit – aber auch „Minderbelastete“-NSdAP
Mitglieder hatten nur eingeschränkte
Bürgerrechte: kein Wahlrecht, keine
Pension, kein öffentliches Amt. Die FPÖ wollte
Minderbelasteten volle Bürgerrechte verschaffen!
Ein fester liberaler Grundsatz lautet nach Taten
und nicht nach Gesinnung behandelt zu werden.
Deswegen gingen viele „Ehemalige“ zunächst
zum VdU, und dann zur
FPÖ. Die Forderung nach
Rückgabe der Bürgerrechte
wurde bald nicht
mehr als liberales Grundprinzip
gesehen. Stattdessen
begannen die alten
Streitigkeiten – „Deutschnational
gegen „Liberal“,
also „freiheitlich“. Die
Partei versteinerte, Junge
fanden nicht zur FPÖ,
weil deutschnationale
Themen zwar in den Korporationen
diskutiert wurden,
aber politisch keine
konkreten Lösungen für
das tägliche Leben der
Menschen anboten. In
der öffentlichen Wahrnehmung
war die FPÖ
kaum mehr existent.
Wie sind Sie denn persönlich
in die Wiener FPÖ
gekommen, beziehungsweise wie hat sich Ihre Obmannschaft
damals ergeben?
Steger: Während meines Studiums in den
sechziger Jahren hätte ich nie gedacht, Politiker
zu werden. Ich war Student und Musiker. Die so
genannten „68er“, als „links“ gegen „rechts“ diskutierte
, wollten mich, beziehungsweise Studienfreunde
aus allen Gruppen der ÖH zur Mitarbeit
gewinnen, mir war mein Studium aber wichtiger
– mein Vater war blind, meine Mutter arbeitsunfähig.
Nach acht Semestern hatte ich Jus absolviert,
ohne – trotz Vorsitz im RFS – bei einer
Partei Mitglied zu sein. Nach dem Studium trafen
wir jungen Akademiker uns vier bis fünf Mal
im Jahr. Wir machten politische Ausarbeitungen
für alle (!) Parteien. Der „Atterseekreis“ schickte
diese an alle (!) Parteien – so naiv waren wir!
Friedrich Peter reagierte und bot das Heim am
Attersee als Tagungsort an, deswegen der Name.
Er selbst kam zu uns, weil er Junge zur FP holen
wollte. Ich war Organisator des Atterseekreises,
traf daher ihn – vor Tagungen auch Bruno Kreisky
und Josef Taus – und lud sie alle ein. Dann
kam der Kreisky zu einem Kamingespräch, wo
er meinte: „Ihr seid die neue Generation in der
FPÖ. Macht aus der FPÖ eine moderne Partei.
Ihr könntet ohne NS-Mief sogar Partner der
SPÖ sein!“ Kreisky hat als Fixstern der Politik
nicht nur Verkrustungen aufgebrochen, sondern
uns Junge auch aufgefordert in die Politik zu gehen
und – in der FPÖ – mitzuwirken.
Wenn Sie die Wiener Freiheitlichen und ihre wesentlichen
Proponenten der damaligen Zeit beschreiben
können, wer waren denn neben Ihnen die maßgeblichen
Persönlichkeiten in der Wiener FPÖ und wie war waren
die Kräfteverhältnisse innerhalb der Partei?
Steger: Mit anderen trat ich 1970 der FPÖ
bei, mit dem Vorsatz, diese zu reformieren.
Funktion wollte ich bis 1975 zunächst keine, weil
ich erst meine Rechtsanwaltsprüfung machen
musste. Wir Jungen hatten aber ab 1971 in der
Wiener FPÖ schon die Mehrheit, unsere Sprecher
waren Mag. Hilmar Kabas und Dr. Rainer
Pawkowicz, beide nach mir Wiener Obmänner.
Vor wichtigen Entscheidungen hielten wir immer
Besprechungen ab. Obmann Tassilo Broesigke
(später RH-Präsident) unterstützten wir für die
NR Wahl 1975, wollten aber „unseren“ Dr. Pawkowicz
als zweiten Mandatar Wiens. Zum letzten
Mal überlistete uns die alte Garde, denn über alle
Restmandate entscheidet der Bundesvorstand.
Deswegen wollten wir auch formell nach vorne
treten: Beim Wiener Parteitag 1975 wurden Dr.
Pawkowicz und ich in geheimer Wahl – mit jeweils
derselben Stimmenanzahl, so gut waren wir
organisiert – Obmann-Stellvertreter. Der bisherige
Stellvertreter Dr. Erwin Hirnschall kam
nur knapp über fünfzig Prozent. Der Parteitag
wünschte inhaltliche und personelle Reformen.
Ich leitete die Organisation, Rainer Pawkowicz
1956–1990
die inhaltlichen Schwerpunkte. Weil die Bundespartei
ihn verhindert hatte, wollte er mich zum
Obmann wählen lassen. Ich wollte bis 1977 warten,
dies nützte die alte Garde mit allen Mitteln,
um mich zu verhindern. Sie fürchtete auch im
Bund den Machtverlust, so entstand eine Spaltung
der Wiener Partei.
Ihre erste Wahl als Wiener Obmann im Jahr 1979
brachte der FPÖ leichte Verluste, vor allem, weil man mit
den Sozialisten einen übermächtigen Gegner hatte, aber
auch die ÖVP deutlich dazu gewinnen konnte. Warum
war das so?
Steger: Nach meiner Erinnerung haben
wir 1979 die NR-Wahl gewonnen, von 5,4 auf
6,0 Prozent. Ein Umbruch in den Generationen
– noch dazu, wenn die alten Amtsträger nicht
ziehen, weil sie um ihre eigenen Ämter fürchten
müssen – geht nie ohne Reibungsverluste ab.
Ohne die Erneuerung durch Dr. Alexander
Götz als neuer Bundesparteiobmann
und unsere junge Gruppe wäre die
Partei damals nicht erfolgreich gewesen,
denn sie war zu verknöchert, um neue
Anhänger zu finden. Die Mandate im
Nationalrat blieben gleich. Alle Präsidiumsmitglieder
waren zwanzig Jahre im
Amt, wir wollten Götz. Der Bürgermeister
in Wien war davor ein SP-Erbhof.
Im Wahlkampf 1979 versetzte uns Götz
aber in Schockstarre: „Der Kreisky hat
Pappe im Hirn“, meinte er, und: „Der
schönste Platz in Wien ist der Südbahnhof,
da kann ich nach Graz fahren…“
Das war nicht gut bei den Wiener Wählern
zu verkaufen. Ich wurde von vielen
gebeten, das Verhältnis zum Bundeskanzler
zu normalisieren, damit die FP in beide
Richtungen aktionsfähig bliebe. Dies gelang
leider erst nach dem Götz-Abgang.
Generell pendelte die FPÖ ja nicht nur in Wien, sondern
auch im Bund seit ihrer Gründung zwischen fünf
und sechs Prozent, die schon vorhin erwähnte Übermacht
von Rot und Schwarz war zu groß, um stärker zu reüssieren.
Wie konnte man dennoch mit einer vermeintlich so
kleinen Partei gute Arbeit in Wien, aber auch im Bund
leisten?
Steger: Das Symbol der FPÖ war wegen des
Kampfes gegen den Proporz der Keil – mit dem
„F“. Wegen dieses Kampfes waren die meisten
zur FPÖ gekommen, weil sie die Diskriminierung
nicht mehr akzeptieren wollten. Bei Vorstellungsgesprächen
hatte man ein Bekenntnis
zu Schwarz oder Rot abzugeben! Damit war klar,
dass Proporz-Karrieristen für die FP nie erreichbar
waren. Auch ich wurde bei meinen ersten
Vorstellungsgesprächen nach „meiner“ Parteizugehörigkeit
– sowohl im ORF als auch in einer
Bank - gefragt. Widerlich! Um diesen Kampf erfolgreich
zu führen, musste die FP Macht gewinnen
– allerdings, ohne wie die anderen zu agieren.
Deswegen die Angriffe auf die FPÖ, wenn ein
Blauer etwas wird.
„
Ein Umbruch in den
Generationen – noch dazu
wenn die alten Amtsträger
nicht ziehen, weil sie um ihre
eigenen Ämter fürchten müssen
– geht nie ohne Reibungsverluste
ab.
Wenn Sie auf Ihre mehr als zehn Jahre als Obmann
der Wiener Freiheitlichen zurückblicken, wo waren denn
Ihre persönlichen Höhepunkte, aber auch Tiefpunkte?
Oder anders formuliert: Was waren denn die wesentlichen
Wegmarken in dieser Ära der Wiener
FPÖ?
Steger: Es ist gelungen, zu anderen Parteien
gute Kontakte aufzubauen, um die ständige berufliche
Benachteiligung Freiheitlicher etwa bei
öffentlichen Vergaben abzubauen. Die Wiener
Partei hat die Führung der Bundespartei übernommen
und setzte Themen:
Es gab die erste freiheitliche Regierungsbeteiligung
und damit die Beendigung der „2. Klasse-Menschen“.
Es kam zur Energiewende durch
die Verhinderung der Atomenergie – noch 1986
versuchte die ÖVP mit den Sozialpartnern, das
Atomsperrgesetz im Parlament aufheben zu lassen,
schaffte aber wegen meines persönlichen
Widerstands nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit
.
Wir erreichten die Gründung der Volksanwaltschaft
mit Vertretern aller drei stärksten
Fraktionen im Parlament, Dazu die formelle
Beendigung des 2. Weltkrieges und die Heimholung
des letzten Kriegsgefangenen, dann
etwa die Aufnahme in den Förderkatalog von
FPÖ-nahen Vereinen, wie dem ÖTB, und von
Publikationen.
Oder wir erreichten den Ausbau der Marktwirtschaft
mit der neuen Gewerbeordnung, der
Beseitigung von Preisregelungen, des weiteren
ein neues Weingesetz als Basis zum Aufstieg
des österreichischen Weines an die Weltspitze.
Auch die Gründung von gut finanzierten poli-
101
An der blauen Donau
tischen Akademien im Bund und in den Ländern
fällt mir noch ein. Überhaupt spielten wir
eine Vorreiterrolle zu einem einheitlichen Europa
– wenngleich auch noch stark verbesserungsfähig.
Ihre bundespolitische Auseinandersetzung mit Jörg
Haider im Jahr 1986 und der Ausgang ist allgemein
bekannt. Wie war das denn in Wien, wollten Sie nicht
Landesparteiobmann bleiben?
Steger: Nein, ich wollte weder im Land
noch im Bezirk Obmann bleiben, denn Niederlagen
sind zur Kenntnis zu nehmen. Das ist keine
Frage der Gerechtigkeit, sondern der Wirkung.
Ich wollte auf dem Parteitag nicht mehr, aber
Dr. Helmut Krünes war dem Druck auf ihn
nicht gewachsen. Nochmals kandidiert habe ich
nur, weil ich meinte, damit die Regierung eventuell
noch retten zu können. Aber dies wollte Dr.
Vranitzky am Ende nicht. Alle meine Mitstreiter,
die die Partei verraten haben, konnten sich`s finanziell
richten.
Kommen wir in die Gegenwart, oder eigentlich in die
nahe Zukunft: Der Wiener FPÖ steht eine Schicksalwahl
bevor. Was würden Sie sich wünschen,
wie die Freiheitlichen in der Bundeshauptstadt in
einem Jahr aufgestellt sind?
Steger: Die FPÖ muss wieder eine Partei
der Anständigen und zu den Wählern treu sein.
Wahlen können dann wieder besser ausgehen,
wenn alle dieses Bild vermitteln!
◆
eine der wichtigen Hauptattraktionen, die Österreich weltweit zu einem
der bedeutendsten Fremdenverkehrsländer gemacht haben.
Die FPÖ-Regierungsmitglieder
der
rot–blauen Koalition:
Ferrarie-Brunnenfeld,
Baur, Ofner,
Steger, Frischenschlager
und Murer
Dabei handelt es sich um eine Attraktion von wahrhaft historischem
Ausmaß. Auf die älteren Wiltoner Sängerknaben zurückgehend, hat
Kaiser Maximilian I. am 30. Juni 1498, als er den Hof von Innsbruck
nach Wien verlegte, die „Hofcapelle-Singknaben“ begründet. Sie sind
die Vorläufer der Wiener Sängerknaben, die seinerzeit von Maximilian
zur Gestaltung der Messe in Wien gegründet wurden. Erst 1925 wurde
für den Knabenchor ein eigener Verein gegründet, der bis heute Schritt
für Schritt den Musikbetrieb professionell ausbaute.
Allein wegen der Sängerknaben kommen rund 80.000 Besucher alljährlich
nach Wien. Sie besuchen einen der mehr als 280 Termine, die
der Knabenchor, oder besser gesagt die vier Konzertchöre pro Jahr in
102
1956–1990
Wien absolvieren. Die Wiener Sängerknaben umfassen nämlich heute
rund 100 junge Burschen zwischen 9 und 14 Jahren.
Vieles von dem, was die Sängerknaben anzubieten haben, geschieht
aber nicht in Österreich. Rund zehn Wochen des Schuljahres ist der
Chor auf Tournee. Und das auf der ganzen Welt, in den Staaten der
EU, in Asien, Australien, den USA und auch in Süd- und Mittelamerika
sowie in Südafrika. Auf diese Weise kommen bei weiteren Konzerten
der vier Chöre noch einmal eine halbe Million Zuhörer dazu. Auftritte
bei Fernsehshows, Sponsoren und die Produktion von zahlreichen Tonträgern
sorgen für ein weiteres einträgliches Einkommen.
Die erfolgreichste Werbung im Ausland, ist das Neujahrskonzert der
Wiener Philharmoniker. Und da gibt es eine interessante Parallele zu
den Sängerknaben. Dieser berühmte Wiener Klangkörper erkürt Jahr
für Jahr seiner Dirigenten für das jeweils nächste Konzert. Und schauen
wir uns dabei die Liste der Tonkünstler an, so stammt ein großer Teil
aus dem Kreis des Knabenchors: Herbert von Karajan, Ricardo Muti,
Zubin Mehta, Nicolaus Harnoncourt, Seiji Ozawa oder Mariss Janson
etwa verbrachten einen Teil ihrer Jugend bei
den Wiener Sängerknaben. Aber auch noch
andere Größen aus der Musikszene wie Franz
Schubert, Bruno Walter oder Wilhelm Furtwängler
begannen hier ihre erste professionelle
Ausbildung. Nach dem Gymnasium der Sängerknaben
in die Bundeslehrerbildungsanstalt.
Und dort traf er erneut auf Prominenz.
Der spätere, man kann heute durchaus sagen,
legendäre Helmut Zilk war dort sein Lehrer.
Steger maturierte 1964, um dann in weiterer
Folge Rechtswissenschaft zu studieren. Und
damit begann auch schon seine politische
Laufbahn. Er trat 1965 nicht nur der Universitätssängerschaft
„Barden zu Wien“ bei, sondern
auch der politisch aktiven, freiheitlichen
Studentenvertretung, dem Ring Freiheitlicher
Studenten (RFS). Der RFS war damals, zu Stegers Zeit, eine politische
Macht mit Wahlergebnissen von 30 Prozent und mehr. Das Jahr 1965
ist aber auch noch aus einem anderen Grund äußerst bemerkenswert.
Es war das Jahr, in dem es in Wien zu Demonstrationen der Studenten
kam. Demonstrationen für und gegen den ursprünglich christlichsozialen
Universitätsprofessor Taras Borodajkewycz vom Kartellverband
(CV). Borodajkewicz wurden damals antisemitische Äußerungen in seiner
Vorlesung an der Hochschule für Welthandel (heute WU) vorgeworfen.
Die Demonstrationen wurden einerseits von Gewerkschaftern
und Widerstandskämpfern organisiert und die Gegendemonstration
vom RFS und Vertretern der Wiener Korporierten, zu denen Burschenschaften,
Corps, Landsmannschaften und auch Sängerschaften zählten.
Beim Zusammentreffen der beiden Demonstrationen kam es zu Zusammenstößen,
in deren Verlauf es zu einem Faustschlag gegen den
herzkranken Kommunisten Ernst Kirchweger kam. Zwei Tage danach
verstarb Kirchweger in einem Wiener Krankenhaus. Borodajkewycz
lehrte weiter an der WU. Der schwarze Unterrichts- und Wissenschaftsminister
Piffl-Percevic widersetzte sich erfolgreich den heftigen Ablöse-
„
Es lag auf der
Hand, dass in der Bundeshauptstadt
zu dieser
Zeit das wohl größte
Wachstumspotenzial für
die FPÖ zu suchen war.
103
An der blauen Donau
„
Auch in den Jahren
davor war es nicht unbedingt
besser gelaufen.
Vier Mandate für die Wiener
Freiheitlichen waren
wohl das höchste der
Gefühle.
forderungen. Erst 1971, in der Zeit der Alleinregierung der SPÖ unter
Bruno Kreisky, erhielt Borodajkewycz Lehrverbot und wurde zwangspensioniert.
Norbert Steger aber, der 1965 stellvertretender Vorsitzender
des damals bedeutenden RFS geworden war, stand erst am Anfang
seiner politischen Laufbahn. Neben seinem
Studium, das er 1970 erfolgreich abschließen
konnte, wirkte er beim RFS als Mandatar. Dieser
war damals, wie gesagt, auf mehr als 30 Prozent
der Stimmen bei den Hochschülerschaftswahlen
gekommen und stellte damit hinter den
Schwarzen die zweitstärkste Fraktion an den
Universitäten.
Stegers berufliche Entwicklung war immer
eine zweipolige. Auf der einen Seite die berufliche
und auf der anderen die politische. Beruflich
eröffnete Steger nach dem Studium, dem
Gerichtsjahr und seiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter
1975 seine eigene Rechtsanwaltspraxis
und betreute entsprechende Rechtsfälle.
In politischer Hinsicht war für ihn klar, dass sein
Ziel in der FPÖ ganz oben angesiedelt sein würde.
Und hier führte für ihn ganz eindeutig der
Weg über die Wiener Parteiführung der FPÖ. Es
lag auf der Hand, dass in der Bundeshauptstadt zu dieser Zeit das wohl
größte Wachstumspotenzial für die FPÖ zu suchen war. Lediglich drei
Abgeordnete zählte die FPÖ damals in Wien. Drei von insgesamt 100.
Auch wenn das Wiener Wahlsystem die kleineren Parteien benachteiligte,
war der Stimmenanteil relativ gering. Knapp 7,7 Prozent brachten die
Freiheitlichen damals zusammen. Das waren, wie bereits gesagt, gerade
einmal drei Mandate, also deutlich weniger als die relative Stärke ergeben
hätte müssen. Bei 100 Mandaten insgesamt hätten das 7 Mandate bedeutet.
Auch in den Jahren davor war es nicht unbedingt besser gelaufen. Vier
Mandate für die Wiener FPÖ waren wohl das höchste der Gefühle.
Steger hatte allerdings auch bereits Anfang der siebziger Jahre,
genauer gesagt 1971, eine Idee, wie er das Kind „schaukeln“ konnte.
Ihm waren zwei grundlegende Dinge in der FPÖ bewusst. Zum einen
gab es seit der Gründung der Partei den ständigen Zwiespalt zwischen
deutschnationaler und liberaler Ausrichtung der Partei. Beide ideologisch
scheinbar auseinanderliegenden Positionen mussten in der FPÖ
unter einen Hut gebracht werden. Keine der beiden Richtungen, so die
freiheitlichen Vordenker und auch die historischen Gegebenheiten, fanden
bei den beiden sogenannten Volksparteien ÖVP und SPÖ eigentlich
eine dauerhafte Heimat. Es musste also stets ein Weg gefunden
werden, der sowohl die eine wie auch die andere Denkrichtung unter
einen Hut zu bringen vermochte. Und auf der anderen Seite war für
Steger auch klar, dass man in der Partei nichts werden konnte, wenn
man nicht über eine gewisse Hausmacht verfügte. Diese war natürlich
umso wirkungsvoller, je breiter gestreut sie war, also je besser er auf die
einzelnen Bundesländer zugreifen konnte. Hinsichtlich der angesprochenen
Hausmacht und der vorherrschenden politischen Orientierung,
zwischen national und liberal zu wählen, galt es natürlich auch noch, die
Zeichen der Zeit richtig zu interpretieren und ihre künftige Entwicklung
richtig einzuschätzen.
104
1956–1990
Und da brauchte man eigentlich nur auf die politische Entwicklung
im Bund zu schauen. Am Beginn der siebziger Jahre hatte Bruno
Kreisky in Österreich die Zügel in die Hand genommen und seine „Alleinherrschaft“
im österreichischen Nationalrat mit Unterstützung der
Freiheitlichen unter dem oberösterreichischen FPÖ-Obmann Friedrich
Peter in die Hand bekommen. Peter, der vor allem in letzter Zeit immer
wieder von einer Koalition mit den Sozialisten unter Kreisky träumte,
brauchte als ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS dringend einen stärkeren
liberalen Anstrich, um seinen geplanten politischen Weg weiter zu
verfolgen. Die Idee Stegers war damit aber nun eindeutig vorgegeben.
Eine Ausrichtung hin zu den Liberalen schien eindeutig erfolgversprechender,
sowohl was das rote Wien anbelangte als auch was die übergeordnete
Bundespartei verlangen würde. Bezog man die überragende
Persönlichkeit Kreiskys und den Aufwind, den die SPÖ genommen hatte,
mit in die Überlegungen ein, war ohnehin klar, in welche Richtung
das Schicksal seinen Lauf nehmen würde.
„Handshake“ von
Kreisky und Steger
Die Folge war die Gründung des „Atterseekreises“. Dabei handelte
es sich offiziell um eine sogenannte „Denkfabrik der liberalen Freiheitlichen“
Hier scharten sich Norbert Steger, Hilmar Kabas dabei neben
105
An der blauen Donau
Volker Kier, Helmut Krünes oder Norbert Guggerbauer um Friedhelm
Frischenschlager. Auch Heide Schmid, die spätere freiheitliche Vorzeigefrau,
Präsidentschaftskandidatin und schließliche Begründerin des Liberalen
Forums, gehörte dazu. Betrachtet man deren geographischen
Bundespräsident
Kirchschläger
attestierte der FPÖ,
zu einer staatstragendenPartei
geworden zu sein
„
Im Wiener Landtag
verlieben lediglich Rainer
Pawkoicz und der unerschütterliche
Erwin Hirnschall.
Hintergrund, so deckten diese Personen weitgehend unterschiedliche
Bundesländer mit einem Schwerpunkt auf Wien ab. Steger gehörte dem
„inneren Kreis“ an und führte diesen Verein durchaus mit Unterstützung
Friedrich Peters, im Interesse ihrer Mitglieder, im weitgehend liberalen
Sinn. Mit der Machtübernahme in der FPÖ durch Jörg Haider
beim Bundesparteitag in Innsbruck 1986 war auch das vorläufige Ende
des Atterseekreises gekommen. Jörg Haider hatte sich immer geweigert,
mit dem „liberalen Klub“ in Verbindung gebracht zu werden. Erst viele
Jahre später, genauer gesagt 2012, wurde der Atterseekreis unter dem
oberösterreichischen Landesparteivorsitzenden Manfred Haimbuchner
wiederbelebt. Heute wird er vom freiheitlichen
Klubdirektor im Nationalrat Norbert Nemeth
geführt. Er ist wirtschaftsliberal ausgerichtet
und nicht nur eine oberösterreichische Wiederentdeckung,
sondern wohl auch ein oberösterreichisches
„Reservebataillon“.
Norbert Steger aber machte Karriere. Die
Überlegung mit dem Attersee Kreis ist aufgegangen.
Zuerst wurde er bereits 1972, zwei Jahre
nach Studienabschluss und bereits ein Jahr
nach der Gründung des Attersee Kreises also,
Bezirksobmann der FPÖ in Hernals und drei
Jahre später hinter Broesigke stellvertretender
Parteiobmann der Wiener Landesgruppe. Damit
hatte er schon die Weichen für seine weitere
Laufbahn gelegt und war „de facto“ bereits an Erwin Hirnschall dem
langjährigen Wien-Abgeordneten der Freiheitlichen, vorbeigezogen. Es
war daher auch nur mehr eine Frage der Zeit, dass ihn der Landesparteitag
1975 zum stellvertretenden Obmann in Wien bestellte.
Zwei Jahre später, 1977 war es dann soweit. Der Gründer und langjährige
Wienobmann Tassilo Broesigke, der zu dieser Zeit auch schon
eine ganze Weile im Nationalrat unabkömmlich geworden war, konnte
106
1956–1990
sich nun endlich in Wien von der Spitze zurückziehen. Er machte damit
den Weg frei für Norbert Steger. Obwohl Landesparteiobmann war
Norbert Steger selbst niemals Mitglied des Wiener Gemeinderates. Seine
Ziele lagen eindeutig eine, ja eigentlich zwei Stufen höher. Wien war
dazu, mit Rückendeckung, des damals immer stärker werdenden Atterseekreises,
nur ein Mittel zum Zweck. So zeigte auch die Wahl zum Wiener
Landtag bzw. Gemeinderat 1978, wie gering dieser im Stellenwert
für Steger war. Die FPÖ verlor zwar 1,2 Prozent der Stimmen, Norbert
Steger als deren Landesparteiobmann wurde aber trotzdem nicht deren
Mitglied. Diese drei waren Erwin Hirnschall, Rainer Pawkoicz und
Holger Bauer. Als letzterer im Juni 1980 in den Nationalrat wechselte,
wurde er von Friedrich Kuchar in der FPÖ
Wien abgelöst. Alle Abgeordneten kamen über
Reststimmen in den Wiener Landtag, das heißt
über die Landesliste. Norbert Steger ihr Obmann
war nicht dabei. Gleiches geschah bei
Stegers zweiter Wien-Wahl 1983. Da wurde das
Ergebnis noch einmal schlechter. Dieses Mal
gingen von den mageren 6,5 Prozent nochmals
1,1 Prozent verloren, und, was noch viel stärker
schmerzte, das dritte Mandat war ebenfalls
weg. Im Wiener Landtag verblieben lediglich
Rainer Pawkowicz und der unerschütterliche
Erwin Hirnschall. Steger war zu diesem Zeitpunkt
nicht nur der Wien-Obmann, sondern
seit 1980 auch bereits als Nachfolger von Alexander
Götz, dem Bundesparteiobmann der
FPÖ im Gespräch. Er war 1970 in den Nationalrat
eingezogen und konnte nun in aller Ruhe
seine Machtinteressen verfolgen. Der Atterseekreis,
der ihn letzten Endes an die Spitze der Partei gehievt hatte, war
beim Wähler weniger beliebt.
Was parteiintern funktionierte, gelang bei den Wahlen nicht. Erst
nach einer Wahlrechtsreform Kreiskys 1984, die den Einzug in den
Nationalrat mit einem Stimmenanteil die unter 5 Prozent ermöglichte,
gelang Steger mit 4,98 Prozent 1983 der Wiedereinzug in Österreichs
oberstes Gesetzgebungsorgan. Eine sehr weise Voraussicht des Bundeskanzlers,
denn dadurch wurde ihm ermöglicht, auch nach dem Verlust
der absoluten Mehrheit 1983 das Heft in der Hand zu behalten. Der damals
gesundheitlich bereits schwer angeschlagene Bruno Kreisky überließ
das Regieren zwar seinem Wunschkandidaten Fred Sinowatz, stellte
ihm aber mit Norbert Steger als Vizekanzler die mit dem schlechtesten
Ergebnis aller Zeiten schwer angeschlagene FPÖ zur Seite.
Diese erste Koalition mit einer blauen Regierungsbeteiligung sollte
solange gut gehen, bis der seit 1976 als Landesparteisekretär von Kärnten
und seit 1983 als Landesparteiobmann fungierende Jörg Haider wieder
ins bundesparteipolitische Geschehen eingriff. Sinowatz hatte sich nach
der Wahlniederlage seines Kandidaten Kurt Steyrer bei der Bundespräsidentenwahl
im Juli 1986 zurückgezogen und seinem Finanzminister
Franz Vranitzky das Feld überlassen. Dieser kündigte die rot–blaue Koalition
auf, als Haider beim Bundesparteitag der FPÖ am 13. September
1986 in Innsbruck zum neuen Obmann der Bundes-FPÖ gewählt worden
war. Vranitzky schrieb Neuwahlen aus.
„
Diese erste
Koa lition mit einer blauen
Regierungsbeteiligung
sollte solange gut gehen,
bis Jörg Haider wieder ins
bundesparteipolitische
Geschehen eingriff.
107
An der blauen Donau
Damit war aber auch das politische Schicksal von Norbert Steger
besiegelt. Er zog sich aus der aktiven Politik zurück, für immer, wie er
damals verkündete, um unter H.-C. Strache allerdings wieder zurückzukommen.
Mittlerweile ist Norbert Steger seit 2018 Vorsitzender des
ORF-Stiftungsrates. Die FPÖ Wien hatte für Steger damals ohnehin
schon lange keine Rolle mehr gespielt. Man mag zu Steger stehen, wie
man will, zugestehen wird man ihm müssen, dass er im Gegensatz zu Erfolgen
beim Wähler parteiintern ausgezeichnet
taktiert hat. Sein strategisches Geschick
hat ihn sowohl unter Friedrich Peter als auch
unter Alexander Götz vorangebracht. Ein
anderer Musterstratege, nämlich Sebastian
Kurz, versteht es aber, einen Schatten auf die
Rolle Stegers zu werfen. In seinen Memoiren,
geschrieben von Paul Ronzheimer, ist zu lesen:
„Haider hatte unter anderem über seinen
Vorgänger als FPÖ-Parteichef Norbert Steger
gesagt: Die persönliche Ehre eines freiheitlichen
Politikers ist in Gefahr, wenn man ihn
unter vorgehaltener Hand als Freimaurer ins
Gerede bringt.“
Erwin Hirnschall
Die Obmannschaft in der FPÖ-Wen hatte
mittlerweile der Niederösterreicher Erwin
Hirnschall übernommen. 1983, in dem Jahr,
als Steger in die Funktion des Vizekanzlers
in der Regierung Sinowatz tätig wurde, ward
Hirnschall – man muss wohl sagen: endlich
– Obmann der Wiener Freiheitlichen. Zu diesem
Zeitpunkt war Erwin Hirnschall wohl
schon überreif. Mit seinen 53 Jahren war er
zwar noch in einem Alter, in dem auch in
Zeiten der Buberlpartie politisch alles möglich
sein musste, allerdings war er auch damals
schon knapp 15 Jahre älter als sein damaliger
Vorgänger Steger und knapp 25 Jahre
älter als der kommende Bundesparteiobmann
Jörg Haider.
Der junge Erwin
Hirnschall
Wie schon gesagt, stammte Hirnschall
aus Niederösterreich. Er wurde am 22. Juli
1932 in Allentsteig geboren und verbrachte
die Jugend und Kindheit in Niederösterreich.
1948, knapp nach dem Zweiten Weltkrieg,
maturierte er am Gymnasium in Zwettl. Unmittelbar danach kam er
nach Wien, um zu bleiben. Hier studierte er Rechtswissenschaften und
promovierte 1955 zum Dr. jur. 1955 war auch das Jahr, in dem sich
für die FPÖ alles entscheiden sollte. Die FPÖ unter Reinthaller wurde
als Nachfolgepartei des VdU in der Josefstadt gegründet. Auch die
Hochschulfraktion der Freiheitlichen, der RFS, war damals entstanden.
Beides geschah unter Mitwirkung des Allentsteigers Erwin Hirnschall.
108
1956–1990
Die Hochschulvertretung wurde allerdings bereits früher, 1952, mit
Norbert Burger gegründet. Sie erreichte auf Anhieb die zweite Position,
noch vor den Sozialisten, an den Universitäten und Hochschulen
Österreichs. Und das bescherte Erwin Hirnschall auch seine erste politische
Position im bereits damals so genannten Dritten Lager. Er wurde
bereits 1953 stellvertretender Vorsitzender des Zentralausschusses der
Österreichischen Hochschülerschaft. Diese Funktion behielt er bis zum
Abschluss seines Studiums 1955 inne. Nach dem üblichen Gerichtsjahr
entschloss sich der damals 26-Jährige, nicht die Laufbahn eines freien
Rechtsanwaltes einzuschlagen, wie das wohl die allermeisten aus dem
Dritten Lager taten und auch tun, sondern begab sich in den Bundesfinanzdienst.
Für einen Freiheitlichen dürfte das
damals nicht unbedingt gerade ein allzu schweres
Unterfangen gewesen sein. Finanzminister
war immerhin zu diesem Zeitpunkt der parteifreie
Reinhard Kamitz. Der ÖVP-Kanzler
Julius Raab hatte Kamitz in seine Regierung
bestellt. Er hatte damit ein ehemaliges Mitglied
der NSDAP bestellt, der zwar aufgrund seiner
Tätigkeit für die Nationalsozialisten seine Dozentur
verloren hatte, in der Österreichischen
Bundeswirtschaftskammer aber, als Fachmann
unbestritten, zum engerern Kreis von Julius
Raab gehört hatte.
Der mittlerweile berühmt gewordene Raab-Kamitz-
Kurs hatte Österreich bekanntlich
wirtschaftlich saniert. Vor allem die überbordende
Inflation – 1951 waren es noch 28 Prozent
– und die damals als extrem hoch angesehene
Staatsverschuldung betrug 60 Prozent
– konnte erfolgreich reduziert werden. Bereits
im dritten Jahr des Wirkens von Reinhard
Kamitz als Finanzminister kamen sowohl Inflation (auf 5 Prozent) als
auch Staatsverschuldung (auf 8 Prozent) auf ein erträgliches Ausmaß.
Nach heutigen Maßstäben wäre vor allem so eine Staatsverschuldung
ein sensationelles Ergebnis.
„
Hirnschall galt,
und das war vielleicht in
den ersten Jahren nach
dem Krieg und unter dem
Wiener FPÖ-Obmann Tassilo
Broesigke nicht unbedingt
eine Empfehlung
als liberal.
In dieses Finanzministerium wurde nun, Erwin Hirnschall der junge
Jurist aus dem Waldviertel, aufgenommen. Seine letzte Funktion in
diesem Amt war die eines Ministerialrates. Aber auch politisch gesehen
entwickelte sich die Laufbahn Hirnschalls. Nicht so schnell und
kometenhaft wie jene von Norbert Steger, aber stetig und dauerhaft, wie
sich in den kommenden Jahren herausstellen sollte. Hirnschall galt, und
das war vielleicht in den ersten Jahren nach dem Krieg und unter dem
Wiener FPÖ-Obmann Tassilo Broesigke nicht unbedingt eine Empfehlung,
als liberal. Der Weg dafür war in Wien zu diesem Zeitpunkt noch
nicht aufbereitet. Trotzdem wurde der als etwas uncharismatisch geltende
Niederösterreicher 1959 zum Bezirksrat in der Bezirksvertretung
in Liesing, dem 23. Wiener Gemeindebezirk, gewählt. Schon bei den
folgenden Wahlen 1964 kam er auf einem Reststimmenmandat neben
Albert Schmidt und Peter Karl in den Wiener Landtag bzw. Gemeinderat.
Der Wiener Vorsitzende Broesigke war zu diesem Zeitpunkt bereits
als Nachfolger des nach Straßburg zum 1949 gegründeten Europarat
enteilten Wilfrid Gredler in den Nationalrat nachgerückt. Die Position
Fortsetzung auf Seite 112 ▶
109
An der blauen Donau
„Der feste Wille, es zu probieren“
Dr. Erwin Hirnschall (†) über die Gründungszeit
der FPÖ im Jahr 1956 und die Stärken
und Schwächen des Dritten Lagers
110
Herr Dr. Hirnschall, welche Stimmung war damals
bei der Gründung der FPÖ im Jahr 1955/56?
Erwin Hirnschall: In mancher Weise ist es
auch vergleichbar mit Situationen, die wir in
den letzten Jahren erlebt haben. Ich darf daran
erinnern, dass der Gründung der FPÖ der
Zusammenbruch des VdU vorangegangen ist
– eine Spaltung, die es damals natürlich auch
im Dritten Lager gegeben hat. Verschiedene
Versuche, eine Gründung auf die Beine zu
stellen, und dann den Versuch, den auch ich
für eigentlich erfolgsversprechend angesehen
habe, das auf der Basis der freiheitlichen Partei
zu tun. Mit den Proponenten, die damals
eine Rolle gespielt haben im öffentlichen Leben.
Beginnend auf der einen Seite mit Friedrich
Peter, mit Wilfried Gredler, mit Anton
Reinthaller, Emil van Tongel, die Erfahrung
mitgebracht haben, zum Teil auch aus der 1.
Republik, aber die auch nach 1945 sich auf verschiedenen
Ebenen bemüht haben, eine dritte
Kraft zu bilden.
Der Gründung der FPÖ ist der Zusammenbruch des
VdU vorangegangen – wie war die Stimmung, gab es eine
Aufbruchstimmung oder eine Depression und was wollte
man eigentlich?
Hirnschall: Ich würde das damals im Jahr
1955 noch nicht als Aufbruchsstimmung bezeichnen.
Wir waren natürlich alle noch gezeichnet von
den furchtbaren Auseinandersetzungen, die dem
vorangegangen sind, und es war eine Hoffnung,
die wir gehabt haben. Eine realistische Hoffnung
und den festen Willen, es zu probieren. Auch in
Hinblick auf die im darauffolgenden Jahr zu erwartende
Nationalratswahl, die es erforderlich
gemacht hat, dass sich das Dritte Lager konsolidiert
und organisiert.
Wie war das politische Klima in den 1950er Jahren?
Hirnschall: Das politische Klima in den
1950er-Jahren war gegenüber jeder neuen Kraft,
die sich konstituieren wollte, von Haus aus feindselig
gesinnt – was also die regierenden Parteien
anlangt. Es hat allerdings in der letzten Phase
dann – vor der Nationalratswahl 1949 – seitens
der SPÖ gewisse Versuche gegeben, eine dritte
Kraft eher zu begünstigen, als sie zu verbieten,
aber auch nur aus der Überlegung, der ÖVP schaden
zu können.
Ein Phänomen, das das Dritte Lager begleitet,
sind die innerparteilichen Auseinandersetzungen – beginnend
in den 1950er-Jahren mit dem VdU bis hin
zum heutigen Zeitpunkt (Das Interview wurde 2008
geführt, Anm. d. Red.). Ist diese Streitkultur ein besonderes
Markenzeichen des Dritten Lagers? Welche
Gründe gibt es dafür? Warum werden Streitigkeiten
im Dritten Lager so massiv ausgetragen wie in keinem
der anderen Lager?
Hirnschall: Es ist richtig, dass das Dritte Lager
besonders anfällig ist für diese Auseinandersetzungen
– ideologische Auseinandersetzungen
waren es damals ja vielfach. Aber es war natürlich
auch so, dass jede Partei in ihrer Gründungsphase
Jahre braucht, um hier den Organisationsgrad
zu erreichen, der notwendig ist, um politisch
wirksam zu sein. Wir haben ja auch in den ersten
Jahren bei den Grünen unentwegt Auseinandersetzungen
gehabt, bis sich dort die Verhältnisse
geklärt haben, auch personell geklärt haben. Das
war also auch bei den Grünen eine längere Phase,
die erst dann mit der Wahl des letzten Vorsitzenden
eine gewisse Beruhigung dort erfahren hat.
Aber beim VdU und bei der FPÖ war es in den
ersten Jahren ein ständiges Bild, das sich wieder
gezeigt hat.
1956–1990
Im Jahr 1983 kam es unter der Obmannschaft von
Norbert Steger zum Tiefpunkt für die FPÖ in Wien
– es gab nur mehr zwei Abgeordnete. Worauf war das
zurückzuführen?
Hirnschall: Das war darauf zurückzuführen,
dass wir natürlich massiv mitgelitten haben in Wien
– mit der Entwicklung der FPÖ auf Bundesebene.
Die Umfragen waren zum Schluss dann schon unter
5 % und wir haben uns wirkliche Sorgen machen
müssen, dass wir die 5 % Hürde im Jahre 1983
nochmal überspringen. Es war am selben Tag Wahltag,
also konnte man – Wahltag Nationalrat und
Gemeinderat – davon ausgehen, dass der Wähler
zwei Stimmzettel abgibt oder genauer gesagt drei,
auch die Bezirksvertretung. Wir haben schon überlegt,
ob es nicht gescheiter wäre, im Wahlkampf, in
der Werbung, die Wähler darauf hinzuweisen, dass
man unterschiedlich wählen kann. Dass man nicht
unbedingt für den Gemeinderat dasselbe wählen
muss wie für den Nationalrat. Dann haben
wir aber aus Solidarität gesagt, dass
kann man doch nicht machen – es ist ja
der nächste Konflikt bereits dadurch vorprogrammiert.
Sie galten während ihrer politischen Tätigkeit
eher als ein Vertreter des liberalen Flügels
der FPÖ – war das ein leichter Weg für Sie?
Hirnschall: Es hat innerparteilich
manchmal Probleme gegeben. Ich
habe mich immer als Nationalliberaler
gefühlt. Ich hab‘ doch auch immer im
Auge gehabt, was seit je her von der
national freiheitlichen Bewegung oder
der jeweiligen Partei in der 1. und in der
2. Republik als notwendig und richtig
angesehen wurde. Aber ich hab‘ immer
mich bemüht, in der Auseinandersetzung mit den
anderen Parteien oder mit dem Auftreten in der
Öffentlichkeit eine vernünftige, liberale Linie zu
gehen. Und hier einen Weg zu gehen – um den
Weg zu erklären – in der Art und Weise, wie er
akzeptabel war – für viele, die auch außerhalb unseres
Lagers gestanden sind.
War und ist es nicht noch immer ein Problem der
FPÖ, dass die beiden Flügel zueinander finden? Birgt das
noch immer innerparteilichen Sprengstoff?
Hirnschall: Es war in den 1950er, 1960er
Jahren schwer möglich manchmal. Es müsste
eigentlich heute (Das Interview wurde 2008 geführt,
Anm. d. Red.) kein so ein Problem mehr
sein. Weil jetzt, ideologisch gesehen, diese Lager
in ihrer Stärke – in Relation zur Wählerschaft –
eher nicht mehr so vorhanden sind, wie sie es damals
waren. Wir haben eher heute das Problem,
dass ein Großteil der Wähler ideologisch weder
in der einen noch in der anderen Richtung geprägt
ist. Sondern halt nach momentaner Befindlichkeit
– sicher auch entsprechend der Personen,
die angeboten wurden oder werden von den Parteien
– seine Entscheidungen trifft, aber die Rolle
der Flügel ist heutzutage nicht mehr so gegeben,
wie es damals war.
Wie stand die FPÖ damals zur EU bzw. zu der
Gründung der EU?
Hirnschall: Wir haben damals – in der heutigen
Zeit mag das wirklich eine Frage sein, die
auf der Hand liegt – wir haben damals als erste
und lange Zeit als einzige Partei das vereinte Europa
im Programm gehabt. Das war ein Beitrag,
den unser damaliger Außenpolitiker Dr. Wilfried
Gredler – der auch österreichischer Vertreter
beim Europarat war – eingebracht hat ins Programm.
Und dieser Programmpunkt – ein vereintes
Europa anzustreben und in weiterer Folge
den Anschluss an die europäische Gemeinschaft
„
Ich würde das damals
im Jahr 1955 noch nicht als
Aufbruchsstimmung bezeichnen.
Aber es gab eine realistische
Hoffnung, und wir hatten
den festen Willen, es zu
probieren.
zu suchen –, der war eigentlich unstrittig. Die
ganzen Jahre unstrittig! Selbst von Jörg Haider
war das in der damaligen Zeit eine Forderung, die
er immer wieder auch im Parlament gestellt hat,
bis in die 1990er-Jahre hinein. Wir haben also dieses
vereinte Europa angestrebt, weil wir nach den
Erfahrungen – Kriegs- und Nachkriegszeit und
auch damals angesichts der Zweiteilung Europas
in Ost und West – keine andere Alternative gesehen
haben für die Zukunft. Natürlich haben wir
uns in weiterer Folge sicherlich vorgestellt, dass
Österreich in einem solchen politischen Gebilde
– EG hat es damals noch geheißen – eine stärkere
Handschrift hinterlassen würde und stärker die eigene
Position und die eigenen Interessen betonen
würde. Das war eigentlich schon gemeint – wir
haben also nicht geglaubt, dass von Brüssel aus
bis in die kleinsten Details hier Vorschriften erlassen
werden, die die Länder zu erfüllen haben.
Wenn Sie in der Geschichte der Partei weitergehen
– hat es ja große Erfolge gegeben, aber auch den bitteren
111
An der blauen Donau
Abstieg. Mit dem Aufstieg und Abstieg verbunden ist der
Name Jörg Haider – was halten Sie persönlich von Jörg
Haider?
Hirnschall: Ich halte Jörg Haider für ein enormes
politisches Talent, der wie kein anderer in
der Lage war, Menschen zu begeistern, Wahlerfolge
herbeizuführen – gleichzeitig aber ist er eine Persönlichkeit,
die dann in der Lage ist, innerhalb kurzer
Zeit wieder das, was er mit Erfolg und Talent
aufgebaut hat, wieder zunichte zu machen. Und es
ist leider so, dass er als Politiker sehr sprunghaft ist
und Dinge, die festgelegt wurden gemeinsam, acht
Tage später oder vielleicht zwei Tage später nicht
mehr gelten.
War es für die Partei in Summe gesehen ein Fluch
oder ein Segen, mit Jörg Haider zu gehen?
Hirnschall: Es war zunächst ein Segen und
es war dann natürlich in der letzten Phase ein
Verhängnis.
Wo sehen Sie die Wurzeln?
Hirnschall: Ich sehe die Wurzeln schon in
seinem Charakter, in seiner Person. Ich hab also
dann eigentlich schon während meiner aktiven
Zeit für mich die Schlussfolgerung gezogen, dass
ich möglichst auf die Autonomie in Wien bedacht
bin, möglichst wenig Kontakte habe und daher
auch möglichst wenig tangiert werden kann von
irgendwelchen raschen Gedankensprüngen.
Was war Ihr größter Misserfolg?
Hirnschall: Mein größter Misserfolg war,
dass ich das Verhängnis Knittelfeld kommen
gesehen habe, mich bemüht habe, es zu verhindern
und es nicht geschafft habe. Ich hab
mir wirklich den Mund wund geredet und gewarnt
davor. Mir war klar, wie das ausschauen
wird das Ergebnis, dass das in der Lage, ist die
Partei zu sprengen. Stundenlang hab ich mit engen
Freunden darüber gesprochen – die meiner
Meinung nach damals wirklich verblendet waren.
Ich hab‘s nicht geschafft. Ich konnte nicht
überzeugen. Ich war dann in Knittelfeld nicht
mit dabei und hab also dann natürlich die Ergebnisse
so wie alle anderen mitzutragen gehabt.
Und das war dann eigentlich zu sehen, wie
irgendwo ein Lebenswerk zerstört wird und das
war bitter. Zumal ich ja sagen muss – das muss
man hier einfügen – dass ich entgegen der Lesart,
die es von Medien gibt und manchmal auch
in der eigenen Partei gibt – glaube, dass die Regierungsbildung
und diese ersten Jahre der Regierung
erfolgreiche Jahre auch für Österreich
waren – auch für die Partei gewesen sind. Die
Zustimmung zur FPÖ in diesen Jahren und zu
Susanne Riess-Passer und Karl Heinz Grasser
war sehr hoch! Wir haben also bis zu Knittelfeld
noch immer in jede Wahl hineingehen können
und auch als Regierungspartei noch 20 % bekommen.
Was hätte konkret geschehen müssen, um Knittelfeld
zu verhindern?
Hirnschall: Knittelfeld hätte verhindert
werden können – durch Jörg Haider, jederzeit!
Es wird darum gerätselt, warum er es nicht getan
hat – aber er wäre in der Lage gewesen immerhin
mit seiner rhetorischen Fähigkeit, aber
auch der Autorität, die er gehabt hat, dieses
Schauspiel da unten jederzeit zu beenden und
die Leute zur Vernunft zu bringen. Er hat es
nicht getan. Es gibt verschiedene Auslegungen,
warum nicht. Eine Auslegung ist die, dass er sich
damals physisch und psychisch in einer schwierigen
Situation befunden hat und die Dinge treiben
hat lassen.
Das Interview mit Dr. Erwin Hirnschall
(* 22. Juli 1930; † 26. August 2011)
wurde im Jahr 2008 von Prof. Walter
Seledec im Auftrag des FPÖ-Bildungsinstitutes
geführt und aufgezeichnet.
im Wiener Landtag sollte Hirnschall übrigens 32 Jahre bis zum Jahr
1996 behalten. Damit ist er bis heute einer der am längsten dienenden
Abgeordneten in Wien. Das war er eigentlich auch bereits schon 1977
so. Umso bemerkenswerter, und als Zeichen für die Stärke des Atterseekreises
ist zu werten, dass dem Langzeitabgeordneten Erwin Hirnschall
damals Norbert Steger als Wiener Obmann vorgezogen wurde.
Hirnschall blieb jedenfalls nicht auf der Position eines einfachen
Abgeordneten stehen. Bereits zu Kreiskys Zeiten wurde er analog zum
Rechnungshofpräsidenten im Bund zum Vorsitzenden des Wiener Kon-
112
1956–1990
trollausschusses gewählt. Dieses Amt hatte er
von 1978 bis zu seinem Ausscheiden 1996,
als er als damals 64-Jähriger nicht mehr kandidierte.
Zu diesem zweifelsfrei vertrauensvollen
Amt war 1991 ein weiteres gekommen
– er wurde zum dritten Landtagspräsidenten
gewählt.
Mitverantwortlich für diesen Aufstieg war
zu diesem Zeitpunkt gewiss auch noch ein
anderer. Niemand geringerer als Jörg Haider.
Die erste Wahl in Wien unter der Ägide von
Haider als Bundesobmann der FPÖ erfolgte
am 8. November 1987. Wie im übrigen Österreich
war im Vorfeld zu dieser Wahl auch in
Wien mit einem Zuwachs gerechnet worden.
Wie groß dieser werden würde, war damals
im Vorfeld nur vermutbar. Wir dürfen nicht
vergessen, die Wiener FPÖ verfügte damals
über ganze 5,38 Prozent der Stimmen. Sie
war also zu dieser Zeit gerade noch einmal
ganz knapp mit zwei Abgeordneten, Hirnschall
und Pawkowicz in den Wiener Landtag
gerutscht. Dementsprechend bescheiden waren
auch die Erwartungen für Wien.
Ein knappes Jahr vorher hatte Jörg Haider
auf Bundesebene noch sensationelle 9,3
Prozent errungen. Aber das war eben Jörg
Haider, der neue Mann, der alles ganz anders
machen würde als sein Vorgänger Norbert
Steger. Hirnschall hatte deshalb, vorsichtig
optimistisch, für die Hauptkundgebung der
Wiener FPÖ das Hotel Wimberger am Wiener Gürtel gemietet. Als
Gastredner war Jörg Haider für diese Veranstaltung angemeldet. Die
FPÖ-Wien, war, wenn es solche Veranstaltungen mit Bundesbeteiligung
überhaupt gab, mit einer Beteiligung von 50 bis 100 Personen an einer
solchen Veranstaltung schon sehr zufrieden. Das Hotel Wimberger
sollte deutlich mehr Raum bieten. In dem damaligen großen Veranstaltungsraum
konnten immerhin 500–600 Personen Platz finden. Für
Erwin Hirnschall war das zweifelsohne eine Herausforderung für die
Wiener FPÖ und seine Mannschaft.
Und dann war es so weit. Jeder, der dieses Ereignis noch aus persönlicher
Warte in Erinnerung hatte, wird von dem Geist, der diese Veranstaltung
begleitete, begeistert sein. Es begann damit, dass man schon
deutlich früher anreiste, weil man fühlte, dass es womöglich zu einer
Knappheit kommen könnte. Trotzdem sollte man seine blaue Überraschung
vor Ort erleben. Bereits im Umfeld des Hotels waren die Straßen
von der Polizei abgesperrt und die Leute drängten sich in dem viel
zu eng gewordenen Raum. Dies war schon gut eine dreiviertel Stunde
vor Veranstaltungsbeginn. Mit ein bisschen Geschick schwindelte man
sich ins Innere des Hotels, um dort noch irgendwo einen der nunmehr
sehr begehrt gewordenen Stehplätze zu ergattern. Und dann … hieß
es erst einmal warten. Der Zeitpunkt, zu dem Haider erscheinen sollte,
113
An der blauen Donau
„
Was nun kommen
sollte, waren äußerst
erfolgreiche Jahre für
die FPÖ und das auch in
Wien.
war längst verstrichen. Hirnschall trat auf die Bühne, um aufgeregt zu
verkünden, Haider wäre längst da, er müsse aber vorher noch zu den
im Umfeld des Hotels Versammelten sprechen. Dann erst, eine gute
Stunde später erschien er unter tosendem Applaus im Wimberger selbst.
Kurz und gut, das Ergebnis der Wien-Wahl unter dem Obmann Erwin
Hirnschall war ebenfalls sensationell. Er
erreichte wie schon Haider 1976 9,2 Prozent
der Stimmen und die Anzahl der Abgeordneten
erhöhte sich auf acht.
Was nun kommen sollte, waren äußerst erfolgreiche
Jahre für die FPÖ und das auch in
Wien. 1991, in diesem Jahr sollte Hirnschall die
Obmannschaft der Wiener FPÖ an Rainer Pawkowicz
übergeben, legte er noch einmal gewaltig
zu. Man kann wohl ruhig sagen als sein
politisches Lebenswerk gelang es ihm, einen triumphalen
Erfolg einzufahren. Die Wahlen ergaben
einen sensationellen Zuwachs auf 22,54
Prozent oder 23 Abgeordnete. Es war dies eine
Steigerung um mehr als 231 Prozent. Hirnschall
übergab die Obmannschaft für die kommenden Wahlen 1996 und angesichts
seines fortgeschrittenen Alters an Rainer Pawkowicz. Es dürfte
aber auch seine neue Funktion eine gewichtige Rolle gespielt haben. Er
wurde Dritter Präsident des Wiener Landtages und verblieb noch eine
letzte Periode im Wiener Gemeinderat und Landtag.
Der Höhenflug der Wiener Freiheitlichen konnte aber auch unter
dem neuen Obmann Rainer Pawkowicz fortgesetzt werden. Hirnschall
wurde 1997 Ehrenobmann von Wien und blieb den Freiheitlichen Zeit
seines Lebens bis zu seinem Tod am 26. August 2011 verbunden.
Wenn er später nicht davor zurückscheute, es war 2007, in einem
Interview, den neuen Landes- und Bundesparteiobmann H.-C. Strache
zu kritisieren. Er brachte damals in diesem Interview sinngemäß zum
Ausdruck:“ …es mangle ihm, Heinz-Christian Strache, im Unterschied
zu Jörg Haider, an intellektuellem Tiefgang.“
◆
114
1956–1990
115
116
An der blauen Donau
1947–1956
1947–1956
DER VERBAND DER
UNABHÄNGIGEN IN WIEN
VON FRITZ STÜBER
ZU WILLFRIED GREDLER
117
An der blauen Donau
Der VdU, der zum Zünglein an der Waage wurde
Die Rückkehr des Dritten Lagers
in der Bundeshauptstadt
Als es nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches bei der Wiedergründung
der Republik zur Abrechnung mit dem Nationalsozialismus
kam, setzten die Siegermächte den Begriff „nationalsozialistisch“
und „national“ gewissermaßen gleich. Damit wurde nicht nur den
ehemaligen Mitgliedern der NSDAP, die damals mit ihren Familienmitgliedern
bestimmt ein Viertel der österreichischen Bevölkerung ausgemacht
haben, die aktive Teilnahme an der Politik der neu gegründeten
Zweiten Republik verwehrt, sondern auch die Neugründung einer nationalliberalen
Partei.
Kommt eine neue
national-freiheitliche Partei?
Die Nationalratsabgeordneten
des VDU
Als am 11. September 1945 der ,,Alliierte Rat“ beschloss, in Österreich
Parteien anzuerkennen, bezog sich dies lediglich auf die Volkspar-
118
1947–1956
tei, auf die Sozialisten und auf die Kommunisten, obwohl sich mehr als
50 Gruppierungen um eine Anerkennung als Partei bewarben. Dementsprechend
waren bei der ersten Nationalratswahl in der Zweiten
Republik am 25. November 1945 auch nur ÖVP, SPÖ und KPÖ zu
einer Kandidatur berechtigt. Einzig in Kärnten, in der britischen Besatzungszone,
gab es eine Ausnahme, wo neben den drei Lizenz-Parteien
eine „Demokratische Partei“ für die Landtagswahl, die gleichzeitig
durchgeführt wurde, kandidieren durfte und ein Mandat erlangte. Allen
ehemaligen Mitgliedern und Parteianwärtern der NSDAP, SS und SA
wurde die Wahlberechtigung entzogen, womit es in Österreich zur Zeit
der ersten Nationalratswahl etwa 600.000 Bürger zweiter Klasse gab, die
von den politischen Rechten ausgeschlossen waren. Auch die Frauen
und Kinder der Registrierten waren betroffen. Diese erste Nationalratswahl
der Zweiten Republik endete mit einer absoluten Mehrheit der
ÖVP, die gemeinsam mit den Sozialisten und
den Kommunisten eine Konzentrationsregierung
bildete (ab 1947 dann Große Koalition
ohne KP).
Durch die Entschließung des „Alliierten
Rates“ wurde der historisch gewachsenen Parteienlandschaft
in Osterreich keineswegs Rechnung
getragen. Bei der letzten freien Wahl in
der Ersten Republik hatten die Parteien des
nationalliberalen Lagers immerhin 18 Prozent
der Stimmen errungen, was nichts anderes bedeutet,
als dass zu Beginn der Zweiten Republik
fast ein Fünftel der Österreicher – seiner
politischen Heimat beraubt – dem großkoalitionären
Proporzdenken der Massenparteien ein
wirksames Korrektiv entgegengestellt haben.
Am 4. Februar 1949 kündigte Herbert
Kraus in einer Pressekonferenz die Gründung einer vierten Partei mit
Namen VdU (Verband der Unabhängigen) an. Kraus und seine Mitstreiter
wählten deswegen den Namen „Verband der Unabhängigen“,
weil gerade in dieser Zeit ein starkes Bedürfnis nach Unabhängigkeit
von Parteienherrschaft bestand. Die beabsichtigte Neugründung auch
publikumswirksam darzustellen, erforderte die Gründung einer eigenen
Zeitung. Bei oberösterreichischen Industriellen trieb Herbert Kraus die
Geldmittel dafür auf. Am 24. Februar 1949 erschien die erste Nummer
der „Neuen Front“. Chefredakteur wurde Viktor Reimann, der stets für
die Titelseite einen eher aggressiven Leitartikel gestaltete, während Herbert
Kraus auf der dritten Seite politische Konzepte entwarf. So ergab
sich eine perfekte Rollenteilung, die sich auf das Parteiblatt äußerst positiv
auswirkte.
Am 26. März 1949 fand die eigentliche konstituierende Generalversammlung
des VdU in der Salzburger Fronburg statt. Diese vierte
Partei musste allerdings als Verein angemeldet werden, da aufgrund der
alliierten Lizenzen nur drei Parteien in Österreich zugelassen waren.
Auch der Nachfolger des VdU, die FPÖ, war letztlich bis zum Parteiengesetz
von 1975 nur als Verein konstituiert. Dem neu gegründeten
Verband blieb nur eine kurze Zeit für die Vorbereitung der Nationalratswahl
am 9. Oktober 1949. Die Zulassung zur Wahl konnte bei den
„
Bei der letzten
freien Wahl in der Ersten
Republik hatten die Parteien
des nationalliberalen
Lagers immerhin 18
Prozent der Stimmen errungen.
119
An der blauen Donau
„
Als ausgesprochener
Individualist kam
Stüber geistig nicht aus
dem Nationalsozialismus,
sondern aus dem Kreis
der Schönerianer.
Alliierten erreicht werden, weil es sich als Glück erwies, dass die Sowjetunion
in ihrem Bereich die Kandidatur der ,,Demokratischen Union“
des links katholischen Prof. Dobretsberger durchsetzen wollte. Aus
diesem Grund wurden in den Verhandlungen
beide Verbände zugelassen. Allerdings konnte
der VdU nicht als VdU kandidieren, sondern
musste aus verfassungsrechtlichen Gründen als
„Wahlpartei der Unabhängigen“ (WdU) antreten.
Dies brachte zusätzliche Schwierigkeiten
mit sich.
Der VdU in Wien
Über die Gründung des VdU in Wien
schrieb Viktor Reimann in seinem Buch „Die
dritte Kraft in Österreich“:
Erst am 8. August 1949, also mehr als fünf
Monate nach der Gründung des Bundes-VdU,
fand die gründende Generalversammlung des
Wiener Landesverbandes statt, die Kraus präsidierte
und auf der Ing. Hans Heger zum Vorsitzenden
gewählt wurde. Heger war eine zwielichtige
Gestalt. Er hatte im Krieg das Ritterkreuz
erworben, gab sich im VdU als Major aus, obwohl
er, wie sich später herausstellte, nur Feldwebel
gewesen war. Seine Beziehungen zu den
Sowjets blieben undurchschaubar, und erst später
stellte sich heraus, dass sie enger waren, als
es die Parteiführung wünschen konnte. In der
russischen Gefangenschaft hatte er den „Antifaschistischen
Eid“ geschworen.
Das Gesicht des Wiener Verbandes prägte
aber nicht Heger, der gleich nach den Wahlen
für etliche Zeit im politischen Dunkel untertauchte,
sondern Dr. Fritz Stüber. Er war der nationale
Barde vom Dienst und Oppositioneller
aus Passion. Als ausgesprochener Individualist
kam Stüber geistig nicht aus dem Nationalsozialismus,
sondern aus dem Kreis der Schönerianer,
die sich immer erst wohl fühlten, wenn die
Nationalen einander in den Haaren lagen.
Fritz Stüber
Sicherlich haben die harten Maßnahmen
der Großparteien gegen die Nationalsozialisten
Stübers Widerstandsgeist wiedererweckt: Er trat der „Verfassungstreuen
Vereinigung“ bei, wurde bei deren Auflösung im Sommer 1848 verhaftet
und nach mehreren Monaten im Februar 1949 wieder entlassen. Als der
VdU gegründet wurde, bot Stüber seine Mitarbeit an. Er besaß unbestritten
eine Menge Qualitäten. Er war ein glänzender Redner, der sich an den
eigenen Worten berauschte und sich von der Begeisterung der Zuhörer
fortreißen ließ. Der Redner Stüber formulierte wesentlich besser als der
120
1947–1956
Schriftsteller, und es gelang ihm in den Versammlungen immer wieder, die
Gefühle der Zuhörer aufzuwühlen.
Stübers Pathos stammte aus alten Zeiten. Seine Gedichte, die seine
Gegner im Parlament öfter zitierten, um ihn als Dichter bloßzustellen,
krankten gleichfalls an diesem nationalen Pathos. Der Kommunist
Ernst Fischer, der gleichfalls Gedichte und zweifellos besser als Stüber
schrieb, nannte diesen einen „Sprachverhunzer“,
was wohl übertrieben war.
Das „Soziale Manifest
des VdU“
als wichtiges
Grundsatzpapier
Stüber sah es als seine „heilige
Pflicht“ an, sich gegen den Niedergang,
wenn nicht Untergang des nationalen
Gedankens zur Wehr zu setzen. Die
Worte „Nation“ und „Deutschland“ bedeuteten
ihm Religion. In ihm steckte
eine Kämpfernatur, die sich nur im
Angriff wohl fühlte. Ein aufbauendes
Konzept besaß er nicht. Er verachtete
das Streben von Kraus, unbedingt ins
politische Spiel zu kommen. Stüber
liebte das Leben in der Opposition.
Für ihn gab es nichts Köstlicheres,
als den anderen Parteien den Spiegel
vor das Gesicht zu halten. Allerdings
bot er selbst zu viele Angriffsflächen,
so dass ihm die Gegner nicht weniger
genüsslich seine eigenen Sünden
vor Augen hielten. Als Jurist und
ehemaliger Finanzbeamter besaß
Stüber profunde Kenntnisse, vor
allem auf dem Gebiet des Steuerrechtes,
und war hier für den VdU
ein echter Gewinn. Er verstand es,
selbst Reden zu reinen Fachfragen
interessant zu gestalten.
Stüber kam im September
1949, knapp vor den Wahlen, mit
der Wochenzeitung „Der Unabhängige“
für Wien, Niederösterreich
und Burgenland heraus. Sie
erreichte keine hohe Auflage.
Das romantisch-nationale
Image, das der Wiener VdU
von Anfang an besaß und das
er nie mehr losbrachte, ist
schuld, dass der VdU nie eine großstädtische
Partei wurde und immer provinziell blieb. Mit politischen Ladenhütern
war die großstädtische Intelligenz einfach nicht zu gewinnen.
In Wien wurde mit Prof. Viktor Miltschinsky ein weiterer Gymnasialprofessor
zum Obmann gewählt, ein Kämpe der Grenzlandsarbeit noch
aus den Zeiten der Monarchie und typischer Vertreter der nationalen
121
An der blauen Donau
Vereinskultur, der zwanzig Jahre
zuvor den Wahlkampf des Schober-Blocks
geleitet und zusammen
mit Hummer 1936 den Parteiverein
der Großdeutschen Volkspartei
zu Grabe getragen hatte. Treibende
Kraft in Wien war zweifelsohne sein
Stellvertreter, Fritz Stüber. Hier, wo
der VdU keine große Massenbasis
hatte gewinnen können, fiel dem
klassischen nationalen Lager nahezu
automatisch die Führung zu. Auch
das Sekretariat des Parlamentsklubs
leitete mit Peter Leisz ein ehemaliger
Hauptgeschäftsführer der Großdeutschen
Volkspartei.
Der erste
Wahlerfolg
1951: Wahlplakat
von Burghard
Breitner
Im Wahlkampf ging es vor allem
um die minderbelasteten ehemaligen
Nationalsozialisten, die nach
dieser Amnestie vom 21. April 1948
wieder wahlberechtigt waren, sowie
um die Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft
und die Volksdeutschen.
Auch die ÖVP bemühte
sich um Kontakte mit ehemaligen
führenden Nationalsozialisten in
Oberweis, wobei der spätere zweite
Nationalratspräsident Alfred Maleta
die Verhandlungen führte. Die
Sozialisten pflegten durch Innenminister
Oskar Helmer sehr gute
Kontakte zum „Gmundner Kreis“
ehemaliger NS-Spitzenfunktionäre,
die inzwischen ein Naheverhältnis
zum amerikanischen CIA aufgebaut hatten. Die ÖVP versuchte, die
Kandidatur des VdU bis zur letzten Minute zu hintertreiben, da sie
große Verluste befürchtete, wenn eine zweite nichtsozialistische Partei
kandidierte. Diese Annahme war allerdings gerade für die Sozialisten
ausschlaggebend, den VdU maßgeblich zu unterstützen.
So konnten dank der SPÖ Papier für Plakate und Stimmzettel billig
in der Papierfabrik Steyrermühl gekauft werden (diese heute banal erscheinende
Frage stellte in der damaligen Zeit ein existentielles Problem
dar, da Papier kontingentiert und entsprechend teuer und schwer erhältlich
war; zudem musste eine entsprechend große Anzahl von Stimmzetteln
gekauft werden, da es noch keine amtlichen Stimmzettel gab). Unter
dem Motto „Recht, Sauberkeit und Leistung“ hatte sich der VdU am
22. Juli 1949 ein 52-Punkte-Programm gegeben. Dazu kam im Jahre
1950 das „Soziale Manifest“ des VdU.
122
1947–1956
Neben den Parteigründern Kraus und Reimann waren die wichtigsten
Männer der ersten Stunde der alte Landbündler und ehemalige
Vizekanzler Karl Hartleb, Gustav Adolf Jakob Neumann und Thomas
Neuwirth, der als unabhängiger Landessekretär des ÖGB in Salzburg
wirkte. Auf seine Ideen und sein Wirken geht auch das soziale Manifest
des VdU zurück. Hartleb stand für die Kontinuität des nationalliberalen
Lagers, das er bereits in der Ersten Republik an hervorragender Stelle,
unter anderem auch als Vizekanzler, vertreten hatte. Gustav Adolf Jakob
Neumann schließlich stand für das junge und erneuernde Element,
durch das sich das nationalliberale Lager in seiner Geschichte stets auszeichnete:
er war erst 25 Jahre alt, besaß also im Jahre 1949 noch nicht
einmal das passive Wahlrecht, galt aber in Oberösterreich als eine Integrationsfigur.
Als Generalsekretär fungierte 1949/50 eine zeitlang das
bekannte Jagdflieger-As Gordon Gollob.
Mit dem Wiedereintritt des nationalliberalen
Lagers in das innenpolitische Geschehen
der Zweiten Republik setzte schlagartig
jene Verteufelung ein, die den VdU und danach
seine Nachfolgeorganisation, die FPÖ,
als ,,nazistisch und faschistoid“ denunzierte
und als Sammelbecken für alte und neue Nazis
darstellen wollte. Unterschlagen wurde
dabei stets, dass das Gros der ehemaligen
Angehörigen der NSDAP spätestens in den
50er-Jahren bei den beiden österreichischen
Großparteien untergeschlupft war und nur
ein kleiner Teil im VdU und in der FPÖ.
Bereits seit den Gründungstagen des VdU
versuchte man im Zuge dieser Hetze, die Begriffe
,,national“ und nationalsozialistisch“
gleichzusetzen, um so das gesamte Dritte Lager
aus dem demokratischen Grundkonsens der Zweiten Republik hinauszudrängen.
Tatsächlich wurde bereits der Wahlkampf von 1949
zu einer Schlammschlacht ohnegleichen. Vor allem die ÖVP führte
ihn sehr persönlich und schreckte auch vor den unfairsten Methoden
nicht zurück. Viktor Reimann vergleicht in seinem Buch „Die
Dritte Kraft“ die Aktionen der ÖVP mit dem Watergate-Skandal. Am
9. Oktober 1949 erteilte die Bevölkerung diesen Diffamierungen allerdings
eine deutliche Abfuhr, da der VdU mit 489.000 Stimmen
11,67 % und 16 Mandate erlangen konnte. Je 8 Mandate kamen von
den Sozialisten, je 8 von der Volkspartei, ganz im Sinne des Wahlprogramms
des VdU, der ja die Proporzwirtschaft aufbrechen wollte.
Bei einer genauen Analyse der Wahlergebnisse fällt ein starkes
West-Ost-Gefälle auf: So erzielte der VdU in den Besatzungszonen
der westlichen Alliierten fast 20 % der Stimmen, während er in der
russischen Besatzungszone nur auf etwa 4 % kam. Das hängt auch
damit zusammen, dass die russische Besatzungsmacht viele Wahlveranstaltungen
des VdU kurzerhand verbot. Allein aus diesen Zahlen
lässt sich auf Grund einer einfachen Rechnung das heute noch häufig
bestehende Vorurteil entkräften, dass es vor allem die ehemaligen Nationalsozialisten
waren, die den VdU gewählt hätten. Von den im Jahre
1948 amnestierten minderbelasteten Nationalsozialisten, es waren ca.
460.000, lebten ganze 300.000 in der östlichen Zone, also dort, wo der
VdU nur 4 % der Stimmen erzielte.
Mit dem Wiedereintritt
des nationalliberalen
Lagers in das innenpolitische
Geschehen der
Zweiten Republik setzte
schlagartig die Verteufelung
ein.
Fortsetzung auf Seite 127 ▶
„
123
An der blauen Donau
Fritz Stüber
Gewichtige
Persönlichkeiten
im Wiener VdU
Im „Bericht der Historiker-Kommission“
(Freiheitliches
Bildungsinstitut, Wien
2019) beschreibt der Historiker
Michael Wladika kritisch
einige der wichtigsten Vertreter
des VdU aus der Wiener
Landesgruppe:
Dr. Fritz Stüber wurde am
18. März 1903 in Wien als
Sohn des Kulturredakteurs
der frei-alldeutschen „Ostdeutschen
Rundschau“, Fritz
Stüber-Günther, geboren. Er
studierte zunächst Rechtswissenschaften
und war dann als
Finanzbeamter tätig. Daneben
verfasste er Gedichtbände. …..
1938 verließ Stüber den von
ihm ungeliebten Staatsdienst
und wechselte ins Zeitungsfach.
Seine Stellung als Schriftleiter
des „Neuen Wiener Tagblattes“
in den letzten Kriegsjahren
verschaffte ihm wegen seiner
Durchhalteartikel einen Kriegsverbrecherprozess
und eine
Viktor Reimann
zweimalige Verhaftung, bis er
im September 1949 freigesprochen
wurde. Der Burschenschafter
Stüber (Vandalia Wien,
1962 Gothia Wien) verkörperte
eine genuin schönerianische
Tradition, die er auch nicht bereit
war zu verleugnen, wie er
selbst schrieb. So war er noch
persönlich mit dem ehemaligen
Reichsratsabgeordneten Anton
Schalk, einem der letzten Getreuen
Schönerers, befreundet,
der 1948 starb.
Dr. Viktor Reimann (1915–
1996) wurde am 25. Jänner
1915 in Wien geboren. Nach
dem Abschluss des Gymnasiums
in Klosterneuburg studierte
er zwei Jahre Theologie,
brach aber das Studium ab,
um in Wien Geschichte zu studieren.
1939 promovierte er.
Reimann war zunächst illegales
NSDAP-Mitglied und als treuer
Heinrich von Srbik-Schüler immer
stark deutschnational und
antisemitisch eingestellt. Allerdings
geriet er aufgrund seiner
Kontakte zur Widerstandsgruppe
um Roman Karl Scholz 1940
in die Mühlen der NS-Justiz und
wurde 1943 wegen „Vorbereitung
zum Hochverrat“ zu zehn
Jahren schwerem Kerker verurteilt.
Bis 1945 saß Reimann im
Strafgefängnis Straubing. Nach
seiner Befreiung wurde er
stellvertretender Chefredakteur
der „Salzburger Nachrichten“.
Dass Reimann
nach 1945 als „NS-Opfer“
firmierte, erwies sich zwar
als vorteilhaft für das Image
des VdU, machte ihn aber
in den eigenen Kreisen verdächtig:
Nicht selten wurde
er in parteiinternen Konflikten,
übrigens wie Kraus,
dem man „Verrat“ vorwarf,
abschätzig als „KZ’ler“ und
„Widerständler“ tituliert.
Univ.-Prof. Dr. Helfried
Pfeifer (1896–1970), am
31. Dezember 1896 in Wien
124
1947–1956
nannter „Illegaler“ wurde Pfeifer
nach dem „Anschluss“ mit 1. Mai
1938 in die NSDAP aufgenommen
und bekam die Mitgliedsnummer
6,104.797 aus dem
„Illegalenblock“ zugewiesen. Er
war einige Zeit als Oberregierungsrat
dem Reichsministerium
des Innern in Berlin zugeteilt
und auch dort wohnhaft. Pfeifer
stieg 1940 zum außerordentlichen
Universitätsprofessor auf.
Als NS-Verwaltungsjurist gab er
1941 unter dem Titel „Die Ostmark.
Eingliederung und Neugestaltung“
eine Sammlung von
grundlegenden Rechtstexten
heraus, mit welchen er zustimmend
die Umwandlung des unabhängigen
Österreich in die
nationalsozialistische Ostmark
dokumentierte. 1945 wurde
Pfeifer aus dem Universitätsdienst
entlassen, als minderbelastet
eingestuft und 1948
nach dem Stande von 1938
als Landesregierungsrat in den
Ruhestand versetzt. Viktor Reimann
unterstrich, dass Pfeifer
als ausgezeichneter Kenner des
Verwaltungs- und Verfassungsrechts
bei der Parlamentsarbeit
Helfried Pfeifer und
Willfried Gredler
geboren, besuchte nach der
Volksschule das Gymnasium in
Wien-Hietzing. Am Ersten Weltkrieg
nahm er als Kriegsfreiwilliger
teil und wurde Offizier. Nach
Kriegsende studierte er Rechtswissenschaften
und schloss das
Studium mit dem akademischen
Grad Dr. jur. ab. Nach dem Gerichtsjahr
trat Pfeifer 1922 in
den politischen Verwaltungsdienst
ein. 1935 habilitierte er
sich über „Grundsätze und Probleme
des österreichischen Sozialversicherungsrechtes“
und
wurde Dozent für Verwaltungslehre
und Verwaltungsrecht an
der Universität Wien. Als soge-
für den VdU „unentbehrlich“ war
und er lobte „seine Zähigkeit,
seinen Fleiß und seine Gewissenhaftigkeit“.
Dr. Willfried Gredler wurde
am 12. Dezember 1916
geboren und entstammte einer
Tiroler Bauernfamilie. Ein
Vorfahre von ihm war 1848 als
Zillertaler Abgeordneter bereits
in der Frankfurter Nationalversammlung
gesessen. Sein Vater
war ein prominenter Heimwehrführer,
der 1938 verhaftet wur-
125
An der blauen Donau
de. Gredler studierte zunächst
Rechtswissenschaften an der
Universität Wien, promovierte
dort zum Doktor der Rechte,
betrieb ein zweites Studium an
der Hochschule für Welthandel
und erwarb außerdem noch das
Diplom an der Wiener Konsularakademie.
Als Student suchte
der damals in Wien 6., Magdalenenstraße
4 wohnhafte Gredler
am 24. Mai 1938 um Aufnahme
in die NSDAP an, die rückwirkend
mit 1. Mai 1938 erfolgte.
Ihm wurde die Mitgliedsnummer
6,334.817 zugeteilt. Aufnahmeantrag,
Aufnahme sowie die Mitgliedsnummer
lassen auf eine
„illegale“ Betätigung schließen.
Im Zweiten Weltkrieg zur Wehrmacht
eingezogen, erreichte er
nur den Dienstgrad eines Gefreiten.
Nach einer Verwundung
diente er im deutschen Auswärtigen
Amt. Gredlers politische
Karriere war erstaunlich: Als Parteimitglied
der NSDAP schloss
er sich im letzten Kriegsjahr der
Widerstandsgruppe 05 an und
gehörte zu jener Gruppe, die
sich 1945 im Palais Auersperg
zusammenfand und eine kampflose
Übergabe Wiens erreichen
wollte. Im Herbst 1945 trat er in
ein Konzern-Unternehmen einer
Bank ein, dessen geschäftsführender
Direktor er nach einigen
Jahren wurde. Daneben arbeitete
er auch in der Katholischen
Aktion. 1948 trat er der ÖVP bei
und bekleidete im Wiener Zweig
der Partei die Stelle des Propagandareferenten.
1949 nahm
er bekanntlich an der Gründung
der „Jungen Front“ teil, zu deren
Obmann-Stellvertreter er gewählt
wurde. Ab 1953 war er nun
im VDU aktiv. Herbert Kraus, der
Gredler als „blitzgescheit, geistreich
und amüsant“ beschrieb,
betrachtete ihn trotzdem als
Konkurrenten und Feind, denn
„Gredler hat oft seine Partei gewechselt,
und noch öfter seine
Freunde“. Laut Viktor Reimann
schätzte Gredler Kraus, doch als
er Abgeordneter wurde, hätte
er bemerkt, wie stark der Stern
von Kraus bereits im Sinken
war. Reimann zitierte Gredler,
der später entdeckt habe, dass
„sich im Falle einer Auflösung
des VdU eine neu zu gründende
nationale Partei nur entweder
einen Kraus oder einen Gredler
leisten könne. Da sich Gredler
selbst näher stand, entschied er
sich für Gredler“.
◆
Wahlplakat
VdU: 1953
126
1947–1956
Ausgrenzung – schon damals
Auch die gleichzeitig mit der Nationalratswahl im Jahre 1949 durchgeführten
Landtagswahlen brachten dem VdU beachtliche Erfolge. So
erzielte er beispielsweise in Oberösterreich 10 Mandate, was gleich zwei
Landesregierungssitze bedeutete. Lediglich in Niederösterreich ging er
leer aus, was auf die Diskriminierung seitens der sowjetischen Besatzungsmacht
zurückzuführen war. Erst unter der Obmannschaft Jörg
Haiders sollte es gelingen, auch in Niederösterreich in der Landespolitik
zu einem gewichtigen Faktor zu werden.
Neben den 16 Nationalratsmandaten konnte
der VdU auch 4 Sitze im Bundesrat erringen.
Trotz dieser politischen Erfolge geriet der
Verband der Unabhängigen in die Isolation.
Auch die Sozialisten verwandelten ihre vor
der Wahl praktizierte freundliche und entgegenkommende
Haltung in eine ablehnende,
nachdem der VdU nicht nur eine Schwächung
der Volkspartei, sondern im gleichen Maße
auch der SPÖ bewirkt hatte. Überdies war
das sensationell gute Abschneiden des VdU
bei den Arbeiterkammerwahlen im Jahre 1949
für die Sozialisten bedrohlich. Der VdU erzielte
dabei 117 Mandate und wurde bei den
Angestellten sogar zur zweitstärksten Fraktion!
Eine harte Reaktion der Sozialisten riefen
auch die VdU-Erfolge bei den Betriebsratswahlen
hervor, bei denen der VdU gepunktet
hatte, und die wiederholt werden mussten.
Durch innerbetrieblichen Terror brachten die
Sozialisten es letztlich dazu, dass viele Positionen
des VdU wieder verloren gingen. Dazu
gesellte sich noch ein menschliches Problem:
Viele der VdU-Aktivisten waren gerade wieder
in ihre alten bürgerlichen Positionen zurückgekehrt.
Sie, vor allem ihre Familien,
fürchteten, diese wieder aufs Spiel zu setzen.
Dies führte in der Folge dazu, dass sehr viele
VdU-Anhänger in den Großbetrieben zur SPÖ übertraten.
Wiedergewählt:
Gredler (li.) und
Kandutsch auf
den Stufen des
Parlaments
Das bereits erwähnte „Soziale Manifest“ des VdU beinhaltete vor
allem die Idee der Partnerschaft von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, also
die innerbetriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer und die Partizipation
an Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Der oberösterreichische
Industrielle Karl Leitl verwirklichte dieses Konzept in seinem Unternehmen.
Die Leitl-Werke befinden sich bis heute zu einem Drittel in Arbeiter-
und Angestelltenbesitz. Das Prinzip gilt als vorbildlich und dient ausländischen
Delegationen häufig als Studienobjekt. Im Ansatz enthält das
„Soziale Manifest des VdU“ auch das richtig verstandene Prinzip der Sozialpartnerschaft
von unten, das heute leider in seiner pervertierten Form
als staatlich verordnetes Zwangssystem von oben praktiziert wird.
Einen letzten großen Erfolg konnte der VdU im Jahre 1951 verbuchen,
als er bereits seine ersten internen Schwierigkeiten zu bewältigen
hatte: Bei der Bundespräsidentenwahl stellte er den Innsbrucker Univ.
127
An der blauen Donau
Das „Waterloo“ des VdU
Der 17. Oktober 1954 sollte
zum Schicksalstag des VdU
werden, denn an diesem Tag
fanden in Wien, Niederösterreich,
Salzburg und Vorarlberg
zugleich Landtagswahlen statt.
Anton Reinthaller, der von der
VdU-Führung bezüglich einer
Wahlempfehlung gefragt wurde,
lehnte schließlich ab, sich
offen für den VdU zu deklarieren,
vielleicht erahnte er auch
das Waterloo der Partei: In
Wien kam der VdU auf gerade
einmal 50.200 Stimmen,
Stübers FSÖ auf 13.500. Weder
der VdU noch die FSÖ erreichten
ein Grundmandat. Im
Wiener Gemeinderat, in den
1949 sechs VdU-Gemeinderäte
gewählt worden waren, gab es
keine dritte Kraft mehr.
◆
„
Das Problem des
nationalliberalen Lagers
war seit jeher gewesen,
dass es über viele ausgeprägte
Individualisten
verfügte, die in ihren
Meinungen ein weites
Spektrum abdeckten, es
aber an Parteidisziplin oft
mangeln ließen.
-Prof. Burghard Breitner auf. Breitner hatte sich als Chirurg im Ersten
und Zweiten Weltkrieg einen guten Namen gemacht, worauf auch sein
Beiname „Engel von Sibirien“ zurückgeht. Er galt als wissenschaftliche
Koryphäe und hatte sich auch in vielerlei künstlerischer und kultureller
Hinsicht profiliert. Obwohl Burghard Breitner selbst keine einzige öffentliche
Wahlversammlung bestritt (lediglich einmal sprach er fünf Minuten
im Radio), erzielte er über 660.000 Stimmen, die absolute Mehrheit
in den Städten Salzburg und Innsbruck sowie eine relative Mehrheit
im Land Salzburg.
Zwietracht und Neuformierung
In den folgenden Jahren stieß eine Reihe neuer Persönlichkeiten
zum VdU. Eine Gruppe um Graf Strachwitz,
der u. a. die Kriegsheimkehrer ansprach, konstituierte
sich vorerst als ,,Junge Front“ innerhalb
der ÖVP, die ihr jedoch keinen genügenden
Spielraum einräumten. So trat Strachwitz aus
der ÖVP aus und war bis 1953 wilder Abgeordneter
im Parlament. Strachwitz, Dr. Wilfried
Gredler und einige andere Parteiungebundene
riefen nunmehr die ,,Aktion zur politischen Erneuerung“
ins Leben und strebten ein Wahlabkommen
mit dem VdU an, Oberst Max Stendebach
wurde zum neuen Obmann gewählt, der
das Wahlabkommen mit der Strachwitz-Gruppe
abschloss. Die Wahl vom 22. Februar 1953
brachte für den VdU in Wien Gewinne, im
Westen aber Stimmenverluste, sodass zwei
NR-Mandate verloren gingen. Von der ,,Aktion
der politischen Erneuerung“ zog Gredler
ins Parlament ein. In der Folge konnte die
Vorstellung von einer Konzentrationsregierung
unter Einbeziehung des VdU nicht verwirklicht
werden. Raab ging es bei diesen Verhandlungen
nur um ein taktisches Manöver zur Einschüchterung
der SPÖ. Der Nationalrat wählte lediglich
Karl Hartleb zum Dritten NR-Präsidenten.
128
1947–1956
Die NR-Wahlen hatten Stüber mit einem gehobenen Selbstbewusstsein
ausgestattet: Die Wiener WdU hatte ihren Stimmenanteil 1953 von
6,8 auf 10,6 %, also um mehr als die Hälfte, erhöht: Wer sich diese Federn
an den Hut stecken durfte, ob hier bloß ein Nachholbedarf gedeckt
wurde, ob auch oder sogar in erster Linie Gredler und sein bürgerlich-liberaler
Anhang gezogen hatten oder ob doch Stübers stets gutgefüllte
und aufsehenerregende Versammlungen den Ausschlag gegeben hatten,
war klarerweise umstritten. Der Wiener Landesverband hatte jetzt auch
im Delegiertenschlüssel auf dem Verbandstag mit Oberösterreich und
der Steiermark fast gleichgezogen.
Auch war der VdU um diese Zeit durch innere Streitigkeiten geschwächt.
Das Problem des nationalliberalen Lagers war seit jeher gewesen,
dass es über viele ausgeprägte Individualisten verfügte, die in
ihren Meinungen ein weites Spektrum abdeckten, es aber an Parteidisziplin
oft mangeln ließen. Das war intellektuell redlich, aber politisch
oft verderblich. In Wien führte die Überbetonung der nationalen Gesichtspunkte
durch den Abgeordneten Fritz
Stüber zu schwierigen internen Auseinandersetzungen,
die letztlich mit dem Ausschluss
Stübers endeten, der seinerseits eine neue Partei,
die Freiheitliche Sammlung Österreichs“
(FSO), gründete.
Der Ausschluss Stübers
Über den Ausschluss Fritz Stübers, des
starken Mannes des VdU in Wien schrieb Viktor
Reimann: (a.a.O.)
Die gescheiterten Regierungsverhandlungen
zwischen ÖVP und VdU hatten verbandsintern
unerwünschte Nachwirkungen.
Sicherlich war Kraus die treibende Kraft bei
diesen Verhandlungen gewesen; ihm wurde
das ewige In-die-Ecke-verbannt-Sein der Opposition zum Trauma. Die
Verhandlungen hatten kaum etwas eingebracht. Doch durfte nicht übersehen
werden, dass eine Partei vom bisherigen Weg, den VdU einfach
zu ignorieren, abgewichen war. Die Koalitionsmaschine lief nicht mehr
ganz so reibungslos. Auch hatten die Verhandlungen mit der ÖVP dem
VdU einen kleinen Prestigeerfolg gebracht, der ihm nach dem enttäuschenden
Wahlergebnis guttat.
Die Angelegenheit wäre längst beendet gewesen, wenn nicht
Stüber, dem wegen seiner ablehnenden Haltung zu den Verhandlungen
mit der ÖVP Schärf das Du-Wort angeboten hatte, sie zum
Anlass genommen hätte, gegen die Bundesverbandsleitung offen
aufzutreten und die Verhandlungen grundsätzlich als falsche Politik
hinzustellen. Deshalb kam es beim Bundesverbandstag am 16. und
17. Mai 1953 in Wien zu heftigen Auseinandersetzungen. Der Wiener
Landesverband stellte sogar den Antrag, der Bundesverbandsleitung
das Misstrauen wegen ihrer Verhandlungspolitik auszusprechen.
Kandutsch äußerte sich im Namen des Verhandlungskomitees
und erklärte, dass Verhandeln eine Form der Demokratie sei und
„
Auch hatten die
Verhandlungen mit der
ÖVP dem VdU einen kleinen
Prestigeerfolg gebracht,
der ihm nach dem
enttäuschenden Wahlergebnis
guttat.
129
An der blauen Donau
es Pflicht einer Parteiführung wäre, alle Möglichkeiten auszunützen,
die sich anböten.
Der Missbilligungsantrag der Wiener erhielt nur 27 von insgesamt
151 Stimmen, aber die Hassausbrüche, die damals teilweise von Wiener
Delegierten gegen die Bundesverbandsleitung erfolgt waren, zeigten,
dass es keine gemeinsame Basis mehr gab. An dieser Eskalation der
Auseinandersetzung, wie sie in solchem Ausmaß seit Gollobs Zeiten
nicht mehr aufgetreten war, trug Stüber zweifellos die Hauptschuld. Der
Erfolg der Wiener bei den Nationalratswahlen hatte ihm den Kopf verdreht
und den Sinn für das Maß verlieren lassen. Er vergaß, dass die
drei Reststimmenmandate, welche die Wiener Organisation errungen
hatte, nach wie vor nur durch die Grundmandate in den Bundesländern
abgesichert waren. Er vergaß weiter, dass Wien nur einen Aufholbedarf
deckte und noch immer nicht dort angelangt war, wo die Bundesländer
trotz der Stimmenverluste standen. Außerdem schrieb er den Wiener
Erfolg ausschließlich seiner nationalen Politik zu und übersah, dass
gerade in Wien die gesellschaftlich stark fundierte Anhängerschaft der
„Aktion“ zweifellos einen gewissen Anteil am Erfolg hatte.
Was Stüber tat, war nichts anderes als das, was nationale Streithähne
seit Schönerers Zeiten immer getan haben: der gemäßigten Gruppen in
den Rücken zu fallen, mit pathetischen, hohlen nationalen Phrasen die
sachliche Argumentation zu überschreien und die Vernunft zu betäuben.
Die Wiener stellten dann Ursin als Gegenkandidaten zu Stendebach
auf, doch erhielt jener nur 38 Stimmen, während Stendebach mit knapp
über 100 Stimmen gewählt wurde.
„
In der Sitzung vom
23. November 1953
schloss die Bundesverbandsleitung
Stüber mit
großer Mehrheit aus.
Auf dem Wiener Parteitag referierte ich
über den Zusammenschluss von VdU und „Aktion“.
Nach dem Referat herrschte eine ziemlich
einheitliche Meinung, die Angelegenheit so
schnell wie möglich ins Reine zu bringen. Deshalb
trat am 4. und 5. Juli 1953 ein außerordentlicher
Bundesverbandstag in Villach zusammen,
auf dem der Beschluss gefasst wurde, den Namen
VdU beizubehalten und den Aktionsleuten
die Kooptierung einer bestimmten Anzahl ihrer
Funktionäre in die Bundesparteileitung und in
alle nachfolgenden Führungsgremien des VdU
anzubieten.
Die Hauptversammlung der „Aktion“, die
am 12. Juli stattfand, lehnte dieses Angebot als zu wenig weitgehend
ab. Damit ging der mit viel Tamtam propagierte gemeinsame Weg des
VdU mit der „Aktion“ auseinander. Im Grund tat es auf keiner Seite
jemanden leid, zumal die Wahlen gezeigt hatten, dass die Zusammenlegung
von Gruppen in der Bevölkerung keinen Eindruck macht, wenn
nicht ein starker Wille dahinter steckt, der die Dinge in Bewegung setzt,
wie er bei der Gründung des VdU im Jahre 1949 sichtbar geworden war.
Der Gegensatz Stübers zur Bundesparteileitung spitzte sich immer
mehr zu. Wenn die Bundesparteileitung nicht riskieren wollte, dass die
130
1947–1956
Rebellion in Wien auch auf die Bundesländer übergriff, musste sie etwas
unternehmen. In der Sitzung vom 23. November 1953 schloss die
Bundesverbandsleitung mit großer Mehrheit Stüber aus der Partei aus
und suspendierte seinen Stellvertreter Ursin von seinen Funktionen. Als
Grund wurden Abspaltungstendenzen im Wiener Landesverband angeführt
sowie Stübers Weigerung, sich Mehrheitsbeschlüssen zu fügen.
Vorausgegangen war die Ermittlung des Parteigerichtes, das vier
Tage hindurch eine große Zahl von Zeugen geladen hatte. Das Parteigericht
kam zu dem Urteil, dass Stöber „nicht nur durch einzelne
Handlungen, sondern auch durch bestimmte Grundtendenzen seines
allgemeinen Verhaltens
eine systematische Untergrabung
der Einheit
des Verbandes betrieben
habe“. Für die Anschuldigung,
dass er Klub- und
Verbandsbeschlüsse zur
Zeit der Verhandlungen
zwischen ÖVP und VdU
den Sozialisten übermittelt
habe, konnte kein
überzeugender Beweis erbracht
werden.
Anton Reinthaller:
Er lehnte es ab,
sich offen für den
VdU zu deklarieren
Stüber trat nun selbst
aus der Partei aus und
verzichtete auf eine Überprüfung
des Verfahrens.
Im Parlament nahm er
als „Wilder“ einige Bänke
hinter seinen ehemaligen
Kollegen Platz.
Auch in der Programmatik
des VdU zeigte sich
in diesen Tagen eine stärkere
Betonung der nationalen
Auffassungen. Bei
der am 15.–16. Mai 1954
abgehaltenen Bundesverbandstagung
in Bad Aussee
beschloss der VdU
ein neues Programm,
das Ausseer-Programm,
das klar in diese Richtung
weist. Der obenerwähnte
Bundesverbandstag
beschloss außerdem,
Verbindung mit Anton
Reinthaller aufzunehmen.
Anton Reinthaller war ein
prominenter Nationalsozialist
gewesen und hatte
1938 in dem kurzlebigen
131
An der blauen Donau
Wahlplakat
VdU: 1953
Kabinett von Seyß-Inquart den Posten eines Landwirtschaftsministers
bekleidet. Nach dem Krieg war er sieben Jahre lang in Haft, wurde später
aber wegen seiner persönlich einwandfreien Haltung amnestiert.
Manche mit dem VdU Unzufriedene scharten sich jetzt um ihn.
Eine große Zäsur in der Geschichte des
VdU stellte der 17. Oktober 1954 dar, der als
„Schwarzer Oktober“ in die Parteigeschichte
einging. An diesem Tag wurden in Wien,
Niederösterreich, Salzburg und Vorarlberg
Landtagswahlen geschlagen, die alle mit erheblichen
Verlusten des VdU endeten. In
Wien flog der VdU sogar aus dem Gemeinderat
bzw. Landtag. Auch die Arbeiterkammerwahlen,
die 1949 noch so hervorragend
für den VdU ausgegangen waren, brachten
1954 eine Katastrophe. Der Mandatsstand
sank von 117 auf 19. Während man mit
Reinthaller und seinem Kreis verhandelte,
hatte dieser am 19. März 1955 die
Freiheitspartei gegründet. Eingedenk
der großen Verluste von 1954 wollte
man von Seiten des VdU ein getrenntes
Antreten bei der oberösterreichischen
Landtagswahl am 23. Oktober 1955
verhindern. Durch Verhandlungen kam
eine Wahlgemeinschaft zwischen VdU
und Freiheitspartei zustande, der sich
auch andere national-freiheitliche Verbindungen
und Vorfeldorganisationen
anschlossen. Die Wahlen endeten
dennoch enttäuschend: Von 10 Mandaten
blieben nur vier übrig, die zwei
Sitze in der Landesregierung gingen
verloren.
◆
132
1947–1956
„Mit Pawkowicz hätte es kein Knittelfeld gegeben“
Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt im Gespräch über die Bedeutung
des Dritten Lagers im 19. und 20. Jahrhundert,
und die Zukunftsaussichten der FPÖ in Wien.
Wie hat sich das nationalliberale Lager in Wien in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt?
Lothar Höbelt: Das lässt sich schematisch
recht einfach charakterisieren: In den
böhmischen Ländern gab es die Tschechen als
nationalen Gegner, in den Alpenländern die
„Klerikalen“, den politischen Katholizismus. Beide
spielten in Wien und Umgebung keine oder
zumindest kaum eine Rolle. Das Resultat war:
Ohne äußeren Gegner wurde auf Teufel komm
raus untereinander gestritten. In der Großstadt
waren natürlich auch die sozialen Gegensätze am
ausgeprägtesten, zwischen dem noblen 1. Bezirk
als Heimstatt der Eliten und den sogenannten
„Vorstadtdemokraten“, dazu kam dann ab den
achtziger Jahren der Streit um den Antisemitismus.
Lueger hatte ja ursprünglich als Liberaler
am linken Flügel begonnen und dann erst mit
Schönerer und den „Klerikalen“ ein Bündnis
geschlossen. Die Nationalliberalen „in der Provinz“
haben dieses Theater in Wien großteils mit
Unverständnis und Entsetzen betrachtet.
Wo sehen Sie die Höhepunkte in dieser Zeit?
Höbelt: Der Höhepunkt – oder vielleicht
besser: der Tiefpunkt –
war um die Jahrhundertwende
die Polarisierung
zwischen den Resten der
sogenannten „Judenliberalen“
und Luegers
„Wurstkesselpartei“, wie
man „Populisten“ ohne
klares Programm damals
genannt hat. Als dann
das allgemeine und gleiche
Wahlrecht eingeführt
wurde, hatten weder die
Deutsche Fortschrittspartei
noch die Deutsche
Volkspartei – die beiden
Gruppierungen, die anderswo
das Lager trugen
- in Wien irgendeinen
Abgeordneten durchgebracht.
1911 gab es dann
einen auffälligen, aber
sehr kontroversen Erfolg:
Nach Luegers Tod
witterten alle seine Gegner
ihre Chance. Das alte
österreichische Wahlrecht
sah ja, wie heute in Frankreich,
Stichwahlen zwischen
den beiden bestplazierten
Kandidaten vor.
Während es der Regierung
überall sonst gelang,
ein Bündnis der beiden bürgerlichen Blöcke zu
vermitteln, kam es in Wien bei den Stichwahlen
zu einem Bündnis zwischen den freiheitlichen
Gruppen, von „Judenliberalen“ bis zu den Schönerianern,
mit den Sozialdemokraten. Im Tagebuch
Arthur Schnitzlers kann man nachlesen,
dass er damals für einen radikalen Antisemiten
stimmte – nur um Luegers Leuten eins auszuwischen.
133
An der blauen Donau
134
Wie ist denn die Bedeutung des dritten Lagers in der
Bundeshauptstadt, damals schon „roten Wien“, in der
Ersten Republik einzuschätzen?
Höbelt: In der Ersten Republik spielte
Wien in der Großdeutschen Volkspartei dann
auf einmal eine überraschend große Rolle. Es
gab da eine kleine, aber sehr aktive Gruppe, die
Nationaldemokraten, die sich in Wien durchsetzte
und auch die ersten beiden Obmänner
auf Bundesebene (Kandl und Wotawa) stellte.
Die Großdeutschen waren ja die Beamtenpartei
par excellence – das war nirgends so ausgeprägt
wie gerade in Wien. Den größten Erfolg erzielte
„
Man soll nie etwas vorhersagen,
schon gar nicht
die Zukunft. Wien (Anm.: die
FPÖ) hat seit dem Jahrzehnt
zwischen 1986 und 1996 ein
rasantes Überholmanöver vorexerziert.
das Lager dann 1930 mit dem „Schoberblock“.
Johannes Schober war quasi ein Quereinsteiger,
aber ein Sängerschafter, der immer schon gerne
die Großdeutschen „umkrempeln“ wollte. Seipel
nannte ihn einmal ironisch den „Unabhängigen
mit der Kornblume“. Als Polizeipräsident von
Wien, den noch der Kaiser ernannt hatte, galt er
als Garant von Recht und Ordnung und war in
heiklen Situationen auch zweimal Bundeskanzler.
Für seinen „nationalen Wirtschaftsblock“ hat
er damals auch diverse kleinere Gruppierungen
zum Mitmachen bewegt – und eine Unzahl von
Prominenten, die für ihn unterschrieben haben.
Am Land hat das weniger gewirkt, aber in Wien
sehr.
Wie haben sich denn die Wiener Freiheitlichen, beziehungsweise
das Lager nach dem 2. Weltkrieg entwickelt?
Höbelt: In der Zweiten Republik ist Wien
lagerintern wieder an die Peripherie gerückt: Stocker
und Alt-Vizekanzler Hartleb wollte ihren
Heimatbund von Graz aus aufbauen; der VdU
wurde in Salzburg gegründet, die FPÖ eigentlich
in Oberösterreich; mitgliederstärkste Landesgruppe
waren lange Zeit die Kärntner. Wien war
mitten in der Russenzone und blieb auch danach
eigentlich ein Außenposten. Friedrich Peter wurde
1958 zum Obmann gewählt, aber er ging erst
1966 ins Parlament und ist erst in den siebziger
Jahren nach Wien übersiedelt.
Wien hatte zwei „Kapazunder“ als parlamentarische
Aushängeschilder, zwei Freiherren
mit einem beeindruckenden intellektuellen Profil,
Willfried Gredler und Tassilo Broesigke,
aber die Parteiorganisation war sehr schmal und
galt als ein wenig verschroben. Peter kritisierte
einmal, ihre Veranstaltungen seien „nationale
Weihestunden“, aber sie hätten mit Politik wenig
zu tun. Weil die Bezirksgruppen so klein waren,
und weil man in der Stadt leicht von einem
Bezirk in den anderen wechseln konnte,
gelang es den Jungen um Norbert Steger
in den siebziger Jahren dann auch relativ
leicht, die Organisation zu „kapern“.
Steger war dann Teil des Dreiecks Götz
– Steger – Haider, das auf Bundesebene
um die Nachfolge Peters rang, aber für
Wien war wichtig, daß Erwin Hirnschall
und Rainer Pawkowicz einen sehr ausgleichenden
Kurs verfolgt haben, während im
Bund die Fetzen flogen. Pawkowicz war
dann auch in der Ära Haider so ziemlich
der einzige Landesobmann, der sich nichts
dreinreden ließ. „Was-wäre-wenn“-Fragen
sind nie schlüssig zu beantworten, aber ich
bin mir ziemlich sicher, wenn Pawkowicz
2002 noch gelebt hätte, wäre es nicht zu
einem „Knittelfeld“ gekommen.
Wo sehen Sie, in die Zukunft gedacht, die Chancen
für dieses nationalliberale Lager in den nächsten Jahren?
Höbelt: Man soll nie etwas vorhersagen,
schon gar nicht die Zukunft. Wien hat seit dem
Jahrzehnt zwischen 1986 und 1996 ein rasantes
Überholmanöver vorexerziert, zur Landesgruppe
mit dem größten Stimmenanteil, der aber starken
Schwankungen unterworfen ist – bei Nationalratswahlen
hat sich dieses Potenzial nie so recht
ausschöpfen lassen. In Wien gibt es in punkto
Zuwanderung den stärksten Problemdruck; mit
Grünen, Pilz, Wien ANDAS usw. auch die rabiatesten
politischen Gegner – und vor allem auch
den Konkurrenten, der nirgendwo so gefährlich
ist, nämlich die Nichtwähler. Das ist auch die Gefahr
bei Spaltungen: Nicht das „Getrennt marschieren“
an sich, das kann, wenn man Glück hat
– wie z.B. 2013 im Bund – auch dazu führen, daß
beide zusammen mehr Stimmen erringen als einer
allein; aber viel wahrscheinlicher ist der Fall,
daß viele sich angewidert abwenden, wenn da nur
interne Schmutzwäsche gewaschen wird, und am
Wahltag daheimbleiben. Aber all das kann sich
schnell ändern: Die Wähler haben dem „Dritten
Lager“ Knittelfeld erstaunlich schnell verziehen,
warum nicht auch Ibiza, wofür die Partei eigentlich
noch viel weniger was dafür konnte.
◆
1947–1956
135
136
An der blauen Donau
1918–1938
1918–1938
DAS DRITTE LAGER IM WIEN
DER ERSTEN REPUBLIK
VOM „ROTEN WIEN“ ZUM ANSCHLUSS
137
An der blauen Donau
Vom sozialistischen Wien, über den Ständestaat
hin zum Nationalsozialismus
Nationalliberale
im roten Wien
Nach der liberalen Periode in der Wiener Kommunalpolitik, die von
den 1860er Jahren bis zur Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts
andauerte, kam die christlichsoziale Ära in der Stadtpolitik, die von
Karl Lueger dominiert wurde. Diese dauerte über den Ersten Weltkrieg
hinaus bis zu den ersten Gemeinderatswahlen in der Ersten
Republik, die am 4. Mai 1919 durchgeführt wurden. Dabei galt
erstmals auf kommunaler Ebene das allgemeine Wahlrecht
für Wiener Frauen und Männer, wobei die Wahlen nach dem
Verhältniswahlrecht durchgeführt wurden.
Bis zum Ende der Monarchie waren die Landtage und
die Gemeinderäte noch nach dem Kurienwahlrecht gewählt
worden, obwohl schon seit 1907 das allgemeine und gleiche
Wahlrecht für Männer existierte. Dies kam allerdings nur bei
den Reichsratswahlen zum Zuge und zwar für die cislaithanische
Reichshälfte der Habsburger Monarchie.
Zwar waren bereits die Wahlen zur konstituierenden
Nationalversammlung Deutsch-Österreichs am 16. Februar
1919 nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht für
Männer und Frauen durchgeführt worden, für die Bundes-
Das Wiener
Rathaus um die
letzte Jahrhundertwende:
1923 wurde
es rot gefärbt
138
1918–1938
hauptstadt war es aber eine Premiere, dass alle Wienerin und Wiener, die
das 20. Lebensjahr erreicht hatten und über einen ordentlichen Wohnsitz
in der Stadt verfügten, wahlberechtigt waren.
Die Wiener
Wahlergebnisse
Bei diesem ersten Wiener Wahlgang in der
Ersten Republik erreichte die Sozialdemokratische
Deutsche Arbeiterpartei mit 54,2 Prozent
100 von 165 Mandaten und damit die
absolute Mehrheit. Die christlichsoziale Partei
belegte den zweiten Platz mit 27 Prozent,
wodurch sie 50 Mandate erhielt. Anders als im
Gesamtstaat, wo die nationalliberalen Parteien
den dritten Platz belegten und seitdem eben
als „Dritte Kraft“ fungierten, nahmen in Wien
die „Partei der Sozialistischen und Demokratischen
Tschechoslowaken“ mit 8,4 Prozent
und acht Mandaten diesen Rang ein.
„
Zwei deutschfrei -
heitliche Parteien, nämlich
eine „Nationaldemokratische
Partei“ und
eine „Deutschnationale
Partei“ kamen auf 5,4
Prozent.
Zwei deutschfreiheitliche Parteien, nämlich eine „Nationaldemokratische
Partei“ und eine „Deutschnationale Partei“ kamen auf 5,4
Prozent dahinter und hatten damit nur zwei Mandate im Wiener Gemeinderat.
Sie stellten also keinen nennenswerten Faktor in der Wiener
Kommunalpolitik dar und hatten damit auch keinen Sitz im 30-köpfigen
Stadtrat der als Exekutivausschuss fungierte.
Unmittelbar nach diesen Gemeinderatswahlen wählte dieser
Exekutivausschuss einen Stadtsenat, der aus zehn amtsführenden
und drei nicht amtsführenden Stadträten bestand, den wiederum
der erste sozialdemokratische Bürgermeister Jakob Reumann
139
An der blauen Donau
führte. Dieser Stadtsenat fungierte dann ab 10. November des Jahres
1920, als Wien durch die neue Bundesverfassung zum Bundesland erklärt
worden war, auch als Wiener Landesregierung.
Der Stadtsenat, der eben ab 10. November 1920 auch Wiener Landesregierung
war, setzte sich aus den sozialdemokratischen Mitgliedern
als amtierende Stadträte zusammen, an ihrer Spitze Bürgermeister und
Landeshauptmann Jakob Reumann. Weitere sozialdemokratische Mitglieder
der Stadtregierung waren Georg Emmerling, Hugo Breitner,
Quirin Kokrda, Karl Richter, Franz Siegel, Paul Speißer, Julius Tandler
und Julius Grünwald.
„
Der Stadtsenat,
der eben ab 10. November
1920 auch Wiener
Landesregierung war,
setzte sich aus den sozialdemokratischen
Mitgliedern
als amtierende
Stadträte zusammen.
Die christlichsozialen Mitglieder des Stadtsenats
bzw. der Landesregierung waren bereits
damals Stadträte ohne Ressort, also nicht amtsführende
Stadträte, nach dem gleichen System,
das bis zum heutigen Tag gilt. Es waren dies der
Vizebürgermeister und Landeshauptmannstellvertreter
Franz Hoß und die Stadträte Viktor
Kienböck, Alma Mozdzko und Karl Rummelhardt.
Bei den Wiener Gemeinderatswahlen von
1923 wurden die Sozialdemokraten bestätigt,
wobei nunmehr Karl Seitz Bürgermeister wurde.
Weitgehend blieben die sozialdemokratischen
Stadträte in Funktion. Zu ihnen stieß
Julius Tandler für das Gesundheitswesen und
auf der Seite der Christlichsozialen Leopold
Kunschak als nicht amtsführender Stadtrat.
Auch die Gemeinderatswahlen von 1927 bestätigten die sozialdemokratische
Dominanz, wobei wieder Karl Seitz zum Bürgermeister
gewählt wurde und dies bis zum 24. Mai 1932 blieb. Nach den Gemeinderatswahlen
vom 24. Mai 1933 wurde erneut Karl Seitz zum Bürgermeister
gewählt und amtierte bis zum 12. Februar 1934. An diesem
Tag wurde er im Zuge des Februar-Putschs des sozialdemokratischen
Schutzbundes von der Polizei im Rathaus verhaftet. Der austrofaschistische
Ständestaat unter Engelbert Dollfuß schaffte die autonome Stadtverwaltung
ab, die dann erst wieder am Beginn der Zweiten Republik im
Frühjahr 1945 errichtet werden sollte.
Und die Nationalliberalen?
Im Dezember des Jahres 1897 hatte in Wien noch der „Deutsche
Volkstag“ stattgefunden und der Deutsche Nationalverband war bei den
Wahlen des Jahres 1911 mit 104 Abgeordneten in den cislaithanischen
Reichsrat eingezogen. Dieser Nationalverband zerfiel jedoch in zahlreiche
Splittergruppen, aus denen sich erst im August 1920 die Großdeutsche
Volkspartei bildete. Diese propagierte, neben ihren anderen nationalliberalen
Inhalten, primär den Anschluss an das Deutsche Reich.
Dieser wurde in Wien, wie überhaupt in der Ersten Republik, besonders
von den Sozialdemokraten in eben demselben Maße propa-
140
1918–1938
giert. Die Anschlussforderung wurde von den Sozialdemokraten erst
am Parteitag des Jahres 1933 aus ihrem Programm gestrichen. Demgemäß
war die Sozialdemokratie auch für viele deutschnational orientierte
Menschen in der Bundeshauptstadt wählbar. Die Großdeutsche
Volkspartei allerdings selbst bildete von 1920 weg, bis zur Errichtung
des Ständestaates in den 30er Jahren, in wechselnden Koalitionen Regierungen
gemeinsam mit dem Christlichsozialen. Damit wurde sie in dem
Antagonismus zwischen bürgerlich-christlichem Lager und dem sozialistisch-linken
Lager hineingezogen. Obwohl die Deutschnationalen
selbst keinerlei paramilitärische Formationen hatten, standen sie damit
in den bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die mit Ende der
20er Jahre einsetzten und bis zur Errichtung des austrofaschistischen
Ständestaates anhielten, auf der Seite des bürgerlichen Lagers.
Bei den Gemeinderatswahlen von 1919 erreichten die Deutschnationalen,
wie bereits geschildert, nur drei von 165 Mandaten. Bei den
Gemeinderatswahlen von 1923, als sie unter der Bezeichnung „Großdeutsche
Partei“ antraten, erhielten sie kein einziges Mandat. Bei den
Gemeinderatswahlen von 1927, als sie in Form einer Einheitsliste mit
den Christlichsozialen, einer mittelständischen Volkspartei und einer
nationalsozialistischen Fraktion kandierten, erhielten sie auch nur zwei
Ausrufung
der Republik
Deutsch-Österreich
141
An der blauen Donau
Machtergreifung
der NSDAP in
Deutschland am
30. Januar 1933
von 120 Mandaten. Und bei den Wahlen von 1932 erhielten sie kein einziges
Mandat. Damals dürfte der Großteil der nationalliberalen Wähler
bereits in das Lager der NSDAP abgewandert sein. Diese hatte 1932
erstmals in Wien kandidiert und 15 von 100 Mandaten errungen.
Dennoch spielte der deutschnationale Gedanke in der Wiener Kommunalpolitik
der Ersten Republik eine große Rolle. Bereits bei der Eröffnungssitzung
des neugewählten Gemeinderats im Mai 1919 kam es zu
einer entsprechenden Konfrontation, als die tschechischen Mandatare
vor der deutschen Gelöbnisformel nicht protokolliert tschechische Sätze
von sich gaben. Dies führte zu energischen Protesten des Vorsitzenden
des Gemeinderats und des rechten Flügels. Die tschechischen Mandatare
ihrerseits wiederum legten Podest dagegen ein, dass das Gelöbnis
das Versprechen enthielt, alles zu unterlassen, was den „deutschen Charakter
Wiens in Frage stellen könnte“. Diese Haltung, die natürlich von
den deutschfreiheitlichen Vertretern massiv eingefordert wurde, wurde
aber auch von den Sozialdemokraten während der gesamten Dauer des
„roten Wiens“ in der ersten Republik vertreten.
Das politische Erbe des alten Liberalismus, wie er unter dem liberalen
Bürgermeister Cajetan Felder vertreten war, hatte in der Bundeshauptstadt
der Ersten Republik kaum mehr politische Chancen. Bereits
im Jahre 1919 erhielt eine liberale „bürgerliche Arbeiterpartei“ gerade
142
1918–1938
noch 6,8 Prozent der in Wien abgegebenen
Stimmen und wählte nur
einen Vertreter in die Nationalversammlung.
Die Gemeinderatswahlen in
den Jahren, 1920 und 1923 brachten
für die liberalen – es kandidierte
wiederum diese „bürgerliche Arbeiterpartei“
– Stimmenanteile in
Wien zuerst nur mehr 4,4 Prozent
und schließlich noch mal 1,8 Prozent.
Im Jahre 1927 erhielt eine
„demokratische Liste“ gar nur mehr
1,3 Prozent der in Wien abgegebenen
Stimmen. Und bei den letzten
Parlamentswahlen in der Ersten
Republik am 9. November 1930 erhielt
in Wien eine „demokratische
Mittelpartei“ gar nur mehr 0,5 Prozent
der abgegebenen Stimmen.
Zu einer gewissen Belebung des
traditionellen Liberalismus kam es
am ehesten noch in Form des so
genannten „Schoberblocks“, der
zu Beginn der Dreißigerjahre kandidierte.
Er erhielt auch die Unterstützung
der „Wiener Neuen Freie
Presse“, die bekanntlich die Tageszeitung
des Wiener jüdischen liberalen
Bürgertums war (vgl.: Walter
B. Simon, Österreich 1919 bis 1938, Ideologien und Politik, Wien 1984,
S. 94 u. S. 102).
Der Anschlussgedanke in allen
politischen Lagern
So waren also die deutschnationalen und
liberalen Parteigruppierungen im Wien der Ersten
Republik auf der politischen Bühne des
Gemeinderats eher schwach vertreten. Das
nationalliberale Lager allerdings lebt in der
Bundeshauptstadt nicht so sehr in diesen politischen
Parteien als vielmehr im Vereins- und
Verbändewesen, wie es sich seit 1848 entwickelt
hatte. Zuallererst waren es die studentischen
Kooperationen, die Burschenschaften, Corps,
Landsmannschaften, Sängerschaften, die zwar
vorwiegend im akademischen Bereich tätig waren,
aber doch das politische Bewusstsein der
Menschen stark prägten. Auch die Einzelvereine
des Deutschen Turnerbunds, Sektionen
„
Das national
liberale Lager allerdings
lebt in der Bundeshauptstadt
nicht so sehr in diesen
politischen Parteien,
als vielmehr im Vereinsund
Verbändewesen.
143
An der blauen Donau
des Deutschen Alpenvereins und vor allem der Deutsche Schulverein
waren einflussreiche Faktoren, die über die politischen Parteien weit heraus
wirkten.
Eher elitäre Organisationen, wie der „Deutsche Club“ und andere
mehr oder minder diskrete Gesellschaften, trugen überdies zur
politischen Substanz dieses Lagers in der ehemaligen Kaiserstadt,
die nunmehr Bundeshauptstadt war, bei. Ihnen allen gemein war
ein striktes Eintreten für den Anschluss an das Deutsche Reich, was
als solches noch kein politisches Alleinstellungsmerkmal gewesen
wäre, bekanntlich traten ja auch die Sozialdemokraten dafür ein und
sogar die Christlichsozialen bis zu einem gewissen Grad. Rot und
Schwarz allerdings zumeist nur dann, wenn jeweils ihre Gesinnungsgenossen
in Berlin politisch am Ruder waren. Unmittelbar nach dem
Ersten Weltkrieg, als der Sozialdemokrat Ebert Reichspräsident war
und auch die Reichsregierung von den Sozialdemokraten dominiert
wurde, waren natürlich auch die österreichischen Sozialdemokraten
um Otto Bauer, Karl Renner und Karl Seitz überzeugte und leidenschaftliche
Vertreter des Anschlussgedankens. Als die Regierung in
Berlin dann in anderen Händen lag, schwand diese Anschlussbegeisterung.
Ähnlich verhält es sich bei den österreichischen Christlichsozialen,
die immer dann positiv gegenüber dem Anschlussgedanken
waren, wenn sich in Berlin eher bürgerliche Parteien an der
politischen Spitze befanden.
Im deutschfreiheitlichen
Lager war das grundsätzlich
anders, da man den Anschluss
gewissermaßen bedingungslos
befürwortete.
Dass sich dann ab Beginn der
Dreißigerjahre große Teile
des nationalliberalen Lagers
in Österreich dem Nationalsozialismus
zuwandten, dürfte
auch einen Grund in dieser
Tatsache haben. Man glaubte,
dass der Anschluss der Alpenrepublik
an das Deutsche
Reich am ehesten von den
Nationalsozialisten realisiert
werden könnte.
Dies kann natürlich in
heutiger Geschichtsbetrachtung
keinerlei Entschuldigung
für die Hinwendung des
traditionsreichen nationalliberalen
Lagers zur NSDAP
sein, es ist aber möglicherweise
ein Teil der Erklärung
dafür. Die Verwirklichung
der nationalen Einheit war
vielen Vertretern des historisch
gewachsenen national-
144
1918–1938
liberalen Lagers damals eben wichtiger als Demokratie und liberales
Gedankengut.
In der „Großdeutschen Volkspartei“, die ja eher das städtische Bürgertum,
im Besonderen auch breite Teile der Beamtenschaft vertrat und
somit auch in Wien politisch aktiv war, waren
die meisten bedeutenden Exponenten korporiert,
zumeist also Burschenschafter, Sängerschafter
oder Vereinsstudenten. So verhält es
sich auch mit Johannes Schober, der wohl prägendsten
Persönlichkeit des nationalliberalen
Lagers in der Zwischenkriegszeit. Als Wiener
Polizeipräsident, als Minister und auch als Bundeskanzler
stand Schober zwar über den Parteien,
verstand sich aber immer als Angehöriger
des nationalliberalen Lagers. Und auch wenn
dieses Lager beziehungsweise die „Großdeutsche
Volkspartei“ in der Wiener Gemeinepolitik
der Zwischenkriegszeit keine nennenswerte
Rolle spielte, waren Johannes Schober und seine
Gesinnungsgenossen, die von 1920 bis 1933
in wechselnden Koalitionen mit den Christlichsozialen
die Bundesregierung bildeten, überaus
einflussreich im Hinblick auf die politische
Entwicklung der Bundeshauptstadt.
Das „rote Wien“ allerdings verstand sich
ja durchgehend als politische Antithese zu den
Bürgerblock-Regierungen, welche von Christlichsozialen und Nationalliberalen
gebildet wurden. Und in diesem „roten Wien“ hatten auch Vertreter
der anderen bürgerlichen Parteien, also der christlichsozialen, keine
große politische Bedeutung. Wennsie auch die Funktionen von nicht
amtsführenden Stadträten innehatten, war ihr Einfluss auf die Wiener
Kommunalpolitik verschwindend gering. Dies sollte sich erst ändern, als
im Zuge der Errichtung des austrofaschistischen Ständestaates die Wiener
Gemeinde Autonomie von Engelbert Dollfuß aufgehoben wurde.
Dem NS-Irrweg erlegen
Die historische Gerechtigkeit verlangt es allerdings, auch darauf
hinzuweisen, dass gewisse Teile des traditionellen nationalliberalen Lagers
sich in den frühen dreißiger Jahren dem Nationalsozialismus auch
versagten. Insbesondere war es der schrankenlose Terror von Seiten der
österreichischen Nationalsozialisten, der bürgerlich orientierte Vertreter
des Dritten Lagers abschreckte. Ihnen ging es um die Bewahrung der
bürgerlichen Ordnung und auch um die Demokratie. Insbesondere der
Landbund, die zweite nationalliberale Partei der Zwischenkriegszeit, trat
vehement für Demokratie und die Erhaltung des Parlamentarismus ein -
vergebens allerdings. Worauf der Landbund aus der Regierung Dollfuß
austrat. Die Parteispitze der „Großdeutschen Volkspartei“ hatte zwar
im Mai 1933 mit den Nationalsozialisten ein „Kampfbündnis“ geschlossen,
einige Großdeutsche jedoch distanzierten sich von dem NS-Terrorismus
und versuchten, eine von den Nationalsozialisten unabhängige,
Gruppierung zu entwickeln. Dieser auf Dauer wenig erfolgreiche Ver-
„
Das „rote Wien“ allerdings
verstand sich ja
durchgehend als politische
Antithese zu den
Bürgerblock-Regierungen,
welche von Christlichsozialen
und Nationalliberalen
gebildet
wurden.
145
An der blauen Donau
„
Die Machtübernahme
durch den Nationalsozialismus
schien die
einzige realistische Möglichkeit,
den Anschlusswunsch
der Österreicher
an das Deutsche Reich zu
realisieren.
Mussolini 1922
such kam den führenden Exponenten dieser Gruppierung nach dem
Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich teuer zu stehen. Zwei
der Initiatoren, nämlich Prodinger und Mittermann,
büßten dafür im Konzentrationslager
mit ihrem Leben.
In der Bundeshauptstadt Wien allerdings
war es zweifellos so, dass sich ein großer Teil
des nationalliberalen Lagers und vor allem der
Vereine und Verbände dieses Lagers dem Nationalsozialismus
zuwandte. Insbesondere die
jüngere Generation des Dritten Lagers sah in
einer Machtübernahme durch den Nationalsozialismus
die einzige realistische Möglichkeit,
den Anschlusswunsch der Österreicher an das
Deutsche Reich zu realisieren.
Um den Weg Österreichs und damit auch
des historisch gewachsenen nationalliberalen
Lagers nach der Ausschaltung der parlamentarischen
Demokratie in den Jahren 1933/34 in
der Zeit des autoritären Ständestaats, über die
Ereignisse rund um den Anschluss des Landes
an Hitler-Deutschland, bis hin in die Katastrophe
des Zweiten Weltkriegs und bis zum Zusammenbruch des Großdeutschen
Reiches zu beleuchten, muss man wohl auch die gesamteuropäische
Situation ansprechen. Besonders die Abkehr breiter Teile dieses
nationalliberalen Lagers von der Demokratie und deren Hinwendung zu
totalitären Vorstellungen, wie sie der Nationalsozialismus
vertrat, ist ohne die Beleuchtung dieses
gesamteuropäischen Hintergrunds und auch ohne
die Betrachtung der ökonomischen Situation nicht
verständlich.
Antidemokratisches
Chaos quer durch Europa
Die Diktatfrieden von Versailles und Saint
Germain stellten für die Verlierer des Ersten Weltkrieges
eine schwere Erschütterung dar. Die als
Ergebnis dieser „Friedensschlüsse“ entstandenen
demokratischen Republiken wurden um das ihnen
feierlich zugesicherte Recht auf Selbstbestimmung
gebracht, Österreich zusätzlich unter ein
Anschlussverbot gestellt. Millionen Deutscher des
ehemaligen Deutschen Kaiserreiches und der K. u.
K.-Monarchie wurden fremden Staaten ohne jeden
Minderheitenschutz zugeschlagen und dort auch
bald zunehmender Unterdrückung ausgesetzt. Das
Deutsche Reich musste ungeheure Reparationsleistungen
erbringen; die kleine österreichische Republik
die Konkursmasse des 52 Millionen-Staates der
Habsburger einseitig übernehmen.
146
1918–1938
Der Entwaffnung der Besiegten folgte gegen alle Zusagen und trotz
dauernd tagender Abrüstungskonferenzen und trotz der Aufrüstung
der Sieger. Der Völkerbund erwies sich immer mehr als eine Einrichtung
zur Absicherung der Kriegsbeute der Alliierten.
Die Frage war naheliegend, ob die alten und neuen Demokratien,
welche angeblich ausgezogen waren, um den „österreichischen Völkerkerker“
aufzubrechen und den „preußischen Militarismus“ für alle
Zeiten niederzuwerfen, wirklich fähig und willens waren, eine neue, bessere
und friedliche Ordnung zu schaffen.
Für die damals lebende Kriegsgeneration
war sie mit einem klaren
Nein zu beantworten. Nach einem
kurzen Aufschwung, welcher sich
aus der Behebung der ungeheuren
Kriegszerstörungen ergab, folgte
1929 die Weltwirtschaftskrise.
Sieger und Besiegte wurden von
Geld entwertung und Massenarbeitslosigkeit
gewürgt. Die ersten
zehn Nachkriegsjahre waren in den
meisten europäischen Ländern eine
ununterbrochene Folge von Regierungskrisen,
blutigen und unblutigen
Putschversuchen und Staatsstreichen,
politischen Attentaten
und Aufmärschen der bewaffneten
Parteiverbände.
Lenin: Ein Bild
von 1930
Russland und seine zaristische
Regierung hatten mit dem von ihnen
angezettelten Thronfolgermord in
Sarajewo 1914 das Todesurteil der
eigenen Dynastie unterschrieben.
Seit der Oktoberrevolution 1917
herrschte dort die grausame und
blutige bolschewistische Diktatur.
Frankreich hat zwischen 1918
und 1933 nicht weniger als 33 Regierungen
verschlissen. Ein blutiger
Putschversuch am 6. Februar 1934
hatte 17 Tote und 2.000 Verwundete
gekostet. Es folgte bald das
Volksfrontbündnis zwischen Kommunisten,
Liberalen und Sozialisten.
Das französische Rezept, die
Deutschen müssten alles bezahlen,
hat zwar Deutschland an den Rand
des Abgrundes gebracht, Frankreich
aber nicht geheilt.
In Italien, dem Sieger aus zweiter
Hand, hatte der König nach
147
An der blauen Donau
dem völligen Versagen der demokratischen
Parteien 1921 Mussolini
die Macht übertragen. Den neuen
„Duce“ nannte Papst Pius XI. den
Mann, den die Vorsehung gesendet
habe.
Spanien war 1936 nach einer
kommunistisch-sozialistischen
Machtübernahme in den Bürgerkrieg
gestürzt, aus dem der
„Caudillo“ Franco als Sieger hervorgehen
sollte.
In Portugal herrschte das autoritäre
Salazar-Regime; de Valera
führte autoritär die neu entstandene
irische Republik. Kemal Atatürk
war der starke Mann, welcher die
Türkei aus dem Nachkriegschaos
führte.
Im Vielvölkerstaat Jugoslawien
hatte König Alexander 1929 die
Verfassung aufgehoben und bis zu
seiner Ermordung 1934 mit Hilfe
des Militärs regiert. In Polen versuchte
General Pilsudski, das innenund
außenpolitische Durcheinander
1926 durch eine Militärdiktatur zu
beenden.
Die Massenarbeitslosigkeit
trieb die Menschen
zur NSDAP
England hatte seine gemischte
Verfassung über den Ersten Weltkrieg
zwar hinweggerettet, wurde
aber mit den Folgen seines „Sieges
von 1918“ nicht fertig. 1931/32 betrug
die Arbeitslosigkeit in England
21 Prozent. Trotz der Zuflüsse aus
seinem gewaltigen und auf Kosten
des Deutschen Reiches noch vergrößerten
Kolonialbesitz und der in
den 30er-Jahren einsetzenden Aufrüstung
waren auch 1939 noch 12
Prozent der Menschen ohne Arbeit.
England war allerdings im Gegensatz
zu den meisten Festlandstaaten mit den Herausforderungen der
kommunistischen Weltrevolution nicht unmittelbar konfrontiert.
In Österreich herrschte in den entscheidenden 30er-Jahren eine
heute nicht mehr vorstellbare wirtschaftliche und soziale Not, derer die
sich feindselig bekämpfenden Parteien nicht Herr zu werden vermochten.
So haben zunehmend alle nach neuen Wegen Ausschau gehalten
und mit autoritären Modellen geliebäugelt; als letzte vielleicht die Sozialdemokraten.
Die tiefgehenden Zweifel an der Lebensfähigkeit Öster-
148
1918–1938
reichs überhaupt und an der demokratischen „Problemlösungskapazität“
schien nur noch die Wahl zwischen einer austrofaschistischen oder
austromarxistischen Lösung zuzulassen.
Der nationale Notstand, Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit
und Massenelend waren mit den Mitteln der Parteiendemokratie kaum
mehr behebbar. Musste man nicht grundlegend andere und neue Wege
beschreiten? Waren die parlamentarisch verfassten Länder überhaupt
noch regierbar? Mit fragwürdigen Ermächtigungsgesetzen, Notverordnungen
und präsidialen Sondervollmachten versuchte man weit über
das damalige Deutschland und Österreich hinaus, die Dinge wieder in
den Griff zu bekommen.
Diese historischen Tatsachen erklären vielleicht auch die damalige
Bereitschaft aller politischen Lager in Österreich,
die Demokratie beiseite zu schieben und
mehr oder weniger autoritäre politische Konzepte
anzustreben.
Das Massenelend in
der Zwischenkriegszeit
Zu Beginn der Ersten Republik waren es
die unmittelbaren Folgen des Ersten Weltkriegs,
dann die Inflation, und kaum hatte sich
um die Mitte der 20er-Jahre so etwas wie eine
leichte Stabilisierung der ökonomischen Lage
quer durch Europa, insbesondere auch in Österreich,
angebahnt, brach die Weltwirtschaftskrise auch über die kleine
Alpenrepublik herein. Wer den politisch Verantwortlichen der Ersten
Republik vorwirft, sie hätten nicht an die Fähigkeit Österreichs, selbstständig
zu überleben, geglaubt, übersieht, dass dieses mangelnde Vertrauen
in die Lebensfähigkeit Österreichs aus einer heute kaum noch
vorstellbaren, wirtschaftlichen und sozialen Not gespeist wurde. Allein
trockene Zahlen können kaum eine Vorstellung von der damaligen Lage
und den Massenelend wiedergeben.
Die Schweizer Wirtschaft war zwischen 1913 und 1938 um 57,5
Prozent, die reichsdeutsche, trotz Krieges und ungeheurer Kriegsschuldzahlungen
an die Siegermächte immerhin noch um 35 Prozent
gewachsen. Die österreichische war in der gleichen Zeit um 10 Prozent
geschrumpft und lag damit schlechter als vor dem Ersten Weltkrieg.
Österreich, und hier vor allem Wien, war das europäische Land mit einer
der niedrigsten Geburten- und der höchsten Selbstmordziffern. Das
Bauernsterben und die Verschuldung der Landwirtschaft hatten ein unvorstellbares
Ausmaß erreicht.
Im Jänner 1937 gab es 401.000 Arbeitslose; dazu kamen noch mehr
als 200.000 so genannte „Ausgesteuerte“. Das waren Menschen, die weder
von den Arbeitsämtern erfasst noch eine öffentliche Unterstützung
bezogen haben. Hungern oder Betteln, meist beides, war ihr Los. Die
Zahl jener, die im März 1938 fünf und mehr Jahre arbeitslos waren, ging
in die Hunderttausende. Die Alterspension der Arbeiter gab es noch nicht.
„
Allein trockene Zahlen
können kaum eine
Vorstellung von der
damaligen Lage und
den Massen elend
wiedergeben.
149
An der blauen Donau
Nur wer diese wirtschaftlich katastrophale Lage kennt, kann verstehen,
warum viele Österreicher in der zweiten Hälfte der 30er-Jahre – und
zwar solche aus allen politischen Lagern – mit einer gewissen Hoffnung
auf das benachbarte Deutsche Reich blickten, in dem die Arbeitslosigkeit
eliminiert wurde und der Wirtschaftsaufschwung offensichtlich war.
Dass dieser einem auf einen Krieg hinzielenden Programm der Aufrüstung
zu verdanken war, konnten die Österreicher natürlich damals
nicht wissen.
„
Zu Ostern traf sich
Dollfuß mit dem italienischen
„Duce“ Benito
Mussolini, worauf die
Österreicher den Weg
in den Faschismus beschleunigten.
Der Weg zum Anschluss
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß indessen
betrieb nach der Ausschaltung des Parlaments
den Staatsstreich auf Raten. Zuerst wurde
der Verfassungsgerichtshof lahmgelegt, dann
die Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt,
im Frühjahr 1933 wurden die kommunistische
Partei, der sozialdemokratische
Schutzbund und die NSDAP verboten. In der
Folge kam es, gewissermaßen als Reaktion des
Deutschen Reiches, zur 1.000-Mark-Sperre, wonach
nach Österreich reisende Deutsche 1.000
Mark zu zahlen gehabt hätten. Dies war der Beginn
eines Wirtschaftskriegs zwischen dem nationalsozialistischen
Deutschland und der von
Dollfuß regierten Alpenrepublik.
Zu Ostern traf sich Dollfuß mit
dem italienischen „Duce“ Benito
Mussolini, worauf die Österreicher
den Weg in den Faschismus
beschleunigten. Versuche der Sozialdemokratie
im Herbst 1933, noch
eine Einigung der Partei zustande
zu bringen und Gesprächsbereitschaft
in Richtung Dollfuß zu signalisieren,
scheiterten. Und die
Bundesregierung agierte weiter mittels
des kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes,
dessen Kontrolle
durch den Nationalrat und
den Verfassungsgerichtshof ausgeschaltet
war.
Nachdem am 12. Februar
1934 der Linzer Schutzbundführer
Richard Bernaschek die Kampfhandlungen
eröffnet hatte, da er
sich gegen eine erneute Waffensuche
der Polizei zur Wehr setzte,
kam es in Oberösterreich, Wien und
in der Steiermark zu Kampfhandlungen,
die in der Tat soetwas wie
einen Bürgerkrieg darstellten. Nach
150
1918–1938
der Niederschlagung des Aufstands, der nach
jüngsten Forschungen längst nicht so viele Opfer
zeitigte, wie es ursprünglich geheißen hatte,
wurde die Sozialdemokratie verboten und der
Weg für die Regierung zu einem faschistisch
orientierten Staatsumbau war offen.
Die Versuche der indessen längst schwer
desorganisierten nationalliberalen Parteien,
den österreichischen Parlamentarismus zu retten,
waren zum Scheitern verurteilt. Am 1. Mai
1934 trat die neue Verfassung des klerikalen
Ständestaats in Kraft, in der das Recht nicht
mehr vom Volke, sondern von Gott ausgehen
sollte. Anstelle der verbotenen und aufgelösten
Parteien wurde nun die regierungsnahe „Vaterländische
Front“ errichtet, die der bereits emigrierte
Sozialdemokrat Otto Bauer als „Spottgeburt
ohne Feuer und Eis“ bezeichnete.
„
Die jüngeren
Generationen des national-freiheitlichen
Lagers
wandten sich von den offenbar
gescheiterten nationalliberalen
Parteien,
von der Großdeutschen
Volkspartei und vom
Landbund, ab.
Die Jüngeren der Sozialdemokratie wanderten damals zunehmend
in Richtung der Kommunisten ab, und die jüngeren Generationen des
national-freiheitlichen Lagers wandten sich von den offenbar gescheiterten
nationalliberalen Parteien, von der Großdeutschen Volkspartei
und vom Landbund, ab, um ihr Heil in der indessen verbotenen illegalen
NSDAP zu suchen. Schätzungen der Historiker zufolge wandte sich
rund ein Drittel des nationalliberalen Lagers den Nationalsozialisten zu,
Kundgebung der
Heimatfront auf der
Schmelz in Wien
(8. Oktober 1936)
151
An der blauen Donau
ein weiteres Drittel verweigerte sich und ein anderes ging in die innere
Emigration. Die zunehmenden Erfolge des NS-Regimes in Deutschland
zogen jedoch bis zum Anschluss 1938 zweifellos einen weit größeren
Anteil des alten Dritten Lagers in ihren Bann.
Im Juli 1934 kam es schließlich zum Putschversuch der illegalen
NSDAP, wobei man den ehemaligen steirischen Landeshauptmann Anton
Rintelen zum Bundeskanzler machen wollte. Beim Eindringen der
Putschisten in das Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz wurde
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß erschossen. Nach der Niederschlagung
des Aufstandes wurden die Dollfuß-Mörder vor ein Standgericht
gestellt und hingerichtet. Dollfuß wurde indessen vom Regime unter
seinem Nachfolger Kurt von Schuschnigg zum österreichischen Märtyrer
hochstilisiert, wobei seine Rolle in Österreich zwischen den politischen
Lagern bis zum heutigen Tag umstritten blieb.
Hitler am
Heldenplatz
Das autoritäre Regime reagierte auf die beiden Putschversuche des
Jahres 1934 mit verstärkten Unterdrückungsmaßnahmen. Anhaltelager
wie im niederösterreichischen Wöllersdorf und in Messendorf in der
Nähe von Graz wurden eingerichtet. Dort trafen sich dann häufig Angehörige
der illegalen NSDAP mit jenen der verbotenen Sozialdemokratie.
152
1918–1938
Es ist bis heute ein wenig beleuchtetes Kapitel der jüngeren österreichischen
Geschichte, dass es in den Anhaltelagern des Ständestaates auch
so etwas wie eine Annäherung zwischen Nationalsozialisten und Sozialdemokraten
gegeben hat. Ein Phänomen,
das angeblich dazu führte, dass Bruno Kreisky
nach dem Anschluss im Jahre 1938 unbeschadet
nach Schweden ausreisen konnte. Ein Phänomen
auch, das dazu führte, dass der nach
Deutschland geflohene Schutzbundführer
Richard Bernaschek sich dort angeblich den
Nationalsozialisten annäherte, was allerdings
nicht verhindern konnte, dass er gegen Kriegsende
im Jahre 1945 in einem NS-Konzentrationslager
ums Leben gebracht wurde.
Die Regierung von Kurt Schuschnigg musste
sich in der Folge auch gegen die Heimwehren
unter Ernst Rüdiger von Starhemberg durchsetzen.
Diese wurden im Jahr 1936 endgültig
ausgeschaltet. Gegenüber Deutschland konnte
sich Österreich, das sich unter Schuschnigg
zum „besseren
deutschen Staat“ erklärte, nur
mittels der Unterstützung Mussolinis
halten. Nachdem die Italiener
aber in imperialem Größenwahn im
Herbst 1935 Abessinien zu besetzen
versuchten und deswegen international
geächtet wurden, musste
sich der italienische Faschistenführer
zwangsläufig an Hitler-Deutschland
annähern.
Demgemäß wurde Schuschnigg
von Italien und auch angeblich von
österreichischen Wirtschaftskreisen,
die an der deutschen Aufrüstung
mitverdienen wollten, unter
Druck gesetzt, was im Juli 1936
zu einem Abkommen mit Hitler
führte. Darin wurde zwar die Unabhängigkeit
Österreichs festgehalten,
in einem geheimen Zusatzabkommen
sollte die Wiener Regierung
allerdings die weitgehende Bewegungsfreiheit
der illegalen NSDAP
akzeptieren und einen Vertrauensmann
derselben in die Regierung
nehmen. Dadurch verlor Österreich
endgültig die Unterstützung der
westlichen Großmächte, allzumal
es sich auch im Völkerbund gegen
eine Verurteilung Italiens wegen des
Abessinienkrieges ausgesprochen
hatte. Somit wurde der deutsch-ös-
„
Gegenüber Deutschland
konnte sich Österreich,
das sich unter Schuschnigg
zum „besseren deutschen
Staat“ erklärte,
nur mittels der Unterstützung
Mussolinis halten.
153
An der blauen Donau
„
Tatsächlich mussten
viele Österreicher im
März 1938 den Eindruck
haben, dass sie nur die
eine Diktatur gegen eine
andere eintauschen
würden.
terreichische Konflikt tatsächlich zu so etwas wie einer innerdeutschen
Angelegenheit.
Insgesamt waren die Versuche Schuschniggs, zuerst sozialdemokratische
Anhänger durch eine Politik sozialer Signale für die „Vaterländische
Front“ zu gewinnen, aber auch seine Versuche, die nationale
Opposition einzubinden, zum Scheitern verurteilt. Überdies blieb seiner
bürokratischen und autoritären Staatsführung
ein Erfolg seiner wirtschaftspolitischen Maßnahmen
verwehrt. In Berlin hingegen plante
Göring als Beauftragter des Vierjahresplans der
deutschen Rüstungswirtschaft bereits zu diesem
Zeitpunkt die Einbeziehung der österreichischen
Ressourcen als feste Größe ein. Und der deutsche
Gesandte in Wien, Franz von Papen, der
Hitler im Jänner 1933 zur Kanzlerschaft verholfen
hatte, spielte auch in Österreich die Rolle des
Steigbügelhalters für die NS-Machtergreifung.
Nur eine Diktatur gegen
eine andere getauscht?
Das sukzessive Nachgeben der Regierung
Schuschnigg gegenüber dem Druck aus Deutschland
und dem Drängen der illegalen Nationalsozialisten in Österreich
selbst wurde von breiten Kreisen der politischen Öffentlichkeit, insbesondere
von der exilierten Führung der Sozialdemokratie, so verstanden,
als wäre der Austrofaschismus der Wegbereiter des Anschlusses
an Hitler-Deutschland. Tatsächlich mussten viele Österreicher im März
1938 den Eindruck haben, dass sie nur die eine Diktatur gegen eine
andere eintauschen würden. Dass der autoritäre Regierungsstil im klerikalen
Ständestaat mit dem NS-Totalitarismus in keiner Weise vergleichbar
sein sollte, konnten damals die wenigsten Zeitgenossen erkennen.
Insgesamt muss gesagt werden, das die Idee des Zusammenschlusses
aller deutschsprachigen Gebiete und damit auch jener der ehemaligen
Habsburger Monarchie in einem großen Deutschen Reich eine lange,
tief in die Geschichte zurückreichende und keineswegs immer antidemokratische
oder imperialistische Tradition hat. Aktualisiert wurde diese
Idee in der Folge des sich im Herbst 1918 abzeichnenden militärischen
Zusammenbruchs der Habsburger Monarchie und der anschließenden
Auflösung durch neue Staatsbildungen im östlichen Mitteleuropa.
Nachdem die Tschechen und die Südslawen eine Zusammenarbeit mit
den Deutschen in einer neuen Staatenkonföderation ablehnten, musste
die zwangsläufig ins Leben gerufene Republik Deutsch-Österreich zur
Sicherung ihrer Lebensfähigkeit eine andere Anbindung suchen. Der
am heftigsten von den Sozialdemokraten in den ersten Nachkriegstagen
geäußerte Wunsch eines Anschlusses an Deutschland zur Bildung einer
gesamtdeutschen Republik wurde in der Folge von den Christlichsozialen
und auch von den Deutschnationalen befürwortet. Dieses Staatsziel
wurde demnach auch am 12. November 1918 aus Anlass der feierlichen
Proklamation der Republik von der Parlamentsrampe ganz offiziell verkündet.
154
1918–1938
Bekanntlich war ein Staatsvertrag über den Beitritt von Deutsch-Österreich
zum Deutschen Reich vorbereitet und der Abschluss dieses
Staatsvertrags wurde nur durch den Diktatfrieden von Versailles und
St. Germain von den Siegermächten verhindert. Unter Androhung wirtschaftlicher
Sanktionen und militärischer Intervention gelang es auch,
alle weiteren Versuche zur Anbahnung eines Zusammenschlusses im
Wege des Völkerbundes erfolgreich zu unterbinden. Jener historisch realisierte
Anschluss, der am 13. März 1938 erfolgte, erfolgte allerdings
durch Gewalt.
In der Folge rückten nicht wenige Angehörige dieses Dritten Lagers
in führende Positionen des NS-Regimes auf, und es ist kein Zufall,
dass einer der nach dem Krieg in Nürnberg zum Tode verurteilten
Hauptkriegsverbrecher der Chef des Reichssicherheitshauptamtes und
Himmler-Stellvertreter Ernst Kaltenbrunner war, der aus Linz stammte
und während des Studiums Mitglied einer Grazer Burschenschaft geworden
war.
Genauso aber muss man darauf hinweisen, dass etwa Robert Bernardis,
der von Historikern „Österreichs Stauffenberg“ genannt wurde
und wegen der Beteiligung am Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 der einzige
aus Österreich stammende Hingerichtete unter den Widerstandskämpfern
war, aus dem nationalfreiheitlichen Lager stammte. Auch er
stammte aus Linz und war als junger Mann Mitglied einer fachstudentischen
Burschenschaft in Mödling.
◆
Robert Bernadis
war im Widerstand
gegen den Nationalsozialismus
155
156
An der blauen Donau
1859–1918
1859–1918
DIE NATIONALLIBERALEN
IN DER KAISERSTADT
VON KAJETAN FELDER
ZU KARL LUEGER
157
An der blauen Donau
Die liberalen Bürgermeister
Wien auf dem
Weg zur Weltstadt
Die Revolution von 1848 mit ihrem Streben nach Freiheit, Bürgerrechten
und Verfassung und ihrem Kampf um die deutsche Einheit
war gescheitert. In Österreich herrschte der junge Kaiser Franz
Josef wieder absolutistisch, und auch in der kaiserlichen Haupt- und
Residenzstadt Wien wurde jede freiheitliche Bewegung unterdrückt.
Auch im Deutschen Bund ging es weiter wie vor der Revolution, und
ein gutes Jahrzehnt noch vermochte man von Seiten der Monarchie das
Streben der Menschen nach Freiheit und verfassungsmäßigen Zuständen
zu unterdrücken.
Erst der ungünstige Ausgang des Krieges gegen Italien, konkret
die Schlacht von Solferino im Jahre 1859, erzwang auch in Österreich
ein gewisses innenpolitisches
Tauwetter. Die in ganz
Deutschland abgehaltenen großen
Schiller-Feiern des Jahres
1859 fanden auch in den deutschen
Erblanden in der Habsburger
Monarchie einen regen
Widerhall, auch in Wien. Sie waren
der Startschuss für eine neuerliche
Freiheitsbewegung.
Nur im Verborgenen konnten
in Wien im Jahrzehnt des Neoabsolutismus
freiheitliche Vereinigungen,
wie das spätere Corps
Saxonia, existieren. Nun; nach
1859 wurden wieder freisinnige
Vereine, Studentenverbindungen,
vornehmlich Burschenschaften
und Corps gegründet, wie auch
Turnvereine und Lesevereine, die
nun zur eigentlichen Basis des
nationalliberalen Lagers werden
sollten. Im Oktoberdiplom von
1860 kam es zu einer Erweiterung
der Rechte des Reichsrats. Die
Liberalen, an ihrer Spitze Staatsminister
Anton von Schmerling,
wollten eine echte parlamentarische
Verfassung, und so kam es
im Jahre 1861 zum sogenannten
„Februarpatent“. Dieses sollte
Napoleon III. weist
seine Garde unter
Marschall Regnaud
zum Sturm gegen
Solferino an: Österreichs
Niederlage
bei Solferino erzwingt
die politische
Liberalisierung
der Monarchie
158
1859–1918
noch für die gesamte Monarchie, also auch für Ungarn, gelten und den
Reichsrat zu einem echten Parlament machen.
Erst die Niederlage der Habsburger Monarchie
bei Königsgrätz gegen Preußen, das
Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen
Bund und der Verlust der Lombardei und Venetiens
zwangen die dramatisch geschwächte
Monarchie im Jahre 1867 dazu, den Ausgleich
mit Ungarn im Sinne einer Realunion zweier
Staaten zu realisieren. Dadurch erhielten die
Länder der Stephanskrone Souveränität in der
Innenpolitik und einen eigenen Reichstag. Von
nun an hießen die Länder diesseits der Leitha
Cisleithanien. So wurde nunmehr die Dezemberverfassung
von 1867 in Gestalt von Einzelgesetzen
erlassen.
Die Deutschliberalen waren bis 1879, bis
zum Beginn der Regierung des Grafen Eduard
von Taaffe, die weitaus stärkste Partei im Reichsrat. Sie befanden sich in
starker Gegnerschaft zum katholischen Klerus, was zum Kulturkampf
zwischen Katholisch-Konservativen und Nationalliberalen führte. De-
Fortsetzung auf Seite 162 ▶
„
Die Deutschliberalen
waren bis 1879,
bis zum Beginn der
Regierung des Grafen
Eduard von Taaffe, die
weitaus stärkste Partei
im Reichsrat.
159
An der blauen Donau
Die Nationalfreiheitlichen:
– ein vielfältiges Lager
Univ. Prof.
Lothar Höbelt
Wie vielfältig und gegensätzlich
das Spektrum der deutschfreiheitlichen
Parteien gegen
Ende der Monarchie war, zeigt
eine Passage aus der Habilitationsschrift
des Historikers
Lothar Höbelt „Kornblume
und Kaiseradler“ (Verlag für
Geschichte und Politik, Wien
1993, S 274 f) über das Wiener
Ergebnis der Reichsratswahlen
von 1911:
„Die eigentliche Sensation
aber lieferten Wien und Umgebung,
wo die Freiheitlichen
vom Zerbröckeln der christlichsozialen
Anhängerschaft
nach dem Tode Luegers,
den Diadochenkämpfen in
der Partei und dem agrarischen
Rechtsruck unter
der Ägide Greßmanns profitierten:
„Schwarz“ und
„Rot“ lagen nach dem
ersten Wahlgang in Wien fast
gleichauf; zum Unterschied von
1907 musste fast überall eine
Stichwahl angesetzt werden,
in der es – wider die Absichten
der Nationalverbändler – zu
dem berühmten offenen Bündnis
mit der Sozialdemokratie
kam, das den ohnedies zersplitterten
freiheitlichen Grüppchen
bei einem anfänglichen
Stimmenanteil vom kaum mehr
als elf Prozent nicht weniger als
ein Drittel der 33 Wiener Mandate
einbringen sollte. (Nur der
freihändlerische Maschinenindustrielle
Max Friedmann hatte
im Parkviertel, dem kleinsten
– und nobelsten – Wahlkreis
ganz Österreichs auf Anhieb
sein Mandat gegen Bielohlawek
errungen.)
Die Wiener Mandatare waren
eine bunte Gesellschaft:
Wien war im Nationalver-
160
1859–1918
band bisher nicht vertreten; die
Einflussmöglichkeit Chiaris und
Hochenburgers auf ihre versprengten
Gesinnungsgenossen
in der Reichshauptstadt dementsprechend
gering. Die Demokraten
und Sozialpolitiker (Hock,
Kuranda und Ofner), schon
bisher außerhalb des Nationalverbandes,
verteidigten ihre
Wahlkreise rund um den Donaukanal;
ihnen am nächsten
stand der steitbare Antiklerikale
Ernst Viktor Zenker auf der
Wieden mit seiner „Wirtschaftspolitischen
Reichspartei“, ein
wohlklingender Titel für ein
Ein-Mann-Unternehmen. Ihm
wurde die Aufnahme verweigert:
Speziell für „Papa Groß“, den
neuen Obmann des Nationalverbandes,
war Zenker ein rotes
Tuch. Am Rande des Verbandes,
immer wieder zur Landung ansetzend
und doch nie wirklich
grünes Licht erhaltend, kreisten
Friedmann, der als „Judenliberaler“
mit seinem antiprotektionistischen
„Österreichischen
Wirtschaftsverband“ just bei den
Bergbauern in der Steiermark
Anklang finden sollte, und der
Advokat Wilhelm Neumann. Das
gewerbliche Milieu vertraten der
Buchdrucker August Denk und
Otto Ganser, der Vizepräsident
des Verbandes österreichischer
Metallwarenproduzenten. (Ihr
Wahlkreis, Neubau, war der Bezirk
mit der höchsten Quote an
Selbständigen in Wien – und
derjenige, wo die Christlichsozialen
am meisten verloren, von 59
Prozent auf 41 Prozent der Stimmen.)
Beide waren integrierbar,
doch blieben sie Oppositionsgeister.
Ganser stand Zenker letzendlich
näher als Groß und trat
bereits im April 1913 wieder aus
– als Protest gegen die Bundesgenossenschaft
von Deutschradikalen
und Christlichsozialen.
Ideologisch, doch nicht politisch
den Deutschradikalen äußerst
nahe standen die beiden
Vertreter des Beamtenbezirkes
Währing, der Vizepräsident des
Verbandes der Staatsbeamten,
Leopold Waber, von seiner Behörde
wegen seines Engagement
einst gemaßregelt, doch
von Beck höchstpersönlich rehabiliert,
und Wilhelm Pollauf,
vor kurzem noch Schönerianer
111 freiheitliche
Abgeordnete zogen 1911 ins
Parlament ein.
und seither Gründer der strikt
antisemitischen „Deutschsozialen
Partei“, auch sie äußerst
kritisch gegenüber der gouvernmentalen
Linie des Nationalverbandes.
Nur ein früher Tod im
Felde hinderte ihn an einer späteren
Karriere in den Reihen
der Nationalsozialisten. (Für
den kompromisslosen Antisemiten
Pollauf stimmte im Zuge
des Wahlkompromisses übrigens
auch Arthur Schnitzler,
wie wir aus seinen Tagebüchern
wissen.) Außerdem wurde in
der Josefstadt der abtrünnige
christlichsoziale Magistratsdirektor
Heilinger gewählt, der
später dem Nationalverband
beitrat. Steinwender schrieb
über die Wiener Freisinnigen
wenig später: „Drei stehen den
Sozialdemokraten ganz nahe,
einer hält sich als Nationalsozialer
in bequemer Isolierung,
einer hat es unterlassen,
sich taufen zu lassen, und von
einem weiß man nicht, warum
er draußen bleibt.“
111 freiheitliche Abgeordnete
schafften 1911 den
Sprung in das Haus am Ring;
fast genau hundert betrug die
Zahl derer, die schließlich dem
Nationalverband beitraten.“
◆
„
161
An der blauen Donau
„
Die deutschliberalen
und deutschnationalen
Kräfte zeichneten
sich in den letzten Jahrzehnten
der Habsburger
Monarchie durch zahlreiche
Spaltungen und heftigen
internen Streit aus.
ren Eintreten für die deutschsprachige Bevölkerung der Monarchie
brachte sie überdies in Konflikt mit den Slawen. Das führte zum Nationalitätenstreit,
der bis zum Ende der Monarchie andauern sollte.
Georg von Schönerer
Der andauernde Kampf gegen den politischen
Katholizismus und die slawischen Nationalitäten
innerhalb der Monarchie führte
zusammen mit der Wirtschaftskrise von 1873
zum Niedergang der Liberalen Partei und zum
Verlust der Regierungsgewalt. Die Partei wurde
in mehrere Teile aufgesplittert, woraus sich
in der Folge mehrere deutschfreiheitliche und
deutschnationale Parteien entwickelten. Diese
sollten aber bis über den Ersten Weltkrieg hinaus
die Mehrheit im Cisleithanischen Reichsrat
der Habsburger Monarchie und schließlich
auch noch in der konstituierenden Nationalversammlung
der Ersten Republik innehaben.
Die deutschliberalen und deutschnationalen
Kräfte zeichneten sich in den letzten Jahrzehnten
der Habsburger Monarchie durch zahlreiche
Spaltungen und heftigen internen Streit
aus. Dennoch waren sie die tragenden Kräfte
des österreichischen Parlamentarismus
bis zum Ersten Weltkrieg.
Eine ihrer prägenden Persönlichkeiten
war Georg Ritter
von Schönerer, der ursprünglich
als deutschorientierter Sozialreformer
auftrat. Zu seinen politischen
Schülern und Mitstreitern
gehörten Karl Lueger, der
spätere Gründer der Christlichsozialen,
aber auch Viktor Adler
und Engelbert Pernerstorfer,
die beiden Gründer der späteren
Sozialdemokratie. Letztere waren
übrigens Burschenschafter,
wie die meisten deutschliberalen und
deutschnationalen Abgeordneten.
Victor Adler
Engelbert Pernerstorfer
162
1859–1918
Schönerer allerdings radikalisierte sich zunehmend und wurde so
etwas wie der politische Begründer des Rassenantisemitismus. Ihm und
seiner alldeutschen Bewegung gegenüber standen eine Reihe gemäßigter
nationalliberaler Politiker, deren Integrationsfigur beispielsweise Otto
Steinwender war.
Die ideologischen und programmatischen Grundsätze der nationalliberalen
Parteien in den letzten Jahren der Monarchie waren einerseits
durch den Antiklerikalismus und den Kulturkampf gegenüber
dem politischen Katholizismus geprägt, andererseits ganz stark vom
Antisemitismus. Überdies standen sie im Nationalitätenstreit im steten
Abwehrkampf gegenüber den slawischen Bevölkerungselementen der
cisleithanischen Reichshälfte, also gegenüber den Tschechen und Südslawen.
Die nationalliberalen Kräfte in der Monarchie waren es auch,
die den Weg zum allgemeinen Wahlrecht ebneten. Im Jahre 1863 gab es
eine Wahlrechtsreform, wobei das geltende Kurienwahlrecht die Wähler
nach ihrem Stand und ihrem Vermögen in vier Kurien einteilte: Großgrundbesitzer,
Handels- und Gewerbekammer, Groß- und Mittelbauern
und stätische Bürger: Im Jahre 1896 wurde eine fünfte allgemeine Wählerklasse
eingeführt, in der alle Männer wahlberechtigt waren. Erst die
Die Liberalen waren
in Wien bis 1878
tonangebend: Sie
stützten sich auf
das das Großkapital
und Großbürgertum
163
An der blauen Donau
Abschaffung des Kurienwahlrechts im Jahre 1908 und die Erhöhung
der Zahl der Reichsratsabgeordneten auf 516 ermöglichten das allgemeine,
gleiche, geheime und direkte Wahlrecht für alle Männer.
Der Schottenring
um 1875, Blick vom
Schottentor Richtung
Donaukanal
Der Reichsrat tagte von 1861 bis 1918 in insgesamt zwölf Legislaturperioden,
wobei bis 1889 eben die Deutschliberale Partei die Mehrheit
der Abgeordneten stellte. Zwar wurden nach der Einführung des
allgemeinen Männerwahlrechts im Jahre 1907 die Christlichsozialen
des Karl Lueger die stärkste Partei und 1911 die Sozialdemokraten, der
Deutsche Nationalverband aber bzw. die Vereinigungen der deutschnationalen,
deutschfreiheitlichen Parteien vermochten in Summe immer
mehr Abgeordnete zu stellen, als die junge Sozialdemokratie und die
christlichsoziale Bewegung. Dies führte auch dazu, dass nach Ende des
Ersten Weltkriegs im Jahre 1918 die provisorische Nationalversammlung,
die aus den deutschen Abgeordneten der Habsburger Monarchie
bestand, eine deutliche nationalliberale Mehrheit aufwies
Die Liberalen in Wien
In der kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt entwickelte sich die
liberale Bewegung nach dem Ende des Neoabsolutismus, indem sie sich
auf das Großkapital und das Großbürgertum stützte. Eine konkrete organisierte
Partei oder gar ein allgemein beschlossenes Parteiprogramm
gab es nicht, und die immer wieder vorkommenden Abspaltungen linker
164
1859–1918
oder rechter Splittergruppen sorgten für eine
gewisse Instabilität der liberalen Gruppierung.
Dennoch waren die Liberalen in Wien
bis 1878 die dominante politische Gruppierung,
ebenso wie in der cisleithanischen
Reichshälfte der Monarchie insgesamt.
Durch das beschränkte Wahlrecht kam es
dazu, dass die liberale Ära in Wien im Wesentlichen
dadurch gekennzeichnet war, dass
die Verwaltung und der Gemeinderat in den
Händen eines relativ kleinen Teils der Bevölkerung
lagen. Und nachdem es bei den Liberalen
kein konkret fixiertes kommunalpolitisches
Programm gab und auch kein wirklich
fixiertes eigenes Wirtschaftskonzept, war der
politische Handlungsspielraum der liberalen
Politiker eher beschränkt.
Im wirtschaftlichen Bereich der liberalen
Kommunalpolitik wurde versucht, durch ein
möglichst sparsames und ausgeglichenes Budget
die Bildung neuen Kapitals zu fördern. Im
Bereich der Steuern gab es nur Zuschläge zu den Staatssteuern, doch keine
eigene Kommunalsteuer. Und im Bereich des Konsums der Bürger
glaubte man, steigenden Konsum verhindern zu müssen, da damit vermeintlich
die Kapitalbildung und die Vollbeschäftigung behindert wären.
Was die wirtschaftlichen Leistungen der liberalen Bewegung in
Wien betrifft, so waren es vor allem die Großprojekte an der Wiener
Ringstraße und die Zentralisierung der Verwaltung, die im Mittelpunkt
der Politik standen. Ab dem Jahre 1850 kam es überdies zur
Eingemeindung der innerhalb des Linienwalls liegenden Bezirke und
zum Bau von Waisenhäusern und Schulen. Auch die innerstädtischen
Verkehrsverbindungen, insbesondere Brücken, wurden verbessert und
erneuert sowie Markthallen errichtet, deren Zweck es war, die Preise
zu dämpfen.
Andreas Zelinka,
Lithographie
von Joseph Kriehuber
1868
Ein besonderes Projekt war der Bau der
ersten Hochquellwasserleitung, was für die
Gesundheit weiter Bevölkerungsteile ganz
wesentlich war. Überdies wurden der Zentralfriedhof
errichtet und die einzelnen kleinen
Kommunalfriedhöfe geschlossen. Die Hochwassergefahr,
die die kaiserliche Haupt- und
Residenzstadt immer wieder bedroht hatte,
wurde durch die Regulierung der Donau gebannt,
und kommunale Gaswerke wurden
errichtet. Auch der innerstädtische Verkehr
wurde durch die Einführung von Pferdestraßenbahnen
reformiert. Ein Engagement der
Stadtverwaltung im Wohnungsbau wurde von
den Liberalen eher abgelehnt, da man keine
kommunalen Monopole wollte, sondern vielmehr
private Bauträger förderte.
„
„Papa Zelinka“
wie ihn die Wiener respektvoll
nannten, galt als
Philanthrop, der sein Jahresgehalt
von immerhin
12.000 Gulden samt und
sonders für Spenden und
Almosen ausgab.
165
An der blauen Donau
„
Cajetan Felder
Ein Jahrzehnt lang
sollte Cajetan Felder als
der bedeutendste
liberale Kommunalpolitiker
der Reichshauptstadt
die Geschicke
derselben lenken.
Wiens liberale
Bürgermeister
Der erste bedeutende liberale
Bürgermeister der Haupt- und
Residenzstadt war der Advokat
Andreas Zelinka. Er wurde
1802 in Mären geboren, studierte
von 1821 bis 1825 Jus
an der Universität Wien und
war dann als Rechtsanwalt tätig.
Während der Revolution
1848 wurde er in den Wiener
Gemeinderat gewählt, dessen
Vizepräsident er 1849 wurde.
Am Beginn der liberalen Ära
schließlich im Jahre 1861 wurde
er Bürgermeister von Wien und
hatte dieses Amt bis 1868 inne.
Gleichzeitig war er auch Abgeordneter
zum niederösterreichischen
Landtag und ab 1867 Mitglied des
Herrenhauses. „Papa Zelinka“ wie ihn
die Wiener respektvoll nannten, galt als
Philanthrop, der sein Jahresgehalt von immerhin
12.000 Gulden samt und sonders für
Spenden und Almosen ausgab. In seiner Ära
wurde die erste Wiener Hochquellwasserleitung
geplant, ebenso die Donauregulierung und die Errichtung
des Wiener Zentralfriedhofs. Bereits 1865, während
seiner Amtszeit, wurde die Ringstraße teilweise eröffnet und – ebenfalls
unter seiner Amtsführung – wurde im August 1863, anlässlich des Geburtstags
von Kaiser Franz Joseph, ein erstes
großes Volksfest in Wiener Prater veranstaltet.
Zelinkas Lieblingsprojekt allerdings war die
Anlage und Gestaltung des Wiener Stadtparks.
Nach dem Tod Zelinkas im November 1868
wurde Cajetan Felder, der ebenfalls Rechtsanwalt
war, mit großer Mehrheit als neuer Wiener
Bürgermeister gewählt. Felder sollte zur
prägendsten Persönlichkeit der liberalen Ära
in Wien werden. Er wurde am 19. September
1814 im vierten Wiener Gemeindebezirk geboren
und war bereits als kleines Kind Vollwaise.
An der Wiener Universität studiert er Jus, wobei
er auch ein großes Interesse am Studium der
antiken Klassiker und der Naturwissenschaften
sowie an fremden Sprachen entwickelte. Als
Student bereits unternahm er große und ausgedehnte
Wanderungen zu Fuß durch weite Teile
166
1859–1918
Europas. Er kam bis nach England, Schottland und Irland, durchwanderte
Belgien, Frankreich und Spanien und sogar Sizilien.
Wenige Tage vor der Wiener Märzrevolution des Jahres 1848 legte
er seine Advokaten-Prüfung ab und erlangte auch die Befähigung zur
Ausführung des Richteramtes. Bereits davor wurde er zum Gerichtsdolmetscher
für die spanische, französische, indische, holländische, dänische,
schwedische und portugiesische Sprache ernannt. Während der
Revolution wurde er zunächst in den ersten Gemeindeausschuss der
Stadt Wien gewählt und schließlich in den Wiener Gemeinderat, wo er
Schriftführer wurde In der Zeit des Neoabsolutismus arbeitete er wieder
als Advokat und machte ausgedehnte Weltreisen. So war er 1852 in Afrika
und legte eine später weltbekannte Sammlung von Insekten, Käfern
und Schmetterlingen an.
Im Jahre 1863 schließlich übertrug ihm der bedeutende österreichische
Bierbrauer Anton Dreher die Vormundschaft über seinen minderjährigen
Sohn. Cajetan Felder fiel somit die Aufgabe zu, den Brauereibetrieb
bis zur Großjährigkeit des Erben im Jahre 1870 zu managen.
Insgesamt also hatte Felder im juristischen und politischen Leben
Die Errichtung des
Zentralfriedhofs
fand auch in der
liberalen Ära statt
Eröffnung der regulierten
Donau 1875
167
An der blauen Donau
Das neugothische
Rathaus war
Cajetan Felders
Lieblingsprojekt
Wiens, aber auch im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich
eine außergewöhnlich geachtete Stellung inne, als er in das Amt des Bürgermeisters
aufrückte.
Ein Jahrzehnt lang sollte Cajetan Felder als der bedeutendste liberale
Kommunalpolitiker der Reichshauptstadt die Geschicke derselben lenken.
Er war seit 1869 auch Landmarschall-Stellvertreter im niederösterreichischen
Landtag und zum lebenslangen Mitglied des Herrenhauses
ernannt worden. Als ihm Kaiser Franz Josef die Ernennung zum Kultusminister
antrug, lehnte er diese entschieden ab, da sein Herz ganz der
Wiener Kommunalpolitik gehörte.
Um das politische Wirken Cajetan Felders zu beurteilen, muss man
wissen, dass der liberale Bürgermeister sich im Grunde nur auf eine
kleine, relativ elitäre Schicht der Wiener Bürger stützen konnte. Damals
waren nur über 24 Jahre alte Bürger wahlberechtigt, die im Zuge des
Zensuswahlrechts durch eine bestimmte Steuerleistung definiert waren.
Diese somit privilegierten Wähler waren in der Reichshauptstadt in drei
Kurien unterteilt und jede dieser Kurien konnte 40 Vertreter in den 120
Mitglieder umfassenden Gemeinderat entsenden. Bei der Wahl Kajetan
Felders im Jahre 1868 hatte Wien etwa 600.000 Einwohner, und davon
waren nicht einmal 20.000 Menschen wahlberechtigt. So gab also
der liberale, wohlhabende Teil der Bürger den Ton an, und die breite
Mehrheit der Bevölkerung, insbesondere die Arbeiter waren politisch
rechtlos. Interessant dabei ist, dass 20 Jahre zuvor, während der Revo-
168
1859–1918
lution gerade die nationalliberalen Bürger und Studenten auch für die
Gleichberechtigung der Arbeiter gekämpft hatten. Das spielte nun keine
große Rolle mehr.
Die Liberalen hatten, wie bereits geschildert, keine eigentliche Massenpartei
zu Stande gebracht, allerdings gelang es Cajetan Felder, die
so genannte „Mittelpartei“, die im Wiener Gemeinderat die Mehrheit
stellte für sich zu vereinnahmen. Und er war für den Aufbruch Wiens
zur Weltstadt wohl der richtige Politiker zur rechten Zeit. Wien war
nämlich beim Amtsantritt Cajetan Felders eine
einzige gigantische Baustelle. Bereits im Jahre
1857 war die alte Stadtmauer abgerissen worden
und wurden die Basteien geschleift. Die
Stadtgräben ließ man zuschütten, und auf
diesem gewaltigen Areal rund um den ersten
Bezirk entstand nun die Ringstraße mit ihren
Prachtbauten, wie wir sie heute kennen. Die
geradezu explosive Bautätigkeit der Gründerzeit
begann. Und durch einen steten Zuwandererstrom,
insbesondere aus Böhmen, der die
Bevölkerung enorm vermehrte, kam es auch
zu einer wirklichen Wohnungsnot die ärmeren
Bevölkerungsteile.
Die liberale Stadtverwaltung unter Cajetan
Felder stand also vor unabsehbaren Aufgaben.
Die erste diese Aufgaben war zweifellos die
Wasserversorgung, wobei die Planungen für
die Hochquellwasswerleitung aus dem Gebiet
vom Schneeberg und Rax bereits vorlagen.
Sie wurden nunmehr zielstrebig verwirklicht.
Bereits 1873 konnte Cajetan Felder das wasserbautechnische
Meisterwerk eröffnen. Aber
erst im Jahre 1880 waren dreiviertel der Wiener
Häuser entsprechend an diese Wasserversorgung angeschlossen.
Im Jahre 1870 schließlich kam es zum Spatenstich für die Regulierungsarbeiten
der Donau, die zuvor durch die regelmäßigen Überschwemmungen
immer gewaltige Schäden verursacht hatte. Bereits
1875 war dieses Werk fertig gestellt und im gleichen Jahr wurde auch
der Wiener Zentralfriedhof seiner Bestimmung übergeben.
Fortsetzung auf Seite 173 ▶
„
Cajetan Felder
schrieb über Karl Lueger,
dieser sei „ein zielbewusster
Bösewicht, wie
er im Buche steht, der
alles, was sich ihm nicht
bedingungslos unterwirft,
mit Gift, Feuer und
Schwert zu vernichten
bestrebt ist“.
Bürgermeister
Julius Newald
Bürgermeister
Eduard Uhl
169
An der blauen Donau
Das Ende des Liberalismus:
Eine Zäsur in der
österreichischen Politik
„
Über den Übergang vom Altliberalismus
zu den Deutschnationalen
schreibt der Wiener
Historiker Lothar Höbelt (in:
Kornblume und Kaiseradler,
Wien 1993, S 350 ff)
In den Papieren von Gustav
Marchet findet sich ein gegnerisches
Propagandaflugblatt
aus dem Jahre 1896, eine Parte
auf den Tod des „Herrn Liberalismus“:
„Die Aufbahrung des
teuren Verblichenen findet während
der nächsten Landtagsund
Reichsratswahlen statt … “
Diese Auffassung hat sich
Der politische Liberalismus
in Österreich wird in
den meisten Darstellungen
noch vor der Jahrhundertwende
zu Grabe getragen.
zur herrschenden Orthodoxie
entwickelt, selbst wenn die dahinterstehende
Wertung in ihr
Gegenteil verkehrt wurde. Der
politische Liberalismus in Österreich
wird in den meisten
Darstellungen noch vor der
Jahrhundertwende zu Grabe
getragen. Die Auflösung der
Vereinigten Deutschen Linken
1895/97, die Ablöse der „Liberalen“
durch die „Deutschnationalen“,
zu guter letzt auch
noch die Ernennung Luegers
zum Wiener Bürgermeister,
stellen zweifelsohne eine einschneidende
Zäsur der österreichischen
Innenpolitik dar.
Soziologische und politologische
Indizien scheinen diesen
Befund zu bestätigen: Der
Wechsel von den „Honoratiorenparteien“
zu den „Massenparteien“,
die alle das Erbe
des Liberalismus antraten; die
Degeneration des Parlamentarismus
im Wechselbad von
Obstruktion und Notverordnungsparagraphen.
Daneben haben die Elemente
der Kontinuität meist
weniger Beachtung gefunden:
Nur in Wien und seiner unmittelbaren
Umgebung wurde die
politische Landschaft auf den
Kopf gestellt, griff eine neue
Synthese bürgerlicher Politik
Platz. Wie John Boyer gezeigt
hat, übernahmen jedoch selbst
die Christlichsozialen mehr von
ihren liberalen Vorgängern als
bisher oft gewürdigt worden
ist. Der Typus der „Honoratioren“-Partei
wurde nicht über
Nacht von der Massenpartei
abgelöst. Vielmehr kamen jetzt
erst, im Übergangsstadium
vom Kurienreichsrat zum allgemeinen
Wahlrecht, nach der
Verdrängung der liberalen „Notabeln“,
der Universitätsprofessoren
und „Verwaltungsräte“,
die „Honoratioren“, die gutbürgerlichen
Lokalmatadore, Mittelschullehrer
und Fabrikanten,
voll zur Geltung. Die organisatorischen
Formen, die Wahlkomitees
und Vertrauensmännerversammlungen
aber blieben
weitgehend die gleichen. In der
Provinz verschoben sich zudem
die Grenzen zwischen den beiden
großen weltanschaulichen
Lagern, zwischen „klerikal“ und
„freiheitlich“ (= „antiklerikal“)
nur unwesentlich, und wenn,
dann keineswegs immer zugunsten
der ersteren. Der kleine
Rückschlag Mitte der neunziger
Jahre wurde durch die Sogwir-
170
1859–1918
kung der Badeni-Jahre mehr als
wettgemacht. Die Elemente der
Kontinuität überwogen.
Die Ablöse einer „Partei“
durch eine andere bedeutete
eine Akzentverlagerung, eine
Reaktion auf die Herausforderung
durch die neue Lage, wie
sie seit den achtziger Jahren
gegeben war:
■ auf den Verlust der deutschen
Mehrheit;
■ auf den Wandel von der
„Prinzipienpolitik“ der Gründerzeit
zur „Interessenpolitik“
der großen Depression;
■ auf die Erweiterung des
Elektorats, die „Fünfguldenmänner“
und das Heraufdämmern
des allgemeinen
Wahlrechts.
Mit der Ablöse der „Liberalen“
durch die „Deutschnationalen“
verschob sich das
Schwergewicht innerhalb des
deutschfreiheitlichen Lagers
vom „rechten“, gouvernmentalen
und großbürgerlichen
Flügel zum „linken“, oppositionellen
und mittelständischen
Flügel. Die Übergänge aber
waren fließend: Der altliberale
Propagandaflugblatt
aus dem Jahre
1896: eine Parte
auf den Tod des
„Herrn Liberalismus“
171
An der blauen Donau
„
Flügel lebte in Teilen der Fortschrittspartei
ebenso weiter
wie die Deutschnationalen an
die Dissidenten schon der siebziger
und frühen achtziger Jahren
anknüpfen konnten.
Allein schon die Schnelligkeit,
das Tempo, mit dem
dieser Übergang sich vollzog,
muss Zweifel daran aufkommen
lassen, wie tiefgreifend
der Wandel war, der in diesen
Jahren vor sich ging. Personelle
Kontinuität lässt sich am
Schicksal der politischen Elite
in vielen Fällen ebenso deutlich
ablesen, wie das für die
Wählerschaft gilt: Bendel nahm
seinen Weg von der Vereinigten
Deutschen Linken über die
Fortschrittspartei zum Nationalverband;
Glöckner landete
sogar bei den Radikalen. Der
verfassungstreue Großgrundbesitzer
Schreiner saß bei den
Agrariern neben Bauern, die vor
Auf dem flachen
Lande zumal ging der
Wechsel der Parteien nahezu
unmerklich vor sich.
kurzem noch Schönerer – und
nicht dem Grafen Oswald Thun-
Salm – Gefolgschaft gelobt
hatten. Auf dem flachen Lande
zumal ging der Wechsel der
Parteien nahezu unmerklich
vor sich. Die bäuerlichen Vertreter
fühlten sich in der Vereinigten
Deutschen Linken ebenso
nachrangig behandelt wie bei
den Alldeutschen, nur um sich
auch als stärkste Fraktion des
deutschfreiheitlichen Lagers
ab 1907 in national-politischen
Fragen weiterhin willig der Führung
ihrer städtischen Kollegen
unterzuordnen. Diese Kontinuität
der Lager wurde auch von
der Gegenseite betont: Das
„Linzer Volksblatt“ belegte unterschiedslos
auch noch Beurle
und seine Kameraden mit dem
Ausdruck „Judenliberale“.
Die Betonung dieser grundlegenden
Kontinuität über weite
Strecken soll nicht in einem
apologetischen Sinne missverstanden
werden. Ein derartiger
Befund ist außerstande, auf die
wertende Frage eine Antwort zu
liefern, wie weit man die deutschfreiheitlichen
Gruppierungen in
der Spätzeit der Monarchie als
„Liberale“ einzustufen vermag.
Sicher erscheint bei einer genauen
Analyse der politischen
Struktur jedoch, dass die Annahme
eines klaren Bruches zwischen
„Liberalen“ auf der einen
Seite und „Deutschnationalen“
auf der anderen an der gesellschaftlichen
Realität vorbeigeht,
vielleicht einzig und allein in
Wien einiges für sich hat. „Nationale“
und „liberale“ Elemente
waren vor und nach dem Umbruch
der neunziger Jahre vertreten:
Die Liberalen waren nicht
weniger an der Vorherrschaft
der Deutschen in ihrer Reichshälfte
und an der Wahrung des
„nationalen Besitzstandes“ interessiert
als ihre Nachfolger.
Ihre Verankerung unter der Elite
der „Inseldeutschen“ ließ sie die
Grenzen dieses Besitzstandes
vielfach sogar noch weiter ziehen,
ausgehend von einem
noch ungebrochenen Selbstbewusstsein,
das sie eben auch toleranter
erscheinen ließ. Diese
Unterschiede waren eine Frage
der Taktik, eine Reaktion auf
die sich wandelnden Umstände.
Die „Nationalen“ wiederum
ließen die Kontrollfunktion des
Liberalismus, das stetige und
wache Misstrauen gegen die
Übergriffe des Staatsapparates
stärker hervortreten als die von
diversen Rücksichten geplagten
„gouvernmentalen“ Altliberalen. ◆
172
1859–1918
Bürgermeister
Johann Prix
Bürgermeister
Raimund Grübel
Das eigentlich bis zum heutigen Tag unübersehbare Denkmal für
das Wirken des liberalen Bürgermeisters Cajetan Felder ist jedoch das
neugotische Wiener Rathaus. Es war dies Felders Lieblingsprojekt, das
er mit großer Energie umsetzte. Gegen den Widerstand der Armee setzt
der Bürgermeister beim Monarchen durch, dass der Bau des Rathauses
auf dem vormaligen Exerzier- und Paradeplatz durchgeführt werden
konnte. Eröffnet wurde das neue Wiener Rathaus
allerdings erst im Herbst des Jahres 1883,
als Cajetan Felder nicht mehr im Amt war. Zur
Eröffnungsfeierlichkeit wurde er nicht einmal
eingeladen. Politik war eben auch damals schon
ein Geschäft, in dem es keinen Dank gibt.
Die rege Bautätigkeit und der gewaltige
Wirtschaftsboom der Gründerzeit fanden ihren
Höhepunkt mit der Wiener Weltausstellung
im Jahre 1873. Das Spekulationsfieber,
das im Umfeld dieser Weltausstellung grassierte,
führte allerdings zu einem katastrophalen
Börsenzusammenbuch. Zwar machten Spekulanten
große Gewinne, die häufig getäuschten
Käufer von Aktien allerdings verloren ihr Vermögen
und ihr Hab und Gut. Für die Staatsfinanzen
war diese Weltausstellung tatsächlich
eine wirkliche Katastrophe. Während die Ausgaben
für die Weltausstellung dem Vernehmen
nach mehr als 20 Millionen Gulden ausmachten,
kam es nur zu einem Bruchteil dieses Betrags
an Einnahmen. Und der Haushalt der
Gemeinde Wien, der ja schon durch die Finanzierung der Großprojekte
von Kajetan Felder überaus angespannt war, drohte zu kollabieren. Die
dadurch entstandenen Streitigkeiten innerhalb der liberalen Fraktion
machten die Stellung Felders als Bürgermeister unhaltbar. Im Juni 1878
trat er also zurück.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Felder nach schweren familiären
Schicksalsschlägen und einer nahezu völligen Erblindung eher
zurückgezogen. Allerdings diktierte er umfangreiche Erinnerungen,
in denen er seinen politischen Werdegang, aber auch seine politischen
„
Nach gut 25 Jahren
in denen deutschliberale
Bürgermeister
die kaiserliche Hauptund
Residenzstadt regiert
hatten, begann
nun 1896 die Periode
der christlichsozialen
Bürgermeister.
173
An der blauen Donau
„
Danach begann
die Ära des roten Wiens,
die mit der Unterbrechung
der ständestaatlichen
Diktatur und des
Nationalsozialismus bis
heute währt.
Zeitgenossen scharfzüngig charakterisierte. Über seinen politischen
Konkurrenten und dann überaus erfolgreichen Nachfolger Karl Lueger,
den Führer der christlichsozialen Bewegung,
schrieb er etwa, dass dieser „ein zielbewusster
Bösewicht, wie er im Buche steht, der alles, was
sich ihm nicht bedingungslos unterwirft, mit Gift,
Feuer und Schwert zu vernichten bestrebt ist“ sei.
Cajetan Felder starb 80-jährig im November des
Jahres 1894. Mit ihm trat die bedeutendste Persönlichkeit
der liberalen Ära in der Wiener Stadtpolitik
ab.
Der Niedergang der
Liberalen in Wien
Nachfolger von Cajetan Felder als Bürgermeister
wurde sein Stellvertreter Julius Newald. Auch
er war in Zivilberuf Advokat und bereits seit 1864
im Wiener Gemeinderat tätig. Wie Cajetan Felder
war er Mitglied der rechtsliberalen Mittelpartei und schließlich auf
Felders Vorschlag auch Obmann dieser Partei. Als es im Dezember des
Jahres 1881 zum Brand des Ringtheaters kam, geriet Julius Newald verstärkt
ins Schussfeld der Opposition. In der Folge trat er schließlich im
Jänner 1882 als Bürgermeister zurück. Im darauffolgenden Ringtheaterprozess
saß der vormalige Bürgermeister auch als Angeklagter vor Gericht,
wobei sich allerdings im Zuge dieser Verhandlung seine Unschuld
erwies.
Bürgermeister
Karl Lueger
Newalds Nachfolger als Bürgermeister war Eduard Uhl. Dieser war
bereits während der Revolution von 1848 Hauptmann
in der sechsten Kompanie der Nationalgarde
am Alsergrund gewesen. Große Sympathien hatte
er sich bei den Wienern erworben durch sein konsequentes
Eintreten für Bürgerrechte, aber auch
dadurch, dass er Teile seines Privatvermögens
einsetzte, um die Wiener Hochquellwasserleitung
zu realisieren. Auch er war Mitglied der liberalen
Mittelpartei. In seiner Amtszeit kam es zu einer
Neuorganisation des Feuerwehrwesens in Wien,
zum Ausbau der Schlachthäuser, aber auch zum
verstärkten Bau von Waisenhäusern. Nachdem die
christlichsoziale Opposition in der Reichshauptund
Residenzstadt immer stärker wurde, trat Uhl
im November 1889 aus Altersgründen zurück.
Auf Eduard Uhl folgte Johann Prix, ebenfalls
ein Rechtsanwalt. Wenige Tage nach seiner Wahl in
Spätherbst 1889 beschloss der Wiener Gemeinderat
im Einvernehmen der kaiserlichen Regierung,
die Einbeziehung von ganzen 43 Vororten in das
Wiener „Verzehrungssteuergebiet“. Damit traten
die Verhandlungen zur Eingemeindung dieser
Bereiche in ein entscheidendes Stadium, worauf
174
1859–1918
Wien im Dezember 1890 ein neues Gemeindestatut erhielt, durch das
„Großwien“ geschaffen wurde. Und im Jahre 1981 kam es zu den ersten
Gemeinderatswahlen unter Beteiligung der Bevölkerung der Vororte.
Teuerungsrevolte in
Wien: Diese wurde
am 17. September
1911 gewaltsam
niedergeschlagen
Prix kam aus dem liberalen Fortschrittsclub und baute auf dessen
Grundlagen einen neuen Parteienverband auf, in welchem auch die
zuvor außerhalb des Clubverbands gestandenen „wilden Abgeordneten“
aufgenommen wurden. Im Gemeinderat allerdings stand Prix von
Anbeginn seiner Amtsführung unter starkem Druck von Seiten Karl
Luegers und der christlichsozialen Opposition. Aber auch im liberalen
Lager kam es zu Unstimmigkeiten und zu einer schwindenden Unterstützung
für den Bürgermeister. Nach einem Misstrauensantrag von
Karl Lueger trat Prix zurück, wurde allerdings vom liberalen Parteienverband
einstimmig zur Wiederwahl aufgestellt, verstarb aber danach an
einer Herzattacke.
Der Nachfolger von Prix wurde der Rechtsanwalt Raimund Grübel.
Jahrgang 1847, gehörte er einer jüngeren Generation an, war allerdings
wie seine liberalen Vorgänger Rechtsanwalt. Auch er hatte sich Verdienste
erworben um die Eingemeindung der Vororte, um das Schulwesen
und den Ausbau der Hochquellwasserleitung sowie der Kanalisation.
Er war allerdings nur bis 1894 Bürgermeister, da er nach einem
überaus ungünstigen Ausgang der Wahlen für die liberale Partei aufgrund
der christlichsozialen Erfolge zurücktrat. Mit Raimund Grübel
endet die Reihe der deutschliberalen Bürgermeister Wiens.
Der christlichsozial dominierte Gemeinderat wählte nunmehr Karl
Lueger zum Bürgermeister. Diese Wahl wurde allerdings von Kaiser
Franz Joseph nicht bestätigt, vielmehr bestellte er Hans Freiherr von
Friebeis, der bislang den Rang eines Bezirkshauptmannes inne ge habt
hatte zum kommissarischen Bürgermeister, der von 1895 bis 1896 amtierte
und mit der Durchführung von Neuwahlen betraut war. Nach
175
An der blauen Donau
ihm trat der christlichsoziale Joseph Strohbach sein Amt an, der als der
„Mann fürs Grobe“ aus dem Umfeld von Karl Lueger galt.
Nach gut 25 Jahren, in denen deutschliberale Bürgermeister die kaiserliche
Haupt- und Residenzstadt regiert hatten, begann nun 1896 die
Periode der christlichsozialen Bürgermeister. Sie währte bis 1919, also
auch gute in Vierteljahrhundert. Nach dem Platzhalter Josef Strohbach
wurde Karl Lueger selbst Bürgermeister, der die Stadt 13 Jahre bis 1910
regierte. Nach seinem Tod wurde der christlichsoziale Joseph Neumayer
Bürgermeister, allerdings nur für zwei Jahre. Und auf ihn folgte Richard
Weißkirchner, der von Karl Lueger testamentarisch gewünschte Nachfolger,
der von 1912 bis 1919 den Bürgermeistersessel innehatte.
Danach begann die Ära des roten Wiens, die mit der Unterbrechung
der ständestaatlichen Diktatur und des Nationalsozialismus bis heute
währt. Es ist also durchaus interessant festzustellen, dass die liberale Ära
Wien auf den Weg zur kaiserlichen Weltstadt führte, wobei diese Liberalen
allerdings wenig demokratischen Rückhalt hatten, sondern vielmehr
im Großbürgertum und in der Industrie verwurzelt waren. Liberal
1859–1918
waren diesen Liberalen allerding auch im Hinblick auf die emanzipierten
Juden, die innerhalb deren Gruppierung eine bedeutsame Rolle spielten.
Dies änderte sich in der christlichsozialen Ära unter Karl Lueger, der
verstärkt auf das Kleinbürgertum setzt und einen strikt antisemitischen
Kurs fuhr. Das rote Wien mit seinen großen sozialpolitischen Leistungen
in der Zwischenkriegszeit verstand sich dann immer als Antithese
zur bürgerlich regierten Republik, in der christlichsoziale Koalitionen
mit den deutschfreiheitlichen Parteien regierten.
Wahlergebnisse
und Stärkeverhältnisse
Die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Wiener Gemeinderat war
anfangs ziemlich schwach. Nur 10 bis 30 % der wahlberechtigten Männer
beteiligten sich bei Wahlen vor 1880. Und 1885 betrug die Wahlbeteiligung
durchschnittlich noch immer nur 34,9 %. Im Jahre 1880
hingegen stieg sie dann stark auf 66 % an und im Jahre 1891, nach der
Die Ringstraße: Im
Vordergrund das
Burgtheater, rechts
dahinter das Kunsthistorische
Museum
177
An der blauen Donau
„
Das rote Wien mit
seinen großen sozialpolitischen
Leistungen in
der Zwischenkriegszeit,
verstand sich immer als
Antithese zur bürgerlich
regierten Republik.
Eingemeindung der Wiener Vororte, erreichte diese Wahlbeteiligung
sogar knapp 72 %. Bei den Wahlen der Jahre 1900, 1906 und 1912 fanden
die so genannten Hauptwahlen im zweiten und vierten Wahlkörper
statt, während die Mandate aus dem ersten und dritten Wahlkörper nach
den jeweils letzten Hauptwahlen, beziehungsweise den Ersatzwahlen
verteilt wurden.
Wie bereits berichtet, dominierte bis zum
Jahre 1895 der liberale Fortschrittsclub, aber
bei der Wahl im Jahre 1895 erreichte der christlichsozial
dominierte Bürgerclub 92 Mandate
gegenüber 46 Mandaten der liberalen Fortschrittspartei.
Im Jahr 1900, sozusagen auf dem
Höhepunkt der Amtsführung von Karl Lueger,
erreichten die Christlichsozialen sogar 128
Mandate gegenüber nur 28 der liberalen Fortschrittspartei
und zwei der Sozialdemokraten.
Ab 1911 allerdings konnten die Christlichsozialen
ihre Mehrheit für Karl Lueger nur
mehr aufrechterhalten, da das Kurienwahlrecht
weiterbestand. Bei der Wahl von 1912 erhielten
die Christlichsozialen 135 Mandate, die
deutschfreiheitlichen Parteien 20 Mandate und
die Sozialdemokraten 10. Dies drehte sich dann in den Jahren nach dem
Ersten Weltkrieg völlig. Bei der Wahl im Mai 1919 erhielt die sozialdemokratische
Arbeiterpartei 54,2 % der Stimmen, die Christlich-Sozialen
27, 1 % und die Großdeutschen nur mehr 5,2 %. Damit brach, wie
gesagt, die sozialistische Dominanz in der Wiener Kommunalpolitik an. ◆
178
1859–1918
179
180
An der blauen Donau
1848/49
1848/49
WIE ALLES BEGANN
DIE REVOLUTION IN DER KAISERLICHEN
HAUPT- UND RESIDENZSTADT
181
An der blauen Donau
Die bürgerliche Revolution von 1848/49 in der
kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien
Die Freiheit ist eine Wienerin
Die Ereignisse des Jahres 1848 liegen bald 200 Jahre zurück, ihre
historische Bedeutung für Österreich und insgesamt für die Deutschen
ist aber heute noch in der politischen Landschaft und ihren Gliederungen
ablesbar. Damals wurden Forderungen aufgestellt, die zum
großen Teil erst viele Jahrzehnte später erfüllt worden sind, die aber
bis zum heutigen Tag für den freiheitlichen Rechtsstaat grundlegend
Lützows wilde verwegene
Jagd – ein
Freikorps im Kampf
gegen Napoleon:
Dieses Freikorps
trug schwarze
Röcke mit roten
Aufschlägen und
goldenen Knöpfen
182
1848/49
sind. In dieser bürgerlichen Revolution, die den gesamten Deutschen
Bund, also auch die deutschen Erbländer Österreichs, erfasst hatte, spielen
die politischen Vorläufer der Freiheitlichen, die Gründerväter des
national-liberalen Lagers, eine überaus bedeutsame Rolle. Diese wird in
der heutigen wissenschaftlichen Literatur zumeist nicht erwähnt, ebenso
wenig die Rolle der Burschenschafter, die damals sozusagen die Initialzündung
für die Reformation waren.
Die Vorgeschichte der Revolution
In der Folge der Französischen Revolution und der Koalitionskriege
gegen das revolutionäre Pariser Regime kam Napoleon an die Macht
und begann seine Eroberungszüge, die sich über weite Teile Europas
erstreckten. Er zwang auch den in der Wiener Hofburg regierenden römisch
deutschen Kaiser Franz II., die Krone des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation zurückzulegen. Immerhin hatte dieses Reich
183
An der blauen Donau
„
Österreichs Staatskanzler
Fürst Wenzel
Metternich war der
eigentliche starke Mann
in der Führung dieses
Deutschen Bundes.
nahezu 900 Jahre bestanden, und die Habsburger hatten von Wien aus
nahezu ein halbes Jahrtausend lang darüber regiert. Die französischen
Heere unter Napoleon unterwarfen damals weite Teile Europas und
besetzten auch das Territorium des gesamten Deutschen Bundes, mit
Ausnahme von Preußen und Österreich.
Der Widerstand gegen die französische Fremdherrschaft war anfangs
eher zaghaft, einzig und allein der Tiroler Andreas Hofer und die
Spanier wehrten sich gegen Napoleons Armeen. Als dann der aus dem
oberösterreichischen Braunau stammende Dichter Johann Palm von
den Franzosen erschossen wurde, da er eine Kampfschrift mit dem Titel
„Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung“ verfasst hatte, wuchs der
Widerstand gegen die Fremdherrschaft. In den Ländern des Deutschen
Bundes gab es auch so etwas wie eine geistige
Erneuerung, wobei der Hochschullehrer Johann
Gottlieb Fichte „Reden an die deutsche
Nation“ hielt und der Turnvater Friedrich Ludwig
Jahn die Schrift „Deutsches Volkstum“ herausgab.
Im Zuge dieser geistigen Erneuerung
wuchs ein glühender deutscher Patriotismus
heran, der über die innerdeutsche Grenze, der
Duodez-Fürstentümer weit hinausging.
Im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon
kam es auch zur Bildung von Freikorps,
unter ihnen das Freikorps des preußischen Majors
von Lützow. Dieses Freikorps trug schwarze
Röcke mit roten Aufschlägen und goldenen
Knöpfen. Darin sieht man heute gemeinhin
den Ursprung der deutschen Farben schwarz–
rot–gold, die ja zuerst die Farben der Urburschenschaft waren. In diesen
Befreiungskriegen ist die Geburtsstunde des neuen deutschen Nationalgefühls
zu sehen. Bei der Völkerschlacht von Leipzig im Jahre von
1813 unter dem Kommando des Österreichers Fürst Schwarzenberg
wurde Napoleon vernichtend geschlagen. Sein Versuch, bei Waterloo
noch einmal das Ruder herumzureißen, scheiterte, und der Korse wurde
endgültig auf die Atlantikinsel Sankt Helena verbannt.
Auf dem Wiener Kongress, der die Verhältnisse nach den napoleonischen
Kriegen in Europa neu ordnen sollte, wurde im Jahre 1815
der „Deutsche Bund“ als Staatenbund in der Nachfolge des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation gegründet. Er umfasste alle deutschen
Kleinstaaten sowie auch Preußen und Österreich. Der Bundestag
residierte in Frankfurt am Main, und Österreichs Staatskanzler Fürst
Wenzel Metternich war der eigentliche starke Mann in der Führung dieses
Deutschen Bundes.
Unmittelbar nach den Freiheitskriegen kam es im Jahre 1815 auch
zur Gründung von Burschenschaften, die mit den Farben des Lützower
Freikorps schwarz–rot–gold zur Speerspitze des demokratischen Freiheitsstrebens
wurden. Als Reaktion auf die Freiheitsforderungen, die
auf dem Wartburgfest erhoben wurden, führte Metternich die Zensur
ein und baute ein Bespitzelungssystem auf, das alle demokratischen und
nationalen Tendenzen verfolgen sollte. Die so genannte Demagogenverfolgung
richtete sich gegen Studenten und Universitätsprofessoren,
184
1848/49
die sich für Demokratie und Parlamentarismus einsetzten. Man kerkerte
tausende Demokraten ein und drängte das sich emanzipierende Bürgertum
in die biedermeierliche Selbstbeschränkung. Die Burschenschaften
hatten durch diese Maßnahmen nur mehr die Möglichkeit, im Untergrund
zu existieren.
Ein Auflodern der Freiheitsbestrebungen gab es beim Hambacher
Fest im Jahre 1832, wo die burschenschaftlichen Farben schwarz–rot–
gold zu den deutschen Nationalfarben erhoben wurden. Der Frankfurter
Wachensturm, bei dem Burschenschafter versuchten, gefangene
Gesinnungsgenossen zu befreien, war ein weiterer Meilenstein auf dem
Weg zur Revolution.
1848 – die Revolution entflammt
Fürst Metternich, der Kutscher Europas, wie er genannt wurde,
war nunmehr mehr als 30 Jahre im Amt und hatte alle Freiheitsbestrebungen
innerhalb des Deutschen Bundes durch Polizeistaatsmethoden
unterdrückt. Diese Unterdrückung und die Missernten der letzten Jahre
vor der Revolution und die damit anwachsenden sozialen Probleme, die
noch durch die beginnende Industrialisierung verstärkt wurden, sorgten
für wachsende Unruhe in der Bevölkerung – auch in Österreich. Bereits
1844 kam es zu einem Hungeraufstand der schlesischen Weber, der auf
militärische Art und Weise blutig niedergeschlagen wurde.
Das Hambacher
Fest mit 30.000
Beteiligten war
ein Vorbote der
Revolution 1848
185
An der blauen Donau
Bereits Ende 1847 erhoben in Offenburg, in Baden, die Sozialrevolutionären
Friedrich Hecker und Gustav Struve die Forderung,
eine „soziale Republik“ zu errichten. Im Jänner 1848 brachen in den
österreichisch besetzten oberitalienischen Städten Mailand und Padua
blutige Unruhen aus. Auch diese wurden militärisch niedergeworfen.
Und im Februar 1848 schließlich kam es in Frankfurt zur Revolution,
wodurch das Land wieder zur Republik wurde. Dies hatte klarerweise
auch Auswirkungen auf den deutschen Raum, weshalb die vorrevolutionäre
Stimmung weiter angeheizt wurde.
Eine Barrikade
bei der Universität
Wien: Die bewaffnete
Akademische
Legion führte
den Kampf
Und nun wurde Wien zum Zentrum des Geschehens: Am 29. Februar
wurde am Kärntner Tor ein Plakat angeschlagen, auf dem es
hieß, dass Fürst Metternich bereits Mitte März ein gestürzter Mann sein
würde. Dies verursachte innerhalb der Wiener Bevölkerung bereits beträchtliche
Unruhe. Als schließlich der ungarische Revolutionär Ludwig
Kossuth am 3. März im ungarischen Landtag in Preßburg eine Rede
hielt, in der er eine parlamentarische Regierung verlangte, sorgte dies in
Wien für ein weiteres Ansteigen der Unruhe. Schließlich tauchte in der
kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt ein revolutionäres Manifest auf,
in dem gefordert wurde, sich „dem großen Bund der freien Deutschen
Männer“ anzuschließen: „Es gilt einen Kampf auf Tod und Leben, seid
186
1848/49
stark, seid mutig und einig“. Dann kam es zu einer relativ gemäßigten
„Bürger Petition“ der Wiener ohne sonderlich radikale Forderungen,
die den Landständen übergeben wurde.
Nun reagierte man auch in der Führung des Deutschen Bundes, da
man die heraufdämmernde Gefahr offenbar erkannt. Unter dem österreichischen
Vorsitz erklärte der Bundestag am 9. März 1948 in Frankfurt
die schwarz–rot–goldenen Farben zu den
Bundesfarben. Und die Wiener Studenten, organisiert
schon in geheimen Burschenschaften,
versammelten sich am 12. März in der Aula der
Universität. Der Wortführer war der jüdische
Arzt Josef Goldmark, der mit einer Deputation
unter der Führung der Professoren Hye und
Endlicher, geschmückt mit der schwarz–rot–
goldenen Trikolore der Burschenschafter, eine
Petition „an den österreichischen Kaiser Ferdinand“
überreichte. Diese Petition hatten Angehörige
der illegalen „Wiener Burschenschaften
Arminia und Germania“ bereits am 8. März in
der Privatwohnung eines Burschenschafters bei
einem geheimen Treffen erarbeitet. Die Petition
forderte Presse- und Redefreiheit, Freiheit
der Universität, Hebung des Volksunterrichts,
Religionsfreiheit auch für die jüdische Religion,
öffentliche Gerichtsverfahren und Schwurgerichte,
sowie – als wichtigste Forderung – ein vom Volk gewähltes
Parlament und darin auch die Vertretung der deutsch-österreichischen
Erblande. Diese Petition mit diesen Forderungen wurde zwar von Erzherzog
Ludwig entgegengenommen, aber nicht beantwortet.
Nun zündete der revolutionäre Funke: Am 13. März kam es vor dem
niederösterreichischen Landhaus in Wien zu Tumulten. Die Studenten
forderten eine Antwort auf die eingebrachte Petition, und der jüdische
Arzt Adolf Fischhof hielt vor der aufgebrachten Menge eine zündende
Rede, bei der er die Forderungen der Burschenschaft wiederholte. Auch
die Rede Kossuths vom 3. März im ungarischen Landtag wurde verlesen
und löste begeisterte Zustimmung aus. Nun forderte man auch die Abdankung
Metternichs, des verhassten „Kutschers Europas“.
Noch am Vormittag dieses 13. März drangen die Studenten unter
der Führung von Adolf Fischhof während der Sitzung der Stände in
den Landtag ein, und in der ganzen Innenstadt wurden Barrikaden errichtet.
Der kaiserliche Stadtkommandant Erzherzog Albrecht gab dann
um 13 Uhr den Schießbefehl, was fünf Tote und mehr als 500 Verletzte
zur Folge hatte. Der erste so genannte Märzgefallene war der jüdische
Student Karl Heinrich Spitzer.
In den Vorstädten kam es nunmehr parallel zum Aufstand in der Arbeiterschaft.
Diese hatten sich der burschenschaftlichen und bürgerlichen
Revolution angeschlossen, da sie sich durch die sozialen Forderungen der
Burschenschafterpetition vertreten fühlten. Fabriken wurden gestürmt
und Maschinen zerstört, als Protest gegen die nachteiligen Folgen der Industrialisierung.
Das gegen die Wiener Arbeiterschaft eingesetzte Militär
griff hart durch, das Resultat waren 45 Tote.
„
Die Wiener
Studenten, organisiert
schon in geheimen
Burschenschaften,
versammelten sich am
12. März in der Aula der
Universität.
187
An der blauen Donau
„
Nunmehr forderte
der Wiener Bürgermeister
Ignaz von Czapka
die Aufstellung eines
Bürgerkorps als Nationalgarde.
Auch
verlangte man eine
Bewaffnung der Studenten,
die eine
Akademische Legion
bilden sollten.
Dies war den burschenschaftlich
geführten
Studenten
sehr recht, und sie
erklären auch, sich für die Wiederherstellung der Ruhe einzusetzen.
Diese Akademische Legion, in die alle Burschenschafter eintraten,
wurde nach den Studienrichtungen eingeteilt: Da gab es das Technikerkorps,
das Medizinerkorps, etc. Die Studenten trugen die berühmten
dunkelblauen Röcke mit dem schwarz–rot–goldenen Band und die
deutsche Kokarde.
Noch am selben Tag gestattete der Stadtkommandant Erzherzog
Ludwig am späten Abend die Aufstellung der Nationalgarde und der
Akademischen Legion. Sofort begann die Einschreibung und die Waffenausgabe
vor dem Zeughaus am Hof. Doch dann kam es zum eigentlichen
Paukenschlag des ersten Revolutionstags: Um 21 Uhr trat Fürst
Metternich von allen seinen Ämtern zurück und verließ fluchtartig die
Stadt. Die Wiener jubelten und veranstalteten Fackelzüge mit Hochrufen
auf den Kaiser. Bereits am 14. März wurde die Aufstellung der Nationalgarde
und der Akademischen Legion öffentlich proklamiert, und in
einem weiteren Erlass verkündete man die Aufhebung der Zensur und
versprach überdies Pressefreiheit. Sofort erschien daraufhin eine Flut
von Schriften und Plakaten, die von Händlern vertrieben wurden. Das
Denkmal Kaiser Josef II, der im Volksmund „der Deutsche“ genannt
188
1848/49
Das Paulskirchenparlament:
Ein Plenum
von Professoren
und Literaten
wurde, am Wiener Josephsplatz wurde mit einer schwarz–rot–goldenen
Schärpe und einer weißen Fahne mit der Aufschrift „Press-Freiheit
1780“ geschmückt.
Am 17. März kam es schließlich zu den großen Leichenfeiern für die
März-Gefallen auf dem Schmelzer Friedhof. Dabei amtierten ein katholischer
und ein evangelischer Geistlicher und auch ein jüdischer Prediger.
Für die Akademische Legion sprach Professor Füster und in allen Reden
wurde der todesmutige Einsatz der jüdischen Studenten gewürdigt
und die Gleichstellung der Juden gefordert. Als unmittelbare Folge der
Märzrevolution wurde die Stadtverwaltung grundlegend verändert. Aus
den bisherigen Hofställen wurden Ministerien. Am 25. März schließlich
kam es zu einer Petition zur Emanzipation der Juden, wobei eine Delegation
der jüdischen Gemeinde sich an den Kaiser richtete. Antisemitische
Wortmeldungen bewegten Josef Goldmark, einen der Führer der
revolutionären Bewegung, seine Funktion in der Akademischen Legion
niederzulegen. Die Burschenschafter innerhalb der Akademischen Legion
bewogen ihn allerdings, dies nicht zu tun. Schließlich wurde am
29. März die Zensur-Hofstelle aufgelöst und ein neues Pressgesetz veröffentlicht.
Und am 2. April hob der Bundestag in Frankfurt am Main
die noch immer bestehenden Ausnahmegesetze für alle Bundesstaaten,
also auch für Österreich, auf. Das bis dahin bestehende Verbot der deutschen
Farben schwarz–rot–gold fiel, und die burschenschaftliche Fahne
wehte von da an hoch vom Turm des Wiener Stephansdoms für die
ganze Dauer der Revolution.
Schwarz–rot–gold wehte nun überall in Wien. Die Bürger überreichten
auch Kaiser Ferdinand eine schwarz–rot–goldene Fahne, die
er auf dem Balkon der Hofburg zeigte. Am 15. April schließlich kam
es zu einer Fahnenweihe im Stephansdom, wo die schwarz–rot–goldene
Fahne der Tiroler Studentenkompanie gesegnet wurde. Die ganze
Kompanie marschierte unter höchstem Jubel der Bevölkerung zum
Wiener Südbahnhof, und der uralte Pater Haspinger, ein Mitstreiter von
Andreas Hofer aus dem Jahr 1809, begleitete diesen Zug ebenfalls, mit
einem schwarz–rot–goldenen Burschenband um die Brust.
189
An der blauen Donau
Freie Wahlen und der
zweiter Wiener Aufstand
Der Bundestag in Frankfurt erließ im April einen Gründungsaufruf
zur Wahl von Abgeordneten für eine künftige deutsche Nationalversammlung.
Dafür wurden am 18. April die Voraussetzungen veröffentlicht:
Ein Abgeordneter kam auf je 50.000 Einwohner, wobei die
Wahlen für Niederösterreich, wo ja auch Wien als niederösterreichische
Stadt dazugehörte, am 28. April 1848 stattfanden. Diese Wahlen waren
zweifellos die ersten freien demokratischen Wahlen in ganz Deutschland
und damit auch in Österreich.
DIe Akademische
Legion – gemeinsam
stark: Die Arbeiter
gingen gemeinsam
mit den Studenten
auf die Barrikaden
190
1848/49
Am 25. April schließlich wurde die Pillersdorfer Verfassung verkündet.
Sie war vom Innenminister Pillersdorf und nicht, wie versprochen,
von einer Volksvertretung erarbeitet worden und brachte zwar viele der
geforderten Freiheiten, allerdings auch nach wie vor Beschränkungen.
Diese störten die Studenten und Arbeiter, die in der Folge in den ersten
Mai-Tagen demonstrierten und der Obrigkeit die eine oder andere „Katzenmusik“
darboten. Am 5. Mai schließlich
bildete sich das Zentralkomitee aus der Akademischen
Legion, Bürger und Nationalgarde,
das in der Folge zunehmend die eigentliche politische
Macht in Wien übernahm. Unter dem
Sprecher, dem jüdischen Arzt Dr. Goldmark,
brachte der Ausschuss der Studierenden Wiens
eine Petition ein, die im Wesentlichen später
am 15. Mai die sogenannte Sturmpetition
bilden sollte. Am 9. Mai wurden in der neuen
Wahlordnung die Arbeiter vom Wahlrecht
ausgeschlossen, wogegen die Studenten und
die Arbeiter heftigst protestierten. Dies auch
deshalb, da wenige Tage zuvor, am 28. April,
die Wahl zur deutschen Nationalversammlung
in der Frankfurter Paulskirche nach dem Modus
des allgemeinen Wahlrechts durchgeführt
worden war. Damit nahm die Auseinandersetzung
über die Verfassung vor allem durch die
Aktivitäten des „Ausschusses der Studierenden Wiens“ an Dynamik zu.
Als dann am 13. Mai der Kommandant der Nationalgarde, ein
Graf Hoyos, glaubte, die Verfassungsdiskussion unterbinden zu können,
indem er das Zentralkomitee der Akademischen Legion auflöste,
kam es zur zweiten Welle der Revolution von 1848 in Wien: Am
15. Mai versammelten sich zahlreiche Menschen aus dem Bereich der
Akademischen Legion und der Nationalgarde, aber auch der Arbeiterschaft,
vor der Wiener Burg, um die so genannte „Sturmpetition“
zu beschließen. In dieser wurde die Zurücknahme der Pillersdorfer
Verfassung und die Einberufung eines konstituierenden Reichstages
verlangt. Dieser sollte durch allgemeine direkte und freie Wahlen bestimmt
werden. Damit brach die Revolution zum zweiten Male aus,
was zu heftigen Kämpfen führte. Diesmal riskierte die kaiserliche
Regierung keinen ernsten Widerstand und stimmte den Forderungen
zu, wobei der Kaiser der Nationalgarde sogar erlauben musste, die
Burgwache zu stellen. Damit überwachten die Revolutionäre die Ausfahrten
des Kaisers und seiner Familie. Am 16. Mai schließlich erließ
Kaiser Ferdinand eine Proklamation, wo das Wahlrecht, wie es zuerst
vorgesehen war, zurückgenommen wurde und eine neue Verfassung
versprochen wurde. Der Reichstag sollte danach aus einer Kammer
bestehen, die auf der Grundlage des allgemeinen und gleichen Wahlrechts
gewählt werden sollte. Der Kaiser selbst allerdings floh mit seinem
Hofstaat am 17. Mai nach Innsbruck.
In der deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche
waren unter den insgesamt 115 Abgeordneten aus Österreich auch
Vertreter Wiens: An vorderster Stelle Anton Ritter von Schmerling, der
später in der Politik der Habsburger Monarchie noch eine bedeutende
Rolle spielen sollte, dann Alfred Wiesner, Karl Möring und Anton Riehl,
„
In der deutschen
Nationalversammlung
in der Frankfurter Paulskirche
waren unter den
insgesamt 115 Abgeordneten
aus Österreich
auch Vertreter Wiens.
191
An der blauen Donau
„
In der Folge wurde
den Arbeitern auch das
freie Wahlrecht gewährt,
was in der burschenschaftlichen
Petition vom
12. März schon verlangt
worden war.
aber als Abgeordneter der Universität auch der Jude Josef Kuranda. Interessant
war auch, dass die Nationalversammlung am 31. Mai auf Antrag
der österreichischen Delegierten bereits einen Minderheitenschutz
für nichtdeutsche Volksgruppen, insbesondere in Böhmen und Mähren
beschloss. Darin hieß es: §188. Denn nicht deutsch redenden Volksstämmen
Deutschlands ist ihre volksthümliche Entwicklung gewährleistet,
namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, soweit deren
Gebiete reichen, in den Kirchenwesen, dem Unterrichte, der inneren
Verwaltung und der Rechtspflege.“ Im Juni schließlich wurde Erzherzog
Johann von Österreich, der beliebte liberale Habsburger, von der Nationalversammlung
zum deutschen Reichsverweser bestellt.
Die Mai Revolution
– der dritte Wiener Aufstand
Nachdem sich die Lage in der Residenzstadt wieder ein wenig beruhigt
hatte, versuchte die kaiserliche Regierung sofort wieder, das Gesetz
des Handelns in die Hand zu bekommen. Deshalb verfügte sie am
25. Mai die Auflösung der Akademischen Legion und die Schließung
der Universität. Das war der Grund, warum die
Wiener Bürger, Arbeiter und Studenten am 26.
Mai wieder Barrikaden errichteten und für Bürgerrechte
demonstrierten. Zu Kämpfen kam
es allerdings nicht, da die Regierung ihren Beschluss
am 26. Mai wieder zurückzog. Unter der
Führung des jüdischen Arztes Dr. Adolf Fischhof
wurde nunmehr der „Sicherheitsausschuss
der Bürger, Nationalgarden und Studenten zur
Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und
Sicherheit und zur Wahrung der Volksrechte“
gebildet, den die Regierung anerkannte und mit
Behördenfunktionen ausstattete. Dieser Ausschuss
befehligte 6000 Studenten der Akademischen
Legion und etwa 20.000 Arbeiter und
war bald die eigentliche politische Autorität der
Hauptstadt, da der Kaiser nicht in Wien war
und der Reichsrat noch nicht konstituiert war.
Bemerkenswert war, dass in dieser Phase des Revolutionsjahrs die burschenschaftlich
orientierten Studenten nach ihrem Einsatz für die Emanzipation
der Juden für die sozialen Rechte der Arbeiterschaft kämpften. Am
28. Juni wurde von einem Arbeiterkomitee unter der Leitung des
Studenten Willmer, der auch der Arbeiter-König genannt wurde,
eine Arbeiter-Ordnung durchgesetzt. Auch gründete man einen
ersten „allgemeinen Arbeiterverein“, der die Sorge für den Lebensunterhalt
der arbeitenden Massen zum Zwecke hatte. In der
Folge wurde den Arbeitern auch das freie Wahlrecht gewährt, was
in der burschenschaftlichen Petition vom 12. März schon verlangt
worden war. Damit war die Revolution von 1848 in der österreichischen
Haupt- und Residenzstadt auf ihrem Höhepunkt: Am
1. Juli 1848 wurde Johann Nestroys Theaterstück „Freiheit in Kräwinkel“
in Wien uraufgeführt, am 3. Juli erschien die erste Ausgabe der
neuen Tageszeitung „die Presse“, und am 5. Juli fand ein Fackelzug
192
1848/49
für Erzherzog Johann statt, der aus Frankfurt eingetroffen war. Bereits
Ende Juni hatten die ersten freien Wahlen in Österreich zum konstituierenden
Reichstag stattgefunden, und am 8. Juli fasste der Sicherheitsausschuss
den Beschluss, alle Exponenten des alten kaiserlichen Systems
aus der Regierung zu entfernen. Demgemäß trat Innenminister Pillersdorf
zurück, nur Kriegsminister Latour verblieb in seinem Amt. Am
22. Juli schließlich wurde der konstituierende Reichstag in der Winterreitschule
der Wiener Hofburg feierlich eröffnet. Es war dies das erste österreichische
Parlament, welches aus freien Wahlen hervorgegangen ist.
Der deutsche Reichsverweser Erzherzog Johann hielt dabei die Thronrede
und 383 Abgeordnete aus allen sozialen Klassen und aus allen Völkern
der Monarchie, außer Ungarn, stellten sich nun die Aufgabe, eine
neue Verfassung auszuarbeiten, um den Weg von der Revolution zur
konstitutionellen Monarchie einzuschlagen. Am 19. August schließlich
kehrte auch Kaiser Ferdinand aus Innsbruck wieder nach Wien zurück
in die Hofburg.
Oktober 1848:
Kriegsminister Latour
wird „laternisiert“
Der vierte und der fünfte
Wiener Aufstand
Ende August nun wurde den Wiener Arbeitern nun der Lohn gekürzt,
Frauen bekamen überhaupt nichts mehr, und es kam zu spontanen
Protesten der Arbeiterschaft. Bei großen Demonstrationen am
22. und 23. August im Wiener Prater kam es zum Aufstand, an dem sich
193
An der blauen Donau
auch viele Arbeiterinnen beteiligten. In der so genannten Praterschlacht
ging die Nationalgarde, allerdings nicht die Akademische Legion, unnötig
brutal gegen die Arbeiter vor, weshalb es zu 22 Toten kam. Beim Begräbnis
der Opfer solidarisierten sich die Studenten der Akademischen
Legion mit den Arbeitern. Der Sicherheitsausschuss löste sich allerdings
auf, da er nach eigenen Ansichten bei der Arbeiterrevolte versagt hatte.
Dies bedeutete eine deutliche Schwächung der Revolution. Auch die
Entsendung von etwa 30.000 Arbeitern zum Eisenbahnbau in der Provinz,
weit weg von Wien, sollte sich in der Folge bitter rächen. Und
damit zeigte sich, dass das bürgerliche Element sich von den revolutionären
Zielen entfernte und nur mehr die Studenten und die Arbeiter als
Träger der Revolution in Wien übrig blieben.
Ein bedeutender Meilenstein dieses Revolutionsjahres war die am
7. September erfolgte Aufhebung des bäuerlichen Untertanenverhältnis
und der Abgabenpflicht auf Antrag des schlesischen Burschenschafter
Hans Kudlich. Der Bauernbefreier Kudlich war dann auch als Kandidat
für den Wiener Reichstag aufgestellt.
Als es am 13. September zu einer Handwerkerdemonstration kam,
nutzte die Regierung deren Auflösung auch für Maßnahmen gegen die
Studenten. Man schloss die Universität und schickte die Studenten in die
194
1848/49
Ferien, weshalb sich die Zahl der Männer in der Akademischen Legion
auf 1500 verringerte.
Anfang Oktober 1848 schließlich kam es zum fünften und letzten
Wiener Aufstand: Ein Grenadierbataillon hatte sich geweigert,
der Anordnung des Kriegskriegsministers Latour, gegen das revolutionäre
Ungarn zu marschieren, zu folgen. Dieses Bataillon wurde
von der Nationalgarde und von den Studenten der Wiener Akademischen
Legion unterstützt, weshalb es am 6. Oktober zu schweren
Kämpfen mit der Armee auch im Inneren des Stephansdoms kam.
Die Massen waren so aufgebracht über die kaiserliche Armee, dass
sie ins Kriegsministerium eindrangen und den Kriegsminister Latour
an einer Laterne erhängten. Angeblich hatten ihn Mitglieder
der Akademischen Legion vergeblich zu schützen versucht. Nun
kam es zum energischen Einschreiten der kaiserlichen Armee unter
dem Fürsten Windischgrätz, der von Prag aus nach Wien marschierte.
Der Wiener kaiserliche Hof war bereits am 7. Oktober nach Olmütz
geflohen. Mit ihm 20.000 antirevolutionäre Bürger der Stadt.
Nun war die „Aula“, also die Studenten, die einzige Behörde, die
in Wien noch Autorität hatte. Sie vereinte rund 10.000 Arbeiter in
einer so genannten Mobilgarde, wobei am 12. Oktober Menzel Wessenhauser
zum Oberkommandierenden der Nationalgarde ernannt
Eine Spätfolge der
Revolution: Das
provisorische Abgeordnetenhaus
in der
Währinger-straße
von 1861 bis 1883
195
An der blauen Donau
„
Trotz der Niederschlagung
der Revolution
arbeitete der freigewählte
österreichische
Reichstag, der noch immer
in Kremsier tagte,
weiter an einer österreichischen
Verfassung.
wurde. Er gebot über 14.000 Bürger der Nationalgarde, über 10.000
Arbeiter der Mobilgarde und über 1500 Studenten der Akademischen
Legion.
Nun entsandte die deutsche Nationalversammlung aus der Frankfurter
Paulskirche eine Delegation nach Wien zur Unterstützung der
Revolution. Mitglieder dieser Delegation waren der Burschenschafter
Robert Blum und der Jude Moritz Hartmann aus Böhmen, die eine
Unterstützungsadresse überbrachten. Am 16. Oktober schließlich verurteilte
der Kaiser in einem Manifest die Revolution
insgesamt und verlangte von seiner
Armee die Wiederherstellung der Ordnung. Am
20. Oktober bereits war Wien von den kaiserlichen
Truppen eingeschlossen, wobei Windischgrätz
die Auflösung der Akademischen
Legion und die bedingungslose Kapitulation
der revolutionären Stadt forderte. Das frei gewählte
Parlament, der Reichstag, erklärte am
22. Oktober das Vorgehen der Armee als ungesetzlich
und verlegte sich von der Residenzstadt
nach Kremsier in Mähren. Am 23. Oktober
schließlich griffen 72000 kaiserliche Soldaten
die Stadt an, die schonungslos bombardiert
wurde. Wien fiel schließlich am 31. Oktober
1848 nach schrecklichen Verwüstungen und
hatte 2000 Tote zu verzeichnen.
Nun wurden nahezu 16.000 Menschen verhaftet,
alle Zeitungen wurden verboten, am Stephansdom
wehte wieder die kaiserliche Fahne,
und die Standgerichte arbeiteten im Akkord.
Robert Blum wurde, trotz seiner Immunität als Delegierter der deutschen
Nationalversammlung, am 9. November hingerichtet. Der Stadtkommandant
Wenzel Messenhauser am 16. November. Damit war die
deutsche Revolution in Österreich und insbesondere in der kaiserlichen
Haupt- und Residenzstadt gescheitert.
Was von der Revolution blieb ...
Trotz der Niederschlagung der Revolution arbeitete der freigewählte
österreichische Reichstag, der noch immer in Kremsier tagte, weiter an
einer österreichischen Verfassung. Mit dabei waren führende Köpfe der
Revolution wie Kudlich, Fischhof und Goldmark. In einem Entwurf
hieß es in der geplanten Präambel der Verfassung: „Alle Souveränität
geht vom Volke aus“, doch diese Forderung war für die kaiserliche Regierung
nunmehr unannehmbar, da nicht das Volk die Quelle der Souveränität
sein durfte, sondern eben der Monarch von Gottesgnaden.
Erwähnenswert war an diesem Verfassungsentwurf auch „die
Gleichberechtigung der Völker und der Nationen“, doch diese Verfassung
trat nie in Kraft. Der neue österreichische Ministerpräsident Fürst
Felix Schwarzenberg hatte nichts für die demokratischen Bewegungen
übrig. Er war vielmehr ein Vertreter des alten Regimes. Daher wurde
dieser Reichstag von der kaiserlichen Regierung am 7. März 1849 ge-
196
1848/49
waltsam aufgelöst. Am selben Tag noch wurde die sogenannte „Märzverfassung“
oktroiert, also aufgezwungen. In ihr wurden die meisten
der in der Revolution erkämpften Freiheitsrechte und Prinzipien zwar
aufgenommen, aber durch entsprechende einengende Bestimmungen
wiederum beschränkt. Die Pressefreiheit wurde vollends abgeschafft,
das Wahlrecht wurde durch einen Wahl-Zensus beschränkt, die Versammlungsfreiheit
war ebenso stark eingeschränkt. Am 31. Dezember
1851 erließ schließlich der neue junge Kaiser Franz Joseph das so genannte
„Silvesterpatent“, wodurch auch diese März-Verfassung aufgehoben
wurde und der alte Absolutismus als Neoabsolutismus wiederhergestellt
wurde.
Insgesamt fand die bürgerliche deutsche Revolution von 1848 in
der kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien ihren eigentlichen
Schwerpunkt. Neben der preußischen Metropole Berlin, neben dem
revolutionären Zentrum in Südwestdeutschland im badischen Bereich
und natürlich neben der Paulskirche war Wien das eigentliche Zentrum
dieser deutschen Revolution. Absolut legitim führt das nationalliberale,
das freiheitlich-freisinnige Lager in Österreich seinen Ursprung auf
die Revolution von 1848 zurück. Die revolutionären Studenten und
Akademiker, die freiheitsorientierten Bürger und deren Bündnis mit
der Arbeiterschaft waren und sind bis zum heutigen Tag Vorbild für
jede freiheitlich orientierte politische Bewegung in der österreichischen
Hauptstadt.
◆
197
198
An der blauen Donau
Anhang
ANHANG
199
An der blauen Donau
Ergebnisse der
Kommunalwahlen
in Wien seit 1945
D
ie Gemeinderatswahlen sind zugleich Landtagswahlen. Die
sonst bei Gemeinderatswahlen wahlberechtigten Bürger anderer
EU-Mitgliedstaaten, die in der Gemeinde ihren ständigen Wohnsitz haben,
sind daher bei Wiener Gemeinderatswahlen nicht zugelassen.
Jahr SPÖ FPÖ ÖVP Grüne KPÖ NEOS
1945 57,2 34,9 7,9
1949 49,9 6,8 34,9 7,9
1954 52,7 4,6 33,2 8,3
1959 54,4 8,0 32,3 5,2
1964 54,7 5,7 33,9 5,002
1969 56,9 7,2 27,8 2,9
1973 60,1 7,7 29,3 2,3
1978 57,2 6,5 33,8 1,8
1983 55,5 5,4 34,8 3,1 1,1
1987 54,9 9,7 28,4 5,2 1,7
1991 47,8 22,5 18,1 10,9
1996 39,2 27,9 15,3 7,9 8,0
2001 46,9 20,2 16,4 12,4 3,4
2005 49,1 14,8 18,8 14,6 1,5
2010 44,3 25,8 14,0 12,6 1,1
2015 39,6 30,8 9,2 11,8 6,2
200
Anhang
201
An der blauen Donau
Bildquellen:
Umschalg, Seite 8–9: Thomas Ledl/Wikipedia/ CC BY-SA 4.0;Seite 42: Wikipedia/Bwag/CC BY-
SA 4.0; Seite 62: ÖNB / Wenzel-Jelinek; Seite 76: Bwag CC BY-SA 4.0; Seite 108: Wiener Stadtund
Landesarchiv, Presse- und Informationsdienst, FC1:71667
Seite 113: ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung (POR); Seiten 126, 132: Österreichische Nationalbibliothek,
Flugblätter-, Plakate- und Exlibris-Sammlung; Seite 142: Bundesarchiv, Bild 102-
02985A / CC-BY-SA 3.0; Seite 148: dhm.de; Seite 152: unzensuriert.at; Seite 155: Gedenkstätte
Deutscher Widerstand; Seite 201: Grafiken „Wikipedia“;
202