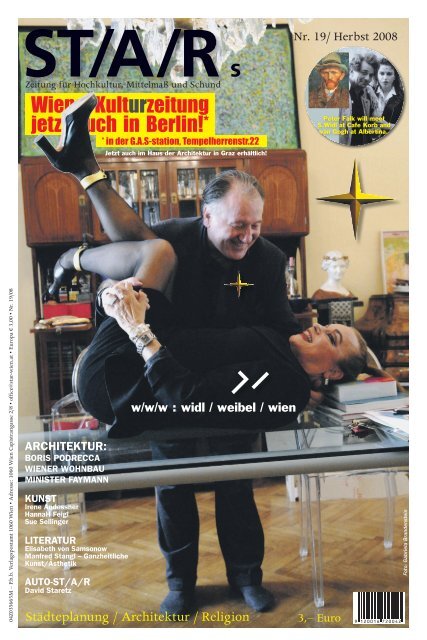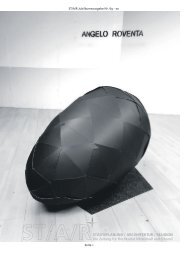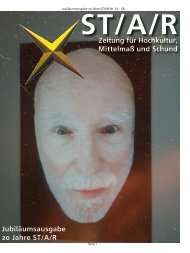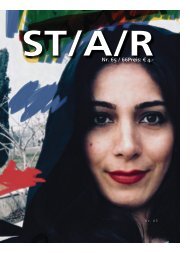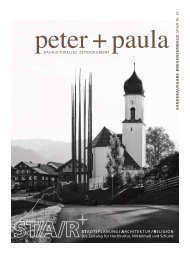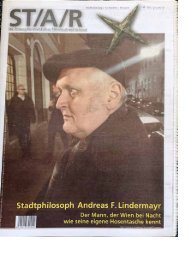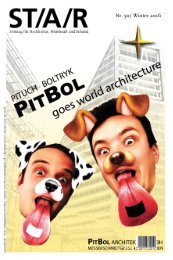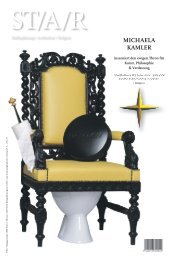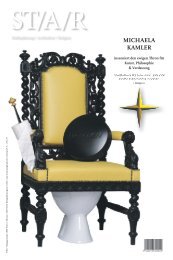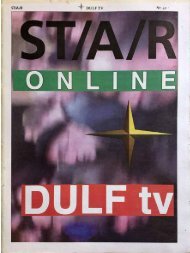ST_A_R_19
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ST</strong>/A/R s<br />
Zeitung für Hochkultur, Mittelmaß und Schund<br />
Nr. <strong>19</strong>/ Herbst 2008<br />
Wiener Kulturzeitung<br />
jetzt auch in Berlin!*<br />
* in der G.A.S-station, Tempelherrenstr.22<br />
Jetzt auch im Haus der Architektur in Graz erhältlich!<br />
Peter Falk will meet<br />
S.Widl at Cafe Korb and<br />
van Gogh at Albertina.<br />
04Z035665M – P.b.b. Verlagspostamt 1060 Wien • Adresse: 1060 Wien Capistrangasse 2/8 • office@star-wien.at • Europa € 3,00 • Nr. <strong>19</strong>/08<br />
ARCHITEKTUR:<br />
BORIS PODRECCA<br />
WIENER WOHNBAU<br />
MINI<strong>ST</strong>ER FAYMANN<br />
KUN<strong>ST</strong><br />
Irene Andessner<br />
HannaH Feigl<br />
Sue Sellinger<br />
LITERATUR<br />
Elisabeth von Samsonow<br />
Manfred Stangl – Ganzheitliche<br />
Kunst/Ästhetik<br />
AUTO-<strong>ST</strong>/A/R<br />
David Staretz<br />
w/w/w : widl / weibel / wien<br />
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
DU<br />
3,– Euro<br />
<br />
Foto: Gabriela Brandenstein
2 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch I Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
EDITORIAL :<br />
Heidulf Gerngross<br />
Ernest erfährt die Welt aus der<br />
Archiquantenwiegenperspektive<br />
Österreichs Biennale Komissärin<br />
Prof.Bettina Götz am 12.09.08<br />
(ARTEC-Architekten) vor dem<br />
Hoffmann-Pavillon in Venedig.<br />
Bericht im nächsten <strong>ST</strong>/A/R<br />
Bettina<br />
28 Mai 2008 – A <strong>ST</strong>AR is born. Ernest Denker-Bercoff,<br />
Sohn von Dr. lit. Brigitte und Dr. art. Christian werden<br />
nach der Geburt ihres <strong>ST</strong>/A/R-Sohnes <strong>ST</strong>/A/R-Ehren<br />
Professorin und <strong>ST</strong>/A/R-Ehren Professor.<br />
Chou<br />
Choupi<br />
Choupa?<br />
Chais pas<br />
Choupichou<br />
Choupicha<br />
Chaipucha<br />
Chaipachi<br />
Choupachu<br />
Choupichu<br />
Chouchouchoupichou<br />
Weiss nich<br />
Ob die Halbmondgondeln,<br />
die Streifschaum<br />
schlagenden,<br />
die Zeit umgeben<br />
oder<br />
ob<br />
Du<br />
mich kennst,<br />
Du, meine Sonnengeburt,<br />
verliebter Natur.<br />
Für *<strong>ST</strong>/A/R*<br />
Von Brigitte und Christian<br />
WIR TRAUERN UM WALTER OBHOLZER<br />
The Making of<br />
Architecture<br />
Ausstellungseröffnung<br />
15.10.2008, <strong>19</strong> Uhr<br />
Az W<br />
Architektur<br />
beginnt im Kopf<br />
im Architekturzentrum Wien<br />
Museumsplatz 1 im 1070 Wien<br />
T++43 -1- 522 31 15, www.azw.at<br />
a-kopf_star-274x205.indd 1<br />
12.09.2008 14:18:58 Uhr
Buch I<br />
Nr. <strong>19</strong>/2008 <strong>ST</strong>/A/R 3<br />
Inhaltsangabe<br />
Buch I - Seite 1–8 Buch II - Seite 9–16 Buch III - Seite 17–24 Buch IV - Seite 25–32 Buch V - Seite 33–36 Buch VI - Seite 37–40 Buch VII - Seite 41–48<br />
Wiener Wohnbau Podrecca<br />
Werner Faymann NAPOLEON<br />
IRENE<br />
LITERATUR<br />
Buch VIII-Seite 49–52<br />
AUTO-<strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch IX - Seite 53–56<br />
WARAN<br />
Buch X - Seite 57–64<br />
GOTTLOB<br />
Impressum<br />
<strong>ST</strong>/A/R Printmedium Wien-Berlin<br />
Europäische Zeitung für den direkten kulturellen Diskurs<br />
Erscheint 4 x jährlich, Nr. <strong>19</strong>/2008,<br />
Erscheinungsort Wien-Berlin<br />
Erscheinungsdatum: 25. September 2008<br />
Medieninhaber:<br />
<strong>ST</strong>/A/R, Verein für Städteplanung/Architektur/Religion<br />
A–1060 Wien, Capistrangasse 2/8<br />
Herausgeber: Heidulf Gerngross<br />
Redaktionelle Mitarbeit: Heidulf Gerngross (Tutti), Wladimir<br />
Jaremenko-Tolstoj (Frutti), Boris Podrecca (Architektur), Elisabeth<br />
von Samsonow (Kunst und Philosophie), Georg Gottlob (Informatik),<br />
Susanne Widl (Gesellschaft), Sue Sellinger (Kunst), Manfred Stangl<br />
(Ganzheitliche Ästhetik),<br />
Hannah Feigl (Kunst), Irene Andessner (Kunst), Rudolf Gerngroß<br />
(Waran), David Staretz (Auto),<br />
Dr. Christian Denker und Brigitte Bercoff (Paris-Brüssel-Wien),<br />
Oxana Filippova (Theater), Valie Airport (Russland), Angelo Roventa<br />
(Rumänien), Christian Schreibmüller (Literatur), Philipp Konzett<br />
(Galerie), Andreas Lindermayr (Gesellschaftsphilosoph)<br />
Organisation: <strong>ST</strong>/A/R-Team<br />
Artdirektion & Produktion: Mathias Hentz<br />
Druckproduktion: Michael Rosenkranz<br />
Druck: Herold Druck und Verlags AG, Wien<br />
Vertrieb: <strong>ST</strong>/A/R, Morawa GmbH.<br />
Aboservice: starabo@morawa.com<br />
oder: starabo@morawa.com<br />
Bezugspreis: 3,- Euro (inkl. Mwst.)<br />
Kontakt: grafik@star-wien.at” grafik@star-wien.at<br />
Redaktion: editors@star-wien.at” editors@star-wien.at<br />
Adresse: Capistrangasse 2/8, 1060 Wien<br />
0043-1-89-024-56, 0043-664-521-3307 Österreich<br />
Cover: Susanne Widl und Peter Weibl<br />
<strong>ST</strong>/A/R wird gefördert von: Bundeskanzleramt und Stadt Wien.<br />
<strong>ST</strong>/A/R ist ein Gesamtkunstwerk und unterliegt dem Urheberrecht.<br />
<strong>ST</strong>/A/R dankt allen BeitragslieferantInnen, MitarbeiterInnen,<br />
KünstlerInnen,<br />
Kunst + Politik<br />
Aus der Sammlung der Stadt Wien<br />
noch bis 10. Oktober 2008<br />
Florentina Pakosta, »Faust«, <strong>19</strong>82<br />
Carlos Scliar, »Uniao pela Paz«, <strong>19</strong>51<br />
Kann Kunst ein wirksames Mittel zur Veränderung der Verhältnisse, auch der Politik sein?<br />
MUSA – MUSEUM AUF ABRUF<br />
Felderstraße 6-8, Wien 1<br />
Neben dem Rathaus<br />
Eintritt frei<br />
Di–Fr 11.00–18.00, Do 11.00–20.00<br />
Sa 11.00–16.00<br />
www.musa.at<br />
Inserat_274x100.indd 1<br />
Feldenkrais und wir – Selbstverständlich!<br />
26.08.2008 17:26:02 Uhr<br />
wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt, bin ich sonntags immer bei Fips und Helga,<br />
neuerdings in der Stiegengasse, feldenkraisen. Dieses eminent sinnvolle Ritual besteht für<br />
mich schon seit mehr als drei Jahren. Angefangen hat es 2005, damals noch im Sitzungssaal der<br />
Agentur Goldfish am Stubenring. Wo üblicherweise werktags Köpfe rauchen, um irgendwelche<br />
Werbestrategien auszuhecken, fing ich endlich an, nach Möglichkeit Sonntag abends immer, den<br />
Anweisungen von Fips (Philipp Ruthner) zufolge, am Boden liegend, in schöner Regelmäßigkeit<br />
mein Körperschema durchzugehen. Der Mensch ist schließlich nicht nur Hirn!<br />
Meist augenzwinkernd mit dabei, mein Freund und Gegenspieler M. Du Schu, dem ich diesen<br />
wertvollen Tip verdanke.<br />
Damals bei Goldfish, erinnere ich mich, saß Fips in der Regel immer auf einem an die Wand gerückten<br />
Sitzungstisch, wo der junge Skater, Füsse baumelnd, seine Anleitungen gab.<br />
Man nahm sich eine von den übereinander getürmten Decken in einem Eck des Sitzungszimmers,<br />
so man nicht, stets gut gerüstet wie ManfreDu, im Besitz einer eigenen Matte war, breitete diese<br />
über das Parkett und legte sich flach auf den Rücken. Man schloss die Augen und machte sich<br />
zunächst bewusst, wie man da liegt, wie die linke Körperhälfte, die rechte Körperhälfte organisiert<br />
ist, ortete die Punkte wo und wie die Wirbelsäule aufliegt usw.<br />
Ab dem das Körperschema durchgegangen und in psychomentaler Hinsicht eine gewisse Ruhe<br />
eingetreten war, konnte die eigentliche Stunde beginnen, die sich in der Regel auf eine reduzierte<br />
Wechselbeziehung von Muskel-an und -entspannung, Körperhaltung, Atmung und Vorstellung<br />
dessen, was man tut, beziehungsweise zu tun beabsichtigt, belief.<br />
So versetzten wir uns eines Tages in das Säuglingsstadium und nuckelten in der Imagination an<br />
Mutters Brust, ganz auf taktile Empfindungen gerichtet, wie sie diesem frühen Stadium entsprechen<br />
und eigentlich noch immer irgendwie wirksam sind. Und seltsam, was plötzlich für Erinnerungen<br />
dämmerten! Ein anderes mal machten wir uns erst im Uhrzeigersinn, dann gegenläufig,<br />
den Bereich um das Steißbein herum bewusst, beziehungsweise viel bewusster, als das normalerweise<br />
der Fall ist. Fips machte mich gerade am Beginn meines regelmäßigen Feldenkraisens<br />
immer wieder darauf aufmerksam, dass weniger mehr ist, dass es darum geht, quasi mühelos das<br />
Beabsichtigte auszuführen. Dass es darum geht, Qualität in alle Bewegungen hineinzubringen,<br />
indem man sich diese bewusst macht. Und immer wieder: “meide parasitäre Bewegungen!”<br />
Das ist in etwa das diametral Entgegengesetzte zu dem, was mir in meiner Kindheit durch Lehrer<br />
und Erzieher eingetrichtert und oft eingebläut wurde. Als zu beaufsichtigendes Individuum hatte<br />
man vor allen Dingen einmal zu gehorchen und dann, sich gefälligst anzustrengen. Man sollte<br />
unter Furcht und Zittern in Schweiß ausbrechen: nur so war es gut. So wurden brave, willfährige<br />
Untertanen herangezogen. Ein solcher war ich durchaus. Wäre nicht ein schwerer Unfall, in dessen<br />
Folge viel Zeit zur Muße und eine zur Gewohnheit gewordene Beschäftigung mit philosophischen<br />
Gegenständen dazwischen gekommen, ich würde noch immer diesen fragwürdigen Grundsätzen<br />
folgen und darauf schwören, wie auf das in Aussicht gestellte Strafgericht Gottes. Typisch für diesen<br />
Untertanen-Kontext war, dass man uns bei jeder Gelegenheit einschärfte: “Brust heraus, Bauch<br />
hinein!”<br />
Moshe Feldenkrais lehrte kurioser Weise genau das Gegenteil. Es sollte der Bauch herauskommen!<br />
Der junge Physiker, der in den Dreißigerjahren in Paris lebte, machte zu dieser Zeit Bekanntschaft<br />
mit dem japanischen Judo-Meister Kano und popularisierte dessen Kampfkunst in Frankreich. Wer<br />
sich je mit Judo befasste, weiß, wie wichtig die Fallschule ist. Wie bei allen fernöstlichen Kampfkünsten,<br />
die dem Taoismus, Chan- oder Zen-Buddhismus<br />
entspringen, geht es vor allem darum, seine Bewegungen<br />
aus der Körpermitte, aus Hara, steuern zu lernen - man verbündet<br />
sich gleichsam mit der Schwerkraft. Das wurde zu<br />
einem soliden Ansatz für eine originelle Physio-Therapie.<br />
Wichtige Anregungen verdankte Feldenkrais weiters dem<br />
amerikanischen Hypnotherapeuthen Milton Erikson und<br />
dem griechisch-armenischen Philosophen Georg I. Gurdjieff,<br />
der in den Dreißigerjahren in Fontainebleau, nähe<br />
Paris, sein Institut und so manchen gut zahlenden Erben<br />
begüterteter Bourgois, an der Nase herum führte. Denn mit<br />
irgendeinem Mode-Trend hatte Gurdjieff partout nichts am<br />
Hut. Unter seiner Leitung galt es zunächst einmal den Verfänglichkeiten<br />
persönlicher Eitelkeit den Kampf anzusagen,<br />
den Staub von den Schuhen zu schütteln und zu erkennen,<br />
welcher Kategorie von Idiotie man zugehört. “Was für ein Idiot bist du? Ein rechteckiger, quadratischer,<br />
runder oder gar zick-zackiger?” Denn man sollte sich nicht zu wichtig nehmen. Grudjieff<br />
ließ seine Schüler die verrücktesten Bewegungen durchführen, da der Panzer fragwürdiger Verhaltensmuster<br />
schwer aufzubrechen und der Weg für ein spielerisches Lernen meist verschlossen ist.<br />
Feldenkrais kehrte diesen etwas gewalttätigen therapeutischen Ansatz um. Seit mittlerweile drei<br />
Jahren profitiere ich davon. Seit Fips und Helga in die Stiegengasse gezogen sind, halte ich dort,<br />
nach Möglichkeit jeden Sonntag, das Feldenkrais-Ritual ab.<br />
Man trifft sich erst in der geräumigen Küche, trinkt Tee, begrüßt die Neuankommenden, stellt fest,<br />
dass der eine oder die andere nach längerem Aussetzen doch wieder dabei ist, bemerkt ein neues<br />
Gesicht und widmet sich wieder dem kleinen Skelett, einer eindeutig zweideutigen Anatomie-Lernhilfe<br />
für Fips.<br />
Nach einer Viertelstunde entspannter Plauderei, ab in den Therapie-Raum!, der durch Helga’s<br />
Schwangerschaft eingeweiht wurde. - Das Ergebnis dieses organischen Prozesses, klein Kolo,<br />
bringt sich seit einem Jährchen mitunter durch Lallen und Schreien im Nebenraum in Erinnerung,<br />
analog zu den Bewegungen, die wir, meist auf dem Rücken liegend, aber auch stehend, manchmal<br />
kniend, manchmal dicht an dicht, dann wieder, wegen geringerer Teilnehmerzahl als aufgelockertes<br />
Grüppchen, aber immer im Bewusstsein dessen, was man tut, durchexerzieren. Was wir da so<br />
tun, erinnert mich an einen Begriff von Lacan. Um auf sein verborgenes Wesen zu kommen, reicht<br />
es nicht hin, dass man es analysiert, es erfordert, dass es aus dem Unbewußten evoziert werde,<br />
manchmal in langen Prozessen, manchmal ad hoc. Es bleibt einem jedoch nicht erspart, sich<br />
darum zeitlebens auf adäquate Weise zu bemühen, wie Feldenkrais es nahelegt. Derartige Bemühungen<br />
sind in etwa das, was die vorsokratischen Philosophen Ethos nannten. Das Ziel all dieser<br />
Bemühungen ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen, jene Wahrheit, die im Spannungsfeld von<br />
Physis und Logos gleichsam geboren wird: Unschuld des Werdens, Alitheia. Aristoteles nannte die<br />
sogenannten Vorsokratiker, Physiologoi. Genau das, denke ich, trifft auch auf Feldenkrais zu.“-<br />
Hegel - um einen Philosophen der neueren Zeit zu nennen - bezeichnet die Philosophie als die<br />
verkehrte Welt “, sagt Heidegger in seiner berühmten Metaphysik-Einführung. Wir sind zwar noch<br />
nie in unseren sonntäglichen Therapie-Stunden so weit gekommen, dass wir auf den Kopf standen,<br />
es scheint aber alles darauf hinaus zu drängen. Und jedes mal nach so einer Therapie-Stunde stelle<br />
ich erstaunt wieder an mir fest, dass ich mich wie neugeboren fühle.
Städteplanung / Architektur / Religion Buch I <strong>ST</strong>/A/R 5<br />
WIDL’S<br />
CAFE KORB<br />
AKTIVE KULTURSZENE –<br />
BE<strong>ST</strong>E WIENER KÜCHE –<br />
WIENER CAFE<br />
Cafe Korb, 1010 Wien, Brandtstätte. 9<br />
Tel.: 533 72 15 – www.cafekorb.at – suewidl@aon.at<br />
Das Cafe Korb ist<br />
meine Heimat und mein<br />
Exil, meine Lust und<br />
meine Last.<br />
Fotos: Heidorf Gerngross<br />
Widl<br />
Weibel<br />
Ralph schilcher<br />
Skulptur Gundi Dietz<br />
Ein Wurf ein Lebenswurf<br />
Peter Sloterdijk sagt:<br />
Nie konnte ich die glänzenden Bilder von<br />
Susanne Widl aus ihren heroischen Tagen sehen,<br />
ohne an die Zeile aus Charles Baudelaires Gedicht<br />
„An eine, die vorüberging“<br />
zu denken:<br />
„enteilende Schönheit, die mich mit einem Schlage<br />
wieder zum Leben erweckte.“<br />
Weibel<br />
Widl<br />
Elfriede Jelinek sagt:<br />
Über die Seele des Café Korb, Susanne<br />
Widl, Model und Performancekünstlerin,<br />
schrieb Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek:<br />
„Ein Fels auf Schlittschuhen, eine<br />
dämonische Schönheit, so etwas habe<br />
ich noch nicht gesehen.“ Was kann man<br />
mehr einem Kaffeehaus preisen.<br />
Susanne Widl:<br />
Gelebter Eigensinn<br />
ist wichtiger<br />
als Eigentum.<br />
G.Jonke<br />
Buchpräsentation im Cafe Korb<br />
von ZENITA KOMAD<br />
Korb News:<br />
Ω Die Artlounge wird zur neuen Broadwaybar.<br />
Ω Im Herbst 2009 gibt es einen Film der heißt:<br />
“Cafe Korb – die klassischen Wiener Ober mit der<br />
kunstsinnigen extravaganten Susanne Widl”<br />
Ω Im Residenzverlag erscheint eine Autobiographie:<br />
“Susanne Widl - Ein Wurf ein Lebenswurf<br />
markus<br />
mittringer<br />
Franz Graf<br />
Peter Sloterdijk<br />
Widl
6 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch I Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Kunsthalle Wien<br />
immer aktiv<br />
Spencer<br />
Tunick<br />
Matt
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch I<br />
<strong>ST</strong>/A/R 7<br />
Für das Leben in der Stadt ...<br />
ist die Wohnung „Ihr Kulturgut“.<br />
Dieser Philosophie setzen wir seit Jahrzehnten mit<br />
unseren Wohnhausanlagen in ganz Wien Denkmäler;<br />
als Mittelpunkt pulsierenden Lebens, entspannter<br />
Erholung und des Wohlfühlens.<br />
Überzeugen Sie sich:<br />
www.gesiba.at, Telefon: 53477-0<br />
Fair living<br />
Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft,<br />
A-1013 Wien, Eßlinggasse 8-10, e-mail: office@gesiba.at<br />
Leistbarer,<br />
qualitätsvoller<br />
Wohnraum.<br />
EGW<br />
Erste gemeinnützige<br />
Wohnungsgesellschaft<br />
Heimstätte Gesellschaft m.b.H.<br />
Emil-Kralik-Gasse 3, 1050 Wien<br />
Telefon +43 / 1 / 545 15 67 - 0<br />
Telefax +43 / 1 / 545 15 67 - 40<br />
www.egw.at<br />
GEMEINNÜTZIG · QUALITÄTSBEWUS<strong>ST</strong> · MENSCHLICH · INNOVATIV
8 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch I Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Galerie Konzett | Contemporary Art<br />
DU<br />
Galerie Konzett | Spiegelgasse 21 | A-1010 Wien<br />
T +43 1 513 01 03 | F +43 1 513 01 04 | gallery@artkonzett.com | www.artkonzett.com<br />
Öffnungszeiten: Di – Fr 11-18 Uhr, Sa 11-17 Uhr
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch II - Wiener Wohnbau <strong>ST</strong>/A/R 9<br />
GEFÖRDERTES WOHNEN IN WIEN<br />
DR. MICHAEL LUDWIG<br />
DR. MICHAEL LUDWIG<br />
WIENER WOHNBAU<strong>ST</strong>ADTRAT
10 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch II - Wiener Wohnbau Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
<strong>ST</strong>ADTRAT LUDWIG<br />
„INNOVATION UND SOZIALE VERANTWORTUNG BE<strong>ST</strong>IMMEN DEN WOHNBAU DES 21. JAHRHUNDERTS“<br />
Wiener Wohnbaustadtrat unterstreicht bei<br />
den Architekturgesprächen im Rahmen des<br />
Forum Alpbach die Bedeutung des geförderten<br />
Wohnbaus<br />
„Neue Familienformen, höhere Lebenserwartung, verstärkte<br />
Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt stellen zunehmend<br />
neue Herausforderungen für den geförderten Wohnbau<br />
dar. Es geht heute – mehr denn je – um maßgeschneiderte<br />
Wohnlösungen, die den soziodemographischen<br />
Veränderungen und den unterschiedlichen Bedürfnissen<br />
der Menschen in allen Lebenslagen entsprechen, und es<br />
geht vor allem darum, weiterhin leistbares Wohnen für<br />
alle Menschen sicher zu stellen. Die laufende Entwicklung<br />
innovativer Konzepte für Bau- und Wohnkulturen ist das<br />
Gebot der Stunde“, erklärte der Wiener Wohnbaustadtrat<br />
Dr. Michael Ludwig im Rahmen der Architekturgespräche<br />
beim Forum Alpbach im August 2008. „Neue Grundrisse,<br />
flexible Innenraumgestaltung, Multifunktionalität und<br />
Mehrfachnutzung von Wohnflächen, neuartige Übergänge<br />
vom privaten in den öffentlichen Raum sowie soziale<br />
Grünraumgestaltung sind dabei nur einige der wesentlichen<br />
Aspekte, die im geförderten Wohnbau in Wien bereits<br />
heute eine zentrale Rolle spielen. Durch viel Kreativität<br />
und Innovationskraft wird Wien auch im 21. Jahrhundert<br />
seiner sozialen Verantwortung und seiner jahrzehntelangen<br />
internationalen Vorreiterrolle im geförderten Wohnbau<br />
gerecht werden.“****<br />
Soziale Verantwortung und leistbares Wohnen<br />
Kaum eine andere Großstadt kann, was insbesondere den<br />
geförderten Wohnbau betrifft, mit mehr Recht von einer<br />
vorbildlichen Baukultur sprechen, als Wien. Der soziale<br />
Wohnbau in Wien mit seiner jahrzehntelangen Tradition<br />
und seiner Modernität gilt weltweit als Musterbeispiel. In der<br />
aktuellen Mercer-Studie, die international die Lebensqualität<br />
in 215 Städten vergleicht, nimmt Wien weltweit den 2. Rang,<br />
und innerhalb der EU sogar den 1. Platz ein – wobei gerade<br />
der Bereich Wohnen, der mit 10 von 10 möglichen Punkten<br />
bewertet wird, einen ganz wesentlichen Anteil daran hat.<br />
Der geförderte Wohnbau in Wien ist Instrument und<br />
Ergebnis einer jahrzehntelangen Politik des sozialen<br />
Ausgleichs und der sozialen Durchmischung in der<br />
Stadt. Sensible Wohnbau- und Sanierungspolitik und<br />
der erfolgreiche Weg der Sanften Stadterneuerungen<br />
zeichnen dafür verantwortlich. Leistbares Wohnen für alle<br />
Bevölkerungsschichten steht dabei im Mittelpunkt. 60% der<br />
WienerInnen leben in geförderten Wohnungen.<br />
Wohnen im 21. Jahrhundert – neue Innovation in Planung<br />
und Architektur<br />
Schon die Anfänge des geförderten Wohnbaus in Wien waren<br />
von höchster architektonischer Qualität gekennzeichnet,<br />
und diese Tradition setzt sich bis heute fort. „Namhafte<br />
ArchitektInnen zeichneten für geförderte Wohnbauten<br />
in Wien verantwortlich. Architektonische Qualität und<br />
Innovation ist – neben Ökonomie und Ökologie – eine der<br />
drei Säulen des geförderten Wiener Wohnbaus“, betonte<br />
Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig.<br />
Neue Familienformen, höhere Lebenserwartung, verstärkte<br />
Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt stellen neue<br />
Herausforderungen für den geförderten Wohnbau dar.<br />
Es gehe heute um maßgeschneiderte Wohnlösungen,<br />
die den soziodemographischen Veränderungen und<br />
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Menschen in<br />
allen Lebenslagen entsprechen, und weiterhin leistbares<br />
Wohnen für alle Wienerinnen und Wiener sicherstellen.<br />
„Neue Grundrisse, flexible Innenraumgestaltung,<br />
Multifunktionalität und Mehrfachnutzung von<br />
Wohnflächen, neuartige Übergänge vom privaten in den<br />
öffentlichen Raum, soziale Grünraumgestaltung sind<br />
dabei nur einige Aspekte, die im geförderten Wohnbau in<br />
Wien bereits heute eine zentrale Rolle spielen. Darüber<br />
hinaus setzen wir ab 2009 über das Instrument der<br />
Bauträgerwettbewerbe einen besonderen Schwerpunkt<br />
für die Entwicklung und Realisierung neuer Wohnformen<br />
setzen, die noch stärker Innovation mit hohem<br />
Kostenbewusstsein verbinden“, erklärte Stadtrat Ludwig.<br />
„Zudem werde ich auch den Meinungsaustausch und die<br />
gemeinsame Ideenfindung über Diskussionsplattformen<br />
forcieren. Neben ArchitektInnen und VertreterInnen von<br />
Bauträgern und der Bauwirtschaft lade ich dazu auch<br />
ExpertInnen, die nicht aus der Wohnbaubranche kommen,<br />
ein.“ Damit werde nicht nur interdisziplinäres Wissen<br />
zusammengeführt, sondern sollten auch ganz bewusst<br />
neue Zugänge eröffnet werden.<br />
„Die laufende Entwicklung innovativer Konzepte für<br />
Bau- und Wohnkulturen ist das Gebot der Stunde“,<br />
so Ludwig. „So arbeiten wir in Wien – in Fortführung<br />
der erfolgreichen Wohnbaupolitik – bereits heute an<br />
den Lösungen für morgen. Durch viel Kreativität und<br />
Innovationskraft wird Wien auch im 21. Jahrhundert seiner<br />
sozialen Verantwortung und seiner jahrzehntelangen<br />
internationalen Vorreiterrolle im geförderten Wohnbau<br />
gerecht werden.“<br />
csi<br />
KABELWERK – EIN <strong>ST</strong>ÜCK <strong>ST</strong>ADT<br />
ARCHITEKTUR: WERK<strong>ST</strong>ATT WIEN
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch II - Wiener Wohnbau<br />
<strong>ST</strong>/A/R 11<br />
Das Wohnen als kulturelle<br />
Ausdrucksform unseres Lebens<br />
du<br />
Zur Zeit der letzten Jahrhundertwende war die Wohnsituation in den europäischen Städten fürchterlich.<br />
Ein Ergebnis der industriellen Revolution, die Millionen von Arbeitern in die Städte trieb. Wien,<br />
Reichshauptstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte gerade die Gründerzeit bewältigt, die<br />
Schleifung der mittelalterlichen Basteien öffnete die alte Stadt zu den Vororten, und die alte kleinteilig<br />
barocke Struktur der Stadt wurde von rationalen Zinskasernen verdrängt. Eine Struktur der Stadt, die bis heute<br />
besteht.<br />
Dagegen etablierte sich der soziale Wohnbau in ganz Europa und in Wien ganz besonders, um die miserablen<br />
Wohnverhältnisse zu bekämpfen. Sozialer Wohnbau bedeutet, dass der Staat eine öffentliche Verantwortung und<br />
Kontrolle über die Höhe der Mieten und die Qualität des Wohnbaus übernimmt. Der Wohnbau ist damit dem freien<br />
Markt entzogen, dafür ermöglichen niedrige Mieten auch niedrige Löhne und folglich eine höhere Produktivität<br />
der Wirtschaft. Der Wohnbau als System wird als wesentliches Steuerungsinstrument verstanden, das innerhalb der<br />
Stadt einen sozialen Ausgleich ermöglicht, das Gentrification und Verslumung verhindert. Zudem ermöglicht die<br />
öffentliche Kontrolle des Wohnbaus auch die Sicherung einer architektonischen Qualität.<br />
Weltweite Aufmerksamkeit erlangt das “Rote Wien” mit seinen “Superblocks”, deren Architekten zum großen<br />
Teil von Otto Wagner ausgebildet waren. Folgten diese noch einer traditionellen Architektursprache, so wurde die<br />
Moderne in neuen Siedlungen realisiert.<br />
Nach der Nazizeit und dem Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg wurde in den achtziger Jahren das System des<br />
Wiener Wohnbaus verfeinert, den heutigen Bedürfnissen angepasst. Mit hoher architektonischer Qualität wird auf<br />
die verschiedenen städtebaulichen Situationen reagiert. Beispielhafte Lösungen wurden realisiert. Die öffentlichen<br />
Förderungen, die politische Verantwortung, die engagierten Bauträger und hervorragenden Architekten - sie<br />
garantieren auch heute leistbare Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen mit einer architektonischen Haltung,<br />
die den Wohnbau als wesentlichen kulturellen Ausdruck des Lebens proklamiert.<br />
Vorwort von Dietmar Steiner, Direktor Architekturzentrum Wien,<br />
aus dem Ausstellungskatalog „Wiener Wohnbau – Innovativ. Sozial. Ökologisch“<br />
FRAUEN-WERK-<strong>ST</strong>ADT UND KULTURPALAIS<br />
EINGANG OSWALDGASSE
Städteplanung / Architektur / Religion Buch II - Wiener Wohnbau <strong>ST</strong>/A/R 13<br />
02., VORGARTEN<strong>ST</strong>RASSE<br />
21., ORA<strong>ST</strong>EIG Grünes Wohnen, umweltfreundliches Bauen<br />
22., RENNBAHNWEG 52 – Bauteil B und C<br />
Bauträger:<br />
- Wien Süd Gemn. Bau- und Wohnungsgenossenschaft<br />
- Gesiba Gemn. Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft<br />
- EGW Heimstätte Gesellschaft m.b.H.<br />
- Bauträger Heimat Österreich gemn. Wohnungsund<br />
Siedlungsgesellschaft<br />
,<br />
ORAG<strong>ST</strong>EIG, ARCHITEKTEN: PPAG<br />
VORGARTEN<strong>ST</strong>RASSE, ARCHITEKTEN: PPAG<br />
Paul (4 1/2 ), Constantin (8), Vinzenz (4)<br />
RENNBAHNWEG, ARCH. WERNER KRAKORA – ARCH. FRANZ WAFLER<br />
Bauen wir für unsere Kinder?
14 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch II - Wiener Wohnbau Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
WIENER WOHNBAU INTERNATIONAL GEFRAGT<br />
Auf der diesjährigen Architektur-Biennale in<br />
Venedig steht eine bemerkenswerte Ausstellung<br />
im Programm: „Housing in Vienna – Wiener<br />
Wohnbau. Innovativ. Sozial. Ökologisch“. Diese<br />
Ausstellung, konzipiert von der Stadt Wien und dem<br />
Architekturzentrum Wien, und gestaltet vom Wiener<br />
Team SPAN-Architekten wurde am 12.9.2008 durch<br />
Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig eröffnet und wird<br />
bis 3.10.2008 im Palazzo der Fakultät für Raumplanung<br />
und Abteilung für Planung (Facoltà di Pianificazione<br />
del territorio and Dipartimento di Pianificazione) der<br />
Universität Venedig (Università di Venezia, IUAV) zu<br />
sehen sein und internationalem Publikum einen Überblick<br />
über die Geschichte des sozialen Wohnbaus Wiens von<br />
den Anfängen in den <strong>19</strong>20er Jahren bis hinauf in die<br />
Gegenwart bieten.<br />
Während für Wiener und Wienerinnen die hohen<br />
Standards des Wohnen zu den selbstverständlichen<br />
Merkmalen ihrer Stadt gehören, pilgern seit Jahrzehnten<br />
Jahr für Jahr zahlreiche ausländische Wohnbauexperten<br />
in unsere Stadt um vor Ort die Errungenschaften des<br />
geförderten Wohnbaus zu bewundern, die weltweit<br />
einzigartig sind.<br />
Allein schon die Zahlen liefern ein eindrucksvolles<br />
Bild. Fast 60 Prozent aller Wiener Haushalte befinden<br />
sich in geförderten Wohnungen, 220.000 davon in<br />
Gemeindebauten. Jährlich investiert die Stadt in den Bau<br />
weiterer 7.000 geförderter Wohnungen, das sind rund 80<br />
– 90 Prozent des gesamten Neubauvolumens. Rund 600<br />
Mio. Euro Wohnbauförderungsmittel fließen jährlich in<br />
den Neubau, in großzügige Sanierungsvorhaben und in die<br />
Wohnbeihilfe. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern<br />
verwendet Wien die gesamte Wohnbauförderung des<br />
Bundes tatsächlich für Wohnen, und legt als Stadt noch<br />
beträchtliche Mittel drauf. Das Ergebnis kann sich sehen<br />
lassen. Der Spitzenplatz, den Wien im Mercer-Survey,<br />
einem weltweiten Vergleich der Lebensqualität in Städten,<br />
regelmäßig einnimmt, ist nicht nur der Kultur, der hohen<br />
sozialen Sicherheit und dem engagierten Umweltschutz<br />
Wiens geschuldet, sondern vor allem der Wiener<br />
Wohnpolitik, die dort stets 10 von 10 möglichen Punkten<br />
erreicht.<br />
Doch nicht nur die Zahlen beeindrucken. Seit seinen<br />
Anfängen zeichnet sich der soziale Wohnbau auch<br />
durch hervorragende Architektur aus. Namhafte<br />
Architekten unterstützten im Auftrag der Stadt bereits die<br />
Siedlerbewegung, die Anfang der <strong>19</strong>20er Jahre, als in Wien<br />
höchste Wohnungsnot herrschte, zur Selbsthilfe schritt um<br />
sich vor den Toren der Stadt mittels Eigenbau Wohnraum<br />
zu schaffen. An den eindrucksvollen Bauten des Roten<br />
Wien der <strong>19</strong>20er und Beginn <strong>19</strong>30er Jahre waren führende<br />
Architekten wie z.B. Peter Behrens, Josef Frank, Hubert<br />
Gessner, Clemens Holzmeister und Adolf Loos beteiligt.<br />
Die Tradition hochwertiger Architektur setzt sich im<br />
geförderten Wohnbau Wiens bis heute fort.<br />
<strong>19</strong>23 führte die sozialdemokratische Wiener Stadtregierung<br />
Wiens die Wohnbausteuer ein und baute mit den<br />
Mitteln dieser Abgabe bis <strong>19</strong>34 61.175 Wohnungen in<br />
348 Wohnhausanlagen. Um soziale Durchmischung<br />
zu sicher zu stellen, wurden die Gemeindebauten die<br />
ganze Stadt verstreut errichtet, auch in den so genannten<br />
„Nobelbezirken“. Zum Symbol des Roten Wien wurde<br />
der Karl-Marx-Hof mit seinen – für die damalige Zeit<br />
fast luxuriös ausgestatteten – 1.200 Wohnungen,<br />
zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen und großzügig<br />
begrünten Innenhöfen. Der Errichtung dieser Bauten<br />
und ihrer Architektur lag ein sozialdemokratisches<br />
Gesellschaftskonzept zugrunde, das auf die Emanzipation<br />
der arbeitenden Menschen und insbesondere der Frauen<br />
zielte.<br />
Während des Ständestaats und des nationalsozialistischen<br />
Regimes wurden Tausende Sozialisten, Gewerkschafter<br />
und Juden aus den Gemeindebauten vertrieben. Der<br />
Weltkrieg führte schließlich zur Zerstörung von 87.000<br />
Wohnungen, mehr als im Roten Wien gebaut worden<br />
waren.<br />
Nach <strong>19</strong>45 wurde mit dem Wiederaufbau begonnen.<br />
Das erste große Bauprojekt der Gemeinde war die Per-<br />
Albin-Hansson-Siedlung, deren Realisierung durch ein<br />
Hilfsprogramm der schwedischen Regierung möglich<br />
wurde. Die wohnpolitischen Schwerpunkte der Stadt<br />
umfassten damals die Auflockerung des dicht bebauten<br />
Stadtgebiets, eine Verdichtung der Randgebiete<br />
durch Gartensiedlungen und die Durchführung von<br />
Architekturwettbewerben.<br />
Ab den <strong>19</strong>60er Jahren begann die großflächige<br />
Stadterweiterung mit jährlich mehr als 10.000<br />
geförderten Neubauwohnungen. In den <strong>19</strong>70er Jahren<br />
standen großzügige Grünraumgestaltung, Schutz vor<br />
Umweltbelastungen, ausreichende Nahversorgung und<br />
Infrastruktur im Mittelpunkt der Bauvorhaben, zu denen<br />
die Terrassensiedlung Alt Erlaa zählte, die eine besonders<br />
aufwändige Ausstattung, u.a. Dachschwimmbäder,<br />
aufwies. Auch die Errichtung der Siedlung Am Schöpfwerk<br />
fällt in diese Zeit. Dort haben unter der Federführung von<br />
Architekt Viktor Hufnagl eine Reihe junger ArchitektInnen<br />
ihre Visionen umgesetzt.<br />
In den <strong>19</strong>80er Jahren wurde neben dem Neubau<br />
die „sanfte“ Stadterneuerung zum wichtigsten<br />
wohnbaupolitischen Aktionsfeld. Bei diesem international<br />
viel beachteten Modell, das bis heute praktiziert wird,<br />
bezuschusst die Stadt großzügig die Sanierung und sorgt<br />
gleichzeitig dafür, dass die Mieten erschwinglich bleiben.<br />
Die BewohnerInnen werden nach der Aufwertung ihres<br />
Viertels nicht in billigere Gegenden abgedrängt, sondern<br />
können in ihren Häusern wohnen bleiben. Auf diese<br />
fast_LIVINGUNIT<br />
designed and copyright© 2008 by: Angelo Roventa,<br />
Carmen Hernandez-Arcas<br />
BEWOHNE DEINE ZEIT<br />
Full function house<br />
with modular mobile furniture (bathroom, bedroom,<br />
living room, study room, kitchen, all including their<br />
necessary storage spaces), for a complete housing unit.<br />
content:<br />
The mobile furniture within the housing unit, with its<br />
multiple spatial arrangements, provides all the function and<br />
comfort of a regular house. The mobile furniture within<br />
the housing unit can be activated simultaneously, fig. 1.01,<br />
or in sequence, fig.1.02-bathroom, 1.03-bedroom,1.04-living<br />
room/study, 1.05-kitchen. Thanks to the mobility of these<br />
elements, those rooms/modules that are not in use at a<br />
specific time can be closed, providing more space for the<br />
rooms/modules that are actually in use. This is a way to<br />
multiply up to 4 times the net usable area of the housing<br />
element.<br />
VORSCHLÄGE FÜR EINEN WIRKLICH SOZIALEN WOHNBAU • VORSCHLÄGE FÜR EINEN WIRKLICH SO
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch II - Wiener Wohnbau<br />
<strong>ST</strong>/A/R 15<br />
Weise bleibt die soziale Durchmischung bestehen, und der<br />
Ghettobildung wird wirkungsvoll vorgebeugt.<br />
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts errichtet die Stadt Wien<br />
die geförderten Wohnanlagen nicht mehr selbst. Die<br />
Abwicklung der Neubauvorhaben findet vielmehr durch<br />
gemeinnützige Wohnbauunternehmen statt, und die<br />
Entscheidungen werden im Grundstücksbeirat bzw. im<br />
Rahmen von Bauträgerwettbewerben getroffen – eine<br />
Vorgangsweise, die dem fairen Wettbewerb verpflichtet<br />
und im Vergleich kostenneutral ist. Inhaltlich steht der<br />
geförderte Wohnbau auf den drei Säulen Ökonomie –<br />
Ökologie – Architektur. Ziel der Wettbewerbe ist somit, für<br />
eine ausreichende Anzahl bedarfsgerechter Wohnungen<br />
zu sorgen, innovative architektonische Lösungen zu<br />
fördern und den Klimaschutz zu forcieren. Seit gut einem<br />
Jahrzehnt ist die Niedrigenergiebauweise Standard. Einen<br />
noch geringeren Energieverbrauch weisen die Passivhäuser<br />
auf. Auf den Aspanggründen entsteht gerade Eurogate, die<br />
größte Passivhaussiedlung Europas.<br />
Den aktuellen gesellschaftspolitischen und<br />
soziodemographischen Herausforderungen begegnet<br />
der geförderte Wohnbau in Wien mit Bauprojekten,<br />
die speziell auf die Lebensbedürfnisse bestimmter<br />
Bevölkerungsgruppen zugeschnitten sind.<br />
Angesichts weltweit gestiegener Bau- und Energiekosten<br />
wird die Stadt in naher Zukunft ihr Hauptaugenmerk auf<br />
die Schaffung leistbaren Wohnraums legen, und für die<br />
Entwicklung neuer Wohnkonzepte verstärkt auf junge,<br />
innovative ArchitektInnen setzen.<br />
Obwohl Wien zunehmend zu einer Metropole<br />
heranwächst, gibt es keine „Hot Spots“ sozialer Konflikte<br />
und auch keine „No Go Areas“ wie in vielen anderen<br />
Städten. Dies ist keineswegs Zufall. Es ist vielmehr<br />
das Ergebnis einer langen Tradition umsichtiger<br />
sozialdemokratischer Wohnungspolitik.<br />
Die Ausstellung „Wiener Wohnbau“ wird ab Jänner 2009<br />
im Ringturm gezeigt und danach auch in mehreren<br />
Bezirken zu sehen sein.<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
Wien, die Bundeshauptstadt Österreichs, ist auf der ganzen Welt für ihre Kultur und<br />
Gastfreundlichkeit, aber auch für ihren engagierten Umweltschutz, ihre hohe soziale Sicherheit<br />
und ihre herausragende Lebensqualität bekannt. So belegt unsere Stadt bei renommierten<br />
internationalen Untersuchungen über die Lebensqualität in Metropolen regelmäßig Spitzenplätze.<br />
In der Mercer-Studie 2007 rangiert Wien weltweit an dritter und in der Europäischen Union<br />
an erster Stelle. Zu diesen ausgezeichneten Ergebnissen hat auch die Wiener Wohnpolitik<br />
maßgeblich beigetragen, denn Wohnzufriedenheit und Lebensqualität sind eng miteinander<br />
verknüpft.<br />
In unserer Stadt hat nicht nur der soziale Wohnbau eine lange und erfolgreiche Tradition. Auch<br />
die Stadterneuerung wird auf sozial verträgliche Weise durchgeführt. Mit den Mitteln der Wiener<br />
Wohnbauförderung werden Jahr für Jahr tausende erschwingliche und qualitätsvolle Wohnungen<br />
errichtet, die den Wienerinnen und Wienern zur Verfügung stehen. Die Errichtung geförderter<br />
Neubauten ist an strenge ökonomische, ökologische und architektonische Kriterien gebunden.<br />
Damit stellt die Stadt sicher, dass leistbare Wohnungen gebaut werden, die jedoch hohen Klimaund<br />
Umweltschutzstandards entsprechen und viel Wohnqualität und Komfort bieten. Durch<br />
den international anerkannten Weg der „sanften Stadterneuerung“ bleiben die Mieten auch<br />
nach umfassenden Sanierungen moderat, und die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner<br />
werden nicht in andere Stadtgebiete verdrängt. Daher gibt es in Wien keine Ghettos, und die<br />
österreichische Bundeshauptstadt zählt zu den sichersten und sozialsten Metropolen der Welt.<br />
Dieser einzigartige Weg, den die Wiener Wohnpolitik eingeschlagen hat, und der international<br />
als vorbildlich gilt, wird in der Ausstellung „Wiener Wohnbau. Innovativ, sozial und ökologisch“<br />
dokumentiert.<br />
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Ausstellungskatalogs und hoffe, dass<br />
Sie daraus viele interessante und spannende Informationen über die Wiener Wohnpolitik<br />
gewinnen. Es würde mich sehr freuen, wenn diese Publikation Ihr Interesse weckt, nicht nur die<br />
Wohnbauausstellung zu besuchen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen der zahlreichen<br />
bedeutsamen historischen und zeitgenössischen Wohnbauten in unserer Stadt persönlich zu<br />
besichtigen.<br />
Vorwort von Dr. Michael Ludwig aus dem Ausstellungskatalog<br />
„Wiener Wohnbau – Innovativ. Sozial. Ökologisch“<br />
Wiener Wohnbau – innovativ. sozial. ökologisch<br />
13.09.2008 – 3.10.2008<br />
Vernissage: Freitag, 12.09.2008, 14.30 Uhr<br />
Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.00 – <strong>19</strong>.00 Uhr<br />
Finissage: Freitag, 03.10.2008, <strong>19</strong>.00 Uhr<br />
Facoltà di Pianificazione del territorio and Dipartimento di Pianificazione<br />
(Fakultät für Raumplanung und Abteilung für Planung)<br />
Università di Venezia, IUAV<br />
Ca’ Tron<br />
S. Croce <strong>19</strong>57<br />
30135 Venedig<br />
Wiens Fertigkeit, funktionale und lebenswerte Wohnbauten zu errichten,<br />
geht auf das “rote Wien” in den <strong>19</strong>20er und <strong>19</strong>30er Jahren zurück, als die<br />
Sozialdemokratische Partei erstmals damit begann, sozialen Wohnbau im<br />
großem Maßstab zu realisieren. Seither entwickelte die Stadt stufenweise<br />
eine Wohnbaupolitik, die wesentlich zur Steigerung der Lebensqualität<br />
beiträgt.<br />
Die Ausstellung<br />
„Wiener Wohnbau – Innovativ. Sozial. Ökologisch“ gibt einen<br />
umfassenden Einblick in den Wohnbau Wiens – von den Anfängen<br />
bis in die Gegenwart. Präsentiert werden realisierte Anlagen des<br />
öffentlich geförderten Wohnbau und deren Einbettung in aktuelle<br />
Stadtentwicklungsprojekte unter besonderer Berücksichtigung sozialer<br />
und ökologischer Aspekte.<br />
Kuratiert vom Architekturzentrum Wien<br />
Eröffnung und Finissage: Dr. Michael Ludwig, Amtsführender Stadtrat für<br />
Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung; Prof. Liliana Padovani. IUAV<br />
Ausstellungskonzept: Wolfgang Förster, Gabriele Kaiser, Dietmar Steiner,<br />
Alexandra Viehhauser<br />
Ausstellungsgestaltung: SPAN-architects (Matias del Campo, Sandra<br />
Manninger)<br />
Die Ausstellung wurde durch die freundliche Unterstützung der Stadt Wien -<br />
Geschäftsgruppe Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung - ermöglicht.<br />
PROTOTYPEN FÜR KARL/MARX/HOF 2<br />
NIEDERENERGIEHÄUSER<br />
EIGENENERGIEHÄUSER<br />
KARL/MARX/HOF 2<br />
ROVENTA/GERNGROSS/WERK<strong>ST</strong>ATT WIEN<br />
ZIALEN WOHNBAU • VORSCHLÄGE FÜR EINEN WIRKLICH SOZIALEN WOHNBAU • VORSCHLÄGE FÜR
16 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch II - Wiener Wohnbau<br />
Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
21., DONAUFELDER <strong>ST</strong>RASSE 91<br />
Eckdaten<br />
π Neubau<br />
π 269 geförderte Mietwohnungen (§12 WWFSG89-Neu >10.000m2)<br />
π Bauträger: FAMILIENHILFE Gemn. Bau- und Siedlungsges.m.b.H.<br />
π Planung: ARGE Architekten CUUBUUS architects ZT GesmbH,<br />
Arch. Prof. Schempp<br />
π Baubeginn: Herbst 2007<br />
π Bezugstermin: voraussichtlich Sommer 2009<br />
Innovative und ökologische Wohnanlage<br />
Der Bauträger Familienhilfe errichtet auf dem ehemaligen Areal der<br />
Porsche KG 269 geförderte Mietwohnungen. Die neue Wohnhausanlage<br />
in Wien-Floridsdorf erfüllt den Niedrigenergie- Standard, erreicht die<br />
Wärmeschutzklasse A und gilt als ökologisches Musterprojekt.<br />
So wird ein optimierter Anteil des Energiebedarfs durch die Nutzung<br />
von Sonneneinstrahlung erreicht.<br />
22., SAIKOGASSE/<br />
ULLREICHGASSE<br />
Eckdaten<br />
π Neubau<br />
π 113 geförderte Mietwohnungen (§12 WWFSG89-Neu
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch III - Podrecca <strong>ST</strong>/A/R 17<br />
CONGRATULAZIONI<br />
<strong>ST</strong>/A/R-ARCHITEKT international<br />
SPRICHT SIEBEN SPRACHEN<br />
BORIS<br />
MANTUA:<br />
BORIS PODRECCA ERHÄLT<br />
ZUSAMMEN MIT DAVID<br />
CHIPPERFIELD DEN<br />
GROSSEN ITALIENISCHEN<br />
ARCHITEKTURPREIS<br />
“VERGILIUS<br />
D’ORO 2008”<br />
BORIS PODRECCA
18 <strong>ST</strong>/A/R<br />
VIENNA BIO CENTER 1<br />
Buch III - Podrecca Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Wien, Österreich, 2003-05; Fotos: Gerald Zugmann, Pez Hejduk, Robert Herbst<br />
IMBA – Institut für Molekulare<br />
Biotechnologie GmbH<br />
GMI – Gregor-Mendel-Institut für<br />
Molekulare Pflanzenbiologie GmbH<br />
VIENNA BIO CENTER 2<br />
Wien, Österreich, 2001-03; Fotos: Gerald Zugmann
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch III - Podrecca<br />
<strong>ST</strong>/A/R <strong>19</strong><br />
LINZ DONAUPARK URFAHR<br />
Donaupark Urfahr<br />
Sarnierung eines Terrain Vague<br />
Linz, Österreich, 2003-<br />
Wettbewerb, 1. Preis<br />
Gutachterverfahren, 2003<br />
zur Realisierung empfohlen<br />
Auslober: Stadt Linz<br />
Künstlerin Kathryn Miller, Los Angeles<br />
Von der zentralen Linzer Donaubrücke abwärts erstreckt sich auf der Urfahraner Seite gegenüber der Innenstadt entlang des Flussufers ein ausgedehntes, undefi niertes, aber<br />
in bester innenstädtischer Lage befi ndliches Roh-Gelände. Hier fi ndet alljährlich der Urfahraner Markt statt und große Teile des nicht merkantilisierten Schwemmlandes werden<br />
auch sonst als Parkplatz genutzt. Die wiederkehrenden Nutzungen Parkplatz, Markt und Zirkus bilden den Anlass der Gestaltungsmaßnahmen. Das Parkplatzgelände für ca. 1000<br />
Autos wird mit einer unregelmäßigen Kleinvegetation überzogen, die sich in Entwässerungsrinnen nach und nach festsetzt. Sonst wird am Gelände ein Oberboden mit einem<br />
Kalk-Schotter-Gemisch aufgetragen, das von der Künstlerin Katryn Miller mit „seedbombs“ (Samenbomben) gestaltet wird: Das Ausstreuen der Samen bewirkt eine regellose<br />
Hintergrundvegetation. An dem der Brücke und der Innenstadt nächst gelegenen Westende dieses „terrain vague“ entsteht eine kleinteiligere Struktur: Holzpritschen, saisonal<br />
wechselnde Bepfl anzungen und eine Wassersäule bilden hier die gestalterischen Akzente. Lichtstelen mit eingebauter Beschallung sorgen für Beleuchtung des Gesamtgeländes.<br />
Hölzerne Sitzstufen, zusätzlich am Flussufer anlegende schwimmende Hotels und andere Interventionen verleihen dem Gebiet neues Leben, das seinen hier traditionell<br />
regellosen Charakter beibehalten soll.
Städteplanung / Architektur / Religion Buch III - Podrecca <strong>ST</strong>/A/R 21<br />
SPLIT<br />
SPLIT<br />
CORMONS<br />
PIAZZA XXIV MAGGIO, Cormons,<br />
Italien, <strong>19</strong>89-<strong>19</strong>90<br />
Platzgestaltung im historischen Zentrum<br />
Zwischen Udine und Görz gelegen, repräsentiert Cormons als<br />
Hauptstadt des Collio-Gebiets den charakteristischen Typ einer<br />
friaulisch- venezianischen Kleinstadt. Der Hauptplatz mit dem<br />
Rathaus war stets auch Verkehrsknotenpunkt, welcher der Klärung,<br />
Organisation und Neugestaltung bedurfte. Ein wesentliches Element<br />
dabei ist die Entfl echtung von Versammlungs- und Verkehrsfl ächen,<br />
sowie di räumliche Akzentuierung mittels einer Brunnenanlage und<br />
einer Reihe von Beleuchtungsmasten. Der Steinbelag greift die<br />
Silhouetten mehrerer Bauten am Platz auf, die Texturen zeichnen<br />
die Volumina nach. Glasplatten über den beim Aushub gefundenen<br />
römischen Stadtmauerresten weisen auf die frühere Geschichte<br />
des Orts hin. Das Brunnenobjekt dient auch als Sockel für die Figur<br />
eines steinwerfenden Knaben des In Wien ausgebildeten Bildhauers<br />
Anfonso Canciani. Implantate aus Rosso-Verona-Stein transportieren<br />
sanguinische Stimmungen, eine monolithische Pergola bildet einen<br />
Auftakt des monumentalen Campanile.<br />
DU<br />
RATHAUSPLATZ, St. Pölten,<br />
Östereich, <strong>19</strong>94-<strong>19</strong>96<br />
Fotos: Damjan Gale<br />
St. Pölten hat durch die Entscheidung im Jahre <strong>19</strong>87, Landtag<br />
und Regierung des größten Österreichischen Bundeslandes,<br />
Niederösterreich, aus Wien hierher zu verlegen, einen großen<br />
baulichen Entwicklungsschub erlebt. Parallel zu den Neubauten<br />
der Landesregierung am Rande der Altstadt wurde die Kernstadt<br />
revitalisiert. St. Pölten zeigte die typischen Probleme österreichischer<br />
Kleinstädte am Ende des 20. Jahrhunderts: Strukturwandel,<br />
Suburbanisierung, Abwertung des historischen Bestandes im<br />
Kerngebiet und Gebrauch der Stadtplätze vorwiegend als Parkfl ächen.<br />
Typisch ist aber auch die hohe Qualität der Barockarchitektur:<br />
hier lebten und wirkten bedeutende Baumeister wie Jakob<br />
Prandtauer und Joseph Munggenast sowie der Maler Bartolomeo<br />
Altomonte. 1785 wurde St. Pölten Bischofs- und Garnisonsstadt.<br />
Die Rückführung des Hauptplatzes zu einem öffentlich genutzten<br />
Veranstaltungsraum griff die gegebene Gliederung mit der barocken<br />
Pestsäule und den gegenüberliegenden Hauptgebäuden von Rathaus<br />
und Franziskanerkirche auf. Steinerne Teppiche verbinden diese<br />
traditionellen Zentren des bürgerlichen und religiösen Lebens. Der<br />
Platz selbst ist „dreischiffi g“ strukturiert, mit einer freien Mitte<br />
und zwei seitlichen Funktionsbereichen. Hier wurden Stadtmöbel,<br />
Brunnenanlage, Garagenabgänge und Beleuchtungsmasten<br />
positioniert. Die Lichtregie des Platzes akzentuiert nicht nur<br />
verschiedene Stimmungen, sondern gibt dem Freiraum auch eine<br />
quasi-bauliche Gliederung verschiedener Höhenzonen.<br />
<strong>ST</strong>ROSSMAYER PARK, Split, Kroatien<br />
Baubeginn: 2000<br />
Fertigstellung: 2002<br />
Bauherr: Stadt Split<br />
<strong>ST</strong>.PÖLTEN<br />
Der Palast des römischen Kaisers Diokletian ist eines der bekanntesten<br />
Schulbeispiele für Adaption und Transformierung einer historischen Struktur<br />
durch spätere Nutzergenerationen. So wurde aus dem Palast ein Stadtteil,<br />
aus den Räumen Häuser. Entlang der Nordmauer wurde im <strong>19</strong>. Jahrhundert<br />
ein Stadtpark angelegt, der zunehmend verkam und von Randgruppen<br />
okkupiert wurde. Ein steinernes Passpartout rahmt ihn neu. Darin ist<br />
ein großes Kiesfeld angelegt, in dem Grüninseln den erhaltenswerten<br />
Baumbestand säumen. Diese Inseln „restituieren“ die von den Venezianern<br />
gefällten Wälder des damaltinischen Archipels. Die Terrassierung kann auch<br />
als Zuschauertribüne für Festivals genutzt werden, neue Angebote wie die<br />
steinernen Bänke sowie verbesserte und neugestaltete Funktionen wie<br />
Brunnen und Lichtmasten werten den Platz zusätzlich auf.<br />
Fotos: Damir Fabijani<br />
Strossmayer Park<br />
Split, Kroatien, <strong>19</strong>98-2002<br />
Fotos: Margherita Spiluttini
22 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch III - Podrecca Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
NEAPEL<br />
NEAPEL<br />
Peter Kogler, Seitenwände Michelangelo Pistoletto, 1. Ebene Boris Podrecca Platztextur<br />
LINIE6<strong>ST</strong>ATIONSANPASQUALE,KINO,SHOPPING –UNTERWASSERARCHITEKTUR
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch III - Podrecca<br />
<strong>ST</strong>/A/R 23<br />
PRIMORJE CON<strong>ST</strong>RUCTION COMPANY, HEADQUARTERS, AJDOVSCINA, SLOVENIA<br />
Fotos: Miran Kambi<br />
Ville urbane<br />
Ljubljana,<br />
Slowenien, 2004-2008<br />
Wettbewerb, 1. Preis
24 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch III - Podrecca Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
PRATER<strong>ST</strong>ERN, BAHNHOF WIEN NORD<br />
2002-mit B. Edelmüller
Buch IV - Werner Faymann <strong>ST</strong>/A/R / /R 25<br />
Städteplanung / Architektur / Religion Buch IV - Werner Faymann <strong>ST</strong>/<br />
DAS BUNDES-<br />
MINI<strong>ST</strong>ERIUM<br />
FÜR VERKEHR<br />
INNOVATION UND<br />
TECHNOLOGIE<br />
ARBEITET AN DER<br />
EUROPÄISCHEN<br />
VERNETZUNG
26 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch IV - Werner Faymann Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
LAINZER TUNNEL<br />
Durch den Lainzer Tunnel – die Verbindungsstrecke zwischen West-,<br />
Süd- und Donauländebahn in Wien – werden Güter- und Personenzüge Wien<br />
schneller und umweltschonender als bisher durchqueren beziehungsweise<br />
an ihre innerstädtischen Ziele, die Güterterminals und Bahnhöfe, gelangen.<br />
Freiwerdende Kapazitäten auf der West- und Südbahn können dann für die<br />
Verbesserung des lokalen Personenverkehrs genutzt werden.<br />
Der Lainzer Tunnel liegt auf der Achse Paris-Bratislava (TEN Korridor 17) und<br />
bildet den wesentlichen Bestandteil bei der Durchbindung durch Wien von West<br />
nach Ost.<br />
Projektlänge: ca. 12,8 km<br />
davon Länge des Verbindungstunnels: ca. 6,6 km<br />
Gesamtlänge der Gleisum- und -neubauten: ca. 25,3 km<br />
Entwurfsgeschwindigkeit:<br />
120 km/h für den Güterverkehr<br />
160 km/h für den Personenverkehr<br />
Baubeginn: <strong>19</strong>99<br />
Gesamtfertigstellung: Ende 2012<br />
Gesamtinvestitionen: rd. 1,289 Mrd Euro (gem. Rahmenplan 2008-2013)<br />
Euro 730 Mio. bisher verbaut (Stand: 12/2007)<br />
Mit der Inbetriebnahme des Lainzer Tunnels wird<br />
folgendes erreicht:<br />
π Zeitgemäße und leistungsfähige Verbindung der Westbahn mit der Süd- und<br />
Donauländebahn<br />
π Entlastung der Verbindungsbahn von schweren Güterzügen<br />
π Nutzung der an der Oberfläche frei werdenden Streckenkapazitäten für einen<br />
verdichteten Personennahverkehr - S-Bahn<br />
π Verbindung der Westbahn mit dem neuen Hauptbahnhof Wien<br />
π Eine Entlastung der Verbindungsbahn vom Güter- und Personenfernverkehr<br />
im 12. und 13. Bezirk und damit eine wesentliche Verbesserung der Lärmsituation<br />
für die Anrainer<br />
π Eine Entlastung der Westbahn vom Güterverkehr im 14. Bezirk und damit eine<br />
wesentliche Verbesserung der Lärmsituation für die Anrainer<br />
Modernisierung der Haltestellen<br />
π Wien Hadersdorf<br />
π Wien Weidlingau<br />
π Purkersdorf Sanatorium<br />
Neubau der Haltestelle Wien – Wolf in der Au<br />
Durch die Verbreiterung des sogenannten Meidlinger Einschnitts von vier auf<br />
acht bzw. neun Gleise ist die niveaufreie Einbindung der S-Bahn in die Südbahn<br />
möglich und somit eine erhebliche Leistungssteigerung im Bahnhof Wien<br />
Meidling - dem am stärksten frequentierten Bahnhof Österreichs - gegeben
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch IV - Werner Faymann<br />
<strong>ST</strong>/A/R 27<br />
Verbesserungen für Anrainer<br />
π Bessere Nahverkehrsanbindung<br />
π wesentliche Reduktion des Zuglärms<br />
π Steigerung des Kundenkomforts durch Haltestellenmodernisierung<br />
π Mögliche Verkürzung der Schrankenschließzeiten durch den verdichteten S-<br />
Bahnverkehr entlang der Verbindungsbahn<br />
Die Errichtung des Lainzer Tunnels erfolgt in vier<br />
Teilabschnitten:<br />
1. Teilabschnitt „Verknüpfung Westbahn“<br />
Der Teilabschnitt im Westen, die „Verknüpfung Westbahn“, verbindet die<br />
beiden bestehenden Fernverkehrsgleise der Westbahn mit der bereits im Bau<br />
befindlichen Neubaustrecke zwischen Wien und St. Pölten (Bestandteil der<br />
Baumaßnahmen zur viergleisigen Westbahn).<br />
Die Rohbauarbeiten in diesem Teilabschnitt wurden 2007 abgeschlossen.<br />
Der nächste große Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung des gesamten<br />
Projekts 2012 erfolgt im Dezember 2008 mit der Teilinbetriebnahme der so<br />
genannten „Weichenhalle“ in diesem Projektabschnitt. Erstmals seit dem Jahr<br />
2000 steht dann die Westbahn im Bereich zwischen Bahnhof Hütteldorf und<br />
dem Bahnhof Unterpurkersdorf wieder viergleisig zur Verfügung.<br />
2. Teilabschnitt „Verbindungstunnel“<br />
Der Kernbereich des Projekts Lainzer Tunnel ist der Teilabschnitt<br />
„Verbindungstunnel“, welcher zweigleisig auf einer Länge von ca. 6,6 km<br />
ausgeführt wird. Er verbindet den Teilabschnitt „Verknüpfung Westbahn“ mit<br />
den Abschnitten „Anbindung Donauländebahn“ und „Einbindung Südbahn“.<br />
3. Teilabschnitt „Einbindung Südbahn“<br />
Der rund 1.550 m lange Teilabschnitt „Einbindung Südbahn“ beinhaltet die<br />
Einbindung der Gleise des Lainzer Tunnels in die Südbahnstrecke zwischen<br />
dem Bahnhof Wien-Meidling und der Haltestelle Hetzendorf. Mit der<br />
niveaufreien Einbindung der S-Bahn in den Bahnhof Wien Meidling wird die<br />
Einfahrtssituation des Schnellbahnverkehrs aus dem Süden nach Meidling<br />
verbessert.<br />
4. Teilabschnitt „Anbindung Donauländebahn“<br />
Der etwa 2.250 m lange Teilabschnitt „Anbindung Donauländebahn“ beinhaltet<br />
die Verbindung des Lainzer Tunnels mit der Donauländebahn, die Strecke zum<br />
Zentralverschiebebahnhof Wien Kledering und zur Ostbahn.<br />
Stand 16.09.2008
Städteplanung / Architektur / Religion Buch IV - Werner Faymann <strong>ST</strong>/A/R 29<br />
HAUPTBAHNHOF WIENStation<br />
Gesamtprojekt Hauptbahnhof Wien:<br />
Die Bauarbeiten beginnen<br />
Häupl, Faymann und Huber starten Jahrhundertprojekt – Neuer<br />
Verkehrsknoten für 145.000 Kunden pro Tag – Auftakt am Südtiroler<br />
Platz<br />
Ein großer Tag für Österreich: in wenigen Jahren werden über 1.000<br />
Züge und 145.000 Menschen pro Tag den neuen Hauptbahnhof<br />
Wien frequentieren. Heute, Dienstag, beginnen die Bauarbeiten<br />
für das Projekt Südtiroler Platz mit dem Spatenstich durch Wiens<br />
Bürgermeister Michael Häupl, Bundesminister Werner Faymann, ÖBB-<br />
Chef Martin Huber und den EU-Koordinator für die TEN-Achse 17, Péter<br />
Balázs. Der Umbau der Station Südtiroler Platz ist das erste Projekt, das im<br />
Rahmen des Gesamtprojekts Hauptbahnhof Wien realisiert wird. In sechs<br />
Jahren wird der Hauptbahnhof in Betrieb gehen und den Bahnverkehr<br />
weit über die Grenzen Wiens hinaus neu ordnen. Bahnreisende werden<br />
eine neue Qualität erleben, die Region einen wirtschaftlichen Impuls.<br />
Der Hauptbahnhof Wien wird neue Märkte ansprechen und Menschen<br />
verbinden.<br />
Bürgermeister Michael Häupl über die Bedeutung des Hauptbahnhofs<br />
für Wien: „Der Hauptbahnhof macht Wien zu einem europäischen<br />
Schienenverkehrsknoten ersten Ranges. Damit legen wir die Basis für einen<br />
weiteren Ausbau Wiens zum multifunktionalen Wirtschaftszentrum für<br />
den zentral- und osteuropäischen Raum. Der zweite positive Effekt ist die<br />
massive Aufwertung des gesamten Erweiterungsareals. Dort wo europäische<br />
Verkehrslinien an das städtische Netz angeknüpft werden, entsteht ein<br />
neuer hochwertiger Stadtteil mit Platz für Arbeiten und Leben.“<br />
Infrastrukturminister Werner Faymann streicht die strategische Bedeutung<br />
des neuen Bahnhofs hervor: “Der Hauptbahnhof Wien ist eines der<br />
wichtigsten Ausbauprojekte für die ÖBB. Das Ziel ist es, die Bahn zu einer<br />
wirklich attraktiven Alternative zum Auto und zum Flugzeug zu machen.<br />
Mit dem neuen Hauptbahnhof gibt es erstmals einen Durchgangsbahnhof<br />
in Wien. Das verkürzt die Fahrzeiten und schafft eine Verbindung der<br />
beiden wichtigsten Bahnachsen in Österreich.“<br />
In erster Linie ist der Hauptbahnhof Wien ein Bahnhof für Kunden. Dazu<br />
ÖBB-Chef Martin Huber: „Wir machen Wien von der Endstation zur<br />
Drehscheibe und den Hauptbahnhof zum Zentrum des Taktverkehrs.<br />
Reisen wird einfacher und schneller. Wir werden z. B. die Anreise von Linz<br />
zum Flughafen Wien in 1 Stunde und 15 Minuten anbieten – heute dauert<br />
dies noch mehr als zweieinhalb Stunden. Damit sind wir schneller als alle<br />
anderen Verkehrsmittel.“<br />
Drehscheibe für Wien, Österreich und Europa<br />
Derzeit befinden sich auf dem Gelände des heutigen Südbahnhofes<br />
zwei Kopfbahnhöfe: der Südbahnhof und der Ostbahnhof; sie liegen<br />
unmittelbar nebeneinander und werden getrennt betrieben. Anstelle<br />
dieser zwei Kopfbahnhöfe schaffen die ÖBB bis 2013 einen zentralen<br />
Durchgangsbahnhof - einen Knotenpunkt im transeuropäischen<br />
Schienenverkehr und die wichtigste Drehscheibe für den internationalen<br />
und nationalen Personenverkehr.<br />
Erstmals werden die Züge aus allen Richtungen in einem Bahnhof<br />
verbunden. Neue Bahnverbindungen werden möglich – beispielsweise von<br />
Linz direkt zum Flughafen Wien Schwechat. Bahn fahren wird dadurch<br />
rascher und bequemer. Bereits heute arbeiten die ÖBB am Fahrplan für<br />
2013: der Hauptbahnhof wird dann zum Taktknoten für Österreich.<br />
Innerhalb der Stadt werden Reisende bequem in andere öffentliche<br />
Verkehrsmittel umsteigen können: S-Bahnen, Straßenbahnen, regionale<br />
und internationale Autobuslinien und nicht zuletzt zur U-Bahnlinie<br />
U1 – sie alle werden mit dem Hauptbahnhof Wien zu einer großen<br />
Verkehrsdrehscheibe vereint. Rund 1.000 Abstellplätze für Fahrräder,<br />
Plätze für Kiss&Ride und Taxis sowie eine Tiefgarage binden den<br />
Individualverkehr an den Bahnhof an.<br />
Der Hauptbahnhof selbst wird aus fünf Doppelbahnsteigen bestehen. Zu<br />
diesen führen die Gleise der Südbahn, der Pottendorferlinie, der Ostbahn<br />
und der Schnellbahnlinie S 80. Eine moderne Dachkonstruktion wird<br />
für ein markantes Erscheinungsbild und für optimalen Witterungsschutz<br />
sorgen. Die Reisenden werden über Leitsysteme geführt. Alle Bereiche<br />
werden barrierefrei erreichbar sein. Das UVP-Verfahren für dieses Projekt<br />
soll noch heuer starten.<br />
denkmalgeschützt<br />
Südtiroler Platz macht Auftakt<br />
Das Gesamtprojekt Hauptbahnhof Wien beginnt dort, wo künftig der<br />
Haupteingang des Bahnhofs sein wird: am Südtirolerplatz. Hier wird<br />
zunächst die Schnellbahnstation umgebaut; sie ist heute bereits an ihre<br />
Kapazitätsgrenze gestoßen und nicht barrierefrei.<br />
Wiener Linien und ÖBB errichten nun eine Verbindungspassage von der<br />
U-Bahn- bzw. S-Bahnstation Südtirolerplatz zum nördlichen Vorplatz<br />
des Hauptbahnhofes. U-Bahn, Straßenbahn und S-Bahn bekommen<br />
barrierefreie Zugänge, die Bahnsteige der S-Bahn werden auf 210 m<br />
verlängert. Der Umbau wird bis 2009 fertig gestellt und 44 Mio. Euro<br />
kosten.<br />
BahnhofCity: wenn der Bahnhof zur Stadt wird<br />
Der Hauptbahnhof Wien wird nicht nur Verkehrsstation sein: hier wird<br />
erstmals eine „Bahnhof-City“ in völlig neuer Dimension errichtet – und<br />
zwar bereits ab 2009. Unter den künftigen Gleisanlagen und in der<br />
Bahnhofshalle entstehen ein Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche<br />
von 20.000 qm und eine Garage mit einer Kapazität von mehr als 600<br />
Stellplätzen. Das heutige Parkdeck am Wiedner Gürtel wird, wie auch der<br />
Südbahnhof, abgerissen. Im neuen Hauptbahnhof wird ein breites Angebot<br />
an Handel, Dienstleistungen und Gastronomie mit der Verkehrsstation<br />
verbunden sein und die bestehende Infrastruktur der Umgebung ergänzen.<br />
Zusätzlich zu seiner Reisefunktion wird der Hauptbahnhof damit zum<br />
attraktiven Zentrum für Arbeiten, Ausgehen und Einkaufen.<br />
Wohnen und Arbeiten: ein neues Stadtviertel entsteht<br />
Auf dem Gelände zwischen Gürtel, Arsenalstraße, Gudrunstraße und<br />
Sonnwendgasse wird ein neues Stadtviertel entstehen – mit Büroflächen<br />
im Ausmaß von 550.000 qm Bruttogeschoßfläche und 5.500 neuen<br />
Wohnungen für rund 13.000 Menschen. Mit einem acht Hektar großen<br />
Park wird auch ein Erholungsgebiet 0geschaffen. Ein Kindergarten und<br />
zwei Schulen sorgen für die soziale Infrastruktur. Insgesamt werden 59 ha<br />
städtebaulich entwickelt – und das nur 2,5 km vom Stephansdom entfernt.<br />
Rund 20.000 Menschen werden hier insgesamt arbeiten. Die ersten<br />
Einheiten sollen 2012 fertig sein.<br />
Mit dem Hauptbahnhof Wien wird auch die Barrierewirkung der heutigen<br />
Schieneninfrastruktur deutlich reduziert. Die angrenzenden Bezirke werden<br />
durch neue Straßen und Fußwege an mehreren Stellen verbunden.<br />
Standortkonzentration Matzleinsdorf: Bahnbetrieb im Hintergrund<br />
Zusätzlich zum Hauptbahnhof Wien setzen die ÖBB zeitgleich ein weiteres<br />
Projekt um, das die Weichen für den Bahnverkehr in diesem Bereich neu<br />
stellt: die Konzentration der Serviceeinrichtungen für die Wartung und<br />
Pflege der Züge. Bis 2009 werden sie am früheren Frachtenbahnhof<br />
Matzleinsdorf zentral zusammengeführt – samt aller notwendigen Zuund<br />
Nachlaufgleise. Bisher sind diese Einrichtungen auf sieben Standorte<br />
in Wien verteilt. Mit dieser Standortkonzentration schaffen die ÖBB eine<br />
moderne Infrastruktur für die Abläufe im Hintergrund.<br />
Abseits der direkten Wahrnehmung durch die Kunden der Bahn bauen<br />
die ÖBB außendem Abstell- und Wendeanlagen, eine Verladestelle für<br />
Autoreisezüge, Anlagen für die Außenreinigung und neue Tragwerke<br />
über die Laxenburgerstrasse, die Landgutgasse und die Triesterstrasse. Die<br />
Logistik im Hintergrund wird völlig neu geordnet.<br />
Über zwei Milliarden Euro Investition<br />
In die Errichtung der neuen Bahninfrastruktur einschließlich<br />
der Verkehrsstation fließen rund 886 Mio. Euro; hier ist die<br />
Inflationsanpassung der nächsten Jahre bereits berücksichtigt. Dieser<br />
Betrag wird größtenteils über den ÖBB-Rahmenplan aufgebracht – dem<br />
Instrument zur Abwicklung der Infrastrukturinvestitionen der ÖBB.<br />
Wesentliche Kostenbeiträge werden aber auch die Gemeinde Wien, TEN-<br />
Förderungen und die Erlöse aus der Immobilienentwicklung liefern. Das<br />
Einkaufszentrum und die Standortkonzentration Matzleinsdorf werden<br />
durch die ÖBB komplett eigenfinanziert. Die Gemeinde Wien wiederum<br />
wird die Kosten für die technische und soziale Erschließung des neuen<br />
Stadtviertels tragen; hier wird mit einem Aufwand von über 100 Mio.<br />
Euro gerechnet. Im gesamten Areal werden in den nächsten neun Jahren<br />
in Summe – von der Schieneninfrastruktur bis zu neuen Wohnungen<br />
– voraussichtlich über zwei Mrd. Euro investiert.<br />
Parallel zu den Bauarbeiten am Südtiroler Platz werden nun auch die UVP-<br />
Verfahren für das Schieneninfrastruktur-Projekt, den neuen Stadtteil und<br />
die neuen Straßen weiter vorbereitet. Die Verfahren sollen noch heuer<br />
beginnen.<br />
Bürgerbeteiligung<br />
Bereits bisher wurden die Bürger in unmittelbarer Umgebung des<br />
Entwicklungsgebietes in die Vorbereitung des Projekts eingebunden. Im Juni und<br />
Juli 2006 sorgte eine Ausstellung für reges Interesse; zum Projekt wurden dabei<br />
zahlreiche Stellungnahmen abgegeben und bestmöglich berücksichtigt. Bewährt<br />
haben sich auch Informationsveranstaltungen in den Bezirken; sie soll es weiterhin<br />
geben. Auch eine eigene Homepage für das Projekt wird vorbereitet.
30 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch IV - Werner Faymann Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Der Westbahnhof ist, neben dem Südbahnhof, einer der beiden großen Wiener Bahnhöfe<br />
und als solcher Ausgangspunkt des Bahnfernverkehrs u.a. nach Deutschland, in die Schweiz und<br />
weiter nach Frankreich und Belgien. Daneben besteht über die Speisinger Verbindungsbahn eine<br />
Verbindung nach Ungarn, Serbien und Rumänien im Osten und Südosten.<br />
In beiden Ebenen der Bahnhofshalle sind verschiedene Geschäfte zur Versorgung der Reisenden<br />
(Supermarkt, Tabak- und Zeitschriftenläden, Internetcafé, Postamt, Kopiergeschäft, Imbissstuben,<br />
Blumenladen, Frisör etc.) angeordnet.<br />
Ende August 2008 wird die denkmalgeschützte Halle samt Vorplatz für drei Jahre gesperrt<br />
und der Bahnhof zur “BahnhofCity Wien West” umgebaut bzw. erweitert. Das Großprojekt<br />
Westbahnhof hat nach ÖBB-Angaben inklusive Schieneninfrastruktur ein Investitionsvolumen<br />
von 130 Mio. Euro. Vorgesehen ist ein zusätzliches Geschoß unter der bestehenden Halle sowie<br />
neue Gebäudekomplexe südlich und nördlich davon. Die Pläne stammen von den Architekten<br />
Heinz Neumann und Eric Steiner, die Ende 2002 einen internationalen Planungswettbewerb für<br />
das Bahnhofsumfeld gewonnen haben.<br />
WE<strong>ST</strong>
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch IV - Werner Faymann<br />
<strong>ST</strong>/A/R 31<br />
WE<strong>ST</strong>BAHNHOF<br />
Geplante Maßnahmen:<br />
• Attraktivierung der unter Denkmalschutz<br />
stehenden Bahnhofshalle<br />
• Verbesserung des Einzelhandels-, Gastronomieund<br />
Dienstleistungsangebotes<br />
• Errichtung eines neuen ÖBB-Reisezentrums<br />
• Neue Vorplatzgestaltung und Verbesserung der<br />
Zufahrten<br />
• Forcierung der Liegenschaftsentwicklung<br />
entlang des Gürtels für Hotel- und Büronutzung<br />
• Schaffung einer Bahnhof City (Finanzierung mit<br />
Partner)
32 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch IV - Werner Faymann Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
EUROPÄISCHE VERNETZUNG<br />
EUROPÄISCHE VERNETZUNG
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch V- NAPOLEON <strong>ST</strong>/A/R 33<br />
Napoleonstadl - Haus der Architektur Kärnten<br />
Eröffnung der Kärntner Landesausstellung 08<br />
im Museum moderner Kunst am 6. Juni 2008<br />
Neben der Dokumentation regionaler Schwerpunkte etablierte<br />
sich Kärntens Haus der Architektur auch als Zentrum für<br />
einen überregionalen und internationalen Austausch der<br />
Architekturszene.<br />
Diesen Aspekt greift die Ausstellung unter dem Titel<br />
architekturTRANSFER auf. Gezeigt wird eine Auswahl an Projekten<br />
internationaler Architekturbüros, die durch ihre Bautätigkeit seit <strong>19</strong>90<br />
wichtige Landmarks in Kärnten gesetzt haben sowie komplementär dazu<br />
erstmals auch einen Überblick über Kärntner ArchitektInnen, die ihren<br />
Arbeitsmittelpunkt außerhalb des Landes gefunden haben. Die Vielzahl an<br />
internationalen Einzelprojekten dokumentiert die Bedeutung des Transfers<br />
avancierter eitgenössischer Architektur in alle Richtungen: von außen<br />
nach innen sowie von einer im Land selbst agierenden Architekturszene<br />
nach außen. Für die 21 vorgestellten ArchitektInnenteams haben SHARE<br />
architects eine unkonventionelle, spielerische Präsentation gestaltet.<br />
Darüber hinaus begleitet die Ausstellung als Zusatztool ein grafisch<br />
aufbereiteter »Reality Check« in die verschiedenen Strukturen und<br />
Arbeitsweisen junger Architekturbüros im europäischen Raum.<br />
Napoleon<br />
Haus der Architektur<br />
Dauer<br />
07.07 bis 02.11.2008<br />
Öffnungszeiten<br />
Mo bis Do 7 bis 17 Uhr<br />
Fr 7 bis 12 Uhr
Städteplanung / Architektur / Religion Buch V- NAPOLEON <strong>ST</strong>/A/R 35<br />
Aus der Serie:<br />
Erfolgreiche Architekten stehen voll hinter<br />
Fassadenplatten von FunderMax.<br />
<br />
Funder Max<br />
RZ anz Chlumbergg 137x205:Layout 1 17.09.2008 14:48 Uhr Seite 1<br />
<strong>ST</strong>AR_ins 18.09.2008 10:35 Uhr Seite 1<br />
www.wiensued.at<br />
OPEN UP<br />
• 4-Zimmer-Atriumsreihenhäuser<br />
mit ca. 118 – 120 m 2<br />
• Eigener Garten mit ca. 21 m 2<br />
• Fitnesswelt und Saunalandschaft<br />
• Tiefgarage<br />
• Kinderspielplatz und -raum<br />
Nahezu jedes Dekor<br />
ist möglich.<br />
Symbolfoto<br />
Visualisierung: www.schreinerkastler.at<br />
Infos: „Wien-Süd“<br />
1230 Wien, Untere Aquäduktgasse 7<br />
Frau Brigitte Kitzwögerer<br />
E-Mail: b.kitzwoegerer@wiensued.at<br />
01 866 95-432<br />
INSEL NR. 2<br />
Quick Change<br />
13. – 25. Oktober<br />
INSEL NR. 3<br />
Its Our Pleasure<br />
20. – 29. November<br />
INSEL NR. 4<br />
ALLREADY<br />
15. – <strong>19</strong>. Dezember<br />
CHRI<strong>ST</strong>IAN EISENBERGER<br />
OPEN UP KOMMUNIKATION<br />
www.tqw.at<br />
FOTO: © CHRI<strong>ST</strong>IAN EISENBERGER / COURTESY OF PROJEKTRAUM VIKTOR BUCHER & GALERIE KONZETT<br />
BBG Architectes, LA VALETTE DU VAR<br />
Architekten Wimmer & Zaic<br />
koopX architekten, Böhning, Schüler, Zalenga<br />
FunderMax GmbH<br />
Klagenfurter Straße 87–89, A-9300 St. Veit / Glan<br />
Tel.: + 43 (0) 5 / 9494-0, www.fundermax.at<br />
Wenn Fassaden heute schöner denn je anzusehen sind, liegt das immer öfter<br />
an FunderMax Exterior Platten. Dahinter stehen Architekten, die nicht nur die<br />
unzähligen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, sondern auch eine Entscheidung<br />
für Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit treffen.
36 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch V- NAPOLEON Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
GANZHEITLICHE KUN<strong>ST</strong> UND ICH-SPALTEREIEN<br />
über beziehungsvolle Kunst und eine, die mittels Codes sich selbst darstellt<br />
v. Manfred Stangl<br />
od dem Ich-Mörder!“ tönt ’s aus versteinerten<br />
Köpfen, „den Platanen, dem Lachen, den Tulpen<br />
den Tod; allem, was wächst, ans Sterben<br />
„T<br />
gemahnt und die Hautgrenzen uns zerrt, sei verdammt<br />
und in den Boden gerammt – Tod so dem Frühjahr, dem<br />
Herbst und dem schwülstig-süßen Apfel-Rot“.<br />
Also marschieren Kameraden der Linearität und der logischen<br />
Kolonnen über Sonnenblumenfelder und treten<br />
die Erde mit inbrünstigen Wonnen – und sie singen<br />
Lieder der Disharmonie und pfeifen auf alles, was nicht<br />
lauthals sich selbst schreit, denn nur Nichts zählt, jedenfalls<br />
nichts, was liebt und verzeiht.<br />
Der Kunstmarkt boomt. Edelkunst ist ausgebucht. Events<br />
sind gut besucht, aber sonst interessiert sich kaum wer<br />
für Kunst, wozu auch, abgeschottet und weggespalten<br />
vom Leben kann heut Kunst keinem wirklich was geben<br />
– es geht nur um Codes, die zudem den Reichen imponieren,<br />
so wie dauerndes Selbststilisieren: Besonderheit,<br />
Genialität, Einzigartigkeit, Kreativität und Dynamik zeigen<br />
die Kunstwerke her. Das sind die Werte, mit denen<br />
Manager sich gerne ummänteln, um mit ihren Millionen<br />
Gehältern von Gewissensbissen befreit to handln;<br />
sie seien besonders und originell, und sie sind das ja<br />
wirklich in ihren Ausreden Geld zu scheffeln. Kaum zu<br />
übertreffen wie radikal und schnell mit kreativem Schaffen<br />
sie Geld an der Finanz verstehen vorbeizuraffen<br />
– wir können nur gaffen.<br />
Jedenfalls umsirrt sie die superbesondere Kunst mit<br />
dem Dunst des Besonderen und Feinen, des Grandiosen,<br />
Großen und Reinen, so fühlen sie sich in ihrem<br />
Image bestärkt; Kunst dient der Ich-Ideologie: „Ich“ ist<br />
alles, wir aber zählen nichts, außer als Konsumentenund<br />
Stimmvieh.<br />
Wir aber gingen mit den Igeln ins Laub oder saßen mit<br />
den Finken in den Himbeersträuchern und sangen den<br />
Sommerwind herbei. Er küsst den Mund bis auf den<br />
Grund und wunderbar trägt er den Sommermond, der<br />
in lauen Nächten wohnt, wie eine Blume im Haar. Sein<br />
Lächeln weht uns warm ums Herz und sonnenklar<br />
erkennen wir Schmerz und Leid, die verlorene Jahreszeit<br />
und sonderbar zieht uns die Erde hinab und plötzlich<br />
sitze ich - die Schultern frei, die Wirbelsäule grad<br />
– zwischen Himmel und Mond. Energie quillt aus dem<br />
All, in mir überall spür’ ich mich mit Glück belohnt.<br />
Schönheit strömt aus mir, Lilien erblüh’n auf Papier;<br />
die Libellen sirren vor Freude schier; melancholische<br />
Melodien spielt die Nacht am Klavier, ein Baum malt ein<br />
Bild von dir; Leben sprießt unentwegt hier: es ist Kunst<br />
vollbracht zwischen Dämmerung und Nacht, die Sterne<br />
schreiben ein Gedicht, der Himmel malt rote Wolken<br />
mit Abendlicht, die Erde formt aus Lehm ein lächelndes<br />
Menschengesicht und endlich verweigerst du dich nicht<br />
und mit Kopf, Hand und Fuß nickst du einen Gruß ins<br />
Himmelszelt. Mit ihren schönsten Wörtern und Farben<br />
grüßt zurück die Welt: du hast sie empfunden, sie endlich<br />
gefunden – hab Freude an ihr.<br />
Die Mondin mit ihren Moschus dampfenden sieben silbergrauen<br />
Hündinnen schritt durch den Wald. Sie traf<br />
sich mit Schwester Nacht. Auch die Engelin der Stille<br />
- die mehr einem Baum gleicht denn einem Menschen -<br />
fand sich am geheimen Ort. Die Wipfel der Fichten und<br />
die Zweige der Eiben wiegten sich im auffrischenden<br />
Wind. Die sieben Hündinnen – die aus der Ferne wie<br />
Wölfinnen wirkten – tollten auf einer Lichtung beim<br />
Tanz der heimlichen Melodie. Wild sprangen sie, wild<br />
sang der Mond; am Blut und in den Brüsten zerrt das geheimnisvolle<br />
Lied der Nacht. „Komm“, haucht das Lied,<br />
„kehr heim“, singt die Nacht, „in den dunklen Hain meiner<br />
Küsse; schließe die Augen, sei mein.“<br />
Das unreife Ich der Moderne beklagte Friedrich Schlegel<br />
vor über 2oo Jahren schon. Er befürchtete, würde das Ich<br />
in den Mittelpunkt rücken, verbreiteten sich der interessante,<br />
absonderliche, hässliche und monströse Ton. Er<br />
unterschied zwischen objektiver und interessanter Poesie.<br />
Freilich sei die interessante künstlich und pikant,<br />
schön indessen nie. Er glaubte aber an eine Zeit nach<br />
der Moderne, in der das Interessante sich selbst abschaffen<br />
und das Übermaß des Individuellen zu Harmonie<br />
finden und zu Schönheit reifen würde.<br />
Für Wackenroder und Tieck - den Initiatoren der Frühromantik<br />
- gelten Gefühl und göttliche Inspiration als<br />
Wesen künstlerischen Schaffens; Verstand und pure<br />
Wissenschaftlichkeit seien demnach eine sinnwidrige<br />
Hürde.<br />
Doch die Romantik ist dem Fortschritt eitle Bürde. Um<br />
18oo erhebt Schelling die Vernunft zum absoluten Ausdruck<br />
des Göttlichen und dem Logos widerfährt höchste<br />
Würde. Gegen <strong>19</strong>oo dreht der Verstand dann völlig<br />
durch. Die Mathematik erobert die Welt. Janes Joyce will<br />
die Literatur aufwerten, indem er dieser mathematische<br />
Gesetzmäßigkeiten unterstellt. Schönberg zerstückelt<br />
Musik bis in seiner Nachfolge der serielle „Komponist“<br />
Töne ohne innere Zusammenhänge aufeinander hetzt.<br />
Kandinsky sucht das Wesen der Erscheinungen hinter<br />
der Natur. Er erklärt das Abstrakte zum Geistigen der<br />
Kunst und mit Malewitsch und Mondrian sind die Linearität<br />
und die Geometrie Richtschnur und hat sich die<br />
mathematisierte Sichtweise der Welt endgültig durchgesetzt.<br />
Dann wurden noch alle Werte verkehrt: mit Nietzsche<br />
– dem Propheten der Narzissten - hieß es, Mitleid zu<br />
verpönen; pubertäre Machtphantasien aber als Befreiung<br />
zu verschönen. Schließlich galt es, sich an die intellektuellen<br />
und wissenschaftlichen Modelle der Weltbeschreibung<br />
zu gewöhnen.<br />
Natürlich war die Aufklärung wichtig. Aber ihre Vertreter<br />
irrten, wenn sie meinten, allein der Katholizismus<br />
mit der Unterdrückung der Sinne sei pur verantwortlich<br />
für die Lebensunlust, aber das Ich mache alles richtig.<br />
Das Modell des Individuums in der Moderne bleibt auf<br />
das Hierarchische, Lineare, letztlich Männliche fixiert<br />
und führt so zu Frust. Die Betonung äußeren bzw. materiellen<br />
Wachstums höhlt das Ich aus; zugleich macht<br />
der Verstand der Emotion und der Intuition den Garaus.<br />
Zensurbehörden sind überflüssig, weil der an Karriere,<br />
Erfolg und Glanz Glaubende allem wird überdrüssig,<br />
das nicht ins Bild passt von Grandiosität, Besonderheit,<br />
coolem Style und dem Selbstbetrug, dass man selber nie<br />
verliert. Die Leere hinter den brillanten Fassaden, Empfindungen<br />
von Ohnmacht und Leid, von abgrundtiefer<br />
verdrängter Wut auf die, welche Leben und Seele umbrachten<br />
werden mit schönen Bildern kaschiert und mit<br />
Drogen, Alkohol und dem täglich herunter gebeteten<br />
Glaubensbekenntnis „Erfolg“ sediert.<br />
Mit dem Rest an Hass reißen wir Schleier vom Leib,<br />
entblößen das süße fremde Weib; auch westliche Künstlerinnen<br />
stellen sich gern nackt dar, oder geben hübsche<br />
Studentinnen preis voyeuristischem Nass: nur das<br />
macht uns noch Spaß. Intimität darf nicht sein, es zählt<br />
die Verkonsumierung allein, bedeckte Körper gelten als<br />
unfein, Pornographie und Sexualisierung sollen Grundund<br />
Menschenrecht sein.<br />
Wir leben inmitten der Welt generierter Bilder des<br />
Glücks. Glauben an die freie Verfügbarkeit der Sexualität<br />
und die prompte Befriedigung aller Sinne als Lebenssinn.<br />
Zeigen Fotos vom erfolgreichen Urlaub oder versenden<br />
sie per MMS, hoffen es, bzw. glauben fest daran,<br />
dass man uns erkennt als zukünftige Superstars und<br />
schau’n uns alle die blödsinnigen Sendungen zur Verbreitung<br />
der Selbstinszenierungen an. Selbst der „kleine<br />
Mann“ glaubt an Karriere und Erfolg oder wenigstens<br />
den Lotto Gewinn. Dann ab vierzig nimmt die Zufriedenheit<br />
am Arbeitsplatz ab, ergaben unlängst Studien<br />
der AK – der Traum von Karriere und einem Leben 1A<br />
ist geplatzt und auch sonst ist von den gesteuerten Illusionen<br />
nicht mehr viel da. Die enttäuschte Frage: „was<br />
hat das alles für einen Sinn?“ bleibt rein statistische Klage<br />
– wer ist zu hören erpicht, was ein Vierzigjähriger in<br />
seinem Frust spricht, allen über 25 traut und glaubt man<br />
ohnehin nicht.<br />
„Umwertung der Werte“: Liebt wer das Sein, fließt es<br />
in seine Lyrik, seine Malerei mit ein, scheint es durch<br />
die Konturen der Natur, oder manifestiert es sich als<br />
Glückseligkeit pur, hört man die Ich-Propagandisten<br />
schrein: „Das ist ja krank und unecht und verrückt ist es<br />
erst recht.“ Sicherlich: vom Standpunkt der modernen<br />
Kultur aus, die sich auf einen Freud beruft, staunt man<br />
nicht schlecht, denn jede Vision erscheint als Zeichen<br />
psychischer Krankheit und Not; der „umgewerteten“<br />
Weltanschauung gilt spirituelle Reife als Erkrankung<br />
und Tod. Deshalb wehklagen die Ich-Anbeter und<br />
stöhnen, wie sehr sie die Liebe, das Mitgefühl und die<br />
Schönheit hassen – denn solche Werte können sie mit<br />
ihren verzerrten Wahrnehmungsweisen nicht fassen.<br />
Das Schöne erscheint ihnen als Hohn, weil sie nur die<br />
Hässlichkeit kennen, der Begriff „Wahrheit“ gilt als Affront<br />
und „Mitgefühl“ klingt dem als Abwertung, der<br />
sich ganz oben sieht auf einem Thron: eben als wichtiger<br />
Ich-Gott jenseits der Massen. Und die Liebe bleibt denen<br />
bloß ein Wort, die mittels Liebesentzugs-Manipulation<br />
und geistigen Schlägen innerlich verwüstet wurden<br />
schon als Kinder. Ich verstehe sie, sie tun mir auch Leid,<br />
aber jetzt geben sie ihre Ödnis für die einzige Wahrheit<br />
aus aller Zeit und betreiben das Zerschlagen der Wälder<br />
und das Abholzen der Himmel und Verbrennen der<br />
Erde in ihrem Schmerz zunehmend geschwinder.<br />
Pointiert formuliert: Aus Mitgefühl sieht jemand, der<br />
ganzheitlich fühlt, davon ab, dem Modernen Menschen<br />
dessen beschädigte Seele vorzuhalten. Er kann ja letztlich<br />
nichts dafür: kritisiert sei nicht der Leidende, sondern<br />
das Leid auslösende System: die Moderne Zivilisation<br />
und Abendländische Kultur. Der sich hinter Masken<br />
der Grandiosität Schützende und Verbergende erkennt<br />
allerdings die Analyse als Attacke nur. Schlägt wild um<br />
sich und verteidigt groteskerweise gerade jene Kultur,<br />
die ihn entfremdet und aussaugt, gegen eine bergende,<br />
ihn mit Lebendigkeit erfüllende Natur.<br />
Dem lebensleeren Imagedichter gilt abgehoben, wer die<br />
Welt liebt, weil diese in Wirklichkeit schlecht sei und<br />
bös; gar nicht generös, was sie doch zu sein hätt’, wo<br />
er doch sein Bestes gibt. Die Welt erkennt seine wahre<br />
Bedeutung nicht an, folglich ist sie nicht nett und der<br />
Krokos liebende Idealist ist naiv und um Hunderte Jahre<br />
zu spät dran.<br />
Die Sonne, der Derwisch, tanzt wirbelnd im Kreis, ein<br />
Arm abgewinkelt zum Himmel, zum All, ein Arm voll<br />
Sonnenstrahlen zur Erde – aus Respekt und weil überall<br />
es Bestimmung des Derwisches ist, die Energien des Kosmos<br />
mit denen der Erde zu einen. Und siehe: der Tanz<br />
ist das Schreiten der Götter, sind die Planetenbahnen, ist<br />
das Singen von Steinen bevor die Zeit vergeht und zur<br />
Stille, zur Meditation der Ewigkeit die Götter sich setzen,<br />
die Zeitlosigkeit heranweht und die Leere sich auftut mit<br />
ihren mystischen Schätzen..<br />
Der Gesang der Götter ist das Zwitschern der Amseln<br />
am Morgen, ist das hüpfende Reh, ist der Freude erwachender<br />
Laut, ist das Trommeln des Regens auf dem<br />
See, ist die Stille in der Abenddämmerung, wenn ein<br />
Suchender ohne Eile in den Himmel schaut – drei Stunden<br />
und drei Jahre, bis aus der Fülle der Schau ein Gedicht<br />
bricht, eine Melodie fließt, lebendige Farben, oder<br />
die Vision, wie ein Baum ein Haus baut – oder es passiert<br />
gar nichts Spezielles; ein kleines Lächeln vielleicht<br />
um die Mundwinkel und in den Augen das Licht eines<br />
Monds, ein sonnenhelles.<br />
Versteht man „ganzheitlich“ in Analogie zu den Erkenntnissen<br />
in Medizin und gar zu naturwissenschaftlichen<br />
Strömen – wo uns das „Tao der Physik“ Capras und<br />
Sheldrakes Evolutionstheorie des Bewusstseins sollte zu<br />
denken geben – fließen die naturnahen, archetypischen<br />
Zugänge nativer Völker ein in die Kunst. Ebenfalls bereicherte<br />
uns die Weisheit des Taoismus: Feng Shui und<br />
die Harmonie zwischen dem Yin und dem Yang – dem<br />
weiblichen und dem männlichen Prinzip – vergessen<br />
in der westlichen Philosophie. Ganz zu schweigen von<br />
der Weisheit in der Zen-Buddhistischen Kunst, welche<br />
die innere Leere der Dinge nicht mit der Abstraktheit<br />
des Männlichen gleichsetzt. Kommt Natur vor schreit<br />
der Modernist gleich entsetzt: „epigonal“, und „das war<br />
schon da“, oder „das ist ja nichts“. Wenn hundert Jahre<br />
nach James Joyces „Ulysses“ - dessen letztes Kapitel<br />
ohne Interpunktionen bleibt – jemand ein Buch ohne<br />
Satzzeichen schreibt, hält man das für modern oder<br />
gar Avantgarde. Bei Joyce schon könnte die Moderne<br />
enden – wozu mit noch mehr Zerstückelung die Zeit<br />
verschwenden? Und der postmoderne Dekonstruktivismus?<br />
Der verkauft sich als die Überwindung moderner<br />
Verstandesüberbewertung und dualistischen Wertetribunals.<br />
Dabei lockt er bloß alles Logische und Lineare<br />
in die Abstraktheit des Zentrifugals. Dekonstruierende<br />
Relativierung lässt zuletzt nichts anderes herrschen als<br />
das allmächtige „Ich“, das keine Kritik oder Grenze hinnimmt<br />
und großmächtig bestimmt, was sein darf, was<br />
nicht. Verbindliches etwa dürfte nicht sein, auf Begriffe,<br />
die das Ich zwängen, lässt es sich nicht ein; debattiert<br />
wird ein Abschaffen aller Definitionen, selbst das Wort<br />
„Moderne“ will Ich nicht hören, damit jegliche Spur<br />
verwischt wird hin zur Allmächtigsetzung des Ich und<br />
dessen Epigonen.<br />
Den Ich-Jüngern gilt jedes Urteil über Kunst als Geschmacksurteil<br />
höchst persönlicher Ausprägung. Jedem<br />
wird eine Meinung zugestanden, diese gilt als individuelle<br />
Überlegung. Jedoch bleibt sie ohne allgemein gültige<br />
Erwägung. So kann nicht über ästhetische Fragen<br />
diskutiert werden, nicht einmal verbindlich nachgefragt.<br />
Nichts Objektives existiert. nur subjektiver Geschmack.<br />
Selbst der Begriff Ästhetik wird anrüchig. Dem, der<br />
ästhetische Prinzipien auszusprechen wagt, wird böse<br />
Absicht nachgesagt. Wer will uns Vorschriften machen?<br />
Wer spricht von Prinzipien in der Kunst, verbindlicher<br />
Kritik und all den anderen unanständigen Sachen? Alles<br />
nur Einzelmeinung und ohne Gewicht. Wer anderes<br />
spricht, dem gilt selbstverständlich unser höhnischtes<br />
Lachen.<br />
Paradoxerweise ist das Ich Inbegriff aller Bewertung –<br />
hat jedoch jede Bedeutung verloren, weil mehr als seine<br />
Einzelmeinung dem Einzelnen nicht zusteht. Für jeglichen<br />
Disput ist’s damit zu spät. Diskussion über Kunst<br />
abgedreht.<br />
Allein die Tatsache, dass wer dennoch auf (s)eine (verbindliche)<br />
Meinung besteht, ist demnach unerhörte<br />
Anmaßung und bereits Beweis für Fanatismus, Verstocktheit,<br />
Schuld und inhaltlichem Scheiß. Zensur<br />
wird radikal ausgeübt, indem der Ich-Ideologe von vornherein<br />
weiß, dass es inhaltlich nichts zu diskutieren gibt<br />
– versucht es trotzdem wer, dann weil der sich wichtig<br />
machen will und den Krawall liebt.<br />
Wer gar eine „Ästhetik der Ganzheit“ verfasst, hat den<br />
Zug der Zeit verpasst und will wohl kriminalisieren oder<br />
ist zumindest durchgedreht. Er ist ein Krimineller, der<br />
das Ich bedrängt: Er ist ein Nazi. Ein Romantiker, von<br />
den Sekten gelenkt. Dem wird ordentlich was eingeschenkt.<br />
Ich entgegne, dass die Postmoderne die Spaltung und<br />
Trennung durch die Moderne – durch die Abendländische<br />
Kultur – verabsolutierend durchsetzt. Die Annahme,<br />
dass kein Begriff ein Ding vollständig benennt,<br />
heißt zuletzt: die Trennung ist komplett. Und wo wer<br />
nichts Verbindliches sagen kann, hat er gefälligst zu<br />
schweigen und soll nicken ganz nett. Keinesfalls jedoch<br />
stören den Ich-Götterreigen.<br />
Für mich bedeutet „Freiheit“ nicht die Allmacht des Ich<br />
mit dessen Obsession andere Menschen, Kulturen und<br />
die Natur auszubeuten, indem Zeitgeister geschickt alles<br />
Wertvolle in undiskutierbare, „sinnbefreite“ Begriffe<br />
verwandeln; mir heißt Freiheit: erkennen, dass wir die<br />
Kinder des Ewigen sind und im Glück dieser Schau voll<br />
Mitgefühl, Solidarität und Liebe zu handeln.<br />
Elegante Mauern errichtet heute die Kunst. Mir ist eine<br />
Zeit vorstellbar, in der Becketts Absurdes Theater nur<br />
müdes Kopfschütteln hervorriefe und die Lektüre der<br />
aktuellen Land- Hand- und Augenvermesser verzichtbar<br />
erschiene - lieber läsen junge Künstler Rilkes Briefe an<br />
den jungen Dichter, in der ein weiser Mensch Verbindlichkeit<br />
spricht: Rilke erinnert an die Sinne, mit denen<br />
wir Unlogisches begreifen; statt darauf uns zu versteifen,<br />
die sensitiven Fähigkeiten zu zertrümmern und<br />
damit menschliche Beziehungen und individuelle Tiefe<br />
verkommen zu lassen und verkümmern. Bald vielleicht<br />
könnte eine Kunst sein, in der Intuition, Verständnis für<br />
das Transzendente und lebensbejahende Gefühle flössen<br />
froh ein.<br />
Wie blind erweisen sich doch jetzige Künstler, wenn sie<br />
stets am „Neuen“ sind hinten dran. Ihre Vorväter und<br />
Mütter kämpften noch gegen die Moderne an, indem sei<br />
als Surrealisten gegen den Logos das Banner der Phantasie<br />
hissten. Oder als Fauvisten die Farbenpracht eines<br />
utopischen Seins über die grauen Industrieschlote kippten<br />
oder pissten. Heute erinnert sich keiner gerne an die<br />
Alten. Sie malten – das allein ist schon schlecht; heutzutage<br />
kreiert man Ideen – materielle Umsetzung schon<br />
ist nicht recht. Und flackerte kurz ein Besinnen nach Gegenständlichkeit<br />
auf, setzte der Kunstmarkt schnell eines<br />
drauf. Abstraktes malt sich schneller, und verhindert die<br />
Gefahr, Kritisches gar zu deutlich sichtbar zu machen,<br />
vehement origineller. Und die indischen, chinesischen<br />
und russischen Manager zeigen mit ihrem Gusto halt<br />
gern ihre Abstammung aus der europäisch aufgeklärten,<br />
liberalen Tradition - wie man die eigenen Leute am apartesten<br />
ausbeutet lernten sie von uns ja schon.<br />
Kunst verweist auf sich selbst vermittels der Codes.<br />
Aus einer Idee etwa blase ein gewaltiges Trumm auf,<br />
das sich die Atelierbalken nur so biegen, aus viel Müll<br />
bastle einen fetten, schmutzigen, öligen oder sonst wie<br />
als Fanal der Konsumwelt dienenden Turm: davon können<br />
die Manager und sonstigen Eliten gar nicht genug<br />
kriegen. Diese sind ja selber aufgeklärt und kritisch und<br />
wollen eh Armut, Hunger und Energieverschwendung<br />
besiegen.<br />
Als das Ominöse, Unerklärliche kommt Kunst ebenfalls<br />
gern daher: etwa ein hellblaues, unförmiges Ding<br />
– documenta-Kuratoren schwärmten gar sehr; wie auch<br />
nicht: das Trumm steht für die unsinnliche, abstrakte<br />
Kultur die unwuchtig und folgenschwer in den Kosmos<br />
hinausknallt und beim Fall in den Abgrund laut scheppert<br />
und hallt.<br />
Unsinniges tauscht seinen Tauschwertschein gegen<br />
Tausende Scheine ein. Je weniger etwas praktischen<br />
Wert besitzt, desto eher gilt es als Kunst; damit steigt<br />
Unsinn in des Käufers Gunst. Ja, schlimmer noch: der<br />
Tauschwert selber erscheint manifestiert in der Kunst,<br />
sodass diese sich willig prostituiert und hörig auf einen<br />
Aspekt des Kapitals reduziert.<br />
Für mich ist Kunst, die das Ich verherrlicht und das<br />
Geld, weder Horizont erweiternd noch „neu“ – sie repräsentiert<br />
eine simpel gestrickte Lebensauffassung und<br />
eine höchst banale und billige Welt.<br />
Gern ferner verweist „Kunst“ auf anderes, das geltungsschwer<br />
im Raum herumsteht – damit zeigt sie sich als<br />
wichtig her, weil sie kolossalen Zusammenhängen auf<br />
den Grund geht. Doch sie stückelt nur Teile mit mehr<br />
oder weniger kulturellen Wert zusammen zur idealen<br />
Hülle: nichts drin, aber mit Bedeutung verpackt und<br />
angedeuteter Fülle; Unsinn zwar, aber der edel gelackt.<br />
Heiße Luft mit viel Gewicht: das Credo Selbstherrlichkeit<br />
als künstlerischer Akt.<br />
Ein besonders schönes Beispiel für die Verbindung von<br />
Codes und Ich-Kult Manifestation liegt in der Selbst-Darstellung<br />
des Künstlers als Original, als Personifikation<br />
der Künste und deren lebendes Denkmal. Alle Stilmittel<br />
der Kunst werden inszeniert auf die eigene Person projiziert:<br />
so stellt man sich als Großer dar: wenngleich das<br />
Werk hinter der Kunstfigur zunehmend erscheint sonder-<br />
und vernachlässigbar.<br />
Dramatisch wird `s, wenn ein halbwegs talentierter Autor<br />
oder Künstler sich in den Klischees der Künstlichkeit<br />
verliert, wenn er permanent sich über seine Rolle<br />
definiert; als Dichter und/oder Genie durch die Gegend<br />
läuft, dabei recht viel schwätzt und noch mehr säuft und<br />
vor allem sich ein normales Leben vorenthält – durchschaut<br />
er den Trug, ist’s vielleicht zu spät: jede Religion<br />
braucht ihre Märtyrer, auch die Kunstreligion – die<br />
Vita des verkannten Genies, das Vorbild der großen<br />
Kunstheiligen zerstörte viele Existenzen schon. Nicht<br />
viel besser endet `s oft, hat wer tatsächlich Erfolg. Das<br />
eigene Image frisst einen schnell auf, gerade weil es für<br />
den Mega-Erfolg notwendig scheint: damit ist man zur<br />
Selbststilisierung quasi verpflichtet, sodass die gekünstelte<br />
Kunst das normale, einfache Leben überhaupt nicht<br />
gewichtet.<br />
Selbstinszenierung und -darstellung übrigens geht bloß<br />
deshalb als Kunst durch, bzw. ist einer ihrer gängigsten<br />
Codes – weil die Moderne ein Ich-Bild propagiert, das<br />
pubertär, narzisstisch, egoistisch und grenzenlos grandios<br />
sich präsentiert. Wobei die Kunst heute - neben dem<br />
allmächtigen Gesetz des Marktes - als mächtige Verbündete<br />
der Ich-Ideologie deren Ideen vorexerziert und sogar<br />
fetischiert.<br />
Die erdigste Hündin der Mondin lief schnüffelnd um<br />
mich, als ich mit abgedeckten Augen im Zimmer lag,<br />
um in den Himmel zu schauen und zu reisen. Dann<br />
sprang sie in mich, um Aromen zu weisen. Der Name<br />
dieser Hündin ist Instinkt: sie blieb bei mir und schenkte<br />
Inspiration: verband die geistigen Welten mit den unterirdischsten<br />
Schichten, wo das Mark die Erde trinkt.<br />
Am Morgen hernach witterte ich die Frühlingsluft und<br />
- als wäre ein siebter Sinn mir erwachsen - war ich fähig<br />
zu erkennen: dieses Gedicht ist als Abbild nihilistischer<br />
Leere zu benennen und dieses andere stammt aus dem<br />
Meer, beheimatet Flut und Glut, hinterlässt mich nicht<br />
leer, sondern tut mir gut. Und einst stieg der Himmel<br />
zu mir herab – ich verging vor Glück, tanzte, sang und<br />
sprang wie verrückt: Glückseligkeit durchströmte die<br />
Welt, als sich das Halschakra öffnete. Nun bin ich Teil<br />
der Schönheit und teilte diese freudig mit jedem, der ihr<br />
gefällt.<br />
Ganzheitliche Malerei mag einerseits mit neosymbolistischen<br />
Formen und Motiven gestalten – wichtiger<br />
aber ist, dass sie auf lebendige Farben sich besinnt, zu<br />
ehrlichem, einfachem und wahrhaftem Malen rinnt, das<br />
in den Pinselstrichen Lebendigkeit führt, nicht das Leben<br />
verschüttet oder in abstrakte Räume einspinnt. Was<br />
nicht heißt, stets sei abstrakte Malerei kontra das Leben:<br />
bei seiner Entwicklung wird es für den Maler Phasen<br />
der Abstraktion geben, um Erstarrtes in ihm aufzulösen.<br />
Doch als Richtschnur kann nicht der abstrakte, nihilistische<br />
halbe Raum dienen der abendländischen dualistischen<br />
Männerkultur. „Ganzheit“ läuft weder auf Schienen,<br />
noch ist ihr Raum ausschließlich das gefürchtete<br />
Dunkel der Irrationalität, der angeblich so bösen.<br />
Das ganzheitliche Theater stellt sich nicht selbst dar.<br />
Verweist nicht auf die grandiose Bühnentechnik, spielt<br />
nicht mit überbordenden Bilderwelten. Überschwemmt<br />
den Zuschauer nicht mit Phantasmagorien an Bilderfluten,<br />
mit der Sucht zu gelten: diese klont die besessene<br />
Welt der Images und Konsumrangabzeichen – „ganzes<br />
Theater“ wird davon in Einfachheit, Stille, Natürlichkeit<br />
und Schönheit zurückweichen, wird mit archetypisch<br />
Verbindlichem unsere Ichheit ausgleichen.<br />
Gemäß den Prinzipien einer Ästhetik der Ganzheit ist<br />
Kritik nicht verpönt – nichts wird verschwiegen, nichts<br />
wird beschönt: aber dem Leben wird Vorzug gegeben vor<br />
einer sich selbst genügenden Darstellung von Gewalt,<br />
Zerstörung und einem dekonstruktiv versickerndem<br />
Streben. Dabei sei an das ästhetische Prinzip „Ausgewogenheit“<br />
gedacht: es meint die Balance zu finden<br />
zwischen Kritik/Ironie/Provokation und Bekenntnis zur<br />
Schönheit – auch jener der Nacht: sonst leistet Kunst<br />
nur Vorarbeit für Zynismus und der Abwendung vom<br />
Sein; damit fiele Kunst weiterhin herein auf den eigenen<br />
Schein: als Ersatzreligion seit der Aufklärung wirkend,<br />
rätselt sie an der Sinnhaftigkeit des Lebens herum,<br />
hält die Natur und das bloße Sein für dumm und<br />
prinzipiell die Welt für schlecht: die Kunst - gottgleich<br />
sich gebärdend – ist nur sich selber Recht und erklärt<br />
sich zur einzigen Erlöserin und verführt die Menschen<br />
dazu, tiefer in die generierten Welten der Illusionen und<br />
des Scheins einzutauchen und sich mit dem Image des<br />
Künstlers/Dichters abzustauchen, der über dem Leben<br />
steht, wenngleich es in Wahrheit ihm fürchterlich dreckig<br />
geht.<br />
Ich weiß, wovon ich spreche, deshalb darf ich auch meine<br />
Kritik sagen: ich beabsichtige nicht anzuklagen, sondern<br />
davor zu warnen, für gar nichts kaputt zu gehen.<br />
Ich war selber dem Spiel der Bilder elend verfallen – nun<br />
stehe ich nicht über allen, sondern helfe aus Liebe Illusionen<br />
zu durchschauen und Blockaden der Lebendigkeit<br />
abzubauen<br />
Ganzheitlicher Tanz wird die Zerrissenheiten des individuellen<br />
Lebens mit dem Ausdruck von Bleibendem<br />
heilen: wie ja bereits Ausdruckstanz asiatischer Weisheit<br />
hilft westliche Opfer des kaltherzigen Kriegs zu<br />
entstylen. Knöcherne Körper könnten voll Anmut den<br />
schwarzen Frauen erliegen, die wie das Wasser tanzen,<br />
dessen Schultern sich im ewigen Wechsel der Gezeiten<br />
und Jahreszeiten wiegen. Gemeint sind nicht die Spiegelbildfrauen<br />
der weißen Kultur, die ihre Körper wie in<br />
Werbeclips an die Bildschirme schmiegen, um für ihre<br />
oberflächenglatte Musik viel Geld zu kriegen.<br />
Literatur, die nicht ausschließlich destruktiv, dekonstruktiv<br />
oder unterhaltungsleicht seicht daherkommt,<br />
öffnet das ästhetische Prinzip Mitgefühl Räume jenseits<br />
des Absurden, der bitteren Ironie und was sonst so dem<br />
Anschein hoher Kunst frommt. Der kritischste Text wirkt<br />
lebensspendet, spürt man ihm seine mitfühlende Orientierung<br />
an, wenn er nicht hasserfüllt, kalt sezierend oder<br />
resignativ sich verstrickt im alles zersetzenden Bann.<br />
Zudem würde Lyrik als Mittlerin zwischen den Verstandes-<br />
und den Archetypenwelten mehr gelten.<br />
Ich lehne nicht prinzipiell die vorhandenen Kunstauffassungen<br />
ab; es sei kritisiert, es sei dekonstruiert, es sei die<br />
Welt in Frage gestellt: aber lassen wir offen, ob da nicht<br />
wirkt eine Kraft, die uns anhält zu hoffen und die all das<br />
Schlechte nur scheinbar triumphieren lässt, doch durch<br />
der Geläuterten Lernen aus den Fehlern – und seien unzählige<br />
Generationen betroffen - letztendlich das Gute<br />
erschafft.<br />
Zusammenfassung der „Ästhetik der Ganzheit“, Informationen<br />
zu „Sonne und Mond - Verein zur Förderung<br />
ganzheitlicher Kunst und Ästhetik“ sowie von Manfred<br />
Stangl erhältliche Bücher unter:<br />
www.sonneundmond.at
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch VI - IRENE <strong>ST</strong>/A/R 37<br />
BERLIN<br />
BERLIN<br />
Frischer Wind für die Kunst<br />
„G.A.S-station - Tankstelle für Kunst und Impuls.“<br />
Wiener Künstler schaffen einen neuen Kunst-<br />
Projekt-Raum in Berlin-Kreuzberg<br />
Auch wenn es der Name vielleicht suggeriert, aber hier<br />
gibt es garantiert keinen billigen Treibstoff zu kaufen.<br />
Hinter dem Schild „G.A.S-station – Tankstelle für<br />
Kunst und Impuls.“ verbirgt sich ein neuer Kunst-<br />
Projekt-Raum in Berlin–Kreuzberg. Die Initiatoren und<br />
Leiter des Projektes, Elisa Asenbaum und Thomas<br />
Stuck, sind schon seit <strong>19</strong>87 in den Bereichen Video,<br />
Sound und Malerei unter dem Label G.A.S (Grafic, Art<br />
& Sound) künstlerisch tätig. Mit der „G.A.S-station –<br />
Tankstelle für Kunst und Impuls.“ haben sich die<br />
beiden Wiener Künstler im multikulturellen Stadtbezirk<br />
Kreuzberg in Berlin einen lang gehegten Traum<br />
erfüllt.<br />
Sechs Monate lang hatten Anwohner, Nachbarn und<br />
Passanten in der Tempelherrenstraße neugierige<br />
Blicke durch die Glasscheibe oder Eingangstür des<br />
ehemaligen Schusterladens geworfen, um zu sehen,<br />
was dahinter so eifrig gewerkelt und gearbeitet wird.<br />
Da wurden Wände weggerissen und Fenster neu<br />
gesetzt, alte Mauerbögen freigelegt, Stromleitungen<br />
gezogen und der Fußboden mit alten Holzbohlen neu<br />
verlegt. Auf 150 Quadratmetern Gesamtfläche ist ein<br />
neuer Kunst-Projekt-Raum entstanden: großzügig,<br />
hell, modern und trotzdem die alte Substanz in seiner<br />
Schönheit erhaltend. Am 21. Juni 2008 konnten sich<br />
Anwohner, Künstler und Kunstinteressierte dann von<br />
ihren neuen Nachbarn und den Möglichkeiten des<br />
neuen Konzeptraumes überzeugen und inspirieren<br />
lassen. „Bon Voyage! Mit vollem Tank einen guten<br />
Start in die Zukunft!“, schreibt die Berliner Autorin<br />
und Filmemacherin Claudia Schmidt, mit einem<br />
holländischen Maler eine der Eröffnungsbesucher, den<br />
beiden Künstlern ins Gästebuch.<br />
Schon der Name des Kunstplatzes macht deutlich, dass<br />
es den Initiatoren Elisa Asenbaum und Thomas Stuck<br />
um neue Impulse und Ansätze für die künstlerische<br />
Arbeit, Inspirationen und das Anstoßen gesellschaftlicher<br />
Debatten geht. Dem traditionellen<br />
Leitsatz „Der Kunst ihre Freiheit“ sehen sich die beiden<br />
Künstler verpflichtet. „Wenn es uns gelingt, den<br />
interdisziplinären Austausch voranzutreiben und eine<br />
Brücke zwischen Kunst und anderen Wissenschaften<br />
zu schlagen, dann wären wir unserem Ziel einen guten<br />
Schritt näher“, umschreibt Elisa Asenbaum ihre<br />
Intentionen. An der Gleichsetzung von künstlerischem<br />
Wert und Marktwert sind die Initiatoren nicht in<br />
erster Linie interessiert, sondern vielmehr an einem<br />
freien, inspirierendem Austausch über aktuelle,<br />
gesellschaftlich relevante Themen mit einer kunstinteressierten<br />
Öffentlichkeit, intellektuellen Kräften<br />
aus allen Bereichen von Kunst und Wissenschaft sowie<br />
Vertretern der Medien.<br />
Im Unterschied zu einer klassischen Galerie versteht<br />
sich G.A.S-station als Kunst-Projekt-Raum, der von<br />
Künstlern selbst geleitet und organisiert wird. „Solche<br />
Projekträume sind informelle Netze, die Künstlern die<br />
Möglichkeit bieten, zu eigenen Bedingungen am<br />
Kunstbetrieb teilzunehmen“, sagt Thomas Stuck.<br />
Allerdings sei auch zusätzliche Förderung und<br />
Unterstützung nötig. „Wir schaffen einen Ort zum<br />
Austausch, eine geeignete Plattform.“ Diese bietet<br />
eine Kooperation mit <strong>ST</strong>/A/R, auch dies eine gute<br />
Möglichkeit, damit die neu geschaffene künstlerische<br />
Achse zwischen Wien und Berlin immer besser in<br />
Schwingung kommt. Jetzt muss die Plattform mit<br />
vielfältigen Kontakten, Ideen und kreativen Impulsen<br />
gefestigt werden.<br />
Am 21.Oktober 2008 startet das erste Ausstellungsprojekt<br />
in der G.A.S-station unter dem Titel<br />
„eMOTION“ - Auseinandersetzungen rund um das<br />
Thema Bewegung und Bewegung im Gefühl. In der<br />
Ausschreibung wurden kreative Köpfe, Künstler,<br />
Theoretiker und Autoren aufgefordert, Ideen und<br />
Vorstellungen aus den Bereichen neue Medien,<br />
bildende Kunst, Literatur oder Wissenschaft<br />
einzureichen. Das Angebot war umfänglich. Aus<br />
Videoarbeiten, Fotoserien, Werken der bildenden<br />
Kunst, Installationen und theoretischen Arbeiten<br />
wurde die Auswahl für diese Ausstellung getroffen.<br />
Mit Hilfe ganz unterschiedlicher künstlerischer und<br />
theoretischer Herangehensweisen ermöglichen die<br />
Objekte ein weit gefächertes Assoziationsfeld aus Bild,<br />
Text und Klang rund um BEWEGUNG & EMOTION.<br />
Ina Krauß (Freie Journalistin, Berlin)<br />
Ausstellungsdauer:<br />
21.Oktober 2008 bis 12. Jänner 2009<br />
Öffnungszeiten: Di-Fr 14-<strong>19</strong> Uhr, Sa 14-17 Uhr oder<br />
nach telefonischer Vereinbarung<br />
Raumkonzept:<br />
Die Räumlichkeiten der G.A.S-station bieten Platz für<br />
kulturelle Veranstaltungen. Sie können als Studio,<br />
Veranstaltungsort, Labor, Entwicklungsplattform für<br />
Projekte, Ausstellungsplatz, Diskussions-, Seminarund<br />
Präsentationsraum oder auch für private<br />
Veranstaltungen gemietet werden.<br />
G.A.S-station<br />
Tempelherrenstraße 22<br />
10961 Berlin/Kreuzberg<br />
fon: +49 30 221 609 312 mob. +49 (0)160 995 78 158<br />
e-mail: info@2gas-station.net<br />
Anfahrt:<br />
G.A.S-station befindet sich im Bezirk Kreuzberg in der<br />
Tempelherrenstraße 22, Ecke Blücher-/Urbanstraße<br />
und ist sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr<br />
angebunden. Bus: M41 direkt ab Hauptbahnhof, hält<br />
unmittelbar vor der Tempelherrenstraße. U-Bahn-<br />
Stationen: U1 Prinzenstraße, U6 Hallesches Tor und<br />
U7 Gneisenaustraße sind ca. 7 min. zu Fuß entfernt.<br />
Auto/Fahrrad: Zufahrt über das Carl-Herz-Ufer,<br />
Johanniterstraße oder Wilmsstraße, die<br />
Tempelherrenstraße ist eine Sackgasse.<br />
Netzwerk:<br />
Wer an Informationen interessiert ist, sendet bitte<br />
eine e-mail an: info@2gas-station.net mit dem Betreff<br />
„newsletter“.<br />
Weitere Infos unter: www.2gas-station.net
Städteplanung / Architektur / Religion Buch VI - IRENE <strong>ST</strong>/A/R 39<br />
ÎRENE ANDESSNER
40 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch VI - IRENE Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
WIEN
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch VII - LITERATUR <strong>ST</strong>/A/R 41<br />
DRAMA SLAM<br />
DAS SCHLACHTEN GEHT WEITER.<br />
von Jimmy Elend<br />
Die Drama Slam, die neueste Form des Dichterwettstreits, die<br />
unter der Obhut der Vitamines Of Society erst im November<br />
2007 das Bühnenlicht der Welt erblickt hatte, zieht ihre Kreise<br />
durch ganz Europa.<br />
Nach der 2. Wiener Drama Slam vom 7. April, welche Sabine<br />
Edith Braun mit ihrem POLIZEISCHLAMPENREPORT über<br />
den Alltag in der Redaktion der Tageszeitung Österreich,<br />
knapp vor dem abermals sehr starken Titelverteidiger Karsten<br />
Rühl für sich entscheiden konnte, fand vom 2. bis zum 4.<br />
Mai 2008 die erste dreitägige Drama Slam im russischen<br />
<strong>ST</strong>/A/R Theater am Prenzlauer Berg in der bundesdeutschen<br />
Hauptstadt Berlin statt. Sie lieferte den Beweis, dass das<br />
Wiener Format auch außerhalb seiner Geburtsstadt Wien zur<br />
Unterhaltung und basisdemokratischen Anregung der Massen<br />
taugen kann.<br />
An der ersten beiden Tagen kamen prima vista performed von<br />
ortsansässigen Schauspielern, mit bewährt geschickter Hand<br />
ausgewählt von Showmaster Jimi ‘River’ Lend, der es sich<br />
nicht nehmen lies auch die erste Berliner Drama Slam selbst<br />
zu leiten, jeweils 6 brandneue Theaterstücke, eingesendet<br />
aus ganz Deutschland zur Aufführung und Bewertung durch<br />
das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten <strong>ST</strong>/A/R<br />
Theater. Den Freitag entschied der Dinnertheatermann und<br />
Lautperformer Reinhard Schmidt mit seiner Bundeswehrkritik<br />
„Musterung“ für sich. Der Samstag gehörte knapp aber doch<br />
dem Poetry Slammer und Lebenskünstler Tilman Birr, der mit<br />
seinem Stück „Manfred heisst Freiheit“ tiefe Einblicke in den<br />
gegenwärtigen Zustand des deutschen Staates gewährte: Ganz<br />
Deutschland und seine Administration ist vom VW-Konzern<br />
beherrscht. Ganz Deutschland? Nein. Im Teutoburger Wald<br />
hat ein einsamer Widerstandskämpfer die freie Republik<br />
Manfredonia ausgerufen und setzt sich gegen die Agenden<br />
und Agenten des Peter Harz erfolgreich zur Wehr.<br />
Am Sonntag standen sich dann Reinhard Schmidt und Tilman<br />
Birr im direkten Duell im ebenfalls von Jimi ‘River’ Lend<br />
ersonnenen Format des Beschleunigungslam gegenüber. In<br />
5 sich zeitlich stetig verkürzenden Runden traten die Autoren<br />
mit allen Texten, die sie je geschrieben hatten, unter Einbezug<br />
der Schauspieler und auch ihrer eigenen Darstellungskraft<br />
gegeneinander an.<br />
Die erste Runde á 6 Minuten ging eindeutig an Reinhard<br />
Schmidt der mit technisch ausgefeilten Requisiten ein Stück<br />
Zukunft im russischen Theater materialisieren konnte.<br />
Das war aber auch schon der einzige Punkt der an den<br />
kulinarischen Dichter ging, in den weiteren Runden war<br />
Tilman Birr nicht mehr zu stoppen und steigerte sich mit<br />
jedem kürzer werdenden Intervall noch in literarische Höhen,<br />
bis er mit dem letzten alles entscheidenden ‘Satz des Abends’<br />
alles klar machen konnte:<br />
„Vom Poeten sind es nur mehr 2 Mitlaute zum Proleten“<br />
So wurde Tilman Birr zum Champion der ersten Berliner<br />
Drama Slam und sein Text, wird wie auch der Text von Sabine<br />
Edith Braun in der Übersetzung von UHCR* Wladimir<br />
Jaremenkon Tolstoj an der ersten russischen Drama Slam<br />
am 28. & 29. August in der Ostseemetropole St.Petersburg<br />
teilnehmen. Schon läuft die Ausschreibung und Dichter von<br />
Wladiwostok bis Jekatarinenburg von Sotchi bis zum Franz-<br />
Josefsland sind aufgerufen ihre Texte einzusenden und sich<br />
im Theater des Dostojevski Museums in den russischen<br />
Dramenhimmel zu schreiben.<br />
Das deutschsprachige Publikum wird die besten russischen<br />
Texte im Zuge der jetzt vierteljährlichen Drama Slam im<br />
Wiener Ensembletheater in der Übersetzung der Drama-Slam-<br />
Organisatorin Valie Airport zu hören und sehen bekommen.<br />
Und auch die Berliner werden sich ab Herbst auf 2 neue<br />
Drama Slams freuen können.<br />
*UHCR= Unser Herr Chef Redakteur<br />
by Oskar Krauss<br />
Russland berichtet<br />
über Heidulf<br />
Gerngross.<br />
„KUBI<strong>ST</strong>EN<br />
MACHT EUCH<br />
RUNDER!“<br />
Rechts im Bild<br />
mit Rafaela Tengg
42 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch VII - LITERATUR Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
KUBI<strong>ST</strong>EN, MACHT EUCH RUNDER!<br />
aus dem Russischen von Vallie Göschel<br />
Einen der Schlüsselmomente der „Langen Nacht der<br />
Museen“ im St. Petersburger Dostojewski-Museum<br />
stellte der feierliche Übergabeakt der vom bekannten<br />
österreichischen Architekten Heidulf Gerngross gestalteten<br />
Fassadentafel dar. Das ganze begann im Jänner, als Gerngross<br />
und Wladimir Jaremenko-Tolstoj die österreichische<br />
Zeitung <strong>ST</strong>/A/R im Dostojewski-Museum präsentierten.<br />
Zu diesem Zeitpunkt existierte das Dostojewski-Museum<br />
ohne Fassadentafel, da diese mehrmals von Fans des<br />
Dostojewski-Museums entwendet worden war. Gerngross<br />
erbot sich, dem Museum eine Archiquanten-Tafel, einer von<br />
Heidulf Gerngross eigens entwickelten Form, zu schenken.<br />
Wir nahmen dieses bemerkenswerte Angebot mit Freuden<br />
an, da wir der Auffassung sind, dass der große russische<br />
Schriftsteller Dostojewski der gesamten Welt gehört. An der<br />
Renovierung des Theatersaales des Museums beteiligte sich<br />
die norwegische Regierung. Nun besitzt es eine Fassadentafel<br />
von einem österreichischen Architekten. Das Museum leitet<br />
ein Projekt zur Schaffung eines Raumes der „Kulturen ohne<br />
Grenzen“. Gerngross’ Fassadentafel ist der Beginn eines<br />
neuen Projektes: „Dostojewski ohne Grenzen“.<br />
Heidulf Gerngross brachte sechs Tafeln aus unterschiedlichen<br />
Materialien: Marmor, Kupfer, Email, Kunststein etc., von<br />
denen nun erstere den Weg ins Museum weist. Wir hoffen,<br />
dass sie trotz ihrer zum Mitnehmen verlockenden Originalität,<br />
lange den Eingang des Dostojewski-Museums schmücken<br />
wird.<br />
Vera Biron<br />
P.S. Kurios mag die Tatsache anmuten, dass Dostojewski seinerzeit<br />
den Oberst und späteren General der Pioniertruppen Alexander<br />
Gerngross in Sibirien traf, mit dem er den Kontakt auch in St.<br />
Petersburg aufrecht erhielt.<br />
____________________________<br />
Am 25. und 26. August wird mit Unterstützung des Österreichischen<br />
Kulturforums Moskau der I. Drama-Slam im Dostojewski-Theater<br />
stattfinden. Der Drama Slam ist eine neue, von Wien ausgehende<br />
Form des Dichterwettstreits, in der szenische und dramatische Texte<br />
verschiedener Autoren von Schauspielern prima vista szenisch gelesen<br />
werden und das Publikum demokratisch über das gelungenste Drama des<br />
Abends entscheidet.<br />
St. Petersburg<br />
Nähere Informationen:<br />
http://www.myspace.com/theatertotal<br />
und: http://www.litafisha.ru/forum/viewtopic.php?t=1633&si<br />
d=1b0d65591347ece0f99c22f4829694f2<br />
Musik gibt es bereits auf einigen CDs, Bragofonie-Konzerte<br />
fanden in St.Petersburg und in Westeuropa statt.<br />
Seit ungefähr zwei Jahren gesellen sich Internet-Übersetzungen<br />
zu den „traditionellen“ Kulturprodukten der GG.<br />
Videokunstarbeiten von Aufführungen des „Alchemietheaters<br />
des rituellen Konstruktivismus“ und Vorträge speziell<br />
eingeladener Star-Künstler/innen aus St. Petersburg und<br />
Moskau.<br />
Für Webcasts wurde der „Internet-Lehrstuhl der Grjasnaja<br />
Galereja“ mit Hilfe des Medienkünstlers Sergey Teterin aus<br />
Perm eingerichtet, der nicht nur die technische Seite der<br />
Internet-Verlautbarungen aus dem großen Saal der Grjasnaja<br />
Galereja bestreitet, sondern wesentlich zur Popularisierung<br />
der GG im russischen Internet beigetragen hat.<br />
Die Pläne der privaten nicht-kommerziellen Galerie sind<br />
ehrgeizig. Ihre Internet-Aktivität und Gewagtheit der Vorhaben<br />
können sich bereits mit der Mehrheit der Petersburger<br />
Museen und Kulturzentren messen. Das Interesse an der<br />
GG als Ausstellungsfläche sowie als professionelles Kollektiv<br />
von Künstler/innen und Kulturoperatoren und nicht zuletzt<br />
als Künstlerresidenz im Herzen von St. Petersburg wächst<br />
täglich.<br />
Neben gemeinsamen Aktionen auf dem Territorium der GG<br />
wird im Gegenzug das „Bragofon“ im Sommer 2008 in die<br />
USA reisen und an der groß angelegten internationalen Sound-<br />
Art-Ausstellung „The sonic self“ in New York teilnehmen.<br />
Grjasnaja Galereja<br />
(von Gerald Kofler)<br />
Die Grjasnaja Galereja, kurz GG, ist ein hot Spot der<br />
gelebten Kreativität und von St. Petersburg. Eine<br />
experimentelle Plattform für phantastische Ideen und<br />
Versuchsgelände für die unterschiedlichsten künstlerischen<br />
Vorhaben. Das Epitheton „Grjasnaja“ (dreckig) im Namen<br />
der Galerie zielt nicht in Richtung Punk, sondern beinhaltet<br />
den direkten Verweis auf den alten Namen (und damit die<br />
Geschichte) der Straße, in der sie sich befindet,– so hieß die<br />
heutige „Uliza Marata“ vor der Revolution: Uliza Grjasnaja<br />
(Dreckige Straße).<br />
Als Schlüsselpersonen haben die beiden Künstler Valie Airport<br />
(Wien/St. Petersburg) und der Mikhail A Crest (St. Petersburg/<br />
Wien) eine Künstlergemeinschaft, Ausstellungsplattform,<br />
Museum der modernen Alchemie, Kammertheater,<br />
Laboratorium für Gastkünstler/innen und einen „Internet-<br />
Lehrstuhl“ ins Leben gerufen.<br />
Valie Airport widmet sich seit mehr als einem Jahrzehnt<br />
auf vielen Ebenen dem Gemeinsamen der Kulturen und im<br />
speziellen der russischen Kultur in ihren offiziellen, sowie<br />
versteckten und bisweilen geheimnisvollen Erscheinungen.<br />
Vor vielen Jahren erwarb sie eine groß dimensionierte<br />
Wohnung in der Marata-Straße im Zentrum von St. Petersburg<br />
Du<br />
und initiierte und betreibt seitdem die Grjasnaja Galereja.<br />
Mikhail A Crest hat sich und sein künstlerisches Schaffen den<br />
Höhen der hermetischen Kunst und der inneren Alchemie<br />
gewidmet. Durch sein Handanlegen verwandelte sich die alte<br />
Petersburger Wohnung in die Grasnaja Galereja, einen mehr<br />
als ungewöhnlichen Ort, der mit jedem Quadratzentimeter<br />
beeindruckt. Selbst bekannte Petersburger Kunstkritiker<br />
können beim ersten Besuch der GG ihr Staunen und ihre<br />
Begeisterung nicht verbergen.<br />
Die GG ist zum Magnet geworden, der auch<br />
Künstlerpersönlichkeiten aus Europa anzieht, um ein-zweidrei<br />
Monate hier zu leben und sich in die stürmischen<br />
künstlerischen Aktivitäten zu stürzen. Jeder Gast der<br />
Grjasnaja Galereja, der sich als Artist-in-residence hierher<br />
begibt, wird unmittelbarer Teil des schöpferischen Kreises der<br />
phantastischen Experimente der GG.<br />
An der Oberfläche bestehen diese in der symbolischen,<br />
vielfachen Destillation von Alkohol auf der Grundlage<br />
komplexer kombinatorischer Zahlensysteme.<br />
Ein Nebenprodukt dessen ist eine spezifische „Sound-<br />
Kunst“; das eigens dafür konstruierte „Bragofon“ fängt die<br />
Gärungsgeräusche ein und hält sie fest. Diese ungewöhnliche<br />
Zu den „strategischen Partnern der<br />
Grjasnaja Galereja gehören:<br />
NCCA <strong>ST</strong>. PETERSBURG (NATIONAL CENTER FOR CONTEMPORARY ART)<br />
MEDIENKUN<strong>ST</strong>LABOR CYLAND IN KRON<strong>ST</strong>ADT<br />
KULTURFONDS “SAINT PETERSBURG ART PROJECT”, NEW YORK<br />
<strong>ST</strong>/A/R – ART MAGAZINE, WIEN<br />
SHIFZ – SYNTHARTURALI<strong>ST</strong>ISCHE KUN<strong>ST</strong>VEREINIGUNG, WIEN<br />
FARCE VIVENDI – PLATTFORM FÜR LITERATUR UND KUN<strong>ST</strong>, WIEN<br />
Kontakt der Grjasnaja Galereja: TEL. +7-812-7133056<br />
VALIE GÖSCHL, SKYPE: VALIEAIRPORT,<br />
MAIL:KAOSPILOT@MONOCHROM.AT,<br />
MOB: +7-921-5544134 ODER MOB: +43-699-<strong>19</strong>717491<br />
MIKHAIL A CRE<strong>ST</strong>: SKYPE/YAHOO: ARXENEKROHEN,<br />
MOB: +7-921-3304805<br />
SERGEY TETERIN: SKYPE: SERGEY_TETERIN, MOB: +7-902-8353069<br />
Links:<br />
Audio/Video-Ressourcen von Mikhail A Crest:<br />
http://www.imeem.com/people/U4wk5B3<br />
Blogpublikationen über die GG:<br />
http://teterin.livejournal.com/tag/gg<br />
TV über die GG, Jänner 2008: http:<br />
//www.youtube.com/watch?v=Cfq_P-PDPEI<br />
Fotoreportage aus der GG: http://fotki.yandex.ru/users/<br />
sergeyteterin/album/32868/<br />
Valie Göschl im Magazin „Na Nevkom“: http://teterin.<br />
livejournal.com/<strong>19</strong>7456.html
WWW.TOL<strong>ST</strong>OI.RU<br />
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch VII - LITERATUR<br />
<strong>ST</strong>/A/R 43<br />
ELISABETH VON SAMSONOW (WIEN)<br />
ALOIS DEMPF – FOUCAULT AUF BAYERISCH<br />
MEINEM LEHRER <strong>ST</strong>EPHAN OTTO GEWIDMET<br />
A Zur Person<br />
B Dempfs Konzept der „langen Geschichte“ und der<br />
„historischen Vernunft“<br />
C Dempfs Entwurf der Theoretischen Anthropologie<br />
A Zur Person<br />
Nach Ernesto Grassi trat Stephan Otto als Institutsvorstand<br />
die Leitung des Instituts für Philosophie und<br />
Geistesgeschichte der Renaissance an der Universität<br />
München an. Ich habe von <strong>19</strong>77 bis <strong>19</strong>86, nach zwei<br />
Orientierungsjahren an der Philosophischen Fakultät<br />
(während derer ich Spaemann, Krings, Kuhn, Annemarie<br />
Pieper und Höffe gehört hatte) an diesem Institut studiert,<br />
zunächst bei Eckhart Kessler, dann bei Stephan Otto selbst,<br />
der mich dann auch mit einer Arbeit über Johannes Kepler<br />
promovierte. In Anschluß an die Promotion war ich mit<br />
Lehraufträgen zu den artes mechanicae und zum Verhältnis<br />
zwischen Astronomie und Philosophie in der Renaissance<br />
betraut, war also auch noch einige Zeit über den Abschluß<br />
meines Doktorats hinaus mit diesem Institut verbunden.<br />
Ich habe Stephan Otto in dieser Zeit mehrmals bewundernd<br />
über seinen Lehrer Alois Dempf sprechen hören. Was mir<br />
als Studentin nicht bewusst gewesen war, war der Umstand,<br />
dass Dempf zur Zeit meines Studiums in unmittelbarer<br />
Nähe zum Haus meiner Tante in Eggstätt seinen<br />
Lebensabend verbrachte und sich in so guter Verfassung<br />
befand, dass er in der Lage war, <strong>19</strong>81 „hochaufgerichtet“ zu<br />
seinem 90.Geburtstag die Glückwünsche der Kollegen und<br />
einer großen Öffentlichkeit entgegen zu nehmen, dabei<br />
überaus kräftig die Hände der Gratulierenden drückend 1 .<br />
Ich muß nachträglich sagen, dass ich ihm gerne persönlich<br />
begegnet wäre, zumal ihm eine Fama vorauslief, die ihn<br />
mir als nahen Verwandten erscheinen ließ, insofern er<br />
nämlich durch eine Verbindung zwischen Philosophie<br />
als Passion und seiner bäuerlicher Herkunft, wie man<br />
berichtet, charakterisiert ist. Wenn ich jetzt in Wien,<br />
nach vielen Umwegen, auf eine hellsichtige Einladung<br />
des hochgeschätzten Michael Benedikt hin, der in mir<br />
so etwas wie eine „geistige Enkelin“ Dempfs erblickte,<br />
mich mit den Schriften Dempfs beschäftige, kommt es<br />
mir vor, als würde der Geist meines Studiums, der Geist<br />
der Münchner Zeit lebendig. Ich fange an zu verstehen,<br />
in welch grundsätzlicher Weise mein eigener Lehrer<br />
wiederum von seinem Lehrer geprägt war, was dann auch<br />
ein Licht auf meine eigene intellektuelle Herkunft wirft,<br />
das mir so vorher noch nicht aufgegangen war. Es ist<br />
natürlich merkwürdig, wenn man als feministische Autorin<br />
plötzlich eine Eloge oder kritische Würdigung der eigenen<br />
Abstammungslinie von sehr patriarchalischen Philosophen<br />
verfasst, in der frau, wie sie endlich zugibt, steht oder<br />
gestanden hat. Ich will diese Gedächtnisarbeit aber auch<br />
in dem Sinne verstehen und vollenden, dass ein Teil der<br />
Befreiung von DenkerInnen meiner Generation hinsichtlich<br />
institutioneller und struktureller Diktate darin besteht, die<br />
Position der Lehrer zu erkennen und zu durchdringen, um<br />
sie dann in positiver Hinsicht, gewissermaßen durch- und<br />
abgearbeitet, anzuerkennen und schließlich zu lassen.<br />
Es ist mir schließlich nicht bewusst gewesen, dass ich als<br />
Kunstanthropologin an der Wiener Akademie der bildenden<br />
Künste in die Nähe eines theoretischen Programms geraten<br />
war, das von Dempf in mehrfachen Anläufen skizziert<br />
und entworfen worden war, nämlich in die Sphäre einer<br />
sich über sich selbst aufklärenden Philosophie, die die<br />
Trauer über die Unmöglichkeit ihrer eigenen Positivität<br />
durch die Konjunktion mit Disziplinen zu heilen versucht,<br />
welche über die Spezifikation „des Menschen“ verstreute<br />
Antworten zu bieten haben.<br />
Daß es ausgerechnet der berühmte Pater Wilhelm Schmidt,<br />
neben Wilhelm Koppers, gewesen sein sollte, der Dempf zu<br />
einem Ruf als Ordinarius für Philosophie an die Universität<br />
Wien verhalf, ist, scheint mir, aus heutiger Sicht eine<br />
folgerichtige und sprechende Tatsache. Schmidt hat sich<br />
als Ethnologe um den Beweis bemüht, dass die „Wilden“<br />
allzumal fromm seien und an einen Himmelvater glaubten.<br />
Auch wenn seine einseitige Lektüre der ethnographischen<br />
Aufzeichnungen heute als radikal überholt gilt, so findet<br />
man doch in den umfangreichen Schriften interessante<br />
Quellen. Seine Deutungsabsichten wirken auf uns heute<br />
naiv und es fällt nicht leicht, sie in ihrem, wenn auch<br />
begrenzten Wert, für die damalige Perspektive auf das<br />
Fremde zu würdigen. Jedenfalls war Schmidt betört vom<br />
1 Vincent Berning und Hans Maier (Hg.): Alois Dempf. Philosoph, Kulturtheoretiker,<br />
Prophet gegen den Nationalsozialismus, Weissenhorn <strong>19</strong>92, S.5<br />
(Vorwort der Herausgeber)<br />
Elisabeth von Samsonow in Jerusalem<br />
Studium des Fremden und damit in gewisser Hinsicht<br />
wahrer Kollege Dempfs, dessen anthropologische<br />
Skizzen immer auf die Vereinigung der bruchstückhaften<br />
Kenntnisse menschlicher Selbst - und Fremdbeschreibung 2<br />
ausgehen. Die Erträge, die die Ethnologie den<br />
substanziellen historischen Kenntnissen Dempfs zur<br />
Seite zu stellen hätte können, sind von ihm bestimmt in<br />
ihrem Wert erkannt worden. Schmidt war es auch, der<br />
sich bemüht hatte, „dank seiner vielen internationalen<br />
Beziehungen(,) verschiedene Rufe ins Ausland (zu)<br />
vermitteln, auch mit dem Angebot der amerikanischen<br />
Staaatsbürgerschaft“ 3 .<br />
Daß Dempf die Mehrheit der Stimmen der<br />
Fakultätsmitglieder für seine Berufung nach Wien erhielt,<br />
hängt kurioserweise auch damit zusammen, dass etwa der<br />
Historiker Heinrich von Srbik aus Unkenntnis des Textes<br />
das Hauptwerk des Kandidaten („Sacrum Imperium“) für<br />
eine „großdeutsche“ Schrift hielt. Dempf selber gab an,<br />
nach dem biographischen Zeugnis seiner Tochter , von<br />
dem „philofaschistischen“ Klima im Kulturleben Wiens<br />
überrascht gewesen zu sein. Für sein Zwangspensionierung<br />
im März <strong>19</strong>38 war wohl Dempfs Mitarbeit bei der<br />
faschismuskritischen Untersuchung „Studien zum Mythos“<br />
Rosenbergs verantwortlich, die dann von einem Gestapo-<br />
Agent eben nicht missverstanden worden war. Nach<br />
Kriegsende wird Dempf wieder nach Wien geholt, liest dort<br />
bis zu seinem Umzug nach München bis <strong>19</strong>50. Ab <strong>19</strong>49<br />
ist er Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität;<br />
er beginnt, regen Austausch mit Kollegen und Forschern<br />
zu pflegen, darunter die „Junge(n) Freunde(n), die seine<br />
Forschungsarbeit fortsetzten“ 4 , namentlich Stephan Otto - ,<br />
mein späterer Lehrer - , Rainer Specht, Hermann Krings.<br />
2 s. Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, Bern <strong>19</strong>50, S. <strong>19</strong>2-201 (Kap.V<br />
Fremderkenntnislehre und Charakterologie)<br />
3 Felicitas Hagen-Dempf: Alois Dempf – ein Lebensbild, in: Vincent Berning<br />
und Hans Maier (Hg.): Alois Dempf, a.a.O., S.17<br />
4 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.20<br />
B die lange Geschichte<br />
Der Schlüssel zu Dempfs Philosophie ist sein Konzept der<br />
Geschichte. Seine Idee einer „langen Geschichte“, über<br />
welche er sich profunde Kenntnis anzueignen trachtete,<br />
rückt auch seinen Katholizismus in einem neuen Licht.<br />
„Goethe verlangte, dass man sich von 3000 Jahren<br />
Geschichte müsse Rechenschaft geben können, jetzt sind<br />
es 5000 Jahre!“ 5 Selbst in einem seiner späteren Beiträge,<br />
nämlich zu einer Festgabe für Eric Vögelin zu dessen<br />
60.Geburtstag, fordert er in einem gerade dreieinhalb<br />
Seiten langen Beitrag, dass man endlich die Frage zu<br />
beantworten habe, „was für Stämme in den ersten Staaten<br />
zusammengefasst werden sollten und wer dies konnte.“ 6<br />
Diese Frage “wer dies konnte“ spiegelt das Motiv von<br />
Dempfs Hauptinteresse an der Geschichte wider. Als<br />
Gegenbewegung zu einer Dialektik der Geschichte oder<br />
zu Modellen evolutionärer Geschichtslogik setzt er die<br />
„universale Personalität“, das sich mit der Welt verbindende<br />
Selbstbewusstsein in der Vielzahl seiner Schichtungen,<br />
welche sich am Leitfaden der Selbsterkenntnis und der<br />
anwachsenden Fülle der Aspekte und Potenzen derselben<br />
selbstbestimmt als Geschichte hat 7 . Diese universale<br />
Personalität ist wohl auch in einer Auseinandersetzung<br />
der Geistes begriffen, deshalb auch reagierend und<br />
eben in systembildenden Prozessen auf dem Wege<br />
zu seiner Entfaltung, aber doch immer vollständig<br />
selbstverantwortlich und frei. Dempf antwortet mit seinen<br />
Entwürfen auf die, wie er selbst schreibt, 150 Jahre des<br />
heroischen Versuchs, eine kritische Geschichtsphilosophie<br />
5 Alois Dempf: Die unsichtbare Bilderwelt. Eine Geistesgeschichte der Kunst,<br />
Einsiedeln-Zürich-Köln <strong>19</strong>60, S.7<br />
6 Alois Dempf: Probleme der Genesis der Hochkulturen, in: Politische Ordnung<br />
und menschliche Existenz. Festgabe für Eric Vögelin zum 60.Geburtstag,,<br />
hg. von Alois Dempf, Hannah Arendt und Friedrich Engel-Janosi,, München<br />
<strong>19</strong>62, S.144<br />
7 „Der Mensch ist das höchstorganisierte, selbstbewusste Wesen, das sich<br />
charakteristisch entfaltet, also frei gesellschaftlich und geschichtlich lebt“ Alois<br />
Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.10<br />
S.46 >
Städteplanung / Architektur / Religion Buch VII - LITERATUR <strong>ST</strong>/A/R 45<br />
Elisabeth von Samsonow:<br />
Mary Magdalene’s Re-Immigration Center, Jerusalem<br />
Wunderbare Reise einer Statue<br />
Zu einer Reise aufbrechen, im Sommer, am besten dorthin, von woher einem die<br />
interessantesten Nachrichten entgegenkommen. Es wird ein großer Reisekoffer<br />
hergestellt, eigentlich ein Sarkophag oder eine Couchette: ausgepolstert,<br />
verziert, mit Satinbettwäsche in leuchtendem Rot und Gelb. Es gibt auch Kleingepäck,<br />
ein Kosmetiktäschchen, Parfumflakons. Eigentlich handelt es sich im Falle der Reise<br />
meiner Statue um eine „Heimkehr“. Denn wenn man es im Licht ihrer Geschichte<br />
betrachtet, ist Maria Magdalena, geboren in Magdala am See Genesareth, keine „natürliche<br />
Französin“. Auch wenn sie bei Marseille mit ihrem Schiffchen gelandet und dann viele<br />
Jahre in einer Grotte im Massiv La Sainte Baume verbracht hat, schließlich ihre Gebeine<br />
in St-Maximin-La Sainte Baume bzw. in Vézélay gelassen haben soll, war sie vielleicht<br />
Frankreichs prominenteste Immigrantin. Die Geschichten wandern mit den Leuten,<br />
Maria Magdalenas Geschichte hatte von da an ihr Zentrum nicht mehr zwischen See<br />
Genesareth und Jerusalem, sondern in „Europa“. Das Exil Maria Magdalenas entspricht<br />
dem Exil des Weiblichen in der Geschichte. Die Reise nach Jerusalem meiner Statue dreht<br />
diese Geschichte symbolisch um. Gibt ihr eine neue Drehung. Markiert einen neuen<br />
Punkt Null. Von hier aus, von diesem bestimmten Ort aus an der Stadtmauer Jerusalems<br />
zwischen dem Damaskustor und dem Herodestor, kommt jetzt ein neuer Impuls. An diese<br />
Stelle wurde die Statue in einer feierlichen Prozession getragen, mit Musik begleitet, von<br />
einer Gruppe von Leuten umgeben, die in den Händen weiße Lilien und Teppichklopfer<br />
hielten. Hier, an dieser ausgesuchten Stelle, wurde der „Sendemasten“ aufgestellt, die<br />
Statue, der Apparat, der Echo-Emitter, die Informationskonserve, die unsterbliche Mumie.<br />
Eine Heimkehr nach ungefähr <strong>19</strong>56 Jahren (wenn man dem Kalender Glauben schenken<br />
will). Eine späte, aber angemessene Ehrung und Feier.<br />
Die Skulptur, die in der zeitgenössischen Kunsttheorie auf Grund mangelnder Kriterien<br />
und und Kategorien ausgelassen wird, um nicht zu sagen: gesnobbt, besitzt für solche<br />
Operationen, wie ich sie im Sinn hatte, unüberbietbare Vorteile. Insofern sie einer<br />
transhumanen Chronik angehört (Dendrochronie oder Geschichte der Bäume) haftet<br />
ihrem „Fleisch“ etwas Objektivierendes an. Der Geschichte der Bäume zuzugehören heißt,<br />
reine Genealogie zu sein, reine Evolution, reine Erdlogik, Aufgehen im Metabolismus.<br />
Jede Skulptur ist im eigentlichen Sinne „Transplantation“, Ortswechsel der Pflanze.<br />
In dieser Transplantation bleibt aber die Pflanze bzw. ihre Gedächtnisbatterie (der<br />
Stamm) innerhalb der Echosphäre der Erde (biotopisch). Das Lindenholz nimmt die<br />
Information und hält sie zurück, anders und langsamer als Wasser. Holz ist daher der<br />
vornehmste Operator einer Tiefengeschichte, einer longue durée, die menschliches,<br />
nicht mehr nur geologisches (wie beim Stein) Geschichtsformat besitzt. Die Bedingung<br />
der Möglichkeit von Gedächtnis ist die elektromagnetische Interferenz des Erdfeldes<br />
mit ihren „Kleinkörpern“. Der Lindenstamm, der von uns verschickt und in Jerusalem<br />
herumgetragen wurde, wechselt (als Transpflanze im Transport) das Echofeld und<br />
hält seine Maria-Magdalena-Information (eine Form haben heißt: einen Zweck haben,<br />
griech. Entelechie) in das Feld hinein. Das ergibt eine neue Interferenz, eine neue<br />
Gedächtniskonstellation.<br />
Maria Magdalena taucht auf, um einen neuen Nullpunkt zu generieren. Die<br />
Gedächtniskonstellation zu verändern heißt eine neue Geschichte zu erzählen. Die<br />
neue Geschichte ist die des Ausgleichs. Es ist die der Balance zwischen Männlich und<br />
Weiblich, nicht weniger als die Verkündigung der Gleichwertigkeit des Verschiedenen:<br />
zwei Hälften (Teppichklopfer/Lilie), die kybernetisch aufeinander reagieren. Es gibt<br />
auch ein Evangelium der Maria Magdalena. Der Teppichklopfer, ein unmittelbar an den<br />
Haushalt verweisendes Instrument, steht für das Weibliche, sofern damit Innerlich,<br />
Intimes, Häusliches, Privates gemeint ist. Ein in einer Prozession im öffentlichen<br />
Raum mitgeführter Teppichklopfer ist, wie Lacan sagen würde, nicht an seinem Ort.<br />
Der Teppichklopfer erhebt also eine Forderung, erstens die Disjunktion zwischen<br />
Weiblichkeit und Häuslichkeit, und zweitens die Konjunktion zwischen Weiblichkeit und<br />
Öffentlichkeit. Der Teppichklopfer ist der provisorische Signifikant. Der Teppichklopfer<br />
ist meistens als schöner Knoten ausgebildet, was ihm einen einzigartigen ästhetischen<br />
Reiz gibt. Ferner steht er als Knotendarstellung mit anspruchsvoller Knotenmathematik in<br />
Beziehung. Und diese Mathematik verweist natürlich auf eine komplexen Diagrammatik<br />
des Raumes, die unweigerlich sowohl BildhauerInnen wie ArchitektInnen in ihren Bann<br />
zieht wie ein „Traktor“.<br />
Die Form der Statue der Maria Magdalena ist selbst aus zwei sich ineinander schlingenden<br />
langen Linien entwickelt. Die gesamte Figur wird von sich schlängelnden Linien wie<br />
von hölzernen Oszillogrammen bedeckt. Damit drückt sie ein „Erdwissen“ aus oder die<br />
Technologie des Lebendigen, das sich im Schlängeln der Kräfte und Informationen, in der<br />
Integration des Bipolaren realisiert. Maria Magdalena verkörpert den idealen Moment, den<br />
Drehmoment, der die Bewegung (wieder) anstößt. Sie wird nicht ohne Grund als Apostola<br />
Apostolorum bezeichnet. Stellvertretend bewegt wieder sie die „weibliche Angelegenheit“.<br />
Jetzt, wo sie wieder zurückgekommen ist und öffentlich in Jerusalem gezeigt wurde, ist<br />
das Exil des Weiblichen beendet.<br />
SAMSONOW
46 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch VII - LITERATUR Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
> S.43<br />
deduktiv und induktiv zu begründen 8 . Man erkennt sehr<br />
schnell, wie tief und effizient die Schulung Dempfs an Kant<br />
und Hegel gewesen ist, insofern sich in dem gesamten<br />
Werk ein gewisser Überdruck mitteilt, zum System zu<br />
kommen bzw. die Elemente oder Begriffe systematisch<br />
zusammenzustellen . Dempf bleibt in dieser Hinsicht<br />
ein Kind des späten neunzehnten und beginnenden<br />
20.Jahrhunderts, radikalisiert aber seine Fragestellungen<br />
zunehmend. Seine Verbindung zu Eric Vögelin tritt<br />
zunehmend deutlich hervor. Was als Geschichtstheologie<br />
oder Geschichtsmetaphysik im Sinne Hegels als Problem<br />
gestellt war, wird zur Geschichtsphilosophie und und<br />
zur politischen Theorie umgestaltet. Dempfs frühe<br />
Arbeit „Weltgeschichte als Tat und Gemeinschaft. Eine<br />
vergleichende Kulturphilosophie“ kündigt bereits einen<br />
Ansatz an, der sich nicht mehr aus der Perspektive der<br />
Sicherung von Heilsgeschichte versteht. Die Einsicht in<br />
die Dynamik von Gruppen- und Staatenbildung, stets<br />
auf dem Hintergrund der „universalen Persönlichkeit“<br />
überwiegt längst die Tendenz, geschichtsteleologisch<br />
eine bestimmte Gruppe zu privilegieren. Das relativiert<br />
seinen Katholizismus noch einmal, abgesehen davon,<br />
dass überhaupt das Beste mit ihm getan hat, was sich<br />
aus ihm ableiten lässt, nämlich ihn als anti-ideologische,<br />
anti-dogmatische, antifaschistische Bastion in Anspruch<br />
zu nehmen. Über die Zusammenhänge der Linien<br />
und Strukturen der Religionen untereinander, die ihn<br />
außerordentlich interessieren, schreibt er bisweilen<br />
Überraschendes: „Das wichtigste Hindernis, daß man<br />
solange die seit zwei Jahrhunderten, seit Vico, in der<br />
Luft liegenden Entwicklungsgeschichte der einzelnen<br />
Kulturkreise nicht systematisch durchgeführt hat, ist<br />
die Eigenart des altchristlich-islamischen Kulturkreises,<br />
den man nicht in seiner Einheit erkannte, weil man<br />
Christentum und Islam als zwei völlig getrennte Religionen<br />
auffaßt, statt den Islam als eine allerdings schroff<br />
differenzierte Konfession des Christentums anzusehen, die<br />
sich von ihm nicht wesentlicher unterscheidet als etwa der<br />
Kalvinismus vom Katholizismus.“ 9 Derlei Überlegungen<br />
lassen zumindest das klare Bewusstsein der historischen<br />
Kontingenz der Religionsentwicklung im institutionellen<br />
und anthropologischen Sinne sehen. Die Prozesse, in<br />
denen sich ein, wiederum in sich gespaltenes und um<br />
Glaubenssätze ringendes (Monophysiten, Arianer etc.)<br />
Christentum herausbildete, werden von Dempf in einer<br />
ausgereiften Schrift aus dem Jahr <strong>19</strong>72 wieder thematisiert<br />
und in umfangreichen bzw. weitreichenden Überlegungen<br />
dargestellt 10 . In der Einleitung legt der Autor Rechenschaft<br />
über die Geschichte dieser Disziplin, über ihre Methoden<br />
und ihre Ziele ab 11 . Wiederum tritt deutlich sein Interesse<br />
an einer Systematisierung und Schematisierung der<br />
organisierenden Kräfte zutage 12 . Die Religionssoziologie<br />
verfolgt ihm dabei einen ähnlichen Zweck wie die<br />
Wissenssoziologie, mit dem Unterschied, dass in der<br />
Religionssoziologie die die Gruppe konstitutierenden und<br />
verpflichtenden Erkenntnisse unmittelbar ethisch und<br />
politisch relevant werden. Die Wissenssoziologie hingegen<br />
wird Dempf in ihrer „außerordentliche Bedeutung (…..)<br />
für das Verständnis der steigenden Freiheit des Menschen<br />
und seiner eigenen Verantwortung für die Lenkung der<br />
Geschichte“ 13 heraussstreichen.<br />
C ANTHROPOLOGIE<br />
Dempfs „Achsenzeit“ ist die Aufklärung, die er als letztes,<br />
sich naiv selbst deutendes Stadium der Geschichte versteht.<br />
„Die ganze Philosophie war ja neben dem seit der<br />
späten Aufklärung sich durchsetzenden Positivismus<br />
der mechanistischen Naturauffassung nur mehr ein<br />
‚Reich der Phantasie’, das als ein zweites Stadium der<br />
Geistesentwicklung nach der Religion und mit ihr als<br />
überholt galt. Nun hat das gewaltige Wachstum des Baumes<br />
der exakten Wissenschaften zu einer neuen Gesamtlage des<br />
geistigen Lebens geführt.“ 14<br />
Dempf hat, wie man dem Zeugnis der Biographen<br />
entnehmen kann, zunächst auf Drängen seines Vaters<br />
hin Medizin studiert, immerhin einige Semester<br />
(die ihn dann zum „Unterarzt“ während des Zweiten<br />
Weltkrieges qualifizieren sollten). Seine Empfänglichkeit<br />
für die Bedeutung des Biologischen ist auch auf diesem<br />
Hintergrund begreiflich 15 , ganz abgesehen von der<br />
8 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.42<br />
9 Alois Dempf: Weltgeschichte als Tat und Gemeinschaft. Eine vergleichende<br />
Kulturphilosophie, Halle (Saale) <strong>19</strong>24=Forschungen zur Philosophie und ihrer<br />
Geschichte, hg. von Hans Meyer, Band I<br />
10 Alois Dempf: Religionssoziologie der Christenheit. Zur Typologie christlicher<br />
Gemeinschaftsbildungen, München-Wien <strong>19</strong>72<br />
11 ebda., S.7-14<br />
12 s. Schema S.13, ebda.<br />
13 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie,a.a.O., S.45<br />
14 Alois Dempf: Die Weltidee, Einsiedeln <strong>19</strong>55, S.60f<br />
15 „(…)mit dem genetischen Verstehen der geheimnisvollen Menschennatur<br />
(ist) eine Einbruchsstelle in das uralte Menschenrätsel zu finden“, Alois Dempf:<br />
Kierkegaards Folgen, Leipzig <strong>19</strong>35, S.<strong>19</strong>3.Um diese „Einbruchsstelle“ habe sich<br />
vor allem as <strong>19</strong>.Jahrhundert bemüht.<br />
Bedeutung, die Dempf in historischer und theoretischer<br />
Hinsicht besonders dem französischen Vitalismus in seiner<br />
Funktion als nostalgische Reaktion auf das Scheitern der<br />
Aufklärung und des Systems in der Philosophie zuweist.<br />
Neben der Erkenntnis des historischen Bewusstseins<br />
bzw. als Korrelat zu ihr, ist also nach Dempf die neue<br />
philosophische Aufgabe in der Synthese zweier bisher<br />
disparat gebliebener Linien des Denkens zu sehen,<br />
nämlich in der Verbindung von Individuation und<br />
Spezifikation 16 . In der Lösung dieser Aufgabe hat Dempf<br />
einen bemerkenswert originellen Schreibstil „erfunden“,<br />
der ähnliche Lösungsansätze, wie beispielsweise diejenigen<br />
von Gehlen, Plessner oder auch Spengler, Toynbee oder des<br />
von ihm geschätzten Borkenau poetisch überbietet:<br />
„..der Stehfuß, die Arbeitshand und der Redemund sind<br />
Organe der Geistseele. Der innere Organisationsgrund<br />
ist nicht eine selbständige zweite Natur, auch er steht<br />
nur als Organisationszentrum im Dienste der Geistseele.<br />
Der Gemeinsinn ist das Auszeugemittel als plastisches<br />
Funktionszentrum.“ 17 . In seiner Schrift „Theoretische<br />
Anthropologie“ entwirft die Koordinaten für eine<br />
zukünftige Wissenschaft vom Menschen, zu denen er<br />
sinnenfällige Figuren zeichnet, wie beispielsweise die<br />
Figur I, die „Umwelt“, „Innenwelt“ und „Organisation“ in<br />
einer Zusammenschau von Üxküll und Haecker vereinigt,<br />
wobei unter „Organisation“ die merkwürdige Begriffsreihe:<br />
Werkzeuge Merkzeuge Lebzeuge 18 zu finden ist. Diese<br />
Zeug-Klassen lassen durchaus an Heidegger denken. Aus<br />
den Zuweisungen höherer Kompetenzen an die Zellnatur,<br />
die Dempf, nach Johannes Müller und Joseph von<br />
Görres, als „Autonom“, als „ein selbständiges Zentrum“<br />
anerkennt <strong>19</strong> , folgert er eine Reihe von Forderungen an<br />
die Philosophie. „Der biologische Organisationsbegriff<br />
ist vertieft worden durch die Lebensplanforschung. Die<br />
Menschenart ist bestimmt durch die Zusammengehörigkeit<br />
von Denkvermögen, Ichbewusstsein und Welthaben. 20<br />
Etwas ernüchtert allerdings durch die Vorstellung, wie und<br />
ob denn in der institutionellen und gemeinschaftlichen<br />
Produktion von Wissen diese Synthese durchgeführt<br />
werden könnte, setzt Dempf hinzu: „(..) aber der<br />
Monstrekongreß der Philosophen kann nicht noch durch<br />
einen Übermonstrekongreß aller Forscher überboten<br />
werden.“ 21 Die Entwicklung des historischen Bewusstseins<br />
legt Dempf also parallel zum Scheitern der Aufklärung<br />
an, gewissermaßen als ihren eigenen Trauer- oder auch<br />
Bereinigungsaspekt, welcher zugleich die schwerste<br />
Krise der Philosophie auf Dauer gestellt habe 22 . Wo die<br />
Gewißheit der philosophischen reinen Prinzipien verloren<br />
war, wucherte sozusagen der Baum des historischen<br />
Bewusstseins in seinen vielfältigen Verzweigungen, welches<br />
Geäst erst in der „morphologischen Anthropologie“ 23 zur<br />
Erkenntnispflege kommt. Es war also für Dempf dieses<br />
überdifferenzierte Wachstum, die „spezialwissenschaftliche<br />
Krisis der Menschenlehre im <strong>19</strong>.Jahrhundert“ 24 ,<br />
deren Folgen zu tragen und durch die Philosophische<br />
Anthropologie zu kompensieren sind. Die geforderte<br />
Vereinigung der Philosophie mit der Biologie und der<br />
Wissenschaft der sinnlichen Organisation, die ihn in Gestalt<br />
der Lehren von Helmholtz und Wundt großen Eindruck<br />
gemacht haben 25 , lässt er also erst in dem Moment zu, in<br />
dem der „dogmatische Schlummer“ bereits beendet ist,<br />
d.h. in dem Augenblick, der dann genau die Geburtstunde<br />
der Philosophie als Theoretische Anthropologie ist, und<br />
zwar aus dem Grunde, daß die immer nur impliziten<br />
Erstannahmen der Metaphysik als Weltanschauung<br />
kritisch durchforstet und durchschaut werden müssen.<br />
Das bedeutet, dass die Philosophie des historischen<br />
Bewusstseins sich nicht nur mit den „Naturwissenschaften<br />
vom Menschen“ zu hybridisieren, sondern über die<br />
Integration dessen, was im weitesten Sinne Mythos<br />
und Religion heißt, über die impliziten Menschenbilder<br />
(„transzendentale Poetik“ 26 ) zu verständigen hat.<br />
„Das ist also die entscheidende erkenntnistheoretische<br />
Vorfrage einer jeden Wissenschaftstheorie überhaupt.<br />
Wie weit ist…unser vermeintlich rein positives,<br />
mathematisch-physikalisches Denken anthropomorph?<br />
Können wir unseren Schatten überspringen? Können wir<br />
unsere eigene Sinnes- und Geistorganisation verstehen,<br />
unsere biologisch bedingte Orientierung in der Welt<br />
und unter den Mitmenschen und Lebewesen, unter<br />
Gebrauchsgegenständen und unbelebten Dingen vielleicht<br />
16 Alois Dempf: Die Einheit der Wissenschaft=Urban-Bücher, hg.von Fritz<br />
Ernst und Karl Gutbrod, Nr.18, Stuttgart <strong>19</strong>55, S.38, siehe auch S.39-42<br />
17 ebda., S.122<br />
18 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, Bern <strong>19</strong>50, S.79<br />
<strong>19</strong> Alois Dempf: Die Weltidee, a.a.O., S.46<br />
20 Alois Dempf: Die Einheit der Wissenschaft, a.a.O., S.124<br />
21 ebda., S.117<br />
22 ebda., S.169<br />
23 ebda., S.175<br />
24 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.15<br />
25 Alois Dempf: Die Weltidee, a.a.O., S.17<br />
26 „Diese transzendentale Poetik zielt auf die Kulturheroen, wie Prometheus,<br />
und auf die Religionsstifter, nicht als Gesetzgeber, sondern als Schöpfer von<br />
Weltanschauungen.“ Alois Dempf: Die Weltidee, a.a.O., S.69<br />
vergleichsweise der lebensgesetzlichen Orientierung der<br />
Tiere in ihrer Umwelt unserer Forschung unterstellen?“ 27<br />
In der Beantwortung dieser Frage kam Dempf zu<br />
Formulierungen, die der nicht nur geneigte oder nicht<br />
kundige Leser ihm leicht als gläubige Naivität auszulegen<br />
könnte: „Die Religion ist viel philosophischer als die<br />
Philosophie. Sie allein hat ein Gesamtbild der ganzen<br />
Wirklichkeit und des ganzen Lebens und vermag vor allem<br />
den ganzen Menschen zu erfassen.“ 28 Die Weltbilder<br />
aber seien in ihrer Abhängigkeit von metaphysischen<br />
Vorentscheidungen zu erkennen, die ihrerseits die<br />
unausgesprochenen Menschenbilder verdecken 29 . Daher<br />
kommt der Religion gegenüber den lebensweltlich<br />
orientierten Disziplinen eine wichtige Funktion zu. Die<br />
integrative Verbindung, die die theoretische Anthropologie<br />
als philosophische Disziplin sowohl zur Biologie und zur<br />
Lehre von der Welthabe durch die Sinnesorganisation<br />
als auch zu den Religionen herstellt, sichert sie<br />
gewissermaßen vor der doppelten Gefahr in den Rückfall<br />
des „dogmatischen Schlummers“. Dem Thema dieser<br />
neuen Wissensorganisation ist Dempfs Schrift „Selbstkritik<br />
der Philosophie“ gewidmet. Die Philosophie verwandelt<br />
sich auf dem Boden einer doppelten, integrativen Kritik in<br />
eine Philosophiegeschichtsschreibung, die anthropologisch<br />
vergleichend verfährt.<br />
Dempf hat als junger Dozent nicht nur in Bonn Max<br />
Scheler gehört, sondern auch dessen Thesen zur<br />
Wissenssoziologie weiter zu entwickeln versucht. Er hat die<br />
Thesen Schelers mit denjenigen Webers zu vereinbaren<br />
beabsichtigt, welcher ihm auch als Religionssoziologe galt 30 .<br />
Wohl auch im Stil der Zeit hat er sich der Frage zugewandt,<br />
wie und mit welchen Mitteln sich unterschiedliche<br />
Gruppen („Werkgemeinschaft“) unterschiedlichen Zielen<br />
unterstellen. In diesem Sinne findet er wesentlich zu dem,<br />
was man als Ideologiekritik 31 und Weltanschauungskritik<br />
bezeichnet. Als Leitfaden der Untersuchung für die<br />
Orientierung historischer Epochen und politischer Gruppen<br />
dient ihm – darin sind seine Analysen wegweisend für<br />
die heute sich zunehmend ins Zentrum des Interesses<br />
schiebende Kunstanthropologie – die Auseinandersetzung<br />
mit künstlerischen Zeugnissen. Dempf schreibt: „So<br />
hat die Kunstgeschichte, in diesem philosophischen<br />
Sinn verstanden, die Hauptlast der Kulturgeschichte und<br />
der Geschichtsphilosophie zu tragen.“ 32 Auch wenn die<br />
Durchführung vollkommen anders ausfällt, so schwebt<br />
doch Dempf, darin Foucault ähnlich, eine Aufschlüsselung<br />
der Institutionen über die Mittel ihrer Repräsentation vor 33 ,<br />
die er allerdings als Ausdruck schöpferischer Intelligenzen,<br />
als Ausdruck der historischen Vernunft setzt. Die<br />
Institutionenlehre ist geknüpft an die Ikonologie, an die<br />
Bilderwelt, die „Bildungsmacht“ wird 34 .<br />
Dempf hat in hohem Alter noch an einer Synthese<br />
seines anthropologischen Konzeptes gearbeitet. Seiner<br />
Vorgabe, man habe sich in einen Horizont von mindestens<br />
fünftausend Jahren zu bewegen, hat er sich weiterhin<br />
verpflichtet, auch wenn die fortschreitende Zeit ihm neue<br />
Aufgaben, neue Autoren, neue Blickwinkel erschloß. Das<br />
Monument einer „Problemgeschichtlichen Synthese“<br />
unter dem einfachen Systemtitel „Metaphysik“ wurde<br />
erst posthum veröffentlicht, nach einer Redaktion und<br />
Ergänzung des Manuskripts durch seine Frau Christa<br />
Dempf-Dulckeit 35 . Es beginnt natürlich auch diese Schrift<br />
mit den antiken Weltlehren und bezieht, in der Krümmung<br />
extrem weiter argumentativer Bögen, schließlich etwa<br />
die neuesten Erkenntnisse der Physik – die Thesen Ilya<br />
Prigogines – ein. An diesem Werk lässt sich noch einmal<br />
ablesen, was es bedeutet, auf sich zu nehmen, das Feld der<br />
historischen Vernunft zu beackern. Es wird nämlich immer<br />
größer, während man noch ackert.<br />
27 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.17<br />
28 Alois Dempf: Religionsphilosophie, Wien <strong>19</strong>37, S. 9<br />
29 Alois Dempf: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.18<br />
30 „Wenn zu Anfang unseres Jahrhunderts dem historischen Materialismus<br />
eine höhere Auffassung gegenübergestellt werden sollte, musste sie selber<br />
von der Wirtschaftslehre ausgehen und Geist, Sittlichkeit und Religion mitten<br />
im Kampf der Lebensmächte zeigen. Nur ein Wirtschaftshistoriker konnte<br />
diese Aufgabe erfüllen, der zugleich den ganzen Stoff der Religionsgeschichte<br />
beherrschte und noch dazu die gewaltige zusammenschauende Kraft besaß,<br />
alle Konstellationen der Kulturgeschichte zu überblicken, Max Weber.“ Alois<br />
Dempf: Religionsphilosophie, a.a.O., S.26<br />
31 s. dazu : Alois Dempf: Staatsphilosophie in Spanien, Salzburg <strong>19</strong>37,<br />
besonders die Einleitung, in der er der Ideologiekritik die Methodenkritik zur<br />
Seite stellt, S.9f; ebenfalls: Theoretische Anthropologie, a.a.O., S.217-2<strong>19</strong><br />
32 Alois Dempf: Die unsichtbare Bilderwelt,a.a.O.,S.<strong>19</strong><br />
33 „Das ist die methodische Aufgabe, Verbindung von Institutionenlehre und<br />
Ikonologie. Das ist mehr als das, was man gewöhnlich Soziologie der Kunst<br />
nennt (…)“ Alois Dempf: Unsichtbare Bilderwelt, a.a.O., S.23<br />
34 ebda., S.22<br />
35 Alois Dempf: Metaphysik. Versuch einer problemgeschichtlichen Synthese,<br />
in Zusammenarbeit mit Christa Dempf-Dulckeit=Elementa .Schriften zur Philosophie<br />
und ihrer Problemgeschichte, hg.von Rudolph Berlinger und Wiebke<br />
Schrader, Band XXXVIII, Amsterdam <strong>19</strong>86
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch VII - LITERATUR<br />
<strong>ST</strong>/A/R 47<br />
Auszug aus:<br />
„AN DEM TAG, ALS ICH MEINE FRISEUSE<br />
KÜS<strong>ST</strong>E, SIND VIELE VÖGEL GE<strong>ST</strong>ORBEN“<br />
von Josef Kleindienst<br />
11556.<br />
Krieg war ausgebrochen.<br />
Ein ganzes Kommando Slowaken war in<br />
der Nacht über die Grenzen gekommen,<br />
hatte Dörfer niedergebrannt und war<br />
dann wieder nach Hause gegangen. Der<br />
slowakische Präsident entschuldigte sich für<br />
diesen bedauerlichen Vorfall und versprach<br />
Wiedergutmachung.<br />
Aber noch in derselben Stunde waren die<br />
Unsrigen ausgerückt und legten Bratislava in<br />
Schutt und Asche. Mir war das egal. Bratislava<br />
gefiel mir nicht sonderlich.<br />
11556<br />
Wieder nichts. Ich spucke aus dem Fenster<br />
und habe wieder nicht getroffen. Ich bin<br />
erschüttert.<br />
115559<br />
Ich gebe mir eine Spritze und verspüre eine<br />
angenehme Entspannung.<br />
11558<br />
Ich gebe mir noch eine Spritze und kratze<br />
mich am Ohr.<br />
115556<br />
Eine Kleine Nachtmusik erklingt aus dem<br />
Radio. Ich bin gerührt.<br />
2004<br />
Zwei Tage hat das Telefon nicht geläutet. Ich<br />
bin verzweifelt. Hat mich die Welt vergessen?<br />
22089<br />
Heute bin ich aufgewacht und habe mir<br />
gedacht, ich muss dieser Welt den Krieg<br />
erklären mit allen mir zur Verfügung<br />
stehenden Mittel. Ich schaue aus dem Fenster<br />
und spucke. Ergebnis egal.<br />
Ich ziehe mich zurück und warte noch zwei<br />
Tage auf einen Anruf.<br />
Dann klingelt das Telefon, ich gehe aber nicht<br />
ran.<br />
Erst nach weiteren zwei Anrufen hebe ich ab.<br />
„Hallo, wer da?“ „Ich bin es Santa Claus.“<br />
„Santa Claus, wie nett, dass du an mich<br />
denkst, du meine Santa Claus, du.“ Mit Santa<br />
Claus habe ich eine innige Verbundenheit.<br />
Ich hatte sie einmal getroffen und sofort<br />
gewusst, dass ich eine Seelenverwandte<br />
gefunden habe. Santa Claus hat das nicht<br />
so gesehen. Aber ich habe sie so lange<br />
terrorisiert, bis sie das eingesehen hat. Jetzt<br />
sind wir glücklich. Santa Claus ruft mich alle<br />
2 Monate einmal an. Und ich rufe sie einmal<br />
im Monat an und erkläre ihr immer, wie gern<br />
ich Sex mit ihr hätte.<br />
Aber sie hat genug Sex, klärt sie mich jedes<br />
Mal auf. Auch schön.<br />
114432<br />
Heute ist mein Tag. Ich laufe in die Trafik<br />
und kaufe mir ein Rubbellos.<br />
11232<br />
Ich brauche auch einen Job, einen verfluchten<br />
Job. U-Bahn-Fahrer dürfen den ganzen Tag<br />
im Kreis fahren und können Pornos lesen.<br />
11222<br />
Transformation. Eine E-Mail hat mich nach<br />
St. Petersburg geschleudert. Hier soll es<br />
Killer zum Saufüttern geben, für 300 Dollar<br />
ist man dabei, wie ich von Vlado erfahre.<br />
Vlado hat mich vom Flughafen abgeholt, mit<br />
einem alten museumsreifen Lada, dessen<br />
Sitze mit hellrotem Plüsch überzogen<br />
waren, und mich, nachdem ich mit seiner<br />
Unterkunft nicht zufrieden war, bei der<br />
Melonenmafia einquartiert. „You know<br />
what is a musserfucker?“ „No idea.“ „Ein<br />
Melonenficker“, hat er gelacht, als er mit<br />
mir den mit Müll überfrachteten Innenhof<br />
eines heruntergekommen Wohnhauses<br />
betrat. Danach stiegen wir das schmale<br />
Stiegenhaus hoch, er zeigte mir mein 7m 2<br />
Zimmer, drückte mir den Schlüssel in<br />
die Hand und meinte noch, ich soll mich<br />
vor der Wohnungseigentümerin, ihrem<br />
Liebhaber, ihrer Tochter, dem Liebhaber ihrer<br />
Tochter und den 8 aserbaidschanischen<br />
Melonenverkäufern, die hier ebenfalls<br />
Quartier bezogen haben, in Acht nehmen.<br />
112701<br />
Bald darauf bin ich von der Melonenmafia<br />
umzingelt. Ich komme mir vor, als hätte<br />
ich eine Kajüte in einem überfüllten<br />
Fischerboot bezogen. Immer wieder<br />
Stimmen, Handyläuten, Getrampel. Ich<br />
betrete die Küche und sehe eine brünette<br />
Frau um die vierzig, offensichtlich die<br />
Wohnungsbesitzerin. Sie lächelt mich<br />
an, als ob ich schon immer da gewohnt<br />
hätte. Sie spricht mit mir. Ich verstehe sie<br />
nicht. Sie spricht nochmals mit mir. Ich<br />
verstehe sie wieder nicht, sage immer nur<br />
„spassiba“ und nicke mit dem Kopf, zeige<br />
auf die Waschmaschine, weil ich meine<br />
Schmutzwäsche waschen möchte, aber sie<br />
zuckt nur mit den Achseln und verlässt den<br />
Raum.<br />
Ich ziehe mich ebenfalls in meinen Raum<br />
zurück und starre auf Putin, der als<br />
Schlüsselanhänger geliftet am Kleiderschrank<br />
baumelt. Bald darauf Getrampel, eine ganze<br />
Herde russischer Elefanten oder so was<br />
Ähnliches muss sich im Nachbarzimmer<br />
niedergelassen haben.<br />
Wände kahl, mein Notebook an die hiesige<br />
Telefonleitung angeschlossen, zwei<br />
Wodkaflaschen am Tisch und irgendwelche<br />
russischen Atommücken, die mich nachts<br />
halb um den Verstand bringen, surren im<br />
Raum umher. Wer hat mir bloß diese Viecher<br />
da geschickt? Der russische Geheimdienst<br />
möchte mich offenbar zermürben, sicherlich<br />
Oberst Scharimenko, dem ich keinen blasen<br />
konnte. Im Hof macht sich eine alte<br />
Frau am Müll zu schaffen, sucht<br />
wohl irgendeinen Computerchip,<br />
der ihr Hungerproblem lösen soll.<br />
Ich würde mir am liebsten Wodka<br />
reinziehen und sonst nichts.<br />
11309<br />
Keine E-Mail, kein Anruf in<br />
den letzten drei Stunden. Im<br />
Nachbarzimmer permanentes<br />
Handyläuten mit allen<br />
möglichen Melodien, ist sicher<br />
schon fünf am Morgen, wer will<br />
jetzt noch Melonen, ich bin am<br />
Ende, das geht jetzt schon die dritte Nacht so.<br />
Plötzlich ein Läuten, am Apparat ein Herr<br />
Dimitrie: „Puschkinskaya, bei den Kommis<br />
um acht“, pfaucht er ins Telefon und legt auf.<br />
12009<br />
Ich verstehe kein Russisch, er kein Deutsch.<br />
Als Erkennungsmerkmal zeigt er mir seine<br />
Narben an den Pulsadern, zweifacher<br />
Selbstmordversuch, und als Draufgabe noch<br />
eine Narbe, die sich über seinen ganzen<br />
rechten Arm erstreckt. Kaukasus. Ich bin<br />
beeindruckt, kann mit nichts Vergleichbarem<br />
entgegenhalten. „Macht nichts“, winkt er ab<br />
und blättert in seinem Wörterbuch.<br />
Ich bestelle Wodka. Er trinkt nur Bier, keinen<br />
Wodka, „no Wodka“, worauf er ausdrücklich<br />
hinweist.<br />
Er ist hinter einem Affen her, hinter einem<br />
Affen, den er kürzlich verloren hat, und<br />
um diesen Affen dreht sich alles, erklärt<br />
er mir. Ich starre ihn an. „Ein Affe hier<br />
in St. Petersburg, ist das nicht zu kalt?“<br />
„Ach was“, wiegelt er ab, „das Tier ist ganz<br />
wintertauglich.“ Er stößt auf mich an und<br />
ich auf seine aufgeschlitzten und nunmehr<br />
verheilten und vernarbten Pulsadern.<br />
„You want?”„No I stopped“, lehne ich sein<br />
Zigarettenangebot ab. „Nicht möglich, hier in<br />
Russland.“<br />
1288<br />
Okay, das Geschäft läuft, das Affengeschäft.<br />
Permanenter Autolärm begleitet mich auf<br />
meinem fünfzehnminütigen Heimweg. An<br />
der Kreuzung ein Kriegsinvalide, der auf<br />
einem Bein von einem Lada zum anderen<br />
hopst, in seinen Händen eine kleine rote<br />
Schüssel, in die von Zeit zu Zeit ein paar<br />
Rubel geworfen werden. In spätestens<br />
zwei Wochen ist er bestimmt an einer<br />
Abgasvergiftung krepiert. Wieder zurück,<br />
rasiert sich gerade ein Melonenverkäufer.<br />
Keine schlechte Idee, denke ich mir und lasse<br />
mich erschöpft auf mein Bett fallen.<br />
23232<br />
Die Melonenverkäufer umkreisen mich.<br />
Wenn ich die Küche betrete, sprechen sie<br />
allesamt gleichzeitig mit mir, offenbar eine<br />
Art Begrüßung. Ich erwidere ein verlegenes<br />
„Spassiba“ nicke aufgeregt und ziehe mich<br />
gleich wieder zurück.<br />
121212<br />
„Da, an dieser Stelle wurde der<br />
Vizebürgermeister von einem<br />
Heckenschützen erschossen. Und dort auf<br />
dem Dach wurde als Andenken an den Killer<br />
ein kleiner Baum gepflanzt.“<br />
1132<br />
Ich steige aus der U-Bahn aus, laufe das<br />
Huun-<br />
Hur-Tu<br />
LIEDER DES WEITEN ASIENS.<br />
Trio Dorchi begeisterte und bannte das Publikum in Berlin<br />
Drei Profis haben sich im Russischen Theater in Berlin mit burjatischen<br />
und mongolischen Lieder präsentiert. Musik und Tanz waren in einer guten<br />
Symbiose und haben viel Spaß und tiefe Erlebnisse für alle Besucher gebracht.<br />
Marina Dorchieva, Mark Gotye und Victor Maximov haben alte burjatische und<br />
mongolische Lieder gefühlvoll gestaltet.<br />
Für die Solistin Dorchieva ist es das erste Konzert in Deutschland. Bisher hat die Profi -<br />
Volksängerin aus Burjatien (Russland) große Erfahrungen in Ihrer Heimat und auch einige<br />
Nominierungen in Großbritannien und der Slowakei.<br />
Für die Besucher, die sich mit der russischen, beziehungsweise burjatischen Geschichte nicht<br />
auskannten, war die Präsentation von Gabriel Schötschel interessant. Er hat die Geschichte<br />
Burjatiens und seiner eigenen Erfahrungen in diesem magischen Land mitgeteilt.<br />
Frühe Zeitzeugen Burjatiens sind die im 13 Jahrhundert geschriebenen Texte in „der Geheimen<br />
Geschichte der Mongolen“. Zu dieser Zeit gab’s noch mehr andere Stämme in diesem Teil der<br />
Welt.<br />
Die Burjaten sind fest mit dem größten See der Welt - dem Baikal verbunden.<br />
Er war den Leuten heilig und keiner durfte in ihm baden.<br />
Die Bühne selber war nicht nur ein Hintergrund des Konzertes, sondern ein Teil exotischer Tradition<br />
der Burjaten. Mann konnte typische burjatische Kostüme genießen.<br />
Die Mitglieder des „Dorchi“ Ensembles waren traditionell kostümiert.<br />
Mimik, Gestik und Gesang waren die Stärken von M. Dorchieva, die mit ihrer schönen Stimme<br />
die Herzen des Publikums eroberte. Sie hat nicht nur mit ihren Liedern, sondern auch mit dem<br />
Tanz die Liebesgeschichte der Burjaten und Mongolen erzählt. Die beide Völker haben eine<br />
lange gemeinsame Tradition, die tiefe mit ihrer Naturwelt verwurzelt ist.<br />
Mit vielen verschiedenen Instrumenten hat der Schlagzeuger Mark Gotye in seinem schwungvollen<br />
Spiel den magischen Bezug zur Natur hergestellt. Es gabt nicht nur die üblichen Schlagzeuginstrumente,<br />
sondern er experimentierte gekonnt mit Klanginstallationen aus Wasser, Holz,<br />
Metall, Wind und anderen Elementen, was im Zuschauerraum zu einer konzentrierten Stille,<br />
selbst bei den Kindern, führte.<br />
Mit überzeugender Virtuosität spielte der Gitarist Victor Maximov, mit verführerischer Energie<br />
der die Lieder nicht nur begleitete, sondern auch einige Solos zum Besten gab.<br />
Dieses Programm ist wirklich ein gelungenes Erlebnis.<br />
Trio „Dorchi“ bereitet eine Reihe von Konzerten in Deutschland vor.<br />
Ich kann dieses Konzerterlebnis wärmstens empfehlen.<br />
Bald wird das Trio eine CD mit burjatischen und mongolischer Lieder auf dem Markt präsentieren.<br />
Evelina Awramowa<br />
Labyrinth entlang, Gänge, die nicht enden<br />
wollen und Menschenmassen, die mir<br />
meinen Atem nehmen und wo ist das Ziel<br />
und überhaupt: Was ist das jetzt für ein Spiel?<br />
Okay, Stopp, seid ihr jetzt alle verrückt, so<br />
wird das nichts.<br />
1556<br />
Agenten abgeschüttelt und St. Petersburg<br />
ohne Feindberührung verlassen.<br />
11009<br />
Wien.<br />
Keine Meldung. Ruhe. Absolute Ruhe.<br />
Ungewöhnlich.<br />
1130<br />
Ich beginne mich am Unterschenkel zu<br />
kratzen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten<br />
hat. Draußen ist es dunkel. Ab und zu<br />
ein Blinken in der gegenüberliegenden<br />
Wohnung.<br />
1135<br />
Draußen regnet es. Herbst kommt und<br />
wieder acht Monate keine Sonne. Zehn Jahre<br />
in dieser Scheißstadt und nie Sonne. „Die<br />
Stadt hat mich kaputtgemacht“, sage ich zu<br />
meinem Gegenüber. Gegenüber: „Irrtum, du<br />
warst schon vorher fertig. Ein Wrack, als du<br />
die Stadt betreten hast.“ „Toll“, sage ich ihr,<br />
„toll, dass du mir immer solche Komplimente<br />
machen musst. I love you” Und sie zu mir:<br />
„Spinner.“
48 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch VII - LITERATUR Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
L.A. Potential<br />
ALTERNDE DICHTER<br />
Stetem Verebben von Leben<br />
müssen auch sie sich ergeben.<br />
Was sie tun, hat Hand und Fuß,<br />
doch kennt man es zum Überdruß.<br />
Man giert nach Leichtsinn junger Wesen,<br />
haßt, was einst Vernunft gewesen.<br />
Ihrem angespannten Geistesbogen<br />
werden Juxrevolver vorgezogen.<br />
Ihre ausgefeilten Reimereien<br />
müssen Unerprobte ja bespeien.<br />
Also donnert es an allen Fronten,<br />
deren Nahen sie nur ahnen konnten.<br />
Dichtung, Bildung, Lebensart<br />
und Aura, die sie schaffen konnten,<br />
zu vergessen, wäre hart.<br />
Doch unermesslich härter ist,<br />
daß alle Welt nun sie vergißt.<br />
Wen wundert´s, daß sie störrisch sind,<br />
KünstlerInnen:<br />
Allison Cortson<br />
David Deany<br />
Bart Exposito<br />
Elisa Johns<br />
Raffi Kalenderian<br />
Jasmine Little<br />
Allison Schulnik<br />
Jacob Tillman<br />
Eric Yahnker<br />
Kuratorin: Lioba Reddeker<br />
EDITION 11 · LOS ANGELES<br />
Ausstellung:<br />
20. September bis 9. November 2008 · täglich von 09.00 - 22.00 Uhr · Hangar-7 · Salzburg Airport · Wilhelm-Spazier-Str. 7A<br />
Weitere Informationen:<br />
www.hangar-7.com · hangart-7@hangar-7.com · T: +43/(0)662/2<strong>19</strong>7 · F: +43/(0)662/2<strong>19</strong>7-3709 · www.basis-wien.at<br />
aus Furcht, daß sie nun Abfall sind...<br />
Okay, sie zanken int´ressant,<br />
und mancher Schwärmer kommt gerannt,<br />
sie zu bewundern wie ein Kind.<br />
Doch meistens sind sie weder Vater<br />
noch ein günstiger Berater.<br />
Selbst die reifere Vernunft<br />
vermischt sich ewig noch mit Brunft,<br />
und diese wird die Jungen lehren,<br />
alte Dichter nicht zu ehren.<br />
Soviel nur zu „Hand und Fuß“.<br />
Man kennt das ja zum<br />
HÄSSLICHES ERWACHEN<br />
Ein versauter Morgen graut.<br />
Du drehst dich wie am Grill im Bett.<br />
Der schlimme Abend gestern haut<br />
dich heut erst richtig vom Parkett.<br />
Du rülpst ins dreckige WC,<br />
„Mich wirst du nicht verbraten, Welt.“<br />
Du pißt und denkst: „Wie wenig Menschen<br />
gibt es doch, auf die ich steh.“<br />
Man sieht dich in verhatschten Patschen<br />
struppig nach der Küche latschen.<br />
Monolog am Küchenhocker.<br />
Kotzen vor dem ersten Mokka.<br />
Ein paar Schlucke kriegst du runter.<br />
Igel tollen in den Eingeweiden.<br />
Doch das macht auch wieder munter.<br />
Leidend magst du dich ja leiden.<br />
Ißt du einen Gabelbissen,<br />
plustern diese Igel sich.<br />
Im Magen stechen dich Hornissen.<br />
Auch die Milch kriegt einen Stich.<br />
L.A. Potential<br />
Und doch: Es freut dich, nicht in einem<br />
unbekannten Zimmer zu erwachen.<br />
Im Spital, der Einzelzelle, deinem<br />
Auto oder neben einem Drachen.<br />
Du rülpst ins dreckige WC,<br />
„Nicht viele gibt´s, auf die ich steh.“<br />
Der Umkehrschluß entfällt bescheiden:<br />
Dich mag auch nur einer leiden.<br />
Christian Schreibmüller<br />
supported by<br />
W ien<br />
Kultur
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch VIII - AUTO<strong>ST</strong>AR <strong>ST</strong>/A/R 49<br />
David Staretz<br />
schreibt, redigiert und fotografiert den Auto-<strong>ST</strong>/A/R
50 <strong>ST</strong>/A/R Buch VIII - AUTO<strong>ST</strong>AR Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch VIII - AUTO<strong>ST</strong>AR<br />
<strong>ST</strong>/A/R 51<br />
Mit der Corvette bis ans Ende der Alten Welt<br />
GO WE<strong>ST</strong> ...<br />
ABER SETZ DIR WAS AUF!<br />
Wir richteten die Motorhaube der gelben Corvette Z06<br />
exakt nach Westen aus und ließen uns dreitausend<br />
Kilometer lang nicht davon abbringen. Dort, wo es nicht<br />
mehr weiterging, warfen wir neun Rosen in den Atlantik.<br />
Gruß nach Detroit!<br />
TEXT UND FOTOS: DAVID <strong>ST</strong>ARETZ<br />
Cabo da Roca, das ist die Nasenspitze der iberischen<br />
Halbinsel, also der utmost western point of Europe,<br />
der Amerika nächstliegende Punkt des Alten<br />
Kontinents – der etwa so weit entfernt ist, wie wir dort<br />
hin angereist sind: 3300 Kilometer.<br />
Wir fuhren eine Nacht, einen Tag, eine Nacht und noch<br />
einen halben Tag – mit Schlafpausen in den Sitzen, mit<br />
Kaffee zu Merinque-Pudeln aus einer Konditorei in Monte<br />
Carlo, mit (xy) Tankstopps, Kurzpausen und ein wenig<br />
Sightseeing am Rande der Route. Einmal ins salzige<br />
Meer gehüpft, klebrig empfunden. Dann drehten wir das<br />
Auto um und fuhren alles wieder zurück. Einen halben<br />
Tag und eine (unfreiwillige) Nacht verbrachten wir in Lissabon.<br />
Wir benötigten yx Liter Benzin, zahlten dafür yx Euro,<br />
und für sämtliche Mautgebühren von Wien über Udine,<br />
Mailand, Genua, Monte Carlo, Toulouse, Saragoza, Madrid<br />
und Lissabon bis Cabo de Roca und wieder zurück<br />
löhnten wir yx Euro. Nur das Parkhaus in Monte Carlo<br />
war generöserweise umsonst.<br />
Das Auto.<br />
Die Corvette Z06, General Motors schnellstes Serienmodell<br />
aller Zeiten, gilt als ziviler Ableger der Rennversion<br />
C6.R. Der Wagen ist verhältnismäßig leicht (dank Abräumen<br />
von 40 kg gegenüber der Normalversion mittels<br />
Einsatz von Aluminium und Carbon, sowie durch Verzicht<br />
auf elektrische Beifahrer-Sitzverstellung und massives<br />
Dichtmaterial), wiegt demnach 1420 kg, was ihm<br />
dank der 512 PS aus dem Siebenliter-V8 “Small Block”<br />
zu einem Leistungsgewicht von 2,77 kg pro PS verhilft,<br />
was zu einer möglichen Beschleunigung von unter vier<br />
Sekunden auf Tempo 100 und einer Höchstgeschwindigkeit<br />
jenseits der 300-km/h-Marke verhilft.<br />
Wir verachteten jegliche Verzärtelung durch E-Automatik<br />
und bestanden auf handfester Sechsgang-Schaltung.<br />
(Um dabei aufrichtig zu bleiben: Man kann erstaunlich<br />
lange schaltfaul im sechsten Gang fahren).<br />
Dem Verzicht auf mollige Schalldämmung kann man<br />
auch Positives abgewinnen, wie wir der Pressemappe entnehmen:<br />
“Das Schalldämmpaket wurde zur Gewichtsreduzierung<br />
überarbeitet und ermöglicht nun eine bessere<br />
Überwachung der Antriebsstranggeräusche”.<br />
Der Wagen besaß außer der speziellen, rennnahen Antriebskonfiguration,<br />
der hinten verbreiterten Karosserie<br />
mit Heckspoiler, den Luftauslässen plus markanter Lufthutze<br />
im Bug, noch die aufwendig hochglanzpolierten<br />
2.000-Euro-Zehn-Speichen-Felgen (vorne 18, hinten <strong>19</strong><br />
Zoll). Ideale Geschmeide, um die Goodyear Extended<br />
Mobility Runflat Reifen der Dimensionen 275/35ZR18<br />
bzw. 325/30ZR<strong>19</strong> aufzuziehen. Dazu gleich eine Kritik<br />
von unterwegs: Regenreifen sind dies gewiss nicht.<br />
Für die lange Fahrt gönnten wir uns noch das unverzichtbare<br />
Navigationssystem, dem wir die gute Note 2<br />
verleihen würden, sowie komplette Lederausstattung,<br />
samt Kopfstützen (bestickt mit gekreuzten Konföderierten-Flaggen,<br />
verzichtbar), sowie der eleganten Konsolenverkleidung<br />
um 3.890 Euro. Was sein muss, muss sein.<br />
Gesamtpreis demnach: 96.430 Euro.<br />
Die Beifahrerin.<br />
Eine heikle Wahl. Es sollte jemand sein, die keine zickigen<br />
Ansprüche stellt, wenn es darum geht, vierzig oder<br />
mehr Stunden im Auto zu verbringen, auch wenn sie ihre<br />
erstaunlichen Beine nie ganz ausstrecken würde können.<br />
Sie sollte immer gut gelaunt sein, sich dann und wann an<br />
den Fahrer schmiegen, so es Verkehrssituation und Mittelkonsole<br />
erlauben, sie sollte mit aktuellem Klatsch und<br />
ähnlich leichter Plauderei aufwarten können, von mir aus<br />
auch das Libretto von Boris Godunov oder Eugen Onegin<br />
nacherzählen, aber sie sollte keinesfalls in gefährliche<br />
Beziehungskillerphrasen wie “Sind wir bald da?” und<br />
“Es zieht, da kriege ich mein Kopfweh” oder “Fahr nicht<br />
immer so schnell” verfallen. Sie sollte schminkfest bis<br />
Tempo 180 sein. Erst da zeigt sich die wahre Kunst des<br />
Nagellackauftragens.<br />
Da blieb mir nur eine Wahl: Viktoriya, gebürtig aus Sibirien,<br />
ein Kind der Kälte, das die behaglich raunende Wärme<br />
der russischen Seele in sich birgt und doch deutlich<br />
mehr vorzuweisen hat als die Vorzüge innerer Schönheit.<br />
Stellen Sie sich vor: Eine junge Frau, die immer gut gelaunt<br />
ist und immer gut aussieht. Darunter sollte man es<br />
nicht geben. (Ihre einzige Extravaganz: Meringue-Pudel<br />
aus ihrer Lieblings-Confiserie in Monte Carlo.)<br />
Die Nacht.<br />
Fahren bei Nacht, weite Entfernungen im Lichtkegel zu<br />
schnüren, während die Kanzel von diesen grüngedimmten<br />
Instrumenten erwärmt ist, und ein kleiner Radiosender<br />
spielt eigenartige Orgelmusik oder jemand liest<br />
katalanische Gedichte oder es rauscht einfach nur dieses<br />
Grundklangmuster aus Fahrtwind, Reifenrollen, Motorklang<br />
und zu überwachenden Antriebsstranggeräuschen<br />
– in dieser Stimmung fühlt man sich im Reisen aufgehoben<br />
wie in einem gesicherten Aggregatszustand des<br />
Unterwegsseins als harmonisches Maß für Zwei. Wie<br />
bestätigende Werte schlagen die Querfugen durch, ruhig<br />
stehen die Instrumentennadeln, und die roten Lampen<br />
anderer Nachtpiloten wirken wie verlässliche Positionslichter<br />
auf der Ostfahrt, bis vor uns der Morgen dämmert<br />
in ungewissem Licht, fahle Sterne und ein lichter Mond<br />
versinken hinter scharfgeschnittenen Wolkenkanten,<br />
den verheißungsvollen Kartografien unbekannter Kontinente.<br />
Manchmal birgt die Nacht auch Schrecknisse von alptraumhafter<br />
Qualität: Zwischen Saragoza und Madrid<br />
führt die Strecke so lange so brutal und kurvenreich bergab,<br />
dass man meint, man müsse einen Kraterschlund<br />
unter Meeresspiegel ansteuern. Und alles, was Räder<br />
hatte, schien polternd in einen Malstrom zu Tale zu stürzen:<br />
Lastwägen, Lieferwägen, wildes Geschepper und<br />
Luftdruckgepfeife, unterfangen vom hohlen Dröhnen<br />
scheinbar entlaufener Tankwägen. Ich war so müde, so<br />
gelähmt, dass ich es etliche Kilometer lang nicht schaffte,<br />
an einem apokalyptischen Betonmischer vorbeizukommen,<br />
der unaufhaltsam mahlend zu Tal dröhnte mit<br />
gefährlich schwankendem Aufbau. Ich war so gebannt,<br />
konnte einfach nicht überholen, es war mir körperlich<br />
unmöglich. Es war auch undenkbar, dieses einsaugende<br />
Gefälle zu verlassen – wie gesagt, diese Etappe hatte alle<br />
wesentlichen Zutaten eines Alptraumes.<br />
Raststätten.<br />
Je weiter man nach Oste<br />
kommt, Italien, Frankreich,<br />
Spanien, Portugal, desto<br />
armseliger, desto einladender<br />
werden die<br />
Raststätten. Es geht<br />
nicht mehr um<br />
die organisierte<br />
Abzocke angeschwemmten<br />
Autofahrermülls,<br />
sondern<br />
um Labung, Trost<br />
und Ruhe für die<br />
weither gekommenen,<br />
auch wenn<br />
sie nur im nächsten<br />
Dorf beheimatet sind –<br />
von ungewisser Herkunft<br />
stammen wir alle, und einen<br />
starken Kaffee, ein kräftig<br />
befülltes Weißbrot benötigen wir.<br />
Manche Raststätten sind so liebevoll<br />
eingerichtet, mit Garten und Springbrunnen,<br />
mit Aquarien und Autoreifen-Schwingschaukeln, mit<br />
archaischen Tischfußballgeräten und scheppernden<br />
Musikboxen, dass man gleich ein paar Tage hier bleiben<br />
möchte.<br />
Nur mit dem Tanken bin ich unzufrieden: irgendeine<br />
Vorschrift, und offenbar steckt nicht einmal die EU dahinter,<br />
verbietet es, Zapfhähne mit Einrastvorrichtung<br />
zu versehen, so dass man genötigt ist, die ganze Zeit am<br />
Hebel zu drücken. Natürlich lässt sich gerade in diesen<br />
Fällen kein Tankwart blicken, der sich ein wenig Trinkgeld<br />
verdienen möchte. Aber das vertieft eben die Fahrer-<br />
Auto-Beziehung. Immerhin sind hier die Toiletten frei<br />
zur Benützung und gar nicht einmal so schmutzig wie<br />
einst.<br />
Das Fahren.<br />
Gleich vorangeschickt die Sensation: Wir benötigten<br />
nicht mehr als 10,2 Liter Superbenzin (98 Oktan) im<br />
Gesamtschnitt. Dies rührte von einer äußerst besonnene<br />
Fahrweise. Erst nach rund zweitausend Kilometern gepflegten<br />
Gleitens fiel mir ein, dass ich bisher noch nie die<br />
512 PS entfesselt hatte. Ein tritt aufs Pedal machte sofort<br />
klar: Hier werden die guten alten Hinterräder angetrieben,<br />
und sie wollen als erste durchs Ziel. Hochmoderne<br />
Fahrwerkselektronik legte dem einige Riegel vor, aber die<br />
Absicht kam deutlich durch bis ins Lenkrad. Der Wagen<br />
explodiert förmlich unter den Pedalen. Die berühmte auf<br />
das Dashboard geklebte Hundert-Dollar-Note (die der<br />
massenträg in den Sitz gedrückte Beifahrer natürlich nie<br />
erreicht) wäre hier erstmals in Gefahr: Sie könnte sich<br />
aus der Verklebung reißen und dem Beifahrer in den<br />
Schoß fallen.<br />
Die Sitzposition ist phantastisch, beide Ellbogen finden<br />
solide Auflage, aber die volle Lenkfreiheit ist bei Bedarf<br />
sofort gegeben. Anders als einst ist die Lenkung ziemlich<br />
direkt ausgelegt, der Straßenkontakt ist besser, als einem<br />
manchmal lieb ist, zumal schlechte Straßenqualität<br />
manchmal erstaunlich durchschlägt. Zum gut Aufgehobensein<br />
zählt auch das Exterieur: Die beiden Radkastenwammen<br />
stehen seitlich sichernd hoch wie Sofalehnen.<br />
(Niemand hat verlangt, dass der Wagen übersichtlich<br />
sein möge, wiewohl man schnelle lernt, kratzerfrei durch<br />
Monacos gefürchtete Parkhäuser zu manövrieren.)<br />
Das Verhältnis zwischen Drehzahlmesser und Tachometer<br />
ist einfach:<br />
1.000 Touren – Tempo 80.<br />
2.000 Touren – Tempo 160.<br />
3.000 Touren - ich habe es natürlich ausprobiert im<br />
Dienste der Wissenschaft – das Verhältnis stimmt abermals:<br />
240. Die 4.000er-Marke war allerdings nur mehr<br />
theoretisch zu schaffen – dort, wo sich die Parallelen<br />
schneiden.<br />
Die Klimaanlage ist ok, auch wenn Fahrer und Beifahrer<br />
ein paar Grade auseinanderliegen. Irgendwann findet<br />
man eine leidlich zugfreie Einstellung. Heiß wurde nur<br />
der Griff zum Kugelschreiber: Die Schatulle in der Mittelkonsole<br />
(zugleich Armablage) entwickelte erschreckende<br />
Temperaturen. Selbst die Cupholderböden erhitzten sich<br />
dramatisch. Gut für Kaffee, schlecht für Kaltgetränke und<br />
für unsere neun Rosen (“Belle de Salamanca”), die wir<br />
in einem Cocktailshaker mitführten. Aber sie hielten die<br />
Fahrt tapfer durch, dufteten in voller Pracht bis hin zu ihrem<br />
Bestimmungsort, wo wir die den Wellen des Atlantik<br />
übergaben: Roses to America.<br />
GO WE<strong>ST</strong><br />
Das Ohr am<br />
Lied der Straße.<br />
Manchmal sang<br />
der Asphalt<br />
so allerliebst,<br />
als<br />
wären<br />
die Sirenen<br />
hinter<br />
Weiter gings nicht mehr<br />
Odysseus her.<br />
Wesentlich harscher<br />
dagegen ist der Klang<br />
der weißen Begrenzungsstreifen, die<br />
klugerweise als akustische Marker ausgeführt sind. Ich<br />
konnte diesen Sound gut als Untermalung zu Enigma<br />
einsetzen, das wir versehentlich mitgenommen und einmal<br />
pflichtschuldig abgespielt hatten, um auch ein wenig<br />
Kitsch in die Reise zu bringen. Lieber hörten wir Regina<br />
Spektor, die junge Russin in New York, aber bloß nicht<br />
zu oft, um uns nicht zu übersättigen. Go West von den<br />
Pet Shop Boys hatte ich eher kuriositätshalber gekauft,<br />
nach zwei Nummern machten wir der Sache ein gnädiges<br />
Ende. Besser aber tödlich einschläfernd: Bruce Cockburn<br />
(The Charity of Night). Erhellend: Best of BB (Brigitte<br />
Bardot). Wie Marilyn Monroe ist sie als Sängerin völlig<br />
unterschätzt. Heute würde sie jedes Superstargesuche im<br />
aufblasbaren Saunaanzug gewinnen.<br />
Verkehrsteilnehmer.<br />
So lange man im schnelleren, kräftigeren Auto sitzt, ist<br />
alles leicht, Man kann sich jeglicher lästiger Situation,<br />
jeglichem Mittelklassegerangel im engen Kanaltal durch<br />
einen entschiedenen Gasstoß entziehen und sich angenehmere<br />
Gesellschaft suchen.<br />
Es stimmt, die gelbe Corvette holt niedrige Triebe aus<br />
harmlosen Verkehrsteilnehmern, selbst brave Familienväter<br />
in ihren mausgrauen Lagunas haben plötzlich ein<br />
Messer zwischen den Zähnen und von hinten sehe ich geschwollene<br />
Adern im Ausschnitt ihres Rückspiegels. Im<br />
Profil zeichnet sich das scharfzüngige Gezeter der Gattinnen<br />
ab, während die Kinder vor ungeschneuzter Begeisterung<br />
die Heckscheiben verschmieren. Mit schwankenden<br />
Manövern<br />
versuchen die Holiday-Nuvolaris,<br />
das<br />
unvermeidliche abzuwenden.<br />
Selbst<br />
nach dem Überholtwerden<br />
geben<br />
sie nicht auf, versuchen,<br />
angefeuert<br />
von den Kindern,<br />
niedergekreischt von<br />
den Frauen, sich im<br />
Verdienter<br />
Windschatten der<br />
Corvette zu verankern.<br />
Portugal<br />
Tischfussballer in<br />
Selbst in Monte Carlo<br />
erregten wir Interesse<br />
bei redlichen<br />
Familienvätern<br />
– vornehmlich bei<br />
Bauarbeitern und<br />
ähnlich unverbildeten<br />
Kennern wahren<br />
Machismos.<br />
Geflickte Bettwäsche<br />
Begeisterung kann<br />
auch anstrengend in Lissabon<br />
werden: Ein Opel<br />
Corsa fährt mir bei Autobahntempo<br />
fast hinten rein, weil der Fahrer durchs Handy<br />
linst, um eine formatfüllende Aufnahme vom Corvetteheck<br />
zu kriegen. Objects in camera are closer than they<br />
appear! Wohlmeinendes Horngetöse der Überlandtrucks<br />
bläst mich vor Schreck fast von der Straße.<br />
Lissabon<br />
Die Stadt der geflickten Leintücher. Immerhin ist das<br />
auch keine schlechtere Art, Lissabon zu charakterisieren,<br />
und wo in Hotels noch Leintücher kunstfertig gestickt<br />
und geflickt werden, dort steige man günstig, sauber und<br />
etwas scheel betrachtet ab. Zum Ausgleich funktioniert<br />
der Fernseher nicht und die Bücher sind im Auto, das<br />
wir vergessen haben, rechtzeitig aus der bewachten Parklücke<br />
zu holen. Jetzt ist das Gitter vor und deshalb haben<br />
wir überhaupt das Hotelzimmer genommen, allerdings<br />
ohne Gepäck, deshalb die misstrauischen Nachtportier-<br />
Blicke.<br />
Die Corvette hat sich ohnehin einen Ruhetag verdient.<br />
Eines der schönsten und sakralsten Bauwerke von Lissabon<br />
ist der Bahnhof, eine Kathedrale des Reisens, elegant,<br />
verheißungsvoll in seiner befreienden Perspektive,<br />
wohin der Zug das Häusliche der riesigen glasgedeckten<br />
Halle verlässt, hinaus zu fremden Zielen und gepflegten<br />
Abenteuern. Lissabon ist überhaupt eine Stadt in 3D, mit<br />
vielen Blickwinkeln und Niveauunterschieden, die auf<br />
verschiedenste Art bewältigt werden, durch Stadtaufzüge<br />
Patent Eiffel oder die Linie E28, die berühmte Straßenbahnstrecke<br />
durch Alfama und Barrio Alto.<br />
Auch das gehört zu einer Autoreise. Einmal bewußt darauf<br />
zu verzichten, um es dadurch frisch und begehrenswert<br />
zu erhalten.<br />
Portugals Autobahnen sind geradezu vereinsamt, manchmal<br />
freut man sich schon, einen Kleinlaster oder sonst<br />
ein Lebewesen wahrzunehmen. Selbst der Polizei dürfte<br />
der Sprit zu teuer kommen.<br />
Cabo da Roca.<br />
Wie so oft, zählt das Ziel einer Reise zu den uninteressanteren<br />
Darstellern. Der berühmte (so nenn ich ihn<br />
halt) Leuchtturm ist in Reparatur, das Steinkreuz ist mir<br />
zu steinkreuzig, aber diese Selbstmörderklippen, die haben<br />
schon was. Arme Rosen, sie werden sich ihre Köpfchen<br />
brechen. Doch wie von selbst erheben sie sich aus<br />
Viktoriyas Hand und streben, von einer Windbö erfasst,<br />
im hohen Flug nach Westen. Grüßt uns Amerika!<br />
Wir strollen noch eine Weile im Souvenirladen herum<br />
(tolle Kratzpullover um 65 Euro!), erlauschen die Kommentare<br />
leitender Touristenopas (“Seht, der neue Chevy<br />
Chrysler”, nehmen sie bisher undenkbare gewesene Fusionen<br />
vorweg) und spazieren durch den nahegelegenen<br />
Ort, der nicht recht weiß, ob sich aus der Lage nun touristisches<br />
kapital schlagen lässt oder ob man nicht eher eine<br />
Rückseite Europas darstellt. Eine Künstlerin produziert<br />
Leuchtturmmodelle aus Blech, immerhin.<br />
Zuletzt die branchenübliche Anmaßung: Das Restaurant<br />
O Campones in Malvera da Serra ist ein Geheimtipp für<br />
Bacalhau. Wie könnte ich das tatsächlich beurteilen? Der<br />
Nationalfisch war einfach gut und der billige weiße Hauswein<br />
in der Karaffe war genau das, wie man sich einen<br />
schlichten freundlichen unsüßen Weißwein vorstellt:<br />
Gut gekühlte Plauderzunge.<br />
Cabo da Roca, westlichster Punkt<br />
Europas – am Ziel<br />
Souvenirs.<br />
Wir packten ein, was sich (erstaunlicherweise) alles unterbringen<br />
ließ: Zwei Meringue-Hunde, fünf Hüte (rollbarer<br />
Knautschlack), eine Stoffkappe, eine ausgemusterte<br />
Kommode mit zwei Schubladen (Fundstück), ein Original-Stierkampfplakat,<br />
vier Paar Damenschuhe, zwei Paar<br />
Herrenschuhe, zwei gläserne, einen papierener Lampenschirm<br />
(zerknittert), ein Parfumflakon Silber (Gravur<br />
1829), zwei Sommerkleider, etlichen Modeschmuck,<br />
ein paar Damen-Kniestrümpfe im rot-weißen Tintin-<br />
Raketenmuster, einen rostigen Dosendeckel (irgendwie<br />
dekorativ), zwei grundierte, bespannte Malgründe, zwei<br />
Portemonnaies, zwei Mini-Fläschchen Martini rosso, einige<br />
modische Taschen, sechs Schachteln Zündhölzer,<br />
zwei Kerzen, eine Flasche Essig, Hartkäse, zwei Porzellanteller,<br />
drei T-Shirts und zwei dekorative Kugeln unbestimmter<br />
Verwendung.<br />
Nachtrag.<br />
Auszug aus dem PM online Magazin: “Eine 3439 Kilometer<br />
lange Brücke soll die Alte und Neue Welt miteinander<br />
verbinden. Sie steht nicht auf Pfeilern, sondern hängt an<br />
geostationären Satelliten. Auf dem gigantischen Bauwerk<br />
sollen Städte für acht Millionen Menschen entstehen.<br />
Die Transatlantic-Bridge ist eine Utopie, doch auch der<br />
Mondflug schien unerreichbar – und wurde hundert Jahre<br />
nach Jules Vernes visionärem Roman Von der Erde zum<br />
Mond Realität. Deshalb glauben die beiden Designer Michael<br />
Haas und Kai Zirz von der Staatlichen Hochschule<br />
für Gestaltung in Karlsruhe, dass ihre Idee eines Tages<br />
Wirklichkeit wird: eine 3439 Kilometer lange Brücke über<br />
den Atlantik, die Europa und Amerika miteinander verbindet.<br />
... Bei der Aufhängung ihres Megabaus orientieren<br />
sich die beiden Gestalter an US-Plänen für den Bau<br />
eines Fahrstuhls ins All: Dessen Laufseil soll an einem<br />
in 36.000 Kilometer Höhe stationierten Satelliten befestigt<br />
werden, der sozusagen ortsfest über der Erde steht;<br />
genauso könne man die transatlantische Brücke an Satelliten<br />
aufhängen. Nach den Vorstellungen der beiden Visionäre<br />
soll sie in 800 Meter Höhe vom französischen St.<br />
Nazaire nach Bridgeport im US-Staat Connecticut führen<br />
– und wäre das achte Weltwunder. Das Bauwerk erfüllt<br />
nicht nur die Funktion einer transkontinentalen Autoverbindung<br />
– es bildet gleichzeitig das Territorium des<br />
eigenständigen künstlichen Staates TransatlanticNation<br />
mit acht Millionen Bewohnern, deren soziales und politisches<br />
Leben nach ganz neuen Regeln organisiert ist.”<br />
Wenn es dann so weit ist, werden wir wieder die Corvette<br />
aus der Garage holen und diesmal nicht umkehren, nur<br />
weil uns ein Steilufer mit anschließendem Ozean bremst.<br />
Neun Rosen als Gruß nach Detroit
52 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch VIII - AUTO<strong>ST</strong>AR Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
CORVETTE
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Buch IX - WARAN <strong>ST</strong>/A/R 53
Städteplanung / Architektur / Religion Buch IX - WARAN <strong>ST</strong>/A/R 55<br />
du gibst nie Ruhe gut so<br />
werde gefragt ob und wann und wie und warum und<br />
wie geht´s waran mir gehn die Antworten aus<br />
Saufen wir uns ins Leben zurück<br />
wäre stolz auf dich<br />
sammle schöne Momente<br />
moment die Maschine brennt<br />
Gruzifix wieder nix Auf bald<br />
was Rudi nicht lernt lernt Rudolf immer noch hab keine lust<br />
ihr stellt mir nur meine Zeit das AMs hat mir ein Hausboot in<br />
Amsterdam zugesichert<br />
Heidulf wir wissen das du Strapse trägst<br />
zugedröhnt hat sie gestöhnt aus der Traum vom Fliegen<br />
ohne Strom gehts auch dann schaun wir halt bei Kerzenlicht fern<br />
mir egal denk doch was du willst Besser wichser Weichei<br />
Oberschlau ungenau<br />
der Anale der Analen die Stute unter den Hengsten das<br />
Traummännlein unter<br />
den Wachbirnen<br />
die Schlampen der Schlampen der AFFE der AFFen FBI<br />
DINNER OUT<br />
wir warn schon so knapp dran völlig durchzudrehn respect<br />
Hab sehnenscheidenentzündung im Lagerfeuer bekommen triffst<br />
du noch immer ins Braune<br />
dein Jokerface muss mal wieder polliert werdennnnnnnnnnnnnnn wer<br />
einmal lügt fladern für die 3. Welt RUDI-HOOD Ultrahools<br />
vs. FOOLS<br />
Doppelbett Bussi<br />
kleiner Prinz Peepmatz schleimer Saubermann<br />
Groteskumwerfend dein<br />
Gestank deine persönliche Note Schimmelpimmel grindfresser<br />
Lurchschlürfer<br />
Mogelpackung nix drinnen außen unscheinbar innen unendlich<br />
verzweifelt so wie der Rest der Mohaikanner<br />
Der Letzte Marokkaner<br />
Buch WARAN Nummer 3999 die Seiten kleben zusammen das<br />
ist Samenraub<br />
geistige Ergüße auf unschuldigem Papier wertvolles Altpapier bitte an alle weiterleiten<br />
bist ein Blitzableiter blitzgescheit blitzschnell beim fladdern Durchfall für alle<br />
Scheiß Laura Rudi Rudas verdient 8000 EURO pro Monat und kann sich keinen Frisör leisten die alte<br />
Plapperschlampe pfui dumm - dümmer - Rudas<br />
nichts als leere Worte<br />
da hör ich lieber dem Rudolf zu der gibt nie eine Ruh zuerst den Sportteil<br />
und dann ein Joint Frühstück im Grünen<br />
Buttersemmerl mit Schnittlauch Lurchcremesuppe mit gratinierten Hasenbemmerln<br />
MHHHHHHHHHMMMMMMMM Lecker schlecker schmecker<br />
Die Zeit vergeht schneller als geplant<br />
habe dir nie zugehört aber alles verstanden was du sagen wolltest es aber nicht<br />
getan hast<br />
vom hudeln kommen die Kinder wünsch dir schöne Ferien am Bauernhof<br />
bald gehts richtig los freu mich schon<br />
It`s hard to smile you have to hide do what you want also so wie immer<br />
die worte brennen auf der Zunge das Hirn löst sich langsam aber sicher im Alk auf<br />
scheiß drauf<br />
hört auf zu kriegen was denken schadet der Vernunft na und ?<br />
Dealer aller Länder vereinigt euch Schnäppchenjäger Allesspachtler Komakiffer<br />
Rußland nicht There will be party<br />
Danke Danke DanWke Wanke Schwanke Kippe Flippe Bin jezt das Nerverl das du<br />
einmal warst<br />
die Welt braucht dich so wie du Gras die Kuh gibt Milch
56 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch IX - WARAN Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
ES I<strong>ST</strong> VERDAMMT LEICHT DER<br />
BE<strong>ST</strong>E ZU SEIN.<br />
NACH ALLEN REGELN<br />
DER KUN<strong>ST</strong><br />
ICH MUSS MICH NOCH FERTIG MACHEN<br />
wo hängst grad ab auf um zu dir zu kommen über sieben nutten musst du gehn sieben dunkle nächte überstehn dann wirst du die<br />
asche sein aber sicher nicht allein<br />
Operation MINDFUCK Mummu .... ist die Göttin des Chaos muss dir auf die sprünge helfen u bahnfahren verboten<br />
chaos is confusion and i lick it Alles Gute zum Geburtstag Bulle Mi Mikey Jeckey Kerzi stecki<br />
Cyborgiastisches Saufgefaltenhardrock am See Bodenseh torkeln in Tokio where do you go<br />
could you remember the future Dauerlutscher gut dass auch du schon alles überrissen hast<br />
wie ein14jähriger Profikillerprofessor tresor geknackt alles liegen und stehn gelassen keine lust mehrgehabt<br />
bummeln in ‘Boston trödeln in Tansanian Ganjha aus Ghana let´s play weißrussisches Roulette<br />
mit weiß Würsten aus munich glückliche gleichgültigkeit bist die unruh in jeder uhr<br />
bleib dir treu die partei braucht dichbrauche unbedingt deine contonummer sonst geht gar nichts<br />
liegewagen nacht über bratislover nach triest fähre nach oslo danach saufen in kemnitz kurz rüber nach rotterdam und last minute to bronx<br />
attention antrax EWIGE BLUMENKRAFTtop secret: nur für autorisierte Personen bzw. zur sofortigen weitergabe an alle<br />
Hurray, Hurray it´s the first of May outdoor fucking starts today
Städteplanung / Architektur / Religion<br />
Das Portrait des Dichters Julian Schutting (1 x 1,35 cm), ist noch bis<br />
<strong>19</strong> Oktober im rahmen der Gemeinschaftsausstellung “<strong>ST</strong>.A.LL im SCHLOSS”<br />
im Schloss Ulmerfeld bei Amstetten zu sehen<br />
Hannah Feigl<br />
Wer ein Portrait, der Portraitmalerin<br />
Hannah Feigl, von sich oder einem<br />
seiner Lieben braucht…<br />
…meldet sich bei <strong>ST</strong>/A/R unter<br />
0664 521 33 07<br />
Foto: Nurith Wagner-Strauss<br />
Buch X - GOTTLOB <strong>ST</strong>/A/R 57<br />
Die Stadtgemeinde Amstetten und der Ver<br />
ein Schau-<strong>ST</strong>.A.LL<br />
laden zur Eröffnung und zum Besuch der Ausstellung ein.<br />
<strong>ST</strong>.A.LL im SCHLOSS 2<br />
DESIGN - GRAFIK - FOTOGRAFIE -<br />
MALEREI - OBJEKTE - VIDEO<br />
Samstag, 23. August 2008 - 14 Uhr<br />
Schloss Ulmerfeld<br />
Begrüßung :<br />
OV Egon Brandl<br />
Zur Ausstellung spricht :<br />
Univ. Pr<br />
of. Manfred Wagner<br />
Eröffnung :<br />
NR Uli Königsberger-Ludwig<br />
15 Uhr : „DU NIX ÄRGAN” im Schlosshof<br />
16:30 : Livemusik mit<br />
VORM VI : Golser, Küblböck...<br />
SCRAP LAP : Fuks, Kunzmann, Sinowatz<br />
SHINEFORM : Edlinger, Kagerer, er, Bruckmayer<br />
Öffnungszeiten:<br />
Fr. 15 - <strong>19</strong> Uhr<br />
Sa., So. und Feiertage: 10 - 12 Uhr & 14 - 17 Uhr<br />
Werner Maria Klein<br />
die Portraitmalerei von<br />
HannaH Feigl<br />
Paul Cézanne: ... ich habe die „Natur“ kopieren<br />
wollen, das jedoch nicht<br />
gelingen wollte – war aber sehr froh bemerkt<br />
zu haben, dass sich die Sonne nicht darstellen<br />
ließ, sondern nur durch Farbe als Äquivalent<br />
repräsentieren.<br />
Die Idee des Portraits wird durch die virtuos<br />
vorgetragene Malerei der Künstlerin, die nach<br />
den eigenen Gesetzmäßigkeiten des von Ihr<br />
gewählten Bildaugbaues, den überkommenen<br />
Vergleich zwischen Darstellung und Vorbild<br />
beziehungsweise Modell vergessen macht, ohne<br />
jedoch dabei eine altmeisterliche naturalistische<br />
Virtualität zu bedienen, wenngleich zuweilen<br />
die Sterilität der Photografie als ergänzendes<br />
Darstellungsmedium für den eigentlichen<br />
kreativen Gestaltungsprozess der Kunstgenese,<br />
wie schon seit Ende des <strong>19</strong>. Jh. bei allen<br />
wesentlichen Portraitmalern der europäischen<br />
Kunstgeschichte sehr rasch üblich, dienstbar<br />
gemacht.<br />
Die abgebildete Realität wird durch die<br />
künstlerisch verdichtete selbstrepräsentative<br />
Bildrealität erweitert, die bei Hannah Feigl<br />
der bloßen Abbildfunktion enthoben, obwohl<br />
die komplexe unverfremdete Wesenhaftigkeit<br />
der Dargestellten weiterhin im Mittelpunkt<br />
bleibt, in der Lage ist, die unqualifizierte<br />
Unterscheidung in „abstrakte“ oder<br />
„gegenständliche“ Kunst als nur irreführend<br />
und gleichsam lästig simplifizierende leere<br />
Rhetorik zu überwinden, um den immanenten<br />
Eigenwert der Malerei (Farben, Nichtfarben,<br />
Formen, Licht und Schatten - Linien und<br />
Flächen werden vom Darstellungsmittel<br />
zum Gestaltungsmittel ... ) wirklich<br />
begehbare philosophische Räume für beseelt<br />
gemalte Psychogramme der portraitierten<br />
Persönlichkeiten, ergo „Der ans Licht<br />
gebrachten“ (lat. pro-trahere „hervorziehen;<br />
ans Licht bringen“), zu eröffnen.<br />
Bedingt durch die in Mode gekommene<br />
„Auftragsmalerei“ im 17. Jh. haben sich<br />
beinahe alle Maler von Bedeutung der<br />
europäischen Kulturgeschichte mit den<br />
mannigfaltigsten Formen der überaus<br />
Hochdotierten Porträtmalerei befasst, wobei<br />
diese Tatsache dem Genre eine enorm<br />
innovative Darstellungsvielfalt eröffnete..<br />
Diese Darstellungsvielfalt fremdrepräsentativer<br />
Bildprogramme offenbarten jedoch der<br />
Künstlerin Hannah Feigl bereits in frühen<br />
Jugendtagen, einen gangbaren Weg zu<br />
Ihrer eigenen assoziativen und gleichsam<br />
lebensnahen Portraitinterpretation, die private<br />
und intime Wesenszüge der Porträtierten aus<br />
der trivialen Unbewusstheit des Alltages in den<br />
geschützten Raum der Kunst zu transponieren<br />
vermag (...).<br />
Hannah Feigl - immerzu „das wirkliche Leben“<br />
im Auge behaltend, gebiert die Künstlerin mit<br />
Ihrer feinmaschig vertexteten Formensprache,<br />
die jedoch nicht moralisierend eingreift, da<br />
Ihrer eigenen aparten Wirklichkeit verpflichtet,<br />
einen Lichterfüllten Farbenklangraum, in<br />
dem die „Freiheit der Kunst“ als Gastgeber<br />
versucht ist, der Würde des Menschen, also<br />
der Sinnerfüllung jeglichen künstlerischen<br />
Strebens, ein platonisches Gastmahl der Ideen<br />
auszurichten.<br />
Maurice Denis 1890: „Man erinnere sich<br />
daran, dass ein Bild, bevor es ein Schlachtross,<br />
eine nackte Frau oder irgendeine Anekdote<br />
ist, seinem Wesen nach eine ebene Fläche<br />
ist, bedeckt mit Farben in einer bestimmte<br />
Ordnung.
58 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch X - GOTTLOB Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
Bauunternehmung GRANIT Gesellschaft m.b.H. • A-8022 Graz, Feldgasse 14 • Tel.: +43 316 / 27 11 11 – <strong>19</strong> • www.granit-bau.at<br />
Rentabilität, die sich sehen lassen kann.<br />
www.immorent.at<br />
Innovative<br />
Projekte in Wien<br />
Utendorfgasse 7<br />
1140 Wien<br />
1. Zertizierte Passivhaus-<br />
Wohnanlage Österreichs<br />
• 39 Wohneinheiten<br />
• 2-, 3- u. 4-Zimmer-Wohnungen<br />
• Balkon, Loggia oder Terrasse<br />
• südseitige Ausrichtung<br />
• Aufzug<br />
• Tiefgarage<br />
• optimale Energienutzung<br />
• beste Wohnqualität<br />
sImmoSu d_Bilderrahmen_270x100abf.indd 1<br />
Innovative<br />
Projekte in Wien<br />
Utendorfgasse 7<br />
1140 Wien<br />
Rennbahnweg 52-54<br />
1220 Wien<br />
Generationsübergreifendes<br />
und betreutes Wohnen<br />
Bauteil C<br />
• 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen<br />
• 52 - 109 m²<br />
• Balkon, Loggia oder Garten<br />
Bauteil A (Seniorenhaus)<br />
• 30 barrierefreie Wohnungen<br />
• 135 Betreuungsplätze<br />
• soziale und medizinische Hilfe<br />
in der Siedlung<br />
• Gemeinschaftsterrasse im<br />
Dachgeschoss<br />
24.09.2008 16:34:12 Uhr<br />
Bezug:<br />
Herbst 2010<br />
1. Zertizierte Passivhaus-<br />
Wohnanlage Österreichs<br />
• 39 Wohneinheiten<br />
• 2-, 3- u. 4-Zimmer-Wohnungen<br />
• Balkon, Loggia oder Terrasse<br />
• südseitige Ausrichtung<br />
• Aufzug<br />
• Tiefgarage<br />
• optimale Energienutzung<br />
• beste Wohnqualität<br />
„... dem Menschen<br />
verpichtet!”<br />
Ansprechpartner:<br />
Mag. (FH) Engelbert Mitterböck<br />
Tel. 01 / 9 82 36 01 -632<br />
engelbert.mitterboeck@hoe.at<br />
Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsges.m.b.H.<br />
Herzgasse 44 • 1100 Wien • wien@hoe.at • www.hoe.at<br />
Rennbahnweg 52-54<br />
1220 Wien<br />
Generationsübergreifendes<br />
und betreutes Wohnen<br />
Bauteil C<br />
• 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen<br />
• 52 - 109 m²<br />
• Balkon, Loggia oder Garten<br />
Bauteil A (Seniorenhaus)<br />
• 30 barrierefreie Wohnungen<br />
• 135 Betreuungsplätze<br />
• soziale und medizinische Hilfe<br />
in der Siedlung<br />
• Gemeinschaftsterrasse im<br />
Dachgeschoss<br />
„... dem Menschen<br />
verpichtet!”<br />
Bezug:<br />
Herbst 2010<br />
Ansprechpartner:<br />
Mag. (FH) Engelbert Mitterböck<br />
Tel. 01 / 9 82 36 01 -632<br />
engelbert.mitterboeck@hoe.at<br />
Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsges.m.b.H.<br />
Herzgasse 44 • 1100 Wien • wien@hoe.at • www.hoe.at
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch X - GOTTLOB<br />
<strong>ST</strong>/A/R 59<br />
<strong>ST</strong>EIN UND LICHT<br />
ranit<br />
Natursteinwerke GmbH & Co KG<br />
Seit fast 170 Jahren ist Poschacher auf die Verarbeitung von Naturstein<br />
spezialisiert.<br />
Neben acht verschiedenen Granitsorten aus eigenen Steinbrüchen,<br />
werden Rohblöcke aus aller Welt in modernst ausgestatteten<br />
Fertigungsanlagen zu einer Vielzahl an Produkten für den Innen- und<br />
Außenbereich fachgerecht weiterverarbeitet.<br />
Egal ob Natursteinlieferungen für Großobjekte, individuelle Einzelfertigungen<br />
im Objektbereich oder Garten- und Landschaftsbau,<br />
Poschacher als größtes österreichisches Natursteinunternehmen ist in<br />
allen Bereichen Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner.<br />
A-4222 St. Georgen/Gusen, Poschacherstr 7 Tel.: 07237/3333-0 Fax: 07237/3333-444<br />
www.poschacher.com – E-Mail: office@poschacher.com<br />
BV Neuer Platz Klagenfurt<br />
2.865 m² Gebhartser Syenit, 375 m² Neuhauser Granit, 102 m² Rosso Vanga Granit<br />
Gutes Licht.<br />
Natursteinwerke GmbH & Co KG<br />
Licht braucht Design. Licht braucht Funktionalität. - Licht ist Basis. Licht ist<br />
Detail. - Licht schafft Raum. Licht schafft Freiraum. - Licht erfordert Planungs-<br />
Know-how. Licht erfordert Kreativität. - Gutes Licht hat viele Ansprüche und<br />
Molto Luce steht für deren Erfüllung.<br />
Seit fast 170 Jahren ist Poschacher auf die Verarbeitung von Naturstein<br />
spezialisiert.<br />
Neben acht verschiedenen Granitsorten aus eigenen Steinbrüchen,<br />
werden Rohblöcke aus aller Welt in modernst ausgestatteten<br />
Fertigungsanlagen zu einer Vielzahl an Produkten für den Innen- und<br />
Außenbereich fachgerecht weiterverarbeitet.<br />
Egal ob Natursteinlieferungen für Großobjekte, individuelle www.moltoluce.com Einzelfertigungen<br />
im Objektbereich oder Garten- und Landschaftsbau,<br />
Poschacher als größtes österreichisches Natursteinunternehmen ist in<br />
allen Bereichen Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner.<br />
4600 Wels, Europastraße 45, T. 07242/698-0, e-mail: office@moltoluce.com<br />
1230 Wien, Vorarlberger Allee 28, T. 01/6160300, e-mail: office.wien@moltoluce.com<br />
A-4222 St. Georgen/Gusen,<br />
Wels<br />
Poschacherstr<br />
· Wien · Weißkirchen<br />
7 Tel.: 07237/3333-0<br />
· Köln · Nürnberg<br />
Fax: 07237/3333-444<br />
www.poschacher.com – E-Mail: office@poschacher.com<br />
Inserat.indd 1<br />
03.09.2008 9:08:56 Uhr
Städteplanung / Architektur / Religion Buch X - GOTTLOB <strong>ST</strong>/A/R 61<br />
GEORG GOTTLOB WITTGEN<strong>ST</strong>EINPREI<strong>ST</strong>RÄGER<br />
Interview Heidulf Gerngross und Hofstetter Kurt mit Georg Gottlob<br />
HG: Die Verbindung Gottlob Georg und Gottlob Frege mag<br />
einen guten Einstieg für unser Gespräch geben. Kannst du<br />
deine Strategie, komplexe Probleme zu lösen, die du an<br />
einfachen Beispielen zeigst, erklären und kurz umreißen,<br />
wie du deine wissenschaftliche Arbeit ins Praktische<br />
umsetzt?<br />
GG: Meine allgemeine Strategie sowohl für die theoretischen<br />
Forschungen als auch für die Praxis besteht darin, Struktur<br />
in Unstrukturiertes und Unüberschaubares zu bringen,<br />
z.B. in schwierige kombinatorische Probleme, aber auch in<br />
in Webinhalte. Was im Web gezeigt wird, sind noch nicht<br />
strukturierte Daten, sondern einfach ein Layout. Wenn man<br />
diese Daten verarbeiten will, braucht man Struktur. Bei<br />
sehr komplexen und zeitaufwendigen Aufgaben, das sind<br />
Probleme, die eine sehr hohe computationale Komplexität<br />
besitzen, kann Strukturierung ebenfalls helfen. Das ist<br />
etwas anderes als Systemkomplexität. Die computationale<br />
Komplexität eines Problems beschreibt, welche Ressourcen,<br />
wie viel Speicherplatz und Zeit ein Computer braucht,<br />
um ein Problem zu lösen. Schwierige Probleme können<br />
dadurch gelöst werden, dass man Struktur findet, das muss<br />
allerdings auch automatisch geschehen, es bedarf spezieller<br />
Algorithmen zum Erkennen von Struktur. Insofern arbeite<br />
ich für verschiedenste Anwendungsbereiche daran, Struktur<br />
automatisch zu erkennen und für die Problemlösung zu<br />
verwenden.<br />
HG: Das beginnt bei so einfachen Dingen, wie der Färbung<br />
einer größeren Agglomeration von Ländern auf einer<br />
Landkarte mit nur drei Farben.<br />
GG: Richtig. Ein einfach zu erklärendes, in Wirklichkeit<br />
jedoch ein sehr schwieriges Problem ist zum Beispiel das<br />
Dreifärbbarkeitsproblem. Man hat eine noch nicht gefärbte<br />
Landkarte, die man mit drei Farben, z.B. Rot, Blau und<br />
Grün, oder Orange, Rosa und Grün, so färben will, dass<br />
zwei aneinander angrenzende Länder verschiedene Farben<br />
haben. Das ist mit drei Farben nicht immer möglich, mit<br />
vier hingegen schon. Dieses Färbungsproblem ist sehr<br />
kompliziert. Wenn man beginnt, ein Land orange zu färben,<br />
das nächste rosa, das übernächste grün usw. stößt man<br />
irgendwann an die Schwierigkeit, dass ein Land, das eine<br />
Grenze mit einem orangen, rosafarbenen und grünen hat<br />
und daher nicht mehr korrekt gefärbt werden kann. Wenn<br />
ich die Methode verwende, dass ich einfach beginne, ein<br />
Land zu färben und solange weiterfärbe, bis ich nichts mehr<br />
färben kann, muss ich Backtracking machen, d.h. ich muss<br />
zurückgehen und umfärben. Das kann sehr lange dauern,<br />
weil man alle Möglichkeiten, vor allem viele unnütze, die in<br />
der Praxis nicht zum Tragen kommen, durchspielen kann.<br />
Dieses Verfahren kann durch Problemzerlegung insofern<br />
verbessert werden, dass man zumindest für viele Fälle, für<br />
die eine Färbung zu finden ist, diese auch tatsächlich leicht<br />
finden kann. Das Schwierige an solchen Problemen sind die<br />
Zyklen und meine Beobachtung in der ganzen Informatik<br />
ist: das Böse im Sinne von hoher Komplexität liegt in den<br />
Zyklen. Immer wenn man etwas nicht berechnen kann,<br />
sind „teuflische“ Zyklen daran schuld.<br />
KH: Ist nicht der Zyklus, z.B. der Rotationszyklus der Erde<br />
oder der Tages- und Nachtzyklus, gerade das Moment jeder<br />
Struktur? D.h. dieser wiederholbare Zyklus einer Struktur,<br />
die man anwenden kann, ist auch in gewissem Maße ein<br />
Zyklus.<br />
GG: Das ist richtig, aber das ist ein überschaubarer und sehr<br />
einfacher Zyklus. Wenn Zyklen nicht mehr überschaubar<br />
sind, wenn es sehr viele Zyklen in einer Struktur gibt, ist die<br />
Struktur nicht mehr kognitiv erfassbar. Durch den Zyklus<br />
entwindet sich die Struktur unserer kognitiven Anschauung<br />
und ist auch für den Computer kaum kognitiv erfassbar. Zwar<br />
hat der Computer hat per definitionem keine Kognition, aber<br />
wenn die verschiedenen Lösungen oder Lösungskandidaten<br />
in einem Lösungsraum eines Problems vergleichbar sind<br />
und in vernünftiger Zeit miteinander verglichen werden<br />
können, kann man in Anlehnung an einen Menschen,<br />
der eine Situation erfasst, sagen, ein Computer erfasst<br />
ein Problem kognitiv. Durch die Zyklen gibt es jedoch<br />
exponentiell viele mögliche Lösungen, sodass ein Computer<br />
dies nicht mehr in vernünftiger Zeit schaffen kann alle zu<br />
betrachten. Man kann jedoch oft Probleme so zerlegen, dass<br />
nur mehr kleine Teile zyklisch sind und im Wesentlichen<br />
eine azyklische, baumartige Struktur herauskommt. Das<br />
nennt man eine Baumzerlegung oder tree decomposition<br />
auf Englisch. Diese Baumzerlegung ist die Zerlegung<br />
einer ursprünglich komplexen oder komplex anmutenden<br />
Struktur in eine einfachere, aufgrund derer man das Problem<br />
lösen kann. Nicht jedes Problem oder jede Instanz eines<br />
Problems lässt sich in das Korsett einer Baumzerlegung<br />
zwingen, es funktioniert aber für viele Probleme, die sich<br />
uns in der Realität darbieten und deren Lösung man nicht<br />
auf Anhieb erkennen kann. Die Baumzerlegung wurde in<br />
der Graphentheorie in der Mathematik eingeführt und wird<br />
intensiv in der Informatik zur Problemlösung eingesetzt. Es<br />
gibt jedoch viele Probleme, die nicht so leicht als Graphen<br />
darzustellen sind wie unser Färbbarkeitsproblem. Hier hatten<br />
wir zunächst eine Landkarte, die wir in eine mathematische<br />
Struktur, und zwar einen Graphen umgewandelt haben.<br />
Ein Graph besteht aus mehreren Punkten, die mit Strichen<br />
verbunden sind, ein Straßennetz kann ebenfalls als Graph<br />
dargestellt werden. Wir haben also unser ursprüngliches<br />
Problem in eine mathematische Struktur umgewandelt,<br />
diese weiter in einen Baum zerlegt und aufgrund dieser<br />
Baumzerlegung eine Lösung gefunden, die Lösung wieder<br />
auf die mathematische Struktur und von der mathematischen<br />
Struktur auf die Landkarte übertragen (Bild 1). Leider benötigt<br />
man manchmal kompliziertere mathematische Strukturen<br />
Bild 1<br />
X1 X2 X3 X4 X5<br />
X8<br />
X3<br />
X6<br />
X7<br />
X4<br />
X5<br />
X3 X4 X2<br />
X3 X2 X1<br />
X3 X5 X6 X8<br />
X5 X6 X7 X8<br />
tree decomposition<br />
als nur Graphen. Eine wichtige Struktur, die immer wieder<br />
in Erscheinung tritt, ist der Hypergraph. Ein Hypergraph<br />
besitzt nicht nur sogenannte Knoten - das sind die Punkte<br />
- und Kanten, die Linien zwischen den Punkten, sondern<br />
Knoten und Hyperkanten. Eine Hyperkante kann aus mehr<br />
als zwei Knoten bestehen. Es gibt zahlreiche Probleme,<br />
deren Struktur eher Hypergraphen ähnelt als Graphen, z.B.<br />
ein Kreuzworträtsel. Jedes Feld, in das ich einen Buchstaben<br />
eintragen kann, wäre ein Knoten und jedes Wort wäre<br />
eine Hyperkante, denn jedes Wort verbindet mehrere<br />
Knoten. Auch beim Kreuzworträtsel machen die Kreise<br />
die Komplexität aus. Wenn wir annehmen, dass jemand<br />
bereits über das Wissen verfügt, um ein Kreuzworträtsel<br />
zu lösen, oder wenn man ihm die möglichen Wörter, die<br />
man in die Felder eintragen kann, vorgibt - wobei es für<br />
jedes Feld natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt - ist<br />
das Rätsel aufgrund der Kreise immer noch schwer lösbar.<br />
Circulus viciosus, der Kreis ist immer das Böse, das die<br />
Komplexität erhöht. Der Kreis im Kreuzworträtsel beginnt<br />
mit dem Ausfüllen eines Wortes, des nächsten usw., wenn<br />
man wieder zurückkommt, passt das Ganze möglicherweise<br />
nicht zusammen. Es ist ein teuflischer Kreis zur Wirkung<br />
gekommen. Bild 2 zeigt ein Kreuzworträtsel und den<br />
dazugehoerigen Hypergraphen.<br />
KH: Man ist immer versucht, den Kreis zu schließen.<br />
Bild 2<br />
ExampleofCSP:CrosswordPuzzle<br />
1h: P A R I S 1v: L I M B O<br />
P A N D A<br />
L I N G O<br />
L A U R A<br />
P E T R A<br />
A N I T A<br />
P A M P A<br />
P E T E R<br />
hyperedge<br />
and so on<br />
hypergraph<br />
GG: Aber dort, wo man versucht, ihn zu schließen, passt es<br />
oft nicht zusammen.<br />
KH: Durch tree decomposition sind solche Kreise dann doch<br />
lösbar.<br />
GG: Ja, wobei man beim Färbungsproblem zunächst eine<br />
tree decomposition oder Baumzerlegung vornimmt, jedoch<br />
etwas anderes braucht, weil es sich nicht um einen Graphen,<br />
sondern Hypergraphen mit Hyperkanten handelt. Wir haben<br />
eine neue Methode, die sogenannte Hyperbaumzerlegung<br />
eingeführt, die die Möglichkeit bietet, auch bei strukturell<br />
komplizierteren Probleme zu relativ schnellen und guten<br />
Lösungen in vernünftiger Zeit zu kommen. Das funktioniert<br />
nicht für jedes, aber für viele dieser Probleme.<br />
HG: Wofür kann man die Hyperbaumzerlegung noch<br />
brauchen?<br />
GG: Hypergraphen treten nicht nur bei Kreuzworträtseln,<br />
sondern auch bei vielen anderen Problemen auf, die in der<br />
nächsten Zeit für Anwendungen interessanter werden, z.B.<br />
für combinatorial auctions, kombinatorische Versteigerungen.<br />
Dies sind verbesserte Auktionen, bei denen ein Bieter über<br />
mehr Optionen verfügt. Er kann nicht nur auf Einzelobjekte<br />
ein Gebot abgeben, sondern gleichzeitig auf mehrere<br />
Objekte bieten. Er kann eine bestimmte Summe für mehrere<br />
Objekte bieten und bekommt dann entweder alle für diesen<br />
Betrag oder gar keines. Bild 3 zeigt einen Hypergraph einer<br />
Bild 3<br />
CombinatorialAuctions<br />
105<br />
50 57<br />
bid hypergraph<br />
h<br />
40<br />
35<br />
kombinatorischen Auktion, den sogenannten bid hypergraph,<br />
durch den die einzelnen Gebote, die sogennanten bids,<br />
dargestellt sind. Hier werden z.B. Tassen und Teekannen<br />
feilgeboten, eine Teekannen-Sammlerin möchte z.B. diese<br />
drei Teekannen haben und bietet 105 Euro dafür. Ein anderer<br />
potentieller Käufer möchte nur eine der Kannen plus einige<br />
Tassen haben und bietet nur 50 Euro. Wieder ein anderer<br />
möchte wieder eine andere Kanne mit einer anderen Tasse<br />
usw. So können verschiedenste Gebote formuliert werden.<br />
KH: Das heißt die Eindimensionalität wird verlassen. Es gibt<br />
bei einer Auktion nicht nur immer ein Ding, das mühsam<br />
ersteigert und dann kombiniert werden muss, sondern ich<br />
kann meinen Wunsch in einer Kombination, in einem Paket<br />
äußern.<br />
GG: Genau, in a package. Das ergibt nun die Schwierigkeit,<br />
dass diese Pakete überlappend sein können. Wenn sich zwei<br />
Pakete von verschiedenen Bietern überlappen, kann nur einer<br />
zu den Gewinnern gehören. Im Gegensatz zu klassischen<br />
Auktionen besteht hier das Problem, die Gewinner<br />
überhaupt zu eruieren. Es muss Optimalitätskriterien geben.<br />
Ein mögliches Kriterium wäre z.B., das Versteigerungshaus<br />
möchte den größtmöglichsten Gewinn machen. Dann<br />
müsste man eine Menge von Hyperkanten bestimmen, die<br />
nicht überlappend sind und die maximale Gesamtsumme<br />
gewähren. Dies ist ein sehr schwieriges Problem, das<br />
ebenfalls durch Hyperbaumzerlegung vereinfacht und<br />
gelöst werden kann. Wir können mit unserer Methode viele<br />
sogenannte NP-schwere Probleme relativ gut lösen, wie sie<br />
hier auf Bild 4 „Classification of decidable problems“ zu<br />
sehen sind. Es zeigt verschiedene Klassen von Problemen<br />
entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades. Tractable<br />
Probleme sind solche, die in einer „vernünftigen“, d.h.<br />
polynomellen Zeit lösbar sind. Wenn das Problem bestimmt<br />
groß ist, werden „nur“ quadratisch viele Schritte für seine<br />
Lösung benötigt. Intractable Probleme dagegen sind nur in<br />
exponentieller Zeit zu lösen, man kann beweisen, dass diese<br />
Probleme nicht effizient lösbar sind. Dazwischen liegen die<br />
NP-vollständigen Probleme – NP t ist die Abkürzung von<br />
„nichtdeterministisch polynomell“. Diese Probleme wären<br />
gut lösbar, wenn man gut raten könnte. Nichtterminismus<br />
heißt raten. Leider können wir nicht alles erraten, da es<br />
exponentiell viele Möglichkeiten gibt.<br />
KH: Und was macht man, wenn ein Problem nicht zerlegbar<br />
ist?<br />
GG:Wenn die Hyperbaumzerlegung und ähnliche<br />
Methoden nicht ausreichen, um schwierige Probleme<br />
zu lösen, dann gibt es andere Lösungsmethoden, die in<br />
vielen Fällen zu einer optimalen Lösung führen können,<br />
sofern es eine solche überhaupt gibt. Diese Verfahren<br />
nennt man randomized local search methods, also Methoden<br />
der zufallsgesteuerten lokalen Suche. Ihre Anwendung<br />
erfordert bestimmte Voraussetzungen. Wenn ich einen<br />
Lösungsraum mit sehr vielen Lösungskandidaten - das<br />
sind mögliche Lösungen, die aber nicht notwendigerweise<br />
Lösungen sind - habe, muss ich diese bewerten, d.h. ich<br />
muss sagen können, wie gut oder wie schlecht ich bei einer<br />
Lösung bin und ob dies überhaupt schon eine Lösung ist.<br />
Man braucht eine Bewertungsfunktion. Soll z.B. ein Graph<br />
mit drei Farben gefärbt werden, wäre die Bestimmung, wie<br />
viele Kanten bereits richtig gefärbt sind, sodass an beiden<br />
Endpunkten verschiedene Farben sind, eine numerische<br />
Bewertungsfunktion. Wenn alle Kanten richtig gefärbt sind,<br />
ist es eine Lösung. Wenn ich bei einem Lösungskandidaten<br />
in einem Lösungsraum bin, kann ich möglicherweise<br />
zu einem besseren hingelangen, indem ich durch kleine<br />
Änderungen, durch kleine Umfärbungen möglicherweise<br />
38<br />
Winner determination is intractable (NP-hard)<br />
INTR<br />
RAC CTA ABLE<br />
Bild 4<br />
weighted set packing problem<br />
Classification of decidable problems<br />
INTRACTABLE PROBLEMS<br />
EPROVABLY<br />
• Theory of the Real Numbers<br />
• Many tasks in automated program verification<br />
PRESUMABLY INTRACTABLE PROBLEMS<br />
NP-complete<br />
• Packing<br />
1000s of practically<br />
relevant problems,<br />
• Traveling Salesperson<br />
many new challenges<br />
• Map coloring<br />
TRACTABLE PROBLEMS (polynomial time)<br />
• Matrix multiplication<br />
• Shortest path<br />
• Linear programming<br />
mehr Kanten richtig färbe und somit meine Lösung<br />
verbessert habe. Ich kann aber auch zu einem lokalen<br />
Optimum gelangen, das nicht mehr verbesserbar ist. In<br />
diesem Fall springt man völlig zufällig irgendwo anders im<br />
Lösungsraum hin. Das ist die chaotische Phase: Ich springe<br />
zu irgendeinem Punkt im Lösungsraum und gehe dann<br />
wieder zu einem systematischen Optimum, solange bis eine<br />
zufriedenstellende oder sogar optimale Lösung gefunden ist.<br />
Meine Theorie ist, dass diese Methode, die in der Informatik<br />
schon sehr lange und erfolgreich angewendet wird, schon<br />
vor langer Zeit durch die Evolution entwickelt wurde. Auf<br />
diesen Gedanken kam ich durch die Beobachtung von<br />
Fliegen. Ich beobachtete Fliegen bei dem Versuch aus<br />
einem Raum mit mehreren offenen und geschlossenen<br />
Fenstern hinauszufinden. Die Fliege versucht zunächst<br />
einmal lokal zu optimieren und fliegt zum nächstliegenden<br />
Fenster. Wenn dies geschlossen ist, wird sie einige Zeit das<br />
Fenster absuchen und sich überzeugen, dass sie über das<br />
lokale Optimum nicht hinaus kann. Nach einiger Zeit wird<br />
sie vom Fenster weg mitten in den Raum fliegen und wirre<br />
Flugrouten vollziehen. Dies nenne ich den chaotischen Teil<br />
der Suche, die meiner Meinung dieser zufallsgesteuerten<br />
Suche entspricht. Die Fliege beruhigt sich dann wieder<br />
und fliegt geradlinig das nächste Fenster an, dies kann das<br />
gleiche wie zuvor sein, denn die Suche ist ja zufallsgesteuert,<br />
aber nach einiger Zeit wird sie das richtige Fenster finden.<br />
So gelangen Fliegen aus einem Raum.<br />
Man könnte sagen, dieses Verhalten sei irrational, ist es<br />
aber nicht. Es ist genauso wenig irrational, wie ein Kind, das<br />
ein Haus aus Bierdeckeln oder Blöcken bauen möchte und,<br />
wenn es zu einem dead end kommt und ansteht, das Haus<br />
zusammenschmettert und von Neuem aufbaut. Dies ist viel<br />
vernünftiger als weiterzumachen, wenn man die Situation<br />
kognitiv nicht durchschaut. Ein Erwachsener würde dies<br />
kognitiv durchschauen und die Eltern werden schimpfen.<br />
Aber das Kind kommt viel schneller zu einer Lösung, wenn<br />
es das schlecht begonnene Haus zerstört und ein neues<br />
aufbaut. Durch diesen Prozess lernt man auch, wie man zu<br />
einer richtigen Lösung kommt. So wie die Evolution selbst<br />
immer den Zufall benötigt und durch Zufall die Kreaturen<br />
immer wieder verbessert.<br />
KH: Aber auch Distanz. Man muss sich auch immer wieder<br />
distanzieren von dem Lokalen.<br />
GG: Wenn ich nur das Lokale vor Augen habe, gelange ich<br />
zu einem lokalen Optimum und nicht weiter.<br />
GH: Kann man sagen, dass die Fliege einen Adrenalinstoß<br />
erfährt und wütend herumfliegt …<br />
GG: Wenn man dies anthropomorph so ausdrücken will,<br />
denn wir wissen nicht, ob Fliegen so etwas wie Wutempfinden<br />
haben können, wir müssen ja vom Menschen auf die<br />
Fliege schließen. Wir können dies mit einer bestimmten<br />
Berechtigung, weil vieleMechanismen ähnlich sind, z.B.<br />
hat man festgestellt, dass Fliegen genauso wie Menschen<br />
Adrenalin produzieren, in bestimmten Situationen mehr<br />
als in anderen. Meine Vermutung ist, das habe ich jedoch<br />
noch nicht bewiesen. Wir wollen in einem weiteren Projekt<br />
untersuchen, ob Adrenalin daran schuld ist. Wenn eine<br />
Fliege bei einem geschlossenen Fenster nicht weiterkommt,<br />
wird möglicherweise wie beim Menschen aus einem Ärger<br />
ähnlichen Mechanismus Adrenalin ausgeschüttet, und es ist<br />
bekannt, dass Adrenalin durch Bewegung abgebaut werden<br />
kann. D.h. die Fliege muss in eine Bewegungsphase treten,<br />
danach setzt wieder das „rationalere“ Verhalten ein, die<br />
Fliege sucht die nächste Route zum nächsten Fenster und<br />
fliegt dem größten Gradienten des Lichtes entgegen, und das<br />
kann zufällig das richtige Fenster sein. Dieser Mechanismus<br />
ist meiner Meinung im gesamten Leben vorhanden. Wenn<br />
wir z.B. einen Schlüsselbund ordnen wollen und das Ganze<br />
zu komplex ist, schütteln wir ihn durch und mit ein bisschen<br />
Glück sind die Schlüssel danach geordnet. Aber auch alles,<br />
was mit Astrologie, Orakel und Horoskop zusammenhängt,<br />
ist meiner Ansicht nach gar nicht so irrational, wie die<br />
meisten Leute deuten, sondern haben ihre Berechtigung,<br />
denn sie helfen. Sie haben zwar keinerlei Bedeutung, denn<br />
sie sind rein zufällig.<br />
HG: Aber es bringt jemanden auf eine andere Ebene.<br />
GG: Richtig, es bringt jemanden aus einer Sackgasse heraus.<br />
Wenn ein Mensch z.B. unglücklich verliebt ist, befindet er<br />
sich in einer Sackgasse, in der man bleiben könnte. Aber<br />
er oder sie wird aus Verzweiflung zu einem Wahrsager<br />
getrieben oder schaut sich das Horoskop an, wo irgendein<br />
Blödsinn drinnen steht, etwas völlig Absurdes, Zufälliges,<br />
Arbiträres, und dieses Arbiträre, z.B. „achten Sie morgen<br />
auf eine grün angezogene Person“, hilft einem, sich von<br />
seinem auswegslosen Target abzuwenden und Neues zu<br />
suchen, auch wenn u.U. das Neue sich wieder als nicht<br />
brauchbar herausstellt.<br />
KH: Das ist auch beim Arztbesuch so, manchmal genügt<br />
es, einmal an der Arzttür zu schnuppern und ein Placebo<br />
einzunehmen und eine andere Situation wie Zuhause zu<br />
haben. Die Abwendung von der persönlichen Umgebung,<br />
das Abstandgewinnen und Herauskommen aus dem<br />
eigenen Orbit genügt, um den Heilungsprozess anzuregen.<br />
GG: Generell wäre das auch eine zusätzliche Teilerklärung<br />
für Wut. Einige Formen der Wut im Menschen sind sehr<br />
positiv. Wut wird immer als etwas Schlechtes dargestellt.<br />
Hero<br />
Georg Gottlob ist Professor für „computing science“ an der Oxford University und an der TU Wien.<br />
Architekt Gerngross sagt, er kann sich über nichts mehr<br />
ärgern, aber da kann ich nur sagen, er ärgert sich nur deshalb<br />
über nichts, weil er bereits ein globales Optimum erreicht<br />
hat. Wer sozusagen einmal das Nirwana erreicht hat …<br />
GH: Du hast ja wirklich Versuche mit Fliegen gemacht …<br />
GG: Wir haben vor längerem Versuche mit Fliegen gemacht<br />
und wollen jetzt ein weiteres Projekt durchführen.<br />
KH: Wenn die Wut impliziert wegzugehen, aber es kann<br />
auch sein, dass die Wut impliziert, sich festzubeißen.<br />
GG: Ich glaube, wenn man sich festbeißt, ist man nicht<br />
wütend. Jemand ist nicht dauernd wütend, die Wut ist<br />
etwas Aufbrausendes, das dann wieder weggeht. Wenn ich<br />
verbissen bin, ist es nicht eine andauernde Wut, sondern ein<br />
Wahn. Zorn und Wut tauchen kurzfristig auf und müssen<br />
abgebaut werden, wenn sie nicht abgebaut werden können,<br />
kann es sich in etwas anderes Unangenehmes verwandeln.<br />
KH: Also kann man sagen, dass dieser emotionale Ausbruch,<br />
wie das Auf den Tisch Hauen, etwas ganz Wesentliches ist.<br />
HG: Es gibt Leute, die das sicher erkannt haben. Es gibt z.B.<br />
die strategische Wut. Ich glaube, sogar bei der Zaha Hadid,<br />
die kommt z.B.herein, fängt einmal wutig an, schreit alle<br />
zusammen und aus diesem Wutzustand gelangt sie auf eine<br />
neue Ebene.<br />
GG: Die strategische Wut ist ein wunderbarer Ausdruck, der<br />
soeben vom Heidulf kreiert wurde.<br />
HG: Ich habe dies einmal beim Herman Czech gesehen, der<br />
immer mir als ruhiger und besonnener Mensch erschienen<br />
ist, der einmal, weil ein kleines Ding nicht funktionierte,<br />
plötzlich die Wut rausgelassen hat, wo ich rückblickend<br />
dachte, dass er sie strategisch angewandt hat, um Ordnung<br />
zu schaffen.<br />
KH: So ein Ventil braucht jeder Mensch, es staut sich ja<br />
auch etwas auf.<br />
GG: Man kann nicht sagen, dass die Wut nur diese Funktion<br />
hat, zu einer besseren Lösung zu gelangen, aber ich denke,<br />
das ist eine der wesentlichen Funktionen.<br />
HG: Was mich interessiert, ist deine Arbeit, die über<br />
die Lösung komlexester Systeme wieder zum Menschen<br />
zurückgeht, um seine Gefühlswelt erklären zu können.<br />
Hier scheint mir ein Weg zu sein, der auch Gefühlswelten<br />
mathematisch erklären kann.<br />
KH: Und evolutionäre Messages, Knowledge.<br />
GG: Richtig, nur müssen wir dazu noch viele Versuche dazu<br />
machen, um dies wirklich zu beweisen.<br />
GH: Da brauchen wir noch eine Menge Fliegen. Dieser<br />
Tisch hier, auf dem lauter Wespen auf rotem Hintergrund<br />
abgebildet sind z.B., ist so entstanden, dass ein Künstler in St.<br />
Peterburg beim Anziehen seiner Tochter von einer Wespe in<br />
die Eier gestochen wurde. Seitdem malt er Wespenbilder.<br />
Aber ich möchte zu der Frage kommen, ob wir aus<br />
unseren Dingen, die der Hofstetter Kurt und ich und du<br />
als Wissenschaftler machen, ein gemeinsames Feld finden<br />
können, um unsere Kapazitäten zu nutzen und mit deinen<br />
zufälligen Strukturerklärungen zu etwas zu kommen, was<br />
vielleicht ein Feld ist, das etwas Neues kreiert. Ob es aus<br />
dem Raum, aus dem die ganzen Worte und Bilder auf uns<br />
einschießen, so etwas wie eine automatische mitteilenswerte<br />
Mitteilung aus dem Feld gibt, so etwas, wo wir den Begriff<br />
„Die vollautomatische Zeitung“ kreiert haben.<br />
GG: Ich möchte ein wenig ausholen, um dahin zu<br />
kommen. Wir haben uns ja auch mit der Strukturierung<br />
von Internetinhalten beschäftigt. Die Daten im Internet<br />
sind meistens in HTML oder Flash programmiert, es sind<br />
eigentlich keine Daten, sondern nur ein Layout. HTML<br />
ist eine Sprache des Layouts. Das Web selbst ist für den<br />
menschlichen Betrachter bestimmt und der Sinn dieser<br />
Daten wird erst durch das menschliche Gehirn erfasst,<br />
meaning is in the eye of the beholder. Ein Computerprogramm<br />
braucht jedoch strukturierte Daten, um zu arbeiten, d.h.<br />
Daten, wo bei jedem Datum dabei steht, was es ist. Wir haben<br />
ein Tool entwickelt, das mittlerweile von einer Startup-Firma<br />
weiterentwickelt und vermarktet wird. Die Firma heißt Lixto<br />
(www.lixto.com). Diesem Tool kann man beibringen, dass es<br />
von verschiedenen Webseiten – man muss natürlich wissen,<br />
welche Webseiten dies sind, es ist keine Suchmaschine, die<br />
ins ganze Web geht – Daten und Texte zusammenträgt<br />
und diese in ein strukturiertes Format umwandelt. Dieses<br />
Tool habe ichursprünglich mit einigen Mitarbeitern und<br />
Studenten an der TU Wien entwickelt. Die Kunden der<br />
Firma Lixto kommen einerseits aus dem Bereich der<br />
Automobilzulieferindustrie. Diese sind verpflichtet, täglich<br />
auf sehr vielen Webseiten zu nachzusehen, ob es etwas<br />
Neues gibt, denn die Automobilhersteller, die sogenannten<br />
OEMs, richten für jeden Zulieferer eine Seite ein, und es gibt<br />
zusätzlich Seiten, die für alle gemeinsam interessant sind, wo<br />
z.B. neue Anbote oder Ausschreibungen usw. stehen. Wenn<br />
ein Zulieferer 30-50 OEMs, große Automobilhersteller, als<br />
Kunden hat, müssen die Angestellten jeden Tag Hunderte<br />
von Webseiten besuchen. Sogar Reklamationen werden nur<br />
auf einer einzigen Webseite dargestellt. Wenn ein Fehler<br />
gemacht wird, kann dies viel Geld und Zeit kosten. Und es ist<br />
ein Fehler anfälliger Prozess, wenn jemand krank ist, kann<br />
oft einige Tage nicht auf die Webseite geschaut werden und<br />
man reagiert zu spät. Wir haben die Software Lixto entwickelt,<br />
die dies automatisch macht. Andere Kunden kommen aus<br />
der Tourismusbranche, z.B. große Internet-Reisebüros und<br />
Hotelvermittler (wie hotel.de), die ihren Onlinekunden eine<br />
Bestpreisgarantien geben. Diese Anbieter wollen natürlich<br />
wissen, ob sie wirklich den besten Preis haben und diesen<br />
gegebenfalls schnell anpassen können, falls jemand anderer<br />
das gleiche Hotel billiger verkauft. Das kann heute natürlich<br />
nur über das Web festgestellt werden, indem man alle<br />
anderen wesentlichen Anbieter und Konkurrenten abgrast,<br />
ihre Webseiten überwacht und automatisch jemanden<br />
notifiziert, der dann sein Angebot schnell ändern muss.<br />
KH: Vorausgesetzt, dass diese Webdaten als Preis identifiziert<br />
und in XML umgewandelt werden.<br />
GG: Genau. Wir bringen unserer Software bei, wie sie<br />
verschiedene Angebote von verschiedenen Webseiten<br />
identifizieren kann, was ist das Hotel, was der Preis, handelt<br />
es sich es überhaupt um dasselbe Hotel, usw. Sie vergleicht<br />
die Preise, und meldet sofort, wenn es eine Abweichung gibt,<br />
damit man rasch darauf reagieren kann und keine Pönale<br />
zahlen muss. Kommen wir nun zu unserer Idee zurück, ein<br />
gemeinsames Projekt zu starten. Wir wollen basierend auf<br />
der Lixto Software eine automatische Zeitung generieren,<br />
indem wir ein Programm entwickeln, das automatisch<br />
auf verschiedenste Webseiten navigiert , von dort Inhalte<br />
holt, diese miteinander kombiniert und verbindet, und<br />
ohne Zutun von Menschen eine Zeitung generiert. Die<br />
Kriterien, nach denen die Quellen ausgewählt werden, die<br />
Berwetungsfunktionen für Texte und Bilder, das Layout,<br />
sowie der Grad der Zufälligkeit werden wir gemeinsam<br />
festlegen, und dann so lange „tunen“, bis interessante<br />
Zeitungen generiert werden. Diese werdendann gedruckt.<br />
KH: Das heißt, dass du, Heidulf, bei deinen Ausgaben<br />
auf einen Knopf drückst und dieser Knopfdruck eine<br />
Momentaufnahme von dieser automatischen Zeitung<br />
generiert, und du hast ein Buch. Was mir schon sehr<br />
am Herzen liegt, ist, dass die qualitativen Inputs schon<br />
vertrauenswürdig sein müssen.<br />
HG: Du kannst ja Parameter reingeben, die das ganze Layout<br />
definieren.<br />
KH: Ich mache das mit meinen S/W Images, ich vertraue<br />
immer auf den Himmel, dass er keine bösen Daten gibt.<br />
GG: Der Dichand fürchtet sich schon mächtig vor diesem<br />
Projekt.<br />
Webseite: http://www.comlab.ox.ac.uk/people/Georg.Gottlob/
62 <strong>ST</strong>/A/R<br />
Buch X - GOTTLOB Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
MARKO ZINK<br />
ES I<strong>ST</strong> SO<br />
analoge Fotografie<br />
12.9. bis 1.11.2008<br />
Einladung zur Vernissage<br />
Donnerstag, den 11.9.2008 um <strong>19</strong> Uhr<br />
Eröffnung der Ausstellung: Andrea Domesle<br />
Katalogpräsentation:<br />
Samstag, 11.10.2008 von 11 bis 14 Uhr<br />
Marko Zink, Andrea Domesle und<br />
Matthias Herrmann<br />
Die Ausstellung wurde Andrea Domesle<br />
und Matthias Herrmann kuratiert.<br />
Schleifmühlgasse 18, 1040 Wien/Vienna<br />
T: 0043 - 1 -920 77 78<br />
www.galerie-stock.net info@galerie-stock.net<br />
Öffnungszeiten Di - Fr 15 - <strong>19</strong> Uhr, Sa 11 - 15 Uhr<br />
Foto: © Max Lautenschläger<br />
Rz_plakat 2.qxd:Rz_plakat 14.07.2008 15:40 Uhr Seite 1<br />
HRDLICKA<br />
Der Titan und die Bühne des Lebens<br />
künstlerhaus<br />
karlsplatz 5<br />
1010 wien<br />
31. 7. – 21. 9. 2008<br />
täglich<br />
10 –18 uhr<br />
donnerstag<br />
10 – 21 uhr<br />
www.k-haus.at<br />
künstlerhaus<br />
Bruckberger<br />
the art of work
Nr. <strong>19</strong>/2008 Buch X - GOTTLOB<br />
<strong>ST</strong>/A/R 63<br />
Heidulf Sue<br />
H Y B R I D B E I N G S<br />
Analog/Digital Fotografie & Animation , Sue Sellinger<br />
Das Projekt ist ein<br />
kritischer Prozess der<br />
Auseinandersetzung mit<br />
bildgebenden und manipulativen<br />
Verfahren. Ausgehend von einer<br />
Serie analoger Portraits realer<br />
Personen entsteht eine Serie von<br />
digital konstruierten Gesichtern,<br />
welche als „gläserne Körper“ in<br />
Form von transparenten Bildern<br />
- weiterführend auch in einer<br />
surreal wirkenden Videoanimation<br />
- neuartige Gestalten annehmen.<br />
Lediglich ein einziges, digital<br />
optimiertes Portrait dient als<br />
Vorlage, das „Master-Face“.<br />
Portraitiert werden Personen<br />
unterschiedlichen Alters,<br />
Geschlechts und Hautfarbe.<br />
Die medial geprägte Umwelt<br />
unserer Zeit, fordert das „Ich“<br />
unweigerlich dazu auf, sich<br />
einer konstruierten Wirklichkeit<br />
zu stellen, die durch Vorgabe<br />
surrealer „Modelle von Ästhetik“<br />
maßgeblich den ästhetischen<br />
Zeitgeist mitbeinflusst. Der<br />
natürliche Akttraktor „Schönheit“<br />
ist Basis, um neue Modelle der<br />
ästhetischen Möglichkeiten zu<br />
kreieren.<br />
Heike Widl<br />
Die ästhetische Dimension einer<br />
durch digitale Bildmanipulation<br />
geprägten Bilderwelt lässt es<br />
dem Betrachter nicht mehr<br />
zu, ausschließlich der eigenen<br />
Antizipationskraft zu vertrauen.<br />
Die uns umschwärmende, mediale<br />
Bilderflut überlässt einem selbst<br />
nicht mehr ausschließlich die<br />
Entscheidung, ob eine Darstellung<br />
tatsächlich real ist oder nicht und<br />
schafft dadurch eine Illusionen von<br />
Wirklichkeit.<br />
Die Darstellung des menschlichen<br />
Körpers, im weitesten Sinne, ist<br />
davon massiv beeinflusst und<br />
schafft die Ausgangsbasis für das<br />
Projekt. Es ist der Versuch, die<br />
Grenzen der realen, ästhetischen<br />
Qualität zu überschreiten und<br />
die ästhetischen Dimensionen<br />
der menschlichen Abbildung zu<br />
erweitern.<br />
GALERIE <strong>ST</strong>RICKNER<br />
1060 Wien,<br />
Fillgradergasse 2/7<br />
T: +43-(0)680-201 44 52<br />
www.galeriestrickner.com<br />
Eröffnung:<br />
18. September 2008<br />
Ausstellungsdauer:<br />
<strong>19</strong>. September –<br />
31. Oktober 2008<br />
Öffnungszeiten:<br />
Di. - Fr. 16:00 – <strong>19</strong>:00,<br />
Sa. 11:00 – 13:00 und nach<br />
telefonischer Vereinbarung<br />
SUE<br />
Onlineportfolio Sue Sellinger<br />
www.highlighter.org
64 <strong>ST</strong>/A/R<br />
star_brus:Layout 1 <strong>19</strong>.09.2008 14:21 Uhr Seite 6<br />
Buch X - GOTTLOB Nr. <strong>19</strong>/2008<br />
GÜNTER<br />
BRUS<br />
Mitternachtsröte<br />
BRUS<br />
MAK-Kunstblättersaal<br />
10.9.2008–25.1.2009<br />
MAK Stubenring 5, Wien 1<br />
www.MAK.at<br />
Günter Brus, Eva, <strong>19</strong>76, Privatsammlung Graz