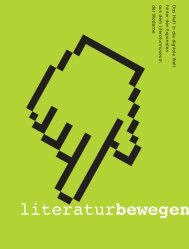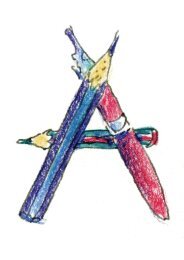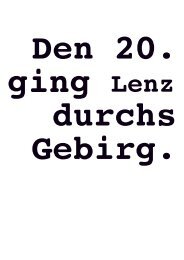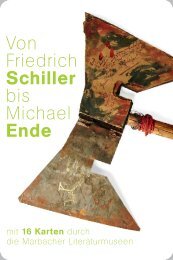Marbacher Magazin 160: Im Schattenreich der wilden Zwanziger (Leseprobe)
Das 2017 erschienene Marbacher Magazin mit Fotos aus dem Nachlass von Ruth Landshoff und Texten von Jan Bürger, Chris Korner und Thomas Blubacher ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf
Das 2017 erschienene Marbacher Magazin mit Fotos aus dem Nachlass von Ruth Landshoff und Texten von Jan Bürger, Chris Korner und Thomas Blubacher ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
IM<br />
SCHATTENREICH EICH<br />
DER WILDEN<br />
ZWANZIGER<br />
Fotografien aus dem Nachlass<br />
von Ruth Landshoff-Yorck<br />
von Jan Bürger
marbachermagazin <strong>160</strong><br />
IM SCHATTENREICH DER<br />
WILDEN ZWANZIGER<br />
Fotografien von Karl Vollmoeller<br />
aus dem Nachlass von<br />
Ruth Landshoff-Yorck<br />
von Jan Bürger<br />
mit Beiträgen von<br />
Thomas Blubacher und<br />
Chris Korner<br />
Deutsche Schillergesellschaft<br />
Marbach am Neckar
VOM PARISER PLATZ<br />
NACH MANHATTAN –<br />
UND MARBACH<br />
5<br />
Der Maler stieg einfach durchs Fenster in die große Wohnung. Niemand<br />
hatte ihn eingeladen. Niemand hatte mit ihm gerechnet, aber<br />
natürlich wusste Karl Vollmoeller, um wen es sich handelte, als <strong>der</strong><br />
schlaksige Mann mit <strong>der</strong> niedrigen Stirn und den großen beweglichen<br />
Augen bei ihm zu Hause Platz nahm. Und so wun<strong>der</strong>te sich<br />
Vollmoeller wohl auch nicht darüber, dass <strong>der</strong> Eindringling nicht<br />
nur einen riesigen Zeichenblock mitgebracht hatte, son<strong>der</strong>n auch<br />
einen Revolver, den er laut auf den Tisch poltern ließ. Ganz Berlin<br />
wusste, wer Oskar Kokoschka war, zumindest die ganze Berliner<br />
Boheme, auch wenn noch lange nicht ausgemacht war, dass ›Koko‹<br />
später einmal zu den größten Malern des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts gezählt<br />
werden würde. Und auch <strong>der</strong> heute vergessene Vollmoeller, Besitzer<br />
<strong>der</strong> Erdgeschosswohnung am Pariser Platz, gleich hinter dem<br />
Brandenburger Tor, gehörte zur Kulturprominenz <strong>der</strong> Hauptstadt.<br />
Schließlich war er einer <strong>der</strong> engsten Vertrauten des Regie-Zauberers<br />
Max Reinhardt.<br />
Mit Vollmoellers wortlosem Drama Das Mirakel / The Miracle feierten<br />
die beiden seit 1911 in ganz Europa Erfolge, in Berlin genauso<br />
wie in London, Paris und seit 1924 sogar am Broadway in New York.<br />
Die Musik zu diesem Stück, das ein Millionenpublikum faszinierte<br />
und den großen Vorteil hatte, nicht übersetzt werden zu müssen, weil<br />
die Darsteller ausschließlich mimisch und gestisch agierten, hatte <strong>der</strong><br />
berühmte Engelbert Humperdinck geschrieben. ›Koko‹ aber suchte
6<br />
1922 am Pariser Platz nicht nach Vollmoeller. Er hatte auch nicht<br />
vor, etwas zu stehlen. Eigentlich war ihm <strong>der</strong> reiche Schriftsteller,<br />
Unternehmer und Filmpionier nur im Weg, denn ihm ging es allein<br />
um dessen Freundin. Er wollte sie unbedingt zeichnen, und nicht nur<br />
an diesem Tag drehte sich in Vollmoellers Zimmerfluchten das meiste<br />
um die nicht einmal volljährige, 1904 geborene Schauspielerin Ruth<br />
Landshoff. Seit kurzem lebte sie mit dem 46-jährigen zusammen und<br />
fläzte, wie es in ihren Erinnerungen heißt, gerade mal wie<strong>der</strong> bei<br />
ihm auf dem Sofa.<br />
Dem alt gewordenen Bohemien muss die Szene nicht ganz geheuer<br />
gewesen sein. Doch <strong>der</strong> Maler ließ sich nicht zurückweisen<br />
und blieb stundenlang – nicht ohne Grund hatte er seinen Revolver<br />
mitgebracht. »Koko zeichnete in wil<strong>der</strong> Eile«, schrieb Ruth Landshoff<br />
knapp vier Jahrzehnte später. »Er schaute mich nicht an, wie<br />
man ein Mädchen, son<strong>der</strong>n wie man ein Haus anschaut o<strong>der</strong> einen<br />
Baum. Mein Hund hatte nur einmal kurz gebellt und schlief wie<strong>der</strong>.<br />
Mir wurde die Stille allmählich langweilig, und ich schlief auch ein.<br />
Ich wachte davon auf, daß Koko den Block zuklappte. Er stand auf<br />
und sagte: ›Danke, küss’ die Hand.‹«1<br />
Zwei <strong>der</strong> an diesem Nachmittag entworfenen Lithografien werden<br />
bis heute immer wie<strong>der</strong> ausgestellt. Bereits 1924 präsentierte<br />
die viel gelesene Zeitschrift Der Querschnitt eine von ihnen, Seite<br />
an Seite mit einem Foto von Ruth Landshoff. »Schöne Frauen beim<br />
Photographen und beim Maler«, lautete das Motto. In den zwei Jahren<br />
seit ›Kokos‹ überfallartigem Besuch war Ruth Landshoff selbst<br />
stadtbekannt geworden – nicht als mittelmäßige Schauspielerin,<br />
son<strong>der</strong>n als durch und durch weltliche Ikone. Sie galt als eines <strong>der</strong><br />
Gesichter <strong>der</strong> jungen Generation.<br />
Wie nur wenige verkörperte sie einen neuen Typ Frau. Während<br />
viele noch über Reformklei<strong>der</strong> und Frisuren diskutierten und<br />
sich durch die Legionen so genannter Bubiköpfe irritieren ließen,<br />
experimentierte Ruth Landshoff bereits auf viel radikalere Weise<br />
mit den Geschlechterrollen. Mal zog sie in Männerklei<strong>der</strong>n durch<br />
die einschlägigen Cafés, mal posierte sie betont weiblich, im Pelz,<br />
mit Zigarette, Hündchen und Vollmoellers weißem Austro-Daimler<br />
vor <strong>der</strong> Kamera. Regelmäßig saß sie im Atelier von Frieda Riess<br />
am Kurfürstendamm Modell, die in dieser Zeit zu den beliebtesten<br />
Fotografinnen überhaupt zählte. Und Aufnahmen des Gesichts und<br />
<strong>der</strong> Hände von Ruth Landshoff waren es auch, die den Bauhaus-Fotografen<br />
Otto Maximilian Umbehr, <strong>der</strong> sich bald nur noch Umbo<br />
nannte, seit 1927 international stilbildend werden ließen.<br />
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Rolle <strong>der</strong><br />
Frau radikal neu definiert. Stefan Zweig prophezeite 1929 sogar, dass<br />
»die vollkommene Umwertung und Verwandlung <strong>der</strong> europäischen<br />
Frau um 1900« eine »zukünftige Kulturgeschichte« mehr beschäftigen<br />
würde als die zurückliegenden Kriegsereignisse.2 In kurzer Zeit<br />
wurde Ruth Landshoff gewissermaßen zum Poster-Girl einer Bewegung,<br />
die den Abtreibungsparagrafen 218 ebenso zur Disposition<br />
stellte wie die patriarchalische Ordnung insgesamt.<br />
Zum Schreiben fand sie, die schon als Kind im Haus des Verlegers<br />
Samuel Fischer ein- und ausging, erst später und wohl eher zufällig.<br />
Ihr erster Artikel erschien im November 1927 allerdings gleich in <strong>der</strong><br />
auflagenstarken Dame aus dem Ullstein Verlag und wurde großzügig<br />
honoriert. Die Presse florierte Ende <strong>der</strong> zwanziger Jahre, und Ruth<br />
Landshoff war als Journalistin viel erfolgreicher als auf <strong>der</strong> Bühne.<br />
Zudem erleichterte ihr die Literatur das Spiel mit den Rollen und<br />
Identitäten, das sie extrem faszinierte. Nachdem sie David Graf<br />
Yorck von Wartenburg geheiratet hatte, entdeckte sie auch für ihre<br />
wechselnden Künstlernamen ganz neue Möglichkeiten – bis hin zur<br />
amerikanisch klingenden Signatur Ruth L. Yorck, die sie später im<br />
Exil bevorzugte. Eigentlich hieß sie aber Ruth Levy, und Landshoff<br />
war <strong>der</strong> Geburtsname ihrer Mutter.<br />
Bezeichnend für das, was Ruth Landshoff bis zur Machtübernahme<br />
<strong>der</strong> Nationalsozialisten erreicht hatte, ist das Kurzporträt<br />
7
8<br />
eines anonymen Journalisten in <strong>der</strong> Illustrierten Das Leben aus<br />
dem November 1931. »Bitte, Rut ohne ›h‹«, heißt es dort. »Auch<br />
jung, Mitte Zwanzig. Universaltalent: Schriftstellerin – Dichterin –<br />
Malerin – Tänzerin – Bühnen- und Filmschauspielerin – Reiterin –<br />
Automobilistin – Motorradfahrerin. Hat Hausfrauenpflichten als<br />
Gräfin York von Wartenburg. Schrieb mit sieben (s-i-e-b-e-n) Jahren<br />
ihre ersten selbstillustrierten Geschichten, lernte im englischen Pensionat<br />
›viel Hockey, Ethik und wenig Geographie‹. Letzteres holte<br />
sie bald praktisch auf Auslandsreisen nach, malte zwei Jahre in Paris,<br />
betätigte sich dann und zwischendurch wie oben angegeben, schreibt<br />
seit drei Jahren über ihre Reisen und was ihr dabei auffällt, Gesellschaftsreportagen,<br />
über Theater, Film, eigenartige Menschen und<br />
Dinge – sehr natürlich, logisch und fesselnd. 1930 erschien ihr erster<br />
Roman: Die Vielen und <strong>der</strong> Eine, blendend geschrieben, stilistisch<br />
interessant und gedanklich von seltener Kühnheit.« 3<br />
Bei Erscheinen ihres Romandebüts im Rowohlt Verlag war Rut<br />
Landshoff, wie sie sich auf dem Umschlag nannte, ein Star. Zugleich<br />
war ihre Existenz voller Abgründe und stets gefährdet. Mit Blick auf<br />
eine Affäre mit dem Politiker und Reichsminister für Ernährung und<br />
Landwirtschaft, Gerhard Graf von Kanitz, verglich sie sich rückblickend<br />
sogar mit einem Callgirl.4 In ihrer Beziehung zu Vollmoeller<br />
traten neben allem Glamour zwischen Berlin, Wien, Paris und Venedig,<br />
neben Bekanntschaften mit Hugo von Hofmannsthal, Albert<br />
Einstein und Charlie Chaplin, um nur einige wenige zu nennen, und<br />
den Affären und Freundschaften mit Annemarie Schwarzenbach<br />
(siehe Foto S. 25), Francesco und Eleonora von Mendelssohn auch<br />
die dunkelsten Seiten ihres Lebens immer wie<strong>der</strong> deutlich zutage.<br />
Harry Graf Kessler spricht in seinem Tagebuch unverblümt von<br />
Vollmoellers »Harem am Pariser Platz«,5 den man sich zugleich als<br />
Casting-Studio für einige <strong>der</strong> wichtigsten Film- und Theaterproduktionen<br />
<strong>der</strong> Weimarer Republik vorstellen muss – bis hin zu Josef von<br />
Sternbergs Blauem Engel mit Marlene Dietrich, an dessen Drehbuch<br />
Vollmoeller maßgeblich beteiligt war. Was ihn selbst immer wie<strong>der</strong><br />
dorthin zog, verschweigt Kessler diskret.<br />
Ruth Landshoff fiel im System Vollmoeller die zweifelhafte Rolle<br />
zu, immer neue und immer jüngere Frauen in die Nähe des Mittvierzigers<br />
zu bringen. Die meisten von ihnen folgten vermutlich blind<br />
dem Traum einer Karriere als Theater- o<strong>der</strong> Filmschauspielerin.<br />
Dafür waren sie bereit, fast alles zu geben. Noch drastischer als<br />
Kessler und wahrscheinlich auch mit mehr Sinn für Übertreibungen<br />
schil<strong>der</strong>te <strong>der</strong> Drehbuchautor und Filmregisseur Géza von Cziffra,<br />
<strong>der</strong> in den <strong>Zwanziger</strong>n selbst zu Vollmoellers Schützlingen gehörte,<br />
diese Verhältnisse. Ruth Landshoff kam ihm damals »verhätschelt«<br />
und »verwöhnt« vor: »Sie war hübsch, reizvoll, das Schicksal hatte<br />
ihr viele Talente in den Schoß gelegt und, glücklicherweise, auch<br />
in ihr apartes Köpfchen. Männer und Frauen liebten sie, und sie<br />
liebte Männer und Frauen.« Vollmoeller habe sie »fast sklavisch«<br />
gedient. »Sie sammelte immer junge Mädchen um sich, sie sortierte<br />
sie, und die Auserwählten landeten in Vollmoellers Bett, <strong>der</strong> sie<br />
dann nach einer gewissen Zeit an seine Freunde weitergab. Wie<br />
einen gebrauchten Wagen. […] Wenn Vollmoeller mit <strong>der</strong> Landshoff<br />
und zwei, drei hübschen Mädchen in <strong>der</strong> Eden-Bar zum 5-Uhr-Tee<br />
erschien, raunten sich die Leute zu, sich <strong>der</strong> Autosprache bedienend:<br />
›Die Vollmoellers machen eine Probefahrt!‹«6<br />
Was man in Ruth Landshoffs 1963 veröffentlichten autobiografischen<br />
Skizzen für Angeberei halten könnte, entpuppt sich angesichts<br />
eines Teilnachlasses mit Briefen, Taschenkalen<strong>der</strong>n, Manuskripten<br />
und zahlreichen Fotos, <strong>der</strong> dem Deutschen Literaturarchiv erst 2016<br />
gestiftet wurde, als das Gegenteil: Sie, die bereits als Kind Thomas<br />
Mann und Gerhart Hauptmann begegnet war, lernte nach und nach<br />
in Berlin fast jeden bedeutenden Schriftsteller, Künstler, Regisseur<br />
und Schauspieler kennen. Gut zehn Jahre lebte sie mitten in <strong>der</strong><br />
experimentierfreudigsten und aufregendsten Szene Europas, bis die<br />
Nazis Berlin zurück in die Provinzialität zwangen und Ruth Lands-<br />
9
10<br />
hoff aufgrund ihres jüdischen Familienhintergrundes emigrieren<br />
musste. Über Frankreich, England und die Schweiz führte ihr Weg<br />
nach New York. Dort traf sie viele ihrer Freunde und Bekannten<br />
wie<strong>der</strong>. Dennoch fiel es ihr zunächst schwer, in den USA Fuß zu<br />
fassen. Obwohl sie bald auf Englisch publizierte, war ihr Alltag<br />
geprägt von finanziellen Engpässen. Dies än<strong>der</strong>te sich erst durch<br />
neue wohlhabende Freunde, allen voran durch den Librettisten John<br />
Latouche (1914–1956) und den Lyriker Kenward Elmslie (geb. 1929),<br />
die sie fortan in Krisenzeiten unterstützten.<br />
Kenward Elmslie begleitete Ruth Landshoff 1959 auch nach<br />
Marbach auf die Schillerhöhe. Dort fuhren die beiden in einem exklusiven<br />
Mercedes-Cabriolet vor, das <strong>der</strong> Pulitzer-Enkel Elmslie einige<br />
Monate zuvor erstanden hatte. Auf den Direktor Bernhard Zeller<br />
muss Ruth Landshoff wie eine Wie<strong>der</strong>gängerin aus den turbulenten<br />
Jahren <strong>der</strong> Berliner Boheme gewirkt haben, wie eine Botschafterin<br />
jener Ära, die schon bald einer <strong>der</strong> wichtigen Sammlungsschwerpunkte<br />
des noch jungen Deutschen Literaturarchivs werden sollte.<br />
Unter dem 11. Mai 1959 notierte Ruth Landshoff in ihrem Taschenkalen<strong>der</strong>,<br />
dass sie dem Schiller-Nationalmuseum »KV-Sachen« übergeben<br />
habe. ›KV‹ stand für den in Stuttgart geborenen Vollmoeller,<br />
dessen Familie einen großen Teil seines literarischen Nachlasses in<br />
Beilstein aufbewahrt hatte, bis ihn Ruth Landshoff dem <strong>Marbacher</strong><br />
Archiv anvertraute. »Lei<strong>der</strong> war das Gespräch viel zu kurz, um den<br />
weiten Umkreis des Lebens von Ruth Landshoff-York auch nur vage<br />
zu ermessen«, bedauert Zeller in seinen <strong>Marbacher</strong> Memorabilien.7<br />
Eine Spur dieser Tage findet sich auch in Ruth Landshoffs veröffentlichten<br />
Erinnerungen. »Ich habe gerade einige Wochen auf dem<br />
Land gelebt, in Beilstein«, heißt es dort. »Das Haus war hübsch, die<br />
Landschaft mit ihren sanft abfallenden alten Hügeln bezaubernd,<br />
die alten Dächer <strong>der</strong> dörflichen Häuser schön und lieblich, und die<br />
Ordnung <strong>der</strong> schlafenden Weinhügel und Gärten beruhigend. […]<br />
Auf dem Schloß Beilstein ist <strong>der</strong> Dichter Karl Vollmöller geboren,<br />
und dort hat er einen großen Teil seiner Jugend verbracht. Nach<br />
seinem Tode bewahrte man dort seine Schriften auf, was noch übriggeblieben<br />
ist nach Feuer und Bomben und an<strong>der</strong>n Verlusten.«8<br />
Vollmoellers Erbe war ihr alles an<strong>der</strong>e als gleichgültig. Mit Bernhard<br />
Zeller vereinbarte sie nicht nur die Übergabe seiner Papiere<br />
an das Archiv. Sie verhandelte auch über eine Auswahl seiner nachgelassenen<br />
Gedichte, die 1960 in <strong>der</strong> Turmhahn-Bücherei für die<br />
Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Deutschen Schillergesellschaft erschien. Das kurze<br />
Nachwort dazu steuerte <strong>der</strong> Hofmannsthal-Herausgeber Herbert<br />
Steiner bei, <strong>der</strong> mit Vollmoeller in den USA in Verbindung stand.<br />
»Vollmoeller war Schwabe«, schrieb Steiner nicht ohne Blick auf sein<br />
Publikum: die Vereinsmitglie<strong>der</strong>. »Seine Liebe galt dem Alten Reich,<br />
nicht dem von 1871, dem alten deutschen und württembergischen<br />
Wesen. Und er war Kosmopolit […] – er hatte in vielen Län<strong>der</strong>n<br />
gelebt, in Griechenland, Paris, Italien, Berlin, Kalifornien. Vielfältig<br />
und reich begabt, hatte er sich nicht nur im Wort ausgesprochen, er<br />
hatte sich früh und leidenschaftlich mit den neuen Möglichkeiten<br />
<strong>der</strong> Zeit befaßt, mit dem Bau von Rennwagen und Flugzeugen, als<br />
einer <strong>der</strong> ersten, und ebenso leidenschaftlich mit dem Theater«.9<br />
Steiner rief die berühmtesten Freunde und Bekannten von Vollmoeller<br />
in Erinnerung: Stefan George, Hugo von Hofmannsthal<br />
und Richard Strauss ebenso wie Gabriele D’Annunzio. Über das ausschweifende<br />
Leben am Pariser Platz und im altehrwürdigen Palazzo<br />
Vendramin am Canale Grande, den <strong>der</strong> reiche »Schwabe« bis 1938<br />
zu seinem Hauptwohnsitz gemacht hatte, verlor er selbstverständlich<br />
kein Wort.<br />
Der Nachlass <strong>der</strong> am 19. Januar 1966 an den Folgen eines Herzinfarkts<br />
gestorbenen Ruth Landshoff dokumentiert diese an<strong>der</strong>e<br />
Seite von Vollmoellers Existenz beson<strong>der</strong>s reichhaltig – den Dandy<br />
und Bohemien, aber auch den Antifaschisten, <strong>der</strong> im Frühjahr 1939<br />
in die USA emigrierte. Dort wurde er Silvester 1941 vom FBI festgenommen<br />
und als ›Internee of War‹ zu Unrecht verdächtigt, mit<br />
11
12<br />
den Nationalsozialisten gemeinsame Sache gemacht zu haben. Bis zu<br />
seiner Freilassung vergingen 13 Monate. Mit den gesundheitlichen<br />
Folgen <strong>der</strong> Haft kämpfte er bis zu seinem Tod am 18. Oktober 1948<br />
in Hollywood.<br />
Nach Ruth Landshoffs Tod verging fast ein halbes Jahrhun<strong>der</strong>t,<br />
bis Kenward Elmslie zusammen mit dem Lyriker Ron Padgett ihre<br />
Papiere in seiner New Yorker Wohnung wie<strong>der</strong>entdeckte und nach<br />
Marbach bringen ließ. Ein zweiter Teilnachlass, <strong>der</strong> überwiegend<br />
Manuskripte zu veröffentlichten Arbeiten und einer nicht abgeschlossenen<br />
Autobiografie enthält, wird im Archivzentrum <strong>der</strong> Boston<br />
University aufbewahrt.<br />
RUTH LANDSHOFF<br />
Fotografien von Karl Vollmoeller<br />
Berlin / Venedig<br />
1 Ruth Landshoff-Yorck, Klatsch, Ruhm und kleine Feuer. Biographische <strong>Im</strong>pressionen,<br />
Köln / Berlin 1963, S. 88 f. 2 Stefan Zweig, »Zutrauen zur Zukunft«, in: Die Frau<br />
von morgen wie wir sie wünschen, hrsg. von F. M. Hübner, mit einem Vorw. von Silvia<br />
Bovenschen, Frankfurt a. M. 1990, S. 25. 3 Das Leben 9 (1931 / 32), H. 5, November, S. 22.<br />
4 Vgl. Thomas Blubacher, Die vielen Leben <strong>der</strong> Ruth Landshoff-Yorck, Berlin 2015, S. 91.<br />
5 Harry Graf Kessler, Das Tagebuch, Bd. 8: 1923–1926, hrsg. von Angela Reinthal,<br />
Günter Rie<strong>der</strong>er und Jörg Schuster unter Mitarb. von Janna Brechmacher, Christoph<br />
Hilse und Nadin Weiß, Stuttgart 2009, S. 727. 6 Géza von Cziffra, Kauf dir einen bunten<br />
Luftballon. Erinnerungen an Götter und Halbgötter, München / Berlin 1975, S. 169; vgl.<br />
Blubacher (Anm. 4), S. 89. 7 Bernhard Zeller, <strong>Marbacher</strong> Memorabilien. Vom Schiller-<br />
Nationalmuseum zum Deutschen Literaturarchiv. 1953–1973, Marbach a. N. 1995, S. 359.<br />
In <strong>der</strong> Registratur <strong>der</strong> Deutschen Schillergesellschaft findet sich <strong>der</strong> Briefwechsel<br />
zwischen Ruth Landshoff-Yorck und Bernhard Zeller aus den Jahren 1959 bis 1966,<br />
in dem es auch um Vollmoellers Gefangenschaft in den USA geht. <strong>Im</strong> Juli 1959 erinnert<br />
sich Landshoff-Yorck, bei <strong>der</strong> Verteidigung Vollmoellers sei es darum gegangen,<br />
Menschen, die »nicht viel ueber Verhaeltnisse in Deutschland« wissen, zu beweisen,<br />
»dass Karl Vollmoeller unfaehig war[,] etwas zu tun[,] was einer democratischen<br />
Gemeinschaft schaedlich werden koennte«. 8 Landshoff-Yorck (Anm. 1), S. 221–222.<br />
9 Karl Vollmoeller, Gedichte. Eine Auswahl, Marbach a. N. 1960, S. 111 f.
DAS UNGEHEUER<br />
ZÄRTLICHKEIT<br />
33<br />
Zu Vollmoellers bevorzugten Beschäftigungen gehörte es, junge<br />
Frauen aus seinem Umfeld zu fotografieren. In den zwanziger Jahren,<br />
als sich noch kaum ein Amateur eine Kamera leisten konnte, verfügte<br />
er bereits über eine hochwertige Ausrüstung. Aktaufnahmen<br />
gehörten zu seinen favorisierten Sujets. Ruth Landshoff hat <strong>der</strong>en<br />
Negative zu Hun<strong>der</strong>ten aufbewahrt. Sie fanden sich 2016 in ihrem<br />
New Yorker Nachlass. Die meisten von ihnen zeigen sie selbst in<br />
Berlin o<strong>der</strong> im Palazzo Vendramin, oft auch unter freiem Himmel am<br />
Lido di Venezia. Eine umfangreiche Serie Vollmoellers gilt <strong>der</strong> 1900<br />
geborenen Schauspielerin Grit Haid, die in einigen Produktionen<br />
von Max Reinhardt mitwirkte und 1938 bei einem Flugzeugabsturz<br />
ums Leben kam. Eine weitere Serie entstand vermutlich im Februar<br />
1926 im Zuge des ersten Berliner Engagements von Josephine Baker.<br />
Damals war die Tänzerin aus St. Louis – anziehend und »prachtvoll«,<br />
wie Thea Sternheim in ihrem Tagebuch bemerkt1 – keine 20<br />
Jahre alt. Sie stand am Anfang ihrer Weltkarriere. Als das Jazz Age<br />
auch die europäische Jugend in seinen Bann zog, hatte Vollmoeller<br />
sie in New York kennengelernt und ihr Engagements in Paris und<br />
Berlin vermittelt. Nun trat sie wochenlang in <strong>der</strong> als Sensation gefeierten<br />
›Revue Nègre‹ am Kurfürstendamm auf – und mitunter vor<br />
privaten Gästen am Pariser Platz.<br />
Manchmal ruhte sie sich dort aber auch einfach nur aus. Géza<br />
von Cziffra erinnerte sich, sie bei Vollmoeller getroffen zu haben.
34<br />
Allerdings: »Sie tanzte nicht, sie saß in einer Ecke und aß Unmengen<br />
von Bockwürsten mit Kartoffelsalat. Das tat sie hier während ihres<br />
Berliner Gastspiels jeden Abend.«2<br />
Die bekanntesten Berichte über Vollmoeller und Baker stehen<br />
im Tagebuch von Harry Graf Kessler unter dem 13. und 24. Februar<br />
1926. Am ersten Abend habe Kessler um ein Uhr morgens einen Telefonanruf<br />
seines Freundes Max Reinhardt erhalten, ob er nicht noch<br />
an den Pariser Platz kommen wolle. Kesslers bemüht hemdsärmelige<br />
Schil<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Erlebnisse dieser Nacht machen deutlich, dass<br />
nicht nur Vollmoeller junge Schauspielerinnen und Tänzerinnen wie<br />
Material behandelte. Aus heutiger Sicht wirken seine Aufzeichnungen<br />
herablassend, sexistisch und in Bezug auf Josephine Baker offen<br />
rassistisch. In ihnen zeigt sich <strong>der</strong> ansonsten so unkonventionelle<br />
Graf ganz als Kind seiner Zeit. Zugleich begeisterte er sich <strong>der</strong>maßen<br />
für Baker, dass er umgehend eine Pantomime für sie und Ruth<br />
Landshoff entwarf. Letztere versah er, ganz Grandseigneur, meist<br />
mit dem Attribut »klein«.<br />
Reinhardt sollte das Stück inszenieren – ein wenig scheint Kessler<br />
dabei auch den Welterfolg Das Mirakel im Hinterkopf gehabt zu<br />
haben – und Kurt Weill die Musik beisteuern. Zu alledem kam es<br />
jedoch nie. Das Skript verschwand in <strong>der</strong> Schublade und findet sich<br />
heute in Kesslers <strong>Marbacher</strong> Nachlass. Wie ernst er diesen Plan<br />
seinerzeit nahm, erfuhr sogar Ruth Landshoff erst aus seinem postum<br />
veröffentlichten Tagebuch. Sie las es, während sie ihre eigenen<br />
Erinnerungen zu Papier brachte. Und nicht ohne Überraschung<br />
musste sie feststellen, dabei »etwas über jemanden« zu erfahren, <strong>der</strong><br />
ihr sehr nahestand, nämlich über sich selbst.3<br />
»Miss Baker sei da«, notiert Kessler am 13. Februar 1926, »und<br />
nun sollten noch fabelhafte Dinge gemacht werden.« Ruth Landshoff<br />
bekommt diese Passage in <strong>der</strong> Auswahlausgabe von 1961 zu Gesicht,<br />
aber folgen wir Kessler weiter: »Ich fuhr also zu Vollmoeller in seinen<br />
Harem am Pariser Platz u. fand dort ausser Reinhardt u. [Paul]<br />
Huldschinsky zwischen einem halben Dutzend nackter Mädchen<br />
auch Miss Baker, ebenfalls bis auf einen rosa Mull Schurz völlig<br />
nackt, und die kleine Lanshoff (eine Nichte von Sammy Fischer) als<br />
Junge im Smoking. Die Baker tanzte mit äusserster Groteskkunst<br />
und Stilreinheit; wie eine ägyptische o<strong>der</strong> archaische Figur, die Akrobatik<br />
triebe, ohne je aus ihrem Stil herauszufallen. So müssen die<br />
Tänzerinnen Salomos und Tutankhamons getanzt haben.«<br />
Bemerkenswert, wie künstlich sich <strong>der</strong> Chronist durch Kennerschaft<br />
und klassische Bildung von einem Geschehen distanziert, das<br />
ihn vermutlich ganz einfach fasziniert, wenn nicht überwältigt hat.<br />
Dabei wird seine Beschreibung immer minutiöser. Beson<strong>der</strong>s for<strong>der</strong>t<br />
ihn Ruth Landshoffs Androgynität heraus: Josephine Baker tanze<br />
»stundenlang scheinbar ohne Ermüdung, immer neue Figuren erfindend,<br />
wie im Spiel, wie ein glückliches Kind. Sie wird dabei nicht<br />
einmal warm, son<strong>der</strong>n behält eine frische, kühle, trockene Haut.<br />
Ein bezauberndes Wesen, aber fast ganz unerotisch. Man denkt bei<br />
ihr an Erotik ebensowenig wie bei einem schönen Raubtier. Die<br />
nackten Mädchen lagen o<strong>der</strong> tänzelten zwischen den vier o<strong>der</strong> fünf<br />
Herren im Smoking herum und die kleine Lanshoff, die wirklich<br />
wie ein bildschöner Junge aussieht, tanzte mit <strong>der</strong> Baker mo<strong>der</strong>ne<br />
Jazztänze zum Grammophon. […] Zwischen Reinhardt, Vollmoeller<br />
u. mir, die darum herumstanden, lagen die Baker u. die Lanshoff<br />
wie ein junges bildschönes Liebespaar umschlungen. Ich sagte: ich<br />
würde für sie eine Pantomime nach den Motiven des Hohen Liedes<br />
Salomonis schreiben, die Baker als Sulamith, die Lanshoff als Salomo<br />
o<strong>der</strong> als <strong>der</strong> junge Liebhaber <strong>der</strong> Sulamith, die Baker im Kostüm<br />
(o<strong>der</strong> nicht-Kostüm) orientalisch antik, Salomo im Smoking, eine<br />
ganz willkürliche, mo<strong>der</strong>n-antike Phantasie nach halb Jazz- halb<br />
orientalischer Musik, vielleicht von Richard Strauss.«4<br />
Vollmoellers wie<strong>der</strong>entdeckte Aufnahmen von Josephine Baker<br />
liefern gleichsam die Filmspur zu jenen orientalistischen Schwelgereien,<br />
die Kessler wochenlang beschäftigen; wahrscheinlich nicht<br />
35
36<br />
zuletzt, weil er die erotische Ausstrahlung, die er Josephine Baker<br />
abspricht, bei Vollmoellers junger Geliebten umso stärker empfindet.<br />
Am 24. Februar sieht er die beiden Protagonistinnen seiner<br />
erträumten Pantomime in großer Runde bei sich zu Hause wie<strong>der</strong>.<br />
Ruth Landshoff wirkt auf ihn diesmal noch männlicher und noch<br />
verführerischer: »im Smoking sehr hübsch, wie ein Junge aussehend,<br />
was sie noch durch eine Hornbrille unterstrich und aufgeschminkte<br />
Andeutung schwarzen Bartflaums«.5 Josephine Baker hingegen, die<br />
gegen Mitternacht hinzustößt, enttäuscht ihn zunächst, denn sie<br />
benimmt sich nur allzumenschlich: Die »kleine Negertänzerin«, für<br />
die Kessler eigens »sein Bibliothekszimmer ausgeräumt« hat, wirkt<br />
erschöpft und mag sich verständlicherweise nicht vorführen lassen<br />
wie ein Automat. Kessler meint, sie sei »offenbar verschüchtert in<br />
ihrer Nacktheit vor den ›Damen‹«, also den an<strong>der</strong>en anwesenden<br />
Frauen.<br />
Den Abend rettete, wenn wir Kessler glauben dürfen, <strong>der</strong> von<br />
sich selbst ebenso hingerissen war wie von Josephine Baker, erst <strong>der</strong><br />
Entwurf für seine Pantomime. Flugs sei die Tänzerin von seinem<br />
Szenario begeistert gewesen, ganz so, als hätte sie nur auf einen<br />
Mann wie ihn gewartet, auf seinen erlösenden <strong>Im</strong>puls, mit dem er<br />
sie zurück in ihr ureigenes Element stieß: »Die Baker war wie verwandelt;<br />
drängte, wann sie das tanzen könne? Dann machte sie einige<br />
Bewegungen, stark u. ausdrucksvoll grotesk, vor <strong>der</strong> grossen Maillol<br />
Figur. Offenbar setzte sie sich mit dieser auseinan<strong>der</strong>; sah sie lange<br />
an; machte ihre Stellung nach, lehnte sich in grotesken Stellungen<br />
an sie an, sprach mit ihr, sichtbar beunruhigt von <strong>der</strong> ungeheuren<br />
Starre und Wucht des Ausdrucks, tanzte um sie in grotesk grandiosen<br />
Bewegungen herum wie eine kindlich spielende, über sich selbst und<br />
ihre Göttin sich lustig machende Priesterin. Man sah: <strong>der</strong> Maillol war<br />
für sie viel interessanter und lebendiger als die Menschen, als Max<br />
Reinhardt, Vollmoeller, Harden, ich. Genie (denn sie ist ein Genie<br />
<strong>der</strong> Grotesk-Bewegung) sprach zu Genie. Dann brach sie plötzlich<br />
ab und tanzte ihre Negertänze u. Karikaturen von allerlei Bewegungen.«6<br />
– Gewissermaßen das gesamte kollektive Bildgedächtnis<br />
amalgamierend, erinnerte ihn Baker in ihrer leidenschaftlichen<br />
<strong>Im</strong>provisation zugleich an ägyptische Reliefs und an mechanische<br />
Puppen von George Grosz.<br />
An<strong>der</strong>ntags, am 28. Februar 1926, wirkt Kessler ernüchtert. Er<br />
hatte ebenfalls mit ansehen müssen, wie Baker bei Vollmoeller ihrer<br />
Leidenschaft für Bockwürste frönte, sie liebevoll »hot dogs« nannte<br />
und das auch noch in einer Gesellschaft, »wo Niemand wusste, wer<br />
<strong>der</strong> Andre war, und aus <strong>der</strong> nur seine sehr reizende Geliebte, Fräulein<br />
Lanshoff (wie<strong>der</strong> in Männerklei<strong>der</strong>n) hervorragte«. Kessler schreckten<br />
am Pariser Platz die »Frauen in allen Stadien <strong>der</strong> Nacktheit«<br />
ab, von denen er nicht wusste, »ob es ›Freundinnen‹, Nutten o<strong>der</strong><br />
Damen«7 waren.<br />
An diesem Tag erschien ihm die »Atmosphäre« um den Hausherrn<br />
fast tragisch, zumal Vollmoeller seit Jahren sein großes dichterisches<br />
Talent verspielt hätte. Dass Frauen wie Josephine Baker<br />
und Ruth Landshoff eine neue Epoche <strong>der</strong> wirklichen Emanzipation<br />
vorbereiteten, konnte Kessler nicht sehen. Es wäre ihm wohl auch<br />
nicht in den Sinn gekommen. Doch immerhin hatte er ein Gespür<br />
für die Kehrseite des Glitzerlebens, das Vollmoeller Ruth Landshoff<br />
ermöglichte, immerhin ahnte er den Preis ihres Ruhms.<br />
Das Ungeheuer Zärtlichkeit nannte sie ihr erstes Buch, das nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verlegt werden konnte.<br />
Der schmale Band mit Erzählungen eröffnete 1952 die von Alfred<br />
An<strong>der</strong>sch herausgegebene Reihe ›studio frankfurt‹, in <strong>der</strong> er 1953<br />
auch Die gestundete Zeit veröffentlichte, das Debüt von Ingeborg<br />
Bachmann. Landshoffs Titelerzählung handelt – durchaus kafkaesk<br />
und zugleich wie ein menschenfreundliches Vorspiel zu Ira Levins<br />
Bestseller Rosemary’s Baby von 1967 – von einer »wun<strong>der</strong>schönen«<br />
Frau, die eines Tages ein »Tier« zur Welt bringt und dieses beglückt<br />
als ihr Baby annimmt, mitsamt seinen »langfingrigen« Greiffüßen.8<br />
37
38<br />
Das kleine, fremdartige Wesen wird auf den Namen »Zärtlichkeit«<br />
getauft.9<br />
Dieses zwischen Erfüllung und Katastrophe changierende, schwer<br />
zu begreifende Ungeheuer »Zärtlichkeit« könnte als Sinnbild über<br />
Ruth Landshoffs gesammelten Hinterlassenschaften stehen: über<br />
den Liebesbriefen, Gedichtentwürfen und auch über den Fotografien,<br />
die ihre unglaubliche Vergangenheit in Erinnerung rufen. Es sind<br />
die Spuren einer Frau, die sich über lange Jahre hinweg von ihren<br />
Gefühlen, von ihrer »Zärtlichkeit« lenken ließ, die sich stets auf ihre<br />
Ausstrahlung, ihr jugendliches Charisma und ihre Schönheit verließ,<br />
bis sie sich im Exil als politische Autorin neu erfand – einer öffentlichen<br />
Person, die eine radikale erotische Befreiung zu verkörpern<br />
schien und sich selbst zum Kunstwerk machte. Doch selbstverständlich<br />
musste auch sie das Zerstörerische, Erniedrigende und Brutale<br />
erfahren, das eine von allen Tabus befreite Sexualität mit sich bringt.<br />
Nicht zuletzt dies machen Vollmoellers Aktaufnahmen anschaulich,<br />
die dem Pornografischen keinesfalls ausweichen. <strong>Im</strong> Gegenteil: Dem<br />
Dilettanten scheint es beim Fotografieren in erster Linie um das<br />
entfesselte Begehren zu gehen. Die Posen seiner Modelle sind meist<br />
stereotyp und erinnern an populäre Bildnisse des frühen 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
Momente künstlerischer Gestaltung bleiben die Ausnahme.<br />
Und gerade in ihrer Hemmungslosigkeit, die den Fotografen nicht<br />
weniger entblößt als seine Modelle, werden sie zu seltenen Dokumenten<br />
aus dem <strong>Schattenreich</strong> einer frühen sexuellen Revolution,<br />
die den Aufbrüchen um 1968 in nichts nachstand.<br />
JOSEPHINE BAKER<br />
Fotografien von Karl Vollmoeller<br />
Berlin, 1926<br />
1 Thea Sternheim, Tagebücher 1903–1971, hrsg. und ausgew. von Thomas Ehrsam<br />
und Regula Wyss i. A. <strong>der</strong> Heinrich Enrique Beck-Stiftung, Bd. 2, Göttingen 2011, S. 18.<br />
2 Géza von Cziffra, Kauf dir einen bunten Luftballon. Erinnerungen an Götter und<br />
Halbgötter, München/Berlin 1975, S. 165. 3 Ruth Landshoff-Yorck, Klatsch, Ruhm und<br />
kleine Feuer. Biographische <strong>Im</strong>pressionen, Köln / Berlin 1963, S. 104. 4 Harry Graf<br />
Kessler, Das Tagebuch, Bd. 8: 1923–1926, hrsg. von Angela Reinthal, Günter Rie<strong>der</strong>er und<br />
Jörg Schuster unter Mitarb. von Janna Brechmacher, Christoph Hilse und Nadin Weiß,<br />
Stuttgart 2009, S. 727 f. 5 Ebd., S. 738. 6 Ebd., S. 739. 7 Ebd., S. 740. 8 Ruth<br />
Landshoff-Yorck, Das Ungeheuer Zärtlichkeit, Frankfurt 1952, S. 83. 9 Ebd., S. 85.
WIE FOTOGRAFIERTE<br />
VOLLMOELLER?<br />
von Chris Korner<br />
51<br />
Von den meisten Fotos finden sich in Ruth Landshoffs Nachlass keine<br />
Abzüge. Überliefert sind großformatige Negative zu Bil<strong>der</strong>n, die in<br />
den Jahren vor 1933 größtenteils von Karl Vollmoeller aufgenommen<br />
wurden. Das von ihm bevorzugte Filmmaterial hat das Format<br />
9 × 14,5 cm. Hierbei handelt es sich um so genannte Planfilme in<br />
Form von einzelnen Negativblättern, die bei absoluter Dunkelheit<br />
in spezielle Filmkassetten geladen wurden. Pro Kassette konnte ein<br />
Bild aufgenommen werden. Anschließend musste eine neue Kassette<br />
in die Kamera eingelegt werden.<br />
Nach dem Belichten wurden die Planfilme im Dunkeln aus den<br />
Kassetten genommen, in lichtdichte Pappschachteln verpackt und<br />
dann zum Entwickeln gebracht. Dies übernahmen meist örtliche<br />
Fotogeschäfte – Vollmoeller fühlte sich z. B. <strong>der</strong> namhaften Gesellschaftsfotografin<br />
Frieda Riess freundschaftlich verbunden, die ihr<br />
Berliner Atelier unweit <strong>der</strong> Gedächtniskirche hatte.<br />
Das Filmmaterial – Schwarz-Weiß-Negativfilm mit relativ geringer<br />
Lichtempfindlichkeit – hat aus heutiger Sicht einige Tücken: Die<br />
Trägerschicht bestand seit Ende des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts bis Anfang <strong>der</strong><br />
1950 er-Jahre aus Nitrozellulose, oft auch Zelluloid genannt. Nitrozellulose<br />
wurde aus Schwefel- und Salpetersäure sowie Baumwollresten<br />
hergestellt und ist auch als ›Schießbaumwolle‹ bekannt. Wie <strong>der</strong><br />
Name schon sagt, ist das Material hochexplosiv und zudem einem<br />
latenten, unaufhaltbaren Zersetzungsprozess unterworfen. Deshalb
52<br />
dürften in einigen Jahrzehnten überhaupt keine historischen Nitronegative<br />
mehr existieren.<br />
Vollmoeller fotografierte mit einer Laufbodenkamera, die durch<br />
eine simple Mechanik zu einem kompakten Kästchen mit Handschlaufe<br />
zusammengeklappt werden konnte. <strong>Im</strong> Volksmund hießen<br />
diese Kameras ›Faltkamera‹. Sie gaben dem Amateurfotografen<br />
die Möglichkeit, ohne umfangreiche Ausrüstung und mit geringem<br />
Aufwand gute Ergebnisse zu erzielen. Die von zahlreichen Manufakturen<br />
hergestellten Kameras bestehen aus einer Halterung für die<br />
Filmkassette, die über einen Faltbalgen mit dem Objektiv verbunden<br />
ist, einem Sucher und dem Laufboden, auf dem <strong>der</strong> gesamte Aufbau<br />
hin und her bewegt werden kann.<br />
Für die Aufnahmen in seinen Wohnungen in Berlin und Venedig<br />
verwendete Vollmoeller ein Holzstativ (siehe Foto rechts) und<br />
elektrische Lampen. Ohne diese Hilfsmittel wären Fotos ohne Verwackelungsunschärfe<br />
fast unmöglich gewesen, denn die damaligen<br />
Objektive verfügten über eine geringe Lichtstärke und zahlreiche<br />
Abbildungsfehler. Die Kombination aus unzulänglicher Qualität <strong>der</strong><br />
Objektive und dem zur Verfügung stehenden Filmmaterial verschafft<br />
den Aufnahmen allerdings eine ganz eigene Anmutung: Hauttöne<br />
und Lichtverläufe erscheinen weicher. Mangels absoluter Tiefenschärfe<br />
fehlt den Bil<strong>der</strong>n die technische Oberflächlichkeit späterer<br />
Fotos: Sie wirken authentischer.<br />
Zwischen 1910 und 1930 wurden Laufbodenkameras vor allem<br />
von ambitionierten Amateuren und Pressefotografen verwendet. Mit<br />
dem von Oskar Barnack bei Leitz in Wetzlar entwickeltem Kleinbildsystem<br />
(Leica), das die Verwendung von 35 mm-Kinofilm in Patronen<br />
ermöglichte, endete die Ära dieses Kameratyps. Nur im Bereich <strong>der</strong><br />
professionellen Architekturfotografie werden auch heute noch technisch<br />
weiterentwickelte Laufbodenkameras verwendet.<br />
Die wahrscheinlich am Pariser Platz in Berlin entstandene<br />
Spiegelaufnahme zeigt nicht nur die Schauspielerin Grit Haid,<br />
son<strong>der</strong>n hinter <strong>der</strong> Kamera auch Karl Vollmoeller selbst. ›››
AUF DEN SPUREN EINER<br />
AVANTGARDISTIN<br />
Ein Gespräch mit Ruth Landshoff-Yorcks<br />
Biografen Thomas Blubacher<br />
55<br />
Thomas Blubacher ist Regisseur, Buchautor und Theaterwissenschaftler.<br />
Er arbeitete an Bühnen in <strong>der</strong> Schweiz, Deutschland, Österreich<br />
und den USA, inszenierte Hörspiele und Radiofeatures.<br />
Seine Feuilletons erschienen u. a. in <strong>der</strong> Süddeutschen Zeitung, <strong>der</strong><br />
Zeit und <strong>der</strong> Neuen Zürcher Zeitung. 2008 veröffentlichte er eine<br />
Doppelbiografie über die Geschwister Eleonora und Francesco von<br />
Mendelssohn, 2013 folgte eine umfangreiche Biografie über Gustaf<br />
Gründgens, und zwei Jahre später publizierte er Die vielen Leben<br />
<strong>der</strong> Ruth Landshoff-Yorck, die bislang einzige ausführliche Lebensbeschreibung<br />
über die 1904 in Berlin geborene und 1966 in New York<br />
verstorbene Schriftstellerin und Schauspielerin.<br />
Die Fragen stellte Jan Bürger.<br />
Wie sind Sie dazu gekommen, Biografien zu schreiben?<br />
Thomas Blubacher: Am Anfang stand 1999 ein schmales Bändchen<br />
über Gustaf Gründgens in <strong>der</strong> Edition Colloquium. Der Umfang<br />
war extrem begrenzt, aber diese Arbeit führte mich zu meinen<br />
späteren Projekten. Durch Gründgens stieß ich auf Francesco von<br />
Mendelssohn und merkte, dass es über ihn keine Literatur gab, dass<br />
man nicht mal sein Todesdatum kannte, obwohl er doch als Regisseur<br />
zwei Stücke von Ödon von Horváth uraufgeführt und Brechts<br />
Dreigroschenoper erstmals am Broadway inszeniert hatte. Francesco<br />
von Mendelssohn wie<strong>der</strong>um gehörte zu den engsten Freunden von<br />
Ruth Landshoff-Yorck.
56<br />
Es war also theatergeschichtliche Pionierarbeit zu leisten.<br />
Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, zum 100. Geburtstag von Francesco<br />
ein größeres Feuilleton zu schreiben. Daraus entstand 2002 ein<br />
Radiofeature, das von zahlreichen Rundfunkanstalten ausgestrahlt<br />
wurde. Und nach insgesamt acht Jahren Recherche konnte ich dann<br />
eine Biografie über die Geschwister Mendelssohn veröffentlichen,<br />
also auch über Eleonora. In bei<strong>der</strong> Leben spielte Ruth Landshoff<br />
eine wesentliche Rolle: Francesco verlobte sich einst zum Spaß mit<br />
Ruth, die sich später wie<strong>der</strong>um in Eleonora verliebte.<br />
Sie verlobten sich?<br />
Ach, das gab man halt so bekannt. Francesco und Ruth waren<br />
ein zwillingshaftes Paar. Sie zogen zusammen als Crossdresser durch<br />
Berlin, während Eleonora wohl wirklich eine große Liebe von Ruth<br />
Landshoff war, wenn auch eine unerwi<strong>der</strong>te. Zu Ruth Landshoffs<br />
50. Todestag, das war <strong>der</strong> äußere Anlass, habe ich dann eine Biografie<br />
über sie im Insel Verlag herausgebracht.<br />
Ruth Landshoffs Freundes- und Bekanntenkreis war Ihnen also<br />
schon vorher präsent: Gründgens und die Mann-Kin<strong>der</strong>, die<br />
Mendelssohns, die Sternheims – und Kurt Weill winkte sozusagen<br />
auch schon aus <strong>der</strong> Ferne. Erscheint Ihnen Ruth Landshoff vor<br />
diesem Hintergrund vor allem eine Projektionsfigur zu sein?<br />
Sind ihre eigenen Werke überhaupt so wichtig?<br />
Angesichts ihres Lebens hatte ich anfangs an den Grafen Kessler<br />
gedacht, dem man nachsagt, 10.000 Prominente gekannt zu haben.<br />
Ruth Landshoff konnte ihm da durchaus Konkurrenz machen; nicht<br />
zufällig war Klatsch, Ruhm und kleine Feuer das einzige große, umfangreiche<br />
Buch, das sie nach 1945 in Deutschland publizieren konnte,<br />
also ihre biografischen <strong>Im</strong>pressionen prominenter Freunde. Ihr<br />
Netzwerk hat für ihre Selbstvermarktung eine große Rolle gespielt.<br />
Aber im Zuge <strong>der</strong> Arbeit an ihrer Biografie habe ich mich natürlich<br />
auch für ihre eigenen literarischen Arbeiten interessiert – die mich<br />
mehr und mehr fasziniert haben.<br />
Was sollte man von ihr lesen?<br />
Die Feuilletons aus den zwanziger Jahren haben Esprit; sie sind<br />
amüsant und auch heute noch lesenswert, nicht zuletzt wegen ihres<br />
unkonventionellen Blickes auf die Geschlechter. Die Exilromane stellen<br />
in ihrem politischen Engagement wichtige Zeitdokumente dar.<br />
Aber am meisten begeistern mich persönlich <strong>der</strong> 1948 erschienene<br />
Roman So Cold the Night und die literarisch ambitionierten Kurzgeschichten<br />
<strong>der</strong> fünfziger Jahre. Mit meinem Background als Theaterregisseur<br />
interessiert mich Ruth Landshoff natürlich nicht zuletzt<br />
als – wenn ich jetzt sage Übermutter, hätte sie wahrscheinlich laut<br />
aufgeschrien –, also sozusagen als Spiritus Rector des Off-Off-Broadway<br />
<strong>der</strong> sechziger Jahre, des Caffe Cino und des La MaMa Experimental<br />
Theatre. Einerseits war sie als Autorin mit dabei, an<strong>der</strong>erseits<br />
hat sie mit ihrem außerordentlichen Gespür für Talent unbekannte<br />
junge Autoren geför<strong>der</strong>t, von denen einige später weltberühmt wurden.<br />
Das finde ich wirklich aufregend. Nicht zuletzt aber ging es mir<br />
um die Frage: Wie bringt jemand, <strong>der</strong> die Avantgarde <strong>der</strong> zwanziger<br />
Jahre in Berlin miterlebt, um nicht zu sagen mitgeprägt hat, sich in<br />
die Avantgarde <strong>der</strong> fünfziger und sechziger Jahre in New York ein?<br />
Gleichzeitig scheint es mir auch bemerkenswert, dass sie sich beide<br />
Male im Zentrum von Homosexuellen-Bewegungen wie<strong>der</strong>findet.<br />
Absolut. Wobei man im Berlin <strong>der</strong> zwanziger Jahre in Künstlerkreisen<br />
das Kokettieren mit schwulen und lesbischen Vorlieben<br />
trotz des Paragrafen 175 geradezu zum Ideal erhob, im New York <strong>der</strong><br />
fünfziger und sechziger Jahre hingegen Razzien in schwulen Lokalen<br />
und Verhaftungen wegen des Austauschs von Zärtlichkeiten in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit noch an <strong>der</strong> Tagesordnung waren. Die Stonewall-Unruhen<br />
hat Ruth Landshoff ja gar nicht mehr erlebt.<br />
57
58<br />
Versuchte sie, die Liberalität <strong>der</strong> zwanziger Jahre in Berlin nach<br />
New York zu tragen?<br />
Als sich die Schwulen in New York noch längst nicht befreit<br />
hatten, gab es im Zentrum <strong>der</strong> Subkultur, <strong>der</strong> Künstlerszene von<br />
Greenwich Village, eine Frau, die sagen konnte: Das kenn’ ich alles,<br />
das hatten wir vor 40 Jahren in Berlin. Das trifft auch noch auf An<strong>der</strong>es<br />
zu, etwa die Emanzipation, die geistige und materielle Unabhängigkeit<br />
berufstätiger Frauen, aber auch auf höchst Problematisches<br />
wie den Umgang mit Drogen … Diesen Link zwischen zwei Welten,<br />
zwei Epochen fand ich aufregend, und das war für mich ein weiterer<br />
Grund, über Landshoff zu schreiben.<br />
Bleiben wir einen Moment bei Ihren Recherchen. Wie haben<br />
Sie das Leben dieser dann doch recht vergessenen Frau<br />
rekonstruiert?<br />
Natürlich habe ich mich für Ruth Landshoffs Nachlass in Boston<br />
interessiert, im Howard Gotlieb Archival Research Center. Er ist<br />
erschlossen, aber in einem relativ beklagenswerten Zustand. Vieles,<br />
was man dort in die Hand nimmt, zerfällt einem unter den Fingern,<br />
Kopien darf man mittlerweile nur noch in bescheidenem Umfang<br />
anfertigen. So war es eine unschätzbare Hilfe für mich, dass mir<br />
Christine Pendl, die als eine <strong>der</strong> ersten über Landshoff geforscht hat,<br />
zu Beginn meiner Arbeit großherzig ein paar Tausend Kopien zur<br />
Verfügung gestellt hatte, die sie 15 Jahre zuvor noch hatte machen<br />
können. Bei meinem Aufenthalt in Boston konnte ich mich also auf<br />
das wenige mir unbekannte Archivmaterial konzentrieren. Anschließend<br />
habe ich mich auf die Suche nach weiteren Quellen gemacht.<br />
Ich stieß zum Beispiel auf den Briefwechsel mit Kenward Elmslie,<br />
<strong>der</strong> in San Diego aufbewahrt wird, o<strong>der</strong> den Nachlass von Bryan<br />
Guinness, <strong>der</strong> sich in Familienbesitz in Großbritannien befindet. Parallel<br />
habe ich nach Leuten gesucht, die Landshoff noch kannten. Ich<br />
traf z. B. in Amsterdam Andreas Landshoff, den Sohn des Verlegers<br />
Fritz H. Landshoff, eines Cousins von Ruth. Er hat dann den Kontakt<br />
zu Gisela Fischer hergestellt, <strong>der</strong> Enkelin von Ruths Onkel Samuel<br />
Fischer, die in Zürich lebte – wie viele an<strong>der</strong>e, die ich befragt habe,<br />
ist sie inzwischen verstorben. Auch zu weiteren Familienangehörigen<br />
wie Ruths Nichte Diana Celenza habe ich Kontakt aufgenommen.<br />
In New York konnte ich etliche Autoren treffen, die Ruth Landshoff<br />
gut kannten, wie etwa Paul Foster, den Initiator von La MaMa, Bob<br />
Heide und Edward Field.<br />
Unerwartet wichtig wurde dann <strong>der</strong> Kontakt zu Robert Patrick,<br />
einem Schauspieler, Regisseur und Autor, vor allem <strong>der</strong> Off-Off-<br />
Broad way-Szene, <strong>der</strong> für kurze Zeit eine Art Sekretär von Ruth<br />
Landshoff war und einen Teil ihrer Autobiografie, die noch immer<br />
unveröffentlicht ist, getippt und redigiert hat. Mit Robert, <strong>der</strong> jetzt<br />
gerade 80 geworden ist, habe ich mich stundenlang per Skype unterhalten,<br />
vor allem aber hat er auf meine Bitte hin seine Facebook-Freunde<br />
gefragt: »Does anyone know a man named Kenward<br />
Elmslie?« – Elmslie war eine ganz wichtige Person im Leben von<br />
Ruth Landshoff: ein junger Schriftsteller, den sie für wahnsinnig<br />
begabt hielt, den sie eigentlich von ihrem engen Freund John Latouche<br />
geerbt hatte, als dieser auf tragische Weise ums Leben kam …<br />
Sie hat ihn mit auf ihre Europareisen genommen und sich auch in<br />
Deutschland erfolgreich für ihn eingesetzt. Elmslie wie<strong>der</strong>um war für<br />
Ruth eine Art Mäzen – er ist ein Enkel des wohlhabenden Zeitungsverlegers<br />
Pulitzer. Ich wusste nur, dass Elmslie noch lebt, aber nicht,<br />
wie ich ihn erreichen kann. Und dann meldete sich Ron Padgett,<br />
<strong>der</strong> bekannte Lyriker, und sagte mir, ich könne Elmslie sprechen,<br />
er könne das arrangieren. Er müsse mich begleiten, Elmslie leide<br />
an Alzheimer, habe aber durchaus lichte Momente. Übrigens lägen<br />
auf Elmslies Dachboden auch noch ein paar Briefe, die für mich<br />
vielleicht interessant wären.<br />
59
60<br />
Ein paar Briefe? Hat Padgett absichtlich untertrieben?<br />
Ich weiß es nicht. De facto handelte es sich um einen umfangreichen<br />
Bestand, darunter neben Notizbüchern, Taschenkalen<strong>der</strong>n,<br />
Bankauszügen und Belegexemplaren etwa 1.000 Briefe, aufschlussreiche<br />
Korrespondenz mit <strong>der</strong> Familie und mit Karl Gustav Vollmoeller,<br />
aber auch mit Leuten wie Klaus Mann und Francesco von<br />
Mendelssohn, Thornton Wil<strong>der</strong>, Truman Capote und Carson Mc-<br />
Cullers. Dazu faszinierende Fotografien – die für mich aber nebensächlich<br />
waren. Ich bin dankbar, dass ich etliche Tage von morgens<br />
bis abends in Elmslies Haus in Greenwich Village verbringen durfte,<br />
überwacht von Ruth Landshoff – über dem Schreibtisch hing Oskar<br />
Kokoschkas berühmte Lithografie Ruth II aus dem Jahr 1922.<br />
Elmslies Pfleger wussten: Morgens um neun kommt <strong>der</strong> Mann aus<br />
Deutschland, arbeitet selbstständig, braucht eigentlich nichts, außer<br />
vielleicht mal einen Kaffee, und geht abends wie<strong>der</strong>. Natürlich habe<br />
ich zwischendurch mehrmals mit Elmslie gesprochen. Es war nicht<br />
unergiebig, aber tatsächlich so, dass er sich von Tag zu Tag nicht<br />
erinnern konnte, dass wir uns bereits kennengelernt hatten. Dass<br />
ich in Ruhe die Dokumente sichten und auswerten durfte, war für<br />
mich ein großes Geschenk. Als Ron mich am letzten Tag fragte, was<br />
meiner Meinung nach mit ihnen geschehen solle, riet ich ihm, sie<br />
nach Marbach zu geben.<br />
Ein Jahr später vermittelte Padgett diesen Bestand für Elmslie<br />
dann tatsächlich nach Marbach. Eine beson<strong>der</strong>e Pointe war dabei,<br />
dass wir aufgrund <strong>der</strong> Memorabilien unseres früheren Direktors<br />
Bernhard Zeller festgestellt haben, dass Elmslie Ruth Landshoff<br />
1959 auf die Schillerhöhe begleitet hat.<br />
Ruth Landshoff wollte damals etwas für Vollmoeller bewegen,<br />
z. B. in Marbach. So entstand 1960 die kleine Ausgabe von Vollmoellers<br />
nachgelassenen Gedichten. Als seine literarische Nachlassverwalterin<br />
suchte sie Rat beim Stuttgarter Urheberrechtsexperten<br />
Ferdinand Sieger, <strong>der</strong> mit Vollmoellers Nichte Christine Purrmann<br />
verheiratet war, und entschied dann auch, dass Vollmoellers Nachlass<br />
nach Marbach gehen sollte.<br />
Das mag auch damit zusammenhängen, dass Zellers Vorgänger<br />
Erwin Ackerknecht bereits unmittelbar nach Vollmoellers Tod 1948<br />
den Kontakt zur Familie suchte. Ackerknecht kannte Vollmoeller<br />
schon vom Stuttgarter Karls-Gymnasium, hatte dort aber erst zwei<br />
Jahre nach ihm Abitur gemacht.<br />
Ruth Landshoff hat sich auf verschiedensten Kanälen für Vollmoellers<br />
Werk eingesetzt, bis hin zum Plan einer Mirakel-Tournee<br />
mit Ingrid Bergman, Hildegard Knef und Roberto Rossellini. Das<br />
ließ sich natürlich nie realisieren, trotz ihrer guten Beziehungen.<br />
Einerseits klingt das hochtrabend, an<strong>der</strong>erseits gehörte sie nicht<br />
zu denjenigen, die mit ihren prominenten Freunden angeben.<br />
Sie kannte ja wirklich alle, und viele sehr gut.<br />
Ruth Landshoffs Aufzeichnungen sind einerseits sehr verlässlich,<br />
an<strong>der</strong>erseits mitunter auch ein bisschen frisiert – mit Sinn für<br />
dramatische Wirkungen und gute Pointen. Wenn man ihr wirklich<br />
glauben darf, hat sie Vollmoeller und Francesco von Mendelssohn an<br />
ein und demselben Abend des Jahres 1921 kennengelernt. Just diese<br />
beiden haben ihr dann mit ihren Kontakten die große Welt eröffnet<br />
und so Landshoffs Leben ganz wesentlich geprägt.<br />
Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Mendelssohn homosexuell<br />
war und Vollmoeller wesentlich älter. Was war das aus<br />
Ihrer Sicht für eine Beziehung mit Vollmoeller?<br />
Ruth Landshoff beschreibt sie eigentlich sehr ungeniert. Mit 17<br />
Jahren wurde sie seine Geliebte, da war Vollmoeller 42. Das ging<br />
ungefähr zwei Jahre, dann war sie ihm zu alt. Nun fiel ihr die Aufgabe<br />
zu, junge Mädchen herbeizuschaffen, für die er sich interessieren<br />
61
62<br />
könnte. Aber es blieb eine ganz enge Bindung, eine Freundschaft, die<br />
mehr als ein Vierteljahrhun<strong>der</strong>t Bestand hatte, bis zu Vollmoellers<br />
Tod. Doch die sexuelle Beziehung muss sich auf die erste Zeit, als<br />
sie noch sehr jung war, beschränkt haben.<br />
Welche Rolle spielte Harry Graf Kessler für das Leben in<br />
Vollmoellers Wohnung am Pariser Platz, in dieser Mischung aus<br />
erotischen Beziehungen, Film- und Theaterbesetzungen und<br />
diversen künstlerischen Projekten?<br />
Hinreichend bekannt ist ja seine oft zitierte Schil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Treffen mit Josephine Baker. Mich hat an seinen Aufzeichnungen<br />
aber weniger die Beschreibung <strong>der</strong> Baker interessiert als die <strong>der</strong><br />
»kleinen Landshoff« im Smoking, die »wirklich wie ein bildschöner<br />
Junge aussieht«. Mir ging es dabei nicht um Kesslers erotische<br />
Neigungen, son<strong>der</strong>n darum, dass er ganz klar etwas Spezifisches<br />
für Ruth Landshoff benennt: eben diese Überschreitung <strong>der</strong> Geschlechtergrenzen.<br />
Verkleidet als Junge, flirtete »René«, wie sie<br />
sich nannte, mit Mädchen. Sie zog im Smoking mit Francesco, <strong>der</strong><br />
ein Abendkleid trug, herum. Und manchmal wechselten beide tatsächlich<br />
ihre Identitäten. Es gab einige Berühmtheiten, die Ruth<br />
Landshoff vernaschen wollten. <strong>Im</strong> letzten Moment hat sie dann, im<br />
Halbdunkeln, sozusagen mit Francesco getauscht, und beide haben<br />
sich schrecklich amüsiert, wenn dann irgendwann <strong>der</strong> Moment kam,<br />
an dem <strong>der</strong> Partner entdeckte, dass er mit Francesco im Bett lag und<br />
nicht mit Ruth …<br />
Wie haben Sie so etwas recherchiert? Stochert man als Biograf<br />
da nicht im Nebel des Unzuververlässigen? Dieser Rollentausch<br />
mit Francesco – gibt es dafür überprüfbare Quellen o<strong>der</strong> nur<br />
die Aufzeichnungen <strong>der</strong> beiden?<br />
Das Crossdressing ist nicht nur durch Briefe, son<strong>der</strong>n auch durch<br />
zeitgenössische Veröffentlichungen belegt. <strong>Im</strong> Anekdotischen musste<br />
ich mich aber letztlich auf das verlassen, was die beiden über solche<br />
intimen Dinge zu Papier brachten.<br />
Und erstaunlicherweise blieb Ruth Landshoff ja meist bei <strong>der</strong><br />
Wahrheit.<br />
Sie hat meines Erachtens nichts erfunden. Es gibt nur ganz<br />
wenige Punkte, bei denen sie schummelte. Nachdem sie sich für die<br />
Öffentlichkeit um ein paar Jahre jünger gemacht hatte, wurde ihr<br />
klar, dass das Konsequenzen hatte. Also musste sie z. B. erzählen,<br />
sie wäre auf dem Schulweg von Murnau für den Film Nosferatu entdeckt<br />
worden, was nicht einmal ganz gelogen war, weil es auf dem<br />
Weg zur Schauspiel-Schule war. Aber sie erzählte die Geschichte<br />
natürlich so, dass sich je<strong>der</strong> Leser ein Kind auf dem Weg zur Schule<br />
vorstellt. Sonst aber flunkerte sie nur wenig und verfälschte nichts<br />
grundlegend.<br />
Wie kam Ruth Landshoff zum Schreiben?<br />
Durch Vollmoellers und Mendelssohns Kontakte erlangte sie<br />
früh eine gewisse Popularität. Zugespitzt könnte man sagen, sie<br />
war eines <strong>der</strong> ersten It-Girls <strong>der</strong> Geschichte. Berühmt, ohne dass<br />
man wusste, wofür. O<strong>der</strong> vielmehr einfach dafür, dass sie ist, wie<br />
sie ist: wie sie sich kleidet, wie sie sich gibt, wie sie aussieht; diese<br />
androgyne Erscheinung, dieses freie Leben. Sie war sehr fotogen,<br />
und für ihre Zeit als junge Frau avantgardistisch. Man sprach sogar<br />
von einer Ruth-Landshoff-Mode. Junge Mädchen haben sie kopiert,<br />
sie fanden diesen Typ Frau toll und wollten auch so sein. Das hat<br />
dazu geführt, dass sie für die Unterhaltungspresse immer interessanter<br />
wurde und nach eigenen Beiträgen gefragt wurde. Sie kam<br />
also durch ihre Prominenz als Society-Girl zum Schreiben. Und<br />
natürlich wurden die Feuilletons meist zusammen mit einem Foto<br />
<strong>der</strong> hübschen Autorin abgedruckt, mal neben dem eigenen Auto, mal<br />
mit ihrem Hund. Sie verfasste amüsante Plau<strong>der</strong>eien über Themen<br />
63
wie Reisen, Autos, Mode. Dabei zeigte sich ihre schriftstellerische<br />
Ausgewählte Literatur<br />
Begabung, sie wagte sich an ihre ersten Unterhaltungsromane, und<br />
sukzessive stiegen die literarischen Ambitionen. Auch ihre Gedichte<br />
sind absolut lesenswert!<br />
Blubacher, Thomas: »Gibt es etwas Schöneres als Sehnsucht?« Die Geschwister<br />
Eleonora und Francesco von Mendelssohn. Berlin 2008.<br />
– Die vielen Leben <strong>der</strong> Ruth Landshoff-Yorck. Berlin 2015.<br />
64<br />
Sie haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr viele<br />
Lebensläufe <strong>der</strong> ersten Hälfte des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts rekonstruiert.<br />
Was ist für Sie das Typische an Ruth Landshoff, was das<br />
Beson<strong>der</strong>e?<br />
Typisch ist, wie dieses exzeptionelle Leben eingebettet ist in die<br />
Zeitläufte und verstrickt in die große Politik. Das Beson<strong>der</strong>e ist,<br />
dass dieses Leben fast wie ein klassischer Entwicklungsroman verläuft.<br />
Pointiert ausgedrückt: vom kapriziösen, verantwortungslosen,<br />
ziemlich selbstsüchtigen It-Girl zur engagierten Antifaschistin, zur<br />
ambitionierten Literatin und Mentorin junger Talente, zu einer<br />
Frau, die gesellschaftlich etwas bewegen wollte, die für die Rechte<br />
Homosexueller und gegen Rassismus kämpfte. <strong>Im</strong> Grunde ist es doch<br />
unglaublich, wie es jemand über Epochen und Kontinente hinweg<br />
Cziffra, Géza von: Kauf dir einen bunten Luftballon. Erinnerungen an Götter und<br />
Halbgötter, München / Berlin 1975.<br />
Hübner, Friedrich M. (Hrsg.): Die Frau von morgen wie wir sie wünschen.<br />
Mit einem Vorw. von Silvia Bovenschen. Frankfurt a.M. 1990 [erstmals Leipzig 1929].<br />
Kessler, Harry Graf: Das Tagebuch. Bd. 8: 1923–1926. Hrsg. von Angela Reinthal,<br />
Günter Rie<strong>der</strong>er und Jörg Schuster unter Mitarb. von Janna Brechmacher,<br />
Christoph Hilse und Nadin Weiß. Stuttgart 2009.<br />
– Tagebücher 1918–1937. Hrsg. von Wolfgang Pfeiffer-Belli, Frankfurt a. M. 1961.<br />
Landshoff-Yorck, Ruth: Das Mädchen mit wenig PS. Feuilletons aus den zwanziger<br />
Jahren. Hrsg. und mit einem Nachw. von Walter Fähn<strong>der</strong>s. Berlin 2015.<br />
– Das Ungeheuer Zärtlichkeit. Frankfurt a. M. 1952.<br />
– Die Schatzsucher von Venedig. Hrsg. und mit einem Nachw. von Walter Fähn<strong>der</strong>s.<br />
Berlin 2004.<br />
– Die Vielen und <strong>der</strong> Eine. Roman. Hrsg. und mit einem Nachw. von Walter Fähn<strong>der</strong>s.<br />
Berlin 2001 [erstmals Berlin 1930].<br />
65<br />
schafft, sich immer weiter zu entwickeln, sich immer wie<strong>der</strong> neu zu<br />
– Klatsch, Ruhm und kleine Feuer. Biographische <strong>Im</strong>pressionen. Köln / Berlin 1963.<br />
erfinden. Und dabei war Ruth Landshoff oft ganz vorneweg: Sie hat<br />
– Lili Marlene, an Intimate Diary. New York 1945.<br />
ans Radio geglaubt, als das Medium noch in den Kin<strong>der</strong>schuhen<br />
– Roman einer Tänzerin. Hrsg. und mit einem Nachw. von Walter Fähn<strong>der</strong>s. Berlin 2002.<br />
steckte, sie hat vom Fernsehspiel geschwärmt, als in Deutschland<br />
noch kein Mensch irgendwas davon hören wollte. Ruth Landshoff<br />
war immer Teil <strong>der</strong> Avantgarde und, wenn man das so sagen kann,<br />
bis ins Alter hinein jung.<br />
– Sixty to Go. Roman vom Wi<strong>der</strong>stand an <strong>der</strong> Riviera. Hrsg. und übersetzt von<br />
Doris Hermanns. Berlin 2014 [erstmals New York 1944].<br />
Sternheim, Thea: Tagebücher 1903–1971. Hrsg. und ausgew. von Thomas Ehrsam<br />
und Regula Wyss. Göttingen 2011.<br />
Tunnat, Fre<strong>der</strong>ik D.: Karl Vollmoeller. Dichter und Kulturmanager. Eine Biographie.<br />
Hamburg 2008.<br />
Vollmoeller, Karl: Gedichte. Eine Auswahl. Hrsg. und mit einem Nachw. von<br />
Herbert Steiner. Marbach a. N. 1960.<br />
– Das Wun<strong>der</strong> (The Miracle). Große Pantomime in zwei Akten und einem Zwischenspiel.<br />
Musik von Engelbert Humperdinck. Regie Max Reinhardt. [Textbuch] Berlin 1912.<br />
Zeller, Bernhard: <strong>Marbacher</strong> Memorabilien. Vom Schiller-Nationalmuseum zum<br />
Deutschen Literaturarchiv. 1953–1973. Marbach a. N. 1995.
© 2017 Deutsche Schillergesellschaft, Marbach am Neckar<br />
Herausgeber : Deutsches Literaturarchiv Marbach<br />
Redaktion : Dietmar Jaegle<br />
Ausstattung : Pauline Altmann, nach einem Reihenentwurf von<br />
Diethard Keppler und Stefan Schmid<br />
Gesamtherstellung : Offizin Scheufele Druck und Medien, Stuttgart<br />
ISBN 978-3-944469-29-4<br />
Die Deutsche Schillergesellschaft wird geför<strong>der</strong>t<br />
durch die Bundesrepublik Deutschland,<br />
das Land Baden-Württemberg, den Landkreis Ludwigsburg<br />
und die Städte Ludwigsburg und Marbach am Neckar.<br />
Umschlag : Pauline Altmann unter Verwendung zweier Fotos<br />
von Karl Vollmoeller.<br />
Frontispiz : Karl Vollmoeller am Lido di Venezia.<br />
Vor- und Nachsatz : Negative von Vollmoellers Fotos<br />
(Fotos: DLA, Chris Korner).<br />
Fotoarbeiten : DLA.<br />
Die Urheberrechte von Karl Vollmoeller und damit auch an den<br />
hier veröffentlichten Fotos wurden 1994 auf die Deutsche<br />
Schiller gesellschaft übertragen.<br />
Beson<strong>der</strong>er Dank gilt Kenward Elmslie für die Schenkung des<br />
New Yorker Teilnachlasses von Ruth Landshoff-Yorck sowie<br />
Ron Padgett und Thomas Blubacher, ohne die das vorliegende<br />
<strong>Marbacher</strong> <strong>Magazin</strong> nicht möglich gewesen wäre.<br />
Darüber hinaus möchte ich Susanna Brogi, Anja Gomm, Anna<br />
Katharina Hahn, Alexa Hennemann, Dietmar Jaegle, Chris Korner,<br />
Diana Layman, Karin Müller, Ulrich Raulff und Veronika Weixler<br />
für ihre vielfältige Unterstützung danken. jb