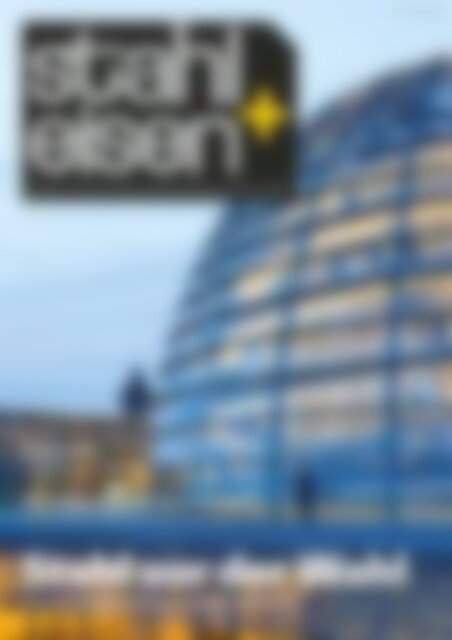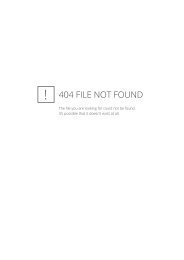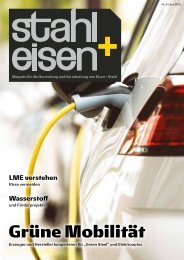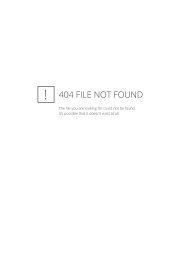stahl + eisen 08/2021 (Leseprobe)
TITELTHEMA STAHL VOR DER WAHL // WEITERE THEMEN: u.a. Direktreduktion rund um den Globus, Wie IoT-Plattformen die grüne Transformation im Stahlmarkt erleichtern, Klimaschutz in China: Nicht um jeden Preis, aus Wissenschaft + Technik: Verzinkung und neue Stähle, Style + Story: 190 Jahre Schwarzenberggebläse
TITELTHEMA STAHL VOR DER WAHL // WEITERE THEMEN: u.a. Direktreduktion rund um den Globus, Wie IoT-Plattformen die grüne Transformation im Stahlmarkt erleichtern, Klimaschutz in China: Nicht um jeden Preis, aus Wissenschaft + Technik: Verzinkung und neue Stähle, Style + Story: 190 Jahre Schwarzenberggebläse
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nr. 8 | August <strong>2021</strong><br />
Magazin für die Herstellung und Verarbeitung von Eisen + Stahl<br />
Rohstoffe<br />
Den Preisschub beherrschen<br />
Verzinkung und neue Stähle<br />
Eine neue Generation steht in den Startlöchern<br />
Stahl vor der Wahl<br />
Ziele und Vorhaben der Politik und Erwartungen der Branche
Messbar besser!<br />
KELLER ITS – Ihr verlässlicher Partner für<br />
die präzise optische Temperaturmessung!<br />
• Lösungen für branchenspezifische Messaufgaben<br />
• High-Tech vom Innovations- und Technologieführer<br />
• Weltweites Vertriebspartnernetz und Servicestützpunkte<br />
www.keller.de/its<br />
Made in Germany
Liebe Leserinnen & Leser,<br />
eigentlich ist das, was „die in Berlin“ (oder Brüssel) machen, ziemlich<br />
weit weg von einer Schicht im Stahlwerk. Meistens jedenfalls. Bei den<br />
großen Kursentscheidungen wirken Politiker aller Couleur, allen voran<br />
natürlich die Regierenden, jedoch immens auf den Alltag der Branche<br />
ein – und auf deren Zukunftsperspektiven.<br />
Aktuelle Nachrichten<br />
finden Sie<br />
fortlaufend auf<br />
<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de. Sie<br />
sind Social-Mediaaffin?<br />
Folgen Sie<br />
auf Twitter doch<br />
@<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>_de.<br />
Während die Volksrepublik China ihren Energiehunger durch den massiven<br />
Ausbau der CO 2 -neutralen Kernenergie sowie den Bau von 190 Kohlekraftwerken stillt,<br />
wie unsere China-Korrespondent Fabian Grummes in seiner wieder sehr lesenswerten Kolumne<br />
auf Seite 36 schreibt, streben fünf von sechs Bundestagsparteien ausweislich ihrer Wahlprogramme<br />
nach Klimaneutralität. Lediglich die FDP hält am ursprünglichen Fahrplan 2050 fest, während<br />
die Bündnisgrünen in 20 Jahren soweit sein wollen (also 2041) und die Partei Die Linke schon<br />
2035. In der Titelstrecke „Stahl vor der Wahl“ haben wir speziell die klimapolitischen Ziele<br />
übersichtlich zusammengefasst. Für die Branche ist dieser Überbietungswettbewerb ziemlich weit<br />
weg von den verlässlichen Rahmenbedingungen, die sie braucht, um die politisch forcierte<br />
Kraftanstrengung der Dekarbonisierung umzusetzen. „Auf dieser Basis kann die Stahlindustrie<br />
nicht verlässlich planen“, schreibt denn auch Dr. Karl-Ulrich Köhler von der SHS - Stahl-Holding-<br />
Saar in seinem exklusiven Meinungsbeitrag (Seite 19). Ähnliche Haltungen finden Sie auch in der<br />
Kurzumfrage auf den Seiten 22 und 23.<br />
Eine explizite Wahlempfehlung werden Sie aus der Redaktion nicht erhalten (und auch keine<br />
implizite), aber der Feststellung von Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender des Vorstands von ElringKlinger<br />
und Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, in seinem Standpunkt können wir so<br />
zustimmen: „Wir stehen vor einer echten Richtungswahl in Deutschland“. Auch gehen wir mit,<br />
was Johannes Nonn von der Wuppermann AG der kommenden Regierung vorab ins Stammbuch<br />
schreibt: Man erwarte von ihr, „die Rahmenbedingungen für den Übergang zu einer<br />
nachhaltigeren Wirtschaft in Deutschland und Europa klar und langfristig verlässlich zu setzen.“<br />
Das soll als Stellungnahme aus der Redaktion aber reichen. Wir wünschen Ihnen eine anregende<br />
Lektüre dieser Ausgabe und schon jetzt, dass Sie Ende September eine gute Wahl treffen!<br />
Torsten Paßmann, Chefredakteur<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 3
STAHL<br />
EISEN<br />
Inhalt 8 | <strong>2021</strong><br />
Cover:<br />
Die beleuchtete Glaskuppel auf<br />
dem Dach des Reichstags<br />
Quelle: Matej Kastelic/www.shutterstock.com<br />
NEWS<br />
TERMINE<br />
6 Wirtschaft + Industrie<br />
u.a. mit voestalpine, thyssenkrupp und<br />
SHS – Stahl-Holding-Saar<br />
10 Klima + Umwelt<br />
u.a. mit LSV Lech-Stahl Veredelung, Salzgitter<br />
und SSAB<br />
12 Additive Fertigung<br />
u.a. mit ODeCon, Desktop Metal und MX3D<br />
14<br />
Stahl<br />
vor der Wahl<br />
Was Parteien vor allem hinsichtlich der Klimapolitik<br />
vorhaben – und was sich die Branche wünscht<br />
TITELTHEMA: STAHL VOR DER WAHL<br />
16 Eine Partei will Klimaneutralität bereits 2035<br />
In der Klimapolitik herrscht vielfach grundsätzliche<br />
Einigkeit – mit Unterschieden in den Details<br />
19 Ein Ziel ist noch keine Lösung<br />
Standpunkt von Dr. Karl-Ulrich Köhler, Vorsitzender<br />
der Geschäftsführung, SHS – Stahl-Holding-Saar<br />
20 Austausch bedingt gesucht<br />
Vor der Wahl lassen sich nicht alle Parteien in den Unternehmen<br />
sehen<br />
24 „Wir stehen vor einer echten Richtungswahl<br />
in Deutschland“<br />
Standpunkt von Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender des<br />
Vorstands von ElringKlinger und Präsident des Arbeitgeberverbands<br />
Gesamtmetall<br />
24 DRI rund um den Globus<br />
Midrex ist Entwickler eines Verfahrens, das in Direktreduktionsanlagen<br />
weltweit zum Einsatz kommt<br />
52<br />
Stichprobeninventur<br />
führt zu spürbarer<br />
Entlastung<br />
Mit Remira hat Salzgitter Flach<strong>stahl</strong> den Inventuraufwand<br />
deutlich minimiert<br />
22 „Rahmenbedingungen klar und langfristig<br />
verlässlich setzen“<br />
Kurzumfrage zu den Erwartungen der Branche an die<br />
kommende Bundesregierung 28 Jetzt ist guter Stahl teuer<br />
Materialengpässe sind auch für Drehteilehersteller eine<br />
belastende Herausforderung<br />
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
30 Wie IoT-Plattformen die grüne<br />
Transformation im Stahlmarkt erleichtern<br />
Mit Hilfe der Digitalisierung agieren Unternehmen<br />
ökologisch und wirtschaftlich<br />
4 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
32 Neue Technologien erhöhen die Effizienz<br />
im Stahlhandel<br />
Die Digitalisierung bietet Stahlhandelsunternehmen<br />
ein enormes Potenzial, ihr Geschäftsmodell fit für die<br />
Zukunft zu machen<br />
36 Nicht um jeden Preis<br />
China-Kolumne von Fabian Grummes<br />
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
43 Verzinkung und neue Stähle<br />
Eine neue Generation weicher Stähle zum Kaltumformen<br />
mit einer Schmelztauchveredelung steht in den<br />
Startlöchern<br />
50 Reststandmenge von Schmiedewerkzeugen<br />
punktgenau prognostizieren<br />
Vorausschauende Überwachung soll die Wirtschaftlichkeit<br />
weiter optimieren<br />
52 Stichprobeninventur führt zu spürbarer<br />
Entlastung<br />
Mit Remira hat Salzgitter Flach<strong>stahl</strong> den<br />
Inventuraufwand deutlich minimiert<br />
62<br />
190 Jahre Schwarzenberggebläse<br />
Ein Technikdenkmal auf der „Alten Elisabeth“<br />
in Freiberg<br />
54 Erzeugnisse und Verfahren für den<br />
Umgang mit Stahl<br />
u.a. mit Tenova, EWM und Karl Roll<br />
RECHT<br />
FINANZEN<br />
56 Einkaufsrisiken besser beherrschen<br />
Wie Unternehmen mit dem Preisschub bei Rohstoffen<br />
umgehen können<br />
BERUF<br />
KARRIERE<br />
58 Auch Führungsverhalten lässt sich<br />
optimieren<br />
Es gibt zwei Archetypen von Führungskräften – einer<br />
von beiden will besser werden<br />
STYLE<br />
STORY<br />
62 190 Jahre Schwarzenberggebläse<br />
Ein Technikdenkmal auf der „Alten Elisabeth“ in<br />
Freiberg<br />
Verzinkung und neue Stähle<br />
45 Eine neue Generation weicher Stähle zum Kaltumformen mit<br />
einer Schmelztauchveredelung steht in den Startlöchern<br />
IMMER<br />
EWIG<br />
3 Editorial<br />
9 Termine<br />
38 Länder + Anlagen<br />
60 VDEh-Personalia<br />
64 People<br />
66 Vorschau + Impressum<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 5
NEWS + TRENDS<br />
Wirtschaft<br />
Industrie<br />
Voestalpine mit guten Finanzkennzahlen<br />
im ersten Quartal<br />
Der österreichische Konzern voestalpine<br />
konnte im ersten Quartal seines seit<br />
April laufenden Geschäftsjahres <strong>2021</strong>/22<br />
den Umsatz um 45,6 % von 2,4 Mrd. Euro<br />
auf 3,5 Mrd. Euro und das EBITDA um<br />
242 % auf 540 Mio. EUR. Das Ergebnis<br />
nach Steuern legte auf 259 Mio. Euro zu<br />
– im Vergleichszeitraum des Vorjahres<br />
waren es mit -70 Mio. Euro noch rote<br />
Zahlen. Mit Ausnahme der Luftfahrtindustrie,<br />
die sich vergleichsweise verhalten<br />
entwickelte, verzeichneten alle<br />
Markt- und Produktsegmente eine positive<br />
Entwicklung. Die europäische Automobilindustrie<br />
war weiterhin mit den<br />
seit Jahreswechsel bestehenden Lieferproblemen<br />
aus der Halbleiterindustrie konfrontiert,<br />
wodurch es in Folge bei einigen<br />
Automobilherstellern zu kurzfristigen<br />
Produktionsstopps kam. Dies führte jedoch<br />
zu keinem nennenswerten Rückgang<br />
der Nachfrage nach hochqualitativen<br />
Stahlprodukten der voestalpine.<br />
„Die voestalpine konnte den Konjunkturaufschwung<br />
nach der pandemiebedingten<br />
Rezession im Vorjahr voll nutzen.<br />
Fast alle unsere Markt- und Produktsegmente<br />
haben sich im ersten Geschäftsquartal<br />
sehr gut entwickelt und die einzelnen<br />
Divisionen zeigten eine ausgezeichnete<br />
Performance“, so Herbert<br />
Eibensteiner, Vorstandsvorsitzender der<br />
voestalpine AG.<br />
KlöCo erwartet stärkstes operatives Jahresergebnis<br />
seit dem Börsengang<br />
Die Klöckner & Co SE (KlöCo) hat nach vorläufigen Zahlen mit<br />
einem operativen Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten<br />
von 401 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres <strong>2021</strong><br />
ein Rekordergebnis erwirtschaftet. Aufgrund der sich auch zu<br />
Beginn des dritten Quartals weiter fortsetzenden positiven Dynamik<br />
der Stahlpreise in Europa und den USA in Verbindung mit<br />
einem äußerst strikten Net Working Capital Management und<br />
unterstützt durch die substantiellen Effekte aus dem Projekt Surtsey,<br />
rechnet die Gesellschaft damit, dass das EBITDA vor wesentlichen<br />
Sondereffekten im dritten Quartal mit 200-230 Mio. Euro<br />
erheblich stärker ausfallen wird als vom Markt bisher erwartet.<br />
Ferner erwartet das Unternehmen im Gesamtjahr <strong>2021</strong> ein EBIT-<br />
DA vor wesentlichen Sondereffekten von 650-700 Mio. Euro zu<br />
erreichen und damit das dann beste operative Jahresergebnis seit<br />
dem Börsengang im Jahr 2006 zu erzielen. Auch diese Prognose<br />
liegt über der bisherigen Markterwartung.<br />
ZVO-Oberflächentage <strong>2021</strong> finden als Hybrid Edition<br />
in Berlin statt<br />
Die Präsenzelemente der ZVO-Oberflächentage <strong>2021</strong><br />
finden wie bereits 2017 und 2019 im bewährten Rahmen<br />
des Estrel Berlin statt.<br />
Den coronabedingten Unwägbarkeiten<br />
begegnet der Zentralverband<br />
Oberflächentechnik e.V. (ZVO) bei<br />
den ZVO-Oberflächentagen <strong>2021</strong><br />
mit einer Kombination aus Onlineund<br />
Präsenzveranstaltungselementen.<br />
Thematisch stehen die Schwerpunkte<br />
Klimaneutralität, Digitalisierung<br />
in der Galvanotechnik,<br />
Innovationstreiber Chemie- und<br />
Umweltregulierung sowie Edelmetalloberflächen<br />
im Mittelpunkt.<br />
Dazu kommen regelmäßig wiederkehrende<br />
Vortragsrubriken wie<br />
Zukunftstechnologien, Verschleißschutz,<br />
Funktionsschichten oder<br />
Energie- und Materialeffizienz. Abgerundet<br />
wird das Kongressprogramm<br />
durch ein FuE-Forum, an<br />
der Industrieausstellung werden 41<br />
Unternehmen teilnehmen Die Präsenzelemente<br />
am 23./24. September<br />
<strong>2021</strong> finden im Estrel Berlin statt,<br />
die Anzahl der bis 16. September<br />
verfügbaren Präsenz-Tickets ist<br />
begrenzt.<br />
Bilder: voestalpine AG, Primetals Technologies<br />
6 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
thyssenkrupp trennt sich von drei Geschäftsbereichen<br />
Im Zuge des Unternehmensumbaus hat sich der Ruhrgebietskonzern<br />
thyssenkrupp Mitte August von der Konzerngesellschaft<br />
thyssenkrupp Carbon Components getrennt. Käufer ist<br />
die Action Composites GmbH aus Österreich. Mit dem Verkauf<br />
erziele man einen „weiteren Erfolg bei der Fokussierung des<br />
Portfolios“, hieß es seitens thyssenkrupp. Kurz vorher wurde<br />
das Infrastructure-Geschäft an die FMC Beteiligungs KG veräußert,<br />
eine unternehmergeführte, unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft,<br />
die langfristig in Unternehmen investiert.<br />
Action Composites ist auf die Entwicklung, Konstruktion und<br />
Produktion von Bauteilen aus Carbon-Verbundwerkstoffen spezialisiert.<br />
Ende Juli wurde mitgeteilt, dass die Geschäftseinheit<br />
Mining Technologies von dem dänischen Unternehmen<br />
FLSmidth übernommen wird, einem Unternehmen von Technologien<br />
für die Mining- und Zementindustrie. Über den Verkaufspreis<br />
wurde in allen Fällen Stillschweigen vereinbart. Die thyssenkrupp-Tochter<br />
Carbon Components wurde 2012 in Zusammenarbeit<br />
mit der TU Dresden gegründet und u.a. auf<br />
geflochtene ultraleichte Hochleistungsfelgen für Sportwagen,<br />
Motorräder und Mountainbikes spezialisiert, thyssenkrupp Infrastructure<br />
ist ein Anbieter im Tief-, Hafen- und Spezialtiefbau<br />
sowie im Ingenieurbau.<br />
BGH Freital erteilt Endabnahme für AOD-Konverter<br />
Von Primetals gelieferter neuer AOD (Argon Oxygen<br />
Decaburization)-Konverter beim Stahlproduzenten<br />
BGH Edel<strong>stahl</strong>werke Freital.<br />
Der deutsche Stahlproduzent BGH Edel<strong>stahl</strong>werke in Freital hat Primetals<br />
Technologies die Endabnahmebescheinigung für einen neuen 50-Tonnen-<br />
AOD-Konverter (Argon Oxygen Decaburization) erteilt. Dieser ergänzt und<br />
entlastet die bestehende VOD-Anlage (Vacuum Oxygen Decarburization).<br />
Für das Projekt lieferte Primetals Technologies neben dem Konverter auch<br />
das Legierungs- und Zuschlagstoffesystem, die Einhausung und die Primärgaskühlung,<br />
Hilfs- und Nebeneinrichtungen sowie die Elektrik und die Automatisierung.<br />
Das komplette Engineering, Überwachungsleistungen für<br />
Montage und Inbetriebnahme sowie die Kundenschulung vor Ort waren<br />
ebenfalls Bestandteile des Leistungsumfangs. Damit soll die Produktion<br />
flexibler werden sowie der spezifische Verbrauch von Rohmaterialien, feuerfesten<br />
Werkstoffen, elektrischer Energie und Betriebsmitteln sinken.<br />
Gleichzeitig werde aufgrund der verkürzten Behandlungszeiten die Produktivität<br />
erhöht und die Qualität der Endprodukte weiter verbessert,<br />
heißt es. Der Einbau des AOD-Konverters in ein bestehendes Werk erforderte<br />
aufgrund der geringen Hallenhöhe eine kundenspezifische Sonderlösung<br />
und erfolgte erfolgte während des laufenden Betriebes.<br />
Boxbay besteht den Praxistest<br />
Bilder: SMS group, Sven Hobbiesiefken<br />
Nach 63 000 Containerbewegungen seit der Inbetriebnahme<br />
Anfang des Jahres in der originalgroßen Proof-of-Concept-Anlage<br />
wissen die Joint-Venture-Partner SMS group und DP World:<br />
Das Hochregallager-System Boxbay im Hafen von Dubai, das 792<br />
Container gleichzeitig aufnehmen kann, ist noch effizienter, als<br />
sie zuvor angenommen hatten. Während der Testphase wurden<br />
einige Änderungen an der ursprünglichen Konstruktion vorgenommen.<br />
Damit konnten die Leistung gesteigert und die Investitionskosten<br />
für zukünftige Anlagen deutlich reduziert werden.<br />
Das hohe Leistungsniveau des Boxbay-Systems – wasserseitig<br />
19,3 Bewegungen pro Stunde und landseitig 31,8 Bewegungen<br />
pro Stunde – reduziert außerdem das in einem Terminal benötigte<br />
Equipment. Mit 29 Prozent niedrigeren Energiekosten und<br />
deutlich reduziertem Wartungsaufwand liegen die Betriebskosten<br />
ebenfalls unter den Erwartungen. Der Praxistest beweise,<br />
dass das System die Arbeitsweise in Häfen und Terminals revolutionieren<br />
könne, urteilte entsprechend positiv auch Sultan<br />
Ahmed bin Sulayem, Group Chairman und CEO von DP World.<br />
„Die gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner SMS group<br />
entwickelte Technologie führt zu einer enormen Erweiterung<br />
Der Proof of Concept (POC) des Hochregallagersystems Boxbay ist<br />
erfolgreich in Betrieb und hat seine Leistungsfähigkeit im realen<br />
Betrieb bewiesen<br />
der Kapazität, verbessert die Effizienz und fördert die Nachhaltigkeit<br />
im Containerumschlag“, ergänzte er.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 7
TITELTHEMA: STAHL VOR DER WAHL<br />
Einführung<br />
Stahl vor<br />
<br />
der Wahl<br />
Klimapolitik ist derzeit das Megathema –<br />
die Branche wünscht sich und braucht<br />
Zuverlässigkeit<br />
14 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Gerade vor großen Wahlen entdecken Politiker aller Couleur<br />
ihr offenes Ohr für Interessens- und potentielle Wählergruppen.<br />
Beredtes Zeugnis legen die zahlreichen Stahlwerksbesuche<br />
von Spitzenpolitikern ab, die man dort sonst selten sieht.<br />
Die Frage ist, was aus diesen Gespräche Eingang in Politik, Gesetze<br />
und Verordnungen findet und was Lippenbekenntnisse<br />
bleiben. Im Rahmen des Titelthemas dokumentieren wir auch,<br />
was sich die Branche wünscht und was die Parteien vorhaben.<br />
Bild: Matej Kastelic/www.shutterstock.com<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 15
TITELTHEMA: STAHL VOR DER WAHL<br />
Klimapolitik<br />
Eine Partei will Klimaneutralität<br />
bereits 2035<br />
Hinsichtlich der Klimapolitik herrscht vielfach grundsätzliche Einigkeit – mit<br />
Unterschieden in den Details<br />
AUTOR: Torsten Paßmann<br />
torsten.passmann@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
DARUM GEHT’S: Nur ein Teil der Bundestagsparteien erwähnt<br />
die Stahlindustrie in den Wahlprogrammen, mit übergeordneten<br />
Themen wie der Klimapolitik wollen sie aber trotzdem<br />
deutlich Einfluss auf die Branche nehmen. Dieser Beitrag fasst<br />
einige zentrale Punkte der Programme zusammen, die Reihenfolge<br />
orientiert sich an den Stimmen der Wahl 2017.<br />
Das kürzeste Wahlprogramm liefert die „Alte Tante“ SPD,<br />
deren Herz bekanntlich im Ruhrgebiet schlagen soll. Auf<br />
66 Seiten im PDF kommt das Programm und die Stahlindustrie<br />
wird darin einmal auf einer Seite erwähnt. Ob die Passage<br />
(siehe das rot unterlegte Zitat) nun eine Floskel oder ein Hoffnungsschimmer<br />
ist, liegt im Auge des Betrachters. Ähnlich knapp<br />
sieht es beim großen Koalitionspartner CDU/CSU aus, dessen<br />
Wahlprogramm als PDF mit 140 Seiten mehr als den doppelten<br />
Umfang hat, die Stahlbranche aber ebenfalls nur einmal erwähnt.<br />
Die beiden eher allgemein gehaltenen Sätze (siehe das schwarze<br />
unterlegte Zitat) sind inhaltlich recht nah am Juniorpartner und<br />
heben auch auf den Einfluss von Wasserstoff als Werkzeug zur<br />
Dekarbonisierung ab.<br />
„Viel“ Stahlbezug – oder keiner<br />
Bei der im Kern bereits seit 1946 bestehenden Partei Die Linke<br />
kommt der Stahl dreimal auf zwei Seiten vor. Auf Seite 61 (von<br />
insgesamt 168) wird beispielsweise ein „Investitionsprogramm für<br />
einen zukunftssicheren Umbau hin zu einer klimaneutralen Stahlund<br />
Grundstoffindustrie“ gefordert, wobei das in gewisser Hinsicht<br />
mit einer Teilverstaatlichung gekoppelt ist (siehe Zitat auf<br />
S. 18). Die Bündnisgrünen stellen ihren Wahlkampf unter das<br />
Motto „alles drin“, was sie mit 272 Seiten Wahlprogramm untermauern.<br />
Das Schlagwort „Stahl“ findet sich hier auf drei Seiten,<br />
wobei die Partei die Branche an einer Stelle aufgrund ihres CO 2 -<br />
Ausstoßes in die Verantwortung nimmt, sich andererseits positiv<br />
auf sie bezieht – für die guten Arbeitsplätze und als „Eckpfeiler<br />
des Wohlstands“. Die beiden größten Oppositionsparteien AfD<br />
und FDP unterscheiden sich u.a. im Umfang diametral (210 zu 68<br />
Seiten), sind sich aber in einem Punkt einig: Anders als die vorgenannten<br />
vier Parteien gehen sie nicht explizit auf die Branche<br />
ein.<br />
„Wasserstoff-Land Nr. 1“ mit der CDU/CSU<br />
Die Unionsparteien wollen die Bundesrepublik zum „Wasserstoff-<br />
Land Nr. 1“ machen und streben die Klimaneutralität bis 2045 an<br />
– so wie es im „Klimapaket“ verabschiedet wurde. Dabei setzen<br />
die Christdemokraten auf einen europaweiten Emissionshandel<br />
sowie eine CO 2 -Bepreisung. Zudem streben sie einen erneuerbaren<br />
Energiemix aus Sonne, Wasserstoff und Wind an. Der vereinbarte<br />
Kohlekompromiss, demzufolge alle Kohlekraftwerke bis 2038<br />
stillgelegt sein sollen, gilt weiterhin. Deutschland soll ohne Tem-<br />
Wasserstoff ermöglicht eine<br />
Dekarbonisierung auch da, wo<br />
Erneuerbare Energie nicht direkt<br />
eingesetzt werden kann. Bedeutende<br />
industrielle Prozesse, etwa in der<br />
Stahl- und Zementindustrie,<br />
lassen sich nur mit Wasserstoff<br />
klimaneutral gestalten.“<br />
(CDU)<br />
polimit und mit dem Verbrennermotor Automobilstandort Nummer<br />
Eins bleiben. Zu den weiteren Vorhaben zählt u.a., die Kreislaufwirtschaft<br />
zu fördern.<br />
Verbrenner sollen laut der SPD bleiben<br />
Der kleinere Koalitionspartner fordert äquivalent zum großen die<br />
Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Um das zu erreichen, sollen<br />
ab 2040 an nur noch erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.<br />
Wir werden Schlüsselindustrien auf<br />
ihrem Weg zur Klimaneutralität<br />
unterstützen und konkrete<br />
Transformationsziele entwickeln<br />
und fördern. Wir werden Deutschland<br />
bis 2030 zum Leitmarkt für<br />
Wasserstofftechnologien machen<br />
– für die klimaneutrale Erzeugung<br />
von Stahl, für CO 2 -arme PKWs,<br />
LKWs und den Schiffs- und<br />
Flugverkehr.“ (SPD)<br />
16 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Um das zu erreichen, wollen die Sozialdemokraten verbindliche<br />
Ausbauziele festlegen, den Kohle- und Atomausstieg gesetzlich<br />
verankern, die Energieeffizienz steigern und Wasserstoff fördern.<br />
Im Gegenzug wünschen sie sich auch Abbau von „klima- und<br />
umweltschädlichen Subventionen“. Die EEG-Umlage in der bestehenden<br />
Form will die SPD bis 2025 abschaffen und aus dem<br />
Bundeshaushalt finanzieren, wozu auch die Einnahmen aus der<br />
CO 2 -Bepreisung dienen sollen. In der Autofahrernation Deutschland<br />
will die SPD „die Elektrifizierung des Verkehrs massiv voranbringen“<br />
und ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen<br />
einführen, vom Verbot von Verbrennungsmotoren ist keine Rede.<br />
Die Wirtschaft soll zur Kreislaufwirtschaft umgebaut und das<br />
ganze Land bis 2030 zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien<br />
gemacht werden.<br />
AfD: bei Klimapolitik quasi allein gegen alle<br />
Die jüngste Bundestags- und größte Oppositionspartei gibt sich<br />
auch in den klimapolitischen Zielen oppositionell: Die Alternative<br />
für Deutschland will als einzige Partei aus dem Pariser Klimaabkommen<br />
aussteigen und strebt auch keine Klimaneutralität an.<br />
Auch müsse Deutschland „aus allen staatlichen und privaten<br />
„Klimaschutz“-Organisationen austreten und ihnen jede Unterstützung<br />
entziehen“, heißt es. Folgerichtig sollen CO 2 nicht besteuert,<br />
erneuerbare Energien nicht präferiert und Wasserstoff<br />
nicht gefördert werden. Diesem Gedankengang folgt, dass die<br />
Partei explizit Braun- und Steinkohle sowie Atom- und Gasenergie<br />
befürwortet. Wie auch andere Parteien will die AfD zwar das<br />
Schienennetz ausbauen, setzt aber auf eine Förderung des motorisierten<br />
Individualverkehrs. Fahrverbote und Tempolimits? Fehlanzeige.<br />
Die Partei will sich für die Schaffung von „Kompetenzzentren<br />
zur Erforschung von Abfallbeseitigungs-und Rohstoffrückgewinnungstechniken“<br />
einsetzen, wobei das Land aus ihrer<br />
Sicht bei der umweltgerechten Beseitigung von Abfällen und<br />
Wiedergewinnung von Rohstoffen bereits gut aufgestellt ist.<br />
FDP will ursprüngliches Zeitfenster zur<br />
Klimaneutralität<br />
Die Freien Demokraten streben die bundesdeutsche Klimaneutralität<br />
für den ursprünglich anvisierten Zeitpunkt an – also 2050.<br />
Ihrem Ruf als marktorientierte Partei entsprechend denkt die FDP<br />
weniger an Gebote, Verbote und enge Zielvorgaben, sondern primär<br />
an den CO 2 -Emissionshandel und einen einheitlichen CO 2 -<br />
Preis. Sinkt die Zahl verfügbarer Zertifikate auf dem Markt, sorgt<br />
das für einen steigenden Preis, was wiederum für eine intrinsische<br />
Motivation sorgt, als Unternehmen in CO 2 -neutrale Technologien<br />
zu investieren. Zusätzlich kann sich die FDP die Förderung von<br />
Projekten vorstellen, die Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre<br />
binden und entfernen. Hinsichtlich der Energiewende halten sich<br />
die Liberalen bedeckter als andere Parteien und geben zu Protokoll,<br />
dass sie die Stromsteuer senken und die EEG-Umlage abschaffen<br />
wollen. Ebenso ist es innerhalb des liberalen Markenkerns,<br />
dass sie bei Kfz keiner Antriebstechnologie den Vorzug<br />
geben wollen, sondern stattdessen bestehende Maßnahmen zur<br />
CO 2 -Reduktion im Verkehr beenden möchten. Neben Subventionen<br />
umfasst das Dieselverbote, Tempolimits und Kaufprämien für<br />
Elektrofahrzeuge.<br />
Die Linke: schnelle Dekarbonisierung und<br />
Verstaatlichungswünsche<br />
Klimapolitische Ziele der Parteien<br />
Zwei Parteien wollen Klimaneutralität in maximal 20 Jahren<br />
CDU/CSU SPD AfD FDP Die Linke<br />
Bündnis90/<br />
Die Grünen<br />
Energiewende<br />
Kohleausstieg bis 2030 bis 2030<br />
Atomausstieg –<br />
Ausbau erneuerbarer Energien 100%<br />
bis 2040<br />
Förderung von Wasserstoff<br />
CO 2 -Bepreisung<br />
Emissionshandel<br />
Kreislaufwirtschaft –<br />
100%<br />
bis 2035<br />
100%<br />
bis 2035<br />
Klimaneutralität bis 2045 bis 2045 bis 2050 bis 2035 bis 2041<br />
Die Reihenfolge der Parteien spiegelt die Rangfolge nach Stimmen bei der Bundestagswahl 2017.<br />
Sowohl die deutsche Industrie als auch die hiesige Infrastruktur<br />
sollen bis 2035 klimaneutral sein, wenn es nach der Partei Die<br />
Linke geht. In logischer Konsequenz positioniert sich die Partei<br />
gegen Energiegewinnung durch fossiles Erdgas und Atomkraft,<br />
der „Kohleausstieg“ soll bis 2030 abgeschlossen sein. Für das selbe<br />
Jahr wird ein weiterer Ausstieg angepeilt – der aus dem fossilen<br />
Verbrennungsmotor. Gleichzeitig plant die Partei flächendeckende<br />
Tempolimits, und zwar 30 km/h innerorts, 80 km/h auf Landstraßen<br />
und 120 km/h auf Autobahnen. Flüge zu Zielen unterhalb<br />
einer Distanz von 500 km und einer Erreichbarkeit per Zug inner<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
August <strong>2021</strong> 17
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Entwicklung<br />
DRI rund um den Globus<br />
Midrex ist Entwickler eines Verfahrens, das in Direktreduktionsanlagen weltweit zum<br />
Einsatz kommt<br />
DARUM GEHT‘S: Das Midrex-Verfahren<br />
zählt zu den wirksamsten industriellen<br />
Methoden, um mittels Direkreduktion<br />
hochwertigen Eisenschwamm (DRI) für<br />
die Stahlproduktion herzustellen. Wo<br />
auf der Welt die Technologie derzeit besonders<br />
erfolgreich zum Einsatz kommt,<br />
zeigt eine Bilderstrecke auf den folgenden<br />
Seiten.<br />
AUTOR: Niklas Reiprich,<br />
niklas.reiprich@<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de<br />
Geht es um die Dekarbonisierung der<br />
Stahlindustrie hin zur klimaneutralen<br />
Produktion, weist die Direktreduktion<br />
(DRI) zweifelsohne enormes Potenzial<br />
auf. Gänzliches Neuland ist sie indes<br />
nicht: Die Technologie punktet bereits seit<br />
vielen Jahren mit ihrer Fähigkeit, <strong>eisen</strong>reiche<br />
Erze unter anderem in flexibles<br />
Chargiermaterial für Elektrolichtbogenöfen–<br />
den sogenannten Eisenschwamm –<br />
umzuwandeln. Ein konkretes Verfahren ist<br />
seit den 1960er Jahren unter dem Namen<br />
„Midrex“ bekannt. Der Prozess des gleichnamigen<br />
Unternehmens besteht daraus,<br />
Eisenerz via Schachtofen im Gegenstromprinzip<br />
mit einem wasserstoffreichen Gas<br />
zu reduzieren. Weltweit produzieren über<br />
50 Anlagen auf diesem Wege große Mengen<br />
an direktreduziertem Eisen für die<br />
Stahlproduktion, darunter heißbrikettiertes<br />
Eisen (HBI), heißes direkt reduziertes<br />
Eisen (HDRI) und kaltes direkt reduziertes<br />
Eisen (CDRI). Midrex zufolge waren dies bis<br />
Ende 2020 insgesamt rund 1,2 Milliarden<br />
Tonnen. Ferner heißt es vonseiten des<br />
Unternehmens, dabei hätten mindestens<br />
12 Anlagen neue Rekorde aufgestellt. Es<br />
lohnt sich also, einzelne Schlaglichter auf<br />
die einige der wichtigsten Produktionsstandorte<br />
zu werfen.<br />
ArcelorMittal, Hamburg, Deutschland<br />
In seinem 49. vollen Betriebsjahr<br />
übertraf das älteste in Betrieb befindliche<br />
Midrex-Modul 2020 seine<br />
jährliche Nennkapazität bei weitem.<br />
Auch wenn die Anlage nicht mit voller<br />
Kapazität betrieben wurde, lag ihr<br />
durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch<br />
bei 84 kWh pro Tonne<br />
– und war damit laut Midrex der niedrigste<br />
aller operierenden Anlagen.<br />
Nennkapazität: 0,4 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 1<br />
Produkt: CDRI<br />
Inbetriebnahme: 1971<br />
DRIC, Dammam, Saudi-Arabien<br />
Beide Module von DRIC in Dammam,<br />
Saudi-Arabien, arbeiteten 2020 über<br />
der Nennkapazität und lagen innerhalb<br />
von 5 Prozent des jährlichen<br />
Produktionsrekords (aufgestellt 2019)<br />
von 1,09 Millionen Tonnen DRI. Modul<br />
1 stellte im Oktober 2020 einen<br />
neuen monatlichen Produktionsrekord<br />
auf. Beide Module brachen auch<br />
Rekorde bei der durchschnittlichen<br />
Stundenproduktivität und übertrafen<br />
zusammen die 10-Millionen-Tonnen-Marke<br />
seit der ersten Inbetriebnahme<br />
im Jahr 2007.<br />
Nennkapazität: 1,0 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 2<br />
Produkt: CDRI<br />
Inbetriebnahme: 2007<br />
Bilder (6): Midrex, Vit-Mav/Shutterstock.com<br />
24 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
EZDK, El Dikheila, Ägypten<br />
Alle drei Midrex-DRI-Anlagen beim ägyptischen Stahlhersteller EZDK arbeiteten<br />
im Jahr 2020 über der Nennkapazität. Im Jahr des 20-jährigen Betriebsjubiläums<br />
lag das Modul 3 des Unternehmens nur 10 Prozent unter seinem Produktionsrekord.<br />
Modul 2 war 8 350 Stunden in Betrieb und überschritt gegen Ende<br />
des vergangenen Jahres die 20-Millionen-Tonnen-Marke an produziertem DRI.<br />
Nennkapazität: 2,32 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 3<br />
Produkt: CDRI<br />
Inbetriebnahme: 1986, 1997, 2000<br />
JSW Dolvi Works, Raigad, Indien<br />
In ihrem nunmehr 26. Betriebsjahr hat die<br />
Midrex-DRI-Anlage von JSW Dolvi ihre<br />
jährliche Nennkapazität überschritten.<br />
2014 installierte JSW ein System zur Senkung<br />
des Erdgasverbrauchs durch die Zuführung<br />
von Koksofengas zum Schachtofen.<br />
Die Lösung war das ganze Jahr über<br />
im Betrieb und deckte 11 Prozent des<br />
Energiebedarfs des Werks. Im Jahr 2020<br />
überschritt die Anlage zudem den Meilenstein<br />
von 30 Millionen Tonnen und war seit<br />
seiner Inbetriebnahme durchschnittlich<br />
8 025 Stunden pro Jahr in Betrieb.<br />
Nennkapazität: 1,0 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 1<br />
Produkt: CDRI<br />
Inbetriebnahme: 1994<br />
Jindal Shadeed,<br />
Sohar, Oman<br />
Im Jahr 2020 lag die DRI-Anlage bei<br />
Jindal Shadeed in Sohar, Oman 15 Prozent<br />
über der Nennkapazität und nur 1<br />
Prozent unter dem Produktionsrekord<br />
von 2019. Die Anlage war im Jahr 2020<br />
8 389 Stunden in Betrieb und stellte<br />
im März einen neuen monatlichen<br />
Produktionsrekord auf. Das Modul ist<br />
hauptsächlich für die Produktion von<br />
HDRI ausgelegt, mit HBI als sekundärem<br />
Produktstrom. Ein Großteil (etwa<br />
93 Prozent) der Jahresproduktion von<br />
über 1,7 Millionen Tonnen wurde als<br />
HDRI im angrenzenden Stahlwerk von<br />
Jindal Shadeed verbraucht. Das Unternehmen<br />
hat seit seiner Inbetriebnahme<br />
vor 10 Jahren bei einer durchschnittlichen<br />
Betriebszeit von 8 222 Stunden<br />
pro Jahr mehr als 15 Millionen Tonnen<br />
DRI produziert.<br />
Nennkapazität: 1,5 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 1<br />
Produkt: HDRI/HBI<br />
Inbetriebnahme: 2011<br />
Lebedinsky GOK, Gubkin, Russland<br />
Die Midrex-HBI-Module 2 und 3 von LGOK in Gubkin, Russland haben 2020 neue jährliche<br />
und monatliche Produktionsrekorde aufgestellt, wobei sie rund 8 100 Stunden in<br />
Betrieb waren. Das HBI-3 hat die Marke von 2 Millionen Tonnen pro Jahr überschritten,<br />
wobei es sich laut Midrex um die bisher höchste Jahresproduktion eines HBI-Moduls<br />
und eines 7,0-Meter-Midrex-Schachtofens handelt. Auch brach jenes Modul damit<br />
seinen jährlichen Produktionsrekord im vierten Jahr in Folge. Mit einer Gesamtproduktion<br />
von fast 27 Millionen Tonnen haben beide Module im Jahr 2020 die 25-Millionen-<br />
Tonnen-Marke überschritten. LGOK HBI-1 wird mit dem HYL-Verfahren betrieben, das<br />
gemeinsam von den italienischen Anlagenbauern Tenova und Danieli entwickelt wurde.<br />
Nennkapazität: 3,2 Mt/Jahr<br />
Schachtöfen: 2<br />
Produkt: HBI<br />
Inbetriebnahme: 2004, 2017<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 25
POLITIK<br />
MÄRKTE<br />
Roh<strong>stahl</strong>herstellung<br />
Roh<strong>stahl</strong>erzeugung nach Regionen<br />
Juli <strong>2021</strong><br />
Millionen Tonnen<br />
Top Ten der <strong>stahl</strong>produzierenden Länder<br />
Juli <strong>2021</strong><br />
Millionen Tonnen<br />
% Veränderung<br />
Juli 21/20<br />
Asien und Ozeanien 116.4 10.9<br />
EU (27) 13.0 20.1<br />
Nordamerika 10.2 18.7<br />
GUS 9.2 9.0<br />
Europa außer EU 4.1 15.5<br />
Südamerika 3.8 26.3<br />
Mittlerer Osten 3.6 10.0<br />
Afrika 1.3 29.2<br />
Total 64 countries 161.7 12.4<br />
% Veränderung<br />
Juli 21/20<br />
China 86.8 8.0<br />
Indien 9.8 28.7<br />
Japan 8.0 16.2<br />
USA 7.5 18.5<br />
Russland 6.7 e 9.2<br />
Südkorea 6.1 8.7<br />
Deutschland 3.0 18.9<br />
Türkei 3.2 17.7<br />
Brasilien 3.0 22.0<br />
Iran 2.6 e 9.9<br />
Die 64 in der Tabelle zusammengefassten<br />
Länder machten 2019 etwa 99 Prozent der<br />
gesamten weltweiten Roh<strong>stahl</strong>produktion<br />
aus. Regionen und Länder, die unter die<br />
Tabelle fallen:<br />
• Afrika: Ägypten, Libyen, Südafrika<br />
• Asien und Ozeanien: Australien, China,<br />
Indien, Japan, Neuseeland, Pakistan,<br />
Südkorea, Taiwan (China), Vietnam<br />
• GUS: Weißrussland, Kasachstan, Moldawien,<br />
Russland, Ukraine, Usbekistan<br />
• Europäische Union (27)<br />
• Europa, Sonstiges: Bosnien-Herzegowina,<br />
Mazedonien, Norwegen, Serbien, Türkei,<br />
Vereinigtes Königreich<br />
• Naher Osten: Iran, Katar, Saudi-Arabien,<br />
Vereinigte Arabische Emirate<br />
• Nordamerika: Kanada, Kuba, El Salvador,<br />
Guatemala, Mexiko, USA<br />
• Südamerika: Argentinien, Brasilien, Chile,<br />
Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru,<br />
Uruguay, Venezuela<br />
e - geschätzt. Die Rangliste der Top-10-Erzeugerländer basiert auf dem Gesamtwert seit Jahresbeginn.<br />
Damaszener Stahl<br />
Manfred Sachse, der „große, alte Meister“<br />
und Kenner des Damastschmiedens liefert<br />
aufschlussreiche, neue Recherchen zur<br />
berühmten Solinger Klingenproduktion.<br />
Auch in englischer<br />
Sprache erhältlich:<br />
www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de/<br />
product/damascussteel/<br />
Damaszener Stahl | Mythos, Geschichte, Technik, Anwendung<br />
€ 79,00<br />
3. erweiterte Auflage | 25,6 x 31,9 cm | 304 Seiten mit zahlreichen<br />
farbigen Abbildungen und technischen Zeichnungen<br />
Entdecken Sie jetzt die dritte, erweiterte Auflage seines erfolgreichen Werks!<br />
Bestellung unter www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de/product/damaszener-<strong>stahl</strong>/
+<br />
+<br />
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Automotive<br />
VERZINKUNG UND<br />
NEUE STÄHLE (1/2)<br />
Die Stahlsortenvielfalt bestimmt den Wettbewerb beim Leichtbau im Automobilsektor.<br />
Eine neue Generation von weichen Stählen zum Kaltumformen mit einer Schmelztauchveredelung<br />
steht in den Startlöchern.<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
TEIL 1<br />
+<br />
+<br />
+<br />
Bild: Vladimir Mulder/www.shutterstock.com<br />
Die Bandverzinkung weist gegenüber der Stückverzinkung<br />
eine Reihe von technischen und ökonomischen Vorteilen auf.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 43
WISSENSCHAFT<br />
TECHNIK<br />
Automotive<br />
AUTOREN: Thomas Schulz, Thorsten<br />
Müller, MET/Con.<br />
thorsten.mueller@sms-group.com<br />
DARUM GEHT’S: Die Bandverzinkung<br />
hat ihre Wurzeln in Polen und<br />
blickt mittlerweile auf eine 90-jährige<br />
Historie zurück. Seit der Grundgüte<br />
aus den beginnenden 1960er<br />
Jahren gab es eine stetige Entwicklung,<br />
die seit der aktuellen Supertiefziehgüte<br />
(DX57D) aus dem Jahre<br />
2004 aber eingeschlafen scheint, wie<br />
die Autoren zeigen. Technische,<br />
aber auch umweltpolitische Aspekte<br />
können aber zu einer Wiederbelebung<br />
führen.<br />
Im Jahr 1931 wurde durch den polnischen<br />
Ingenieur und Erfinder Tadeusz<br />
Sendzimir die erste Anlage<br />
zur Bandverzinkung in Polen gebaut.<br />
Dieser und einer zweiten Anlage in<br />
Polen folgten zeitgleich Anlagen in<br />
Frankreich, Großbritannien und den<br />
USA. 1952 wurde durch Ostrilion in<br />
Buenos Aires (Argentinien) die erste<br />
kontinuierliche Bandverzinkungsanlage<br />
errichtet. Im Verlaufe der 1950er<br />
Jahre folgten sechs weitere kontinuierliche<br />
Bandverzinkungsanlagen. Später<br />
wurden diese auch als Schmelztauchveredlungsanlagen<br />
bezeichnet, die auf<br />
dem Sendzimirverfahren basieren.<br />
Ausgangspunkt für diese technische<br />
Entwicklung war der zunehmende Bedarf<br />
an Stählen mit einem Korrosionsschutz<br />
im Bereich der Bauindustrie<br />
und bei den Profilierern. In Deutschland<br />
wurde erstmalig 1959 eine kontinuierliche<br />
Breitband-Schmelztauchverzinkung<br />
bei der damaligen August-Thyssen-Hütte<br />
AG in Duisburg in Betrieb<br />
genommen.<br />
Vorteile durch<br />
Bandverzinkung<br />
Durch den Übergang von der Stückverzinkung<br />
zur Bandverzinkung ergaben<br />
sich eine Vielzahl von technischen und<br />
ökonomischen Vorteilen. Die Qualität<br />
des oberflächenveredelten Feinblechs<br />
konnte entscheidend verbessert werden.<br />
Dieser vor Korrosion geschützte Stahl<br />
eignete sich jetzt auch für schwierige<br />
Umformvorgänge, wie Streckziehen<br />
und Tiefziehen. Der automobile Einsatz<br />
entwickelte sich zunehmend, da die<br />
„vollverzinkte“ Karosserie im Fokus der<br />
Automobilindustrie stand. Der Motor<br />
dabei war der Autohersteller Porsche.<br />
Anlagenspezifische Übersicht über<br />
die Anzahl von in Betrieb genommenen<br />
Anlagen<br />
Zwischen 2000 und 2009 wurde bislang einmal die Anzahl von 300<br />
hochgefahrenen Anlagen überschritten<br />
Abb. 1: Die Übersicht differenziert nach kontinuierlichen Schmelztauchveredelungsanlagen<br />
(CGL), kontinuierlichen Durchlaufglühanlagen (CAL), kontinuierlichen<br />
elektrolytischen Verzinkungsanlagen (ECL) sowie diskontinuierlichen Haubenglühanlagen<br />
(BAF). [1]<br />
Abb. 1 zeigt auf Grundlage der ehemaligen<br />
VDEh Plantfacts die Anzahl der in<br />
Betrieb genommenen Anlagen, Die Dominanz<br />
der Schmelztauchveredlungsanlagen<br />
ist sehr deutlich zu erkennen.<br />
Abb. 2 zeigt, basierend auf die ehemaligen<br />
VDEh Plantfacts [1] , eine anlagenspezifische<br />
Übersicht über die Jahreskapazitäten<br />
von in Betrieb genommenen<br />
Anlagen nach den Jahrzehnten<br />
betrachtet.<br />
Neue Motivation durch<br />
Umweltbewusstsein?<br />
Zwischen der Grundgüte aus den beginnenden<br />
1960er Jahren und der aktuellen<br />
Supertiefziehgüte (DX57D) aus dem<br />
Jahre 2004 gab es eine stetige Entwicklung,<br />
die in den letzten 17 Jahren jedoch<br />
zum Erliegen kam. Der DC07 (nicht<br />
schmelztauchveredelte Supertiefziehgüte)<br />
betrat erst im Februar 2007 die normative<br />
Bühne. Die Gründe für eine mangelnde<br />
Motivation zur Weiterentwicklung<br />
dieser Stahlfamilie liegen zum<br />
einen im Erreichen der technischen<br />
Möglichkeiten bei der Stahlherstellung<br />
entlang der gesamten Prozesskette, zum<br />
anderen an der geringen Bereitschaft<br />
der Stahlanwender, die mit einer Weiterentwicklung<br />
verbundenen höheren<br />
Kosten (Gütepreisaufschlag) zahlen zu<br />
wollen.<br />
Der notwendige Wandel im Umweltbewusstsein<br />
und der damit verbundenen<br />
Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge,<br />
zur deutlichen Reduzierung des<br />
CO 2 -Ausstoßes, könnte mit den modernen<br />
Schmelztauchveredelungsanlagen<br />
der Motivator für einen Neustart in<br />
Richtung einer Ultratiefziehgüte<br />
(DX58D) und Extremtiefziehgüte<br />
(DX59D) sein. Die zur Beschreibung der<br />
Stahlgruppe verwendeten mechanischen<br />
Basiskennwerte, wie Streck-/<br />
Dehngrenze, Zugfestigkeit, Bruchdehnung,<br />
Verfestigungsexponent und senkrechte<br />
Anisotropie, werden unter anderem<br />
durch die Wärmebehandlung in der<br />
Schmelztauchveredelungsanlage variiert.<br />
Der dafür maßgeblich beeinflussende<br />
Glühzyklus ist eine Temperatur-Zeit-<br />
Funktion.<br />
In Abb. 3 sind drei Generationen von<br />
kontinuierlichen Durchlaufglühanlagen<br />
mit und ohne Schmelztauchveredelung<br />
und deren Glühzyklen schematisch dargestellt.<br />
Es verdeutlicht, dass das Feinblech<br />
in den modernen Anlagen ein<br />
Vielfaches mehr Zeit zum Verweilen<br />
Quellen: MET/Con<br />
44 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Anlagenspezifische Übersicht über<br />
die Jahreskapazitäten<br />
Nur zwei Verfahren konnten eine Kapazität von 30 Mio. t überschreiten<br />
Abb. 2: Seit den 1960er-Jahren lag CGL nur einmal auf dem zweiten Platz. [1]<br />
• Güte I (Grundgüte)<br />
„Feuerverzinktes Feinblech das für die<br />
Herstellung von einfachen Profilformen,<br />
z.B. Trapezblech, Wellblech,<br />
Stahldachpfannen geeignet ist. Dieses<br />
Material ist auch für einfache handwerkliche<br />
Verformungen zu verwenden.<br />
Maschinelle Falzungen z.B. Pittsburgh-Falze,<br />
lassen sich im Allgemeinen<br />
einwandfrei bis zu einer Nenndicke<br />
von maximal 0,9 mm und den<br />
Zinkauflagengruppen 001 bis 350 herstellen.<br />
Falzmaschinen stellen jedoch<br />
hohe Anforderungen an die Verformbarkeit<br />
des feuerverzinkten Feinbleches.<br />
Wenn die Verformungsgeschwindigkeit<br />
und die Einstellung und Form<br />
der Rollensätze den Materialeigenschaften<br />
angepaßt sind, entstehen keine<br />
Schwierigkeiten bei der Verarbeitung.“<br />
• Güte II (Maschinenfalzgüte)<br />
„Feuerverzinktes Feinblech dieser Güte<br />
ist besonders geeignet für maschinelle<br />
Falzungen und normale Profilierungen.<br />
hat, welches sich dominierend auf die<br />
erreichbaren mechanischen Kennwerte<br />
auswirkt.<br />
Normative<br />
Ausgehend von der ASTM 525 „Specification<br />
for General Requirements for<br />
Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) by<br />
the Hot-Dip Process” [2] traten fünf Stahlsorten<br />
namentlich auf den deutschen<br />
Markt, ohne dass es eine nationale, normative<br />
Grundlage gab.<br />
Durchlaufglühanlagen und<br />
deren Glühzyklen<br />
Drei Generationen im Vergleich<br />
Güte I<br />
Güte II<br />
Güte III<br />
Güte IV<br />
Güte V<br />
Grundgüte<br />
Maschinenfalzgüte<br />
Ziehgüte<br />
Tiefziehgüte<br />
Tiefziehgüte<br />
alterungsbeständig)<br />
In einer Anwenderinformation des<br />
Deutschen Verzinkerei Verbandes<br />
(DVV) wurden die fünf Güten hinsichtlich<br />
Ihres vorgesehenen Verwendungszweckes<br />
und ihrer besonderen Verarbeitungsmerkmale<br />
beschrieben, um<br />
dem Verarbeiter bzw. dem Verbraucher<br />
von feuerverzinktem Feinblech in Tafeln<br />
und Rollen, über den damaligen<br />
Stand der Liefermöglichkeiten zu informieren.<br />
[3] Diese Unterlage wurde dann<br />
Grundlage der Bestellung („Bestellung<br />
nach DVV“), siehe Tabelle 1.<br />
Abb. 3: Schematische Glühkurve einer kontinuierlichen Durchlaufglühanlage mit<br />
(CGL) und ohne (CAL) Schmelztauchveredlung (Temperatur-Zeit-Verlauf)<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 45
STYLE<br />
STORY<br />
Technikgeschichte<br />
Mit dem Bau des Schwarzenberggebläses<br />
erreichte der Freiberger<br />
Maschinendirektor Christian<br />
Friedrich Brendel die damaligen<br />
Grenzen der Leistungsfähigkeit<br />
der Gießereitechnik.<br />
190 Jahre<br />
Schwarzenberggebläse<br />
ein Technikdenkmal auf der „Alten Elisabeth" in Freiberg<br />
AUTOR: Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd<br />
Grabow<br />
DARUM GEHT’S: Das Deutsche Museum<br />
in München ist zwar das eigentliche<br />
„Technikgedächtnis“ Deutschlands, aber<br />
er erinnert sich nicht an alles. Eine Lücke<br />
ist das 1831 gebaute Schwarzenberggebläse,<br />
das aufgrund von Raummangel<br />
nicht nach Bayern umziehen durfte. Seit<br />
1936 steht eines der historisch bedeutendsten<br />
Werke deutscher Maschinenbaukunst<br />
am Schacht Elisabeth in Freiberg.<br />
Unser Gastautor Prof. Dr.-Ing. habil.<br />
Gerd Grabow stellt das<br />
Technikdenkmal vor.<br />
Eines der geschichtlich bedeutendsten<br />
Werke deutscher Maschinenbaukunst<br />
ist das in den Jahren 1830 und<br />
1831 gebaute Hochofengebläse mit Wasserradantrieb<br />
der Staatlichen Sächsischen<br />
Halsbrücker Hüttenwerke. Das Gebläse<br />
wurde vom Freiberger Maschinendirektor<br />
Christian Friedrich Brendel konstruiert.<br />
Der Bau erfolgte auf der dem Bergkommissionsrat<br />
Lattermann gehörenden vogtländischen<br />
Eisenhütte „Morgenröthe". Im Juli<br />
1831 wurde das Gebläse in der Antonshütte<br />
bei Schwarzenberg in Betrieb genommen.<br />
Es war dort von 1831 bis 1860 und<br />
von 1862 bis 1925 in der Halsbrücker Hütte<br />
bei Freiberg im Einsatz. Das Gebläse<br />
steht heute als historisches Kulturdenkmal<br />
auf der „Alten Elisabeth" in Freiberg.<br />
Aufbau des Gebläses<br />
Das Hochofengebläse ist eine doppeltwirkende<br />
Kolbenmaschine mit drei vertikal<br />
angeordneten Zylindern. Es liefert einen<br />
Luftvolumenstrom von 45,5 m3/min auf<br />
einen Druck von 50 mmHg bei einer Antriebsdrehzahl<br />
von 10,5 U/min.<br />
Die Antriebsleistung beträgt P= 10,3 kW<br />
und wird von einem oberschlächtigen Wasserrad<br />
über eine Kupplung auf die Kurbelwelle<br />
übertragen. Das Drehmoment wirkt<br />
von der Kurbelwelle auf die Schubstangen,<br />
und über Rollenkreuzköpfe werden die<br />
Kräfte auf die Kolben weitergeleitet. Der<br />
Kolbendurchmesser beträgt 850 mm, der<br />
Kolbenhub 1 416 mm. Die Maschine hat<br />
eine Gesamtmasse von 33 t.<br />
Auffällig sind die aus der Architektur der<br />
damaligen Zeit übernommenen neugotischen<br />
Bauformen. Der äußere Aufbau des<br />
Gebläses, das einschließlich seines Fundamentes<br />
eine Höhe von 7,5 m besitzt, wirkt<br />
imposant. Das Maschinengestell mit seinen<br />
zwölf über 4,5 m hohen gusseisernen kapitellgeschmückten<br />
Säulen und seinen sechs<br />
Zwischenbogenwänden mit neogotischen<br />
Ornamenten ist besonders wuchtig.<br />
Eigenartig in ihrer Gegensätzlichkeit<br />
wirken die Verzierungen. Sie waren eine<br />
Besonderheit für den sich im 19. Jahrhundert<br />
entwickelnden Maschinenbau. Damit<br />
wurde zum Ausdruck gebracht, wie es die<br />
Kunstmeister verstanden haben, mit dem<br />
spröden Werkstoff Guss<strong>eisen</strong> umzugehen<br />
und das Maschinengestell zu einem starren,<br />
kastenförmigen Gebilde zu formen,<br />
das hohe Belastungen aufnehmen konnte.<br />
Mit dem Bau des Gebläses wurde zur damaligen<br />
Zeit die Grenze der Leistungsfähigkeit<br />
der Gießereitechnik erreicht. Gussstücke<br />
von dieser Feinheit in der Formgestaltung<br />
waren bis dahin noch nicht<br />
hergestellt worden.<br />
Brendel war bei dem Entwurf neue<br />
Wege gegangen, sodass es galt, beim Bau<br />
In Freiberg erinnert eine Gedenktafel<br />
an Christian Friedrich Brendels Haus an<br />
die Lebensdaten des Konstrukteurs des<br />
Schwarzenberg-Gebläses<br />
Foto groß: Ingo Berg, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons; Foto klein: Unukorno, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons<br />
62 August <strong>2021</strong> <strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de
Foto oben: NN, Public domain, via Wikimedia Commons; Foto unten: Malenki, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons<br />
Bergkommissionsrat Heinrich Ludwig Lattermann<br />
war Inhaber der vogtländischen<br />
Eisenhütte „Morgenröthe“, wo Guss und<br />
Bau des Gebläses erfolgten.<br />
viele unvorhergesehene Schwierigkeiten<br />
zu überwinden. Dass auch die einfachsten<br />
Konstruktionen ihren Zweck erfüllten, beweist<br />
der Umstand, dass das Gebläse annähernd<br />
100 Jahre fast ununterbrochen in<br />
Betrieb war und den Hütten bei der Bereitstellung<br />
von Luft für die Schmelzöfen wertvolle<br />
Dienste geleistet hat.<br />
Baugeschichte des Gebläses<br />
In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts<br />
war der Plan entstanden, neben den<br />
bei Freiberg gelegenen Hüttenwerken Muldenhütten<br />
und Halsbrücke noch ein Werk<br />
im oberen Erzgebirge aufzubauen, um die<br />
in dieser Gegend gefundenen Erze verhütten<br />
zu können, ohne sie erst weit transportieren<br />
zu müssen. Aus diesem Grunde<br />
wurde in den Jahren 1828 bis 1831 im<br />
Schwarzwassertal zwischen Schwarzenberg<br />
und Johanngeorgenstadt die „Königliche<br />
Antonshütte" erbaut.<br />
Der Freiberger Maschinendirektor Brendel,<br />
der es ausgezeichnet verstand, die<br />
technischen Fortschritte für die ihm unterstellten<br />
Werke auszunützen, schlug im<br />
Jahre 1829 dem Oberhüttenamt vor, in das<br />
neu errichtete Werk sofort ein gusseisernes<br />
Zylindergebläse zu installieren. Brendel<br />
stützte sich bei seinem Vorschlag auf die<br />
guten Erfahrungen, die an einem gleichartigen<br />
Gebläse in Muldenhütten und auch<br />
an anderen Stellen z.B. an einem in Gröditz<br />
aufgestellten Zylindergebläse, hatten gesammelt<br />
werden können. Wenn man heute<br />
nach 190 Jahren resümiert, so muss man<br />
den Weitblick des Ingenieurs Brendel bewundern,<br />
der die viel höheren Kosten und<br />
das damit verbundene Risiko für eine moderne<br />
Einrichtung nicht scheute.<br />
Am 9. März 1831 erfolgte die Übernahme<br />
des Gebläses in Morgenröthe. In einem<br />
Bericht an das Oberhüttenamt sprach sich<br />
Brendel sehr lobend über die gute Arbeit<br />
bei der Herstellung der Maschine aus. Die<br />
Montage der einzelnen Maschinenteile und<br />
die Aufstellung der gesamten Maschine<br />
nahm viel Zeit in Anspruch. Am 19. Juni<br />
1831 war es soweit. Man ließ das Gebläse<br />
zum ersten Mal mit Wasserkraft mehrere<br />
Stunden mit 5 Umdrehungen pro Minute<br />
versuchsweise laufen. Bei wenig Aufschlagwasser<br />
zeigte sich ein gleichförmiger, ruhiger<br />
Lauf der Maschine. Daraufhin entschloss<br />
man sich in Halsbrücke, am 4. Juli<br />
1831, mit dem Betrieb der Königlichen<br />
Antonshütte offiziell zu beginnen.<br />
Betriebsgeschichte des Gebläses<br />
Über den Betrieb des Gebläses auf der Antonshütte<br />
finden sich in den Akten nur<br />
wenige Vermerke, da die Maschine ohne<br />
nennenswerte Beanstandungen lief. Mit<br />
dem Betrieb der Königlichen Antonshütte<br />
hatte man allgemein nach ihrer Errichtung<br />
Schwierigkeiten. Der Bergbau im Obererzgebirge<br />
wurde immer weniger lohnend,<br />
und eine Grube nach der anderen wurde<br />
stillgelegt. Infolgedessen erhielt die Antonshütte<br />
bei weitem nicht mehr so viel<br />
Erz wie anfänglich. Das führte dazu, dass<br />
1844 zeitweise eine Stillsetzung des Betriebes<br />
erfolgte. Im Jahre 1848 entschloss<br />
sich das Oberhüttenamt, die Antonshütte<br />
wieder in Betrieb zu nehmen. Damit war<br />
auch die aufgezwungene Ruhepause für<br />
das Gebläse zu Ende.<br />
1862 erfuhr man, dass in den Hüttenwerken<br />
Halsbrücke durch Veränderungen<br />
im Produktionsprozess eine Erhöhung der<br />
Gebläseleistung für den Betrieb der<br />
Schmelzöfen erforderlich wurde. Demzufolge<br />
war es naheliegend, das Antonshütter<br />
Gebläse zu übernehmen, da sich diese Maschine<br />
langjährig bewährt hatte und die<br />
Kosten für die Neuanschaffung eines Gebläses<br />
wesentlich höher liegen würden.<br />
Am 19. März 1862 reichte der Kunstmeister<br />
Schwamkrug einen Kostenanschlag für<br />
die Überführung des Gebläses von Antonshütte<br />
nach Halsbrücke an das Oberhüttenamt<br />
ein. Nach nunmehr 30 Jahren erfolgte<br />
die Umsetzung des alten Gebläses nach<br />
Halsbrücke.<br />
Neben dem Antonshütter Gebläse arbeitete<br />
gleichzeitig das in den Jahren 1836<br />
und 1837 erbaute Balanciergebläse und gab<br />
zu keinen ernsten Klagen Anlass.<br />
Eines Tages genügten die beiden Veteranen<br />
doch nicht mehr den zunehmenden<br />
Anforderungen, die von Seiten der Hochöfen<br />
an sie gestellt wurden. Es waren nunmehr<br />
schon 50 Jahre nach der Aufstellung<br />
des Gebläses in Halsbrücke und sogar 80<br />
Jahre nach seiner Erbauung vergangen, als<br />
am 10. März 1911 von der Halsbrücker<br />
Schmelzhütte ein Bericht über die Gebläseleistung<br />
der Hütte an das Oberhüttenamt<br />
abgegeben wurde, in dem zum Ausdruck<br />
kam, dass wegen der erhöhten Anforderungen<br />
und infolge von Veränderungen im<br />
Hüttenprozess zusätzlich ein Reserveturbogebläse<br />
eingebaut werden sollte. Trotz<br />
des Einsatzes des Kreiselgebläses vergingen<br />
noch 14 Jahre, ehe das Schwarzenberg-Gebläse<br />
im Oktober 1925 stillgesetzt werden<br />
konnte.<br />
Fazit<br />
Es ist das besondere Verdienst von Professor<br />
Fritzsche, dass er das Gebläse nach dem<br />
Stillsetzen in Halsbrücke, später im Jahre<br />
1936, auf der Halde der Grube „Alte Elisabeth",<br />
eines der meistbesuchten Anschauungsobjekte<br />
aus der Geschichte der Produktivkräfte<br />
im Hüttenwesen, aufstellte.<br />
Trotz des vielen, uns heute überflüssig<br />
erscheinenden Zierrates erkennt man, wie<br />
meisterhaft es die Erbauer, der Oberkunstmeister<br />
Brendel und der Eisenwerkbesitzer<br />
Lattermann, verstanden haben, Zweck und<br />
Formschönheit zu vereinen, ohne dass das<br />
Gesamtbild des Schwarzenberggebläses<br />
gestört wird.<br />
Die Schachtanlage „Alte Elisabeth“ in der Nähe der Freiberger Altstadt ist seit 1936 die<br />
Heimat des Schwarzenberggebläses.<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 63
Technologie, Forschung,<br />
Märkte und Menschen!<br />
DER Stahl-Newsletter!<br />
Ihr täglicher Info-Kanal.<br />
Jetzt anmelden: www.<strong>stahl</strong><strong>eisen</strong>.de<br />
<strong>stahl</strong>und<strong>eisen</strong>.de August <strong>2021</strong> 35