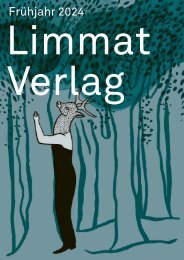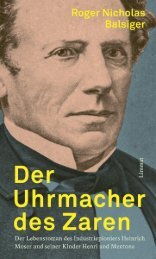frauenhaus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Christina Caprez<br />
Wann, wenn<br />
nicht jetzt<br />
Das Frauenhaus in Zürich<br />
Herausgegeben von der<br />
Stiftung Frauenhaus Zürich<br />
Limmat Verlag<br />
Zürich
9 Vorwort<br />
Geschichte 13<br />
Mitte der 1970er-Jahre<br />
14 Die Frauenbewegung entdeckt ein neues Thema<br />
1977–1979<br />
25 Misshandelte Frauen zu beraten reicht nicht<br />
1979–1983<br />
34 Die Herkulesarbeit des Aufbaus<br />
1983–1986<br />
49 Richtungskampf und erste Strukturdiskussionen<br />
1986–1992<br />
62 Das Frauenhaus als Seismograf<br />
1992–1995<br />
71 Rassismus – (k)ein Thema unter Feministinnen<br />
1995–2001<br />
80 Die Stadt wird aktiv<br />
2001–2007<br />
95 Identitätskrise, Schliessung und Neueröffnung<br />
2007–2013<br />
110 Öffentliche Anerkennung und ein Abschied<br />
2013–2019<br />
118 Ins Frauenhaus – und dann?<br />
Die 2020er-Jahre und darüber hinaus<br />
130 Das Frauenhaus der Zukunft
Erfahrungen 145<br />
146 «Für mich gibt es ein Leben vor und eines<br />
nach dem Frauenhaus»<br />
158 «Im Frauenhaus galten Oliven als Luxusprodukt»<br />
165 «Wenn ich mich getrennt hätte, wäre ich<br />
ausgeschafft worden»<br />
174 «Entweder ich gehe jetzt, oder ich bin in zwei<br />
Wochen eine Schlagzeile»<br />
184 «Im Frauenhaus zu sein, ist für mich und<br />
meine Kinder ein Segen»<br />
189 «Früher dachten viele: Im Frauenhaus arbeiten alles<br />
linke Weiber mit selbst gestrickten Socken»<br />
195 «Freisprüche sind leider häufig»<br />
202 «Das Problem häusliche Gewalt ist nicht gelöst,<br />
wenn man den Täter inhaftiert»<br />
211 «Die Männer streiten die Gewalttat oft ab»<br />
Suna Yamaner<br />
253 Gesellschaftlicher Diskurs über häusliche Gewalt<br />
Susan A. Peter<br />
262 Erinnern als gelebte politische Praxis<br />
Anhang 287<br />
288 Zeitzeuginnen und Fachleute<br />
292 Stiftungsrätinnen seit 1981<br />
293 Literatur- und Quellenverzeichnis<br />
298 Die Autorin<br />
298 Dank<br />
Hintergrund 221<br />
Regula Kägi-Diener<br />
222 Schutz vor Gewalt: Rechtliches<br />
Maritza Le Breton<br />
233 Migrantinnen im Spannungsfeld von Migration<br />
und Gewalt gegen Frauen<br />
Bea Rüegg / Erika Haltiner<br />
245 Fachliche Hilfe für gewalt betroffene Frauen und Kinder
Vorwort<br />
Rund zwei Jahre ist es her, dass wir uns im Stiftungsrat der Stiftung<br />
Frauenhaus Zürich die Frage stellten, wie wir das 40-Jahr-Jubiläum<br />
der Stiftung zu feiern gedenken. Zeitgleich musste der Keller des<br />
langjährigen Bürogebäudes wegen einer Totalsanierung geräumt<br />
werden. Wie so häufig führte das eine zum anderen, und den Stiftungsrätinnen<br />
war bald klar, dass jetzt der Moment war, die alten<br />
Archivschachteln zu sichten, zu sortieren und die Geschichte der<br />
Stiftung in einem Buch zu würdigen. Um das Verständnis für die<br />
eigene Geschichte zu schärfen und einen Beitrag zum Wissenstransfer<br />
zu leisten, aber auch, um das Geleistete einem breiteren Publikum<br />
zugänglich zu machen. Im Namen des gesamten Stiftungsrats<br />
bedanke ich mich herzlich, sowohl bei Nathalie Widmer, die das<br />
fast 45-jährige Material archivarisch aufgearbeitet hat, als auch bei<br />
der Projektgruppe für ihren grossen Einsatz für dieses Buch: Christina<br />
Caprez, Autorin, Liliane Studer, Lektorin und in den 1970er-<br />
Jahren beim Aufbau des Berner Frauenhauses mit dabei, sowie<br />
Susan A. Peter, die Geschäftsführerin unserer Stiftung – sowohl<br />
für die Geschichte der Stiftung als auch für dieses Buch unersetzbar.<br />
Das Resultat spricht für sich.<br />
Unser Dank gilt aber auch allen ehemaligen engagierten Gründungsfrauen<br />
bzw. Mitarbeiterinnen, allen Vorstandsfrauen sowie<br />
den ehemaligen wie den heutigen Stiftungsrätinnen. «Wann, wenn<br />
nicht jetzt?», fragten sich die Frauen des Vereins zum Schutz misshandelter<br />
Frauen und deren Kinder, als sie in den 1970er-Jahren<br />
in Zürich eines der ersten Frauenhäuser der Schweiz eröffneten.<br />
Ihr Pionierinnengeist und ihr langjähriges Engagement für das<br />
Frauenhaus bleiben auch aus heutiger Perspektive beeindruckend.<br />
Die Stiftung bietet heute ein professionelles Kriseninterventionsangebot<br />
für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder und stellt<br />
sich regelmässig die Frage, wie der Opferschutz noch besser und<br />
9
nachhaltiger werden kann. So hat die Stiftung denn auch ab 2015<br />
ein erstes Postventionsangebot in der Schweiz für Klientinnen und<br />
deren Kinder nach ihrem Frauenhausaufenthalt konzipiert und<br />
umgesetzt, das VistaNova. Wie zu Pionierinnenzeiten – und doch<br />
im Heute – ist es der Stiftung ein grosses Anliegen, stets mit hörbarer<br />
Stimme das Thema parteilich, feministisch und mit wachem<br />
Auge zu vertreten und den von Gewalt betroffenen Frauen und<br />
Kindern damit Gehör zu verschaffen.<br />
Nach wie vor verstehen wir als Stiftung die konkrete Arbeit im<br />
Alltag auch als Auftrag, das Problem der Gewalt an Frauen in der<br />
Öffentlichkeit bewusster zu machen. Heute streitet zwar kaum jemand<br />
mehr ab, dass Gewalt gegen Frauen existiert. Und doch bleibt<br />
es unsere Kernaufgabe, betroffenen Frauen und ihren Kindern<br />
einen Ort anzubieten, der Zuflucht und Sicherheit garantiert – immer<br />
dann, wenn sie sich die Frage stellen müssen: Wann, wenn<br />
nicht jetzt, brauche ich Schutz? Auch wenn es immer noch Menschen<br />
gibt, die weiterhin meinen, dass es sich bei häuslicher Gewalt<br />
um individuelle Schicksale handelt. Der Stiftung ist es darum ein<br />
grosses Anliegen, die individuell erlebte Gewalt von Frauen auch<br />
im grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang zu sehen und zu<br />
den notwendigen politischen Debatten anzuregen, um strukturelle<br />
Veränderungen zu erreichen. Denn Gewalt gegen Frauen hat<br />
nicht nur viele Formen, sie hat System, gestern, heute und auch<br />
morgen noch.<br />
In diesem Sinne bedanken wir uns mit dem Buch bei allen an<br />
der Geschichte der Stiftung interessierten Leser:innen, allen Spender:innen,<br />
den Zusammenarbeitspartner:innen und all jenen, die<br />
das grosse Problem Gewalt gegen Frauen und Kinder und häusliche<br />
Gewalt ernst nehmen und zu einer Gesellschaft ohne Gewalt beitragen.<br />
Heute bieten sich sowohl für die Stiftung als auch für die<br />
Schweiz Gelegenheiten auf verschiedenen Ebenen, die Problematik<br />
umfassend anzugehen, sich weiterzuentwickeln und mutige nächste<br />
Veränderungsschritte aufzugleisen. Die Umsetzung des 2018 in<br />
Kraft getretenen Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung<br />
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)<br />
hat gute Voraussetzungen dafür geschaffen, nun endlich<br />
eine Nulltoleranz gegenüber Gewalt einzufordern, auch gegenüber<br />
Frauen und Kindern.<br />
Zürich, Dezember 2021<br />
Gabriela Medici<br />
Präsidentin Stiftung Frauenhaus Zürich<br />
10
Christina Caprez<br />
Geschichte
Mitte der 1970er-Jahre<br />
Die Frauenbewegung entdeckt<br />
ein neues Thema<br />
Die 1970er-Jahre waren elektrisierende Zeiten für Frauen in Europa<br />
– in Paris und Berlin genauso wie in Zürich. In vielen Städten<br />
bildeten sich autonome Frauengruppen. Frauen erkannten, dass<br />
sie vermeintlich individuelle Alltagserfahrungen teilten, dass ihre<br />
Erfahrungen also gesellschaftliche Wurzeln haben mussten. «Das<br />
Private ist politisch» war eine zentrale Erkenntnis in der Bewegung.<br />
Es ging um den eigenen Körper, um Schwangerschaftsabbruch,<br />
Pornografie, Sexualität. Lesben organisierten sich. Die Feministinnen<br />
kritisierten nicht nur die patriarchalen Strukturen der Gesellschaft,<br />
sondern auch den Machismo der linken Genossen, die<br />
die Unterdrückung der Frauen nur als Nebenwiderspruch sahen.<br />
Gleichzeitig grenzten sie sich von der Generation der Mütter ab, die<br />
das Frauenstimmrecht mit – aus Sicht der Töchter – braven Methoden<br />
wie Petitionen erkämpft hatte.<br />
In der Deutschschweiz organisierten sich die autonomen Feministinnen<br />
in der Frauenbefreiungsbewegung (FBB) und in der Organisation<br />
für die Sache der Frau (OFRA). Mit aufsehenerregenden<br />
Aktionen, mit Demonstrationen und Häuserbesetzungen machten<br />
sie auf ihre Anliegen aufmerksam. Im Kampf um das Recht auf<br />
Schwangerschaftsabbruch schmissen sie 1975 nasse Windeln auf<br />
Nationalräte. Und aus Protest gegen Pornografie und Prostitution<br />
bewarfen sie Besucher eines Stützlisex-Lokals an der Zürcher Langstrasse<br />
mit Mehl. An der Lavaterstrasse beim Bahnhof Enge eröffneten<br />
die Feministinnen 1974 ein Frauenzentrum, ein paar Strassen<br />
weiter kurze Zeit später einen Frauenbuchladen.<br />
Das Bewusstsein, Teil einer internationalen Bewegung zu sein,<br />
befeuerte die Feministinnen. Im März 1976 reiste eine Delegation<br />
aus Zürich nach Brüssel ans Internationale Frauentribunal, an<br />
dem über 2000 Frauen aus 40 Ländern teilnahmen. Inspiriert von<br />
Kriegsverbrechertribunalen sammelten sie Zeugnisse aller Formen<br />
von Gewalt, die sie im Alltag erlebten: von Vergewaltigung und<br />
Gewalt in der Ehe über Pornografie und Sexismus in der Werbung<br />
bis hin zu Diskriminierung in der Ausbildung und am Arbeitsplatz.<br />
Mit dabei war auch Jeanne DuBois, eine 25-jährige Juristin aus<br />
Zürich.<br />
Jeanne DuBois: Im Vorfeld des Tribunals sammelten wir an<br />
einer Kunstauktion im Volkshaus Geld für die Anreise mittelloser<br />
Frauen. Die Tagung war riesig, es gab unzählige Arbeitsgruppen,<br />
die Frauen halfen einander mit Ad-hoc-Übersetzungen.<br />
Die Stimmung war toll. Besonders beeindruckt hat mich<br />
ein Bericht der Gründerinnen des ersten Frauenhauses in<br />
London.<br />
In London gab es seit 1972 das erste Frauenhaus in Europa, 1976<br />
eröffneten Feministinnen in Berlin und Köln die ersten Frauenhäuser<br />
– Zufluchtsorte für Frauen, die in ihrer Ehe Gewalt erfuhren.<br />
Deren Erfahrungsberichte in Buchform lagen im Zürcher<br />
Frauenbuchladen auf, wo Annemarie Leiser, ebenfalls FBB-Mitglied<br />
und Sozialpädagogin in einem freien Kindergarten, darauf<br />
stiess. Die Lektüre erschütterte sie, und sie begann, mit Freundinnen<br />
über das Thema Gewalt gegen Frauen zu sprechen. An einem<br />
Abendessen im Frauenzentrum im November 1976 fragte Leiser<br />
in die Runde, wer sich mit dem Thema näher auseinandersetzen<br />
wolle, und stiess auf offene Ohren bei den Frauen am Tisch – unter<br />
ihnen die angehende Sozialarbeiterin Lisbeth Sippel und die Juristin<br />
Jeanne DuBois, die das Thema seit ihrer Reise nach Brüssel nicht<br />
mehr losliess.<br />
14 15
Annemarie Leiser: Am grossen Brett im Frauenzentrum,<br />
wo schon hundert andere Zettel hingen, machten wir dann<br />
einen Anschlag mit der Info, dass wir eine Arbeitsgruppe zum<br />
Thema Gewalt an Frauen gründen wollen. Beim ersten Treffen<br />
kamen auf Anhieb gegen 20 Frauen. Es war ein günstiger<br />
Moment innerhalb der FBB: Der Kampf für den Schwangerschaftsabbruch<br />
war vorbei, die Beratungsstelle INFRA gegründet,<br />
ein neues Thema willkommen.<br />
Die Jahre davor waren vom Engagement für den straflosen Schwangerschaftsabbruch<br />
geprägt gewesen. Die FBB-Frauen hatten sich<br />
sogar auf den parlamentarischen Weg eingelassen, um das Ziel zu<br />
erreichen, und 1971 – im Jahr, als die Schweizer Männer endlich<br />
Ja sagten zum Frauenstimmrecht – einen grossen Teil der Unterschriften<br />
für eine nationale Volksinitiative gesammelt. Doch im<br />
Rahmen von Parlamentsdebatte und Vernehmlassung wurde die<br />
Vorlage abgeschwächt: Im Januar 1976 zog das Initiativkomitee das<br />
Begehren zurück, um den Weg freizumachen für die moderatere<br />
Fristenlösung. In der Folge wandte sich die FBB, die für das volle<br />
Selbstbestimmungsrecht der Frauen ohne Frist eintrat, ernüchtert<br />
vom Abstimmungskampf ab.<br />
Das Engagement für das Thema Gewalt gegen Frauen gab der<br />
Be wegung frischen Schwung. Es war neu, es betraf ein gesellschaftliches<br />
Tabu, und es bot die Möglichkeit, fundamentale Gesellschaftskritik<br />
– an der Institution Ehe, an den Machtverhältnissen<br />
zwischen Männern und Frauen – mit einem ganz konkreten Projekt<br />
– der Gründung eines Frauenhauses – zu verbinden. Geschlagene<br />
Frauen, wie sie im Jargon der Zeit genannt wurden, galten als offensichtlichster<br />
Beweis der patriarchalen Gewalt, die alle Frauen tagtäglich<br />
erlebten. Die Treffen der Arbeitsgruppe verliefen anfangs<br />
chaotisch. Es gab weder eine Traktandenliste noch eine Sitzungsleitung<br />
oder ein Protokoll. Frau trank viel Wein und rauchte. Die<br />
Journalistin Marianne Pletscher, die mit der Frauenbewegung sympathisierte<br />
und einen Fernsehfilm zum Thema plante, nahm an<br />
einer der ersten Sitzungen teil.<br />
Marianne Pletscher: Damals war das eine ziemliche Spontigruppe.<br />
Die Sitzungen waren endlos, da wurde nach meinem<br />
Gefühl viel im Kreis herumgeredet. Der Ausdruck «professionell»<br />
war schon fast ein Schimpfwort. Ich war nicht sicher,<br />
ob sie jemals ein Frauenhaus auf die Beine stellen würden.<br />
Doch da täuschte ich mich. Ausgerechnet jene Frauen brachten<br />
dann das effzienteste Projekt der Frauenbewegung zustande<br />
– und dies in kurzer Zeit …<br />
Dazu musste sich die Bewegung zuerst auf ein gemeinsames Ziel<br />
und vor allem eine Strategie verständigen, denn die Meinungen<br />
gingen stark auseinander. In der Arbeitsgruppe kristallisierten sich<br />
bald zwei Strömungen heraus: die Realos, die sich für die geschlagenen<br />
Frauen einsetzen, und die Radikalen, die lieber öffentlichkeitswirksame<br />
Aktionen organisieren und fundamentalen Widerstand<br />
leisten wollten.<br />
Lisbeth Sippel: An einem Wochenende kam es zum Clash<br />
zwischen den beiden Gruppen. Wir Realos mussten ziemlich<br />
einstecken.<br />
Annemarie Leiser: Nachts kicherten einige im Mehrbettzimmer<br />
zu mir herüber: «Hast du das Protokoll schon geschrieben?<br />
Ha ha!» Für die Radikalen war ein Protokoll etwas<br />
Bürgerliches. Sie fanden, wir seien langweilige Bürokratinnen,<br />
sie seien die eigentliche Frauenbewegung und führten<br />
ein freieres, lustigeres Leben. Anderntags hatten wir dann ein<br />
klärendes Gespräch und beschlossen, dass es besser war, wenn<br />
wir uns trennten.<br />
16 17
Lisbeth Sippel: Die Radikalen, darunter viele aus der Lesbenszene,<br />
traten aus der Arbeitsgruppe aus. Sie wollten das<br />
Thema breiter angehen, sie prangerten den Sexismus generell<br />
an. Allerdings kritisierten auch wir Realos strukturelle<br />
Gewalt und wollten nicht einfach nur ein Sozialprojekt machen.<br />
Annemarie Leiser: Wir hofften darum auch, dass wir einander<br />
ergänzen würden – unsere Arbeit für das Frauenhaus und<br />
ihre Aktionen in der Öffentlichkeit. Allerdings waren wir<br />
dann ziemlich absorbiert mit unserem Projekt. Wir, also die<br />
Ar beitsgruppe Gewalt an Frauen, bestanden weiter, die andere<br />
Gruppe löste sich bald auf.<br />
Im Frühling 1977 gründeten zehn Frauen aus der Arbeitsgruppe<br />
den Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder.<br />
Protokolle sahen sie als wichtiges Kommunikationsmittel, um Abwesende<br />
auf dem Laufenden zu halten. Eine Sitzungsleitung war<br />
aber weiterhin tabu. Die Gruppe orientierte sich am Ideal der Basisdemokratie,<br />
Hierarchien waren verpönt. An der ersten Sitzung<br />
nahm Konstanze Pistor teil, eine Feministin aus Berlin, die zufällig<br />
gerade in Zürich war. Pistor und ihre Mitstreiterinnen hatten vor<br />
wenigen Monaten im Stadtteil Grunewald ein Frauenhaus eröffnet.<br />
Zuvor hatten die Feministinnen zwei Jahre lang in der Stadt für<br />
ihr Anliegen geweibelt, hatten die Öffentlichkeit sensibilisiert und<br />
erfolgreich Geld beantragt. So hörten die Zürcherinnen aufmerksam<br />
zu, als Pistor ihnen eine ganze Liste konkreter Ratschläge mitgab:<br />
Sie sollten eine Studie zur Problemlage erstellen, die Stadt um<br />
eine Liegenschaft ersuchen, Frauen in öffentlichen Positionen gezielt<br />
um Unterstützung anfragen («aber erst, nachdem das Projekt<br />
schon etwas gefestigt ist»), eine Kartei mit Pressekontakten erstellen<br />
und parallel zur ersten grossen Medienkonferenz ein Spendenkonto<br />
eröffnen.<br />
In den darauffolgenden Treffen gingen die Frauen zielstrebig an<br />
die Arbeit und liessen sich dabei von den Erfahrungen aus Berlin<br />
inspirieren. Um zu beweisen, dass auch in der Schweiz Frauen von<br />
ihren Männern misshandelt wurden, verschickten sie einen Fragebogen<br />
zu Art und Ausmass von Gewalt an mehrere Hundert Fachpersonen<br />
und Ämter, darunter Ärzte, Psychiaterinnen, Pfarrer und<br />
Eheberatungsstellen. Und sie traten in Kontakt mit Politiker:innen.<br />
Bei SP-Kantonsrat und Eheschutzrichter Armand Meyer stiessen<br />
sie auf offene Ohren. Meyer war in seinem Berufsalltag häufig mit<br />
Frauen konfrontiert, die von ihren Ehemännern misshandelt wurden.<br />
Er fühlte sich in diesen Situationen oft ohnmächtig, weil er den<br />
Frauen nicht die nötige Hilfe anbieten konnte – wenn sie den Weg<br />
zu ihm überhaupt fanden. Denn viele Frauen wagten den Schritt<br />
zum Arzt oder Richter schon gar nicht. Zu gross war ihre Angst vor<br />
noch grösseren Repressalien, sollte der Ehemann entdecken, dass<br />
die Frau die Gewalt nicht mehr einfach hinnahm.<br />
Zum einen fürchteten viele Frauen – zu Recht – das Gesetz: Gemäss<br />
Zivilgesetzbuch durfte der Mann als «Haupt der Familie» die<br />
eheliche Wohnung bestimmen. Zwar galt eine «ernsthafte Gefährdung<br />
der Gesundheit» eines Ehegatten als legitimer Grund, den<br />
Haushalt zu verlassen, jedoch nur für die Dauer der Gefährdung.<br />
Zum anderen mussten die Frauen Beweise vorlegen. Hatte eine Frau<br />
Mut gefasst und Meyers Amtsstube betreten, musste er sie nach<br />
Anhörung ihres Berichts wieder nach Hause schicken. Zwar konnte<br />
er mittels dringlicher superprovisorischer Massnahmen den<br />
Mann aus der Wohnung weisen. Doch zuvor musste er ihm rechtliches<br />
Gehör gewähren, was Zeit kostete.<br />
Am 18. April 1977 reichte Meyer im Kantonsrat eine Interpellation<br />
ein. Er forderte den Regierungsrat auf, Zahlen zum Problem<br />
«bedrängte Ehefrauen und ihre Kinder» zu erheben und Massnahmen<br />
in Form von Beratung und Notunterkünften zu ergreifen.<br />
Die Dringlichkeit seines Anliegens unterstrich er mit einer eigenen<br />
Zählung am Zürcher Bezirksgericht: Allein zwischen Januar und<br />
18 19
März 1977 hätten sich 153 Betroffene beim Gericht gemeldet. Bei<br />
27 von ihnen sei die «Brutalität der Ehemänner» derart massiv gewesen,<br />
dass eine sofortige Trennung und der Bezug einer Notunterkunft<br />
«dringendst» erforderlich gewesen wären. Neun dieser Frauen<br />
hätten jedoch keine Unterkunft gefunden.<br />
Parallel werteten die Mitglieder des Vereins zum Schutz misshandelter<br />
Frauen und deren Kinder ihre eigene breiter angelegte<br />
Umfrage aus. Die Resultate waren erschütternd: 81 Prozent der<br />
antwortenden Fachleute waren regelmässig mit dem Problem Gewalt<br />
gegen Frauen konfrontiert (25 Prozent täglich, 28 Prozent<br />
wöchentlich, 28 Prozent monatlich). Die Gewaltformen reichten<br />
von «Schlagen» über «Geschlechtsverkehr unter Zwang» bis hin zu<br />
«Zigarette auf der Haut und im Gesicht der Frau ausdrücken». Auch<br />
psychische Gewalt wurde erwähnt: «die Frau unter finanziellem<br />
Druck halten, (…) Liebesentzug, Drohungen, Selbstmord zu verüben<br />
und / oder die ganze Familie zu erschiessen», ausserdem «Lächerlichmachen<br />
der Frau, Verlassen der Familie auf unbestimmte<br />
Zeit, Gesprächsverweigerung usw.».<br />
Im Juni 1977 präsentierten die Vereinsfrauen die Ergebnisse<br />
ihrer Umfrage an einer Pressekonferenz. Gemäss ihrem feministischen<br />
Anspruch war es ihnen wichtig, nicht nur Art und Ausmass,<br />
sondern auch die gesellschaftlichen Ursachen der Gewalt deutlich<br />
zu benennen.<br />
Aus der Pressemitteilung des Vereins<br />
zum Schutz misshandelter Frauen vom 15. 6. 1977<br />
Als Frauen leben wir in einer Welt von Verboten und Geboten<br />
mit dem Resultat, dass sehr viele von uns isoliert in ihren<br />
Wohnungen mit Haushalt und Kindern leben. Wir sprechen<br />
kaum miteinander und glauben, dass wir alle Einzelschicksale<br />
hätten ohne jede Gemeinsamkeit mit anderen Frauen. Psychische<br />
Gewalt, Diskriminierung in Erziehung und Ausbildung,<br />
Benachteiligung am Arbeitsplatz und auf Gesetzesebene sowie<br />
die Vermarktung der Frauen in Werbung und Film bestimmen<br />
unser alltägliches Leben und gehören genauso in den Bereich<br />
Gewalt gegen Frauen. Die körperliche Misshandlung ist wahrscheinlich<br />
die augenfälligste brutale Äusserung dieser Gewalt.<br />
Die Medien nahmen das neue Thema auf. Der Blick inszenierte<br />
einen Geschlechterkampf: «Jetzt schlagen geprügelte Schweizer<br />
Frauen zurück.» Das Badener Tagblatt wunderte sich: «Auch ‹brave›<br />
Eidgenossen prügeln.» Allerdings wies kaum eine Zeitung auf den<br />
Zusammenhang zwischen Gewalt und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen<br />
hin. Nur einzelne Artikel im Brückenbauer und im Tages-<br />
Anzeiger, geschrieben von engagierten Journalistinnen, gingen<br />
näher auf die Hintergründe ein.<br />
Eheschutzrichter Meyer wandte sich ebenfalls an die Öffentlichkeit.<br />
In einem Artikel in der sozialdemokratischen Zeitung Volksrecht<br />
vom 21. Juni 1977 schilderte er eindringlich den Fall einer<br />
45-jährigen Hausfrau und Mutter dreier Kinder, die von ihrem Mann<br />
regelmässig so sehr misshandelt wurde, dass sie ärztlich versorgt<br />
werden musste. «Sie hat uns ziemlich scheussliche Fotos von solchen<br />
Verletzungen gezeigt», berichtete Meyer. «In der Nacht zuvor<br />
war sie wieder einmal sehr heftig malträtiert worden. Am liebsten<br />
wäre sie gar nicht mehr heimgegangen. Wir mussten ihr das aber<br />
zumuten, mindestens bis zur Verhandlung. Wir wussten ja auch<br />
nicht, wohin sie sonst hätte gehen sollen!» Nachdem die Frau zwei<br />
weitere Male beim Eheschutzrichteramt vorgesprochen habe und<br />
heimgeschickt worden sei, habe sie wenige Tage später ihr Begehren<br />
zurückgezogen.<br />
Auch ausserhalb von Zürich war das Thema Gewalt gegen Frauen<br />
immer virulenter geworden. In Genf existierte das älteste Frauenhausprojekt<br />
der Schweiz: Die Feministin Geneviève Piret öffnete<br />
ihre eigene Wohnung für misshandelte Frauen. In Bern gründeten<br />
autonome Feministinnen 1977 ebenfalls eine Arbeitsgruppe.<br />
20 21
Wie die Zürcherinnen orientierten sie sich am Beispiel deutscher<br />
Frauengruppen, die die Selbstorganisation und Selbstbestimmung<br />
der Betroffenen ins Zentrum rückten. Doch die autonomen Feministinnen<br />
erhielten Konkurrenz von bürgerlicher Seite: In Basel<br />
boten christliche Heime misshandelten Frauen Schutz. In Bern war<br />
eine private Stiftung, das Mütter- und Pflegekinderhilfswerk, dabei,<br />
Wohnungen für Betroffene einzurichten, lehnte das Modell Frauenhaus<br />
jedoch ab, da sich dort «die Probleme der Frauen geradezu<br />
bal len». Die autonomen Feministinnen sahen es genau umgekehrt:<br />
Erst durch das Zusammenleben und den Austausch mit anderen<br />
Betroffenen würden misshandelte Frauen erkennen, dass ihre Situation<br />
kein individuelles Verschulden war. Christliche Heime und<br />
Hilfswerke waren für die Feministinnen nichts anderes als patriarchale<br />
Institutionen, die den Frauen helfen wollten, dabei aber nicht<br />
deren Autonomie im Blick hatten, sondern die Rückkehr zum geläuterten<br />
Ehemann ins traute Heim.<br />
Als am 22. August 1977 der Zürcher Kantonsrat die Interpellation<br />
von Armand Meyer behandelte, zogen die Feministinnen zum<br />
Rathaus am Limmatquai und verteilten Flugblätter an die eintrudelnden<br />
Kantonsräte – fast ausschliesslich Männer. Seit der Einführung<br />
des Frauenstimmrechts waren sechs Jahre vergangen, im<br />
180-köpfigen Kantonsparlament sassen gerade mal acht Frauen. Ein<br />
Kolumnist der Basler Zeitung hielt die Szene später in einer Glosse<br />
fest. Ein «schon leicht ergrauter Volksvertreter» habe beim Anblick<br />
der Feministinnen geflachst: «Die sehen ja noch ganz gesund aus!»<br />
Auch später im Ratssaal sei die Debatte von Heiterkeit geprägt gewesen.<br />
Die Antwort von Justizminister Arthur Bachmann auf die Interpellation<br />
Meyer war eine herbe Enttäuschung für die Vereinsfrauen,<br />
die die Diskussion auf der Tribüne verfolgten. Der Regierungsrat<br />
hatte die Fürsorge-, Erziehungs- und Polizeidirektion nach ihren<br />
Erfahrungen mit dem Problem gefragt. Ihre Antwort: In den meisten<br />
Fällen hätten Frauen wie Männer ihren Anteil an den Konflikten.<br />
Dabei seien es oft die Frauen, deren «ständige und peinigende<br />
Sticheleien, wortreiche Klagen und Beschuldigungen zu aggressiven<br />
Entladungen führen, mit denen der ‹Brutale› die erhaltenen Schmerzen<br />
und Erniedrigungen zu kompensieren sucht». Mit anderen Worten:<br />
Die Frauen waren selber schuld, sie hatten die Gewalt provoziert,<br />
eigentliche Opfer waren die Männer.<br />
Vor diesem Hintergrund sei zu befürchten, dass die Schaffung<br />
von Unterkünften eine «Sogwirkung» zur Folge hätte, «welche<br />
Frauen erlaubt, der Konfliktbewältigung auszuweichen, und brutale<br />
Männer in ihrer Haltung, Frauen und Kinder aus dem Hause zu<br />
jagen, bestätigt, weil der Staat ja hierfür vorgesorgt habe». Wichtiger<br />
als das Leid, das gewalttätige Ehemänner ihren Frauen zufügten,<br />
war in den Augen des Regierungsrats eine andere Tatsache: «Solche<br />
Akte der Brutalität (…) zerstören die Ehe als Urzelle des Staates (…).»<br />
Und – so konnte man zwischen den Zeilen lesen – indem man den<br />
Frauen die Möglichkeit gab, den gemeinsamen Haushalt zu verlassen,<br />
vernichte man die Ehe endgültig, anstatt sie zu kitten.<br />
Bei den Feministinnen auf der Zuschauertribüne rumorte es.<br />
Aufgewühlt hörten sie zu, als Armand Meyer entgegnete: «Dass<br />
damit die Familien zerstört werden, kann nicht behauptet werden,<br />
denn sie sind es längst.» Ratsmitglied Verena Grendelmeier von der<br />
LdU wies auf die ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern<br />
und Frauen hin und kritisierte die Regierung: «Mit der bisherigen<br />
1.-August-Mentalität kommen wir nicht weiter!» Prompt konterte<br />
SVP-Kollege Carl Bertschinger, ob es die Angst vor Schlägen gewesen<br />
sei, die Grendelmeier bisher daran gehindert habe zu heiraten.<br />
Die Ratsherren hielten sich die Bäuche. Niemand verteidigte Grendelmeier.<br />
Jahre später erinnerte sich die Politikerin: «In der Pause<br />
kam ein anderer von der SVP und wollte sich entschuldigen. Ich<br />
sagte ihm, dass ich für eine öffentliche Beleidigung keine privaten<br />
Entschuldigungen entgegennehme.»<br />
Justizminister Bachmann von der SP, der zu Beginn die Antwort<br />
der Regierung vertreten hatte, dürfte es immer unwohler geworden<br />
22 23
sein, je länger die Debatte dauerte. Denn zum Schluss vollzog er<br />
eine eigentliche Kehrtwende: Er gestand ein, die Antwort seines<br />
Gremiums habe ihn «gefühlsmässig auch nicht ganz befriedigt».<br />
Er kündigte an, Gesuche von Organisationen, die sich in diesem<br />
Bereich engagierten, «wohlwollend zu prüfen». Ob dieser unerwarteten<br />
Ankündigung jubelten die Frauen auf der Tribüne. Trotzdem<br />
hatte die Debatte ihnen noch einmal unmissverständlich vor Augen<br />
geführt, welche Hürden sie zu überwinden hatten.<br />
1977–1979<br />
Misshandelte Frauen zu beraten<br />
reicht nicht<br />
In den darauffolgenden Wochen konzentrierten sich die Vereinsfrauen<br />
auf die Beratungsstelle, die sie als Erstes eröffnen wollten.<br />
Sie einigten sich auf ein «seriöses» Logo, eine Kombination aus<br />
Frauenzeichen und einem Haus. Die Faust liessen sie weg, angesichts<br />
der politischen Grosswetterlage wollten sie nicht zu radikal<br />
erscheinen. Im November 1977 war es dann so weit: Im Frauenzentrum<br />
an der Lavaterstrasse eröffneten die Vereinsfrauen ihre<br />
Beratungsstelle. Am Mittwoch von 15 bis 21 Uhr waren jeweils zwei<br />
von ihnen anwesend und berieten Betroffene ehrenamtlich.<br />
Annemarie Leiser: Wir hatten ein Flugblatt kreiert, das wir<br />
an Sozialdienste und Arztpraxen zum Auflegen sendeten. In<br />
einer Kartei sammelten wir Adressen von Anwältinnen, Ärztinnen,<br />
Psychologinnen, zu denen wir die Frauen schicken<br />
konnten. Wir dachten, wir seien gut vorbereitet. Aber dann<br />
kam schon am allerersten Nachmittag, als wir die Beratungsstelle<br />
eröffneten, eine Frau mit gepackten Koffern. Wir waren<br />
völlig überfordert! Wir riefen dann in einem der Foyers an,<br />
die damals ledigen Frauen Unterkünfte anboten.<br />
Dieses Erlebnis zeigte den Vereinsfrauen gleich zu Beginn, dass<br />
die Beratungsstelle nur ein erster Schritt sein konnte. Sie erkannten,<br />
wie dringend ein Frauenhaus war, und starteten eine inten sive<br />
Geldsuche. Dabei kam ihnen die Journalistin Marianne Pletscher<br />
zuhilfe: Sie hatte monatelang zu dem Thema recherchiert und<br />
schon einen Fernsehbeitrag über misshandelte Frauen gedreht.<br />
25