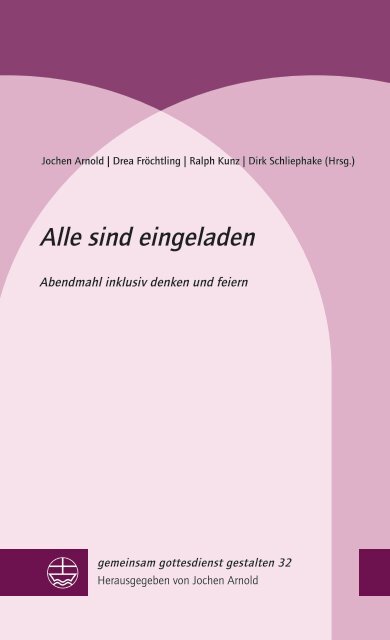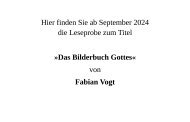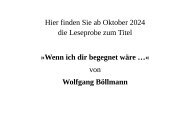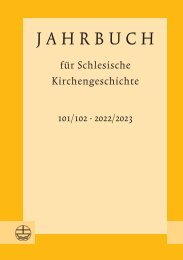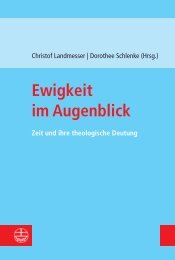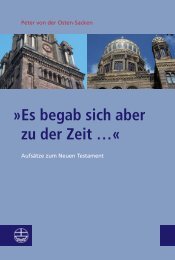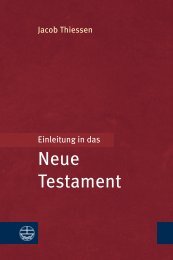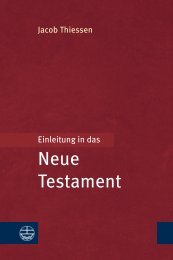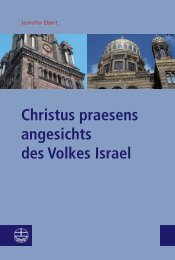Arnold, Fröchtling, Kunz | Schliephake: Alle sind eingeladen (Leseprobe)
Die Feier des Abendmahls ist neben der Wortverkündigung das Herzstück des Gottesdienstes. Christliche Gastfreundschaft findet hier ihren liturgischen Ausdruck. Sie knüpft an das an, was Jesus von Nazareth mit vielen Menschen seiner Zeit geteilt und gefeiert hat. Ihm getreu gilt auch heute das inklusive Motto: Alle sind eingeladen, Gemeinschaft zu erleben, Versöhnung zu erfahren, getröstet und gestärkt zu werden für ihren Weg. Das Buch bietet biblische, systematische, ethische und praktische Einführungen in das Thema „Essen vor Gott“ und beleuchtet dabei stets den Aspekt des Inklusiven und Universalen. Die 20 ausgeführten Abendmahlsliturgien folgen sechs theologischen Leitmotiven: Freude an der Schöpfung, Gedächtnis im Leiden, Freiheit im Heiligen Geist, Heil und Heilung, Gemeinschaft und Teilen, Transformationen und Visionen. Sie orientieren sich dabei an agendarischen Strukturen und situativen Gegebenheiten verschiedener evangelischer Kirchen. Sie überschreiten bewusst das Vertraute und brechen auf zu neuen Feierformen: diakonisch, interkulturell, mehrsprachig, inklusiv.
Die Feier des Abendmahls ist neben der Wortverkündigung das Herzstück des Gottesdienstes. Christliche Gastfreundschaft findet hier ihren liturgischen Ausdruck. Sie knüpft an das an, was Jesus von Nazareth mit vielen Menschen seiner Zeit geteilt und gefeiert hat. Ihm getreu gilt auch heute das inklusive Motto: Alle sind eingeladen, Gemeinschaft zu erleben, Versöhnung zu erfahren, getröstet und gestärkt zu werden für ihren Weg.
Das Buch bietet biblische, systematische, ethische und praktische Einführungen in das Thema „Essen vor Gott“ und beleuchtet dabei stets den Aspekt des Inklusiven und Universalen. Die 20 ausgeführten Abendmahlsliturgien folgen sechs theologischen Leitmotiven: Freude an der Schöpfung, Gedächtnis im Leiden, Freiheit im Heiligen Geist, Heil und Heilung, Gemeinschaft und Teilen, Transformationen und Visionen. Sie orientieren sich dabei an agendarischen Strukturen und situativen Gegebenheiten verschiedener evangelischer Kirchen. Sie überschreiten bewusst das Vertraute und brechen auf zu neuen Feierformen: diakonisch, interkulturell, mehrsprachig, inklusiv.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jochen <strong>Arnold</strong> | Drea <strong>Fröchtling</strong> | Ralph <strong>Kunz</strong> | Dirk <strong>Schliephake</strong> (Hrsg.)<br />
<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong><br />
Abendmahl inklusiv denken und feiern<br />
gemeinsam gottesdienst gestalten 32<br />
Herausgegeben von Jochen <strong>Arnold</strong>
Inhalt<br />
I. <strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> – Abendmahl inklusiv denken<br />
A Abendmahl, biblisch- und systematisch-theologisch<br />
bedacht — 13<br />
1. Mit Gott am Tisch – eine biblisch-theologische Spurensuche<br />
(Jochen <strong>Arnold</strong>) — 13<br />
2. Gott und Mensch beim Abendmahl – systematischtheologische<br />
Überlegungen, ökumenische Perspektiven<br />
und liturgische Konkretionen (Jochen <strong>Arnold</strong>) — 23<br />
B Inklusion in Kirche und Gottesdienst — 39<br />
3. »Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische<br />
Perspektive (Drea <strong>Fröchtling</strong>) — 39<br />
4. Musik als inklusives Medium – nicht nur im Gottesdienst<br />
( Jochen <strong>Arnold</strong> und Bettina Gilbert) — 54<br />
5. Gottes Inklusionsprogramm – eine theologische<br />
Thesenreihe (Jochen <strong>Arnold</strong>) — 68<br />
C Gottesdienst und Abendmahl inklusiv — 71<br />
6. Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst –<br />
praktische Thesen und Leitfragen (Jochen <strong>Arnold</strong> und<br />
Dirk <strong>Schliephake</strong>) — 71<br />
7. Abendmahl mit Kindern – inklusiv von Anfang an<br />
(Dirk <strong>Schliephake</strong>) — 78<br />
8. Abendmahl und Heilung (Ralph <strong>Kunz</strong>) — 89<br />
9. Abendmahl in Vesperkirchen – eine Wiederentdeckung<br />
der offenen Mahlzeiten Jesu (Martin Dorner) — 105<br />
10. Abendmahl inklusiv feiern – zehn Impulse für die liturgische<br />
Praxis (Dirk <strong>Schliephake</strong> und Bettina Gilbert) — 115<br />
Inhalt | 5
II.<br />
<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> – Abendmahl inklusiv feiern<br />
A Schöpfung und Schöpfungsgaben<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! – Ein Gottesdienst draußen<br />
[Psalm 104] (Susanne Paetzold) — 129<br />
Kauft umsonst! – Familiengottesdienst im Sommer in leichter<br />
Sprache [Jesaja 55] (Jochen <strong>Arnold</strong>) — 142<br />
B Gedächtnis im Leiden<br />
Aufbruch und Befreiung – Abendmahlsgottesdienst am Vorabend<br />
der Konfirmation [Johannes 6] (Evelina Volkmann) — 150<br />
When Israel was in Egypt’s Land – Häusliches Tischabendmahl an<br />
Gründonnerstag in der Zeit des »Corona-Shut-Down« 2020<br />
[ Exodus 12] (Jochen <strong>Arnold</strong> und Elisabeth Rabe-Winnen) — 165<br />
Gott in der Verlassenheit spüren – Gottesdienst am Karfreitag<br />
[Psalm 22] (Elisabeth Rabe-Winnen) — 176<br />
C Wo der Geist ist, da ist Freiheit<br />
»Das Essen und die Gemeinschaft mit Jesus, das gehört zusammen!«<br />
– Abendmahlsfeier in der Vesperkirche [Markus 2,13–18]<br />
(Martin Dorner) — 187<br />
Hingabe – ein Gottesdienst mit <strong>Alle</strong>n in der Osterzeit<br />
[Johannes 15,13] (Dirk <strong>Schliephake</strong>) — 196<br />
Schmecken und riechen, hören und sehen, fühlen und verstehen:<br />
So wirkt Gottes Geist. – Ein inklusiver Gottesdienst an Pfingsten<br />
[Apostelgeschichte 2] (Ulrike Beichert und Team) — 209<br />
D Trost und Stärkung<br />
»Mittel gegen die Angst!« – Brotteilen im Schulgottesdienst<br />
(mit heterogenen und multireligiösen Schülergruppen)<br />
[Markus 4,35-41] (Martin Dorner) — 223<br />
6 | Inhalt
Wegzehrung – Outdoor-Abendmahlsgottesdienst zum Abschluss<br />
eines Gemeindefestes [1 Könige 19] (Drea <strong>Fröchtling</strong>) — 236<br />
Du wirst sein ein bewässerter Garten [Jesaja 58,7–12]<br />
(Anne Gidion) — 247<br />
E Gemeinschaft und Verantwortung<br />
Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg [Apostelgeschichte 2,42–<br />
47 und 1 Korinther 10,16f.] (Stefan Nadolny und Steve Ogedegbe)<br />
— 257<br />
Recht und Gerechtigkeit – wie ein nie versiegender Bach<br />
[Amos 5,24] (Peter und Stefanie Arthur) — 268<br />
»Versöhnungs-Geschäft« – ein Gottesdienst am Buß- und Bettag<br />
in einem leerstehenden Laden [2 Korinther 5,17–20]<br />
(Mirko Peisert) — 277<br />
F Transformationen und Visionen<br />
God will prepare a banquet for all the nations [Isaiah 25,6–9]<br />
(Delphine Takwi) — 285<br />
Brannte nicht unser Herz? – Ein Gottesdienst zur<br />
Emmausgeschichte [Lukas 24,13–35] (Fritz Baltruweit) — 295<br />
Kinder, habt ihr nichts zu essen? – Gottesdienst mit österlichem<br />
Morgenmahl [Johannes 21,1–14] (Dirk <strong>Schliephake</strong>) — 307<br />
Das Lied der Himmlischen – Familiengottesdienst am Sonntag<br />
Kantate [Offenbarung 15,2–4] (Susanne Mathis-Meuret) — 322<br />
Literatur — 337<br />
Autorenhinweise — 339<br />
Inhalt | 7
TEIL I:<br />
<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> –<br />
Abendmahl inklusiv denken
»<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong>.« So hört man es oft, wenn die Kirche für<br />
Veranstaltungen wirbt. Man denkt vielleicht zuerst eher an das<br />
Gemeindefest oder eine Konzertveranstaltung für Groß und<br />
Klein. Aber denkt man auch noch an den sonntäglichen Gottesdienst?<br />
Gerade zu Letzterem kommen ja längst nicht alle Kirchenmitglieder.<br />
Manche vermeiden auch bewusst die Abendmahlsfeier.<br />
Warum? Ist die Sprache zu schwer verständlich? Ist die alte Liturgie<br />
zu abständig oder die Musik zu »uncool«? Liegt es an den<br />
»anstrengenden Leuten«? Oder passt schlicht die Uhrzeit nicht?<br />
Besteht gar kein wirkliches Interesse an einem christlichen Gemeinschaftsritual?<br />
Viele Antworten <strong>sind</strong> denkbar. In den Zeiten<br />
der Corona-Pandemie gibt es auch Menschen, die dazu rieten,<br />
Abendmahl zu fasten.<br />
Diese Positionen zu analysieren oder zu bewerten, ist nicht<br />
Aufgabe dieses Buches. Aber eines wollen wir mit Nachdruck<br />
ausschließen: Dass Menschen sich – trotz ihrer Zugehörigkeit<br />
zur Kirche bzw. einer gefühlten Nähe zur Gemeinde – nicht <strong>eingeladen</strong><br />
fühlen. Besonders schmerzlich ist das, wenn sie meinen,<br />
sie seien vom Tisch des Herrn ausgeschlossen.<br />
Der Bischofsrat der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers hat deshalb<br />
Anfang 2020 in einem werbenden Brief an alle Gemeinden<br />
die Abendmahlspraxis angefragt und deutlich gemacht, dass niemand<br />
vom Tisch Jesu weggeschickt werden soll. Dabei wird auf<br />
Jesus Christus als Gastgeber verwiesen und Bezug auf die Taufe<br />
genommen:<br />
»In breiter ökumenischer Übereinstimmung ist die Taufe Voraussetzung<br />
dafür, am Abendmahl teilzunehmen.<br />
Weil Christus selbst einlädt, wird […] niemand abgewiesen, der<br />
den Wunsch zeigt, das Abendmahl mitzufeiern. Diese Teilnahme<br />
kann als Schritt in die christliche Gemeinschaft hinein verstanden<br />
werden. Menschen, die nicht getauft <strong>sind</strong>, laden wir zur Taufe<br />
ein. Getaufte, die aus der Kirche ausgetreten <strong>sind</strong>, ermutigen wir<br />
zum Wiedereintritt.« 1<br />
Kein Wunder, dass damit auch die in etlichen Gemeinden übliche,<br />
an die Konfirmation gebundene Zulassung zum Abendmahl<br />
endgültig abgeschafft werden soll:<br />
1<br />
Bischofsrat Hannover 2020, Abendmahlsbrief, 3.<br />
<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> – Abendmahl inklusiv denken | 11
»Die Einladung zum Abendmahl schließt auch getaufte Kinder<br />
sowie Konfirmandinnen und Konfirmanden ein.<br />
Sie ist an kein Alter gebunden. Kinder <strong>sind</strong> schon früh vom Abendmahl<br />
angerührt und können seine Bedeutung und Schönheit mit<br />
allen Sinnen erfahren. Diese frühen Erfahrungen legen eine gute<br />
Grundlage für ein Leben in Gemeinschaft mit Gott und auch für<br />
die lebenslange Entfaltung einer eigenen Abendmahlsspiritualität.«<br />
2<br />
Diese Passage spiegelt den aktuellen Stand der Konsensbildung<br />
zumindest der deutschsprachigen evangelischen Kirchen Europas<br />
wider, was allerdings noch nicht heißt, dass diese Überzeugung<br />
auch in allen Gemeinden Anklang und Akzeptanz findet.<br />
Abendmahl tauftheologisch bzw. ekklesiologisch inklusiv zu denken<br />
und zu feiern, ist keine Selbstverständlichkeit.<br />
2<br />
Bischofsrat Hannover 2020, Abendmahlsbrief, 4.<br />
12 | <strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> – Abendmahl inklusiv denken
A<br />
Abendmahl, biblisch- und<br />
systematisch-theologisch bedacht<br />
1. Mit Gott am Tisch – eine biblisch-theologische<br />
Spurensuche<br />
Jochen <strong>Arnold</strong><br />
1.1. Bei Gott am Tisch – Verheißungen<br />
Das Bild, mit Gott gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu essen,<br />
entwickelt sich durch die biblische Tradition wie ein großes Crescendo.<br />
Drei Stationen aus dem ersten Testament seien hier vorangestellt.<br />
Die erste Begebenheit ist Gottes Erscheinen bei Abraham<br />
im Hain Mamre (1 Mose 18) zur Mittagszeit.<br />
Und der HERR erschien Abraham im Hain Mamre, während er<br />
an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und<br />
als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer<br />
vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür<br />
seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich<br />
Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht<br />
vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu<br />
waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will<br />
euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt; danach<br />
mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht<br />
vorübergekommen.<br />
Sie sprachen: Tu, wie du gesagt hast. Abraham eilte in das Zelt<br />
zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß feines Mehl, knete<br />
und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes,<br />
gutes Kalb und gab‘s dem Knechte; der eilte und bereitete es zu.<br />
Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet<br />
hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen<br />
unter dem Baum, und sie aßen.<br />
Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete:<br />
Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wieder zu dir kommen<br />
übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.<br />
Mit Gott am Tisch | 13
Die Rollen <strong>sind</strong> überraschend verteilt. Gott selbst kommt zu<br />
Besuch, aber in menschlicher Gestalt, und das gleich zu dritt. In<br />
orientalischer Erzählfreude wird die Gastfreundschaft Abrahams<br />
und Saras geschildert: In hoher Geschwindigkeit und Intensität<br />
bieten sie alles auf, was sie haben. Ihre Hingabe lässt uns fragen:<br />
Was motiviert uns? Was bieten wir an, wenn Fremde unangemeldet<br />
bei uns anklopfen? Welche Chance vertun wir, wenn wir nicht<br />
dafür offen <strong>sind</strong>?<br />
Am Ende überraschen die Besucher den Gastgeber und seine<br />
Frau mit einem Geschenk. Ein ungewöhnliches Versprechen: »Ihr<br />
sollt ein Kind haben!« Der Lebenswunsch von Sara und Abraham<br />
soll erfüllt werden. Das sinnliche Essen und die Zusage der Nachkommenschaft<br />
<strong>sind</strong> miteinander verbunden. Leitmotiv ist die<br />
Gastfreundschaft Abrahams und die überraschende Gegenwart<br />
Gottes. Nur die beiden Gastgeber <strong>sind</strong> (noch) Zuschauer.<br />
In 2 Mose 24,9–11 wird Folgendes erzählt:<br />
Und sie stiegen auf den Berg; Mose, Aaron und die 70 Ältesten<br />
und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine<br />
Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. […] Und<br />
als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie.<br />
Was an anderer Stelle in der Bibel Menschen versagt bleibt (vgl.<br />
2 Mose 34 bzw. Mt 17), wird hier Wirklichkeit: Eine ausgewählte<br />
Schar begegnet Gott von Angesicht zu Angesicht. Sie schauen<br />
seine Herrlichkeit. Und danach essen und trinken sie in einer heiligen<br />
Mahlzeit. Im Gegensatz zur ersten Begebenheit schaut hier<br />
Gott zu, nachdem die Ältesten, Mose und Aaron ihn geschaut haben.<br />
Anders die Vision, die uns in Jesaja 25 erzählt wird. Dort heißt<br />
es:<br />
Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein<br />
fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein […], von Wein,<br />
darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen,<br />
mit der alle Völker verhüllt <strong>sind</strong>, und die Decke, mit der<br />
alle Heiden zugedeckt <strong>sind</strong>. Er wird den Tod verschlingen auf<br />
ewig. Und der Herr wird alle Tränen abwischen und wird aufheben<br />
die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn Er hat’s<br />
gesagt. Da wird man sagen: »Siehe, das ist unser Gott, auf den<br />
wir hoffen, lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.«<br />
14 | Jochen <strong>Arnold</strong>
Ähnlich wie in 2 Mose 24,9–11 begegnen Menschen Gott auf<br />
einem Berg von Angesicht zu Angesicht. Auch hier essen und<br />
trinken sie in einer heiligen Mahlzeit. Die Tische biegen sich. Gott<br />
schenkt voll ein (vgl. Ps 23,4). Das Wunderbare dabei ist: <strong>Alle</strong> Völker<br />
<strong>sind</strong> ohne Ausnahme beteiligt. Gott selbst sorgt dafür. Ja, Gott<br />
selbst sitzt – im Gegensatz zu 2 Mose 24 – mit am Tisch. Das alles<br />
geschieht außerhalb der Zeit. Was hier geschaut wird, steht noch<br />
aus und ist nicht zu übertreffen: Gott wischt alle Tränen ab,<br />
nimmt die Decke von ihren Augen. <strong>Alle</strong> werden satt und alle werden<br />
getröstet. Gottes Zuwendung geschieht leiblich, seelisch und<br />
geistlich.<br />
Diese Hoffnung auf das messianische Völkermahl teilte Jesus<br />
mit den Jüdinnen und Juden seiner Zeit. Und sie verbindet uns<br />
mit dem Volk Gottes aller Generationen und Konfessionen: das<br />
Inklusionsprogramm Gottes ist hier am Ziel.<br />
1.2. Die Mahlzeiten und Wunder Jesu –<br />
Gottes sinnliches Inklusionsprogramm<br />
Auch wenn dieses Ziel manchmal noch weit weg scheint, hat<br />
Gottes Inklusionsprogramm schon begonnen, es ist nicht nur<br />
Zukunftsmusik. Jesus von Nazareth hat Gottes Liebe in dreifacher<br />
Gestalt kommuniziert und sichtbar gemacht:<br />
– »in der gemeinschaftlichen Feier, vor allem in der Form von<br />
grundsätzlich inklusiven Mahlzeiten;<br />
– in Lehr- und Lernprozessen, wie sie wohl am deutlichsten<br />
und wirkmächtigsten in seinen Gleichnissen zum Ausdruck<br />
kamen;<br />
– im Helfen zum Leben, wie es besonders anschaulich in seinen<br />
Heilungen überliefert ist.« 3<br />
Eines der auffälligsten Merkmale dieses Inklusionsprogramms<br />
war, dass Jesus an vielen Orten und in unterschiedlichen Situationen<br />
mit Menschen gegessen und getrunken hat (vgl. Mk 2,13–<br />
17; Mt 11,19 par Lk 7,34 f.). Die Mahlzeiten mit Zöllnern und<br />
Frauen zweifelhaften Rufs erregten viel Aufmerksamkeit. Dass es<br />
allerdings schon in diesen vorösterlichen Mahlzeiten um mehr<br />
geht als um bloßes Essen und Trinken, zeigen die Worte, die dazu<br />
vielfach überliefert <strong>sind</strong>. Jesu »Tischreden« <strong>sind</strong> oft die charman-<br />
3<br />
Christian Grethlein, Quo vadis, Ecclesia? – Evangelische Kirche im Transformationsprozess,<br />
Dt. Pfr.bl. 2020, 5–9, hier: 7.<br />
Mit Gott am Tisch | 15
ten Worte eines Gastes (nicht eines Gastgebers), der sich bisweilen<br />
ja auch selbst <strong>eingeladen</strong> hat, wenn er etwa zu Zachäus<br />
(Lk 19,5) sagt: Zachäus, steig eilend herunter; denn ich muss heute<br />
in deinem Haus einkehren!<br />
Damit rücken Jesu Mahlzeiten mit ins Licht von Aktionen<br />
heilsam-provokativer Re-Inkludierung »mit Ansage«. Gerade das<br />
Zusammenfallen von Handlung und Worten ist signifikant für<br />
das Auftreten Jesu. Offensichtlich war es ihm wichtig, einen Ausgleich<br />
zwischen denen, die »zurückgesetzt« lebten und den anderen,<br />
die sich für rechtschaffen hielten, zu schaffen und seine<br />
Haltung dazu öffentlich kundzutun. Dadurch erteilt er ausdrücklichen<br />
und versteckten Exklusionen seiner Zeitgenossen, von<br />
denen vielfach erzählt wird und die bis in den Kreis seiner Jünger<br />
hineinreichen (vgl. Mk 10,13; Lk 18,39), eine Absage in Wort und<br />
Tat. Nach Mk 2,17 sagt Jesus: »Die Starken bedürfen des Arztes<br />
nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen<br />
und nicht die Gerechten.« Interessanterweise wird in diesem Logion<br />
die Rettung von Sünden bzw. die Heilung durch den Arzt mit<br />
dem Zeichen gemeinsamen Essens (mit dem Zöllner Levi) verbunden.<br />
Sind die Gerechten damit ausgeschlossen?<br />
Auch dies lässt sich nicht unbedingt behaupten. Immerhin<br />
wendet sich Jesus auch den reichen und frommen Menschen zu.<br />
Beispiel dafür ist der »reiche Jüngling«. Auch ihm gilt Jesu Zuwendung<br />
und Liebe (Mk 10,21 par). Dennoch: Gerade den Schwachen,<br />
den Menschen am Rande der Gesellschaft, den kritisch Beäugten<br />
verkündigte er das Reich Gottes und heilte sie oder ihre<br />
Angehörigen von langer Krankheit (vgl. Mk 7,24–30; Joh 5,1–10).<br />
Er brachte sie damit in das gesellschaftliche Leben zurück. Leibliches<br />
Heilwerden war mit wieder hergestelltem Selbstwert und<br />
neuen Beziehungsmöglichkeiten verbunden (vgl. Lk 17,11–19).<br />
Jesus stiftete vielfach solche neuen Beziehungen. Er baute Brücken<br />
zu Samaritanern (vgl. Joh 4) und römischen Soldaten (Mt<br />
8,5–13; Mk 15,39; Joh 4), sprach mit unterschiedlichen theologischen<br />
und politischen Gruppierungen seiner Zeit und diskutierte<br />
mit ihnen über die Tora und das Reich Gottes (Mk 12,18–<br />
35). Sein Umgang mit Menschen diverser politischer und religiöser<br />
Orientierung bzw. ethnischer Zugehörigkeit hatte starke Wirkung<br />
und provozierte viele. Die größte Provokation war wohl die<br />
Tempelreinigung (vgl. Mk 11,15–19; Joh 2,13–25), die ebenfalls<br />
mit einer »Ansage« verbunden überliefert ist. Jesus überschritt<br />
damit die religiösen Grenzen nicht nur im Sinne politischer Kor-<br />
16 | Jochen <strong>Arnold</strong>
ektheit, die Aktion wurde – wie sein Anspruch Sünden zu vergeben<br />
(vgl. Mk 2,5–7) – als Blasphemie begriffen und daher auch in<br />
der Passionsgeschichte zum Gegenstand im Prozess (Mk 14,57 f.).<br />
Das prominenteste Zeichen für praktizierte Inklusion ist das<br />
Wunder der Brotvermehrung. Hier geht es nicht mehr nur um ein<br />
zeichenhaftes Essen mit Einzelnen oder eine Heilung von einzelnen<br />
Personen, sondern darum, dass eine sehr große Zahl von<br />
Menschen – alle Anwesenden – satt wird. Die Motivation Jesu<br />
wird als eine emotional-ganzheitliche beschrieben. Es jammert<br />
ihn, wenn Menschen Hunger haben (Mk 6,34; Mk 8,2). Es geht<br />
ihm durch Mark und Bein vor Mitleid. Damit wird deutlich: Das<br />
Wunder geschieht nicht um des Wunders, sondern um der Menschen<br />
willen. Markus und Matthäus erzählen die Speisungsgeschichte<br />
sogar zweimal (Mk 6 und 8 par), um damit die Fülle der<br />
Adressaten des Reiches Gottes zu zeigen: Juden und Heiden<br />
(5 000 und 4 000) sollen satt werden, ein inklusives Symbol des<br />
Heils Gottes für die ganze Welt im Sinne des anbrechenden Reiches<br />
Gottes.<br />
Die zeichenhafte Handlung der Brotvermehrung im Speisungswunder,<br />
das alle satt macht, wird im letzten Mahl Jesu symbolisch<br />
auf seinen Tod bezogen. Die Einsetzungsworte im Abendmahl<br />
stellen alle Opferpraktiken der damaligen Zeit auf den Kopf,<br />
wenn sie pointiert sagen: »für euch gegeben«. Nicht für Gott wird<br />
hier etwas geopfert, sondern Gott selbst gibt sich in Christus für<br />
alle Menschen. Daher ist auch eine inklusive Reformulierung des<br />
Kelchworts angemessen: Statt »das für viele vergossen wird zur<br />
Vergebung der Sünden« können wir mit dem 2. Hochgebet im Römischen<br />
Messbuch (1970) sagen: für alle vergossen!<br />
Doch wie gehen wir mit den biblischen Überlieferungen um,<br />
die davon sprechen, dass Menschen nicht dabei <strong>sind</strong>, wenn gegessen<br />
und getrunken wird, ja womöglich so vom Heil Gottes<br />
ausgeschlossen <strong>sind</strong>? Betrachten wir dazu nochmals Lukas 14<br />
(par Mt 22), das Gleichnis vom großen Gastmahl. Viele werden<br />
<strong>eingeladen</strong>. Das Fest ist groß angelegt. Aber die Kamera des Erzählers<br />
richtet sich auf drei Personen, die zum Fest <strong>eingeladen</strong><br />
<strong>sind</strong>. Einer kauft einen Acker, ein anderer ein Joch Ochsen, ein<br />
Dritter heiratet. Für den göttlichen Gastgeber ist das traurig. Ja,<br />
er wird richtig zornig. Doch anstatt sie zu ermahnen, zu strafen<br />
oder sich einfach »sauer« zurückzuziehen und das Fest abzusagen,<br />
schickt er seinen Diener los: Geh schnell auf die Straßen und<br />
Gassen und hole die Armen und Gehbehinderten, die Blinden und<br />
Mit Gott am Tisch | 17
Lahmen herein. Die Armen bekommen – wie an Weihnachten die<br />
Hirten – die Einladung persönlich mitgeteilt! Sogar ein zweites<br />
Mal wird der Knecht losgeschickt, um auch auf den Landstraßen,<br />
jenseits der »konventionellen« Orte, Menschen einzuladen. Und<br />
alle dürfen kommen. Keiner ist dabei, der es nicht wert wäre, dabei<br />
zu sein.<br />
Ist das ein inklusiver oder ein exklusiver Text? Hier findet ganz<br />
offensichtlich – auf Initiative des Gastgebers hin – eine große<br />
räumliche und personelle »Expansion« statt. Er möchte unbedingt,<br />
dass sein Haus voll wird. Die Botschaft lautet: Das große<br />
Fest soll mit unzählbar vielen Menschen stattfinden. Eine besondere<br />
Bedingung zur Teilnahme gibt es nicht. Hauptsache, man<br />
kommt. Im Klartext: Gott tut alles, um menschliche »Selbst-Exklusionen«<br />
zu kompensieren. Gott liebt sich den Himmel voll. Ist<br />
es möglich, dass Menschen nicht kommen, dass Plätze am Tisch<br />
Gottes leer bleiben?<br />
Darauf antwortet Jesaja 25,6–9, die bereits angeführte Jesaja-<br />
Apokalypse. Sie enthüllt die große Vision eines Mahls, in dem<br />
dann doch alle dabei <strong>sind</strong>. Gott selbst ist Gastgeber für alle Völker.<br />
Diese Mahl-Vision des Reiches Gottes ist vielleicht die größte<br />
und mutigste der ganzen Bibel und zeigt etwas von der universalen<br />
Weite jüdisch-christlicher Hoffnung für die Welt.<br />
Doch noch <strong>sind</strong> wir nicht so weit. Wir leben in einer Zwischen-<br />
Epoche. Versöhnt und doch nicht vollendet. Gerechtfertigt und<br />
noch nicht verwandelt. Wie können wir damit umgehen?<br />
Paulus setzt in Galater 3,25–28 auf ein Inklusionsprogramm,<br />
das in der Rechtfertigung aus Glauben an Christus gründet und<br />
uns als Kirche heute einen klaren Blick gibt:<br />
Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus<br />
Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus<br />
angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht<br />
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid<br />
allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so<br />
seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung<br />
Erben.<br />
Damit ist klar: Wer glaubt und getauft ist, gehört dazu. Denn er<br />
oder sie ist in Christus, trägt ihn gleichsam in sich (vgl. Gal 2,20).<br />
Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder<br />
seines Standes weniger willkommen sein im Gottesdienst als ein<br />
anderer oder eine andere. Fakt ist dann aber auch: Die Reichen<br />
18 | Jochen <strong>Arnold</strong>
<strong>sind</strong> genauso willkommen wie die Armen. Diese inklusive Herausforderung<br />
betrifft besonders die »satten Kirchen« im globalen<br />
Norden des 21. Jahrhunderts.<br />
Es geht um eine Kultur der Gastfreundschaft und der Einladung.<br />
Sie ist gleichsam das Markenzeichen von Kirche. In Apostelgeschichte<br />
2 wird diese Ursituation von Kirche beschrieben.<br />
Gemeinde Christi konstituiert sich aufgrund der Wirkung des<br />
Heiligen Geistes als Gemeinschaft unter Wortverkündigung, Teilen<br />
des Brotes und Gebet (Apg 2,42).<br />
Dann heißt es weiter:<br />
Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder<br />
und Zeichen durch die Apostel. <strong>Alle</strong> aber, die gläubig geworden<br />
waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie<br />
verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem<br />
es einer nötig hatte. Sie waren täglich und stets beieinander<br />
einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den<br />
Häusern, nahmen die Speise mit Freuden und lauteren Herzen,<br />
lobten Gott und fanden Gnade beim ganzen Volk.<br />
Die Mahlfeier gehört neben der Wortverkündigung und dem Gebet<br />
zentral zum Gottesdienst der christlichen Urgemeinde. <strong>Alle</strong><br />
haben an diesen Mahlzeiten Anteil. Inklusiv ist auch das Teilen<br />
der gemeinsamen Güter. Offenbar ist man mobil, was die Wahl<br />
des Ortes angeht. Die Mahlfeiern scheinen – welch ein aktuelles<br />
Signal! – primär in den Häusern stattzufinden. Die Hausgemeinde<br />
ist das innere Herz der neuen Bewegung. Zentrales affektives<br />
Merkmal ist der österliche Jubel der Christen, der so ansteckend<br />
war, dass sich Menschen <strong>eingeladen</strong> fühlten, sich der<br />
Gemeinde anzuschließen: das meint: »Gnade bei dem ganzen<br />
Volk« finden.<br />
Ein Blick in die aktuelle praktisch-theologische Diskussion<br />
und unsere kirchliche Situation zeigt: Wir <strong>sind</strong> aktuell in einer<br />
Suchbewegung, die neben der klassischen Parochie auch andere<br />
Gemeindeformen im Fokus hat. Menschen erleben Kirche gerade<br />
nicht mehr am »klassischen Ort«, sondern auch außerhalb in<br />
einer Kneipe, auf einem Sofa am Rhein, in einem Laden an der<br />
Ecke oder natürlich – die Corona-Krise hat es eindrucksvoll gezeigt<br />
– medial im Internet. Dabei ist eine neue Kreativität und<br />
Beweglichkeit gottesdienstlicher Situationen entstanden, die<br />
gleichsam »urchristlich« ist und uns sicher guttut.<br />
Mit Gott am Tisch | 19
Doch der Blick in Apg 6 zeigt, dass es schon in der Jerusalemer<br />
Gemeinde Probleme gab. Die griechisch sprechenden Witwen<br />
wurden bei der Verteilung der Speisen übersehen. Es brauchte<br />
ein neues Amt und eine klare Verteilung der Aufgaben. Diakone<br />
sollten tätig werden und die sozial Schwächeren versorgen. Eine<br />
ethnisch-kulturelle Differenz und der schwache Status der Witwen<br />
steht im Hintergrund dieses Konflikts (Apg 6,1f.). Die eigenen<br />
Sprachgenossen liegen uns oft näher als die Geschwister anderer<br />
Kultur … Doch mit dem Mut zur Veränderung und dem Weitblick<br />
der Leitenden gelingt es, solidarisch (im Geist Jesu) zu handeln<br />
und das Gefälle zu vermindern.<br />
Auch Paulus deckt Exklusionspraktiken auf. Er konfrontiert<br />
die Korinther (1 Kor 11) mit einem Fehlverhalten, das den sowieso<br />
schon großen sozialen Unterschied zwischen Sklaven und<br />
Freien noch verschärft und fehlende Liebe untereinander ans<br />
Licht bringt: Einige <strong>sind</strong> schon satt, bevor die anderen überhaupt<br />
eingetroffen <strong>sind</strong>. Paulus hält ihnen vor: Wenn ihr ohne Rücksicht<br />
auf die Schwächeren euch am Tisch des Herrn gütlich tut, ja<br />
sie förmlich degradiert oder exkludiert, dann esst ihr euch das<br />
Mahl des Herrn »zum Gericht«.<br />
Die Ermahnung des Paulus ist klar: Wartet aufeinander! Gebt<br />
acht aufeinander. Respektiert einander. Nur so seid ihr überzeugend<br />
Gemeinde Christi.<br />
Beide Beispiele zeigen, dass kulturelle und soziale Unterschiede<br />
zur Exklusion auch unter Christen führen können. Aber<br />
der Geist der Liebe hält dagegen, wird solidarisch und kreativ.<br />
Auf diesem Hintergrund ruft Paulus die Geschichte der Einsetzung<br />
aufs Neue oder zum ersten Mal der Gemeinde in Erinnerung.<br />
Sinngemäß sagt er: Jesus hat sich für euch (alle) dahingegeben,<br />
mit seinem Leib und seinem Blut. Das ist der neue Bund<br />
Gottes mit seinem Volk, mit euch. Und er trägt euch auf, dieses<br />
Mahl immer wieder zu feiern und damit das zu tun, was Jesus getan<br />
hat, als er sich von seinen Jüngern verabschiedete. Mit diesem<br />
gemeinsamen Essen sollt ihr den Menschen Gottes Heil verkündigen,<br />
das untrennbar mit Jesu Tod verbunden ist. Wörtlich<br />
sagt er: Sooft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt,<br />
verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt (1 Kor 11,26).<br />
Damit steht das Handeln der Gemeinde unter einem großen<br />
Vorzeichen. Kirchliches Tun ist getragen vom Versprechen Jesu,<br />
dass er kommt und sich zuwendet. Zugleich hat dieses Versprechen<br />
auch den Auftrag zur Wiederholung bei sich. Eingebettet ist<br />
20 | Jochen <strong>Arnold</strong>
es zwischen zwei große Ereignisse, dem Tod und der Auferstehung<br />
Christi zum einen und seiner Wiederkunft zum anderen.<br />
Raum und Zeit werden auf großartige Weise in der Mahlfeier entschränkt<br />
und zugleich das hereingeholt und vergegenwärtigt,<br />
was unseren Raum und unsere Zeit in ein hoffnungsvolles Licht,<br />
das Licht des ewigen Gottes, stellt.<br />
Neben dieser raum-zeitlichen Inklusion treten weitere Motive<br />
in der synoptischen Überlieferung (Mt 26 und Mk 14) hervor:<br />
Ausdrücklich heißt es bei Markus und Matthäus: Für die Vielen<br />
vergossen. Das griechische Wort polloi (= viele) steht für die<br />
große Zahl aller Menschen (Mk 14,24 par Mt 26,28, vgl. Mk 10,45<br />
par Mt 20,28). Deshalb übersetzt die katholische Kirche im<br />
2. Hochgebet der Messe (Missale Romanum 1970) hier: »[…] das<br />
für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.«<br />
Die Verifikation dieser inklusiven Aussage liefert die Geschichte<br />
selbst: Denn auch Judas ist dabei. Sogar der Verräter bekommt<br />
Teil am Mahl des Herrn in jener Nacht. Am Tisch Christi<br />
<strong>sind</strong> Sünder jeder Art willkommen. Salopp gesagt: Auch schräge<br />
Vögel werden satt.<br />
Wenn wir uns heute auf ein »Inklusives Abendmahl« besinnen,<br />
können wir uns also auf deutlich mehr berufen und besinnen<br />
als »nur« auf das Abschiedsmahl Jesu mit den Jüngern. Oder<br />
besser: Wir sehen Jesu letztes Mahl im Licht dessen, was davor<br />
und danach geschah. Dafür sprechen auch die Überlieferungen,<br />
wonach sogar der Auferstandene noch mit den Jüngern gegessen<br />
hat (vgl. Lk 24,30 f. bzw. Joh 21,9–13). Jesus ist es selbst, der das<br />
Brot bricht, dankt und austeilt. So werden sie gewahr, dass es Jesus<br />
ist.<br />
Bereits 1982 wurde dieser Gedanke vom Ökumenischen Rat<br />
der Kirchen (Glaube und Kirchenverfassung) in Lima so formuliert:<br />
»Die Mahlzeiten, von denen berichtet wird, daß Jesus an ihnen<br />
während seiner irdischen Wirksamkeit teilgenommen hat, verkündigen<br />
und stellen die Nähe des Gottesreiches dar, für das die<br />
Speisungen der Menge ein Zeichen <strong>sind</strong>. Bei seinem letzten Mahl<br />
war die Gemeinschaft des Gottesreiches verbunden mit einem<br />
Ausblick auf Jesu zukünftiges Leiden. Nach seiner Auferstehung<br />
ließ der Herr seine Jünger im Brechen des Brotes seine Auferstehung<br />
erkennen. Die Eucharistie führt somit diese Mahlzeiten<br />
Mit Gott am Tisch | 21
Jesu während seines irdischen Lebens und nach seiner Auferstehung<br />
weiter und dies immer als ein Zeichen des Gottesreiches.« 4<br />
Inklusion ist nicht nur etwas für diakonische Spezialisten, sondern<br />
Zeichen der Verkündigung Jesu und des Reiches Gottes.<br />
Eine inklusive Feier ist zentrales Motiv des christlichen Gottesdienstes<br />
von der ersten Stunde des Wirkens Jesu an bis zu seiner<br />
Wiederkunft. Sie spricht alle menschlichen Sinne an: Hören und<br />
Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten. Der ganze Christus ist<br />
darin präsent: Jesus von Nazareth am Tisch mit Zöllnern, Pharisäern,<br />
Prostituierten und römischen Besatzern, der ins Leiden<br />
gehende Freund und der auferstandene Herr mit seinen Wundmalen.<br />
4<br />
Lima 1982: Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission<br />
für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen,<br />
Frankfurt a. M. 11 1987, Abschnitt E 1.<br />
22 | Jochen <strong>Arnold</strong>
B<br />
Inklusion in Kirche und Gottesdienst<br />
3. »Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische<br />
Perspektive<br />
Drea <strong>Fröchtling</strong><br />
»Es ist normal, verschieden zu sein. Wir wollen Inklusion« 31 . Mit<br />
diesem Titel wirbt eine Veröffentlichung der Evangelischen Kirche<br />
in Deutschland für eine diversitätssensible Öffnung von Theologie,<br />
Kirche und Gemeinde. Während Fragen von Inklusion in<br />
der Pädagogik zu den langjährig diskutierten Handlungsfeldern<br />
gehören, ist die Auseinandersetzung mit Inklusion als Querschnittsfrage<br />
und -aufgabe jenseits von Diakonie, Baufragen und<br />
Konfirmandenunterricht eher neuerer Natur. Inklusionsfragen<br />
wurden bislang zum Großteil der Praktischen Theologie zugeordnet,<br />
auch da allerdings eher als ›Randgebiet‹.<br />
Im Folgenden soll Inklusion in aller Kürze als Konzept, als Anspruch<br />
und als Aufgabe für Gottesdienst und kirchliches Handeln<br />
dargestellt werden. In einem ersten Teil werden Unterschiede<br />
zwischen Integration und Inklusion aufgezeigt. Ein<br />
zweiter Abschnitt informiert kurz über den rechtlichen Rahmen<br />
von Inklusion, ein dritter Abschnitt beleuchtet biblisch-theologische<br />
Hintergründe zur Inklusion. Ein spezieller Fokus auf Gottesdienst<br />
als Ort von Inklusion erfolgt im vierten Teil, während der<br />
abschließende Teil auf Inklusion über den Gottesdienstraum hinausblickt.<br />
3.1. Unterschiede zwischen Integration und Inklusion<br />
Während das lat. inclusio mit Primärbedeutungen wie »Einschließung«<br />
oder »Einschluss« eher negativ besetzt ist und u. a. in Kon-<br />
31<br />
Evangelische Kirche in Deutschland, Es ist normal, verschieden zu sein. Wir<br />
wollen Inklusion, Leipzig 2019.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 39
texten wie Gefangennahme vorkommt, 32 hat Inklusion im deutschen<br />
Sprachgebrauch eine positive Füllung. Hier wird der Begriff<br />
in der Regel »als Sozialbegriff in einem engen Bedeutungszusammenhang<br />
mit Dazugehörigkeit, Teilhabe und Gemeinschaftsbezug«<br />
33 verwendet. In öffentlichen ebenso wie in akademischen<br />
Diskursen gibt es allerdings unterschiedliche Vorstellungen davon,<br />
was Integration und Inklusion bedeuten und was die beiden<br />
Konzepte voneinander unterscheidet. In manchen Ansätzen wird<br />
Inklusion dabei als eine Weiterentwicklung der Integration verstanden<br />
(Exklusion – Segregation – Kooperation – Integration –<br />
Inklusion); andere Konzepte differenzieren deutlich(er) zwischen<br />
Integration und Inklusion und deren Prämissen.<br />
Zu der letzteren Gruppe gehören Hinz u. a. Sie betonen die<br />
grundlegend unterschiedlichen Voraussetzungen und Annahmen<br />
von Integrations- und Inklusionskonzepten: Hierzu gehören<br />
u. a. die Aspekte individuumsorientierter Ansatz (Integration) vs.<br />
Systemischer Ansatz (Inklusion), Zwei-Gruppen-Theorie (Integration)<br />
vs. Theorie einer ununterteilbaren heterogenen Gruppe<br />
(Inklusion) und spezielle Förderpläne (Integration) vs. gemeinsame<br />
Reflexion und Planung aller Beteiligter (Inklusion). 34 Inklusion<br />
geht dabei von vornherein von Diversität als Normalzustand<br />
aus. In den Worten von Schweiker: »In der inklusiven Pädagogik<br />
wird die monistische Perspektive, d. h. die Sicht einer einheitlichen<br />
Welterklärung und die dichotome Sichtweise von Menschen<br />
›mit und ohne‹ aufgegeben. Inklusion ist unteilbar. Sie schließt<br />
jedes Differenzmerkmal ein« 35 .<br />
Bei Inklusion geht es u. a. um den Einbezug aller in Gesellschaft<br />
und ihre sog. Funktionssysteme. Zum Einbezug in Funktionssys-<br />
32<br />
Eva Schattenmann, Inklusion und Bewusstseinsbildung. Die Notwendigkeit<br />
bewusstseinsbildender Maßnahmen zur Verwirklichung von Inklusion in<br />
Deutschland, Oberhausen 2014, Kap. 2.1.2., E-Book ohne Paginierung.<br />
33<br />
Wolfhard Schweiker, Prinzip Inklusion. Grundlagen einer interdisziplinären<br />
Metatheorie in religionspädagogischer Perspektive, Göttingen 2017, 44.<br />
34<br />
Vgl. hierzu die konzeptionellen Überlegungen u. a. von Andreas Hinz, Von<br />
der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung?<br />
Zeitschrift für Heilpädagogik 9 (2002), 354–361 und ders., Vom<br />
sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen<br />
Verständnis der Inklusion!?, in: Irmtraud Schnell /Alfred Sander (Hg.), Inklusive<br />
Pädagogik, Bad Heilbrunn 2004, 41–74.<br />
35<br />
Wolfhard Schweiker, Inklusive Praxis als Herausforderung praktisch-theologischer<br />
Reflexion und kirchlicher Handlungsfelder, in: Johannes Eurich /Andreas<br />
Lob-Hüdepohl (Hg.), Inklusive Kirche, Stuttgart 2011, 131–145, 135.<br />
40 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
teme wie z. B. Schule/Bildung oder Kirche/Religion gehört es, »die<br />
Lebensbedingungen so zu gestalten, dass jede Person in ihrer unverwechselbaren<br />
Einzigartigkeit unabhängig von Fähigkeiten<br />
und Unfähigkeiten als vollwertiges Mitglied (full membership)<br />
wahrgenommen und so unterstützt wird, dass niemand aus der<br />
Gemeinschaft herausfällt, Ausgrenzungen werden von Anfang an<br />
vermieden« 36 . »full membership« im Sinne von Inklusion wird<br />
dabei von Schweiker verstanden als »die beziehungsreiche, gleichberechtigte<br />
und vielfältige Gemeinschaft in der Differenz aller Mitglieder«<br />
37 . Strukturveränderungen und die Bereitstellung von<br />
Ressourcen allein reichen dabei nicht aus, um eine solche Gemeinschaft<br />
zu gestalten; ein weitreichender Mentalitätswandel<br />
gehört elementar zur inklusiven Gesellschaft dazu.<br />
Ein solcher Mentalitätswandel basiert auf einem Perspektivwechsel.<br />
Inklusionskonzepte <strong>sind</strong> ressourcenorientiert. Statt<br />
einer defizit-fokussierten Sicht auf »Anders-sein« wird das spezifische<br />
»So-sein« mit seinen jeweiligen Gaben und Stärken in den<br />
Blick genommen. Schattenmann, im Rückgriff auf Lob-Hüdepohl,<br />
integriert hier neben dem Teilhabe-Begriff auch den der<br />
Teilgabe. Hierunter versteht sie u. a. das Einbringen vorhandener<br />
Fähigkeiten und Kompetenzen in öffentliche Gestaltungsprozesse.<br />
38<br />
3.2. Inklusion: Begriff und rechtlicher Rahmen<br />
Schweiker identifiziert für den Inklusionsbegriff vier sog. Klassifikationen:<br />
a) drinnen – draußen: Zugang – Weggang, b) aktiv –<br />
passiv dabei: Partizipation, c) Bezug – Anti-Bezug: Qualität der<br />
Zugehörigkeit, d) rein – raus: Einbezogensein. 39<br />
In seinem Grundlagenwerk, »Prinzip Inklusion«, untersucht<br />
Schweiker dann u. a. Inklusion in Menschenrechtsvereinbarungen.<br />
Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass im »International<br />
Bill of Rights« Inklusion als expliziter Begriff nicht vorkommt. 40<br />
Unter Zugrundelegung der oben genannten Klassifikationen<br />
kommt Schweiker dann allerdings zu einer Neubewertung der<br />
36<br />
Ebd.<br />
37<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 337.<br />
38<br />
Schattenmann, Inklusion, Kapitel 2.3.2., E-Book ohne Paginierung.<br />
39<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 46 und 55–58.<br />
40<br />
A. a. O., 53.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 41
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Bezug auf Inklusion.<br />
Er stellt fest, »dass sich alle zentralen Wortfelder des Inklusionsbegriffs<br />
in zahlreichen Formulierungen der allgemeinen<br />
Menschenrechte von 1948 wiederfinden. Inklusion impliziert Bedeutungsinhalte<br />
wie Zugang, Zugehörigkeit, Schutz und Mitwirkung,<br />
die als Menschenrechte bereits im Gründungsdokument<br />
fest verankert <strong>sind</strong>. Der Sache nach ist Inklusion im Kanon der<br />
Menschenrechte nichts Neues.« 41<br />
Die deutsche Gesetzgebung zu Fragen von Inklusion zeichnet<br />
sich sowohl durch Diskriminierungsverbote als auch durch<br />
unterstützende Maßnahmenpakete für Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
aus. So ist z. B. das Verbot der Benachteiligung von<br />
Menschen aufgrund von Behinderung seit 1994 durch eine Ergänzungsformulierung<br />
im Grundgesetz (GG) gesetzlich verankert,<br />
42 während das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen<br />
(BGG) u. a. Barrierefreiheit regelt. Die Sozialgesetzbücher<br />
SGB IX und XII nehmen Teilhabe, Selbstbestimmung und Rehabilitation<br />
sowie Fragen der Eingliederung und Sozialhilfe in den<br />
Blick. Darüber hinaus setzt sich das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz<br />
(AGG) mit der Beseitigung von Nachteilen durch<br />
Diskriminierungsfaktoren auseinander. Zu diesen gehören, neben<br />
»Rasse«, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, Weltanschauung<br />
und sexueller Identität, auch Behinderung.<br />
Von spezieller Bedeutung ist die UN-Behindertenrechtskonvention<br />
(UN-BRK), die in Deutschland seit März 2009 rechtsverbindlich<br />
ist. Die UN-BRK greift den in der Salamanca-Erklärung<br />
von 1994 formulierten Inklusionsbegriff auf und wendet sich dezidiert<br />
gegen ein medizinisches Modell von Behinderung. Zentral<br />
für die UN-BRK ist ein sozial-menschenrechtlicher Ansatz im<br />
Verständnis von Beeinträchtigung, Behinderung und Inklusion.<br />
In der UN-BRK findet das Inklusionsprinzip auf alle Lebensbereiche<br />
Anwendung.<br />
Die UN-BRK geht in der Präambel (e) davon aus, dass »Behinderung<br />
als Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht,<br />
die sie an der vollen und wirksamen Teilhabe auf Grundlage<br />
der Gleichberechtigung mit anderen an der Gesellschaft hindern«.<br />
Art. 3 der Konvention formuliert dann sog. »allgemeine<br />
41<br />
A. a. O., 57.<br />
42<br />
GG, Artikel 3, Abs. 3, Satz 2.<br />
42 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
Grundsätze«: Hierzu gehören u. a. die Würde und Autonomie des<br />
Menschen, Entscheidungsfreiheit, das Recht auf Nichtdiskriminierung,<br />
auf Teilhabe und auf vollen Einbezug sowie auf Chancen-<br />
und Zugangsgleichheit.<br />
Das Recht auf Inklusion im Sozialraum ist in Art. 19 UN-BRK<br />
verankert. Graumann spricht hier von der Herausforderung,<br />
»dass alle gemeindenahen Dienste und Infrastrukturen zukünftig<br />
so gestaltet werden müssen, dass Menschen mit Behinderungen<br />
einen gleichberechtigten Zugang dazu haben« 43 . Gleichberechtigung<br />
in diesem Kontext bedeute sowohl die Erfahrung von<br />
Wertschätzung zu ermöglichen als auch besondere Bedürfnisse<br />
von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 44<br />
3.3. Theologisch-biblische Bezüge von Inklusion<br />
Inklusion setzt eine hohe Wertschätzung von Diversität als ›Normalfall‹<br />
voraus – also etwas, womit sich Religionsgemeinschaften<br />
in der Regel eher schwertun. Kirchengeschichte ist an vielen<br />
Stellen eine Geschichte der Normierung und der dogmatischen<br />
Setzung, die über »drinnen« und »draußen« bestimmt (hat), angefangen<br />
von dogmatischen Ab- und Ausgrenzungen und deren<br />
Konsequenzen in Kolonialismus und Mission, über Fragen der<br />
Ausgrenzung offen schwul oder lesbisch lebender Christen bis<br />
hin zu Kontroversen um die Einstellung von Religionsarbeitern<br />
und -arbeiterinnen mit Beeinträchtigungen oder sexuellen »Minderheitsidentitäten«.<br />
Ein kritischer Blick auf Kirche als »Exklusionsagentur«<br />
wäre sicherlich notwendig, kann aber an dieser<br />
Stelle nicht geleistet werden.<br />
Theologien ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts <strong>sind</strong><br />
zunehmend geprägt durch kontextuelle Zugänge zu biblischen<br />
Texten. Gleichzeitig haben Themen wie Ökumene, Menschenrechte,<br />
Dialog mit Menschen unterschiedlichen Glaubens und<br />
die Frage nach einer politischen Theologie u. a. durch die Arbeit<br />
des Ökumenischen Rates der Kirchen einen immer größeren<br />
Stellenwert gewonnen. Menschliches Leben, Glauben und Hoffen<br />
in herausfordernden Lebenssituationen nahm gegenüber de-<br />
43<br />
Sigrid Graumann, Menschenrecht ›Inklusion‹, in: Michaela Geiger /Matthias<br />
Stracke-Bartholmai (Hg.), Inklusion denken – theologisch, biblisch, ökumenisch,<br />
praktisch, Stuttgart 2017, 21–31, 26.<br />
44<br />
A. a. O., 29.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 43
duktiv-dogmatischen Zugängen auch im deutschsprachigen<br />
Raum an Bedeutung zu, und Auseinandersetzungen um die Rolle<br />
der Diakonie im Nationalsozialismus begannen. Fragen von Gerechtigkeit<br />
und Ausgrenzung nahmen so immer mehr Raum ein,<br />
und Kirche als (mögliche) »Inklusionsagentur« geriet stärker in<br />
den Blick.<br />
Schweiker spricht bezüglich des Selbstanspruchs von Theologie<br />
und Kirche von »Vollinklusion«, und argumentiert: »Hinsichtlich<br />
des Selbstanspruchs von Theologie und Kirche wird die<br />
Prinzipienformel der Vollinklusion vertreten. […] Das Erlösungsgeschehen<br />
gilt allen Menschen, darum soll das Evangelium auch<br />
allen Völkern verkündet und alle sollen durch die Taufe in die Gemeinschaft<br />
einbezogen werden …« 45<br />
Im Diskurs um Inklusion haben sich in den letzten Jahrzehnten<br />
u. a. die folgenden Haupt-Begründungszusammenhänge etabliert:<br />
a) Schöpfungsglaube: Gottes Schöpfung zeichnet sich durch Vielfalt<br />
aus; diese Vielfalt steht unter dem »Und siehe, es war alles<br />
sehr gut!« des Schöpfers. Gott begibt sich in eine individuelle<br />
Beziehung zum einzelnen Menschen (s. u. a. Jes 43,1: »Ich<br />
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein« oder<br />
Ps 139,13: »Du hast mich gebildet im Mutterleib«). Verletzlichkeit<br />
gehört zur Schöpfung dazu; Gemeinschaft wird in<br />
Verschiedenheit gelebt.<br />
b) Gottebenbildlichkeit des Menschen: 46 Gott schuf den Menschen<br />
nach seinem Bilde (1 Mose 1,26); dies begründet seine Würde.<br />
Hier betont Schweiker Unverlierbarkeit, Unteilbarkeit, Unbegreiflichkeit<br />
und Unverfügbarkeit als »formale Bestimmungen<br />
der Gottebenbildlichkeit des Menschen« – wir können<br />
diese geschenkte Würde weder selbst herstellen noch verlieren.<br />
47<br />
c) Begabung des Menschen: Jeder Mensch ist auf die eine oder andere<br />
Weise begabt allein dadurch, dass er Begabungen durch<br />
Gott geschenkt bekommt (u. a. 1 Kor 12). Es gibt bei diesen<br />
Begabungen keinerlei hierarchische Rangfolge, alle <strong>sind</strong> wich-<br />
45<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 133.<br />
46<br />
Vgl. Johannes Heger/Christian Höger, Von der Integration zur Inklusion?<br />
Wegmarken internationaler und nationaler Erklärungen, in: Sabine Pemsel-Maier/Mirjam<br />
Schambeck (Hg.), Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe, Freiburg<br />
i. Br. 2016, 73–93, 73.<br />
47<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 314.<br />
44 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
tig. Als unterschiedliche Glieder des einen Leibes <strong>sind</strong> wir<br />
aufeinander und auf Gott/Christus verwiesen. Nur in der Gemeinschaft<br />
können wir Menschsein gemeinsam gestalten.<br />
d) Jesus als menschliches Vorbild und gekreuzigter Gott: Als<br />
» heruntergekommener« Gott kennt Jesus die Vulnerabilität<br />
menschlicher Existenz, Marginalisierung und einen gewaltsamen<br />
Tod. In Begegnungen mit Menschen stellt er diejenigen<br />
in den Mittelpunkt, die entweder am Rande oder außerhalb<br />
der Städte und Dörfer leben: Menschen mit Epilepsie,<br />
Lepra-Erkrankungen und unterschiedlichen Formen körperlicher<br />
Beeinträchtigung, Sexarbeiterinnen, Menschen in Armut,<br />
Menschen, die den gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen.<br />
Körtner beschreibt diese Praxis Jesu als »Inklusion<br />
von Ausgegrenzten« 48 .<br />
e) Der Mensch als Gerechtfertigter: Jeder Mensch ist bedingungslos<br />
angenommen von Gott und in seinem Da-Sein geschätzt<br />
und geliebt. Gerechtfertigt wird unser Leben nicht aus Taten<br />
heraus, sondern allein aus der akzeptierenden Liebe Gottes.<br />
Schweiker geht noch einen Schritt weiter und beschreibt, im<br />
Rückgriff auf die trinitarische Selbstentäußerung, Gott selbst als<br />
»Inklusionsagenten«: »Der dreieinige Gott, der in einem Akt der<br />
Selbstbegrenzung Mensch wird und die partizipierende Beziehung<br />
mit dem ganz anderen (totaliter aliter) sucht, erweist sich<br />
als ein ›Inklusionsagent‹« 49 . Auch Schäper greift Fragen von Alterität<br />
auf und spricht in diesem Zusammenhang von einer Option<br />
für die Anderen als Option für die Exkludierten. Hierbei grenzt<br />
sie sich vom »othering« als »Vorgang der Distanzierung und Entwertung«<br />
ab und favorisiert, angelehnt an Emmanuel Lévinas,<br />
das Konzept der Alterität, das eine gegenseitige Verantwortung<br />
füreinander impliziert. 50<br />
48<br />
Ulrich Körtner, Anerkennung, Rechtfertigung und Gerechtigkeit als Kernbegriffe<br />
Diakonischer Ethik, in: Markus Dederich/Markus W. Schnell (Hg.), Anerkennung<br />
und Gerechtigkeit in Heilpädagogik, Pflegewissenschaft und Medizin.<br />
Auf dem Weg zu einer nichtexklusiven Ethik, Bielefeld 2014, 47–76, 54.<br />
49<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 406.<br />
50<br />
Sabine Schäper, Inklusive Kirche – Kirche der Andersheiten?, in: Johannes<br />
Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.), Behinderung – Profile inklusiver Theologie,<br />
Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 54–66, 60ff., 60.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 45
3.4. Inklusiver Gottesdienst<br />
Gottesdienste nach Agende 1 <strong>sind</strong> über Jahrzehnte als angemessene<br />
Form des gemeindlichen liturgischen Feierns und der Kommunikation<br />
des Evangeliums gesehen worden. »<strong>Alle</strong>« waren und<br />
<strong>sind</strong> als Zielgruppe gemeint. Mit der zunehmenden Auseinandersetzung<br />
um unterschiedliche Milieus und divergente Gruppen-<br />
und Einzel-Bedürfnisse kamen zielgruppenorientierte Gottesdienste<br />
mehr und mehr in den Blick. Hierzu gehör(t)en u. a.<br />
auch Gottesdienste für/mit Menschen mit Beeinträchtigungen<br />
und/oder mit Demenz. Liedke und Wagner kritisieren in diesem<br />
Zusammenhang zurecht die Praxis der »exkludierenden Inklusion«:<br />
durch einen Sonderstatus wird eine Gruppe quasi-exkludiert;<br />
die Exklusion führt dann zur gruppenspezifischen Inklusion<br />
durch besondere Angebote, z. B. durch ebensolche Gottesdienste<br />
für »besondere« Zielgruppen. 51<br />
Inklusive Gottesdienste versuchen demgegenüber Gottesdienste<br />
so zu gestalten, dass Liturgie, Verkündigung und Vergemeinschaftung<br />
für unterschiedlichste Gruppen und Menschen<br />
bedeutungsvoll, mitgestaltbar und nachvollziehbar <strong>sind</strong>. Orientierungspunkte<br />
für die Gestaltung <strong>sind</strong> hier in der Regel Menschen<br />
mit Beeinträchtigungen oder andere im Agende-1-Gottesdienst<br />
eher marginalisierte Gruppen.<br />
An dieser Stelle greift die Kritik von Stracke-Bartholmai: Er<br />
verweist darauf, dass die Bezeichnung von bestimmten Gottesdiensten<br />
als »inklusiv« gleichzeitig bedeutet, dass bestimmte<br />
Menschen(gruppen) im »normalen« Gottesdienst eine Ausnahme<br />
bilden. Auch löse die Bezeichnung »inklusiver Gottesdienst« weder<br />
»das Problem einer exklusiven Theologie« noch die Gefahr,<br />
dass ein ›inklusiver‹ Gottesdienst paternalistische Züge bekommen<br />
könne, wenn Erfahrungen und Stimmen von »Inkludierten«<br />
keinen Raum bekommen. 52<br />
Rollen im Gottesdienst <strong>sind</strong> in der Regel klar verteilt auf »Leistungsrollen«<br />
und »Publikumsrollen«. Während sich die Leistungs-<br />
51<br />
Ulf Liedke/Harald Wagner, Inklusionen. Sozialwissenschaftliche Grundlagen<br />
für eine Praxistheorie der Teilhabe und Vielfalt, in: Ulf Liedke u. a. (Hg.), Inklusion.<br />
Lehr- und Arbeitsbuch für professionelles Handeln in Kirche und Gesellschaft,<br />
Stuttgart 2016, 9–37, 16.<br />
52<br />
Matthias Stracke-Bartholmai, Unterbrechungen – Inklusion queer gedacht<br />
als Inspiration für den Gottesdienst, in: Michaela Geiger/Matthias Stracke-Bartholmai<br />
(Hg.), Inklusion denken – theologisch, biblisch, ökumenisch, praktisch,<br />
Stuttgart 2017, 57–89, 74.<br />
46 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
ollen primär auf Lektoren und Lektorinnen, Pastoren und Pastorinnen,<br />
Diakone und Diakoninnen sowie Prädikanten und<br />
Prädikantinnen verteilen, nimmt bei Agende-1-Gottesdiensten<br />
die Gemeinde, soziologisch betrachtet, eher die Publikumsrolle<br />
ein. Partizipation ist damit von vornherein eher responsorisch<br />
und folgt vorgegebenen Pattern. Um Gottesdienste als »inklusiv«<br />
bezeichnen zu können, müsste u. a. Partizipation auf wesentlich<br />
breiterer Ebene gewährleistet sein. Ausgehend von den »UNESCO<br />
Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All«<br />
aus dem Jahr 2005 erhebt Schweiker folgende Merkmale für Inklusion:<br />
»Inklusion ist ein Prozess, der sich an der Diversität aller<br />
Menschen orientiert […], zunehmende Partizipationen ermöglicht<br />
und Exklusion in allen Lebensbereichen verringert. Dies beinhaltet<br />
die Umstellungen und Veränderungen von Inhalten, Methoden,<br />
Strukturen in der Perspektive einer gemeinsamen Vision<br />
von Inklusion.« 53 Überträgt man dies auf den Gottesdienst, so bedeutet<br />
das einen grundlegend anderen Ansatz gottesdienstlichen<br />
Feierns.<br />
Für den Bereich der Partizipation sieht Schweiker drei Aspekte:<br />
Zugang/access, Zugehörigkeit/membership und Mitwirkung/take<br />
part in: 54<br />
a) Zugang: Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen<br />
(BGG, Art. 4) beschreibt Barrierefreiheit wie folgt: Barrierefrei<br />
<strong>sind</strong> alle von Menschen geschaffenen Lebensbereiche, z. B.<br />
Bauten, Verkehrsmittel, Systeme der Informationsverarbeitung<br />
und Kommunikationseinrichtungen, »wenn sie für Menschen<br />
mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise,<br />
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde<br />
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar <strong>sind</strong>«. Zugang zum<br />
Gottesdienst wird häufig nicht nur durch Treppen, fehlende<br />
Induktionsschleifen und den Mangel an Großdruckausgaben<br />
des Gesangbuchs erschwert, sondern neben baulichen und<br />
strukturellen Barrieren auch durch Barrieren didaktischer<br />
Art. Liturgie und Predigt rechnen in der Regel mit Gottesdienstfeiernden,<br />
für die eine diskursive Logik zugänglich ist<br />
und die wortzentrierten Abläufen folgen können. Um Zugang<br />
auch inhaltlich barrierefrei zu gestalten, muss der Gottes-<br />
53<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 74.<br />
54<br />
A. a. O., 387.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 47
dienst grundlegend anders aufgebaut und strukturiert werden,<br />
um »Inhalte« begreifbar werden zu lassen.<br />
Zugehörigkeit: Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft<br />
ist durch die Taufe gegeben. Zugehörigkeit steht auch nichtgetauften<br />
Menschen offen – das Reich Gottes hat viele Wohnungen.<br />
Was theologisch als gegeben erachtet wird, muss allerdings<br />
auf der kommunikativen und der emotionalen<br />
Ebene spürbar werden: »Indem Menschen sich einander<br />
›mitteilen‹, lassen sie einander teilhaben an den eigenen Gedanken,<br />
Bedürfnissen und Interessen. ›Teil-habe‹ stellt somit<br />
eine Verbindung zwischen Menschen her. Folglich stiftet und<br />
stärkt Kommunikation Gemeinschaft« 55 . Kommunikation,<br />
die Gemeinschaft stiftet, braucht über liturgische Responsorien<br />
hinaus Räume, in denen ein direkter Austausch und direkte<br />
Begegnung stattfinden können. Gottesdienste müssen<br />
dabei Zugehörigkeit als Befindlichkeit mit schaffen. Hierzu<br />
eignet sich insbesondere das Abendmahl. In der liturgischen<br />
Tischgemeinschaft kann Zugehörigkeit erfahrbar werden,<br />
wenn der Gemeinschaftscharakter liturgisch hervorgehoben<br />
wird. Zugehörigkeit ist dann gegeben, wenn Menschen sich<br />
positiv gemeint und wertgeschätzt fühlen und wenn sie Formen<br />
und Inhalte gottesdienstlichen Feierns für sich als »stimmig«<br />
erleben.<br />
b) Mitwirkung: Auf theologischer Ebene bietet das Priestertum<br />
aller Gläubigen eine partizipative Basis. Fraglich bleibt dabei,<br />
ob es eine Vollinklusion aller geben kann (und sollte), ohne<br />
zwischen Leistungsrolle und Publikumsrolle zu diskriminieren.<br />
56 Im Kontext Gottesdienst reicht das bloße Betonen des<br />
Priestertums aller Gläubigen in der Regel nicht aus, um Partizipation<br />
zu erleben. Hier gilt die Forderung von Seufert &<br />
Frey-Seufert, auch die liturgische Verantwortung inklusiv zu<br />
gestalten. 57<br />
55<br />
Cornelia Jager, Gottesdienst ohne Stufen. Ort der Begegnung für Menschen<br />
mit und ohne geistige Behinderung, Stuttgart 2018, 116.<br />
56<br />
Schweiker, Prinzip Inklusion, 126.<br />
57<br />
Kyra Seufert/Gerd Frey-Seufert, »Mit dabei« – inklusiver Gottesdienst. Außergewöhnliche<br />
Begegnung sensibilisiert für andere Lebenswelten, in: Johannes<br />
Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.), Behinderung – Profile inklusiver Theologie,<br />
Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 277–283, 280.<br />
48 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
Seufert und Frey-Seufert legen 10 Thesen bezüglich inklusiver<br />
Gottesdienste vor. 58 Ihre Ausgangsüberzeugung ist, dass »[j]ede<br />
christliche Gemeinde […] von ihrem Auftrag und Selbstverständnis<br />
her dazu aufgefordert [ist], inklusive Gottesdienste zu feiern«<br />
59 . Das Ziel inklusiver Gottesdienste sehen sie darin, »die<br />
biblische Botschaft erlebbar zu machen« 60 . Dieses »Erlebbar-Machen«<br />
beinhaltet die bedingungslose Akzeptanz als Person und<br />
das Wertgeschätzt-Werden als Geschöpf Gottes.<br />
Folgende Elemente können dabei helfen, Gottesdienste inklusiver,<br />
d. h. begreifbarer, sinnvoller und beziehungsorientierter zu<br />
gestalten, auf der vertikalen wie auf der horizontalen Ebene:<br />
1. Sprache: Kommunikative Exklusion geschieht häufig in Gottesdiensten,<br />
die stark wort-zentriert <strong>sind</strong>; u. a. Menschen mit<br />
Migrationshintergrund ohne Deutsch als Muttersprache fühlen<br />
sich häufig in agendarischen lutherischen Gottesdiensten<br />
nicht zu Hause. Leichte(re) Sprache kann hier inkludierend<br />
wirken. Kurze Sätze, die nur eine Hauptaussage haben,<br />
helfen beim Verstehen und machen »Inhalte« zugänglicher,<br />
für alle. Bei Menschen, die mit Demenz oder anderen kognitiven<br />
Beeinträchtigungen leben, braucht es häufig darüber hinaus<br />
visuelle Hilfen wie Abbildungen und eine eher emotionale<br />
Sprache in der Kommunikation. Aktive Satzformen <strong>sind</strong> leichter<br />
verständlich als Passiv-Konstruktionen. Eine Trennung<br />
von zusammengesetzten Hauptwörtern hilft z. B. bei ausgeteilten<br />
Texten, den Sinn zu erfassen. Verbale Kommunikation<br />
ist in der Regel verlangsamt bei Menschen mit Demenz, so<br />
dass z. B. bei Liturgien genügend Raum für Antworten gegeben<br />
werden muss.<br />
2. Liturgie: Klassische Liturgien bieten für Menschen mit Demenz<br />
ein oft sehr hilfreiches Orientierungsgerüst, weil das<br />
Langzeitgedächtnis darauf häufig noch zugreifen kann. Für<br />
Menschen mit anderen kognitiven Beeinträchtigungen und<br />
für Deutschlernende eignen sich diese Liturgien in der Regel<br />
nur bedingt, weil die Sprache altertümlich und wenig alltagsorientiert<br />
ist. Hier kann stattdessen eine Mischung aus klassischen<br />
Elementen und neuformulierten Passagen in leichter<br />
Sprache zum Einsatz kommen. Es lohnt sich, Liturgien in of-<br />
58<br />
A. a. O., 279–281.<br />
59<br />
A. a. O., 279.<br />
60<br />
A. a. O., 280.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 49
fenen Workshops mit unterschiedlichsten Gemeindegruppen<br />
zu thematisieren und daraus eine kontext- und bedürfnisorientierte<br />
Liturgie zu entwickeln, die über einen längeren<br />
Zeitraum regelmäßig zum Einsatz kommt. Anstelle einer Predigt<br />
kann eine solche Liturgie z. B. Raum lassen für Bibliolog,<br />
Bible sharing oder andere Zugänge, in denen Gottesdienstfeiernde<br />
sich dem Text/Thema ebenso nähern können wie ihren<br />
Mit-Feiernden im Gottesdienst. Je beteiligungsorientierter Liturgien<br />
<strong>sind</strong>, desto stärker ist ihr integrierendes, partizipatorisches<br />
Potential. Beteiligung kann dabei ganz unterschiedliche<br />
Formen annehmen, vom moderierten Gespräch bis hin<br />
zu frei formulierten Gebeten mit Symbolen.<br />
3. Rituale: Rituale schaffen Sicherheit, wenn die eigene Welt, z. B.<br />
durch das Erleben von Demenz, unüberschaubar und unerklärlich<br />
geworden ist. Gleichzeitig schaffen Rituale, wenn sie<br />
gemeinschaftlich ausgeführt werden, ein starkes Gefühl der<br />
Zugehörigkeit. Solche Rituale können z. B. das gemeinsame<br />
Anzünden von Kerzen bei der Fürbitte oder eine körperlich<br />
erfahrbare Form der Segnung sein.<br />
4. Kreativität: Kreative Elemente helfen bei der Aneignung von<br />
Inhalten, und sie schaffen Gemeinschaft, wenn es sich um<br />
kollektives Tun handelt. Kreative Elemente können aus dem<br />
darstellenden Bereich (z. B. Anspiel, Arbeit mit Atelierpuppen,<br />
Bibliolog) oder aus dem herstellenden Bereich kommen<br />
(z. B. Arbeit mit Ton, Symbolerstellung, bemalte Ostereier<br />
oder selbst gebastelte Weihnachtssterne als Hoffnungszeichen<br />
etc.). Kreativität eröffnet einen unmittelbaren Zugang;<br />
Inhalte werden so handhabbar.<br />
5. Gemeinschaft erleben: Zahlreiche Menschen erfahren Exklusion<br />
auf gesellschaftlicher Ebene, weil ihr Da-Sein oder ihr So-<br />
Sein nicht den Normsetzungen einer Mehrheitsgesellschaft<br />
oder einer Religionsgemeinschaft entspricht. Das Abendmahl<br />
kann der gottesdienstliche Höhepunkt im Erleben von horizontaler<br />
und vertikaler Gemeinschaft sein, vorausgesetzt,<br />
dass es dementsprechend liturgisch eingebettet wird. Starkes<br />
Gemeinschaftserleben wird auch im gemeinsamen Singen<br />
und Musizieren deutlich – hier bietet es sich an, selbst gebaute<br />
Instrumente im Gottesdienst zum Einsatz zu bringen.<br />
Auch divers aufgestellte Vorbereitungsteams für Gottesdienste<br />
eignen sich gut als Gemeinschafts-Raum.<br />
50 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
Inklusive Gemeinde ist, ebenso wie Inklusion als Gesamtansatz,<br />
eine Vision, deren Umsetzung politischen Willen, mentale Bereitschaft,<br />
Kreativität und eine grundlegende Orientierung an Diversität<br />
als herzustellenden ›Normalfall‹ braucht. Stracke-Bartholmai<br />
betont, dass es bei Inklusion auch um die Unterbrechung<br />
der herrschenden Verhältnisse geht. 61 Er verweist darauf, dass<br />
der Gottesdienst häufig unter der Perspektive der »Unterbrechung«<br />
verstanden wird und fordert eine kritische Reflexion<br />
langjähriger Praxis: »Wird der inklusive Moment […] als Anlass<br />
zur kritischen Hinterfragung der eigenen Praxis genommen,<br />
wird das, was ursprünglich als Unterbrechung auftrat, irgendwann<br />
normal« 62 . Gottesdienste und Gemeinden brauchen diese<br />
kritische (Selbst-)- Hinterfragung, um schrittweise diverser, inklusiver<br />
und partizipatorischer zu werden.<br />
3.5. Inklusion über den Gottesdienstraum hinaus<br />
Als »traditionelle Perspektive« beschreibt Schäper den Fokus auf<br />
individuelle Herausforderungen, vor denen einzelne Menschen<br />
mit Beeinträchtigungen stehen. Für diese Menschen würden spezifische<br />
(Gruppen-)Angebote gemacht. 63 Demgegenüber sieht sie<br />
in der Inklusionsperspektive den Fokus auf Gemeinden und Kirche<br />
als Ganzes gerichtet – damit werde Inklusion zum Auftrag<br />
der Kirche und zur »Handlungsmaxime der Gemeindeleitung<br />
und aller haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden« 64 . Einen<br />
ähnlichen Ansatz vertritt Schweiker, wenn er betont: »[I]nklusive<br />
Praxis [ist] unteilbar und kann darum nicht auf einzelne kirchliche<br />
Sektoren begrenzt werden. Sie erstreckt sich auf die Praxis<br />
des gesamten Gottesvolkes […] und fordert alle kirchlichen Einrichtungen<br />
und Werke heraus, alle Handlungsfelder und Kirchengemeinden«<br />
65 . Teilhabe-Themen können nicht an Diakonie<br />
61<br />
Stracke-Bartholmai, Unterbrechungen, 75.<br />
62<br />
A. a. O., 88.<br />
63<br />
Sabine Schäper, Kirche als Inklusionsagentur und/oder -akteurin? – Chancen<br />
und Widersprüche auf der Suche nach einer neuen Rolle, in: Johannes Eurich/Andreas<br />
Lob-Hüdepohl (Hg.), Inklusive Kirche, Stuttgart 2011, 146–162,<br />
hier: 152.<br />
64<br />
Ebd.<br />
65<br />
Schweiker, Inklusive Praxis, 141.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 51
und Caritas delegiert werden; sie betreffen kirchliches Leben,<br />
Glauben und Handeln als Ganzes. 66<br />
Schäper kennzeichnet Inklusion als Selbstverpflichtung – sie<br />
»setzt die gemeinsame Verantwortung eines Gemeinwesens für<br />
soziale Prozesse voraus« 67 . Eine solche Selbstverpflichtung erfolgt<br />
in der EKD-Veröffentlichung »Es ist normal, verschieden zu sein:<br />
Wir wollen Inklusion«: »Die Kirche will Menschen mit Behinderungen<br />
ernst nehmen. Dafür muss sich die Kirche verändern.« 68<br />
Als Teil dieses Veränderungsprozesses beschreibt die EKD den<br />
Schritt weg von Fürsorge für eine Minderheit hin zu einem Patienten-Kollektiv<br />
(Bach) oder einer Ermutigungsgemeinschaft<br />
(Bollag), in der alle gegenseitig aufeinander verwiesen und angewiesen<br />
<strong>sind</strong> und sich auf Augenhöhe begegnen. Im gegenwärtigen<br />
kirchlichen Leben stellt die Veröffentlichung dabei noch<br />
große Defizite fest: »Aber die Kirche hat noch einen weiten Weg<br />
vor sich, damit sie eine inklusive Kirche wird. Die Arbeit der Kirchengemeinden<br />
ist noch nicht vielfältig genug. Zum Beispiel treffen<br />
sich in den Gemeinden oft keine Mitglieder mit Behinderungen.<br />
Die meisten Mitglieder, die sich dort treffen, <strong>sind</strong> auch nicht<br />
arm.« 69 Diese Aufzählung ließe sich sowohl milieuspezifisch auffächern<br />
als auch in Bezug auf Menschen mit Migrationshintergrund<br />
ergänzen.<br />
Kirchenmitglieder haben, so Schweiker, nicht nur das Recht<br />
auf barrierefreies Leben im Gemeinwesen, sondern auch auf »gestaltungsaktive<br />
Teilhabe inmitten der kirchlichen Gemeinschaft«<br />
70 . Dies setzt voraus, dass eine »Entdiakonisierung der<br />
Wahrnehmung behinderter Menschen« erfolgt. 71 Gleiches gilt für<br />
Menschen mit Migrationshintergrund, die vielfach eher als Objekte/Hilfeempfänger<br />
diakonischen Handelns denn als Mitgestalter<br />
kirchlichen Lebens und Handelns wahrgenommen werden.<br />
Die Entwicklung und Umsetzung eines auf Kirche und<br />
Gemeinde bezogenen »Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung<br />
66<br />
Wolfhard Schweiker, Implikationen von Inklusion für Kirchengemeinden, in:<br />
Johannes Eurich/Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.), Behinderung – Profile inklusiver<br />
Theologie, Diakonie und Kirche, Stuttgart 2014, 167–177, 172.<br />
67<br />
Schäper, Kirche als Inklusionsagentur, 154f., 155.<br />
68<br />
EKD, Inklusion, 42 (Fassung in leichter Sprache).<br />
69<br />
A. a. O., 51f., 52.<br />
70<br />
Schweiker, Implikationen, 173.<br />
71<br />
Ulf Liedke, Menschen. Leben. Vielfalt. Inklusion als Gabe und Aufgabe für<br />
Kirchengemeinden, Pastoraltheologie 3 (2012), 71–86, 81.<br />
52 | Drea <strong>Fröchtling</strong>
der UN-Behindertenrechtskonvention« wie er von der Bundesregierung<br />
vorgelegt wurde, könnte dabei helfen, Inklusion als Querschnittsaufgabe<br />
auf allen Ebenen kirchlichen Handelns zu verankern.<br />
»Wir wollen Inklusion« – eine praktisch-theologische Perspektive | 53
C<br />
Gottesdienst<br />
und Abendmahl<br />
inklusiv<br />
6. Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst –<br />
praktische Thesen und Leitfragen<br />
Jochen <strong>Arnold</strong> und Dirk <strong>Schliephake</strong><br />
»Die gewohnte Liturgie ist theologisch verantwortlich und sensibel<br />
so zu gestalten, dass alle Menschen in ihren individuellen Besonderheiten,<br />
ihren vielfältigen Lebens- und Glaubenserfahrungen<br />
angemessen berücksichtigt werden und ohne Ausgrenzung<br />
gemeinsam ein Fest der Verschiedenen feiern.« 82<br />
Dieser Leitsatz von Ralph <strong>Kunz</strong> setzt eine neue Haltung aller<br />
voraus, Ziel ist eine Barrierefreiheit in den Köpfen gegenüber<br />
denen, die abweichen von sozialen, kulturellen und lokalen Gewohnheiten<br />
und eine Überwindung von Ausschlusstendenzen<br />
und Rollenfestlegungen. Wo Gottesdienst inklusiv gefeiert wird<br />
oder besser: wo wir uns der inkludierenden Kraft der Liturgie anvertrauen,<br />
entsteht eine Gemeinschaft der Hoffnung, der Liebe<br />
und des Glaubens – immer wieder neu.<br />
»Inklusion ist kein Akt der politischen Korrektheit und die volle<br />
Gemeinschaft der Heiligen ist keine Sache des Anstands oder<br />
eine Gnade, die Normale einer Gruppe von Abnormalen gewähren.<br />
Inklusion ist ein Prozess, der auf Erhöhung der Partizipationsmöglichkeiten<br />
aller Menschen abzielt, um so die geistlichen,<br />
sozialen, kulturellen Ressourcen des Gottesdienstes für alle Menschen<br />
zu erschließen, Gemeinde aufzubauen und Gemeinschaft<br />
entstehen zu lassen. Gnade ist es, wenn uns das gelingt.« 83<br />
82<br />
Vgl. Ralph <strong>Kunz</strong>, Inklusive Gemeinde, in: Ders./Ulf Liedke, Handbuch Inklusion<br />
in der Kirchengemeinde, Göttingen 2013, 96.<br />
83<br />
A. a. O., 95.<br />
Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst | 71
Wie wird diese inklusive Gemeinschaft im Gottesdienst<br />
k onkret gestaltet?<br />
1. Jeder kann kommen, so wie er ist (Willkommenskultur)<br />
Glocken laden alle auf gleiche Weise ein. Ihre Schwingungen rufen<br />
Menschen in die Nähe Gottes. Sie bringen die Gastfreundschaft<br />
Gottes und der christlichen Gemeinde zum Klingen. <strong>Alle</strong><br />
werden dort geschwisterlich und mit gleicher Wertschätzung begrüßt.<br />
Im Namen Gottes richten wir uns und unsere Herzen auf<br />
den gemeinsamen Ursprung aus und öffnen uns für ein Feiern<br />
auf gleicher Augenhöhe als Geschwister.<br />
Können alle, die wollen, auch wirklich kommen? Gibt es eine Begleitung<br />
oder einen Fahrdienst? Kommen alle an die Informationen<br />
zum Gottesdienst heran? Ist ein barrierefreier Zugang möglich?<br />
Können alle gut hören, sehen und bequem sitzen?<br />
2. Leichte Sprache für elementare Zugänge und Erfahrungen<br />
(Elementarisierung)<br />
Im Gottesdienst <strong>sind</strong> möglichst viele Zugänge und Methoden elementar<br />
und verständlich. Lebenswirklichkeiten und Glaubenserfahrungen<br />
der verschiedenen Menschen werden wahr- und<br />
ernstgenommen. Gebete und Predigten konzentrieren sich auf<br />
elementare biblische Grundmotive. Die Sprache im Gottesdienst<br />
enthält immer auch (liturgisch) Leichte Sprache. Dazu gehört der<br />
Verzicht auf Verneinungen und auf Fremdwörter und Abstrakta.<br />
Klare Verbformen (Indikativ und Imperativ) helfen ebenso wie<br />
eine Aussage pro Satz (vgl. <strong>Arnold</strong>/Gidion/Martinsen).<br />
Werden die Leitsätze der Leichten Sprache angewendet? Wo und<br />
wie kommen eigene Glaubenserfahrungen ins Spiel? Konzentrieren<br />
sich Texte und Lieder auf elementare biblische Motive?<br />
3. Mit allen Sinnen Gottes Güte feiern (Sinnenhaftigkeit)<br />
Besonders bedeutsam für die, die in einzelnen Sinnesbereichen<br />
ihrer Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung eingeschränkt<br />
<strong>sind</strong>, ist die Beteiligung möglichst aller Sinne im Gottesdienst:<br />
sehen, hören, riechen, schmecken, somatisch spüren,<br />
Schwingungen erleben, sich bewegen. Gegenstände aus dem Alltag<br />
oder der Bibel werden mit vielen Sinnen »begriffen«. Der Kirchenraum<br />
und seine symbolische Gestaltung und die liturgi-<br />
72 | Jochen <strong>Arnold</strong> und Dirk <strong>Schliephake</strong>
schen Farben des Kirchenjahres werden intensiv wahrgenommen.<br />
Singen, Klänge und Musik (Orgelschwingungen) lassen den<br />
eigenen Körper spüren. Die Predigten werden so gestaltet, dass<br />
innere Bilder mit allen Sinnen erfahrbar werden.<br />
Werden mindestens vier elementare Sinne angesprochen? Sind<br />
Lieder und Musik sinnenreich und bringen den Körper zum Klingen?<br />
Wird die Predigt mit vielen inneren, sinnengefüllten Bildern<br />
gestaltet?<br />
4. Der ganze Körper fühlt und schmeckt (Leiberfahrungen)<br />
Berührung ist eine Grundgeste der Mitmenschlichkeit und leiblichen<br />
Zuwendung. Im Gottesdienst findet ein sensibler Umgang<br />
mit annehmenden und gebenden Berührungen statt, z. B. Segensgesten,<br />
Handreichen, Friedensgruß, Salbung. Lieder und Gebete<br />
werden mit Gebärden unterstützt. Das verstärkt ihre emotionale<br />
Tiefe. Bibelworte werden nicht erklärt, sondern erzählt, gelesen<br />
und zugesprochen. Biblische Geschichten werden erzählt, die die<br />
Zuwendung Gottes leiblich erfahrbar machen. Gemeinsam wird<br />
gegessen und getrunken und Tischgemeinschaft erlebt. Das<br />
Abendmahl wird miteinander gefeiert: Christus kommt uns nahe.<br />
Wir schmecken seine freundliche Zuwendung.<br />
Welche Gesten der Zuwendung <strong>sind</strong> in diesem Gottesdienst erlebbar?<br />
Werden Kinder und Menschen mit Behinderungen zum<br />
Abendmahl <strong>eingeladen</strong>? Wie feiern wir regelmäßig im Gottesdienst<br />
Tauferinnerung?<br />
5. Mit Händen und Füßen (Handlungsorientierte Teilhabe)<br />
Bewegung und Körpersprache im Gottesdienst <strong>sind</strong> mehr als Aufstehen<br />
und Sich-Hinsetzen. Gebete, Psalmen, Lieder und Tänze<br />
bieten gute handlungsorientierte Teilhabemöglichkeiten. Menschen<br />
werden beteiligt nach ihren Möglichkeiten, Bewegungen<br />
und Gesten spontan zu »erfinden« und mit allen auszuprobieren.<br />
Es geht nicht um Perfektion, sondern um die Freude, den ganzen<br />
Körper zur Ehre Gottes und zum eigenen Wohlbefinden einzusetzen.<br />
Welche Lieder singen wir mit Bewegungen? Welchen Psalm beten<br />
wir mit einer Gebärde?<br />
Besteht Offenheit für spontane Bewegungen im Gottesdienst?<br />
Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst | 73
6. Gefühlen Raum geben (Emotionale Resonanzen)<br />
Die Fähigkeit zu fühlen, zu lachen, zu weinen, wütend oder ängstlich<br />
zu sein, haben alle Menschen gemeinsam. Im Gottesdienst<br />
gibt es keine falschen Gefühle. Verschiedene Arten, wie Menschen<br />
sich beteiligen und anwesend <strong>sind</strong>, ihre Gefühlsäußerungen und<br />
ihre Mimik werden als Resonanz begrüßt und wertschätzend aufgenommen.<br />
Emotionen werden, wenn es sein muss, eingegrenzt,<br />
aber nicht entwertend verboten. Stimmungen und Emotionen<br />
im Gottesdienst werden in Gebeten aufgenommen und geteilt:<br />
»Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden.«<br />
(Röm 12,15)<br />
Welche Gefühle bestimmen diesen Gottesdienst? Wie wird mit<br />
Wut oder Trauer im Gottesdienst umgegangen? Werden Gefühlsäußerungen<br />
in den Gebeten aufgenommen? Beklagen wir in den<br />
Fürbitten einseitig das Leben von Kindern, Behinderten, Alten?<br />
7. Einen heilsamen Rhythmus erleben<br />
Wir feiern einen inklusiven Gottesdienst in einem rhythmischen<br />
Wechsel von Passivität und Aktivität, Aufnehmen und Geben,<br />
Stille und Bewegung. Es wechseln sich dialogische, meditative,<br />
bewegende und erzählende Teile ab. Wir achten auf einen klanglichen<br />
Wechsel von Gesprochenem und Gesungenem, Gesten<br />
und Handlungen und vermeiden lange Phasen einer monologischen<br />
Verkündigungsform. Wir achten besonders auf Momente<br />
der Stille. Wir gestalten die Übergänge der einzelnen Phasen<br />
möglichst ohne moderierende Worte, sondern mit akustischen<br />
Signalen oder Liedern.<br />
Wie sieht der Rhythmus dieses Gottesdienstes aus? Wo <strong>sind</strong> die<br />
Momente der Stille und die bewegten Phasen? Wie gestalten wir<br />
die Übergänge gut?<br />
8. Erfahrungen mit Gott kommunizieren<br />
(Erfahrungsorientiert erzählen)<br />
Erfahrungen, die biblische Menschen mit Gott gemacht haben,<br />
stehen im Zentrum der Kommunikation des Evangeliums. Diese<br />
biblischen Erfahrungen verbinden sich mit den eigenen Glaubenserfahrungen,<br />
erweitern, verändern oder deuten sie neu. Erfahrungen<br />
werden in inneren Bildern im Gehirn gespeichert. Im<br />
Gottesdienst werden diese inneren Bilder gebildet und erweitert.<br />
74 | Jochen <strong>Arnold</strong> und Dirk <strong>Schliephake</strong>
Erzählen wir Bibelgeschichten mit inneren Bildern? Ermöglichen<br />
wir Gespräche und das Einbringen eigener Erfahrungen? Erzählen<br />
wir uns im Gottesdienst-Team von unseren eigenen Glaubenserfahrungen?<br />
9. Rituale gemeinsam erfahren (Erinnernde Vorausahnung)<br />
Feste, regelmäßig wiederkehrende Lieder, Psalmen, Rituale und<br />
liturgische Abläufe stiften Ordnung, unterstützen Menschen,<br />
sich zu orientieren, Handlungssicherheit zu gewinnen und heimisch<br />
zu werden. Fest ritualisierte Abläufe stiften Gemeinschaft<br />
und ein Wir-Gefühl. Rituale dienen der Vergewisserung und Heiligung:<br />
Ich gehöre zu Gott. Wir gehören zur Gemeinschaft der<br />
Heiligen (3 Mose 19,2). Regelmäßige Tauferinnerung ist wichtig<br />
mit der biblischen Zusage: »Gott spricht: Du bist ein geliebtes<br />
Kind Gottes.« Rituale werden möglichst von allen gemeinsam<br />
vollzogen und versuchen, alle zu beteiligen. Besonders der Segen<br />
am Ende des Gottesdienstes hat den Charakter einer verheißenen<br />
Zusage. Mit »Amen« bekräftigen alle die Zusagen und Gebete.<br />
Ja, so soll es sein.<br />
Welche Rituale feiern wir regelmäßig im Gottesdienst? Ist der Ort<br />
der Rituale und ihr Ablauf gut gewählt? Ist der Segen wirklich ein<br />
Segen oder nur eine Segensbitte?<br />
10. Differenzierte Vertiefungsmöglichkeiten eröffnen<br />
Nicht alles muss von allen verstanden werden. Nicht alles wird für<br />
alle gleich wichtig. Nicht alle müssen alles tun können. Aber für<br />
jeden soll es eine Beteiligungsebene geben. Jede Person kann sich<br />
ihren Möglichkeiten, Neigungen, Bedürfnissen entsprechend differenzierten<br />
Angeboten zuwenden. Besonders bietet sich eine<br />
Vertiefungsphase nach der Predigt dafür an: Die einen werden<br />
kreativ, die anderen singen oder theologisieren. Differenzierung<br />
bietet die Chance zu vertiefen, was für den Einzelnen wichtig geworden<br />
ist. Angebote können gewählt werden, in denen unterschiedliche<br />
Gaben, Neigungen, Fertigkeiten zum Einsatz kommen.<br />
Menschen, die unscheinbar, unangepasst, gehörlos, blind,<br />
geistig behindert <strong>sind</strong>, werden dadurch aktiv beteiligt.<br />
Werden differenzierte Angebote vorbereitet für die Vertiefungsphase?<br />
Welche räumlichen Möglichkeiten bieten sich an? Wird<br />
prozessorientiert vertieft? Wie wird der individuelle Vertiefungsprozess<br />
gewürdigt?<br />
Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst | 75
11. Kompetenzen stärken und selbst einbringen<br />
Jede und jeder kann und soll sich seinen Begabungen gemäß einbringen.<br />
Dabei werden die Menschen nicht im Blick auf ihre Defizite,<br />
sondern auf ihre Kompetenzen hin betrachtet. Menschen<br />
beteiligen sich gern dort, wo sie ihre Stärken haben. Unterschiedliche<br />
Begabungen und Interessen kommen im Gottesdienst vor.<br />
Menschen mit Behinderung und kleine Kinder dürfen nicht in<br />
eine passive Objektrolle der Hilfsbedürftigen abgedrängt werden.<br />
Sie <strong>sind</strong> selbstbestimmte Subjekte. Ihnen wird freundlich Assistenz<br />
als Hilfe zur Selbsthilfe angeboten.<br />
Wie gestalten wir eine Ermutigungskultur? Welche Partizipationsmöglichkeiten<br />
bietet dieser Gottesdienst? Wie können wir<br />
Talente von Gemeindegliedern und Mitarbeitenden entdecken?<br />
12. Vergewisserung: die Kraft Gottes spüren<br />
Im Gottesdienst wird jeder und jede in seinem/ihrem Selbstwertgefühl<br />
und auch für den Alltag gestärkt. Im Gottesdienst erfährt<br />
der/die Einzelne neue Kraft und Ermutigung, Vergewisserung<br />
und Stärkung. Gottesdienste stärken Hoffnungen, trainieren<br />
Liebe und vergewissern Glauben! Besonders im Abendmahl und<br />
beim Segen wird diese Kraft Gottes erfahrbar. Aber auch durch<br />
Wahrnehmung, Wertschätzung und Beteiligung im Gottesdienst.<br />
Wie erfahren wir als Mitarbeitende die Kraft Gottes im Gottesdienst?<br />
Segnen wir (einzelne) Menschen im Gottesdienst? Gehen<br />
wir wertschätzend miteinander im Team um?<br />
13. Spielen und Humor<br />
Nicht nur Kinder spielen gerne. Im Spiel erfahren wir einen Raum<br />
der Freiheit und Freude. Im Spiel begegnen wir einander und erwerben<br />
alle wesentlichen Kompetenzen für das Leben. Inklusive<br />
Liturgie ist immer auch spielende Liturgie. Gott kommt ins Spiel<br />
und will mit uns die Freiheit des Reiches Gottes entdecken. Im<br />
Spiel <strong>sind</strong> alle beteiligt und offen für Mitspielende und Erweiterung<br />
der Spielmöglichkeiten. Am besten gelingen Spiele, wenn<br />
sie mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit Humor gespielt werden. Inklusive<br />
Gottesdienste <strong>sind</strong> durchdrungen von einer humorvollen<br />
Grundhaltung, die keinen Menschen beleidigt, lächerlich macht<br />
oder auslacht. Diese Grundhaltung lässt mit Störungen gelassen<br />
umgehen.<br />
76 | Jochen <strong>Arnold</strong> und Dirk <strong>Schliephake</strong>
Gehen wir humorvoll an die Vorbereitung des Gottesdienstes?<br />
Freuen wir uns auf das gemeinsame Spiel im Haus Gottes? Sind<br />
wir bereit zum Mitspielen? Welche Kompetenzen werden beim<br />
Spiel im Angesicht Gottes gestärkt?<br />
14. Gottes Geist Raum geben<br />
Vertrauen, dass Gottes Geist auch unter schwierigen Bedingungen<br />
eines Gottesdienstes wirkt, heißt: Wir vertrauen, dass Gott<br />
auch im Verborgenen gegenwärtig ist. <strong>Alle</strong> Menschen im Gottesdienst<br />
haben Anspruch auf theologisch verantwortliche und liturgisch<br />
gestaltete Begegnungen mit Gottes Nähe und Güte. Sie<br />
haben Anspruch auf vollen Ernst und keine Banalisierungen. Im<br />
Gottesdienst haben wir es immer mit dem lebendigen Gott zu<br />
tun, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Herrn über<br />
Leben und Tod. Darum <strong>sind</strong> Gottesdienste Orte, wo uns die Menschenfreundlichkeit<br />
Gottes und seine Kraft begegnen: Immer<br />
geht es dabei um Stärke und Schwäche, Widerstand und Ergebung,<br />
Licht und Schatten. »Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.«<br />
(2 Kor 3,17)<br />
Wie finden wir Kraft, auch unter schwierigen Bedingungen Gottesdienst<br />
zu feiern? Wie werden wir aus- und fortgebildet für den<br />
Dienst der Verkündigung? Wer begleitet uns fachlich und seelsorglich?<br />
15. Diakonische Solidarität stärken<br />
Die inklusive Hoffnungskraft eines Gottesdienstes wirkt auch im<br />
Alltag weiter. Besonders im Abendmahl, bei den Abkündigungen<br />
und den Fürbitten wird die weltweite Solidarität mit Menschen<br />
in Not und Mitverantwortung für Gottes Schöpfung feiernd und<br />
betend eingeübt. Nicht Resignation oder bloßes Pflichtgefühl,<br />
sondern eine lebendige Hoffnung nährt und inspiriert das diakonische<br />
Handeln der Gemeinde. Gottesdienst und Diakonie, Beten<br />
und Tun folgen aufeinander und <strong>sind</strong> zugleich untrennbar verbunden<br />
wie zwei Seiten einer Medaille.<br />
Ist die diakonische Dimension des Abendmahls spürbar? Kommen<br />
aktuelle Themen der weltweiten Ungerechtigkeit zur Sprache?<br />
Werden Menschen mit ihrer Lebenswirklichkeit beteiligt bei<br />
den Fürbitten?<br />
Inklusion als Chance für Kirche und Gottesdienst | 77
TEIL II:<br />
<strong>Alle</strong> <strong>sind</strong> <strong>eingeladen</strong> –<br />
Abendmahl inklusiv feiern
A<br />
Schöpfung<br />
und Schöpfungsgaben<br />
Lobe den Herrn, meine Seele!<br />
Ein Gottesdienst draußen [Psalm 104]<br />
Susanne Paetzold<br />
Vorüberlegungen<br />
Psalm 104 fasziniert durch eindrucksvolle, mächtige Bilder, die<br />
uns in Bewegung bringen. Gottes Fantasie und Fürsorge können<br />
wir sehen, riechen und schmecken. Er stärkt unsere Seele und<br />
unser Herz. Der Text lockt uns für den Gottesdienst nach draußen,<br />
um uns unmittelbar in den Lichtglanz Gottes zu stellen. Daraus<br />
ergibt sich eine Änderung der Abendmahlsliturgie.<br />
Bei Sonnenschein wäre ein Gottesdienst draußen besonders<br />
berührend, braucht allerdings technische Verstärkung, ausreichend<br />
Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz. Der Altar steht mitten<br />
auf einer grünen Wiese. Die Gottesdienstgemeinde sitzt im<br />
Kreis oder in Halbkreisen.<br />
Bei schlechtem Wetter lassen sich manche Schöpfungsgaben<br />
in die Kirche tragen und Vogelgezwitscher über die Lautsprecheranlage<br />
einspielen. Mit der rechtzeitigen Zucht von Katzengras<br />
lässt sich ein Altar im Kirchenraum »auf die Wiese« setzen.<br />
Dann hat die gewohnte Abendmahlsliturgie ihren Platz.<br />
Klang zum Votum: Sansula-Kalimba besonders schön in der<br />
Stimmung »heavenly a«.<br />
Stationen zum Flanieren vor, während oder nach dem Gottesdienst<br />
<strong>sind</strong> unter »kreative Bausteine« ausgeführt.<br />
Gottesdienst<br />
Musik zum Eingang<br />
Votum<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 129
Wir decken den Tisch<br />
Liturgin: Die Schöpfung klingt.<br />
<strong>Alle</strong>: Gott, dein Licht lässt Blumen blühen.<br />
Kerzen anzünden; Blumen auf den Altar stellen – Musik: Kalimba, Orgel, o. Ä.<br />
L: Die Liebe klingt.<br />
A: Jesus Christus, du gingst ans Kreuz für uns.<br />
Kreuz auf den Altar stellen – dazu Musik: Kalimba, Orgel, o. Ä.<br />
L: Das Leben klingt.<br />
A: Heiliger Geist, du hast Worte des Lebens für uns.<br />
Bibel auf den Altar legen und aufschlagen – dazu Musik: Kalimba, Orgel, o. Ä.<br />
Wir feiern Gott in unserer Mitte.<br />
Amen.<br />
Begrüßung<br />
L: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Der Glanz Gottes hüllt uns<br />
ein, der Klang Gottes empfängt uns. Wir <strong>sind</strong> hier. Gotteserfahrungen<br />
der Menschen aus alten Zeiten bringen unsere<br />
Seele heute Morgen zum Klingen. In diesem Gottesdienst<br />
<strong>sind</strong> Worte und Bilder aus Psalm 104 Gottes Geschenk an<br />
uns. Seine Bilder <strong>sind</strong> Lebensproviant für die Seele und fröhlicher<br />
Klang der Güte Gottes. Wir stehen in Gottes Schöpfung,<br />
entdecken Gottes Gaben, wandeln im Glanz Gottes<br />
und essen Brot beim Abendmahl. Gottes Freude kommt zu<br />
Wort und bewegt uns.<br />
»Denn wir essen Brot und leben vom Glanz«, schreibt Hilde<br />
Domin im Gedicht »Die Heiligen«.<br />
Dieser Spur folgen wir in diesem Gottesdienst, liebe Gemeinde.<br />
Eingangsgebet<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Wie zahlreich <strong>sind</strong> deine Werke.<br />
Du beschenkst uns jeden Tag.<br />
Überschwänglich sorgst du für uns.<br />
Wir genießen die Gaben deiner Schöpfung.<br />
Im Abendmahl schmecken und sehen wir,<br />
130 | Susanne Paetzold
wie freundlich du zu uns bist.<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Amen.<br />
Gemeinsames Lied | Lobe den Herren, den mächtigen König<br />
der Ehren (EG 316)<br />
Kyrie<br />
Mit all unserer Zerrissenheit sitzen wir an deinem Tisch –<br />
erbarme dich.<br />
Mit all unseren Sorgen sitzen wir an deinem Tisch –<br />
erbarme dich.<br />
Mit Krankheit und all unserem Schmerz sitzen wir an deinem<br />
Tisch – erbarme dich.<br />
Mit all unseren Erschöpfungen sitzen wir an deinem Tisch –<br />
erbarme dich.<br />
Mit all unserem Hunger nach Liebe sitzen wir an deinem Tisch –<br />
erbarme dich.<br />
Gloria 32-01 | Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich (Kanon)<br />
1.<br />
F C B<br />
F<br />
Die<br />
Que la<br />
Herr<br />
grâ<br />
lich<br />
ce<br />
keit des Herrn blei<br />
du Sei gneur<br />
be<br />
sub<br />
e<br />
siste<br />
wig<br />
à<br />
lich,<br />
ja mais,<br />
2.<br />
der<br />
qu’il se<br />
Herr<br />
ré<br />
freu<br />
e<br />
jou<br />
sich<br />
is se<br />
sei ner<br />
des ses<br />
Wer<br />
œu<br />
ke!<br />
vres!<br />
3.<br />
Ich will<br />
Je chan<br />
sin<br />
te rai<br />
gen<br />
le<br />
dem Herrn<br />
Sei gneur<br />
mein<br />
tant<br />
Le<br />
que j’ex<br />
ben lang;<br />
is te rai;<br />
4.<br />
ich<br />
je<br />
will<br />
cé<br />
lo ben<br />
lé bre<br />
mei nen Gott,<br />
rai mon Dieu<br />
so<br />
tant que<br />
lang<br />
je<br />
ich<br />
vi<br />
bin.<br />
vrai.<br />
In: Durch Hohes und Tiefes 257, München 2009<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 131
Lesung aus Johannes 6<br />
Jesus Christus spricht:<br />
»Ich bin das Brot des Lebens. Eure Eltern haben in der Wüste das<br />
Manna gegessen und <strong>sind</strong> gestorben. Dies ist das Brot, das vom<br />
Himmel kommt, damit alle von ihm essen und so nicht mehr<br />
sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen<br />
ist. <strong>Alle</strong>, die von diesem Brot essen, werden ewig leben.<br />
Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Körper für das Leben<br />
der Welt.« (Die Bibel in gerechter Sprache, Joh 6,48–51)<br />
Glaubensbekenntnis<br />
Wir stehen auf, bekennen unseren Glauben und singen:<br />
Wir glauben: Gott ist in der Welt ( freiTöne = fT 137)<br />
Predigtimpuls<br />
Menschen <strong>sind</strong> Jäger und Sammlerinnen – schon immer. Das<br />
steckt in unserem genetischen Bauplan. Das Wissen um logistische<br />
Warenbestandsaufnahmen und politische Versprechen »es<br />
gibt genug«, halten uns nicht davon ab: vom Sammeln. In der Corona-Krise<br />
waren es Brotbackmischungen, Mehl und Klopapier.<br />
Supermarktregale hinterlassen Botschaften an die Sammlerinnen<br />
und Sammler: jeder bitte nur 2 Stück Hefe, 4 Liter Milch und<br />
eine Packung Klopapier. Wir staunen. Nicht über leere Regale,<br />
sondern über uns selber. Wir staunen, dass wir so <strong>sind</strong>.<br />
Die Betenden des Psalms waren auch so. Gleicher genetischer<br />
Bauplan wie wir. Was sie zum Leben brauchten, gab es nicht zu<br />
kaufen. Sie waren angewiesen auf die Gaben der Schöpfung. Bevorratung<br />
und Lagerhaltung waren nicht so ausgeprägt wie in<br />
unseren Zeiten, aber es gab sie auch damals: Jäger und Sammler.<br />
Was sie von uns unterscheidet?<br />
Ihre Lebenseinstellung.<br />
Vertrauen und Dankbarkeit.<br />
Sie vertrauen darauf:<br />
Da ist EINER, der gibt reichlich. So viel du brauchst und noch<br />
mehr. Das Land ist voller Früchte.<br />
Da ist EINER, der gibt großzügig. Als Zeichen der Verbundenheit.<br />
Wein und Öl erfreue des Menschen Herz.<br />
Da ist EINER, der gibt reichlich. Ich muss nur die Hand aufhalten.<br />
Da ist EINER, der gibt großzügig. Ich darf mich freuen.<br />
132 | Susanne Paetzold
Sie <strong>sind</strong> dankbar und wissen, WER es ist, der da gibt.<br />
Sie staunen über Gott, den König und HERRN, über Fülle und<br />
Reichtum und über Freude.<br />
Lobe den HERRN, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes<br />
getan hat, heißt es einen Psalm weiter vorn in der Bibel.<br />
Wir <strong>sind</strong> heute gestellt in Gottes Schöpfung.<br />
Vergesst das nicht und lasst euch beschenken.<br />
Vertraut darauf und bleibt dankbar.<br />
Wenn ich meine Hand auftue, empfange ich.<br />
Wenn ich meine Hand auftue, wird sie gefüllt – nein, gesättigt mit<br />
Gutem.<br />
Satt.<br />
Bin ich satt?<br />
Was macht satt?<br />
Was macht meine Seele satt?<br />
Wir essen Brot und leben vom Glanz.<br />
Wir stehen heute im Licht Gottes, halten die Hand auf und bekommen<br />
Brot, das uns stärkt und Wein, der uns erfreut. Was die<br />
Psalmbeter nicht ahnen, Gott ist unendlich großzügig. Gott gibt<br />
mehr als Brot, Wein und Öl, Hoffnungszeichen des Heils.<br />
Gott gibt sich selbst. Ganz. Für uns.<br />
Gott kommt zu uns in Christus, dem wahren Licht. Folgen wir<br />
ihm und wandeln im Licht des Lebens.<br />
Gott kommt zu uns in Christus, dem Brot des Lebens. Kommen<br />
wir zu ihm, dann werden wir nicht hungern. Jesus gibt sich<br />
hin für das Leben der Welt. Wer von diesem Brot isst, der wird leben<br />
in Ewigkeit.<br />
Gott kommt zu uns in Christus, dem wahren Weinstock. Bleiben<br />
wir in ihm, wenn wir Abendmahl feiern.<br />
Im Abendmahl schmecken wir Gottes »DNA«. Seine Phantasie,<br />
seine Weisheit, seine Liebe ist in die Schöpfung eingestiftet.<br />
Gott gibt, wir dürfen empfangen, schmecken, uns stärken und<br />
freuen. Gleich feiern wir miteinander Abendmahl. In diesem Moment<br />
<strong>sind</strong> wir durch Christus eingestiftet in ein Leben mit Gott.<br />
Wandeln wir in seinem Licht, essen von seinem Brot und trinken<br />
vom wahren Weinstock.<br />
Voller Vertrauen und dankbar stellen wir uns in Gottes Licht,<br />
staunen, öffnen unsere Sinne und machen uns empfangsbereit.<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 133
Körpergebet zu Psalm 104<br />
Mitten auf grünem Gras in Gottes weiter Schöpfung<br />
<strong>sind</strong> wir versammelt.<br />
Wir kommen zum Tisch des HERRN.<br />
Jeder mit seinen Erfahrungen, seiner Gestimmtheit,<br />
seinen Sorgen oder seiner Freude.<br />
Wir kommen in Kontakt mit den Worten aus Psalm 104.<br />
Staunen und beten.<br />
Jede, jeder für sich ganz persönlich.<br />
Wer mag, steht auf und macht mit.<br />
Eine steht neben den Sprechern und macht die Bewegungen vor.<br />
A<br />
B<br />
Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt;<br />
der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden,<br />
dass es nicht wankt und bleibt immer und ewiglich.<br />
Gott sorgt für mich.<br />
Ich stehe.<br />
sicheren Stand suchen<br />
Stehe fest auf sicherem Grund. locker in den Knien<br />
Ich bin geerdet.<br />
Geerdet im Glauben,<br />
verwurzelt in Gott.<br />
hin und her schwingen<br />
Das Fundament seiner Schöpfung<br />
ist Grund des Glaubens der Zeugen,<br />
die schon vor mir gestaunt und<br />
dieses Lied gesungen haben:<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
B<br />
HERR, mein Gott, du bist sehr groß;<br />
in Hoheit und Pracht bist du gekleidet.<br />
Licht ist dein Kleid, das du anhast.<br />
Schaue und staune:<br />
Gottes Schöpfung.<br />
Der weite Himmel.<br />
Die Landschaft.<br />
Die Blumen und Bäume.<br />
Licht und Schatten.<br />
Du in der Schöpfung –<br />
Schaue dich um<br />
Schaue nach oben<br />
nach links und rechts<br />
Schaue auf den Boden<br />
Stelle dich aufrecht hin<br />
134 | Susanne Paetzold
mit anderen in der weiten Schöpfung Gottes.<br />
Schaut euch an!<br />
Gemeinde schaut sich an<br />
Du stehst im Licht Gottes.<br />
Spürst du es?<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A Du tränkst die Berge von oben her,<br />
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.<br />
Du lässest Gras wachsen für das Vieh<br />
und Saat zu Nutz den Menschen,<br />
B Lausche in die Schöpfung. Augen schließen<br />
Höre das Zwitschern der Vögel. Hände hinter die Ohren<br />
halten<br />
Höre das Summen der Bienen.<br />
Höre die Sonntagsstille.<br />
Hörst du das Gras wachsen?<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;<br />
wenn du deine Hand auftust,<br />
so werden sie mit Gutem gesättigt.<br />
B Halte deine Hände auf Hände zur Schale formen<br />
und warte.<br />
Stille<br />
Du bekommst viel Gutes – so viel du brauchst.<br />
Was brauchst du wirklich?<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
Du bringst Brot aus der Erde hervor.<br />
Wein erfreue des Menschen Herz<br />
und sein Gesicht glänze vom Öl<br />
und Brot stärke des Menschen Herz.<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 135
B<br />
Manche Gabe lässt sich nicht sammeln.<br />
Manche Schöpfungsgabe<br />
muss noch werden.<br />
Handflächen streichen<br />
im Wechsel<br />
Aus Saat und Früchten wird<br />
Brot für den Alltag.<br />
Brot auf den Tisch<br />
stellen (Assistent/in 1)<br />
Wein für das Fest.<br />
Wein auf den Tisch stellen<br />
(Liturgin)<br />
Öl als Zeichen der Verbundenheit. Öl auf den Tisch stellen<br />
(Assistent/in 2)<br />
Spürt etwas vom Glanz Gottes, Salböl herumgeben und<br />
einsalben<br />
vom guten Duft des Lebens,<br />
(Assistentin 1, Assistent<br />
2, Liturgin)<br />
Öl, das reinigt und pflegt.<br />
Kannst du Gott genießen?<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
Es wartet alles auf dich,<br />
dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.<br />
B Gott ist großzügig. Arme zum Himmel strecken<br />
Abendmahl als Fest des Lebens<br />
mitten im Alltag.<br />
Kelch wird auf den Tisch<br />
gestellt<br />
An diesem Tisch »erfahren wir von dem Gott,<br />
der vom Himmel gekommen ist,<br />
um in die Schmerzen und<br />
Arme vor der Brust kreuzen<br />
Schönheit der Menschheit einzutreten«.<br />
(Nadia Bolz-Weber)<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
Du sendest aus deinen Atem,<br />
so werden sie geschaffen,<br />
und du machst neu das Antlitz der Erde.<br />
B Ich atme ein tief einatmen<br />
136 | Susanne Paetzold
und atme aus.<br />
Was nimmt mir den Atem?<br />
Was raubt mir die Kraft?<br />
tief ausatmen,<br />
<strong>Alle</strong> Herr, wie <strong>sind</strong> deine Werke so groß und viel!<br />
Du hast sie alle weise geordnet,<br />
und die Erde ist voll deiner Güter.<br />
A<br />
B<br />
Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich,<br />
der HERR freue sich seiner Werke!<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Halleluja!<br />
Sei gewiss:<br />
Gott freut sich an seinen Geschöpfen.<br />
Gott freut sich über dich.<br />
Freut euch!<br />
Singt Gott ein Lied:<br />
Arme fallen lassen<br />
Schwingen und bewegen<br />
Gemeinsames Lied | Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich<br />
(Kanon)<br />
In: Das Liederbuch »Lieder zwischen Himmel und Erde« Nr. 150<br />
An dieser Stelle ist ein Schreittanz zum Kanon ein schönes Gemeinschaftserlebnis.<br />
Abkündigung<br />
Gemeinsames Lied | Wunderbarer König (EG 327)<br />
Fürbitten<br />
Gott, du sorgst für uns …<br />
In allem Schweren stärke mich, in aller Trauer tröste mich.<br />
Namen der Verstorbenen und aktuelle Anliegen einfügen.<br />
Gott, du sorgst für uns …<br />
Dankbar für alles Gute in meinem Leben.<br />
Namen der Getauften und Brautpaare und aktuelle Anliegen<br />
einfügen.<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 137
Gott, du sorgst für uns …<br />
In deiner Verheißung stehen wir und<br />
beten als Christen in der Welt.<br />
Aktuelle Ereignisse und Anliegen aufnehmen.<br />
Oder: Fürbitten mit Erzählgebet<br />
Gott,<br />
wir staunen über deine Schöpfung, über deinen Lebensatem.<br />
Immer wieder ein neuer Anfang. Jeder Atemzug ein Geschenk.<br />
Jeder Tag ein neuer Tag in deiner Welt.<br />
Gott,<br />
wir staunen und <strong>sind</strong> dankbar, für alles, was du uns schenkst.<br />
Ich bin von Herzen dankbar für …<br />
Wer mag, erzählt.<br />
Gott,<br />
wir staunen auch über Müll, Klimawandel und Zerstörung.<br />
<strong>Alle</strong>s hängt miteinander zusammen.<br />
Das Licht und die Wolken,<br />
der Regen und die Pflanzen,<br />
Menschen und Tiere.<br />
Gott,<br />
wir <strong>sind</strong> ratlos und bitten dich für unsere Welt.<br />
Ich achte die Schöpfung, indem ich …<br />
Wer mag, erzählt einen Einsatz/Beitrag für die Natur.<br />
Gott,<br />
deine Werke <strong>sind</strong> so groß und so viel,<br />
wir danken dir!<br />
Amen.<br />
Gemeinsames Lied | <strong>Alle</strong>r Augen warten auf dich, Herre (fT 16)<br />
Einladung<br />
Gott will uns eine Freude machen.<br />
Wir halten die Hände auf und empfangen Gutes!<br />
Gottes gute Schöpfungsgaben.<br />
Wir kommen an seinen Tisch,<br />
halten die Hände auf und empfangen Brot.<br />
Gottes strahlendes Wort erfüllt das<br />
138 | Susanne Paetzold
von Menschen gemachte Brot.<br />
Gott stärkt uns. Christus schenkt sich uns.<br />
Er ist Geschmack des Himmels und der Glanz unseres Lebens.<br />
Gebet<br />
Wir kommen an deinen Tisch, halten die Hände auf und<br />
empfangen dein Heil.<br />
Du schenkst uns ein. Wein(-traubensaft), der unser Herz erfreut.<br />
Du heilst uns an Leib und Seele.<br />
Du machst uns satt für Alltag und Festzeiten.<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Gott, wir stehen fest in deinem Glanz.<br />
Gott, wir bitten dich um deine heilsame Gegenwart.<br />
Wir atmen ein und atmen aus.<br />
Spüren deine Lebenskraft.<br />
Kraft vom Himmel auf die Erde.<br />
<strong>Alle</strong> warten, dass du ihnen Speise gibst zu ihrer Zeit.<br />
Lied | Du bist heilig (fT 153)<br />
Vaterunser<br />
Einsetzungsworte<br />
Einladung<br />
Kommt und seht, wie freundlich der HERR ist.<br />
Kommt, es ist alles bereit.<br />
Das Brot des Lebens für dich.<br />
Der Kelch des Heils für dich.<br />
Austeilung mit Musik<br />
Dankgebet<br />
Gott, du bist großzügig.<br />
Gott, du gibst reichlich.<br />
Wir riechen und schmecken, wie freundlich du bist.<br />
Wir danken dir, dass du uns stärkst an Leib und Seele!<br />
Lobe den HERRN, meine Seele!<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 139
Gemeinsames Lied | Lobe den Herrn, meine Seele<br />
(fT 80, auch als Kanon)<br />
Entlassung und Segen<br />
Musik zum Ausgang<br />
Im Anschluss an den Gottesdienst<br />
Schattenplätze einrichten. Liegestühle hinstellen.<br />
Gaben aus Gottes Garten genießen: Kaffee, Wasser, Fruchtsäfte, Brot,<br />
Obst, Gemüse.<br />
Schaukel und Hängematten einrichten, wenn es der Kirch- bzw.<br />
Pfarr garten hergeben.<br />
Kreative Bausteine<br />
Dusch-Stationen<br />
Vor und nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit zum Flanieren.<br />
An drei Orten können sich die Besucherinnen und Besucher beschenken<br />
lassen oder schöpferisch tätig werden. Gleichzeitig ist<br />
es ein Ausweichort für kleine Kinder, die dem ganzen Gottesdienst<br />
noch nicht folgen können. In der Zwischenzeit können sie<br />
an den Orten wirksam werden, mit Licht spielen, mit den Händen<br />
arbeiten, gute Worte pflücken und sich zusprechen lassen.<br />
– »Licht ist dein Kleid, das du anhast«<br />
Lichtdusche (z. B. Stehlampe)<br />
Im Glanz Gottes duschen, Wärme spüren und<br />
mit Licht spielen<br />
– »Du tränkst die Berge von oben her,<br />
du machst das Land voll Früchte«<br />
Regendusche (z. B. Gartendusche) –<br />
das Land ist voll und alles wächst:<br />
Samen einpflanzen und gießen oder<br />
Schöpfungsgarten gestalten<br />
– »Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt«<br />
Segensdusche (z. B. Sonnenschirm)<br />
Segensworte pflücken<br />
eigene Karten gestalten und<br />
zum Pflücken zur Verfügung stellen<br />
140 | Susanne Paetzold
Psalm malen<br />
Arbeitsplätze einrichten<br />
Maluntergrund mit Kreppklebeband auf Holzplatten fixieren<br />
Gemalt wird mit Jaxxon-Kreiden<br />
Psalm hören<br />
Psalm 104 wird zweimal gelesen<br />
wirken lassen<br />
Farben auswählen und Kreide holen<br />
in Stille arbeiten<br />
Einführung in die Stille, Arbeitsplatz abtasten und blind malen<br />
Gefühlen nachspüren<br />
mit offenen Augen und Lappen weitermalen und<br />
mit Farben spielen<br />
Galeriezeit<br />
Bilder betrachten, Erfahrungen austauschen,<br />
einen Ausschnitt auswählen und Passepartout kleben<br />
Lobe den Herrn, meine Seele! | 141
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten<br />
<strong>sind</strong> im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
© 2021 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist<br />
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt<br />
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen<br />
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Gesamtgestaltung: makena plangrafik, Leipzig<br />
Druck und Binden: CPI books GmbH<br />
ISBN 978-3-374-06621-6 // eISBN (PDF) 978-3-374-06732-9<br />
www.eva-leipzig.de