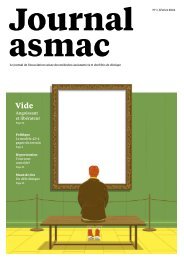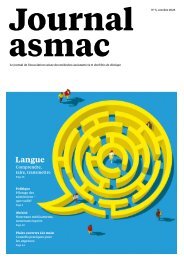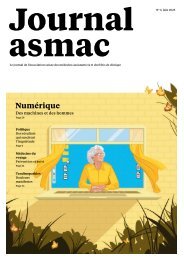vsao Journal Nr. 2 - April 2023
Partnerschaft - Suchen, finden, bewahren Politik - Weiterbildung und Arbeitszeit Thrombosen - «Nebenwirkungen» der Pandemie Proktologie - Leitsymptome und Massnahmen
Partnerschaft - Suchen, finden, bewahren
Politik - Weiterbildung und Arbeitszeit
Thrombosen - «Nebenwirkungen» der Pandemie
Proktologie - Leitsymptome und Massnahmen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>vsao</strong><br />
<strong>Nr</strong>. 2, <strong>April</strong> <strong>2023</strong><br />
<strong>Journal</strong><br />
Das <strong>Journal</strong> des Verbandes Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte<br />
Partnerschaft<br />
Suchen, finden, bewahren<br />
Seite 20<br />
Politik<br />
Weiterbildung und<br />
Arbeitszeit<br />
Seite 6<br />
Thrombosen<br />
«Nebenwirkungen»<br />
der Pandemie<br />
Seite 50<br />
Proktologie<br />
Leitsymptome und<br />
Massnahmen<br />
Seite 54
Wir lassen Ihnen Ihre<br />
Individualität.<br />
Dienstleistungen und Software, die zu Ihrer Praxis passen.<br />
Jede Arzt- oder Therapiepraxis ist anders. Das ist gut so. Darum sind die Software- und<br />
Dienstleistungsangebote der Ärztekasse modular aufgebaut und passen sich an Ihre<br />
individuellen Bedürfnisse an.<br />
Weitere Infos und Angebote auf<br />
aerztekasse.ch<br />
Ärztekasse – die standeseigene<br />
Genossenschaft an Ihrer Seite<br />
publix.ch
Inhalt<br />
Partnerschaften<br />
Suchen, finden, bewahren<br />
Coverbild: Stephan Schmitz<br />
Editorial<br />
5 Zusammen geht es einfacher –<br />
oder nicht?<br />
Politik<br />
6 Weiterbildung ist Arbeitszeit!<br />
9 Auf den Punkt gebracht<br />
Weiterbildung /<br />
Arbeitsbedingungen<br />
10 Was ist eigentlich strukturierte<br />
Weiterbildung?<br />
13 Im AA-Universum<br />
Perspektiven<br />
50 Aktuelles aus der Gefässmedizin:<br />
Arterielle und venöse Thrombosen<br />
bei COVID-19-Infektionen<br />
54 Aus der «Therapeutischen<br />
Umschau» – Übersichtsarbeit:<br />
Leitsymptome bei proktologischen<br />
Erkrankungen und allgemeine<br />
Massnahmen<br />
59 Der besondere Ort<br />
mediservice<br />
60 Briefkasten<br />
62 Fitter mit Klettern<br />
64 Mobilität der Zukunft<br />
<strong>vsao</strong><br />
14 Neues aus den Sektionen<br />
18 <strong>vsao</strong>-Inside<br />
19 <strong>vsao</strong>-Rechtsberatung<br />
66 Impressum<br />
Fokus: Partnerschaften<br />
20 Virtuelle Suche nach analogem Glück<br />
24 Im Gleichklang übers Glatteis<br />
28 Der vergessene Teil der Natur<br />
30 Tipps für eine erfolgreiche<br />
Praxisgemeinschaft<br />
36 Das Verbindende pflegen<br />
38 «Zusammen fühlen wir uns wohl»<br />
40 Partnerschaftliche Beziehungen<br />
hinter Gittern<br />
44 Ein Lotse für alle Wege<br />
48 Scheidungsschmerz verringern<br />
Anzeige<br />
Wir können Ärztinnen und Ärzten einiges bieten, weil wir sie gut verstehen.<br />
Als mediservice <strong>vsao</strong>-Mitglied gehören Sie zu einer privilegierten Gruppe:<br />
Sie haben exklusiven Zugang zu einem Online-Stellenvermittlungsportal und<br />
auf eine Online-Agenda mit Seminarangeboten. Als angehender Arzt können<br />
Sie zudem exklusiv an Laufbahn-Kongressen auf höchstem Niveau teilnehmen.<br />
www.mediservice-<strong>vsao</strong>.ch<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 3
Allgemeine<br />
Innere Medizin<br />
06. – 10.06.<strong>2023</strong> Zürich<br />
40 h<br />
Innere Medizin<br />
20. – 24.06.<strong>2023</strong> Zürich<br />
40 h<br />
Hausarzt<br />
Fortbildungstage<br />
09. – 10.03.<strong>2023</strong> St. Gallen<br />
14 Credits SGAIM<br />
23. – 24.03.<strong>2023</strong> Bern<br />
14 h<br />
Anästhesiologie<br />
und Intensivmedizin<br />
16. – 17.05.<strong>2023</strong> Zürich<br />
16 h<br />
EKG – Grundkurs 14 h<br />
05. – 06.06.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Gynäkologie<br />
24 h<br />
27. – 29.04.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Nephrologie<br />
15 h<br />
23. – 24.06.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Neurologie 16 Credits SNG<br />
12. – 13.05.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Ophthalmologie 15 h<br />
08. – 09.06.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Pädiatrie<br />
24 h<br />
26. – 28.04.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Pneumologie<br />
14 h<br />
12. – 13.05.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Psychiatrie und<br />
Psychotherapie<br />
04. – 06.05.<strong>2023</strong> Zürich<br />
Urologie<br />
12.05.<strong>2023</strong> Zürich<br />
24 h<br />
7 h<br />
Update Refresher<br />
Alle weiteren Kurse im Jahr <strong>2023</strong><br />
auf www.fomf.ch<br />
Information / Anmeldung<br />
Tel.: 041 567 29 80 | info@fomf.ch | www.fomf.ch<br />
Hybrid: Teilnahme vor Ort oder via Livestream<br />
Publicjobs - das Jobportal für Mediziner*innen<br />
Offene Stellen als Oberärzt*innen oder Assistenzärzt*innen<br />
Jetzt bewerben auf publicjobs.ch
Editorial<br />
Zusammen geht<br />
es einfacher –<br />
oder nicht?<br />
Catherine Aeschbacher<br />
Chefredaktorin <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
Gewisse Partnerschaften muten auf den ersten Blick ziemlich<br />
ungewöhnlich an. So ungewöhnlich, dass man sie<br />
lange Zeit ins Reich der Märchen verwiesen hat. So gibt es<br />
in der Mythologie der amerikanischen Ureinwohner die<br />
Überlieferung von der Freundschaft zwischen Kojoten und Dachsen.<br />
Vor einigen Jahren fing eine Kamerafalle tatsächlich Bilder ein, die<br />
einen Kojoten und einen Dachs mit einem offensichtlich sehr vertrauten<br />
Umgang zeigten. Obwohl die Wissenschafter nicht so weit gehen<br />
wollten, dies als «Freundschaft» zu bezeichnen, sprachen sie doch<br />
davon, dass sich hier «zwei wilde Tiere ihrer Partnerschaft eindeutig<br />
bewusst sind».<br />
In unserm Fokus-Teil geht es nicht um derart exotische Partnerschaften,<br />
aber um vielerlei Formen des Zusammenfindens, der Zusammenarbeit<br />
oder des Zusammenseins. Wie wählt man beispielsweise geeignete<br />
Partner bzw. Partnerinnen für eine Praxisgemeinschaft aus?<br />
Wie finden Sportlerpaare zusammen, die in höchster Harmonie über<br />
Eisflächen gleiten? Was verbindet Städte, die über Kontinente hinweg<br />
Partnerschaften eingehen? Wie werden blinde Menschen und ihre<br />
Führhunde zu einem perfekten Team? Und wie steht es um Partnerschaften<br />
unter erschwerten Bedingungen, zum Beispiel bei Strafgefangenen?<br />
Dank sozialer Medien wird die Partnersuche vermeintlich einfacher;<br />
unzählige Kontakte stehen zur Verfügung. Die scheinbar unbegrenzten<br />
Möglichkeiten haben aber ihre Tücken, wie die Expertin für Tinder<br />
und Co in unserem Schwerpunkt belegt. Im ganz realen Leben haben<br />
sich Serge und Raymonde getroffen und vor mehr als 50 Jahren geheiratet.<br />
Sie geben Tipps für eine dauerhafte Partnerschaft. Und falls es<br />
doch anders herauskommen sollte, berichtet eine Scheidungsanwältin<br />
über sinnvolle Wege der Trennung. Schliesslich kehren wir nochmals<br />
zur Natur zurück: Der Evolutionsgenetiker macht klar, dass neben dem<br />
Fressen und Gefressenwerden das partnerschaftliche Zusammenleben<br />
und die gegenseitige Unterstützung ein ebenso erfolgreiches Überlebensmodell<br />
ist.<br />
Die Weiterbildung gehört zu den Kernaufgaben der Weiterbildungsstätten,<br />
würde man denken. Ist doch alles vertraglich geregelt, in der<br />
Weiterbildungsordnung festgehalten und in den entsprechenden<br />
Programmen definiert. So auch die vier Stunden strukturierte Weiterbildung<br />
pro Woche. Aber die Realität zeigt, dass nur die wenigsten<br />
Assistenzärztinnen und -ärzte regelmässig in den Genuss dieser vier<br />
Stunden kommen. In unserem Politikartikel sowie im Beitrag zur<br />
strukturierten Weiterbildung (Rubrik «Weiterbildung/Arbeitsbedingungen»)<br />
geht es – wohl nicht zum letzten Mal – um den Stellenwert<br />
der Weiterbildung im Rahmen der täglichen Arbeit.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 5
Politik<br />
Weiterbildung<br />
ist Arbeitszeit!<br />
Die strukturierte Weiterbildung muss als Arbeitszeit angerechnet werden.<br />
Das hat das SECO in einem Brief an die kantonalen Arbeitsinspektorate klar<br />
festgehalten. Für den <strong>vsao</strong> eine wichtige und wertvolle Klarstellung.<br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
Die strukturierte Weiterbildung ist für Assistenzärztinnen und -ärzte obligatorisch und zählt deshalb als Arbeitszeit.<br />
Gemäss Weiterbildungsordnung<br />
des Schweizerischen Instituts<br />
für ärztliche Weiter- und Fortbildung<br />
(SIWF) müssen Assistenzärztinnen<br />
und -ärzte wöchentlich vier<br />
Stunden strukturierte Weiterbildung absolvieren<br />
(siehe dazu den Artikel «Was ist<br />
eigentlich strukturierte Weiterbildung?»<br />
auf Seite 10). Die Frage, ob diese strukturierte<br />
Weiterbildung als Arbeitszeit gilt<br />
oder nicht, gab und gibt immer wieder Anlass<br />
zu Diskussionen. Indem Spitäler die<br />
Anrechnung als Arbeitszeit verweigern,<br />
können sie die gesetzlich festgelegte wöchentliche<br />
Höchstarbeitszeit von 50 Stunden<br />
umgehen bzw. ausdehnen.<br />
Das Staatssekretariat für Wirtschaft<br />
(SECO) schiebt dieser Praxis nun in aller<br />
Deutlichkeit einen Riegel. Bereits im vergangenen<br />
November richtete es einen<br />
Brief an die kantonalen Arbeitsinspektorate<br />
und hielt darin fest, dass die zur<br />
Weiterbildung aufgewendete Zeit als Arbeitszeit<br />
gilt. Das SECO stützt sich bei<br />
dieser Beurteilung auf das Medizinal -<br />
berufegesetz und die Weiterbildungsordnung<br />
des SIWF: «Das Medizinalberufegesetz<br />
präzisiert, dass die universitäre<br />
Ausbildung die Grundlagen zur Berufsausübung<br />
im betreffenden Medizinalberuf<br />
Bild: Adobe Stock<br />
6<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Politik<br />
Bild: zvg<br />
vermittelt, während die berufliche Weiterbildung<br />
der Erhöhung der Kompetenz und<br />
der Spezialisierung im entsprechenden<br />
Fachgebiet dient. Die lebenslange Fortbildung<br />
schliesslich gewährleistet die Aktualisierung<br />
des Wissens und der beruflichen<br />
Kompetenz. Die berufliche Weiterbildung<br />
umfasst zu einem grossen Teil das praktische<br />
Lernen an der Patientin bzw. am Patienten<br />
und daneben einen sogenannten<br />
‹strukturierten› Teil, d.h. ‹eine Bildung<br />
namentlich in organisierten Kursen, mit<br />
Lernprogrammen und einer definierten<br />
Lehr-Lern-Beziehung›. Das Schweizerische<br />
Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung<br />
(SIWF) verlangt, dass jede Weiterbildungsstätte<br />
ein ‹Weiterbildungskonzept›<br />
erarbeitet. Das Konzept bestätigt, dass den<br />
Assistenzärztinnen und -ärzten der Besuch<br />
der im Programm geforderten Kongresse<br />
und Kurse im Rahmen der Arbeitszeit ermöglicht<br />
wird und dass ihnen strukturierte<br />
Weiterbildung im Umfang von mindestens<br />
vier Stunden pro Woche angeboten wird.»<br />
Aus diesen Ausführungen ergibt sich<br />
für das SECO, «dass die berufliche Weiterbildung<br />
für Assistenzärztinnen und -ärzte<br />
zur Spezialisierung in einem Fachgebiet<br />
obligatorisch ist. Folglich zählt die zur<br />
Weiterbildung aufgewendete Zeit gemäss<br />
Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung 1 zum<br />
Arbeitsgesetz (ArGV 1) als Arbeitszeit. Vor<br />
allem die Stunden der ‹strukturierten›<br />
Weiterbildung müssen in der Arbeitszeit -<br />
erfassung dokumentiert und in der Einsatzplanung<br />
einkalkuliert werden, um sicherzustellen,<br />
dass die im Arbeitsgesetz<br />
und seinen Verordnungen vorgeschriebenen<br />
Bestimmungen zur Arbeits- und<br />
Ruhezeit, darunter insbesondere die wöchentliche<br />
Höchstarbeitszeit, eingehalten<br />
werden.»<br />
Wichtige und wertvolle Klärung<br />
Diese Klarstellung war dringend nötig<br />
und hilft dem <strong>vsao</strong> bei seinem Einsatz für<br />
gute Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen.<br />
«Das Konzept der 42+4-Stunden-<br />
Woche funktioniert nur, wenn klar ist,<br />
dass die vier Stunden strukturierte Weiterbildung<br />
ebenfalls zur Arbeitszeit gehören»,<br />
sagt Nora Bienz, Vizepräsidentin des<br />
<strong>vsao</strong>. «Das SECO bestätigt nun genau das,<br />
und das ist für die Gespräche mit Arbeitgebenden<br />
und Arbeitsinspektoraten enorm<br />
wichtig, da diese Frage immer wieder umstritten<br />
war.»<br />
Mit der 42+4-Stunden-Woche strebt<br />
der <strong>vsao</strong> an, dass bei der Dienstplanung<br />
pro Woche maximal 42 Stunden Arbeit mit<br />
Patientinnen und Patienten und vier<br />
Stunden strukturierte Weiterbildung eingeplant<br />
werden. «So kann sichergestellt<br />
werden, dass die vier Stunden strukturierte<br />
Weiterbildung in Anspruch genommen<br />
werden können, ohne die wöchentliche<br />
Höchstarbeitszeit zu überschreiten», erklärt<br />
Nora Bienz.<br />
Weiterbildung nur für eine<br />
Minderheit<br />
Dass diese Forderung weiterhin hochaktuell<br />
ist, zeigte zuletzt eine Umfrage, die<br />
von der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ)<br />
durchgeführt wurde und an der sich rund<br />
4500 Assistenzärztinnen und -ärzte beteiligten.<br />
Die Umfrage ergab nicht nur, dass<br />
die Arbeitszeiten zu lang sind, sondern<br />
auch, dass die eigentlich obligatorische<br />
strukturierte Weiterbildung vielfach nicht<br />
besucht werden kann. Fast 40 Prozent der<br />
Assistenzärztinnen und -ärzte gaben an,<br />
dass sie im Durchschnitt länger als elf<br />
Stunden pro Tag arbeiten, nur bei sieben<br />
Prozent sind es weniger als zehn Stunden.<br />
Gleichzeitig geben mehr als die Hälfte<br />
der Befragten an, dass die vier Stunden<br />
Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber gar<br />
nicht angeboten werden. Weitere 40 Prozent<br />
sagen, dass «das Weiterbildungsangebot<br />
zwar bestehe, sie es aber wegen<br />
der hohen Arbeitslast oder der Schichtplanung<br />
nicht oder nur selten besuchen<br />
könnten» (NZZ vom 20. Februar <strong>2023</strong>).<br />
Missstände melden<br />
Das bedeutet, dass nur ein kleiner Teil der<br />
Assistenzärztinnen und -ärzte die obligatorische<br />
strukturierte Weiterbildung im<br />
vorgesehenen Umfang absolvieren kann.<br />
Ein Zustand, den es zu ändern gilt, auch<br />
und nicht zuletzt zugunsten einer qualitativ<br />
hochstehenden Gesundheitsversorgung<br />
in der Schweiz. Der Brief des SECO<br />
steht auf der <strong>vsao</strong>-Website zum Download<br />
zur Verfügung, er wurde ebenfalls an die<br />
<strong>vsao</strong>-Visitatorinnen und -Visitatoren verteilt,<br />
die die Weiterbildungsstätten regelmässig<br />
überprüfen. «Wir sind aber auch<br />
weiterhin darauf angewiesen, dass Meldungen<br />
von Missständen in Bezug auf die<br />
Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen<br />
zu uns gelangen», sagt Nora Bienz. «Dafür<br />
kann zum Beispiel online die <strong>vsao</strong>-Meldestelle<br />
genutzt werden, es gibt aber auch<br />
den Weg direkt über die Sektionen oder<br />
den <strong>vsao</strong>-Dachverband. Wir gehen jedem<br />
Hinweis nach.»<br />
Die Spitäler haben ebenso ein Interesse<br />
daran, gute Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen<br />
anzubieten, um Mitarbeitende<br />
zu gewinnen und zu halten.<br />
Der <strong>vsao</strong> hilft gerne, zum Beispiel mit<br />
der kostenlosen Dienstplanberatung, die<br />
Wege zeigen kann, wie die Anforderungen<br />
von Arbeitsgesetz und Weiterbildungsordnung<br />
erfüllt werden können.<br />
Mehr zum Thema unter<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/arbeitsbedingungen/<br />
arbeitsrecht bzw.<br />
www.meldestelle-<strong>vsao</strong>.ch<br />
@<strong>vsao</strong>asmac<br />
Danke für Ihre Teilnahme!<br />
Anfang März haben wir die letzten<br />
Antworten für die vierte umfassende<br />
Mitglieder befragung entgegengenommen.<br />
Eingeladen waren alle Assistenzund<br />
Oberärztinnen und -ärzte, die beim<br />
<strong>vsao</strong> Mitglied sind. Über 3200 Teilnehmende<br />
haben den Fragebogen vollständig<br />
ausgefüllt, womit das Ziel von 3000<br />
Teilnahmen mehr als erreicht wurde.<br />
Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht<br />
haben! Die Antworten sind für<br />
unsere politische Arbeit und den Einsatz<br />
für unsere Mitglieder äusserst<br />
wertvoll. Die volle Auswertung der<br />
Ergebnisse werden wir Anfang Mai<br />
veröffentlichen.<br />
Rücktritt aus dem GA<br />
Patrizia Kündig,<br />
langjähriges Mitglied<br />
des Geschäftsausschusses<br />
(GA) und bis<br />
Mai 2022 Vizepräsidentin<br />
des <strong>vsao</strong>, tritt<br />
per Ende <strong>April</strong> <strong>2023</strong><br />
als GA-Mitglied und<br />
Leiterin des Ressorts Weiterbildung<br />
zurück. Sie hat sich entschieden, eine<br />
längere Pause zur beruflichen und<br />
persönlichen Weiterentwicklung einzulegen.<br />
Der <strong>vsao</strong> bedankt sich bei<br />
Patrizia herzlich für ihren Einsatz.<br />
Die Leitung des Ressorts Weiterbildung<br />
übernimmt ab Mai Richard Mansky.<br />
Er ist seit <strong>April</strong> 2021 Mitglied des GA<br />
und des Ressorts Weiterbildung.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 7
Privat<br />
Hausrat<br />
Privathaftpflicht<br />
Rechtsschutz<br />
Gebäude<br />
Wertsachen / Kunst<br />
Motorfahrzeug<br />
Ausland / Expat<br />
Reise / Assistance<br />
Krankenkasse<br />
Taggeld<br />
Unfall<br />
Leben<br />
Stellenunterbruch<br />
Beruf<br />
Arztpraxis<br />
Gebäude<br />
Berufshaftpflicht<br />
Rechtsschutz<br />
Cyber<br />
Taggeld<br />
Unfall<br />
Nutzen Sie unsere Kooperationspartner<br />
und profitieren Sie von den Vorteilen<br />
und Rabatten:<br />
– Allianz Suisse<br />
– AXA-ARAG<br />
– Concordia<br />
– Helvetia<br />
– Innova<br />
– ÖKK<br />
– Schweizerische Ärzte-Krankenkasse<br />
– Swica<br />
– Versicherung der Schweizer Ärzte<br />
Genossenschaft<br />
– Visana<br />
– ZURICH<br />
Falls Sie bereits eine Versicherung bei<br />
einer der oben genannten Versicherungen<br />
besitzen, dann prüfen Sie einen<br />
Übertritt in unsere Kollektivverträge.<br />
Wir unterstützen Sie gerne dabei.<br />
Exklusive Lösungen für mediservice <strong>vsao</strong>-asmac-Mitglieder<br />
031 350 44 22 – wir sind für Sie da.<br />
info@mediservice-<strong>vsao</strong>.ch, www.mediservice-<strong>vsao</strong>.ch
Politik<br />
Arbeitskraft als<br />
knappes Gut<br />
Bild: zvg<br />
«Die Arbeitskraft der kommenden Gen Z wird<br />
ein knappes Gut sein», schrieb kürzlich der<br />
Ökonom Marcus Schögel in der «Neuen Zürcher<br />
Zeitung». Unternehmen und ihre Führungskräfte<br />
sollten deshalb nicht über die Ansprüche junger Generationen<br />
klagen, sondern deren Potenzial erkennen. Es gelte, «die Ideen<br />
junger Talente und Mitarbeiter nicht nur wertzuschätzen,<br />
sondern aktiv für den Fortbestand des Unternehmens zu gewinnen».<br />
Eigentlich ganz logisch. Ein Unternehmen, das es<br />
dauerhaft nicht schafft, junge Mitarbeitende zu gewinnen,<br />
wird früher oder später verschwinden. Oder anders<br />
gesagt: Ein Unternehmen, das es nicht schafft,<br />
die Bedürfnisse junger Talente zu erfüllen,<br />
die es für sich gewinnen will, wird keine<br />
Zukunft haben.<br />
Beispiele von Unternehmen, die<br />
diese Herausforderung meistern, gibt<br />
es genug, und man muss dafür gar<br />
nicht unbedingt immer auf Google<br />
zurückgreifen. Vor ein paar Tagen las<br />
ich in der Zeitung von einem Projekt<br />
des Kantons Bern für die Etablierung<br />
einer Teilzeitlehre. Das gab es bisher<br />
anscheinend noch gar nicht, ist aber<br />
offensichtlich ein Bedürfnis. Im Artikel<br />
wurde das Beispiel einer jungen Frau<br />
vorgestellt, die mit 18 Jahren Mutter wurde<br />
und nun mit 26 Jahren doch noch eine Lehre<br />
absolvieren kann, in einem Teilzeitpensum von<br />
80 Prozent. Auch Pensen von 60 oder 70 Prozent sollen<br />
möglich sein. Der Kanton hat die Zeichen der Zeit anscheinend<br />
anerkannt und gewinnt so Fachkräfte, die ihm<br />
möglicherweise längerfristig wertvolle Dienste leisten.<br />
Im Gesundheitswesen und insbesondere in der ärztlichen<br />
Weiterbildung scheint das noch nicht angekommen zu sein.<br />
Ein ehemaliger Chefarzt sagte zum Beispiel, ebenfalls in der NZZ,<br />
viele junge Assistenzärztinnen und -ärzte würden sich Teilzeitarbeit<br />
wünschen, aber «Medizinberufe sind nun einmal keine<br />
Bürojobs». Ein anderer ehemals leitender Arzt schrieb in der<br />
«Ärztezeitung», er habe Zeit seines Lebens «die berüchtigten<br />
‹60 bis 80 Stunden pro Woche› gearbeitet» und stelle fest, dass<br />
er dennoch keinen Schaden erlitten, sondern viel Gewinn verbucht<br />
habe. Der Tenor solcher Voten ist der von «Wir mussten auch<br />
viel arbeiten, das hat uns nicht geschadet» und «Die heutige<br />
Generation ist verwöhnt und hat gar nie richtig zu arbeiten<br />
gelernt». Dabei sind die Bedürfnisse doch legitim. Wenn der<br />
Partner oder die Partnerin ebenfalls arbeiten will, Kinder oder<br />
Angehörige Betreuung benötigen, ein Hobby gepflegt oder<br />
Auf den<br />
Punkt<br />
gebracht<br />
ein politisches Amt ausgeübt werden will, ist es dann wirklich<br />
so vermessen und abwegig, vom Arbeitgeber eine halbwegs<br />
verlässliche Dienstplanung und die Einhaltung des Arbeitsgesetzes<br />
zu verlangen?<br />
Nein, ist es natürlich nicht, und um zum Ausgangspunkt<br />
zurückzukommen: Noch viel mehr als das muss möglich sein.<br />
Es kann nicht nur um die verlässliche Dienstplanung und das<br />
Arbeitsgesetz gehen, sondern es geht tatsächlich darum, die<br />
Wünsche und Bedürfnisse von Mitarbeitenden ernst zu nehmen,<br />
sie zu respektieren und nach Möglichkeit zu erfüllen, um im<br />
Gegenzug ihre Arbeitskraft zu erhalten. Mitarbeitende,<br />
die ernstgenommen werden, die sich<br />
gehört und respektiert fühlen, sind sehr wohl<br />
auch bereit, Loyalität zu beweisen, wenn<br />
nötig auch einmal eine Extraschicht zu<br />
leisten, länger zu bleiben oder für<br />
einen kranken Kollegen einzuspringen.<br />
Voraussetzung dafür ist aber<br />
das gemeinsame Verständnis, dass<br />
das Arbeitsverhältnis ein gegenseitiges<br />
Geben und Nehmen ist.<br />
Nur so wird es im Gesundheitswesen<br />
gelingen, das knapper werdende<br />
Gut der Arbeitskraft weiterhin<br />
zu gewinnen.<br />
Philipp Thüler,<br />
Leiter Politik und Kommunikation,<br />
stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 9
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Bei der Arbeit lernen Ärztinnen und Ärzte<br />
jeden Tag. Genauso wichtig ist aber auch die<br />
strukturierte Weiterbildung.<br />
Was ist eigentlich<br />
strukturierte<br />
Weiterbildung?<br />
Vier Stunden strukturierte Weiterbildung pro Woche sind<br />
für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung obligatorisch.<br />
Doch was ist genau unter strukturierter Weiterbildung zu verstehen?<br />
Ein SIWF-Merkblatt schafft Klarheit.<br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer <strong>vsao</strong><br />
Bild: Adobe Stock<br />
10<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
In vielen Spitälern wird die gesetzlich<br />
festgelegte Höchstarbeitszeit von<br />
50 Stunden pro Woche regelmässig<br />
überschritten. Trotzdem oder gerade<br />
deswegen können die wenigsten Assistenzärztinnen<br />
und -ärzte die strukturierte<br />
Weiterbildung, die gemäss Weiterbildungsordnung<br />
des Schweizerischen Instituts für<br />
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF)<br />
im Umfang von vier Stunden pro Woche<br />
obligatorisch ist, besuchen. Teilweise wird<br />
diese Weiterbildung von den Spitälern gar<br />
nicht angeboten, teilweise kann sie von<br />
den Assistenzärztinnen und -ärzten nicht<br />
oder nur teilweise besucht werden – wegen<br />
der hohen Arbeitslast und/oder suboptimaler<br />
Dienstplanung. Das bestätigte sich<br />
zuletzt bei der grossen Umfrage, welche<br />
die «Neue Zürcher Zeitung» durchführte<br />
(«NZZ» vom 20. Februar <strong>2023</strong>), es entspricht<br />
auch den Erkenntnissen der <strong>vsao</strong>-<br />
Mitgliederbefragungen.<br />
Der <strong>vsao</strong> strebt deshalb die 42+4-Stunden-Woche<br />
an mit wöchentlich 42 Stunden<br />
Arbeit an Patientinnen und Patienten und<br />
vier Stunden strukturierter Weiterbildung.<br />
Wenn dies in der Dienstplanung konsequent<br />
so geplant wird, ist die Gefahr, dass<br />
die Höchstarbeitszeit von 50 Stunden pro<br />
Woche erreicht oder überschritten wird,<br />
deutlich kleiner und die Chance, dass die<br />
strukturierte Weiterbildung tatsächlich besucht<br />
werden kann, wesentlich grösser.<br />
Diverse Formen sind möglich<br />
Doch was ist unter strukturierter Weiterbildung<br />
überhaupt zu verstehen? Das SIWF<br />
hat dazu ein Merkblatt publiziert, das auf<br />
der SIWF-Website oder auf der Website des<br />
<strong>vsao</strong> heruntergeladen werden kann. Darin<br />
wird unterschieden zwischen der Weiterbildung<br />
nach dem Grundprinzip «Learning<br />
on the Job», die nicht klar quantifizierbar<br />
ist, und der strukturierten Weiterbildung,<br />
die im Umfang von vier Stunden pro Woche<br />
obligatorisch ist.<br />
Zum «Learning on the Job» gehört der<br />
Kompetenzzuwachs, der während der klinischen<br />
Dienstleistung entsteht. Dies entspricht<br />
aber nicht einer strukturierten<br />
Weiterbildung, denn diese muss gemäss<br />
dem Merkblatt «eine Struktur haben und<br />
einen expliziten Fokus auf die Weiterbildung<br />
der Ärztinnen und Ärzte […]. Wenn<br />
die strukturierte Weiterbildung im klinischen<br />
Alltag stattfindet, sollte sie eine<br />
Vorbereitung, Durchführung und Nachbesprechung<br />
der Aktivität beinhalten.»<br />
Zu dieser Art von strukturierter Weiterbildung<br />
im klinischen Alltag gehören zum<br />
Beispiel arbeitsplatzbasierte Assessments,<br />
Bedside-Teachings oder EPAs (Entrustable<br />
Professional Activities).<br />
Weitere Formen strukturierter Weiterbildung<br />
werden im Merkblatt aufgelistet.<br />
Es sind dies zum Beispiel:<br />
– Kongresse und Jahresversammlungen<br />
von Fachgesellschaften (mit physischer<br />
Präsenz oder auch hybrid/virtuell)<br />
– Von der Institution organisierte oder<br />
anerkannte moderierte interdisziplinäre<br />
Veranstaltungen (auch online), wie<br />
zum Beispiel Vorträge und Fallvorstellungen,<br />
interdisziplinäre Kolloquien,<br />
klinisch-pathologische Konferenzen,<br />
Morbiditäts-Mortalitäts-Konferenzen<br />
oder CIRS-Besprechungen (Critical Incidents<br />
Reporting System)<br />
– Klinikinterne Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen<br />
im Rahmen von fachspezifischen<br />
Curricula wie zum Beispiel<br />
Vorträge, moderierte Fallbesprechungen<br />
mit didaktischem Fokus, Seminare<br />
oder <strong>Journal</strong> Clubs<br />
– Interaktive Veranstaltungen wie zum<br />
Beispiel praktische Kurse oder medizinische<br />
Simulationskurse<br />
Speziell erwähnt werden im Merkblatt die<br />
«Teachable Moments». Das sind «bestimmte<br />
Ereignisse, Situationen oder Erfahrungen,<br />
die genutzt werden können,<br />
um Lernenden etwas zu vermitteln, das<br />
zufälligerweise während der klinischen<br />
Arbeit erkennbar wird». Sie gelten dann<br />
als strukturierte Weiterbildung, wenn sie<br />
mindestens zehn Minuten dauern und eine<br />
Struktur mit Vorbereitung und Nachbesprechung<br />
aufweisen. Da sie aber üblicherweise<br />
ad hoc auftreten, können sie<br />
nicht als Teil der regulären, zu planenden<br />
vier Stunden strukturierte Weiterbildung<br />
gezählt werden.<br />
Zeit zur Verfügung stellen<br />
Das SIWF weist im Merkblatt darauf hin,<br />
dass «nicht jede Weiterbildungsstätte für<br />
sich allein die ganze strukturierte Weiterbildung<br />
anbieten muss». Für kleinere Weiterbildungsstätten<br />
könne die Zusammenarbeit<br />
mit grösseren Kliniken eine wertvolle<br />
Option sein. Zentral sei aber, dass «die Weiterbildungsstätte<br />
die entsprechende Zeit<br />
zur Verfügung stellt, damit die Ärztinnen<br />
und Ärzte in Weiterbildung die Angebote<br />
auch tatsächlich wahrnehmen können».<br />
Die vier Stunden strukturierte Weiterbildung<br />
sollten gemäss dem Merkblatt<br />
«grundsätzlich jede Woche angeboten werden.<br />
Weiterbildungsblöcke (zum Beispiel<br />
externe Kurse) sollten im Sinne einer flexiblen<br />
Auslegung der Vorgaben berechnet<br />
werden.»<br />
Die strukturierte Weiterbildung ist ein<br />
zentraler Bestandteil der ärztlichen Weiterbildung.<br />
Gemäss den erwähnten Umfragen<br />
erhält sie nicht immer und überall<br />
den notwendigen Stellenwert. Entsprechende<br />
festgestellte Missstände können<br />
jederzeit bei der <strong>vsao</strong>-Meldestelle gemeldet<br />
werden. Der <strong>vsao</strong> verfolgt jeden Hinweis<br />
und ist darauf angewiesen, dass entsprechende<br />
Meldungen gemacht werden,<br />
wenn die Weiterbildung nicht wie vorgesehen<br />
besucht werden kann. Herzlichen<br />
Dank für Ihre Mithilfe!<br />
Mehr zum Thema unter<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/aerztliche-weiterbildung/konzepte-und-vertraege-2/<br />
bzw. www.meldestelle-<strong>vsao</strong>.ch<br />
@<strong>vsao</strong>asmac<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 11
Ihre Bedürfnisse<br />
im Mittelpunkt<br />
Visitationen<br />
Bewertungen, Löhne, Arbeitszeiten,<br />
Kitas, Jobs - und noch viel<br />
mehr: medicus ist das umfassende<br />
Portal für Ihre Karriere. Dort<br />
finden Sie die optimal zu Ihnen<br />
passende Stelle!<br />
Die Spitäler und <strong>vsao</strong>-Sektionen<br />
bieten Ihnen wichtige Informationen<br />
zu den Arbeitsbedingungen. Den<br />
wichtigsten Beitrag leisten jedoch<br />
Sie: Bewerten Sie anonym Ihren<br />
bisherigen Arbeitgeber. Damit<br />
helfen Sie anderen – und profitieren<br />
selber von deren Erfahrungen.<br />
www.medicus.ch<br />
Wie gut ist die Weiterbildung in<br />
den Kliniken? Dieser Frage gehen<br />
die Visitationen auf den Grund. Zu<br />
den Expertenteams gehört immer<br />
jemand vom <strong>vsao</strong>. Die Besuche vor<br />
Ort dienen dazu, Verbesserungsmöglichkeiten<br />
zu erkennen. Denn<br />
Sie als unser Mitglied sollen von<br />
einer hohen Weiterbildungsqualität<br />
profitieren.<br />
Falls Sie selber Visitationen<br />
begleiten möchten: eine E-Mail<br />
an visitationen@<strong>vsao</strong>.ch, und<br />
Sie erfahren mehr!<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/visitationen<br />
Feedback-<br />
Pool<br />
Für Sie als Mitglied ist sie zentral:<br />
die Weiterbildung. Deshalb fühlen<br />
wir unserer Basis mit Umfragen<br />
regelmässig den Puls dazu. Dank<br />
dieses Feedback-Pools können wir<br />
unsere Verbandsarbeit gezielt auf<br />
Ihre Anliegen ausrichten.<br />
Wollen Sie mitmachen?<br />
Dann schreiben Sie an<br />
sekretariat@<strong>vsao</strong>.ch.<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/studien-undumfragen<br />
Arztberuf<br />
und Familie<br />
• Wie bringe ich Familie, Freizeit und<br />
Beruf unter einen Hut?<br />
• Wie steige ich nach der Babypause<br />
wieder ein?<br />
• Wie meistere ich die täglichen<br />
Herausforderungen?<br />
Antworten auf solche Fragen erhalten Sie<br />
als <strong>vsao</strong>-Mitglied bei unserem kostenlosen<br />
Coaching. Die Beratung erfolgt telefonisch<br />
durch die Fachstelle UND.<br />
044 462 71 23<br />
info@fachstelle-und.ch<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch/telefoncoaching
Weiterbildung / Arbeitsbedingungen<br />
Im AA-Universum<br />
Karrierestart im Dschungel<br />
(10.12.–23.12.2022)<br />
Der «Dschungel von Calais», so<br />
werden die Zeltlager rund um<br />
die Hafenstädte von Calais<br />
und Dunkerque in Frankreich<br />
benannt. Diese werden von Flüchtlingen<br />
bewohnt, welche als finales Ziel das ca.<br />
33 km jenseits des Ärmelkanals liegende<br />
England haben.<br />
Statt mich frisch geschminkt und<br />
frisiert im sterilen Spitaldress und in<br />
sauberen Turnschuhen im ebenso sterilen<br />
und beheizten Krankenhaus einzufinden,<br />
betrete ich im wenig eleganten Outfit<br />
(Hauptsache warm) inklusive hübscher,<br />
gefütterter Gummistiefel bei Regen, Wind<br />
und minus zehn Grad eine Sumpflandschaft<br />
in Nordfrankreich. Diese ist mit<br />
unzähligen bunten Zelten bedeckt, ergänzt<br />
von diversen Müllhaufen und<br />
schmutzigen, am Boden liegenden Kleidern.<br />
Es riecht nach verbranntem Plastik,<br />
hie und da trifft man auf improvisierte<br />
Feuerstellen, wo Brot oder Fleisch grilliert<br />
wird.<br />
Über diese triste Landschaft verteilt,<br />
tummeln sich Freiwillige in Westen der<br />
jeweiligen Hilfsorganisationen. Als «Doctor»<br />
oder «Nurse» (denn hier wird nebst<br />
Arabisch oder Farsi bevorzugt Englisch<br />
gesprochen) ist man fast so erwünscht wie<br />
die mobile Ladestation, das Frisierzubehör<br />
und der köstliche Instantkaffee oder<br />
(für mich eine Premiere) die mit Wasser<br />
zubereitete heisse Schokolade. Egal ob<br />
mit oder ohne Erfahrung, hier sind alle<br />
Hände gefragt.<br />
Unterwegs in einem dunkelblauen<br />
Citroën-Berlingo und ausgerüstet mit<br />
einer mobilen Hausapotheke sowie diversem<br />
Wundversorgungsmaterial, fährt das<br />
Team des «First Aid Support Teams»<br />
(FAST) täglich in ein anderes Zeltlager.<br />
Kaum hat es parkiert, bildet sich auch<br />
schon eine erste Schlange vor dem Wagen.<br />
Es werden Paracetamol, Voltarensalbe,<br />
schmerzlinderndes Zahngel und Hustensirup<br />
verteilt. Zuweilen erhält man einen<br />
soeben herausgefallenen Zahn entgegengestreckt.<br />
Ernstere Fälle werden ins nahe<br />
gelegene Spital verlegt.<br />
Etwas spannender wird es, wenn sich<br />
jemand mit Juckreiz präsentiert. Noch<br />
spannender, wenn die darauffolgenden<br />
drei, vier Patientinnen und Patienten<br />
dasselbe Leiden aufweisen. Ein kurzer<br />
Blick auf Hände und/oder Ellbogen, ergänzt<br />
mit Sozial- und Umgebungsanamnese,<br />
und schon hat man den Übeltäter<br />
erkannt. Die freche Krätzmilbe hat ihr<br />
ideales Habitat ausfindig gemacht:<br />
feuchtwarme Kleidung, schlechte hygienische<br />
Verhältnisse seit Wochen (ohne<br />
eine Veränderung der Verhältnisse in<br />
Sicht) und viele Menschen, die auf engem<br />
Raum leben. Ein unerwünschter Freund<br />
und Begleiter, den man in der gegebenen<br />
Situation leider nicht so einfach und<br />
schnell wieder loswird. Eine gründliche<br />
Desinfektion vor Ort kann hier nur überbrückend<br />
bis zum Krankenhaustermin<br />
vorgenommen werden. Ob dieser auch<br />
wirklich eingehalten werden kann, ist<br />
unklar. Denn wenn das Wetter passt und<br />
das Meer ruhig ist, so hat ein freier Platz<br />
auf dem Gummiboot nach Dover viel<br />
höhere Priorität als die Verabschiedung<br />
einer Milbe ...<br />
Mein Fazit: Eine gute Möglichkeit,<br />
sich einen ersten kurzen, aber prägnanten<br />
Einblick in die humanitäre Hilfe und<br />
Medizin zu verschaffen und einmal alle<br />
Eitelkeiten abzulegen. Und spätestens<br />
nach einer solchen Erfahrung freut man<br />
sich doppelt, in die sterile Krankenhauskleidung<br />
zu schlüpfen, und lernt auch<br />
den gruseligen Automatenkaffee, der in<br />
den meisten Spitälern angeboten wird,<br />
zu schätzen.<br />
Camille Bertossa,<br />
Assistenzärztin im<br />
1. Weiterbildungsjahr<br />
Bild: zvg<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 13
<strong>vsao</strong><br />
Neues aus<br />
den Sektionen<br />
Bern<br />
Einladung zur ordentlichen<br />
Mitgliederversammlung<br />
<strong>2023</strong> des VSAO Bern<br />
Donnerstag, 27. <strong>April</strong> <strong>2023</strong>,<br />
PROGR Bern, Waisenhausplatz 30,<br />
3011 Bern<br />
Programm<br />
Ab 18.30 Uhr Apéro<br />
19.00 Uhr Mitgliederversammlung<br />
mit Remo Zumstein, Poetry-Slam<br />
20.15 Uhr Nachtessen und Tombola<br />
Traktanden<br />
1. Protokoll der ordentlichen<br />
Mitgliederversammlung 2022<br />
2. Jahresbericht 2022 des<br />
Präsidiums<br />
3. Jahresrechnung 2022<br />
4. Budget <strong>2023</strong><br />
5. Mitgliederbeiträge 2024<br />
6. Wahlen (Präsidium, Vorstand)<br />
7. Wahl der Revisionsstelle<br />
8. Lohnverhandlungen <strong>2023</strong><br />
9. Kampagne 2022 und Social Media<br />
10. Fragen und Diskussion<br />
Anmeldung bis 20. <strong>April</strong> <strong>2023</strong> online<br />
auf www.<strong>vsao</strong>-bern.ch<br />
Die Anmeldung wird per Post verschickt.<br />
Der Jahresbericht wird ab 1. <strong>April</strong> <strong>2023</strong> auf<br />
Deutsch und Französisch aufgeschaltet.<br />
(Bitte für die Tombola-Lose Bargeld mitnehmen!)<br />
Janine Junker, Geschäftsführerin VSAO Bern<br />
Tessin<br />
Neuer GAV für die Assistenzund<br />
Oberärztinnen und -ärzte<br />
und neuer Prozess für die<br />
Arbeitszeitverwaltung während<br />
der Schwangerschaft<br />
Die <strong>vsao</strong>-Sektion Tessin (ASMACT) möchte<br />
darüber informieren, dass nach langwierigen<br />
Verhandlungen die neuen GAV<br />
für Assistenz- und Oberärztinnen und<br />
-ärzte, die in der kantonalen Ente Ospedaliero<br />
Cantonale EOC (Zusammenschluss<br />
kantonaler Spitäler) arbeiten, am 1. Januar<br />
<strong>2023</strong> für eine Dauer von fünf Jahren in<br />
Kraft getreten sind.<br />
Zu den wichtigsten Errungenschaften,<br />
die unser Verband aushandeln konnte,<br />
gehören:<br />
– die Reduktion der Wochenarbeitszeit von<br />
derzeit 50 auf 46 Stunden pro Woche, einschliesslich<br />
4 Stunden strukturierter Weiterbildung<br />
(42+4), bei gleichem Lohn, ab<br />
Januar 2025<br />
– ein Engagement des EOC zur Förderung<br />
der strukturierten Weiterbildung durch<br />
eine klare Abgrenzung von Arbeits- und<br />
Weiterbildungszeit<br />
– die Erfassung der tatsächlichen Pausen,<br />
soweit der Arzt die Möglichkeit hat, sich<br />
von der Arbeit zu entfernen<br />
– die Erhöhung des Mutterschaftsurlaubs<br />
von 18 auf 19 Wochen<br />
– ein zweijähriges Pilotprojekt, das die automatische<br />
Verlängerung des Vertrags<br />
bis zum Ende des Mutterschaftsurlaubs<br />
im Falle einer Schwangerschaft vorsieht<br />
– die Erhöhung des Vaterschaftsurlaubs<br />
von 10 auf 15 Tage<br />
– die Erhöhung der Gehälter <strong>2023</strong> um 2,5%<br />
PROGR: Vogelperspektive mit Sicht auf Innenhof<br />
Die Parteien wollten auch in den Paritätischen<br />
Ausschuss investieren und erkannten<br />
dessen Rolle nicht nur als Vermittler<br />
bei Streitigkeiten über die Umsetzung der<br />
Verträge an, sondern auch als «Gestalter<br />
von Best Practices», der die Entstehung<br />
Bild: © Martin Bichsel; zvg<br />
14<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
Bild: Adobe Stock<br />
von Problemen verhindern und die Rahmenbedingungen<br />
für die Arbeit der Ärztinnen<br />
und Ärzte im EOC verbessern<br />
kann.<br />
Eines der ersten Themen, mit denen<br />
sich der Paritätische Ausschuss im Rahmen<br />
einer eigenen Arbeitsgruppe befasste,<br />
war die Regelung der Arbeitszeit für<br />
schwangere Ärztinnen.<br />
Dieses Projekt wurde während der Verhandlungen<br />
initiiert, um eine konkrete<br />
Antwort auf die Ergebnisse unserer Umfrage<br />
vom März 2021 zu geben, in der es um die<br />
arbeitsbedingten Beschwerden vieler Ärztinnen<br />
sowohl während der Schwangerschaft<br />
als auch nach ihrer Rückkehr aus<br />
dem Mutterschaftsurlaub ging.<br />
Die gemeldeten Probleme (die unter<br />
anderem die systematische Überschreitung<br />
der täglichen Höchstarbeitszeit, die<br />
mehr oder weniger verdeckte Diskriminierung<br />
am Arbeitsplatz, das Gefühl der Unzulänglichkeit<br />
oder mangelnden Rücksichtnahme<br />
und auch enttäuschte Karriereaussichten<br />
beinhalteten, aber auch die Schwierigkeit,<br />
die eigenen Rechte und Bedürfnisse<br />
zu verstehen und zu kommunizieren)<br />
machten uns die Notwendigkeit bewusst,<br />
einen Kulturwandel auf allen Ebenen des<br />
Unternehmens zu fördern, der zu mehr Respekt<br />
und Rücksichtnahme auf die Mutterschaft<br />
am Arbeitsplatz führt.<br />
Das Projekt hat dazu geführt, dass ab<br />
dem 1. Januar <strong>2023</strong> ein neuer Prozess bezüglich<br />
des Umgangs mit Mutterschaft im<br />
medizinischen Bereich eingeführt wurde,<br />
der auf allen Ebenen zu mehr Information,<br />
Respekt und Sensibilisierung gegenüber<br />
Ärztinnen führen soll, die während der<br />
Schwangerschaft arbeiten.<br />
Die Sektion Tessin ist mit den erzielten<br />
Fortschritten zufrieden, ist sich aber bewusst,<br />
dass das alles «leichter gesagt ist als<br />
getan» und dass es daher notwendig ist,<br />
wachsam zu bleiben, damit die korrekte<br />
Umsetzung der neuen Verträge gewährleistet<br />
wird.<br />
Für die Sektion Tessin des <strong>vsao</strong>: Dr. med. Davide<br />
Giunzioni, Präsident; Dr.ssa med. Giorgia Lo<br />
Presti, Vizepräsidentin; Dr. med. Norman Horat,<br />
Vizepräsident<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 15
<strong>vsao</strong><br />
Zürich /<br />
Schaffhausen<br />
Events:<br />
Rückblick und Ausblick<br />
Die Sektion Zürich/Schaffhausen blickt auf<br />
erfolgreiche Events in den vergangenen<br />
Monaten zurück: Zum Jahresbeginn haben<br />
wir unseren Teamevent in Form eines ayurvedischen<br />
Kochkurses durchgeführt. Dabei<br />
haben wir neben dem Teamwork beim<br />
Gemüseschnipseln und Anbraten nochmals<br />
gelernt, wie wichtig eine gesunde, frische,<br />
mit Liebe zubereitete Nahrung für<br />
unsere körperliche und mentale Gesundheit<br />
ist. Gerade wir Ärztinnen und Ärzte<br />
sollten uns dies bei der hohen Arbeitsbelastung<br />
immer wieder in Erinnerung rufen.<br />
Anschliessend ging es im Januar mit unserem<br />
traditionellen After-Work-Event weiter.<br />
Wiederum haben sich rund 60 Assistenz-<br />
und Oberärztinnen und -ärzte in der<br />
Chiffon Bar in Zürich zum Austausch in<br />
lockerer Atmosphäre bei Drinks und<br />
Livejazzmusik eingefunden.<br />
Vergangenen Monat fand dann der<br />
erste Finanzworkshop für Assistenz- und<br />
Oberärztinnen unter dem Titel «Boost your<br />
Financial Health» statt. Der Anlass mit<br />
elleXX war schon früh ausgebucht; über<br />
60 interessierte Ärztinnen erhielten wertvolle<br />
Tipps rund um ihre Finanzen und<br />
Money-Gaps und konnten sich beim anschliessenden<br />
Apéro austauschen und networken.<br />
Schliesslich haben wir am 1. <strong>April</strong><br />
unser traditionelles Coach-my-Career-Seminar<br />
mit Inputreferaten und Podiumsdiskussion<br />
rund um den Berufseinstieg<br />
durchgeführt. In interaktiven Workshops<br />
zeigten wir den Medizinstudierenden u.a.<br />
konkrete Lösungen zu Herausforderungen<br />
im Klinik alltag als auch mögliche Karrierewege<br />
auf.<br />
Teamwork: ayurvedischer Kochkurs am Neujahrs-Teamevent des VSAO-Zürich-Vorstandes.<br />
le Top» eingeladen. Die mediale Aufmerksamkeit<br />
hilft, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren<br />
und dem verbreiteten Ärzteimage<br />
entgegenzuwirken.<br />
Bürokratieabbau und Fonds für innovative<br />
Projekte<br />
Eines unserer Kernanliegen ist, die Bürokratie<br />
in der Medizin zu reduzieren. Aktuell<br />
sammeln wir auf breiter Ebene Ideen<br />
dazu. Falls Ihr Good Practice Examples<br />
oder einen eigenen Vorschlag zum Bürokratieabbauen<br />
habt, meldet Euch bei uns<br />
unter info@<strong>vsao</strong>-zh.ch.<br />
Und zu guter Letzt: Der VSAO Zürich<br />
hat einen Fonds für innovative, lokale Projekte<br />
zu VSAO-relevanten Themen gegründet.<br />
Reicht Eure Ideen und Projekte<br />
ein, und wir evaluieren gerne eine finanzielle<br />
Unterstützung: info@<strong>vsao</strong>-zh.ch.<br />
Vereinbarkeit Ja!<br />
Aber wie?<br />
Klar, Vereinbarkeit von Beruf und<br />
Privatleben ist wichtig, gerade auch bei<br />
jungen Assistenzärztinnen und -ärzten.<br />
Nur wie löse ich das in der Praxis?<br />
Wir holen alle Player an einen Tisch<br />
oder besser gesagt in einen Saal.<br />
Der <strong>vsao</strong> führt unter Mitwirkung der<br />
Fachhochschule Nordwestschweiz<br />
(FHNW), des Schweizerischen Instituts<br />
für Weiter- und Fortbildung (SIWF)<br />
und der Vereinigung Personalmanager*innen<br />
Schweizer Gesundheitsinstitute<br />
(VPSG) am 6. Juni <strong>2023</strong>, von<br />
9.30 Uhr bis 15.00 Uhr, in den Räumlichkeiten<br />
der FHNW in Olten einen<br />
Anlass zum Thema «Vereinbarkeit<br />
Ärzteberuf und Privatleben während<br />
der ärztlichen Weiterbildung» durch.<br />
Medienberichte zur aktuellen Situation<br />
Beschäftigt hat unsere Sektion in den vergangenen<br />
Wochen auch die Medienberichterstattung,<br />
ausgelöst durch eine<br />
schweizweite Umfrage der «NZZ» bei Assistenzärztinnen<br />
und -ärzten. Die unabhängigen<br />
Umfrageergebnisse bestätigen<br />
die aktuelle Lage und geben unseren Bemühungen<br />
und Forderungen für bessere<br />
Arbeitsbedingungen Rückenwind. Zahlreiche<br />
Medien haben das Thema aufgegriffen.<br />
Unsere Sektion, vertreten durch<br />
Präsidentin Anna Wang und Vorstandsmitglied<br />
Federico Mazzola, wurde u.a. in<br />
die Diskussionssendung «TALK» von «Te-<br />
Save the Date: Am Donnerstag,<br />
15. Juni <strong>2023</strong>, findet die jährliche<br />
Mitgliederversammlung des VSAO<br />
Zürich/Schaffhausen statt.<br />
Dominique Iseppi, Kommunikationsassistentin,<br />
VSAO Zürich<br />
Es erwarten Sie spannende Referate und<br />
die Gelegenheit zum Austausch mit<br />
anderen Fachpersonen. Der Anlass<br />
richtet sich an HR-Verantwortliche,<br />
Weiterbildungsstättenleitende, Gleichstellungsbeauftragte<br />
sowie weitere<br />
interessierte Personen aus Spitälern<br />
und Praxen.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung<br />
unter www.<strong>vsao</strong>.ch/vereinbarkeit<br />
Bild: zvg<br />
16<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Ich möchte<br />
als Arzt<br />
arbeiten und<br />
meine Kinder<br />
betreuen.<br />
Geht das?<br />
Das<br />
geht!<br />
Gemeinsam<br />
machen wir es<br />
möglich!<br />
Wir setzen uns für Teilzeitstellen ein.<br />
JETZT AUF VSAO.CH MITGLIED WERDEN!
<strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong>-Inside<br />
Philipp Thüler<br />
Wohnort: Bern<br />
Beim <strong>vsao</strong> seit: August 2022<br />
Der <strong>vsao</strong> für Dich in drei Worten:<br />
Solidarisch, engagiert, fokussiert<br />
Zwischen Bollwerk und Bundeshaus<br />
– in Bern sind die<br />
Wege zwar kurz, aber der Weg<br />
hin zu politischen Veränderungen<br />
kann sehr lang sein. Das weiss<br />
Philipp Thüler, Leiter Politik und<br />
Kommunikation <strong>vsao</strong>, bestens. Doch<br />
Beharrlichkeit und Engagement zeichnen<br />
sein Schaffen aus.<br />
Politik und Kommunikation haben Philipp<br />
von Beginn weg interessiert. Bereits<br />
während seines Studiums in Geschichte,<br />
Politikwissenschaft und Medienwissenschaft<br />
war Philipp eine Zeitlang als<br />
<strong>Journal</strong>ist tätig. Nach seinem Abschluss<br />
zog es ihn aber in den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Als Kommunikationsverantwortlicher<br />
war er für verschiedene<br />
Organisationen tätig, unter anderem für<br />
das damalige Bundesamt für Berufsbildung<br />
und Technologie, für die Schweizerische<br />
Friedensstiftung swisspeace und<br />
die internationale NGO «Initiatives of<br />
Change». Bevor er zum <strong>vsao</strong> kam, arbeitete<br />
Philipp während zehn Jahren für die<br />
Föderation der Schweizer Psychologinnen<br />
und Psychologen (FSP), zuletzt als Leiter<br />
Kommunikation und Marketing.<br />
Die Aussicht, verschiedene Interessen<br />
unter einen Hut zu bringen und für<br />
eine überzeugende Aufgabe einzutreten,<br />
führten Philipp zum <strong>vsao</strong>. «Gesundheit<br />
ist für alle wichtig, und Ärztinnen und<br />
Ärzte sind entscheidend», sagt er und<br />
fährt fort: «Der <strong>vsao</strong> vertritt Anliegen,<br />
mit denen ich mich bestens identifizieren<br />
kann.» Sein Wissen und seine Erfahrungen<br />
sind die besten Voraussetzungen für<br />
die Arbeit beim <strong>vsao</strong>. Philipp ist Mitglied<br />
verschiedener Gremien, ist zuständig<br />
für das politische Monitoring und die<br />
Kommunikation nach aussen und pflegt<br />
den Kontakt zu anderen Organisationen<br />
(FMH, H+, SBK usw.) sowie zu den <strong>vsao</strong>-<br />
Sektionen. Fokussierung ist ein weiteres<br />
Stichwort, das seine Arbeit prägt. Es ist<br />
ihm wichtig, die Ressourcen des <strong>vsao</strong> im<br />
Sinne der Mitglieder einzusetzen, deren<br />
Anliegen angemessen gehört werden<br />
sollen. «Je besser der <strong>vsao</strong> funktioniert,<br />
desto besser erreicht er seine Ziele, die<br />
nicht nur für die Mitglieder, sondern<br />
für die ganze Gesellschaft wichtig sind»,<br />
ist Philipp überzeugt. Entsprechend<br />
benutzt er in der Kommunikation alle<br />
Kanäle, um nach innen und aussen ein<br />
möglichst grosses Echo zu erzielen.<br />
Als Vater zweier schulpflichtiger<br />
Kinder ist er mit der Frage der Vereinbarkeit<br />
von Familie und Beruf bestens<br />
vertraut. Ebenso mit der Tatsache,<br />
dass es neben der Arbeit einen Ausgleich<br />
braucht. So ist er in der Freizeit entweder<br />
im Freien beim Joggen, Wandern oder<br />
Skifahren anzutreffen oder in der Küche.<br />
Familie und Freunde werden bekocht<br />
und kommen in den Genuss seiner Backkünste.<br />
Und falls dann noch Zeit für<br />
einen Jass oder ein anderes Spiel bleibt,<br />
kann er seine strategischen Talente<br />
auch privat ausleben.<br />
Bild: zvg<br />
18<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
<strong>vsao</strong><br />
<strong>vsao</strong>-Rechtsberatung<br />
Aufhebungsvertrag statt<br />
Kündigung?<br />
Bild: zvg<br />
Aufgrund diverser Differenzen<br />
möchte mein Arbeitgeber<br />
das Arbeitsverhältnis<br />
mit mir beenden. Nach<br />
einigen Diskussionen ist er bereit, statt<br />
einer Kündigung über einen Aufhebungsvertrag<br />
zu diskutieren. Worauf<br />
muss ich achten? Kann es diesbezüglich<br />
Probleme geben?<br />
Oft ist ein Aufhebungsvertrag die wesentlich<br />
bessere Lösung als eine Kündigung.<br />
In einem Aufhebungsvertrag können<br />
alle Punkte geklärt werden, so etwa auch<br />
die Auszahlung von allfälligen Überstunden<br />
oder Ferien. Auch die Frage,<br />
wie ein Zeugnis ausfallen soll, kann darin<br />
festgehalten werden. Gegebenenfalls<br />
kann eine Entschädigung festgelegt<br />
werden. Für den Arbeitgeber hat die<br />
Aufhebungsvereinbarung den Vorteil,<br />
dass darin meist klar definiert wird, wann<br />
das Arbeitsverhältnis endet. Für die<br />
Arbeitnehmerin ist der scheinbare Vorteil,<br />
dass ihr nicht gekündigt wurde, sondern<br />
das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen<br />
Einvernehmen aufgehoben wurde. Dies<br />
sieht auf den ersten Blick oft besser aus,<br />
selbst wenn letztlich allen Fachpersonen<br />
klar ist, dass auch eine Auflösung im<br />
gegenseitigen Einvernehmen meist nicht<br />
freiwillig erfolgt ist.<br />
Arbeitslosenansprüche<br />
Insbesondere gilt dies für allfällige<br />
Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung.<br />
Diese erachtet eine Auflösungsvereinbarung<br />
trotz allem als<br />
Selbstkündigung, was Einstelltage zur<br />
Folge haben kann. Es wird deshalb oft in<br />
Aufhebungsvereinbarungen festgehalten,<br />
dass man – bei Fragen der Arbeitslosenversicherung<br />
– festhält, warum der<br />
Vertrag abgeschlossen worden ist bzw.<br />
weshalb man – wäre kein Aufhebungsvertrag<br />
zustande gekommen – gekündigt<br />
hätte. Sofern der Grund nicht bei der<br />
Arbeitnehmerin liegt, ist dies in jedem<br />
Fall bereits in der Vereinbarung darzulegen,<br />
um spätere Diskussionen zu<br />
vermeiden.<br />
Krankheit<br />
In Aufhebungsvereinbarungen wird,<br />
wie dargelegt, meist ein klares Enddatum<br />
des Arbeitsverhältnisses vereinbart.<br />
Diesbezüglich wird oft festgehalten, dass<br />
sich das Arbeitsverhältnis auch dann<br />
nicht verlängert, wenn die Arbeitnehmerin<br />
krank wird. Grundsätzlich verlängert<br />
sich ein Arbeitsverhältnis bzw. die<br />
Kündigungsfrist jedoch bei Krankheit.<br />
Je nach Anstellungsdauer kann dies<br />
zwischen einem und sechs Monaten sein.<br />
Diese rechtliche Regelung darf in einer<br />
Aufhebungsvereinbarung nur dann<br />
ausser Kraft gesetzt werden, wenn<br />
anderweitige Zugeständnisse von Seiten<br />
des Arbeitgebers gemacht werden<br />
(bspw. Abgangsentschädigungen oder<br />
längere Freistellungszeiten). Sofern dies<br />
nicht der Fall ist und man als Arbeitnehmerin<br />
trotzdem einen Aufhebungsvertrag<br />
unterzeichnet hat, in welchem<br />
ein Enddatum festgelegt wurde, welches<br />
sich auch wegen Krankheit nicht verlängert,<br />
kann dies angefochten werden,<br />
sofern man krank wird. Diesbezüglich<br />
kann man verlangen, dass die Vereinbarung<br />
in diesem Punkt als ungültig<br />
erklärt wird und sich der Arbeitsvertrag<br />
trotzdem verlängert. Die Rechtsprechung<br />
geht nämlich davon aus, dass in einem<br />
Aufhebungsvertrag gegenseitige Zugeständnisse<br />
gemacht werden müssen,<br />
die in etwa gleichwertig sind. Ein Aufhebungsvertrag,<br />
der nur zulasten<br />
der Arbeitnehmerin abgefasst wird,<br />
ist ungültig.<br />
Wichtig ist auch, zu wissen, dass man<br />
als Arbeitnehmerin eine Bedenkfrist von<br />
einigen Tagen verlangen darf, bevor man<br />
einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet.<br />
Hat man keine solche Bedenkfrist<br />
erhalten, kann man den Vertrag ebenfalls<br />
anfechten mit dem Argument, man sei<br />
überrumpelt worden.<br />
Zusammenfassend gilt somit,<br />
dass eine Auflösungsvereinbarung eine<br />
gute Alternative zu einer Kündigung<br />
sein kann. Es gilt aber, diese genau<br />
zu studieren und allenfalls auch durch<br />
den Rechtsbeistand der jeweiligen<br />
VSAO-Sektion prüfen zu lassen.<br />
Claudia von Wartburg,<br />
Juristin, Geschäftsleiterin<br />
VSAO Basel<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 19
Fokus<br />
Virtuelle Suche<br />
nach analogem<br />
Glück<br />
Online ist scheinbar alles möglich: eine schier unendliche Zahl<br />
von Dates und Beziehungen aller Art. Die im virtuellen Raum aufgebauten<br />
Verbindungen erfüllen aber oft nicht die im analogen Leben bestehenden<br />
Erwartungen. Die sogenannte Parasozialität hat ihre eigenen Regeln.<br />
Dr. phil. Johanna L. Degen, Sozialpsychologin an der Europa-Universität Flensburg<br />
Im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten reicht ein Klick, um eine neue Beziehung aufzubauen. Oftmals ist deren Qualität jedoch unbefriedigend.<br />
Bilder: Adobe Stock<br />
20<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Die Bedeutungszuschreibungen<br />
und Normen rund um<br />
Beziehungen verändern sich,<br />
auch wenn die Begriffe oft<br />
gleich bleiben; einst bedeutete Monogamie<br />
die lebenslange Bindung und<br />
exklu sive Sexualität. Heute bedeutet<br />
Mono gamie, dass wir aufhören, mit anderen<br />
sexuell aktiv zu sein, und die<br />
Aneinan derreihung von Partnerschaften<br />
für eine gewisse Zeit (Perel, 2019).<br />
Gleichzeitig halten sich überholte<br />
Narrative. Wir müssten schambefreite Sexualität<br />
ausleben und mehr auf uns achten.<br />
Einst gültig, überdauern derlei Überzeugungen<br />
auch in mancher therapeutischen<br />
Praxis. Allerdings zeigt sich, dass<br />
die Herausforderung heute ist zu fühlen,<br />
was man möchte, wenn alles geht. Und<br />
mehr noch, Beziehungen und Sexualität<br />
sollen exotisch, aussergewöhnlich und<br />
von andauernder Leidenschaft getragen<br />
werden (Clement, 2019). Zudem zeigt sich<br />
eine gewisse Orientierung am persönlichen<br />
Mehrwert und daran geknüpfte, bedingte<br />
Verbindlichkeit.<br />
Die Leere füllen<br />
Das, was eine Beziehung bringen soll, ist<br />
die Kompensation erlebter Sinnlosigkeit<br />
in neoliberalen Lebensbedingungen, während<br />
selbstständige Aneignung von lustvollem<br />
Leben, Kontakt zum Körper und zu<br />
anderen als herausfordernd erlebt werden.<br />
Dabei erleben Menschen Entfremdung.<br />
Es lässt sich beobachten, dass sich<br />
Subjekte auch in einer Beziehung einsam<br />
fühlen, Agitation, Leere und Ängste erleben,<br />
während gleichzeitig eine verlässliche<br />
Bindung und das Gefühl, erkannt,<br />
akzeptiert und geliebt zu werden, ersehnt<br />
werden.<br />
Soziale Räume zur Anbahnung von<br />
(intimen und nicht intimen) Beziehungen<br />
schliessen sich aus der Subjektperspektive<br />
zunehmend. Dies erklärt sich nicht allein<br />
in der physischen Isolation unter den<br />
Bedingungen der Pandemie. Sondern basiert<br />
unter anderem auch auf einer Verhärtung<br />
zwischen den Geschlechtern,<br />
entstehender Unsicherheit und resultierendem<br />
Rückzug. Wobei sich die Frage<br />
stellt, wie neue Geschlechterrollen funktionieren<br />
können, die politisch akzeptiert<br />
und trotzdem attraktiv sind.<br />
Wir haben also Beziehungen, die unter<br />
dem Druck stehen, uns viel (Mehrwert)<br />
zu liefern, zudem eine gewisse Ichzentrierung,<br />
erleben Zeit als knappe Ressource<br />
und fühlen uns politisch bedroht und unsicher<br />
im sozialen Raum.<br />
Alles scheint möglich<br />
Onlinedating und Social Media bieten dafür<br />
vermeintliche Lösungen. Sie sind immer<br />
zur Hand, bieten endlos scheinenden<br />
Zugriff auf schöne Erlebnisse, Validierung<br />
im Kollektiv und ermöglichen es, Konfrontationen<br />
mit anderen und sich auszuweichen.<br />
Eine unmittelbar angenehme<br />
Sphäre, die aber Konsequenzen hat, die in<br />
die analogen Beziehungen hineinreichen.<br />
Beim Dating etablieren sich neue Logiken,<br />
wie Parallelität, Quantifizierung<br />
und Low Investment (Degen & Kleeberg-Niepage,<br />
2021; 2022). Das bedeutet,<br />
dass wir nicht unbedingt das passende<br />
Match suchen, sondern das unmittelbar<br />
verfügbare. Wir daten mehrere gleichzeitig<br />
und manchmal mehrere an einem Tag.<br />
Wir freuen uns über viele Matches, auch<br />
wenn sie uns in der Kommunikation überfordern.<br />
Beim Date halten wir die Investition<br />
gering, sowohl monetär als auch<br />
emotional und zeitlich. Man geht dabei<br />
joggen oder zum Baumarkt (Degen, 2021).<br />
Austauschbar und gefühlsarm<br />
Selbst wenn diese Praktiken aus der Subjektperspektive<br />
gesehen sinnvoll sind, haben<br />
sie unbeabsichtigte und unerwünschte<br />
Konsequenzen. Die Spannung verliert<br />
sich. Die anderen erscheinen austauschbar,<br />
man selbst erlebt sich als austauschbar,<br />
und auch die Sexualität verändert<br />
sich. Abwertend als «Tindersex» bezeichnet,<br />
soll dieser wenig lustvoll sein. Sex<br />
wird als bedeutungslos und gefühlsarm<br />
erlebt, und es wird dabei aufs Äussere geachtet.<br />
Dabei geht es hier nicht um die moralische<br />
Bewertung von kurzfristigen Begegnungen,<br />
sondern um mangelnde Erfüllung.<br />
Von aussen wirkt Onlinedating spannend<br />
und attraktiv. Auch in Beziehungen<br />
können hierüber Bedürfnisse niedrigschwellig<br />
und unauffällig ausgelagert<br />
werden. Man kann den eigenen Marktwert<br />
checken, schon mal nach Alternativen<br />
Ausschau halten, ein Kompliment<br />
abfangen, und man lebt die eigene Beziehung<br />
vor einem Vorhang von endlos<br />
scheinenden Alternativen.<br />
Der Fokus richtet sich mitunter auf<br />
das Äussere. Dies geschieht nicht nur<br />
über Onlinedating, sondern auch über Social<br />
Media. Liebe nährt sich unter anderem<br />
aus Zuwendung und Fokus (Fromm,<br />
1956) – und der liegt oftmals auf dem mobilen<br />
Endgerät. Die Unterbrechung einer<br />
kommunikativen Situation durch die<br />
Handynutzung, Phubbing bzw. Phone<br />
Snubbing (Stein et al., 2022) genannt, kennen<br />
wir alle. Es wird auf Instagram gescrollt,<br />
wenn wir im Bett liegen. Das Handy<br />
schläft unter dem Kopfkissen. Die Insta-Story<br />
wird zu Ende geschaut, auch<br />
wenn das Baby gerade schreit, «das dauert<br />
nur ein paar Sekunden».<br />
Und wir binden uns an diejenigen,<br />
deren Leben wir verfolgen, die wir anschauen.<br />
Auch an Influencer. Selbst wenn<br />
die Beziehung einseitig – parasozial – ist.<br />
Wir bedeuten Influencern nur in der Masse<br />
der Follower etwas; für die Follower jedoch<br />
ist die Beziehung bedeutungsvoll<br />
und sie investieren Zeit, Geld und Fokus.<br />
Die Forschung zeigt, dass das nicht im-<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 21
Fokus<br />
mer suchtähnlich zu sein scheint, sondern<br />
dass wir unser Endgerät oder die Parasozialität<br />
darin lieben (Lindström,<br />
2011).<br />
Sowohl Social Media als auch Onlinedating<br />
bieten Raum für Projektionen, mit<br />
psychischen Konsequenzen. Wenn wir<br />
geghostet oder unfollowed werden, dann<br />
interpretieren wir das in unseren Narrativen<br />
oftmals als negativ verstärkend. Die<br />
differenzierte Begründung bleibt aus.<br />
Dies wird als verletzend erlebt. Wir praktizieren<br />
eine soziale Beziehung, die uns gegenseitig<br />
nicht guttut und wie wir sie uns<br />
nicht wünschen. Und dann ist es selbstwertdienlich,<br />
das Gegenüber abzuwerten.<br />
Aufs Geschlecht bezogen gilt beispielsweise<br />
die Unterstellung, Frauen seien<br />
umtriebig und Männer entweder Player<br />
oder verzweifelt. Und mit derlei stereotypen<br />
Bewertungen finden wir bei Social<br />
Media im Kollektiv Bestätigung – argumentativer<br />
Austausch und Begegnung als<br />
mögliches Korrektiv bleiben aus.<br />
Glückliche Nutzer<br />
Dabei muss es so nicht zugehen. Sexting<br />
und Onlinesex haben messbar positive<br />
Auswirkungen auf Sexualität (Döring &<br />
Mohseni, 2018). Es gibt auch glückliche<br />
Onlinedater und Social-Media-Nutzer. Sie<br />
lassen sich nicht in den Bann der Beschleunigung<br />
ziehen. Sie fühlen, was sich<br />
gut anfühlt, und reduzieren, was sich<br />
schlecht anfühlt. Sie kompensieren Verletzung<br />
nicht mit Mehr des Gleichen. Sie<br />
betreiben Slowdating, halten Kontakt zum<br />
Körper und der Lust und lassen Parasozialität<br />
nicht im Übermass in die analogen<br />
Beziehungen hineinragen. Sie eignen sich<br />
das Digitale an, ohne sich als Rohmaterial<br />
konsumieren zu lassen.<br />
Literatur<br />
Clement U. (2019). Systemische<br />
Sexualtherapie. Klett-Cotta.<br />
Degen, J. L. (2021). >500 Entscheidungen<br />
am Tag – Onlinedating zwischen<br />
transzendentaler Hoffnung und programmatischer<br />
Enttäuschung. Kursbuch Online.<br />
Degen, J. L. & Kleeberg-Niepage, A.<br />
(2022). The More We Tinder: Subjects,<br />
Selves and Society. Hu Arenas 5, 179–195.<br />
2022. https://doi.org/10.1007/s42087-020-<br />
00132-8<br />
Degen, J. L. und Kleeberg-Niepage, A.<br />
(2021). Profiling the Self in Mobile Online<br />
Dating Apps: a Serial Picture Analysis. Hu<br />
Arenas. 2021. https://doi.org/10.1007/<br />
s42087-021-00195-1<br />
Döring, N. (2019). «Sexuelle Aktivitäten<br />
im digitalen Kontext. Aktueller<br />
Forschungsstand und Handlungsempfehlungen<br />
für die Praxis», in: Psychotherapeut<br />
64(5) (2019), S. 374–384. https://doi.org/<br />
10.1007/s00278-019-00371-3<br />
Döring, N. & Mohseni, M. R. (2018).<br />
Are Online Sexual Activities and Sexting<br />
Good for Adults’ Sexual Well-Being? Results<br />
From a National Online Survey, International<br />
<strong>Journal</strong> of Sexual Health, 30:3, 250–263,<br />
DOI: 10.1080/19317611.2018.1491921<br />
Fromm, E. (1956/2005). Die Kunst des<br />
Liebens. Ullstein.<br />
Lindström, M. (2011). You love your<br />
Iphone. Literary. New York Times.<br />
Perel, E. (2019). The State of Affair.<br />
Rethinking Infidelity. Yellow Kite.<br />
Stein, J.-P., Liebers, N., & Faiss, M.<br />
(2022). Feeling better ... but also less lonely?<br />
An experimental investigation of how<br />
parasocial and social relationships affect<br />
people’s well-being. Mass Communication<br />
and Society. Advance publication online.<br />
https://doi.org/10.1080/<br />
15205436.2022.2127369<br />
Anzeige<br />
Partnervermittlung mit Charme<br />
persönlich · seriös · kompetent<br />
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich<br />
044 534 19 50<br />
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.<br />
Kathrin Grüneis<br />
22<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 23
Fokus<br />
Was von aussen nach perfekter Harmonie und Leichtigkeit<br />
aussieht, ist das Resultat harten Trainings. Nur eine tragfähige<br />
Partnerschaft birgt die Chance, an die Spitze zu gelangen.<br />
Im Gleichklang<br />
übers Glatteis<br />
Alle Mannschaftssportarten benötigen Teamgeist.<br />
Ist eine Sportart jedoch ausschliesslich auf Paare ausgerichtet,<br />
verschärft sich das Problem deutlich. Gilt es doch,<br />
die richtigen Personen zusammenzubringen und zusammenzuhalten.<br />
Beim Eistanz müssen sowohl technisches Niveau<br />
wie auch die Persönlichkeit harmonieren.<br />
Cédric Pernet, Nationaltrainer Eistanz Swiss Ice Skating (SIS)<br />
Bild: Adobe Stock<br />
24<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Wer Eistanz als Sport wählt,<br />
ist zwingend auf einen<br />
Partner bzw. eine Partnerin<br />
angewiesen. Wie aber<br />
findet man das passende Pendant? Hierfür<br />
stehen verschiedene Möglichkeiten offen:<br />
Die Athleten suchen ihre Partner über ihr<br />
persönliches Netzwerk, über dasjenige des<br />
Trainers oder über den Verband Swiss Ice<br />
Skating, welcher stark in die Umsetzung<br />
der Projekte und die Betreuung seiner Athleten<br />
involviert ist. Heute findet die Partnersuche<br />
vermehrt über das Internet und<br />
die sozialen Netzwerke (Facebook, Instagram<br />
etc.) statt. So gibt es beispielsweise<br />
die Internetseite ice partner search, eine<br />
Plattform für den Austausch von Eiskunstläufern,<br />
die einen Partner oder eine Partnerin<br />
suchen. Der Athlet kann dort sein<br />
Profil erstellen und/oder direkt eine Suche<br />
unter den verschiedenen Profilen auf der<br />
Plattform durchführen. Schliesslich ist<br />
auch die Mund-zu-Mund-Propaganda ein<br />
effizientes Mittel, um einen Partner oder<br />
eine Partnerin zu finden.<br />
Technik und Harmonie<br />
Es versteht sich von selbst, dass eine Partnerin<br />
oder ein Partner bestimmten Kriterien<br />
entsprechen muss, damit ein Paar<br />
kompatibel ist. Bei der Bildung eines<br />
Eistanzpaares müssen folgende Kriterien<br />
beachtet werden:<br />
– Das Alter muss mit dem Reglement vereinbar<br />
sein: Im Allgemeinen sollte der<br />
Altersunterschied zwischen Mädchen<br />
und Jungen idealerweise zwei Jahre<br />
betragen, da das geltende Reglement den<br />
Übergang zur Juniorenkategorie für<br />
Mädchen mit 15 Jahren und für Jungen<br />
mit 17 Jahren festlegt. Dementsprechend<br />
ist der Übergang zu den Senioren mit<br />
19 Jahren für die Frauen und 21 Jahren<br />
für die Männer vorgeschrieben.<br />
– Die Partner müssen auch bezüglich Körpergrösse<br />
harmonieren. Der Junge muss<br />
ein wenig grösser sein als das Mädchen<br />
(7 bis 20 cm Grössenunterschied). Dieser<br />
Unterschied wirkt sich auf die Harmonie<br />
der Linien des Paares aus, auf die Leichtigkeit,<br />
mit der der Junge seine Partnerin<br />
führen kann, und auf die Fähigkeit des<br />
Paares, dem Niveau seiner Kategorie entsprechende<br />
Hebefiguren auszuführen.<br />
– Das sportliche Niveau: Das technische<br />
Niveau zwischen den beiden Partnern<br />
muss nahe beieinanderliegen und Spielraum<br />
für weitere Fortschritte bieten. Sie<br />
müssen ein gemeinsames Ziel verfolgen<br />
und ähnliche Mittel, die zur Erreichung<br />
dieses Ziels benötigt werden, einsetzen.<br />
Falls beide Athleten die Kriterien erfüllen,<br />
können Probetrainings durchgeführt werden,<br />
um festzustellen, ob sie zusammenpassen<br />
oder nicht. Diese Tests zeigen<br />
auch, ob sich die Athleten verstehen oder<br />
nicht bzw. wie gut die beiden Persönlichkeiten<br />
harmonieren. Tests sind unerlässlich,<br />
um ein realistisches Bild zu erhalten<br />
und eine Prognose hinsichtlich der möglichen<br />
Zukunft des Paares machen zu<br />
können. Die Kriterien betreffend Harmonie<br />
und technisches Niveau müssen<br />
entsprechend geprüft werden. Trotzdem<br />
bleibt es am Ende eine Wette auf die Zukunft.<br />
Zu eigenen Fehlern stehen<br />
Wie in jeder Sportart sind auch im Eiskunstlauf<br />
Fehler, schlechte Leistungen<br />
und Niederlagen notwendig, um Fortschritte<br />
zu machen. Diese müssen analysiert,<br />
verstanden und akzeptiert werden,<br />
damit die Athleten einen Vorteil für ihre<br />
Entwicklung daraus ziehen können.<br />
Es ist auch wichtig, dass jeder für seine<br />
Fehler und schlechten Leistungen die Verantwortung<br />
übernimmt, damit diese sich<br />
schlussendlich positiv auswirken und<br />
nicht als Bedrohung für den Fortbestand<br />
der Partnerschaft wahrgenommen werden.<br />
Bei einem Fehler ist es natürlich<br />
leichter, den anderen zu kritisieren, als<br />
sich einer kritischen Selbstbetrachtung zu<br />
unterziehen. Wenn ein Partner den anderen<br />
in Frage stellt, untergräbt er damit das<br />
Vertrauen in den anderen und in die Partnerschaft.<br />
Diese negative Spirale kann<br />
dann zu einer Trennung führen.<br />
Wie bei jeder Mannschaftssportart ist<br />
es von zentraler Bedeutung, mit einer<br />
schlechten Leistung umgehen zu können,<br />
da diese nicht nur den Athleten, sondern<br />
auch das Paar auf die Probe stellt. Eine Betreuung<br />
hinsichtlich mentaler Vorbereitung<br />
mit einer kompetenten Person, in<br />
Zusammenarbeit mit dem Trainer, kann<br />
dem Paar helfen, besser mit Schwierigkeiten<br />
umzugehen und so seinen Fortbestand<br />
zu sichern. Sowohl die Arbeit zur mentalen<br />
Vorbereitung als auch die Arbeit auf Paarebene<br />
muss dabei auf den Einzelnen ausgerichtet<br />
sein. Es sind zwei sich gegenseitig<br />
beeinflussende Achsen.<br />
Letztendlich sind eine gute Beziehung<br />
zwischen den beiden Partnern, die gegenseitige<br />
Wertschätzung und das Vertrauen<br />
wesentliche Elemente für den Fortbestand<br />
des Paares, denn sie ermöglichen es, gemeinsam<br />
auf äussere Schwierigkeiten und<br />
Herausforderungen innerhalb der sportlichen<br />
Karriere zu reagieren.<br />
Trennungen vermeiden<br />
Auch wenn Paare über längere Zeit harmonieren,<br />
gibt es mehrere Situationen,<br />
die zu einer Trennung führen können:<br />
1) Ein Partner hört auf, da sein Lebensentwurf<br />
nicht mehr mit der Ausübung seines<br />
Sports zu vereinbaren ist.<br />
2) Ein Partner erleidet eine langwierige<br />
Verletzung.<br />
3) Ein Partner beendet seine Karriere wegen<br />
fehlender Motivation.<br />
4) Die beiden Partner haben unüberwindbare<br />
Meinungsverschiedenheiten.<br />
5) Das Paar erreicht die gesteckten Ziele<br />
nicht, was das ganze Projekt in Frage<br />
stellt.<br />
6) Die beiden Partner entwickeln sich<br />
unterschiedlich, was sich negativ auf<br />
ihre Harmonie auswirkt. Die Unterschiede<br />
können sowohl die Technik als<br />
auch die Interpretation/Präsentation/<br />
Bewegungsqualität des Oberkörpers<br />
be treffen.<br />
Im Fall 1 und 2 gibt es keine Lösung, die<br />
den Fortbestand des Paares ermöglichen<br />
kann. Wird der Sport zugunsten einer weiterführenden<br />
Ausbildung oder von etwas<br />
anderem aufgegeben, ist die Trennung<br />
unausweichlich. Ebenso bei langwierigen<br />
Verletzungen, da es keine Ersatzpartner<br />
gibt. Der unverletzte Partner führt dann<br />
normalerweise sein Einzeltraining fort.<br />
Manchmal kann auch der Trainer als «Ersatzpartner»<br />
dienen, um ein Mindestmass<br />
an Training und Gefühl für das Paarlaufen<br />
aufrechtzuerhalten. Je nach Situation ist<br />
es auch möglich, den verletzten Partner<br />
während der Genesungszeit durch einen<br />
Einzelathleten zu ersetzen, jedoch ohne<br />
Teilnahme an Wettkämpfen.<br />
In den vier anderen Fällen kann das<br />
Dreieck Trainer/Athleten/Eltern je nach<br />
Situation Aktionspläne entwickeln, um die<br />
Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Bei Bedarf<br />
kann Swiss Ice Skating die Coaches<br />
und Athleten unterstützen.<br />
Wie in der Gesellschaft besteht auch<br />
im Sport die Tendenz zu weniger dauerhaften<br />
Partnerschaften, d.h., die spontanen<br />
Wechsel nehmen zu, was sich entsprechend<br />
in einer erhöhten Anzahl Trennungen<br />
widerspiegelt.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 25
Fokus<br />
Bild: Adobe Stock<br />
26<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Symbiosis<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 27
Fokus<br />
Der vergessene<br />
Teil der Natur<br />
Die Natur ist ein ewiges Schlachtfeld, auf dem der Kampf<br />
ums Überleben ausgetragen wird. Diese Sicht der Dinge greift zu kurz.<br />
Denn daneben existieren unzählige Formen des Zusammenlebens,<br />
der gegenseitigen Hilfe und Freundschaften zwischen den Arten.<br />
Prof. André Langaney, Abteilung Genetik und Evolution, Abteilung für Anthropologie, Universität Genf<br />
Für die Neoliberalen ist die Natur<br />
ein Raum der Konkurrenz, des<br />
Raubbaus, des Kampfes um das<br />
Überleben, kurzum der Gewalt<br />
und des Terrors, dessen Prophet Charles<br />
Darwin sein soll. Manche möchten, dass<br />
unsere gesellschaftliche Ordnung von<br />
solchen Gesetzmässigkeiten bestimmt<br />
wird und Deregulierung und Wettbewerb<br />
als einzig mögliche Optionen übrig bleiben,<br />
ganz nach dem T.I.N.A.-Prinzip von<br />
Margaret Thatcher («There Is No Alternative!»).<br />
Nehmen wir noch die göttliche<br />
Perfektion der Natur, die einst von Bischof<br />
Paley postuliert wurde, dazu, kommen<br />
wir zu den Absurditäten der Soziobiologie<br />
und der evolutionären Psychologie,<br />
für welche die physischen, sozialen<br />
und psychologischen Merkmale in jeder<br />
lebenden Spezies «optimiert» sind. Die<br />
natürliche Selektion wäre dabei mit Konflikt<br />
gleichzusetzen. Ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte<br />
und Biologie von<br />
gestern und heute genügt, um zu verstehen,<br />
dass eine solch ideologische Sichtweise<br />
lächerlich ist.<br />
Gewiss, Räuberei, Konkurrenz und<br />
Parasitismus existieren und tragen zur natürlichen<br />
Selektion bei. Aber für ein Merkmal,<br />
welches das Überleben ermöglicht,<br />
ist die Anzahl der Nachkommen, die dieses<br />
tragen (und die damit verbundene Fertilität),<br />
der wichtigste Faktor für seine Verbreitung<br />
in einer Population. Die «Gewinner»<br />
der natürlichen Selektion sind die<br />
Überlebenden, die sich am meisten vermehren,<br />
aber nicht die Schönsten, Stärksten,<br />
Intelligentesten oder die «Angepasstesten».<br />
In «Über die Entstehung der Arten»<br />
[1] schwankt Charles Darwin immer<br />
wieder zwischen dem archaischen Kampf<br />
ums Überleben, der Spencer am Herzen<br />
liegt, für den der Wettbewerb die Grundlage<br />
der Evolution ist, und einer modernen<br />
Sichtweise, in der Zufall und Fruchtbarkeit<br />
eine wichtigere Rolle spielen.<br />
Galton (Darwins Cousin) und Leonard<br />
Darwin (Charles’ Sohn), die Begründer<br />
und Unterstützer des Sozialdarwinismus,<br />
der Eugenikbewegung und ihrer Exzesse,<br />
an denen Charles Darwin trotz einiger<br />
Zweideutigkeiten keine Schuld trägt, werden<br />
diese Zweifel später in ihrem Sinne<br />
aus dem Weg räumen.<br />
Zusammenarbeit und Symbiose<br />
Ab Ende des 19. Jahrhunderts widersetzten<br />
sich Naturalisten dieser Weltanschauung,<br />
indem sie eine Natur beschrieben, in<br />
der sich die Arten gegenseitig dulden und<br />
helfen, so wie es Petr Kropotkin schon im<br />
Titel seines bekanntesten Werkes angedeutet<br />
hatte [2]. Über das Verhältnis von<br />
Räuber und Parasit hinaus sind viele Beziehungen,<br />
die mit einem gegenseitigen<br />
Nutzen, einer Symbiose, einhergehen,<br />
wohl bekannt. Dabei ist die Kooperation<br />
häufig vorteilhaft für beide Seiten, auch<br />
im Kampf ums Überleben. Sich nahestehende<br />
oder auch entferntere Arten teilen<br />
Nahrung oder Verhalten, schützen oder<br />
verteidigen sich gemeinsam, oft bis hin<br />
zu einer gegenseitigen Abhängigkeit. Es<br />
gibt unzählige Beispiele, angefangen bei<br />
der Bestäubung, bei der Insekten eine<br />
sexuelle Dienstleistung an Blumen gegen<br />
Nahrung oder sogar gegen eine andere<br />
sexuelle Dienstleistung eintauschen. So<br />
zum Beispiel, wenn eine Wespe das Blütenblatt<br />
einer Orchidee als vermeintlichen<br />
Sexualpartner benutzt! Termiten brauchen<br />
die Mikroben der Mikrobiota für ihre<br />
Ver dauung ebenso wie Kühe und Menschen,<br />
während für die Stickstofffixierung<br />
durch Hülsenfrüchte Bakterien benötigt<br />
werden. Marc-André Selosse [3] erinnert<br />
daran, dass die Symbiose, also eine enge,<br />
exklusive und notwendige Beziehung zwi-<br />
Bild: Adobe Stock<br />
28<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
schen zwei lebenden Arten (Kropotkins<br />
«gegenseitige Hilfe») eine sehr alte und<br />
allgemeine Eigenschaft des Lebens ist. So<br />
findet man in Tier- und Pflanzenzellen<br />
Mitochondrien, die deren energetische<br />
Ressourcen verwalten und die von Bakterien<br />
abstammen, die sich vor über einer<br />
Milliarde Jahren als Kommensalen angesiedelt<br />
haben. Dasselbe gilt für Chloroplasten,<br />
die die Photosynthese der Pflanzen<br />
sicherstellen, oder für Flechten, die<br />
eine symbiotische Lebensgemeinschaft<br />
mit Grünalgen und Pilzen bilden.<br />
Bewusste Freundschaft<br />
Kropotkin, ein revolutionärer Aristokrat,<br />
Anarchist und Romantiker, unterschied<br />
wie Kessler, der ihn inspiriert hatte, zwischen<br />
der gegenseitigen Hilfe als unbewusstes<br />
Ergebnis der natürlichen Selektion,<br />
z.B. bei sozialen Insekten, und dem<br />
freiwilligen Vorgehen, das sich bei höheren<br />
Wirbeltieren beobachten lässt. Dabei<br />
sei jedoch darauf hingewiesen, dass das<br />
friedliche Zusammenleben eine Voraussetzung<br />
für die gegenseitige Hilfe ist, wie<br />
sie auch für die Organisation des Zusammenlebens<br />
einer oder mehrerer Arten notwendig<br />
ist. Von wirbellosen Tieren, darunter<br />
Insekten, bis hin zum Menschen zeigen<br />
die grossen Ansammlungen wie<br />
Fischschwärme oder Vogel- und Säugetiergemeinschaften,<br />
dass die Nähe zu anderen<br />
Individuen, derselben Art oder<br />
nicht, die oft gesucht wird, Sicherheit und<br />
Freude vermittelt.<br />
Es kann von gegenseitiger Hilfe und<br />
Freundschaft im menschlichen Sinne die<br />
Rede sein, wenn ein entwickeltes Nervensystem<br />
eine Vorstellung des anderen, seiner<br />
Bewegungen, Absichten und Emotionen<br />
ermöglicht, wenn Empathie es erlaubt,<br />
daran teilzuhaben. Sie können aus<br />
einer Prägung (mütterliche oder sexuelle<br />
Prägung), einer sozialen Konditionierung<br />
(Verhalten je nach Verwandtschaft, Zugehörigkeit<br />
zu einer sozialen Gruppe) oder<br />
einer sozialen Erfahrung, die belohnt wurde,<br />
hervorgehen. In all diesen Fällen geht<br />
die Beziehung von einer Interaktion zwischen<br />
Individuen aus, die sowohl zwischen<br />
Mitgliedern derselben Art als auch<br />
zwischen Mitgliedern verschiedener Arten<br />
auftreten kann. In diese Kategorie<br />
kann man auch die Beziehungen zwischen<br />
Tieren, die im Haushalt gehalten werden,<br />
und den Menschen einordnen. Wenn<br />
mehrere Arten gemeinsam gehalten werden,<br />
entwickeln sich oft unerwartete<br />
«freundschaftliche» Beziehungen zwischen<br />
denen, die in der Natur Feinde wären.<br />
Insbesondere dann, wenn sie sich im<br />
jungen Alter kennen gelernt haben, da jugendliche<br />
Charaktere und Verhaltensweisen<br />
Aggressionen oft hemmen. In sozialen<br />
Netzwerken finden sich so Unmengen an<br />
Bildern und Videos von diesen paradoxen<br />
Freundschaften zwischen Hunden und<br />
Katzen, Katzen und Ratten, Menschen<br />
und neuen Haustieren, die oft sehr exotischen<br />
Ursprungs sind.<br />
Literatur<br />
[1] Charles Darwin, 1859, The Origin<br />
Of Species By Means Of Natural Selection<br />
Or The Preservation Of Favoured Races In<br />
The Struggle For Life, John Murray,<br />
London.<br />
[2] Peter Kropotkin, 1902, Mutual<br />
aid, a factor of evolution, McClure, Phillips<br />
& Co, New York.<br />
[3] Marc-André Selosse, 2017,<br />
Jamais seul, Actes Sud, Arles.<br />
Von wegen wie Katz und Hund. Vertreter von Arten, die sich normalerweise<br />
aus dem Weg gehen, können unter Umständen Freundschaften entwickeln.<br />
Wobei sich diese wohl auf die jeweiligen Individuen beschränken.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 29
Fokus<br />
Tipps für eine<br />
erfolgreiche Praxisgemeinschaft<br />
Das Zeitalter des Einzelkämpfers ist wohl bald zu Ende,<br />
jedenfalls im medizinischen Umfeld. Immer mehr breitet sich das<br />
Erfolgsmodell Praxisgemeinschaft aus. Aber ist dieses wirklich<br />
immer und in allen Fällen besser? Wo liegen die Chancen und Gefahren<br />
einer gemeinsam betriebenen Praxis?<br />
Dieter J. Tschan, lic. oec. HSG, und Dr. Jörg Tschan, Oralchirurgie, Nimeda Consulting GmbH<br />
Bilder: Adobe Stock<br />
30<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
«Drum prüfe,<br />
wer sich ewig bindet,<br />
ob sich das Herz<br />
zum Herzen findet,<br />
der Wahn ist kurz,<br />
die Reu ist lang.»<br />
Friedrich Schiller<br />
Anscheinend beherzigen zu<br />
wenige Heiratswillige die berühmten<br />
Verse des deutschen<br />
Dichters (und Arztes), denn<br />
die Scheidungsrate ist in vielen Ländern<br />
in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen.<br />
Trennungen gibt es jedoch nicht<br />
nur im privaten Bereich: Leider gehen<br />
auch viele Praxisgemeinschaften in die<br />
Brüche, das heisst, ein Partner steigt bald<br />
wieder aus oder – im schlimmsten Falle –<br />
die Praxisgemeinschaft muss (mit all den<br />
rechtlichen und finanziellen Folgen!) aufgelöst<br />
werden. Friedrich Schiller hat in<br />
seinem Zitat anschaulich beschrieben,<br />
wie viel Verantwortung Bindung mit sich<br />
bringen kann. Und dies nicht nur im Privatleben,<br />
sondern – fast noch stärker – im<br />
Berufsleben In seinem berühmten «Lied<br />
von der Glocke» warnt er uns vor vorschnellen<br />
Entscheidungen; ein Ratschlag,<br />
den sich auch Ärztinnen und Ärzte bei<br />
der Erweiterung bzw. Umorganisation der<br />
eigenen Praxis zu Herzen nehmen sollten.<br />
Wie verballhornt der Volksmund Schiller<br />
doch so treffend: «Drum prüfe, wer sich<br />
ewig bindet, ob sich nicht doch etwas Besseres<br />
findet!»<br />
Auf der gleichen Wellenlänge<br />
Was bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter<br />
für ein Unternehmen gilt, gilt genauso<br />
für Praxisgemeinschaften: Meist erfolgt<br />
eine Anstellung basierend auf der fachlichen<br />
Qualifikation, eine Trennung dann<br />
jedoch wegen persönlicher, menschlicher<br />
Differenzen. Es gilt also den Partner bzw.<br />
die Partnerin zu finden, welche nicht nur<br />
fachlich, sondern insbesondere auch von<br />
der Persönlichkeit her in die Praxisgemeinschaft<br />
passt. Es ist zwingend, vorab<br />
eine gemeinsame Strategie und Philosophie<br />
der Praxisführung zu definieren. Einzelkämpfertum<br />
bzw. fehlende Kompromissbereitschaft<br />
sind fehl am Platz. Zentrale<br />
Themen wie Offenheit, regelmässige<br />
Besprechungen und gegenseitiger Respekt<br />
bilden die Grundlage einer beruflichen<br />
Als Paar in der Hausarzt- Gruppenpraxis<br />
Während unserer Weiterbildungszeit haben wir als Paar darauf geachtet, in verschiedenen<br />
Spitälern zu arbeiten. Einzig in einem Zentrumsspital liessen wir uns gleichzeitig<br />
anstellen und entdeckten die praktischen Seiten des gemeinsamen Arbeitgebers<br />
wie die Koordination der Ferienplanung oder der Weiterbildung.<br />
Der Abschluss des Facharztcurriculums vor der Familiengründung war uns wichtig:<br />
Kleine Kinder zu betreuen während der Weiterbildungszeit, ist eine enorme Herausforderung;<br />
das haben wir uns nicht zugetraut.<br />
Nach unserer Weiterbildungszeit ergab sich die Möglichkeit, in eine Hausarzt<br />
Gruppenpraxis einzusteigen und diese später noch zu erweitern. Aktuell sind wir<br />
vier Fachärzte, ein Assistenzarzt und ein pensionierter Vertretungsarzt.<br />
Wir konnten das gegenseitige Vertrauen, den Respekt und die Grosszügigkeit von<br />
unseren Vorgängern erben und weiterpflegen, das hat sich als zentral erwiesen.<br />
Wir sozialisieren uns in den Teambesprechungen, im Pausenraum und orientieren<br />
uns aneinander. Eine grundsätzlich ähnliche Haltung bezüglich der medizinischen<br />
Herangehensweise an die Probleme ist eine wichtige Vorbedingung: Bei aller Grosszügigkeit<br />
wird es unweigerlich zu Konflikten kommen, wenn zwei völlig verschiedene<br />
Ansätze bestehen. Damit die Verstrickungen nicht zu gross werden, sind alle Patienten<br />
einem Stammarzt zugeteilt, dieser ist für die Langzeitbetreuung verantwortlich.<br />
Bei gegenseitiger Vertretung fokussieren wir uns auf die akuten Probleme.<br />
Die Praxisorganisation in Form einer AG hilft uns, die administrativen Aufgaben aufzuteilen,<br />
welche auch gut bezahlt werden. Durch die Entschädigung der Ärzte über<br />
den Arzttarif gibt es keine Boni/Malus bei Nichterreichen der Budgetzahlen. Alle tragen<br />
auf ihre Art zum Gelingen bei, und der Einsatz wird direkt entlöhnt. Ein heikler Punkt<br />
ist die Ferien- und Abwesenheitsplanung, wir sind jedes Mal erleichtert, wenn wir uns<br />
geeinigt haben. Bedingt durch den Hausärztemangel müssen wir uns immer wieder<br />
abgrenzen und zu uns selber Sorge tragen.<br />
Dass eine Partnerschaft in der Praxis gut läuft, ist genau so wenig selbstverständlich<br />
wie in der Ehe. Als Paar sehen wir uns in der Praxis nicht in einer Sonderrolle, sondern<br />
sind je ein Teil des Teams und wirken beide unabhängig – das ist für uns ein sehr<br />
wichtiger Punkt. Durch die Aufteilung von Kinderbetreuung und Praxisarbeit überlappen<br />
sich unsere Sprechstunden wenig, so dass eine hilfreiche zeitliche Trennung<br />
besteht. Wir arbeiten beide halbtagsweise, sind also sowohl in der Praxis als auch<br />
zu Hause präsent. Dies erfordert eine hohe Flexibilität und ist entsprechend kräfteraubend<br />
– vieles tragen wir von der Arbeit nach Hause. Unsere Konflikte als Paar<br />
fokussieren sich vor allem auf Fragen der Kinderbetreuung, unsere gemeinsame<br />
«private» Zeit, in der keine scharfe Trennung der Zuständigkeiten möglich ist.<br />
Ursprünglich war es nicht unser Wunsch, am selben Ort und sogar in derselben Praxis<br />
zu arbeiten; es hat sich so ergeben und funktioniert zum Glück bis heute gut.<br />
Judith und Hannes Balmer, Stedtli-Praxis.ch<br />
Partnerschaft. Wird eine Praxis erweitert,<br />
bedeutet dies für die «Neuen» Respekt vor<br />
dem Geschaffenen und für die «Alten» Respekt<br />
vor den Ideen und Vorstellungen der<br />
jüngeren Generation zu haben.<br />
Der Erfolg ist nicht garantiert<br />
Die Gründe für einen Misserfolg können<br />
vielschichtig sein; es gibt keine Erfolgsgarantie!<br />
Wenn man es sich zu einfach macht<br />
und nicht alle Auswirkungen gedanklich<br />
durchspielt, wenn man nur die Vorteile<br />
sieht, kann es ein böses Erwachen geben.<br />
Manche Inhaber wollen weniger arbeiten,<br />
Verantwortung und Bürokratie abgeben,<br />
was ohne (neuen) Partner, der das<br />
auffängt, misslingt. Verantwortung abzugeben,<br />
heisst in der Folge aber auch, nicht<br />
mehr allein entscheiden zu können und<br />
sich somit abstimmen und einigen zu<br />
müssen. Dies kann zu Unzufriedenheit<br />
führen.<br />
Fast immer sind die Ziele des Inhabers<br />
und des Einsteigers nicht umfassend diskutiert<br />
und abgestimmt. Der «Neue» möchte<br />
vielleicht wachsen und ein weiteres Leistungsspektrum<br />
anbieten, der «Alte» eher<br />
das Vorhandene beibehalten und aufteilen.<br />
Die Koordination bei Investitionen, bei<br />
Personalentscheidungen etc. sind ebenso<br />
zu bedenken und können zu Meinungsverschiedenheiten<br />
führen.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 31
Fokus<br />
Von Beginn weg war der Wurm drin<br />
Eigentlich schien anfänglich alles zu stimmen: Meine zukünftige Praxispartnerin und<br />
ich kannten uns von der Arbeit im Spital und teilten den Wunsch nach einer eigenen<br />
Praxis. Wir verstanden uns gut, und ich hatte das Gefühl, dass wir die gleichen Ziele<br />
verfolgten und eine ähnliche Auffassung von unserer Arbeit hatten. Zudem war ich<br />
froh, das Risiko teilen zu können.<br />
Grundsätzlich ist es wie in der Ehe<br />
oder der Familie: Wenn sich jeder etwas zurücknimmt<br />
und den anderen etwas Platz<br />
zur Entfaltung gewährt, entwickelt es sich<br />
für alle zum Vorteil. Wenn es nur darum<br />
geht, seinen eigenen Willen durchzusetzen<br />
und sich zu behaupten, sind Partnerschaften<br />
sehr rasch zum Scheitern verurteilt.<br />
Tipps für eine erfolgreiche Praxispartnerschaft<br />
– Kopf, Herz und Hand<br />
(Heinrich Pestalozzi):<br />
Nur wenn der Bauch und der Verstand ja<br />
zum neuen Partner sagen, ist es wohl<br />
der richtige Entscheid. Haben Sie unbedingt<br />
den Mut, auch auf Ihre Intuition<br />
zu hören!<br />
– Heterogene Teams:<br />
Eine Partnerschaft unter «Gleichaltrigen»<br />
bzw. in der gleichen Generation<br />
Ausgebildeten entspricht eher dem<br />
Modell «Erweiterung»; eine Partnerschaft<br />
mit Partnern unterschiedlicher<br />
Generation entspricht eher dem Modell<br />
«Übergabe bzw. Fortführung mit Anpassungen».<br />
Eine gemeinsame Ziel -<br />
setzung ist ebenso zu beachten bei eher<br />
gleichen bzw. sehr unterschiedlichen<br />
fachlichen Schwerpunkten und Qualifikationen.<br />
32<br />
Wir hatten das Glück, eine bestehende Praxis übernehmen zu können, die wir aber<br />
praktisch von Grund auf neu bauten. Bereits in dieser Phase zeigten sich erste Differenzen.<br />
Obwohl ich im Gegensatz zu meiner künftigen Praxispartnerin während der Bauphase<br />
noch zu hundert Prozent berufstätig war, kümmerte ich mich viel intensiver um<br />
den Bau. Sie besuchte die Baustelle praktisch nie, verlangte aber Änderungen, die<br />
wenig Sinn machten, jedoch zu massiven Mehrkosten führten. Ich investierte wesentlich<br />
mehr Geld in den Umbau, versäumte aber, das in der Buchhaltung entsprechend<br />
auszuweisen. Obwohl mir bereits zu diesem Zeitpunkt erste Zweifel kamen, schob ich<br />
diese zur Seite.<br />
Als der Praxisbetrieb dann anlief, wurden unsere Differenzen immer sichtbarer. Meine<br />
Praxispartnerin arbeitete vier Tage pro Woche, ich viereinhalb. Es schien mir selbstverständlich,<br />
dass wir uns an unseren Freitagen vertreten würden, sollten Patienten eine<br />
dringende Konsultation benötigen. Ich machte das für ihre Patienten, da ich der Meinung<br />
bin, dass wir eine Dienstleistung erbringen und letztendlich unsere Patienten<br />
entscheiden müssen, ob sie eine Konsultation benötigen oder nicht. Meine Praxispartnerin<br />
sah sich ausserstande, meine Vertretung zu übernehmen. Glücklicherweise<br />
konnten wir zusätzliche Ärzte anstellen, so dass die Abdeckung gewährleistet war. Mit<br />
der Zeit wurde unsere unterschiedliche Arbeitsweise immer deutlicher: Die Patienten<br />
meiner Kollegin sassen bis zu einer Stunde im Wartezimmer, weil sie das Zeitmanagement<br />
nicht im Griff hatte, was zu Verdruss bei den Patienten und den MPA führte.<br />
Zudem kam ihrerseits Neid auf, da «mein Betrieb» sehr viel besser lief und florierte. Die<br />
Stimmung verschlechterte sich zusehends, die Luft war buchstäblich «zum Schneiden».<br />
Entsprechend gingen wir uns immer mehr aus dem Weg, sprachen kaum mehr miteinander,<br />
kurz gesagt, die Gemeinschaft war inexistent. Nachdem sich bei mir sowohl<br />
psychische als auch physische Probleme zeigten, setzte ich unter das Ganze einen<br />
Schlusspunkt. Unterstützt wurde ich dabei von den angestellten Kollegen, die mich<br />
aufforderten, mich von meiner Praxispartnerin zu trennen.<br />
Dass die Trennung nicht von heute auf morgen erfolgte, sondern sich über mehrere<br />
Jahre erstreckte und mir nicht nur viel Kraft, sondern auch beträchtliche finanzielle<br />
Mittel abverlangte, sei hier nur am Rande erwähnt. Aber lieber das sprichwörtliche<br />
Ende mit Schrecken als umgekehrt. Heute bin ich alleiniger Inhaber der Praxis und froh<br />
darüber.<br />
Rückblickend rate ich allen, die eine Praxisgemeinschaft gründen möchten, sich juristisch<br />
rundum abzusichern. Noch bevor der erste Franken in eine gemeinsame Praxis<br />
fliesst, sollten alle Eventualitäten vertraglich geregelt sein. Wer ein mögliches Ende von<br />
Beginn weg vor Augen hat und weiss, wie dieses aussehen wird, kann sicherer an den<br />
Aufbau gehen.<br />
M. Z. (Name der Redaktion bekannt)<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Wichtig ist zudem die Erkenntnis, dass<br />
die Medizin heute ein weiblicher Beruf<br />
geworden ist, auch diese Überlegung<br />
gilt es in eine geeignete Strategie einzubauen.<br />
– Seine Stärken und Schwächen<br />
kennen:<br />
Idealerweise macht man zuvor eine objektive,<br />
unvoreingenommene Analyse<br />
der eigenen Stärken und Schwächen.<br />
Dies gilt sowohl für den bisherigen Eigentümer<br />
als auch für den neuen Partner.<br />
– Einarbeitungsphase:<br />
Es empfiehlt sich nach sechs und zwölf<br />
Monaten eine erste «Zwischenbilanz»<br />
zu ziehen und auch die Verträge zeitlich<br />
so flexibel auszuarbeiten, dass nach dieser<br />
Zeit Anpassungen möglich sind.<br />
Dies sollte auch für die finanziellen Aspekte<br />
gelten.<br />
– Regelmässige Erfolgskontrolle:<br />
Werden die Erwartungen von beiden (!)<br />
Seiten erfüllt? Oder fühlt sich einer als<br />
Gewinner, der andere aber als Verlierer?<br />
Anzeige<br />
– Klare, verständliche Strategie:<br />
Eine einfach zu verstehende Strategie,<br />
die von allen mitgetragen wird, hilft<br />
«das Schiff auf Kurs zu halten».<br />
Fazit<br />
Damit eine Praxisgemeinschaft gelingt und<br />
nicht zum Alptraum wird, sind sehr unterschiedliche<br />
Punkte zu beachten, bspw. betreffend<br />
Personalfragen, Investitionen, Gewinnverteilung,<br />
Marketing, vor allem aber<br />
auch persönliche und psychologische Faktoren.<br />
Letztlich muss auch das Bauchgefühl<br />
stimmen. Auch kein noch so gutes Gefühl<br />
ersetzt indes vertragliche Regelungen.<br />
Denn alles, was man nicht geregelt hat,<br />
birgt Potenzial für Ärger. Praxispartnerschaften<br />
sind für einen längeren Zeitraum<br />
gedacht. Sollte die Chemie nicht stimmen,<br />
muss man sich entweder miteinander arrangieren<br />
oder das hoffentlich im gemeinsamen<br />
Vertrag vereinbarte Ausstiegsszenario<br />
nutzen. Bereits vor dem Einstieg muss<br />
folglich ein allfälliger Ausstieg detailliert<br />
und abschliessend geregelt sein.<br />
Über Nimeda Consulting<br />
Die Nimeda Consulting GmbH ist<br />
eine spezialisierte Beratungsfirma für<br />
Personen im medizinischen Umfeld.<br />
Dank der Interdisziplinarität unseres<br />
Teams (Arzt und Manager) gelingt es,<br />
auch komplexe Problemstellungen<br />
umfassend und detailliert zu analysieren<br />
und nachhaltige Lösungen zu<br />
präsentieren.<br />
Durch unsere einzigartige Kombination<br />
von Management-, Medical-,<br />
IT- sowie Legal-Know-how werden wir<br />
Ihre medizinische Praxis nachhaltig<br />
erfolgreicher machen, denn dank<br />
unseren bewährten Beratungsdienstleistungen<br />
können Sie sich stärker<br />
auf Ihre medizinische Kerntätigkeit<br />
fokussieren. Wir bieten u.a. folgende<br />
Dienstleistungen an: Management-,<br />
Finanz- und IT-Beratung, Führung<br />
und Coaching, Praxisübergabe und<br />
-übernahme, Neueröffnung, Sanierungen.<br />
Wir beraten Sie gerne auf<br />
Deutsch, Französisch und Englisch.<br />
Unser Slogan: Management Know-how<br />
for Medical Professionals.<br />
www.nimeda.com<br />
sympathisch l<br />
einfach l<br />
effizient l<br />
pex ll<br />
Die sympathische<br />
Ärztesoftware<br />
pex II ist ein hocheffizienter Assistent mit einem ausgeklügelten<br />
TarMed-Abrechnungs- und Informationssystem. Die Ärztesoftware<br />
besticht durch eine einfache, übersichtliche Bedienung und klaren<br />
Arbeitsabläufen. Mit einer Vielzahl an Softwareoptionen lässt sich<br />
Ihre persönliche pex II Lösung zusammenstellen. Zudem ist eine<br />
Vernetzung mit internen und externen Stellen jederzeit möglich.<br />
Delemed AG l Medical Software<br />
Talstrasse 4 l CH-3122 Kehrsatz-Bern<br />
Tel. +41 (0)31 950 27 27<br />
info@delemed.ch l www.delemed.ch<br />
Ihr Partner für medizinische Software<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 33
Fokus<br />
Symbiosis<br />
34<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Bild: Adobe Stock<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 35
Fokus<br />
Das Verbindende<br />
pflegen<br />
Miami Beach, Seoul oder Shanghai sind mit Basel-Stadt<br />
partnerschaftlich verbunden. Sabine Horvath, Abteilungsleiterin<br />
Aussenbeziehungen und Standortmarketing, erklärt,<br />
was diese Städtepartnerschaften für Basel bedeuten.<br />
Catherine Aeschbacher, Chefredaktorin <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
Die Städtepartnerschaft zwischen Basel und Miami Beach ist mit der Kunstmesse Art Basel begründet,<br />
welche in Basel jeweils im Juni und in Miami Beach im Dezember stattfindet.<br />
36<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Bilder: zvg<br />
Was genau ist eine Städtepartnerschaft?<br />
Eine Städtepartnerschaft hat eine konkrete<br />
Zusammenarbeit zwischen zwei Städten<br />
zum Inhalt. Dies mit dem Ziel, sich auf bestimmten<br />
Gebieten, etwa in den Bereichen<br />
Wissenschaft, Innovation, Bildung oder<br />
Gesundheit, der Nachhaltigkeit oder der<br />
Stadtentwicklung, auszutauschen sowie<br />
eine Zusammenarbeit aufzubauen, zu kooperieren<br />
und sich gegenseitig zu stärken.<br />
Woher stammt die Idee?<br />
Städtepartnerschaften fanden insbesondere<br />
in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg<br />
eine grosse Verbreitung. Damals mit<br />
dem Ziel, durch Partnerschaften die durch<br />
zwei Weltkriege aufgerissenen Wunden in<br />
Europa zu heilen. In der heutigen Zeit sind<br />
Städtepartnerschaften eher auf Standortinteressen<br />
ausgerichtet.<br />
Seit wann gibt es Städtepartnerschaften?<br />
Erstmals sind 1921 das englische Keighley,<br />
West Yorkshire, und Poix-du-Nord im<br />
französischen Département Nord eine<br />
Städtepartnerschaft eingegangen, allerdings<br />
in der Form, dass die englische Stadt<br />
die französische «adoptierte».<br />
Basel unterhält mehrere Städtepartnerschaften.<br />
Wie ist es dazu gekommen?<br />
Die Partnerschaften und Kooperationen<br />
des Kantons Basel-Stadt orientieren sich<br />
an den Interessen von standortrelevanten<br />
Akteuren. Dabei geht es um die Bedeutung<br />
von Basel als Life Sciences Cluster,<br />
die Austragungsorte der Art Basel sowie<br />
den Innovationsbereich. Ziel ist es, den eigenen<br />
Standort international zu vernetzen<br />
und zu positionieren.<br />
Welches war die erste Partnerstadt und<br />
weshalb?<br />
Basel-Stadt begründete seine erste Partnerschaft<br />
mit dem US-Bundesstaat Massachusetts<br />
im Jahr 2002. Die beiden Standorte<br />
haben gemeinsame Interessen als Life<br />
Sciences Cluster und gehören zu den<br />
wirtschaftlich führenden Regionen ihres<br />
Landes.<br />
Mit welchen anderen Städten bestehen<br />
Partnerschaften?<br />
Weitere strategische Städtepartnerschaften<br />
beziehungsweise -kooperationen<br />
pflegt der Kanton Basel-Stadt mit Shanghai<br />
(seit 2007), Toyama in Japan (2009),<br />
Miami Beach (2011) sowie Seoul (2022).<br />
Mit Abidjan/Yopougon pflegt Basel seit<br />
2021 eine Städtepartnerschaft im Sinne eines<br />
sozialen Engagements.<br />
Nach welchen Kriterien werden solche<br />
Partnerstädte ausgewählt?<br />
Es gibt drei Voraussetzungen, die eine<br />
Partnerstadt oder -region erfüllen sollte:<br />
Zum einen gemeinsame Interessen und<br />
Standortstärken, zweitens das Vorhandensein<br />
von Basler Institutionen und Akteuren<br />
vor Ort, die von dieser Partnerschaft<br />
profitieren können, und drittens<br />
einen konkreten Mehrwert, der eine politische<br />
Beziehungspflege generieren kann.<br />
So war etwa in Abidjan/Yopougon die lokale<br />
Verankerung des Schweizerischen<br />
Tropeninstituts (TPH) ausschlaggebend.<br />
Wie werden diese Partnerschaften<br />
gepflegt?<br />
Der Kanton fokussiert sich auf die politische<br />
Ebene zwischen Regierungsvertreterinnen<br />
und -vertretern der Partnerstädte.<br />
Zudem initiiert und fördert er den Austausch<br />
auf institutioneller Ebene, etwa<br />
zwischen Hochschulen, Spitälern, Unternehmen<br />
oder Forschungsinstitutionen.<br />
Und schliesslich unterstützt der Kanton<br />
wo möglich Kooperationsprogramme wie<br />
beispielsweise ein Schüleraustauschprogramm<br />
mit Massachusetts oder ein Programm<br />
für Start-ups aus Seoul und Basel.<br />
Spürt die Basler Bevölkerung etwas<br />
von diesen Partnerschaften?<br />
Die wirtschaftliche und wissenschaftliche<br />
Zusammenarbeit ist oft nicht direkt wahrnehmbar.<br />
Hier sind wir gefordert aufzuzeigen,<br />
welche Synergien entstehen und<br />
wie der Standort von der Kooperation<br />
profitiert. Direkt erkennbar ist der Austausch<br />
im Kulturbereich, sei es in Form<br />
von Gastkonzerten, Theaterkooperationen<br />
oder Aus stellungen. Zudem sind die<br />
Städte partnerschaften in Form von Geschenken<br />
im öffentlichen Raum sichtbar,<br />
so etwa die Shanghaier Skulptur ZHOU<br />
im Basler St. Johanns-Park.<br />
Wie aktuell ist die Idee in einer zunehmend<br />
vernetzten Welt?<br />
International ausgerichtete Städte wie<br />
Basel sind in einer globalisierten Welt auf<br />
die Zusammenarbeit mit Städten in anderen<br />
Weltteilen angewiesen. Städtepartnerschaften<br />
bieten hierfür den geeigneten<br />
formalen Rahmen. Allerdings nimmt die<br />
Spezialisierung bei der internationalen<br />
Zusammenarbeit weiter zu und wir tendieren<br />
heute eher Richtung thematische<br />
Kooperationen zwischen Städten und Regionen.<br />
Sabine Horvath,<br />
Leiterin Aussenbeziehungen<br />
und Standortmarketing Kanton<br />
Basel-Stadt<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 37
Fokus<br />
«Zusammen<br />
fühlen wir uns<br />
wohl»<br />
Raymonde und Serge Maire sind seit mehr als einem<br />
halben Jahrhundert verheiratet. Ein Universalrezept für eine dauerhafte<br />
Beziehung haben auch sie nicht, aber gemeinsame Werte<br />
und gegenseitiger Respekt scheinen gute Voraussetzungen zu sein.<br />
Bilder: zvg<br />
38<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Sie sind seit 53 Jahren verheiratet.<br />
Wie haben Sie sich kennengelernt?<br />
1969 arbeitete ich als Mechaniker in der<br />
Autogarage, in welcher auch der Bruder<br />
von Raymonde angestellt war. Eines Tages<br />
erzählte er mir, dass seine Schwester nach<br />
einem einjährigen Aufenthalt in Amerika<br />
in die Schweiz zurückkehren würde. Gleich<br />
bei unserem ersten Treffen war es Liebe<br />
auf den ersten Blick.<br />
Dann war es Ihnen also schnell klar,<br />
dass Sie ihr Leben zusammen verbringen<br />
wollen?<br />
Ja, uns war praktisch von Beginn weg klar,<br />
dass wir unser Leben gemeinsam verbringen<br />
würden.<br />
Was fanden Sie an Ihrem Mann bzw.<br />
an Ihrer Frau speziell anziehend?<br />
Serge war ehrlich und fleissig. Zusammen<br />
fühlten wir uns wohl. Und wir beide wollten<br />
eine Familie gründen. 1970 haben wir<br />
geheiratet.<br />
Raymonde war eine Frohnatur, gut gelaunt<br />
und immer positiv eingestellt.<br />
Welches sind die grössten Herausforderungen?<br />
Die Kinder gemäss unseren Überzeugungen<br />
mit Respekt, in Bescheidenheit und<br />
mit Liebe zu erziehen. In den 1970er Jahren<br />
war das alles viel einfacher, da es weder<br />
Mobiltelefone noch Computer gab.<br />
Was raten Sie jungen Paaren,<br />
die sich ebenfalls eine so dauerhafte<br />
Beziehung wünschen?<br />
Wir raten ihnen, in Liebe und Einfachheit<br />
zu leben. Ebenso, den Kindern viel Zeit zu<br />
widmen und den Dialog stets aufrechtzuerhalten.<br />
Wichtig scheint uns vor allem,<br />
nicht mit Neid auf andere zu schauen,<br />
sondern sich mit dem zu begnügen, was<br />
das Leben einem bietet.<br />
Zeit in Afrika<br />
Serge und Raymonde Maire haben<br />
einige Jahre in Afrika gelebt, wo sie<br />
zusätzlich zu ihren beiden leiblichen<br />
Töchtern noch zwei Töchter adoptiert<br />
haben. In Burkina Faso haben sie<br />
zudem eine Selbsthilfeorganisation<br />
gegründet. Dank dieser gelang es,<br />
im Heimatdorf ihrer älteren Adoptivtochter<br />
eine Schule zu eröffnen.<br />
Heute bereichern drei Enkelkinder<br />
die Familie. Alle diese Ereignisse<br />
seien wohl auch ein Grund für die<br />
53 gemeinsamen Jahre; die Zeit<br />
sei nur so verflogen.<br />
Gab es Hindernisse, die Sie zuerst<br />
überwinden mussten?<br />
Unsere beiden Familien lebten in bescheidenen<br />
Verhältnissen. Sie haben keinen<br />
Einspruch gegen unsere Heirat eingelegt.<br />
Serge bereitete sich 1972 in Abendkursen<br />
auf sein eidgenössisches Meisterdiplom<br />
vor. Das war keine einfache Zeit, denn unsere<br />
älteste Tochter war bereits auf der<br />
Welt, und ich war mit unserem zweiten<br />
Kind schwanger.<br />
Haben Sie vor Ihrer Hochzeit spezielle<br />
Vorsätze gefasst?<br />
Nein, wir haben vor unserer Hochzeit keinerlei<br />
Vorsätze gefasst.<br />
Sie haben in den 70er Jahren geheiratet.<br />
Das war eine Zeit des Umbruchs,<br />
der neuen Lebensmodelle. Hat Sie das<br />
irgendwie tangiert?<br />
Ich verfolgte im Mai 1968 die Ereignisse in<br />
Paris interessiert mit. Raymonde hielt sich<br />
in dieser Zeit in den USA auf und hatte gar<br />
nichts davon mitbekommen. Die Kommunen<br />
und die freie Liebe haben uns jedoch<br />
in keiner Weise beeinflusst.<br />
Welches sind für Sie die wichtigsten<br />
Faktoren in einer Beziehung?<br />
Am wichtigsten sind Vertrauen, Ehrlichkeit,<br />
Bescheidenheit, aber auch, Träume<br />
zu haben und sie zu verwirklichen.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 39
Fokus<br />
Partnerschaftliche<br />
Beziehungen<br />
hinter Gittern<br />
Strafanstalten sind kein Quell der Romantik.<br />
Die Insassen bringen eine schwierige Vergangenheit mit,<br />
was keine gute Voraussetzung für dauerhafte Beziehungen ist.<br />
Und bereits bestehende Beziehungen drohen<br />
durch die Situation zu zerbrechen.<br />
Dr. med. Thomas Knecht, Leitender Arzt, Fachstelle Forensische Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
Psychiatrisches Zentrum Appenzell Ausserrhoden<br />
«Absence makes the heart<br />
grow fonder», heisst es opti<br />
mistisch in einer Songzeile<br />
von Kris Kristofferson.<br />
In der Tat: Liebessehnsucht mag eine stärkende<br />
Wirkung auf die Verbundenheit<br />
zwischen zwei Menschen haben. Allerdings<br />
spielt nebst der Dauer auch der<br />
Grund der Absenz eine nicht unwesentliche<br />
Rolle. Ob es dabei um einen Studienaufenthalt<br />
an einer Topuniversität oder<br />
eine längere Freiheitsstrafe geht, ist von<br />
einiger Relevanz.<br />
In unseren liberalen Verhältnissen<br />
wird man nicht wegen jeder Lappalie arrestiert;<br />
vielmehr ist das «Wegsperren» oft<br />
die Konsequenz einer unhaltbar gewordenen<br />
Lebenssituation, welche Delinquenz<br />
miteinschliesst. Intakte Beziehungen mit<br />
attraktiven Partnern passen dagegen besser<br />
zu einem gelungenen Lebensvollzug.<br />
So kann es nicht verwundern, dass es oftmals<br />
eher Mütter und Geschwister sind,<br />
welche zur Besuchszeit in den Strafanstalten<br />
aufmarschieren als etwa eine rassige<br />
Geliebte. Entsprechend ist der häufigste<br />
Zivilstand unter Strafgefangenen entweder<br />
ledig oder getrennt/geschieden.<br />
Theoretisch wären auch Beziehungen<br />
zwischen zwei Personen denkbar, welche<br />
sich beide hinter Gittern befinden. Aber<br />
erstens werden Männer- und Frauenabteilungen<br />
strikte separat geführt, und zweitens<br />
sind Verhältnisse zwischen Angestellten<br />
und Insassen gänzlich tabu. Gegenbeispiele<br />
wie Hassan Kiko und Angela<br />
Magdici (Limmattaler Gefängnis) sind zumindest<br />
hochgradig unerwünscht. Aber<br />
auch unter Gleichgeschlechtlichen entwickeln<br />
sich kaum je zarte Bande von bleibendem<br />
Wert. Die vielzitierte «Nothomosexualität»<br />
zeigt wenig romantische Züge,<br />
ist oftmals mehr Ausdruck von Dominanz,<br />
Unter drückung und Ausbeutung unter<br />
den Insassen.<br />
Bad Boys und Abhängigkeit<br />
Aber ist der Strafgefangene für das Gegengeschlecht<br />
durchs Band unattraktiv? Mitnichten!<br />
Ein krasses Beispiel ist der Massenmörder<br />
Breivik, der korbweise Heiratsanträge<br />
erhält. Ähnlich gelagerte Fälle<br />
waren Charles Manson mit seiner «family»,<br />
der Satanist Richard Ramirez mit seinen<br />
Groupies und Ted Bundi, welcher via<br />
künstliche Insemination sogar aus der<br />
Haft heraus ein Kind mit einer Verehrerin<br />
gezeugt haben soll. Diese erotische Verklärung<br />
des dominanten Gewalttäters<br />
wird in der Wissenschaft als «Hybristophilie»<br />
bezeichnet; der Volksmund spricht<br />
lieber vom «Bad-Boy-Syndrom». Damit<br />
sind wir bei jenen Beziehungsformen angelangt,<br />
bei denen sich der eine Partner<br />
in Haft, der andere in Freiheit befindet.<br />
Bestand die Beziehung schon vorher, so<br />
stellt die Inhaftierung oftmals einen<br />
Brechpunkt dar. Das liegt aber keineswegs<br />
nur am staatlichen Eingriff; oftmals war<br />
die gesamte Lebenssituation bereits zerrüttet<br />
und keine gemeinsame Perspektive<br />
mehr vorhanden.<br />
Auf der anderen Seite haben wir aber<br />
auch Beziehungen, welche während der<br />
Haft ihren Anfang nehmen. Die Initialzündung<br />
geht dabei meist von einer Kontaktanzeige<br />
des Inhaftierten aus. Grundtenor:<br />
«Böser Junge (29), sucht Frauen<br />
zwischen 20 und 40 für BK (Briefkontakt).<br />
Bei Sympathie ist durchaus auch mehr<br />
möglich …» Viele Strafanstalten verfügen<br />
heute über spezielle «Familienzimmer»,<br />
in die sich die Liebenden für eine definierte<br />
Weile zurückziehen können. Ein<br />
solches Verhältnis weist auf psychologischer<br />
Ebene ein paar interessante Aspekte<br />
auf. Der Mann ist gewöhnlich das Punctum<br />
fixum, die Frau hat ihre volle Mobilität.<br />
Es liegt somit in ihrer Hand, wie hoch<br />
sie die Dauer (und Intensität) des Zusammenseins<br />
dosieren will. Da sich der Staat<br />
um die Versorgung des Eingeschlossenen<br />
kümmert, ist sie einstweilen auch von<br />
dieser Last befreit, zumal wechselseitig<br />
keine wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.<br />
Ausserdem hat sie jederzeit die<br />
40<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Eine stabile Beziehung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Resozialisierung.<br />
Leider erweisen sich Partnerschaften von Strafgefangenen meist nicht als dauerhaft.<br />
Bild: Adobe Stock<br />
Möglichkeit eines Rückziehers, ist zumindest<br />
temporär vor Stalking geschützt. Alles<br />
in allem ergibt sich daraus für die Frau<br />
eine Position der strategischen Überlegenheit,<br />
die ihr sehr entgegenkommt, zumal<br />
hier der Mann weit stärker auf ihren<br />
Goodwill angewiesen ist.<br />
Feste Partnerschaft als Schutzfaktor<br />
Aber wie steht es nun mit der Beziehungsqualität<br />
derjenigen Strafgefangenen, die<br />
in einer Langzeitbeziehung leben? – Nun,<br />
hier zeichnen sich zwei unterschiedliche<br />
Beziehungsmuster ab, welche m.E. vor allen<br />
Dingen durch die Altersklasse bedingt<br />
zu sein scheinen. Bei den jüngeren Semestern<br />
macht sich oft das sog. «assortative<br />
mating» bemerkbar, d.h., es werden<br />
vorwiegend Partnerinnen gewählt, welche<br />
den Betreffenden in entscheidenden<br />
Charaktereigenschaften ähneln. So tragen<br />
diese Frauen nicht selten Borderline<br />
oder gar dissoziale Wesenszüge, so dass<br />
sie durch ihr unstetes Bindungsverhalten<br />
ständig neue Turbulenzen ins Beziehungsleben<br />
hineinbringen. Bei dissozialen<br />
Persönlichkeiten ist das «Unvermögen<br />
zur Beibehaltung längerfristiger<br />
Beziehungen» sogar eines von sechs diagnostischen<br />
Kriterien gemäss ICD-10,<br />
während Borderlinerinnen in einem wilden<br />
Wechsel von Nähesuchen und brüsker<br />
Abstossung hin und her oszillieren,<br />
für die Eingeschlossenen oft eine heftige<br />
Nagelprobe.<br />
Das Ideal einer stetigen, ausgewogenen<br />
und kraftspendenden Dauerbeziehung<br />
findet sich nach meiner Erfahrung<br />
am häufigsten bei den älteren Jahrgängen<br />
unserer Inhaftierten. Diese zeichnen sich<br />
oft durch ein erhebliches Mass an Lebenserfahrung<br />
und Abgeklärtheit aus, was<br />
sie den quälenden Zustand des Getrenntseins<br />
und die damit immer verbundenen<br />
Ungewissheiten besser ertragen lässt. Die<br />
Stärke dieser Bindung kann aufgrund gewisser<br />
Abhängigkeiten der frei lebenden<br />
Partnerin noch vergrössert werden, so z.B.<br />
durch Kulturfremdheit, soziale Isolation<br />
oder wirtschaftliche Abhängigkeit.<br />
Angesichts all dieser problematischen<br />
Aspekte muss festgestellt werden,<br />
dass Freiheitsstrafen zweifellos erschwerende<br />
Umstände für ein natürliches Beziehungsleben<br />
erzeugen. Dies ist sehr zu<br />
bedauern, wenn man bedenkt, dass eine<br />
funktionierende partnerschaftliche Beziehung<br />
einer der stärksten bekannten<br />
Schutzfaktoren auf dem Weg zur Resozialisierung<br />
ist. Nicht umsonst spricht man<br />
im Fachjargon von einem «turning point»<br />
(Wendepunkt) in der kriminellen Karriere,<br />
wenn eine solche tragende Beziehung unverhofft<br />
zustande kommt.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 41
Fokus<br />
Bild: Adobe Stock<br />
42<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Symbiosis<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 43
Fokus<br />
Ausgelassen mit Mama und den Geschwistern zu spielen, ist Teil des Aktivierungsplans.<br />
Dieser hilft den Welpen auf ihren ersten Schritten hin zum Blindenführhund.<br />
Ein Lotse<br />
für alle Wege<br />
Bordsteinkanten, Blumentöpfe, aber auch<br />
Einsamkeit und Diskriminierung: Vieles, was sich blinden<br />
und sehbehinderten Menschen täglich in den Weg stellt,<br />
ist für Sehende unsichtbar. Blindenführhunde können helfen,<br />
einen Teil dieser Hindernisse zu überwinden.<br />
Hierfür braucht es aber eine lange Ausbildung und Training –<br />
auch für den menschlichen Partner.<br />
Bianca Molnar, Redaktionsmitglied <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
Bilder: zvg<br />
44<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Gäbe es ein Tinder für Blinde<br />
und ihre potentiellen Führhunde,<br />
wären die wichtigsten<br />
Kriterien Grösse, Laufgeschwindigkeit,<br />
Temperament, Belastbarkeit<br />
gegenüber Umweltreizen. Und anders<br />
als bei der zwischenmenschlichen<br />
Version entscheiden zunächst andere, ob<br />
es ein Match ist. Doch bis Mensch und<br />
Hund wirklich zueinander finden, vergehen<br />
zwei bis drei Jahre.<br />
Die zehn Labradorwelpen, die in der<br />
Nacht auf den 13. Dezember 2022 in der<br />
Zucht der Blindenhundeschule Allschwil<br />
zur Welt kamen, sind die jüngsten von<br />
durchschnittlich 80 Welpen, die hier jährlich<br />
geboren werden.<br />
Die ersten zehn Lebenswochen werden<br />
sie aufmerksam betreut. Ein Aktivitätsplan<br />
unterstützt ihre Entwicklung: Mit<br />
zwei Wochen öffnen sie die Augen und beginnen,<br />
die Wurfbox zu erkunden, später<br />
das Hundezimmer mit den angebotenen<br />
Spielsachen, danach den Garten. Mit<br />
sechs bis sieben Wochen geht es auf Ausflüge<br />
in das nahe gelegene Dorf oder in<br />
den Wald. Dabei lernen sie verschiedene<br />
Bodenbeschaffenheiten, Verkehrsgeräusche<br />
oder das Autofahren kennen.<br />
Mit zehn Wochen dann der erste Meilenstein:<br />
Jeder Welpe zieht in sein neues<br />
Zuhause bei einem Paten ein. Hier wird er<br />
die ersten anderthalb Lebensjahre verbringen<br />
und alles erlernen, was ein Hund<br />
können muss: neben Stubenreinheit und<br />
Grundgehorsam auch die Gewöhnung an<br />
Menschenmengen, Tramtüren oder Bahnhofslärm.<br />
Am Ende seiner Sozialisation<br />
soll er sich so sicher in die Welt der Menschen<br />
bewegen, dass er einen Blinden darin<br />
führen kann. Er soll weder ängstlich<br />
noch besonders ablenkbar sein und eigenständig<br />
Lösungen finden, wenn Unerwartetes<br />
passiert.<br />
er den Hund auffordern, Boden-, Seitenund<br />
Höhenhindernisse anzuzeigen, Bankomaten,<br />
Zebrastreifen und Türen aufzusuchen<br />
oder bei Treppen und Trottoirkanten<br />
stehen zu bleiben. Genau wie ihre Kollegen<br />
bleibt Jennifer Meyer für alle von ihr<br />
ausgebildeten Hunde, was Betreuung und<br />
Platzierung angeht, ein Hundeleben lang<br />
verantwortlich. Das Matching von Mensch<br />
und Hund bedarf eingehender Vorabklärungen.<br />
Das Führhundegespann soll sich<br />
möglichst harmonisch zusammen fortbewegen<br />
können, deshalb spielen Körpergrösse,<br />
Laufgeschwindigkeit und Temperament<br />
eine Rolle. So sollte ein sensibler<br />
Hund eher in eine ruhige, ländliche Umgebung<br />
vermittelt werden, während ein<br />
junger, sportlicher Mensch einen energiegeladenen<br />
Partner brauche, erklärt Jennifer<br />
Meyer.<br />
Das «Zusammengehen» und -leben<br />
erlernen<br />
Die Führhundeanwärter absolvieren einen<br />
sogenannten Infokurs, um das Geführtwerden<br />
unverbindlich auszuprobieren.<br />
Nach dem Matching mit einem geeigneten<br />
Hund wird das Gespann vom zuständigen<br />
Instruktor zwei Wochen lang<br />
täglich zu Hause betreut, um das Mitein-<br />
Auf die Grundschule folgt die<br />
Spezialisierung<br />
Die Eignung zum Blindenführhund wird<br />
während der monatlichen Besuche durch<br />
einen Patenbetreuer der Blindenhundeschule<br />
evaluiert. Ist sie gegeben, kehrt der<br />
Hund mit zwei Jahren für die sechs- bis<br />
neunmonatige Führhundeausbildung<br />
nach Allschwil zurück. An die Stelle des<br />
Paten als primäre Bezugsperson tritt nun<br />
ein Instruktor bzw. eine Instruktorin, zum<br />
Beispiel Jennifer Meyer. Sie trainiert mit<br />
dem angehenden Führhund rund 30 Hörzeichen,<br />
die es dem späteren menschlichen<br />
Partner erlauben, möglichst selbstständig<br />
unterwegs zu sein. Dadurch kann<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 45
Fokus<br />
Unterwegs mit Esra<br />
Jolanda Gehri treffe ich an einem<br />
Samstagnachmittag in der Berner<br />
Altstadt. Esra, ihre braune Labradorführhündin,<br />
begleitet sie. Wie ihre<br />
drei Vorgänger kommt auch Esra aus<br />
Allschwil.<br />
Der Weg durch den Vorweihnachtstrubel<br />
der Innenstadt erweist sich<br />
diesmal als Hindernisparcours.<br />
Jolanda Gehri hakt sich bei mir unter,<br />
ich kündige Richtungswechsel, Bordsteine,<br />
Stufen oder im Weg stehende<br />
Blumentöpfe an, weiche Passanten aus<br />
und gerate auf zu schmale Trottoirs.<br />
Dass sich Jolanda Gehri hier bestens<br />
auskennt, merke ich, als sie nach dem<br />
Besteigen eines Bordsteins sagt: «Ah,<br />
jetzt sind wir beim Swisscom-Shop.»<br />
Jolanda Gehri ist 68 Jahre alt und<br />
von Geburt an blind. Sie besuchte die<br />
Blindenschule in Zollikofen bei Bern,<br />
die damals noch ein Internat war. In<br />
Basel absolvierte sie eine Ausbildung<br />
zur Telefonistin und zog als junge Frau<br />
zurück nach Bern. Im Blindenheim in<br />
der Länggasse lernte sie ihren Mann<br />
kennen, zusammen bekamen sie zwei<br />
Kinder. Nach deren Auszug habe sie<br />
Lust auf eine neue Aufgabe gehabt<br />
und sich als Führhundeanwärterin in<br />
Allschwil angemeldet, erzählt sie.<br />
Sowohl Beginn als auch Ende der<br />
Partnerschaften mit ihren Führhündinnen<br />
hätten ihre Tücken: Am Anfang<br />
müsse man eine tragfähige Beziehung<br />
aufbauen, Vertrauen zum Hund<br />
gewinnen, ihm aber auch Halt und<br />
Orientierung bieten. Die Trennung<br />
von den älteren Hunden falle nach<br />
langen gemeinsamen Jahren natürlich<br />
schwer. Einem ihrer ehemaligen<br />
Hunde ist Jolanda Gehri nach dessen<br />
«Pensionierung» manchmal noch<br />
begegnet und hat ihm den Loyalitätskonflikt<br />
angemerkt: «Er wusste nicht<br />
so recht, mit wem er jetzt nach Hause<br />
gehen soll.»<br />
Im Alltag biete Esra ihr Entlastung,<br />
aber auch Gesellschaft, sagt Jolanda<br />
Gehri. Im Urlaub könne man den<br />
Führhund jedoch nicht gebrauchen, er<br />
könne nur dort helfen, wo ihm der<br />
Mensch klare Anweisungen geben<br />
kann, weil er den Weg kennt. Während<br />
ihrer geplanten Reise nach Amsterdam<br />
wird Esra deshalb von Bekannten<br />
zu Hause betreut.<br />
Jennifer Meyer trainiert mit einem Blindenführhund<br />
das Anzeigen eines Bodenhindernisses.<br />
ander zu erlernen. Dabei ist der Wechsel<br />
vom weissen Langstock zum Führhund<br />
nicht immer einfach: Beim Pendeln mit<br />
dem Stock können Bodenunebenheiten<br />
oder Hindernisse ertastet werden, Säulen<br />
oder Mauern können als Orientierung dienen.<br />
Der Hund führt den Menschen um<br />
diese Hindernisse herum, dieser muss<br />
ihm jedoch über Hörzeichen sagen, wohin<br />
es gehen soll. Dafür braucht der blinde<br />
Mensch einen sehr guten Orientierungssinn,<br />
um sich auch ohne tastbare Fixpunkte<br />
auf bekannten Wegen zurechtzufinden.<br />
Der Hund muss seinerseits selbstständig<br />
Lösungen, zum Beispiel Umwege, finden,<br />
wenn der gewohnte Weg plötzlich durch<br />
eine Baustelle verstellt ist. So fordert jede<br />
Strecke die enge Zusammenarbeit des Gespanns.<br />
Man könne sich nicht einfach auf<br />
den Hund verlassen, unterstreicht Jennifer<br />
Meyer. Er merke sofort, wenn der<br />
Mensch nicht bei der Sache sei. Daneben<br />
brauche es Vertrauen und eine tragfähige<br />
Beziehung zum Hund, dessen Bedürfnisse<br />
ebenfalls Raum benötigen. Um sich von<br />
der konzentrierten Arbeit zu erholen,<br />
braucht jeder Blindenführhund auch Spaziergänge<br />
ohne Geschirr und Leine, auf<br />
denen er frei laufen, mit anderen Hunden<br />
spielen oder im Gras herumtollen kann.<br />
Währenddessen ist sein Mensch auf sich<br />
allein gestellt.<br />
Aufgrund der anspruchsvollen Aufgabe<br />
können die meisten Führhunde ihre<br />
Menschen nicht ein Leben lang begleiten.<br />
Mit zehn oder elf Jahren können sich erste<br />
Anzeichen der Überforderung oder Konzentrationsschwäche<br />
bemerkbar machen:<br />
Der Zug im Geschirr sei nicht mehr so<br />
stark, in unruhiger Umgebung lege der<br />
Hund die Ohren an oder zeige andere sogenannte<br />
Konfliktzeichen, erklärt Jennifer<br />
Meyer. «Dann wird es Zeit, das Führgeschirr<br />
an den Haken zu hängen und dem<br />
Hund einen Platz fürs Alter zu suchen.»<br />
Manchmal kann er als Haustier bei seinem<br />
sehbehinderten Menschen bleiben. Wenn<br />
nicht, wird ihm mit Hilfe der Blindenhundeschule<br />
ein neuer Platz vermittelt.<br />
Nach seiner längsten Partnerschaft<br />
als Teil des Führhundegespanns muss der<br />
pensionierte Führhund eine neue Beziehung<br />
eingehen. Aufgrund ihres offenen<br />
Wesens sei dies für Labradore jedoch nicht<br />
so problematisch, sagt Jennifer Meyer.<br />
Nichtsdestotrotz seien die Abschiede oft<br />
sehr emotional.<br />
Den zehn Welpen des jüngsten Wurfs<br />
der Blindenführhundeschule Allschwil<br />
steht all das noch bevor. Ob sie zu Führoder<br />
Assistenzhunden ausgebildet, als<br />
Zuchthunde ausgewählt oder als Sozialhunde<br />
vermittelt werden, es bleibt zu hoffen,<br />
dass sie ein ganzes Hundeleben lang<br />
viele glückliche Partnerschaften eingehen.<br />
46<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Anzeige<br />
SPINAS CIVIL VOICES<br />
Wir Blinden sehen anders,<br />
z. B. mit der Nase.<br />
Obwohl Matthias Etter mit einer Sehbehinderung lebt, steht er auf eigenen Beinen.<br />
Statt mit den Augen orientiert er sich mit allen anderen Sinnen. Damit er unabhängig<br />
seine Wege gehen kann, steht ihm der SZBLIND mit Rat und Tat zur Seite.<br />
Selbstbestimmt durch den Alltag. Dank Ihrer Spende: PK 90-1170-7. szblind.ch<br />
SZB_FuellerIns_Hund_210x290_RA_d_4c_ZS.indd 1 10.11.21 09:52<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 47
Fokus<br />
Scheidungsschmerz<br />
verringern<br />
«Gleich und Gleich gesellt sich gern», sagt das Sprichwort.<br />
Das trifft bei Ärztinnen und Ärzten überdurchschnittlich oft zu.<br />
Was aber geschieht, wenn Gleich und Gleich sich scheiden lassen?<br />
Über die finanziellen Folgen und Alternativen zum<br />
Gerichtsverfahren.<br />
Anaïs Brodard, Rechtsanwältin, Mediatorin SAV, Collaborative Lawyer<br />
Die Statistiken sprechen eine<br />
klare Sprache: Eine Ärztin<br />
hat eine Wahrscheinlichkeit<br />
von 29,1 Prozent, in einer Beziehung<br />
mit einem Arzt zu leben. Auf Seiten<br />
der Ärzte sind 30,1 Prozent mit einer<br />
Ärztin liiert. Innerhalb dieses Berufsstandes<br />
besteht somit eine ausgeprägte Homogamie<br />
[1].<br />
Wie die Zahlen vom Bundesamt für<br />
Statistik zeigen, endet in der Schweiz<br />
praktisch jede zweite Ehe mit einer Scheidung<br />
[2]. Für das Jahr 2021 beläuft sich die<br />
Scheidungsrate auf 41,9 Prozent. Aufgrund<br />
dieser Tatsachen lohnt es sich, einen<br />
genaueren Blick auf die Besonderheiten<br />
der Scheidungsfälle bei Ärztinnen<br />
und Ärzten zu werfen.<br />
Finanzielle Interessen<br />
Die grosse Mehrheit der Ärztinnen und<br />
Ärzte sind in einem Angestelltenverhältnis<br />
(z.B. in einem Spital) oder frei praktizierend<br />
(in einer Privatpraxis, die üblicherweise<br />
als Einzelfirma betrieben wird)<br />
tätig.<br />
Bei einer Scheidung wird das Ver mögen<br />
des Paares gemäss dem gewählten Güterstand<br />
(ordentliche/geänderte Errungenschaftsbeteiligung<br />
oder Gütertrennung,<br />
sofern ein notariell beurkundeter Ehevertrag<br />
vorliegt) aufgeteilt.<br />
Falls der Arzt oder die Ärztin einer<br />
unselbstständigen Tätigkeit nachgeht,<br />
gibt es keine besonderen Fragen hinsichtlich<br />
der Bewertung seiner Tätigkeit, die<br />
geklärt werden müssen. Die Situation von<br />
Ärztinnen und Ärzten, die ihre Praxis als<br />
Einzelfirma betreiben, ist hingegen anders.<br />
In einem solchen Fall muss die Arztpraxis<br />
einer Bewertung unterzogen werden.<br />
Dieser Wert dient dann als Grundlage<br />
für die Aufteilung.<br />
Bei der Bewertung der Arztpraxis hat<br />
der Zivilrichter die Kompetenz, die Bewertungskriterien<br />
festzulegen und den<br />
finanziellen Wert zu bestimmen. Es gibt<br />
verschiedene Bewertungsmethoden, wie<br />
z.B. den Substanzwert oder den Buchwert,<br />
die Praktiker-Methode oder den<br />
Durchschnittswert, die Discounted-Cashflow-Methode<br />
oder den Ertragswert. Der<br />
Gesetzgeber präzisiert nicht, welche Methode<br />
auf welche Situation angewendet<br />
werden muss. Die Bewertung eines kleinen<br />
oder mittleren Unternehmens und<br />
insbesondere eines Einzelunternehmens<br />
ist insofern heikel, als der Erfolg eines solchen<br />
Unternehmens oft an eine bestimmte<br />
Person gebunden ist. Dies ist auch bei<br />
einer Arztpraxis der Fall.<br />
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die<br />
Ergebnisse der Bewertung je nach gewählter<br />
Methode stark schwanken können.<br />
Der Ausgang der gerichtlichen Entscheidung<br />
bezüglich Wert der Arztpraxis<br />
ist damit ungewiss.<br />
Das Bundesgericht hatte einen Fall zu<br />
beurteilen, in dem es um die Frage ging,<br />
welchen Wert der «Patientenstamm» eines<br />
Arztes hat. Das Bundesgericht hat<br />
entschieden, dass in einem solchen Fall<br />
der Kundenstamm eines Arztes aufgrund<br />
des persönlichen Vertrauensverhältnisses,<br />
das ein wesentliches Element in der<br />
Beziehung zwischen Arzt und Patienten<br />
darstellt, keinen sicheren Wert im Vermögen<br />
des Ehegatten darstellt [3]. Im vorliegenden<br />
Fall wurde die Arztpraxis auf der<br />
Grundlage ihres Buchwerts mit mehreren<br />
zehntausend Franken bewertet.<br />
So kommt es häufig vor, dass ein Arzt<br />
seine Praxis verkaufen oder teilweise oder<br />
vollständig auflösen muss, um seinen Verpflichtungen<br />
aus der Scheidung nachkommen<br />
zu können. Für den Arzt kann eine<br />
Scheidung nicht nur den Verlust seiner Arbeitsgrundlage<br />
(seiner Praxis), sondern<br />
auch die Verringerung oder sogar den Wegfall<br />
seines Einkommens (zumindest für einen<br />
bestimmten Zeitraum) bedeuten. Um<br />
eine solch chaotische Situation zu vermeiden,<br />
die kaum vollstreckt werden kann,<br />
empfiehlt es sich, Ärzte auf Alternativen zu<br />
einem Gerichtsverfahren hinzuweisen.<br />
Weshalb? Damit diese die Folgen ihrer<br />
48<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Fokus<br />
Nicht jede Trennung muss in einem Gerichtsprozess enden. Einvernehmliche Lösungen, gefunden mit Hilfe qualifizierter Personen, ersparen oftmals<br />
nicht nur Geld, sondern mildern auch den seelischen Schmerz.<br />
Bild: Adobe Stock<br />
Scheidung bewältigen und zu realistischen,<br />
dauerhaften Lösungen kommen können,<br />
die den Interessen und Bedürfnissen aller<br />
von der Scheidung betroffenen Parteien so<br />
weit wie möglich gerecht werden.<br />
Alternativen zum Gerichtsverfahren<br />
Es gibt verschiedene Alternativen zum<br />
Gerichtsverfahren. Die zu bevorzugenden<br />
sind das kooperative Anwaltsverfahren<br />
(collaborative law & practice, clp) oder die<br />
Mediation.<br />
Das kooperative Anwaltsverfahren ist<br />
freiwillig und vertraulich. Dabei wird jede<br />
Partei von einem eigenen Anwalt unterstützt,<br />
der in diesem Bereich ausgebildet<br />
ist. Es läuft in fünf klar definierten Schritten<br />
ab. Die anwesenden Anwälte verpflichten<br />
sich, ihr Mandat zu kündigen, falls<br />
keine Einigung erzielt werden kann. Die<br />
Arbeit findet im Team statt und folgt den<br />
Grundprinzipien der Transparenz und<br />
Vertraulichkeit [4].<br />
Die Mediation wiederum ist ein freiwilliger<br />
Prozess, bei dem die Parteien mit<br />
Hilfe eines neutralen, unparteiischen und<br />
unabhängigen Mediators versuchen, die<br />
Kommunikation wiederherzustellen und<br />
eine Einigung zu erzielen [5].<br />
Der Entscheid für einen Prozess (Gericht)<br />
oder für eine alternative Vorgehensweise<br />
(kooperatives Anwaltsverfahren<br />
oder Mediation) bringt grundlegende Unterschiede<br />
mit sich:<br />
– In einem Gerichtsverfahren ist es der<br />
Richter, der entscheidet, die Arztpraxis<br />
bewertet und Zahlungsfristen ansetzt.<br />
Im kooperativen Anwaltsverfahren oder<br />
bei der Mediation hingegen sind es die<br />
Parteien die die Wahl haben und finanzielle<br />
Vereinbarungen treffen können,<br />
um das Fortbestehen der Praxis zu ermöglichen.<br />
– In einem Gerichtsverfahren folgt der<br />
Richter strengen Verfahrensregeln (Prozesshandlung,<br />
Beweise, Einvernahme<br />
von Zeugen, Anhörungen, Gutachten),<br />
während beim kooperativen Anwaltsverfahren<br />
oder bei der Mediation die<br />
Anzahl Sitzungen im Voraus festgelegt<br />
wird und die Parteien entscheiden, nach<br />
welcher Methode sie die Arztpraxis bewerten<br />
lassen wollen.<br />
– In einem Gerichtsverfahren können die<br />
anfallenden Kosten extrem hoch sein<br />
und hängen von der Komplexität des<br />
von den Anwälten eingeleiteten Verfahrens,<br />
den herangezogenen Beweismitteln<br />
sowie der Anzahl der erforderlichen<br />
Gerichtsverhandlungen ab. Im Gegensatz<br />
zu einem aussergerichtlichen Verfahren<br />
verliert man hier die Kontrolle<br />
über die finanziellen Konsequenzen des<br />
Gerichtsverfahrens.<br />
Letztendlich sind Lösungen, die von den<br />
Parteien selbst gefunden werden, oft dauerhafter<br />
als die von einem Richter nach<br />
einem oft langen und anstrengenden Prozess<br />
auferlegten Lösungen. Zudem ermöglichen<br />
einvernehmliche Lösungen auch<br />
eine bessere Planung der Folgen hinsichtlich<br />
Steuern, Vorsorge und Übergabe der<br />
Praxis.<br />
Literatur<br />
[1] Pierre Courtioux, Vincent<br />
Lignon, Homogamie éducative et inégalités<br />
de revenu salarial: une perspective de cycle<br />
de vie, 2015.<br />
[2] https://www.bfs.admin.ch/bfs/<br />
de/home/statistiken/bevoelkerung/<br />
heiraten-eingetragene-partnerschaftenscheidungen.html<br />
[3] BGer 5C.271/2005 vom 23. März<br />
2006, Erw. D.b.<br />
[4] https://www.droitcollaboratif.ch/<br />
[5] https://www.vd.ch/themes/<br />
justice/conseils-et-assistance/mediation<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 49
Perspektiven<br />
Aktuelles aus der Gefässmedizin:<br />
Arterielle und venöse Thrombosen bei COVID-19-Infektionen<br />
«Nebenwirkungen»<br />
der Pandemie<br />
Dass COVID-19 weit mehr als eine Erkrankung der oberen Atemwege ist,<br />
wurde bald klar. Das Risiko von kardiovaskulären und thromboembolischen<br />
Komplikationen liegt deutlich höher als etwa bei einer Influenza und<br />
nimmt mit der Schwere der Erkrankung zu. Eine Antikoagulationstherapie<br />
muss individuell evaluiert werden.<br />
Ioannis Sotirelis, Prof. Dr. Alexander Zimmermann, PD. Dr. Claudia Schrimpf, Klinik für Gefässchirurgie,<br />
Universitätsspital Zürich<br />
Die Erkrankung an COVID-19<br />
(Coronavirus Disease 2019)<br />
durch ein SARS-CoV-2 (Severe<br />
Acute Respiratory Syndrome<br />
Coronavirus Type 2) ist mit einer<br />
hohen kardiovaskulären Morbidität und<br />
Mortalität assoziiert [1; 2]. Die Rate an<br />
thromboembolischen und kardiovaskulären<br />
Komplikationen nimmt mit der<br />
Schwere der Erkrankung zu. Thromboembolische<br />
Ereignisse treten nicht nur als<br />
klassische tiefe Venenthrombose (TVT)<br />
oder Lungenembolie (LE) auf, sondern<br />
manifestieren sich auch als Mikrothrombosen<br />
in unterschiedlichen Organsystemen.<br />
Zwei Mechanismen verantwortlich<br />
Als einer der Hauptmechanismen thromboembolischer<br />
Ereignisse der COVID-19-<br />
Infektion wird ein systemischer Inflammationsprozess<br />
verantwortlich gemacht.<br />
Es kommt zu einem Sturm an proinflammatorischen<br />
Zytokinen (wie z.B. Interleukin<br />
[IL]-1, IL2, IL-6 und Tumornekrosefaktor<br />
alpha), die ähnlich wie bei einer<br />
disseminierten intravasalen Gerinnung<br />
(DIC) zu einem prothrombotischen Milieu<br />
mit Steigerung der Produktion und Aktivität<br />
von Thrombozyten als auch zu einer<br />
Verminderung der Fibrinolyse (IL-2) führen.<br />
Anders als bei einer DIC ist bei CO-<br />
VID-19 die Thrombozytopenie gering und<br />
auch die aktivierte partielle Thromboplastinzeit<br />
und/oder Prothrombinzeit nur<br />
in einem geringen Ausmass erhöht. Deshalb<br />
wurde ein zweiter Mechanismus für<br />
die Entstehung arterieller Thrombosen<br />
postuliert, nämlich eine direkte Schädigung<br />
des Endothels mit konsekutiver Endotheliitis<br />
[3, 4]. Diese Hypothese wurde<br />
durch eine relativ frühe Entdeckung von<br />
Varga et al. unterstützt, die elektronenmikroskopisch<br />
SARS-CoV2-Partikel in Endothelzellen<br />
nachweisen konnten [5]. In diesem<br />
Zusammenhang wird angenommen,<br />
dass für die Infektion der Endothelzelle<br />
die Bindung des Virus an den ACE-2-<br />
Rezeptor (Angiotensin Converting Enzyme-2)<br />
notwendig ist [6, 7]. Interessanterweise<br />
deuten einige Studien darauf<br />
hin, dass der ACE-2-Rezeptor auf arteriosklerotischen<br />
Endothelzellen hochreguliert<br />
zu sein scheint [8–10], was das Auftreten<br />
arterieller Thrombosen bei Patienten<br />
mit kardiovaskulärem Risikoprofil und<br />
COVID-19 zusätzlich begünstigt [11, 12].<br />
Häufigkeit arterieller und venöser<br />
Thrombosen<br />
Das Auftreten venöser Thromboembolien<br />
(VTE) variiert aufgrund der unterschiedlichen<br />
Endpunkterfassung in der Literatur.<br />
Zwei Metaanalysen von Patienten mit<br />
COVID-19 konnten Inzidenzen an VTE<br />
von etwa 28–38 Prozent bei Intensivpatien<br />
ten und 7–17 Prozent bei nicht<br />
intensiv pflichtigen Patienten identifizieren<br />
[13, 14]. Am häufigsten kamen tiefe<br />
Beinvenenthrombosen und Lungenembolien<br />
mit jeweils 22 Prozent bei Intensivund<br />
13 Prozent bei nichtintensivpflichtigen<br />
Pa tienten vor [15]. Mit 3,7–9,6 Prozent<br />
sind thrombotische Ereignisse im arteriellen<br />
System weitaus seltener und wurden<br />
dadurch weniger untersucht [16, 17]. Ein<br />
erhöhtes Risiko für das Auftreten eines<br />
akuten Koronarsyndroms aufgrund von<br />
COVID-19 scheint mit vorbestehender<br />
Arteriosklerose assoziiert zu sein und<br />
COVID-19 scheint auch in anderen arteriellen<br />
Stromgebieten das Auftreten arterieller<br />
Thrombosen zu begünstigen [11, 12].<br />
Klok et al. berichteten in einer initialen<br />
Fallserie an 187 intensivpflichtigen Patienten<br />
über 3,7 Prozent ischämische<br />
Schlaganfälle [16]. Eine Metaanalyse der<br />
Datenbank des «Coronavirus Critical Care<br />
Consortiums» konnte bei insgesamt 2699<br />
eingeschlossenen Patienten 19 ischämische<br />
Insulte nachweisen [18]. Verglichen<br />
damit ist das Risiko eines ischämischen<br />
Insultes bei einer vergleichbaren viralen<br />
Erkrankung wie z.B. Influenza mit ca. 0,2<br />
Prozent deutlich niedriger [19]. Anders als<br />
50<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Perspektiven<br />
bei koronaren und zerebralen CO-<br />
VID-19-Manifestationen konnten Cheruiyot<br />
et al. arterielle Thrombosen bei jungen<br />
Männern ohne vorbestehende Atherosklerose<br />
nachweisen. Dabei waren meist<br />
grosse Gefässe wie die Aorta und mesenteriale<br />
Gefässe betroffen [20]. Dies unterstützt<br />
die Theorie, dass auf molekularer<br />
Ebene ein akuter, lokaler Endothelschaden,<br />
also eine Endotheliitis, für das Auftreten<br />
thrombotischer Ereignisse mitverantwortlich<br />
ist. Eine endotheliale arteriosklerotische<br />
Vorschädigung kann zwar<br />
begünstigend wirken, ist jedoch nicht<br />
Grundvoraussetzung für eine CO-<br />
VID-19-bedingte arterielle Thrombose [3–<br />
5, 7]. Letztlich ist der zugrunde lie gende<br />
Mechanismus nicht abschliessend geklärt.<br />
Einen Hinweis geben Fournier<br />
et al., die feststellten, dass eine initiale<br />
Erhöhung des D-Dimers > 1250 ng/l einen<br />
unabhängigen Prädiktor für das Auftreten<br />
arterieller Thrombosen darstellt und<br />
ein dreifach erhöhtes Mortalitätsrisiko<br />
bei COVID-19-Patienten mit arterieller<br />
Throm bose im Vergleich zu Patienten<br />
ohne COVID-19, trotz etablierter Antikoagulation,<br />
besteht [21].<br />
Antikoagulation zur Prävention<br />
thromboembolischer Ereignisse<br />
Aufgrund des erhöhten Risikos thromboembolischer<br />
Ereignisse ist die wissenschaftliche<br />
Evaluation einer Antikoagulation<br />
bei COVID-19 erstrebenswert.<br />
In der ACTION(AntiCoagulaTIon- cOro-<br />
Na virus)-Studie wurden bei an COVID-19<br />
erkrankten Patienten mit erhöhten D-Dimeren<br />
eine 30-tägige therapeutische Antikoagulation<br />
(Rivaroxaban 20 mg oder unfraktioniertes/niedermolekulares<br />
Heparin)<br />
mit einer prophylaktischen In-Hospital-Dosierung<br />
von unfraktioniertem/niedermolekularem<br />
Heparin verglichen. Die therapeutische<br />
Antikoagulation zeigte keinen Vorteil<br />
bezüglich der Sterblichkeit, ging aber mit<br />
einem höheren Blutungsrisiko einher [22].<br />
Hingegen konnte in der ATTACC<br />
(Anti -thrombotic-Therapy-to-Ame liorate-<br />
Complications-of-Covid-19)-Studie belegt<br />
werden, dass hospitalisierte COVID-19-<br />
Erkrankte auf Normalstation von einer therapeutischen<br />
Antikoagulation profitieren<br />
können und entsprechend eine Abwägung<br />
erfolgen sollte [23]. Bei intensiv pflichtigen<br />
Patienten mit COVID-19, ohne anderweitige<br />
Indikation zur Antikoagulation, wurden<br />
verschiedene Studien (ATTACC, ACTIV-4a<br />
und REMAP-CAP) vorzeitig gestoppt, da<br />
es unter Vollantikoagulation zu vermehrten<br />
Blutungsereignissen ohne Prognoseverbesserung<br />
kam [23, 24]. Für den ambulanten<br />
Bereich bzw. nach Spitalaufenthalt<br />
ist anhand der aktuellen Datenlage nicht<br />
davon auszugehen, dass Patienten von<br />
einer Antikoagulation profitieren [25]. Bei<br />
ambulanten Patienten mit hohem Risiko<br />
für eine venöse Thrombo embolie kann<br />
jedoch, je nach Risikoprofil, eine prophylaktische<br />
Antikoagulation erwogen werden<br />
(Tabelle 1) [25].<br />
Besondere Empfehlungen für eine Antikoagulation<br />
bei Patienten mit arterieller<br />
Thrombose aufgrund einer COVID-19-<br />
Infektion bestehen nicht. Vielmehr bestimmt<br />
das Ausmass des operativen/interventionellen<br />
Eingriffs die nachfolgende<br />
Antikoagulationsstrategie.<br />
Letztlich bleibt in der täglichen Praxis<br />
die Durchführung einer Antikoagulation<br />
oftmals eine patientenindividuelle Entscheidung<br />
unter Einbezug des Blutungsund<br />
Thromboserisikos. Die multifaktoriell<br />
bedingte Entstehung der Thrombosen<br />
sowie die unterschiedliche Ausprägung<br />
der COVID-19-Infektion stellen für Kliniker<br />
dabei eine Herausforderung im Therapieentscheid<br />
dar.<br />
Tabelle 1. Antikoagulationsmanagement bei gesicherter COVID-19-Infektion. VTE: venöse Thromboembolie, NMH: niedermolekulares Heparin,<br />
FPX: Fondaparinux, UFH: unfraktioniertes Heparin [25].<br />
Aufenthaltsort<br />
VTE-Risiko<br />
ambulante Behandlung<br />
– Keine generelle prophylaktische oder therapeutische Antikoagulation<br />
bei alten, schwer kranken teils immobilen Patienten<br />
– Prophylaxe möglich Enoxaparin 1×4000 IE sc.<br />
Normalstation VTE-Risiko hoch – Frühe Antikoagulation mit NMH, FPX oder UFH in prophylaktischer<br />
Dosierung bei niedrigem Blutungsrisiko therapeutische Antikoagulation<br />
erwägen<br />
VTE-Risiko niedrig<br />
– Standardmässige medikamentöse Thromboembolieprophylaxe<br />
Intensivstation<br />
ambulant nach<br />
Hospitalisation<br />
VTE-Risiko niedrig<br />
VTE-Risiko hoch<br />
– Standardmässige medikamentöse Thromboembolieprophylaxe<br />
– Engmaschiges Monitoring<br />
– Keine therapeutische Antikoagulation, ohne spezifische Indikation<br />
(z.B. LE)<br />
– Keine prophylaktische oder therapeutische Antikoagulation<br />
– Prophylaktische Antikoagulation erwägen<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 51
Perspectives<br />
Bibliographie<br />
[1] Birocchi S., Manzoni M.,<br />
Podda G. M., Casazza G., Cattaneo<br />
M. High rates of pulmonary artery<br />
occlusions in COVID-19. A<br />
meta-analysis. Eur J Clin Invest.<br />
2021; 51(1): e13433.<br />
[2] Cattaneo M., Bertinato<br />
E. M., Birocchi S., Brizio C.,<br />
Malavolta D., Manzoni M., et al.<br />
Pulmonary Embolism or<br />
Pulmonary Thrombosis in<br />
COVID-19? Is the Recommendation<br />
to Use High-Dose Heparin for<br />
Thromboprophylaxis Justified?<br />
Thromb Haemost. 2020; 120 (8):<br />
1230–2.<br />
[3] Obi A. T., Tignanelli C.<br />
J., Jacobs B. N., Arya S., Park P. K.,<br />
Wakefield T. W., et al. Empirical<br />
systemic anticoagulation is<br />
associated with decreased venous<br />
thromboembolism in critically ill<br />
influenza A H1N1 acute respiratory<br />
distress syndrome patients. J Vasc<br />
Surg Venous Lymphat Disord.<br />
2019; 7 (3): 317–24.<br />
[4] Bellosta R, Luzzani L,<br />
Natalini G, Pegorer M. A., Attisani<br />
L., Cossu L. G., et al. Acute limb<br />
ischemia in patients with<br />
COVID-19 pneumonia. J Vasc Surg.<br />
2020; 72 (6): 1864–72.<br />
[5] Varga Z., Flammer A. J.,<br />
Steiger P., Haberecker M.,<br />
Andermatt R., Zinkernagel A. S., et<br />
al. Endothelial cell infection and<br />
endotheliitis in COVID-19. Lancet.<br />
2020; 395 (10234): 141–8.<br />
[6] Hamming I., Timens W.,<br />
Bulthuis M. L., Lely A. T., Navis G.,<br />
van Goor H. Tissue distribution<br />
of ACE2 protein, the functional<br />
receptor for SARS coronavirus.<br />
A first step in understanding SARS<br />
pathogenesis. J Pathol. 2004; 203<br />
(2): 631–7.<br />
[7] Zou X., Chen K., Zou J.,<br />
Han P., Hao J., Han Z. Single-cell<br />
RNA-seq data analysis on the<br />
receptor ACE2 expression reveals<br />
the potential risk of different<br />
human organs vulnerable to<br />
2019-nCoV infection. Front Med.<br />
2020; 14 (2): 185–92.<br />
[8] Dong B., Zhang C., Feng<br />
J. B., Zhao Y. X., Li S. Y., Yang Y. P.,<br />
et al. Overexpression of ACE2<br />
enhances plaque stability in a<br />
rabbit model of atherosclerosis.<br />
Arterioscler Thromb Vasc Biol.<br />
2008; 28 (7): 1270–6.<br />
[9] Li M. Y., Li L., Zhang Y.,<br />
Wang X. S. Expression of the<br />
SARS-CoV-2 cell receptor gene<br />
ACE2 in a wide variety of human<br />
tissues. Infect Dis Poverty.<br />
2020; 9 (1): 45.<br />
[10] Ma S., Sun S., Li J., Fan<br />
Y., Qu J., Sun L., et al. Single-cell<br />
transcriptomic atlas of primate<br />
cardiopulmonary aging. Cell Res.<br />
2021; 31 (4): 415–32.<br />
[11] Lodigiani C., Iapichino<br />
G., Carenzo L., Cecconi M.,<br />
Ferrazzi P., Sebastian T., et al.<br />
Venous and arterial thromboembolic<br />
complications in COVID-19<br />
patients admitted to an academic<br />
hospital in Milan, Italy. Thromb<br />
Res. 2020; 191: 9–14.<br />
[12] Bansal M. Cardiovascular<br />
disease and COVID-19. Diabetes<br />
Metab Syndr. 2020; 14 (3): 247–50.<br />
[13] Mohamed M. F. H.,<br />
Al-Shokri S. D., Shunnar K. M.,<br />
Mohamed S. F., Najim M. S.,<br />
Ibrahim S. I., et al. Prevalence of<br />
Venous Thromboembolism in<br />
Critically Ill COVID-19 Patients:<br />
Systematic Review and Meta-<br />
Analysis. Front Cardiovasc Med.<br />
2020; 7: 598–846.<br />
[14] Jimenez D., Garcia-<br />
Sanchez A., Rali P., Muriel A.,<br />
Bikdeli B., Ruiz-Artacho P., et al.<br />
Incidence of VTE and Bleeding<br />
Among Hospitalized Patients<br />
With Coronavirus Disease 2019: A<br />
Systematic Review and Meta-analysis.<br />
Chest. 2021; 159 (3): 1182–96.<br />
[15] Liu Y., Cai J., Wang C.,<br />
Jin J., Qu L. A systematic review<br />
and meta-analysis of incidence,<br />
prognosis, and laboratory<br />
indicators of venous thromboembolism<br />
in hospitalized patients<br />
with coronavirus disease 2019. J<br />
Vasc Surg Venous Lymphat Disord.<br />
2021; 9 (5): 1099–111 e6.<br />
[16] Klok F. A., Kruip M.,<br />
van der Meer N. J. M., Arbous M. S.,<br />
Gommers D., Kant K. M., et al.<br />
Confirmation of the high<br />
cumulative incidence of thrombotic<br />
complications in critically<br />
ill ICU patients with COVID-19:<br />
An updated analysis. Thromb Res.<br />
2020; 191: 148–50.<br />
[17] de Roquetaillade C.,<br />
Chousterman B. G., Tomasoni D.,<br />
Zeitouni M., Houdart E., Guedon<br />
A., et al. Unusual arterial<br />
thrombotic events in Covid-19<br />
patients. Int J Cardiol. 2021;.<br />
323: 281–4.<br />
[18] Cho S. M., Premraj L.,<br />
Fanning J., Huth S., Barnett A.,<br />
Whitman G., et al. Ischemic<br />
and Hemorrhagic Stroke Among<br />
Critically Ill Patients With<br />
Coronavirus Disease 2019:<br />
An International Multicenter<br />
Coronavirus Disease 2019 Critical<br />
Care Consortium Study. Crit Care<br />
Med. 2021; 49 (12): e1223–e33.<br />
[19] Merkler A. E., Parikh N.<br />
S., Mir S., Gupta A., Kamel H., Lin<br />
E., et al. Risk of Ischemic Stroke in<br />
Patients With Coronavirus Disease<br />
2019 (COVID-19) vs Patients With<br />
Influenza. JAMA Neurol. 2020;<br />
77(11): 1–7.<br />
[20] Cheruiyot I., Kipkorir V.,<br />
Ngure B., Misiani M., Munguti J.,<br />
Ogeng’o J. Arterial Thrombosis in<br />
Coronavirus Disease 2019 Patients:<br />
A Rapid Systematic Review. Ann<br />
Vasc Surg. 2021; 70: 273–81.<br />
[21] Fournier M., Faille D.,<br />
Dossier A., Mageau A., Nicaise<br />
Roland P., Ajzenberg N., et al.<br />
Arterial Thrombotic Events in<br />
Adult Inpatients With COVID-19.<br />
Mayo Clin Proc. 2021; 96(2):<br />
295–303.<br />
[22] Lopes R. D., de Barros E.<br />
S. P. G. M., Furtado R. H. M,<br />
Macedo A. V. S., Bronhara B.,<br />
Damiani L. P., et al. Therapeutic<br />
versus prophylactic anticoagulation<br />
for patients admitted to<br />
hospital with COVID-19 and<br />
elevated D-dimer concentration<br />
(ACTION): an open-label,<br />
multicentre, randomised,<br />
controlled trial. Lancet. 2021; 397<br />
(10291): 2253–63.<br />
[23] Investigators A,<br />
Investigators AC-a, Investigators<br />
R-C, Lawler P. R., Goligher E. C.,<br />
Berger J. S., et al. Therapeutic<br />
Anticoagulation with Heparin in<br />
Noncritically Ill Patients with<br />
Covid-19. N Engl J Med. 2021; 385<br />
(9): 790–802.<br />
[24] Investigators R-C,<br />
Investigators AC-a, Investigators A,<br />
Goligher E. C., Bradbury C. A.,<br />
McVerry B. J., et al. Therapeutic<br />
Anticoagulation with Heparin in<br />
Critically Ill Patients with Covid-19.<br />
N Engl J Med. 2021; 385 (9): 777–89.<br />
[25] Kluge S., U. J., T. W. S3<br />
Leitlinie Empfehlung zur<br />
stationären Therapie von Patienten<br />
mit COVID-19. AWMF Register <strong>Nr</strong><br />
113/001 [Internet]. 2022.<br />
52<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Perspektiven<br />
Aus der «Therapeutischen Umschau»* – Übersichtsarbeit<br />
Leitsymptome<br />
bei proktologischen<br />
Erkrankungen und<br />
allgemeine Massnahmen<br />
Manfred Essig, Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie, Spital Tiefenau, Insel Gruppe AG, Bern<br />
Gemeinsamkeit von proktologischen<br />
Erkrankungen ist eine<br />
hohe Selbstmedikation und<br />
eine oft eine längere Leidensgeschichte<br />
zum Schutz der Intimsphäre.<br />
Deshalb ist bei Andeutungen von Beschwerden<br />
ein gezieltes Nachfragen nötig.<br />
Patienten mit proktologischen Erkrankungen<br />
haben eine Anamnese mit gut zu<br />
erfragenden Leitsymptomen. Dabei ist<br />
wichtig zu verstehen, dass im umgangssprach<br />
lichen Verständnis alle Symptome<br />
von Patienten unter dem Begriff: «Ich habe<br />
Probleme mit den Hämorrhoiden» subsummiert<br />
werden. Der umgangssprachlich<br />
verwendete Begriff «Hämorrhoidenbeschwerden»<br />
lässt sich in fünf wesentliche<br />
Leitsymptome aufgliedern, mit denen rein<br />
anamnestisch eine breite Differentialdiagnose<br />
abgebildet werden kann.<br />
Der Leidensdruck ist bei vielen Patienten<br />
oft gut durch einen stabilen Allgemeinzustand<br />
kompensiert, weshalb eine Frage:<br />
«Wie geht es Ihnen?» meist mit «gut» beantwortet<br />
wird.<br />
Initial ist eine grobe Einschätzung<br />
von proktologischen Erkrankungen wichtig.<br />
Ob es sich eher um einen akut benignen<br />
Verlauf, wie zum Beispiel die häufige<br />
symptoma tische Vergrösserung des inneren<br />
Hämorrhoidalplexus mit Blutungen<br />
handelt, oder ob es sich um akut lebensbedrohliche<br />
Zustände handelt, wie zum<br />
Beispiel eine sich abzeichnende Beckenphlegmone.<br />
* Der Artikel erschien ursprünglich in der<br />
«Therapeutischen Umschau» (2021), 78(9),<br />
489–493.<br />
Nach einer allgemeinen Anamnese,<br />
welche B-Symptome, Ernährungsgewohnheiten,<br />
Genussmittel und Drogenkonsum,<br />
Bauchsymptome wie Durchfall<br />
oder Obstipation, Medikamenteneinnahmen<br />
und die Sexualanamnese des letzten<br />
Jahres erfragt, kommen wir zu den Leitsymptomen:<br />
1. Haben sie Blut im Stuhl? Wenn ja, ist es<br />
nur am Papier oder nach dem Stuhlgang<br />
verteilt auf die ganze Toi lettenschüssel?<br />
2. Haben sie Schmerzen im Analbereich?<br />
Wenn ja, während des Stuhlgangs oder<br />
den ganzen Tag?<br />
3. Leiden sie unter Juckreiz? Wenn ja, zu<br />
welcher Tageszeit / Jahreszeit, essensabhängig,<br />
bestehen weitere Symp tome?<br />
4. Haben sie ein Fremdkörpergefühl?<br />
Wenn ja, wie lange besteht das und wie<br />
beeinträchtigt sie das in ihrer gesamten<br />
Lebensqualität?<br />
5. Haben sie unwillkürlichen Stuhlabgang<br />
/ drang? Wenn ja, haben sie Geburten<br />
oder Operationen hinter sich<br />
leiden sie an einer neurologischen Erkrankung<br />
oder leiden sie an Rückenmarksveränderungen<br />
oder -schädigungen,<br />
hatten sie Operationen im<br />
Anal- / Beckenbereich?<br />
Leitsymptom Blutung<br />
Bestehen nur anale Frischblutabgänge ohne<br />
Schmerzen, ist dies ein häufiges Symptom<br />
von pathologisch vergrösserten inneren<br />
Hämorrhoiden und damit statistisch<br />
das das häufigste Symptom des klassischen<br />
inneren Hämorrhoidalleidens (siehe<br />
Abb. 1a – c) [1, 2].<br />
Dabei spielt das Alter des Patienten<br />
für die nosologische Zuordnung eine wesentliche<br />
Rolle in der statischen Verteilung.<br />
Es treten jedoch Tumoren, sexuell<br />
übertragbare Erkrankungen, entzündliche<br />
Darmerkrankungen in jedem Lebensalter,<br />
jedem Geschlecht und jeder Ethnie<br />
und jedem Sozialstatus auf. Auch wenn<br />
die statistische Verteilung der Symptome<br />
mit dem Alter klar zunimmt, ist es sehr<br />
einschneidend, wenn eine therapierbare<br />
Läsion im jüngeren Lebensalter verpasst<br />
wird.<br />
Blutungen können sich bei fast allen<br />
analen Erkrankungen zeigen, allerdings<br />
in einer differenzierten Gewichtung mit<br />
anderen Symptomen [3].<br />
Innere Hämorrhoiden haben typisch<br />
Frischblut und sonst seltener Symptome,<br />
je nach Stadium wenig Juckreiz, Soiling,<br />
Schmerzen sind eher selten (allenfalls bei<br />
zusätzlichen Entzündungen und Thrombosierungen<br />
bei höhergradigen Hämorrhoidalleiden).<br />
Die Blutmenge kann leicht<br />
bis anämisierend sein, je nach Stuhlkonsistenz<br />
und Konstitution sowie unter Gerinnungshemmung.<br />
Tumoren und deren Vorstufen im<br />
Anal bereich können sich mit Frischblut<br />
zuerst manifestieren, haben aber oft bei<br />
Cave: Jede neu aufgetretene anale<br />
Blutung muss ernst genommen werden<br />
und bedarf einmal einer Standortbestimmung<br />
mittels Endoskopie,<br />
am besten Koloskopie und Anoskopie!<br />
54<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Perspektiven<br />
subtilen Nachfragen Kombinationen mit<br />
Fremdkörpergefühl, Urgesymptomatik,<br />
Gefühl der unvollständigen Entleerung.<br />
Jede sexuell übertragbare Erkrankung<br />
(STD), jede entzündliche Darmerkrankung<br />
kann anale Blutungen hervorrufen<br />
dies können oft auch Schmierblutungen<br />
sein. Wenige Blutauflagerungen am Toilettenpapier<br />
können durch Ekzeme, entzündete<br />
Marisken oder durch schmerzhafte<br />
Fissuren hervorgerufen werden.<br />
Die Aussage «Frischblutabgang» ist<br />
wie Vieles in der Medizin von relativer<br />
Natur und hängt von der Erfahrung des<br />
Beschreibers ab, so können Divertikelblutungen,<br />
je nach Intensität von koaguliertem<br />
Blut bis zum massiven analen Frischblutabgang<br />
das Erscheinungsbild prägen.<br />
Aus ärztlich-ethischer Sicht ist der<br />
Leidensdruck bei analen Blutungen und<br />
die Angst des Patienten oft ein Taktgeber<br />
zur Intensivierung der Diagnostik – aus<br />
gastroenterologischer Sicht sollte jeder<br />
Patient zur Entspannung seiner Angst<br />
zum Ausschluss relevanter Differentialdiagnosen<br />
und zur juristischen Entlastung<br />
des Arztes einer Endoskopie zugeführt<br />
werden [4].<br />
Leitsymptom Schmerz<br />
Anale Schmerzen beeinträchtigen in den<br />
meisten Fällen das Allgemeinbefinden<br />
(siehe Abb. 2a – c).<br />
Schmerzen, welche bei der Defäkation<br />
auftreten und messersticharig sind<br />
und dann noch bis Stunden nach der Defäkation<br />
bestehen können, sind ein klassisches<br />
Leitsymptom der akuten Analfissur.<br />
Die Schmerzen können derartig stark sein,<br />
dass eine Vermeidung des Toilettengangs<br />
mit Folge von Obstipation durch den Patienten<br />
induziert wird. Ursächlich für die<br />
Entstehung der Analfissur ist meist eine<br />
leichte lokale Inflammation mit Dehnung<br />
durch harten Stuhlgang. Die Fissur wird<br />
dabei durch den schmerz-reflektorisch erhöhten<br />
Analsphinktertonus, welche den<br />
Blutabfluss behindert, verlängert.<br />
Schmerzen bei entzündlichen Darmerkrankungen<br />
können nach der Defäkation<br />
kurzzeitig besser werden. Meistens<br />
werden jedoch anale Schmerzen bei der<br />
Defäkation kurzzeitig intensiviert.<br />
Schmerzen, welche unabhängig von<br />
der Defäkation bestehen, sind oft mit<br />
Fremdkörpergefühl kombiniert. Hier ist<br />
an erster Stelle die Thrombose der äusseren<br />
Analvenen zu erwähnen. Diese entsteht<br />
oft unvermittelt innerhalb von wenigen<br />
Stunden, ausgelöst durch Pressen,<br />
langes Sitzen, Lastenheben und vieles<br />
anderes.<br />
Dauerschmerz mit meist leichten bis<br />
schweren und schwersten Allgemeinsymptomen<br />
können durch Abszesse ausgelöst<br />
werden.<br />
Anale Schmerzen erfordern eine lokale<br />
Inspektion und rektal digitale Untersuchung<br />
als Minimum. Bei Unklar heiten<br />
und vor allem bei B-Symptomen ist eine<br />
Bildgebung (CT Becken) zum Ausschluss<br />
von Abszessen nötig.<br />
Leitsymptom Juckreiz<br />
Der Häufigkeit nach spielen hygienische<br />
Aspekte oft kombiniert mit Adipositas eine<br />
grosse Rolle. Klassische Ursachen sind<br />
Ekzeme (siehe Abb. 3a – c) [5].<br />
Bei Juckreiz ohne erkennbare äussere<br />
Ursachen kann pragmatisch an eine Wurminfektion<br />
gedacht werden. Differenzialdiagnostisch<br />
machen sexuell übertragbare<br />
Krank heiten und andere entzündliche Erkrankungen<br />
ebenso einen wesentlichen<br />
Teil aus.<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
Abbildung 1a – c. Bei Blutungen: a. Hämorrhoiden Grad II; b. Rektumkarzinom; c. Melanom im Analbereich.<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
Abbildung 2a – c. Bei Schmerzen: a. Analfissur; b. Abszess; c. Thrombose.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 55
Perspektiven<br />
Analschleimhautprolaps und innere<br />
Hämorrhoiden ab Grad II können durch<br />
eine unphysiologische Hypersalivation<br />
ebenfalls zu Hautirritationen mit Juckreiz<br />
führen.<br />
Eine Hauptursache für Juckreiz ist<br />
die Anwendung von alkoholhaltigen, vasodilatierenden<br />
Reinigungstüchern oder<br />
die Verwendung von allergisierenden,<br />
topischen Stoffen wie Umweltschutztoilettenpapier<br />
(Herstellung aus alten Zeitungen<br />
mit Druckerschwärze) oder auch<br />
Kamillenextrakte können eine allergisierende<br />
Wirkung haben.<br />
Juckreiz erfordert im Minimum eine<br />
lokale Inspektion und bei Unklarheit eine<br />
proktologische Untersuchung.<br />
Leitsymptom Fremdkörpergefühl<br />
Hier kommen alle Tumorarten und entzündlichen<br />
Erkrankung in Betracht (siehe<br />
Abb. 4a – c).<br />
Dieses Symptom hat eine breite Differentialdiagnose<br />
und bedarf einer in tensiven<br />
Abklärung mittels Endoskopie und bis und<br />
mit MR-Diagnostik oder Endosonographie<br />
des Beckens und Analkanales.<br />
Leitsymptome Inkontinenz<br />
oder Urge-Symptome<br />
Patienten mit Inkontinenz kommen oft<br />
spät zur Abklärung zum Spezialisten, da<br />
die Symptome meist langsam auftreten<br />
und eine Art damit umzugehen etabliert<br />
ist (von häufigen Toilettenbesuchen, Einlagen<br />
tragen, bis zur sozialen Isolation).<br />
Typische einfach zu verstehende Pathophysiologie<br />
ist eine neuromuskuläre<br />
Störung des komplexen Sphinktersystems,<br />
die jede Stufe betreffen kann. Zum<br />
einen können entzündliche Irritationen<br />
zum Beispiel bei einer beginnenden Colitis<br />
ulcerosa im Rectum zu Urge-Symptomen<br />
führen. Zum anderen kann jede<br />
Schädigung des Sphinkters selbst (jede<br />
Geburt, ob normal, Sectio oder traumatisch;<br />
jeder operative Eingriff im Analbereich)<br />
zum Verlust von kontraktilen<br />
Fasern führen. Jede neurogene Schädigung<br />
kann zur Inkontinenzsymptomen<br />
führen (MS, Rückenmarksoperationen,<br />
Parkinson, Diabetes, Traumata, Noxen<br />
wie Alkohol). Meistens kommen relevante<br />
Störungen durch die Kombination von<br />
Schädigung mit zunehmendem Alter vor.<br />
Zusammenfassung<br />
Neben einer allgemeinen Anamnese<br />
gibt es bei proktologischen Erkrankungen<br />
fünf gezielt zu erfragende<br />
Leitsymptome, welche das diagnostische<br />
Prozedere bestimmen. Neben<br />
Allgemeinmassnahmen wie Lifestyle<br />
und Basisthera-pien kommen einfach<br />
anzuwendende Hinweise mit nicht<br />
relevanten Nebenwirkungen zur<br />
Anwendung.<br />
Abstract: Leading<br />
symptoms in proctological<br />
diseases and<br />
general measures<br />
In addition to a general anamnesis,<br />
proctological diseases are characterised<br />
by five specific leading symptoms that<br />
determine the diagnostic procedure.<br />
In addition to general measures such as<br />
lifestyle and basic therapies, easy-touse<br />
tips with no relevant side effects are<br />
explained.<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
Abbildung 3a – c. Zu Juckreiz: a. Ekzem; b. Analkarzinom; c. Condylomata acuminata.<br />
a)<br />
b)<br />
c)<br />
Abbildung 4a – c. Bei Fremdkörpergefühl: a. Rektumtumor; b. gutartige Hypertrophe Analpapille; c. Morbus Crohn Fisteln.<br />
56<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Perspektiven<br />
Grundsätzlich bedürfen die Inkontinenz<br />
und Urge-Symptomatik einer Abklärung<br />
beim Spezialisten oder einem proktologischen<br />
Zentrum. Der Leidensdruck<br />
des Patienten ist hier der Taktgeber.<br />
Therapeutische Basismassnahmen<br />
bei proktologischen Symptomen<br />
Der Grundsatz, dass eine Stuhlregulation<br />
von maximal drei Mal täglich und minimal<br />
drei Mal wöchentlich angestrebt wird,<br />
ist eine Richtlinie, die vom Wohlbefinden<br />
des Patienten bestimmt wird und kann<br />
deshalb auch eine grössere Bandbreite haben<br />
[6].<br />
Ziel ist eine schmerzfreie, geformte,<br />
Defäkation von hellbrauner Farbe, welche<br />
kontrolliert werden kann, aber nicht unterdrückt<br />
werden sollte.<br />
Viele gut durchgeführte Studien bestätigen<br />
den Benefit von klassischen Lifestyleinterventionen.<br />
1. Ausreichende Bewegung (WHO-Empfehlung;<br />
www.euro.who.int)<br />
2. Ernährung im mediterranen Sinn (nicht<br />
Pizza, nicht Pasta – vornehmlich pflanzlich;<br />
www.thelancet.com – mediterranean<br />
diet)<br />
3. Beckenbodentraining zur Motivation<br />
unter physiotherapeutischer Anleitung<br />
4. Anstrebung eines normalen BMI<br />
5. Pragmatischer Versuch mit Flavonoiden,<br />
um den Blutfluss im kleinen Becken<br />
zu regulieren (Daflon®)<br />
Als Basismassnahmen kann bei den Leitsymptomen<br />
nach oder parallel zu den<br />
empfohlenen Abklärungen und spezifischen<br />
Therapien Folgendes allgemein<br />
empfohlen werden.<br />
Leitsymptom Blutung<br />
1. Bei ursächlichem Hämorrhoidalleiden<br />
aller Grade – Beckenbodentraining, Lifestyleinterventionen<br />
2. Stuhlregulation mit Leinsamen und<br />
Floh samen<br />
3. Hygiene mit Wasser und weichen weissem<br />
Papier<br />
4. Keine langen Sitzzeiten auf der Toilette<br />
Leitsymptom Schmerz<br />
1. Analgesie bei Thrombosen mit Novaminsulfon,<br />
oder nicht steroidalen Antirheumatika<br />
(NSAR), oder topisch mit<br />
Lokalanästhetika (Emla®), die Stichinzision<br />
bringt bei der Gesamtschau<br />
über eine Woche keinen Vorteil gegenüber<br />
der konservativen Therapie.<br />
2. Bei Fissuren warme Sitzbäder abends<br />
zur Relaxation der Muskulatur, topisch<br />
Ca-Antagonisten vom Typ Nifedipinsalbe<br />
zwei Mal täglich 0,2 %<br />
3. Stuhlregulation<br />
Leitsymptom Juckreiz<br />
1. Anale Hygiene<br />
2. Lifestyleintervention<br />
3. Bei pruritus sine materie: pragmatischer<br />
Versuch mit Mebendazol (Vermox®)<br />
4. Meiden von Feuchttüchern (Allergisierung,<br />
Vasodilatation)<br />
5. Kein Umweltschutztoilettenpapier (Druckerschwärze)<br />
6. Topische Hautpflege mit Mandelöl,<br />
Zinksalbe (bei Rissen)<br />
Leitsymptom Fremdkörpergefühl<br />
1. Stuhlregulation<br />
2. Bei Nachweis von unspezifischen entzündlichen<br />
Veränderungen kurzzeitige<br />
pragmatische Therapie mit Mesalazin<br />
Leitsymptom Inkontinenz / Urge<br />
1. Hygiene<br />
2. Beckenbodentraining Biofeedback unter<br />
geschulter physiotherapeutischer<br />
Leitung<br />
3. Vorbeugung durch Schwangerschaftsgymnastik<br />
4. Vermeidung von relativ indizierten<br />
operativen Eingriffen im Analbereich<br />
Literatur<br />
[1] Kuehn HG, Gebbensleben O, Hilger<br />
Y, Rohde H. Relationship between anal<br />
symptoms and anal findings. Int J Med Sci.<br />
2009;6:77 – 84.<br />
[2] Gallo G, Martellucci J, Sturiale<br />
A, Clerico G, Milito G, Marino F, et al. Consensus<br />
statement of the Italian society of<br />
colorectal surgery (SICCR): management<br />
and treatment of hemorrhoidal disease.<br />
Tech Coloproctol. 2020;24:145 – 164.<br />
[3] Jensen SL, Harling H,<br />
Arseth-hansen P, Tange G. The natural<br />
history of symptomatic haemorrhoids.<br />
Int J Colorectal Dis. 1989;4:41 – 4.<br />
[4] Pfenninger JL, Surrell J. Nonsurgical<br />
treatment options for internal<br />
hemorrhoids. Am Fam Physician.<br />
1995;52:821 – 34.<br />
[5] Kreuter AJ. Proctology – diseases<br />
of the anal region. Dtsch Dermatol<br />
Ges. 2016;14:352 – 73. quiz 372 – 5.<br />
[6] Alonso-Coello P, Zhou Q, Martinez-Zapata<br />
MJ, Mills E, Heels Ansdell D,<br />
Johanson JF, et al. Meta-analysis of flavonoids<br />
for the treatment of haemorrhoids.<br />
Br J Surg. 2006;93:909 – 20.<br />
Prof. Dr. med. Anne Leuppi-Taegtmeyer, PhD<br />
Oberärztin Klinische Pharmakologie<br />
und Toxikologie<br />
Leiterin Regionales Pharmacovigilance Zentrum<br />
Universitätsspital Basel<br />
Petersgraben 4<br />
4031 Basel<br />
Anne.Leuppi-Taegtmeyer@usb.ch<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 57
©Pierre-Yves Massot<br />
Lachen und Träume<br />
für unsere Kinder im Spital<br />
Jede Woche erhalten die Kinder im Spital Besuch von<br />
den Traumdoktoren.<br />
Ihre Spende schenkt Lachen. Herzlichen Dank.<br />
www.theodora.ch<br />
IBAN CH51 0900 0000 1006 1645 5
Perspektiven<br />
Der besondere Ort<br />
Ein einzigartiges<br />
Naturjuwel<br />
Fabian Kraxner, Redaktionsmitglied <strong>vsao</strong> <strong>Journal</strong><br />
Mein Lieblingsort liegt<br />
bloss 900 Längs- und<br />
80 Höhenmeter entfernt<br />
von meiner Wohnadresse<br />
im attraktiven Zürcher Bezirk Affoltern.<br />
Der badetaugliche Naturweiher in<br />
Hedingen ist ein friedvoller, idyllischer<br />
und kraftspendender Ort. Er ist zu jeder<br />
Jahreszeit facettenreich und bei allen<br />
Generationen beliebt, ein kleines Naturjuwel<br />
fernab von Trubel und Wirbel.<br />
Nachstehend schildere ich einige Impressionen<br />
im Jahresverlauf.<br />
Wenn im Herbst die bunten Blätter<br />
von den Bäumen fallen, die Tage kürzer<br />
und die Nächte länger werden, Morgennebel<br />
über dem Wasser liegt, erscheint<br />
uns der Weiher mit seinem Schilf- und<br />
Wiesenufer, den Büschen und Bäumen<br />
als mystischer und kraftvoller Ort.<br />
Die Stimmung erinnert mich an ein<br />
Gedicht von Eduard Mörike mit dem Titel<br />
«Septembermorgen»:<br />
Bild: zvg<br />
Im Nebel ruhet noch die Welt,<br />
Noch träumen Wald und Wiesen:<br />
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,<br />
Den blauen Himmel unverstellt,<br />
Herbstkräftig die gedämpfte Welt<br />
In warmem Golde fliessen.<br />
Raureif bedeckt Bäume und Sträucher<br />
rund um den Weiher, Schnee überpudert<br />
den Boden. Der Winter hat sich angekündigt.<br />
Die Luft ist kalt, und wenn die<br />
Sonnenstrahlen durch die Bäume<br />
scheinen, ist dies ein erquickender<br />
Moment. Immer wieder ist der Weg zum<br />
und um den Weiher ein lohnenswerter<br />
Winterspaziergang, wohltuend für Körper<br />
und Geist. Bei genügend Schnee besteht<br />
die Möglichkeit, auf der nahe gelegenen<br />
Hochebene Feldenmaas Langlauf zu<br />
betreiben.<br />
Die Tage werden spürbar länger,<br />
die Vögel zwitschern es laut von den<br />
Bäumen, die Knospen an Büschen und<br />
Bäumen spriessen, erste Blümchen<br />
erscheinen aus dem Boden. Ja, es stimmt:<br />
Der Frühling ist da. Am Weiher wirds<br />
belebter; Kinder und Erwachsene spielen,<br />
lachen und diskutieren im Restaurant<br />
oder beim gemeinsamen Picknick.<br />
Die Wärme des Sommers, die grosszügige<br />
Liegewiese sowie die familiäre<br />
Atmosphäre locken Bade- und Sonnenliebhaber<br />
zum Weiher. Das gemütliche,<br />
feine Restaurant freut sich ebenso darüber.<br />
Es wird geplanscht, geschwommen<br />
oder ins erfrischende Nass gesprungen.<br />
Ganz persönlich freue ich mich auf den<br />
«Abendschwumm» am Ende des Tages.<br />
Das Schwimmen Richtung Abendrot ist<br />
für mich eine unersetzliche Wohltat.<br />
Der Naturweiher ist aus Hedingen<br />
nicht wegzudenken. Er verbindet die<br />
gesamte Bevölkerung an einem wunderprächtigen<br />
Ort. Klein, aber fein, und dies<br />
zu jeder Jahreszeit.<br />
Fabian Kraxner<br />
ist seit 2021 Redaktionsmitglied<br />
des <strong>vsao</strong><br />
<strong>Journal</strong>s und Oberarzt<br />
in der Psychiatrie und<br />
Psychotherapie.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 59
mediservice<br />
Briefkasten<br />
Unfall mit Garagenauto –<br />
wie ist das versichert?<br />
Während einer Reparatur<br />
an meinem Fahrzeug<br />
stellte mir die Garage<br />
ein Ersatzauto zur<br />
Verfügung. Ohne mein Verschulden<br />
wurde ich in eine Kollision verwickelt.<br />
Wer bezahlt die Drittschäden und die<br />
Schäden am Garagenauto?<br />
Da Sie als Lenker des von der Garage zur<br />
Verfügung gestellten Autos kein Verschulden<br />
trifft, können sich die Garage<br />
(für die Bezahlung des Schadens am zur<br />
Verfügung gestellten Ersatzwagen) und<br />
allfällige andere Geschädigte direkt an<br />
den Haftpflichtversicherer des unfallverursachenden<br />
Autos wenden. Wir gehen<br />
davon aus, dass Ihnen die Garage den<br />
Ersatzwagen aufgrund einer vorgängigen<br />
Abmachung gegen Entgelt – eventuell zu<br />
einem reduzierten Preis – zur Verfügung<br />
stellte. Die Fahrzeugbenutzung erfolgte<br />
daher aufgrund eines Mietvertrages.<br />
Wurde Ihnen hingegen das Ersatzfahrzeug<br />
als Dienstleistung gratis abgegeben,<br />
würde es sich um eine Gebrauchsleihe<br />
handeln. Da Sie an der Kollision nachweislich<br />
keine Schuld trifft, können Sie<br />
hinsichtlich der Beschädigungen am<br />
gemieteten oder geliehenen Fahrzeug<br />
gegenüber der Garage den für beide<br />
Vertragssituationen nötigen Entlastungsbeweis<br />
erbringen. Sie sind somit in<br />
beiden Fällen gegenüber der Garage nicht<br />
entschädigungspflichtig.<br />
Direktes Forderungsrecht des<br />
Geschädigten<br />
Die Garage kann sich als geschädigte<br />
Partei aufgrund des im Strassenverkehrsgesetz<br />
verankerten direkten Forderungsrechtes<br />
unmittelbar an den Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer<br />
des ihr<br />
bekannten Schadenverursachers wenden.<br />
Dieser wird die Schadenerledigung<br />
aufgrund der klaren Verschuldenslage<br />
unverzüglich in die Wege leiten und<br />
schliesslich die ausgewiesenen Reparaturkosten<br />
übernehmen. Sollte die Garage<br />
für das beschädigte Fahrzeug eine<br />
Vollkasko-Versicherung besitzen, kann<br />
sie den Schaden unter Berücksichtigung<br />
des vertraglichen Selbstbehaltes auch<br />
über diese Versicherung abwickeln<br />
lassen. Die Vollkasko-Versicherung wird<br />
sich dann ihre Aufwendungen vom<br />
Haftpflichtversicherer des Verursachers<br />
zurückerstatten lassen. Auch den vertraglichen<br />
Vollkasko-Selbstbehalt kann die<br />
Garage vom Haftpflichtversicherer des<br />
Schadenverursachers zurückfordern.<br />
Schweizerischer Versicherungsverband<br />
(SVV)<br />
Bild: Adobe Stock<br />
60<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
Wir beraten Ärztinnen und Ärzte, weil wir sie gut verstehen.<br />
Lassen Sie sich von uns einen gratis Versicherungs-Check-Up<br />
verschreiben. Und danach sprechen wir über Ihre Personenversicherung,<br />
Sach- und Vermögensversicherung und Unfallversicherung.<br />
www.mediservice-<strong>vsao</strong>.ch
mediservice<br />
Fitter mit<br />
Klettern<br />
Sportklettern in der Halle ist so populär wie Krafttraining<br />
im Fitnesscenter und findet sogar im Schulsport statt. Weil ausser<br />
Muskelkraft auch Beweglichkeit, Gleichgewicht und mentale Power<br />
trainiert werden, gilt Klettern als Prävention.<br />
Kimberly Ann Zwygart, Spezialistin Bewegung bei santé24 / SWICA<br />
Klettern und Bouldern sind<br />
nicht nur im Trend, sondern<br />
mittlerweile etablierte Breitensportarten<br />
zum Aufbauen<br />
von Kraft, Beweglichkeit, gutem Gleichgewicht,<br />
mentaler Stärke und taktischem<br />
Geschick. Neben der Arm- und Schultermuskulatur<br />
werden dabei ganze Muskelschlingen<br />
inklusive der Rumpfmuskulatur<br />
aktiviert. Das Ganzkörpertraining<br />
schult auch die Bewegungskoordination.<br />
Haltung und auch das Körpergefühl verbessern<br />
sich.<br />
Boomender Freizeitsport für alle<br />
Nur wenige Sportarten haben sich in den<br />
letzten Jahren so stark entwickelt wie das<br />
Sportklettern. Gemäss Zahlen des Bundesamts<br />
für Sport aus dem Jahr 2021 betreiben<br />
3,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung<br />
die zur Sportart Klettern gehörenden<br />
Disziplinen Bouldern, Bergsteigen,<br />
Indoor-Klettern, Eisklettern, Freestyle<br />
und Freeclimbing. Während Klettern am<br />
Fels draussen das Naturerlebnis miteinschliesst,<br />
hat der Sport in der Halle den<br />
Vorteil, ganzjährig unabhängig von Wetterbedingungen<br />
praktiziert werden zu<br />
können.<br />
Beim Sportklettern dienen Seil und<br />
Haken üblicherweise nur als Sicherung<br />
und werden nicht für die Fortbewegung<br />
benutzt. Meistens wird in Zweierseilschaf-<br />
ten geklettert, wobei sich eine Person am<br />
Boden befindet und sichert, während die<br />
andere Person klettert. Bouldern ist Sportklettern<br />
in Absprunghöhe. Daher fehlen<br />
Sicherungsseil und Klettergurt. Eine Matte<br />
am Boden soll Stürze abfangen und<br />
Fussverletzungen verhindern. Weil der<br />
Bewegungsablauf beim Bouldern sehr<br />
komplex ist, muss die Route vorgängig<br />
geistig bewältigt werden. Konditionell ist<br />
in der Regel ein sehr hoher Krafteinsatz<br />
notwendig.<br />
Sicher unterwegs in der Kletterwand<br />
Der Klettersport ist grundsätzlich für jede<br />
Person geeignet. Lediglich ist Vorsicht geboten<br />
bei akuten Verletzungen oder Entzündungen.<br />
Diese sollten ärztlich abgeklärt<br />
werden, bevor man mit dem Klettern<br />
beginnt. Gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung<br />
bfu sind die Hauptunfallursachen<br />
beim Hallenklettern Ablenkung<br />
und falsche Sicherung. Um das Risiko zu<br />
minimieren, ist wichtig: Sicherungstechnik<br />
erlernen und die Knoten überprüfen<br />
lassen, mit einer Person klettern, der man<br />
vertraut, sich nicht ablenken lassen. Gutes<br />
Aufwärmen senkt das Verletzungsrisiko<br />
ebenfalls. Als Ausgleich zum Klettersport<br />
eignet sich zum Beispiel Schwimmen,<br />
also Ausdauertraining kombiniert<br />
mit Beweglichkeit. Ausdauertraining steigert<br />
die Leistungsfähigkeit, während die<br />
Beweglichkeit wichtig ist, damit die Muskeln<br />
geschmeidig und beweglich bleiben.<br />
Wertvolles Training auch für Kinder<br />
Klettern fördert auch die physische<br />
und psychische Gesundheit der Kinder.<br />
Es schult Motorik, Koordination und die<br />
räumliche Orientierungsfähigkeit, die<br />
Konzentration und stärkt das Selbstbewusstsein.<br />
Ab wann ein Kind klettern darf,<br />
hängt von seiner Entwicklung ab und von<br />
den Eltern, inwiefern sie das zulassen. Ein<br />
vierjähriges Kind kann auch spielerisch<br />
die Kletterwand «erkunden» und mit einem<br />
Seil von den Eltern abgesichert werden.<br />
Grundsätzlich liegt das ideale Einstiegsalter<br />
für das Bouldern bei sechs bis<br />
acht Jahren, da Kinder in diesem Alter in<br />
der Lage sind, Regeln zu befolgen. Sie sollten<br />
aber immer von einer volljährigen Begleitperson<br />
beaufsichtigt werden. Seit<br />
Klettern in den Lehrplan 21 der Volksschule<br />
aufgenommen wurde, lernen die Kinder<br />
vielerorts schon im Schulsport, wie man<br />
richtig und sicher klettert.<br />
Bilder: zvg; Adobe Stock<br />
62<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
SWICA unterstützt<br />
den Klettersport<br />
Seit 2015 besteht die Kollektivpartnerschaft<br />
zwischen der IGKA Interessengemeinschaft<br />
Kletteranlagen Schweiz<br />
für einen sicheren und qualitativ<br />
hochstehenden Indoor-Klettersport<br />
und SWICA. Über die Hälfte der 76<br />
Kletterhallen in der Schweiz haben<br />
einen Vertrag mit SWICA. Klettern<br />
und Bouldern gehören zu den gesundheitsfördernden<br />
Sportarten, die<br />
SWICA mit umfangreichen Gesundheitsförderungsbeiträgen<br />
unterstützt:<br />
Bei entsprechender Zusatzversicherung<br />
erhalten Kundinnen und Kunden<br />
von SWICA anerkannten Kletterhallen<br />
bis zu 600 Franken jährlich an ihr<br />
persönliches Kletterabonnement für<br />
ein, sechs oder zwölf Monate zurückerstattet.<br />
Mehrfache<br />
Prämien rabatte<br />
Als Mitglied von mediservice <strong>vsao</strong>asmac<br />
profitieren Sie bei SWICA dank<br />
Kollektivvertrag und BENEVITA<br />
Bonusprogramm von attraktiven<br />
Prämienrabatten auf Spital- und<br />
Zusatzversicherungen. Zudem unterstützt<br />
SWICA Ihre Aktivitäten in<br />
den Bereichen Bewegung, Ernährung<br />
und Entspannung mit bis zu<br />
800 Franken pro Jahr.<br />
www.swica.ch/de/mediservice<br />
SWICA ist zudem Partner der Kletterweltmeisterschaft<br />
<strong>2023</strong>, die vom<br />
1. bis 12. August in Bern stattfindet.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 63
mediservice<br />
Mobilität der<br />
Zukunft<br />
Elektromobilität, Car-Sharing, Multimodalität.<br />
Die Liste der Möglichkeiten und Trends im Bereich Mobilität ist lang –<br />
und sie wird länger. Während sich vor ein paar Jahren<br />
die Frage stellte, ob man das Auto, die öffentlichen Verkehrsmittel<br />
oder das Fahrrad nimmt, gibt es heute viel mehr Optionen und<br />
Variationsmöglichkeiten. Und die Innovationslust im Bereich Mobilität<br />
kommt dabei keineswegs zum Erliegen.<br />
Bild: zvg<br />
64<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
mediservice<br />
men und dabei auch zeitlich effizient zu<br />
handeln, funktioniert als Katalysator für<br />
diese Entwicklung. Als Entscheidungshilfe<br />
für die Wahl des Fortbewegungsmittels<br />
helfen zum Beispiel Faktoren wie<br />
Strecke, Verkehrsdichte oder Rushhour.<br />
Shared Mobility: mieten statt<br />
besitzen<br />
Um nahtlos und einfach ans Ziel zu kommen,<br />
stellt sich längst nicht mehr nur<br />
die Frage nach dem richtigen Gefährt,<br />
sondern auch, ob es ein eigenes oder ein<br />
gemietetes sein soll. «Sharing is caring.»<br />
Ob Autos, Fahrräder oder Roller, sie alle<br />
können einfach nach Bedarf gemietet<br />
werden. Zeit und Kosten für die Instandhaltung<br />
entfallen, abgerechnet wird kilometergenau.<br />
Wir zahlen nur, was wir nutzen<br />
und bleiben dabei stets flexibel.<br />
Gleichzeitig gibt es beruhigende Effekte<br />
auf Parkflächen und Verkehrsdichte. Die<br />
Umwelt fährt mit uns. Verlockend und<br />
auch clever, könnte man meinen. Und<br />
doch nutzen laut Swiss Mobility Monitor<br />
2022 weiterhin mehr als 75 Prozent der<br />
Schweizer das eigene Auto und nur 10 Prozent<br />
nutzen Car-Sharing als Alternative.<br />
Ähnlich gering ist die Anzahl Personen,<br />
die vorhaben, in den nächsten Monaten<br />
Car-Sharing-Angebote beruflich oder privat<br />
zu nutzen. Und das, obwohl unsere<br />
Autos laut Mobilitätsforschung 95 Prozent<br />
der Zeit ungenutzt herumstehen.<br />
Elektromobilität: Steckdose statt<br />
Zapfsäule<br />
Auch die Möglichkeiten der Elektromobilität<br />
werden aktuell noch nicht vom<br />
Grossteil der Schweizer Bevölkerung genutzt.<br />
Im Jahr 2022 handelte es sich<br />
gemäss Bundesamt für Statistik bei nur<br />
2,3 Prozent der immatrikulierten Personenwagen<br />
um Fahrzeuge mit Elektroantrieb.<br />
Der Grossteil der Autofahrer setzt<br />
nach wie vor auf den klassischen Benziner,<br />
gefolgt von Dieselmotoren.<br />
Gleichzeitig steigt aber die Zahl der<br />
Neuzulassungen von Elektroautos stark<br />
an. So wurden in der Schweiz 2021 im<br />
Vergleich zum Vorjahr 62,1 Prozent mehr<br />
MyWay: die kilometergenaue Autoversicherung<br />
Ideal für Personen, die nur bei Bedarf fahren: Eine kleine Grundgebühr – und dann<br />
zahlen Sie nur noch pro gefahrene Kilometer. Den bewährten Versicherungsschutz von<br />
Zurich geniessen Sie trotzdem rund um die Uhr.<br />
Unterwegs sein ist längst mehr,<br />
als von A nach B zu gelangen.<br />
Ob beruflich oder privat, jeder<br />
von uns bewegt sich regelmässig<br />
an verschiedene Orte. Zu Fuss<br />
zum Bahnhof und dann mit dem Zug weiter,<br />
einen E-Roller mieten und an der Bushaltestelle<br />
umsteigen oder doch direkt<br />
das Auto für den gesamten Weg nehmen?<br />
Inzwischen gibt es eine Fülle an Möglichkeiten,<br />
die sich zusätzlich noch kombinieren<br />
lassen. Verschiedene Fortbewegungsmittel<br />
für eine Wegstrecke nehmen – die<br />
sogenannte Multimodalität wird zunehmend<br />
attraktiver. Das Bedürfnis, bequem<br />
und ohne Hindernisse ans Ziel zu kommediservice<br />
<strong>vsao</strong>-Mitgliedschaft<br />
Dank Ihrer mediservice <strong>vsao</strong>-Mitgliedschaft<br />
geniessen Sie bei Zurich<br />
erstklassige Vorzüge.<br />
Besuchen Sie einfach online den<br />
Mitgliederbereich und entdecken<br />
Sie die Möglichkeiten:<br />
zurich.ch/de/partner/login<br />
Ihr Zugangscode: TqYy4Ucx<br />
Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch<br />
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr<br />
unter<br />
0800 33 88 33<br />
Bitte erwähnen Sie bei Ihrer Kontaktaufnahme<br />
mit Zurich immer Ihre<br />
mediservice <strong>vsao</strong>-Mitgliedschaft.<br />
Elektroautos neu in Verkehr gesetzt. Der<br />
Anstieg setzt sich auch 2022 fort, bleibt<br />
jedoch gesamthaft kaum spürbar. Die Einstellung<br />
der Bevölkerung zu neuen und<br />
alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten<br />
wirkt weiterhin zögerlich. Ob und wie<br />
weit sich der Blickwinkel öffnet, wird die<br />
Zukunft zeigen. Der Anstieg bei den Neuzulassungen<br />
von Elektroautos erlaubt jedoch<br />
den Eindruck, dass sich etwas tut.<br />
Fahren wir künftig autonom?<br />
Die abwartende Haltung gegenüber Car-<br />
Sharing und Elektromobilität verstärkt<br />
sich im Hinblick aufs autonome Fahren.<br />
Während Assistenzsysteme wie die Einparkhilfe<br />
sich grosser Beliebtheit er freuen,<br />
bleibt die Haltung gegenüber der Vision<br />
vom selbstfahrenden Auto reserviert. Früher<br />
gab es den Traum vom Fliegen. Heute<br />
wird am Fahren ohne Fahrer gearbeitet.<br />
Die Skepsis erscheint nicht völlig unbegründet<br />
angesichts der vielen technischen<br />
Herausforderungen. Die Fahrzeuge müssen<br />
standardisiert aufgesetzt werden und<br />
dann in individuellen, teils unvorhersehbaren<br />
Situationen bestehen. Welche konkreten<br />
Lösungen für diese Art der Komplexität<br />
bei der Mobilitätsinnovation realisierbar<br />
sind, ist an vielen Stellen noch offen.<br />
Wo wir hinwollen und wie ebenfalls.<br />
Eins ist sicher: Die Möglichkeiten werden<br />
weiterwachsen und unserem Bedürfnis<br />
nach Flexibilität und komfortabler Fortbewegung<br />
Rechnung tragen.<br />
Mehr dazu erfahren Sie online auf zurich.ch/myway<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 2/23 65
Impressum<br />
Kontaktadressen der Sektionen<br />
<strong>Nr</strong>. 2 • 42. Jahrgang • <strong>April</strong> <strong>2023</strong><br />
Herausgeber/Verlag<br />
AG<br />
VSAO Sektion Aargau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
mediservice <strong>vsao</strong>-asmac<br />
Bollwerk 10, Postfach, 3001 Bern<br />
Telefon 031 350 44 88<br />
journal@<strong>vsao</strong>.ch, journal@asmac.ch<br />
www.<strong>vsao</strong>.ch, www.asmac.ch<br />
Im Auftrag des <strong>vsao</strong><br />
Redaktion<br />
Catherine Aeschbacher (Chefredaktorin),<br />
Kerstin Jost, Fabian Kraxner, Maya Cosentino,<br />
Bianca Molnar, Patricia Palten, Léo Pavlopoulos,<br />
Lukas Staub, Anna Wang<br />
Geschäfts ausschuss <strong>vsao</strong><br />
Angelo Barrile (Präsident), Nora Bienz<br />
(Vizepräsidentin), Severin Baerlocher,<br />
Christoph Bosshard (Gast), Marius Grädel,<br />
Patrizia Kündig, Richard Mansky,<br />
Gert Printzen, Svenja Ravioli, Patrizia Rölli,<br />
Martin Sailer, Jana Siroka, Clara Ehrenzeller<br />
(swimsa)<br />
Druck, Herstellung und Versand<br />
Stämpfli AG, Kommunikationsunternehmen,<br />
Wölflistrasse 1, 3001 Bern<br />
Telefon +41 31 300 66 66<br />
info@staempfli.com, www.staempfli.com<br />
Layout<br />
Oliver Graf<br />
Titelillustration<br />
Stephan Schmitz<br />
Inserate<br />
Zürichsee Werbe AG, Fachmedien,<br />
Markus Haas, Laubisrütistrasse 44, 8712 Stäfa<br />
Telefon 044 928 56 53<br />
E-Mail <strong>vsao</strong>@fachmedien.ch<br />
Auflagen<br />
Druckauflage: 22 250 Expl.<br />
WEMF/KS-Beglaubigung 2022: 21 697 Expl.<br />
Erscheinungshäufigkeit: 6 Hefte pro Jahr.<br />
Für <strong>vsao</strong>-Mitglieder im Jahresbeitrag<br />
inbegriffen.<br />
ISSN 1422-2086<br />
Ausgabe <strong>Nr</strong>. 3/<strong>2023</strong> erscheint im<br />
Juni <strong>2023</strong>. Thema: Digital<br />
© <strong>2023</strong> by <strong>vsao</strong>, 3001 Bern<br />
Printed in Switzerland<br />
BL/BS<br />
VSAO Sektion beider Basel, Geschäftsleiterin und Sekretariat:<br />
lic. iur. Claudia von Wartburg, Advokatin, Hauptstrasse 104,<br />
4102 Binningen, Tel. 061 421 05 95, Fax 061 421 25 60,<br />
sekretariat@<strong>vsao</strong>-basel.ch, www.<strong>vsao</strong>-basel.ch<br />
BE VSAO Sektion Bern, Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 381 39 39,<br />
info@<strong>vsao</strong>-bern.ch, www.<strong>vsao</strong>-bern.ch<br />
FR<br />
ASMAC Sektion Freiburg, Sanae Chemlal, Rue du Marché 36, 1630 Bulle,<br />
presidence@asmaf.ch<br />
GE Associations des Médecins d’Institutions de Genève, Postfach 23,<br />
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genf 14, amig@amig.ch, www.amig.ch<br />
GR<br />
JU<br />
NE<br />
VSAO Sektion Graubünden, Kornplatz 2, 7000 Chur, Samuel B. Nadig,<br />
lic. iur. HSG, RA Geschäftsführer/Sektionsjurist, Tel. 081 256 55 55,<br />
info@<strong>vsao</strong>-gr.ch, www.<strong>vsao</strong>-gr.ch<br />
ASMAC Sektion Jura, Bollwerk 10, 3001 Bern, sekretariat@<strong>vsao</strong>.ch<br />
Tel. 031 350 44 88<br />
ASMAC Sektion Neuenburg, Joël Vuilleumier, Jurist,<br />
Rue du Musée 6, Postfach 2247, 2001 Neuenburg,<br />
Tel. 032 725 10 11, vuilleumier@valegal.ch<br />
SG/AI/AR VSAO Sektion St. Gallen-Appenzell, Bettina Surber, Oberer Graben 44,<br />
9000 St. Gallen, Tel. 071 228 41 11, Fax 071 228 41 12,<br />
surber@anwaelte44.ch<br />
SO<br />
TI<br />
TG<br />
VD<br />
VS<br />
VSAO Sektion Solothurn, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMAC Ticino, Via Cantonale 8-Stabile Qi, 6805 Mezzovico-Vira,<br />
segretariato@asmact.ch<br />
VSAO Sektion Thurgau, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ASMAV, case postale 9, 1011 Lausanne-CHUV,<br />
asmav@asmav.ch, www.asmav.ch<br />
ASMAVal, p.a. Maître Valentine Gétaz Kunz,<br />
Ruelle du Temple 4, CP 20, 1096 Cully, contact@asmaval.ch<br />
Zentralschweiz (LU, ZG, SZ, GL, OW, NW, UR)<br />
VSAO Sektion Zentralschweiz, Geschäftsstelle: lic. iur. Eric Vultier,<br />
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich, vultier@schai-vultier.ch,<br />
Tel. 044 250 43 23, Fax 044 250 43 20<br />
ZH/SH<br />
VSAO ZH/SH, RA lic. iur. Susanne Hasse,<br />
Geschäftsführerin, Nordstrasse 15, 8006 Zürich, Tel. 044 941 46 78,<br />
susanne.hasse@<strong>vsao</strong>-zh.ch, www.<strong>vsao</strong>-zh.ch<br />
Publikation<strong>2023</strong><br />
FOKUSSIERT<br />
KOMPETENT<br />
TRANSPARENT<br />
Gütesiegel Q-Publikation<br />
des Verbandes Schweizer Medien<br />
66<br />
2/23 <strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong>
PROFITIEREN SIE VON<br />
EXKLUSIVEN VORTEILEN.<br />
Dank der Partnerschaft zwischen mediservice <strong>vsao</strong>-asmac und SWICA<br />
sowie dem BENEVITA Bonusprogramm erhalten Sie bis zu 30 Prozent*<br />
Prämienrabatt auf ausgewählte Zusatzversicherungen.<br />
*Mehr erfahren<br />
Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/mediservice<br />
In Partnerschaft mit<br />
AndreaMag ®<br />
300 mg Magnesium (12.3 mmol)<br />
• Brausetabletten mit angenehmem Geschmack<br />
• Erhältlich als Orangen- oder Himbeeraroma<br />
• Vegan<br />
Kassenpflichtig<br />
Mehr<br />
Informationen:<br />
Andreabal AG, 4123 Allschwil<br />
www.andreabal.ch<br />
Andreamag®, Z: Magnesium 300 mg (12.3 mmol). I: Magnesiummangel, zur Deckung eines erhöhten Bedarfs während der Schwangerschaft und Stillzeit, im<br />
Hochleistungssport, Neigung zu Wadenkrämpfen, bei muskulären Krampfzuständen, bei Eklampsie und Präeklampsie, tachykarden Herzrhythmusstörungen.<br />
D: Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 1x täglich 1 Brausetablette oral. KI: Niereninsuffizienz, AV-Block, Exsikkose. IA: Tetracycline, Eisensalze, Cholecalciferol.<br />
UW: Gelegentlich Durchfall. P: 20 und 60 Brausetabletten. VK: Liste D. 04/2020. Kassenpflichtig. Ausführliche Informationen unter www.swissmedicinfo.ch.<br />
Andreabal AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil, Tel. 061 271 95 87, Fax 061 271 95 88 www.andreabal.ch
Was ist besser<br />
als rechtzeitig<br />
anzukommen?<br />
Mit 28 Zurich Help Points und<br />
250 Partnergaragen bringen wir<br />
Sie sicher und schnell ans Ziel.<br />
mediservice <strong>vsao</strong>-asmac Mitglieder<br />
profitieren von Sonderkonditionen.<br />
Prämie berechnen:<br />
zurich.ch/partner<br />
Zugangscode: TqYy4Ucx<br />
ZH32441-2203