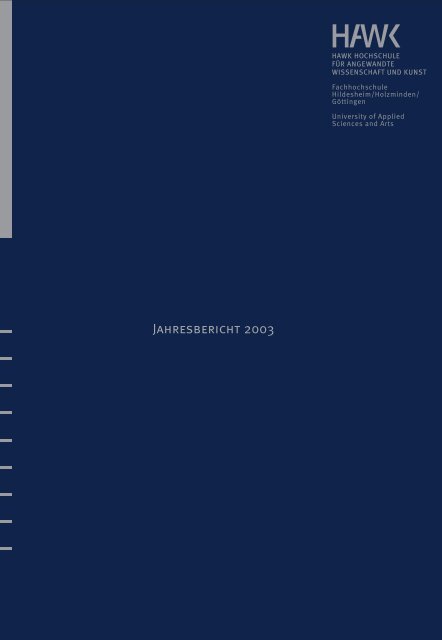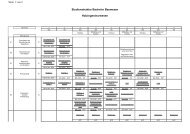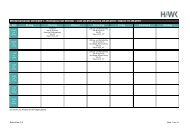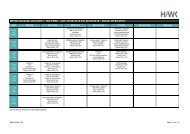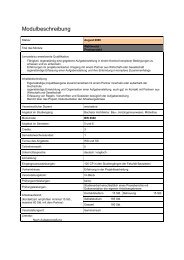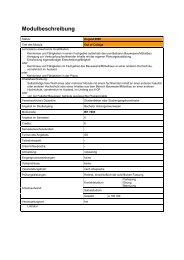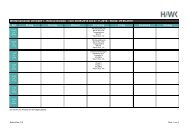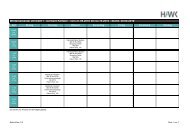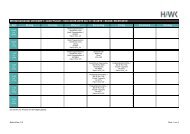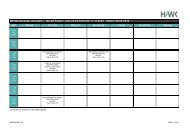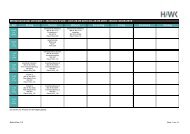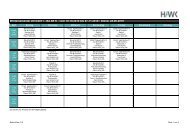Untitled - Mentoring - HAWK
Untitled - Mentoring - HAWK
Untitled - Mentoring - HAWK
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Jahresbericht 2003<br />
Berichte des Präsidiums<br />
Berichte der Fakultäten/<br />
Fachbereiche<br />
Berichte der Zentralen<br />
Einrichtungen<br />
Hochschulrat<br />
Honorarprofessoren<br />
Senatsbeauftragte<br />
und -kommissionen<br />
Forschungs- und<br />
Entwicklungsarbeiten
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Redaktion Pressestelle<br />
Sabine zu Klampen<br />
Gestaltung FH CI/CD-Team
Inhalt<br />
Jahresbericht der<br />
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte<br />
Wissenschaft und Kunst<br />
FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
Berichte des Präsidiums<br />
Bericht des Präsidenten<br />
Bericht der Kanzlerin<br />
Bericht der Vizepräsidentin<br />
Bericht des Vizepräsidenten<br />
Berichte der Fakultäten/Fachbereiche<br />
Fakultät Bauwesen<br />
Fakultät Gestaltung<br />
Fachbereich Konservierung<br />
und Restaurierung<br />
Fakultät Naturwissenschaften<br />
und Technik<br />
Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Fakultät Soziale Arbeit<br />
und Gesundheit<br />
Fakultät Wirtschaft<br />
Berichte der Zentralen Einrichtungen<br />
Akademisches Auslandsamt<br />
Bibliothek<br />
Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Pressestelle<br />
Rechenzentrum<br />
Büro für Wissens- und<br />
Technologietransfer<br />
005<br />
013<br />
025<br />
029<br />
033<br />
085<br />
109<br />
159<br />
189<br />
239<br />
263<br />
271<br />
281<br />
287<br />
305<br />
309<br />
315
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Inhalt<br />
Anhang<br />
Hochschulrat<br />
Honorarprofessoren<br />
Ehrensenatoren<br />
Senatsbeauftragte<br />
und -kommissionen<br />
Forschungs- und<br />
Entwicklungsarbeiten<br />
323<br />
324<br />
325<br />
326<br />
329
Berichte des Präsidiums<br />
Bericht<br />
des Präsidenten<br />
Prof. Dr. Johannes Kolb<br />
Im Sommer 2002 verabschiedete der Niedersächsische<br />
Landtag eine grundlegend geänderte<br />
Fassung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes<br />
(NHG), die zahlreiche bisher gesetzlich geregelte<br />
Sachverhalte den einzelnen Hochschulen zur<br />
Entscheidung übertrug. Nachdem das neue NHG<br />
zum 01. September 2002 wirksam wurde, beschlossen<br />
Senat und Präsidium im Wintersemester 2002/<br />
2003 eine Reihe von Ordnungen und anderen<br />
Bestimmungen, um die jetzt nicht mehr gesetzlich<br />
geregelten Fragen innerhalb der Hochschule zu<br />
klären.<br />
Neue Organisation der Hochschule<br />
Dies betraf in erster Linie die neue Grundordnung,<br />
erweiterte Regelungen zur Sicherung der Beteiligung<br />
von Frauen an der Selbstverwaltung, den Schutz von<br />
Minderheiten bei der Mitwirkung in Gremien, die<br />
Neugliederung der Hochschule in Fakultäten,<br />
die Einführung der neuen Institutionen Studienkommission<br />
und Studiendekanin/Studiendekan sowie<br />
die Vorbereitung eines umfassenden Evaluierungssystems.<br />
Gleichzeitig wurde die Einführung der<br />
neuen leistungsbezogenen W-Besoldung für<br />
Professorinnen und Professoren vorbereitet, die am<br />
01. Januar 2003 in Kraft trat.<br />
Im Frühjahr 2003 wählte der Senat auch die von ihm<br />
zu bestimmenden Mitglieder des neu eingerichteten<br />
Hochschulrates.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />
Die Realisierung dieser Beschlüsse beanspruchte<br />
einen großen Teil des Jahres 2003. So sah sich das<br />
Wissenschaftsministerium z. B. erst im Herbst 2003<br />
in der Lage, die von dort zu bestellenden Mitglieder<br />
des Hochschulrates zu bestimmen und die vom<br />
Senat im Oktober 2002 beschlossene Grundordnung<br />
zu genehmigen (ohne inhaltliche Änderungen).<br />
Aber auch innerhalb der Hochschule gab es<br />
langwierige Umstellungsprozesse.<br />
So verfügten die zum 01. Februar 2003 oft aus<br />
mehreren kleineren Fachbereichen neu gebildeten<br />
Fakultäten anfangs noch nicht über gemeinsame<br />
Konzepte und Verfahren für die gesamte Fakultät;<br />
dies gilt beispielsweise für die Kapazitäts- und<br />
Entwicklungsplanung der Studiengänge, die<br />
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel oder die Organisation<br />
der „vereinigten Dekanate“. Auch wenn<br />
hier im Verlauf des Jahres 2003 intensive Entwicklungsarbeit<br />
geleistet wurde, konnten noch nicht alle<br />
Fakultäten ihr erweitertes Leistungspotenzial voll<br />
entfalten. Dagegen wurden die wirksameren<br />
Schutzvorschriften im Wahlrecht und in den Ordnungen<br />
der Gremien ohne nennenswerte Probleme<br />
umgesetzt, insbesondere auf der zentralen Ebene<br />
(Senat, Senatskommissionen und Hochschulrat).<br />
Und auch bei den erstmals eingerichteten Studienkommissionen<br />
sowie den Studiendekaninnen<br />
und Studiendekanen gab es weniger Anlaufschwierigkeiten,<br />
als angesichts der Neuartigkeit der<br />
jeweiligen Aufgabenbereiche und Verfahrensregelungen<br />
zu erwarten gewesen wäre.
Evaluation und leistungsbezogene Vergütung<br />
Das neue Hochschulgesetz sieht eine regelmäßige<br />
Bewertung aller Lehrveranstaltungen durch die<br />
Studierenden vor. Gleichzeitig wurde durch die<br />
Einführung der leistungsbezogenen W-Besoldung<br />
für Professorinnen und Professoren eine umfassende<br />
Evaluation von Lehre und Forschung erforderlich.<br />
Die Verordnung des Landes zur Umsetzung der<br />
W-Besoldung (NHLeistBVO) wurde im Dezember 2002<br />
beschlossen und trat für die Fachhochschulen zum<br />
Jahresbeginn 2003 in Kraft. Bereits im Januar 2003<br />
realisierte die <strong>HAWK</strong> als bundesweit erste<br />
Hochschule Berufungen auf der Grundlage der<br />
neuen W-Besoldung.<br />
Diese leistungsbezogene Besoldung gilt seither für<br />
alle neu berufenen Professorinnen und Professoren.<br />
Außerdem ließen sich 21 Professorinnen und<br />
Professoren auf eigenen Antrag aus der bisherigen<br />
C-Besoldung in die W-Besoldung überleiten.<br />
Gleichstellung/Frauenförderung<br />
Der Professorinnen-Anteil bei den Berufungen im<br />
Jahre 2003 betrug 50 Prozent, in den vorhergehenden<br />
Jahren jeweils zwischen 40 und 50 Prozent.<br />
Dadurch beträgt der Professorinnen-Anteil inzwischen<br />
insgesamt 26 Prozent nach 24,5 Prozent<br />
im Vorjahr.<br />
Der Studentinnen-Anteil ist auf über 45 Prozent gestiegen.<br />
Dies ist für eine Fachhochschule ein<br />
Spitzenwert. Allerdings liegt der Anteil der Frauen<br />
bei den Hochschulzugangsberechtigten seit Jahren
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />
deutlich über 50 Prozent. Unsere heutigen Studienangebote<br />
berücksichtigen also die beruflichen<br />
Orientierungen junger Frauen und ihre Anforderungen<br />
an ein Studium noch längst nicht so gut wie<br />
dies bei Männern ganz selbstverständlich der Fall<br />
ist. Dies ist eine Herausforderung und zugleich eine<br />
große Chance: hier gibt es offensichtlich noch nicht<br />
erschlossene Expansionsmöglichkeiten für die<br />
Hochschule.<br />
Familiengerechte Hochschule<br />
Im Frühjahr 2003 wurde die <strong>HAWK</strong> als „Familiengerechte<br />
Hochschule“ zertifiziert. Dies bedeutet nicht<br />
nur eine Anerkennung für bereits erbrachte<br />
Leistungen, sondern vor allem eine Verpflichtung<br />
der Hochschule, weitere umfassende Verbesserungen<br />
zu erarbeiten und sich und den Audit-Instanzen<br />
regelmäßig Rechenschaft über Art, Umfang und<br />
Zeitpunkt der jeweils realisierten Teil-Ziele abzulegen.<br />
Als größtes Einzelprojekt in einem insgesamt zehn<br />
Arbeitsfelder umfassenden Aufgabenkatalog<br />
bereitete die <strong>HAWK</strong> im Jahre 2003 das Projekt<br />
„Studienzeitverkürzung durch Kleinkindbetreuung“<br />
vor. Bis Ende des Jahres waren die Klärungen<br />
innerhalb der Hochschule sowie mit dem Jugendamt<br />
der Stadt Hildesheim und dem Landesjugendamt so<br />
weit fortgeschritten, dass 2004 eine erste Ausbaustufe<br />
und voraussichtlich ab 2006 der volle Betrieb<br />
realisiert werden können.
Ausbau der Standorte Holzminden und Göttingen<br />
Im Wintersemester 2002/2003 schrieb die Fakultät<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit (Hildesheim und<br />
Holzminden) sieben Professuren und mehrere<br />
andere Stellen in Holzminden aus, um hier vom<br />
Herbst 2003 an den Studiengang Sozialwesen mit<br />
einer speziell auf diese Region ausgerichteten<br />
Struktur anzubieten. Es handelt sich um den ersten<br />
nicht auf das Bauen bezogenen Studiengang am<br />
Standort Holzminden.<br />
Auf 51 Sozialwesen-Studienplätze in Holzminden<br />
gingen 508 Bewerbungen ein, ohne dass die Zahl<br />
der Bewerbungen für den Studiengang Sozialwesen<br />
in Hildesheim zurückgegangen wäre. Offensichtlich<br />
kann in der Region Holzminden eine große<br />
Nachfrage nach Studienplätzen erschlossen werden,<br />
die bisher aus Mangel an passenden Angeboten<br />
nicht sichtbar wurde. Durch das neue Studienangebot<br />
konnte der anhaltende Rückgang der Nachfrage<br />
in den Bau-Studiengängen mehr als ausgeglichen<br />
werden (insgesamt 876 Studierende).<br />
In Göttingen wurde an der Fakultät Naturwissenschaften<br />
und Technik u. a. mit Hilfe von Spenden<br />
aus der Wirtschaft ein umfangreiches Investitionsprogramm<br />
realisiert. Gleichzeitig wurden die vom<br />
Land anfinanzierten und durch Umschichtungen<br />
innerhalb der Hochschule dauerhaft abgesicherten<br />
Stellen ausgeschrieben, so dass auch das Studienangebot<br />
erweitert werden konnte.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht des Präsidenten<br />
Gleichzeitig führte die Göttinger Fakultät Ressourcenmanagement<br />
im Wintersemester 2003/2004 den<br />
Bachelor-Studiengang Arboristik und den Master-<br />
Studiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung<br />
ein, zwei neuartige und bundesweit<br />
singuläre Studienangebote.<br />
Insgesamt stieg die Zahl der Studierenden in<br />
Göttingen durch das erweiterte Studienangebot um<br />
zehn Prozent auf 1.154.<br />
Hochschuloptimierungskonzept HOK<br />
Nach Ende des Sommersemesters 2003 begann die<br />
Landesregierung, im Rahmen allgemeiner Ausgabenreduzierungen<br />
auch ein Konzept für Mittelkürzungen<br />
im Hochschulbereich zu entwickeln. Das<br />
vom Kabinett im Oktober 2003 beschlossene<br />
Hochschuloptimierungskonzept (HOK) sieht vor,<br />
dass die <strong>HAWK</strong> insgesamt 35 Stellen sowie Landesmittel<br />
in Höhe von jährlich 900.000,– Euro verliert<br />
und die Fakultät Wirtschaft schließt, jedoch auch<br />
den Studiengang Sozialwesen in Holzminden und<br />
den Bachelor-Studiengang für Medizinalfachberufe<br />
in Hildesheim stärken und das Studienangebot<br />
der Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen<br />
weiter modernisieren soll.<br />
Daraufhin hob das Präsidium mit Zustimmung des<br />
Senates die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre<br />
und Krankenversicherung auf. Dadurch wurde es<br />
möglich, die im HOK vorgesehenen Stellenkürzungen<br />
zu Lasten der aufzulösenden Fakultät<br />
Wirtschaft zu realisieren und den anderen<br />
Fakultäten die erforderlichen Stellen zuzuweisen,
um ihr Studienangebot flächendeckend auf die<br />
Bologna-Strukturen umstellen zu können (Akkreditierung<br />
neuer Bachelor- und Master-Studiengänge).<br />
Studierende<br />
Zum Wintersemester 2003/2004 wurden für das<br />
erste Studiensemester 1.113 Studierende immatrikuliert,<br />
was einer Auslastung von 110 Prozent für das<br />
erste Semester entspricht und zu einer durchschnittlichen<br />
Auslastung der Hochschule von 101<br />
Prozent führte. Die Zahl der Studierenden insgesamt<br />
stieg erneut um 1,5 Prozent auf 5.822 und erreichte<br />
damit einen neuen Höchststand. 86 Prozent der<br />
Studierenden befinden sich innerhalb der<br />
Regelstudienzeit und über 90 Prozent innerhalb des<br />
Zeitraums aus Regelstudienzeit und vier weiteren<br />
Semestern, in dem auch ohne besondere Gründe<br />
keine Studiengebühren zu zahlen sind.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin
Bericht<br />
der Kanzlerin<br />
Iris Linke<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Die in 2002 begonnenen Umstrukturierungs- und<br />
Organisationsmaßnahmen in der allgemeinen<br />
Verwaltung wurden auch in 2003 weiter fortgesetzt.<br />
Zwischenzeitlich sind alle vakanten Positionen innerhalb<br />
der Organisationseinheiten besetzt worden<br />
und die Aufgabenbereiche geklärt.<br />
Verbesserung der Kommunikationsprozesse<br />
Es finden regelmäßig monatlich sowohl eine große<br />
Dienstbesprechung wie auch kleinere Besprechungsrunden<br />
in den Organisationseinheiten statt.<br />
Es wurden außerdem verschiedene Arbeitsgruppen<br />
gebildet, die organisationsübergreifend arbeiten.<br />
Neben der neuen Darstellung der <strong>HAWK</strong> im Internet<br />
wurden im Intranet Diskussionsforen eingerichtet,<br />
die bei aktuellen Fragestellungen genutzt werden<br />
sowie zeitnah über Entscheidungsprozesse<br />
innerhalb der Hochschule informiert.<br />
Neues Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)<br />
Mit dem Inkrafttreten des neuen NHG Ende 2002<br />
sollten die staatlichen Hochschulen größere<br />
Freiräume in internen Angelegenheiten erhalten<br />
sowie diverse Entscheidungsbefugnisse in die<br />
Hochschulen und deren Gremien verlagert werden.<br />
Das Präsidium wurde gestärkt, das Konzil abgeschafft<br />
und ein neues Organ, der Hochschulrat, der<br />
überwiegend aus externen Mitgliedern besteht,<br />
eingeführt. Im Alltag stellte sich bald heraus, dass
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
zwar verschiedene Aufgabenbereiche und zusätzliche<br />
Aufgaben in die Hochschulen verlagert,<br />
hier aber kein zusätzliches Personal oder Mittel zur<br />
Verfügung gestellt wurden.<br />
Ab 2003 wurde seitens des Landes eine „Betriebsanweisung“<br />
in Kraft gesetzt, die die im neuen NHG<br />
entfallenen Regelungen und Kontrollen so wieder<br />
einführten und vor allem im Bereich der Finanzen<br />
bisher nicht gekannte Verschärfungen einführte.<br />
Auch die Berichtspflichten und Datenabfragen sind<br />
nahezu unverändert bestehen geblieben.<br />
Verlagert wurde in die Hochschulen die Umsetzung<br />
und Erhebung der neu eingeführten Langzeitstudiengebühren.<br />
Von der Zusage, zumindest einen Teil<br />
der so gewonnenen zusätzlichen Mittel den<br />
Hochschulen zur Verfügung zu stellen, trat das Land<br />
nach Umsetzung dieser Maßnahme zurück.<br />
Die <strong>HAWK</strong> hat in 2003 eine neue Grundordnung<br />
sowie diverse weitere Ordnungen in Kraft gesetzt.<br />
Es wurde außerdem eine Evaluierungsrichtlinie und<br />
eine Forschungsrichtlinie erarbeitet sowie die<br />
Gebührenordnung überarbeitet.<br />
Außerdem wurde dem Namen der Fachhochschule<br />
die Bezeichnung „Hochschule für angewandte<br />
Wissenschaft und Kunst (<strong>HAWK</strong>)“ vorangestellt und<br />
ein neuer Öffentlichkeitsauftritt entwickelt und auch<br />
im Internet sowie allen Medien der Außendarstellung<br />
umgesetzt.
Die mit dem neuen NHG geänderte Bezeichnung der<br />
Kanzlerin als hauptamtliche Vizepräsidentin wurde<br />
über die neue Grundordnung dahingehend geändert,<br />
dass die Bezeichnung Kanzlerin zur Darstellung<br />
der unveränderten Zuständigkeiten weiter<br />
geführt wird.<br />
Modellprojekt „Kosten-Leistungs-Rechnung“ KLAR<br />
Die <strong>HAWK</strong> hat sich seit 2003 am Modellprojekt des<br />
Landes zur Einführung der KLAR in Hochschulen<br />
beteiligt und in den Fakultäten durch Ermittlung von<br />
Kennzahlen mit einer Umsetzung begonnen.<br />
Es wurde ein Personalabrechnungsprogramm<br />
„Kidicap“ beschafft und erfolgreich eingesetzt. In<br />
Zusammenarbeit mit der Controllerin wurde<br />
begonnen, Verwaltungsbereiche der neu gebildeten<br />
Fakultäten genauer zu analysieren, auch um<br />
angesichts der schwierigen Haushaltslage die<br />
erforderlichen Leistungen festzustellen sowie den<br />
damit verbundenen Personalbedarf.<br />
Der Präsident, Herr Kolb, hat den Vorsitz der Haushaltskommission<br />
und der Frauen- und Gleichstellungskommission<br />
an die Kanzlerin übertragen.<br />
Neues Besoldungssystem für<br />
Professorinnen und Professoren<br />
Im Bereich der Professorinnen-/Professoren-Besoldung<br />
wurde an den Fachhochschulen in Niedersachsen<br />
ein neues Vergütungssystem eingeführt,<br />
welches Leistungs- und Funktionsbezüge neben
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
dem Grundgehalt nach W 2/W 3 vergibt. Es wurden<br />
außerdem Professorinnen und Professoren in<br />
Teilzeit und im Angestelltenverhältnis berufen.<br />
Neue Landesregierung<br />
Die neue, im Februar gewählte Landesregierung hat<br />
in ihrer Orientierungsphase nach Übernahme der<br />
Dienstgeschäfte festgestellt, dass das Land<br />
Niedersachsen so stark verschuldet ist, dass nur<br />
noch energisches Entgegensteuern verbunden mit<br />
erheblichen Einsparauflagen zu einer Verbesserung<br />
der schwierigen Haushaltssituation beitragen<br />
können. Das bisherige, auch in Zielvereinbarungen<br />
ausgehandelte FEP II sowie der Innovationspakt mit<br />
den Hochschulen, der bis Ende 2004 Planungssicherheit<br />
geben sollte, entfielen im Verlauf des<br />
Jahres. Statt dessen entwickelte die Landesregierung<br />
ein Hochschuloptimierungskonzept (HOK) und<br />
verfügte Einsparungen, welche dramatische<br />
Auswirkungen auf die weitere Entwicklung und den<br />
Aufbau der Hochschulen in Niedersachsen haben<br />
werden.<br />
Seit Mitte des Jahres 2003 hat das Land einen<br />
Einstellungsstop für Verwaltungspersonal verfügt,<br />
der auch über den Jahreswechsel fortbestanden hat<br />
sowie eine Haushaltssperre seit September 2003<br />
mit Verschärfung im November 2003 verhängt, die<br />
auch für Hochschulen – und das trotz Globalhaushalt<br />
und Zielvereinbarungen – gültig sind.<br />
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die<br />
Arbeitsanforderungen und -aufgaben auch im Ver-
waltungsbereich stark zugenommen haben, im<br />
Gegenzug aber keine echte Personalaufstockung erfolgte,<br />
so dass die einzelne Mitarbeiterin/der einzelne<br />
Mitarbeiter inzwischen erheblich stärker<br />
belastet wird. Verschärft wird diese Situation durch<br />
Mittelkürzungen/Einsparauflagen, die alle Bereiche<br />
der Hochschule betreffen.<br />
Im öffentlichen Dienst wurde für Beamtinnen und<br />
Beamte die 40-Stunden-Woche eingeführt, das<br />
Urlaubsgeld ab 2004 gestrichen, das Weihnachtsgeld<br />
auf 50 Prozent abgesenkt und auf die<br />
monatliche Vergütung verteilt. Den Angestellten<br />
wurde der letzte Ausgleichstag gestrichen sowie die<br />
Vergütungszahlung um 14 Tage zum Monatsende<br />
hin verschoben. Umsetzung der Streichung der<br />
Sonderzahlungen sind beabsichtigt, auch der<br />
Kündigungsschutz im Öffentlichen Dienst wird inzwischen<br />
von der Landesregierung in Frage gestellt.<br />
Neben den verschiedenen Erhöhungen im<br />
Lebensumfeld der Einzelnen sind dieses sehr unerfreuliche<br />
Entwicklungen, die sich sicherlich nicht<br />
motivierend auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
auswirken werden.<br />
Ausstattungs-, Kosten- und Leistungsvergleich<br />
Die <strong>HAWK</strong> hat sich auch für die Erhebung der Daten<br />
aus 2002 im Rahmen der HIS-Studie „Ausstattungs-,<br />
Kosten- und Leistungsvergleich“ norddeutscher<br />
Hochschulen mit umfänglichem Zahlenmaterial beteiligt,<br />
die alle Hochschulbereiche und Kostenstellen<br />
betrifft, so dass mit Erstellung des zweiten
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
Berichtes in 2004 eine gut aufbereitete Datenlage<br />
entsteht, aus der sich die gute Positionierung der<br />
<strong>HAWK</strong> ablesen lässt.<br />
Bauunterhalt und Reparaturen<br />
Besonders schwierig für die <strong>HAWK</strong> ist und bleibt die<br />
räumliche Situation. Im Bereich der Bauunterhaltungsmaßnahmen<br />
und Reparaturen wurden in 2003<br />
größere Fortschritte erzielt und diverse notwendige<br />
Maßnahmen, auch in Zusammenarbeit mit dem<br />
staatlichen Liegenschafts- und Baumanagement,<br />
umgesetzt. Die <strong>HAWK</strong> hat aus eigenen Mitteln<br />
200.000,– Euro beigesteuert, um schon über<br />
längere Zeit liegen gebliebene Maßnahmen durchzuführen<br />
und die entstandene Reparaturstau-<br />
Situation zu verbessern. Es wurde ein Neubau in<br />
Holzminden begonnen sowie verschiedene Neuanmietungen<br />
und Umbaumaßnahmen durchgeführt.<br />
Personalentwicklung<br />
Personalentwicklung im Bereich der Lehre<br />
Im Haushaltsjahr 2003 standen der <strong>HAWK</strong> im<br />
Rahmen der Lehre folgende Planstellen oder<br />
entsprechende Mittel zur Verfügung:<br />
Kap. 0364<br />
Sonderprogramm<br />
Professoren Lehrkräfte<br />
C2 C3 A12/13 BAT 11/1b<br />
73<br />
112<br />
7<br />
6<br />
3<br />
2<br />
–<br />
3<br />
Die Zahlen stammen aus dem vorläufigen<br />
Haushaltsplan.
Zum Beginn des Wintersemesters 2002/2003 waren<br />
181,5 Stellen besetzt, davon 31,0 mit Frauen. Damit<br />
hat sich der Frauenanteil auf rund 17,7 Prozent<br />
erhöht.<br />
Insgesamt wurden im Jahre 2003 acht Berufungen<br />
und 4,5 angestellte Professoren als Neueinstellungen<br />
vorgenommen. Acht Professoren wurden in<br />
den Ruhestand versetzt oder verließen die <strong>HAWK</strong><br />
auf eigenen Wunsch. W 2-Überleitung von C nach W<br />
siebzehn Professoren.<br />
Personalentwicklung im Bereich der<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Personaleinstellungen aus Mitteln<br />
der Finanzautonomie<br />
Auch im Jahr 2003 konnten zahlreiche Personalmaßnahmen<br />
aus Mitteln der Finanzautonomie<br />
realisiert werden. Es handelte sich überwiegend um<br />
Maßnahmen im Bereich der Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter in Lehre und Forschung.<br />
Die Personalmaßnahmen waren auch in 2003 sehr<br />
unterschiedlich angelegt. Von kurzfristigen, wenige<br />
Monate umfassenden Maßnahmen mit nur wenigen<br />
Wochenstunden bis zu ganzjährigen, vollzeitigen<br />
Beschäftigungsverhältnissen waren alle Variationen<br />
vertreten.<br />
Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wurden verschiedene<br />
Stellen in den Abteilungen und anderen<br />
Organisationseinheiten besetzt, so dass hier das<br />
geplante und gewollte Ziel erreicht wurde.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
Personalmaßnahmen aus Drittmitteln<br />
Im Jahr 2003 wurden aus Drittmitteln 51 Verträge mit<br />
studentischen Hilfskräften und 54 Verträge mit<br />
Angestellten weiterfinanziert bzw. neu begründet.<br />
Überwiegend wurden aus diesen Mitteln Beschäftigungsverhältnisse<br />
für Mitarbeiter/innen in Lehre<br />
und Forschung realisiert. In diesem Bereich ist ein<br />
starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren zu<br />
verzeichnen. Insbesondere konnte deutlich mehr<br />
Projektpersonal aus Industriemitteln (hauptsächlich<br />
in der Fakultät Naturwissenschaft und Technik in<br />
Göttingen) eingestellt werden.<br />
Altersteilzeit<br />
Im Jahr 2002 haben zehn Personen nach dem Blockmodell<br />
und eine Person nach dem Teilzeitmodell<br />
Altersteilzeit beantragt. Zum Jahresende änderte<br />
sich die Gesetzgebung, wobei sich zukünftig sowohl<br />
für die Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmerseite<br />
deutliche Verschlechterungen ergeben. Es wurden<br />
daher zum Jahresende 2002 erheblich mehr ATZ-<br />
Verträge abgeschlossen als in den Vorjahren.<br />
Bislang wurde allen Anträgen von Beschäftigten auf<br />
Gewährung einer Altersteilzeitbeschäftigung<br />
entsprochen. In 2003 erfolgte dann keine weitere<br />
Beantragung mehr.<br />
Ausbildungssituation<br />
Im Jahr 2003 wurden Auszubildende in den<br />
verschiedenen Bereichen der <strong>HAWK</strong> beschäftigt:<br />
– zwei Auszubildende in der Zentralverwaltung<br />
(Verwaltungsfachangestellte),
– ein Auszubildender in der Fakultät N Göttingen<br />
für das Berufsbild Industriemechaniker Geräte<br />
und Feinwerktechnik,<br />
– fünf Auszubildende im Rechenzentrum für das<br />
Berufsbild Fachinformatiker und<br />
– ein neues Ausbildungsverhältnis entstand in der<br />
Bibliothek.<br />
Die bisherigen zwei Auszubildenden des Rechenzentrums<br />
wurden nach erfolgreichem Abschluss<br />
ihrer Ausbildung in befristeten Arbeitsverhältnissen<br />
weiter beschäftigt, ebenso die Verwaltungsfachangestellte.<br />
Fortbildung der Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter<br />
Für das Sommersemester 2003 sowie für das<br />
Wintersemester 2003/2004 wurden wiederum in<br />
Kooperation mit der Universität Hildesheim und der<br />
Volkshochschule Hildesheim Weiterbildungsprogramme<br />
durchgeführt. Die Fortbildungsprogramme<br />
wurden auf Grund von Bedarfsanfragen aktuell und<br />
bedarfsorientiert erarbeitet. Besonders groß war die<br />
Zahl der Teilnehmer/innen im Bereich der EDV-<br />
Seminare und Veranstaltungen zu den Themen<br />
„Gendermainstreaming“ und „Gendercontrolling“.<br />
Die Mitarbeiter/innen können außerdem das<br />
Angebot der VHS vergünstigt nutzen, was im Bereich<br />
der Sprachkompetenz wünschenswert ist.<br />
Für den Standort Göttingen wurde eine Kooperation<br />
mit der Universität Göttingen abgeschlossen. Mit-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
arbeiter/innen und Studierende können hier das<br />
Fortbildungsprogramm und das Sportprogramm der<br />
Universität Göttingen in Anspruch nehmen.<br />
Studentische Hilfskräfte<br />
Es wurden insgesamt 324 studentische Hilfskräfte/<br />
Tutorinnen und Tutoren beschäftigt.<br />
Für studentische Hilfskräfte und den Einsatz von<br />
Tutorinnen und Tutoren wurden insgesamt rund<br />
470.000,– Euro verausgabt. Zum überwiegenden<br />
Teil waren die Hilfskräfte in den Fachbereichen<br />
beschäftigt.<br />
Haushalt/Finanzen<br />
1. Wirtschaftsplan 2003<br />
Der mit dem Land abgeschlossene Innovationspakt<br />
ist ersatzlos entfallen. Auf die aus den Ansätzen<br />
der Vorjahre durch das Land errechneten Mittelansätze<br />
wurde sowohl eine globale Minderausgabe<br />
wie auch eine weitere Kürzung der laufenden Mittel<br />
vorgenommen.<br />
Der im Rahmen des Haushalts für 2003 unter Kap.<br />
0634 des Einzelplans 06 ausgewiesene Wirtschaftsplan<br />
für das Berichtsjahr weist im Erfolgsplan eine<br />
Gesamtsumme in Höhe von 31.703.000,– Euro aus.<br />
Nahezu 4/5 dieser Summe betreffen Personalaufwendungen.<br />
Für Mieten und Bewirtschaftungskosten<br />
der Gebäude waren 1.781.500,– Euro<br />
veranschlagt. Für Investitionen wurden im Finanzplan<br />
293.000,– Euro zugewiesen.
Die Mittelverteilung erfolgte wie schon in den<br />
Vorjahren durch die „Grundsätze für den Haushalt“<br />
2003. Hierin sind sowohl Sachmittel für die<br />
Fakultäten, die in Anlehnung an die Finanzierungsformel<br />
der Fachhochschulen berechnet werden wie<br />
auch die Sachmittel für alle anderen Organisationseinheiten<br />
sowie die Bewirtschaftungsgrundsätze<br />
enthalten.<br />
2. Formelgebundene Mittelzuweisung<br />
Auch im Berichtszeitraum erfolgte die Zuweisung für<br />
die Fachhochschulen durch eine formelgebundene<br />
Mittelzuweisung. Die Bemessung des Hochschulbudgets<br />
wurde im Jahr 2000 mit fünf Prozent des<br />
Gesamtbudgets eingeführt. Modellrechnungen<br />
hatten bereits deutlich gemacht, dass unsere<br />
Fachhochschule auf Grund dieser leistungsorientierten<br />
Bemessungsgrundlage in Zukunft mehr<br />
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen würden. Im<br />
Haushaltsjahr 2002 wurden bereits 35 Prozent des<br />
Hochschulbudgets nach leistungsbezogenen<br />
Kriterien zugewiesen. Bedauerlicherweise wurde<br />
dann diese formelgebundene Mittelzuweisung auf<br />
den Stand von 35 Prozent „eingefroren“, was auch<br />
in 2003 nicht geändert wurde. Statt dessen überlegt<br />
die neue Landesregierung, auch hier eine veränderte<br />
Finanzierung einzuführen.<br />
3. Körperschaftshaushalt<br />
Mit Wirkung zum 01. Januar 2001 hat der Senat<br />
einen Körperschaftshaushalt eingerichtet. Aus Mitteln<br />
wie z. B. Spenden, die diesem Körperschafts-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Kanzlerin<br />
haushalt zufließen, kann sich die Hochschule auch<br />
wirtschaftlich betätigen und sich z. B. an Institutionen<br />
zur Forschungsförderung beteiligen, die<br />
rechtlich als Firmen organisiert sind. Dieses wurde<br />
durch eine Beteiligung an der Firma PhontonicNet<br />
GmbH, die u. a. aus Bundesmitteln finanziert<br />
werden soll und Aktivitäten von Hochschulen und<br />
außerhochschulischen Forschungseinrichtungen<br />
fördert, umgesetzt. Es erfolgte im Dezember 2002<br />
außerdem eine Beteiligung an der neugegründeten<br />
niedersächsischen hochschulübergreifenden<br />
Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH, die die<br />
beteiligten Hochschulen u. a. bei der Anmeldung<br />
und Vermarktung von Patenten unterstützt.
Bericht<br />
der Vizepräsidentin<br />
Aufgabenbereich: Forschung, Technologietransfer,<br />
EDV/Rechenzentrum<br />
Prof. Dr. Cornelia Behrens<br />
Forschung<br />
Das Jahr 2003 war geprägt durch eine Weiterentwicklung<br />
der Maßnahmen der Qualitätssicherung in<br />
der Forschung. Zur Wahrnehmung der Verantwortung<br />
in der Forschung und der damit verknüpften<br />
Aufgaben in Lehre und Nachwuchsförderung hat der<br />
Senat der <strong>HAWK</strong> die „Richtlinie zur Sicherung guter<br />
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit<br />
wissenschaftlichem Fehlverhalten“ erlassen. Die in<br />
dieser Richtlinie vorgesehenen Ombudspersonen<br />
und die Kommission wurden inzwischen gewählt<br />
und stehen allen Mitgliedern und Angehörigen der<br />
Hochschule in Fragen guter wissenschaftlicher<br />
Praxis oder wissenschaftlichen Fehlverhaltens zur<br />
Verfügung.<br />
Im Wintersemester 2003/2004 wurde vom Senat<br />
eine Evaluierungskommission aus Vertreterinnen<br />
und Vertretern aller Fakultäten eingesetzt, um die<br />
erste Evaluation von Forschungsvorhaben und<br />
künstlerischen Vorhaben im Zusammenhang mit der<br />
W-Besoldung durchzuführen. Die Kommission<br />
erstellte einen entsprechenden Kriterienkatalog, auf<br />
dessen Grundlage und unter Berücksichtigung der<br />
jetzt gemachten Erfahrungen die weitere interne<br />
Forschungsevaluation gemäß der Evaluierungs-<br />
Richtlinie der Hochschule erfolgen wird.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Vizepräsidentin<br />
Weiterhin erfolgte in der Forschungskommission die<br />
Überarbeitung des Merkblattes zur Antragstellung<br />
im Rahmen der hochschulinternen Forschungsförderung.<br />
Hier wird nunmehr das Augenmerk<br />
darauf zu richten sein, in welcher Form die<br />
Forschungsergebnisse über das Internet einer noch<br />
breiteren interessierten Fachöffentlichkeit zur<br />
Verfügung gestellt werden können.<br />
Professorinnen und Professoren der <strong>HAWK</strong> ist es<br />
wiederum gelungen, in nennenswertem Umfang<br />
Drittmittel zu akquirieren. Dies erhöht weiter die<br />
Forschungskompetenz der Hochschule und die<br />
Möglichkeiten zur Durchführung anspruchsvoller<br />
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben insbesondere<br />
mit kleinen und mittleren Unternehmen. Im<br />
Rahmen von Drittmittelprojekten erweitern sich<br />
zudem die Möglichkeiten der Nachwuchsförderung<br />
auch in Kooperation mit universitären Partnern.<br />
Die Hochschule beteiligt sich außerdem – in den<br />
Bereichen Bildgebende Sensortechnik und<br />
Gesundheit – an der Zielsetzung des Landes, die<br />
unternehmensorientierte Fachhochschulforschung<br />
über den Aufbau von Forschungsnetzen zu verstärken.<br />
Eine Grundlage für die Akquisition externer<br />
Forschungsgelder liegt nach wie vor in der Bereitstellung<br />
von Hochschulmitteln für die Förderung von<br />
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Sie<br />
betrugen im Berichtsjahr erneut ca. 145.000,– Euro.
Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an der<br />
<strong>HAWK</strong> sind außerordentlich vielfältig (siehe Anlage<br />
zu den Einzelprojekten) und spiegeln damit auch<br />
das umfassende Studienfächerspektrum wieder.<br />
Die Struktur der Hochschule stellt dabei sicher, dass<br />
die Einheit von Forschung und Lehre gewährleistet<br />
ist und starke wechselseitige Synergien ausgelöst<br />
werden. Auf diese Weise partizipieren auch die<br />
Studierenden an der teilweise sehr ambitionierten,<br />
anwendungsorientierten Forschung.<br />
Wissens- und Technologietransfer<br />
Die im Jahr 2002 gestartete gemeinsame Vortragsreihe<br />
der Universität Hannover, Universität<br />
Hildesheim und unserer Hochschule „Vorsprung<br />
durch Innovation“ für kleine und mittlere Unternehmen,<br />
wurde im Sommersemester 2003 erfolgreich<br />
abgeschlossen. Durchschnittlich nahmen 25<br />
Personen teil.<br />
Erstmalig war unsere Hochschule mit vier Fakultäten<br />
und einem Fachbereich auf der LIGNA vertreten.<br />
Mit einem eigens dafür entworfenen und selbst<br />
gebauten Messestand nahmen wir im Mai 2003 an<br />
der weltgrößten Holzfachmesse in Hannover teil.<br />
In zwei Fakultäten und einem Fachbereich in<br />
Hildesheim wurden Existenzgründungsveranstaltungen<br />
in Zusammenarbeit mit der HI-REG GmbH<br />
Hildesheim durchgeführt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht der Vizepräsidentin<br />
Durch die Unterstützung von N-Transfer GmbH<br />
in Hannover konnten wir für die Fakultät Gestaltung<br />
eine Infoveranstaltung zum Thema „Urheber- und<br />
Geschmacksmusterrecht“ mit 50 teilnehmenden<br />
Personen anbieten.<br />
Weitere Informationen über die Aktivitäten können<br />
dem Bericht des Büros für Technologie- und<br />
Wissenstransfer entnommen werden.<br />
EDV/Rechenzentrum<br />
Einen Überblick über die Aktivitäten gibt der ausführliche<br />
Bericht des Rechenzentrums.
Bericht<br />
des Vizepräsidenten<br />
Aufgabenbereich: Lehre und Studium, Bibliothek<br />
Prof. Dr. Hubert Merkel<br />
Das Jahr 2003 verlief in seinen äußerlich sichtbaren<br />
Effekten sehr unspektakulär.<br />
Nachdem die ersten Verlautbarungen der neuen<br />
Landesregierung noch ein moderates Wachstum des<br />
Hochschulbereiches erwarten ließen und darum<br />
entsprechende Planungen in unserem Hause<br />
vorangetrieben wurden, war spätestens nach der<br />
Sommerpause klar, dass es nicht nur nicht zu<br />
entsprechenden Arrondierungen und sinnvollen<br />
Erweiterungen unseres Studienangebots kommen<br />
wird, sondern dass die Hochschule massiven<br />
Sparauflagen ausgesetzt sein wird.<br />
Die Konsequenzen sind bekannt: Schließung einer<br />
Fakultät, Stellenverluste, massive Kürzungen im<br />
Sachmittelbereich etc.<br />
Herbst und Winter waren deshalb angefüllt mit der<br />
als höchst unproduktiv empfundenen Arbeit der<br />
Ausgestaltung des „Hochschuloptimierungskonzepts“<br />
der Landesregierung auf der Ebene unserer<br />
Hochschule. Zielsetzung dabei war es, den verbleibenden<br />
Fakultäten wenn schon keine nennenswerten<br />
Entwicklungsmöglichkeiten, so doch<br />
möglichst frühzeitig ein möglichst hohes Maß an<br />
Planungssicherheit zu geben.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich und von<br />
dem für Studium und Lehre verantwortlichem
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bericht des Vizepräsidenten<br />
Präsidiumsmitglied sehr dankbar festzuhalten, dass<br />
alle Fakultäten in der inneren Verarbeitung des<br />
Bologna-Prozesses in diesem Jahr entscheidende<br />
Fortschritte gemacht haben.<br />
Bei den Abstimmungsgesprächen zur Vorbereitung<br />
der Zielvereinbarung 2004 der Hochschule mit dem<br />
Land wurde deutlich, dass ausnahmslos alle<br />
Fakultäten spätestens zum WS 05/06 Studierende<br />
nur noch in Bachelor- und Masterstudiengänge<br />
zulassen wollen.<br />
Der Modularisierungsgedanke hat sich durchgesetzt.<br />
Die bisher vorliegenden Projektskizzen lassen<br />
erkennen, dass die zentralen Anliegen von Bologna<br />
umgesetzt werden. Es sind nicht graduelle<br />
Veränderungen des bisherigen Studienangebots<br />
verbunden mit einem neuen Abschluss, sondern<br />
tatsächlich neue Studiengangsmodelle, die gestuft<br />
ein flexibleres Studieren mit individueller Profilbildung<br />
ermöglichen werden.<br />
Im Sommersemester 2003 wurde erstmalig die in<br />
Zukunft regelmäßig stattfindende Lehrevaluation<br />
nach § 5 Absatz 2 NHG durchgeführt. In Abstimmung<br />
mit allen Studiendekaninnen und<br />
Studiendekanen wurde ein einheitlicher Fragebogen<br />
verwendet, der den Studierenden am Semesterende<br />
vier Wochen online zur Verfügung stand. Über<br />
individuelle Zugriffs-nummern war gewährleistet,<br />
dass jeder Studierende jede von ihm belegte<br />
Lehrveranstaltung genau einmal anonymisiert<br />
beurteilen konnte.
Insgesamt wurden 1054 Lehrveranstaltungen bewertet.<br />
Der Rücklauf lag bei den einzelnen Fakultäten<br />
zwischen knapp 30 und 60 Prozent. Das ist für<br />
eine vollkommen freiwillige Online-Befragung, die<br />
zudem unter großem Zeitdruck eingeführt werden<br />
musste, ein sehr hoher Wert. Dies zeigt die<br />
Ernsthaftigkeit und das Interesse der Studierenden<br />
an diesem neuen Instrument der Qualitätskontrolle.<br />
Das Verfahren wird im Laufe der nächsten Semester<br />
optimiert werden, wobei die Grundlinien klar sind<br />
und beibehalten werden: Ziel ist nicht die Überwachung<br />
der Lehrenden, sondern eine konstruktive<br />
Rückkoppelung zwischen Studierenden, Studiendekaninnen<br />
und Studiendekanen und Lehrenden<br />
zum Zwecke der Qualitätssteigerung der Lehre.<br />
Einen Überblick über die Veränderungen im Bereich<br />
der Internationalisierung gibt der Bericht des<br />
Akademischen Auslandsamtes.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen
Berichte der Fakultäten/Fachbereiche<br />
Fakultät<br />
Bauwesen<br />
Geschäftsführender Dekan<br />
Prof. Dipl.-Ing. Martin Thumm<br />
Dekan<br />
Prof. Dr.-Ing. Wilfried Ohm<br />
Vorwort<br />
Mit Beginn des Sommersemesters 2003 sind die<br />
jeweils an den Standorten Hildesheim und Holzminden<br />
vorhandenen Baustudiengänge Architektur<br />
und Bauingenieurwesen, die Studiengänge<br />
Immobilienwirtschaft und -management, der<br />
Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen in<br />
Holzminden und der Studiengang Holzingenieurwesen<br />
in Hildesheim in der Fakultät Bauwesen<br />
zusammengefasst worden. Geleitet wird die Fakultät<br />
entsprechend dem NHG von nunmehr einem<br />
Dekanat, dem jeweils zwei Studiendekane und ein<br />
Dekan oder Geschäftsführender Dekan aus den<br />
Standorten Holzminden und Hildesheim angehören.<br />
In dem erstmalig eingesetzten standortübergreifenden<br />
Fakultätsrat fand wie auch in dem Dekanat ein<br />
intensiver Gedankenaustausch zur Gestaltung der<br />
neuen Fakultät Bauwesen statt. Auch die jeweilige<br />
Zuständigkeit zwischen dem Dekanat und dem<br />
Fakultätsrat war Gegenstand der Diskussionen.<br />
Als sehr zeitaufwendig haben sich für die Mitglieder<br />
im Dekanat und im Fakultätsrat die Fahrten<br />
zwischen Holzminden und Hildesheim und umgekehrt<br />
erwiesen. So soll zukünftig mehr als bisher<br />
die im Wintersemester eingerichtete Tele-Teaching
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Strecke zwischen Hildesheim und Holzminden für<br />
die Besprechungen in Anspruch genommen werden.<br />
Erste Versuche haben gezeigt, dass der Umgang<br />
mit dieser neuen Technologie Aufgeschlossenheit<br />
und eine gewisse Umstellung für die Mitglieder erfordert<br />
– Learning by Doing scheint hier der richtige<br />
Weg zu sein.<br />
Die Gestaltung der neuen Bachelor- und Master-<br />
Studiengänge zur Umsetzung des Bologna-<br />
Prozesses hat bei der Frage ob drei, dreieinhalb<br />
oder vier Jahre Regelstudienzeit richtig sind, zu<br />
zahlreichen engagierten Diskussionen geführt.<br />
Erschwerend dazu war die Ungewissheit über die<br />
von der Landesregierung beabsichtigten Haushaltsund<br />
Personaleinsparungen sowie die vorgesehenen<br />
Standort- bzw. Studiengangsschließungen.<br />
Ein Jahr Zusammenarbeit im Dekanat und<br />
Fakultätsrat hat trotz der vielen Aufgaben, wie<br />
– Gestaltung der neuen Studiengänge<br />
– Zusammenarbeit in einer Fakultät<br />
– Bewältigung der Standortentfernung<br />
– Bereitschaft zur Lehre an beiden Standorten<br />
– Haushalts- und Personaleinsparungen<br />
zu mehr gegenseitigem Verständnis und Rücksichtnahme<br />
bei den jeweiligen Problemen in den<br />
Standorten geführt. Mit Zuversicht, Engagement und<br />
Sachkenntnis werden die Professorinnen/Professoren<br />
und Mitarbeiter/innen der Fakultät Bauwesen<br />
die Lösung der Aufgaben vorantreiben.
Studiengang<br />
Architektur Hildesheim<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr. Georg Klaus<br />
Studienangebot<br />
Der Studiengang Architektur Hildesheim bietet auch<br />
weiterhin ein allgemeines, grundständiges<br />
Architekturstudium an als Voraussetzung und<br />
Grundlage für eine Tätigkeit als europaweit anerkannte<br />
Architektin bzw. anerkannter Architekt,<br />
entsprechend den Empfehlungen des Fachbereichstags<br />
Architektur Deutschland und übergeordnet den<br />
Anforderungen der EU-Richtlinie Architektur.<br />
Die Einführung der ECTS-Bewertung, eines Punktesystems<br />
zur Anerkennung von Studienleistungen,<br />
hat sich bewährt und erleichtert den Wechsel von<br />
Hochschulen für die Studierenden. Voraussetzung<br />
für das Studium bleibt ein sechsmonatiges<br />
Vorpraktikum in einem der Bauhauptberufe. Damit<br />
soll sichergestellt werden, dass die zum besseren<br />
Verständnis notwendige Anschauung des Tätigkeitsfeldes<br />
zuvor erfolgte.<br />
Die Diversifizierung im Bauwesen, die Entwicklung<br />
neuer Techniken im Bereich des Bauens und<br />
Planens sowie die Vernetzung aller am Bau<br />
Beteiligten und die daraus erwachsenden Weiterungen<br />
des Tätigkeitsfeldes der Architektinnen und<br />
Architekten machen hinsichtlich der Anerkennung<br />
des Vorpraktikums eine Prüfung in Einzelfällen<br />
zunehmend notwendig. Im Rahmen der Fortschreibung<br />
der Prüfungsordnung werden auch weiterhin<br />
die Kriterien zu Inhalt, Form und Dauer des Vorpraktikums<br />
diskutiert werden müssen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Veränderungen des Studienangebotes<br />
Mit der an den hochschulweit allgemeinen Teil angepassten<br />
Prüfungsordnung und mit dem speziellen<br />
Teil für den Studiengang Architektur wurde auch das<br />
Projektstudium verstärkt. Durch Modifizierung<br />
wurde außerdem der übergreifende Fächerbezug,<br />
d. h. die Einbindung von weiteren Fächern wie<br />
Städtebau, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik<br />
in das Projektstudium erreicht.<br />
Projektstudium und Praxisbezug<br />
Ebenso wurde die studiengangsübergreifende<br />
Zusammenarbeit mit den Bauingenieuren im Projekt<br />
verstärkt fortgesetzt. So ist ein zweisemestriges,<br />
gemeinsames Studienprojekt für Studierende beider<br />
Studiengänge in der gültigen Prüfungsordnung<br />
bereits umgesetzt, indem im praktischen Lehrbetrieb<br />
Studierende beider Studiengänge an einer<br />
gemeinsamen zweisemestrigen Projektübung<br />
teilnehmen. Ziel dieser Bemühungen wird sein, die<br />
Studierenden noch näher an den Praxisfall heranzuführen<br />
und sie zu befähigen, auch insbesondere<br />
im Team erfolgreich zu arbeiten. Zudem entstehen<br />
aus der fakultätsinternen Zusammenarbeit der<br />
unterschiedlichen Studiengänge Synergien, die<br />
direkt Eingang in die Lehre finden.<br />
Modularisierung<br />
Seit Ende des Jahres 2001 und bis zum Jahre 2004<br />
wird von Vertretern der Baustudiengänge die<br />
Landesstudie „Modularisierung und Einführung<br />
eines Leistungspunktesystems in den Studiengän-
gen Architektur und Bauingenieurwesen der<br />
niedersächsischen Fachhochschulen“ erarbeitet, in<br />
die auch der Studiengang Architektur eingebunden<br />
ist. In dieser Studie werden die Möglichkeiten und<br />
Probleme untersucht, die mit der geplanten<br />
Modularisierung der Studiengänge im Bauwesen<br />
und mit den damit verbundenen Leistungspunktesystemen<br />
entstehen. Dazu gehört auch die<br />
Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen<br />
(Bachelor/Master of Arts, Science oder Engineering),<br />
voraussichtlich zum Wintersemester 2004/2005.<br />
Vertiefungsstudium Denkmalpflege<br />
Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, das<br />
Vertiefungsstudium in ein Masterstudium mit dem<br />
Abschluss Master of Science überzuführen. Der<br />
Beginn dieses Masterstudiums ist für das WS 05/06<br />
geplant. Bis dahin wird das Schwerpunktstudium<br />
Denkmalpflege in der bewährten Form der<br />
Vertiefung angeboten und diese Qualifizierung mit<br />
einem Zertifikat neben der Diplomurkunde<br />
bestätigt.<br />
Dieses Angebot besteht für Studierende der Fakultät<br />
Bauwesen mit den Studiengängen Architektur,<br />
Bauingenieur- und Holzingenieurwesen, sowie für<br />
die Fakultät Gestaltung mit dem Studiengang<br />
Farbdesign, Vertiefung Denkmalpflege. Die<br />
Studierenden können derzeit innerhalb ihrer jeweils<br />
grundständigen Studiengänge das Angebot von<br />
acht speziellen Wahlpflichtfächern zu Themen der<br />
Denkmalpflege wahrnehmen. Neben den Kernfächern<br />
dieses Kataloges gibt es für die verschiedenen<br />
Studiengänge entsprechend ausgerichtete
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Schwerpunkte. Damit trägt der Fachbereich der<br />
massiven Verlagerung der Neubautätigkeit in den<br />
Altbaubereich weiterhin Rechnung.<br />
Die örtliche Nähe beteiligter Studiengänge und die<br />
Verbindungen zu Institutionen (Niedersächsisches<br />
Landesamt, Fachbereich Konservierung und<br />
Restaurierung, Hornemann-Institut, Universitäten in<br />
Hildesheim, Hannover und Braunschweig,<br />
städtische Archive und Museen), die Einbeziehung<br />
der lehrenden Personen sowie des labor- und<br />
gerätetechnischen Equipments ist seit vielen<br />
Semestern die Basis für ein produktives Zusammenwirken,<br />
das auf der Grundlage angewandter<br />
Wissenschaft Diplomarbeiten zu architektur- und<br />
stadtbaugeschichtlichen Themen der Region<br />
(Weltkulturerbe St. Michaelis) und des gesamten<br />
niedersächsischen Raumes (Münsterländische<br />
Klöster und Wasserburgen, Lüneburger Rathaus<br />
etc.) als Forschungsarbeiten ermöglicht und sich in<br />
entsprechenden Veröffentlichungen widerspiegelt.<br />
Inzwischen nehmen mit zehn bis fünfzehn<br />
Teilnehmern pro Semester etwa 20 – 30 Prozent der<br />
Studierenden das Angebot wahr. Die damit<br />
verbundenen Gruppengrößen haben sich als sehr<br />
effizient erwiesen.<br />
Kooperation mit ausländischen Hochschulen<br />
Zur Öffnung in den europäischen Raum sind Partnerschaften<br />
nach Ost und West entwickelt worden,<br />
die sich durch einen regelmäßigen Austausch
Studierender mit den Möglichkeiten entsprechender<br />
Qualifizierung durch „Doppeldiplome“ (Anerkennung<br />
jeweils zweier beteiligter Hochschulen)<br />
auszeichnen. In diesem Zusammenhang ist die<br />
verbindliche Teilnahme an einem Wahlfach fachtechnische<br />
Fremdsprache.<br />
In diesen Rahmen gehört auch die Beschäftigung<br />
mit dem angelsächsischen Vergaberecht für<br />
Bauleistungen, das in der Regel außerhalb<br />
Deutschlands im Bauwesen Anwendung findet. In<br />
zunehmendem Maße kommen ausländische<br />
Studierende, besonders aus Polen, Holland und<br />
Russland, zum Studium nach Hildesheim. Das<br />
bereichert das weltoffene Bild des Studienganges<br />
bzw. der Fakultät und trägt dazu bei, noch mehr<br />
einheimische Studierende anzuregen, über<br />
Auslandsaufenthalte nachzudenken.<br />
Nach einer gewissen Bereinigung hat sich die<br />
Internationale Kooperation konsolidiert. Aktiv findet<br />
Austausch sowohl unter Studierenden als auch<br />
unter Lehrenden statt mit den Architektur-<br />
Studiengängen:<br />
– Niederlande Hogeschool van Utrecht<br />
– Polen TU Danzig<br />
TU Krakau<br />
– Russland Bau-Universität Rostow am<br />
Don<br />
– Ungarn TU Budapest
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Bauen International<br />
Für den außereuropäischen Bereich (Süd-, Mittelund<br />
Nordamerika, Zentralafrika, Indonesien und<br />
Australien) bildet das Vertiefungsstudium Bauen<br />
International ein entsprechendes Angebot. War<br />
dieses Fach in der Vergangenheit primär vom<br />
Gedanken der technischen Entwicklungshilfe<br />
geprägt, so stehen heute die Spezifika und<br />
Besonderheiten der jeweiligen Länder in klimatischtechnischer,<br />
baustoffkundlicher, wirtschaftlicher<br />
und gesellschaftlicher Hinsicht sowie die Fähigkeit<br />
zu flexibler Reaktion und sozialer Kompetenz<br />
(„social skills“) im Mittelpunkt. Ein entsprechendes<br />
Lehrangebot besteht, die Diplomarbeiten spiegeln<br />
die Thematik wider.<br />
Studienerfolg<br />
Interessant ist, dass sich die durchschnittliche<br />
Studiendauer, wenn auch in kleinen Schritten, ganz<br />
allmählich verlängert. Dies kann als Tendenz<br />
gewertet werden, dass immer mehr Studierende<br />
nicht so sehr auf ein zügiges Studium schauen,<br />
sondern Gründe haben, ihr Studium etwas zu<br />
verlängern. Das kann daran liegen, dass parallel<br />
zum Studium Geld verdient werden muss, dass vor<br />
Beginn der Diplomarbeit sämtliche anderen<br />
Leistungen abgeschlossen sein sollen, dass wegen<br />
der schwierigen Arbeitsplatzsituation am Baumarkt<br />
die Zeit für eine Vertiefung genutzt wird oder dass<br />
bereits eine Familie gegründet wurde.
Ebenso stellt der Studiengang fest, dass zunehmend<br />
Studierende mehr Wahlpflichtfächer belegen<br />
als nach der DPO mindestens erforderlich. Hierfür<br />
werden sowohl das reichhaltige thematische<br />
Angebot des Studienganges als auch der Konkurrenzdruck<br />
bei künftigen Bewerbungen die<br />
ausschlaggebenden Gründe sein.<br />
Die Kolleginnen und Kollegen des Lehrkörpers<br />
stellen fest, dass leider auch die Probleme in den<br />
Grundlagenfächern zunehmen. So sind Allgemeinbildung<br />
und Grundkenntnisse, z. B. die Rechtschreibkenntnisse<br />
und vor allem mathematische<br />
Kenntnisse häufig mangelhaft. Während viele<br />
Studierende wenige Probleme mit der Einarbeitung<br />
in die EDV haben, fehlen bei ihnen räumliches<br />
Vorstellungsvermögen und technisch-wissenschaftliches<br />
Denken. Beide Fähigkeiten sind jedoch<br />
unabdingbar für ein erfolgreiches Architekturstudium.<br />
Trotz der Teilung der Lerngruppen zur<br />
Intensivierung der Betreuung, soweit dies die<br />
Kapazität zulässt, erkennen Studierende oft erst zu<br />
spät, dass sie sich nicht für eine Studienrichtung<br />
passend zu ihren Fähigkeiten entschieden haben.<br />
Und trotz einer Beratung und Empfehlung durch die<br />
Professorenschaft stellt sich nicht die Einsicht ein,<br />
die Studienrichtung zu wechseln.<br />
Weiterbildung<br />
Erfolgreich fortgesetzt wurden die „Architekturgespräche“,<br />
zu denen seit Jahren etwa jeden Monat<br />
Referenten eingeladen werden, um aus ihrer
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
berufspraktischen Tätigkeit zu berichten. Diese<br />
hochschulöffentliche Veranstaltungsreihe mit<br />
Berufskolleginnen und -kollegen aus den unterschiedlichsten<br />
Tätigkeitsfeldern des Architekten aus<br />
dem In- und Ausland hat sich zu einem beliebten<br />
Treffen studierender wie tätiger Architekten<br />
etabliert.<br />
Entwicklung<br />
Die auf den Zahlen der Bewerbungen, Zulassungen<br />
und tatsächlich erfolgten Immatrikulationen<br />
basierenden statistischen Kurven haben sich in den<br />
letzten Semestern mit einer Tendenz zur Überlagerung<br />
angenähert. Insgesamt muss daraus auch<br />
eine Tendenz zum möglichen Rückgang der<br />
Studierenden für den Studiengang Architektur abgeleitet<br />
werden. Durch die weitreichende Aufhebung<br />
des NC konnte dem entgegengewirkt werden.<br />
Die leicht zurückgehende Zahl der Bewerber kann in<br />
der Zukunft dazu führen, dass die zur Verfügung<br />
stehenden Plätze nicht mehr alle angenommen<br />
werden, wie dies bereits bundesweit bei den<br />
Bauingenieuren der Fall ist. Dies bringt einerseits<br />
den Nachteil, dass der Notenquerschnitt der<br />
Bewerber auf ein niedrigeres Niveau sinkt, was sich<br />
in der Folge als mangelnde Vorbildung der<br />
Studierenden auswirkt; andererseits würden jedoch<br />
kleinere Semester die Chance bieten, die Betreuung<br />
zu intensivieren. Dieses seit Jahren vorgetragene<br />
Anliegen der Lehrenden ist bisher kaum berücksichtigt<br />
worden, weil es mit mehr Lehrkapazität ver-
unden ist. Gerade aber im künstlerisch-kreativen<br />
Bereich der Architekturausbildung ist eine gute<br />
Betreuung zur Förderung der Fähigkeiten wesentlich.<br />
Häufig musste in der Vergangenheit viel Zeit<br />
aufgewendet werden, um Studierenden durch<br />
wiederholtes Prüfen zu verdeutlichen, dass sie<br />
wenig geeignet sind für den erstrebten Beruf; diese<br />
Zeit geht den zu Fördernden leider verloren.<br />
Der Studiengang beabsichtigt, gerade diesem<br />
Problem durch das Angebot einer individuellen<br />
Studienberatung am Anfang des Studiums entgegenzuwirken<br />
und im Rahmen inzwischen bewährter<br />
Tutorenprogramme für das immer wichtiger<br />
werdende Selbststudium als Untermauerung und<br />
Ergänzung der Lehre fakultative Nachkurse und<br />
Proseminare anzubieten.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen
Studiengänge<br />
Bauingenieurwesen und<br />
Holzingenieurwesen Hildesheim<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr.-Ing. Axel Stödter<br />
Studienangebot<br />
Die Fakultät Bauwesen bietet u. a. die beiden<br />
Studiengänge<br />
– Bauingenieurwesen<br />
– Holzingenieurwesen<br />
am Standort Hildesheim an. Innerhalb dieser Studiengänge<br />
ist die Wahl des Studienschwerpunktes<br />
„Bauen International“ möglich.<br />
Grundlage für das Studium ist die seit Sommersemester<br />
2002 eingeführte Diplomprüfungsordnung.<br />
Sie besteht aus einem allgemeinen Teil (gilt für<br />
die gesamte Fachhochschule) und dem besonderen<br />
Teil (gilt nur für die genannten Studiengänge).<br />
Studienerfolg<br />
Die nachfolgenden Tabellen zeigen, dass in den<br />
vergangenen Studienjahren trotz rückläufiger<br />
Bewerberzahlen die Zahl der Immatrikulationen im<br />
Studiengang Holzingenieurwesen erhöht wurde.<br />
Dies war durch eine Erhöhung der Zahl der<br />
Lehrbeauftragten möglich, die den Studiengängen<br />
zugeordneten Professoren sind voll ausgelastet.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Studiengang Bauingenieurwesen<br />
Immatrikulationen<br />
Studierende im<br />
Studiengang<br />
Absolventen<br />
Durchschnittliche<br />
Studiendauer<br />
(aktualisiert März 2004)<br />
SS WS SS WS SS WS SS<br />
2000 00/01 2001 01/02 2002 02/03 2003<br />
22 49 26 53 13 56 18<br />
408<br />
38<br />
10,2<br />
394<br />
33<br />
10,9<br />
Studiengang Holzingenieurwesen<br />
Immatrikulationen<br />
Studierende im<br />
Studiengang<br />
Absolventen<br />
Durchschnittliche<br />
Studiendauer<br />
Ausstattung<br />
Das Labor für Holztechnik (LHT) besteht seit 1987<br />
unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. M. H. Kessel.<br />
Neben der Unterstützung der Ausbildung der<br />
Studenten des Studienganges Holzingenieurwesen<br />
führt das Labor für Holztechnik LHT als bauaufsichtlich<br />
anerkannte Überwachungs- und Zertifizierungsstelle<br />
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben<br />
aus dem Bereich Ingenieurholzbau durch. Im<br />
372<br />
22<br />
10,2<br />
384<br />
19<br />
10,0<br />
361<br />
30<br />
11,0<br />
361<br />
29<br />
11,6<br />
317<br />
25<br />
11,4<br />
SS WS SS WS SS WS SS<br />
2000 00/01 2001 01/02 2002 02/03 2003<br />
39 40 26 75 18 58 27<br />
240<br />
25<br />
9,6<br />
242<br />
16<br />
9,1<br />
245<br />
22<br />
8,8<br />
284<br />
22<br />
8,7<br />
274<br />
20<br />
9,3<br />
295<br />
23<br />
8,7<br />
285<br />
27<br />
8,8
Rahmen seiner Tätigkeit als anerkannte Prüfstelle<br />
arbeitet das LHT eng mit mittelständischen<br />
Holzbauunternehmen zusammen. In Zusammenarbeit<br />
mit der Qualitätsgemeinschaft Holzbau und<br />
Ausbau e. V. führen Mitarbeiter des LHT Qualitätsüberwachungen<br />
durch. Das Labor für Holztechnik<br />
führt als anerkannte Prüfstelle in Kooperation<br />
mit Baustoff- und Verbindungsmittelherstellern<br />
sowie Fertigungsbetrieben Untersuchungen zu verschiedensten<br />
aktuellen baupraktischen Problemen<br />
durch.<br />
Ausstattung des LHT:<br />
– Belastungsrahmen mit zwei servohydraulischen<br />
Prüfzylindern (160kN Zug/250kN Druck)<br />
– Universalprüfmaschine 20 kN<br />
– Begehbare Klimakammer mit<br />
B x H x L = 24,0 x 2,40 x 5,00 m 3 ,<br />
t= 3°– 43°C, H = 10 – 90 % rel. Luftfeuchte<br />
– Elektronische Messkette mit diversen Kraft- und<br />
Wegaufnehmern<br />
– Präzisionswaagen<br />
Forschungsschwerpunkte:<br />
– Tragverhalten von Holztafeln für Holzhäuser in<br />
Tafelbauart<br />
– Holz-Holz und Holz-Holzwerkstoffverbindungen<br />
Prüftätigkeit:<br />
– Bestimmung von Werkstoffeigenschaften<br />
– Anschlussprüfungen<br />
– Bauteilprüfungen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Prüftätigkeit in 2003:<br />
– Prüfung der Festigkeit und Steifigkeit des<br />
Verbundes von FERMACELL-Gipsfaserplatten mit<br />
der bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-434<br />
mit Rippen aus Nadelholz für Holztafeln nach<br />
DIN 1052: 2002-02 und Eurocode 5 (Fels)<br />
– Prüfung einer Balkenschuhverbindung<br />
(Heggenstaller AG)<br />
– Prüfung eines Systemverbinders<br />
(Holzbau Cordes)<br />
– Ermittlung des Fließmoments entsprechend<br />
DIN EN 409 von Schnellbauschrauben<br />
TN 3,5 x 55 mm und TN 3,9 x 45 mm<br />
(Knauf Gips KG)<br />
– Zeitgeraffte klimatische Beanspruchung von<br />
Treppenstufen<br />
(Partnergemeinschaft Holztreppenhersteller)<br />
Das Institut für Prüfung und Forschung im Bauwesen<br />
(IPBF) Hildesheim e. V. ist ein gemeinnütziges An-<br />
Institut, das der Fakultät Bauwesen zugeordnet ist.<br />
Es hat sich die Aufgabe gestellt, Forschung und<br />
Lehre durch praxisbezogene Forschungsprojekte zu<br />
fördern, Ergebnisse in der Praxis sowie auch<br />
besonders in der Lehre anzuwenden und Prüfverfahren<br />
weiter zu entwickeln. Dazu stellt es moderne<br />
technische Ausstattung für diese Aufgaben und die<br />
Lehre in den Studiengängen zur Verfügung, auf<br />
die im Rahmen von Lehrveranstaltungen und<br />
Diplomarbeiten zurückgegriffen werden konnte. Als<br />
Prüfstelle für Schallschutz liegt eine Zertifizierung<br />
für die Durchführung von Güteprüfungen nach
DIN 4109 vor. Schwerpunkte der Arbeiten, in die<br />
studentische Hilfskräfte eingebunden sind, liegen<br />
ferner im Bereich der Raumakustik, des Wärme- und<br />
des Feuchteschutzes. Erwähnenswert ist, dass<br />
durch die Arbeit des IPFB eine wesentliche<br />
Verbesserung der Raumakustik für die St. Andreaskirche<br />
erreicht werden konnte. Dies dokumentierten<br />
erstmals die Chorkonzerte der „Romantischen<br />
Nacht 2003“.<br />
Das IPFB feierte am 29.03.2003 sein 40-jähriges<br />
Bestehen mit großer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit.<br />
Das Labor für Bearbeitungstechnik im Studiengang<br />
Holzingenieurwesen ist mit einer Super Computing<br />
Work Station (HPJ 210) und einer CNC/DNC-<br />
Fertigungslinie ausgestattet und steht für Ausbildungs-<br />
und Forschungszwecke zur Verfügung.<br />
In dem Neubau am Goschentor stehen insbesondere<br />
dem Studiengang Holzingenieurwesen drei<br />
weitere Laborräume für die Ausbildung zur Verfügung:<br />
– Labor für Bearbeitungstechnik<br />
– Labor für Möbeltechnik<br />
– Labor für Möbelkonstruktion<br />
Das aus Drittmitteln finanzierte Trockenbaulabor in<br />
den Kellerräumen des Gebäudes Hohnsen 1 nimmt<br />
eine wichtige Funktion in der Lehre wahr.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Das EDV-gestützte Labor für Massivbau mit<br />
15 studentischen Arbeitsplätzen konnte nun nach<br />
Umbau in einem großzügig gestalteten Raum untergebracht<br />
werden. Der PC-Raum weist 16 Rechner<br />
und Flachbildschirme auf.<br />
Mitwirkung in Gremien<br />
Die Professoren der Studiengänge nehmen regelmäßig<br />
an den Fachbereichstagen, den Fachausschuss-Sitzungen<br />
der Fachbereichstage und an den<br />
Dekanetreffen teil.<br />
Prof. Dr. H.-J. Collin<br />
– Vorsitzender des Arbeitskreises „Umfeldverträgliche<br />
Verkehrsbelastung“ der Deutschen<br />
Forschungsgesellschaft für Straßen- und<br />
Verkehrswesen<br />
– Mitglied im Arbeitsausschuss „Sonderfragen des<br />
Stadtverkehrs“ der Deutschen Forschungsgesellschaft<br />
für Straßen- und Verkehrswesen<br />
– Mitglied im Deutschen Forum Mensch und<br />
Verkehr<br />
Prof. Dr. U. Gerhardt<br />
– Mitarbeiter im Unterausschuss UA-4.1 (Holztrocknung)<br />
der Deutschen Gesellschaft für<br />
Holzforschung e. V.<br />
– Vorstandsmitglied des Fördervereines Holztechnik<br />
an der Fachhochschule Hildesheim/<br />
Holzminden e. V.<br />
– Mitglied im Verbraucherrat des Deutschen Instituts<br />
für Normung e. V., UA 5.1.5 „Polstermöbel“
Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />
– Präsident der WTA, Wissenschaftlich-Technische<br />
Arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und<br />
Bauwerkserhaltung in Europa<br />
– Mitglied der CEN TC 524 WG9<br />
„Dachunterspannbahnen – Unterdeckungen“<br />
– Mitglied der Arbeitsgruppe „Simulationsverfahren“<br />
im Referat 6 – Grundlagen der WTA<br />
Prof. N. Nebgen<br />
– Arbeitsausschuss AA8 „Brandverhalten von Holz<br />
und Holzwerkstoffen“ der Deutschen Gesellschaft<br />
für Holzforschung (DGfH) in München<br />
– Arbeitsausschuss AA15 „Holzbau und Computer“<br />
der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung<br />
(DGfH) in München<br />
– Gruppe „Hochschulprojekte“ der Arbeitsgemeinschaft<br />
Holz<br />
Prof. A. Nentwig<br />
– Mitglied im DIN-Ausschuss für Möbel<br />
Prof. Dr. M. Ringkamp<br />
– Ständiges Mitglied der DAAD-Auswahldelegation<br />
Indonesien<br />
Prof. Dr. A. Stödter<br />
– Mitglied im Norddeutschen Wasserzentrum<br />
– Berater im Unterausschuss „Gestaltung und<br />
Bewirtschaftung der Gewässer nach EU-Wasserrahmenrichtlinie“<br />
der Länderarbeitsgemeinschaft<br />
Wasser
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
– Mitglied im Strategischen Arbeitskreis zur Neuordnung<br />
der Wasserwirtschaft in Niedersachsen<br />
– Mitglied der ATV-DVWK-Arbeitsgruppe „Hochwasservorhersage<br />
mit Fuzzy Logic“<br />
Prof. A. C. Toepfer<br />
– Obmann der Arbeitsausschüsse für die ATV DIN<br />
18 307 „Verbauarbeiten“ und ATV DIN 18 319<br />
„Rohrvortriebsarbeiten“ der VOB Teil C<br />
Forschungstätigkeiten<br />
Prof. Dr. H.-J. Collin<br />
– „Wirkungen des Semestertickets in Hildesheim“<br />
Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />
– „Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />
Häuser – baubiologische Aspekte“, AGIP-<br />
Forschung F. A. Nr. 2002.483<br />
Veröffentlichungen<br />
Prof. Dr.-Ing. H.-J. Collin<br />
– Mitautor des Standardwerkes „Stadtverkehrsplanung“<br />
(Springer-Verlag, 2003)<br />
– Mitautor für das „Handbuch der Kommunalen<br />
Verkehrsplanung“ (Beiträge: Belastbarkeit der<br />
Straßen und der Stadt im Kfz-Verkehr, Verkehrstechnische<br />
Datenerhebungen, Verkehrsverhaltensbezogene<br />
Datenerhebungen, Verträglichkeitsanalysen<br />
in der Kommunalen Verkehrsplanung)<br />
– Mitautor am Stadtleitbild von Hildesheim
Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />
– MSR VI, 6th International Conference „Materials<br />
Science and Restauration“, Karlsruhe<br />
1. „Climate stability of historical museums;<br />
Building physics calculations at the Herzog-<br />
Anton-Ulrich Museum of Brunswick“<br />
2. „Climate stability of historical muesums –<br />
Research of temperture and moisture<br />
reaction in areas close to outer walls,<br />
consequences regarding the buildings and<br />
the exhibits“<br />
– Weimarer Bauphysiktage, Weimar<br />
„Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit von<br />
Energiemaßnahmen an Gebäuden im Bestand“<br />
– IBK-Feuchteschäden, Berlin<br />
(1. Simulation von Feuchte- und Wasserschäden<br />
– Möglichkeiten zur ganzheitlichen Betrachtungsweise<br />
des Temperatur- und Feuchteverhaltens in<br />
Gebäuden; 2. Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />
Häuser – baubiologische Aspekte)<br />
Vorträge und Seminare<br />
Prof. Dr.-Ing. H.-J. Collin<br />
– Braucht die Landeshauptstadt Kiel eine Stadtregionalbahn?<br />
(Kiel, im Januar 2003)<br />
– Grundzüge des neuen Busliniennetzes in Goslar<br />
(Goslar, im Februar 2003)<br />
– Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt von<br />
Bremen (Bremen, im Mai 2003)<br />
– Ideen zur Umgestaltung der ZOB-Anlage in<br />
Hildesheim (Hildesheim, im April 2003)
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
– Busoptimierung in Hildesheim<br />
(Hildesheim, im Mai 2003)<br />
– Wie ist in Wolfsburg eine Mobilitätszentrale zu<br />
gestalten? (Wolfsburg, im Juni 2003)<br />
– Durchführung einer Direkt-Marketing-Aktion<br />
(Mülheim an der Ruhr, im September 2003)<br />
– Marktpotenziale im ÖPNV<br />
(Lüdenscheid, im Oktober 2003)<br />
– Erfassung des Wirtschaftsverkehrs in Hildesheim<br />
(Hildesheim, im November 2003)<br />
Prof. Dr. H.-P. Leimer<br />
– MSR VI, 6th International Conference „Materials<br />
Science and Restauration“, Karlsruhe<br />
(1. „Climate stability of historical museums;<br />
Building physics calculations ot the Herzog-<br />
Anton-Ulrich Museum of Brunswick“;<br />
2. „Climate stability of historical muesums –<br />
Research of temperture and moisture reaction in<br />
areas close to outer walls, consequences<br />
regarding the buildings and the exhibits“)<br />
– Weimarer Bauphysiktage, Weimar<br />
„Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit von<br />
Energiemaßnahmen an Gebäuden im Bestand“<br />
– IBK-Feuchteschäden, Berlin<br />
(1. Simulation von Feuchte- und Wasserschäden<br />
– Möglichkeiten zur ganzheitlichen Betrachtungsweise<br />
des Temperatur- und Feuchteverhaltens in<br />
Gebäuden; 2. Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />
Häuser – baubiologische Aspekte)
Internationale Kooperationen<br />
Im Wintersemester 2002/2003 waren im Studienschwerpunkt<br />
„Bauen International“ 56 Studierende<br />
der Architektur, des Bau- und Holzingenieurwesens<br />
eingeschrieben.<br />
Im Rahmen dieses Studienschwerpunktes leisteten<br />
im Wintersemester 2002/2003 und Sommersemester<br />
2003 mehrere Studierende aus Hildesheim<br />
Ingenieurassistenzen in folgenden Ländern ab:<br />
Neuseeland, USA, Tansania, Südafrika, Indien,<br />
Indonesien, Russland, Chile, Brasilien, Mexiko<br />
Im Sommersemester 2003 haben insgesamt fünf<br />
Studierende ein Diplom im Studienschwerpunkt<br />
„Bauen International“ erworben.<br />
Das Labor für Holztechnik arbeitet mit Hochschulen,<br />
Institutionen und Verbänden in der Schweiz, in<br />
Italien, Großbritannien, Frankreich und Belgien<br />
zusammen. Das Labor für Holztechnik ist Mitglied<br />
im NETWORK EUROWOOD.<br />
Die Kooperation mit der Universität für Bauwesen in<br />
Rostow am Don, Russland, wird sehr intensiv<br />
fortgesetzt. Erste Studierende haben ihr Diplom in<br />
Hildesheim erworben und sind nun für ein Jahr an<br />
der Universität Rostow eingeschrieben.<br />
Im Berichtszeitraum hat wiederum ein intensiver<br />
Austausch von Dozenten und Studierenden<br />
stattgefunden.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Doppeldiplom <strong>HAWK</strong>/Universität Rostow am Don<br />
Die Kooperation mit der Staatlichen Bauuniversität<br />
für Bauwesen in Rostow am Don, Russland, hat im<br />
November 2001 zu einem Vertrag über ein<br />
„Doppeldiplom“ geführt. Danach können die<br />
Studierenden der <strong>HAWK</strong> Hildesheim im Studiengang<br />
Bauingenieurwesen nach dem 7. Semester zwei<br />
Semester in Rostow studieren und müssen dort<br />
bestimmte Pflichtfächer bestehen. Ihre Diplomarbeit<br />
schreiben sie danach an der <strong>HAWK</strong> in<br />
Hildesheim. Nach der bestandenen Diplomprüfung<br />
erhalten sie das Diplom von der Fachhochschule<br />
Hildesheim und von der Staatlichen Bauuniversität<br />
für Bauwesen in Rostow am Don.<br />
Die Studierenden der Staatlichen Bauuniversität in<br />
Rostow am Don im Studiengang Bauingenieurwesen<br />
können nach dem 6. Semester zwei Semester an<br />
der Fachhochschule in Hildesheim studieren und<br />
müssen dort bestimmte Pflichtfächer bestehen.<br />
Außerdem müssen sie in Deutschland ein<br />
zweimonatiges Praktikum als Ingenieurassistent<br />
absolvieren. Ihre Diplomarbeit schreiben sie danach<br />
an der Universität in Rostow. Nach der bestandenen<br />
Diplomprüfung erhalten sie das Diplom von der<br />
Staatlichen Bauuniversität für Bauwesen in Rostow<br />
am Don und von der <strong>HAWK</strong> in Hildesheim.<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Berufung zum Beginn des Wintersemesters<br />
2003/2004:<br />
– Prof. Dr.-Ing. Jürgen Vogel<br />
für das Fach „Geotechnik“
Studiengang<br />
Architektur Holzminden<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr.-Ing. Birgit Franz<br />
Studienangebot<br />
Der Studiengang Architektur bietet für Studierende<br />
gemäß Diplomprüfungsordnung 1998 folgende<br />
Studienschwerpunkte an:<br />
– Denkmalpflege und Sanierung<br />
– Baubetrieb und Datenverarbeitung<br />
– Metallbau<br />
sowie gemäß Diplomprüfungsordnung 2003<br />
folgende Kompetenzfelder:<br />
– Allgemeines (AL)<br />
– Baudenkmalpflege (BD)<br />
– Bautechnik (BT)<br />
– Entwurf und Planung (EP)<br />
– Kommunikation (KM)<br />
– Konstruktion (KO)<br />
– Management (MA)<br />
– Metallbau (ME)<br />
Wesentliches Kriterium für die Architektenausbildung<br />
ist, dass in allen drei Studienschwerpunkten<br />
bzw. acht Kompetenzfeldern eine klassische<br />
Architektenausbildung erfolgt, so wie sie von den<br />
entsprechenden Architektenkammern gefordert<br />
wird.<br />
Der Studiengang Architektur bietet neben sechs<br />
Semestern theoretischer Ausbildung zwei berufspraktische<br />
Studiensemester (im 5. und 8. Semester)
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
an. Die Lehrveranstaltungen umfassen gemäß<br />
Diplomprüfungsordnung 1998 insgesamt 168<br />
Semesterwochenstunden, gemäß Diplomprüfungsordnung<br />
2003 insgesamt 158 Semesterwochenstunden.<br />
Der erste Studienabschnitt bis zum Vordiplom<br />
beträgt jeweils drei Semester.<br />
Für die Architekturausbildung bedeutet das Zusammenwachsen<br />
Europas, dass mehrere Fremdsprachen<br />
im Lehrangebot vorhanden sind. Seit dem<br />
Wintersemester 1995/1996 wird neben Englisch und<br />
Französisch auch Spanisch angeboten. Weitere<br />
Fremdsprachenangebote wie Russisch sind in<br />
Vorbereitung.<br />
Die Studienschwerpunkte „Denkmalpflege und<br />
Sanierung“, „Baubetrieb und Datenverarbeitung“<br />
und „Metallbau“ können im 6. und 7. Semester<br />
studiert werden. Die Entscheidung für einen dieser<br />
Schwerpunkte ist im 4. Semester möglich. Das<br />
darauffolgende Praxissemester (5. Semester) kann<br />
in einem dieser Entscheidungen entsprechenden<br />
Unternehmen absolviert werden. In zunehmendem<br />
Maße auch im Ausland.<br />
Die Umstellung auf eine Vertiefung im Rahmen der<br />
Kompetenzfelder gemäß Diplomprüfungsordnung<br />
2003 ermöglicht bereits ab dem 4. Semester eine<br />
neigungsbezogene Ausrichtung des Studiums. Auch<br />
hier kann das darauffolgende Praxissemester<br />
(5. Semester) in einem dieser Entscheidungen<br />
entsprechendem Unternehmen im In- und Ausland<br />
absolviert werden.
Eine besondere Form der Ausbildung von Architekturstudentinnen<br />
und -studenten sind studentische<br />
Wettbewerbe, die im öffentlichen Bereich mit<br />
verschiedenen Aufgabenstellungen stattgefunden<br />
haben.<br />
Studienerfolg<br />
Es ist erfreulich, dass die Studierenden des Studiengangs<br />
Architektur ihr Diplom in der Mehrzahl<br />
innerhalb der Regelstudienzeit absolvieren. Das ist<br />
zurückzuführen auf das straff organisierte Studium,<br />
die große Anzahl der Teilprüfungen, die über die<br />
Studienzeit gut verteilten Hausarbeiten und<br />
Entwürfe sowie die Beschränkung der Lehrveranstaltungen<br />
auf 168 Semesterwochenstunden.<br />
Das Vordiplom liegt gemäß derzeit gültiger<br />
Prüfungsordnungen nach dem dritten Semester.<br />
Die Themenstellungen reichten von Entwurf und<br />
Konstruktion bis hin zu baubetrieblichen Berechnungen<br />
sowie denkmalpflegerischen Fragestellungen.<br />
Die Studierenden in den Semestern A1, A2 und A4<br />
studieren bereits gemäß der Diplomprüfungsordnung<br />
2003.<br />
Studienanfänger<br />
Zulassungsbeschränkungen, außer den geforderten<br />
Eingangsvoraussetzungen, gibt es nicht. Insgesamt<br />
sind zurzeit 279 Studierende im Studiengang<br />
Architektur eingeschrieben. 50 Prozent davon sind
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
weiblich. Im Berichtsjahr 2003 wurden im<br />
Sommersemester 26 und im Wintersemester 43<br />
Studierende aufgenommen.<br />
Besondere Aktivitäten innerhalb der Hochschule<br />
Prof. Helmut Drewes und Prof. Dr. Helmut Sager<br />
– Zusammen mit Dipl.-Arch. U. Hassel wurde in<br />
Vorbereitung auf die neue Prüfungsordnung das<br />
4. Projekt durchgeführt. Dieses Projekt befasste<br />
sich mit leichten weitgespannten Flächentragwerken,<br />
Membrankonstruktionen.<br />
Das Thema war, die Überdachung für das<br />
Sommertheater Stahle zu entwerfen. Ergänzt<br />
wurde die Entwurfsaufgabe durch die Lehrinhalte<br />
Tragwerkslehre und Baustoffkunde. Von<br />
besonderem Interesse für den Erfolg war ein<br />
Workshop mit industrieller Beteiligung durch die<br />
Fa. Cenotec und die betreuenden Korrekturen<br />
durch Herrn R. Lutz und R. Scheuermann von der<br />
Fa. Ove Arup. Die Ergebnisse wurden hochschulöffentlich<br />
in einer Ausstellung präsentiert.<br />
Die Eröffnungsveranstaltung fand großen<br />
Anklang, da das Sommertheater musikalisch die<br />
Ausstellung einleitete. Eine 2. Ausstellung der<br />
Ergebnisse erfolgte im Sommertheater Stahle<br />
während der Eröffnung der Sommerspielzeit.<br />
Prof. Dr. Birgit Franz und Prof. Dr. Jens Kickler<br />
– Ein gemeinsames interdisziplinäres Projekt im<br />
Studiengang Architektur (Themenbereich Denkmalpflege)<br />
und im Studiengang Bauingenieurwesen<br />
(Themenbereich Holzbau) widmete sich
im Sommersemester 2003 der Wiedernutzbarmachung<br />
des denkmalgeschützten Wirtschaftsgebäudes<br />
auf dem Domänenhof Heidbrink. Bei<br />
der Präsentation der Ergebnisse waren Vertreter<br />
des Staatlichen Baumanagements Hildesheim,<br />
unter anderem Leiter Fred Apel, des Landkreises<br />
Holzminden und der Gemeinde Polle sowie der<br />
auf der Domäne lebende Schmiedemeister<br />
Georg Petau anwesend.<br />
– Die denkmalgeschützte Hofanlage Putlitz wurde<br />
wiederum im Wintersemester 2003/2004<br />
gemeinsam von Studierenden des Studiengangs<br />
Architektur und des Bauingenieurwesens untersucht<br />
und bewertet. Aufbauend auf diesen<br />
Ergebnissen wurde eine Machbarkeitsstudie<br />
erarbeitet. Der zugehörige Workshop vor Ort<br />
wurde finanziell von der Bodenverwertungs- und<br />
-verwaltungs-GmbH Berlin finanziell unterstützt.<br />
Die Betreuung vor Ort wurde zusätzlich von<br />
Herrn Liebau, wissenschaftlicher Mitarbeiter,<br />
unterstützt.<br />
Prof. Walter Krings<br />
– Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Elze:<br />
Studentenprojekt im Semester A7 DS, Entwurf<br />
über zwei Semester aufgeteilt in Bestandsanalyse,<br />
Entwicklungskonzept mit Darstellung von<br />
Einzelmaßnahmen, Aussagen zum Stadtmarketing,<br />
Vorschläge für eine Gestaltungssatzung<br />
– Städtebauliche Sanierungsplanung in<br />
Bad Pyrmont für den Stadtkernbereich:<br />
Studentenprojekt Semester A7 DS
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
– Exkursion Toskana:<br />
Freihandzeichnen – Baugeschichte – Architektur<br />
Studienfahrt mit dem Semester A 4<br />
Prof. Reinhard Lamers<br />
– Eröffnung des kommunikationstechnologischen<br />
High-Tech-Zeitalters. Gemeinsam eröffneten<br />
Prof. Hans-Peter Leimer in Hildesheim und<br />
Prof. Reinhard Lamers in Holzminden mit einem<br />
Seminar zum Thema Baukonstruktion und<br />
Bauphysik die neu eingerichtete Strecke für<br />
Teleteaching.<br />
Prof. Dr. Helmut Sager<br />
Bereich Baustoffkunde<br />
– Oberflächentechnik Metall (OTM I + II), Bauphysik<br />
der Baumetalle<br />
– Sondergebiete Betoninstandsetzung, Injektionen,<br />
Beschichtungen von Industrie- und Bodenflächen<br />
– Zusätzlich zu den Lehrveranstaltungen wurden<br />
im 1. und 2. Semester „Freiwillige Übungen“<br />
angeboten.<br />
– Das 1. Semester befasste sich mit der Herstellung<br />
und der Oberflächengestaltung von Ziegeln,<br />
die auch das Aufbringen von Engoben<br />
einschließlich der zugehörigen Brände einschlossen.<br />
Zum Abschluss der Übung wurde aus<br />
den knapp 40 Ziegeln ein Pfeiler im Lichthof der<br />
Fachhochschule aufgemauert, der als Stütze für<br />
die Ausstellungsflächen der Übungsergebnisse<br />
der 2. Semester diente.
– Das 2. Semester hatte die Aufgabe, Beton so<br />
zu formen, dass dabei Fabeltiere entstehen<br />
sollten. Diese Tiere zusammen mit den<br />
Ergebnissen des 1. Semesters füllten zum<br />
Jahresende den Lichthof.<br />
– Semesterbegleitende Übungen, die zum<br />
Pflichtprogramm gehörten, befassen sich im<br />
3. Semester mit Parkett, mit Innen- und<br />
Außenvertäfelung von Wänden. Eine zugehörige<br />
Ausstellung machte die genutzten Holzarten den<br />
einzelnen Sinnen der Ausstellungsbesucher<br />
signifikant nutzbar.<br />
– Das 4. Semester befasste sich in den semesterbegleitenden<br />
Übungen mit dem Diffusionsverhalten<br />
von Unterspannbahnen, wobei sie die<br />
Diffusionsmessungen vorzunehmen hatten. Eine<br />
Ausstellung über die Versuchsergebnisse und<br />
die Verwendung von Unterspannbahnen in Form<br />
einer Postersession schloss diese Arbeit ab.<br />
Bereich Lehmbauseminar<br />
– Im Sommersemester fand in Stadtoldendorf das<br />
7. Sommerlehmbauseminar statt, bei dem die<br />
tatkräftige Unterstützung von Dipl.-Arch. Raetz,<br />
Herrn Liebau und Herrn Jürgens den Erfolg bei<br />
der Weiterführung der Sanierung eines alten<br />
Fachwerkhauses sicherstellte.<br />
Bereich Exkursionen<br />
– Architekturexkursion Graz:<br />
Die Exkursion des 4. Semesters wurde vor Ort<br />
durch zahlreiche Führungen der verantwortlichen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Architekten unterstützt. Hauptanziehungspunkt<br />
waren naturgemäß die Projekte der Europäischen<br />
Kulturhauptstadt 2003.<br />
– Metallbauexkursion München:<br />
Mit den Studierenden des 6. und 7. Semesters<br />
wurden an einem Wochenende bedeutende<br />
Stahlbauten und Umbauten besichtigt, wobei<br />
Bauwerksführungen insbesondere im Neuen<br />
Stadion, Swiss Re, Bürogebäuden Nickel-<br />
Architekten, Feuerwache 8 und der Pinakothek<br />
der Moderne in Erinnerung bleiben.<br />
Weitere Studiengänge<br />
Seit dem Sommersemester 1998 wird in dem<br />
gemeinsam mit dem Studiengang Bauingenieurwesen<br />
gegründeten Institut für Chemie der<br />
Studiengang Bau-Chemie angeboten. Ergänzend<br />
werden Wahl- und Wahlpflichtvorlesungen im Fach<br />
Bau-Chemie gehalten.<br />
Gemeinsam mit dem Studiengang Bauingenieurwesen<br />
wird seit dem Wintersemester 1999/2000<br />
der Studiengang Immobilienwirtschaft und<br />
-management angeboten.<br />
Seit dem Wintersemester 1995/1996 ist vom Ministerium<br />
für Wissenschaft und Kultur der zweisemestrige<br />
Ergänzungsstudiengang „Internationales<br />
Bauen“ als Fortsetzung des früheren „Auslandsbaues“<br />
genehmigt worden. Dieser Ergänzungsstudiengang<br />
ist stufenweise ausbaubar. (Er soll die<br />
Studienschwerpunkte Baumanagement, Immobili-
enwirtschaft, Architektur und Konstruktiven Ingenieurbau<br />
haben.) Mit Baumanagement als erstem<br />
Schwerpunkt wurde im Wintersemester 1996/1997<br />
begonnen. Der Ergänzungsstudiengang erstreckt<br />
sich über zwei Semester und kann mit dem „Master<br />
of Science“ der Kingston University abgeschlossen<br />
werden, der zur Promotion berechtigt. Die<br />
Lehrinhalte sind stark europabezogen und mit dem<br />
Kooperationspartner, der Kingston University in<br />
London, gemeinsam erarbeitet worden. Der<br />
Studiengang konnte in London bereits zum Wintersemester<br />
1994/1995 studiert werden. Angestrebt<br />
wird für die nähere Zukunft auch, den Vertiefungsschwerpunkt<br />
Architektur mit dem Partner in<br />
Kingston anzubieten.<br />
Besondere Aktivitäten außerhalb der Hochschule<br />
Trotz der Überlast in der Lehre werden von den<br />
Professorinnen und Professoren zahlreiche<br />
Aktivitäten außerhalb der Hochschule in ihren<br />
Fachschwerpunkten wahr-genommen:<br />
Prof. Helmut Drewes<br />
Konstruktives Entwerfen, Baukonstruktion und<br />
Tragwerkslehre<br />
– Beratende Teilnahme an Architekturwettbewerben<br />
Prof. Annegret Droste<br />
Entwerfen, Gebäudelehre und Architekturtheorie<br />
– Mitglied in der Jury „Förderpreis des Niedersächsischen<br />
Baugewerbes“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
– Aktive Teilnahme an Wettbewerben<br />
– Tätigkeit als Preisrichterin bei Architekturwettbewerben<br />
– Mitarbeit im Verein zur Förderung der Baukultur<br />
Prof. Dr. Birgit Franz<br />
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege<br />
– Mitglied im Arbeitskreis Theorie und Lehre der<br />
Denkmalpflege e. V., im Weiterbildungszentrum<br />
für Denkmalpflege und Altbauinstandsetzung<br />
e. V., der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft<br />
für Bauwerkserhaltung und<br />
Denkmalpflege e. V.; im Deutschen Nationalkomitee<br />
von ICOMOS<br />
– Planungsleistung und gutachterliche Tätigkeit im<br />
denkmalgeschützten Baubestand<br />
– Gutachterliche Tätigkeit im Bereich Krankenhausbestand<br />
– Tätigkeit als Preisrichterin<br />
– Vorträge im Fortbildungsprogramm des Instituts<br />
Fortbildung Bau e. V. der Architektenkammer<br />
Baden-Württemberg<br />
– Wissenschaftliche Buchveröffentlichung zum<br />
Thema „Behutsame Wiedernutzbarmachung von<br />
Bürgerhäusern. Fallbeispiel“<br />
– Konzeption, Organisation und Moderation der<br />
Tagung „Betagte Hochhäuser – problematische<br />
Altlast oder erhaltenswerte Ressource“,<br />
gemeinsam mit Olaf Peterschröder, an der<br />
Universität Karlsruhe (TH)
Prof. Walter Krings<br />
Grundlagen des Städtebaus, Stadt- und Ortsentwicklung<br />
– Mitglied im Landeswettbewerbsausschuss<br />
Architektenkammer Rheinland-Pfalz<br />
– Wettbewerbsvorprüfung für Architektenkammer-<br />
Dienstleistungs GmbH<br />
– Preisrichter bei öffentlichen Ideen- und Realisierungswettbewerben<br />
– Städtebauliche Sanierungsberatung in förmlich<br />
festgelegten Sanierungsgebieten<br />
– Gutachtertätigkeit für städtebauliche Leistungen<br />
– Städtebauliche Planungsleistungen<br />
Prof. Reinhard Lamers<br />
Bauphysik, Baukonstruktion, Darstellende<br />
Geometrie<br />
– Zahlreiche Seminare und Vorträge im Rahmen<br />
von gutachterlichen Tätigkeiten am Institut für<br />
Weiterbildung<br />
– Mitglied in der Arbeitsgruppe im Landesvorhaben<br />
„Modularisierung und Einführung eines<br />
Leistungspunktesystems in den Studiengängen<br />
Architektur und Bauingenieurwesen der niedersächsischen<br />
Fachhochschulen“, Vertreter für den<br />
Studiengang Architektur in Holzminden<br />
– Tagesseminare und Vorträge zur Energieeinsparverordnung<br />
unter anderem für das Weiterbildungszentrum<br />
der Fachhochschule in Holzminden<br />
und für das Weiterbildungszentrum an<br />
der Fachhochschule in Oldenburg.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
– Tagesseminar zu Abdichtungen bei der Niedersächsischen<br />
Architektenkammer<br />
– Vorträge und Fachaufsatz zum Thema Fachwerksanierung<br />
Prof. Herbert Lemmer<br />
Baubetrieb, Baudurchführung<br />
– Weiterbildungsveranstaltungen zur Bauvertragsgestaltung<br />
und -abwicklung<br />
– Diverse Weiterbildungsseminare zu Architekten-<br />
und Ingenieurverträgen<br />
– Diverse gutachterliche Stellungnahmen bzw.<br />
beratende Tätigkeiten für Bauherren und/oder<br />
Bauunternehmungen zu Vertragsauslegungen<br />
und Bauabrechnungen<br />
– Beiratsmitglied in einer Norddeutschen Bauunternehmung<br />
Prof. Dr. Otto Maier<br />
Technischer Ausbau, Baukonstruktion, Entwurf<br />
– Vorträge anlässlich der Wachsmann-Ehrung 2001<br />
– Diverse Artikel in Fachzeitschriften zu Wachsmann<br />
und zu Problemen des elementierten<br />
Bauens<br />
Prof. Peter Obbelode<br />
Baukonstruktion/Sanierung, Bauphysik<br />
– Mitarbeit in diversen Preisgerichten bei Architekturwettbewerben<br />
– Mitglied im Beirat zur Stadtgestaltung Bielefeld<br />
– Mitglied in USTA Bielefeld<br />
– Mitarbeiter in der Zukunftswerkstatt der Stadt<br />
Bielefeld
– Mitarbeit im Gutachterausschuss der<br />
Carl-Duisberg-Gesellschaft<br />
– 2. Vorsitzender des BDA-Ostwestfalen-Lippe<br />
Prof. Dr. Helmut Sager<br />
Baustoffkunde, Konstruktion im Metallbau<br />
– Baustoffkundliche Gutachten auf dem Spezialgebiet<br />
Betoninstandsetzung/Injektion<br />
Internationale Kooperationen<br />
Der Studiengang kooperiert mit mehreren<br />
Hochschulen und anderen Instituten auf dem Gebiet<br />
der Lehre und der Forschung. Hierbei sind<br />
besonders hervorzuheben:<br />
Kooperation in der Lehre mit<br />
– Kingston University, London<br />
– Oulu Institute of Technology, Finnland<br />
– FH Piräus, Griechenland<br />
– Universität Lissabon<br />
– Technische Universität Kiew/Ukraine für<br />
Architekten und Bauingenieure.<br />
Die Kooperation bezieht sich auf eine enge<br />
Zusammenarbeit bei der Entwicklung grundständiger<br />
und ergänzender Studiengänge sowie die<br />
Förderung des Austausches von Studentinnen und<br />
Studenten in den praxisbezogenen Studiensemestern.<br />
Mit der Kingston University ist der Ergänzungsstudiengang<br />
„Internationales Bauen“ aufgebaut. Im
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Zuge eines Dozentenaustausches führen mehrere<br />
Professoren aus Holzminden bereits seit Frühjahr<br />
1995 Lehreinheiten in London und Oulu/Finnland<br />
durch.<br />
Besonderheiten<br />
Die Visualisierung des Neubaus der Fachhochschule<br />
in Holzminden sollte bereits lange vor der geplanten<br />
Fertigstellung im Sommer 2005 erfahrbar sein.<br />
Kurzentschlossen entwickelten Studierende der<br />
Fachhochschule anhand der Baupläne des<br />
Karlsruher Architekturbüros Rainer Diekmann den<br />
zugehörigen virtuellen interaktiven Rundgang und<br />
stellten diesen ins Internet.
Studiengänge<br />
Bauingenieurwesen,<br />
Immobilienwirtschaft- und management<br />
und Internationales Bauen Holzminden<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr.-Ing. Bernd Kubat<br />
Studienangebot<br />
Die Fakultät bietet in Holzminden folgende<br />
Studiengänge an:<br />
– Bauingenieurwesen mit den Schwerpunkten<br />
– Wasser-, Abfallwirtschaft und Verkehr<br />
– Konstruktiver Ingenieurbau<br />
– Immobilienwirtschaft und -management<br />
– Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen<br />
Die Studiengänge „Immobilienwirtschaft und<br />
-management“ und „Internationales Bauen“ werden<br />
in Kooperation mit dem Studiengang Architektur in<br />
Holzminden angeboten.<br />
Studiengang Bauingenieurwesen<br />
Der Studiengang Bauingenieurwesen in Holzminden<br />
bietet den Forderungen der Bauwirtschaft entsprechend,<br />
aber auch aufbauend auf den<br />
Empfehlungen des Fachbereichstages Bauingenieurwesen,<br />
einen grundständigen Studiengang von acht<br />
Semestern an. Das 5. und 8. Semester sind Praxissemester.<br />
Ziel ist es, den Studierenden für den späteren<br />
beruflichen Werdegang ein breit angelegtes,<br />
praxisgerechtes Wissen zu vermitteln. Dabei können<br />
die Studierenden auch Wahlpflichtfächer und<br />
Wahlfächer in den Studiengängen Immobilienwirtschaft<br />
(z. B. Bauprojektentwicklung, Investitionen,<br />
Marketing) und Bauchemie belegen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Die Vertiefung ab dem 6. Semester in die Schwerpunkte<br />
„Konstruktiver Ingenieurbau“ oder „Wasser-,<br />
Abfallwirtschaft und Verkehr“ bietet den Studierenden<br />
die Möglichkeit, ein den Neigungen angepasstes<br />
Studium in den letzten beiden Semestern<br />
durchzuführen. Ein straff organisierter Studienplan<br />
führt zu kurzen Studienzeiten. Regelmäßige, mit<br />
Vertretern aus Bauunternehmungen, Ingenieurbüros<br />
und Bauverwaltungen, geführte Gespräche über die<br />
Lehrinhalte stellen sicher, dass die Absolventen den<br />
späteren Anforderungen im Bauwesen entsprechen.<br />
Studiengang Immobilienwirtschaft<br />
und -management<br />
Der Studiengang Immobilienwirtschaft und<br />
-management wurde erstmals mit Beginn des<br />
Wintersemesters 1999/2000 angeboten. Dieser<br />
Studiengang trägt der Tatsache Rechnung, dass<br />
Bauvorhaben – auch im öffentlichen Bereich – von<br />
der Bauwirtschaft nicht nur geplant und gebaut,<br />
sondern zunehmend auch initiiert, finanziert, vermarktet<br />
und bewirtschaftet werden. Zudem<br />
wünschen Investoren und Käufer bzw. Nutzer der<br />
Immobilien häufig eine rechtliche, wirtschaftliche,<br />
technische und künftig auch ganzzeitliche<br />
Betreuung durch entsprechende Fachleute. Die<br />
Studienangebote der deutschen Hochschulen sind<br />
diesen Anforderungen bisher nur teilweise gerecht<br />
geworden. Es gab bis vor kurzem kein Studium, das<br />
diese ganzheitlichen und ganzzeitlichen Anforderungen<br />
berücksichtigte.
Das Studium in Holzminden wird insbesondere auf<br />
folgende Aufgaben vorbereiten:<br />
– Projektentwicklung<br />
– Finanzierung<br />
– Vermarktung<br />
– Bewirtschaftung<br />
Der Studiengang wird in zwei Varianten angeboten:<br />
– Studium mit Praxissemestern<br />
– Studium im Praxisverbund<br />
Studium im Praxisverbund kann bedeuten:<br />
– Weiterbildung und Qualifizierung<br />
Freistellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />
für das Studium und betriebliche<br />
Arbeit in der Praxisphase<br />
– Erweitertes Praxisstudium<br />
Der Betrieb richtet Praxisstellen ein, auf die<br />
sich Studienanfänger bewerben können.<br />
Diese Studierenden absolvieren in den<br />
Praxisphasen ein gelenktes Studium im Betrieb.<br />
Da der Studiengang in enger Kooperation mit Praxispartnern<br />
entwickelt wurde, hat der Fachbereich<br />
auch für die Durchführung des Studienangebotes<br />
einen Beirat gebildet.<br />
Der Beirat, bestehend aus Vertretern von Banken,<br />
Bauträgern, Projektsteuerern und Bauunternehmen,<br />
soll kontinuierlich bei der weiteren Entwicklung
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
mitwirken und beratend tätig sein. Das Studium<br />
beginnt einmal jährlich im Wintersemester.<br />
Im Juli konnten die ersten Absolventinnen und<br />
Absolventen verabschiedet werden.<br />
Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen<br />
Der Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen<br />
wurde erstmalig im Wintersemester 1996/1997<br />
begonnen und wird seitdem in jedem Wintersemester<br />
erneut angeboten. Architektinnen und Architekten<br />
sowie Bauingenieurinnen und Bauingenieure<br />
sollen in diesem Ergänzungsstudiengang auf<br />
europaweite Bauaufgaben vorbereitet werden. Es ist<br />
geplant, in der Endstufe drei Vertiefungsschwerpunkte<br />
(Baumanagement, Konstruktiver Ingenieurbau<br />
und Architektur) anzubieten.<br />
Begonnen wurde zunächst mit dem Schwerpunkt<br />
Baumanagement, in dem die Studierenden für das<br />
Bauen im Ausland in sprachlicher, rechtlicher,<br />
wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht<br />
ausgebildet werden. Neben einem Zertifikat<br />
erhalten die Absolventinnen und Absolventen auch<br />
den Master of Science der Kingston University, der<br />
zur Promotion berechtigt. Der Studiengang umfasst<br />
drei Semester. Da alle Lehrveranstaltungen als<br />
Blöcke (Module) angeboten werden, kann das<br />
Studium teilweise auch an den Partnerhochschulen<br />
absolviert werden. Außerdem ist es möglich, das<br />
Studium berufsbegleitend auf vier Jahre verteilt als<br />
Teilzeitstudium durchzuführen.
Dieses Studienangebot sowie die Möglichkeit,<br />
damit einen internationalen Abschluss zu erlangen,<br />
haben bei den externen Gutachtern im Rahmen der<br />
Evaluation des Fachbereichs Bauingenieurwesen<br />
einen sehr großen Anklang gefunden.<br />
Studienerfolg<br />
Bei der Betrachtung der Studienzeiten ist erfreulich,<br />
dass die Studierenden ihr Studium in der Mehrzahl<br />
innerhalb der Regelstudienzeit mit Erfolg abschließen.<br />
Gründe dafür sind das straff organisierte<br />
Studium, die große Zahl von Teilprüfungen, die über<br />
die Studienzeit gut verteilten Hausübungen und<br />
Entwürfe, die studienbegleitenden Exkursionen und<br />
die Beschränkungen der Lehrveranstaltungen auf<br />
168 Semesterwochenstunden.<br />
Studienanfängerinnen/Studienanfänger:<br />
Stg. Bauingenieurwesen: 67 Studierende<br />
Stg. Immobilienwirtschaft: 67 Studierende<br />
Erg.-Stg. Internationales Bauen: 35 Studierende<br />
Diplomierungen:<br />
Im Zeitraum Wintersemester 2002/2003 bis Sommersemester<br />
2003 wurden insgesamt 103 vorwiegend<br />
praxisorientierte Diplomarbeiten betreut.<br />
Die Diplomarbeiten wurden zum größten Teil in<br />
enger Zusammenarbeit mit Baufirmen, Ingenieurbüros<br />
und Behörden ausgegeben, wobei die<br />
Kontakte häufig im Praxissemester hergestellt<br />
wurden.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Einige Arbeiten – besonders aus dem Laborbereich –<br />
lieferten wertvolle Beiträge zu den verstärkt anlaufenden<br />
Forschungstätigkeiten der Professoren.<br />
Weiterbildung<br />
Für die Weiterbildung von bereits diplomierten Bauingenieurinnen<br />
und Bauingenieuren sowie<br />
Architektinnen und Architekten bietet der Fachbereich<br />
den Ergänzungsstudiengang Internationales<br />
Bauen an.<br />
Mit dem Ergänzungsstudiengang Internationales<br />
Bauen sollen Praktiker auf die Probleme des<br />
europaweiten Bauens vorbereitet werden, das<br />
neben technischen und normativen Schwierigkeiten<br />
auch sprachliche, organisatorische und vertragliche<br />
Anforderungen stellt. Aufgrund der großen Nachfrage<br />
in der Wirtschaft/Praxis wird in Anlehnung an<br />
den Ergänzungsstudiengang „Internationales<br />
Bauen“ an der Einrichtung eines kostenpflichtigen<br />
Ergänzungsstudienganges „Immobilienmanagement“<br />
gearbeitet.<br />
Vorträge und Seminare<br />
Über diese fachbereichseigenen Lehrangebote<br />
hinaus haben sich Professoren durch Vorträge und<br />
Seminare bei mehreren Weiterbildungseinrichtungen<br />
beteiligt, z. B.:<br />
Prof. Dr. G. Maybaum, J. Mühlmann:<br />
– Numerische Berechnungen zur Kombinierten<br />
Pfahl-Plattengründung des Investment Banking<br />
Center, Frankfurt
Pfahlsymposium, Institut für Grundbau und<br />
Bodenmechanik, Technische Universität Braunschweig,<br />
20./21.02.2003<br />
Prof. Dr. G. Maybaum, J. Mühlmann:<br />
– Transierte gekoppelte mechanisch-hydraulische<br />
Berechnungen zur Prognose von Langzeitsetzungen.<br />
20. CAD-FEM USER’S MEETING,<br />
09. – 11.10.02, Friedrichshafen<br />
Prof. Dr. M. Thomas:<br />
– „Performance of Real Estate“<br />
Stichting voor Beleggings en Vastgoedkunde,<br />
3. Dezember 2003, Amsterdam<br />
– „Benchmarking – Performanceanalyse institutioneller<br />
Immobilieninvestitionen“ Bauakademie<br />
der FH Biberach, 29. März 2003,<br />
Biberach an der Riß<br />
Die Fakultät beabsichtigt, ein Weiterbildungsangebot<br />
für Praktiker aus der Bau- und Immobilienwirtschaft<br />
anzubieten.<br />
Durchgeführte Lehrgänge<br />
Lehrgänge und Kurse im Weiterbildungszentrum<br />
„Bauen-, Immobilien-, Umwelt“ in 2003<br />
Bauen:<br />
07.02.03 – VOB<br />
15.02.03 – Grundlagen der Erstellung von<br />
Baugutachten<br />
22.02.03 – Projektsteuerung im Bauwesen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
06.03.03 – Einführung in die Wertermittlung<br />
von bebauten und<br />
unbebauten Grundstücken<br />
07.03./08.03. und<br />
14.03./15.03.03 – Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse<br />
RAB 30 – Anlage B<br />
03.04.03 – Immobilienmarketing-Bausteine<br />
erfolgreicher Objektvermarktung<br />
05.04.03 – Grundlagen der Projektentwicklung<br />
von gewerblichen<br />
Immobilien und Wohnimmobilien<br />
16.05./17.05. und<br />
23.05./24.05.03 – Spezielle Koordinatorenkenntnisse<br />
RAB 30 – Anlage C<br />
12.09./13.09. und<br />
09.09. – 20.09.03 – Arbeitsschutzfachliche<br />
Kenntnisse RAB 30 – Anlage B<br />
21.11.03 – Spezielle Koordinatorenkenntnisse<br />
RAB 30 –Anlage C<br />
15.09.03 – GIS II: GIS-Anwendungen in<br />
der Umweltplanung mit<br />
ArcView GIS 3.2<br />
17.10.03 – GIS III: ArcView – „Spezial“<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Die Professoren des Fachbereichs leisten an vielen<br />
Stellen Arbeit in der Weiterentwicklung der Lehre in<br />
ihrem Fachgebiet und bei der Darstellung der<br />
Hochschule nach außen. Stellvertretend seien hierfür<br />
folgende Aktivitäten genannt:
Prof. Dr. Vahland:<br />
– Gesprächsrunde mit Vertretern der „Bau- und<br />
Immobilienwirtschaft“<br />
Lehraufträge an anderen Hochschulen<br />
Prof. Dr. G. Maybaum:<br />
– „Baubegleitende Messverfahren im Grund- und<br />
Tunnelbau“, TU Braunschweig<br />
Prof. Dr. J. Oeljeschlager:<br />
– „Servicemanagement und Facility Management“,<br />
Ebs European Business School, Oestrich-Winkel<br />
Prof. Dr. J. Paulun:<br />
– Apl. Prof. der Universität Hannover<br />
– Fachhochschule Lippe und Höxter<br />
„Massivbau, Holzbau, Stahlbau“<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Thomas<br />
– „Strategisches Immobilienmanagement:<br />
Immobilien Performance Messung“, Ebs-European<br />
Business School, Oestrich-Winkel, SS 2003<br />
Mitarbeit in bundesweiten Hochschulorganisationen<br />
bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
Die Professoren der Studiengänge nehmen<br />
regelmäßig an den Fachbereichstagen, den<br />
Fachausschusssitzungen der Fachbereichstage und<br />
an den Dekanetreffen teil.<br />
Prof. Dr. J. Erbach:<br />
– Vertreter der FH in der Carl-Duisberg-Gesellschaft
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Prof. Dr. J. Oeljeschlager:<br />
– Leiter des Arbeitskreises Facilities Management<br />
der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche<br />
Forschung GIF e. V.<br />
– Mitherausgeber der Zeitschrift für Immobilienökonomie<br />
Prof. Dr. M. Thomas:<br />
– Vizepräsident der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche<br />
Forschung GIF e. V.<br />
– Mitherausgeber der Zeitschrift für Immobilienökonomie<br />
– Mitglied des European Partnership &<br />
Accreditation Board der RICS Royal Institution of<br />
Chartered Surveyors<br />
– Mitglied der RICS Royal Institution of Chartered<br />
Surveyors Akkreditierungskommission für den<br />
Studiengang Immobilienwirtschaft der<br />
FH Nürtingen<br />
– Mitglied der RICS Royal Institution of Chartered<br />
Surveyors Reakkreditierungskommission für den<br />
Studiengang Immobilienwirtschaft der<br />
FHTW Berlin<br />
– Mitglied der Initiative Corporate Govermance für<br />
die deutsche Immobilienwirtschaft<br />
Prof. Dr. U. Pusch:<br />
– Vorsitzender des Hochschullehrerbundes (HLB)<br />
des Ortsverbandes Holzminden
Mitarbeit in Gutachtergremien<br />
Prof. Dr. U. Pusch:<br />
– Mitglied des Kuratoriums „Dr.-Erich-Lübbert-<br />
Stiftung“ Stifterverband für die Deutsche<br />
Wissenschaft<br />
Veröffentlichungen<br />
Prof. Dr. G. Maybaum, K.-H. Nerkamp, H. Pelzer,<br />
O. Heunecke, B. Ringesten:<br />
– Geodätische und geotechnische Messprogramme<br />
beim Bauprojekt 4. Röhre Elbtunnel; Flächenmanagement<br />
und Bodenordnung, Heft 2/2003<br />
Prof. Dr. R. Vahland<br />
– Kostenrechnung für Bauingenieure<br />
10. Auflage, Teubner-Verlag, Stuttgart<br />
Thomas, Matthias:<br />
– Immobiliendatenbanken und Benchmarking<br />
– Grundlage von wirtschaftlichen Entscheidungen.<br />
In: Der ImmobilienVerwalter 9 (2003), Nr. 2,<br />
S. 90 – 91<br />
– Internationale Werteermittlung, Düsseldorf:<br />
Euroforum Verlag 2003 – Lehrmaterial<br />
Thomas, Matthias; Aumann, Claudia:<br />
– Real Estate as an Asset Class.<br />
In: Rudolf, Markus; Leser, Hartmut (Hrsg.):<br />
Handbuch Institutionelles Investment,<br />
Wiesbaden, Gabler, 2003, S. 659 – 690
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Thomas, Matthias; Kurzrock, Björn:<br />
– Der deutsche Markt für Gewerbeimmobilien im<br />
Jahr 2001, ERES Newsletter (2003), Nr. 1,<br />
www.retrigroup.com/eres/20031thomas.htm<br />
Thomas, Matthias; Pierschke, Barbara:<br />
– Facilities Management und Immobilien-Performancemessung,<br />
Gebäude-Management Dossier<br />
(2003), Nr. 16, S. 7 – 28<br />
Thomas, Matthias; Weppler, Matthias:<br />
– Marktorientierte Immobilienbewertung<br />
Einführung in die Wertlehre, Düsseldorf:<br />
Euroforum Verlag 2003 – Lehrmaterial<br />
Tagungs- und Konferenzbeiträge<br />
Thomas, Matthias:<br />
– „Immobilienrisikomanagement“<br />
Beitrag zum 2. Investorensymposium der<br />
Deutschen Bank AG, 01. Oktober 2003, Frankfurt<br />
– „Indirect German Property Investment Vehicles<br />
Performance and Taxation“<br />
Beitrag zur Konferenz über Securtised Tax Transparent<br />
Property Investment Vehicles in Europe;<br />
KTI Kiinteistötalouden instituutti ry und der<br />
European Real Estate Society, 28. Februar 2003,<br />
Helsinki<br />
– „Indirekte Immobilienanlagen für institutionelle<br />
Investoren“, Beitrag zum 2. Forum der Gesellschaft<br />
für Immobilienwirtschaftliche Forschung<br />
e. V., 18. Februar 2003, Frankfurt
Internationale Kooperationen<br />
Der Fachbereich kooperiert mit mehreren Hochschulen<br />
und anderen Institutionen auf dem Gebiet<br />
der Lehre und der Forschung. Hierbei sind<br />
besonders hervorzuheben:<br />
Kooperation in der Lehre mit<br />
– Kingston University, London<br />
– Oulu Institute of Technology, Finnland<br />
– Fachhochschule Pyräus, Griechenland<br />
– Universität Salamanca, Spanien<br />
Die Kooperation bezieht sich auf eine enge Zusammenarbeit<br />
bei der Entwicklung grundständiger und<br />
ergänzender Studiengänge sowie die Förderung<br />
des Austausches von Studentinnen und Studenten<br />
in den praxisbezogenen Studiensemestern. Mit den<br />
erwähnten Partnerhochschulen wird gemeinsam der<br />
Ergänzungsstudiengang Internationales Bauen<br />
angeboten.<br />
Kooperation in der Forschung<br />
Prof. Dr.-Ing. G. Maybaum:<br />
– KFKI Projekt „Beanspruchung und Bemessung<br />
von Holzpfählen im Wasserbau“, Präsentation<br />
am 01.03.02 in Flintbeck<br />
– „Verlässlichkeit von Porenwasserdruckmessungen<br />
in bindigen Weichböden“<br />
Prof. Dr.-Ing. R. Vahland:<br />
– „Überarbeitung, Einführung in die Kostenrechnung<br />
für Bauingenieure“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Bauwesen<br />
Prof. Dr.-Ing. N. Rogosch:<br />
– „Minimierung der Nutzerkosten bei Erhaltungs-<br />
und Erneuerungsmaßnahmen im Straßenbau“<br />
Prof. Dr.-Ing. J. Kickler:<br />
– „Neue Holzprodukte außerhalb der zur Zeit<br />
gültigen DIN 1052“<br />
Prof. Dr.-Ing. O. Paulsen:<br />
– „Quantifizierung des Fremdwasseranfalls in<br />
Mischentwässerungen“<br />
Professorinnen und Professoren<br />
Folgender Professor beendete seine Lehrtätigkeit<br />
und verabschiedete sich in den Ruhestand:<br />
– Prof. Dr.-Ing. Jürgen Paulun<br />
Fachgebiet: Stahlbau, Holzbau
Fakultät<br />
Gestaltung<br />
Dekan<br />
Prof. Werner Sauer<br />
Studien- und Prodekan<br />
Prof. Dr. Hans-Friedrich Müller<br />
Entsprechend der Vorgaben des neuen Niedersächsischen<br />
Hochschulgesetzes wurde der Fachbereich<br />
Gestaltung ab Februar 2003 in die Fakultät<br />
Gestaltung überführt.<br />
Studienangebot<br />
In der Fakultät Gestaltung mit seinem Studiengang<br />
Gestaltung werden folgende Studienrichtungen<br />
angeboten:<br />
– Advertising-Design<br />
– Corporate Identity/Corporate Design<br />
– Farb-Design<br />
– Grafik-Design<br />
– Metallgestaltung<br />
– Produkt-Design<br />
– Innenarchitektur<br />
– Lighting-Design<br />
Damit deckt der Fachbereich Gestaltung mit seinen<br />
acht benachbarten und sich ergänzenden<br />
Studienrichtungen ein sehr breites Spektrum von<br />
der zweidimensionalen über die dreidimensionale<br />
bis zur räumlich-architektonischen Gestaltung ab.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Die Vermittlung von gestalterischer und theoretischer<br />
Kompetenz in der jeweiligen Studienrichtung<br />
wird durch interdisziplinäre Entwurfs- und Projektbearbeitungen<br />
erweitert. Wahlpflichtbereiche<br />
erlauben unseren Studierenden individuelle<br />
Schwerpunkte, und ein berufspraktisches Studiensemester<br />
im Hauptstudium vertieft den Bezug zur<br />
Praxis.<br />
Die Studierenden werden durch unsere Lehrenden<br />
und Mitarbeiter intensiv betreut. Ihnen stehen<br />
hervorragend ausgestattete Labore und Werkstätten<br />
zur Verfügung.<br />
Kooperationen mit mehreren ausländischen Partnerhochschulen<br />
fördern den wichtigen Austausch von<br />
Menschen und Ideen.<br />
Verbindungen zu anderen Fachbereichen werden<br />
weiter ausgebaut, wie auch die praxisorientierte Zusammenarbeit<br />
mit Unternehmen, Agenturen,<br />
Design- und Planungsbüros.<br />
Die Regelstudienzeit beträgt in allen Studienrichtungen<br />
acht Semester. Die Bewerber/innen müssen<br />
über die besondere Hochschulberechtigung hinaus<br />
eine künstlerische Befähigung nachweisen. Ihr<br />
Ergebnis entscheidet über die Rangfolge der Zulassungen<br />
zum Studium.<br />
Die Studienrichtungen sind stark nachgefragt. Der<br />
Frauenanteil beträgt mehr als 70 Prozent. Die<br />
Auslastung des Studienganges liegt bei über
120 Prozent. In den acht Studienrichtungen der<br />
Fakultät studieren zurzeit ca. 650 Studentinnen und<br />
Studenten.<br />
Ausstellungen der Fakultät<br />
Die interessantesten Semesterarbeiten aus allen<br />
Studienrichtungen wurden in der Novemberausstellung<br />
vom 15. – 22.11.2003 in den Räumen der<br />
Fakultät präsentiert.<br />
Zur Vernissage dieser sehr gut besuchten Ausstellung<br />
sprach Herr Ralph Wiegmann, Geschäftsführer<br />
der iF International Forum Design Hannover.<br />
Während der Ausstellungswoche konnten 13 Referenten<br />
aus verschiedensten Gestaltungsdisziplinen<br />
für Fachvorträge gewonnen werden.<br />
Mit Ende des Sommersemesters 2003 konnte die<br />
Fakultät 50 Diplome, im Wintersemester 2003/2004<br />
62 Diplome vergeben. In den jeweiligen Diplomausstellungen<br />
wurden die Arbeiten der Absolventinnen<br />
und Absolventen öffentlich für mehrere Tage<br />
präsentiert.<br />
Ausstattung<br />
Die räumlich äußerst angespannte Situation der<br />
Bibliothek Gestaltung/Restaurierung konnte durch<br />
die Nutzung weiterer Räume in der Fakultät<br />
Gestaltung deutlich verbessert werden.<br />
Als Ausgleich für diese Maßnahme und um die<br />
jahrelange Raumnot der Fakultät zu mindern,<br />
konnten neue Räumlichkeiten am „Langen Garten“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
in Hildesheim angemietet werden. Auf diesem ehemaligen<br />
Fabrikgelände nutzt die Fakultät Gestaltung<br />
bereits das sogenannte Kesselhaus als Lichtwerkstatt<br />
für die Studienrichtung Lighting-Design.<br />
Dank des großen Engagements des Vermieters, des<br />
planenden Architekten, der zuständigen Abteilungen<br />
der Hochschule und der ausführenden Betriebe<br />
konnten die umfangreichen Umbaumaßnahmen<br />
termingerecht abgeschlossen werden. Ab dem<br />
Wintersemester 2003/2004 finden alle Lehrveranstaltungen<br />
des Bereiches der künstlerischen und<br />
gestalterischen Grundlehre in diesen attraktiven<br />
Räumlichkeiten statt.<br />
Der Aufbau des Fachgebietes Lighting-Design ging<br />
trotz der erschwerten Bedingungen (Haushaltskürzungen<br />
und Ausgabensperren im Jahre 2003)<br />
dank der enormen Eigeninitiative der Studierenden<br />
in der Zusammenarbeit mit den Professoren ein<br />
großes Stück voran.<br />
In Eigenleistung wurden wesentliche Renovierungsund<br />
Ausbauarbeiten, die für den Lehrbetrieb<br />
notwendig sind, von den Studierenden erbracht.<br />
Neben einem Versuchsraum zur Messung von<br />
Tageslicht wurden Werkstatt- und Lagerbereiche<br />
eingerichtet. Die für den Lehrbetrieb notwendigen<br />
Maßnahmen zur Verdunklung, dem Versuchsaufbau<br />
von Lichtelementen und dem Aufbau einer Handbibliothek<br />
wurden auch Maßnahmen zum Einbruchschutz<br />
zum Teil in Eigenleistung durchgeführt.
Austauschaktivitäten<br />
Der Studentenaustausch mit dem Department of Art<br />
and Design der University of Wisconsin-Stout, begründet<br />
und organisiert von Prof. Dr. Hans-Friedrich<br />
Müller, ging 2003 in sein 16. Jahr.<br />
88 Hildesheimer Designstudierende erhielten bis<br />
heute die Gelegenheit, ein akademisches Jahr in<br />
den Vereinigten Staaten zu verbringen. 80 US-<br />
Studierende waren je für ein Jahr am Fachbereich<br />
Gestaltung. Die hiesigen Teilnehmer/innen sind bis<br />
heute vom DAAD gefördert worden; ca. 375.000,–<br />
Euro an ISAP-Fördermitteln konnten so auf<br />
Studierende des Fachbereichs gelenkt werden (nicht<br />
gerechnet die US-Studiengebühren, die vorher von<br />
den amerikanischen Teilnehmern entrichtet<br />
wurden). Unter ISAP (Internationale Studien- und<br />
Austauschpartnerschaften) fördert der DAAD<br />
zahlreiche Programme weltweit, an der gesamten<br />
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
bisher nur dieses eine.<br />
Mit dem privaten College of Visual Arts, St. Paul,<br />
Minnesota, koordiniert Prof. Dr. Müller seit sechs<br />
Jahren eine Austauschpartnerschaft: 13 Studierende<br />
von dort tauschten Studienplatz und Wohnung mit<br />
gleich vielen Studierenden dieses Fachbereichs.<br />
Die hohen Studiengebühren am Partnerstandort<br />
trugen auch hier die US-Studierenden.<br />
Ebenfalls seit sechs Jahren betreut Prof. Dr. Müller<br />
ein SOKRATES-Programm mit der Facultad de Bellas<br />
Artes der Universidad Complutense de Madrid. Von
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
dort möchten nicht so viele Leute nach Hildesheim<br />
wie umgekehrt:<br />
Sechs spanische Studierende waren bisher für ein<br />
akademisches Jahr hier, 13 Hildesheimer Designstudierende<br />
für ein Jahr dort. Gleichwohl wurde das<br />
Programm unlängst auf Vorschlag der UCM bis 2006<br />
verlängert.<br />
Ein weiteres Austauschprogramm, vor sechs Jahren<br />
vom verstorbenen Prof. Gero Köllmann begründet,<br />
läuft unter heutiger Betreuung durch Prof. Dr. Müller<br />
mit der National School of Design an der Swinburne<br />
University of Technology of Melbourne, Australien.<br />
Hieran konnten bisher 9 Hildesheimer Studierende<br />
für je ein Semester teilnehmen.<br />
Herr Prof. Eckhard Westermeier betreut die Austauschaktivitäten<br />
mit dem Kymenllaakson Polytec<br />
Kouvola Finnland, die sich großer Beliebtheit<br />
erfreuen und von den Studierenden weiterhin sehr<br />
rege in Anspruch genommen werden.<br />
Im Rahmen der Partnerschaft zur University of<br />
Swinburne/National Institute of Design, Melbourne,<br />
waren im Dezember 2003, ein Professor und zwölf<br />
Studenten der Partnerhochschule für zwei Wochen<br />
zu Gast in Hildesheim.<br />
Prof. Werner Sauer und Prof. Dr. Hans-Friedrich<br />
Müller organisierten für die Studierenden Exkursionen<br />
zu VW in Wolfsburg, Wilkhahn in Eimbeckhausen<br />
und nach Berlin.
Prof. Andreas Schulz (PD) führte einen Workshop<br />
zum Thema Büroschlaf durch.<br />
Vorträge<br />
Prof. Georg Dobler<br />
– hielt im September 2003 einen Vortrag mit dem<br />
Thema „Natur im Schmuck“ an der Akademie der<br />
Bildenden Künste in München.<br />
Frau Prof. Iska Schönfeld<br />
hielt Vorträge über<br />
– „Licht und Farbe im Krankenhaus“ im Rahmen<br />
der Roadshow der Firma Zumtobel Staff im<br />
Krankenhaus Duisburg, April 2003<br />
– „Aspekte der Kunstlichtplanung“ an der Fachhochschule<br />
in München, Dezember 2003<br />
– „Tageslichtplanung: eine vergessene Kunst?“<br />
LiTG Hannover, Treffen in Hildesheim,<br />
November 2003<br />
Prof. Andreas Schulz (LD)<br />
– hielt im Rahmen der Coburger Designtage<br />
einen Vortrag zum Thema „Lighting-Design“<br />
in Coburg, Mai 2003<br />
Prof. Iska Schönfeld und Prof. Andreas Schulz (LD)<br />
– hielten Vorträge zum Thema<br />
„Tageslichtplanung: eine vergessene Kunst?“<br />
und „Der Wirkstoff Licht“, LitG Hannover,<br />
Treffen in Hildesheim, im November 2003
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Prof. Werner Sauer<br />
– hielt am 10. September 2003 einen Vortrag über<br />
„Erstens Form – Erstens Funktion“ im<br />
Kestner Museum Hannover über den Ablauf von<br />
Design- und Entwicklungsprozessen anhand<br />
eigener, realisierter Projekte.<br />
Paul Kunofski und Prof. Marion Lidolt<br />
– hielten anläßlich der Ausstellung<br />
„Künstlerbücher – Buchobjekte“ einen Vortrag<br />
über künstlerische Drucktechniken und führten<br />
durch die Ausstellung.<br />
Prof. Axel Venn<br />
hielt Vorträge<br />
– auf der Messe Hannover, floorforum-Domotex,<br />
„Farb-, Stil-, Einrichtungswelten – Zwischen<br />
Luxus, Lust und Leidenschaft“ (Januar 2003)<br />
– auf der Internationalen Möbelmesse Köln,<br />
imm cologne, „Marketing mit Farben“<br />
(Januar 2003)<br />
– bei der Kodak AG, Stuttgart „Farbphänomene,<br />
Farbtrends, Synästhesien und Assoziationen“<br />
(März 2003)<br />
– bei der AIT-Interface, Bauzentrum München<br />
„Wohnen 2005“ (März 2003)<br />
– im Marketingclub Mönchengladbach<br />
„Von der Produktnobilitierung zum Gefühlstuning“<br />
(März 2003)<br />
– in der Architektenkammer NRW interzum/<br />
koelnmesse „Oberflächen im Innenbereich –<br />
Farbe Licht“ (Mai 2003)
– in der Fachhochschule Coburg, 15. Coburger<br />
Designtage „Marketing mit Farben“ (Mai 2003)<br />
– in der AIT-Interface, „Medienbunker Hamburg<br />
Wohnen 2005“ (Mai 2005)<br />
– in der Decor Union, Hannover, „Wohnen und<br />
Trends 2005“ (Juli 2003)<br />
– im International Circle „Leadership by Haniel<br />
2003“ Duisburg-Ruhrort „marketing with<br />
colours“ (Juli 2003)<br />
– bei Brillux, Münster, Fassadenpreis 2003, „Wege<br />
zur Kreativität“ (September 2003)<br />
– im Deutschen Farbenzentrum e. V. Farbinfo 03,<br />
Uni-Mannheim „Farbtrends – Grundlagen für<br />
Farbstrategien“ (Oktober 2003)<br />
– im VSLT, Zürich „Der Kick zu mehr Kreativität –<br />
Stil, Statur, Funktion“ (Oktober 2003).<br />
Prof. Dr. Marieluise Schaum und Prof. Bernd Frank<br />
– hielten einen Vortrag auf der Farb-Info 03 „Farbe<br />
im Kopf“ (Internationale Farbtagung der Universität<br />
Mannheim in Kooperation mit dem<br />
Deutschen Farbenzentrum) zum Thema: Farbige<br />
Pixel in Kunst und Comic – aktuelle Tendenzen.<br />
Ausstellungen<br />
Prof. Georg Dobler<br />
– zeigte seine Schmuckarbeiten im Rahmen einer<br />
Einzelausstellung mit dem Titel<br />
„FALSCHE FREUNDE – FAUX AMIS“ in der<br />
„Galerie Spektrum“, München<br />
– leistete einen Beitrag zur Ausstellung „Die Helen<br />
Drutt Collection“ im Museum of Modern Art,<br />
Houston-Texas
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
– Das „Museum of Fine Arts Philadelphia“ und das<br />
„Museum of Modern Art“, Houston erwarben<br />
Schmuckstücke für ihre Sammlungen von<br />
Georg Dobler.<br />
Prof. Hans Pieler<br />
– hatte an der Ausstellung der Helmut Gernsheim<br />
Sammlung in den Reiss-Engelhorn-Museen,<br />
Mannheim (November 2003) teilgenommen<br />
– hatte in der ständigen Installation des Hauses<br />
der Brandenburgisch Preußischen Geschichte,<br />
Potsdam, 10 Fotografien aus der Serie<br />
„Transit“ ausgestellt<br />
– hatte eine Ausstellung „Und die Sonne geht um<br />
den Stein“ in der Galerie Joanna Kunstmann,<br />
Mallorca (April 2003).<br />
Prof. Werner Sauer<br />
– präsentierte in der Ausstellung „Setz Dich – Sit<br />
Down“ über Stühle, Stile und das Sitzen vom<br />
14.08. bis 16.11.2003 des Kestner Museums in<br />
Hannover die Designentwicklung eines Konferenzsessels<br />
für die Firma Wilkhahn. Zu sehen<br />
waren originale Design-Modelle, Prototypen und<br />
Skizzen sowie die grafische Darstellung des<br />
gesamten Entwurfsprozesses.<br />
Paul Kunofski und Prof. Marion Lidolt<br />
– planten und organisierten die Ausstellung<br />
„Künstlerbücher – Buchobjekte“. Die Ausstellung<br />
zeigte über 50 ausgewählte Künstlerbücher<br />
von Studierenden und Lehrenden der Fakultät
Gestaltung. Zahlreiche Bücher dieser Ausstellung<br />
fanden bereits Anerkennung durch Ankäufe<br />
öffentlicher Sammlungen und Bibliotheken, z. B.<br />
der Landesbibliothek Hannover, der Badischen<br />
Landesbibliothek Stuttgart und der Herzog-<br />
August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Die Mehrheit<br />
der gezeigten Arbeiten entstand in den von Paul<br />
Kunofski betreuten grafischen Druckwerkstätten<br />
der Fakultät.<br />
Die Gestaltung der Printmedien zur Ausstellung<br />
und die Ausstellungsgestaltung übernahm<br />
Prof. Marion Lidolt. Bei der Finanzierung half der<br />
„Förderverein für Künstlerinnen und Künstler in der<br />
Region Hildesheim“. Bei der Konstruktion und dem<br />
Bau zahlreicher Vitrinen half Bernd Kriegeskorte.<br />
Paul Kunofski<br />
– plante und organisierte drei Ausstellungen<br />
studentischer Arbeiten in den Galeriefluren des<br />
Priesterseminars in Hildesheim<br />
– Ankäufe seiner künstlerischen Arbeiten erfolgten<br />
durch die Weinhagen Stiftung, Hildesheim und<br />
den Verein für Originalradierung, München.<br />
Prof. Axel Venn<br />
– hatte Ausstellungen in der Orangerie/Blieskastel,<br />
Kulturamt Blieskastel und FARBRAUM art gallery,<br />
Darmstadt. Einzelausstellung – Freie Arbeiten:<br />
„Axel Venn im Farbenrausch“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Prof. Eckhard Westermeier<br />
– hat folgende 2 Außenraum-Video-Installationen<br />
im Rahmen der Veranstaltung „Licht am Deister“:<br />
„Drei Flüsse, das Licht, das Fachwerk, die Stadt“<br />
Prof. Dr. Marieluise Schaum und Prof. Bernd Frank<br />
– organisierten und leiteten eine Exkursion zur<br />
Internationalen Farb-Info 2003 des Deutschen<br />
Farbenzentrums. Im November 2003 haben<br />
in der Universität Mannheim 12 Studierende und<br />
Absolventinnen und Absolventen der <strong>HAWK</strong>,<br />
Fakultät Gestaltung, Studienrichtungen Farb-<br />
Design und Lighting-Design (Anja Bültemann,<br />
Uta Krieger, Nina Kühl, Jürgen Dilpert, Wiebke<br />
Meier, Anja Sorger, Peter Uhrig, Timo Rieke,<br />
Hauke Giesecke, Markus Felsch, Steffi Schuster,<br />
Heike Schmidt), ihre Arbeiten der internationalen<br />
Fachöffentlichkeit mit großer Resonanz<br />
vorgestellt.<br />
Prof. Werner Bünck<br />
– Vom 17.02 – 24.04.2003: Ausstellung der<br />
Ergebnisse des internen Wettbewerbs der Landeskirche<br />
Hannover zum Thema „Osterleuchter“<br />
im Landeskirchenamt Hannover<br />
– Vom 07.06. – 19.07.2003: Sonderausstellung<br />
„Sakrale Kunst“ in der St. Nicolai Kirche,<br />
Eckernförde, im Rahmen des internationalen<br />
Metallgestalterkongresses<br />
– Vom 06.09. – 14.09.2003: Sonderausstellung<br />
von Arbeiten aus dem Studienschwerpunkt<br />
Metallgestaltung Bau/Raum im Rahmen der
„Designaspekte 2003“ im Foyer des Niedersächsischen<br />
Metallverbandes in Hannover<br />
– Vom 09.10. – 30.10.2003: Ausstellung von<br />
Studienarbeiten in der Seniorenakademie in<br />
Alfeld „Geformtes Metall“<br />
– Aufnahme von 3 Besteckentwürfen in die<br />
Sammlung des Deutschen Klingenmuseums,<br />
Solingen.<br />
Veröffentlichungen und Berichte<br />
Von Prof. Iska Schönfeld erschienen in<br />
– „Licht-Puls“, Artikel in der Zeitschrift<br />
HIGHLIGHT 11/12 2003<br />
– „Experimentelles Licht“, Artikel in der Zeitschrift<br />
Professional Lighting Design Nr. 34, 2003<br />
– „Spektakuläre Lichtinstallation“, Artikel in der<br />
Zeitschrift LICHT 11/12 2003<br />
– „Warenwelten: Wahre Welten des Lichts“,<br />
Artikel in der Zeitschrift LAT, 1/2004<br />
– „Let colours shine – Licht im Krankenhaus“,<br />
Artikel in der Zeitschrift lightlive! 1/2003<br />
Von Prof. Axel Venn erschienen die Ausgaben<br />
seiner Bücher<br />
– „Sonnenträume – Schattenräume“,<br />
ISBN 3-935731-42-6, in englischer Sprache<br />
„sunny dreams, shady rooms“ und in<br />
russischer Sprache, Gollenstein 2003<br />
– „Ideenräume“,<br />
ISBN 3-935731-30-2, in holländischer Sprache<br />
„Woonideeen“, Gollenstein 2003<br />
– Glossen = 1/02/03 in „Arcbitex“<br />
– „Nicht zu schüchtern, bitte“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
– „Weg mit dem Muff der Neunziger“<br />
– „Missverständnis in grün“<br />
– Aufnahme der französischen Ausgabe<br />
des Buches „Landhausstile zum Wohlfühlen“,<br />
„Le style authentique“, ISBN 3-7701-5546-7<br />
(französische Ausgabe) DUMONT<br />
in das schulische Lehrprogramm des Staates<br />
Alberta, Canada.<br />
Über die Berufungen der Professoren Iska Schönfeld<br />
und Andreas Schulz wurde in der gesamten<br />
nationalen und internationalen Architekturpresse<br />
zum Teil sehr ausgiebig berichtet. In den Fachzeitschriften<br />
für Licht und Beleuchtung gab es<br />
Sonderberichte zur Hochschule und dem Lehrstuhl.<br />
Prof. Dominika Hasse<br />
– hat seit September 2002 in der Studienrichtung<br />
Grafik-Design das Fachgebiet „Editorial Design“<br />
neu eingerichtet. In der ti, Technologie-Information<br />
niedersächsischer Hochschulen,<br />
Ausgabe 3/2003, wurde darauf hingewiesen.<br />
Aufgrund dieser Veröffentlichung konnten Kontakte<br />
zu niedersächsischen Wirtschaftsunternehmen<br />
geknüpft werden, die eine Drittmittelgewinnung<br />
für die Fakultät in Aussicht<br />
stellen.<br />
Wettbewerbe und Auszeichnungen<br />
Prof. Iska Schönfeld und Prof. Werner Sauer nahmen<br />
in Zusammenarbeit mit Studierenden der Studienrichtung<br />
Lighting-Design und Produkt-Design am<br />
Studentenwettbewerb der Initiative Energie Effizienz
teil. Ziel des bundesweiten Design-Wettbewerbs<br />
war es, die Vielfalt und Möglichkeiten von Leuchten<br />
mit Kompaktleuchtstofflampen bei den Verbrauchern<br />
bekannt zu machen. Die Auswertung der Jury<br />
wird im Februar 2004 bekannt gegeben werden. Die<br />
Leuchtmittel, Betriebsgeräte und Fassungen wurden<br />
von den Firmen Philips und BJB gesponsert.<br />
Prof. Andreas Schulz (PD) führte am 04.06.2003<br />
gemeinsam mit den Werkstattleitern, Studierenden<br />
verschiedener Studienrichtungen und reger<br />
Publikumsbeteiligung ein Akkuschrauberrennen<br />
durch. Dabei traten insgesamt 16 Teams mit Fahrern<br />
und eigenen Fahrzeugkonstruktionen in einem<br />
öffentlichen Wettbewerb gegeneinander an. Die<br />
Akkuschrauber und die Preise wurden von der Firma<br />
Festool aus Wendlingen freundlicherweise gestellt.<br />
In der Presse wurde ausführlich darüber berichtet.<br />
Kooperation<br />
Unter dem Titel „Design-Initiative“ treffen sich seit<br />
Mitte 2001 Vertreter der vier niedersächsischen<br />
Design-Hochschulen, um Entwicklungsperspektiven<br />
zu diskutieren und aufeinander abzustimmen, die<br />
jeweiligen Kernkompetenzen weiterzuentwickeln<br />
und somit das eigene Profil zu stärken.<br />
Ein erstes konkretes Ergebnis dieses Designdialoges<br />
zwischen den Design-Fachbereichen der<br />
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, der<br />
Fachhochschule Hannover, der Fachhochschule<br />
Braunschweig/Wolfenbüttel und unserem Fachbereich,<br />
ist die gemeinsam erarbeitete Broschüre
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
„Designtransfer aus Niedersächsischen Hochschulen“.<br />
In dieser Dokumentation werden aus verschiedenen<br />
Design-Disziplinen ausgewählte<br />
Kooperationsprojekte mit großen und kleinen<br />
Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und<br />
öffentlichen Bereichen vorgestellt. Die Anfang 2003<br />
erscheinende Publikation wird vom Niedersächsischen<br />
Ministerium für Wissenschaft und Kultur<br />
herausgegeben.<br />
Die Studienrichtung Lighting-Design führte mit der<br />
Fachhochschule Osnabrück, Fachbereich Landschaftsarchitektur,<br />
ein Workshop zur Beleuchtung<br />
im Außenraum unter der Leitung von Prof. Dr. Harald<br />
Hofmann durch.<br />
Auch wegen des großen Workshop-Erfolges wurden<br />
die Studierenden dieser Studienrichtung für die<br />
Beleuchtung einer Sonderveranstaltung eingeladen,<br />
die am 22.05.2003 im Park der Fachhochschule<br />
Osnabrück stattfand.<br />
Die Studienrichtung Lighting-Design war an insgesamt<br />
sechs Projekten anderer Fakultäten beteiligt.<br />
Die Kosten für die Materialanschaffungen dazu<br />
wurden von der Studienrichtung Lighting-Design<br />
übernommen.<br />
Kooperationen mit der Praxis<br />
Prof. Georg Dobler organisierte mit der Firma München-Feingusstechnik/Berlin<br />
einen Schmuckwettbewerb.<br />
Thema: „Reproduktion Kettenreaktion“ für<br />
Studierenden der Studienrichtung Metallgestaltung.
Prof. Iska Schönfeld nahm mit Studierenden des<br />
2. und 3. Semesters der Studienrichtung Lighting-<br />
Design an den designaspekten.03 anlässlich des<br />
Weltdesignkongresses ICSID in Hannover teil. In<br />
Kooperation mit dem hannoverschen Einzelhändler<br />
Horstmann + Sander und dem Leuchtenhersteller<br />
Zumtobel Staff wurde an einer Gebäudefassade<br />
in der hannoverschen Fußgängerzone im September<br />
2003 ein „Licht-Pulsmeter“ installiert, das durch<br />
Farb- und Formveränderungen der Fenster- und<br />
Dachbereiche zwei Wochen lang für Aufmerksamkeit<br />
sorgte. Zahlreiche Veröffentlichungen erschienen in<br />
der Hannoverschen-, Hildesheimer- und überregionalen<br />
Lichtfach-Presse.<br />
Prof. Iska Schönfeld und Prof. Andreas Schulz (PD)<br />
arbeiteten zusammen an einem Drittmittelprojekt<br />
mit der Fa. Leuchten Manufactur Wurzen GmbH. Im<br />
Rahmen von studentischen Entwürfen von<br />
Studierenden der Studienrichtung Lighting- und<br />
Produkt-Design wurde das Thema „Das Repräsentative<br />
Licht der Zukunft“ bearbeitet. Es ist geplant, die<br />
besten Entwürfe rund um das Thema der Neugestaltung<br />
von großen Kronleuchtern vom Hersteller<br />
realisieren zu lassen und auf der Messe Light &<br />
Building im April 2004 in Frankfurt auszustellen.<br />
Für die Teilnahme der Studierenden der Studienrichtungen<br />
Lighting- und Produkt-Design am Wettbewerb<br />
„Energieeffiziente Beleuchtung“ (siehe<br />
Wettbewerbe) wurden die Leuchtmittel, Betriebsgeräte<br />
und Fassungen von den Firmen Philips und<br />
BJB gesponsert.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Im Rahmen des Lichterfestes der Stadt Springe hat<br />
ein 15-köpfiges Team der Studienrichtung Lighting-<br />
Design unter der Leitung von Prof. Andreas Schulz<br />
(LD) die St. Andreas-Kirche temporär beleuchtet. Die<br />
Aktion fand eine sehr breite Resonanz in der Presse.<br />
Der NDR berichtete darüber live innerhalb der<br />
Sendung „Hallo Niedersachsen“.<br />
Ebenfalls mit Prof. Schulz haben die Studierenden<br />
des 6. Semesters als Semesteraufgabe einen<br />
Entwurf für eine Multifunktionshalle bei Hamburg<br />
erarbeitet, der ausgeführt wird. Dafür wurden<br />
Fremdmittel eingeworben.<br />
Prof. Andreas Schulz (PD) erarbeitete gemeinsam<br />
mit Studierenden des Grundstudiums neue<br />
Lösungsansätze für ein Interface der Firma Buderus<br />
Heiztechnik. Im Vordergrund des Projektes stand<br />
die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit bei der<br />
Eingabe und Ausgabe von Daten. Die Ergebnisse<br />
wurden am Firmensitz von Buderus in Lollar<br />
präsentiert.<br />
Bei der Projektentwicklung Interface/Produkt wurde<br />
für die Firma John Deere/Sabo in Gummersbach die<br />
Interaktion der Nutzer mit Rasenmähern untersucht<br />
und ausgewertet. Auf dieser Basis entstanden<br />
2 Entwürfe im Maßstab 1:1, die grundlegend neue<br />
Lösungen zeigen. Die Präsentation in Gummersbach<br />
hatte eine hohe Aufmerksamkeit im Unternehmen<br />
und stellt eine wirtschaftliche Nutzung in Aussicht.<br />
Die Projektleitung hatte Prof. Andreas Schulz.
Anlässlich des internationalen Designkongresses<br />
ICSID und der vom 06. bis 13. September 2003 in<br />
Hannover stattfindenden Design-Woche „designaspekte“<br />
wurde das von Prof. Werner Sauer betreute<br />
Studienprojekt „Muskel-Mobil“ im Karstadt Sport-<br />
Haus in Hannover umfangreich präsentiert.<br />
Die Studierenden des 5. und 6. Semesters Produkt-<br />
Design konzipierten und gestalteten experimentelle,<br />
muskelbetriebene Sportgeräte für den Einsatz auf<br />
dem Wasser oder auf dem Land. Visualisiert wurden<br />
die Ideen durch maßstäbliche Designmodelle und<br />
grafische Darstellungen. Für diese Präsentation<br />
gestalteten die Studierenden eine zehn Meter lange<br />
Schaufensterfront in der stark frequentierten<br />
Fußgängerzone „Große Packhofstraße“.<br />
Prof. Werner Sauer betreute im Wintersemester<br />
2003/04 ein Projekt mit Studierenden des 5. und 6.<br />
Semesters Produkt-Design und der Firma BREE,<br />
einem Hersteller hochwertiger Taschen und<br />
Accessoires. Zu entwickeln war ein preiswerter Mitnahmeartikel,<br />
der die Kundenfrequenz in den BREE-<br />
Geschäften steigern soll. Zurzeit prüft BREE die<br />
Realisierbarkeit der Entwürfe.<br />
Prof. Eckhard Westermeier gestaltete in dem<br />
Lehrangebot „Rechnergestütztes Gestalten/Zeitbasierte<br />
Medien“ im Wintersemester mit Studierenden<br />
des 6. Semesters die Ausstellung „Vorbild: Realität“<br />
in der Aula des roten Fakultätsgebäudes. Sechs<br />
Studierende setzten unter seiner Leitung Video-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Konzeptionen um, deren Aufgabe es war, die<br />
mediale Welt mit der „realen“ zu konfrontieren. Sie<br />
präsentierten einem breiten Publikum in einer sehr<br />
gut besuchten Ausstellung die Ergebnisse, die sie<br />
über die letzten Semester in der Auseinandersetzung<br />
mit der Disziplin Videoinstallation erarbeitet<br />
hatten.<br />
Prof. Marion Lidolt gestaltete mit ihren Studierenden<br />
den Kalender 2003 für den Verein für Suizidprävention.<br />
Prof. Axel Venn installiert im Rahmen der Lehre<br />
„Marketing-Theorie“ ein Trend-Panel. Es geht um die<br />
Erforschung (Trend-Scouting) und Hochrechnung<br />
zukünftiger Farbvorlieben auf verschiedenen<br />
Gestaltungsebenen. Arbeitstitel: „Corpus & Colore“.<br />
Themen der durchgeführten Trend-Analysen waren:<br />
– „Haarfarben“<br />
– „Körperfarben“<br />
– „Face-Design“<br />
– „Accessoires“.<br />
Erste Kooperationen mit den Firmen Mathai, Hildesheim,<br />
Merck KGaA und Wella, Darmstadt, bestehen<br />
bereits oder sind eingeleitet.<br />
Interaktive Internet-Veröffentlichungen und Trend-<br />
Panel-Periodika sind in Vorbereitung.<br />
Ende des Sommersemesters 2003 gelang es<br />
Prof. Dominika Hasse, den neu berufenen Kurator
des Kunstvereins Hildesheim, Herrn Thomas<br />
Kaestle, für eine Kooperation mit den Studierenden<br />
zu gewinnen.<br />
Eine Jahrespublikation mit dem Thema „Wo ist die<br />
Kunst“ wurde im Laufe des Wintersemesters<br />
2003/04 unter der Leitung von Prof. Hasse durch<br />
die Projektgruppe – Almuth Jung, Verena Hirschberger,<br />
Anita Klaiber, Kerstin Schulz und Sina Schiewe<br />
entwickelt, gestaltet und realisiert.<br />
Die Publikation ist über den Kunstverein oder im<br />
Buchhandel erhältlich.<br />
Unter der Leitung von Prof. Frank haben fünf<br />
Studierende der Studienrichtung Grafik-Design (in<br />
Zusammenarbeit mit der Stadt Hildesheim, dem<br />
Round Table Club, dem Stadtmuseum Hildesheim<br />
und dem Knochenhauer Amtshaus) an einem<br />
Wettbewerb zur Gestaltung eines Stadtführers<br />
„Rosenroute für Kinder“ teilgenommen.<br />
Die beiden Gewinnerinnen des Wettbewerbs, Katja<br />
Rapp und Martina Köhler, wurden beauftragt,<br />
die Gestaltung zu übernehmen.<br />
Im Mai 2003 wurden während des Jubiläums der<br />
Hildesheimer Rosenroute auf dem Marktplatz dem<br />
Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim 2000<br />
Exemplare übergeben.<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Prof. Georg Dobler wurde in die Jury des Internationalen<br />
Schmuckwettbewerbes „THE CIRCLE“ der<br />
Städtischen Gallerie in Legnica/Polen berufen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
Herr Hartwig Gerbracht wurde als Juror vom Bundesverband<br />
Metall für den Wettbewerb „Die Gute Form“<br />
eingeladen. Er nahm vom 07. bis 09. Juni 2003<br />
mit sieben Studeierenden am „Internationalen<br />
Treffen Gestaltender Schmiede“ in Eckernförde teil.<br />
Marion Lidolt, Gründungsmitglied des Vereins zur<br />
Förderung von Künstlerinnen und Künstlern in der<br />
Region Hildesheim, gestaltete ehrenamtlich die<br />
Printmedien zu zehn in diesem Jahr stattgefundenen<br />
Ausstellungen sowie die Jahresprospekte der<br />
vereinseigenen Galerie im Stammelbach-Speicher.<br />
Paul Kunofski ist seit März 2003 (gemeinsam mit<br />
Prof. Fritz Dommel, Berlin und Inge Thumm,<br />
Hildesheim) Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes<br />
Bildender Künstlerinnen und Künstler<br />
Hildesheim. Er war maßgeblich beteiligt an der<br />
Organisation der Jahresausstellung 2003 (Mitarbeit<br />
in der Jury, Vernissage, Druckvorführung zur<br />
Finissage).<br />
Prof. Marion Lidolt ist im März 2003 wiederholt in<br />
den Vorstand des Berufsverbandes Bildender<br />
Künstlerinnen und Künstler Hildesheim gewählt<br />
worden.<br />
Prof. Axel Venn ist Mitglied des Decosit-Trend-<br />
Teams, der Welt größten Dekostoff-Messe, Decosit,<br />
Brüssel. Des weiteren ist er auch Mitglied des<br />
Trend-Panels von „the mix interior“, „the mix“<br />
Global Color Research Limited, London.
Exkursionen<br />
Prof. Iska Schönfeld<br />
organisierte und unternahm<br />
– eine eineinhalbtägige Exkursion im April 2003<br />
zum Planungsbüro Bartenbach Lichtlabor mit<br />
Büroführung und Besichtigung diverser Tageslichtplanungsprojekte<br />
in Innsbruck/Österreich<br />
– eine eintägige Exkursion im Oktober 2003 nach<br />
Berlin mit dem Thema „Beleuchtung in<br />
repräsentativen Gebäuden“. Besichtigung und<br />
Diskurs mit den teilnehmenden Studierenden<br />
diverser großer Berliner Gebäude. Die Ergebnisse<br />
der Exkursion flossen in die Bearbeitung<br />
des Drittmittelprojekts „Repräsentatives Licht<br />
der Zukunft“ ein.<br />
Prof. Andreas Schulz (LD)<br />
organisierte und unternahm<br />
– eine eintägige Exkursion nach Berlin im September<br />
2003, bei der Projekte der aktuellen Lichtplanung<br />
besichtigt wurden.<br />
Prof. Andreas Schulz (PD)<br />
– organisierte im Rahmen der Veranstaltung<br />
Ergonomie für Metallgestalter und Produkt-<br />
Designer eine Exkursion zur Silberwarenmanufaktur<br />
der Firma Willkens in Bremen und zur<br />
Dieter Rams Ausstellung: Die Faszination des<br />
Einfachen im Wagenfeldhaus<br />
– unternahm mit Studierenden eine Exkursion<br />
zur Internationalen Möbelmesse 2004 in Köln
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Gestaltung<br />
– veranstaltete eine Fortbildung zum Material<br />
Kunststoff bei einem Kunststoffverarbeiter für<br />
18 Studierende.<br />
Prof. Eckhard Westermeier<br />
organisierte und führte Studentenexkursionen<br />
– im März 2003 zum Zentrum für Kunst- und<br />
Medientechnologie Karlsruhe durch. Den Studierenden<br />
wurden durch die Führungen von<br />
mehreren Dozenten des Hauses die Welt der<br />
digitalen Kunst nahegebracht und vertieft<br />
– im September 2003 zum Gasometer Oberhausen<br />
zur Videoinstallation „five Angels“ von Bill Viola.<br />
Personal<br />
Im Berichtszeitraum konnten folgende Professuren<br />
neu besetzt werden:<br />
– Prof. Markus Schlegel<br />
Projektentwicklung Farb-Design<br />
– AxelVenn<br />
Verwaltung einer Professur „Farb-Design“
Fachbereich<br />
Konservierung und Restaurierung<br />
Dekan<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer (bis 31.01.03)<br />
Prof. Akad. Rest. Jan Schubert (ab 01.02.03)<br />
Prodekan<br />
Prof. Akad. Rest. Jan Schubert (bis 31.01.2003)<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer (ab 01.02.03)<br />
Studiendekanin<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl (seit 01.02.2003)<br />
Studienangebot<br />
Im Studiengang Restaurierung werden folgende<br />
Studienrichtungen angeboten:<br />
– Konservierung und Restaurierung von<br />
Buch und Papier<br />
– Konservierung und Restaurierung von<br />
gefassten Holzobjekten und Gemälden<br />
– Konservierung und Restaurierung von<br />
Möbeln und Holzobjekten<br />
– Konservierung und Restaurierung von<br />
Steinobjekten<br />
– Konservierung und Restaurierung von<br />
Wandmalerei/Architekturoberfläche<br />
Die in allen Studienrichtungen zunehmenden Kontakte<br />
mit staatlichen und kirchlichen Denkmalämtern,<br />
Museen, Bibliotheken und Archiven in<br />
Niedersachsen und anderen Bundesländern sowie<br />
zahlreichen internationalen Fachinstitutionen, auch<br />
außerhalb Europas, zeigen, dass der Fachbereich
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Konservierung und Restaurierung sich in den 17<br />
Jahren seines Bestehens einen Namen gemacht hat.<br />
Entsprechend steigt die Zahl der Studierenden und<br />
hat die Kapazitätsgrenze erreicht.<br />
Frau Prof. Jirina Lehmann, seit Sommersemester<br />
2001 im Ruhestand, hält bis auf weiteres ihre<br />
Vorlesung zur Werkstoffgeschichte.<br />
Dr. Erwin Stadlbauer, international bekannter<br />
Fachmann für Materialkunde im Niedersächsischen<br />
Landesamt für Denkmalpflege in Hannover, erhielt<br />
am 14. November 2002 aus der Hand des<br />
Präsidenten der <strong>HAWK</strong>, Prof. Dr. Johannes Kolb, die<br />
Ernennungsurkunde zum Honorarprofessor.<br />
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub hielt die Laudatio auf<br />
den neuen Honorarprofessor.<br />
Prof. Dr. Maierbacher-Legl veranlasste die Umbenennung<br />
ihrer Studienrichtung in „Konservierung<br />
und Restaurierung von Möbeln und Holzobjekten“,<br />
da diese Bezeichnung gegenüber „Holzobjekten mit<br />
veredelter Oberfläche“ allgemein verständlicher ist<br />
und das Lehrangebot konkreter erfasst.<br />
Die seit Wintersemester 1999/2000 bestehende<br />
Professur für „Mikrobiologie in der Restaurierung“,<br />
die Frau Prof. Dr. Karin Petersen im Rahmen einer<br />
Kooperation mit der Universität Oldenburg vertritt,<br />
verfügt seit März 2002 über gut ausgebaute<br />
Lehrräume und ein operatives Labor mit einem
eigenen Rasterelektronenmikroskop, einem<br />
Axioplan – Auflichtmikroskop, einem Luminometer<br />
und entsprechender Fotoausrüstung.<br />
Nachdem seit März 2002 ein gut ausgestattetes<br />
Mikrobiologielabor zur Verfügung steht, konnte zum<br />
01.03.2003 auch die Stelle eines Laborleiters für<br />
Mikrobiologie mit dem Diplom-Biologen Ulrich Fritz<br />
besetzt werden.<br />
Die Hildesheimer FH besitzt damit nicht nur den in<br />
der deutschen Hochschullandschaft einzigartigen<br />
Vorzug einer eigenen Professur (Frau Prof. Dr. Karin<br />
Petersen) in diesem Spezialgebiet, sondern verfügt<br />
auch über eine kontinuierliche operative Betreuung<br />
im Bereich Mikrobiologie, die sich positiv auf die<br />
Möglichkeiten der Projekteinwerbung auswirken<br />
wird.<br />
Um in Kirchen und Museen, bei Projektwochen,<br />
Fach- und Diplomarbeiten vor Ort effektiver arbeiten<br />
zu können, wurde von der Studienrichtung<br />
„Gefasste Holzobjekte und Gemälde“ ein Technoskop<br />
und verschiedene mobile Messgeräte<br />
(Lux-Meter, Datenlogger für Temperatur und relative<br />
Luftfeuchtigkeit) angeschafft.<br />
Für die materialtechnische Forschungsarbeit der<br />
Studienrichtungen „Steinobjekte“ und „Wandmalerei/Architekturoberfläche“<br />
steht seit 2003 ein<br />
Dispersionsgerät zur Verfügung.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Trotz der Anmietung von zusätzlichen Räumen und<br />
von Umbauten 2002 ist die Raumsituation im<br />
Gebäude Kaiserstraße 19 insgesamt nach wie vor<br />
bedrückend und auch sicherheitstechnisch bedenklich.<br />
Vertreter des Wissenschaftsministeriums<br />
konnten sich vor Ort von den Raumnöten überzeugen.<br />
Der Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
an der <strong>HAWK</strong> gehört auch auf dem Gebiet der EDV<br />
zu den am besten ausgestatteten Studiengängen<br />
dieser Art an deutschen Hochschulen. Sowohl in der<br />
Lehre und Forschung als auch im Studium hat die<br />
Intensität des Einsatzes der EDV, vor allem auch der<br />
Bildbearbeitung sprunghaft zugenommen.<br />
Allerdings ergeben sich zunehmend Probleme der<br />
Betreuung, Wartung und Datensicherung.<br />
Am 4. Juli 2003 hielt der Fachbereich Konservierung<br />
und Restaurierung mit tatkräftiger Organisation der<br />
Studierenden den dritten Infotag ab. Studierende<br />
im Vorpraktikum, Studienbewerber und Interessenten<br />
konnten sich über das Studienangebot<br />
informieren.<br />
Neue Mitarbeiter/innen<br />
Mit der Eingliederung des Hornemann Instituts am<br />
1. September 2003 sind nun die Leiterin Frau Dr.<br />
Angela Weyer, Webentwickler Sascha Berger,<br />
Dipl.-Rest. Cord Brune, Dipl.-Restauratorin Barbara<br />
Hentschel, IT-Koordinator Thomas Kittel und<br />
Frau Birgit Gecius Mitglieder des Fachbereichs<br />
Konservierung und Restaurierung.
Dipl.-Rest. Martin Merkert vertritt die Werkstattleiterin<br />
Dipl.-Rest. Ina Birkenbeul im Rahmen des<br />
Erziehungsurlaubs.<br />
Frau Dipl.-Rest. Anneli Ellesat besetzt seit Dezember<br />
2002 vertretungsweise die Stelle der Kooperation<br />
mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege<br />
(NLD) wegen des Erziehungsurlaubs von<br />
Dipl.-Rest. Heike Leuckfeld. Sie bietet praktische<br />
Übungen für die Studienrichtung Steinobjekte an.<br />
Im Rahmen von AGIP-Projekten arbeiten Dipl.-Rest.<br />
Anita Horn und Dipl.-Rest. Andreas Buder halbtags<br />
im Archäometrielabor und Dipl.-Rest. Jens Klocke im<br />
Mikrobiologielabor (seit Juli 2002).<br />
Herr Dipl.-Biol. Ulrich Fritz hat zum 01.03.2003 die<br />
Leitung des Mikrobiologielabors übernommen.<br />
Im Rahmen eines AGIP Projektes arbeitet Frau<br />
Dipl.-Rest. Merle Strätling seit Oktober 2003 ebenfalls<br />
im Mikrobiologielabor.<br />
Im Rahmen eines AGIP Projektes arbeitet Dipl.-Rest.<br />
Claudia Schindler seit Oktober 2003 in der Studienrichtung<br />
Steinkonservierung.<br />
Dipl.-Rest. Ina Birkenbeul nahm ab Sommersemester<br />
2003 einen Lehrauftrag „Kunstharze in der<br />
Restaurierung“ für die Studienrichtungen Holz 1 und<br />
Holz 2 wahr.<br />
Die Hochschule für Bildende Künste Dresden ist<br />
Partner im laufenden Dissertationsvorhaben von
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Frau Dipl.-Rest. Stefanie Lindemeier. Frau Lindemeier<br />
hält Lehrveranstaltungen vor allem im Bereich<br />
Dokumentation ab.<br />
Seit dem Wintersemester 2003/04 wird von<br />
Prof. Finkel und Prof. Engel die interfakultative Zusammenarbeit<br />
praktisch umgesetzt: in den Räumen<br />
der Buch- und Papierrestaurierung wird von den<br />
Studenten beider Fakultäten (Fak. G und FB K)<br />
Papier hergestellt, welches in den Werkstätten der<br />
Gestaltung im Hochdruckverfahren bedruckt wird.<br />
Werkstättenleiterin Dipl.-Rest. Barbara Rittmeier gab<br />
neben der üblichen restauratorischen Tätigkeit als<br />
freiwillige zusätzliche Leistung eine praktische<br />
Einleitung zum neuen Angebot „Papierschöpfen“.<br />
Weiterentwicklung<br />
Charakteristikum der im Dezember 2002 vorläufig<br />
genehmigten Prüfungsordnung (besonderer Teil)<br />
ist die (bereits in der Praxis bestehende) Orientierung<br />
von Studium und Lehre auf Projektarbeit an<br />
Kunst- und Kulturgut. Wahlmöglichkeiten wurden erweitert,<br />
die künstlerische Ausbildung verstärkt und<br />
insgesamt die Einhaltung der Regelstudienzeit<br />
gefördert.<br />
Gemäß den Neuerungen der novellierten Prüfungsordnung<br />
wurden die Praktikums- und Feststellungsordnung<br />
angepasst. Das alsZulassungsvoraussetzung<br />
vorgeschriebene Praktikum wurde auf ein<br />
Jahr verkürzt. Das Feststellungsverfahren findet<br />
nunmehr im Sommersemester statt. Das Infoheft für<br />
Studienbewerber wurde aktualisiert.
Die Entwicklung eines Modular-Systems für den<br />
Bachelor- und Masterstudiengang Restaurierung<br />
wurde in Angriff genommen.<br />
Die praxisorientierte, dem modernen Berufsbild<br />
gemäße Ausbildung von Restauratorinnen/Restauratoren<br />
versteht sich als spezifische Verknüpfung von<br />
naturwissenschaftlichen, kunstwissenschaftlichen<br />
und künstlerisch-handwerklichen Kenntnissen, die<br />
auch spezifische organisatorische Bedingungen<br />
erfordert. Es ist deshalb sachentsprechend und erfreulich,<br />
dass im Rahmen der Neuordnung der<br />
Hochschule in Vollziehung des Neuen NHG der Studiengang<br />
Restaurierung als eigene organisatorische<br />
Einheit erhalten geblieben ist. Seit 1. Februar 2003<br />
ist das frühere „Institut für Restaurierung“ nunmehr<br />
„Fachbereich Konservierung und Restaurierung“<br />
(FB K), mit den einer Fakultät entsprechenden<br />
Funktionen.<br />
Damit wurden – durchaus bemerkenswert<br />
angesichts des allgemeinen Trends zu größeren Einheiten<br />
– die organisatorischen Grundlagen gelegt<br />
für eine intensive Weiterentwicklung des Studiengangs,<br />
die den spezifischen Zielvorstellungen der<br />
praxisorientierten Ausbildung von Restauratorinnen/<br />
Restauratoren entspricht.<br />
Ein weiterer Markstein in der Entwicklung des<br />
Fachbereichs Konservierung und Restaurierung ist<br />
die am 1. September vollzogene Eingliederung des<br />
Hornemann Instituts in den Fachbereich. Damit ist
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
nicht nur das Bestehen des Hornemann Instituts<br />
gesichert, sondern können auch die bereits bestehenden<br />
Tätigkeiten im Bereich von Datenbanken,<br />
E-Learning, Ausstellungen, Publikationen, Tagungen<br />
etc. noch intensiver mit Forschung und Lehre des<br />
Fachbereichs verknüpft werden.<br />
Wie die ganze <strong>HAWK</strong> betreffen das „HOK“ (Hochschuloptimierungskonzept)<br />
und damit die vom MWK<br />
verfügten Sparmaßnahmen auch den Fachbereich<br />
Konservierung und Restaurierung: Die geplante<br />
Studienrichtung Metallkonservierung wird derzeit<br />
nicht eingerichtet. Auch die räumliche Zusammenführung<br />
und die Behebung der Raumnöte ist derzeit<br />
nicht möglich. Für die weitere Entwicklung des<br />
Fachbereichs ist die Erfüllung dieser Ziele aber<br />
unabdingbar.<br />
Weitere organisatorische Entwicklungsziele :<br />
– Eine Lehrkraft für besondere Aufgaben für die<br />
sprunghaft gestiegenen Anforderungen im<br />
Bereich der digitalen visuellen Dokumentation.<br />
– Die Entlastung der Professur für kunstwissenschaftliche<br />
Grundlagen der Restaurierung<br />
angesichts steigender Studierendenzahlen.<br />
Studienerfolg<br />
Die Regelstudienzeit beträgt acht Fachsemester, ein<br />
praxisbezogenes Studiensemester inklusive. Vor<br />
Beginn des Fachstudiums wird nunmehr ein<br />
12-monatiges studienvorbereitendes Praktikum absolviert.<br />
Die Immatrikulation erfolgt nach Ableistung<br />
dieses Vorpraktikums.
In den fünf Studienrichtungen des Fachbereichs<br />
Konservierung und Restaurierung studieren zurzeit<br />
ca. 146 Studentinnen und Studenten. Im Wintersemester<br />
2002/2003 begannen 38 Studienanfänger<br />
mit dem 1. Fachsemester. Im WS 2002/2003<br />
konnten 14, im SS 2003 neun Diplome vergeben<br />
werden (Holz I: 6 (1); Holz 2: 7 (3); B/P: –;<br />
Stein: 1 (2); Wand: – (3)).<br />
Kooperationen in der Praxis<br />
Der Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
will seinen Studierenden eine möglichst praxisnahe<br />
Ausbildung bieten und arbeitet daher intensiv mit<br />
zahlreichen Museen, Denkmalämtern, landeskirchlichen<br />
Bauämtern, Bibliotheken und anderen<br />
Fachinstitutionen in Niedersachsen und in anderen<br />
deutschen Bundesländern sowie mit Partnern im<br />
Ausland zusammen. Besonders hervorzuheben<br />
ist der seit Jahren bewährte Kooperationsvertrag mit<br />
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege<br />
(NLD), der von Dipl.-Rest. Heike Leuckfeld,<br />
bzw. in Vertretung von Dipl.- Rest. Anneli Ellesat<br />
betreut wird. Jährlich hält Dipl.-Des. Elke Behrens,<br />
NLD, ein Kartierungsseminar in Hannover.<br />
Dank vielfältiger Kooperationen erhält der Fachbereich<br />
Leihgaben zu Studienzwecken sowie zur<br />
Konservierung und Restaurierung, er wirkt an<br />
größeren Restaurierungsvorhaben und praxisorientierten<br />
Forschungsprojekten mit. Die Studierenden<br />
können objektbezogen bzw. im Rahmen von<br />
Projekten ihre Fach- und Diplomarbeiten erstellen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Eine für die fachliche Effizienz wichtige Entwicklungstendenz<br />
ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit,<br />
vor allem die zunehmende Kooperation der<br />
einzelnen Studienrichtung in gemeinsamen<br />
Projekten, aber auch die selbstverständliche<br />
operative Tätigkeit der übergreifenden Disziplinen,<br />
also der Kunstwissenschaft, der Chemie und der<br />
Mikrobiologie.<br />
Projekte, Forschung<br />
Unter Leitung von Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub<br />
wurde das von der <strong>HAWK</strong> geförderte Forschungsprojekt<br />
zum Thema „Historische Rathäuser in<br />
Niedersachsen. Geschichte – Kunst – Erhaltung“, an<br />
dem zahlreiche Studierende des Fachbereichs<br />
Konservierung und Restaurierung mit Facharbeiten<br />
beteiligt waren, abgeschlossen. Die Ergebnisse der<br />
Forschungsarbeit wurden im Rahmen des Hornemann<br />
Instituts publiziert.<br />
Das im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde<br />
der Stadt Lüneburg begonnene<br />
interdisziplinäre Projekt der restauratorischen<br />
Befundsicherung und Entwicklung von Konservierungskonzepten<br />
im Rathaus von Lüneburg wurde<br />
mit Fach- und Diplomarbeiten im Rahmen der<br />
Studienrichtung „Wandmalerei/Architekturoberfläche“<br />
(Gerichtslaube: Wandmalerei, Boden; Wandmalerei<br />
in: Alte Kanzlei, Altes Archiv, Dienerzimmer)<br />
vorläufig abgeschlossen.
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub wurde im Wintersemester<br />
2003/04 ein Forschungssemester gewährt.<br />
Das Thema „Zur Restaurierung und ästhetischen<br />
Präsentation von Malerei und Plastik im 20. Jahrhundert<br />
in Europa: Theoretische Positionen,<br />
Methoden und Techniken der Ergänzung und<br />
Retusche“ umfasst u. a. die Erstellung eines E-Learning-Moduls<br />
in Kooperation mit dem Hornemann<br />
Institut und die kommentierte Übersetzung des<br />
grundlegenden Textes von Cesare Brandis Teoria del<br />
Restauro aus dem Italienischen ins Deutsche. Das<br />
Forschungsprojekt wird in Kooperation mit dem<br />
Istituto Centrale per il Restauro in Rom und dem<br />
Opificio delle Pietre Dure in Florenz ausgeführt.<br />
In interdisziplinärer Zusammenarbeit von Prof. Dr.<br />
Ursula Schädler-Saub, Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-<br />
Legl und Prof. Dr. Ivo Hammer wurde die restauratorische<br />
Befundsicherung und Inventarisation der<br />
Raumausstattung des Sanatoriums Dr. Barner in<br />
Braunlage, ein bedeutender Bau des späten<br />
Jugendstils, im Rahmen von Fach- und Diplomarbeiten<br />
von Studierenden erfolgreich fortgeführt.<br />
Das DBU Vorprojekt „Zum Erhalt mittelalterlicher<br />
Wandmalereien in Lübecker Bürgerhäusern“,<br />
an dem sowohl das Archäometrielabor als auch das<br />
Labor für Mikrobiologie und die Studienrichtung<br />
Wandmalerei/Architekturoberfläche beteiligt sind,<br />
wurde fortgeführt. Kooperationspartner sind das<br />
Institut für Denkmalpflege Lübeck und das ZMK.<br />
Zwei Facharbeiten zur restauratorischen Befundsi-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
cherung wurden verfasst, außerdem wurden unter<br />
anderem regelmäßige Untersuchungen zur Keimbelastung<br />
der unterschiedlich exponierten Flächen<br />
wie auch der Keimbelastung der angrenzenden<br />
Räume durchgeführt.<br />
In Zusammenarbeit mit dem archäologischen<br />
Institut der Universität Buenos Aires, Argentinien,<br />
wurden von Prof. Dr. Karin Petersen die Untersuchungen<br />
zur mikrobiellen Besiedlung im Grabmal<br />
des Neferhotep, Theben West, Ägypten fortgesetzt.<br />
Mit Frau Prof. Dr. Witte, Toxikologin, und Herrn Prof.<br />
Dr. Butte, Umweltchemiker, an der Universität<br />
Oldenburg forscht Frau Prof. Dr. Petersen derzeit<br />
auch im Rahmen von Diplomarbeiten zur Gesundheitsgefährdung<br />
durch mikrobiell besiedelte<br />
Objekte. In diesem Zusammenhang wurde auch ein<br />
kombiniertes EFRE/ESF Projekt bewilligt, in dem<br />
eine Postdoc Stelle bis Ende 2005 angesiedelt ist.<br />
Die bisher erzielten Ergebnisse belegen erstmals<br />
das Vorhandensein potentiell Mykotoxin bildender<br />
Schimmelpilze auf Kunstobjekten und ergaben<br />
ebenfalls erstmals den Nachweis derartiger<br />
Mykotoxine in Kirchenräumen. Auch die verstärkte<br />
Freisetzung von Aflatoxinen nach Biozidzugabe<br />
konnte für relevante Arten im Laborversuch aufgezeigt<br />
werden.<br />
In Kooperation mit Herrn Dr. Müller, Universität<br />
Oldenburg, FB V. erfolgen Untersuchungen zur<br />
Möglichkeit des Einsatzes von Naturstoffen mit bakterizider<br />
Wirkung auf Wandgemälden.
Prof. Dr. Karin Petersen bearbeitet – außer den<br />
genannten Projekten – folgende ebenfalls von ihr<br />
initiierte Forschungsprojekte:<br />
– AGIP-Projekt „Praxisorientierter Nachweis<br />
mikrobieller Belastung an Kulturgut“. Das Projekt<br />
wird in Zusammenarbeit mit dem NLD durchgeführt.<br />
Seit Juli 2002 ist im Rahmen dieses<br />
Projekts Diplomrestaurator Jens Klocke tätig.<br />
Inzwischen wurde einem Antrag von Herrn Klocke<br />
zur Zulassung als Doktorand an der Hochschule für<br />
Bildende Künste in Dresden entsprochen. Die Betreuung<br />
in Dresden wird durch Herrn Prof. Dr. Herm<br />
erfolgen, in Hildesheim übernimmt Frau Petersen<br />
die Betreuung.<br />
– AGIP-Projekt „Pilzbelastung der Raumluft hochgedämmter<br />
Häuser – gesundheitsrelevante<br />
Aspekte“. Die Untersuchungsmethoden sind auf<br />
denkmalpflegerisch relevante Objekte übertragbar.<br />
Kooperationspartner sind Prof. Dr. Leimer<br />
vom Institut für Bauphysik der <strong>HAWK</strong>, die Firma<br />
Marmorit und die INTOX GmbH. Frau Dipl.-Biol.<br />
Ilka Töpfer wurde befristet an der <strong>HAWK</strong> eingestellt.<br />
Sie konnte 2003 eine Zusatzausbildung<br />
zur geprüften Baubiologin sehr erfolgreich<br />
abschließen.<br />
– AGIP-Projekt „Möglichkeiten der Desinfektion<br />
von Kunst- und Kulturgut durch Mikrowellenbehandlung“.<br />
Dieses Projekt wird gemeinsam
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
mit Frau Prof. Dr. Maierbacher-Legl durchgeführt.<br />
Kooperationspartner sind die Firma Sprint<br />
Sanierung sowie mehrere Museen in der BRD.<br />
Für dieses Projekt wurde Frau Dipl.-Rest. Merle<br />
Strätling befristet eingestellt.<br />
Praxisorientierte mikrobiologische Untersuchungen<br />
zur Vorbereitung weiterer Forschungsprojekte<br />
erfolgten insbesondere an den Wand- und<br />
Deckenmalereien in der ev. Kirche in Greene sowie<br />
der St. Josephs Kirche in Osnabrück, Niedersachsen,<br />
in der kath. Pfarrkirche Ibbenbüren, Westfalen-<br />
Lippe, in der Stiftskirche Quedlinburg, Sachsen-<br />
Anhalt und in der Gruft der ev. Georgen Parochialkirche<br />
Berlin.<br />
Im Rahmen des AGIP-Projektes, Forschungsschwerpunkt<br />
der <strong>HAWK</strong> „Laser- und Plasmabehandung von<br />
Holz“, unter der Leitung von Prof. Dr. Henrik Schulz<br />
stehen dem Archäometrielabor ein UV/VIS-<br />
Reflexionsspektroskopiesystem Tidas der Firma J&M<br />
GmbH und ein Kontaktwinkelmessgerät der Firma<br />
Data Physics Instruments GmbH zur Verfügung. Die<br />
Untersuchungen zur Oberflächenfunktionalität<br />
plasmabehandelter Hölzer werden zusammen mit<br />
dem Fachbereich PMF in Göttingen und dem Institut<br />
für Chemie in Holzminden durchgeführt.<br />
Im Rahmen der eigenen Werkstoffforschung wurden<br />
die Untersuchungen über Löslichkeit und Löslichkeitsparameter<br />
fortgesetzt. Ergebnisse wurden auf<br />
der 23. Archäometrietagung der GdCh (Gesellschaft<br />
deutscher Chemiker) in Berlin-Dahlem vorgestellt.
Die Vorlesungen „Grundlagen der Chemie“ und<br />
„Instrumentelle Analytik für Restauratoren“ wurden<br />
mit Hilfe von Multimedia-Elementen (Video, DVD<br />
und in-situ-Video-Experimente) erweitert. Die<br />
Praktika: „Grundpraktikum für Restauratoren“, „Einführung<br />
in die nasschemische Pigmentanalytik“,<br />
Erweiterung des Praktikums „Einführung in die<br />
Dünnschicht-Chromatographie“ (Dipl.-Chem.<br />
M. Schulz), gemeinsames Reinigungspraktikum mit<br />
Holz II (Dipl.-Chem. M. Schulz und I. Birkenbeul)<br />
und das online-VL-Projekt (Vorlesungs-Skripte per<br />
Internet, www.archaeometrielabor.com), konnten<br />
durch Einsatz der EDV weiter ausgebaut werden.<br />
Die Zeitschrift „Chemie in unserer Zeit“, ChiuZ, und<br />
anderes Lehrmaterial ist seit Anfang 2003 online<br />
von jedem Rechner der FH in Volltextversion lesbar.<br />
Die Universität Göttingen, Institut für Anorganische<br />
Chemie, ist Partnerinstitution für das Dissertationsvorhaben<br />
von Dipl.-Rest. Andreas Buder. Die von<br />
Herrn Buder erbrachten Studienleistungen im Fach<br />
Chemie wurden im Dezember 2003 von der<br />
Universität Göttingen als äquivalent zu einem<br />
Diplom anerkannt. Der Arbeitstitel seiner externen<br />
Dissertationsschrift lautet: „Die Irreversibilität des<br />
Alterns – Zur Thermodynamik des Zerfalls von<br />
Kunstwerken“.<br />
Das Archäometrielabor pflegt Zusammenarbeit mit<br />
dem GCI, Los Angeles, California, (The Getty<br />
Conservation Institute) im Rahmen des IRUG-<br />
Programms (Infrared User Group), mit der Berner
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Hochschule der Künste, Fachbereich Konservierung<br />
und Restaurierung (Studiengang Moderne<br />
Materialien, Prof. Dr. Wülfert, Prof. Dobrusskin) und<br />
dem LKA Niedersachsen, Forensische Abteilung und<br />
Spurensicherung.<br />
Der nun schon zum siebten Mal stattgefundene<br />
Praktikumsaustausch zwischen der Hochschule der<br />
Künste Bern (Prof. Dr. Wülfert „Polarisationsmikroskopie“)<br />
und der Fachhochschule Hildesheim (Dipl.-<br />
Chem. M. Schulz „Dünnschicht-Chromatographie“)<br />
fand in der vorlesungsfreien Zeit Ende Juli 2003<br />
statt.<br />
Ebenfalls in der vorlesungsfreien Zeit fand erstmals<br />
im Sommersemester 2003 ein Kurspraktikum zu<br />
„Speziellen Präparierungstechniken und Untersuchungsmethoden“<br />
und zur „Faseranalyse“ statt, das<br />
Herr Dipl.-Rest. Andreas Buder durchführte.<br />
Die begonnene Kooperation zwischen der<br />
Domkustodie und dem Dombaumeister und der<br />
<strong>HAWK</strong> bezüglich der restauratorischen Befundsicherung<br />
und Konzepterstellung für die geplante<br />
Restaurierung des Doms von Hildesheim wurde<br />
fortgeführt. Außer einer weiteren Projektwoche der<br />
Studienrichtung „Gefasste Holzobjekte und<br />
Gemälde“ laufen mehrere Einzeluntersuchungen im<br />
Rahmen von Facharbeiten in dieser Studienrichtung<br />
und in den Studienrichtungen „Steinobjekte“ und<br />
„Wandmalerei/Architekturoberfläche“.
Im Rahmen der Lehre der Studienrichtung „Buch<br />
und Papier“ ist die Kooperation mit der Dombibliothek<br />
Hildesheim ausgebaut worden: Das Projekt<br />
„Hildesheimer Prachthandschriften des Dommuseums“<br />
(Untersuchung, Maßnahmenkatalog,<br />
Empfehlungen zur richtigen Aufbewahrung der<br />
Handschriften) findet zur Gänze in der Dombibliothek<br />
statt, entsprechende Räume werden von der<br />
Dombibliothek zur Verfügung gestellt.<br />
Im Rahmen der Projektwochen im SS 2003 wurden<br />
unter der Leitung von Prof. Mag. Patricia Engel und<br />
Dipl.-Rest. Barbara Rittmeier von den Studierenden<br />
des 2. und 4. Semesters der Studienrichtung<br />
„Buch und Papier“ unter Beteiligung von drei Gaststudierenden<br />
der Akademie der Bildenden Künste<br />
Warschau die gesamte grafische Sammlung des<br />
Dommuseums und die bedeutende Siegelsammlung<br />
restauratorisch aufgenommen und die Lagerungsbedingungen<br />
erfasst. Aus dieser Arbeit ergaben sich<br />
im Weiteren Facharbeiten zum Vordiplom.<br />
Die Studierenden des 6. Semesters der Studienrichtung<br />
„Buch und Papier“ führten in den Projektwochen<br />
SS 2003 die Restaurierung des großen<br />
Papyrus des Roemer- und Pelizaeus-Museums in<br />
Hildesheim durch. Diese Arbeit war von einer<br />
Studentin im Rahmen ihrer Facharbeit vorbereitet<br />
worden.<br />
Thema der Projektwochen im WS 2003/04 (29.09. –<br />
10.10.2003) der Studienrichtung „Buch und Papier“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
die „große Routinekontrolle der Bestände nach 10<br />
Jahren“ der Bibliothek der Benediktinerabtei<br />
Altenburg in Niederösterreich. Die ca. 10.000 Bände<br />
von teilweise erheblicher Größe, Gewicht und Höhe<br />
der Ausstellung (10 m!) wurden fachgerecht<br />
gereinigt und auf Insektenbefall hin untersucht.<br />
Außerdem war die Bibliothek selbst Ausstellungsobjekt,<br />
die Studierenden betrieben aktive Öffentlichkeitsarbeit<br />
und klärten die Besucher über das<br />
restauratorische Tun auf. Darüber hinaus machten<br />
es sich die Studierenden selbst zur Zusatzaufgabe<br />
die Präsentation einiger Bücher in Vitrinen zu<br />
verbessern.<br />
Ende Oktober 2003 konnte von Prof. Mag. Patricia<br />
Engel fristgerecht das Globen-Projekt im Rahmen<br />
des EU-Programms „Culture 2000“ in Brüssel<br />
eingereicht werden. Partner der Hochschule sind<br />
dabei das Hornemann Institut, Hildesheim,TNO<br />
Industrial Technology, Papier and Board, Delft,<br />
Niederlande, „Department of conservation of Paper<br />
and Leather“ der Nicolaus Copernicus Universität,<br />
Torn, Polen, Veilje Amts Konserveringscenter,<br />
Kopenhagen, Dänemark. Die Entscheidung der EU-<br />
Kommission ist bis April 2004 zu erwarten.<br />
Anlässlich des Besuchs der Leiterin der Restaurierungswerkstätten<br />
des Matenaderan in Eriwan an der<br />
<strong>HAWK</strong> hat sich Frau Prof. Mag. Patricia Engel im<br />
vergangenen Herbst auf die Kooperation in einem<br />
Projekt zur Erhaltung der ältesten frühchristlichen<br />
Handschriften geeinigt. Das Problem ist Tintenfraß.
Armenische Tinten sind bisher nicht erforscht.<br />
Projektpartner waren zunächst drei deutsche<br />
Kollegen, eine Kollegin aus Italien und ein Kollege<br />
aus Russland, sowie das Team des Matenadaran. Im<br />
Laufe des Jahres seither konnten nicht nur zwei<br />
weitere Partner für das Projekt gewonnen werden<br />
(ein Geisteswissenschaftler aus Armenien, der sich<br />
mit den Inhalten der Texte befasst, sowie ein<br />
naturwissenschaftliches Forschungszentrum zur<br />
Analyse der Tinten in Rom), sondern es wurden<br />
bedeutende inhaltliche Fortschritte erreicht. Im<br />
Rahmen der Lehre wurden die ersten Tinten nach<br />
historischen Rezepten gemischt, um künstlich<br />
gealtert zu werden. Auf diese Weise produzierte<br />
Schäden sollen schließlich restauratorisch<br />
behandelt werden. Ein geeignetes Verfahren zur Behandlung<br />
der Bestände in Eriwan soll so gefunden<br />
werden. Parallel dazu konnte die Unterstützung des<br />
Mechitaristenklosters in Wien für unsere Arbeit<br />
gewonnen werden. Das Mechitaristenkloster Wien<br />
hat die viertgrößte Sammlung armenischer<br />
Handschriften in der Welt und ist in für uns<br />
erreichbarer Nähe. Für einen Lokalaugenschein in<br />
Eriwan werden im Moment Gelder gesucht. Ziel ist<br />
es zunächst eine geeignete Restaurierungsmethode<br />
für die Bestände zu finden, dann die 17.000<br />
betroffenen Handschriften vor Ort in Schadensklassen<br />
zu kategorisieren und schließlich mindestens<br />
eine dauerhafte Arbeitsstelle vor Ort zu finanzieren,<br />
um die Vorschläge umsetzten zu können.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Lettland: Auch im Juli 2003 nahmen wieder sieben<br />
Studierende der Studienrichtungen „Holz I“ und<br />
„Holz II“ zusammen mit Werkstattleiter „Holz I“,<br />
Dipl.-Rest. Martin Merkert, und in Kooperation mit<br />
Ausbildern und Studierenden vom Baukolleg Riga<br />
an einer Kampagne zur Restaurierung der Holzkirche<br />
in Igene teil.<br />
Die Studienrichtung „Gefasste Holzobjekte und<br />
Gemälde“ unter der Leitung von Prof. Dr. Michael<br />
Graf von der Goltz befasste sich – außer mit<br />
den genannten übergreifenden Projekten – mit<br />
folgenden weiteren Objekten:<br />
– Städtisches Museum Braunschweig,<br />
(restauratorische Befundsicherung, konservatorische<br />
Sofortmaßnahmen)<br />
– Bad Gandersheim, Stiftskirche: Verstärkte<br />
Zusammenarbeit („Mecklenburgisches Grabmal“,<br />
und museale Präsentation von ehemaligen<br />
Ausstattungsstücken)<br />
– Kassel, Landesmuseum: Neue Zusammenarbeit<br />
im Bereich Volkskunde (Zwei Schwingböcke)<br />
– Wiederbelebung der Zusammenarbeit mit<br />
Roemer Museum, Stadtgeschichtliche Sammlung<br />
im Knochenhaueramtshaus: Untersuchung und<br />
Konservierung von einer Skulptur und zwei<br />
Tafelbildern im Rahmen von Vordiplomarbeiten.<br />
– Verstärkte Kooperation mit dem Hildesheimer<br />
Dom. Eine weitere Projektwoche zur Bestandaufnahme<br />
der zwölf Apostel-Figuren in der Antoniuskapelle<br />
des Domes und von zwei ehemaligen<br />
barocken Beichtstühlen (heute im Depot).
– Erstmalige interdisziplinäre Zusammenarbeit mit<br />
dem Kunsthistorischen Seminar der Universität<br />
Göttingen<br />
Gefasste Holzobjekte und Gemälde:<br />
Im Rahmen von Fach- und Diplomarbeiten wurden<br />
zudem Objekte folgender Museen und Kirchen<br />
bearbeitet: Bomann Museum Celle, Museum Goslar,<br />
Kestner Museum Hannover, Dommuseum<br />
Hildesheim, Staatliche Museen Kassel, Diözese und<br />
Dom Hildesheim, St. Elisabethkirche zu Hude,<br />
Hersbrucker Stadtpfarrkirche.<br />
Weitere Museen im Umfeld sind an einer Zusammenarbeit<br />
interessiert.<br />
Die Studienrichtung „Holzobjekte mit veredelter<br />
Oberfläche“ („Holz II“) unter der Leitung von<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl führte mit ihren<br />
Studierenden das gemeinsam mit ungarischen<br />
Kolleginnen und Kollegen betriebene und von der<br />
FH HHG geförderte Forschungsprojekt zur Erforschung<br />
und Erhaltung eines Großzahlensembles<br />
spätmittelalterlicher Stollentruhen in Siebenbürgen/<br />
Rumänien weiter. Nach Abschluss von Pilotrestaurierungen<br />
an zwei Truhen wurde eine mehrwöchige<br />
Konservierungsaktion in der Wehrkirche in<br />
Henndorf/Rumänien vom 05. – 24. August 2003<br />
durchgeführt. Das binationale Studienpraktikum<br />
wurde vom DAAD in Bonn und von der Messerschmitt-Stiftung<br />
Osteuropa in Schäßburg gefördert.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Frau Prof. Dr. Maierbacher-Legl nahm auf Einladung<br />
der Akademie der Bildenden Künste Budapest,<br />
Fachbereich Restaurierung, mit vier Studierenden<br />
ihrer Studienrichtung an einem EU-geförderten<br />
Intensive Project in Budapest und Sibiu/Rumänien<br />
teil. Gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden<br />
von drei Sokrates Partner-Hochschulen aus<br />
Finnland, Ungarn und Rumänien wurden bemalte<br />
Kirchenausstattungen auf einer Rundreise durch<br />
Siebenbürgen studiert und anschließend im ASTRA-<br />
Freilichtmuseum in Sibiu/Hermannstadt siebenbürgisch-sächsische<br />
Möbel konserviert. Vorlesungen<br />
und Vorträge rundeten das umfangreiche Programm<br />
ab, welches vom 22. April bis zum 11. Mai 2003<br />
dauerte.<br />
Das von der <strong>HAWK</strong> geförderte Forschungs- und<br />
Entwicklungsvorhaben „Kommentierte Bibliografie-<br />
Datenbank zur Kultur-, Technologie- und Restaurierungsgeschichte<br />
des Möbels“ wurde von<br />
Prof. Dr. Maierbacher-Legl und Dipl.-Rest. Buchholz<br />
weitergeführt und maßgeblich durch Mittel der<br />
„Roentgen-Stiftung“ unterstützt.<br />
Diplom-, Projekt- und Facharbeiten in der Studienrichtung<br />
„Möbel und Holzobjekte“ waren – außer<br />
den genannten Projekten – mit Objekten folgender<br />
Kooperationspartner verbunden:<br />
Stiftung Sanatorium Dr. Barner Braunlage, Bauhaus<br />
Museum Berlin; Herzog-Anton-Ulrich-Museum<br />
Braunschweig; Focke Museum Bremen; Bomann<br />
Museum Celle; Deutsche Werkstätten Hellerau/
Dresden; Altonaer Museum Hamburg, Museum für<br />
Kunst und Gewerbe Hamburg; Kestner-Museum<br />
Hannover; Historisches Museum Hannover;<br />
Schlossmuseum Jever; Hessisches Landesmuseum<br />
Kassel; Heimat- und Volkskunstmuseum Kaufbeuren;<br />
Grassi Museum für Kunsthandwerk Leipzig;<br />
Schlossmuseum Ludwigsburg.<br />
Prof. Dr. Maierbacher-Legl und Prof. Dr. Petersen<br />
betreiben in Zusammenarbeit mit dem Wilhelm-<br />
Klauditz-Institut für Holzforschung am Fraunhofer-<br />
Institut in Braunschweig ein AGIP-Projekt zum<br />
Thema „Mikrowellen zur Desinfektion kontaminierter<br />
Kunstobjekte aus Holz“. Im Rahmen dieses<br />
Projekts wurde für die Dauer von zwei Jahren eine<br />
Diplomrestauratorin eingestellt.<br />
Der Praxisbezug der Nebenwirkungen der Mikrowellen-Bestrahlung<br />
von Kunst- und Kulturgut steht im<br />
Vordergrund und wird im interdisziplinären<br />
Zusammenspiel getestet.<br />
Die Studienrichtung „Steinobjekte“ unter der Leitung<br />
von Prof. Akad. Rest. Jan Schubert ist – außer<br />
an den genannten übergreifenden Projekten – an<br />
den DBU-Projekten „Granit“ und „Glasierte Ziegel“<br />
beteiligt, in Zusammenarbeit mit dem ZMK und dem<br />
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege.<br />
Zu den Projekten entstanden mehrere Facharbeiten<br />
und eine Diplomarbeit zum Thema: „Fixierung<br />
keramischer Glasuren an engobierter Terrakotta –<br />
Untersuchungen zur Eignung verschiedener<br />
Hinterfüllstoffe und Festigungsmittel“.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Im Rahmen der Kooperation mit dem Ägyptischen<br />
Museum der Universität Leipzig wurden an der<br />
<strong>HAWK</strong> ein Steinrelief aus der Grabanlage des<br />
ägyptischen Beamten Seschemnefer II. von<br />
2380 v. Chr. sowie zahlreiche Ushebti, Ostraka,<br />
Steinschalen und Reliefe restauriert.<br />
Im Rahmen der Kooperation mit der Universität<br />
Guadalajara/Mexiko verfasste Claudia Schindler<br />
eine Diplomarbeit zur „Untersuchung ausgewählter<br />
Materialien zur Festigung von Tuffstein an<br />
Bauwerken in Guadalajara“.<br />
Die Zusammenarbeit mit den internationalen<br />
Organisatoren der Konservierung der Felsentempel<br />
von Petra in Jordanien (CARCIP, BLFD, CSBE und<br />
IFAPO) führte zu einer Diplomarbeit von Wanja<br />
Wedekind: „Ein Pflege- und Konservierungsplan der<br />
antiken Entwässerungssysteme zum Schutz der<br />
Felsfassaden in Petra/Jordanien“.<br />
Prof. Jan Schubert arbeitet in Kooperation mit<br />
Prof. Dr. Thomas Thielmann vom Institut für<br />
Bauchemie der <strong>HAWK</strong> in Holzminden, am AGIP-<br />
Forschungsprojekt „Entwicklung neuartiger, kieselsolmodifizierter<br />
Hybridpolymere für die Steinkonservierung“.<br />
Ausgangspunkt dieses Forschungsprojektes<br />
ist die Diplomarbeit von Claudia Schindler.<br />
Die Studienrichtung „Wandmalerei/Architekturoberfläche“<br />
unter der Leitung von Prof. Dr. Ivo Hammer<br />
war – außer an den genannten übergreifenden
Projekten – an folgenden Drittmittel-Projekten tätig,<br />
immer in Zusammenarbeit mit der zuständigen<br />
Denkmalpflege, in der Regel in Form von (begleitenden)<br />
Facharbeiten, häufig in interdisziplinärer<br />
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Schädler-Saub,<br />
Prof. Dr. Petersen und Prof. Dr. Schulz:<br />
Müsselmow/Mecklenburg-Vorpommern (Pfarrkirche):<br />
Alle Studierenden der Studienrichtung waren<br />
an zwei Projektkampagnen der <strong>HAWK</strong> (19. –<br />
29.05.2003 und 29.09. – 10.10.2003) beteiligt.<br />
Gegenstand der Arbeiten war die konservatorisch<br />
notwendige mechanische Abnahme von Übertünchungen<br />
und die Fixierung. Träger: Verein der<br />
Freunde von Müsselmow e. V.<br />
– Idensen, alte Kirche, romanische Wandmalerei,<br />
Befundsicherung (Monitoring in der Petruskapelle<br />
und des Sockelbereichs)<br />
Träger: ev.-luth. LKA Hannover<br />
– Hildesheim, St. Michaelis, ehem. Sakristei<br />
(ev.-luth. LKA Hannover)<br />
– Hildesheim, Marienburg, Festsaal<br />
(Uni Hildesheim)<br />
– Hildesheim, Burg Steuerwald, Pallas, Rittersaal<br />
(Untere Denkmalschutzbehörde)<br />
– Halberstadt/Sachsen-Anhalt, Dom, Kreuzgang,<br />
Wandmalerei (Stiftung: Landesamt für Denkmalpflege))<br />
– Paderborn-Neuenbeken/Nordrhein-Westfalen,<br />
Pfarrkirche, Wandmalerei 13. Jahrhundert<br />
(Westfäl. Amt für Denkmalpflege)<br />
– Memmingen/Baden-Württemberg, ehem. Elsbethenkloster,<br />
Wandmalerei 15. Jh. (Sponsoring)
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
– Vechta, Probsteikirche St. Georg, Wandmalerei<br />
(Kirchengemeinde)<br />
Privates sponsoring (Fa. Dullinger Kalk, Salzburg)<br />
ermöglichte Prof. Dr. Ivo Hammer gemeinsam mit<br />
dem historischen Museum der Stadt Brünn und der<br />
staatlichen Denkmalpflege in Prag die Entwicklung<br />
eines Projekts zur Befundsicherung und Entwicklung<br />
eines Konservierungskonzepts für den Fassadenputz<br />
des Hauses Tugendhat von Mies van der Rohe<br />
in Brünn/Tschechien, seit 2001 zum UNESCO<br />
Weltkulturerbe gehörend. Mit insgesamt vier<br />
interdisziplinären Facharbeiten, einer Diplomarbeit<br />
und einer Projektkampagne der <strong>HAWK</strong> in Brünn im<br />
Mai 2004 wird das Thema im Kontext der Fassadenoberflächen<br />
der frühen Bauten von Mies van der<br />
Rohe (die bisher nicht erforscht sind) bearbeitet.<br />
Im WS 2003/04 hat Prof. Dr. Ivo Hammer mit dem<br />
von der <strong>HAWK</strong> geförderten Forschungsprojekt<br />
„Kompatible Fixierung/Konsolidierung von<br />
Wandmalerei und Archiekturoberfläche mit<br />
Nanokalk und anderen hydrophilen Materialien“ in<br />
enger Zusammenarbeit mit der Universität von<br />
Florenz, CSGI (Profs. Piero Baglioni und Luigi Dei)<br />
begonnen. Im Rahmen des Projekts fand am<br />
12./13. Dezember 2003 an der <strong>HAWK</strong> ein Seminar<br />
mit Prof. Luigi Dei statt. Die Arbeiten zur systematischen<br />
Untersuchung der Anwendungstechnolgie<br />
werden von zwei Studierenden im Rahmen einer<br />
Facharbeit durchgeführt.
Prof. Dr. Ivo Hammer konnte die Vorbereitung der<br />
Publikation des vom Österreichischen Forschungsfonds<br />
(FWF) geförderten Projekts zum Thema<br />
Frühmittelalterliche Wandmalereifragmente des<br />
Regnum Moravorum, an dem er in Zusammenarbeit<br />
mit den Universitäten in Wien, Bratislava, Brno,<br />
tschechischen und slowakischen Museen und dem<br />
Österreichischen Bundesdenkmalamt beteiligt ist,<br />
abschließen.<br />
Kooperation mit Hochschulen mit<br />
Restauratorenausbildung<br />
Am 1. Februar 2003, im Rahmen des Diplomtages,<br />
wurde ein Kooperationsvertrag der <strong>HAWK</strong> mit ECRO<br />
(Escuela de Conservacion y Restauracion de<br />
Occidente in Guadalajara, Mexiko) feierlich durch<br />
den Direktor Arq. Alejandro Canales Daroca und den<br />
Vizepräsidenten der <strong>HAWK</strong> Prof. Dr. Hubert Merkel<br />
unterzeichnet.<br />
Prof. Schubert oblag die Betreuung von Studierenden<br />
im Rahmen des Socrates Programms im<br />
Fachbereich Konservierung und Restaurierung der<br />
<strong>HAWK</strong>:<br />
– Vier Studierende der Escuela de Conservacion y<br />
Restauracion de Occidente in Guadalajara,<br />
Mexiko<br />
– Fünf Studierende der Kymenlaakso Polytechnic<br />
in Kouvola, Finnland<br />
– Vier Studierende der Technischen Universität in<br />
Krakau, Polen<br />
– Zwei Studierende der Kunstakademie in<br />
Warschau, Polen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Darüber hinaus ist im Rahmen der Kooperation mit<br />
der Kunstakademie in Warschau die Magisterarbeit<br />
von Marek Jeziorowski über glasierte Terrakotta<br />
entstanden.<br />
Eine Studierende unserer Fachhochschule mit dem<br />
Schwerpunkt Steinrestaurierung studierte ein<br />
Semester an der Nikolaus Kopernikus Universität in<br />
Thron, Polen.<br />
Das Staatliche Institut für Restaurierung in Moskau<br />
Gos NIIR und die Studienrichtung „Restaurierung<br />
von Buch und Papier“ haben sich über ein<br />
Abkommen, vergleichbar den Socratesvertägen<br />
innerhalb der EU geeinigt. Da mit russischen<br />
Institutionen keine Socratesverträge abgeschlossen<br />
werden können, ist bis jetzt Kontakt mit der<br />
Kulturstiftung der Länder und dem Goetheinstitut in<br />
Moskau aufgenommen worden. Es wurde Hilfe und<br />
Unterstützung der Idee versprochen und sogar<br />
finanzielle Hilfe für das Jahr 2004 in Aussicht<br />
gestellt.<br />
Im Rahmen des Socrates Programms hat Prof. Dr.<br />
Michael Graf von der Goltz einen Kooperationsvertrag<br />
mit der Sorbonne Universität Paris 1 abgeschlossen.<br />
Auf Einladung des Institut National du Patrimoine in<br />
Paris nahm Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz an<br />
einem international besetzten „Séminaire relatif à<br />
l’enseignement supérieur dans le domaine de la
estauration en Europe“ teil. Das INP ist auch an<br />
einem weiteren Informationsaustausch bezüglich<br />
der Entwicklung der Restauratorenausbildung stark<br />
interessiert.<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl und Prof. Dr. Karin<br />
Petersen nahmen am jährlichen Treffen der<br />
deutschsprachigen Hochschulen in Köln am 07. und<br />
08. November 2003 teil. Bei diesem Treffen wurde<br />
neuerlich durch eine Resolution bekräftigt, dass die<br />
betreffenden Studiengänge den Bachelor als<br />
berufsqualifizierenden Abschluss ablehnen. Zu<br />
diesem Thema wurde auch von mehreren Professorinnen/Professoren<br />
eine Informationsveranstaltung<br />
der Zewa an der Universität Hannover besucht.<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer gestaltete mit der Studienrichtung<br />
„Wandmalerei/Architekturoberfläche“ vom<br />
05. bis 07. Juni 2002 gemeinsam mit der Fachklasse<br />
für „Wandmalerei“ an der Hochschule für Bildende<br />
Künste in Dresden, unter Mitwirkung von Restaurator<br />
Johannes Weissenbach (Wien) das zweite<br />
Seminar in der Alten Ziegelei Hundisburg, dieses<br />
Mal zum Thema historische Verputze (Kalk, Gips,<br />
Verputz). Prof. M. A. Heinz Leitner und Dipl.-Rest<br />
Roland Lenz, Dresden bereiteten gemeinsam mit Dr.<br />
Dott. Thomas Danzl, Leiter der Restaurierungswerkstätten<br />
des Landesdenkmalamtes Sachsen-Anhalt<br />
das Seminar vor. An dem Seminar nahmen auch<br />
Studierende der entsprechenden Fachklassen der<br />
Fachhochschulen in Potsdam und Köln teil.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Prof. Dr. Karin Petersen hielt an den der Hochschule<br />
für Bildende Künste Dresden (10. – 14. Februar<br />
2003) und für die FH Potsdam (23. – 26. September<br />
2003) Vorlesungen zum Thema „Mikrobielle<br />
Zerstörung von Kunst und Kulturgut“.<br />
Prof. Petersen hat zudem die Betreuung für zwei<br />
Diplomarbeiten an der Akademie der Bildenden<br />
Künste in Stuttgart übernommen.<br />
Gastvorträge/Weiterbildung<br />
Besuch von Joost Caen, Königliche Akademie für<br />
Schöne Künste, Antwerpen, 26. – 28. November<br />
2003 auf Einladung von Prof. Mag. Patricia Engel,<br />
mit Vorträgen zu den Themen „Geschichte von Glasfenstern“<br />
und „Restaurierung von Glasfenstern“.<br />
Besuch von Iza Zajac, Akademie der Bildenden<br />
Künste, Warschau auf Einladung von Prof. Mag.<br />
Patricia Engel vom 17. – 19. Dezember 2003, mit<br />
Vorträgen zu den Themen „Restaurierung alter<br />
Drucke und Graphiken“ und „Lederrestaurierung in<br />
Warschau“.<br />
Im Jahr 2003 organisierte Frau Prof. Mag. Patricia<br />
Engel zwei Weiterbildungsangebote an Kollegen, die<br />
immer teilweise auch von den eigenen Studierenden<br />
belegt werden sollen; die Kurse wurden über<br />
die Fachpresse ausgeschrieben:<br />
– Lederchemie mit Claudius Schettino, Florenz;<br />
26. – 29. Januar (Übersetzung: Barbara<br />
Rittmeier).<br />
– Retusche mit Wolfgang Schwahn, Coburg;<br />
04. – 06. Juni
Das Angebot „Retusche“ wurde dabei erstmalig<br />
nicht nur an Studierende der eigenen Studienrichtung<br />
und Fachkollegen, sondern im Sinne der<br />
Interdisziplinarität auch an alle andere Studierenden<br />
des Fachbereichs gemacht und rege angenommen.<br />
In Zusammenarbeit mit Frau Dipl.-Rest. Barbara<br />
Hentschel hat Frau Prof. Dr. Karin Petersen ein<br />
e-learning modul zur „Mikrobiellen Schädigung von<br />
Kunst- und Kulturgut“ entwickelt, dessen Probedurchlauf<br />
auf 25 Teilnehmer aus dem Inland und<br />
dem europäischen Ausland begrenzt war. Dieser<br />
erste Kurs konnte bereits erfolgreich abgeschlossen<br />
werden.<br />
Frau Jordan-Fahrbach, Textilrestauratorin im Herzog-<br />
Anton-Ulrich-Museum, Braunschweig, gab auf<br />
Einladung von Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz<br />
ein zweitägiges Seminar zur Faserbestimmung.<br />
Frau Dipl.-Rest. Anna Gulyanska hielt auf Einladung<br />
von Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz einen<br />
Vortrag zum Thema Ikonenrestaurierung.<br />
Frau Dr. Barbara Rommé, Stadtmuseum Münster<br />
hielt einen Vortrag über Holzsichtigkeit im späten<br />
Mittelalter in Norddeutschland – Möbel und<br />
Retabelskulptur.<br />
Dipl.-Ing. Benita Albrecht führte im Januar 2003 für<br />
die Studienrichtungen „Stein“ und „Wand“ ein<br />
Blockseminar zu Techniken der Bauaufnahme durch.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Auf Einladung von Prof. Dr. Ivo Hammer hielt<br />
Prof. Dr. Luigi am 12./13.12.2003 ein Seminar über<br />
Nanokalk, das von Studierenden der Studienrichtungen<br />
„Stein“ und „Wand“ besucht wurde.<br />
Prof. Jan Schubert organisierte den 3-tägigen<br />
Workshop „KEIM-Silikattechnik“, der u. a. von Herrn<br />
Piedziejewski von der Kunstakademie in Warschau<br />
geleitet wurde.<br />
Auf Initiative von Prof. Jan Schubert wurde die<br />
Zusammenarbeit mit dem Institut für Bauchemie in<br />
Holzminden durch zwei Vortragsreihen von<br />
Prof. Dipl.-Ing. R. Möhring „Bauen – konstruktive<br />
und stoffliche Aspekte“ und Prof. Dr. T. Thielmann<br />
„Polymere – Eigenschaften und Anwendung“<br />
intensiviert.<br />
James Anderson, Universität Louisiana of Lafayette,<br />
USA, hielt auf Einladung von Prof. Jan Schuberrt<br />
einen dreitägigen workshop zu „Untersuchungen<br />
der steinernen Darstellungen an Kirchen in<br />
Schleswig-Holstein”. Außerdem hielt er einen<br />
öffentlichen Vortrag „Paralleldenken Ikonografie<br />
und Literatur – der Fall St. Wilhadi Kirche in Ulsnis“.<br />
Veröffentlichungen<br />
Komm. Prof. Mag. Patricia Engel<br />
Patricia Engel, Weniger ist mehr: Gedanken zur<br />
Minimalintervention am Buch, in: „Papierrestaurierung“,<br />
Vol.4 (2003) – No. 2.
Prof. Dr. Ivo Hammer<br />
Ivo Hammer, gemeinsam mit Erwin Stadlbauer, Rolf<br />
Niemeier und Jans-Jürgen Schwarz, Erfahrungen und<br />
denkmalpflegerische Strategien – Beispiel des<br />
Kreuzgangs der Michaeliskirche in Hildesheim, in:<br />
Heinz Leitner, Steffen Laue und Heiner Siedel<br />
(Hrsg.), Mauersalze und Architekturoberflächen,<br />
Tagungsbeiträge Hochschule für Bildende Künste<br />
Dresden, 01. – 03. Februar 2002, 94 – 106.<br />
Ivo Hammer, Bewusstsein und Zeit.<br />
Zur Erhaltungsgeschichte der romanischen Wandmalereien<br />
in Lambach und Salzburg Nonnberg, in:<br />
Matthias Exner und Ursula Schädler-Saub (Hrsg.),<br />
„Die Restaurierung der Restaurierung? Zum Umgang<br />
mit mittelalterlichen Wandmalereien und Architekturfassungen<br />
des Mittelalters im 19. und 20. Jahrhundert“,<br />
ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees<br />
XXXVII (Schriften des Hornemann Instituts<br />
Bd. 5), München 2002, 119 – 134.<br />
Ivo Hammer, Zeitgeist und Restaurierung.<br />
Moden und Alternativen in der Konservierung und<br />
Restaurierung von Wandmalerei, Impulsreferat bei<br />
der Podiumsdiskussion (Johanna Diehl, Wienfried<br />
Heiber, Stefan Kainz, Eva Kleinsasser, Barbara<br />
Matuella, Manfred Siems) (Tagung des Österreichischen<br />
Restauratorenverbands, Wien 15. November<br />
2002), Konservieren Restaurieren Bd. 7, Wien 2003.<br />
Ivo Hammer, Zur materiellen Erhaltung des Hauses<br />
Tugendhat in Brünn und anderer Frühwerke von
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Mies van der Rohe, in: Mies van der Rohe – restauriert,<br />
Tagung des Schinkelzentrums und des Graduiertenkollegs<br />
Kunstwissenschaft-Bauforschung-<br />
Denkmalfplege der TU Berlin 15./16. Dezember<br />
2001, im Druck.<br />
Ivo Hammer, Konservierung – Restaurierung.<br />
Vergängliches erhalten – Vergangenes Wiederherstellen?,<br />
in: Kunsthistorische Arbeitsblätter 10.3.10.,<br />
im Druck.<br />
Ivo Hammer, Bedeutung historischer Fassadenputze<br />
und denkmalpflegerische Konsequenzen. Zur<br />
Erhaltung der Materialität von Architekturoberfläche,<br />
in: Michael Petzet (Hrsg.), ICOMOS Hefte des<br />
Deutschen Nationalkomitees (Historische Architekturoberfläche.<br />
Kalk, Putz, Farbe – Historical<br />
Architectural Surfaces. Lime, Plaster and Colour.<br />
Tagung des Deutschen Nationalkomitees von<br />
ICOMOS und Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege<br />
München, Residenz, Max-Joseph-Saal,<br />
22.11.2002), im Druck.<br />
Dipl.-Rest. Anita Horn<br />
Anita Horn gemeinsam mit Henrik Schulz,<br />
Estimation of the Reliability of Hansen-Parameters<br />
of Photoxidative Degraded Polymer Films by Contact<br />
Angle Measurements, in: www.archaeometrielabor.<br />
com/Bilder/pdf/grenzflaechen01.pdf.<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl<br />
Gerdi Maierbacher-Legl, Werktechnische Standards
im historischen Möbelbau. Betrachtungen zum<br />
Berchtesgadener Standseitenschrank, in: Festschrift<br />
für Lenz Kriss-Rettenbeck zum 80. Geburtstag,<br />
Jahrbuch für Volkskunde 2003.<br />
Prof. Dr. Karin Petersen<br />
Karin Petersen, Guest editor für das Geomicrobiology<br />
Journal, Vol. 20, 3, 2003 Special Issue:<br />
Geomorphogenetic Potential of Microbial Biofilms.<br />
Karin Petersen, Wall Paintings – Aspects of<br />
Deterioration and Restoration, in: RSC Paperbacks:<br />
Principles of Conservation Science, E. May, ed. In<br />
press.<br />
Dipl.-Rest. Barbara Rittmeier<br />
Barbara Rittmeier, Das Restaurieren alter Bücher.<br />
Vorwort zur Neuauflage des Buches von Paul Adam<br />
(Erstauflage 1927), Hannover 2003<br />
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub<br />
Ursula Schädler-Saub, Entdeckung und Zerstörung?<br />
Zur Freilegung und Restaurierung mittelalterlicher<br />
Wandmalereien im Nürnberger Raum im 19. und 20.<br />
Jahrhundert, in: Matthias Exner und Ursula<br />
Schädler-Saub (Hrgs.), Die Restaurierung der<br />
Restaurierung? Zum Umgang mit Wandmalereien<br />
und Architekturfassungen des Mittelalters im 19.<br />
und 20. Jahrhundert, ICOMOS-Hefte des Deutschen<br />
Nationalkomitees XXXII und Schriftenreihe des Hornemann<br />
Institus Bd. 5, München 2003, 145 – 158.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Ursula Schädler-Saub, Zur Restaurierungsgeschichte<br />
mittelalterlicher Wandmalerei in Europa. Eine<br />
Bibliographie Raisonné, in: Matthias Exner und<br />
Ursula Schädler-Saub (Hrgs.), Die Restaurierung der<br />
Restaurierung? Zum Umgang mit Wandmalereien<br />
und Architekturfassungen des Mittelalters im 19.<br />
und 20. Jahrhundert, ICOMOS-Hefte des Deutschen<br />
Nationalkomitees XXXII und Schriftenreihe des Hornemann<br />
Institus Bd. 5, München 2003, 265 – 287.<br />
Ursula Schädler-Saub, Restaurierung und Zeitgeschmack.<br />
Zur Erhaltung und Neugestaltung<br />
historischer Rathaussäle im 19. Jahrhundert (mit<br />
wissenschaftlichem Katalog), in: Ursula Schädler-<br />
Saub und Angela Weyer (Hrsg.), Mittelalterliche<br />
Rathäuser in Niedersachsen und Bremen.<br />
Geschichte, Kunst, Erhaltung (Regionale Kulturerbe-<br />
Routen Bd. 2), Schriften des Hornemann Instituts<br />
Bd. 6, Petersberg 2003, 49 – 70 und 78 – 177<br />
(Katalog).<br />
Prof. Dr. Henrik Schulz<br />
Henrik Schulz gemeinsam mit Anita Horn,<br />
Estimation of the Reliability of Hansen-Parameters<br />
of Photoxidative Degraded Polymer Films by Contact<br />
Angle Measurements, in: www.archaeometrielabor.<br />
com/Bilder/pdf/grenzflaechen01.pdf.<br />
Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz<br />
Michael Graf von der Goltz, Die Düsseldorfer VDR-<br />
Tagung aus Sicht des VDR-Osteuropa-Beauftragten,<br />
in: VDR Bulletin 4, 2003, 7.
Michael Graf von der Goltz, La Faculté de la<br />
conservation et restauration à Hildesheim:<br />
situation, ECTS et „3/5/8“, in: Rechenschaftsbericht<br />
zum „Séminaire relatif à l’enseignement supérieur<br />
dans le domaine de la restauration en Europe“,<br />
Institut National du Patrimoine, Paris 2003.<br />
Vorträge<br />
Komm. Prof. Mag. Art. Patricia Engel<br />
Patricia Engel, Vorstellung des Fachbereichs<br />
Konservierung und Restaurierung der <strong>HAWK</strong> und<br />
Möglichkeiten der Kooperation (engl.), Universität<br />
Warschau, 17.02.2003.<br />
Patricia Engel, Vorlesung zu einem aktuellen<br />
Restaurierungsproblem Eisenoxidation auf<br />
Pergament an einem niederländischen Pergamenteinband<br />
des 17. Jahrhunderts, Universität Warschau,<br />
17.02.2003.<br />
Patricia Engel, „Konsultation vor dem Objekt“,<br />
Restaurierung eines Globus, Universität Warschau,<br />
18.02.2003.<br />
Patricia Engel, Gos NIIR Vortrag über Möglichkeiten<br />
einer Kooperation zwischen den beiden Instituten;<br />
anschließend Gespräch, Universität Moskau,<br />
(20.02. – 02.03.).<br />
Patricia Engel, „Armenische Tinten – Armenische<br />
Handschriften“, IADA Tagung Göttingen, 27.09.2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Patricia Engel, Sinnhaftigkeit des Kopierens im<br />
Rahmen der Ausbildung zum Restaurator am<br />
Beispiel der Kopierarbeit in der „Studienrichtung<br />
Restaurierung von Buch und Papier“, Poster IADA,<br />
Tagung Göttingen, 27.09.2003.<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer<br />
Ivo Hammer, Zu Geschichte und Möglichkeiten der<br />
Salzverminderung bei hydrophiler Architekturoberfläche,<br />
Werkstattgespräch des NLD in Zusammenarbeit<br />
mit der <strong>HAWK</strong>, Hannover, NLD 21.02.2003.<br />
Ivo Hammer, Principles and problems of tretment of<br />
salts in the conservation of architectural surfaces,<br />
Vortragsreihe Thorn, Universität, Fakultät für<br />
Konservierung, 12. Mai 2003.<br />
Ivo Hammer, Historische Verputze. Materialien und<br />
Techniken der Erhaltung, Fachklassentreffen in der<br />
Ziegelei Hundisburg, Sachsen-Anhalt, 12. Juni 2003.<br />
Ivo Hammer gemeinsam mit Johannes Weissenbach,<br />
Struktur, Faktur und Textur historischer Verputze<br />
(mit praktischen Übungen), Fachklassentreffen in<br />
der Ziegelei Hundisburg, Sachsen-Anhalt,<br />
13. Juni 2002.<br />
Ivo Hammer, Konservierung und politische<br />
Verantwortung, Beiträge bei der Podiumsdiskussion<br />
„Kunst und Diktatur“ des Österreichischen<br />
Restauratorenverbands, Wien, Oper, Gobelinsaal,<br />
10. Oktober 2003.
Ivo Hammer, Typologie und frühbürgerlicher<br />
Realismus. Zur Biblia Pauperum Weigel Felix, PML<br />
N.Y. Ms. 230, Dombibliothek Hildesheim,<br />
11. November 2003.<br />
Ivo Hammer, Technology Transfer of Heritage,<br />
Beitrag zum European Forum: Heritage Conservation<br />
and Technology Transfer, Monte Carlo,<br />
06. Dezember 2003.<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl<br />
Gerdi Maierbacher-Legl, Ethische Gesichtspunkte<br />
der Möbelrestaurierung. Vortrag im Rahmen der<br />
Praktikantenausbildung der Hamburger Museen am<br />
26. Februar 2003.<br />
Prof. Dr. Karin Petersen<br />
Karin Petersen, Simone Bröer und Ilka Töpfer:<br />
Biodeterioration of art objects – aspects of health<br />
risk. Int. Congress on Moulds, Health and Heritage,<br />
Braunschweig, 04. – 05. September 2003.<br />
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub<br />
Ursula Schädler-Saub, Wandmalereien mit Retabelfunktion<br />
in den Seitenkapellen von St. Lorenz in<br />
Nürnberg – Form und Ikonographie. Fachkolloquium<br />
zur Geschichte, Kunstgeschichte und Erhaltung der<br />
Stadtpfarrkirche St. Lorenz in Nürnberg,<br />
29. – 30. März 2003.<br />
Ursula Schädler-Saub, Über die Bedeutung der Restaurierungsgeschichte<br />
zum Verständnis von Kultur-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
denkmalen. Kurzvortrag anlässlich folgender<br />
Buchpräsentation am 29.04.2003 in St. Michael in<br />
Hildesheim: Matthias Exner und Ursula Schädler-<br />
Saub (Hrgs.), Die Restaurierung der Restaurierung?<br />
Zum Umgang mit Wandmalereien und Architekturfassungen<br />
des Mittelalters im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
ICOMOS-Hefte des Deutschen Nationalkomitees<br />
XXXII und Schriftenreihe des Hornemann<br />
Institus Bd. 5, München 2003.<br />
Ursula Schädler-Saub, Italia und Germania: Die<br />
italienischen Restaurierungstheorien und Retuschiermethoden<br />
und ihre Rezeption in Deutschland.<br />
Vortrag auf der internationalen Fachtagung des<br />
Bayerischen Nationalmuseums und des Deutschen<br />
Nationalkomitees von ICOMOS „Die Kunst der<br />
Restaurierung. Entwicklungen und Tendenzen der<br />
Restaurierungsästhetik in Europa“, München<br />
14. – 17. Mai 2003.<br />
Ursula Schädler-Saub, Zur Restaurierungsgeschichte<br />
mittelalterlicher Rathäuser in Niedersachsen, am<br />
Beispiel des Hildesheimer Rathauses, Vortrag<br />
anlässlich folgender Buchpräsentation am<br />
25.09.2003: Ursula Schädler-Saub und Angela<br />
Weyer (Hrsg.), Mittelalterliche Rathäuser in<br />
Niedersachsen und Bremen. Geschichte, Kunst,<br />
Erhaltung (Regionale Kulturerbe-Routen Bd. 2),<br />
Schriften des Hornemann Institus Bd. 6, Petersberg<br />
2003.
Ursula Schädler-Saub, Le influenze di Cesare Brandi<br />
e dell’Istituto Centrale per il Restauro sulla teoria e<br />
sulla prassi del restauro in Germania, Convegno<br />
internazionale di Studi „Brandi fuori d’Italia“<br />
promosso dall’Istituto Centrale per il Restauro,<br />
ICCROM, UNESCO e Unione Europea, sotto l’Alto<br />
Patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana,<br />
Assisi 28. – 30.11.2003.<br />
Prof. Akad. Rest. Jan Schubert<br />
Jan Schubert, „Theorie und Praxis in der Baudenkmalpflege“,<br />
EGIR Zweite Europäische Restaurierungs<br />
Informationsbörse, Universität Krakau,<br />
13. – 15. Februar 2003.<br />
Jan Schubert, „Salzschäden an Bauwerken –<br />
Konservatorische Behandlungsmethoden“, Dozentenaustausch<br />
im Rahmen des SOKRATES-Programm,<br />
Technische Universität Krakau, Februar 2003.<br />
Jan Schubert, „Erhaltung und Pflege salzbelasteter<br />
Kulturobjekte“, Werkstattgespräch für Restauratoren<br />
am NLD Hannover, 21. Februar 2003.<br />
Prof. Dr. Henrik Schulz<br />
Henrik Schulz gemeinsam mit Anita Horn,<br />
„Bestimmung der Löslichkeits-Parameter photooxidativ<br />
geschädigter Polymer-Überzüge durch<br />
Randwinkelmessungen“, 23. GdCh-Tagung in Berlin-<br />
Dahlem, März 2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub war als ehrenamtliche<br />
Beraterin bei schwierigen Restaurierungsvorhaben<br />
in der Denkmalpflege tätig, u. a. bei der<br />
Restaurierung des Katharinen-Altars in der Stadtpfarrkirche<br />
St. Sebald in Nürnberg.<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer und Prof. Dr. Ursula Schädler-<br />
Saub waren am 04. August 2003 als ehrenamtliche<br />
Berater des NLD bezüglich der Erhaltungder<br />
mitelalterlichen Wandmalereien in Eilsum tätig.<br />
Über die normalen Arbeiten als Werkstattleiterin<br />
hinaus leistete Frau Dipl.-Rest. Barbara Rittmeier die<br />
laufende Übersetzung der Einleitung des Seminares<br />
„Lederchemie“ im Januar 2003 (italienisch-deutsch).<br />
Für die visuelle Darstellung der umfangreichen<br />
Schriften der Bibel der Bibelausstellung „Das Buch –<br />
Die Bibel und ihre Bilder“ im Dommuseum Hildesheim<br />
(01.02. – 21.04.2003) fertigte Frau Rittmeier<br />
Nachbildungen (46 Schriftrollen und 26 Bücher) an.<br />
Im November organisierte Frau Rittmeier im Zuge<br />
der „Präventiven Konservierung“ die Vorstellung<br />
verschiedener Arten der Klimaüberwachung für<br />
Kunstwerke für Studierende des gesamten<br />
Fachbereiches mit Andreas Reiter, Hofolding.<br />
Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Hornemann<br />
Institut wurde im Sommer mit der Umstellung der<br />
bisherigen Art der Dokumentation der zu bearbei-
tenden Objekte in der Werkstatt begonnen; zum<br />
Anlaß der IADA-Tagung in Göttingen im September<br />
wurde die erste Dokumentation der Werkstatt Buch<br />
und Papier exemplarisch in „hericare“ vorgestellt.<br />
Im Rahmen der Projektgruppe Kreuzgang war<br />
Prof. Dr. Hammer ehrenamtlich als Fachgutachter<br />
tätig. Für das Oberlandesgericht Celle fertigte und<br />
verteidigte am 05.05.2003 Prof. Dr. Hammer ein<br />
Obergutachten in einem Verfahren, das eine Fassadenrestaurierung<br />
betraf.<br />
Das von Prof. Dr. Ivo Hammer und Prof. Dr. Ursula<br />
Schädler-Saub für das Hornemann Institut, in<br />
Kooperation mit dem Zentrum für Fernstudium der<br />
Universität Hildesheim, erarbeitete Fortbildungsmodul<br />
für Restauratorinnen und Restauratoren mit<br />
dem Titel „Restauratorische Befundsicherung von<br />
Architekturoberfläche“ wird derzeit vom Hornemann<br />
Institut vor allem nach medientechnischen<br />
Gesichtspunkten überarbeitet. Das Fortbildungsmodul<br />
soll zunächst in Form einer CD erscheinen.<br />
Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz und Dipl.-Rest.<br />
Ina Birkenbeul nahmen in Köln an der zweitägigen<br />
Tagung der VDR-Fachgruppe Polychrome Bildwerke,<br />
zum Thema Ergänzung – Retusche – Rekonstruktion,<br />
teil.<br />
Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz und die Werkstattleiter<br />
Dipl.-Rest. Ina Birkenbeul und Dipl.-Rest.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
Martin Merkert nahmen an der Tagung VDR-Jahrestagung<br />
in Düsseldorf zum Thema „Oberflächenreinigung“<br />
teil.<br />
Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz wurde zum<br />
Osteuropa-Beauftragten des Verbandes der<br />
Restauratoren VDR benannt. In dieser Funktion<br />
nahm er an einer Podiumsdiskussion zum Thema<br />
Restauratoren in Europa teil und moderierte einen<br />
Teil der VDR-Jahrestagung.<br />
Anlässlich des Internationalen Museumstages,<br />
18.05.03, präsentierten Werkstattleiterin<br />
Dipl.-Rest. Ina Birkenbeul und zwei Studierende im<br />
Stadtmuseum Goslar Objekte, die in der Holz I<br />
Restaurierungswerkstatt von Studierenden<br />
bearbeitet worden sind.<br />
Auf Ersuchen der ZMK gab Prof. Dr. Michael Graf von<br />
der Goltz eine schriftliche Stellungnahme zur<br />
geplanten Restaurierung der „Nana Caroline“ von<br />
Niki St. Phalle, Hannover, ab.<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl wirkte als Jurymitglied<br />
der Kunstmesse München 2003, Sachgebiet<br />
Möbel des 16. bis 19. Jahrhundert.<br />
Werkstattleiter Dipl.-Rest. Ralf Buchholz ist als<br />
Fachgruppenleiter Möbel und Holzobjekte des Verbandes<br />
der Restauratoren VDR tätig und damit im<br />
Bundesvorstand des VDR.
26. Mai – 01. April 2003: Messe „LIGNA“ in<br />
Hannover, gemeinsamer Messestand der Studienrichtung<br />
„Möbel und Holzobjekte“ mit der Fakultät<br />
Gestaltung (Innenarchitektur), dem Studiengang<br />
Holzingenieurwesen und der Fakultät Ressourcenmanagement<br />
der <strong>HAWK</strong>.<br />
Prof. Schubert führte Untersuchungen an dem<br />
Weltkulturerbeobjekt „Boim Kapelle“ in Lviv<br />
(Lemberg), Ukraine zur Vorbereitung eines Projektes<br />
mit der „Lviv Foundation for the Preservation of<br />
Architectural and Historical Monuments“ durch.<br />
Prof. Jan Schubert ist Ansprechpartner für die<br />
Auslands-Kooperation mit den Hochschulen in<br />
Thorn, Warschau und Krakau in Polen, sowie den<br />
Hochschulen in Kouvola, Finnland, Carrara, Italien<br />
und Guadalajara in Mexiko.<br />
Prof. Dr. Schädler-Saub nahm am 08. – 10.05.2003<br />
in Thessaloniki, Griechenland, an einer internationalen<br />
Fachkonferenz von ICOMOS über die<br />
Erhaltung von Wandmalereien teil und wirkte an der<br />
abschließenden Bearbeitung und Verabschiedung<br />
einer internationalen Charta „Principles for the<br />
Preservation and Conservation-Restoration of Wall<br />
Paintings“ mit.<br />
Prof. Dr. Schädler-Saub führte die Konzeption und<br />
Planung einer internationalen Fachtagung durch, die<br />
vom Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS<br />
zusammen mit dem Bayerischen Nationalmuseum
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
in München organisiert wurde. Die Tagung fand im<br />
Mai 2003 statt und befasste sich mit dem Thema:<br />
„Die Kunst der Restaurierung. Entwicklungen und<br />
Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa“.<br />
Als Mitglied der Monitoring-Gruppe von ICOMOS für<br />
die Erhaltung des Weltkurlturerbes in Deutschland<br />
befasste sich Prof. Dr. Schädler-Saub u. a. mit<br />
Fragen der Erhaltung und Nutzung der historischen<br />
Altstädte von Wismar und Stralsund, die neu in die<br />
Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurden.<br />
Prof. Dr. Schädler-Saub gab dem Kultursender des<br />
WDR am 14.05.2003 ein 20-minütiges Interview<br />
über Fragen der Restaurierungsethik und Restaurierungsästhetik.<br />
Zum selben Thema gab Prof. Dr. Schädler-Saub der<br />
Kulturredaktion des BR 2 ein kurzes Interview am<br />
15.05.2003.<br />
Im Rahmen der internationalen Projektwochen der<br />
Fachrichtung „Möbel und Holzobjekte mit veredelter<br />
Oberfläche“ in Siebenbürgen/Rumänien im August<br />
2003 hat das Archäometrielabor u. a. an den<br />
interdisziplinären Projekten u. a. des Astra-<br />
Museums in Hermannstadt und der Fakultät Konservierungswissenschaften<br />
der Akademie der Künste<br />
Budapest teilgenommen. Ein aktiver Lehraustausch<br />
ist für das Jahr 2004 geplant.<br />
Prof. Jan Schubert ist Ansprechpartner für die<br />
Auslands-Kooperation, unter anderem zwischen den
Hochschulen in Thorn, Warschau und Krakau in<br />
Polen und der <strong>HAWK</strong> Hildesheim im Rahmen des<br />
Socrates-Programms.<br />
Ansprechpartner des Studienganges Restaurierung<br />
für ENCoRE (European Network for Conservation-<br />
Restoration Education) ist der Dekan.<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer wirkte als Berater der Jury für<br />
den Grand Prix for Innovation Award. Er schlug<br />
die Arbeit des CSGI der Universität von Florenz für<br />
den Preis vor. Am 6. Dezember 2003 empfing<br />
Prof. Dr. Piero Baglioni den Großen Preis der Jury für<br />
Innovation in Heritage Konservation. Damit wird<br />
auch die Arbeit von Prof. Enzo Ferroni, dem Erfinder<br />
der Gipsumwandlungsmethode geehrt.<br />
Der Magistrat der Stadt Brünn hat Prof. Dr. Ivo<br />
Hammer als Beirat für die Konservierung und<br />
Wiederherstellung des Hauses Tugendhat von Mies<br />
van der Rohe in Brünn/Tschechien eingeladen.<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer hat für das Arbeitsamt Erfurt<br />
im Rahmen einer landesweiten Orientierungsveranstaltung<br />
am 14.02.2003 einen Vortrag zur Information<br />
über das Berufsbild des Restaurators/der<br />
Restauratorin gehalten. Titel: Vergängliches<br />
erhalten, Vergangenes wiederherstellen?<br />
Lehrveranstaltungen vor Ort<br />
Prof. Mag. Patricia Engel<br />
– Lehrveranstaltung im Zusammenhang mit dem<br />
Tintenprojekt im historischen Bergwerk Ram-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
melsberg. Rammelsberger Vitriole wurden zur<br />
lokalen Tintenproduktion bereits seit dem<br />
Mittelalter verwendet. Mit Hilfe von Untersuchungen<br />
der Spurenelemente konnte das eindeutig<br />
nachgewiesen werden.<br />
Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub<br />
– Florenz und Arezzo: Denkmale der Frührenaissance,<br />
Besuch der Restaurierwerkstätten<br />
der Fortezza da Basso und des Opificio delle<br />
Pietre Dure in Florenz. Besuch laufender<br />
Restaurierungsarbeiten an der „Confraternita“ in<br />
Arezzo und in der „Cappella della Maddalena“<br />
im Bargello in Florenz.<br />
– Eintägige Exkursionen: Museen in Braunschweig<br />
und Hamburg, mittelalterliche Kirchen in Braunschweig,<br />
Königslutter, Idensen und Halberstadt.<br />
Prof. Dr. Michael Graf von der Goltz<br />
– Kunstmuseum Wolfsburg: Zusammen mit Studierenden<br />
und der Werkstattleiterin Ina Birkenbeul<br />
wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Michael<br />
Graf von der Goltz das Gemälde „Double be a<br />
Somebody with a body“ von Andy Warhol<br />
(Maße 294,6 x 538,5 cm) für einen Transport<br />
nach New York abgespannt und aufgerollt.<br />
– Hannover, Sprengelmuseum: Ausstellung Niki St.<br />
Phalle (Materialvielfalt der zeitgenössischen<br />
Kunst), Führung durch Bettina von der Goltz.<br />
– Städtisches Museum Braunschweig: Im Rahmen<br />
einer Projektwoche wurde semesterübergreifend<br />
(1., 3. und 7. Sem.) eine Bestandsaufnahme zu
den in der Ausstellung befindlichen mittelalterlichen<br />
Holzobjekten erarbeitet.<br />
– Hildesheim Dom: Im Rahmen einer Projektwoche<br />
Bestandsaufnahme der zwölf Apostel-Figuren in<br />
der Antoniuskapelle des Domes und von<br />
zwei ehemaligen barocken Beichtstühlen, heute<br />
im Depot.<br />
– Kunstsammlungen der Universität Göttingen:<br />
Unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Graf von<br />
der Goltz und Dr. Gerd Unverferth (Kunsthistorisches<br />
Seminar der Universität Göttingen)<br />
sowie der Mitarbeit von Werkstattleiter Dipl.-Rest.<br />
Martin Merkert wurden im Rahmen einer<br />
Projektwoche semesterübergreifend von<br />
Studierenden der Kunstgeschichte (Göttingen)<br />
und der Konservierung und Restaurierung<br />
(Hildesheim) Gemälde der Kunstsammlung der<br />
Universität Göttingen interdisziplinär kunsthistorisch,<br />
kunsttechnologisch und restauratorisch<br />
untersucht. Das übereinstimmend als sehr<br />
erfolgreich bewertete Experiment soll im SS 04<br />
mit weiteren Studierenden fortgeführt werden.<br />
– Besuch und Besichtigung der Restaurierungswerkstätten<br />
des Herzog-Anton-Ulrich-Museums,<br />
Braunschweig, mit Studierenden des ersten,<br />
dritten und siebten Semesters, Holz I.<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl<br />
– 19. Mai 2003: Freilichtmuseum Detmold,<br />
Monitoring Holzschädlinge, Führung durch<br />
Dr. Uwe Noldt, Bundesforschungsanstalt für<br />
Holz- und Forstwirtschaft Uni Hamburg.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fachbereich Konservierung und Restaurierung<br />
– 20 Mai 2003: Ausstellung „Feine Möbel aus<br />
Westfalen“ im Freilichtmuseum Detmold,<br />
Führungen durch Dipl.-Rest. Jochen Winkelbach<br />
und Prof. Dr. Stefan Baumeier.<br />
– 06. Mai 2003: Städt. Museum Braunschweig und<br />
Herzog-Anton-Ulrich-Museum Braunschweig:<br />
Übungen vor Originalen mit Führungen durch<br />
Dr. Eberle und Dr. Walz.<br />
Dipl.-Rest. Ralf Buchholz<br />
– Stadtmuseum Kaufbeuren, Kartierung und Ausbau<br />
von zwei Holzdecken des 18. Jahrhunderts,<br />
23. – 26. September.<br />
Prof. Akad. Rest. Jan Schubert gemeinsam mit<br />
Prof. Dr. Ivo Hammer<br />
– Thorn, Marienburg, Danzig: Besuch der Restaurierungswerkstätten<br />
der Partnerhochschule in<br />
Thorn und Besichtigung restaurierter Objekte,<br />
Mai 2003.
Fakultät<br />
Naturwissenschaften und Technik<br />
Geschäftsführender Dekan<br />
Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Müller<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr.-Ing. Axel Bangert<br />
Studienangebot<br />
Der Lehrbetrieb an der Fakultät wurde mit dem Sommersemester<br />
1992 aufgenommen.<br />
Zurzeit studieren neun Semestergruppen in den<br />
Studiengängen Physiktechnik, Messtechnik,<br />
Feinwerktechnik, Präzisionstechnik, Elektrotechnik<br />
und Informatik sowie Bau-Chemie in Holzminden.<br />
Seit 2001 wird ein Masterstudiengang „Optical<br />
Engineering/Photonics“ angeboten.<br />
Die Studiengänge Physiktechnik, Feinwerktechnik,<br />
Präzisionstechnik, Elektrotechnik und Informatik<br />
werden als Studium im Praxisverbund und Studium<br />
mit berufspraktischen Studiensemestern angeboten.<br />
Die Studienzeit beträgt einheitlich acht<br />
Semester. Das Studium beginnt jeweils mit dem<br />
Wintersemester. Am Ende des Studiums steht der<br />
Abschluss zur Diplomingenieurin bzw. zum<br />
Diplomingenieur (FH) in den fünf Fachrichtungen:<br />
Physiktechnik Schwerpunkte:<br />
Technische Optik und<br />
Lasertechnik<br />
Feinwerktechnik Schwerpunkte:<br />
Konstruktion und Fertigung<br />
in Verbindung mit CIM
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Präzisionsferti- Schwerpunkte:<br />
gungstechnik Optik und Mechanik<br />
Informatik Vertiefungsrichtungen:<br />
Automatisierungtechnik<br />
und Medientechnik<br />
Elektrotechnik Vertiefungsrichtung:<br />
Messtechnik<br />
Der zum Wintersemester 2001/2002 aufgenommene<br />
Masterstudiengang „Master of Science in Optical<br />
Engineering/Photonics“ wird von 62 Studierenden,<br />
davon 13 Frauen, im Teilzeit- oder Vollzeitstudium<br />
wahrgenommen. Der Studiengang schließt mit der<br />
Masterprüfung und dem Hochschulgrad „Master of<br />
Science (M. Sc.)“ ab.<br />
Außerdem beteiligt sich die Fakultät gemeinsam mit<br />
der Fakultät Ressourcenmanagement am Studiengang<br />
Wirtschaftsingenieurwesen.<br />
Studium im Praxisverbund<br />
Das Studium verknüpft die theoretische Ausbildung<br />
an der Fachhochschule mit einer praktischen<br />
Ausbildung in Betrieben des Praxisverbundes in<br />
zeitlichen Blöcken (Praxisphasen) in einem Gesamtumfang<br />
von 80 Wochen. Das Studium im Praxisverbund<br />
ist entweder mit einer industriellen Ausbildung<br />
für eine Facharbeiterprüfung vor der IHK nach<br />
dem Grundstudium in einem dem Studienfach
entsprechenden Ausbildungsberuf verknüpft oder<br />
erlaubt eine in das Studium integrierte industrielle<br />
Tätigkeit.<br />
Im Hauptstudium arbeiten die Studierenden als<br />
Praktikanten in den Betrieben/Instituten und wenden<br />
das an der Fachhochschule erworbene Wissen<br />
unmittelbar praktisch an. Mit diesem Modell wird<br />
eine besonders praxisnahe Qualifikation vermittelt.<br />
Studium mit berufspraktischen Studiensemestern<br />
(Praxissemester)<br />
In diesem Studienmodell sind praxisorientierte<br />
Studiensemester jeweils als 5. und 8. Fachsemester<br />
vorgesehen. Die Lehrinhalte entsprechen dem<br />
Studium im Praxisverbund. Im 8. Semester wird<br />
gleichzeitig die Diplomarbeit angefertigt.<br />
Studienerfolg<br />
In den neun Semestern studieren insgesamt 446<br />
Studentinnen und Studenten, davon 308 mit<br />
Praxissemestern und 71 im Praxisverbund, der<br />
Frauenanteil liegt bei 14 Prozent, der Anteil der<br />
ausländischen Studierenden beträgt neun Prozent.<br />
Die Abbrecherquote liegt im Berichtszeitraum unter<br />
fünf Prozent. Der Anteil an Studierenden mit<br />
Praxissemestern beträgt 84 Prozent gegenüber 16<br />
Prozent im Praxisverbund.<br />
Im Berichtszeitraum konnten 30 Diplomarbeiten<br />
erfolgreich abgeschlossen werden. Sie wurden vor<br />
allem in Industriebetrieben und Instituten der
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Region Südniedersachsen geschrieben.<br />
Die Fakultät beteiligt sich mit ca. 30 Prozent an dem<br />
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der<br />
Fakultät Ressourcenmanagement.<br />
Ausbau der Präzisionsfertigungstechnik<br />
Der Studiengang Präzisionsfertigungstechnik der<br />
Fakultät für Naturwissenschaften und Technik (N) in<br />
Göttingen existiert seit Herbst 2000. Inzwischen<br />
haben rund 50 Studierende diesen spezifischen<br />
Studiengang aufgenommen. Die ersten Absolventinnen<br />
und Absolventen dieses fertigungstechnisch<br />
geprägten Studiengangs erwarten wir im Sommer<br />
dieses Jahres.<br />
Neben dem Neubau mit rund 950 m 2 Nutzfläche,<br />
welcher Ende 2001 der Nutzung zugeführt wurde, ist<br />
die maschinelle und gerätetechnische Ausstattung<br />
zur Ingenieurausbildung von größter Bedeutung. In<br />
den letzten Monaten des vergangenen Jahres 2003<br />
konnten wir unsere Fertigungsräume mit hochmodernen<br />
CNC-Maschinen und Messgeräten im<br />
Bereich der optischen Produktionsverfahren mit vier<br />
Großgeräten ausstatten. Im Einzelnen handelt es<br />
sich hierbei um eine Optikschleifmaschine der<br />
Firma Schneider, eine Poliermaschine der Firma<br />
OptoTech und eine Zentrier- und Randbearbeitungsmaschine<br />
der Firma LOH. Mit diesen CNC-Bearbeitungsmaschinen<br />
ist es uns möglich, im Bereich<br />
der Feinoptik sphärische und asphärische Linsen<br />
bis Durchmesser 120 mm in höchster Genauigkeit<br />
zu fertigen. Zur Prüfung der erzielten Genauigkeiten
der optisch wirksamen Oberflächen wird das vierte<br />
Großgerät, ein Interferometer der Firma OptoTech<br />
mit fünf Objektiven, welches sowohl sphärische als<br />
auch asphärische Flächen vermessen kann,<br />
eingesetzt.<br />
Mit diesen Maschinen und Geräten steht uns eine<br />
fertigungstechnische Basis im Bereich der Optikproduktion<br />
zur Verfügung, die ihres Gleichen sucht.<br />
Die Ingenieurausbildung sowohl im Bereich der<br />
Optik- als auch im Bereich der Mechanik-Fertigung<br />
wird unseren Studierenden, unserer Fakultät und im<br />
Anschluss daran der optischen Industrie, welche zur<br />
Beschaffung dieser vier Großgeräte ebenfalls einen<br />
wesentlichen Beitrag geleistet hat, zugute kommen.<br />
Forschung<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: „Augensicherer LED/LD-<br />
Strahler für Bildsensoranwendungen“<br />
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kegler konnte im Sommersemester<br />
2003 und im Wintersemester 2003/2004<br />
seine Untersuchungen aus dem Forschungssemester<br />
im Jahr 2002 zur offenen standardisierten<br />
Steuerungstechnik mit dem aktuellen Teilthema<br />
„Untersuchungen von neuen Entwicklungen und<br />
Konzepten zur Projektierung und Visualisierung<br />
offener verteilter Automatisierungsaufgaben“<br />
fortführen.<br />
Prof. Dr. Andrea Koch: Von der FH HHG in 2003<br />
gefördertes Projekt: Optischer Sensor zur schnellen<br />
Erfassung von Gas- und Flüssigkeitleckagen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Prof. Dr. Thomas Reck: Entwicklung eines modellgestützten<br />
Messverfahrens für den Einsatz in der<br />
Automobilindustrie.<br />
Prof. Dr. Karl-Josef Schalz: Hochgenaue Konturmessung<br />
an geschliffenen Glasoberflächen<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Von der FH HHG in 2003<br />
unterstützte Forschungsprojekte:<br />
– EUV-Strahlungsquelle<br />
– Plasmavorbehandlung eines Finger- oder<br />
Fußnagels für eine Lackierung<br />
Prof. Dr. Petra Weidner: Forschungsaufenthalt am<br />
Department of Mathematical Information Technology<br />
der University of Jyväskylä, Finnland,<br />
26.05. – 25.06.2003.<br />
In 2003 bearbeitete Forschungsthemen:<br />
– Untersuchung und Erweiterung des Anwendungsbereiches<br />
der interaktiven Software NIMBUS<br />
– Testrichtlinien für Software zur Lösung mehrkriterieller<br />
Probleme<br />
– Gutachtertätigkeit und Buchbesprechungen für<br />
den Physica-Verlag sowie die Zeitschriften<br />
„Journal Optimization Methods and Software“<br />
und „Mathematical Methods of Operations<br />
Research“<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Prof. Dr.-Ing. Axel Bangert: Internationaler Tag für<br />
Studierende. Informationsveranstaltung über<br />
ERASMUS-Programm und Partnerhochschulen,<br />
29. Oktober 2003.
Prof. Dr. Rohwer (Stellenbosch, Südafrika) hat im<br />
Sommersemester 2003 als Gastdozent Vorlesungen<br />
im Masterstudiengang Optical Engineering/Photonics<br />
gehalten.<br />
Bis August 2003 unterstützte Frau Prof. Dr. Márta<br />
Seebauer von der Budapester Technischen Fachhochschule<br />
den Studiengang Informatik im Rahmen<br />
einer DAAD-Gastprofessur.<br />
Am 10. und 11. Juli 2003 nahmen Frau Prof. Dr.<br />
Márta Seebauer und Prof. Dr.-Ing. Andreas Kegler an<br />
der Jahrestagung des DAAD für ausländische<br />
Gastdozentinnen/Gastdozenten und deutsche<br />
Gastgeber in Bonn teil.<br />
6. November 2003: Vernissage der Georg-Christoph-<br />
Lichtenberg-Gesamtschule (IGS) mit dem Mitglied<br />
des Landtages Herrn Thomas Oppermann.<br />
Übergabe des Laser-Scannig-Mikroskops der Firma<br />
Carl Zeiss Göttingen mit dem Geschäftsbereichsleiter<br />
Herrn Dr. Bernd Faltermeier.<br />
Praktika für Externe<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl:<br />
Praktikum als Europasekretärin:<br />
Anja Maue und Anne Klingner.<br />
Ausbildung zur Physikalischen Technischen<br />
Assistentin:<br />
Valentina Franz und Barbara Eberhardt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Preise<br />
Am 26. März 03 fand die diesjährige Verleihung der<br />
Physik-Preise durch die Deutsche Physikalische<br />
Gesellschaft statt. Unter anderem wurde auch der<br />
Georg-Simon-Ohm-Preis für die beste Fachhochschul-Diplomarbeit<br />
Deutschlands vergeben mit dem<br />
Thema: „Aufbau und Charakterisierung eines<br />
gepulsten, lasergestützten Gas-Targets zur<br />
Erzeugung weicher Röntgenstrahlung“. Preisträger<br />
2003 wurde Herr Dipl.-Ing. Christian Peth, Absolvent<br />
der Fakultät des Studienganges Feinwerktechnik.<br />
Im Rahmen der amerikanischen Technologiemesse<br />
Inpex (Invention & New Product Exposition) in<br />
Pittsburgh/Pennsylvania ist Professor Dr. Wolfgang<br />
Viöl mit der Silbermedaille in der Kategorie<br />
Industrieanlagen ausgezeichnet worden. Er hat<br />
einen Prototyp zur Plasmabehandlung von Holz<br />
entwickelt.<br />
Wissenschaftlich-technische Veranstaltungen<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey, Dipl.-Ing. Lutz Brekerbohm<br />
und Dipl.-Ing. Robert Burdick: Intelligente CMOS-<br />
Kamera, InnovationsForum Photonik, Kaiserpfalz/<br />
Goslar, 13.05.2003.<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: Photonik im Wald: Harvester<br />
lernen sehen, Eröffnungssymposium in Göttingen<br />
„Holz – ein innovativer Werkstoff: Wirtschaft und<br />
Wissenschaft im Dialog“, Niedersächsisches<br />
Kompetenznetz für nachhaltige Holznutzung,<br />
30. und 31.10.2003.
Dipl.-Ing. Lutz Brekerbohm, Dipl.-Ing. Robert Burdick<br />
und Prof. Dr. Klaus Bobey: Entwicklung eines<br />
intelligenten Bildsensorsystems mit dem CMOS-<br />
Bildsensor FUGA 1000 – Die ICam 6701, CCD-Forum<br />
in München am 15. und 16.05.2003.<br />
Dipl.-Ing. Carsten Büttner, Bernd Schlichting, Prof.<br />
Dr. Klaus Bobey: Digitale Echtzeit-Farbsignalverarbeitung<br />
in Kameras mit Einchip-Farbsensoren,<br />
48. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium<br />
Technische Universität Ilmenau, 22. – 25.09.2003.<br />
Prof. Dr.-Ing. Andreas Kegler nahm am 16. und<br />
17. Oktober 2003 an der Vollversammlung des<br />
Fachbereichstages Elektrotechnik und Informationstechnik<br />
in Berlin teil.<br />
Prof. Dr. Viöl: Eröffnungssymposium des Kompetenznetzes<br />
Nachhaltige Holznutzung: Holz – ein<br />
innovativer Werkstoff – Wirtschaft und Wissenschaft<br />
im Dialog vom 30.10. – 31.10.2003.<br />
Kolloquien<br />
9. Januar 2003: Vortrag von Gastprofessorin der<br />
Budapester Technischen Fachhochschule Frau Prof.<br />
Dr. Seebauer.<br />
10. April 2003: Herr Dipl.-Ing. G. Kovács<br />
M.Sc. Past Secretary General and Vice-President of<br />
the John von Neumann Computer Society<br />
President of the Foundation for the Hungarian<br />
Informatics History Museum, Chairman of the John
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
von Neumann’s Centenary Advisory Group zum<br />
Thema: „The Computer Reasoning and the Human<br />
Thinking“.<br />
11. Mai 2003: Herr Prof. Dr. rer. nat. habil. Thomas<br />
Nattermann, Institut für Theoretische Physik der<br />
Universität zu Köln zum Thema: „Das Weltbild der<br />
modernen Physik“.<br />
11. Juni 2003: Herr Dr. rer. nat. Volker Carstens<br />
Institut für Aeroelastik der DLR in Göttingen<br />
zum Thema: „Aeroelastik – ein interdisziplinäres<br />
Forschungsgebiet zwischen Strömung und Struktur“.<br />
4. Dezember 2003: Herr Prof. Dr. rer. nat. habil.<br />
Andreas Tünnermann, Institutsleiter des Fraunhofer<br />
IOF Jena und Direktor des Instituts für Angewandte<br />
Physik der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum<br />
Thema: „Faserlaser – Perspektiven und Anwendungen“.<br />
Messen und Ausstellungen<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: Exponat: Die intelligente<br />
CMOS-Kamera ICam 6701, embedded-world-2003 in<br />
Nürnberg, Messestand der Firma D.signT.,<br />
Februar 2003.<br />
Exponate: Tree Vision Box und Tree Vision System,<br />
Ligna in Hannover, Messestand der FH HHG,<br />
26. bis 30.05.2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Hannover Industriemesse<br />
vom 07. bis 12. April 2003.
Holzmesse Ligna Plus vom 26. bis 30. Mai 2003.<br />
Environment 2003, Kairo, vom 30.09. – 02.10.2003<br />
4th international conference & exhibition on<br />
Environmental technologies.<br />
Jetro Environment Japan in WASTEC, Tokyo, vom<br />
25.11. bis 28.11.2003.<br />
Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler<br />
Prof. Dr.-Ing. Axel Bangert: Besuch von 14 Schülerinnen<br />
und Schülern des Gymnasiums (Goetheschule),<br />
Einbeck, 29.01.2003.<br />
Besuch von 14 Schülerinnen und Schülern des<br />
Lerchenberggymnasiums, Altenburg, 27.02.2003.<br />
Besuch von sechs Schülerinnen und Schülern des<br />
Felix-Klein-Gymnasiums und der Georg-Christoph-<br />
Lichtenberg Gesamtschule Göttingen, 24.09.2003.<br />
Besuch von 15 Schülerinnen und Schülern der BBS<br />
Simmern, 20.11.2003.<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: Experimente im Labor<br />
Sensortechnik für das XLAB:<br />
18. bis 19.09.2003 mit einer Schülergruppe aus<br />
Karlsruhe, 24.06.2003 mit einer Schülergruppe aus<br />
Berlin, 27.11.2003 mit einer weiteren Schülergruppe.<br />
Prof. Dr. Thomas Reck, Dipl.-Ing. Birgit Zwickert:<br />
Info-Tage der Fakultät N vom 1. bis 3. März 2003<br />
(Laborversuch PC-Messtechnik).
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Eine Technische Lasershow,<br />
„Wissenschaft und Jugend“, 6. Göttinger Woche<br />
30. Juni bis 04. Juli 2003.<br />
X-Lab-Versuch Thermographie, Göttingen<br />
Im Jahr 2003 haben jeweils ein Schüler des Otto-<br />
Hahn-Gymnasiums, der Georg-Lichtenberg-<br />
Gesamtschule und des Max-Planck-Gymnasiums in<br />
Göttingen sowie ein Schüler des Grotefend-<br />
Gymnasiums in Hann. Münden ihr Betriebspraktikum<br />
in den Laboren von Prof. Dr. Wolfgang Viöl<br />
durchgeführt und an aktuellen und angewandten<br />
Forschungsthemen mitgewirkt.<br />
Im Rahmen eines <strong>Mentoring</strong>-Projekts wurden zwei<br />
Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums während<br />
ihrer 11. und 12. Klasse von zwei Studentinnen der<br />
Fakultät betreut und unterstützt.<br />
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaften,<br />
des Biologie- und des Physikunterrichtes<br />
am Otto-Hahn-Gymnasium in Göttingen wurden<br />
zwei Halbjahreskurse an der Fakultät Naturwissenschaften<br />
und Technik von Dipl.-Phys. Dipl.-Ing.<br />
Stephan Wieneke durchgeführt.<br />
Veröffentlichungen und Berichte<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: Forschung im Labor für<br />
Sensortechnik – Harvester lernen sehen, FFG-News,<br />
S. 13 (6/2003).
Prof. Dr. Friedbert Bombosch, Prof. Dr. Klaus Bobey,<br />
Dipl.-Ing. Lutz Brekerbohm, Dipl.-Ing. Robert<br />
Burdick, Dietmar Sohns und Ralf Dreeke: Harvester<br />
lernen sehen, Forst und Technik, S. 14 – 19<br />
(5/2003).<br />
A. Kegler: „New Possibilities of IEC 61499 for<br />
Component Based Distributed Automation“<br />
Kongressband IFAC Workshop on Control Applications<br />
of Optimisations in Visegrad, Ungarn.<br />
A. Kegler: „Fortführung der Untersuchungen zur<br />
Bedeutung des internationalen Norm-Entwurfs IEC<br />
61499 für verteilte Automatisierungsaufgaben unter<br />
besonderer Berücksichtigung von aktuellen<br />
Neuentwicklungen“, Forschungsbericht,<br />
September 2003.<br />
Prof. Dr. Petra Weidner: Tradeoff directions and<br />
dominance sets. In: T. Tanino, T. Tanaka,<br />
M. Inuiguchi (Hrsg.), Multi-Objective Programming<br />
and Goal-Programming, Advances in Soft Computing,<br />
Berlin – Heidelberg – New York: Springer-<br />
Verlag, S. 275 – 280, 2003.<br />
P. Weidner, J. Hakanen, K. Miettinen and M. M.<br />
Mäkelä: Experiences with a multicriteria optimization<br />
procedure using hyperbola efficiency. Reports of<br />
the Department of Mathematical Information<br />
Technology, Series B. Scientific Computing, No. B<br />
17/2003, University of Jyväskylä (Finnland), 2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
P. Rehn, W. Viöl: Dielectric barrier discharge<br />
treatments at atmospheric pressure for wood<br />
surface modification, Holz als Roh- und Werkstoff<br />
61, Springer Verlag (2003) 145 – 150.<br />
P. Rehn, A. Wolkenhauer, M. Bente, S. Förster, W.<br />
Viöl: Wood surface modification in dielectric barrier<br />
discharges at atmospheric pressure, Surface and<br />
Coating Technology 174 – 175 (2003) 515 – 518.<br />
M. Leck, G. Ohms, W. Viöl: Modifizierung von<br />
Holzflächen durch Plasmabehandlung, Chemische<br />
Innovationen an niedersächsischen Hochschulen,<br />
Niedersächsisches Institut für Wissenschaft und<br />
Kultur (2003) 22 – 23.<br />
W. Viöl: Plasmaanlage zur Behandlung von<br />
Eisendrähten, Neue Materialien und Verfahren,<br />
Arbeitskreis der Technologietransferstellen<br />
niedersächsischer Hochschulen 4 (2003) 7.<br />
W. Viöl: Plasmavorbehandlung für Fingernägel, Neue<br />
Materialien und Verfahren, Arbeitskreis der<br />
Technologietransferstellen niedersächsischer<br />
Hochschulen 4 (2003) 7.<br />
S. Wieneke, Ch. Uhrlandt, W. Viöl: Experimental and<br />
theoretical investigations of sealed-off CO2 lasers<br />
excited by dielectric barrier discharges, angenommen<br />
in Laser Physics Letters (2003).
M. Bente, W. Viöl: Wood surface modification in<br />
dielectric barrier discharges at atmospheric<br />
pressure for creating water repellent characteristics,<br />
angenommen in Holz als Roh- und Werkstoff,<br />
Springer Verlag (2003).<br />
Patente<br />
W. Viöl als Erfinder und Anmelder: Diffusionsgekühlter<br />
Gaslaser mit Mittelfrequenzanregung, Deutsche<br />
Patentanmeldung Aktenzeichen DE 198 02 319.7<br />
vom 23.01.1998, Patenterteilung in Aussicht gestellt<br />
2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Anmelder:<br />
Method for modifying wooden surfaces by electrical<br />
discharges at atmospheric pressure, Europäisches<br />
Patentamt EP 1 233 854 B1, Anmeldetag 09.11.2000,<br />
Veröffentlichungstag der Patenterteilung<br />
02.01.2004.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Anmelder:<br />
Verfahren und Vorrichtung zur Ausbildung eines<br />
Plasmastrahls, Deutsche Patentanmeldung<br />
Aktenzeichen DE 101 16 502.1 vom 03.04.2001,<br />
Patent erteilt 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Verfahren und Vorrichtung<br />
zur Analyse und Überwachung der Lichtintensitätsverteilung<br />
über den Querschnitt eines<br />
Laserstrahls, Deutsche Patentanmeldung Aktenzeichen<br />
101 58 859.3 vom 30.11.2001, Patent erteilt<br />
2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Verfahren und Vorrichtung<br />
zur Behandlung der Oberfläche eines<br />
Metalldrahts, insbesondere als Beschichtungsvorbehandlung,<br />
Deutsche Patentanmeldung Aktenzeichen<br />
102 19 197.2 vom 29.04.2002, Patent erteilt<br />
2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl und Ch. Viöl als Erfinder und<br />
Fachhochschule HHG als Anmelder: Verfahren und<br />
Vorrichtung zur Vorbereitung eines Finger- und<br />
Fußnagels für eine Beschichtung, insbesondere<br />
Lackierung, Deutsche Patentanmeldung Aktenzeichen<br />
102 38 931.4 vom 23.08.2002, Patent erteilt<br />
und veröffentlicht am 31.07.2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Verfahren und Vorrichtung<br />
zur Analyse und Überwachung der Lichtintensitätsverteilung<br />
über den Querschnitt eines<br />
Laserstrahls, PCT-Anmeldung 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Verfahren und Vorrichtung<br />
zur Behandlung der Isolierschicht eines<br />
Drahtes, insbesondere als Beschriftungsvorbehandlung,<br />
Deutsche Patentanmeldung Aktenzeichen<br />
103 00 471.8 vom 09.01.2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Verfahren und Vorrichtung<br />
zur Behandlung der Oberfläche eines
Metalldrahts, insbesondere als Beschichtungsvorbehandlung,<br />
PCT-Anmeldung 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Erfinder und Fachhochschule<br />
HHG als Anmelder: Behandlung von lebende<br />
Zellen enthaltende biologische Materialien mit<br />
einem durch eine Gasentladung erzeugten Plasma,<br />
Deutsche Patentanmeldung Aktenzeichen<br />
103 24 926.5 vom 03.06.2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl und Ch. Viöl als Erfinder und<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl als Anmelder: Verfahren und<br />
Vorrichtung zur Vorbereitung eines Finger- und<br />
Fußnagels für eine Beschichtung, insbesondere<br />
Lackierung, PCT-Anmeldung 2003.<br />
Vorträge<br />
A. Kegler: „New Possibilities of IEC 61499 for<br />
Component Based Distributed Automation“<br />
IFAC Workshop on Control Applications of Optimisations,<br />
30. Juni – 02. Juli in Visegrad , Ungarn.<br />
Prof. Dr. Petra Weidner: An interactive procedure in<br />
MCDM using hyperbola efficiency. Vortrag an der<br />
Universität Jyväskylä, Jyväskylä (Finnland),<br />
Juni 2003.<br />
A method for calculating tradeoffs in multicriteria<br />
optimization. Vortrag auf der Tagung „International<br />
Symposium on Mathematical Programming (ISMP)<br />
2003“, Kopenhagen (Dänemark), August 2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Holzoberflächenveredelung<br />
durch Atmosphärendruck-Plasma, eingeladener<br />
Vortrag zum Kolloquium der Holzingenieure an der<br />
FH Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Hildesheim,<br />
11. Februar 2003.<br />
Dipl.-Ing. Peter Rehn, Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Holz-<br />
Oberflächenveredelung durch Atmosphärendruck-<br />
Plasma, 11. Bundesdeutsche Fachtagung Plasmatechnologie,<br />
Ilmenau, 09. – 12. März 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Plasmabehandlung des<br />
Holzfensters, eingeladener Vortrag zu den<br />
Thementagen Holz, Bremen, 13. – 14. März 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Holz-Oberflächenveredelung<br />
durch Atmosphärendruck-Plasma, eingeladener<br />
Vortrag zur Industriemesse Hannover,<br />
11. April 2003.<br />
Dipl.-Ing. Friedrich Ach, H. Dathe, D. Kubein-<br />
Meesenburg, H. Nägerl, Prof. Dr. Wolfgang Viöl:<br />
Optischer Messplatz zur Verschleißbestimmung in<br />
Reihenuntersuchungen an explantierten Tibiaendoprothesen,<br />
InnovationsForum Photonik, Goslar,<br />
13. Mai 2003.<br />
Dipl.-Ing. Stephan Wieneke, Dipl.-Ing. Christian<br />
Uhrlandt, Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Kompakte<br />
diffusionsgekühlte CO2-Laser der nächsten<br />
Generation, InnovationsForum Photonik, Goslar,<br />
13. Mai 2003.
Dipl.-Ing. Friedrich Ach, Dipl.-Ing. Andy Kaemling,<br />
Dipl.-Ing. Maik von Ringleben, Prof. Dr. Wolfgang<br />
Viöl: Laser beam characterization by measurement<br />
of the thermal mirror expansion, InnovationsForum<br />
Photonik, Goslar, 13. Mai 2003.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Plasmatechnologie im<br />
Dienste der Holzoberflächenmodifikation,<br />
eingeladener Vortrag zum Eröffnungssymposium<br />
Holz – ein innovativer Werkstoff: Wirtschaft und<br />
Wissenschaft im Dialog, Göttingen,<br />
30. – 31. Oktober 2003.<br />
Prof. Dr. Thomas Reck: Untersuchung eines<br />
modellgestützten Messerfahrens mit Fehlerklassifikation<br />
(IAV GmbH).<br />
Externe Vorlesungen<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Physikalische Grundlagen<br />
der Lasermaterialbearbeitung, Vorlesung im<br />
Wintersemester 2002/2003 an der TU Clausthal.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Plasmatechnologie,<br />
Vorlesung im Sommersemester 2003 an der<br />
TU Clausthal.<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl: Physikalische Grundlagen<br />
der Lasermaterialbearbeitung, Vorlesung im<br />
Wintersemester 2003/2004 an der TU Clausthal.<br />
Prof. Dr. Petra Weidner: Lehrende an der „II Summer<br />
School on Optimization and Numerical Analysis“,<br />
San Pedro, Costa Rica, 17. – 22. März 2003.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Drittmittelprojekte<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey: 10/01-12/03 AGIP-Projekt<br />
„Entwicklung eines CMOS-Bildsensorsystems für<br />
Holzerntemaschinen (Harvester)“.<br />
09.03 – 12.04 AGIP-Projekt „Digital-Kamera mit<br />
Echtzeit-Farbmanagement für medizinische<br />
Anwendungen“<br />
09.03 – 12.05 EFRE-Projekt „Digitale-Kamera mit<br />
Echtzeit-Farbmanagement für medizinische<br />
Anwendungen“.<br />
Prof. Dr. Andreas Koch: Ultraschneller Rußdetektor,<br />
Gemeinschaftsprojekt mit der Volkswagen AG,<br />
gefördert durch AGIP, Projektlaufzeit<br />
01.01.2003 – 28.02.2005.<br />
Prof. Dr.Wolfgang Viöl:<br />
Laser- und Plasmaoberflächenbehandlung von Holz,<br />
gefördert von der VW-Stiftung, Fa. Obermeier,<br />
Fa. Anteholz und Fa. Trumpf Lasertechnik,<br />
Projektlaufzeit 01. Januar 2001 – 31. Dezember<br />
2005, Projektgesamtkosten: ca. 1.500.000,– Euro.<br />
CO2-Laserstrahlanalysator, gefördert von der EU und<br />
der Fa. MetroLux, Projektlaufzeit 01. September<br />
2001 – 31. August 2004, Projektgesamtkosten:<br />
ca. 410.000,– Euro.<br />
Plasmabehandlung von Span- und Holzfaserplatten,<br />
gefördert von der EU und der Fa. Mende, Projektlaufzeit<br />
01. September 2001 – 31. August 2004,<br />
Projektgesamtkosten: ca. 510.000,– Euro.
Laser- und Plasmabehandlung von Glas und<br />
Glasbeschichtungen, gefördert von der EU und der<br />
Fa. Interpane Glasbeschichtungsgesellschaft,<br />
Projektlaufzeit 1. September 2001 – 31. August<br />
2004, Projektgesamtkosten: ca. 420.000,– Euro.<br />
Erprobung eines neuen Verfahrens zur CO2-<br />
Laserstrahlanalyse, gefördert vom BMBF, der Fa.<br />
MetroLux und der Fa. Trumpf Lasertechnik,<br />
Projektlaufzeit 01. September 2001 – 28. Februar<br />
2003, Projektgesamtkosten: ca. 150.000,– Euro.<br />
EUV-Strahlungsquelle, gefördert von der EU, AGIP<br />
und der Fa. MetroLux, Projektlaufzeit 01. September<br />
2002 – 31. August 2005, Projektgesamtkosten:<br />
ca. 490.000,– Euro.<br />
DAAD-Förderung<br />
Prof. Dr. Rohwer (Stellenbosch, Südafrika)hat im<br />
Sommersemester 2003 als Gastdozent an der<br />
Fakultät N Vorlesungen gehalten. Die Gastdozentur<br />
wurde vom DAAD gefördert.<br />
Die Fakultät erhielt bis August 2003 eine DAAD-<br />
Gastprofessur für Frau Prof. Dr. Márta Seebauer von<br />
der Budapester Technischen Fachhochschule.<br />
Personal<br />
Frau Prof. Dr. Márta Seebauer von der Budapester<br />
Technischen Fachhochschule unterstützte die<br />
Fakultät bis August 2003 als DAAD-Gastprofessorin.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Herr Prof. Dr. Rohwer (Stellenbosch, Südafrika) war<br />
im Sommersemester 2003 als DAAD-Gastdozent<br />
tätig.<br />
Herr Dipl.-Ing. Oliver Hemesieepe nahm am<br />
01.12.2002 seine Tätigkeit mit einer halben Stelle<br />
im Rahmen der Anschlussfinanzierung des Masterstudienganges<br />
Optical Engineering/Photonics auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Carls Sandhagen nahm im April 2003<br />
seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im<br />
Rahmen eines Forschungsprojektes bei<br />
Prof. Dr. A. Koch auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Georg Avramidis nahm seine Tätigkeit<br />
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen eines<br />
Forschungsprojektes von Prof. Dr. habil. Wolfgang<br />
Viöl am 1. August 2003 auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Jan-Hendrik Hluschi nahm seine<br />
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof.<br />
Dr. habil. Wolfgang Viöl am 15. Oktober 2003 auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Andy Kaemling nahm seine Tätigkeit<br />
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 01. Januar<br />
2003 auf.<br />
Frau Dipl.-Ing. Cindy Kaemling nahm ihre Tätigkeit<br />
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Rahmen<br />
eines Forschungsprojektes von Prof. Dr. habil.<br />
Wolfgang Viöl am 01. September 2003 auf.
Herr Dipl.-Ing. Jens Kromer nahm seine Tätigkeit als<br />
wissenschaftliche Hilfskraft bei Prof. Dr. habil.<br />
Wolfgang Viöl am 01. März 2003 auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Friedrich Ach war vom 01. Oktober bis<br />
zum 31. Dezember 2003 als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter tätig.<br />
Herr Dipl.-Ing. Carsten Büttner nahm am 01.<br />
September 2003 seine Tätigkeit mit einer halben<br />
Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen<br />
eines Drittmittelprojektes auf.<br />
Herr Dipl.-Ing. Lutz Brekerbohm nahm am<br />
01.01.2002 bis 31. Dezember 2003 seine Tätigkeit<br />
mit einer halben Stelle als wissenschaftliche<br />
Mitarbeiter im Rahmen eines Drittmittelprojektes<br />
auf.<br />
Die Auszubildenden Tanja Grögor und Sascha Nolte<br />
begannen zum 01. September 2003 an der Fakultät.<br />
Der Umschüler Bernd Kratochwill ist seit dem<br />
01. Oktober 2003 für 28 Monate und der Praktikant<br />
Stefan Freter seit dem 15. Juli 2003 für ein Jahr in<br />
der Werkstatt beschäftigt.<br />
Personal am Institut für Mechatronik und<br />
angewandte Photonik der N-Transfer GmbH<br />
Frau Cindy Kaemling nahm am 01. Oktober 2003<br />
ihre Tätigkeit im Institut für Mechatronik und<br />
angewandte Photonik der N-Transfer GmbH auf.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Herr Axel Behrendt leistet in der Zeit vom<br />
22. September 2003 bis zum 31. Januar 2004 sein<br />
Praxissemester am Institut für Mechatronik und<br />
angewandte Photonik der N-Transfer GmbH an der<br />
Fakultät N.<br />
Frau Maren Heuer wird vom 01. September 2003 bis<br />
zum 31. Januar 2004 als Praktikantin für den<br />
Bereich Forschung am Institut für Mechatronik und<br />
angewandte Photonik der N-Transfer GmbH an der<br />
Fakultät N eingestellt.<br />
Frau Dipl.-Ing. Maren Kopp nahm am 01. Februar<br />
2003 ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
am Institut für Mechatronik und angewandte<br />
Photonik der N-Transfer GmbH an der Fakultät N auf.<br />
Herr Christian Mohr wird vom 08. Dezember 2003<br />
bis zum 10. September 2004 als Praktikant am<br />
Institut für Mechatronik und angewandte Photonik<br />
der N-Transfer GmbH an der Fakultät N eingestellt.<br />
Herr Dipl.-Ing. Edgar Roddewig nahm am<br />
01. September 2003 seine Tätigkeit als wissenschaftlicher<br />
Mitarbeiter am Institut für Mechatronik<br />
und angewandte Photonik der N-Transfer GmbH an<br />
der Fakultät N auf.<br />
Herr Benny Schumacher ist vom 25. August 2003 bis<br />
zum 29. Februar 2004 als Praktikant im Bereich<br />
Forschung am Institut für Mechatronik und<br />
angewandte Photonik der N-Transfer GmbH an der<br />
Fakultät N tätig.
Herr Dipl.-Ing. Dirk Wandke nahm seine Tätigkeit als<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für<br />
Mechatronik und angewandte Photonik der<br />
N-Transfer GmbH an der Fakultät N am<br />
01. April 2003 auf.<br />
David Nolte ist als Praktikant im Bereich Informationstechnologie<br />
seit dem 01. Dezember 2003 bis<br />
19. September 2004 beschäftigt.<br />
Mitwirkung in Gremien<br />
Haushaltskommission: Prof. Dr. Thomas Reck<br />
Forschungskommission: Prof. Dr. Wolfgang Viöl<br />
Dipl.-Ing. Stefan<br />
Wienecke<br />
Zentrale Studienkommission:<br />
Prof. Dr. Petra Weidner<br />
Dipl.-Ing. Harald<br />
Bachmann<br />
Dipl.-Ing. Birgit<br />
Zwickert<br />
Bibliothekskommission: Prof. Dr. Wolfgang<br />
Müller<br />
Evaluierungskommission: Prof. Dr. Andrea Koch<br />
Stellvertretende<br />
Ombudsperson: Prof. Dr. Andrea Koch
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Mitwirkung in anderen Gremien<br />
Die Fakultät Naturwissenschaften und Technik ist<br />
mit ihren Studiengängen Elektrotechnik und<br />
Informatik seit Oktober 2003 Mitglied im Fachbereichstag<br />
Elektrotechnik und Informationstechnik.<br />
Prof. Dr. Ulrike Bartuch: Mitarbeit im Kuratorium des<br />
Laber-Laboratoriums Göttingen e. V.
Studiengang<br />
Bau-Chemie Holzminden<br />
Standortdekan und Studiendekan<br />
am Standort Holzminden<br />
Prof. Dipl.-Ing. Rolf Möhring<br />
Studienangebot<br />
Seit Sommersemester 2003 ist mit der Zusammenlegung<br />
des Studiengangs Bau-Chemie und dem<br />
Fachbereich PMF die Fakultät NT entstanden.<br />
Der Studiengang Bau-Chemie hat seinen Lehrbetrieb<br />
1998 aufgenommen und bietet den<br />
achtsemestrigen Studiengang Bau-Chemie an:<br />
Besondere Berücksichtigung findet hier die Vermittlung<br />
der Kenntnisse von Stoffen unter Berücksichtigung<br />
ihrer Vielfalt, der Einsatzbreite und ihren<br />
wesentlichen Eigenschaften.<br />
Anliegen ist die Auseinandersetzung mit der stofflichen<br />
Seite des Bauens in der Gesamtheit: vom<br />
Rohstoff, über Baustoff, Bauphase, Nutzungsphase,<br />
Renovierung und Umbau, Abriss bzw. Entnahme bis<br />
zur Wiedereingliederung in Teilkreisläufe.<br />
Die Absolventen werden wunschgemäß vornehmlich<br />
als selbstständige Chemie-Ingenieure der gesamten<br />
Baubranche beratend zur Verfügung stehen, finden<br />
aber ebenfalls in formulierenden- und qualitätssichernden<br />
Aufgabenbereichen der Baustoffindustrie<br />
ihre Betätigungsfelder sowie in vielerlei gewünschter<br />
Unterstützung des öffentlichen Dienstes<br />
bzw. der Verbraucherverbände bis hin zu Forschungsaufgaben.<br />
Hochschulintern wird neben der Ausbildung der<br />
spezifischen Studierenden in erheblichem Umfange<br />
Wissenstransfer in die Fakultät Bauwesen geleistet.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
Im Gegenzug nehmen Studierende der Bau-Chemie<br />
an Vorlesungen im Bereich Architektur und<br />
Bauingenieurwesen teil.<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Prof. Dr. Rolf Möhring/Prof. Dr. Thomas Thielmann:<br />
Weiterhin wurde, wie schon in der Vergangenheit,<br />
die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der<br />
Fakultät Restaurierung weiter ausgebaut.<br />
Im Rahmen des Socrates-Programms wurde ein<br />
Kooperationsabkommen mit der Universität Thorn<br />
geschlossen.<br />
Die Verbindung zur Vereinigten Universität Hefei,<br />
Provinz Anhui, entwickelt sich kontinuierlich mit der<br />
2. Gruppe chinesischer Studentinnen und<br />
Studenten.<br />
Veröffentlichungen und Berichte<br />
Prof. Dipl.-Ing. R. Möhring/Prof. Dr. rer. nat. T.<br />
Thielmann: Mitarbeit am „Scholz Baustoffkunde“,<br />
15. Auflage.<br />
Drittmittelprojekte/Forschung<br />
Prof. Dr. Rolf Thielmann/Prof. Jan Schubert, Fakultät<br />
Restaurierung Hildesheim:<br />
Von der AGIP wurde ein Forschungsauftrag<br />
„Entwicklung neuartiger kieselsolmodifizierter<br />
Hybridpolymere in der Steinkonservierung“<br />
genehmigt, wodurch in erheblichen Umfang Forschungsmittel<br />
eingeworben werden konnten. Dieser<br />
wird am Standort Holzminden durch Prof. Dr. R.<br />
Thielmann betreut.
Personal<br />
Prof. Dipl.-Ing. Rolf Möhring<br />
Interdisziplinäre Lehre, Technischer Ausbau und<br />
Entwerfen, Baukonstruktion<br />
Prof. Dr. rer. nat. Gisela Ohms<br />
Allgemeine, Anorganische und Analytische Chemie<br />
Prof. Dipl.-Phys. Michael Leck<br />
Instrumentelle Analytik, Baustoffkunde<br />
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Thielmann<br />
Organische und Ökologische Chemie<br />
Dipl.-Ing. Petra Lorasch<br />
Labor für Anorganische Chemie<br />
Dipl.-Ing. Annette Meiners<br />
Labor für Instrumentelle Analytik<br />
Dipl.-Ing. Martina Voß<br />
Labor für Organische Chemie<br />
Technikum/Interdisziplinäre Lehre<br />
Verwaltungsangestellte Ulrike Liersch<br />
Sekretariat/Prüfungsamt
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement
Fakultät<br />
Ressourcenmanagement<br />
Dekan<br />
Prof. Dr. Martin Thren<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr. Jürgen Horsch<br />
Studiendekan<br />
Dr. Friedemann Krummheuer<br />
Vorwort<br />
Das Jahr 2003 begann mit einer Neuwahl des<br />
Fakultätsrates, des Dekanats und der Gremien für<br />
die Selbstverwaltung. Durch die Novellierung des<br />
Niedersächsischen Hochschulgesetzes und auf<br />
Wunsch des Kollegiums wurde aus dem Fachbereich<br />
Forstwirtschaft und Umweltmanagement die<br />
Fakultät Ressourcenmanagement, ein Name, der<br />
den heutigen Aktivitäten der Institution in Lehre,<br />
Forschung und Entwicklung ihre angemessene<br />
Identität verleiht.<br />
Erstmalig wurde ein Dekanat gewählt, bestehend<br />
aus einem Geschäftsführenden Dekan (Prof. Dr.<br />
Martin Thren) und zwei Studiendekanen (Prof. Dr.<br />
Jürgen Horsch und Dr. Friedemann Krummheuer).<br />
Diese Umstrukturierung führt zu veränderten<br />
Zuständigkeiten in der Organisation und in der<br />
Zuständigkeit der Gremien: Die Geschäftsführung<br />
wird vom Dekan wahrgenommen, die Studiendekane<br />
sind für alle Studien- und Prüfungsangelegenheiten<br />
zuständig, sie leiten zugleich die<br />
Studienkommissionen und Prüfungsausschüsse.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Der bereits 2001 begonnene Reformprozess wurde<br />
zielstrebig weitergeführt, aus formalen Gründen<br />
musste allerdings die Reform des Studiengangs<br />
Forstwirtschaft „auf Eis gelegt“ werden. Die sich aus<br />
dem Reformprozess ergebenden neuen Professuren<br />
konnten denominiert und ausgeschrieben und die<br />
Berufungskommissionen eingesetzt werden. Es<br />
gelang, die Professur „Regionalmanagement und<br />
Landeswissenschaften“ mit gleichzeitiger Koordination<br />
für den Master-Studiengang „Regionalmanagement<br />
und Wirtschaftsförderung“ zum Wintersemester<br />
zu besetzen, womit Aufbau und wesentliche<br />
Kernkompetenzen im neuen sichergestellt waren.<br />
Zum Wintersemester 2003/2004 konnten erstmalig<br />
Studierende für den grundständigen Bachelor-<br />
Studiengang „Arboristik“ und den Master-<br />
Studiengang zugelassen werden. Zusammen mit<br />
den bereits „klassischen“ Studiengängen „Forstwirtschaft“<br />
(Diplom) und „Wirtschaftsingenieurwesen“<br />
(Diplom) bestand eine so große Nachfrage nach<br />
Studienplätzen, dass das Studienangebot der<br />
Fakultät zu 100 Prozent ausgelastet werden konnte.<br />
Der Beginn des Wintersemesters war außerdem<br />
geprägt durch die drastischen Auswirkungen des<br />
„Hochschuloptimierungskonzepts“, welche<br />
sämtliche Fakultäten unserer Hochschule betrafen.<br />
Zeitweise schienen alle Bemühungen um weitere<br />
Reformen hinfällig. In zähem und kooperativem<br />
Ringen, gemeinsam mit dem Präsidium, gelang es,<br />
die Präferenzen bei Neuberufungen von Professuren
so zu setzen, dass zumindest die neu eingerichteten<br />
Studiengänge durch Abdeckung der<br />
Kernkompetenzen hauptamtlicher Lehrkräfte sicher<br />
gestellt waren.<br />
Ende des Jahres 2003 war somit eine Plattform<br />
geschaffen worden, die es ermöglichte, mit<br />
Optimismus und erstarktem Reformwillen wieder in<br />
die Zukunft zu blicken.<br />
Dies alles wäre nicht ohne den überdurchschnittlichen<br />
Einsatz und dem Durchhaltevermögen von<br />
allen Beteiligten in unserem Hause Ressourcenmanagement<br />
möglich gewesen. Ihnen gilt ein<br />
herzlicher Dank. Ein erster Prüfstein für eine neue<br />
Identität, ein Beginn; auf dem bisher Geleisteten<br />
können wir uns jedoch nicht ausruhen. Wir müssen<br />
auch in der Zukunft attraktive und dem Arbeitsmarkt<br />
gerecht werdende Studiengänge anbieten.<br />
Der Reformprozess wird uns in den nächsten Jahren<br />
noch in Atem halten.<br />
Studienangebot<br />
Die Fakultät Ressourcenmanagement bietet<br />
folgende Studiengänge an:<br />
Diplom-Studiengang Forstwirtschaft<br />
(Acht Semester inkl. zwei Praxissemester)<br />
Im Hauptstudium bestehen im Rahmen von Wahlpflichtfächern<br />
Spezialisierungsmöglichkeiten in den<br />
Bereichen:
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
– Öffentlichkeitsarbeit<br />
– Methoden der Landschaftsinventur<br />
– Privatwirtschaftliches Management<br />
– Landnutzungssysteme und Ressourcenschutz<br />
Diplom-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen<br />
(Acht Semester inklusiv ein Praxissemester)<br />
Im Hauptstudium differenziert sich das Studienangebot<br />
in vier Schwerpunkte:<br />
– Elektrotechnik<br />
– Fertigungstechnik<br />
– Umwelt-/Qualitätsmanagement<br />
– Umwelttechnik<br />
Bachelor-Studiengang Arboristik<br />
(Sechs Semester)<br />
Das Studium qualifiziert zu beruflichen Tätigkeiten<br />
in Grünflächen- und Naturschutzämtern, Straßenbauämtern<br />
und Betriebshöfen, Baumpflegeunternehmen,<br />
Garten- und Landschaftsbetrieben,<br />
Planungs- und Sachverständigenbüros.<br />
Master-Studiengang Regionalmanagement und<br />
Wirtschaftsförderung<br />
(Vier Semester)<br />
Thematische Module des Masterstudienganges<br />
sind:<br />
– Europäische Struktur- und Förderpolitik<br />
– Schwerpunkt Osteuropa<br />
– EU-Recht<br />
– Wirtschaftsförderung<br />
– Interkulturelle Zusammenarbeit
– Marketing<br />
– Tourismus<br />
– Planung und Entwicklung<br />
– Fremdsprachen<br />
– Informationsmanagement<br />
Hervorzuheben ist die internationale Ausrichtung<br />
der Studieninhalte: Englisch ist gleichberechtigte<br />
Lehrsprache, Exkursionen ins Ausland, international<br />
ausgerichtete Studieninhalte usw.<br />
An der Fakultä Ressourcenmanagement waren zum<br />
31. März 2004 685 Studierende eingeschrieben:<br />
432 im Studiengang Forstwirtschaft, 214 im<br />
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 23 im<br />
Bachelor-Studiengang Arboristik und<br />
16 im Master-Studiengang Regionalmanagement<br />
und Wirtschaftsförderung.<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Die Fakultät hat auch im Jahr 2003 versucht, seine<br />
Öffentlichkeitsarbeit weiterzuführen und unter<br />
Schülern und anderen Interessenten sein Studienangebot<br />
bekannt zu machen.<br />
Präsentation des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen<br />
am 30.01. vor Schülerinnen und<br />
Schülern der Georg-von-Langen-Schule, Holzminden.<br />
Präsentation aller Studiengänge an drei Göttinger<br />
Gymnasien.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Forschungs- und Beratungsnetze<br />
Fachinformationsstelle Bioenergie Niedersachsen<br />
(BEN)<br />
Zum 01. Oktober 2003 hat die Fakultät Ressourcenmanagement<br />
die Trägerschaft für die Fachinformationsstelle<br />
Bioenergie Niedersachsen (BEN)<br />
übernommen. Seit diesem Zeitpunkt verstärken die<br />
beiden Mitarbeiter Dipl.-Ing. Michael Kralemann<br />
und Dipl.-Ing. (FH) Udo Jakobs das Team des<br />
Fachgebietes Technischer Umweltschutz. Herr<br />
Kralemann studierte an der TU Braunschweig<br />
Maschinenbau mit der Fachrichtung Energie- und<br />
Wärmetechnik. Seit 1992 war er bei der Niedersächsischen<br />
Energie-Agentur GmbH in Hannover tätig.<br />
Sein Aufgabengebiet umfasste die Themenbereiche<br />
Bioenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, Nahwärmeversorgung,<br />
Solarenergie und Windkraft. Hierbei<br />
handelt es sich in der Hauptsache um die Erstellung<br />
von Konzeptstudien als Entscheidungsgrundlagen<br />
vorwiegend im kommunalen Bereich, um die<br />
Konzeption, Organisation und Durchführung von<br />
Seminaren und um die Leitung der Informationsund<br />
Beratungsstelle Bioenergie Niedersachsen<br />
(BEN). Udo Jakobs hat an der Fachhochschule<br />
Bielefeld am Fachbereich Elektrotechnik den<br />
Studiengang Regenerative Energieerzeugung<br />
studiert. Im November 2001 hat er das Studium mit<br />
der Diplomarbeit zum Thema Holzenergienutzung<br />
bei der Niedersächsischen Energie-Agentur (Nds.<br />
EA) in Hannover abgeschlossen. Im Anschluss<br />
arbeitete Herr Jakobs bei der Nds. EA für das Projekt<br />
BEN. Innerhalb der Infostelle liegen die Arbeits-
schwerpunkte von Herrn Jakobs im Bereich der<br />
Erstberatung zur Bioenergienutzung, der Erstellung<br />
von Informationsmaterialien, der Organisation und<br />
Durchführung von Veranstaltungen sowie der<br />
Betreuung des internetbasierten Bioenergie-<br />
Netzwerkes (www.ben-online.de).<br />
Kompetenznetz Holz<br />
Die Fakultäten Ressourcenmanagement und<br />
Naturwissenschaft und Technik hat mit der Fakultät<br />
für Forstwissenschaften und Waldökologie, dem<br />
Fraunhoferinstitut für Holzforschung in Braunschweig<br />
und der Niedersächsischen Forstlichen<br />
Versuchsanstalt den Aufbau der Infrastruktur des<br />
Kompetenznetzes vorangetrieben. Die Abteilung<br />
Information und Marketing ist mit den Herren Sven<br />
Thomas, Daniel Melle sowie mit Prof. Dr. Friedbert<br />
Bombosch personell und technisch für die<br />
anstehenden Aufgaben gut gerüstet. Im Berichtszeitraum<br />
wurden die Internetplattform und ein<br />
Intranet freigeschaltet, die mannigfaltige Möglichkeiten<br />
nach außen und innen eröffnen. Hierzu<br />
wurde ein Serverraum eingerichtet sowie die<br />
notwendigen Leitungsstrukturen gesichert. Neben<br />
der Organisation und Durchführung eines Get-<br />
Together-Meetings, Messeauftritts „LIGNA“ und<br />
Eröffnungssymposiums standen der Aufbau<br />
verschiedener Datenbanken für Bilder, Personal und<br />
Geräte auf dem Programm der Abteilung. Die<br />
Gestaltung und Umsetzung des Internetauftritts<br />
„Pappelgruppe.de“, Flyer, Poster, Logos gehörten<br />
ebenso zu den Aufgaben, wie die Freischaltung des
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
mittlerweile viel beachteten Internetforums in enger<br />
Kooperation mit dem HOLZZENTRALBLATT. Die<br />
Abteilung Information und Marketing steht weiter<br />
für Dienstleistungen den o. g. Partnern unterstützend<br />
zur Verfügung (www.Kompetenznetz-Holz.de).<br />
Internationale Kooperationen<br />
Cyprus Forestry College, Prodromos, Occupational<br />
Health, Fire Ecosystems, Reforestation<br />
Cyprus Forest Department, Larnaca, Chippers,<br />
Plantations, Flying Nurseries<br />
CPEN/INPA (Amazonaforschungsinstitut), 69011<br />
Manaus AM, Brasilien<br />
Rainforest CRC, James Cook University, Cairns<br />
Campus, Cairns, Qld 4870 Australien<br />
Untersuchungen zu den „Ursachen der Einnischung<br />
baumsamenfressender Laufkäfer in tropischen<br />
Regenwäldern“.<br />
Prof. Dr. Stergios Vergos, TEI Larissa, FB Forstwirtschaft<br />
in Karditsa<br />
Wissenschaftlicher Beirat zur Fachzeitschrift e.l.b.w.<br />
Umwelttechnik, Wien<br />
Abfall-Entsorgungs- und Verwertungs-GmbH (AEVG),<br />
Graz, Österreich<br />
Abfallverband Osttirol, Lienz, Österreich<br />
Abfall-Verwertung-Entsorgung GmbH, Hörsching,<br />
Österreich<br />
Baufeld Austria GmbH, Wien, Österreich<br />
Bleiberger Berwerksunion, Arnoldstein, Österreich<br />
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft<br />
Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich<br />
Büro Heresch & Heresch Umwelt- und Behördenen-
gineering GmbH, Graz, Österreich<br />
Bundeswirtschaftskammer, Wien, Österreich<br />
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand<br />
EuropeAid Co-operation Office, European<br />
Commission, Brussels, Belgium<br />
Funder GmbH, St. Veith, Österreich<br />
Gmundener Zementwerke GmbH, Gmunden,<br />
Österreich<br />
Magistrat Wiener Neustadt, Österreich<br />
Mannesmann Anlagenbau AG, Wien, Österreich<br />
Metall Mining Cooperation, Toronto, Kanada<br />
Montanuniversität Leoben, Österreich<br />
RAB GmbH, Salzburg, Österreich<br />
Salzburger AbfallbeseitigungsGmbH, Salzburg,<br />
Österreich<br />
Saubermacher GmbH, Graz, Österreich<br />
Steiermärkische Landesregierung, Graz, Österreich<br />
Tiroler Landesregierung, Innsbruck, Österreich<br />
Thöni Industriebetriebe GmbH, Telfs, Österreich<br />
Umweltakademie Judenburg, Österreich<br />
Universität Veszprém, Ungarn<br />
Verband der österreichischen Entsorgungsbetriebe<br />
(VOEB), Wien, Österreich<br />
Vereinigte Universität Hefei, Provinz Anhui, China<br />
Zentrale Müllklärschlammbehandlungsanlage GmbH<br />
(ZEMKA), Zell am See, Österreich<br />
Forsttechnische Akademie Sankt-Petersburg,<br />
Institutski per 5, 194021 Sankt-Petersburg, Russland<br />
TEI Kavala, FB Forstwirtschaft in Drama (Prof. Dr.<br />
Nikos Afzis)<br />
TEI Larissa, FB Forstwirtschaft in Karditsa<br />
Forsttechnikum Warcinie, Polen (Herr Direktor<br />
Manka)
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Cyprus Forestry College, Prodromos, Limassol,<br />
Zypern<br />
Fachhochschule Larenstein, Niederlande<br />
Fachhochschule Tampere, Finnland<br />
Wageningen University, Niederlande<br />
Mehrtägige auswärtige Lehrveranstaltungen<br />
11. – 21.07.2003 Alpenexkursion ins Allgäu:<br />
Die zehntägige Exkursion ins Allgäu befasste sich<br />
schwerpunktmäßig mit botanischen, pflanzensoziologisch-standortkundlichen,<br />
waldbaulichen,<br />
wildökologischen, sowie Themen des Naturschutzes<br />
und des Tourismus.<br />
Die örtlichen Voraussetzungen sind in dem<br />
Exkursionsgebiet optimal zu nennen, da die<br />
geologisch-standörtliche Vielfalt, die der Höhenlagen<br />
und der Expositionen einen großen botanischen<br />
Artenreichtum zur Folge haben, der Waldbau der<br />
Berg- und Bergmischwälder, die Problematik Wald<br />
und Wild mit wildökologisch-raumplanerischen<br />
Komponenten angesprochen werden kann, Schutzwälder,<br />
Hochlagenaufforstungen und Lawinenverbauung,<br />
wie auch die Fragen des Nebeneinanders<br />
und der Verträglichkeit von Naturschutz und<br />
Tourismus auf engem Raum behandelt werden<br />
können.<br />
Die Exkursion wird seit 1985 mit etwas variierenden<br />
Inhalten für Studierende ab dem dritten Semester<br />
angeboten.
Semesterexkursion SS 03: Im Studiengang<br />
Forstwirtschaft fand in der Zeit vom 19. bis 23 Mai<br />
eine mehrtägige auswärtige Lehrveranstaltung unter<br />
der Leitung von Prof. Dr. Frank und Herrn Dr. Ulrich<br />
Harteisen statt. Insgesamt 23 Studenten machten<br />
sich auf die Reise nach Bückeburg, Syke, Minden<br />
und Paderborn. In der fürstlichen Forstverwaltung in<br />
Bückeburg beeindruckten urige Eichenwälder und<br />
man lernte die kundenorientierte Bereitstellung von<br />
Rohholz kennen. Im Niedersächsischen Forstamt<br />
Syke ging es u. a. um die Themen Walderneuerung<br />
nach dem Sturm 1972. Im Forstamt Minden standen<br />
Fragen der Kiefernbewirtschaftung im Altersklassenwald<br />
und die Strategie der Kleinprivatwaldbetreuung<br />
in NRW auf dem Programm. Als Abnehmer des<br />
Rohholzes der Forstwirtschaft wurde bei der Firma<br />
Hornitex der Produktionsablauf, die Produktpalette<br />
ihrer Spanplattenproduktion besichtigt. Zum<br />
Abschluss wurden Fragen des Naturschutzes am<br />
Beispiel des Naturschutzgebietes Externsteine und<br />
des ehemaligen Truppenübungsplatzes Senne<br />
besprochen. Alle beteiligten Dienststellen zeigten<br />
sich sehr motiviert, zum guten Gelingen der<br />
insgesamt runden Veranstaltung beizutragen. Der<br />
Blick über den Tellerrand von Göttingen konnte dazu<br />
beitragen, die fachliche Urteilsfähigkeit der<br />
Studenten über andere Standorte zu erhöhen.<br />
Exkursionen im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen:<br />
Um den Studenten einen verstärkten Zugang zur<br />
Praxis zu ermöglichen, wurden mehrere Fachexkursionen<br />
durchgeführt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Großen Anklang fand die im Sommersemester<br />
durchgeführte Exkursion zu mehreren Zielen im<br />
Bereich des Umweltschutzes (Abfallwirtschaftsbetrieb<br />
Hannover/Zentraldeponie, Windkraftwerk der<br />
Firma Enercon in Hannover Laatzen, MVA Kassel<br />
usw.). Teilnehmer waren die Studierenden des 4.<br />
Semesters. Im Rahmen der Vorlesung „Bodenschutz<br />
und Altlastensanierung“ besuchten Studenten des<br />
4. Semesters das im Rückbau befindliche AKW<br />
Würgassen. Dabei konnten wertvolle Eindrücke im<br />
Bereich der Stilllegung und der Demontage eines<br />
AKW gesammelt werden.<br />
Ausgewählte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben<br />
An der Fakultät wurde im Berichtsjahr eine Vielzahl<br />
von Projekten bearbeitet, die im Folgenden<br />
dargestellt sind. Die inhaltliche Gestaltung lag beim<br />
jeweiligen Projektleiter.<br />
Prof. Dr. Bombosch<br />
Logistik<br />
In enger Zusammenarbeit mit der Waldarbeitsschule<br />
Münchehof, Herrn FAm Holger Kuprat wurde die<br />
Diplomarbeit von Herrn Christian Müller beendet.<br />
Die Ergebnisse der Bereitstellung und Aufarbeitung<br />
mit dem größten Mobilhacker Mitteleuropas Terex<br />
804 CT ergab, dass eine viel versprechende<br />
Aufarbeitungsmöglichkeit für Laubstarkholzkronen<br />
sowie auch in Schwachholzbeständen besteht. Es<br />
darf dabei nicht unerwähnt bleiben, dass der<br />
organisatorische Aufwand einer perfekt funktionierenden<br />
Transportkette immens ist. Die Umrechnung
von „Terex geblasenem“ Hackgut liegt bei<br />
2,7 Schüttkubikmeter/fm. Ferner wurden wertvolle<br />
Hinweise in Sachen Kronenvolumina und Trennschnitte<br />
für die Aufarbeitung von Starkholzkronen<br />
gegeben. Auch wurde das Kalkulationsprogramm<br />
Energie-/Industrieholz überarbeitet (Publikation in<br />
Forst und Technik 5/2003).<br />
Sensortechnik<br />
Die Zusammenarbeit mit der Fakultät Naturwissenschaft<br />
und Technik, Prof. Dr. Klaus Bobey, Dipl.-Ing.<br />
Robert Burdik und Dipl.-Ing. Lutz Brekerbohm<br />
erbrachte mit den 2002 erwähnten Diplomarbeiten<br />
von Glahn und Eilers sowie einigen weiteren<br />
intensiven Studien den Durchbruch. Wurde Anfang<br />
des Jahres noch gesagt: Harvester lernen sehen,<br />
konnte zum Jahresende gesagt werden: Harvester<br />
können sehen! (Forst und Technik 5/2003,<br />
Eröffnungssymposium 30./31.10.2003).<br />
Hauptanliegen dieser Projektstudie mit Fa. Wahlers<br />
Forsttechnik als Industriepartner ist zum einen die<br />
Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie, sowie der<br />
Leistung unter widrigen Beleuchtungsverhältnissen.<br />
Noch als Vision werden der Ausbau der Sensorik zur<br />
Erfassung der exakten Lage und der BHD der<br />
stehenden und entnommenen Bäume gesehen.<br />
Steilhangmaschine<br />
Auf der Basis der 2002 entwickelten Simulationsstudie<br />
konnte in der Fa. Kässbohrer Geländefahrzeug<br />
AG ein Partner gefunden werden, der in der<br />
Lage ist, mit Hilfe einer auf einem Pistenfahrzeug
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
montierten Winde, die Traktionshilfe für einen voll<br />
beladenen Forwarder zu geben, die laut Simulation<br />
notwendig ist, um Bringungsaufgaben im Steilhang<br />
bestandes- und bodenschonend durchzuführen.<br />
Der Pilotversuch gestaltete sich ausgesprochen<br />
erfolgreich. Alle Beteiligten, Stützpunktforstamt<br />
Lauterberg mit Herrn Dietmar Sohns, Kollege Prof.<br />
Dr. Reiner Nollau sowie drei Diplomanden wurden in<br />
ihren Erwartungen weit übertroffen. Es gelang einen<br />
25 tschweren Forwarder aus einer Hangpartie mit<br />
85 Prozent Hangneigung schlupffrei herauszufahren!<br />
(Forst und Technik, 9/2003). Die auf der<br />
AUSTRO2003 vorgestellten Ergebnisse trafen auf<br />
sehr große Resonanz. Das Projekt wird fortgesetzt.<br />
Prof. Denninger<br />
Stand der hochmechanisierten Holzernte in<br />
Niedersachsen<br />
Prof. Dr. Harteisen<br />
Forschungsprojekt: Analyse der regionalökonomischen,<br />
insbesondere touristischen Entwicklungsperspektiven<br />
einer Nationalparkregion Senne<br />
(Förderung über die Bezirksregierung Detmold durch<br />
das Ministerium für Umwelt und Naturschutz,<br />
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen) in Zusammenarbeit mit Prof.<br />
Dr. Peter Liepmann, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,<br />
Universität Paderborn.<br />
Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Holger Belz, Dipl.-Volkswirt<br />
Andreas Wiendl, cand. (Geogr.) Henning Schwarze.<br />
Ziel der Forschung war es, die regionalwirtschaftli-
chen Effekte eines Nationalparks Senne auf die<br />
unmittelbar umgebende Region – das Nationalparkvorfeld<br />
– aufzuzeigen. Eine mit den Schutzzielen<br />
grundsätzlich vereinbare Form der wirtschaftlichen<br />
Nutzung eines Nationalparks ist der Tourismus.<br />
Tourismus als Wirtschaftszweig ist u. a. von der<br />
Existenz intakter Natur- und Kulturlandschaften<br />
abhängig. Es soll betont werden, dass es sich bei<br />
den in dieser Studie dargestellten Szenarien um<br />
Abschätzungen von Entwicklungen in der Zukunft<br />
handelt, denn der Nationalpark Senne ist ja noch<br />
nicht vorhanden.<br />
Ausgehend vom Status quo und in Anlehnung an<br />
die Referenzregionen (Nationalparkregionen in<br />
Deutschland) werden die möglichen Entwicklungspotentiale<br />
bezogen auf folgende Betrachtungsfelder<br />
ermittelt:<br />
– Touristische Wertschöpfung<br />
– Arbeitsplätze<br />
– Infrastruktur<br />
– Umweltbildung & Forschung<br />
– Fördermöglichkeiten<br />
Die Forschung stellt einen Baustein in der<br />
Diskussion über die Entwicklungsperspektiven der<br />
Region dar und soll dazu beitragen, die notwendigen<br />
Entscheidungen für eine nachhaltige,<br />
zukunftsweisende Entwicklung der Senneregion in<br />
einem öffentlichen Diskussionsprozess vorzubereiten.<br />
Der Schutz der Natur, verbunden mit einer<br />
gelenkten touristischen Nutzung, kann eine auch<br />
ökonomisch Erfolg versprechende Perspektive für<br />
die Senneregion sein.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Die Studie ist im Dialog mit den regionalen<br />
Akteuren und den Vertretern der Referenzregionen<br />
im Rahmen eines intensiven Diskussionsprozesses<br />
entstanden. Dieses methodische Vorgehen kann<br />
selbst als ein Ergebnis des Forschungsvorhabens<br />
betrachtet werden.<br />
Ergebnisse<br />
1. Nationalparkregion Senne<br />
Die Untersuchung basiert auf der Beschreibung und<br />
Abgrenzung einer Nationalparkregion mit Nationalparkvorfeld<br />
und Nationalparkumfeld. Im Nationalparkvorfeld<br />
mit einer unmittelbaren räumlichen<br />
Beziehung zu einem Nationalpark Senne (Nationalpark-,<br />
bzw. Anrainergemeinden) leben heute<br />
ca. 340.000 Einwohner. Das Nationalparkumfeld<br />
beschreibt einen Raum, der einerseits von der<br />
Errichtung eines Nationalparks positive Effekte<br />
erfährt und andererseits auch bestimmte Funktionen<br />
wahrzunehmen hat. Im Nationalparkumfeld<br />
eines Nationalparks Senne leben heute ca. 2 Mio.<br />
Einwohner. Bei der Analyse eines durch einen<br />
Nationalpark Senne induzierten Tourismus kommt<br />
schließlich der Betrachtung der möglichen<br />
Besucherzuflüsse aus einem Raum im Umkreis von<br />
ca. 200 km eine besondere Bedeutung zu. In<br />
diesem Raum leben rund 12 Mio. Menschen. Somit<br />
wäre ein Nationalpark Senne für insgesamt<br />
ca. 12 Millionen Menschen ein schnell und gut<br />
erreichbares touristisches Ziel.
2. Referenzregionen<br />
Alle betrachteten Referenzregionen (NP Bayerischer<br />
Wald, NP Müritz, NP Hainich) weisen insbesondere<br />
in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens<br />
kontinuierlich wachsende Besucherströme auf, die<br />
regionale Einkommens- und Beschäftigungseffekte<br />
generieren. In allen Regionen konnten Fördermittel<br />
als nationalparkinduzierte Zahlungsströme in<br />
erheblichem Umfang eingeworben werden. Die<br />
betrachteten Nationalparke sind somit ein<br />
entscheidender Motor der Regionalentwicklung. Es<br />
wird auch deutlich, dass die durch einen Nationalpark<br />
induzierten regionalwirtschaftlichen Effekte<br />
schon in wenigen Jahren wirksam werden.<br />
3. Ist-Analyse<br />
Die Ist-Analyse der regionalwirtschaftlichen<br />
Bedeutung des Tourismussektors im potenziellen<br />
Nationalparkvorfeld Senne unterstreicht die aktuelle<br />
Bedeutung der Tourismuswirtschaft für die<br />
Senneregion. Der Gesamtbruttoumsatz durch den<br />
Tourismus im Nationalparkvorfeld Senne beträgt für<br />
das Jahr 2000 rund 74 Mio. Euro. Er führt zu einem<br />
Einkommenseffekt von knapp 41 Mio. Euro.<br />
4. Potenzial- und Variantenanalyse<br />
Unter Verwendung von Annahmen wurden die<br />
potenziellen Einkommens- und Beschäftigungseffekte<br />
nach der Errichtung des Nationalparks Senne<br />
berechnet.<br />
In Abhängigkeit von unterschiedlich weit gefassten<br />
Besucherzuflüssen mit entsprechenden zusätzli-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
chen Einkommens-, Beschäftigungs- und Auslastungseffekten<br />
wurden folgende „Entwicklungspfade/-varianten“<br />
berechnet:<br />
Die Variante I, mit einem Wertschöpfungszuwachs<br />
von 2,4 Mio. Euro und ca. 200 zusätzlichen<br />
Beschäftigten, geht ausschließlich von einem durch<br />
den Nationalpark induzierten Tagestourismus aus<br />
dem Nationalparkumfeld (2 Mio. Einwohner) aus.<br />
Bereits nach einigen Jahren nach Errichtung eines<br />
Nationalparks Senne ist diese Entwicklung zu<br />
erwarten.<br />
Die Variante II bezieht die möglichen Besucherzuflüsse<br />
aus dem angrenzenden Raum im Umkreis von<br />
ca. 200 km (10 Mio. zusätzliche Einwohner) mit ein.<br />
Es konnte ein Wertschöpfungszuwachs in Höhe von<br />
56 Mio. Euro ermittelt werden, was in etwa auch<br />
eine Verdoppelung der Übernachtungszahlen im<br />
Nationalparkvorfeld bedeuten sowie einer<br />
Beschäftigungssteigerung von ca. 3.500 Arbeitsplätzen<br />
im Tourismussektor entsprechen würde.<br />
Diese Entwicklungsperspektiven sind erst nach<br />
einer – im Vergleich zur Variante I – längeren<br />
Vorlaufzeit zu erwarten. Die Betrachtung der<br />
Referenzregionen zeigt jedoch, dass eine derartige<br />
Entwicklung nach ca. zehn Jahren realistisch sein<br />
kann.<br />
Die denkbar günstigste Entwicklung mit einer noch<br />
längeren Vorlaufzeit zeigt die Variante III. Sie lehnt<br />
sich an die Entwicklung in der Nationalparkregion<br />
Bayerischer Wald an, der bereits seit mehr als<br />
30 Jahren besteht. Wie die Beispiele des Nationalparks<br />
Bayerischer Wald oder auch des Schweizer
Nationalparks zeigen, werden Nationalparke im<br />
Laufe der Jahrzehnte als touristische Destinationen<br />
zunehmend bekannt und gezielt von Touristen aus<br />
der gesamten Bundesrepublik, bzw. der Schweiz<br />
sowie aus dem Ausland aufgesucht. Entsprechend<br />
hoch sind der Wertschöpfungszuwachs und die<br />
Beschäftigungseffekte. Für die aktuelle Diskussion<br />
um die Errichtung des Nationalparks Senne sollten<br />
zunächst vor allem die Varianten I und II in Betracht<br />
gezogen werden.<br />
5. Wertschöpfungsketten und Ausgabenverflechtungen<br />
Die regionalwirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven<br />
der Nationalparkregion Senne hängen<br />
insoweit von der Errichtung des Nationalparks<br />
Senne ab, wie dieser Schritt zusätzliches Einkommen<br />
und zusätzliche Beschäftigung sowie<br />
zusätzliches Wachstum in der Region generiert:<br />
zum einen durch zusätzliche Konsumausgaben von<br />
Tages- und Übernachtungs-Touristen und durch<br />
zusätzliche Fördermittel verschiedener Träger, also<br />
Ausgaben, durch die Kaufkraft in die Region fließt,<br />
zum anderen durch davon angestoßene weitere<br />
Konsumausgaben und Investitionen von Unternehmen<br />
in der Region selbst. Bedeutend sind neben<br />
den direkten Einkommens-, Beschäftigungs- und<br />
Wachstumseffekten durch den Tages- und<br />
Übernachtungstourismus auch die regionalwirtschaftlichen<br />
Perspektiven für die mit dem<br />
Tourismus durch Ausgaben und Wertschöpfungsketten<br />
verflochtenen Wirtschaftsbereiche der<br />
Nationalparkregion Senne.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
6. Fördermittel als nationalparkinduzierte<br />
Zahlungsströme<br />
Durch Fördermittel der öffentlichen Hand, durch<br />
Stiftungen und Sponsoren sowie mittels regionaler<br />
Initiativen sind beträchtliche Zahlungsströme für die<br />
Senneregion zu erwarten. Diese Fördermittel<br />
können durch ihre entsprechende Verwendung<br />
(z. B. Infrastrukturmaßnahmen, Umweltbildung etc.)<br />
darüber hinaus die touristische Attraktivität der<br />
Senne-Region und den damit verbundenen<br />
nationalparkinduzierten Tourismuszuwachs befördern<br />
und verstärken.<br />
7. Handlungsempfehlungen<br />
Für die Zeit bis zur Errichtung eines Nationalparks<br />
Senne werden die folgenden Handlungsempfehlungen<br />
ausgesprochen:<br />
– Einrichtung einer Koordinationsstelle für das<br />
Regionalmanagement der Nationalparkregion<br />
Senne<br />
– Aufbau einer begleitenden Lenkungsgruppe<br />
(regionale Akteure)<br />
– Aufbau einer Datenbank Senne<br />
– Schärfung der „regionalen Identität“ und des<br />
„regionalen Erscheinungsbildes“ der Nationalparkregion<br />
Senne, um eine Unverwechselbarkeit<br />
zu erreichen und die Bekanntheit zu steigern<br />
– Entwicklung von Logo und Claim für die Nationalparkregion<br />
Senne<br />
– Vermarktung der Region über vielfältige Medienträger<br />
(Profilkarte, Postkarten, Internet, Messepräsentationen<br />
etc.)
– Ausbau der Regionalvermarktung<br />
(„Senne Original“)<br />
– Innerregionale und überregionale Kooperationen<br />
(„Public-Private-Partnership“)<br />
– Vernetzung der komplementären Angebote<br />
(Angebotskatalog)<br />
– Entwicklung des touristischen Profils für die<br />
Senneregion<br />
– Schaffung und Präsentation von buchbaren und<br />
verknüpften Tourismusangeboten.<br />
Darüber hinaus wird empfohlen, die Zeit bis zur<br />
Errichtung des Nationalparks zu nutzen, um<br />
wenigstens einen Teil der aufgezeigten Handlungsempfehlungen<br />
zu realisieren. Für diese Vorgehensweise<br />
sprechen insbesondere folgende Erkenntnisse:<br />
– Die bereits heute durch den Tourismus im Nationalparkvorfeld<br />
realisierte hohe regionale Wertschöpfung<br />
kann schon im Vorlauf der Errichtung<br />
eines Nationalparks Senne gesteigert werden.<br />
– Die günstigen Entwicklungen eines Nationalpark-<br />
Tourismus mit den aufgezeigten realisierbaren<br />
Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotentialen<br />
nach Errichtung eines Nationalparks Senne können<br />
nur bei einer entsprechenden Vorbereitung<br />
der Kommunen und Unternehmen ohne weitere<br />
zeitliche Verzögerung genutzt werden.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Zudem können Fördermittel, die projektbezogen<br />
eingeworben werden, zur Überbrückung der<br />
Vorlaufzeit eines Nationalpark-Tourismus beitragen,<br />
da eine Förderung nicht nur in der Errichtungsphase<br />
selbst sondern schon davor möglich ist, wie das<br />
Beispiel des Nationalparks Hainich zeigt.<br />
Um etwaige Investitionsrisiken in der Vorlaufzeit<br />
und danach zu verringern, wird für die frühzeitige<br />
Beachtung und Schaffung von Optionen plädiert,<br />
die auf eine Errichtung des Nationalparks Senne<br />
zielen und genutzt werden, wenn sich diesbezügliche<br />
Erwartungen stabilisieren. Ein Indikator hierfür<br />
könnte die realisierte Auslastung der Beherbergungskapazitäten<br />
sein.<br />
Folgende Strategien der Wirtschaftsförderung<br />
werden empfohlen:<br />
– Strategie der Importsubstitution<br />
Ziel ist die Stärkung des endogenen Entwicklungspotentials<br />
der regionalen Wirtschaft, und<br />
zwar über die bereits aufgezeigten, unmittelbar<br />
oder mittelbar vom Tages- und Übernachtungs-<br />
Tourismus ausgehenden Ausgabenströme sowie<br />
Einkommens- und Beschäftigungseffekte hinaus<br />
– Strategie des zunehmenden Dienstleistungsexports<br />
durch Tourismus<br />
Ihr Ziel ist die Stärkung des exogenen Entwicklungspotentials<br />
der regionalen Wirtschaft, und<br />
zwar durch Umlenkung von Ausgaben in die<br />
Anrainergemeinden des Nationalparkvorfeldes,<br />
die sonst in anderen Regionen getätigt würden.
– Strategie für ein gemeinsames Profil und ein<br />
gemeinsames Image<br />
Ziel ist die Stärkung weicher Standortfaktoren für<br />
Unternehmen mit ihren Beschäftigten.<br />
Das gemeinsame Profil und das gemeinsame Image<br />
„Nationalparkvorfeld Senne“ könnten in einem<br />
weiten Sinne genutzt werden: Die Anrainergemeinden<br />
des Nationalparks haben nämlich mit diesem<br />
Profil, bzw. Image einen so genannten „weichen<br />
Standortfaktor“, der für die Bestandssicherung und<br />
-entwicklung der jeweiligen kommunalen Wirtschaft<br />
von großer Bedeutung ist. Die kommunale<br />
Wirtschaftsförderung könnte diesen Strandortfaktor<br />
verstärkt in den Vordergrund stellen, um Unternehmen<br />
mit entsprechenden Standortanforderungen zu<br />
halten oder sogar im Rahmen von Neuansiedlungen<br />
anzuziehen, und zwar mit den jeweiligen Beschäftigten,<br />
für die das Nationalparkvorfeld mit dem<br />
potentiellen Nationalpark „vor der Haustür“ sowie<br />
mit der erreichbaren Vielfalt der angeführten Güterund<br />
Dienstleistungsangebote im Nationalparkvorfeld<br />
und in den angrenzenden Naturparkregionen<br />
entscheidende Standortfaktoren für die Wohnortwahl<br />
darstellen. Insoweit bietet ein gemeinsames<br />
Profil und Image „Nationalparkvorfeld Senne“ über<br />
die Förderung der Tourismuswirtschaft hinaus auch<br />
Optionen für zukünftige Entwicklungen der<br />
kommunalen Wirtschaft der betreffenden Gemeinden,<br />
deren Erschließung bereits vor Errichtung des<br />
Nationalparks beginnen kann.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Prof. Dr. Horsch<br />
Entwicklungsstand und Defizite von Controlling-<br />
Systemen (speziell im Kostenmanagement) in<br />
privatwirtschaftlichen Unternehmen.<br />
Bestandsaufnahme der in den Unternehmen<br />
angewandten Controllinginstrumente, vorwiegend<br />
im Bereich Kostenmanagement. Kernziel ist die<br />
Gewinnung empirischer Daten, die den Entwicklungsstand<br />
und die Perspektiven des Controllings<br />
aufzeigen.<br />
Prof. Dr. Kätsch<br />
Forschung und Entwicklung im Fachgebiet<br />
Geoinformatik 2003<br />
Die Forschungsarbeiten an verschiedenen Projekten<br />
auf den Gebieten Geoinformatik und Fernerkundung<br />
konnten im Jahre 2003 fortgesetzt und um zwei<br />
weitere Projekte erweitert werden. Abgeschlossen<br />
werden konnten zwei im südlichen Afrika durchgeführte<br />
Studien zum Einsatzpotential moderner<br />
Satellitenfernerkundung. Zum einen ging es dabei<br />
um die objektive Erfassung und Beschreibung von<br />
Landschaftsstrukturen im Gebiet des Okavango,<br />
Botswana mit Hilfe von Quickbird-Satellitenbildern<br />
und GIS (Harry Oppenheimer Research Center,<br />
Maun, Botswana). Die hochauflösenden Bilder mit<br />
einer Bodenauflösung von weniger als 1 m sollten<br />
zur mathematisch-statistischen Beschreibung von<br />
ökologisch bedeutsamen Eigenschaften der<br />
Landschaftsstruktur herangezogen werden um<br />
daraus Rückschlüsse auf Zerstörung und Fragmentierung<br />
der Lebensräume im Delta des Okavango im
nordwestlichen Botswana zu gewinnen. Die nun<br />
abgeschlossene Projektphase diente vor allem der<br />
methodisch-technischen Entwicklung. Ein eher<br />
ökologisch ausgerichtetes Folgeprojekt ist beantragt<br />
und soll ab 2004 bearbeitet werden.<br />
Das zweite, nunmehr abgeschlossene Projekt hatte<br />
die großräumige Kartierung von Wassereinzugsgebieten<br />
zum Ziel. Mit Hilfe von Stereobildern des<br />
indischen IRS-Satellitensystems konnten Verfahren<br />
zur automatischen Extraktion und Analyse der<br />
Oberflächenstrukturen einen mehrer Quadratkilometer<br />
bedeckenden Wassereinzugsgebiets am<br />
Ostabfall der südafrikanischen Drakensberge<br />
entwickelt und erfolgreich erprobt werden. Die<br />
Ergebnisse des von der VW-Stiftung sowie der<br />
südafrikanischen Forstindustrie geförderten<br />
Projekts wurden auf dem internationalen Weltkongress<br />
für Kartographie in Durban, Südafrika<br />
präsentiert werden.<br />
Im Jahre 2003 wurde mit den Arbeiten für ein<br />
Projekt zur Bilanzierung des Carbon-Haushaltes von<br />
Regionen in Mitteleuropa begonnen (CARBOGIS).<br />
Dieses Projekt zielt auf die Entwicklung eines<br />
Informationssystems zur Überwachung des<br />
Ausstoßes von CO2 sowie die Abschätzung des<br />
C-Bindungspotential in Wäldern mit Hilfe der<br />
Fernerkundung. Die Arbeiten wurden in 2003 mit<br />
der Auswertung von Bildern des MODIS-Satelliten<br />
begonnen, der aufgrund seiner großen spektralen<br />
Spannweite in besonderer Weise für die Erfassung<br />
des aktuellen Zustandes der Waldvegetation<br />
geeignet zu sein scheint. Schließlich werden auch
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
technische Aspekte der Substitution fossiler<br />
Brennstoffe durch regenerative Brennstoffe wie Holz<br />
bearbeitet. Das Projekt ist für eine Laufzeit von drei<br />
bis vier Jahren projektiert und wird gemeinsam mit<br />
Partnern aus dem Landkreis Osnabrück und<br />
Göttingen durchgeführt. Innerhalb der Fakultät ist<br />
das Fachgebiet „regenerative Energien“ für die<br />
technischen Fragestellungen zuständig.<br />
Prof. Dr. Kerck<br />
Vermeidbarkeit von technischen Holzschäden durch<br />
holzbrütende Insekten in der forstlichen Praxis.<br />
Zur Rolle der holzbrütenden Insekten bei dem<br />
derzeitigen Buchensterben.<br />
Prof. Metz<br />
Anbauversuche schnellwachsende Baumarten<br />
Im Berichtsjahr 2003 konnten entscheidende<br />
Fortschritte und erste Ergebnisse auf den Gebieten<br />
„Anbau von Pappelsetzstangen“ und Bereitstellung<br />
von „Pappelhackschnitzeln für Biomasse-<br />
Heizkraftwerke“ geliefert werden.<br />
Die beiden Forschungsvorhaben wurden von der<br />
<strong>HAWK</strong> finanziell unterstützt und durch Ermäßigung<br />
der Lehrverpflichtung gefördert.<br />
Pappelsetzstangen<br />
Die Anbauversuche mit zwei- bis vierjährigen<br />
Pappelsetzstangen auf landwirtschaftlichen Flächen<br />
der ehemaligen Domäne Georgenhof, Hessen, sind<br />
äußerst erfolgreich verlaufen.<br />
Die Versuchsanordnung erfolgte in enger Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Schnellwachsende<br />
Baumarten in Hann.-Münden unter Einbindung<br />
studentischer Hilfskräfte.<br />
Erste Wurzelgrabungen haben ergeben, dass die<br />
Setzstangen in der Lage sind, auch auf steinigen<br />
und nur schwach lehmigen Böden eine kräftige<br />
Bewurzelung zu entfalten.<br />
Die Anwuchsprozente liegen bei über 95 Prozent<br />
und sind damit weit über bisher üblichen Raten bei<br />
Pflanztechniken mit Pappel-Steckhölzern. Zudem<br />
entfallen weitgehend die Probleme mit üppiger<br />
Begleitflora, Schermausverbiss und Wildverbiss<br />
durch Rehwild.<br />
Durch Veröffentlichungen in der örtlichen Presse<br />
haben inzwischen zahlreiche Landwirte ihr Interesse<br />
bekundet, ähnliche Anbauversuche auf stillgelegten<br />
landwirtschaftlichen Flächen vorzunehmen.<br />
Im Frühjahr 2004 werden mehrere dieser Pilotprojekte<br />
gestartet.<br />
Pappelhackschnitzel für Biomasse-Heizkraftwerke<br />
Im Frühjahr 2003 wurden auf Pappelversuchsflächen<br />
im Forstamt Karlshafen ertragskundliche<br />
Erhebungen an verschiedenen Pappelklonen<br />
vorgenommen, um Prognosen über Bio-Masseproduktion<br />
für spätere Freilandpflanzungen zu<br />
erhalten.<br />
Gleichzeitig wurden Baumfällungen durchgeführt,<br />
um Erkenntnisse über Trocknungsgrade während<br />
der Sommermonate zu bekommen. Im Herbst 2003<br />
wurden erstmals ganze Bäume mit Ästen mit einem<br />
Mobilhacker zu Hackschnitzeln aufbereitet und die
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Hackschnitzel einem landwirtschaftlichen Bio-<br />
Heizkraftwerk zur Verfügung gestellt. Damit schließt<br />
sich eine Versuchsreihe: Anbau von Balsampappeln<br />
und Verwendung als Hackschnitzel für Bio-Heizkraftwerke.<br />
Rainer BÜCHNER hat in seiner Diplomarbeit<br />
„Bereitstellung von Pappelhackschnitzeln aus<br />
Kurzumtriebsbeständen“ SS 2003, wesentliche<br />
Beiträge zu dieser Thematik geliefert.<br />
In einer weiteren Versuchsanordnung wurden in<br />
Zusammenarbeit mit den Stiftungsforsten Kloster<br />
Haina die Fragestellungen untersucht, welche<br />
Umrechnungsfaktoren ergeben sich von Erntefestmeter<br />
in Schüttraumkubikmeter bei Bereitstellung<br />
unterschiedlicher Laubbaumarten unter Anwendung<br />
differenzierter Baummessmethoden. Auch in<br />
diesem Fall konnten völlig neue Ergebnisse<br />
präsentiert werden, die in der forstlichen Presse<br />
bislang noch nicht veröffentlicht wurden.<br />
Diese Ergebnisse sind festgehalten in der<br />
Diplomarbeit von Kai RAUPACH „Ermittlung von<br />
Umrechnungsfaktoren für Waldhackschnitzel“,<br />
WS 03/04.<br />
Prof. Dr. Nelles<br />
Angewandte F & E-Projekte:<br />
Im Jahr 2003 wurden einige Projekte in den<br />
Bereichen Angewandte Forschung & Entwicklung<br />
sowie Technologie- und Wissenstransfer bearbeitet<br />
und es konnten weitere Vorhaben eingeworben<br />
werden. Detaillierte Informationen können der<br />
Homepage www.fu.fh-goettingen.de/fgtus<br />
entnommen werden.
Zum 01. Februar konnte das EFRE-geförderte Projekt<br />
„Verbesserung der Genehmigungsfähigkeit von<br />
Biogasanlagen“ begonnen werden. Ziel des<br />
Projektes ist die Untersuchung der Hygienisierungsleistung<br />
von Biogasanlagen mit zwischengeschalteter<br />
Hygienisierungseinheit. Aufgrund der in jüngster<br />
Vergangenheit aufgetretenen Tierkrankheiten<br />
bestehen derzeit auf Seiten der Genehmigungsbehörden<br />
große Unsicherheiten im Umgang mit<br />
seuchenhygienischen Fragestellungen denen<br />
lediglich in unzureichendem Maße aussagekräftige<br />
Forschungsergebnisse entgegenstehen. Der<br />
Nachweis einer Gewährleistung der Hygienisierungsleistung<br />
gemäß geltender Rechtsvorschriften<br />
wäre für den Projektpartner, dem Biogasplanungsbüro<br />
Archea GmbH, ein deutlicher Wettbewerbsvorteil<br />
in einem von starker Konkurrenz geprägtem<br />
Markt.<br />
Die im Rahmen des in 2001 begonnenen AGIP-<br />
Projektes „Untersuchung und Optimierung der Co-<br />
Fermentaton in zweistufigen Biogas-Anlagen“<br />
errichtete Biogas-Forschungsanlage wurde in 2003<br />
mit einer Online-Gasmessung und einer verbesserten<br />
Steuerungstechnik versehen. Diese Aufrüstung<br />
stellt eine erhebliche Verbesserung hinsichtlich der<br />
Qualität der Forschungsergebnisse dar und wurde<br />
auf Grundlage der bislang erhaltenen praktischen<br />
Erfahrungen mit der Anlage vorgenommen.<br />
Das EFRE-Projekt „Erschließung des Geschäftsfeldes<br />
Optimierung von Biogasanlagen“ erhielt in enger<br />
Abstimmung mit dem Projektpartner Krieg & Fischer
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Ingenieure GmbH im April 2003 eine Neuausrichtung:<br />
Sollten zu Beginn der Untersuchungen<br />
anonymisierte Daten gesammelt und ausgewertet<br />
werden, um damit anlagenunabhängige Aussagen<br />
über die Optimierung von Prozesszuständen zu<br />
machen, wurde die Betrachtungsweise hin zur<br />
genauen und vollständigen Erfassung einzelner<br />
Anlagen geändert.<br />
Es wurde im Verlauf der Untersuchungen deutlich,<br />
dass eine optimale Betriebsführung nur mit<br />
sorgfältig geführtem Betriebstagebuch sinnvoll<br />
möglich ist, so dass die später zu vertreibende<br />
Beratungsleistung sowohl eine angepasste Analytik<br />
als auch eine entsprechende Dokumentation und<br />
die dazugehörige Schulung der Betreiber umfassen<br />
muss.<br />
Die Ergebnisse des Projektes konnten bereits einen<br />
wertvollen Beitrag zur Erarbeitung von „Mindeststandards“<br />
zur Führung von Betriebstagebüchern<br />
sowie von Empfehlungen für die erforderliche<br />
Analytik leisten. Um eine weitreichende Gültigkeit<br />
der Untersuchungen zu erreichen, wurde darauf<br />
geachtet Biogasanlagen aus verschiedenen<br />
Bereichen hinsichtlich der zugesetzten Grundstoffe<br />
und Substrate auszuwählen.<br />
Eine Anlage, die zunächst schwerpunktmäßig<br />
untersucht wurde, ist der „Bioenergiehof Obernjesa“<br />
bei Göttingen. Es handelt sich dabei um im<br />
Frühjahr 2003 in Betrieb genommene Biogasanlage,<br />
die nur mit Energiepflanzensilage ohne Gülle oder<br />
anderen tierischen Produkten betrieben wird. In<br />
Abstimmung mit dem Betreiber wurde ein Mess-
und Überwachungsprogramm erstellt, anhand<br />
dessen die optimale Betriebsführung ermittelt wird.<br />
Analog zu diesen Messungen wurden weitere<br />
Anlagen der Region in die Untersuchungen<br />
einbezogen.<br />
Das Projekt Energiepark Northeimer Schulen konnte<br />
im Februar 2002 mit einer Ergebnispräsentation vor<br />
dem Kreistag des Landkreises Northeim erfolgreich<br />
abgeschlossen werden. Die durchgeführte Arbeit<br />
und die aufgezeigten Ergebnisse fanden die<br />
allgemeine Zustimmung über alle Fraktionen<br />
hinweg. Gegenwärtig wird die Umsetzung der<br />
Machbarkeitsstudie in ein Nahwärmenetz zwischen<br />
mehreren Schulen in der Stadt Northeim geplant.<br />
Als problematisch für die Umsetzung hat sich<br />
jedoch das zögerliche Verhalten der Kreistagsmitglieder<br />
aufgrund des hohen Investitionsvolumens<br />
erwiesen. Bis heute ist noch keine abschließende<br />
Entscheidung getroffen worden.<br />
Das Projekt Wissenschaftliche Begleitung der<br />
Biogasanlage Lüchow ist im Januar 2003 angelaufen.<br />
Im Rahmen der drei Jahre laufenden wissenschaftlichen<br />
Begleitung sollen die folgenden vier<br />
Punkte bearbeitet werden:<br />
– ökologische Bewertung des Verfahrens<br />
– ökonomische Beurteilung des Verfahrens<br />
– energetische Bewertung des Verfahrens<br />
– Prozessoptimierung in technischer und<br />
wirtschaftlicher Hinsicht<br />
Im Lauf des Jahres wurde eine Prozesskette der<br />
Biogasanlage sowie der vor- und nachgelagerten
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Bereiche modelliert und erste Kontakte zu den<br />
beteiligten Unternehmen aufgebaut. Für relevante<br />
Fragestellungen im Bereich der ökologischen<br />
Bewertung wurden geeignete Erfassungs- und<br />
Bewertungsverfahren gesucht und angepasst. Eine<br />
erste Fragebogenaktion zur Erfassung der Auswirkungen<br />
aus den vorgelagerten landwirtschaftlichen<br />
Produktionsprozessen wurde vorbereitet und wird<br />
im Januar 2004 durchgeführt.<br />
Im September 2003 konnte das AiF-Projekt<br />
Verbesserung der Qualität von Holzhackschnitzeln<br />
aus der Landschaftspflege begonnen werden. Im<br />
Rahmen des Projekts sollen Lager- und Aufbereitungstechniken<br />
erprobt werden, die Wassergehalt<br />
sowie Stör- und Feinstoffanteil des Hackguts aus<br />
der Landschaftspflege auf ein qualitatives Niveau<br />
gemäß Öl-Norm 7133 senken. Sowohl in der Region<br />
Göttingen als auch im Raum Frankfurt/Wiesbaden<br />
wurden verschiedene Versuche zur Trocknung und<br />
Aufbereitung des Hackgutes erstellt. Die zur<br />
Untersuchung kommenden Verfahren werden in<br />
Zusammenarbeit mit zwei Garten-/Landschaftsbauunternehmen<br />
bewertet. Ziel ist es hierbei, Fehler bei<br />
der Implementierung in die Praxis zu vermeiden.<br />
Über die Versuche hinaus wird parallel die regionale<br />
Vermarktung des zukünftig hochwertigen Hackschnitzels<br />
erarbeitet. Hierzu wird in Kooperation mit<br />
regionalen Organisationen der Kontakt zu<br />
potentiellen Kunden aufgebaut. Auch in diesem<br />
Projekt konnten Studenten für die Marketingplanung<br />
und die Vorauswahl potentieller Kunden<br />
eingebunden werden.
Im Rahmen des EFRE geförderten Projektes<br />
Bioenergie Südniedersachsen konnten mehrere<br />
Machbarkeitsstudien durchgeführt werden.<br />
Weiterhin konnten lokale KMU bei ihren Bemühungen<br />
um Förderungen durch nationale und internationale<br />
Institutionen unterstützt werden. Im Laufe des<br />
Projektes sollen weiterhin Einzelprojekte angeschoben<br />
und die beteiligten Betriebe bzw. potenziellen<br />
Anlagenbetreiber durch das FG Technischer<br />
Umweltschutz unterstützt und beraten werden. Das<br />
Projekt wurde im Oktober 2001 begonnen und hat<br />
eine Laufzeit von drei Jahren.<br />
Im Mai wurde durch das Niedersächsische<br />
Forstliche Bildungszentrum Münchehof in<br />
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen,<br />
Fachgebiet Technischer<br />
Umweltschutz die Fachveranstaltung „Heizen<br />
mit Holz“ durchgeführt. An den beiden Tagen<br />
konnten mehr als 5.000 Besucher begrüßt werden.<br />
Die Untersuchung und Optimierung des Rotteverlaufs<br />
unbelüfteter Vorrottesysteme zur biologischen<br />
Abfallbehandlung, gefördert durch die Arbeitsgruppe<br />
Innovative Projekte (AGIP) und Firma Tönsmeier<br />
Entsorgung GmbH & Co. KG. Das Projekt startete im<br />
April 2001 und wurde im September 2003<br />
abgeschlossen. In der ersten Phase wurden mehrere<br />
Versuchs-Chargen auf die Parameter GV, TS,<br />
Rottegrad und Temperatur untersucht. Es wurde in<br />
einem weiteren Schritt die Zusammensetzung der<br />
Rotte verändert, in dem mehr Strukturmaterial<br />
verwendet wurde. Erste Ergebnisse zeigen, dass die<br />
Veränderung der Rezeptur zu sehr positiven
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Ergebnissen geführt hat. Ab August 2002 wurde die<br />
neue Versuchsreihe mit veränderter Biomüllaufbereitung<br />
begonnen. Die Ergebnisse zeigten eine<br />
signifikante Verbesserung der Rotteprozesse. Der<br />
Endbericht wurde der Förderstelle im September<br />
2003 übergeben. Die Vorschläge des Endberichts<br />
werden im Rahmen des Umbaus der Kompostierungsanlage<br />
in Hildesheim umgesetzt.<br />
Für den wirtschaftlichen Betrieb einer Anlage zur<br />
Erzeugung von Wärme aus regenerativen Quellen ist<br />
die kostengünstige Bereitstellung von Brennmaterial<br />
unumgänglich. Im Bereich Waldhackschnitzel<br />
kommt der Erzeugung und Logistik der Waldhackschnitzel<br />
eine entscheidende Bedeutung zu.<br />
Hier besteht ein Spannungsfeld zwischen dem<br />
Erzeuger der Waldhackschnitzel (staatliche und<br />
private Waldbesitzer), die für ihr hochwertiges<br />
Produkt einen möglichst hohen Erlös erzielen<br />
wollen, und dem Abnehmer der Hackschnitzel (Einund<br />
Mehrfamilienhäusern, öffentliche Gebäude),<br />
der für einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage auf<br />
längerfristig kalkulierbare, betriebswirtschaftlich<br />
sinnvolle Preise für Waldhackgut angewiesen ist.<br />
Um dieses Spannungsfeld teilweise zu entschärfen<br />
wurde vom Niedersächsischen Forstlichen<br />
Bildungszentrum Münchehof, der Firma Häckseltechnik<br />
Mittelstendorf GmbH, der Firma Bruno<br />
Reimann Holzgroßhandlung und Fuhrunternehmen,<br />
der Firma Container Express Overbeck, dem<br />
Maschinenring Kommunalservice GmbH, Niederlassung<br />
Northeim und der Fachhochschule Hildes-
heim/Holzminden/Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement<br />
ein Arbeitskreis gegründet<br />
(„Erzeugung und Logistik von Waldhackschnitzeln“),<br />
der sich mit der kostengünstigen Erzeugung von<br />
Waldhackschnitzeln und darüber hinaus mit der<br />
ökologischen und ökonomischen Logistik für das<br />
Waldhackgut beschäftigt. Der Arbeitskreis steht<br />
allen interessierten Firmen und Institutionen offen.<br />
Im Jahr 2003 konnte die Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel<br />
als weiterer kompetenter<br />
Partner gewonnen werden. Sie wird sich vor allem<br />
mit analytischen Problemen im Bereich der<br />
Waldhackschnitzelkontrolle beschäftigen.<br />
Erste Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind<br />
folgende genehmigte Forschungs- und Entwicklungsprojekte:<br />
– Entwicklung eines Großhackers gemeinsam mit<br />
dem Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum<br />
Münchehof und der Firma Häckseltechnik<br />
Mittelstendorf GmbH<br />
– „Erschließung des Geschäftsfeldes Versorgung<br />
von Ein- und Mehrfamilienhäusern bzw. öffentlicher<br />
Gebäude mit Hackschnitzeln“; Kooperation<br />
der Professoren Nelles und Weihs<br />
– Energetische Verwertung von Holzhackschnitzel<br />
in Heiz(-kraft)werken aus dem Sanitärhieb und<br />
Waldpflegemaßnahmen verschiedener deutscher<br />
Laub- und Nadelhölzer; Kooperation der Professoren<br />
Kerck, Nelles und Weihs
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Die Entwicklung und der Bau eines Großhackers<br />
wird vom Niedersächsischen Ministerium für den<br />
ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz gefördert. Mit dem Großhacker<br />
ist erstmals in Deutschland ein Gerät verfügbar das<br />
folgende Vorteile hat:<br />
– Hackerbetrieb auf Waldwegen, die mit einachsgetriebenen<br />
Container-Lkw nicht angefahren<br />
werden können<br />
– Hackerbetrieb abseits der LKW-befahrbaren<br />
Wege auf den Maschinenwegen (Rückeweg/<br />
-gasse)<br />
– Es werden nur geringe Wegeseitenräume<br />
benötigt. Es muss keine Möglichkeit der seitlichen<br />
Übergabe in abgestellten Container vorhanden<br />
sein, wie es bei den vorhandenen Systemen<br />
notwendig ist. Eine Bereitstellung eines<br />
Dumpers für den Containertransport vom Hacker<br />
zur Aufnahmestelle für den LKW-Transport ist<br />
nicht notwendig<br />
– Spezielle Bauweise, die die eigenständige Fortbewegung<br />
sowohl auf der Rückegasse, als auch<br />
auf der Straße (Höchstgeschwindigkeit<br />
ca. 65 km/h) gewährleistet<br />
– Der Einzug kann 45° seitlich rechts geschwenkt<br />
werden (Betrieb auf der Waldstraße bei im<br />
90°-Winkel gepoltertem Holz)<br />
– Deutliche Senkung der Produktionskosten durch<br />
die oben genannten speziellen Merkmale.<br />
Die Entwicklung und Erprobung des Großhackers<br />
wurde im Dezember 2003 abgeschlossen.
Im Rahmen des EFRE-Projekts Erschließung des<br />
Geschäftsfeldes Versorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern<br />
bzw. öffentlicher Gebäude mit<br />
Hackschnitzeln werden aktuelle Probleme der<br />
Hackschnitzellogistik bei Kleinanlagen gelöst<br />
werden. Als ein wichtiger Punkt wurde hier die<br />
kostengünstige Belieferung von Ein- und Mehrfamilienhäusern<br />
bzw. öffentlichen Gebäuden mit<br />
Hackschnitzeln guter Qualität erkannt. Hier sind vor<br />
allem zwei Punkte zu nennen:<br />
– Abnahme von kleinen Mengen und teilweise<br />
ungünstige bauliche Anordnung von Brennstofflagerräumen<br />
in bestehender Bausubstanz<br />
– Im niedersächsischen Raum gibt es noch keine<br />
einheitlichen Qualitätsanforderungen an Hackschnitzel<br />
(im bayrischen oder österreichischen<br />
Raum sind Qualitätsanforderungen in Form der<br />
ÖNORM M 7133 teilweise bereits vorhanden);<br />
dies führt zu einer massiven Verunsicherung der<br />
potentiellen Kunden<br />
Es werden die am Markt befindlichen Systeme im<br />
deutschsprachigen Raum evaluiert. Ein erstes<br />
Auslieferungssystem konnte bereits angeschafft<br />
werden. Im Juni 2003 konnte das mobile Trommelsieb<br />
der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen in Betrieb genommen werden. Damit ist<br />
es möglich Größtkornanalysen im repräsentativen<br />
Umfang durchzuführen. Damit konnte eine wichtige<br />
Forderung der Prüfung von qualitativ hochwertigen<br />
Waldhackschnitzeln erfüllt werden. Das Projekt hat<br />
eine Laufzeit von Juli 2002 bis Juni 2004.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Das AGIP-Projekt Energetische Verwertung von<br />
Holzhackschnitzel in Heiz(-kraft)werken aus dem<br />
Sanitärhieb und Waldpflegemaßnahmen verschiedener<br />
deutscher Laub- und Nadelhölzer startete im<br />
Januar 2003 und beschäftigt sich mit der Verwertung<br />
von Sanitärhiebsholz und Waldpflegemaßnahmen.<br />
Dabei wird ein gemeinsam mit dem Niedersächsischen<br />
Forstlichen Bildungszentrum Münchehof<br />
und der Firma Häckseltechnik Mittelstendorf<br />
GmbH entwickelter Großhacker zum Einsatz<br />
kommen. Es ist geplant ein Verfahren zu entwickeln,<br />
um die Maßnahmen für den Sanitärhieb und die<br />
Waldpflege mit einem positiven Deckungsbeitrag<br />
durchführen zu können.<br />
Die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement nahm<br />
an der Messe Ligna 2003 teil. Dabei wurden<br />
Exponate sowohl am Gemeinschaftsstand der<br />
Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
als auch auf dem Freigelände (hier in Zusammenarbeit<br />
mit dem Niedersächsischen Forstlichen<br />
Bildungszentrum und der Firma HtM GmbH)<br />
ausgestellt. Der auf dem Freigelände ausgestellte<br />
Großhacker Terex 804 CT wurde von der Firma HtM<br />
in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen<br />
Forstlichen Bildungszentrum (FAR Holger Kuprat)<br />
und der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen, Fakultät Ressourcenmanagement,<br />
Fachgebiet Technischer Umweltschutz Dipl.-Ing.<br />
Andreas Neff/Prof. Dr. Michael Nelles entwickelt und<br />
war einer der Höhepunkte der Ligna 2003.
Die Erstellung des Bioenergiekonzepts für den<br />
Gewerbepark Duderstadt-Euzenberg wird durch<br />
Finanzmittel der EU-Strukturprogramme Leader+<br />
und EFRE gefördert. Im Gewerbepark Duderstadt-<br />
Euzenberg gibt es eine ganze Reihe von Gebäuden,<br />
die derzeit nicht über eine moderne Wärmeversorgung<br />
verfügen. Hier ist die Ansiedlung weiterer<br />
Betriebe geplant und deshalb müssen auch<br />
bestehende Gebäude u. a. mit einer Energieversorgung<br />
nach Stand der Technik ausgestattet werden.<br />
Das Gleiche gilt für die geplanten Neubauten im<br />
Gewerbepark sowie die angrenzende BGS-Kaserne.<br />
Die Wärmeversorgung des Gewerbeparks Euzenberg<br />
soll künftig nach Möglichkeit auf Basis von<br />
Energieholz sichergestellt werden. Das Fachgebiet<br />
Technischer Umweltschutz erstellt vor diesem<br />
Hintergrund eine Machbarkeitsstudie für ein<br />
nachhaltiges dezentrales Bioenergiekonzept. Das<br />
Projekt wurde im Januar 2003 abgeschlossen. Daran<br />
schloss sich eine Phase der intensiven politischen<br />
und kommunalen Lobbyarbeit an, als deren<br />
Höhepunkt der Besuch von Bundes-Umweltminister<br />
Jürgen Trittin an der Fachhochschule Hildesheim/<br />
Holzminden/Göttingen am 05.12.2003 angesehen<br />
werden kann. Dabei wurde massiv für das geplante<br />
Projekt geworben.<br />
Im Rahmen des EU-Strukturförderprogramms<br />
Leader+ engagiert sich das Fachgebiet Technischer<br />
Umweltschutz seit Sommer 2000 insbesondere in<br />
der Arbeitgruppe „Bioenergie“ der Lokalen<br />
Aktionsgruppe (LAG) des Landkreises Göttingen. In
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
diesem Rahmen wurde auch an der Erstellung des<br />
EU-Antrages der LAG mitgewirkt, der im Jahr 2002<br />
als bester Antrag aus Niedersachsen bewertet und<br />
genehmigt wurde. Im Leitprojekt „Bioenergieholzkontor<br />
Südniedersachsen (BKS)“ hat das Fachgebiet<br />
Technischer Umweltschutz die wissenschaftliche<br />
Begleitung bis Ende 2006 übernommen.<br />
Die laufenden Projekte des Fachgebiets Technischer<br />
Umweltschutz sind in den meisten Fällen interdisziplinär<br />
angelegt, wobei es sich in erster Linie um die<br />
Zusammenarbeit von Natur- und Ingenieurwissenschaftlern<br />
sowie Wirtschaftswissenschaftlern<br />
handelt. Dabei wird insbesondere eine Vernetzung<br />
der an der Fakultät Ressorcemmanagement und mit<br />
anderen Fakultäten der <strong>HAWK</strong> angestrebt.<br />
Ein außergewöhnliches angewandtes F & E-Projekt<br />
ist in diesem Zusammenhang sicherlich das AGIP-<br />
Vorhaben „Evaluierung der Qualifikation von<br />
Jugendlichen vor dem Hintergrund anderer<br />
relevanter Arbeitsmarktakteure sowie exemplarische<br />
Implementierung der energetischen Biomasseverwertung“.<br />
Es handelt es sich um eine Kooperation<br />
zwischen den Fakultäten Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit sowie Ressourcenmanagement, wobei<br />
hier die enge Zusammenarbeit zwischen den<br />
Disziplinen Sozialwissenschaften (Prof. Finkeldey)<br />
und Ingenieurwissenschaften (Prof. Nelles) zentraler<br />
Bestandteil des Projekts ist.<br />
In diesem sozial-ökologischen Projekt wurden 2003<br />
in Kooperation mit dem Niedersächsischen
Forstlichen Bildungszentrum (NFBz) in Seesen/Münchehof<br />
die beruflichen Perspektiven von Forstwirten<br />
und Waldarbeitern erhoben. Mit Hilfe von halbstrukturierten<br />
Interviews findet eine Befragung der<br />
Auszubildenden (drei Ausbildungsjahrgänge) des<br />
NFBz während ihrer Blocklehrveranstaltungen an<br />
der BBS II in Northeim statt. Darüber hinaus werden<br />
die Daten von insgesamt 380 Forstwirten und<br />
Forstwirtinnen erhoben, die ihre Ausbildung in den<br />
Jahren 1996 bis 2000 am NFBz absolviert haben.<br />
Mit Hilfe der so gewonnen Daten sollen möglichst<br />
konkrete Aussagen, über die derzeitige berufliche<br />
Situation von Forstwirten und Waldarbeitern im<br />
Land Niedersachsen gemacht werden. Die<br />
Ergebnisse dieser Untersuchung fließen in einen<br />
Bericht des NFBz an den Berufsbildungsausschuss<br />
der Landwirtschaftskammer Hannover ein.<br />
Im Bereich der internationalen Umweltschutzprojekte<br />
lag der Schwerpunkt der Aktivitäten in der VR<br />
China. Das Land Niedersachsen und die chinesische<br />
Provinz Anhui verbindet eine inzwischen 20 Jahre<br />
währende Partnerschaft. Die Provinz Anhui liegt im<br />
östlichen Zentralchina. Das ca. 60 Millionen<br />
Einwohner beheimatende Areal besitzt mit 140.000<br />
km 2 etwa 1/3 der Größe der Bundesrepublik<br />
Deutschland und liegt zwischen der gemäßigten<br />
und der subtropischen Klimazone. In der Provinzhauptstadt<br />
Hefei wohnen ca. 4,3 Mio. Einwohner.<br />
Durch den Abschluss eines weitgehenden<br />
Kooperationsvertrages zwischen der Universität<br />
Hefei und der <strong>HAWK</strong> im Oktober 2001 wurde die
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Zusammenarbeit weiter intensiviert und im Jahr<br />
2003 konnten neben kleineren Vorhaben im Bereich<br />
Abfallwirtschaft und Abwassertechnik insbesondere<br />
folgende Projekte vorbereitet werden:<br />
ASIA-LINK-Projekt „Curricula Development of<br />
Technology Oriented Sustainable Resource<br />
Management in China and Thailand“<br />
Dieses Projekt wurde im Sommer 2003 von der EU<br />
bewilligt. Gemeinsam mit der Montanuniversität<br />
Leoben (Österreich) und der Chulalongkorn<br />
Universität Bangkok (Thailand) werden an der<br />
chinesischen Partneruniversität in Hefei die<br />
Grundlagen für den geplanten umwelttechnischen<br />
Studiengang erarbeitet und die einschlägigen<br />
Lehrveranstaltungen eingeführt.<br />
Umwelttechnologie-Transferbüro in Hefei<br />
Im September 2003 wurde der Vertrag mit der<br />
Universität Hefei in Hildesheim unterzeichnet und<br />
der Betrieb planmäßig Anfang Januar 2004<br />
aufgenommen. Das Büro soll insbesondere<br />
niedersächsische/deutsche Unternehmen<br />
unterstützen, die sich auf dem chinesischen<br />
Umweltmarkt engagieren wollen. Das Angebotsspektrum<br />
umfasst zunächst folgende Leistungen:<br />
– Erstberatung von deutschen Firmen mit Interesse<br />
am Markteintritt in der chinesischen Umweltmarkt<br />
– Marktanalysen für die spezifischen Umweltprodukte<br />
(umwelttechnische Anlagen, Umweltdienstleistungen)<br />
– Entwicklung angepasster umwelttechnischer Verfahren<br />
für den chinesischen Markt
– Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung<br />
von großtechnischen Pilotprojekten in<br />
der VR China<br />
– Vermittlung von chinesischen Praktikanten und<br />
Diplomanden, die derzeit in Göttingen ihr<br />
Studium absolvieren<br />
Prof. Dr. Paarmann<br />
Feststellung des Nahrungsspektrums der Laufkäferart<br />
Trichotichnus storeyi aus dem australischen<br />
Regenwald<br />
Die Klassifizierung der Feigenarten nach der<br />
Nahrungsqualität, die sie Trichotichnus storeyi im<br />
australischen Regenwald bieten, wurde fortgeführt.<br />
Die neusten Untersuchungen ergaben, dass sich<br />
T. storeyi auch an Samen von Bäumen entwickeln<br />
kann, die nicht zur Gattung Ficus (Feigen) gehören.<br />
Er ist offenbar ein größerer Generalist als bisher<br />
angenommen, was auch durch die Beobachtung<br />
unterstützt wird, dass die Larven ihre Öffnungstechnik<br />
in bestimmten Situationen ändern können.<br />
Funktions- und ökomorphologische Untersuchungen<br />
zur Erklärung der Gildenstruktur samenfressender<br />
Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) aus tropischen<br />
Regenwäldern<br />
Es wurden Fütterungsversuche durchgeführt, die<br />
mögliche neue Wirtsartenspektren bei einer<br />
Verschleppung von samenfressenden Laufkäferarten<br />
nach Australien aufzeigen sollten. So deuten<br />
unsere Ergebnisse darauf hin, dass die amazonischen<br />
Feigensamenspezialisten durchaus in
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Australien ausreichend Wirtsbaumarten finden<br />
würden. Ihre stärkere Spezialisierung aufs<br />
Samenfressen könnte zumindest zu einer Verdrängung<br />
der australischen Art von den Feigenfruchtfällen<br />
führen.<br />
Wir haben außerdem in der Birkenfeige (Ficus<br />
benjamina) eine Art gefunden, deren Samen allen<br />
bisher in Zucht befindlichen Feigenkäferarten eine<br />
Entwicklung ermöglicht! Auf diese Weise kommen<br />
wir der Definition eines idealen Wirtsfeigensamens<br />
für samenfressende Laufkäfer sehr nahe.<br />
Die Messung der Druckfestigkeit von Feigensamen<br />
erfolgt derzeit im Max-Plank-Institut für Metallforschung<br />
in Stuttgart.<br />
Interessant für das Projekt dürfte auch eine<br />
neuerdings in Afrika gefangene und in Zucht<br />
genommenen Laufkäferart von Feigenfruchtflächen<br />
sein. Die Mandibelform der Larven deutet auf eine<br />
Lochbohrtechnik hin, wie sie von amazonischen und<br />
südostasiatischen Arten verwendet wird.<br />
Prof. Dr. Rastin<br />
The Influence of Air Pollution on Plants and Wood<br />
Quality<br />
Bearbeitungszeitraum: Oktober 2003 bis März 2007<br />
Finanzierung: Iranische Regierung, <strong>HAWK</strong><br />
Mitarbeiter: Alireza Pourkhabbaz<br />
Studentische Hilfskräfte: Flemming Hamester<br />
Zusammenarbeit mit: Ministerium für Wissenschaft<br />
und Technologie im Iran, Institut für Forstbotanik<br />
der Universität Göttingen, Institut für Bioklimatologie<br />
der Universität Göttingen
In trockenen und niederschlagsarmen Gebieten der<br />
Erde wie der Provinz Khorasan im Iran sind die<br />
städtischen Grünanlagen nicht nur von großer<br />
ökologischer Bedeutung, sondern erfüllen auch eine<br />
wichtige Erholungsfunktion. Sind diese Gebiete<br />
dicht besiedelt, so sind die städtischen Grünanlagen<br />
durch Immission von Luftverunreinigungen,<br />
insbesondere durch Autoabgase stark gefährdet.<br />
Über die Wirkung von Luftverunreinigungen auf den<br />
Gesundheitszustand der Grünanlagen in der Provinz<br />
Khorasan liegen bis jetzt keine Untersuchungen vor.<br />
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Wirkung<br />
von Luftverunreinigungen auf den morphologischen,<br />
anatomischen, chemischen und biochemischen<br />
Merkmalen der Park- und Straßenbäume in den<br />
dicht besiedelten Gebieten der Provinz Khorasan<br />
wie den Städten Mashad und Birjand zu untersuchen<br />
und zu überlegen, welche Maßnahmen zur<br />
Gewährleistung einer langfristigen Sicherung der<br />
Schutz- und Erholungsfunktion der o. g. Grünanlagen<br />
notwendig sind.<br />
Untersuchungen zum Erfolg von Bodenschutzmaßnahmen<br />
im Hamburger Wald<br />
Bearbeitungszeitraum: Januar 2003 bis November<br />
2005<br />
Finanzierung: Behörde für Wirtschaft und Arbeit der<br />
Freien und Hansestadt Hamburg,<br />
<strong>HAWK</strong> Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
Mitarbeiterin: Brunhilde Fedderau-Himme<br />
Studentische Hilfskräfte: Seven Albrecht, Nina<br />
Fleckner, Flemming Hamester, Jassica Waschkowski
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Zusammenarbeit mit: Behörde für Wirtschaft und<br />
Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
Um die Folgen der jahrzehntelang anhaltenden<br />
Einträge durch Deposition von Luftverunreinigungen<br />
auf die Hamburger Waldökosysteme zu erfassen,<br />
wurden sie unter meiner Leitung 1981 bis 1984 im<br />
Rahmen des Forschungsvorhabens „Bodenanalyseprogramm“<br />
untersucht. Die Ergebnisse dieser<br />
Untersuchungen zeigten, dass durch fortgeschrittene<br />
und tiefgreifende Bodenversauerung auf fast<br />
allen untersuchten Standorten Düngungen als<br />
Bodenschutzmaßnahmen dringend erforderlich<br />
sind. In den Jahren 1982 bis 1990 wurden die<br />
Wälder in Hamburg mit verschiedenen Kalkfraktionen<br />
und Kalkdosierungen behandelt. In dem<br />
Forschungsvorhaben sollen die Erfolge der<br />
Bodenschutzmaßnahmen bewertet und folgende<br />
Fragen beantwortet werden:<br />
– Waren die vorangegangenen Bodenschutzmaßnahmen<br />
erfolgreich?<br />
– Wurden die damaligen angestrebten Ziele<br />
erreicht?<br />
– Sind Folgemaßnahmen zur Gewährleistung einer<br />
langfristigen Sicherung der Nutz-, Schutz- und<br />
Erholungsfunktion sowie der biologischen Vielfalt<br />
der Hamburger Waldökosysteme erforderlich?<br />
– Wenn ja, wie, wann und auf welchen Standorten<br />
sollten sie erfolgen?<br />
Die von der Literatur bekannten Untersuchungen<br />
über die Wirkung der Kalkung auf Waldökosysteme
eziehen sich auf Zeiträume von weniger als zehn<br />
Jahren, welche zu kurz sind, um die Effekte einer<br />
Kalkung auf Waldökosysteme aufzudecken. Die hier<br />
geplanten Untersuchungen sind daher in ihrer Art<br />
weltweit einmalig, da zwischen den ersten<br />
Kalkungsversuchen und den jetzigen Untersuchungen<br />
ein Zeitraum von 20 Jahren liegt; eine sehr gute<br />
Dokumentation von den damals erhobenen Daten<br />
und Untersuchungsmethoden vorliegt und die vor<br />
20 Jahren durchgeführten wie auch jetzigen<br />
Untersuchungen von derselben Person geleitet<br />
werden.<br />
Prof. Dr. Rohe<br />
Wildbiologische Erhebungen als begleitende<br />
Untersuchungen zu einem ökotoxikologischem<br />
Monitorring<br />
Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Forsten<br />
des Landes Rheinland-Pfalz und in Kooperation mit<br />
dem Büro Hartmann (Göttingen) sowie dem<br />
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz wurden<br />
wildbiologischen Untersuchungen durchgeführt. Ziel<br />
des Modellprojektes ist es, Möglichkeiten der<br />
Bestandeserholung durch gezielte Biotopentwicklungsmaßnahmen<br />
und jagdliche Maßnahmen<br />
herbeizuführen.<br />
2003 konnten umfangreiche Daten zur Entwicklung<br />
der Landwirtschaft nach dem Zweitem Weltkrieg<br />
gesammelt werden. In diesem Zeitraum fand<br />
überwiegend der Rückgang der Niederwildarten<br />
Feldhase, Fasan und Rebhuhn statt. Die weitgehend<br />
gleichverlaufende Entwicklung der Landwirtschaft in
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Ressourcenmanagement<br />
den Untersuchungsflächen wurde in entsprechende<br />
Themenbereiche wie Anbau, Größe der Anbauflächen,<br />
Tierbestand, Sonderstrukturen, Maschinen,<br />
Anzahl und Größe der Betriebe zusammengefasst.<br />
In einer summarischen Betrachtung des historischen<br />
Wandels und dessen wahrscheinlichen<br />
Auswirkungen auf die Niederwildarten Feldhase,<br />
Rebhuhn und Fasan konnten erste Ergebnisse<br />
dargestellt werden.<br />
Die Maßnahmen zur Lebensraumaufwertung wurden<br />
durch den Berufsjäger, die Jagdpächter, Revierbetreuer<br />
und Helfer in den Untersuchungsrevieren<br />
(Bechtheim, Osthofen Nord und Süd) durchgeführt<br />
und erfolgten in enger Absprache und Zusammenarbeit<br />
mit den Flächeneigentümern bzw. -nutzern<br />
sowie den jeweiligen Verwaltungen. Als Maßnahmen<br />
kamen in Betracht: Flächenstillegungen, Dauerund<br />
Rotationsbrachen, Anlage von Äsungsflächen<br />
(Grün- und Körneräsung) und Verbesserungen der<br />
Nahrungsbasis (Zufütterungen). Die eingesetzten<br />
Mischungen enthalten keine landwirtschaftlichen<br />
Problemarten. So ist die Gefahr der Einwanderung<br />
in Kulturflächen ausgeschlossen. Auch kann die<br />
Biotopfläche jederzeit wieder in Kultur genommen<br />
werden. Insgesamt wirkte sich der trockene Sommer<br />
2003 hemmend auf die Entwicklung der Saaten in<br />
den Biotopflächen aus.<br />
In einem Vergleichsrevier wurden siedlungsnah<br />
vorbildlich angelegte und gepflegte Deckungs- und<br />
Äsungsflächen erweitert. Dies förderte die positive<br />
Entwicklung der Rebhuhn- und Fasanenpopulationen.
Prof. Dr. Weihs<br />
Im Berichtszeitraum konnten wesentliche Fortschritte<br />
auf dem Gebiet der Elektrischen Widerstandstomographie<br />
als Verfahren zur zerstörungsfreien<br />
Untersuchung von Bäumen gemacht werden (AGIP).
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit
Fakultät<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Geschäftsführender Dekan Hildesheim<br />
Prof. Dr. Gerhart Unterberger<br />
Dekan/Studiendekan S Holzminden<br />
Prof. Dr. Klaus Below<br />
Studiendekanin S Hildesheim<br />
Prof. Dr. Maria Busche-Baumann<br />
Studiendekanin Medizinalfachberufe<br />
Dipl.-Päd. Annette Probst<br />
Dekanatsgeschäftsführerin<br />
Dipl.-Soz. Ulrike Teichmann<br />
Studienangebot<br />
Das Studienangebot der Fakultät Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit umfasst vier grundständige Studiengänge<br />
sowie einen Weiterbildungsstudiengang:<br />
1. Diplomstudiengang Soziale Arbeit –<br />
Vollzeitstudium Hildesheim<br />
2. Diplomstudiengang Soziale Arbeit –<br />
Berufsbegleitendes Studium für Fachkräfte im<br />
Sozialwesen Hildesheim<br />
3. Diplomstudiengang Soziale Arbeit –<br />
Vollzeitstudium Holzminden<br />
4. Bachelor-Studiengang für Absolventinnen und<br />
Absolventen der Fachberufe Logopädie, Physiotherapie<br />
und Ergotherapie Hildesheim
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
5. Weiterbildungsstudiengang<br />
Sozialmanagement für Führungskräfte im Sozialwesen<br />
Hildesheim<br />
Studiengänge Soziale Arbeit in Hildesheim<br />
und Holzminden<br />
Die Studiengänge Soziale Arbeit beziehen sich auf<br />
das Feld der professionellen Sozialen Arbeit mit der<br />
gleichrangigen Verbindung von Sozialpädagogik<br />
und Sozialarbeit.<br />
Das Studium verbindet Hochschulstudium mit<br />
Praxisphasen und erfordert die Verknüpfung der<br />
Verantwortungsbereiche von Hochschule und<br />
Trägern der beruflichen Praxis für die Ausbildung<br />
der Studierenden.<br />
Die Studierenden erlangen im Studium die<br />
Kompetenz, in dem komplexen Berufsfeld<br />
Sozialarbeit/Sozialpädagogik professionell zu<br />
handeln. Dazu gehört, dass sie wissenschaftlich,<br />
problem- und handlungsorientiert, fächerübergreifend,<br />
selbständig und im Team zu arbeiten lernen<br />
und gegenüber den betroffenen Menschen und der<br />
Gesellschaft Verantwortung für ihr Handeln<br />
übernehmen.<br />
Gleichrangige und aufeinander bezogene Ziele sind<br />
die Befähigung zum wissenschaftlichen Denken und<br />
Arbeiten sowie der Erwerb zentraler Handlungs- und<br />
Kommunikationskompetenzen (Disziplinbezug und<br />
Professionsbezug).
Das Studium orientiert sich an folgenden Schlüsselkompetenzen<br />
für eine zeitgemäße Soziale Arbeit:<br />
Systematisches Denken, Verantwortungsbewusstsein,<br />
Flexibilität, Kreativität, kulturelle Aufgeschlossenheit,<br />
Konfliktfähigkeit und Selbstmanagement.<br />
Die Selbstständigkeit hat als Ziel des Studiums ein<br />
besonderes Gewicht; sie trägt dazu bei, dass es<br />
später im Beruf leicht fällt, auf die sich laufend<br />
ändernden Anforderungen an die Soziale Arbeit<br />
flexibel zu reagieren. Als Prinzip des Studierens<br />
stellt die Selbständigkeit hohe Anforderungen an<br />
Studierende; selbständiges Studieren will erst<br />
erlernt sein. Das Mentorenprogramm bietet einen<br />
Rahmen für Studierende diese Fähigkeit auszubilden;<br />
in festen Gruppen, die drei Semester<br />
zusammen bleiben, wird u. a. die Fähigkeit zum<br />
selbstgesteuerten Lernen vermittelt.<br />
Studienstruktur<br />
Die Studienzeit beträgt einschließlich des<br />
Berufspraktikums acht Semester (Regelstudienzeit).<br />
Das Studium gliedert sich in<br />
1. das Grundstudium (drei Semester), das mit der<br />
Diplomvorprüfung abschließt,<br />
2. das Hauptstudium (drei Semester), das mit der<br />
Diplomprüfung zum Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagogen<br />
(FH) abschließt und<br />
3. das Berufspraktikum (zwei Semester), das mit<br />
einem Kolloquium zur staatlichen Anerkennung<br />
abschließt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Lehr- und Studienbereiche<br />
Die wissenschaftliche Basis wird fächerübergreifend<br />
in vier Lehr- und Studienbereichen vermittelt:<br />
1. Soziale Arbeit als Wissenschaft und Profession<br />
2. Rechtliche und administrative Grundlagen der<br />
Sozialen Arbeit<br />
3. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische<br />
Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
4. Pädagogische, psychologische und soziologische<br />
Grundlagen der Sozialen Arbeit<br />
Zentrale Wissensbestände einzelner Disziplinen<br />
werden aufeinander bezogen gelehrt. Dies gilt<br />
insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der<br />
theoretischen und methodischen Grundlagen einer<br />
„Sozialarbeitswissenschaft“ als „integrierte<br />
Praxiswissenschaft“.<br />
Handlungsformen in der Sozialen Arbeit:<br />
Der Studienbereich „Handlungsformen in der<br />
Sozialen Arbeit“, in welchem als einzigem<br />
Studierende des Grund- und Hauptstudiums<br />
gemeinsam studieren, umfasst Handlungsverfahren,<br />
-konzepte und -methoden der Sozialen Arbeit:<br />
– Kulturelle und pädagogische Handlungsformen<br />
– Beratung in der Sozialen Arbeit<br />
– Handlungsformen in Organisationen und im<br />
Gemeinwesen<br />
In diesem Studienbereich wird die kognitive und<br />
emotionale Basis für eine professionelle Haltung<br />
ausgebaut und ein Repertoire an zentralen<br />
Handlungs- und Kommunikationskompetenzen<br />
erworben.
Studienschwerpunkte in Hildesheim sind:<br />
– Sonderpädagogik und Rehabilitation Behinderter<br />
– Soziale Arbeit mit Erwachsenen<br />
– Soziale Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und<br />
Familien<br />
Sie ermöglichen die exemplarische Vertiefung von<br />
theoretischen Kenntnissen und Handlungskompetenzen.<br />
In Projekten wird sozialpädagogisches<br />
Handeln erprobt und werden berufsbezogene<br />
Fähigkeiten weiterentwickelt.<br />
Die Studienbausteine in Hildesheim<br />
– Gesundheitsförderung,<br />
– Interkulturelle und internationale Soziale Arbeit,<br />
– Bildung und Soziale Arbeit<br />
sind Hildesheimer Spezifika und greifen neue<br />
Qualifizierungsanforderungen aus der Theorie und<br />
Praxis der Sozialen Arbeit auf. Sie bieten den<br />
Studierenden eine Alternative zur Wahl eines<br />
Schwerpunktes, tragen zur Profilbildung des<br />
Studiengangs bei und ermöglichen den Studierenden<br />
eine wissenschaftliche und berufliche<br />
Profilierung.<br />
Studienschwerpunkte in Holzminden sind:<br />
1. Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen<br />
2. Soziale Arbeit mit Erwachsenen<br />
Die beiden Schwerpunkte werden unter Einbeziehung<br />
von sozialraumorientierten (gemeinwesenorientierten)<br />
Ansätzen der Sozialen Arbeit<br />
konzipiert, wobei insbesondere bei den Praxis- und<br />
Projektteilen des Studiums Arbeitsfelder des
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
ländlichen und klein-/mittel-städtischen Bereichs<br />
überwiegen werden.<br />
Die Sozialraumorientierung des Studienangebots<br />
enthält für den Standort Holzminden besonders<br />
gute Möglichkeiten des fächerübergreifenden<br />
Studiums und gemeinsamer Projekte, da es mit den<br />
bereits vorhandenen Studienangeboten des<br />
Bauingenieurwesens, der Architektur und des<br />
Immobilienmanagements gemeinsame Schnittflächen<br />
gibt.<br />
Insbesondere für Weiterbildungsangebote und<br />
Kooperationsveranstaltungen mit Trägern der<br />
Sozialen Arbeit bieten sich durch das in Holzminden<br />
bereits bestehende Institut für berufsbegleitende<br />
Weiterbildung (Weiterbildungszentrum) sehr gute<br />
Voraussetzungen.<br />
„Europa-Zertifikat“<br />
Im Rahmen der grundständigen Studiengänge<br />
„Soziale Arbeit“ kann ein „Europa-Zertifikat“<br />
erworben werden. Dieses belegt, dass ein Studium<br />
mit einer Orientierung an europäischer Sozialarbeit<br />
erfolgreich absolviert wurde. Das Zertifikat wird im<br />
Rahmen der Kooperationen im Sokrates-Erasmus-<br />
Programm zusammen mit Partnerhochschulen der<br />
FH vergeben.<br />
Studiengang Soziale Arbeit –<br />
Berufsbegleitendes Studium Hildesheim<br />
Ergänzende Hinweise<br />
Der berufsbegleitende Studiengang ist ein Angebot<br />
– für Fachkräfte im Sozialwesen, die sich beruflich<br />
und wissenschaftlich weiter qualifizieren wollen,
– für Träger und Einrichtungen der Sozialen Arbeit,<br />
die das Angebot zur Personalentwicklung ihrer<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen wollen.<br />
Der Studiengang ist eng angelehnt an den bereits<br />
bestehenden Vollzeitstudiengang und führt zum<br />
gleichen Abschluss, geht aber speziell auf die<br />
Probleme von Menschen ein, die parallel zu ihrer<br />
Arbeit studieren, und ermöglicht in besonderer<br />
Weise Kooperationen zwischen Theorie und Praxis.<br />
Studiengang Soziale Arbeit Holzminden<br />
Ergänzende Hinweise<br />
Seit dem Wintersemester 2003/2004 bietet die<br />
Fachhochschule am Standort Holzminden erstmals<br />
Studienplätze zum Studium der „Sozialen Arbeit“<br />
mit dem Abschluss zur Diplom-Sozialarbeiterin/<br />
Sozialpädagogin (FH) bzw. zum Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge<br />
(FH) an. Die Aufnahme von<br />
Erstsemestern erfolgt immer zum Wintersemester.<br />
Ab diesem Semester werden fünf Professorinnen<br />
und Professoren, zwei Lehrkräfte für besondere<br />
Aufgaben und fünf Lehrbeauftragte mit der Lehre<br />
beginnen und die weitere Gestaltung des Studienangebots<br />
planen. Eine zentrale Komponente des<br />
Studienangebots ist die Kooperation und Verflechtung<br />
mit den öffentlichen und freien Trägern der<br />
Sozialen Arbeit in der Region, die auch die Partner<br />
bei Studienprojekten sein sollen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Bachelor-Studiengang für Absolventinnen und<br />
Absolventen der Fachberufe Logopädie,<br />
Physiotherapie und Ergotherapie<br />
Ausbildungs- und Studienziel<br />
In der Akkreditierungsphase befindet sich der erste<br />
grundständige Bachelorstudiengang (B. Sc.) für<br />
Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie in<br />
Deutschland an. Damit erhalten die Berufsangehörigen<br />
dieser Berufe erstmals die Möglichkeit den<br />
akademischen Grad eines Bachelors zu erwerben.<br />
Der Bachelorabschluss für Physiotherapeutinnen/<br />
Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten<br />
und Logopädinnen/Logopäden bedeutet<br />
den Anschluss Deutschlands an eine seit langem<br />
bestehende Ausbildungstradition dieser Berufe in<br />
vielen Ländern Europas und darüber hinaus und<br />
führt zu einem international anerkannten Berufsabschluss.<br />
Soll der Studiengang einerseits den längst<br />
überfälligen Anschluss an internationale Ausbildungsstandards<br />
gewährleisten, so verfolgt die<br />
Hochschulausbildung andererseits das Ziel, die<br />
Absolventinnen und Absolventen auf veränderte<br />
und neue Anforderungen der Praxis im Gesundheitswesen<br />
vorzubereiten. An dieser Stelle sei beispielhaft<br />
auf die demographischen und epidemiologischen<br />
Veränderungen der Gesellschaft verwiesen,<br />
vor deren Hintergrund sich die Rolle der Berufsangehörigen<br />
der Gesundheitsberufe verändert. Das<br />
Postulat nach mehr Bedarfsgerechtigkeit und<br />
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat unter
anderem eine höhere Sensibilität als bisher für<br />
multiprofessionelle Perspektiven zur gemeinschaftlichen<br />
Erstellung von Gesundheit zur Folge. Der<br />
Studiengang trägt mit seinem integrierten Angebot<br />
für Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten,<br />
Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten und<br />
Logopädinnen/Logopäden dazu bei, diese<br />
Perspektiven einnehmen zu können. Die Professionalität<br />
der Berufsangehörigen soll weiterentwickelt<br />
und begründet werden. Das vorhandene Wissen<br />
systematisiert und ausgebaut werden. Die Fakultät<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit der Hochschule für<br />
angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim<br />
richtet ihr Studienangebot auch mit dem Blick auf<br />
die aktuellen Erfordernisse des Arbeitsmarktes aus.<br />
Studienanforderung<br />
Der Studiengang ist ein grundständiges (sechssemestriges)<br />
Angebot und wird in Kooperation mit den<br />
Berufsfachschulen für Physiotherapie (Universität<br />
Göttingen, Annastift Hannover), Ergotherapie (Celle,<br />
Annastift Hannover) und Logopädie (Universität<br />
Göttingen) angeboten.<br />
Für Absolventen und Absolventinnen anderer<br />
Berufsfachschulen, die mindestens eine Fachhochschulreife<br />
nachweisen können, besteht die<br />
Möglichkeit, nach einer erfolgreich absolvierten<br />
Einstufungsprüfung, in das 4. Semester immatrikuliert<br />
zu werden.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Studienstruktur<br />
Der Studienaufbau ist durch die Herausbildung von<br />
sowohl fachlichen als auch überfachlichen<br />
Kompetenzen gekennzeichnet. Die in der Berufsausbildung<br />
erworbenen Fachkompetenzen werden<br />
reflektiert und erweitert und um überfachliche<br />
Kompetenzen wie Gesundheitswissenschaften,<br />
Betriebswirtschaft und Medizinrecht vervollständigt.<br />
Als Folie für die Kompetenzerweiterung der<br />
Studierenden dient die Einübung einer wissenschaftlichen<br />
Herangehensweise und Haltung an<br />
aktuelle Themenkomplexe aus der Praxis der<br />
Studierenden. Am Ende des Studiums steht das<br />
Verfassen einer Bachelorarbeit, in der die<br />
Studierenden nachweisen sollen, dass sie einen<br />
Themenkomplex eigenständig und den Kriterien des<br />
wissenschaftlichen Arbeitens gemäß erfasst und<br />
durchdrungen haben.<br />
Die Lehrenden kommen aus verschiedenen<br />
wissenschaftlichen Disziplinen und Berufen. Sie<br />
haben sich mit ihrer Einstellung an der Fakultät<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit zu Lehre und<br />
Forschung der unterschiedlichen Grundlagen und<br />
Aspekte therapeutischen Handelns in den<br />
Gesundheitsberufen verpflichtet.<br />
Die Einbindung der bisher gemachten Erfahrungen<br />
der Studierenden (in Berufsausbildung, Praktika<br />
und Berufstätigkeit) schafft in besonderer Weise<br />
die Möglichkeit, berufsrelevante Themen in Lehre<br />
und Forschung präsent zu machen und an der<br />
wissenschaftlichen, persönlichen und beruflichen<br />
Sozialisation der Studierenden mitzuwirken.
Lehre bedeutet in der Fakultät Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit vor allem, dass die Lehrenden die<br />
Studierenden in ihrem eigenen aktiven Studienprozess<br />
unterstützen. Dazu gehören das Anleiten zum<br />
Selbststudium, die Vermittlung von Wissen,<br />
forschendes Lehren und Lernen in den berufsrelevanten<br />
Themen, eine Haltung der Selbstreflexion<br />
und Selbstwahrnehmung sowie multiprofessionelles<br />
Denken und Arbeiten.<br />
Das Lehrangebot im Studiengang besteht aus<br />
Lehrveranstaltungen zu den fachspezifischen<br />
Inhalten in den Bereichen Ergotherapie, Logopädie<br />
und Physiotherapie. Weitere Lehrveranstaltungen<br />
erfolgen in den Fächern Gesundheitswissenschaften<br />
und Betriebswirtschaftslehre sowie in den<br />
Bereichen wissenschaftliches Arbeiten und<br />
Schlüsselqualifikationen. Darüber hinaus besteht<br />
ein Wahlangebot.<br />
Die Fakultät entwickelt und fördert internationale<br />
Beziehungen in Lehre, Forschung und Praxis der<br />
Gesundheitsberufe und unterstützt den Austausch<br />
von Studierenden und Lehrenden. Durch die<br />
geplante Einführung von Modulen und ECTS-<br />
Punkten strebt sie im Sinne des Bologna-Abkommens<br />
von 1999 eine Kompatibilität des Studienganges<br />
mit den bestehenden europäischen und<br />
internationalen Studienabschlüssen an.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Weiterbildung<br />
Weiterbildungsstudiengang Sozialmanagement<br />
für Fachkräfte im Sozialwesen<br />
Dieser Weiterbildungsstudiengang ist ein Kooperationsprojekt<br />
der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
mit dem Caritasverband der<br />
Diözese Hildesheim e. V. Der Studiengang umfasst<br />
zunächst 25 Studienplätze pro Jahr. Er richtet sich<br />
an Führungskräfte – bzw. zukünftige Führungskräfte<br />
– im Sozialwesen. Ein spezifisches Charakteristikum<br />
des Weiterbildungsstudiengangs ist die<br />
fachliche Qualifikation von Führungskräften in<br />
Korrelation mit einer einschlägigen sozialpädagogischen<br />
Berufstätigkeit. Primäre Zielgruppe des<br />
neuen Studiengangs sind diplomierte Sozialpädagoginnen/Sozialarbeiterinnen<br />
bzw. Sozialpädagogen/Sozialarbeiter<br />
und geprüfte Sozialwirtinnen/Sozialwirte<br />
der Fachakademie für Sozialmanagement.<br />
Der Weiterbildungsstudiengang Sozialmanagement<br />
soll die Studierenden befähigen,<br />
– die Gesamtverantwortung einer sozialen Einrichtung<br />
entsprechend ihren betriebswirtschaftlichen<br />
und sozialpädagogischen Anforderungen<br />
zu übernehmen,<br />
– Phänomene und Probleme der Führung in sozialen<br />
Organisationen ganzheitlich und in ihrer Vernetzung<br />
zu analysieren, Lösungen zu konzipieren<br />
und in Kooperation mit den Mitarbeitern<br />
umzusetzen,
– berufliche Tätigkeiten auszuüben, die die<br />
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und<br />
Methoden erfordern, im gesellschaftlichen<br />
Leben und in der beruflichen Praxis verantwortungsbewusst,<br />
schöpferisch und kooperativ<br />
zu handeln.<br />
Der Weiterbildungsstudiengang ist für Leitungskräfte<br />
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert,<br />
die in sozialen Einrichtungen der Caritas und<br />
Diakonie sowie der Kommunen tätig sind und<br />
Leitungsverantwortung tragen bzw. übernehmen<br />
wollen.<br />
Berufsbegleitende Weiterbildung zum<br />
Hildesheimer Gesundheitstrainer bzw.<br />
zur Hildesheimer Gesundheitstrainerin<br />
Das Institut für Therapie und Beratung an der FH<br />
HHG bietet Fachleuten im Sozial- und Gesundheitswesen<br />
diese einjährige berufsbegleitende<br />
Weiterbildung an. Ziel dieser Ausbildung ist es,<br />
gesundheitsfördernde Kommunikationsmuster und<br />
die Arbeit mit Gruppen chronisch Kranker zu<br />
erlernen, um chronisch Kranken dabei zu helfen, ihr<br />
Selbstheilungspotential zu nutzen, Heilungsprozesse<br />
zu beschleunigen und sich von unnötigen<br />
Belastungen, negativen Gefühlen und Stress zu<br />
befreien.<br />
Das Hildesheimer Gesundheitstraining ist ein<br />
umfangreiches System für die Beratung von
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Gruppen chronisch Kranker, wurde speziell und<br />
gezielt dafür entwickelt und mehrfach klinisch<br />
getestet. Es gibt spezifische Formen für die<br />
Orthopädie (bei chronischen Rückenerkrankungen),<br />
Onkologie, Allergologie (bei Allergien und Asthma),<br />
Kardiologie und die Prävention.<br />
Forschung<br />
Forschungsprojekte<br />
An der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
werden laufend Forschungsprojekte durchgeführt,<br />
die durch die Fachhochschule, das Niedersächsische<br />
Ministerium für Wissenschaft und Kultur oder<br />
durch andere Drittmittelgeber gefördert werden.<br />
Dies betrifft u. a. folgende Forschungsfelder:<br />
– Berufsfeld- und Arbeitsmarktforschung<br />
– Professionalisierung Sozialer Arbeit<br />
– Migration<br />
– Frauen- und Geschlechterforschung<br />
– Jugend und Gewalt<br />
– Sozialarbeit und Polizei<br />
– Schule und Jugendhilfe<br />
– Analyse sozialpädagogischer Handlungskompetenz<br />
– Mentale Gesundheitsberatung bei Stress und<br />
chronischen Krankheiten (Hildesheimer Gesundheitstraining)<br />
– Ökonomie und Recht sozialer Dienste<br />
– Gesundheitsforschung
Studierende können an Forschungsprojekten<br />
mitwirken und die Bedingungen ihres beruflichen<br />
Handelns wissenschaftlich analysieren. Der Aspekt<br />
der mit der Lehre verknüpften Forschung („forschendes<br />
Lernen“) und die Arbeit mit qualitativen<br />
Forschungsmethoden gewinnen im Studienbereich,<br />
aber auch im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit<br />
zunehmend an Bedeutung. Die neue Studienstruktur<br />
berücksichtigt dies in besonderer Weise.<br />
Einrichtung und Ausstattung<br />
Das „Institut für Studium und Praxis der Sozialen<br />
Arbeit“ erbringt Dienstleistungen für die Studiengänge<br />
Soziale Arbeit an der Schnittstelle von Lehre,<br />
Studium und Praxis. Seine Arbeit betrifft insbesondere<br />
das Studium neben dem Beruf, Praktika und<br />
Projekte im Studium, das Berufspraktikum, die<br />
Professionsforschung, Praxisevaluation und<br />
arbeitsfeldbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Dazu<br />
kommen noch entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen.<br />
Wichtig für Lehre und Forschung sind die Dokumentations-<br />
und Informationsstelle zur Geschichte der<br />
Sozialen Arbeit (DIGESA) und die Dokumentationsund<br />
Informationsstelle für „Recht und Ökonomie<br />
Sozialer Arbeit“ (DIRÖSA). Sie informieren und<br />
beraten Lehrende und Studierende bei dem<br />
Vorhaben interdisziplinäre Zusammenhänge<br />
aufzugreifen, sie zu analysieren und für gegenwärtige<br />
Fragestellungen nutzbar zu machen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Das „Institut für Therapie und Beratung an der FH<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen e. V.“ hat das<br />
Ziel, Innovationen auf der Basis neuer Forschungsergebnisse<br />
in die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit<br />
und des Gesundheitswesens zu tragen und fördert<br />
damit die Wahrnehmung der Fakultätsaufgaben. Es<br />
unterstützt Forschungsvorhaben und bildet<br />
berufsbegleitend aus. Schwerpunkt ist dabei<br />
momentan die einjährige berufsbegleitende Ausbildung<br />
bezüglich des Hildesheimer Gesundheitstrainings.<br />
Studienerfolge<br />
Im Studienjahr 2002/2003 (Wintersemester<br />
2002/2003 und Sommersemester 2003) hat<br />
wiederum eine große Zahl von Studierenden in den<br />
jeweiligen Studiengängen ihr Studium erfolgreich<br />
abgeschlossen. In der folgenden Tafel sind diese<br />
Absolventen nach ihrer Studiendauer aufgeschlüsselt:<br />
In den grundständigen Studiengängen Soziale<br />
Arbeit haben 155 Studierende ihr Studium wie folgt<br />
abgeschlossen:<br />
Studiendauer<br />
Absolventen<br />
5<br />
1<br />
6<br />
43<br />
Studienjahr 2002/2003<br />
7<br />
44<br />
8<br />
31<br />
9<br />
13<br />
10<br />
6<br />
> 10<br />
17
Im grundständigen Studiengang Medizinalfachberufe<br />
haben 66 Studierende ihr Studium wie folgt<br />
abgeschlossen:<br />
Studiendauer<br />
Absolventen<br />
Studienjahr 2002/2003<br />
Im Weiterbildungsstudiengang Sozialmanagement<br />
haben 27 Studierende ihr Studium wie folgt<br />
abgeschlossen:<br />
Studiendauer<br />
Absolventen<br />
5<br />
0<br />
3<br />
15<br />
6<br />
61<br />
4<br />
12<br />
Promotionsvorhaben<br />
In Zusammenarbeit mit der Universität Hildesheim<br />
laufen derzeit an der Fakultät in den Studiengängen<br />
Soziale Arbeit Hildesheim – im Rahmen von<br />
Assistentinnenstellen und Assistentenstellen – drei<br />
Promotionsvorhaben. Die Promotionsassistentinnen<br />
nehmen teil an mehreren Forschungs- und<br />
Entwicklungsprojekten der Fakultät und an<br />
Qualifizierungsangeboten verschiedener Hochschulen.<br />
Schon jetzt zeigt sich, dass die Promotionsvorhaben<br />
ein wichtiges Moment der inhaltlichen Weiterentwicklung<br />
der Forschung und Lehre an der Fakultät<br />
sind. Längerfristig muss es darum gehen, Zeit- und<br />
7<br />
5<br />
8<br />
0<br />
9<br />
0<br />
Studienjahr 2002/2003<br />
5<br />
–<br />
6<br />
–<br />
7<br />
–<br />
10<br />
0<br />
8<br />
–<br />
> 10<br />
0<br />
> 8<br />
–
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Mittelbaustellen zu etablieren, die eine Forschungsund<br />
Entwicklungskontinuität herstellen.<br />
Frauenförderung<br />
Als Bestandteil des Hochschulentwicklungsplanes<br />
der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen ist das Ziel des Frauenförderplans der<br />
Fakultät und seines impliziten Maßnahmenkatalogs,<br />
die Gleichstellung von Frauen und Männern an<br />
der Fakultät, durchzusetzen.<br />
Die Frauenförderung betrifft alle Entscheidungen<br />
einer Fakultät über seine Aufgaben in Lehre und<br />
Forschung, in Ausbildung und Nachwuchsförderung,<br />
in Studien- und Rekrutierungsangelegenheiten, in<br />
der Haushalts-, Struktur- und Entwicklungsplanung.<br />
Deshalb muss gewährleistet sein, dass Frauen und<br />
Männer die gleichen Chancen haben, im gleichen<br />
Umfang und mit gleichen Erfolgsaussichten Einfluss<br />
auf alle Entscheidungsebenen der Fakultät zu<br />
nehmen. Der Frauenförderplan wurde im März 2003<br />
fortgeschrieben und dessen Maßnahmenkatalog<br />
modifiziert.<br />
Um gerade auch in der Lehre Aktivitäten im Bereich<br />
von Frauenforschung und Frauenstudium zu fördern,<br />
werden Lehrveranstaltungen mit frauen- und/oder<br />
geschlechtsspezifischen Inhalten im kommentierten<br />
Vorlesungsverzeichnis gesondert ausgewiesen.
Mitwirkung in Gremien<br />
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind neben<br />
den Gremien der Selbstverwaltung in regionale und<br />
überregionale Aktivitäten eingebunden, nehmen an<br />
der Entwicklung der Profession und wissenschaftlichen<br />
Disziplin „Soziale Arbeit“ (Sozialarbeit und<br />
Sozialpädagogik) konstruktiv teil, arbeiten und<br />
engagieren sich in Organisationen der sozialen<br />
Arbeit.<br />
Kooperationen mit anderen Hochschulen<br />
Kooperationsvereinbarungen bestehen mit der<br />
Universität Hildesheim, dem Fachbereich Polizei der<br />
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in<br />
Hildesheim, dem Caritasverband der Diözese<br />
Hildesheim e. V. sowie verschiedenen regionalen<br />
sozialen Einrichtungen (Projektkooperationen).<br />
Internationale Kooperationen<br />
Im Rahmen des sog. ERASMUS-Konsortiums der<br />
Studiengänge S Hildesheim mit Hochschulen in<br />
Helsinki, Finnland (3 Studienplätze), Manchester,<br />
Großbritannien (3 Studienplätze), Amsterdam,<br />
Niederlande (3 Studienplätze); Gent, Belgien<br />
(3 Studienplätze); Ljubljana, Slowenien (2 Studienplätze),<br />
Madrid, Spanien (2 Studienplätze) sowie<br />
Szombathely, Ungarn (3 Studienplätze) können<br />
insgesamt 18 Studienplätze von Studierenden der<br />
Fakultät belegt werden.<br />
Seit dem Wintersemester 1998/1999 haben 35<br />
Studierende die Chance eines Auslandssemesters
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
wahrgenommen. Hinzu kommt etwa die gleiche Zahl<br />
die Praktika (auch außerhalb der Erasmusvereinbarungen)<br />
absolvierte. Für das im WS 98/99 eingeführte<br />
Europazertifikat sind zur Zeit 104 Studierende<br />
angemeldet. 14 Studierende haben es bisher<br />
erworben.<br />
Sechs bis zehn Studierende von den Partnerhochschulen<br />
kommen jährlich nach Hildesheim,<br />
überwiegend aus Finnland und Ungarn. Das größte<br />
Hindernis für ausländische Studierende ist die<br />
fehlende Sprachkompetenz.<br />
Im Rahmen der „Study visits of short duration“<br />
lernen jährlich etwa 40 Studierende Aspekte der<br />
Praxis und des Studiums der Sozialen Arbeit durch<br />
Aufenthalte von acht bis zehn Tagen bei den<br />
Partnerhochschulen kennen. Die entsprechenden<br />
Gruppen der Partnerhochschulen werden bei ihren<br />
Gegenbesuchen in das Studium und die Praxis der<br />
Sozialen Arbeit in Deutschland eingeführt.<br />
Im Januar 2003 fand die erste gemeinsame<br />
Veranstaltung des Konsortiums der Partnerhochschulen<br />
in Hildesheim mit etwa vierzig Studierenden<br />
und Lehrenden aus sechs Ländern statt („First<br />
European Seminar on Social Work Problems“). Die<br />
Veranstaltungsreihe wurde im April 2003 in<br />
Amsterdam fortgesetzt. Jeweils mit wechselndem<br />
Tagungsort soll diese Reihe in den nächsten Jahren<br />
fortgesetzt werden.
Schließlich gibt es eine Kooperation mit der<br />
Sozialakademie in Salzburg (Österreich) und<br />
Fakultät Gesundheitswissenschaften der Universität<br />
Pécz.<br />
Es werden Curricula zur freizeitkulturellen Erziehung<br />
und Bildung entwickelt. Dies betrifft Hochschulen in<br />
Belgien, Spanien, den Niederlanden, Schweden,<br />
Finnland, Österreich und Deutschland. Mit Israel,<br />
Spanien und der Türkei bestehen Projekte der<br />
Forschungskooperation im Bereich „Jugend und<br />
Gewalt“. Im Rahmen des Studienschwerpunktes<br />
„Interkulturelle und Internationale Soziale Arbeit“<br />
besteht zum Thema „Kulturelle und sozialstrukturelle<br />
Konsequenzen der Migration“ eine Zusammenarbeit<br />
mit der Universität Mersin (Türkei).<br />
Zunehmend absolvieren Studierende Praktika und<br />
Studienteile im Ausland.<br />
Studierende Eltern Kinder (StudElKi)<br />
Studierende, die Kinder haben oder bekommen,<br />
stehen vor dem Problem, Studium, Erziehung und<br />
Existenzsicherung in Einklang zu bringen. Diese<br />
Situation verursacht häufig große Probleme, nicht<br />
selten ist der Abbruch des Studiums für ein<br />
Elternteil die Folge. Die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
hat es sich zum Ziel<br />
gesetzt, Bedingungen zu schaffen, die Studierenden<br />
mit Kind diesen Spagat erleichtern.<br />
Als ersten Schritt zur Umsetzung hat das Studentenwerk<br />
Braunschweig eine Krippe eingerichtet, die
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
fachlich und personell durch das Projekt StudElKi<br />
der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
unterstützt wird. StudElKi bietet eine fachlich<br />
qualifizierte Betreuung für Kleinstkinder im Alter<br />
von ein bis drei Jahren. Das Angebot richtet sich an<br />
studierende Eltern aller Fakultäten der Fachhochschule.<br />
Durch StudElKi soll garantiert werden, dass kein/e<br />
Studierende/r wegen der Geburt eines Kindes<br />
ihr/sein Studium aufgeben oder für längere Zeit<br />
unterbrechen muss. Zum anderen bereichert<br />
StudElKi aber auch das Lehrangebot in den<br />
Studiengängen Soziale Arbeit Hildesheim. StudElKi<br />
bietet Studierenden die attraktive Möglichkeit,<br />
einen Teil ihres Studiums und ihrer Fachpraxis<br />
während des Studiums in dieser Einrichtung zu<br />
absolvieren. Für Studierende mit Interesse an<br />
Kinder- und Jugendarbeit bzw. Elementarpädagogik<br />
ist StudElKi eine mögliche Brücke zur künftigen<br />
Berufspraxis.<br />
Im Rahmen des Audits Familiengerechte Hochschule<br />
entwickelt die Fakultät derzeit in Zusammenarbeit<br />
mit der Hochschulleitung ein tragfähiges Konzept,<br />
die Kinderbetreuung, über die Gruppe der<br />
Studierenden hinaus, allen Mitgliedern der<br />
Fachhochschule anbieten zu können.<br />
PC-Pool<br />
Der in 2001 eingerichtete PC-Pool, welcher den<br />
Studierenden und Lehrenden zur Verfügung steht,<br />
findet regeren Zuspruch als jemals zuvor. Seit<br />
01. April 2003 arbeitet die Fakultät mit Stud.IP, einer
Kommunikationsplattform für Studierende,<br />
Lehrende und Veranstaltungen.<br />
Der PC-Pool ermöglicht darüber hinaus den<br />
Lehrenden, aber besonders den Studierenden<br />
Internetrecherchen durchzuführen, sozialpädagogische<br />
DV-Programme zu erlernen und anzuwenden,<br />
schriftliche Arbeiten anzufertigen sowie über das<br />
Netz wissenschaftlich zu kommunizieren.<br />
Neuere Entwicklungen<br />
Die Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
durchläuft gegenwärtig eine sehr dynamische<br />
Entwicklungsphase. Die beiden grundständigen<br />
Diplomstudiengänge Soziale Arbeit in Hildesheim –<br />
einer davon berufsbegleitend –, der Bachelorstudiengang<br />
zu den Medizinalfachberufen Logopädie,<br />
Physiotherapie und Ergotherapie sowie der<br />
Weiterbildungsstudiengang Sozialmanagement<br />
wurden im Herbst 2003 durch einen Diplomstudiengang<br />
Soziale Arbeit in Holzminden erweitert. Die<br />
Umwandlung der Diplomstudiengänge in Studiengänge<br />
mit den Abschlüssen Bachelor (B. A.) und<br />
Master (M. A.) ist ebenso für die nächste Zukunft<br />
geplant, wie die Entwicklung neuer Angebote zur<br />
Elementarerziehung, zur Rehabilitation und<br />
Gesundheitsberatung und eines M. A. Studiengangs<br />
für die Medizinalfachberufe.<br />
Berufungs- und Besetzungsverfahren<br />
Die Berufungs- bzw. Besetzungskommissionen für<br />
die Wiederbesetzung von vier Professuren für den<br />
Standort Hildesheim und die Neubesetzung von
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
sieben Professuren und zwei Stellen Lehrkräfte für<br />
besondere Aufgaben (befristet, unbefristet) für den<br />
neuen Standort Holzminden haben ihre Arbeit mit<br />
reger Mitarbeit der Studierenden im Wintersemester<br />
2002/2003 aufgenommen. Bis auf ein zwei Verfahren<br />
in Hildesheim und ein Verfahren in Holzminden<br />
konnten im Berichtszeitraum alle Professuren<br />
besetzt werden.<br />
Evaluation<br />
Im Rahmen der ersten Runde des zweitens Zyklus<br />
einer landesweiten Evaluation der Fächer Sozialpädagogik/Sozialwesen/Sozialarbeit<br />
2002/2003<br />
wurden die Studiengänge Soziale Arbeit/Sozialwesen<br />
und Sozialmanagement im Wintersemester<br />
2002/2003 evaluiert. Kernpunkt der Evaluation<br />
bildete die studentische Befragung zu Lehre und<br />
Studium. Das Gutachten der Peer-Group liegt seit<br />
Ende 2003 vor, die Umsetzung des Gutachtens<br />
erfolgt in 2004.
Fakultät<br />
Wirtschaft<br />
Dekan<br />
Prof. Dr. Dieter Leitmann<br />
Studiendekan<br />
Prof. Dr. Matthias Pletke<br />
Studienangebot<br />
Die Fakultät Wirtschaft hat ihren Lehrbetrieb 1992<br />
aufgenommen und bietet die beiden achtsemestrigen<br />
Studiengänge<br />
– Betriebswirtschaft und<br />
– Krankenversicherung<br />
an, in die jeweils zwei berufspraktische Tätigkeiten<br />
von je einem Semester Dauer integriert sind.<br />
Das letzte CHE-Hochschulranking 2002 empfahl das<br />
Studium der Betriebswirtschaft an sieben<br />
Fachhochschulen, darunter auch an der Fakultät<br />
Wirtschaft in Hildesheim.<br />
Im Studiengang Betriebswirtschaft werden Diplom-<br />
Kaufleute für den nationalen ebenso wie für den<br />
internationalen Arbeitsmarkt und für den privaten<br />
ebenso wie für den öffentlichen Sektor ausgebildet.<br />
Die Profilbildung des Studiengangs zielt auf private<br />
und öffentliche Dienstleistungen, auf Internationalität<br />
und auf die Informationstechnologie.<br />
Zu diesem Zweck wird im Hauptstudium eine Reihe<br />
von Spezialisierungsmöglichkeiten angeboten:
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Wirtschaft<br />
– Controlling<br />
– Consulting<br />
– Finanzierung<br />
– Global Business und Asset Management<br />
– International Business<br />
– Marketing<br />
– Personalwirtschaft<br />
– Prüfungs- und Steuerwesen<br />
– Unternehmensführung<br />
– Wirtschaftsinformatik und e-business<br />
Die Kooperation mit den Fachhochschulen in<br />
Hannover und Wernigerode eröffnet darüber hinaus<br />
zusätzliche Spezialisierungen (z. B. Bankbetriebslehre,<br />
Touristik).<br />
In Verbindung mit den o. g. Spezialisierungen sind<br />
– Wirtschaftsinformatik (modernste betriebswirtschaftliche<br />
Anwendungssoftware)<br />
– Wirtschaftsrecht sowie<br />
– Wirtschaftsenglisch, vertieft durch Auslandsaufenthalte,<br />
wichtige Bestandteile der Ausbildung.<br />
Der Studiengang Krankenversicherung wird im<br />
Rahmen einer engen Kooperation mit der AOK<br />
Niedersachsen realisiert. Der Studiengang<br />
kombiniert Kerninhalte eines betriebswirtschaftlichen<br />
Studiums mit spezifischen krankenversicherungsrelevanten<br />
Inhalten und führt zu einem<br />
betriebswirtschaftlichen Abschluss als „Diplom-<br />
Kauffrau/Kaufmann (FH)“ mit der Fachrichtung<br />
Krankenversicherung. Seit Auslaufen des ersten
Kooperationsvertrages mit der AOKN ist ab dem<br />
Sommersemester 2001 dieser Studiengang für alle<br />
Studienbewerber geöffnet worden. Zulassungsvoraussetzung<br />
ist nunmehr ein sechsmonatiges<br />
Vorpraktikum bei einem Träger der Krankenversicherung.<br />
Trotz intensiver bundesweiter Werbung für<br />
diesen Studiengang blieb die Nachfrage nach<br />
Studienplätzen seitdem unbefriedigend. Deshalb<br />
wurde in 2003 die Zulassung zum Studiengang<br />
Krankenversicherung vom Sommersemester auf das<br />
Wintersemester umgestellt.<br />
Hochschulintern wirkt die Fakultät Wirtschaft an<br />
dem von der Fakultät Bauwesen in Holzminden<br />
angebotenen Ergänzungsstudiengang Internationales<br />
Bauen mit.<br />
Studienerfolg<br />
Im Wintersemester 2003/2004 haben im Studiengang<br />
Betriebswirtschaft 78 und im Studiengang<br />
Krankenversicherung zehn Studienanfänger<br />
begonnen. Insgesamt waren 687 Studierende<br />
(davon 47 Prozent Frauen) im Studiengang Betriebswirtschaft<br />
und 50 Studierende (davon 44 Prozent<br />
Frauen) im Studiengang Krankenversicherung<br />
immatrikuliert. Im Studienjahr 2002/2003 haben im<br />
Studiengang Betriebswirtschaft 102 Studierende ihr<br />
Studium erfolgreich abgeschlossen, im Studiengang<br />
Krankenversicherung waren es 19 Absolventen.<br />
In beiden Studiengängen werden sämtliche<br />
Prüfungsleistungen studienbegleitend, d. h. in enger
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Wirtschaft<br />
Verbindung mit den Vorlesungen erbracht. Dadurch<br />
können die Studierenden ihr Studium in der<br />
Regelstudienzeit von acht Semestern erfolgreich<br />
abschließen. Im Studiengang Betriebswirtschaft<br />
haben ca. 70 Prozent aller Studierenden ihr<br />
Vordiplom nach dem vierten Fachsemester<br />
abgeschlossen, 28 Prozent der Studierenden der<br />
Betriebswirtschaft beenden in der Regelstudienzeit<br />
erfolgreich ihr Studium, im Durchschnitt erhalten sie<br />
ihr Diplom nach knapp neun Semestern. Die<br />
Studierenden der Krankenversicherung erreichen ihr<br />
Diplom im Durchschnitt nach acht Semestern.<br />
Besondere Aktivitäten<br />
Die Fakultät setzte auch im Jahr 2003 ihre<br />
Vortragsreihe „Brücke zur Praxis“ mit sechs<br />
Veranstaltungen fort, in der die Studierenden und<br />
die Öffentlichkeit von renommierten Praktikern<br />
kompetent über aktuelle Fragen im Schnittfeld von<br />
Theorie und Praxis informiert werden. Im Berichtszeitraum<br />
fanden folgende Veranstaltungen statt:<br />
Sommersemester 2003:<br />
– „Gemeinsam mehr erreichen – Kooperatives<br />
Marketing in der Praxis“, Robert Kroth,<br />
Geschäftsführer Gerschau.Kroth.Werbeagentur,<br />
Hannover.<br />
– „Vertrauensarbeitszeit versus Zeitkonto – nur ein<br />
scheinbarer Widerspruch?“, Dr. Andreas Hoff,<br />
Gründungsgesellschafter Dr. Hoff – Wiedinger –<br />
Herrmann, Berlin.
– „Deutsche Messe goes global“, Ernst Raue,<br />
Vorstandsmitglied Deutsche Messe AG,<br />
Hannover.<br />
Wintersemester 2003/2004:<br />
– „HLX – eine Low-Cost Airline im Aufwind“,<br />
Wolfgang Kurth, Chief Executive Officer, Hapag-<br />
Lloyd-Express, Hannover-Langenhagen<br />
– „Integrierte Planungsrechnung als Bestandteil<br />
des betrieblichen Rechnungswesens – Pflicht<br />
oder Kür?“, Mario Brunow, Geschäftsführung<br />
Econ Controlling GmbH & Co. Unternehmensberatung,<br />
Hannover<br />
– „HR als Service Center“, Hans-Peter Günter, Vice<br />
President Payroll Serivices, T-Systems International<br />
GmbH, Frankfurt/M.<br />
Die Fakultät ist am SOKRATES-Programm beteiligt,<br />
das von der Europäischen Union gefördert wird. Er<br />
steht in Verbindung zu ausländischen Hochschulen,<br />
an denen Studierende des Fachbereichs Auslandssemester<br />
absolvieren können. Im Austausch<br />
besuchen Studierende der Partnerhochschulen den<br />
Fachbereich Wirtschaft in Hildesheim. Kooperationspartner<br />
im Berichtszeitraum waren:<br />
– Jönköping University, Schweden<br />
– IUT de Périgueux, Bordeaux, Frankreich<br />
– Häme Polytechnic, Finnland<br />
– Kymenlaakson Polytechnic, Kotka, Finnland<br />
– Oulu-Rahe Polytechnic, Finnland<br />
– Rovaniemi Polytechnic, Finnland
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Wirtschaft<br />
– Hogeschool Drenthe, Emmen, Niederlande<br />
– Universidad de Alicante, Spanien<br />
– Institute of Technology, Carlow, Irland<br />
Eine Hochschulpartnerschaft besteht zusätzlich mit<br />
der University of Pecs, Ungarn.<br />
Im Studienjahr 2002/2003 absolvierten 27<br />
Hildesheimer Studierende ein Auslandssemester an<br />
unseren Partnerhochschulen. Im selben Zeitraum<br />
waren neun ausländische Studierende an der<br />
Fakultät Wirtschaft für ein Semester oder ein<br />
Studienjahr immatrikuliert.<br />
Im Rahmen von Staff-Mobility-Programmen waren<br />
im Berichtszeitraum vier Lehrende der Fakultät im<br />
Ausland tätig.<br />
Kooperationen mit der Praxis<br />
Ein dichtes Netz an Praxiskontakten in Deutschland<br />
und Großbritannien hat Prof. Dr. Schütz im Rahmen<br />
seiner kontinuierlichen Forschungsarbeiten auf dem<br />
Gebiet der „Neuen Berufe in Marketing und<br />
Vertrieb“ geknüpft. Seine Buchpublikation zum<br />
Thema „Grabenkämpfe im Management“ hat in der<br />
Fachöffentlichkeit große Resonanz gefunden.<br />
Herr Prof. Dr. Buchholz engagiert sich auf dem<br />
Gebiet des Wissenstransfers zwischen Hochschule<br />
und Praxis auf regional-ökonomischem Gebiet im<br />
Hinblick auf kommunale Institutionen.
Exkursionen<br />
Studentische Exkursionen (Besuche von Firmen und<br />
Institutionen) finden an der Fakultät regelmäßig<br />
während der Projektwoche sowie im Kontext von<br />
Lehrveranstaltungen, vor allem in den Fächern<br />
Marketing und Personalwirtschaft, statt.<br />
Neuere Entwicklungen<br />
Die Fakultät hatte ein Konzept für einen auslandsbezogenen<br />
Studiengang entwickelt. Dieser<br />
Studiengang Internationale Betriebswirtschaft sollte<br />
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingeführt werden.<br />
Eine erste Professur „Internationales Management“<br />
war ausgeschrieben, das Berufungsverfahren wurde<br />
vom Präsidium aufgehoben und die Stelle wurde<br />
gestrichen.<br />
Herr Prof. Dr. Schäfer (Allg. Betriebswirtschaftslehre/<br />
Finanzierung) hat zum Wintersemester 2003/2004<br />
den Ruf auf eine Professur C 3 an der FH Nordhausen<br />
angenommen. Das Wiederbesetzungsverfahren<br />
der Professur Allg. Betriebswirtschaftslehre/Steuern<br />
wurde vom Präsidium aufgehoben, die Stelle wurde<br />
gestrichen. Die unbesetzten Professuren „Finanzierung“<br />
und „Krankenversicherungsmanagement“<br />
wurden ebenfalls gestrichen. Im Rahmen des<br />
Hochschuloptimierungskonzeptes des Landes<br />
Niedersachsen wurde die Schließung der Fakultät<br />
Wirtschaft verfügt. Somit wurden zum Wintersemester<br />
2003/2004 letztmalig Studierende in beiden<br />
Studiengängen aufgenommen.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Fakultät Wirtschaft<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Im Wintersemester 2002/2003 lehrten am<br />
Fachbereich Wirtschaft zwölf Professorinnen und<br />
Professoren sowie drei Lehrkräfte für besondere<br />
Aufgaben (Englisch). Zwei externe Dozenten waren<br />
jeweils auf einer Vertretungsprofessur tätig.<br />
Im technischen und Verwaltungsdienst sind fünf<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Berichte der Zentralen Einrichtungen<br />
Akademisches<br />
Auslandsamt<br />
Leitung<br />
Dr. Sylvia Korz<br />
Aufgabenfeld<br />
Das Akademische Auslandsamt (AAA) bietet<br />
vielfältige Serviceleistungen im Bereich Internationalisierung<br />
der Hochschule: angefangen von der<br />
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen ausländischer<br />
Studienbewerber/innen, Betreuungskonzepten<br />
für internationale Studierende, Beratung und<br />
Information deutscher Studierender bei der<br />
Durchführung von Auslandsaufenthalten inklusive<br />
der Verwaltung entsprechender Finanzierungsprogramme,<br />
Unterstützung des Lehrpersonals bei<br />
Anbahnung/Durchführung internationaler<br />
Kooperations- und Partnerschaftsvorhaben bis hin<br />
zu Fragen des Sprachenangebots und der Entwicklung<br />
internationaler Studienangebote. Zudem<br />
übernimmt das Auslandsamt Verwaltungsaufgaben,<br />
die den Hochschulen im Rahmen ihrer Internationalisierung<br />
von übergeordneten Organisationen wie<br />
EU-Kommission, DAAD, HRK, MWK etc. übertragen<br />
werden.<br />
Personelle Veränderungen<br />
Die personelle Situation des Auslandsamtes war<br />
auch in 2003 durch Veränderungen gekennzeichnet.<br />
Die AB-Maßnahme „Dokumentation“ von Herrn<br />
Claudio Dell’Aere lief zum 15.02.2003 endgültig aus.<br />
Zum 01. März 2003 wurde die vakante Vollzeit-Stelle<br />
„Sachbearbeitung studentische Angelegenheiten im<br />
AAA“ durch Frau Christina Mazur neu besetzt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Akademisches Auslandsamt<br />
Ebenfalls am 01.03.2003 übernahm Frau Bettina<br />
König am Standort Holzminden im Rahmen einer<br />
halben Stelle die Betreuung der chinesischen<br />
Programmstudierenden aus Hefei. Zu ihrem<br />
Aufgabengebiet zählt ferner die allgemeine<br />
Beratung/Betreuung aller Studierenden in<br />
Holzminden in Fragen mit internationalem Bezug.<br />
Service für deutsche Studierende<br />
Deutsche Studierende können sich während der<br />
Sprechzeiten und nach Vereinbarung sowie in<br />
Informationsveranstaltungen des Auslandsamtes<br />
über Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte<br />
informieren. Dafür steht neben der persönlichen<br />
Beratung auch die Infothek zur Verfügung, wo<br />
Informationen zu Förderprogrammen, Praktika,<br />
Sprachkursen, Partnerhochschulen etc. bereitgestellt<br />
werden.<br />
Auslandsbezogene Informationsveranstaltungen in<br />
den Fakultäten wurden vom Auslandsamt unterstützt.<br />
So fanden im Jahr 2003 Infoveranstaltungen<br />
für die unteren Semester zu „Studium und<br />
Praktikum im Ausland“ in den Fakultäten Bauwesen<br />
(HI), Soziale Arbeit und Gesundheit, Naturwissenschaft<br />
und Technik, Ressourcenmanagement und<br />
Wirtschaft statt.<br />
Das Auslandsamt informiert sowohl über hochschuleigene<br />
Kooperationen als auch über Bewerbungsmöglichkeiten<br />
bei zentralen Stipendiengebern<br />
(z. B. DAAD, InWEnt-Gesellschaft (ehemals CDG),
Fulbright, SOKRATES-Programm), führt Beratungen<br />
durch, nimmt Bewerbungen entgegen und führt im<br />
Rahmen einiger Programme hochschulinterne<br />
Vorauswahlen durch. Hierfür gibt es teilweise<br />
Auswahlkommissionen, die mit Vertretern der<br />
Fakultäten besetzt sind. Beratung zu den Rahmenbedingungen<br />
eines Auslandsaufenthaltes<br />
(Visafragen, Versicherungen, Arbeitserlaubnis etc.)<br />
gehört darüber hinaus zu unseren Aufgaben.<br />
Mit dem „Hildesheimer Sprachenforum“ stand den<br />
Studierenden der FH HHG in 2003 ein umfassendes,<br />
differenziertes und qualifiziertes Fremdsprachenangebot<br />
zur Verfügung. Das gemeinsame Angebot von<br />
VHS Hildesheim, FH und Universität umfasste pro<br />
Semester 46 Kurse in 18 Fremdsprachen, wobei die<br />
häufig nachgefragten Sprachen auf unterschiedlichen<br />
Niveaustufen angeboten wurden. Die Kurse<br />
werden von der VHS organisiert und durchgeführt<br />
und sind für Studierende der FH bei bevorstehendem<br />
Auslandsaufenthalt zwecks Studium oder<br />
Praktikum kostenfrei (einmaliger Gutschein).<br />
Studierende, die Fremdsprachenkenntnisse<br />
außerhalb des fachlich Notwendigen erwerben oder<br />
vertiefen möchten, zahlen sonderermäßigte Preise.<br />
Sprachkurs für Lehrende<br />
Der vom AAA organisierte und seit mittlerweile fünf<br />
Jahren angebotene Englischkurs für Lehrende am<br />
Standort Hildesheim erfreute sich auch im<br />
vergangenen Jahr guten Zuspruchs. Im Rahmen des<br />
gemeinsamen Weiterbildungsprogramms der beiden
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Akademisches Auslandsamt<br />
Hildesheimer Hochschulen wurde er ebenfalls von<br />
Dozentinnen und Dozenten der Universität<br />
Hildesheim in Anspruch genommen.<br />
Service für ausländische Studienbewerber/innen<br />
Die Bewertung ausländischer Bildungsnachweise in<br />
Bezug auf die Hochschulzugangsberechtigung<br />
sowie die Beratung und Anfragenbearbeitung in<br />
Bezug auf ausländische Studieninteressenten wird<br />
ebenfalls im Akademischen Auslandsamt durchgeführt.<br />
Die 484 für das Sommersemester 2003 und das<br />
Wintersemester 2003/2004 eingegangenen<br />
Bewerbungen teilten sich wie folgt auf die<br />
Fakultäten auf:<br />
Fakultäten Anzahl<br />
Bewerbungen<br />
Bauwesen/Hi<br />
65<br />
Bauwesen/Hol<br />
10<br />
Gestaltung<br />
32<br />
Konservierung und Restaurierung<br />
5<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
47<br />
Ressourcenmanagement<br />
76<br />
Naturwissenschaften und Technik/Hol<br />
11<br />
Naturwissenschaften und Technik/Gö<br />
59<br />
Wirtschaft<br />
178<br />
nicht genannt<br />
1<br />
Summe:<br />
484
Die Bewerbungen kamen aus folgenden Ländern:<br />
Land Anzahl<br />
Ägypten<br />
Albanien<br />
Aserbeidschan<br />
Bosnien Herzegowina<br />
Bulgarien<br />
Burkina Faso<br />
China<br />
Ecuador<br />
El Salvador<br />
Gambia<br />
Georgien<br />
Ghana<br />
Griechenland<br />
Guinea<br />
Indien<br />
Indonesien<br />
Irak<br />
Iran<br />
Israel<br />
Italien<br />
Japan<br />
Jemen<br />
Jordanien<br />
Jugoslawien<br />
Kamerun<br />
Kasachstan<br />
Kenia<br />
Kroatien<br />
Kongo<br />
Korea<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
11<br />
1<br />
157<br />
1<br />
1<br />
3<br />
2<br />
2<br />
3<br />
2<br />
1<br />
10<br />
4<br />
7<br />
1<br />
4<br />
1<br />
3<br />
5<br />
1<br />
10<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
5<br />
Land Anzahl<br />
Lettland<br />
Liberia<br />
Litauen<br />
Lybien<br />
Marokko<br />
Mauretanien<br />
Moldawien<br />
Mongolei<br />
Niederlande<br />
Nigeria<br />
Pakistan<br />
Palästina<br />
Peru<br />
Polen<br />
Portugal<br />
Rumänien<br />
Russland<br />
Spanien<br />
Südafrika<br />
Sudan<br />
Syrien<br />
Thailand<br />
Türkei<br />
Tunesien<br />
Ukraine<br />
Ungarn<br />
USA<br />
Usbekistan<br />
Vietnam<br />
Weißrussland<br />
1<br />
1<br />
6<br />
1<br />
85<br />
2<br />
2<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
37<br />
1<br />
1<br />
16<br />
1<br />
1<br />
2<br />
1<br />
1<br />
14<br />
7<br />
25<br />
3<br />
2<br />
5<br />
6<br />
6
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Akademisches Auslandsamt<br />
Von den insgesamt 484 ausländischen Bewerbungen<br />
erhielten 217 Interessenten eine Zulassung, von<br />
denen sich 96 Studierende immatrikulierten.<br />
Service für ausländische Studierende<br />
Im Wintersemester 2003/2004 waren an der FH<br />
HHG 347 ausländische Studierende (= sechs<br />
Prozent aller Studierenden) aus 79 Ländern<br />
immatrikuliert, davon 230 Bildungsausländer.<br />
Das Auslandsamt unterstützt ausländische<br />
Studierende bei der Wohnungssuche, bei der<br />
Integration am Studienort und fungiert als<br />
Anlaufstelle in schwierigen Situationen. Außerdem<br />
bietet es jeweils zwei Wochen vor Semesterbeginn<br />
ein Einführungsprogramm an und unterstützt die<br />
Studierenden durch Deutsch-Intensivsprachkurse<br />
vor Semesterbeginn und durch semesterbegleitende<br />
Deutschkurse auf jeweils zwei Niveaustufen.<br />
Um die Integration der ausländischen Studierenden<br />
zu fördern und ihnen den Einstieg ins Studium an<br />
der <strong>HAWK</strong> zu erleichtern, hat das Auslandsamt das<br />
Betreuungsprogramm „Say HI“ ins Leben gerufen,<br />
bei dem deutsche Studierende ehrenamtlich als<br />
Tutoren für jeweils einen ausländischen Studierenden<br />
fungieren.<br />
Zu Beginn des Winter- und Sommersemesters<br />
wurden je zweiwöchige „Orientierungswochen“<br />
durchgeführt, in denen umfangreiche Unterstützung<br />
bei der Bewältigung der formalen Erfordernisse
sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm zur<br />
Eingewöhnung am neuen Studienort geboten<br />
wurden. Während der Semester organisierte das<br />
AAA Exkursionen unter zumeist deutschlandkundlichen,<br />
aber auch kulturellen oder fachlichen<br />
Aspekten: Ziele waren neben der Umgebung<br />
Hildesheims u. a. Berlin, Hamburg, Bremen,<br />
Hannover, Hameln, Minden, Leipzig, Dresden und<br />
Goslar.<br />
Des Weiteren wurde in Kooperation mit dem<br />
Ausländer/innen-Beaufragten des AStA in<br />
Hildesheim ein „Internationaler Stammtisch“<br />
eingerichtet, an dem ausländische Studierende<br />
zweiwöchentlich kulinarische und kulturelle<br />
Besonderheiten ihrer Länder präsentierten. In<br />
Göttingen wurde ebenfalls ein „Internationaler<br />
Stammtisch“ ins Leben gerufen, der während der<br />
Vorlesungszeit ein Mal monatlich in den Räumen<br />
der KHG stattfindet.<br />
Austausch- und Programmstudierende aus Partnerhochschulen<br />
kamen im Studienjahr 2002/2003 aus<br />
Russland, den USA, Großbritannien, Ungarn,<br />
Finnland, Polen, Rumänien, Spanien, Griechenland,<br />
Belgien, Irland, Schweden, den Niederlanden und<br />
Indonesien. Hochschulseits erfolgte die finanzielle<br />
Unterstützung dabei durch eingeworbene DAAD-<br />
Mittel u. a. in den Programmen Ostpartnerschaftsprogramm,<br />
ISAP, STIBET etc.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Akademisches Auslandsamt<br />
Studienabschlussbeihilfen des DAADs, die<br />
ausländischen Studierenden eine finanzielle<br />
Entlastung während der Diplomprüfung bieten<br />
können, sowie Kontaktstipendien wurden in 2003<br />
an insgesamt fünf ausländische Studierende<br />
vergeben.<br />
SOKRATES/ERASMUS Programm 2002/2003<br />
und Hochschulkooperationen<br />
Im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms<br />
2002/2003 wurden die Aktivitäten auf dem<br />
bisherigen Niveau fortgeführt. ERASMUS-Zusammenarbeit<br />
erfolgte mit Hochschulen in Belgien,<br />
Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland,<br />
Großbritannien, Italien, Irland, den Niederlanden,<br />
Österreich, Polen, Schweden, Slowenien, Spanien,<br />
Ungarn und Zypern.<br />
Den Schwerpunkt der Aktivitäten bildete der<br />
Studierendenaustausch: Das Auslandsamt betreute<br />
insgesamt 55 ERASMUS-Studierende, die jeweils für<br />
drei bis zwölf Monate an einer ausländischen<br />
Partnerhochschule studierten. Dazu kamen rund 60<br />
Austauschstudierende von und nach Partnerhochschulen<br />
in nicht-europäischen Ländern (insbesondere<br />
China, USA, Russland, Australien). Vorkehrungen<br />
des Auslandsamts für „incomings/outgoings“<br />
bestanden u. a. in der Organisation von Intensivund<br />
semesterbegleitenden Sprachkursen,<br />
Orientierungswochen zur Einführung in die<br />
Hochschule, Studienberatung, praktischer Hilfe bei<br />
der Wohnraumbeschaffung und bei Behördengängen,<br />
Visa-Beschaffung, Krankenversicherung usw.
Alle „outgoings“ erhielten ein ERASMUS-Stipendium,<br />
dessen Beantragung und Abwicklung über das<br />
Auslandsamt erfolgte.<br />
Dreizehn Dozentinnen und Dozenten der FH<br />
übernahmen an kooperierenden Hochschulen in<br />
Belgien, Finnland, den Niederlanden, Polen,<br />
Spanien, Ungarn, Zypern und Irland Lehraufträge<br />
von kurzer Dauer. Zwei kooperationsvorbereitende<br />
Reisen führten nach Spanien und Polen. Reise- und<br />
Aufenthaltskosten wurden aus dem vom Auslandsamt<br />
verwalteten SOKRATES-Etat der EU sowie<br />
zusätzlich aus hochschuleigenen Mitteln bezuschusst.<br />
Art der SOKRATES/ERASMUS-Aktivitäten 2002/03 Anzahl<br />
Studierendenmobilität (SM) Gesamtzahl der ins Ausland<br />
2002/03 entsandten ERASMUS-Studierenden<br />
(outgoings): 55<br />
Studierendenmobilität (SM) Gesamtzahl aufgenommenen<br />
2002/03 ERASMUS-Studierenden<br />
(incomings): 46<br />
Dozentenmobilität (TS) Gesamtzahl der ins Ausland<br />
2002/03 entsandten Hochschullehrer<br />
(incl. 2 Anbahnungsreisen<br />
und 3 Reisen zur Organisation<br />
der Mobilität): 18<br />
Im Rahmen des Besuchs des Präsidenten der<br />
mexikanischen Hochschule ECRO (Escuela de<br />
Conservación y Restauración de Occidente de
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Akademisches Auslandsamt<br />
Guadalajara) am Fachbereich Restaurierung wurde<br />
im Januar 2003 eine neue Hochschulpartnerschaft<br />
besiegelt.<br />
Anlässlich des Besuchs einer hochrangigen<br />
Delegation von unserer chinesischen Partnerhochschule<br />
in Hefei und der Provinzregierung in Anhui<br />
im Oktober 2003 unterzeichneten die Vize-<br />
Präsidenten Prof. Dr. Merkel und Prof. Dr. Cai eine<br />
weitergehende Vereinbarung über Forschungszusammenarbeit<br />
in der Fakultät Ressourcenmanagement.<br />
Die Zahl der internationalen Fakultäts- und<br />
Hochschulkooperationen hat sich bis Ende 2003 auf<br />
insgesamt 63 erneut gesteigert.<br />
Finanzielle Förderung der Internationalisierung<br />
Auch in 2002/2003 wurden in maßgeblichem<br />
Umfang hochschuleigene Mittel zur Förderung der<br />
Internationalisierung bereitgestellt. Damit konnten<br />
u. a. Dozentenbesuche an Partnerhochschulen zur<br />
Pflege und zum Ausbau der Kontakte ebenso wie<br />
der Besuch ausländischer Delegationen an die<br />
FH unterstützt werden. Auf Auslands-Gruppenreisen<br />
von Studierenden unter Leitung von Hochschullehrern<br />
entfiel ein weiterer, nicht unerheblicher Anteil<br />
der Zuschüsse. Ein großer Teil der Mittel kam dem<br />
Sprachenangebot (Fremdsprachen und Deutsch als<br />
Fremdsprache) des AAA bzw. dem der Hochschule<br />
zugute.
Bibliothek<br />
Leitung<br />
Helene Julien-Reyelts<br />
Aufgaben<br />
Die Bibliothek versorgt Studierende und Lehrende<br />
der Hochschule und interessierte externe Nutzer mit<br />
der für Studium, Lehre und Forschung oder<br />
Weiterbildung erforderlichen Fachliteratur.<br />
Das Bibliothekssystem wird zentral geleitet und<br />
administriert, stellt benutzerfreundlich in unmittelbarer<br />
Nähe zur jeweiligen Fakultät dezentral<br />
Literatur und Information zur Verfügung<br />
Literaturversorgung<br />
Hildesheim<br />
Bibliothek Bauwesen und Wirtschaft<br />
(Zentralbibliothek)<br />
Bestand: 47.055 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Architektur, Bauingenieurwesen,<br />
Holzingenieurwesen, Wirtschaft, Krankenversicherung<br />
sowie Medizinalfachberufe<br />
Bibliothek Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Bestand: 42.824 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Sozialwissenschaft,<br />
Sozialpädagogik, Psychologie, Pädagogik,<br />
Sonderpädagogik, Soziale Arbeit, Sozialmanagement,<br />
Frauen- und Geschlechterforschung<br />
Bibliothek Gestaltung und Restaurierung<br />
Bestand: 33.703 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Gestaltung, Bildende Kunst,
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bibliothek<br />
Innenarchitektur, Kommunikationsdesign,<br />
Produktdesign, Restaurierung, Konservierung<br />
Holzminden<br />
Bibliothek Bauwesen und Soziale Arbeit<br />
Bestand: 19.511 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Architektur, Bauwesen,<br />
Bauchemie, Immobilienwirtschaft u. -management<br />
Der sozialwissenschaftliche Literaturbestand<br />
befindet sich seit Wintersemester 2003 im Aufbau.<br />
Göttingen<br />
Bibliothek Ressourcenmanagement<br />
Bestand: 29.431 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Forstwirtschaft, Umwelt- und<br />
Landschaftspflege, Arboristik, Wirtschaftsingenieurwesen<br />
Bibliothek Naturwissenschaft und Technik<br />
Bestand: 13.009 Bände<br />
Literaturschwerpunkte: Physik-, Mess-, Elektro-,<br />
Feinwerktechnik, Informatik, Präzisionsfertigungstechnik<br />
Die Bibliothek hat einen Gesamtbestand von<br />
185.533 Monographien, 579 laufende Zeitschriftenabonnements<br />
sowie 140 Loseblattausgaben.<br />
Im Jahr 2003 wurden 7.869 Bände neu erworben.<br />
Die Finanzierung erfolgte aus den Mittelzuweisungen<br />
der Fakultäten.<br />
Neben dem kontinuierlichen Medienzuwachs wird<br />
die permanente Pflege (Revision) der Bibliotheksbe-
stände und der Kataloge zunehmend wichtiger, um<br />
das Auffinden relevanter Literatur in räumlich<br />
begrenzten Freihandbibliotheken zu gewährleisten.<br />
Benutzung<br />
Auch in diesem Jahr hat der positive Trend in den<br />
Bibliotheken angehalten: die Ausleihen wuchsen<br />
um 4.000 gegenüber dem Vorjahr. Dies ergibt eine<br />
Gesamtausleihe von 102.154 Medien.<br />
Insgesamt haben sich 2.300 neue Leser in den<br />
Bibliotheken im Jahr 2003 angemeldet.<br />
Die Darstellung zeigt die prozentuale Verteilung der<br />
Nutzer-Neuanmeldung:<br />
G+R Hi<br />
12 %<br />
B+S Ho<br />
11 %<br />
RCM Gö<br />
16 %<br />
N+T Gö<br />
8 %<br />
S Hi<br />
18 %<br />
B+W Hi<br />
35 %
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bibliothek<br />
Fernleihe<br />
Die im Lokalsystem Göttingen eingebundenen<br />
Bibliotheken nehmen am überregionalen Leihverkehr<br />
teil. Das Verhältnis zwischen gebender und<br />
nehmender Fernleihe ist unausgewogen. So forderte<br />
die Bibliothek Ressourcenmanagement zehn<br />
Prozent (= 67 Titel) aus anderen Bibliotheken für<br />
ihre Benutzer an, bearbeitete im Gegenzug aber 603<br />
Anfragen. (Bibliothek N/T: aktive FL 74 Prozent : 26<br />
Prozent passive FL).<br />
Da dieser kosten- und zeitintensive Service leider<br />
sehr zulasten unserer Einrichtung geht, ist dies<br />
derzeit für andere Bibliotheken nicht geplant.<br />
Räumliche Situation<br />
Durch die Gründung der Fakultät Soziale Arbeit in<br />
Holzminden musste für die Erweiterung der<br />
Bibliothek sofort eine Übergangslösung bis zum<br />
Umzug in das neue Gebäude gefunden werden.<br />
Dies gelang mittels Türdurchbruch in einen an die<br />
Bibliothek angrenzenden Raum.<br />
Die Bibliothek Gestaltung und Restaurierung hat<br />
durch den Umzug in angrenzende Räume ab sofort<br />
Platz für die vorhandene Literatur, Benutzerleseund<br />
Rechercheplätze. Hinzu kam endlich auch der<br />
notwendige Büroraum für die Mitarbeiterinnen. Mit<br />
der verbesserten Arbeitssituation wird nunmehr die<br />
Bestandsrevision erfolgen können. Um die<br />
Buchbestände angemessen zu benutzen, müssten<br />
die Regale besser beleuchtet werden.
Dieses lange überfällige Problem ist in der<br />
Bibliothek Soziale Arbeit in Hildesheim durch<br />
Einbau neuer Deckenbeleuchtung seit Jahresende<br />
erfolgreich gelöst.<br />
Durch Ausbau der Fakultät ist die Kapazitätsgrenze<br />
in der Bibliothek Ressourcenmanagement erreicht.<br />
Nur durch hervorragende Logistik konnten neue<br />
Regale eingefügt werden, um zumindest kurzfristig<br />
den neuen Bestand zu präsentieren. Das Raumproblem<br />
ist dennoch ungelöst.<br />
EDV<br />
Die Anschaffung neuer Rechner und Drucker war<br />
durch die Weiterentwicklung der Bibliotheks-<br />
Software für das LBS4 und den OPC4 notwendig.<br />
Die Aufstellung aller Rechner hat begonnen, ist<br />
jedoch noch nicht abgeschlossen. Die hierfür<br />
notwendige Umstellung des derzeitigen Betriebssystems<br />
NT auf WindowsXP konnte durch das<br />
Rechenzentrum leider noch nicht durchgeführt<br />
werden, ist aber für 2004 zugesagt.<br />
Weiterhin wurde auf eine neue Aufrüstung des<br />
zentralen CD-ROM-Servers verzichtet. Die dafür<br />
notwendigen Kosten übersteigen bei weitem die<br />
Möglichkeiten der Bibliothek.<br />
Die Bibliothek Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Hildesheim ist durch eine neue Funkverbindung nun<br />
besser an das Datennetz angeschlossen. Dies<br />
ermöglicht endlich eine angemessene Arbeitssituation<br />
für die dv-gestützte Ausleihe, Katalogisierung<br />
und Recherche.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Bibliothek<br />
Neben den per Internet recherchierbaren frei<br />
zugänglichen Datenbanken ist die Bibliothek<br />
Lizenznehmer an folgenden Online-Fachdatenbanken:<br />
WISOnet (verzeichnet Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche<br />
Literatur), RSWB (Baufachliteratur)<br />
sowie FIZ-Technik und Springer-Link. Da die<br />
Anzahl der am niedersächsischen Konsortium<br />
beteiligten Bibliotheken abnimmt, somit die Kosten<br />
steigen, werden auch wir dieses Angebot nicht<br />
länger aufrecht erhalten können.<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
Durch den Ausbau der Bibliothek am Standort<br />
Holzminden erhielt die Bibliothek eine neue<br />
Vollzeitstelle.<br />
Die Bibliothek bildet erstmals eine Fachangestellte<br />
für Medien- und Informationsdienste in der<br />
Bibliothek Bauwesen und Wirtschaft am Standort<br />
Hildesheim aus.<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Seit Frühjahr ist der Internetauftritt der Bibliothek<br />
im neuen Layout der FH gestaltet. Die Homepage<br />
wird seit Sommer in Eigenregie durch die Bibliothek<br />
gepflegt. Die Bibliotheksbenutzer können über<br />
unsere Homepage alle Kataloge und Nutzerfunktionen<br />
anwählen. Zusätzlich wird die Verlängerung per<br />
Mail angeboten sowie die Möglichkeit, Anschaffungsvorschläge<br />
zu senden.<br />
In einer zweiten Phase werden einheitliche<br />
Benutzungstexte entwickelt.
Frauen- und<br />
Gleichstellungsbüro<br />
Zentrale Frauen- und<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Ingrid Haasper<br />
Wiss. Referentin<br />
Hannah Wadepohl<br />
Sachbearbeiterin<br />
Doris Yel<br />
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte<br />
der Fakultäten<br />
Standort Göttingen:<br />
– Joanna Adamowicz, Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Standort Hildesheim:<br />
– Renate Deiters, Fakultät Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit<br />
– Süleyman Ersu, Fakultät Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit (Vertreter)<br />
Standort Holzminden:<br />
– Manuela Dittrich, Fakultät Bauwesen<br />
– Ilse-Marie Hansmann, Fakultät Bauwesen<br />
– Prof. Dr. Ina Hermann-Stietz, Fakultät Soziale<br />
Arbeit und Gesundheit<br />
– Katharina Drohmann, Fakultät Soziale Arbeit<br />
und Gesundheit (Vertreterin)
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte<br />
Die nach § 42 Abs. 1 NHG nunmehr hauptamtliche<br />
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Ingrid<br />
Haasper, trat am 01. März 2004 ihr Amt an.<br />
Im Mai 2004 nahm Hannah Wadepohl ihre Tätigkeit<br />
als wissenschaftliche Referentin im Frauen- und<br />
Gleichstellungsbüro auf.<br />
Frauenrat/Frauenversammlung<br />
Der Frauenrat tagte im vergangenen Jahr insgesamt<br />
drei Mal. Neben der Vorbereitung der Frauen-<br />
Teilversammlungen an den Standorten Göttingen<br />
und Holzminden befasste er sich mit den Modalitäten<br />
und Erfahrungen im Hinblick auf die Umsetzung<br />
des novellierten NHG und aller damit in Zusammenhang<br />
stehenden neuen Ordnungen und Richtlinien.<br />
Standortübergreifend wurden hier darüber hinaus<br />
die Aktivitäten zum Girl’s Day 2003 geplant und<br />
koordiniert. Für Januar 2004 wurde eine Klausurtagung<br />
des Frauenrates inhaltlich und organisatorisch<br />
vorbereitet.<br />
Im Verlaufe des Berichtszeitraumes fanden an den<br />
Standorten Göttingen und Holzminden sowie an der<br />
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit in<br />
Hildesheim Frauen-Teilversammlungen statt, in<br />
deren Rahmen unter anderem auch die Wahlen der<br />
Fakultätsfrauenbeauftragten erfolgten:<br />
– Joanna Adamowicz, Fakultät Ressourcenmanagement;<br />
– Manuela Dittrich und Ilse-Marie Hansmann,<br />
Fakultät Bauwesen;<br />
– Dr. Ina Hermann-Stietz und Katharina Drohmann
(Vertretung), Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit/Holzminden;<br />
– Renate Deiters und Süleyman Ersu (Vertretung),<br />
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit/<br />
Hildesheim.<br />
Im Sinne der „Gleichstellung“ nimmt mit Herrn Ersu<br />
erstmalig ein Mann dieses Amt wahr.<br />
Alle gewählten Fakultätsfrauen- und Gleichstellungsbeauftragten<br />
werden für die Wahrnehmung der<br />
Aufgaben im Rahmen dieser Funktion angemessen<br />
freigestellt. Sie nahmen ihre Tätigkeit direkt nach<br />
der Bestellung durch die Fakultätsräte auf.<br />
Kommission für Frauenförderung und Gleichstellung<br />
Die Kommission nahm Stellung zu den Fortschreibungen<br />
der Frauenförderpläne der Fakultät<br />
Naturwissenschaften und Technik (früher:<br />
Fachbereich Physik-, Mess- und Feinwerktechnik)<br />
und der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
(früher: Fachbereich Sozialpädagogik). Sie<br />
erarbeitete außerdem eine formale Struktur für die<br />
Fortschreibung der Frauenförderpläne der<br />
Fakultäten, die zukünftig eine bessere Vergleichbarkeit<br />
aller Pläne Gewähr leisten soll. Sie legte<br />
darüber hinaus einen Zeitplan für die Umsetzung<br />
2004 fest.<br />
Projekte<br />
Audit: Familiengerechte Hochschule –<br />
Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie<br />
Am 10. März 2003 wurde der <strong>HAWK</strong> im Rahmen<br />
eines Festaktes in der Akademie der Wissenschaf-
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
ten und der Literatur in Mainz als bisher einziger<br />
Hochschule in Niedersachsen und einer von vier<br />
Hochschulen bundesweit das Zertifikat „Familiengerechte<br />
Hochschule“ verliehen.<br />
Die zu Grunde liegende Antragstellung wurde 2002<br />
von der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten<br />
initiiert, die auch die Projektleitung für die sukzessive<br />
Umsetzung der zehn Zielvereinbarungen in den<br />
kommenden drei Jahren bis 2006 übernommen hat.<br />
Während des Berichtszeitraumes konnten folgende<br />
Vorhaben eingeleitet bzw. umgesetzt werden:<br />
Handlungsfeld 1: Arbeitszeit<br />
Ein entsprechender Entwurf zur Anpassung der<br />
bestehenden Dienstvereinbarung (Erhöhung des<br />
Ausgleichszeitraumes für Gleitzeit von einem<br />
Kalendervierteljahr auf ein Halbjahr/Ausdehnung<br />
des Modells der Funktionszeiten auf weitere<br />
Bereiche der Hochschule) wurde vom Personalrat<br />
erarbeitet, liegt der Hochschulleitung vor und wartet<br />
auf Abschluss.<br />
Die Funktionszeiten wurden während der vorlesungsfreien<br />
Zeit 2003 probeweise ausgeweitet und<br />
von den Beschäftigten sehr positiv angenommen.<br />
Um eine Entscheidung im Hinblick auf die<br />
Notwendigkeit der Schaffung einer Multifunktionskraft-Stelle<br />
(„Springerinnen“-Stelle) vorzubereiten,<br />
haben die Controllerin und die Frauen- und<br />
Gleichstellungsbeauftragte ein Konzept für eine<br />
qualitative und quantitative Analyse zu Arbeitsanfall-<br />
und -fehlzeiten ausgearbeitet. Diese Instrumente<br />
sollen Anfang 2004 mit der Kanzlerin, der
Abteilung Personal und dem Personalrat abgestimmt<br />
werden und im Verlaufe des Jahres sowohl<br />
in der Zentralverwaltung wie auch in den Verwaltungen<br />
der Fakultäten in Einsatz kommen.<br />
Handlungsfeld 2: Arbeitsort<br />
Die Erprobungsphase des ersten Arbeitsplatzes in<br />
alternierender Telearbeit wurde inzwischen<br />
abgeschlossen und erfolgreich evaluiert. Der<br />
Entwurf für eine entsprechende Dienstvereinbarung<br />
liegt der Hochschulleitung seit September 2003 vor<br />
und wartet auf Abschluss. Weitere Anfragen/Anträge<br />
nach Tele-Arbeitsplätzen liegen vor und müssen<br />
nach in Kraft treten der Dienstvereinbarung geprüft<br />
werden.<br />
Handlungsfeld 3: Arbeitsinhalte und -abläufe<br />
Zur Stärkung informeller Kontakte und „kürzerer<br />
Dienstwege“ wurden inzwischen in einigen<br />
Hochschulgebäuden sog. Kommunikationsinseln<br />
eingerichtet.<br />
Handlungsfeld 4: Führungskompetenz<br />
– Zu Beginn des Sommersemesters 2003 befasste<br />
sich die Planungskommission der Hochschule<br />
mit dem Thema „Leitbilddiskussion“ (u. a. Verankerung<br />
der Familienorientierung); ein entsprechender<br />
hochschulinterner Diskussionsprozess<br />
sollte im SS 03 eingeleitet werden. Auf Grund<br />
der besonderen und unerwarteten hochschulpolitischen<br />
Entwicklungen des Sommers 2003<br />
(HOK etc.) trat diese Diskussion jedoch
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
zwangsläufig in den Hintergrund und soll 2004<br />
wieder aufgenommen werden.<br />
– Im Herbst 2002 fand für die Zentralverwaltung<br />
und die Zentralen Einrichtungen eine mehrtägige<br />
Führungskräfteschulung statt.<br />
– Im Rahmen des Weiterbildungsprogramms von<br />
Fachhochschule und Universität Hildesheim<br />
wurde ein Vortrag zur Umsetzung der Zielvereinbarungen<br />
des Audits und eine Veranstaltung<br />
zum Thema „Gender-Mainstreaming“ durchgeführt.<br />
Diese Veranstaltungen hatten das Ziel,<br />
über die familiengerechte Gestaltung der<br />
Hochschule zu informieren und die Belegschaft<br />
für Genderthemen allgemein sowie Strategie,<br />
Inhalte und konkrete Umsetzung von Gender-<br />
Mainstreaming und „work-life-balance“ zu<br />
sensibilisieren. Weitere Veranstaltungen sind für<br />
2004 in Planung.<br />
Handlungsfeld 5: Informations- und<br />
Kommunikationspolitik<br />
Auf der Website „Arbeiten/Studieren mit Kind“<br />
befinden sich inzwischen zahlreiche Informationen<br />
über das Audit und dessen Umsetzung sowie<br />
umfangreiche Datenbanken zur Kinderbetreuung<br />
(Krippen, Kitas, Horte, Beratungsstellen) für alle drei<br />
Standorte. Außerdem wurde inzwischen eine<br />
virtuelle Kinderbetreuungsbörse für selbst<br />
organisierte Kinderbetreuung eingerichtet und ins<br />
Netz gestellt. Parallel dazu informiert die Frauenund<br />
Gleichstellungsbeauftragte regelmäßig in<br />
Gremien und Organen, im Rahmen der monatlich
stattfindenden Abteilungsleiter/innenbesprechungen<br />
sowie in der Zeitschrift des Frauen- und<br />
Gleichstellungsbüros „TheaNo“ über den Stand der<br />
Umsetzung der Zielvereinbarungen.<br />
Die inzwischen zahlreichen und deutlich vermehrten<br />
Anfragen Studierender und Beschäftigter nach<br />
Möglichkeiten der Kinderbetreuung, aber auch zu<br />
anderen Inhalten des Auditierungsprozesses lassen<br />
ebenso wie die Anfragen anderer Hochschulen zu<br />
den Erfahrungen auf die Wirksamkeit dieser<br />
Öffentlichkeitsarbeit schließen.<br />
Geplant ist weiterhin für 2004 die Einrichtung eines<br />
Newsletters über die Neuigkeiten der familiengerechten<br />
Hochschule.<br />
Handlungsfeld 6: Personalentwicklung<br />
Um eine „Begrüßungskultur“ zu etablieren und<br />
neuen Kolleginnen und Kollegen den Arbeitseinstieg<br />
an der Hochschule zu erleichtern, entwickelte eine<br />
Arbeitsgruppe sog. „Begrüßungsmappen“ in zwei,<br />
auf Grund der Einsatzbereiche, unterschiedlichen<br />
Versionen für lehrendes und wissenschaftsstützendes<br />
Personal. Diese Mappen enthalten die<br />
wichtigsten internen Unterlagen (Ordnungen,<br />
Dienstvereinbarungen, Verzeichnisse, Formulare,<br />
etc.) sowie ein Glossar, das alphabetisch geordnet<br />
über Abläufe, Dienstwege, Zuständigkeiten,<br />
Ansprechpersonen etc. informiert. Neuen Beschäftigten<br />
soll damit die erste Orientierung in der<br />
Hochschule erleichtert werden.<br />
Parallel dazu wurde ein sog. Paten-/Patinnensystem<br />
etabliert, d. h. jeder neuen Kollegin und jedem
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
neuen Kollegen wird für die erste Zeit nach<br />
Arbeitsaufnahme als direkte/r Ansprechpartner/in<br />
eine Patin oder ein Pate zur Seite gestellt.<br />
Geplant ist, zukünftig ähnliche Begrüßungsmappen<br />
auch für Studienanfängerinnen und -anfänger zu<br />
entwickeln. Da dies jedoch auf Grund der großen<br />
Anzahl mit besonderen finanziellen Aufwendungen<br />
verbunden ist, müssen hier zunächst Finanzierungsmöglichkeiten<br />
gefunden werden.<br />
Um den Wiedereinstieg zum Beispiel nach der<br />
Elternzeit zu erleichtern und vorzubereiten, gibt es<br />
die Möglichkeit zur stundenweisen Tätigkeit in der<br />
Hochschule während der Elternzeit. Dieses Angebot<br />
wurde 2003 erfreulicherweise von insgesamt sieben<br />
Beschäftigten, davon einem Kollegen, in Anspruch<br />
genommen.<br />
Handlungsfeld 7: Flankierender Service für Familien<br />
Standort Göttingen:<br />
An der Fakultät Ressourcenmanagement konnte mit<br />
finanzieller und organisatorischer Unterstützung des<br />
Frauen- und Gleichstellungsbüros ein Still- und<br />
Wickelraum eingerichtet werden. Die Fakultätsfrauen-<br />
und Gleichstellungsbeauftragte ermittelte<br />
darüber hinaus im Rahmen einer Umfrage den<br />
aktuellen Bedarf an Kinderbetreuung am Standort<br />
Göttingen. Daraus entstand gemeinsam mit<br />
Studierenden und Beschäftigten eine Initiative zu<br />
selbst organisierter Kinderbetreuung. Dieses<br />
Projekt, für das die Fakultät inzwischen auch einen<br />
entsprechenden Raum zur Verfügung gestellt hat,<br />
soll 2004 realisiert werden.
Die Verhandlungen mit dem Tagesmütterverein in<br />
Göttingen scheiterten leider zum einen an den zu<br />
hohen laufenden Kosten, die auf die Hochschule im<br />
Rahmen einer Kooperation zugekommen wären,<br />
zum anderen entsprach das Angebot auch nicht<br />
unbedingt den Erfordernissen unserer Hochschulangehörigen.<br />
Standort Holzminden:<br />
In Holzminden stehen wir aktuell noch in Verhandlungen<br />
mit dem dortigen Tagesmütterverein;<br />
insbesondere im Hinblick auf eine Kooperation bei<br />
der sog. Notfallbetreuung. Darüber hinaus sind<br />
auch hier ein Projekt selbst organisierter Kinderbetreuung<br />
sowie ein ergänzendes Betreuungsangebot<br />
während der Sommerferien 2004 geplant.<br />
Standort Hildesheim:<br />
Ziel ist, in Hildesheim eine auf die Belange einer<br />
Hochschule und die Bedarfe der Hochschulangehörigen<br />
zugeschnittene Modellkrippe für<br />
Kleinstkinder zu gründen, in der neben der<br />
professionell organisierten auch Raum für selbst<br />
organisierte Kinderbetreuung zur Verfügung steht.<br />
Die Ausrichtung der Modelleinrichtung beruht auf<br />
einer Verknüpfung von Forschung und Praxis in<br />
Zusammenarbeit mit dem im Aufbau befindlichen<br />
Bachelor-Studiengang Elementarpädagogik der<br />
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit. Das<br />
pädagogische Konzept wird im Hinblick auf die Pisa-<br />
Studie wissenschaftlich entwickelt und begleitet.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Die für die Gründung erforderlichen Verhandlungen<br />
mit der Stadt Hildesheim über eine Beteiligung und<br />
das konkrete Nutzungskonzept wurden 2003<br />
aufgenommen, wobei der bisherige Verhandlungsverlauf<br />
auf einen positiven Ausgang hoffen lässt.<br />
Geklärt wird derzeit parallel die räumliche<br />
Unterbringung der Modellkrippe, die gesetzlich mit<br />
etlichen Auflagen hinsichtlich Größe, Ausstattung,<br />
Freifläche etc. verbunden ist. Auch hier zeichnen<br />
sich inzwischen Lösungen ab, wobei realistisch<br />
davon auszugehen ist, dass bis zur endgültigen<br />
Realisierung des Gesamtkonzeptes mit Zwischenbzw.<br />
Übergangslösungen gerechnet werden muss.<br />
Die für das Projekt „Modellkrippe“ zuständige<br />
Arbeitsgruppe ist neben den, die Gründung<br />
allgemein vorbreitenden Aktivitäten, aktuell auch<br />
damit befasst, im Rahmen von Fundraising weitere<br />
Finanzierungsquellen aufzutun.<br />
Handlungsfeld 8: Rahmenbedingungen im Studium<br />
Die Zentrale Studienkommission befasste sich mit<br />
einem entsprechenden Formulierungsvorschlag zum<br />
Nachteilsausgleich für studierende Eltern im<br />
Allgemeinen Teil der Prüfungsordnungen und sprach<br />
eine entsprechende Empfehlung aus.<br />
Frauenarchiv<br />
Alle im „frauenarchiv“ erfassten Arbeiten beschäftigen<br />
sich mit den verschiedensten Themen aus<br />
Frauenleben, Frauenalltag und Frauenpolitik und<br />
dokumentieren damit gleichzeitig das breite<br />
inhaltliche Spektrum dessen, was in diesem
speziellen Bereich gelehrt und bearbeitet wurde.<br />
Das „frauenarchiv“ soll jedoch nicht nur zeigen, wie<br />
viele Arbeiten zu frauenspezifischen Themen<br />
verfasst wurden, sondern die systematische<br />
Erfassung und Gliederung nach Stichworten soll<br />
Studierenden zukünftig die Recherche und den<br />
Zugriff erleichtern und zu weiteren wissenschaftlichen<br />
Arbeiten zu speziellen Frauenthemen anregen.<br />
Das „frauenarchiv“ gibt es nun auch als Datenbank<br />
und ist auf der Homepage des Frauen- und Gleichstellungsbüros<br />
unter dem Stichwort „Infos/Diplomarbeiten“<br />
zu finden.<br />
Darüber hinaus wurden von jeder Arbeit das<br />
Vorwort, das Inhaltsverzeichnis und die Literaturliste<br />
kopiert und in einem Handapparat abgelegt, der<br />
in der Bibliothek der Fakultät Soziale Arbeit und<br />
Gesundheit zu finden ist. Bei Bedarf kann dort auch<br />
die vollständige Diplomarbeit ausgeliehen werden.<br />
Girl’s Day 2003 – Mädchen-Zukunftstag<br />
Erstmalig fanden am 08. Mai 2003 an allen drei<br />
Standorten Veranstaltungen im Rahmen des<br />
bundesweiten „Girl’s Day“ statt. Alle Angebote<br />
stießen auf große und interessierte Resonanz und<br />
wurden insgesamt gut angenommen. Allen<br />
Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Ideen und<br />
ihrem Engagement zum Gelingen dieses Tages<br />
beigetragen haben, sei an dieser Stelle noch einmal<br />
herzlich gedankt.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Von der FH-Frauenzeitung „TheaNo“, die einmal im<br />
Semester als Printausgabe erscheint, wurde 2003<br />
auch eine Online-Version entwickelt und ins Netz<br />
gestellt. Darüber hinaus wurde die Website des<br />
Frauen- und Gleichstellungsbüros inhaltlich<br />
überarbeitet und laufend aktualisiert. Die<br />
inhaltliche Gestaltung und Realisierung der Service-<br />
Website „Studieren mit Kind“ sowie die Einrichtung<br />
der virtuellen Kinderbetreuungsbörse lag ebenfalls<br />
in der Verantwortung des Frauen- und Gleichstellungsbüros.<br />
Frauenförderprogramme<br />
Auch 2003 beteiligte sich die Hochschule auf<br />
Initiative der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten<br />
an der Ausschreibung des Dorothea-Erxleben-<br />
Programms mit zwei Anträgen. Dieses Programm<br />
ermöglicht es jungen Wissenschaftlerinnen, die<br />
Promotion nachzuholen und sich nach erfolgreichem<br />
Abschluss auf eine in ihrem ausgewiesenen<br />
Forschungsbereich angesiedelte Professur zu<br />
bewerben. Beide Anträge waren in dieser Ausschreibungsrunde<br />
jedoch nicht erfolgreich. Die Perspektivprofessur,<br />
die in dem Antrag nachgewiesen<br />
werden musste, sollte aus dem zum damaligen<br />
Zeitpunkt noch in Aussicht gestellten Fachhochschul-Entwicklungs-Programm<br />
finanziert werden.<br />
Dies schien der Auswahlkommission zu ungewiss,<br />
da nicht klar war, ob dieses Programm überhaupt<br />
realisiert werden würde.
Frauenforschung – Zentrum für Interdisziplinäre<br />
Frauen- und Geschlechterforschung (ZIF)<br />
Finanzierung:<br />
Die Finanzierung des ZIF durch Mittel aus dem<br />
Hochschulwissenschaftsprogramm (HWP);<br />
Programmteil: Chancengleichheit ist inzwischen bis<br />
2006 gesichert.<br />
Wissenschaftlicher Beirat:<br />
Neben dem „Gemeinsamen Ausschuss“, der in<br />
regelmäßigen Sitzungen die Arbeit des ZIF begleitet<br />
und berät, konnte inzwischen auch der im Kooperationsvertrag<br />
mit der Universität vorgesehene<br />
„Wissenschaftliche Beirat“ besetzt werden.<br />
Mitglieder sind:<br />
– Prof. Dr. Heike Flessner, Universität Oldenburg<br />
– Prof. Dr. Carol Hagemann-White, Universität<br />
Osnabrück<br />
– Waltraud Klitzke, ehemalige Frauenbeauftragte<br />
der Volkswagen AG Wolfsburg<br />
– Dr. Andrea Löther, Center of Excellence Women<br />
and Science (CEWS), Bonn<br />
– Prof. Dr. Friederike Maier, Direktorin des Harriet<br />
Taylor Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung<br />
der Fachhochschule für Wirtschaft,<br />
Berlin<br />
– PD Dr. Michael Meuser, Essener Kolleg für<br />
Geschlechterforschung, Universität Duisburg-<br />
Essen<br />
– Dr. Christine Roloff, Hochschuldidaktisches<br />
Zentrum der Universität Dortmund
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, das<br />
ZIF bei der Konzeption von Forschungsvorhaben und<br />
-projekten, Lehr-, Weiterbildungs- und Vortragsveranstaltungen<br />
zu beraten und wird voraussichtlich im<br />
März 2004 zu seiner konstituierenden Sitzung<br />
zusammentreten.<br />
Inhalte und Aktivitäten:<br />
Die Frauen- und Geschlechterforschung in<br />
Hildesheim konzentriert sich derzeit inhaltlich auf<br />
die Schwerpunkte „Organisation und Geschlecht“,<br />
„Geschlechterordnungen im Wohlfahrtsstaat“ und<br />
„Medialität und Gender“. Im Sinne der interdisziplinären<br />
und hochschulübergreifenden Ausrichtung<br />
des ZIF beteiligen sich Wissenschaftlerinnen und<br />
Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen<br />
beider Hochschulen an der Entwicklung dieser<br />
Schwerpunkte. Das ZIF übernimmt dabei die<br />
unterschiedlichsten Aufgaben: Förderung der<br />
Kooperation von Wissenschaftler/innen beider<br />
Hochschulen und unterschiedlicher Fächer und<br />
Fachkulturen; Beratung bei der Antragstellung;<br />
Übernahme verwaltender Tätigkeiten für einzelne<br />
Projekte; Vermittlung von Kontakten zur Herstellung<br />
von Synergieeffekten.<br />
Darüber hinaus führte das ZIF 2003 auch eigene,<br />
inzwischen bewährte Veranstaltungsreihen fort:<br />
– den „Treffpunkt Frauen- und Geschlechterforschung“,<br />
der einem breiten Teilnehmer/innen<br />
kreis die Möglichkeit bietet, sich über laufende<br />
einschlägige Forschungsprojekte zu informieren<br />
bzw. eigene Projekte vorzustellen;
– die Workshops, die zu speziellen Fragestellungen<br />
der laufenden Forschungsprojekte gemeinsam<br />
mit interessierten Wissenschaftler/innen<br />
beider Hochschulen themenbezogen organisiert<br />
werden.<br />
Gastprofessuren Frauen- und Genderforschung<br />
Da sich die Einrichtung der Gender-Gastprofessur in<br />
der Vergangenheit als sehr erfolgreich erwiesen hat,<br />
stellte die Fachhochschule für das Wintersemester<br />
2003/2004 Mittel für eine weitere einsemestrige<br />
Gastprofessur zur Verfügung mit der Auflage,<br />
einschlägige Lehrveranstaltungen an möglichst<br />
vielen Fakultäten anzubieten. Diese Professur<br />
wurde mit Frau Dr. Mechthild Berreswill vom<br />
Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen<br />
besetzt. Eine fakultätsübergreifende Vernetzung<br />
ihres Lehrangebotes konnte dabei ansatzweise<br />
realisiert werden. Frau Dr. Berreswill bot insgesamt<br />
fünf Lehrveranstaltungen an, darunter unter<br />
anderem eine Forschungswerkstatt an der Fakultät<br />
Soziale Arbeit und Gesundheit; eine Wahlpflichtveranstaltung<br />
an der Fakultät Wirtschaft und eine<br />
Veranstaltung an der Fakultät Naturwissenschaften<br />
und Technik.<br />
Für das WS 04/05 hat das ZIF im Herbst 2003<br />
weiterhin im Rahmen des Maria-Goeppert-Mayer-<br />
Programms des Niedersächsischen Ministeriums für<br />
Wissenschaft und Kultur einen Antrag auf die<br />
Vergabe einer internationalen Gender-Gastprofessur<br />
für Frau Prof. Dr. Margrit Eichler, Lehrstuhl am<br />
Department of Sociology and Equity studies der
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
University of Toronto, gestellt. Dieser Antrag wurde<br />
inzwischen positiv entschieden. Wir erwarten Frau<br />
Dr. Eichler im WS 2004/2005 in Hildesheim.<br />
Tagungen und Vorträge<br />
22. Oktober 2003<br />
Urban Sex Attac. Stadt und Geschlecht<br />
Dr. Annette Geiger, Universität der Künste Berlin<br />
Fakultät Bauwesen <strong>HAWK</strong><br />
07. – 08. November 2003<br />
„Between Autonomy and Dependency: Reproductive<br />
Rights, Pregnancy and Motherhood of Teenagers<br />
and Young Women – Legal and Social Perspectives“<br />
Internationale Expertinnen-Tagung organisiert vom<br />
ZIF gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Scheiwe,<br />
Universität Hildesheim<br />
11. November 2003<br />
„Sterben und erfolgreiches Altern – wie passt das<br />
zusammen?“<br />
Prof. Dr. Karin Wilkening, Fachhochschule<br />
Braunschweig/Wolfenbüttel<br />
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
27. – 29. November 2003<br />
„netzwerke.formen.wissen. – Vernetzungs- und<br />
Abgrenzungsdynamiken der Frauen- und Geschlechterforschung“<br />
Expertinnen-Konferenz zum Aufbau und zur Pflege<br />
eines Netzwerkes der Einrichtungen und Studiengänge<br />
zur Frauen- und Geschlechterforschung im<br />
deutschsprachigen Raum
09. Dezember 2003<br />
„Jugend und Gewalt: Gefährlich oder gefährdet“<br />
Prof. Dr. Werner Greve, Universität Hildesheim<br />
Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit<br />
Personalangelegenheiten/Berufungs- und<br />
Stellenbesetzungsverfahren<br />
Ein großer Anteil der Beratungsgespräche in<br />
Personalangelegenheiten ergab sich aus der<br />
Nachfrage der Kolleginnen in Technik und<br />
Verwaltung. Neben aktuellen Problemen mit<br />
Kolleginnen/Kollegen und/oder Vorgesetzten am<br />
Arbeitsplatz standen hier Fragen im Hinblick auf<br />
Arbeitsplatzbeschreibungen, Umsetzungen,<br />
Weiterbeschäftigung, Stundenaufstockung oder<br />
Anträge auf Höhergruppierung im Mittelpunkt.<br />
Im Berichtszeitraum war die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte<br />
außerdem an 20 Berufungsverfahren<br />
beteiligt. In neun Verfahren erhielt eine Frau<br />
Platz 1 der Liste (Stand: 01.12.2003).<br />
Bei Stellenbesetzungsverfahren wirkte die Frauenbeauftragte<br />
an insgesamt 36 Verfahren mit. Von<br />
diesen Stellen konnten 26 Stellen jeweils mit<br />
Frauen besetzt werden (15 davon befristet; zwei<br />
Hausbewerbungen; zwei Azubis). Zehn Stellen<br />
wurden mit männlichen Bewerbern besetzt (sieben<br />
davon befristet; eine Hausbewerbung).<br />
Externe Aktivitäten<br />
Als Mitglied im Vorstand der „Bundeskonferenz der<br />
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Frauen- und Gleichstellungsbüro<br />
Hochschulen (BuKoF)“ nahm die Frauen- und<br />
Gleichstellungsbeauftragte an verschiedenen<br />
Gesprächen mit Ministerien, der Hochschulrektorenkonferenz<br />
(HRK), der DFG u. a. sowie an entsprechenden<br />
Tagungen und Konferenzen teil. Auf<br />
Landesebene ist sie stimmberechtigtes Mitglied im<br />
Arbeitsausschuss der „Landeskonferenz der<br />
Niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten<br />
(LNHF)“. Des Weiteren vertrat sie die Fachhochschule<br />
auf den Tagungen der LNHF und der „Landeskonferenz<br />
der Niedersächsischen Fachhochschulfrauenbeauftragten<br />
(LAKOF)“. Am 27./28. April 2003 war<br />
sie Gastgeberin der Frühjahrskonferenz der LAKOF.<br />
Frau Yel, Sachbearbeiterin im Frauen- und<br />
Gleichstellungsbüro, ist gewählte Sprecherin der<br />
Kommission MTV der LNHF und in dieser Funktion<br />
ebenfalls stimmberechtigtes Mitglied im Arbeitsausschuss<br />
sowie Mitglied in der Kommission Frauenförderung<br />
MTV der BuKoF.
Pressestelle<br />
Leitung<br />
Sabine zu Klampen<br />
Pressearbeit<br />
Die Pressestelle hat eine Vielzahl von Presseinformationen<br />
über kleinere und größere Projekte und<br />
Entwicklungen aller drei Standorte der Hochschule<br />
an die Medien herausgegeben. Dabei gab es einige<br />
herausragende Themen: So fand die Berufung von<br />
Prof. Iska Schönfeld für die Studienrichtung<br />
Lighting-Design der Fakultät Gestaltung als<br />
Deutschlands erste Professorin nach dem neuen W-<br />
Besoldungsrecht bundesweit große Beachtung.<br />
Auch die Zertifizierung der Fachhochschule<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen als eine von<br />
bundesweit vier „Familiengerechten Hochschulen“<br />
fand ein außerordentlich großes Presseecho.<br />
Medien in der gesamten Bundesrepublik berichteten<br />
zudem über die Einführung der einzigartigen<br />
Studiengänge Arboristik sowie Regionalmanagement<br />
und Wirtschaftsförderung an der Göttinger<br />
Fakultät Ressourcenmanagement.<br />
Auch die Einführung des Master-Studienganges<br />
Immobilienmanagement in Holzminden ist weit über<br />
die Region hinaus aufgegriffen worden. Überregional<br />
Beachtung fand auch das Forschungsprojekt zur<br />
Plasma-Oberflächenbehandlung von Holz an der<br />
Göttinger Fakultät Naturwissenschaften und<br />
Technik. Die Einführung des Studienangebotes<br />
Soziale Arbeit am Standort in Holzminden ist<br />
ebenfalls von vielen Presseberichten unterstützt<br />
worden.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Pressestelle<br />
Das so genannte Hochschuloptimierungskonzept<br />
des Niedersächsischen Wissenschaftsministers Lutz<br />
Stratmann und dessen Auswirkungen auf die<br />
Hochschule waren das Hauptthema der Pressestelle<br />
im Herbst und Winter des Jahres 2003. Die<br />
Diskussionen um die finanziellen Einschnitte und<br />
die in diesem Zusammenhang stehende Schließung<br />
der Fakultät Wirtschaft sind von den Medien<br />
intensiv begleitet und kommentiert worden. Hier<br />
hatte die Pressestelle eine Vielzahl von Anfragen zu<br />
bearbeiten, Kontakte herzustellen und Informationen<br />
herauszugeben.<br />
Internet<br />
Auf den Internetseiten der <strong>HAWK</strong> ist die Pressestelle<br />
mit einer eigenen Seite vertreten. Neben den<br />
beiden Rubriken „Pressemitteilungen“ und<br />
„Pressespiegel“ gibt es auch das „Medienverzeichnis“.<br />
Unter der Überschrift „Pressemitteilungen“<br />
sind die Mitteilungen, die die Pressestelle an die<br />
Öffentlichkeit gegeben hat, nachzulesen und von<br />
den Medien abrufbar. Unter dem Titel „Pressespiegel“<br />
sind die Veröffentlichungen zu finden, die<br />
regional und bundesweit in Zusammenhang mit der<br />
Hochschule in Zeitungen und Zeitschriften<br />
erschienen sind. In der Rubrik „Medienverzeichnis“<br />
werden von der Pressestelle die Broschüren und<br />
Fotos der Fakultäten beziehungsweise Studiengänge,<br />
die der Zentralen Einrichtungen und die die<br />
gesamte Hochschule betreffenden Broschüren<br />
eingestellt. Sie sind nicht nur aufgelistet, sondern<br />
als so genannte PDF-Dateien aufzurufen, anzusehen
und zu drucken. Das hat den Vorteil, dass für die<br />
schnelle Information der Postweg umgangen werden<br />
kann. Die Veröffentlichungen sind zusätzlich per E-<br />
Mail zu bestellen, entweder im Immatrikulationsamt<br />
oder bei Fotos in der Pressestelle. Das Medienverzeichnis<br />
ist noch im Aufbau und noch nicht<br />
vollständig. Es ist sowohl von Hochschulangehörigen<br />
als auch von Außenstehenden vielfach genutzt<br />
worden.<br />
Die Pressestelle war auch an den Vorbereitungen<br />
und der Einführung des neuen Internet-Auftritts der<br />
Hochschule beteiligt.<br />
Broschüren/Werbematerial<br />
Im Zuge des neuen Niedersächsischen Hochschulgesetzes<br />
hat die Hochschule ihre Struktur nicht nur<br />
von Fachbereichen auf Fakultäten, sondern auch<br />
den Namen umgestellt und sich ein neues Logo<br />
gegeben. Diese Neuorientierung hat die Pressestelle<br />
im Rahmen ihres Aufgabengebietes begleitet und<br />
war redaktionell an der Erstellung der ersten großen<br />
<strong>HAWK</strong>-Werbebroschüre für alle Fakultäten beteiligt.<br />
Marketing<br />
Im Rahmen des Projektes Hochschulmarketing<br />
kooperiert die Pressestelle in vielerlei Hinsicht mit<br />
der Universität Hildesheim und dem Bereich<br />
Stadtmarketing der Stadt Hildesheim.<br />
Das vom Frauenbüro initiierte und von der<br />
Pressestelle begleitete Projekt „Familiengerechte<br />
Hochschule“ konnte im März 2003 mit der
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Pressestelle<br />
feierlichen Übergabe des Zertifikats in Köln an der<br />
<strong>HAWK</strong> fest verankert werden. Die Pressestelle<br />
beteiligt sich auch weiterhin kontinuierlich an der<br />
Projektgruppe zur Einrichtung einer Kindertagesstätte.<br />
Hochschulinterne Information<br />
Die Pressestelle informiert die Hochschulangehörigen<br />
per Rundmail fortlaufend über Entwicklungen<br />
innerhalb der Hochschule beziehungsweise über<br />
hochschulpolitische Entscheidungen der Landesregierung.
Rechenzentrum<br />
Leitung<br />
Dipl.-Ing. Dieter Schilling<br />
Stellv. Leitung<br />
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Thiemrodt<br />
Mitarbeiter/innen<br />
– Dipl.-Ing. Michael Schlüter<br />
– Dipl.-Phys. Rainer Spiekermann<br />
– Dipl.-Phys. Hans Joachim Schaper<br />
– Wolfgang Walbröhl (Fak. Wirtschaft)<br />
– Dipl.-Ing. Dieter Jordan (Standort Holzminden)<br />
– Matthias Krieter (Standort Göttingen, Fak. R)<br />
– Ursula Otto (Sekretariat)<br />
– Michael Berghaus (Standort Göttingen, Fak. N)<br />
– Dogan Hiraoglu<br />
– Dipl.-Inf. Petra Rauterberg<br />
– Dipl.-Öko. Dirk Vornkahl<br />
– Dipl.-Pädagoge Thomas Kittel<br />
– Pädagoge Heiko Nordmann<br />
Aufgabenfeld<br />
Das Rechenzentrum ist eine zentrale Einrichtung der<br />
Fachhochschule.<br />
Die Aufgaben erstrecken sich unter anderem auf<br />
den Betrieb der hochschulöffentlich bereitgestellten<br />
Rechnersysteme und Datenkommunikationsnetze in<br />
Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung sowie<br />
zur Erledigung von Verwaltungsaufgaben. Das<br />
Rechenzentrum berät und unterstützt die Benutzer<br />
der DV-Anlagen und koordiniert die Beschaffungen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Rechenzentrum<br />
und Erweiterungen von DV-Anlagen, Datenkommunikationsnetzen<br />
und Rechnerprogrammen.<br />
Das Rechenzentrum ist an den drei Hauptstandorten<br />
der Fachhochschule in Hildesheim, Holzminden<br />
und Göttingen mit eigenen Abteilungen vertreten.<br />
Sachausstattung<br />
Beschaffungen von DV-Großgeräten (> 75.000,–<br />
Euro) aus dem Computer-Investitionsprogramm<br />
(CIP), dem Programm WAP (wissenschaftliche<br />
Arbeitsplätze)/CAM oder dem Fachhochschulentwicklungs-Programm<br />
(FEP) sowie sonstige DV-<br />
Gerätebeschaffungen oder -ergänzungen (> 5.000,–<br />
und < 75.000,– Euro) bzw. nennenswerte Einzelanschaffungen<br />
und -ergänzungen (< 5.000,– Euro)<br />
wurden im Berichtzeitraum wie folgt vorgenommen:<br />
Standort Hildesheim<br />
Rechenzentrum:<br />
Im Zuge der Namensumstellung <strong>HAWK</strong> wurde ein<br />
neues Mailsystem auf der Basis von Lotus-Notes<br />
beschafft und installiert. Das System wird für die<br />
gesamte Hochschule vorgehalten, die lokalen Mail-<br />
Systeme werden nach einer Übergangszeit<br />
abgeschaltet.<br />
Die zukünftigen Mail-Adressen sind wie folgt<br />
aufgebaut: Name@hawk-hhg.de<br />
Die alten Adressen gelten bis auf weiteres.
Netzsicherheit:<br />
Für den Standort wurde eine Firewall beschafft und<br />
die Antivirensoftware Sophos wurde im Rahmen<br />
einer Landeslizenz aktualisiert.<br />
Die Umsetzung von Netware 5.1 auf Netware 6.5<br />
wird z. Z. von zwei Mitarbeitern des Rechenzentrums<br />
vorbereitet. Das Clustersystem mit Netware 6.5 soll<br />
im Laufe des Jahres 2004 für den Echtzeitbetrieb<br />
freigeschaltet werden.<br />
Fakultät Wirtschaft:<br />
An der DV-Ausstattung des PC-Pools sowie den<br />
zentralen Komponenten wurden im Jahr 2003 keine<br />
wesentlichen Veränderungen vorgenommen.<br />
Fakultät Gestaltung:<br />
In dem Berichtzeitraum wurden einige kleinere<br />
Vernetzungsmaßnahmen in den Gebäuden<br />
Kaiserstraße 43 und Marienfriedhof durchgeführt.<br />
Ferner wurde für die Fakultät ein CIP-Antrag gestellt,<br />
der auch bewilligt wurde, aber durch die allgemeine<br />
Haushaltssperre nicht mehr beschafft werden<br />
konnte.<br />
Das Antragsvolumen belief sich auf 83.000,– Euro<br />
(22 Rechnersysteme, ein Serversystem sowie<br />
diverse Softwarepakete).<br />
Fakultät Sozialwesen:<br />
In dem Gebäude Hohnsen 1 wurde ein PC-Pool mit<br />
zehn Rechnersystemen installiert.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Rechenzentrum<br />
Die Rechnersysteme wurden im Raum 107 Hohnsen<br />
2 abgebaut. Die Richtfunkstrecke Hohnsen 1 – Brühl<br />
konnte in Betrieb genommen werden.<br />
Standort Holzminden<br />
Am Standort Holzminden wurde ein PC-Pool mit<br />
insgesamt zwölf Rechnersystemen für den<br />
Studiengang Sozialwesen installiert. Hier wurden<br />
die Systeme nicht für den Frontalunterricht<br />
aufgebaut, sondern durch die Konstruktion der<br />
Tische für Arbeitsgruppen errichtet. Diese Idee<br />
sollte für andere Pools vielleicht aufgegriffen<br />
werden.<br />
Des Weiteren wurde eine Firewall installiert.<br />
Standort Göttingen<br />
Für die Fakultät Naturwissenschaften und Technik<br />
wurde ein CIP/CAD-Pool in der Höhe von 83.000,–<br />
Euro beantragt. Die Beschaffung ist im Sommersemester<br />
2004 vorgesehen.<br />
An der Fakultät Ressourcenmanagement wurden<br />
keine Veränderungen vorgenommen.<br />
Betrieb<br />
Die DV-Systeme wurden im Jahr 2003 ohne größere<br />
Ausfallzeiten betrieben.<br />
Durch die Installation der Firewalls und der<br />
Virensoftware konnte die Netzsicherheit wesentlich<br />
erhöht werden. Eine 100-Prozent-Sicherheit gegen<br />
Angriffe von außen wird es aber nicht geben<br />
können.
luK-Technik<br />
Im Berichtzeitraum wurden diverse PCs als Ersatz<br />
für veraltetes Gerät oder als Neuausstattung durch<br />
die Verwaltung oder das Rechenzentrum beschafft.<br />
Der UNIX-Zentralrechner für die Immatrikulationsund<br />
Prüfungsverwaltung sowie die Mittelbewirtschaftung<br />
wurden planmäßig und ohne Ausfallzeiten<br />
betrieben.<br />
Ausblick<br />
Für die Hochschule stehen im Haushalt 2004<br />
weitere PC-Pools und wissenschaftliche Arbeitsplätze<br />
zur Verfügung. Das MWK hält sich aber wegen der<br />
Haushaltslage einen Finanzierungsvorbehalt vor.<br />
Das für 2003 angestrebte Plott-/Druckzentrum<br />
konnte aus organisatorischen und technischen<br />
Gründen noch nicht eingerichtet werden. Im Laufe<br />
des Jahres 2004 soll dieses Zentrum sowohl technisch<br />
als auch personell am Goschentor aufgebaut<br />
werden. Auch das Druckabrechnungssystem konnte<br />
wegen einer fehlenden Softwareschnittstelle nicht<br />
installiert werden.<br />
Es ist vorgesehen im ersten Halbjahr 2004 ein<br />
technisch ausgereiftes System zu installieren.<br />
Funktionsteste werden z. Z. im Rechenzentrum<br />
durchgeführt.<br />
Multimedia<br />
Die Multimedia-Hörsäle in Holzminden und<br />
Hildesheim (Goschentor) wurden installiert, und ein<br />
Probebetrieb fand im Wintersemester 2003/2004
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Rechenzentrum<br />
statt. Die Systeme funktionierten nach kleinen<br />
Anfangsschwierigkeiten problemlos. Die Vorlesungen<br />
zwischen Holzminden und Hildesheim<br />
(Gebäudesanierung von Prof. Dr. Leimer/Prof. Dr.<br />
Lamers) konnten einwandfrei übertragen werden.
Büro für Wissens- und<br />
Technologietransfer<br />
Leitung<br />
Dipl.-Ing. Karl-Otto Mörsch<br />
Mitarbeiterin<br />
Claudia Sommer<br />
Veranstaltungen<br />
Im September 2003 fand zum ersten Mal eine<br />
zweitägige Klausursitzung der Wissens- und<br />
Technologietransferstellen der niedersächsischen<br />
Hochschulen in Holzminden statt. Neben den<br />
Transferstellenteilnehmern nahmen Vertreter vom<br />
Innovationsnetzwerk, N-Transfer und dem<br />
Ministerium für Wissenschaft und Kultur teil.<br />
Die Ringvorlesung „Vorsprung durch Innovation –<br />
Innovationstraining für kleine und mittlere<br />
Unternehmen“ wurde mit vier weiteren Veranstaltungen<br />
im Sommersemester erfolgreich beendet.<br />
Durchschnittlich nahmen 25 Personen pro Abend<br />
teil. Jeder Veranstaltungstermin lebte von den<br />
Praxisbeispielen, die die Theorie belegten, da<br />
hauptsächlich Unternehmer zu den Referenten<br />
gehörten. Besonderen Dank ging an Herrn Hans-<br />
Günter Bock vom Bundesverband der mittelständigen<br />
Wirtschaft (BMBW) als kompetenter Moderator<br />
der Veranstaltungen.<br />
Im Jahre 2003 wurden in dieser Veranstaltung<br />
folgende Themen behandelt:<br />
23.01. Ideen schützen – Ideen nutzen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Büro für Wissens- und Technologietransfer<br />
06.02. Den Markt im Blick<br />
20.02. Der Weg in den Markt<br />
06.03. Netzwerke und Kooperationen<br />
Unser Büro vertrat die Hochschule im Kooperationsbeirat<br />
der Kooperationsstelle Hochschulen und<br />
Gewerkschaften in Hannover sowie bei den<br />
Sitzungen der Patentverwertungsoffensive des<br />
BMBF in Hannover. Bei der Durchführung der<br />
Veranstaltungen der Kooperationsstelle „SCIENCE-<br />
D@Y 2003“ konnten wir durch Vermittlung eines<br />
Referenten aus dem Studiengang Krankenversicherung<br />
helfen.<br />
Existenzgründung<br />
Gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft<br />
Hildesheim Region (HI-REG) mbH wurden an zwei<br />
Fakultäten und einem Fachbereich drei Existenzgründungsveranstaltungen<br />
durchgeführt. Als<br />
Referent stand Frau Gerlind Herzberg vom<br />
Gründerlotsen der HI-REG zur Verfügung.<br />
In unserem Büro erhalten interessierte Studierende<br />
erste Information zur Existenzgründung. Danach<br />
verweisen wir auf die kompetenten Ansprechpartner/innen<br />
bei der HI-REG oder dem Büro „Die<br />
Gründerfreundliche Hochschule“ in Hannover.<br />
Messen<br />
In diesem Jahr lag der Schwerpunkt unseres Büros<br />
auf der Vorbereitung, Organisation und Durchführung<br />
der Messebeteiligung an der LIGNA in<br />
Hannover. Die LIGNA ist die größte Holzfachmesse
der Welt und fand vom 26.05. bis 30.05.2003 statt.<br />
Studierende des Studienganges Holzingenieurwesen<br />
und Innenarchitektur haben unter der<br />
Federführung von Herrn Professor Misol<br />
(Fakultät Gestaltung) einen Messestand entworfen,<br />
gebaut, montiert und während der Messe betreut.<br />
Die beteiligten Studierenden haben dies in Ihrer<br />
Freizeit durchgeführt. Dafür gilt allen unser<br />
besonderer Dank.<br />
Der Stand hatte eine Größe von 180 m 2 und wurde<br />
unterstützt von Firmen und dem Niedersächsischen<br />
Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie aus<br />
Mitteln der Hochschule und unserem Büro.<br />
Die Aussteller auf unserem Hochschulmessestand<br />
waren:<br />
Prof. Dr. Ulrich Weihs,<br />
Fakultät Ressourcenmanagement:<br />
„Elektrische Widerstandstomographie an Bäumen“<br />
Prof. Dr. Michael Nelles,<br />
Fakultät Ressourcenmanagement:<br />
„Holzhackschnitzel“<br />
Prof. Dr. Wolfgang Viöl,<br />
Fakultät Naturwissenschaften und Technik:<br />
„Holz-Oberflächenveredelung durch Atomsphärendruck-Plasma“<br />
Prof. Dr. Klaus Bobey,<br />
Fakultät Naturwissenschaften und Technik:<br />
„Tree-Vision-System für Harvester“<br />
Prof. Werner Sauer, Fakultät Gestaltung:<br />
„Möbel für Kinder“<br />
Prof. Andreas Nentwig, Fakultät Bauwesen:<br />
Projekt „Jacke anziehen“
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Büro für Wissens- und Technologietransfer<br />
Prof. Dr. Gerdi Maierbacher-Legl,<br />
Dipl.-Rest. (FH) Ralf Buchholz,<br />
Fachbereich Konservierung und Restaurierung:<br />
„Historische Holzveredelung“<br />
Detaillierte Informationen zu den Exponaten finden<br />
Sie auf unseren Internetseiten.<br />
Wir vertraten die Hochschule auf weiteren Messen:<br />
25./26.01.2003 – Einstieg Abi in Hamburg<br />
21./22.03.2003 – Einstieg Abi in Köln<br />
Patent<br />
Der von der Innovationsgesellschaft der Universität<br />
Hannover gestellte Projektantrag im Rahmen der<br />
„BMBF Verwertungsoffensive“ ist an N-Transfer<br />
übertragen worden und wird von N-Transfer<br />
weitergeführt.<br />
Weitere Patente konnten angemeldet werden.<br />
Erstmals mussten anteilige Kosten für die<br />
Aufrechterhaltung und Anmeldung von Patenten<br />
unserer Hochschule übernommen werden.<br />
Ein erster Lizenzvertrag in Zusammenarbeit mit<br />
N-Transfer konnte abgeschlossen werden. Die<br />
Verhandlungen über einen weiteren Lizenzvertrag<br />
laufen noch.<br />
Mit Herrn Dr.-Ing. Jörg Schrader von N-Transfer<br />
konnten wir eine Info-Veranstaltung zum Thema<br />
„Urheberrecht und Geschmacksmuster“ anbieten.
Die Veranstaltung fand in der Fakultät Gestaltung<br />
statt. An dieser Veranstaltung nahmen 50<br />
Studierende teil.<br />
Herr Mörsch vertritt die Interessen unserer<br />
Hochschule im Arbeitsausschuss der niedersächsischen<br />
Hochschulpartner zur „BMBF-Verwertungsoffensive“<br />
bei N-Transfer.<br />
Forschung<br />
Das Büro für Technologie- und Wissenstransfer<br />
unterstützte Professorinnen und Professoren aus<br />
den Fakultäten bei der Suche nach Partnern zur<br />
Einrichtung von fachbezogenen Forschungsnetzwerken,<br />
eine Initiative des Niedersächsischen<br />
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur.<br />
Hilfestellung gab unser Büro bei Anträgen zur<br />
Arbeitsgruppe Innovative Projekte (AGIP), bei der<br />
Einreichung von Anträgen über Fördermittel aus<br />
dem „Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung“<br />
(EFRE) und der bei dem BMBF-Programm zur<br />
Förderung anwendungsorientierter Forschung und<br />
Entwicklung an Hochschulen (aFuE).<br />
Herr Mörsch gehört der Forschungskommission<br />
unserer Hochschule an.<br />
EU-Programm<br />
Aus dem EU-Programm LEONARDO DA VINCI, das<br />
Studierende bei einem Praktikum im europäischen<br />
Ausland unterstützt, konnten 33 Studierende einen<br />
Zuschuss bekommen. Die Praktikumsdauer betrug
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003 – Büro für Wissens- und Technologietransfer<br />
zwischen drei und sechs Monaten und wurde mit<br />
insgesamt 50.000,– Euro unterstützt. Dazu kommen<br />
noch Gelder für Sprachkurse und Reisekosten. Das<br />
Programm richtet sich an alle Studierende unserer<br />
Hochschule, die ein Praktikum in der EU absolvieren<br />
möchten.<br />
Herr Mörsch nahm an der zweitägigen Info- und<br />
Transfertagung „Profil Hochschule – Wirtschaft<br />
stärken“ des DAAD in Bonn teil.<br />
Unternehmenskontakte<br />
Durch die Messebeteilung an der LIGNA und der<br />
Veranstaltung „Vorsprung durch Innovation“<br />
konnten die Kontakte zu Unternehmen in der Region<br />
ausgeweitet werden. Gezielte Anfragen aufgrund der<br />
Messebeteiligung an der LIGNA wurden an die<br />
entsprechenden Professorinnen/Professoren<br />
weitergeleitet. Unser Büro half bei der Suche nach<br />
Praktikanten, Absolventen, Diplomanden und<br />
Gutachtern weiter.<br />
Veröffentlichungen<br />
Es wurde ein Flyer über die Exponate zur LIGNA für<br />
die Messebeteiligung in Hannover erstellt.<br />
Für die Absolventen des Studienganges Holzingenieurwesen<br />
wurde von unserem Büro eine<br />
Datenbank aufgebaut, die der Kommunikation der<br />
Absolventen untereinander dienen soll, langfristig<br />
aber den intensiven Austausch zwischen der<br />
Hochschule und den Unternehmen ermöglichen<br />
soll.
Weiter wurden, wie nach jedem Semester, die<br />
Diplomarbeitsthemen der einzelnen Fakultäten und<br />
dem Fachbereich zu einer Broschüre zusammengestellt.<br />
Dies finden Sie auch auf unseren Seiten im<br />
Internet.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003
Anhang<br />
Hochschulrat<br />
Der Hochschulrat besteht aus sieben Mitgliedern,<br />
von denen vier vom Senat und drei vom Wissenschaftsministerium<br />
bestellt werden.<br />
– Dr. Dieter Dohmen, Köln<br />
– Prof. Dr. Marlis Dürkop, Hamburg<br />
– Prof. Dr. Clemens Geißler, Langenhagen<br />
– Dr. Hans-Peter Geyer, Hildesheim<br />
– Dr. Uwe Reinhardt, Hannover<br />
– Andrea Ruhstrat, Göttingen<br />
– Barbara Wiedemann, Sarstedt<br />
An den Sitzungen des Hochschulrates nehmen mit<br />
beratender Stimme die Mitglieder des Präsidiums<br />
sowie die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte<br />
teil.
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Honorarprofessoren<br />
Zu Honorarprofessoren der <strong>HAWK</strong> Hochschule für<br />
angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen wurden<br />
2003 bestellt:<br />
– 04.07.2003 Markus Brockmann<br />
– 08.10.2003 Karl-Heinz Dietert<br />
– 14.11.2003 Dr. Erwin Stadlbauer<br />
Als Honorarprofessoren der <strong>HAWK</strong> Hildesheim/<br />
Holzminden/Göttingen schieden 2003 aus:<br />
– keine<br />
Honorarprofessoren<br />
Fakultät/Fachbereich Honorarprofessoren<br />
Fak. B (BHO) Dipl.-Ing. Markus Brockmann<br />
Fak. B (AHI) Eike Schlömilch<br />
Fak. B (BHI) Dipl.-Kfm. Michael Sommer<br />
Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Dietert<br />
FB K Dr. Peter Klein<br />
Dr. Erwin Stadlbauer<br />
Fak. R Dr. Carsten Hufenbach<br />
Dr. Dieter Steinhoff<br />
Fak. S Dipl.-Päd. Alois-Ernst Ehbrecht, M. A.<br />
Dr. Robert Gutfreund
Ehrensenatoren<br />
Als Ehrensenatoren der <strong>HAWK</strong> Hochschule für<br />
angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen wurden<br />
2003 bestellt:<br />
– keine<br />
Im Juni 2003 verstarb der Ehrensenator der <strong>HAWK</strong><br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen:<br />
– Prof. Georgi Airapetow<br />
staatliche Bauuniversität Rostow-am-Don<br />
Ehrensenator der <strong>HAWK</strong> Hildesheim/Holzminden/<br />
Göttingen ist seit Oktober 2002:<br />
– Drs. Pieter van Vliet<br />
Hogeschool van Amsterdam
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Senatsbeauftragte<br />
und -kommissionen<br />
Senatsbeauftragte<br />
Senatsbeauftragter für die Angelegenheiten<br />
behinderter Hochschulangehöriger:<br />
– Prof. Dr. Udo Wilken, Tel.: 05121/881-413<br />
Senatsbeauftragter für den Datenschutz:<br />
– Prof. Dr. Eberhard Lopau, Tel.: 05121/881-501<br />
Senatsbeauftragte für Technologietransfer:<br />
– Prof. Dr. Cornelia Behrens, Tel.: 05121/881-265<br />
Senatsbeauftragter für die Gestaltung von<br />
Drucksachen:<br />
– Prof. Gerd Finkel, Tel.: 05121/881-315<br />
Senatsbeauftragter für Immaturenprüfungen:<br />
– Prof. Dr. Udo Wilken, Tel.: 05121/881-413<br />
Senatskommissionen<br />
Kommission für Frauenförderung und Gleichberechtigung:<br />
Leitung: Frau Iris Linke, Tel.: 05121/881-101<br />
Planungskommission:<br />
Leitung: Prof. Dr. Johannes Kolb, Tel.: 05121/881-100<br />
Haushaltskommission:<br />
Leitung: Frau Iris Linke, Tel.: 05121/881-101<br />
Zentrale Studienkommission:<br />
Leitung: Prof. Dr. Hubert Merkel, Tel.: 05121/881-123
Forschungskommission:<br />
Leitung: Prof. Dr. Cornelia Behrens,<br />
Tel.: 05121/881-265<br />
Evaluierungskommission:<br />
Leitung: Prof. Dr. Cornelia Behrens,<br />
Tel.: 05121/881-265
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Von der Hochschule geförderte<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten<br />
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
B Prof. Dr. Collin Wirkungen des Semestertickets in<br />
Hildesheim<br />
B Prof. Dr. Herr Marktanalyse zur Erkennung von<br />
Future Trends in der Baukonstruktion<br />
für Stahlbau sowie Stahlbaubeton,<br />
Mauerwerksbau und Holzbau<br />
B Prof. Dr. Herr Systemorganisation und -<br />
management im Bauwesen<br />
B Prof. Obbelode Ertüchtigung historischer<br />
Fachwerkwände – Vergleichende<br />
Untersuchung anhand von drei<br />
Bauvorhaben<br />
B Prof. Dr. Paulsen Regionalspezifische<br />
Starkregencharakteristiken<br />
B Prof. Dr. Rogosch Minimierung der Nutzerkosten bei<br />
Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen<br />
im Straßenbau<br />
B Prof.’in Dr. Schmieder Optimierung der Sammel- und<br />
Prof. Dr. Paulsen Transportsysteme für die Rest- und<br />
Bioabfälle des Kreises Holzminden<br />
B Prof. Dr. Rogosch Minimierung der Nutzerkosten bei<br />
Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen<br />
im Straßenbau<br />
G Prof. Misol Zielsetzung, Inhalte und<br />
Vermittlungsmöglichkeiten von<br />
formalästhetischen-freidimensionalen<br />
Gestaltungsgrundlagen für das<br />
Studium und die Praxis im anwendungsbezogenen<br />
Industrie- und<br />
Produkt-Design<br />
K Prof.’in Engel Globenrestaurierung<br />
K Prof. Dr. Hammer Kompatible Fixierung/Konsolidierung<br />
von Wandmalerei und Architekturoberfläche<br />
mit Nanokalk und anderen<br />
hydrophilen Materialien<br />
K Prof.’in Dr. Maier- Mittelalterliche Stollentruhen aus<br />
bacher-Legl Siebenbürgen/Rumänien. Erfassen.<br />
Erschließen. Erhalten<br />
K Prof.’in Dr. Schädler- Zur Restaurierung und ästhetischen<br />
Saub Präsentation von Malerei und Plastik<br />
im 20. Jh. in Europa: Theoretische<br />
Positionen, Methoden und Techniken<br />
der Ergänzung und Retusche
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
K Prof.’in Dr. Schädler Mittelalterliche Rathäuser in<br />
-Saub Niedersachsen. Geschichte, Kunst,<br />
Erhaltung<br />
N Prof.’in Dr. Bartuch Charakterisierung von Kfz-<br />
Beleuchtungen<br />
N Prof. Dr. Bobey Augensicherer LED/LD-Strahler für<br />
Bildsensoranwendungen<br />
N Prof. Dr. Bobey Entwicklung eines CMOS-Bildsensorsystems<br />
für Holzerntemaschinen<br />
N Prof. Dr. Bobey Digital-Kamera mit Echtzeit-Farbmanagement<br />
für medizinische<br />
Anwendungen<br />
N Prof. Dr. Hirschberg Universelles Businterface zur<br />
Ankoppelung an Fahrzeug-<br />
Infotainment-Systeme<br />
N Prof. Dr. Kegler Offene standardisierte<br />
Steuerungstechnik<br />
N Prof.’in Dr. Koch Ultraschneller Rußdetektor<br />
N Prof.’in Dr. Koch Optischer Sensor zur schnellen<br />
Erfassung von Gas- und<br />
Flüssigkeitsleckagen<br />
N Prof. Leck Analytischer Nachweis von<br />
Hydrophobierungen auf<br />
mineralischen Baustoffen mittels<br />
plasmainduzierter Freisetzung<br />
N Prof. Leck Untersuchungen zur Freisetzung<br />
umweltgefährdender Stoffe bei der<br />
thermischen Zersetzung von Brandschutzbeschichtungen<br />
im Brandfall<br />
N Prof. Leck Laser- und Plasmaoberflächenbehandlung<br />
von Holz<br />
N Prof. Leck Analytischer Nachweis polymerer<br />
Dipl.-Ing.’in Meiners Zusatzstoffe in mineralischen<br />
Matrizes mittels GC-MS Vergleich<br />
pyrolytischer bzw. plasmainduzierter<br />
Freisetzung latent flüchtiger Stoffe<br />
N Prof. Dr. Müller Rasterelektronenmikroskopische<br />
Untersuchungen bei der Laser-<br />
Plasmaspektroskopie an<br />
pharmazeutischen Produkten<br />
N Prof. Dr. Nollau Kraftregelung eines elektrohydraulischen<br />
Windenantriebs
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
N Prof.’in Dr. Ohms Untersuchungen zum Korrosionsverhalten<br />
von Baustahl bei der<br />
Verwendung von Verzögerern auf<br />
Phosphonatbasis<br />
N Prof.’in Dr. Ohms Laser- und Plasmaoberflächenbehandlung<br />
von Holz<br />
N Prof. Dr. Osterried Messmethode für Verschleiß von<br />
Eisenbahnrädern<br />
N Prof. Dr. Schalz Hochgenaue Konturmessung an<br />
geschliffenen Glasoberflächen<br />
N Prof. Dr. Thielmann Entwicklung neuartiger,<br />
kieselsolmodifizierter Hybridpolymere<br />
für die Steinkonservierung<br />
N Prof. Dr. Viöl Plasmavorbehandlung eines Fingeroder<br />
Fußnagels für eine Lackierung<br />
N Prof. Dr. Viöl Laser- und Plasmaoberflächenbehandlung<br />
von Holz<br />
N Prof.’in Dr. Weidner Untersuchung und Erweiterung des<br />
Anwendungsbereiches der<br />
interaktiven Software NIMBUS<br />
N Prof.’in Dr. Weidner Testrichtlinien für Software zur Lösung<br />
mehrkriterieller Probleme<br />
N Dipl.-Ing. Wolf Analyse von EEG-Monitoring-Daten<br />
zur Lokalisierung von epileptischen<br />
Potentialen in Langzeitaufnahmen<br />
N Dipl.-Ing. Wolf Erweiterung eines Autonomen<br />
Intelligenten Systems zum Einsatz für<br />
virtuelle Versuche<br />
R Prof. Dr. Bombosch Aufbau und Entwicklung der<br />
Abteilung Forschung und Marketing<br />
im Kompetenznetz Holz zu einem<br />
eigenständigen Unternehmen<br />
R Prof. Dr. Harteisen Regionalökonomische Effekte der<br />
Errichtung von Nationalparken auf die<br />
umgebende Region. Entwicklung von<br />
Szenarien für die Modellregion Senne<br />
in NRW<br />
R Prof. Dr. Horsch Entwicklungsstand und Defizite von<br />
Controlling-Systemen (speziell im<br />
Kostenmanagement) in privatwirtschaftlichen<br />
Unternehmen<br />
R Prof. Dr. Kätsch Untersuchungen zur Schätzung der<br />
Nettoprimärproduktion der Wälder<br />
Mitteluropas im Jahresablauf mit Hilfe<br />
großräumiger Satellitenfernerkundung
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
R Prof. Dr. Kätsch Untersuchungen zur Modellierung der<br />
optimalen Landnutzung im südlichen<br />
Afrika zur Sicherstellung der Wasserund<br />
Nahrungsmittelversorgung<br />
R Prof. Dr. Metz Fortführung der Anbauversuche mit<br />
Pappel-Hybriden im Schnellwuchsbetrieb<br />
R Prof. Dr. Meierjürgen Urbane Forstwirtschaft – Entwicklung<br />
und Bedeutung für die Gesellschaft<br />
R Prof. Dr. Meierjürgen Initiierung eines Waldprogramms und<br />
Entwicklung maßgeblicher<br />
Kernpunkte<br />
R Prof. Dr. Nelles Wissenschaftliche Begleitung der<br />
großtechnischen Biogas-Pilotanlage<br />
mit integrierter Gärsubstratkonditionierung<br />
in Lüchow<br />
R Prof. Dr. Nelles Untersuchungen zur Verbesserung<br />
der Genehmigungssituation von<br />
Biogasanlagen<br />
R Prof. Dr. Nelles Energetische Verwertung von<br />
Hackschnitzeln in Heiz(kraft)werken<br />
aus dem Sanitärbetrieb und Waldpflegemaßnahmen<br />
verschiedener<br />
Laub- und Nadelhölzer<br />
R Prof. Dr. Nelles Implementierung angepasster<br />
Abfallwirtschaftskonzepte in China<br />
am Beispiel der Provinzhauptstadt<br />
Hefei<br />
R Prof. Dr. Nelles Evaluierung der Qualifikation von<br />
Jugendlichen vor dem Hintergrund<br />
anderer relevanter Arbeitsmarktakteure<br />
sowie exemplarische<br />
Implementierung der energetischen<br />
Biomasseverwertung<br />
R Prof. Dr. Nelles Untersuchung und Optimierung des<br />
Rotteverlaufs unbelüfteter Vorrottesysteme<br />
zur biologischen Abfallbehandlung<br />
R Prof. Dr. Nelles Untersuchung und Optimierung der<br />
Co-Fermentation in zweistufigen<br />
Biogasanlagen<br />
R Prof. Dr. Nelles Nachhaltige regionale Verwertung von<br />
Biomasse (Bioenergie Südniedersachsen)<br />
R Prof. Dr. Nelles Erschließung des Geschäftsfeldes<br />
Optimierung von Biogasanlagen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003<br />
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
R Prof. Dr. Nelles Erschließung des Geschäftsfeldes<br />
Versorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern<br />
bzw. öffentlichen<br />
Gebäuden mit Hackschnitzeln<br />
R Prof.’in Dr. Oestreich Gerichtliche Durchsetzung<br />
umweltrechtlicher Vorsorgepflichten<br />
durch den Nachbarn<br />
R Prof. Dr. Paarmann Funktions- und ökomorphologische<br />
Untersuchungen zur Erklärung der<br />
Gildenstruktur samenfressender<br />
Laufkäfer (Col., Carabidae) aus<br />
tropischen Regenwäldern<br />
R Prof. Dr. Paarmann Feststellung des Nahrungsspektrums<br />
der Laufkäferart Trichotichmus storeyi<br />
aus dem australischen Regenwald<br />
R Prof. Dr. Paarmann Die Wirtsartenbindung einer<br />
samenfressenden Laufkäferart aus<br />
dem australischen Regenwald<br />
R Prof.’in Dr. Rastin Untersuchungen zum Erfolg von<br />
Bodenschutzmaßnahmen im<br />
Hamburger Wald<br />
R Prof. Dr. Rohe Des Hasen Tod – Umweltgifte<br />
und/oder Flurbereinigung<br />
R Prof. Dr. Weihs Entwicklung eines Expertensystems<br />
zur zerstörungsfreien Baumdiagnose<br />
am stehenden Stamm<br />
R Prof. Dr. Weihs Energetische Verwertung von<br />
Hackschnitzeln in Heiz(kraft)werken<br />
aus dem Sanitärbetrieb und Waldpflegemaßnahmen<br />
verschiedener<br />
Laub- und Nadelhölzer<br />
R Prof. Dr. Weihs Erschließung des Geschäftsfeldes<br />
Versorgung von Ein- und Mehrfamilienhäusern<br />
bzw. öffentlichen<br />
Gebäuden mit Hackschnitzeln<br />
R Prof. Dr. Thren Beitrag zum Wachstum, zur Holztechnologie<br />
und zur waldbaulichen<br />
Behandlung von Abies grandis<br />
S Prof.’in Dr. Busche- Jugendhilfe und Schule – Evaluation<br />
Baumann von Kooperationsmodellen<br />
S Prof. Dr. Dahlmüller Zunehmende Maschinisierung und<br />
Mediatisierung des menschlichen<br />
Lebens<br />
S Prof. Dr. Finkeldey Markenkult, Kinderarbeit, Soziale<br />
Arbeit
Fakultät/<br />
Fachbereich Antragsteller/in Vorhaben<br />
S Prof. Dr. Finkeldey Evaluierung der Qualifikation von<br />
Jugendlichen vor dem Hintergrund<br />
anderer relevanter Arbeitsmarktakteure<br />
sowie exemplarische<br />
Implementierung der energetischen<br />
Biomasseverwertung<br />
S Prof. Dr. Hammer Arbeitsrechtliche Aspekte der<br />
Weiterbildung im Arbeitsverhältnis<br />
S Prof. Dr. Hammer Kirche und Staat – Plädoyer für ein<br />
Integriertes Kommissions- und<br />
Tarifmodell<br />
S Dipl.-Soz. Pich Sozialarbeiter/innen, Sozialpädagoginnen<br />
und Sozialpädagogen im<br />
Mikrozensus<br />
S Dipl.-Päd.’in Soziale Arbeit im internationalen<br />
Schindler Vergleich, speziell am Beispiel Italiens<br />
S Prof. Schwindt Prüfverfahren nach DIN EN 1498 und<br />
EN 362 und 365 für fachhochschuleigene<br />
Patente<br />
S Prof. Dr. Unterberger Psychologische Begleitung von<br />
Krebstherapien mit Hilfe von Medien<br />
W Prof. Dr. Lopau Internet-BGB<br />
W Prof. Dr. Schütz Kooperations-Lösungen für<br />
Marketing-Schnittstellen
<strong>HAWK</strong> Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Jahresbericht 2003