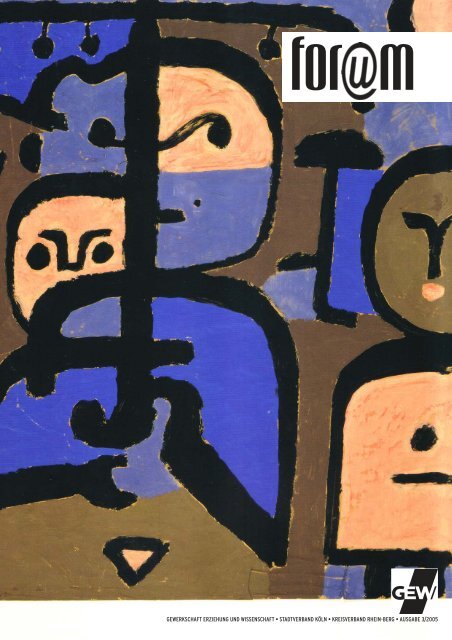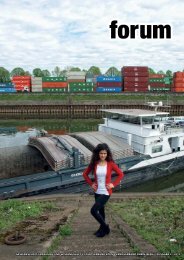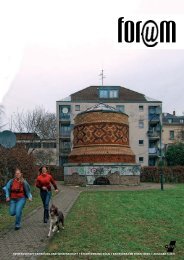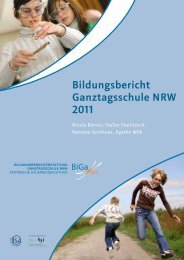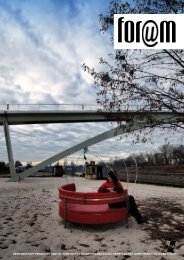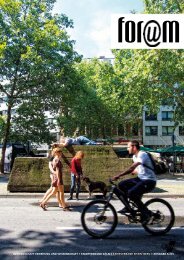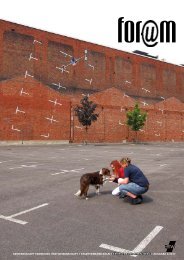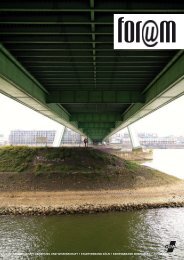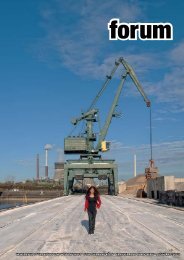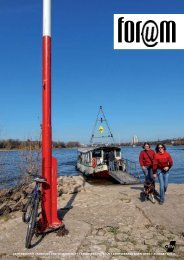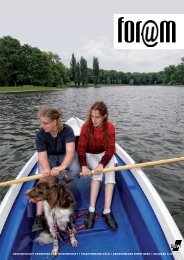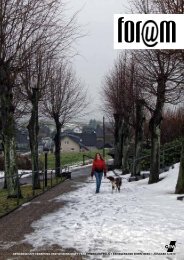Ausgabe 3/2005 - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Ausgabe 3/2005 - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Ausgabe 3/2005 - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
for m<br />
SEITE 1<br />
GEWERKSCHAFT ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT • STADTVERBAND KÖLN • KREISVERBAND RHEIN-BERG • AUSGABE 3/<strong>2005</strong>
KOMMENTAR<br />
Doppelrolle<br />
Doppelrolle<br />
GEW als Anwältin für Bildungsreformen <strong>und</strong> bessere Tarifbedingungen<br />
von Karl-Heinz Reith<br />
Wir leben in rauen Zeiten, in sorgenvollen Zeiten: Hartz IV <strong>und</strong> über fünf Millionen Arbeitslose. Nicht wenige Eltern,<br />
die heute noch eine scheinbar sichere Beschäftigung haben, bangen auch um ihren Arbeitsplatz. Können sie ihren<br />
Kindern morgen noch das ermöglichen, was heute oft schon schwer fällt <strong>und</strong> was zugleich als selbstverständlich<br />
gilt: Geld für die Klassenfahrt, Geld für Handy <strong>und</strong> Hobbys, Geld für Extra-Lernmittel, eigenen PC <strong>und</strong> Internet?<br />
Zur Angst vieler Mütter <strong>und</strong> Väter um Einkommen <strong>und</strong> Existenz der Familie kommt die Sorge um die Zukunft der<br />
Kinder. Lernen sie wirklich genug, um sich später im Arbeitsleben behaupten zu können? Wie sicher ist ihnen eine<br />
Lehrstelle? Was ist, wenn das Kind „nicht mal“ den Hauptschulabschluss schafft? Fast zehn Prozent Schulabbrecher<br />
pro Jahrgang - das ist kein Pappenstiel. Oder: Lohnen sich Abitur <strong>und</strong> Studium wirklich - bei den ständigen<br />
Hiobsbotschaften über Studiengebühren, BAföG-Kreditmodelle mit riesigen Rückzahlsummen <strong>und</strong> unsicheren<br />
Beschäftigungsperspektiven auch für Akademiker?<br />
Die Sorgen vieler Eltern finden sich bei Schülern wie Studierenden wieder: Lerne ich tatsächlich das Richtige für<br />
meine spätere Arbeit? Führt mich die angebotene Lehrstelle in eine Sackgasse oder in den gewünschten Beruf?<br />
Was soll ich überhaupt noch lernen, haben doch viele im Bekanntenkreis nach erfolgreicher Lehre mit ihrem<br />
Gesellenbrief zugleich die Kündigung erhalten? Und irritiert verfolgt so mancher Student während des Studiums<br />
das Auf <strong>und</strong> Ab sich ständig widersprechender Prognosen über die Zukunftsperspektiven etwa auf dem Lehrerarbeitsmarkt.<br />
Raue Zeiten, sorgenvolle Zeiten - doch nicht nur für Eltern <strong>und</strong> für junge Menschen, sondern auch für Erzieher,<br />
Lehrer, Weiterbildner oder Hochschulmitarbeiter. Steigende Ansprüche an ihre Arbeit, zu große Lerngruppen,<br />
Pflichtst<strong>und</strong>enzahl-Erhöhungen oder unbezahlte Mehrarbeit, Zwangs-Teilzeit im Osten, Gehaltseinbußen, Fristverträge<br />
<strong>und</strong> ungesicherte Arbeitsverhältnisse. Der Nachholbedarf in Sachen tarifliche Absicherung bei vielen<br />
freien Trägen ist riesig. In der Lehrerbildung ist eine echte Reform nicht in Sicht. Vehement sperren sich die Länder<br />
dagegen, die Erzieherausbildung endlich durch ein Hochschulstudium aufzuwerten - wie es international längst<br />
Standard ist. Und wer als Lehrer oder Erzieher dringend nach Weiterbildung oder Supervision ruft, bleibt meist sich<br />
selbst überlassen.<br />
Gleichwohl, allen Unkenrufen zum Trotz, sind in dieser Republik in jüngster Zeit einzelne Pflänzchen der Bildungsreform<br />
erblüht: mehr Ganztagsschulen <strong>und</strong> Nachmittagsbetreuung, Versuche mit Schulautonomie, endlich offizielle<br />
Anerkennung für frühkindliche Bildung in Kindergärten <strong>und</strong> Horten. Die gewünschten Reformen wie Ganztagsschule,<br />
Lernen in heterogenen Gruppen, individuelle Förderung der Schüler, spielerisches frühes Lernen im Kindergarten<br />
- das alles fordert auch von den Beschäftigten im Bildungswesen zunächst mehr Kraft <strong>und</strong> Zeit <strong>und</strong> Abschied<br />
vom bekannten Trott. Neues Denken <strong>und</strong> Reformen sind bisweilen anstrengend. Erschwert wird dies, wenn<br />
die Finanzminister dabei den Rahmen nachhaltiger prägen als die Bildungs- oder Jugendminister, die notwendige<br />
Personalressourcen nur unzureichend aufstocken oder gar verweigern. Die Situation der öffentlichen Kassen ist<br />
hinlänglich bekannt. Die Konflikte scheinen programmiert.<br />
Doch deshalb auf Änderungen gänzlich verzichten? Die Bildungsgewerkschaft GEW hat sich in ihrer Geschichte<br />
von vielen anderen Interessensverbänden bisher dadurch unterschieden, dass sie nicht nur Hüter der ökonomischen<br />
wie sozialen Arbeitsplatzinteressen ihrer Mitglieder war, sondern stets auch Antreiber <strong>und</strong> Motor für Bildungsreformen.<br />
Dabei befindet sich die GEW sozusagen in einer Doppelrolle, einerseits als Anwältin für die<br />
Beschäftigten im Bildungsbereich, andererseits als Anwältin für die betroffenen jungen Menschen <strong>und</strong> Eltern.<br />
Diese Doppelrolle bedeutet auch nach klassischem gewerkschaftspolitischen Verständnis keinen Widerspruch in<br />
sich. Viele Lehrer sind nicht deswegen heute so erschöpft, weil sie zu viel arbeiten. Sie fühlen sich unter anderem<br />
deshalb so kaputt <strong>und</strong> ausgebrannt, weil ihnen für die tradierte Form einer Schule der Selektion längst der pädagogische<br />
Sinn abhanden gekommen ist: Unter diesen Bedingungen müssen sie als Pädagogen einfach „falsch“<br />
<strong>und</strong> gegen innere Überzeugung arbeiten.<br />
Das gesellschaftspolitische Eintreten der GEW für eine neue Schule ist also auch zugleich gewerkschaftliches<br />
Engagement für bessere Arbeitsqualität. Ein pädagogischer Aufbruch, Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz <strong>und</strong> der<br />
eigenen Arbeit - das sind die besten Indikatoren für beruflichen Erfolg in der Schule, im Kindergarten wie anderen<br />
Bildungsstätten. Nur in dieser Doppelrolle ihres Engagements für inhaltliche Bildungsreformen wie für bessere<br />
Tarifbedingungen wird die GEW auch in Zukunft ihrem umfassenden gewerkschaftspolitischen Anspruch gerecht.<br />
(entnommen aus E & W, <strong>Ausgabe</strong> April)<br />
SEITE 2
IMPRESSUM<br />
Herausgeber: GEW Stadtverband Köln,<br />
Hans-Böckler-Platz 1, 50672 Köln<br />
Erscheint fünfmal im Jahr; Bezugspreis 1,25 Euro<br />
Für GEW-Mitglieder ist der Bezug des forum im<br />
Mitgliedsbeitrag enthalten. Leserbriefe geben nicht<br />
in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.<br />
Redaktion:<br />
Henning Cremer, Nanny Gatzen-Stadter,<br />
Klaus Minartz (verantwortlich)<br />
GESCHÄFTSSTELLE<br />
Montag bis Donnerstag 10.00 bis 16.00 Uhr<br />
Freitag 12.00 bis 16.00 Uhr<br />
Telefon 02 21 51 62 67<br />
Telefax 02 21 52 54 46<br />
Homepage www.gew-koeln.de<br />
E-MAIL gew-koeln@netcologne.de<br />
BANKVERBINDUNG<br />
SEB<br />
BLZ 370 101 11<br />
Konto 1320732101<br />
Redaktionsschluss 12. August <strong>2005</strong><br />
Erscheinungstermin 6. September <strong>2005</strong><br />
TELEFONISCHE RECHTSBERATUNG<br />
Telefon 02 21 51 62 67<br />
Montag <strong>und</strong> Donnerstag 17.00 bis 19.00 Uhr<br />
<strong>und</strong> nach Vereinbarung<br />
In den Ferien:<br />
Landesrechtsschutzstelle 02 01 2 94 03 37<br />
Druck: Prima Print, Köln<br />
DTP: Thomas Sommerkamp, Witten<br />
Titelbild:<br />
(siehe Preisausschreiben)<br />
Wenn GEW, dann<br />
www.gew-koeln.de<br />
forum 3/<strong>2005</strong><br />
SEITE 3<br />
INHALT<br />
Kommentar 2<br />
Impressum <strong>und</strong> Inhalt 3<br />
Ein-Euro-Jobs / Tarifpolitik<br />
Arbeitsgelegenheit 4<br />
Beschluss <strong>Gewerkschaft</strong>stag 5<br />
Empfehlungen an Schulleitungen 7<br />
Tarif: Arbeitszeit ist Knackpunkt 9<br />
Bildungspolitik<br />
Forderung nach Förderung 10<br />
Fordern <strong>und</strong> Fördern 13<br />
Sozialpädagogen<br />
Neuer AK KiTa 17<br />
Service 18<br />
HIB 19<br />
Fachgruppen & Arbeitskreise 20<br />
Gr<strong>und</strong>schulfragebogen 22<br />
Aktive Ruheständler 23<br />
Rhein-Berg 24<br />
UE Zwangsheirat 25<br />
Edelweißpiraten-Festival 26<br />
Preisausschreiben 27<br />
Rechtsberatung 27
EIN-EURO-JOBS<br />
»Arbeitsgelegenheiten<br />
gegen Aufwandsentschädigung«<br />
von Heiko Gosch<br />
Vorwort zur Broschüre „Ein-Euro-<br />
Jobs“ der GEW. Diese ist zu beziehen<br />
über www.gew.de oder über unsere<br />
Kölner Geschäftsstelle www.gewkoeln.de.<br />
Mit der Einführung des Arbeitslosengeldes<br />
II, d.h. der Zusammenlegung von<br />
Arbeitslosen- <strong>und</strong> Sozialhilfe wurde ein<br />
Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik<br />
vollzogen. Unabhängig davon, welche<br />
Qualifikation vorhanden ist, welches<br />
Einkommen in einem früheren Arbeitsverhältnis<br />
erzielt wurde <strong>und</strong> wie lange<br />
in der Vergangenheit in die Arbeitslosenversicherung<br />
eingezahlt wurde, in<br />
der Regel nach einem Jahr – spätestens<br />
nach dreieinhalb Jahren -, fallen Arbeitslose<br />
auf das Sozialhilfeniveau. Mit<br />
Hartz IV verbindet der Gesetzgeber<br />
gleichzeitig die Zielsetzung, Langzeitarbeitslose<br />
an den Arbeitsmarkt „heranzuführen“.<br />
Wesentliches Instrument<br />
sind dabei die „Arbeitsgelegenheiten<br />
gegen Aufwandsentschädigung“, zu<br />
denen die Arbeitslosengeld II-Empfänger<br />
seit dem 1. Januar verpflichtet<br />
werden können. Die GEW lehnt diese<br />
»Arbeitsgelegen-heiten« entschieden ab.<br />
(siehe Beschluss des GEW - <strong>Gewerkschaft</strong>stages<br />
im April <strong>2005</strong> in Erfurt auf<br />
der Seite 6)<br />
Über Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen<br />
sollen im<br />
öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche<br />
Arbeiten verrichtet werden. Nach<br />
den Kriterien der B<strong>und</strong>esagentur für<br />
Arbeit (BA) liegen insbesondere gemeinnützige<br />
Arbeiten im öffentlichen<br />
Interesse. In dem Beispielkatalog der<br />
BA werden die Bereiche <strong>Wissenschaft</strong><br />
<strong>und</strong> Forschung sowie Bildung <strong>und</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> an vorderster Stelle genannt.<br />
Wir müssen also davon ausgehen - erste<br />
Praxisberichte aus einzelnen B<strong>und</strong>esländern<br />
bestätigen dies -, dass im Bereich<br />
der GEW verstärkt Ein-Euro-Jobs<br />
geschaffen werden.<br />
Ein-Euro-Jobs sollen also zusätzliche<br />
Angebote ermöglichen. Arbeit des<br />
festangestellten Personals soll nicht<br />
übernommen werden. Wie begründet<br />
die Ablehnung von Ein-Euro-Jobs durch<br />
die GEW ist, zeigen erste Berichte aus<br />
Kindergärten, Schulen <strong>und</strong> Hochschulen.<br />
Ein-Euro-Jobber nehmen faktisch<br />
Regelaufgaben wahr. Jeweils wird argumentiert,<br />
dass das vorhandene festangestellte<br />
Personal durch seine Pflichtaufgaben<br />
ausgelastet sei <strong>und</strong> weitere<br />
wünschenswerte Aktivitäten deshalb<br />
unterbleiben müssten. So werden z. B.<br />
an der Universität in Marburg im<br />
Rahmen einer ,,Arbeitsgelegenheit“<br />
Dokumente wissenschaftlich ausgewertet,<br />
die andernfalls unbearbeitet weiter<br />
im Archiv lagern würden. Diese Aufgaben<br />
werden von arbeitslosen Akademikern<br />
wahrgenommen. In Schulen droht,<br />
dass Ein-Euro-Jobber pädagogische<br />
,,Sonderaufgaben“ übernehmen. Hierzu<br />
könnten insbesondere Aufgaben gehören,<br />
die unstreitig pädagogisch sinnvoll<br />
<strong>und</strong> erforderlich erscheinen, aber<br />
infolge der Arbeitsaus- <strong>und</strong> überlastung<br />
vom festangestellten Personal nicht<br />
mehr ausgeführt werden können.<br />
Hierzu zählen z.B. Leseförderung <strong>und</strong><br />
Differenzierungsangebote, aber auch<br />
Aufsichten <strong>und</strong> pädagogische Unterrichtshilfen<br />
im Regelunterricht. Im Falle<br />
einer Übernahme von Aufsichten <strong>und</strong><br />
der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien<br />
könnte der Eindruck entstehen,<br />
dass hier zu einer Entlastung<br />
von Lehrkräften beigetragen werden<br />
SEITE 4<br />
soll. Statt dessen droht vielmehr, dass<br />
an den Schulen schrittweise eine Differenzierung<br />
der Arbeitsaufgaben in<br />
Kernbereiche <strong>und</strong> Zusatzangebote<br />
erfolgt. Der Kernbereich würde von<br />
festangestellten Lehrkräften <strong>und</strong> anderem<br />
Fachpersonal wahrgenommen<br />
werden. Zusatzangebote würden im<br />
Rahmen von ,Arbeitsgelegenheiten „<br />
umgesetzt werden. Damit würde faktisch<br />
die Einrichtung fester Arbeitsplätze<br />
verhindert werden.<br />
Auch in Kindergärten ist zu befürchten,<br />
dass die Ausstattung mit regulärem<br />
Personal verschlechtert wird. Eine Spaltung<br />
in Kernaufgaben <strong>und</strong> Zusatzangebote<br />
könnte auch hier zur Folge<br />
haben, dass jeweils nur eine verantwortliche<br />
Fachkraft in den Kindergruppen<br />
in einem festen Anstellungsverhältnis<br />
tätig ist. Weitere Fachkräfte würden<br />
auch hier vorrangig in Form von „Arbeitsgelegenheiten“<br />
eingesetzt werden.<br />
Öffentliche Arbeitgeber <strong>und</strong> Wohlfahrtsverbände<br />
stehen infolge der<br />
Steuerpolitik von Rot-Grün <strong>und</strong> der<br />
Blockadepolitik der Union im B<strong>und</strong>esrat<br />
unter fortgesetzten Zwängen, in den<br />
Haushalten zu kürzen. Unter diesem<br />
Druck wird zwangsläufig der Blick auf<br />
die Einrichtung von Ein-Euro-Jobs<br />
gelenkt werden.<br />
Betriebs- <strong>und</strong> Personalräten kommt<br />
dabei die Aufgabe zu, die Interessen der<br />
Beschäftigten <strong>und</strong> die der Arbeitssuchenden<br />
miteinander zu verbinden<br />
<strong>und</strong> zu vertreten. Das gemeinsame<br />
Interesse besteht in der Sicherung der<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten <strong>und</strong> der<br />
Schaffung von ordentlichen, sozialversicherungsrechtlich<br />
geschützten<br />
Arbeitsverhältnissen.
Mit dieser Handlungshilfe will die GEW<br />
Betriebs- <strong>und</strong> Personalräte in die<br />
Lage versetzen, ihre Einflussmöglichkeiten<br />
bei der Schaffung <strong>und</strong> Ausgestaltung<br />
von Arbeitsgelegenheiten<br />
wahrzunehmen. Betriebs- <strong>und</strong> PersonaIräte<br />
können auf die Einhaltung der<br />
Kriterien für die Schaffung von Ein-<br />
Euro-Jobs wie öffentliches Interesse,<br />
Zusätzlichkeit, Wettbewerbsneutralität<br />
<strong>und</strong> arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit<br />
achten. Obwohl Arbeitslose, die<br />
in Ein-Euro-Jobs eingesetzt werden,<br />
keinen Arbeitnehmerstatus hoben,<br />
können Betriebs- <strong>und</strong> Personalräte bei<br />
der Eingliederung in den Betrieb mitreden.<br />
Ausdrücklich hinweisen möchte<br />
ich auf die Möglichkeit des Abschlusses<br />
von Betriebs- <strong>und</strong> Dienstvereinbarungen<br />
zum Einsatz von Arbeitslosen in<br />
Ein-Eurojobs. Hier können betriebsbezogen<br />
Kriterien zur Abgrenzung von<br />
,,Arbeitsgelegenheiten“ zu regulären<br />
Arbeitsplätzen definiert werden, Arbeitsbedingungen<br />
festgelegt <strong>und</strong> Übernahmekriterien<br />
in reguläre Arbeitsverhältnisse<br />
bestimmt werden.<br />
Trotz der gr<strong>und</strong>sätzlichen Ablehnung<br />
der „Arbeitsgelegenheiten“ durch die<br />
GEW müssen Betriebs- <strong>und</strong> Personalräte<br />
in die Lage versetzt werden, ihre<br />
Rechte optimal wahrzunehmen. Manche<br />
Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt<br />
aber auch noch nicht abschließend<br />
beantwortet werden. Dazu liegen<br />
noch zu wenige Praxisberichte vor <strong>und</strong><br />
keinerlei gerichtliche Entscheidungen.<br />
Wir wollen deshalb diese Broschüre<br />
laufend fortschreiben <strong>und</strong> aktualisieren.<br />
EIN-EURO-JOBS<br />
Beschluss des GEW-<strong>Gewerkschaft</strong>stages<br />
Gegen Arbeitszwang durch Ein-Euro-Jobs<br />
Für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung<br />
I.<br />
Die GEW lehnt die Verpflichtung von<br />
Arbeitslosen zur Übernahme von Arbeit<br />
gegen eine bloße Mehraufwandsentschädigung<br />
ab. Sie verurteilt dies als eine<br />
neue Form von Arbeitszwang <strong>und</strong> sieht<br />
darin einen Verstoß gegen Artikel 12, Absatz<br />
2 GG.<br />
Diese sogenannten ,,Arbeitsgelegen-heiten“,<br />
die das S GB II (Hartz IV) für Bezieher von<br />
Arbeitslosengeld II (,,ALG II“) vorsieht,<br />
sind der bisher massivste Angriff auf soziale<br />
<strong>und</strong> arbeitsrechtliche Standards. Sie werden<br />
zu einer weiteren Verdrängung versicherungspflichtiger<br />
Beschäftigungsverhältnisse<br />
führen <strong>und</strong> zielen darauf ab,<br />
• die Beschäftigungs- <strong>und</strong> Entlohnungsbedingungen<br />
allerArbeitnehmerinnen <strong>und</strong><br />
Arbeitnehmer anzugreifen,<br />
• die öffentlichen <strong>und</strong> privaten Arbeitgeber<br />
weiter aus ihrer Verantwortung zur Schaffung<br />
von regulären Arbeitsplätzen zu<br />
entlassen <strong>und</strong> den Stellenabbau zu beschleunigen,<br />
• die politisch bewusst erzeugte Unterfinanzierung<br />
der öffentlichen Haushalte zu<br />
verschleiern <strong>und</strong> gesellschaftlich notwendige<br />
Arbeiten zum „Nulltarif“ zu erledigen,<br />
• zusätzliche Möglichkeiten zu<br />
schaffen, die sozialen Leistungen<br />
gegenüber Arbeitslosen<br />
drastisch zu kürzen <strong>und</strong><br />
Sanktionen zu verhängen,<br />
• die Arbeitslosenstatistik zu<br />
verfälschen.<br />
Einen Beitrag zum Abbau der<br />
Arbeitslosigkeit <strong>und</strong> zur<br />
Schaffung von Beschäftigung<br />
leisten diese Maßnahmen<br />
nicht. Sie bieten den<br />
von Arbeitslosigkeit Betroffenen<br />
letztlich keine Pers-<br />
SEITE 5<br />
pektive, da sie die Schaffung notwendiger<br />
Arbeitsplätze behindern. Die Notlage<br />
arbeitsloser Menschen wird so schamlos<br />
ausgenutzt. Stattdessen ist ein öffentlich<br />
geforderter Beschäftigungssektor mit<br />
regulären sozialversich-erungspflichtigen<br />
Arbeitsverhältnissen <strong>und</strong> tariflicher bzw.<br />
ortsüblicher Entlohnung aufzubauen.<br />
II.<br />
Die GEW hält den Einsatz von Arbeitsgelegenheiten<br />
mit Mehraufwandsentschädigung<br />
(MAE) im Bildungsbereich für<br />
einen falschen <strong>und</strong> gefährlichen Weg. Damit<br />
werden die notwendigen regulären Stellen<br />
für Lehrkräfte <strong>und</strong> andere qualifizierte<br />
Beschäftigte verdrängt <strong>und</strong> faktisch ein<br />
Niedriglohnsektor in den verschiedenen<br />
Bildungseinrichtungen eingeführt. Sie stellt<br />
dazu fest:<br />
Der Einsatz von ,,Ein-Euro-Jobs“ in Kitas,<br />
Schulen, Hochschulen <strong>und</strong> Weiterbildungseinrichtungen<br />
betrifft pädagogische,<br />
technische <strong>und</strong> Verwal-tungsaufgaben, die<br />
i.d.R. zu den regulären Pflichtaufgaben des<br />
Staates gehören. Diese Aufgaben dürfen<br />
nicht zum Null-Tarif mit „Ein-Euro-Arbeitskräften“<br />
erledigt werden, da es sich<br />
i.d.R. nicht um zusätzliche oder ergänzende
Aufgabenfelder handelt. Der Einsatz von<br />
„Ein-Euro-Kräften“ führt dazu, dass der<br />
Stellenabbau beschleunigt wird <strong>und</strong> notwendige<br />
Arbeitsplätze gar nicht erst geschaffen<br />
werden. Darunter leidet die Qualität<br />
von Bildungsarbeit. Notwendige Neueinstellungen<br />
werden verhindert.<br />
Die Betreuung, Förderung <strong>und</strong> Bildung von<br />
Kindern bzw. jungen <strong>und</strong> erwachsenen<br />
Menschen ist ein auf eine langfristige<br />
Entwicklungsbegleitung angelegter Prozess.<br />
Der Erfolg von Bildung <strong>und</strong> <strong>Erziehung</strong> ist in<br />
hohem Maße davon abhängig, dass Kinder<br />
<strong>und</strong> Jugendliche stabile Beziehungen zu<br />
Lehrkräften <strong>und</strong> Erzieher/innen aufbauen<br />
können. Personelle Kontinuität ist dafür<br />
eine wesentliche Voraussetzungen. Wenn<br />
Beschäftigte lediglich für einen<br />
begrenzten Zeitraum eingesetzt werden,<br />
wird dieser pädagogische Prozess erheblich<br />
gefährdet Die GEW fordert die Schaffung<br />
regulärer Arbeitsplätze für die notwendigen<br />
Aufgaben im Bildungsbereich.<br />
III.<br />
Die GEW fordert die Personal- <strong>und</strong> Betriebsräte<br />
auf, mit allen ihnen zur Verfügung<br />
stehenden rechtlichen Mitteln den<br />
Einsatz von Arbeitslosen mit Mehraufwandsentschädigung<br />
in Bildungseinrichtungen<br />
zu verhindern, insbesondere<br />
wenn die folgenden Bedingungen nicht<br />
erfüllt sind: Arbeitsgelegenheiten“ gegen<br />
Aufwandsent-schädigung dürfen nur dort<br />
eingerichtet werden, wo in den letzten drei<br />
Jahren kein Abbau von Stellen bzw. Arbeitsplätzen<br />
erfolgt ist <strong>und</strong> keine sog. Personalüberhänge<br />
bestehen. Die Träger solcher<br />
Maßnahmen müssen verpflichtet werden,<br />
dies nachzuweisen <strong>und</strong> insbe-sondere<br />
darzulegen, dass die zu erledigenden<br />
Arbeiten zusätzlich sind. Die Zusätzlichkeit<br />
ist daran zu messen, dass diese Arbeiten<br />
nicht durch reguläre Beschäftigte erledigt<br />
EIN-EURO-JOBS<br />
werden können; die fehlende Finanzierung<br />
ist kein Kriterium für Zusätzlichkeit! Die<br />
Einrichtungen mit Ein-Euro-Jobs müssen<br />
zudem nachweisen, dass sie während der<br />
Laufzeit dieser Maßnahmen keine Arbeitsplätze<br />
abbauen.<br />
• Die Zusätzlichkeit ist von den Arbeitsgemeinschaften<br />
streng zu prüfen <strong>und</strong> gegenüber<br />
den jeweiligen Beiräten der Arbeitsgemeinschaften<br />
in jedem Einzelfall nachzuweisen.<br />
Voraussetzung für die Übernahme<br />
von Tätigkeiten in Bildungseinrichtungen<br />
durch einen Langzeitarbeitslosen ist dessen<br />
entsprechende Qualifikation, z. B. eine<br />
einschlägige Ausbildung zum Lehrer/zur<br />
Lehrerin bzw. Sozialpädagogen. Der Einsatz<br />
von nicht oder nur unzureichend qualifizierten,<br />
möglicherweise auch fachfremden<br />
Arbeitslosen in pädagogischen Arbeitsfeldern<br />
ist zu verhindern. Die Träger müssen<br />
sich verpflichten, bei Bedarf auch<br />
zusätzliche Qualifizie-rungsmaßnahmen<br />
für Menschen in Arbeitsgelegenheiten<br />
anzubieten.<br />
IV.<br />
Für alle Langzeitarbeitslosen in Arbeitsgelegenheiten<br />
müssen folgende Gr<strong>und</strong>sätze<br />
gelten:<br />
• Eine Arbeitsgelegenheit darf nur mit<br />
Einwilligung des Arbeitslosen <strong>und</strong> nur nach<br />
einem ausführlichen Beratungsgespräch<br />
<strong>und</strong> Profiling, in dem die jeweiligen Kompetenzen<br />
<strong>und</strong> Defizite festgestellt werden, in<br />
Erwägung gezogen werden. Sie muss in<br />
einen individuellen Eingliederungsplan<br />
einbezogen sein, der die mittel- <strong>und</strong> langfristige<br />
(also nicht nur die kurzfristige)<br />
Integration zum Ziel hat. Eine Segmentierung<br />
in unterschiedliche „K<strong>und</strong>engruppen“,<br />
die das Vorenthalten bestimmter Förderinstrumente<br />
zur Folge hat, ist abzulehnen.<br />
Daher müssen vor allem die anderen,<br />
in § 16 SGB II vorgesehenen Möglichkeiten<br />
SEITE 6<br />
<strong>und</strong> Unterstützungsmaßnahmen, z.B. auch<br />
Qualifizierung, vorrangig genutzt werden.<br />
Die Verengung der Förderinstrumente für<br />
ALG II-Empfänger auf Ein-Euro-Jobs<br />
widerspricht den gesetzlichen Fördergr<strong>und</strong>sätzen,<br />
wonach Arbeitsgelegenheiten<br />
nachrangig gegenüber allen anderen<br />
Förderinstrumenten <strong>und</strong> fir die Eingliederung<br />
in das Erwerbsleben im Einzelfall<br />
erforderlich sein müssen.<br />
• Für Jugendliche unter 25 sind ,,Ein-Euro-<br />
Jobs“ i. d. R. ein untaugliches Instrument.<br />
Im Vordergr<strong>und</strong> muss hier stehen, den<br />
Jugendlichen eine Integrations- <strong>und</strong> Qualifizierungsperspektive<br />
zu bieten statt sie in<br />
Ein-Euro-Jobs unter zu bringen.<br />
• Die Arbeitsgemeinschaften sind zu<br />
verpflichten, in den Beiräten regelmäßig<br />
Rechenschaft abzulegen über die Zahl der<br />
eingerichteten MAE, die jeweiligen Einsatzfelder,<br />
die Prüfung der Zusätz-lichkeit, die<br />
Qualifikation der Arbeitslosen <strong>und</strong> entsprechende<br />
Qualifizierungsmaßnahmen <strong>und</strong> die<br />
jeweiligen Träger dieser Maßnahmen.<br />
V.<br />
Die GEW fordert ihre Mitglieder auf, den<br />
Einsatz von ,,Ein-Euro-Jobs“ in den Kollegien,<br />
in Gesamtkonferenzen, Personalversammlungen<br />
<strong>und</strong> Betriebsgruppenversammlungen<br />
der verschiedenen Bildungseinrichtungen<br />
zum Thema zu machen.<br />
Wir brauchen eine offene <strong>und</strong> breite<br />
Diskussion mit den KollegInnen, mit Eltern,<br />
Schüler/innen <strong>und</strong> Studierenden, was uns<br />
Bildung wert sein <strong>und</strong> welche Perspektiven<br />
die Gesellschaft arbeitslosen Menschen<br />
bieten muss. Verschämtes Wegschauen <strong>und</strong><br />
Ignorieren der Probleme hilft weder den<br />
betroffenen arbeitslosen Menschen noch<br />
wird es der Dramatik der Entwicklung<br />
gerecht.
Liebe Schulleiterin, lieber Schulleiter,<br />
immer mehr Kommunen kommen auf<br />
die Schulen mit der Bitte zu, Ein-Euro-<br />
Jobs einzurichten. Das ist für die Schulen<br />
eine schwierige Entscheidung, weil<br />
sie unter permanentem Personalmangel<br />
leiden <strong>und</strong> zahlreiche unerledigte Arbeiten<br />
sowie der oftmalige Wunsch der<br />
arbeitslosen Betroffenen eine Beschäftigung<br />
von Ein-Euro-Kräften zunächst<br />
nahe legen. Als <strong>Gewerkschaft</strong> halten wir<br />
jedoch diesen Weg für absolut falsch,<br />
weil er den Betroffenen keine Perspektive<br />
bietet, ihnen kein reguläres sozialversicherungspflichtigesArbeitsverhältnis<br />
ermöglicht <strong>und</strong> in der Regel auch<br />
nicht in den sog. ersten Arbeitsmarkt<br />
mündet.<br />
Zusagen des Schulministeriums<br />
In mehreren Gesprächen mit der Schulministerin<br />
haben wir die Probleme von<br />
Ein - Euro - Jobs in Schulen erörtert.<br />
Dabei wurde gr<strong>und</strong>sätzliche Übereinstimmung<br />
darüber erzielt, dass solche<br />
Arbeitsverhältnisse nicht die Arbeit von<br />
Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrern ersetzen<br />
dürfen. Gr<strong>und</strong>sätzlich sollen auch gegen<br />
den Willen der Schule keine Ein - Euro -<br />
Jobs eingerichtet werden, so das MSJK.<br />
Meinungsaustausch<br />
Wir bitten Sie, uns Ihre Informationen<br />
<strong>und</strong> Einschätzungen zu den Ein - Euro -<br />
Jobs zukommen zu lassen. Da die Personalräte<br />
insbesondere über die gesetzliche<br />
Bestimmung zu wachen haben, dass<br />
keine regulären Arbeitsplätze verdrängt<br />
werden, bitten wir Sie auch, gegebenenfalls<br />
den für Ihre Schule zuständigen<br />
Personalrat zu informieren. Zudem<br />
bitten wir Sie, durch Information der<br />
zuständigen Schulaufsicht die Beachtung<br />
der personalvertretungsrechtlichen<br />
Erfordernisse zu ermöglichen.<br />
EIN-EURO-JOBS<br />
Empfehlungen zum Umgang<br />
mit »Ein-Euro-Jobs« in der Schule<br />
Rechts- <strong>und</strong> Sachlage<br />
Zu Ihrer Meinungsbildung möchten wir<br />
noch folgende Informationen geben:<br />
Mit Inkrafttreten des SGB II sind<br />
Erwerblose seit 1.1.<strong>2005</strong> gezwungen,<br />
auch sog. Arbeitsgelegenheiten („1-<br />
Euro-Jobs“) anzunehmen. Bis Ende<br />
2004 war dies noch freiwillig.<br />
Der permanente Personalabbau auch<br />
<strong>und</strong> gerade in den Schulen hat schließlich<br />
zur Verlagerung von Aufgaben auf<br />
das vorhandene Personal <strong>und</strong> zu weiterer<br />
Arbeitsverdichtung geführt. Es steht<br />
allerdings im Widerspruch zu den<br />
gesetzlichen Vorgaben, wenn die durch<br />
Personalabbau gerissenen Lücken<br />
durch „1-Euro-JobberInnen“ abgedeckt<br />
werden. Arbeitsgelegenheiten müssen<br />
zusätzlich sein <strong>und</strong> dürfen weder<br />
reguläre Beschäftigung verdrängen<br />
noch deren Schaffung behindern. Das<br />
ist aber der Fall, wenn Tätigkeiten in<br />
Bibliotheken, Laboren, im Hausmeisterbereich<br />
oder in der unmittelbaren<br />
Unterstützung der Schüler/innen im<br />
Rahmen von „1-Euro-Jobs“ erledigt<br />
werden. Damit geraten Arbeitsplätze auf<br />
Dauer in Gefahr. Darüber hinaus wird<br />
auch ehrenamtliche Tätigkeit schrittweise<br />
verdrängt.<br />
Das Instrument der Arbeitsgelegenheiten<br />
ist weder arbeitsmarktpolitisch<br />
sinnvoll noch nützt es den Betroffenen<br />
selbst. Der Gesetzgeber hat in §16 Abs. 2<br />
SGB II ausdrücklich gefordert, dass<br />
diese Maßnahmen im Einzelfall „erforderlich“<br />
sein müssen, um die betreffenden<br />
arbeitslosen Alg II-Bezieherinnen<br />
<strong>und</strong> Bezieher in den (ersten) Arbeitsmarkt<br />
zu integrieren. Es muss sich also<br />
mit einem solchen „1-Euro-Job“ eine<br />
Perspektive raus aus der Arbeitslosigkeit<br />
bieten. Diese ist aber in den Schulen<br />
nicht vorhanden.Bitte bedenken Sie<br />
auch, dass mit diesem Instrument<br />
Arbeit ohne nennenswerten Bezahlung,<br />
SEITE 7<br />
ohne jegliche Arbeitnehmerrechte <strong>und</strong><br />
ohne Erwerb sozialversicherungsrechtlicher<br />
Ansprüche geleistet wird.<br />
Dass viele betroffene arbeitslose Kolleginnen<br />
<strong>und</strong> Kollegen derartige Arbeitsgelegenheiten<br />
annehmen, darf nicht als<br />
Zustimmung missverstanden werden.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der drastischen Sanktionen,<br />
die bei Ablehnung solcher Tätigkeiten<br />
drohen, haben die Betroffenen faktisch<br />
keine Wahl. Wir befürchten, dass sich<br />
dies auch auf das Klima in den Schulen<br />
erheblich negativ auswirken wird.<br />
Eingliederung in die Schule<br />
Diese Dienstkräfte werden zeitweilig in<br />
die Schulen integriert, unterliegen dem<br />
Weisungsrecht der Schulleitung <strong>und</strong><br />
bedürfen wegen ihrer Rechtlosigkeit<br />
(noch nicht einmal „Arbeitnehmer“ mit<br />
Arbeitsvertrag) des besonderen Schutzes<br />
der Personalvertretungen.<br />
Mitbestimmungsrecht der Personalvertretung<br />
Den Personalräten steht - nach Auffassung<br />
der GEW - ein Mitbestimmungsrecht<br />
bei der Eingliederung in die<br />
Dienststelle zu. Der Personalrat hat vor<br />
jeder Einstellung einer/eines 1-2 Euro<br />
Jobberin/Jobbers nach §75 Absatz 1 Ziff.<br />
1, §77 BPersVG bzw. § 72 Absatz 1 Nr. 1<br />
LPersVG NRW mitzubestimmen.<br />
Für das Personalvertretungsrecht hat<br />
das BVerwG vergleichbar zum Einsatz<br />
von Personen aufgr<strong>und</strong> eines sogen.<br />
Gestellungsvertrages entschieden, dass<br />
eine Einstellung vorliegt, wenn die<br />
gestellten Personen so in die Dienststelle<br />
eingegliedert werden, dass diese<br />
ihnen gegenüber die für ein Arbeitsverhältnis<br />
typischen Weisungsbefugnisse<br />
hat; es sei unerheblich, dass die gestellten<br />
Personen keine Arbeitnehmer sind<br />
(BVerwG vom 27.8.1997, Az.: 6 P 7.95).
Ein-Euro-Jobs vorerst<br />
gestoppt<br />
Die Kölner Verwaltung wird bis auf<br />
Weiteres keine „Integrationsjobs“ bekommen:<br />
Der städtische Gesamtpersonalrat<br />
hat sein Veto eingelegt. Einsatzbereiche<br />
<strong>und</strong> Bedingungen seien nicht geklärt<br />
von Isabel Fannrich,<br />
taz Köln, im April <strong>2005</strong><br />
Die Einführung von Ein-Euro-Jobs in<br />
der Kölner Verwaltung liegt derzeit auf<br />
Eis. Auslöser der Job-Sperre ist der<br />
Protest des städtischen Gesamtpersonalrats<br />
(GPR). „Wir sind nicht gegen<br />
Integrationsjobs, aber die Einsatzbereiche<br />
<strong>und</strong> Bedingungen müssen<br />
geklärt sein“, begründet dessen Vorsitzender,<br />
Friedel Giesen-Weirich, den<br />
Einspruch. In einem Brief an Stadtdirektor<br />
Herbert Winkelhog (CDU), der<br />
der taz vorliegt, hatte der GPR deswegen<br />
bereits im März die Stadtverwaltung<br />
aufgefordert, vor der Einführung der so<br />
genannten Integrationsjobs zunächst<br />
die Rahmenbedingungen zu klären <strong>und</strong><br />
dabei die Personalvertretung stärker<br />
einzubeziehen. Sollten die „eingeleiteten<br />
<strong>und</strong> weiteren Maßnahmen nicht umgehend“<br />
gestoppt werden, behalte sich der<br />
GPR eine Rechtsberatung <strong>und</strong> „gegebenenfalls“<br />
ein Klageverfahren vor.<br />
EIN-EURO-JOBS<br />
Nach Auskunft der für Ein-Euro-Jobs<br />
verantwortlichen ARGE, der Arbeitsgemeinschaft<br />
von Stadt <strong>und</strong> Arbeitsagentur,<br />
liegt bereits eine Liste mit<br />
„Interessensbek<strong>und</strong>ungen“ von Dienststellen<br />
für die auf ein halbes Jahr befristeten<br />
Stellen vor. Allerdings sei das<br />
Antragsformular noch nicht zu haben,<br />
so ARGE-Geschäftsführer Josef Ludwig.<br />
Dennoch gebe es bereits erste Integrationsjobs<br />
bei der Stadt, beklagt GPR-<br />
Mann Giesen-Weirich. So arbeiteten<br />
r<strong>und</strong> 20 Leute in „Kolonnen“ in Parks<br />
oder als Küchenhilfe in Kitas. Bei den<br />
„zwei Handvoll“ Integrationsjobs<br />
handle es sich um ehemalige Hilfe-zur-<br />
Arbeit-Stellen, erklärt Frank Fricke vom<br />
städtischen Organisationsamt. Diese<br />
seien Ende 2004 ausgelaufen <strong>und</strong> zur<br />
Vermeidung von Engpässen bis Ende<br />
Juli <strong>2005</strong> als Integrationsjobs verlängert<br />
worden.<br />
Die ARGE hat auf den Protest des GPR<br />
reagiert. Wie aus einem von Winkelhog<br />
unterzeichneten Antwortbrief an den<br />
GPR hervorgeht, ließ sie „vor dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> personalvertretungsrechtlicher<br />
Hinweise alle städtischen<br />
Einsatzgelegenheiten“ sperren. Eine<br />
Rückabwicklung der bisher vorgenommenen<br />
Besetzungen aber hält der<br />
Stadtdirektor wegen der „Integrationsleistungen<br />
für die Hilfeempfänger nicht<br />
für opportun“.<br />
Förderverein <strong>Gewerkschaft</strong>liche Arbeitslosenarbeit e.V.<br />
1984 gründeten arbeitslose <strong>Gewerkschaft</strong>erInnen die Koordinierungsstelle (KOS),<br />
um ein Informations- <strong>und</strong> Koordinierungsbüro für Erwerbslose <strong>und</strong> von Erwerbslosigkeit<br />
Bedrohte aufzubauen. Wir organisieren Aktionen <strong>und</strong> koordinieren<br />
Kampagnen der Erwerbslosenprojekte. Wir vernetzen über 1000 Erwerbsloseninitiativen<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik. Wir bieten Hilfestellungen <strong>und</strong> Serviceleistungen für<br />
Betroffene, Projekte <strong>und</strong> Akteure in der Arbeitsmarktpolitik. Bei uns können Broschüren,<br />
Flyer, Plakate <strong>und</strong> Merkblätter zum Thema Erwerbslosigkeit bestellt werden.<br />
www.erwerbslos.de<br />
SEITE 8<br />
Beirat Ein-Euro-Jobs<br />
bei der Stadt Köln<br />
von Christine Oberhäuser<br />
Kollege Uellenberg-van-Daven,<br />
Kreisvorsitzender des DGB, ist<br />
Mitglied des Beirates der Arbeitsgemeinschaft<br />
( gebildet aus B<strong>und</strong>esanstalt<br />
für Arbeit <strong>und</strong> Stadt<br />
Köln) <strong>und</strong> berichtet, dass folgende<br />
Kriterien für die Vergabe von Ein-<br />
Euro-Jobs vereinbart wurden:<br />
• Die Träger müssen ein Konzept<br />
vorlegen, in dem nachgewiesen<br />
wird, in welcher Form die Betroffenen<br />
Hilfestellung erhalten <strong>und</strong><br />
weiterqualifiziert werden.<br />
• Die Übernahme der Beschäftigung<br />
ist freiwillig.<br />
• Mitbestimmung durch Personalbzw.<br />
Betriebsräte muss gewährleistet<br />
sein.<br />
• Jugendliche sollen nur dann<br />
Angebote für 1-Euro-Jobs bekommen,<br />
wenn sie keine Ausbildung<br />
haben. In Zusammenarbeit mit der<br />
TAS (Tages- <strong>und</strong> Abendschule )<br />
soll ihnen ggf. ermöglicht werden,<br />
den Hauptschulabschluss nachzuholen,<br />
so dass sie am Ende der<br />
Maßnahme befähigt sind in eine<br />
duale Ausbildung zu wechseln.<br />
Erstes Beispiel<br />
aus Bergheim<br />
Nach Informationen aus der Jungen<br />
GEW ist an der Bergheimer Gesamtschule<br />
ein Ein-Euro-Jobber eingestellt<br />
worden. Er soll die Biologie- <strong>und</strong> Chemie-Archive<br />
ordnen, eine Tätigkeit, die<br />
nur ein Fachkollege erledigen kann.
TARIFPOLITIK<br />
Arbeitszeit ist Knackpunkt<br />
GEW, ver.di <strong>und</strong> GdP haben die Tarifverhandlungen<br />
mit den Ländern am 25.<br />
April abgebrochen. Hierfür trägt die<br />
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) die<br />
volle Verantwortung! Gr<strong>und</strong> ist die<br />
kompromisslose Haltung der Länder in<br />
der Arbeitszeitfrage. Damit ist das Ziel,<br />
ein einheitliches Tarifrecht für die<br />
Beschäftigten von B<strong>und</strong>, Ländern <strong>und</strong><br />
Gemeinden zu erreichen, in weite Ferne<br />
gerückt.<br />
Die Blockadehaltung der Länder in der<br />
Arbeitszeitfrage ist indiskutabel. Längere<br />
Arbeitszeit schafft keine Arbeitsplätze.<br />
Deshalb wird sich die GEW im<br />
Interesse der Millionen von Arbeitslosen<br />
gegen eine Arbeitszeitverlängerung<br />
stemmen:<br />
GEW <strong>und</strong> ver.di haben der TdL angeboten,<br />
das Tarifergebnis mit B<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
Kommunen im Februar <strong>2005</strong> zur Neugestaltung<br />
des Tarifrechts für den<br />
öffentlichen Dienst (TVöD) zu übernehmen.<br />
Die TdL hatte den Prozess der<br />
Neugestaltung des Tarifrechts für den<br />
öffentlichen Dienst verlassen. Sie hatten<br />
die Tarifregelungen zur Dauer der<br />
Arbeitszeit im Tarifgebiet West sowie<br />
zur Zuwendung <strong>und</strong> zum Urlaubsgeld<br />
in Ost <strong>und</strong> West gekündigt. Als Begründung<br />
wurde eine vermeintliche Gleichbehandlung<br />
mit den Beamtinnen <strong>und</strong><br />
Beamten angeführt.<br />
Die Länder haben die weitgehenden<br />
Zugeständnisse von GEW <strong>und</strong> ver.di in<br />
den Verhandlungen ignoriert. GEW <strong>und</strong><br />
ver.di hatten die Bereitschaft signalisiert,<br />
·für den Bereich der wissenschaftlich<br />
Beschäftigten nach beiderseitig tragfähigen<br />
Lösungen zu suchen,<br />
·im Tarifgebiet West auf der Basis der<br />
38,5-St<strong>und</strong>en-Woche einheitliche<br />
Arbeitszeiten für die nach dem 30. April<br />
2004 eingestellten Beschäftigten erst<br />
während der Laufzeit des Tarifvertrages<br />
herzustellen,<br />
·im Tarifgebiet Ost weiterhin an der 40-<br />
St<strong>und</strong>en-Woche festzuhalten,<br />
·die Höhe der Einmalzahlung in einer<br />
Staffelung zu vereinbaren, die den<br />
länderspezifischen Besonderheiten<br />
Rechnung trägt.<br />
Für angestellte Lehrkräfte haben GEW<br />
<strong>und</strong> ver.di ihre Verhandlungsbereitschaft<br />
bek<strong>und</strong>et, tarifliche Regelungen<br />
auf der Basis des Gr<strong>und</strong>satzes „im<br />
materiellen Inhalt keine Besser- <strong>und</strong><br />
keine Schlechterstellung“ zu verhandeln.<br />
Hierzu gehören aus Sicht der GEW<br />
- eine originäre Tarifregelung bei Arbeitszeit<br />
<strong>und</strong> Urlaub anstelle der Verweisung<br />
auf das Beamtenrecht,<br />
- die tarifliche Regelung der Eingruppierung<br />
von Lehrkräften in der künftigen<br />
Entgeltordnung des TVöD,<br />
SEITE 9<br />
- die tariflich geregelte Überleitung der<br />
Lehrkräfte in das neue Bezahlungssystem,<br />
- die Berücksichtigung von Vorbereitungsdienst<br />
<strong>und</strong> Zeiten an Auslandsschulen<br />
bei der Zuordnung zu den<br />
Stufen der neuen Entgelttabelle.<br />
Die Blockade der TdL verhindert im<br />
Länderbereich ein einheitliches neugestaltetes<br />
Tarifrecht für den öffentlichen<br />
Dienst. Es droht der Verlust des<br />
tariflichen Schutzes im Länderbereich<br />
<strong>und</strong> eine Ausweitung von beamtenrechtlich<br />
vorgeprägten Arbeitsbedingungen<br />
für die Tarifbeschäftigten der<br />
Länder.<br />
Jetzt müssen sich die Beschäftigten<br />
lautstark gegen das Verhalten der TdL<br />
zur Wehr setzen. Der Druck muss<br />
spürbar erhöht werden, um die Arbeitgeber<br />
im Länderbereich zum Einlenken<br />
zu bewegen!<br />
Die Große Tarifkommission der GEW<br />
erklärt, dass die Verhandlungen zu den<br />
gekündigten Tarifregelungen (Dauer<br />
der Arbeitszeit im Tarifgebiet West<br />
sowie Zuwendung <strong>und</strong> Urlaubsgeld in<br />
den Tarifgebieten West <strong>und</strong> Ost) gescheitert<br />
sind.
FÖRDERUNG<br />
Die Forderung nach Förderung<br />
Neugewichtung von Schule <strong>und</strong> Unterricht notwendig<br />
von Peter Dobbelstein,<br />
Michael Gasse, forum schule. 1/05<br />
Kaum eine Bildungsdebatte, in der nicht<br />
die bessere Förderung von Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schülern abgemahnt wird, kaum<br />
eine bildungspolitische Initiative, die<br />
nicht ihren Beitrag zur individuellen<br />
Förderung an herausragender Stelle<br />
betont. - Was heißt das für die Schulen,<br />
wenn die Forderung nach Förderung<br />
eine so zentrale Stellung im Zielkatalog<br />
schulischer Arbeit erhält? Lassen sich die<br />
hinter dem Begriff Förderung stehenden<br />
Vorstellungen nahtlos in die Schulwirklichkeit<br />
übertragen?<br />
In der Tat: Leicht tun wir uns im b<strong>und</strong>esdeutschen<br />
Schulsystem nicht mit der<br />
Förderung von Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern. Woran zeigt sich das? Gleich<br />
mehrere Aspekte lohnen eine nähere<br />
Betrachtung.<br />
Förderung als Zusatzaufgabe<br />
Erstens ist die Zieldimension einer<br />
individuellen Förderung bei uns nicht<br />
selbstverständlicher Dreh- <strong>und</strong> Angelpunkt<br />
des Schulalltags. Stattdessen wird<br />
unser Denken <strong>und</strong> Handeln durch das<br />
Bewerten <strong>und</strong> Messen von Leistungen<br />
(durch Notengebung) geprägt. Um es<br />
etwas moralisierend zu wenden: Das<br />
gr<strong>und</strong>legende Bewusstsein, dass wir<br />
mit dem Schuleintritt eines Kindes<br />
Verantwortung für seinen Bildungserfolg<br />
übernommen haben, ist in anderen<br />
Bildungssystemen zum Teil deutlich<br />
ausgeprägter. Die Förderung von<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern besitzt<br />
somit dort einen ganz anderen Stellenwert.<br />
Bei uns werden Lernwege eher<br />
selten als Suchwege verstanden, auf<br />
denen Kinder frei von Beurteilung <strong>und</strong><br />
Bewertung agieren können. Die Beobachtung<br />
von Lernprozessen - eine<br />
wesentliche Voraussetzung für diagnostische<br />
Einschätzungen von Lernpotenzialen<br />
<strong>und</strong> Lernchancen - wird bei uns<br />
in der Regel als eine Gelegenheit zur<br />
Bewertung <strong>und</strong> damit im weiteren<br />
Sinne zur Notengebung verstanden.<br />
Förderung droht damit eher als Zusatzaufgabe<br />
bzw. Belastung wahrgenommen<br />
zu werden. Vielfach können sich ihr<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen erst widmen,<br />
wenn es die übrig gebliebene Zeit<br />
erlaubt. Allerdings: In den Genuss einer<br />
individuellen Förderung kommen dann<br />
meist nur Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
mit besonderen Lernschwierigkeiten.<br />
Defizitorientierung<br />
Damit sind wir beim zweiten Aspekt.<br />
Wenn von Lerndiagnose <strong>und</strong> von<br />
Förderung gesprochen wird, neigen wir<br />
dazu - sozialisiert in unserem Schulsystem<br />
-, in erster Linie nach dem (noch)<br />
nicht Gekonnten <strong>und</strong> dem noch nicht<br />
Verstandenen zu fragen. Wir suchen<br />
nach Defiziten <strong>und</strong> versuchen, ihnen –<br />
bestenfalls - mit gezielten Maßnahmen<br />
zu begegnen. Die Reaktionen mancher<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen auf die<br />
Ergebnisse der jüngst durchgeführten<br />
Lernstandserhebung verw<strong>und</strong>ern da<br />
nicht: Ihnen sei doch längst klar, was<br />
ihre Neuner alles nicht können. – Ganz<br />
anders der Umgang mit Lernstandserhebungen<br />
<strong>und</strong> den darauf abgestimmten<br />
diagnostischen Materialien in<br />
Schweden. Dort interessieren sich<br />
Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer für das, was<br />
ihre Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bereits<br />
können, wie die schwedische Bildungsexpertin<br />
Lisa Björkl<strong>und</strong> berichtet. Auf<br />
der Gr<strong>und</strong>lage des erreichten Lernstands<br />
können dann Ziele <strong>und</strong> Strategien<br />
für eine weitere Förderung vereinbart<br />
werden - ausgehend von den<br />
individuellen Leistungsniveaus.<br />
Es ist offenk<strong>und</strong>ig, dass die jeweiligen<br />
SEITE 10<br />
Sichtweisen von Lehrerinnen <strong>und</strong><br />
Lehrern – defizit- bzw. bewertungsorientiert<br />
oder ausgerichtet auf bereits<br />
erworbene Fähigkeiten <strong>und</strong> Kompetenzen<br />
– das Selbstbild von Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schülern nachhaltig prägen <strong>und</strong><br />
einen großen Einfluss auf die eigene<br />
Einschätzung von Lernprozessen haben.<br />
Nicht erst seit der Auswertungsdiskussion<br />
zur ersten PISA-Studie wissen<br />
wir, dass ein positives Selbstbild den<br />
Lernerfolg von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
fördert. Wer seinen Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schülern zunächst zeigt, in welchen<br />
Bereichen sie erfolgreich waren <strong>und</strong> was<br />
sie bereits gelernt haben, wird feststellen,<br />
dass sich mit dem Bewusstsein<br />
eigener Fähigkeiten <strong>und</strong> Fertigkeiten<br />
neue Lernaufgaben leichter angehen<br />
lassen – auf allen Leistungsniveaus, die<br />
in unserem differenzierten Schulwesen<br />
anzutreffen sind.<br />
Förderung als Herausforderung an<br />
unterrichtliches Handeln<br />
Förderung in diesem Sinne ist aber<br />
nicht nur eine pädagogische Haltung<br />
aus der heraus die Leistungsbilder von<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern betrachtet<br />
werden. Förderung stellt gleichzeitig<br />
auch komplexe <strong>und</strong> differenzierte<br />
Anforderungen an unterrichtliches<br />
Handeln <strong>und</strong> methodisches Vorgehen<br />
<strong>und</strong> bedarf daher unterschiedlicher<br />
Instrumente.<br />
In der Sonderpädagogik gibt es ein<br />
breites Repertoire, wie Lernbedingungen,<br />
Lernschwierigkeiten <strong>und</strong> -<br />
blockaden erkannt <strong>und</strong> darauf angepasste<br />
Lernstrategien entwickelt werden<br />
können. Zwar sind sonderpädagogische<br />
Herangehensweisen nicht nahtlos in die<br />
Regelschulen übertragbar, sie bieten<br />
jedoch eine Fülle an Anregungen, die<br />
auch dort stärkere Berücksichtigung<br />
finden können. Ebenso kennen wir aus
dem Bereich der Begabungsförderung<br />
viele Förderinstrumente – z.B. im<br />
Zusammenhang mit der Einrichtung<br />
von Profilklassen –, die von Lehrerinnen<br />
<strong>und</strong> Lehrern für alle Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler genutzt werden können.<br />
Hierzu zählen Formen von Projektarbeit<br />
<strong>und</strong> Wettbewerben genauso wie Formen<br />
innerer (individuelle Aufgabenstellungen)<br />
<strong>und</strong> äußerer Differenzierung<br />
(Drehtürmodell, Schülerakademien,<br />
Lernplanarbeit in Selbstlernzentren).<br />
Individuelle Lern- <strong>und</strong> Förderempfehlungen<br />
sollen Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer<br />
dabei unterstützen, Begabungsprofile<br />
auf allen Leistungsebenen differenziert<br />
zu berücksichtigen. Auch eine Maßnahme,<br />
die ursprünglich zur Förderung von<br />
leistungsschwachen Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern konzipiert wurde, birgt das<br />
Potenzial zu einem allgemein anwendbaren<br />
Förderinstrument.<br />
Im Zuge der Arbeit mit Lern- <strong>und</strong><br />
Förderempfehlungen entwickeln Schulen<br />
z.B. Indikatoren, Fragebögen <strong>und</strong><br />
Szenarien für die Lernbeobachtung <strong>und</strong><br />
Lerndiagnose, die bei allen Kindern<br />
<strong>und</strong> Jugendlichen eingesetzt werden<br />
können, um Lernschwierigkeiten besser<br />
ausgleichen zu können. Andere Schulen<br />
standardisieren ihre Korrekturpraxis,<br />
sodass sie zur Gr<strong>und</strong>lage für eine<br />
systematische <strong>und</strong> passgenaue individuelle<br />
Lernberatung wird. Auf diesen<br />
Wegen werden Förderempfehlungen zu<br />
einem wichtigen Baustein von Unterrichtsentwicklung,<br />
Lernberatung <strong>und</strong><br />
Lernförderung.<br />
Wenn die Förderung von Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schülern ein zentrales Anliegen<br />
von Schule ist, hat dies weitreichende<br />
Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung.<br />
Letztlich soll jede Schülerin<br />
<strong>und</strong> jeder Schüler einen optimalen<br />
Lernzuwachs erzielen können. Damit<br />
müssen Räume für Formen des selbst-<br />
FÖRDERUNG<br />
ständigenLernens <strong>und</strong> differenzierteLernangebote<br />
geöffnet<br />
werden, in denen<br />
die Lernbedürfnisse Einzelner<br />
berücksichtigt werden.<br />
Fachorientierung<br />
Selbstverständlich gibt es in<br />
unseren Schulen vielfältige<br />
Förderansätze, die aber in der<br />
Regel vor allem fachliche Aspekte in den<br />
Mittelpunkt stellen. In welchen inhaltlichen<br />
Bereichen müssen wir Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler stärker fördern als<br />
bisher? Zentrale Lernstandserhebungen<br />
in den Jahrgangsstufen 4 <strong>und</strong> 9 liefern<br />
Informationen über die Stärken <strong>und</strong><br />
Schwächen von Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern in bestimmten Bereichen der<br />
Fächer Deutsch <strong>und</strong> Mathematik sowie<br />
zusätzlich Englisch in Klasse 9. Die<br />
Ergebnisse dieser Tests zeigen, mit<br />
welchen Aufgaben, d.h. mit welchen<br />
fachlichen Anforderungen, Schülerinnen<br />
<strong>und</strong> Schüler gut bzw. nicht gut<br />
zurechtgekommen sind. Die Ergebnisse<br />
können bestimmten Kompetenzniveaus<br />
zugeordnet werden, sodass sich ein<br />
konkretes Fähigkeitsprofil herausdifferenziert.<br />
Lernstandserhebungen<br />
sagen zwar nicht, welche Förderkonzepte<br />
<strong>und</strong> Förderstrategien wir anwenden<br />
sollen, sie zeigen uns jedoch, in<br />
welchen Bereichen eines Fachs Förderung<br />
notwendig ist.<br />
<strong>Erziehung</strong> als integraler Bestandteil<br />
von Förderung<br />
Die besten Maßnahmen zur individuellen<br />
<strong>und</strong> gruppenbezogenen Förderung<br />
werden jedoch konterkariert, wenn<br />
Unterrichtsst<strong>und</strong>e für Unterrichtsst<strong>und</strong>e<br />
ein Viertel der Zeit für Disziplinierungen<br />
verloren geht oder wenn ein<br />
SEITE 11<br />
Klima von Konkurrenz <strong>und</strong><br />
Missgunst herrscht. Oft achten wir zu<br />
wenig darauf, dass die Lernatmosphäre,<br />
das Lernklima, der Umgang miteinander<br />
so gestaltet sind, dass sich eine<br />
Fehlerkultur entwickeln kann, in der die<br />
falsche Antwort nicht als Dokumentation<br />
des Versagens verstanden wird.<br />
Wenn wir ein Klima der gegenseitigen<br />
Unterstützung, der Hilfestellungen <strong>und</strong><br />
des solidarischen Verhaltens schaffen<br />
wollen, brauchen wir die entsprechenden<br />
Lernarrangements. Förderkonzepte<br />
sind somit nicht nur fachlich zu denken;<br />
sie dürfen die Persönlichkeitsentwicklung<br />
im Sinne des komplexen Bildungs<strong>und</strong><br />
<strong>Erziehung</strong>sauftrages von Schule<br />
nicht aus dem Blick verlieren. Das<br />
Erzieherische ist dann nicht das, was<br />
„Schule nun auch noch verstärkt bewältigen<br />
soll“, sondern integraler Bestandteil<br />
von Förderung.<br />
Eine Neugewichtung<br />
Förderkonzepte <strong>und</strong> Förderstrategien<br />
lassen sich aus unterschiedlichen<br />
Perspektiven denken <strong>und</strong> im Schulalltag<br />
von verschiedenen Ausgangspunkten<br />
aus umsetzen <strong>und</strong> anwenden. Einmal<br />
stehen die Lernblockaden <strong>und</strong> Lernprobleme<br />
einzelner leistungsschwacher<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Vordergr<strong>und</strong>,<br />
ein anderes Mal sind es die<br />
Lernanreize <strong>und</strong> Herausforderungen,
Einladung<br />
Aus 7 mach 1<br />
Das neue Schulgesetz <strong>und</strong><br />
die Folgen für Lehrerräte<br />
Leitung:<br />
U. Becker<br />
In dieser Fortbildung wird das neue<br />
Schulgesetz <strong>und</strong> seine Auswirkungen auf<br />
die Arbeit der Lehrerräte vorgestellt. Die<br />
Änderungen in der Mitbestimmung, das<br />
Verhältnis zur Schulleitung <strong>und</strong> die<br />
Veränderungen in der schulischen Zielsetzung<br />
stehen im Mittelpunkt.<br />
Systematik des neuen Schulgesetzes<br />
Die wichtigsten rechtlichen Änderungen<br />
Auswirkungen auf die Lehrerratsarbeit<br />
Ein neues Verhältnis zur Schulleitung?<br />
Schulpolitische Paradigmenwechsel?<br />
Montag, 13.6.<strong>2005</strong><br />
9.30-16.30 Uhr<br />
Köln, DGB-Haus<br />
Bitte in der Geschäftsstelle anmelden:<br />
gew-koeln@netcologne.de<br />
<strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Köln<br />
QUALITÄTSAGENTUR<br />
Neue Qualitätsagentur in NRW<br />
Der Bildungsforscher Prof. Wilfried Bos<br />
wird der wissenschaftliche Beauftragte<br />
der neuen Qualitätsagentur in NRW.<br />
Das hat Schul- <strong>und</strong> Jugendministerin<br />
Ute Schäfer (SPD) in Düsseldorf bekannt<br />
gegeben. Bos, der als deutscher<br />
Leiter der internationalen Gr<strong>und</strong>schul-<br />
Lese-Untersuchung (IGLU) auch außerhalb<br />
von Fachkreisen bekannt wurde,<br />
wird die Arbeit der Experten in der<br />
neuen Agentur begleiten.<br />
„Wenn wir allen Schulen in NRW bis<br />
zum Jahr 2009 weitgehende Selbstständigkeit<br />
einräumen wollen, ist das<br />
kein Selbstzweck. Wir wollen unseren<br />
Schulen Gestaltungsspielräume öffnen,<br />
damit sie bessere Schulen werden“,<br />
betonte die Ministerin. „Was die<br />
Bildungspolitik <strong>und</strong> damit der Staat<br />
leisten muss, ist, für entsprechende<br />
Rahmenbedingungen zu sorgen, die<br />
Bildungsziele klar zu definieren <strong>und</strong><br />
das Erreichen dieser Ziele zu überprüfen.“<br />
Die neue NRW-Qualitätsagentur, die im<br />
Landesinstitut für Schule in Soest<br />
angesiedelt <strong>und</strong> von Dr. Eike Thürmann<br />
geleitet werden soll, wird insbesondere<br />
folgende Aufgaben wahrnehmen:<br />
• Auf der Gr<strong>und</strong>lage der Bildungsstandards<br />
der Kultusministerkonferenz wird<br />
Fortsetzung von Seite 11<br />
die besonders begabte Kinder <strong>und</strong> Jugendliche brauchen. Ansätze einer differenziellen<br />
Begabungsförderung mit Beobachtungsinstrumenten <strong>und</strong> Lernarrangements,<br />
die mehr Flexibilität <strong>und</strong> damit Lernerorientierung zulassen, können den unterschiedlichen<br />
Bedürfnissen von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern gerecht werden. Werden<br />
schließlich Ansätze aus der Fachperspektive, die von den zu erwartenden<br />
Lernergeb-nissen ausgehen <strong>und</strong> den Förderbedarf von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
identifizieren, mit dem Aspekt des Lernklimas <strong>und</strong> mit erzieherischen Dimensionen<br />
verb<strong>und</strong>en, dann erfordert die Forderung nach Förderung eine tiefgreifende (Neu-<br />
)Orientierung von Schule <strong>und</strong> Unterricht. Dies lässt sich sicherlich nicht dadurch<br />
erreichen, dass im Bildungssystem einige wenige Hebel umgelegt werden; es handelt<br />
sich eher um eine neue Gewichtung. Es geht darum, dass die Förderung im Zielkatalog<br />
der didaktisch-pädagogischen Arbeit einen neuen, herausragenden Stellenwert<br />
erhält.<br />
SEITE 12<br />
die Qualitätsagentur an der Weiterentwicklung<br />
der Kernlehrpläne in Nordrhein-Westfalen<br />
arbeiten.<br />
• Für die Lernstandserhebungen in<br />
den vierten <strong>und</strong> neunten Klassen liegt<br />
die Verantwortung für die Aufgabenentwicklung<br />
in der Qualitätsagentur,<br />
ebenso die zentralen Abschlussprüfungen<br />
nach der Sek<strong>und</strong>arstufe I. Die<br />
Aufgabenentwick-lung für das Abitur<br />
bleibt Aufgabe der Fachaufsicht für die<br />
gymnasiale Oberstufe <strong>und</strong> wird durch<br />
die Qualitätsagentur koordiniert.<br />
• Auf der Gr<strong>und</strong>lage wissenschaftlicher<br />
Erkenntnisse wird die Qualitätsagentur<br />
in allen ihr zugewiesenen<br />
Aufgabenbereichen die Lehrerfortbildung<br />
<strong>und</strong> die Schulaufsicht in<br />
ihrer Tätigkeit unterstützen.<br />
• Für die künftigen Schulinspektionen<br />
wird die Qualitätsagentur Konzepte <strong>und</strong><br />
Materialien, zu denen auch die notwendigen<br />
Qualitätskriterien gehören,<br />
entwickeln <strong>und</strong> pflegen sowie die<br />
Inspektoren ausbilden.<br />
• Die Qualitätsagentur arbeitet dem<br />
Ministerium in Fragen der<br />
Bildungsberichterstattung zu <strong>und</strong> stellt<br />
Daten für internationale Vergleichsstudien<br />
zur Verfügung.
von Anne Ratzki<br />
Das schlechte Abschneiden der deutschen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler bei der<br />
Oberstufenstudie TIMSS <strong>und</strong> der<br />
15jährigen bei PISA hat die Aufmerksamkeit<br />
auch auf die Frage gelenkt, wie<br />
Leistung zustande kommt. War in den<br />
letzten Jahren nach der Rede des B<strong>und</strong>espräsidenten<br />
Herzog die ,,Kuschelpädagogik“<br />
in Verruf geraten <strong>und</strong> der<br />
Ruf nach härteren Anforderungen<br />
erhoben worden, so mussten nun alle,<br />
die die bei TIMSS <strong>und</strong> PISA erfolgreichen<br />
Länder besuchten, sich fragen, ob<br />
harte Anforderungen allein <strong>und</strong> die<br />
damit verb<strong>und</strong>ene verschärfte Auslese<br />
die richtigen Mittel sind, um gute<br />
Leistungen zu erreichen.<br />
In den nordischen Staaten werden die<br />
Lernenden geachtet, sie dürfen nicht<br />
beschämt werden, Selektion gibt es<br />
nicht <strong>und</strong> die Anforderungen sind hoch.<br />
Doch damit alle diese Anforderungen<br />
erreichen können, ist Förderung eine<br />
Selbstverständlichkeit. Wir sind es<br />
gewöhnt, Fördern <strong>und</strong> Fordern als<br />
entgegengesetzte Pole wahrzunehmen,<br />
als einen Spagat, den eine gute Schule<br />
zu leisten hat: Die Schwachen fördern,<br />
die Guten fordern.<br />
Doch wahrscheinlich ist dies eine der<br />
vielen falschen Gr<strong>und</strong>annahmen unseres<br />
Schulsystems. Sie führte dazu, dass<br />
Schwachen nicht viel zugemutet wurde,<br />
dass man sie vor „Überforderung“<br />
schützen wollte, indem man sie nur mit<br />
dem unbedingt Nötigen durch „Förderung“<br />
ausstattete, sie dazu in weniger<br />
anspruchsvolle Schulformen überwies,<br />
sie der „Konkurrenz“ der besseren<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen entzog. Muss<br />
aber nicht Förderung mit dem Ziel<br />
verb<strong>und</strong>en sein, Anschluss an das<br />
Lernen der anderen zu halten oder<br />
wieder zu finden? Dabei fordere ich von<br />
FÖRDERUNG<br />
Fordern <strong>und</strong> Fördern<br />
in den Zeiten von PISA <strong>und</strong> Standards<br />
einem schwachen Schüler mehr, als<br />
dieser von sich aus zu leisten in der<br />
Lage wäre. Fördern <strong>und</strong> Fordern sind<br />
zwei Seiten derselben Münze: Individuelles<br />
Lernen, das Kindern ermöglicht<br />
ihre persönlichen Potenziale zu entwickeln.<br />
Die beiden Pole müssen sich<br />
aufeinander zu bewegen <strong>und</strong> in Balance<br />
gebracht werden.<br />
Schulische Realität<br />
<strong>und</strong> unbequeme Fragen<br />
Viele Maßnahmen in unserem selektiven<br />
Schulsystem werden mit Förderung<br />
oder Schutz vor Überforderung begründet.<br />
Es beginnt mit der Zurückstellung<br />
von der Schule im Alter von sechs<br />
Jahren: die Kinder seien noch nicht<br />
schulreif, müssten erst im Schulkindergarten<br />
„gefördert“ werden. Warum<br />
geschieht eine solche Förderung nicht<br />
in der Schule? Das Kind hat sich auf die<br />
Einschulung gefreut <strong>und</strong> erlebt eine<br />
Zurückweisung, die oft demotivierend<br />
wirkt. Die Einschulung trotz voraussehbarer<br />
Lernprobleme wäre andererseits<br />
eine Herausforderung für das<br />
Kind, die durch schulinterne Förderung<br />
gestützt werden müsste. Das Kind<br />
erfährt Die Schule traut mir etwas zu.<br />
Die skandinavischen Länder haben hier<br />
einen guten Weg gef<strong>und</strong>en: Fließender<br />
SEITE 13<br />
Übergang von der Vorschulklasse mit<br />
spielerischem Lernen zur Schule <strong>und</strong><br />
dort von Anfang anUnterstützung für<br />
Kinder mit Lernproblernen in kleinen<br />
Gruppen von fünf bis sieben Kindern,<br />
besonders beim Lesen lernen. Einen<br />
ähnlichen Weg will die neue Schuleingangsphase<br />
gehen, die in Nordrhein-<br />
Westfalen ab <strong>2005</strong> eingeführt wird:<br />
Alle schulpflichtigen Kinder werden<br />
eingeschult <strong>und</strong> in der Gr<strong>und</strong>schule z. B.<br />
in jahrgangsübergreifenden Gruppen<br />
entsprechend ihrer Schulfähigkeit<br />
gefördert. Schutz vor Überforderung<br />
<strong>und</strong> bessere Förderung ist oft auch die<br />
Begründung für eine Überweisung in<br />
die Sonderschule für Lernbehinderte<br />
oder <strong>Erziehung</strong>sschwierige (neue<br />
Namen auch: Sonderschule mit Schwerpunkt<br />
Lernen bzw. emotionale <strong>und</strong><br />
soziale Entwicklung). In vielen B<strong>und</strong>esländern<br />
werden Kombinationen aus<br />
beiden Sonderschulsparten als „Förderschulen“<br />
bezeichnet. Kinder mit<br />
Lern- <strong>und</strong> Verhaltensproblemen müssen<br />
zur „Förderung“ ihre Klassen in der<br />
Gr<strong>und</strong>schule verlassen, verlieren ihre<br />
Klassenkameraden <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e, die<br />
besser lernen, die ein besseres Sozialverhalten<br />
zeigen, um in eine Klasse zu<br />
gehen, die nur aus lern- <strong>und</strong> verhaltensschwierigen<br />
Kindern besteht. Wenn es<br />
stimmt, dass Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
voneinander lernen, was können diese<br />
Kinder voneinander lernen? Lernen<br />
muss hier vor allem vom Lehrer, von<br />
der Lehrerin ausgehen, <strong>und</strong> das ist in<br />
dieser Umgebung eine wahrhaft schwierige<br />
Aufgabe. Fachlich bedeutet Förderung<br />
in der Förderschule vor allem eine<br />
Reduktion der Anforderungen. So<br />
erhalten Lernbehinderte z. B. keinen<br />
Unterricht in Englisch.<br />
Das Abschlusszeugnis der Sonderschule<br />
macht Arbeitgebern klar: Dieser Schüler,<br />
diese Schülerin hat weniger gelernt,
es fehlen Wissen <strong>und</strong> Kompetenzen. Das<br />
hat lebenslange Konsequenzen.<br />
Auch die Überweisung in eine weiterführende<br />
Schule nach dem 4. Schuljahr<br />
folgt dieser Logik. Auf das Gymnasium<br />
werden Kinder überwiesen, deren<br />
Eltern helfen können, den Anforderungen<br />
des Gymnasiums gerecht zu werden<br />
oder die Hilfe bezahlen können. Die<br />
Gr<strong>und</strong>schule erwartet nicht, dass im<br />
Gymnasium Kinder systematisch<br />
gefördert werden; die Lehrer <strong>und</strong><br />
Lehrerinnen wissen, dass Kinder mit<br />
Lern- <strong>und</strong> Verhaltensproblemen das<br />
Gymnasium bald wieder verlassen<br />
müssen. Mit dieser Einschätzung<br />
erklären sich die „ungerechten“ Zuweisungen,<br />
die durch Untersuchungen wie<br />
die Hamburger Studie zur Lernausgangslage<br />
der Fünftklässler (LAU)<br />
dokumentiert sind: Kinder mit gleichen<br />
Leistungen in der Gr<strong>und</strong>schule erhalten<br />
je nach Sozialstatus der Eltern unterschiedliche<br />
Schulformempfehlungen.<br />
Interessant in diesem Zusammenhang<br />
ist ein weiterer PISA-Bef<strong>und</strong>: Die<br />
Leistungen der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
in den drei Schulformen überschneiden<br />
sich erheblich. „Ein nicht<br />
geringer Teil könnte nach ihrem Leistungsniveau<br />
in einen höheren Bildungsgang<br />
wechseln“ Jürgen Baumert in der<br />
taz vom 12. 3. 2003). Dabei zeigen<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen mit gleichen<br />
kognitiven Gr<strong>und</strong>fähigkeiten <strong>und</strong><br />
vergleichbarer sozialer Herkunft, die<br />
das Gymnasium besuchen, deutlich<br />
bessere Leistungen als diejenigen in der<br />
Hauptschule. Die Erklärung ist einfach:<br />
Die Anforderungen der Schulform sind<br />
höher, von den Jugendlichen wird mehr<br />
gefordert <strong>und</strong> das Zusammensein mit<br />
besseren Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
hat einen Fördereffekt. PISA 2003 hat<br />
diesen Effekt nun auch für die schwä-<br />
FÖRDERUNG<br />
cheren<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen am<br />
Gymnasium bestätigt: Das etwas bessere<br />
Abschneiden Deutschlands ist vor<br />
allem auf Lernzuwächse am Gymnasium<br />
zurückzuführen, insbesondere auf<br />
die besseren Leistungen der schwächeren<br />
Schüler am Gymnasium. In der<br />
Hauptschule hat sich nichts geändert.<br />
„Das Verharren der Hauptschüler auf<br />
ihrem niedrigen Leistungsstand geht<br />
einher mit der sozialen Selektivität der<br />
deutschen Schulen“ (Klaus Klemm: Die<br />
Hauptschule bleibt sitzen. In: Frankfurter<br />
R<strong>und</strong>schau, 8. Dezember 2004, S. 7).<br />
Der dritte Bereich, in der diese Logik<br />
der angeblichen Förderung eine fatale<br />
Wirksamkeit entfaltet, ist Sitzenbleiben<br />
<strong>und</strong> erzwungener Schulwechsel nach<br />
„unten“. Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
seien den Anforderungen von Gymnasium<br />
oder Realschule nicht gewachsen,<br />
seien auf der falschen Schule, müssten<br />
entlastet <strong>und</strong> gefördert werden -so die<br />
Argumente. Förderung macht aber<br />
nicht die Schule, die sie besuchen,<br />
sondern mit dieser Begründung werden<br />
sie weggeschickt. In den skandinavischen<br />
Ländern verzichten die Schulen<br />
auf eine solche Aussonderung. In der<br />
gemeinsamen Schule für Alle gibt es<br />
schulinternen Förderunterricht, der die<br />
SEITE 14<br />
individuellen Förderbedürfnisse aufgreift<br />
Fachfor-derung in kleinen Gruppen<br />
oder Verhal-tenstraining mit<br />
Sozialpädagogen. 17 % bis 27 % der<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler werden<br />
individuell gefördert, jenach Einzugsbereich,<br />
das ist die langjährige Erfahrung.<br />
Der Förderanteil liegt also wesentlich<br />
höher als in Deutsch land, wo etwas<br />
mehr als 5% die Förderschu-len besuchen.<br />
Statt Kinder zu beschämen, sie<br />
wegzuschicken, wenn sie Probleme<br />
haben, erfahren Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
dort Hilfe, wo sie die Schule<br />
besuchen. Solche Förderung stigmatisiert<br />
nicht. Wie alle internationalen<br />
Untersuchungen deutlich gemacht<br />
haben, ist diese Art von schulinterner<br />
Förderung in einer gemeinsamen<br />
Schule außerordentlich erfolgreich <strong>und</strong><br />
führt zu erheblich besseren Leistungen<br />
gerade der Kinder aus sozial schwächeren<br />
Familien <strong>und</strong> der Migran-tenkinder.<br />
98 % eines Jahrgangs erreichen in<br />
Schweden den Abschluss der Sek<strong>und</strong>arstufe<br />
I. Dass dies auf einem hohen<br />
Kompetenzniveau geschieht, hat PISA<br />
nachgewiesen. Die deutschen Schülerlnnen,<br />
denen man zur Verhinderung<br />
von „Überforderung“ die „Förderung“<br />
in weniger anspruchsvollen Schulformen<br />
zuteil werden ließ, zeigten<br />
dagegen am Ende der Sek<strong>und</strong>arstufe<br />
erhebliche Defizite <strong>und</strong> waren, wie die<br />
Gr<strong>und</strong>schulstudie IGLU deutlich machte,<br />
z. T. hinter den Lernstand am Ende<br />
der Gr<strong>und</strong>schule zurückgefallen. Aber<br />
auch den Leistungsspitzen im Gymnasium<br />
hatte die „Entlastung“ von lernschwierigen<br />
Mitschülern wenig genutzt,<br />
die Oberstufenschüler <strong>und</strong> -schülerinnen<br />
erreichen international nur das<br />
Mittelfeld <strong>und</strong> bleiben mit einem Anteil<br />
von 28 %, die die Hochschulreife erreichen,<br />
weit hinter dem OECD-Durchschnitt<br />
von 45 % zurück.
Wann gelingt Förderung?<br />
„Jedes sinnerfüllte Lernen erfordert<br />
auf Seiten des Lernenden eine<br />
inhaltlich relevante Vorwissensbasis.<br />
Neue Informationen<br />
können weder in ihrer aufgabenspezifischen<br />
Bedeutsamkeit<br />
beurteilt noch in ihrer inhaltlichen<br />
Besonderheit produktiv<br />
erarbeitet werden, ohne dass<br />
der Lernende dabei auf verfügbares<br />
Wissen zurückgreifen<br />
muss. jeder Ansatz ist zum<br />
Scheitern verurteilt, der durch<br />
formale Techniken des Lernens, mit<br />
Hilfe einiger weniger Schlüsselqualifikationen<br />
oder einer funktional autonom<br />
gewordenen intrinsischen Lernmotivation<br />
versucht, fehlendes<br />
oder mangelhaftes inhaltliches Vorwissen<br />
zu kompensieren“ (Weinert 1996, S.<br />
115).<br />
Lernen muss früh einsetzen. Und Fördern<br />
muss früh einsetzen, soll es kontinuierliches<br />
Lernen sichern <strong>und</strong> Lücken<br />
vermeiden helfen. Sind erst Lücken<br />
entstanden, sind sie viel schwerer<br />
wieder aufzufüllen. Fördern muss an<br />
Vorwissen anknüpfen, sonst geht es ins<br />
Leere. Nach dieser Einsicht muss Förderung<br />
parallel zum ersten systematischen<br />
Lernen beginnen. Je nach Aufbau<br />
des Wissenserwerbs schon im Kindergarten,<br />
spätestens aber in der Gr<strong>und</strong>schule.<br />
Sehr gut ist das in finnischen <strong>und</strong><br />
schwedischen Kindergärten, die jetzt<br />
alle „Vorschule“ genannt werden, zu beobachten.<br />
In kleinen Gruppen bringen<br />
die Kindergartenlehrerinnen den Kindern<br />
spielerisch Wörter <strong>und</strong> Begriffe<br />
nahe, durch Portfolios lernen sie ihren<br />
eigenen Lernfortschritt zu verstehen, sie<br />
können zumindest ihrenNamen schreiben<br />
<strong>und</strong> haben Vorstellungen von<br />
Zahlen, Maßen <strong>und</strong> Gewichten, bevor<br />
FÖRDERUNG<br />
sie mit sechs Jahren in die Vorschulklasse<br />
kommen. Hier werden die Bereiche<br />
Worterkennung, Mit Zahlen umgehen<br />
<strong>und</strong> Sich selbst einschätzen können<br />
erweitert.<br />
Kindergartenlehrerinnen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schullehrerinnen<br />
werden gemeinsam<br />
ausgebildet <strong>und</strong> arbeiten eng zusammen.<br />
Früh wird erkannt, welche Kinder<br />
sich schwer tun, <strong>und</strong> mit Beginn der<br />
Gr<strong>und</strong>schule setzt gezielt Leseförderung<br />
ein. In dieser Weise werden in den<br />
nordischen Ländern auch Migrantenkinder<br />
gefördert. Hier haben wir in<br />
Deutschland die größten Defizite. Je<br />
nach Kenntnis der Landessprache findet<br />
die Alphabetisierung in der Muttersprache<br />
oder Landessprache statt. Die<br />
Landessprache wird intensiv unterrichtet,<br />
die Muttersprache ebenfalls. Zusätzlich<br />
gibt es eine Förderung in den<br />
Sachfächern durch eine zweite Lehrkraft<br />
in Klassen mit Migrantenkindern,<br />
möglichst in der Muttersprache der<br />
Kinder. Diese Forderung wird solange<br />
fortgesetzt, bis die Kinder die Landessprache<br />
beherrschen. So wird vermieden,<br />
dass Lücken entstehen, weil das<br />
Kind die Lehrerin in den Sachfächern<br />
nicht verstehen kann.<br />
Spätere Förderung von Migrantenkindern<br />
in Deutschland trifft oft auf zu<br />
SEITE 15<br />
viele Lücken <strong>und</strong> ist nicht mehr sehr<br />
erfolgreich, weil zu wenig Vorwissen<br />
vorhanden ist. Förderung in erfolgreichen<br />
Bildungssystemen setzt früh ein<br />
<strong>und</strong> ist personell intensiv. Sie<br />
wird kontinuierlich fortgeführt<br />
durch die Gr<strong>und</strong>schule<br />
in die Sek<strong>und</strong>arstufe. Und<br />
selbst in der Oberstufe haben<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
noch die Möglichkeit, auf das<br />
schulinterne Fördersystem<br />
zuzugreifen. Noch 2002 hat die<br />
OECD festgestellt, dass nur 14 %<br />
der Schüler in Deutschland eine Schule<br />
besuchen, die speziellen Förderunterrichtdurch<br />
Lehrkräfte anbietet. der im<br />
internationalen Vergleich mit großem<br />
Abstand niedrigste Anteil. Der OECD -<br />
Durchschnitt liegt hier bei 72 %, während<br />
er in Dänemark, Finnland, Japan,<br />
Neuseeland <strong>und</strong> dem Vereinigten<br />
Königreich bei über 90 % liegt (Bildung<br />
auf einen Blick. OECD Indikatoren<br />
2002).<br />
Welche Ziele verfolgen wir eigentlich,<br />
wenn wir Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
fördern?<br />
In Deutschland fehlen bis heute von<br />
allen akzeptierte Bildungsziele, die dem<br />
gesamten Schulwesen Orientierung<br />
geben. Zwar finden sich in allen Präambeln<br />
zu Richtlinien <strong>und</strong> in den Schulgesetzen<br />
der Länder Kataloge gr<strong>und</strong>sätzlicher<br />
Werte, wie z. B. in Art. 7 der<br />
nordrhein-westfälischen Landesverfassung:<br />
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung<br />
vor der Würde des Menschen <strong>und</strong><br />
Bereitschaft zum sozialen Handeln zu<br />
wecken ist vornehmstes Ziel der <strong>Erziehung</strong>“,<br />
doch für die Schulrealität haben<br />
sie nicht unmittelbare Bedeutung.<br />
Das ist anders in Skandinavien. Hier<br />
sind die Bildungsziele auf einer pragmatischeren<br />
Ebene angesiedelt, dafür
prägen sie die Schulrealität. In Schweden<br />
gelten Demokratie <strong>und</strong> Verantwortung<br />
als oberste Ziele der<br />
Schule. Alle Schweden sollen in der<br />
Lage sein, als gleichberechtigte<br />
Mitglieder einer demokratischen<br />
Gesellschaft persönliche Verantwortung<br />
zu übernehmen. „Alle<br />
Aktivitäten in der Schule müssen<br />
in Übereinstimmung mit den<br />
gr<strong>und</strong>legenden Werten gestaltet<br />
werden“, heißt es im schwedischen<br />
Schulgesetz. „Der Unterricht muss<br />
demokratische Ar-beitsformen verwenden<br />
<strong>und</strong> die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
darauf vorbereiten, persönliche Verantwortung<br />
für ihr Tun <strong>und</strong> Lassen zu<br />
übernehmen.“ Oberstes Bildungsziel in<br />
Finnland ist Chancengleichheit, in<br />
Norwegen ist es „Menschlichkeit in<br />
einer sich ständig verändernden Gesellschaft“.<br />
Standards <strong>und</strong> Curricula sind<br />
auf diese Ziele bezogen <strong>und</strong> Förderung<br />
heißt, allen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
das Erreichen dieser Ziele zu ermöglichen.<br />
In Deutschland gibt es derartige verbindliche<br />
Bildungsziele nicht. Die Standards,<br />
die die Kultusministerkonferenz<br />
2003 beschlossen hat, sind, trotz ihres<br />
Namens, auch keine Bildungsstandards,<br />
sondern Fachleistungsstandards. Die<br />
Kultusminister <strong>und</strong> -ministerinnen<br />
haben sich darauf verständigt, über wie<br />
viel Fachwissen (im besten Fall - Englisch<br />
- auch: welche Kompetenzen) die<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen verfügen<br />
müssen, um den mittleren Bildungsabschluss<br />
zu erreichen. Es gibt keine Zielorientierung,<br />
wie viele Schüler diesen<br />
Abschluss erreichen sollen. Logischerweise<br />
gibt es auch keine Verpflichtung<br />
der Schulen, ihre Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
zu fördern mit dem Ziel, dass<br />
möglichst alle die Standards für den<br />
FÖRDERUNG<br />
mittleren Abschluss erreichen. Alles ist<br />
so unbestimmt wie bisher.<br />
Diese Logik trifft insbesondere die<br />
Jugendlichen, die Hauptschulen <strong>und</strong><br />
Sonderschulen besuchen, sie werden<br />
von der Kultusministerkonferenz von<br />
vornherein als diejenigen definiert, die<br />
den mittleren Bildungsabschluss nicht<br />
erreichen können. Es ist keine Rede<br />
davon, auch sie so zu fördern, dass<br />
möglichst viele von ihnen die Bildungsstandards<br />
erreichen. Für sie haben die<br />
Kultusminister eigene reduzierte Standards<br />
für den Hauptschulabschluss<br />
beschlossen <strong>und</strong> die Länder erlassen<br />
eigene reduzierte Kerncurricula.<br />
Bei einem Vergleich der Standards <strong>und</strong><br />
der darauf bezogenen Kerncurricula<br />
fällt auf, dass in Englisch z. B. im Curriculum<br />
für die Hauptschule in NRW<br />
jeder Hinweis auf Literatur <strong>und</strong> Kultur<br />
fehlt, dass es auch nicht um Reisen in<br />
englisch-sprachige Länder geht - es<br />
fehlt der gesamte kulturelle <strong>und</strong> internationale<br />
Kontext, auf den die Bildungsstandards<br />
für den mittleren Abschluss<br />
großen Wert legen. Die Standards für<br />
den Hauptschulabschluss sind auf<br />
schlichte Kommunikation <strong>und</strong> Texte zur<br />
SEITE 16<br />
Berufswelt geschrumpft. Damit sind<br />
Hauptschüler <strong>und</strong> Sonderschüler abgehängt,<br />
ihr Bildungsgang endet in einer<br />
Sackgasse.<br />
Auch gute Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
in diesen Schulformen<br />
haben keine Chance mehr, den<br />
mittleren Abschluss zu erreichen,<br />
denn sie werden nicht nach<br />
Lehrplänen unterrichtet, die auf<br />
den mittleren Bildungsabschluss<br />
bezogen sind. Konnten bisher<br />
Jugendliche über die Hauptschule<br />
auch die Fachober-schulreife<br />
erwerben, sogar mit Qualifikation,<br />
<strong>und</strong> dann weiterführende<br />
Schulen besuchen, so wird dies in Zukunft<br />
nicht mehr möglich sein: es bleibt<br />
ein fachlich so stark reduzierter Abschluss,<br />
dass auch die Berufschancen<br />
von Hauptschülern <strong>und</strong> -schülerinnen<br />
weiter sinken werden.<br />
DieAlternative wären anspruchsvolle<br />
Mindeststandards, die von praktisch<br />
allen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern erreicht<br />
werden müssen, wie es in den so<br />
erfolgreichen nordischen Ländern<br />
praktiziert wird. Solche Standards<br />
wären eine Herausforderung für unser<br />
Schulsystem. An diesen Standards<br />
müsste sich auch die Förderung orientieren.<br />
Mindeststandards für Deutschland<br />
hatte auch Eckhard Klieme in<br />
einem Gutachten für die Kultusministerkonferenz<br />
empfohlen. Das Gutachten<br />
wurde b<strong>und</strong>esweit gelobt, doch die<br />
damalige Präsidentin der KMK, Karin<br />
Wolff aus Hessen, lehnte Mindeststandards<br />
ab, sie erschienen ihr nicht anspruchsvoll<br />
genug für die Gymnasien.<br />
Schließlich einigten sich die Kultusminister<br />
auf Regelstandards oder, wie<br />
es heute heißt, Bildungsstandards für<br />
den mittleren Abschluss.
Gute Standards, so Klieme, eröffnen die<br />
Chance, dass klar festgelegt wird, was<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler am Ende eines<br />
Ausbildungsabschnitts können sollen. Es<br />
geht nicht mehr um den „Input“, was<br />
Lehrerinnen unterrichten sollen, mit<br />
unsicherem Ausgang, was schließlich<br />
hängen bleibt. Das setzt aber voraus, dass<br />
Standards nicht zur Verfeinerung der<br />
Auslese, also zur Legitimierung von Schulform-<br />
<strong>und</strong> Laufbahnentschei-dungen,<br />
missbraucht werden. Es setzt auch voraus,<br />
dass es Mindeststandards gibt, auf die sich<br />
die Gesellschaft verpflichtet <strong>und</strong> für die sie<br />
Verantwortung übernimmt:<br />
Fordern <strong>und</strong> fördern. Schulen <strong>und</strong> Lehrkräfte<br />
müssten Förderkonzepte entwickeln,<br />
wie möglichst alle Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler diese Standards erreichen können<br />
<strong>und</strong> die Gesellschaft müsste den Schulen<br />
die Mittel für diese Förderung zur Verfügung<br />
stellen. Aufbauend auf den Mindestkompetenzen,<br />
die alle Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schüler erwerben, können höhere Kompetenzstufen<br />
für immer mehr Jugendliche<br />
angestrebt werden. Hohe Anforderungen<br />
<strong>und</strong> gezielte Förderung wären der Weg zu<br />
einem besseren Bildungsstand für alle.<br />
Es ist zu hoffen, dass die demografische<br />
<strong>und</strong> ökonomische Entwicklung in<br />
Deutschland den Verantwortlichen möglichst<br />
bald deutlich macht, dass wir es uns<br />
nicht mehr leisten können, etwa ein Viertel<br />
unserer Jugendlichen von guter Ausbildung<br />
auszuschließen, indem wir die<br />
Anforderungen reduzieren, sondern dass<br />
Förderkonzepte entwickelt werden müssen,<br />
wie möglichst alle qualifizierte Standards<br />
erreichen können.<br />
SOZIALPÄDAGOGEN<br />
Aufruf zur Bildung eines<br />
Arbeitskreises<br />
Zur Situation in den Kölner Kindertagesstätten<br />
von Dipl.-Päd. Peter Heim<br />
Sicher kennt das jeder, der sein Kind<br />
in Köln in einer der städtischen Kitas<br />
unterbringen will oder untergebracht<br />
hat: Immer wieder gibt es Themen,<br />
die sowohl Eltern als auch Erzieher-<br />
Innen interessieren, die wegen der<br />
besonderen Situation vor Ort aber<br />
nicht diskutiert werden können, oder<br />
Probleme, die, wenn überhaupt, nur<br />
Kita-übergreifend angegangen oder<br />
gelöst werden können.<br />
Hinzu kommen die Sparmaßnahmen<br />
der Stadt Köln auch im Kita-<br />
Bereich, die der gesellschaftlichen<br />
Notwendigkeit, die Bildungsarbeit in<br />
den Kitas stärker auszubauen,<br />
diametral entgegenstehen.<br />
Bei den Eltern war dabei der Ausgangspunkt<br />
die Beobachtung, dass es<br />
in Köln zwar Elternräte für die<br />
einzelnen Kitas, aber keine bezirks<strong>und</strong><br />
stadtbezogenen Elternräte gibt,<br />
die solche Fragen angehen könnten.<br />
Ein Beispiel hierfür ist die Abschaffung<br />
einer bewährten Praxis in<br />
vielen Kitas, nämlich eines von der<br />
Kita gestellten attraktiven Frühstücks<br />
für alle Kinder Ende letzten<br />
Jahres. Dem voraus ging eine zentrale<br />
Entscheidung der Stadtverwaltung.<br />
Die Elternräte vor Ort hatten<br />
keine Möglichkeit, diese<br />
Entscheidung zu revidieren.<br />
Zwar gab es eine gewisse<br />
öffentliche Kritik an dieser<br />
Entscheidung bis hin zu<br />
einem Beitrag in der<br />
WDR-Lokalzeit, aber<br />
diese Kritik hatte keine<br />
praktischen Konsequenzen.<br />
SEITE 17<br />
Bei den ErzieherInnen gibt es andere<br />
Interessen im Hinblick auf ihre Situation<br />
als abhängig Beschäftigte. Hier ist<br />
die <strong>Gewerkschaft</strong> ver.di bereits aktiv.<br />
Hinzu kommen aber inhaltliche Interessen,<br />
die die Qualität ihrer Arbeit betreffen.<br />
Spätestens hier treffen sich ihre<br />
Interessen <strong>und</strong> die der Eltern: Es geht<br />
um die bestmöglichen Bedingungen<br />
<strong>und</strong> Möglichkeiten für unsere Kinder in<br />
unserer Stadt:<br />
„Für eine bessere Bildung aller Kinder<br />
von Anfang an.“ (GEW)<br />
Und gerade bei der inhaltlichen <strong>und</strong><br />
praktischen Bearbeitung dieser Querschnittsaufgabe<br />
gibt es aus unserer<br />
Sicht in Köln einen eklatanten Mangel.<br />
Wir rufen deshalb zur Bildung einer<br />
Arbeitsgruppe interessierter Kölner<br />
Eltern <strong>und</strong> ErzieherInnen auf, um die<br />
Situation der Kölner Kindertagesstätten<br />
zu verbessern.<br />
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei<br />
der Geschäftsstelle der GEW, Stadtverband<br />
Köln, unter<br />
Tel. 0221/516267<br />
Fax: 0221/525446<br />
email: gew-koeln@netcologne.de<br />
Sie erhalten dann bei einer genügend<br />
großen Anzahl an Interessenten einen<br />
Termin für ein erstes Treffen.
Einladung<br />
Der Lehrerrat:<br />
Klagemauer?<br />
Motor der Schulentwicklung?<br />
Streitschlichter?<br />
Minipersonalrat?<br />
Die Fortbildung wendet sich an Lehrerräte<br />
<strong>und</strong> an Lehrerratsarbeit Interessierte an<br />
traditionellen (nicht selbstständigen)<br />
Schulen, die effektiv die Interessen der<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen vertreten <strong>und</strong><br />
ihre Schule mitgestalten wollen. Neben einer<br />
knappen Darstellung der gesetzlichen<br />
Rechte <strong>und</strong> Pflichten als Lehrerrat stehen<br />
der kollegiale Austausch <strong>und</strong> Praxisfragen<br />
im Vordergr<strong>und</strong>: das Selbstverständnis,<br />
der Umgang mit den Anliegen der<br />
Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen,<br />
das Verhältnis zur Schulleitung.<br />
Rechte des Lehrerrats:<br />
„Gummiparagrafen“ als Chance.<br />
Personalvertretungsrechtliche Aufgaben:<br />
Einstieg zum Minipersonalrat?<br />
Selbstverständnis, Zielsetzung,<br />
Arbeitsplanung: Klarheit <strong>und</strong> Struktur.<br />
Interessenvertretung:<br />
Um welche Anliegen muss, will <strong>und</strong> kann<br />
ich mich kümmern?<br />
Mitgestaltung bei der Schulentwicklung:<br />
Zwischen Kooperation <strong>und</strong> Konflikt.<br />
Lösungen für Praxisprobleme:<br />
Und wie geht das?<br />
Samstag, 25.6.<strong>2005</strong><br />
9.30-16.30 Uhr<br />
Köln, DGB-Haus<br />
Leitung: U. Becker<br />
Bitte in der Geschäftsstelle anmelden:<br />
gew-koeln@netcologne.de<br />
<strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Köln<br />
Service für<br />
SozPäd.<br />
Erzieherin:<br />
Zwischen Kind <strong>und</strong><br />
Bildungsplänen<br />
Die Fachzeitschrift „Kindergarten<br />
heute“ hat in einer Umfragen von 2.104<br />
ErzieherInnen erfahren, wie sich deren<br />
Berufsalltag darstellt.<br />
Einige Ergebnisse:<br />
• 70 % der Einrichtungen integrieren<br />
Kinder mit besonderem Förderbedarf,<br />
• 85 % haben ein schriftlich formuliertes<br />
Konzept,<br />
• die Bewegungserziehung dominiert<br />
mit 25 % das pädagogische Profil,<br />
• in 53 % der Einrichtungen ist die<br />
Leitung freigestellt,<br />
• die größte Berufszufriedenheit haben<br />
37 % der ErzieherInnen im Umgang mit<br />
einzelnen Kindern.<br />
Zukunftsfaktor<br />
Kinderbetreuung<br />
Der Deutsche Industrie- <strong>und</strong> Handelskammertag<br />
hat in einer Umfrage erhoben,<br />
was Kitas zur Vereinbarkeit von<br />
Familie <strong>und</strong> Berufe anbieten. 170<br />
Einrichtungen haben sich beteiligt.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der Ergebnisse<br />
forderte der DIHK u. a., die Mittagsschließung<br />
generell abzuschaffen <strong>und</strong><br />
Kitas auch am Wochenende zu öffnen.<br />
Der Kitabesuch sollte im 5. Lebensjahr<br />
verpflichtend <strong>und</strong> für die Eltern kostenfrei<br />
sein.<br />
Weitere Informationen in der GEW<br />
Geschäftsstelle (Tel.: 0221/516267 oder<br />
email: gew-koeln@netcologne.de).<br />
SEITE 18<br />
Buchempfehlung:<br />
Fluchtpunkt Sonderschule<br />
Gibt es Alternativen?<br />
Aus der Praxis für Eltern, Jugendhilfe<br />
<strong>und</strong> Schule<br />
Ergebnisse eines wissenschaftlichen<br />
Symposions. Rechtsgr<strong>und</strong>lagen,<br />
Praxisbeispiele. Politikempfehlung<br />
Beiträge:<br />
Dr. Bernardino Mancini. Italienischer<br />
Generalkonsul Köln<br />
• Dr. (I) Sergio Mancini, Internationale<br />
Familienberatung des Caritasverbandes<br />
Köln: Erlebnisse mit der Sonderschule<br />
• Dr. Mechtild Gomolla, Universität<br />
Münster: Überrepräsentation der Migrantenkinder<br />
in den Sonderschulen<br />
für Lernbehinderte - auch ein Effekt der<br />
institutionellen Diskriminierung?<br />
• Dr. Wolfgang Zaschke, Jugendhilfe<br />
<strong>und</strong> Schule e.V. / Nippes Museum:<br />
Schülerförderung in der kommunalen<br />
Jugendhilfe <strong>und</strong> Integrationsförderung<br />
- eine Alternative zur Sonderschuleinweisung<br />
von Migrantenkindern?<br />
• Michael Verhoeven, Rechtsanwalt<br />
Köln: Ansatzpunkte für eine Verbesserung<br />
der Rechtsposition von Eltern<br />
gegenüber Schule aus Anwaltsperspektive.<br />
• Volker Balsat, Sonderschullehrer /<br />
Italienisches Konsulat (CO.AS.SCIT):<br />
Gegenmaßnahmen zur Einweisung in<br />
die Sonderschule am Beispiel eines<br />
Konsulates<br />
Nippes Museum - Jugendhilfe <strong>und</strong><br />
Schule e.V. - 120 S<br />
Köln: März <strong>2005</strong> - 5,- Euro; Kostenlos<br />
als PDF-Datei.<br />
Bestellung nippes.museumweb.de
HIB<br />
HochschulInformationsBüro Köln / Bonn<br />
Workshops<br />
im SommerSemester <strong>2005</strong><br />
Zeitmanagement<br />
Sa., 2.7. 05<br />
10 - 18 Uhr<br />
Zeitmanagement hilft,<br />
sich auf das Wesentliche<br />
zu konzentrieren. Es<br />
steigert die Leistungsfähigkeit,<br />
schafft mehr<br />
Erfolgsmöglichkeiten<br />
<strong>und</strong> eine höhere Zufriedenheit.<br />
Die wichtigsten Instrumente<br />
zur effizienteren<br />
Gestaltung der Arbeit<br />
<strong>und</strong> dem bewussten<br />
Umgang mit der Zeit<br />
werden vermittelt.<br />
Inhalte sind u.a. Ziele<br />
setzen, Strukturieren <strong>und</strong><br />
Planen von komplexen<br />
Aufgaben, persönliche<br />
Zeitfallen <strong>und</strong> Störfaktoren<br />
erkennen, Checklisten<br />
<strong>und</strong> Ablagesysteme<br />
sowie Werk-zeugkisten<br />
für die eigene Arbeitsorganisation.<br />
Selbstständigkeit - eine Alternative in<br />
pädagogischen Berufen?<br />
Fr. 15. 7. <strong>2005</strong> von 16 bis 19 Uhr <strong>und</strong><br />
Sa. 16. 7. <strong>2005</strong> von 10 bis 18 Uhr<br />
Selbstständigkeit kann eine Möglichkeit in einer<br />
schwierigen Arbeitsmarktlage sein, sie ist aber auch<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich eine interessante Alternative zur abhängigen<br />
Beschäftigung.<br />
Wir beschäftigen uns mit dem Entscheidungsprozess:<br />
Bin ich von meiner Persönlichkeit her ein Existenzgründer,<br />
ein Typ für Selbstständigkeit? Welche fachlichen<br />
<strong>und</strong> kaufmännischen Qualifikationen sollte ich<br />
haben?<br />
Anhand der (vielleicht noch vagen) Geschäftsideen<br />
der TeilnehmerInnen prüfen wir Tätigkeiten <strong>und</strong><br />
Tätigkeitsfelder auf ihre Eignung für eine Existenzgründung.<br />
Neben der Entscheidungshilfe werden wir uns mit den<br />
praktischen Aspekten der Selbstständigkeit befassen.<br />
Darüber hinaus können konkrete Realisierungsmöglichkeiten<br />
der beruflichen Vorstellungen der<br />
TeilnehmerInnen erarbeitet werden.<br />
Zielgruppe: Studierende/AbsolventInnen<br />
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen<br />
Teilnahme-Gebühr: für das eintägige Seminar 10 Euro (GEW-Mitglied),<br />
15 Euro (Nicht-Mitglied)<br />
sowie 15 Euro (bzw. 20 Euro) für das 1,5-tägige<br />
Seminar. Hierin sind auch die Kosten für einen<br />
Mittagsimbiss, Getränke <strong>und</strong> Skripte enthalten.<br />
Ort. DGB-Haus, Hans-Böckler-Platz 1, 50672 Köln<br />
Trainerin: Dipl.-Päd. Beate Kleifgen<br />
Anmeldung: gew-koeln@netcologne.de<br />
oder 0221-516267 (Mo: 10-13 Uhr)<br />
Infos <strong>und</strong> Anregungen: beate.kleifgen@jungegew.de<br />
SEITE 19<br />
Einladung<br />
Eine Informationsveranstaltung zum<br />
Referendariat für Lehramtsstudierende<br />
der Sek<strong>und</strong>arstufe I/II<br />
Lehrer/in werden?<br />
Dienstag, 24. Mai <strong>2005</strong><br />
18:00 bis 20:00 Uhr<br />
Raum wird noch bekanntgegeben<br />
Philosophikum, Universität zu Köln<br />
Erstes Staatsexamen,<br />
was nun?<br />
Das Hochschulinformationsbüro der <strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
veranstaltet für die knapp 15.000 Lehramtsstudierenden<br />
der Universität zu Köln in<br />
jedem Semester Informationsveranstaltungen<br />
zum Thema Referendariat.<br />
Das Berufsbild des Lehrers/der Lehrerin <strong>und</strong><br />
die praktischen Anforderungen, die an<br />
Referendare <strong>und</strong> Referendarinnen in Schule<br />
<strong>und</strong> Seminaralltag gestellt werden, können in<br />
der universitären Lehramtsausbildung kaum<br />
thematisiert werden.<br />
Dieses Defizit möchte die GEW durch die<br />
Veranstaltung »Erstes Staatsexamen - was<br />
nun?« ausgleichen. Informiert wird u.a. über<br />
den Numerus Clausus im Referen-dariat, den<br />
bedarfsdeckenden Unterricht, die Einstellungschancen<br />
nach dem Referendariat<br />
sowie über den ganz normalen<br />
Referendariatsalltag.<br />
<strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Köln
Einladung<br />
Coro Getsemnani<br />
Chinandega (Nicaragua)<br />
Der Coro Getsemani ist ein Bestandteil<br />
des »Kinderhilfsprojekts Chinandega<br />
2001« <strong>und</strong> tritt in den USA <strong>und</strong> in Europa<br />
auf. Die Musik gibt den Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen in Chinandega Hoffnung<br />
in zweifacher Hinsicht:<br />
Sie transportiert die Lebensfreude <strong>und</strong><br />
Hoffnung ehemaliger Kinder von der<br />
Müllhalde auf ein erfülltes <strong>und</strong> menschenwürdiges<br />
Leben <strong>und</strong> sichert gleichzeitig<br />
den Bestand <strong>und</strong> die Weiterentwicklung<br />
des Kinderhilfsprojektes.<br />
Der Coro Getsemani besteht aus einem<br />
Chor, einer Band <strong>und</strong> einer Tanzgruppe.<br />
Er setzt sich zusammen aus Kindern <strong>und</strong><br />
Jugendlichen im Alter von 8 bis 16 Jahren .<br />
Ihr Repertoire umfasst lateinamerikanische<br />
Folklore.<br />
2003 war der Coro Getsemani das erste<br />
Mal in Deutschland auf Tournee.<br />
Die Kölner Konzerte des Chors werden<br />
vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft<br />
Köln-Corinto/El Realejo<br />
unterstützt. Chinandega ist Nachbarstadt<br />
von Corinto <strong>und</strong> El Realejo.<br />
6. Juni <strong>2005</strong>, 20.00 Uhr<br />
Comedia Colonia, Löwengasse 7-9<br />
Eintritt 10 Euro<br />
<strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Köln<br />
FACHGRUPPEN & ARBEITSKREISE<br />
FG KiTa<br />
Privattelefonate während der Arbeitszeit;<br />
unvorbereitete Teilnahme an der<br />
Teambesprechung; ständiges Zuspätkommen;<br />
Liegenlassen des Materials;<br />
unaufgeräumte Küche; informelles<br />
»Quatschen« mit den Eltern; unerledigte<br />
Arbeitsaufträge; vergessene Absprachen<br />
...<br />
In Kindertagesstätten wird meist<br />
immer noch das Motto „Wir sind so<br />
sozial <strong>und</strong> kommen alle immer gut<br />
miteinander aus“ gelebt. Das hat zur<br />
Folge, dass Konflikte nicht offen besprochen<br />
werden <strong>und</strong> unterschwellig brodeln.<br />
Die Fachgruppe KiTa trifft sich am<br />
Donnerstag, 23.6.<strong>2005</strong> von 17.30 Uhr<br />
bis 19.30 Uhr zum Thema: „Grenzen<br />
setzen - Konflikte vermeiden!“ Wir<br />
tauschen uns darüber aus, welche<br />
Verhaltensweisen uns zum „brodeln<br />
<strong>und</strong> explodieren“ bringen können, wie<br />
wir Grenzen setzen <strong>und</strong> angemessen<br />
reagieren können.<br />
Das erste Treffen nach den Sommerferien<br />
findet statt am Donnerstag, 1.9.<strong>2005</strong><br />
von 17.30 bis 19.30 Uhr zum Thema:<br />
„Öffentlichkeitsarbeit/ Sponsoring“<br />
Treffpunkt: DGB-Haus, Hans-Böckler-<br />
Platz 1<br />
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.<br />
Wegen der Raumreservierung<br />
Anmeldungen bitte bis 16.6.05 bzw.<br />
26.8.05 in der GEW Geschäftsstelle.<br />
SEITE 20<br />
FG Gr<strong>und</strong>schule<br />
Die Fachgruppe Gr<strong>und</strong>schule trifft sich<br />
das nächste Mal am Montag, 06. Juni<br />
<strong>2005</strong> um 19.00 Uhr im DGB-Haus.<br />
Hans-Böckler-Platz 1, GEW-Geschäftsstelle<br />
1. OG,<br />
Thema des Fachgruppentreffens:<br />
„ Schulinspektionen in Nordrhein-<br />
Westfalen“ – Was da alles auf uns<br />
zukommt!<br />
- Austausch von Informationen, Erfahrungen,<br />
Befürchtungen -<br />
Ab 2009 sollen alle Schulen in NRW<br />
nach dem Willen des Schulministeriums<br />
„selbstständige Schulen“ werden.<br />
Gleichzeitig soll die Schulaufsicht<br />
umstrukturiert werden. Es soll nur<br />
noch eine zweistufige Schulaufsicht<br />
geben (Schulamt <strong>und</strong> Ministerium).<br />
Hauptaufgabe der Schulaufsicht soll die<br />
Beratung der Schulen werden. Daneben<br />
sollen SCHULINSPEKTIONEN als<br />
Instrument der externen Bewertung<br />
von Schulen treten.<br />
Ab April <strong>2005</strong> nehmen 10 Schulen pro<br />
Regierungsbezirk in einer Erprobungsphase<br />
an einem Pilotprojekt Schulinspektionen<br />
teil.<br />
Die Ergebnisse sollen ab 2009 auf alle<br />
Schulen übertragen werden. Über<br />
Schulinspektionen gibt es zur Zeit einen<br />
sehr unterschiedlichen Informationsstand<br />
in den Schulen. In manchen<br />
Schulen gehen Gerüchte um, schon ab<br />
dem nächsten Schuljahr werde es<br />
Schulinspektionen geben.<br />
Auf unserer Fachgruppensitzung wollen<br />
wir uns verfügbare Informationen zum<br />
Instrument Schulinspektion geben <strong>und</strong><br />
zusammen tragen <strong>und</strong> uns mit der<br />
Bedeutung für LehrerInnen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schulen<br />
beschäftigen.<br />
Kontakt:<br />
Wolfgang Raabe, Tel. 02203-51342,<br />
Dorothee Kammann, Tel. 0221-9378706
FG Hauptschule<br />
Die nächste Fachgruppensitzung findet<br />
statt am Donnerstag, 16. Juni <strong>2005</strong> ab<br />
19.00 Uhr im DGB-Haus, Hans-Böckler-<br />
Platz 1, GEW-Besprechungsraum, 1. OG.<br />
Kontakt:<br />
Hans-Martin Meister, Tel. 0221/317247<br />
FG Sonderpädagogische<br />
Berufe<br />
Die Fachgruppe trifft sich am Montag,<br />
6. Juni <strong>2005</strong> um 19.30 Uhr im DGB-<br />
Haus, Hans-Böckler-Platz 1, Tagungsraum<br />
EG.<br />
Schwerpunktthema: Förderpläne<br />
Referentinnen: Dorothea Braun, Judith<br />
Schmischke<br />
Anschließend: Gemeinsames Kölsch.<br />
Ansprechpartnerin:<br />
Christiane Balzer, Tel. 0221/515214<br />
FG Realschule<br />
Immer am letzten Donnerstag im<br />
Monat trifft sich der Stammtisch der<br />
Fachgruppe Realschule im „Dionysos“,<br />
Zülpicher Str. / Ecke Meister-Gerhard-<br />
Str. (Haltestelle Linie 9: Dasselstr./<br />
Bahnhof Süd) ab 19.30 Uhr.<br />
Gelegenheit zum Diskutieren <strong>und</strong><br />
„Klönen“; die neuesten Trends im<br />
Dienstrecht <strong>und</strong> Schulrecht können<br />
eingeholt werden; Personalräte sind als<br />
Ansprechpartner da. Alle Kolleginnen<br />
<strong>und</strong> Kollegen sind herzlich eingeladen!<br />
LEMK<br />
Unser nächstes Treffen ist am Montag,<br />
20. Juni <strong>2005</strong> um 19.00 Uhr im DGB-<br />
Haus, Hans-Böckler-Platz 1, GEW-<br />
Besprechungsraum, 1. OG<br />
Weiterer Termin: Montag, 5. September<br />
<strong>2005</strong> um 19.00 Uhr<br />
Ansprechpartner: Spyros Kostadimas<br />
FACHGRUPPEN & ARBEITSKREISE<br />
FG Gymnasium<br />
1. Zu unserer nächsten Fachgruppensitzungen<br />
laden wir ein:<br />
Dienstag, 14. Juni <strong>2005</strong> um 20.00 Uhr<br />
im Kölner DGB-Haus, Hans-Böckler-<br />
Platz 1, GEW-Besprechungsraum, 1. OG.<br />
Mitglieder <strong>und</strong> Gäste sind herzlich<br />
willkommen!<br />
2. Einladung für Referendarinnen <strong>und</strong><br />
Referendare: Wenn Sie die GEW<br />
kennenlernen wollen, kommen Sie zu<br />
uns. Sie sind herzlich willkommen.<br />
Besprechen Sie mit uns gewerkschaftliche<br />
Anregungen am Seminar, informieren<br />
Sie sich über unsere Aktivitäten.<br />
Termin: Dienstag, 7. Juni <strong>2005</strong> um 20<br />
Uhr im Kölner DGB-Haus, Hans-<br />
Böckler-Platz 1, Tagungsraum EG.<br />
FG Berufskolleg<br />
Bezirksarbeitskreis im Regierungsbezirk<br />
Köln<br />
Zum nächsten gemeinsamen Treffen<br />
des Bezirksarbeitskreises <strong>und</strong> der<br />
Fachgruppe Berufskolleg laden wir euch<br />
herzlich ein. Es findet statt:<br />
Donnerstag, 30. Juni <strong>2005</strong> um 17.00 Uhr<br />
im DGB-Haus, Hans-Böckler-Platz 1,<br />
Großer Saal 1. OG<br />
Bitte mailt uns hierzu eure Themenwünsche.<br />
Wir freuen uns über eine rege<br />
Teilnahme <strong>und</strong> grüßen ganz herzlich,<br />
• Mechtild Degen-Sieg, für die Fachgruppe<br />
(degen-sieg@web.de)<br />
• Dietrich Weinkauf, für den Bezirksarbeitskreis<br />
(d.weinkauf@t-online.de)<br />
Wenn GEW, dann<br />
www.gew-koeln.de<br />
SEITE 21<br />
Arbeitskreis<br />
Angestellte Lehrkräfte<br />
Bezirk Köln<br />
Der Arbeitskreis trifft sich jeden ersten<br />
Montag im Monat um 19.00 Uhr im<br />
DGB-Haus am Hans-Böckler-Platz 1.<br />
Die nächsten Termine:<br />
6. Juni <strong>2005</strong>, Großer Saal 1. OG<br />
4. Juli <strong>2005</strong>, Kleiner Sitzungssaal 1. OG<br />
Kontaktadresse für Köln:<br />
Hans-Peter Persy,Tel.: 0221/733294<br />
email: corneille@freenet.de<br />
AK „Rechtsextremismus“<br />
Liebe InteressentInnen,<br />
auf der Veranstaltung „Rechtsrock“ am<br />
17.Februar wurde von einigen Teilnehmern<br />
das Bedürfnis nach weiterem<br />
Austausch über Handlungskonzepte<br />
zum Umgang mit »rechten« Jugendlichen<br />
im pädagogischen Raum <strong>und</strong> nach<br />
weiterer Einarbeitung in das Thema<br />
»rechte Jugendkulturen« geäußert. Den<br />
Vorschlag einen Arbeitskreis zu initiieren<br />
möchten wir nun umsetzen <strong>und</strong><br />
laden hiermit alle Interessierten zum<br />
ersten Treffen des AK ein.<br />
Das konstituierende Treffen des GEW<br />
Arbeitskreises wird am 24.Mai <strong>2005</strong> um<br />
18.oo Uhr im Tagungsraum (DGB-<br />
Haus, Hans-Böckler-Platz 1, EG) stattfinden.<br />
Hier möchten wir uns über die Inhalte<br />
<strong>und</strong> Zielsetzungen des AK einigen <strong>und</strong><br />
erste Aufgaben festlegen.<br />
Bitte leitet diese Information an weitere<br />
interessierte KollegInnen weiter. Die<br />
Teilnahme am AK ist nicht ausschließlich<br />
GEW Mitgliedern vorbehalten.<br />
Wir freuen uns besonders auf deine<br />
Teilnahme am 24. Mai um 18 Uhr!<br />
Viele Grüße<br />
Beate, Drorit <strong>und</strong> Max
FACHGRUPPEN & ARBEITSKREISE<br />
Fragebogenaktion der Fachgruppe Gr<strong>und</strong>schule<br />
von Wolfgang Raabe<br />
Zu Beginn des Jahres verschickte die<br />
Fachgruppe Gr<strong>und</strong>schule an alle Fachgruppenmitglieder<br />
einen Fragebogen,<br />
um allen die Gelegenheit zu geben ihre<br />
Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse als Gr<strong>und</strong>schullehrerInnen<br />
in der GEW zum<br />
Ausdruck zu bringen. Ziel der Umfrage<br />
ist es die Informations- <strong>und</strong> Beratungsarbeit<br />
<strong>und</strong> die Aktivitäten der GEW an<br />
Kölner Gr<strong>und</strong>schulen zu verbessern.<br />
Von ca. 600 verschickten Fragebögen<br />
wurden bis Ende Februar 75 Fragebögen<br />
wieder zurück geschickt. Die Antworten<br />
wurden von Mitgliedern der<br />
Fachgruppe Gr<strong>und</strong>schule ausgewertet.<br />
Hier die Ergebnisse:<br />
Erwartungen an die Fachgruppe<br />
Gr<strong>und</strong>schule:<br />
Informationen zu Schulpolitik, Schulrecht,<br />
schnelle Reaktion auf Erlasse per<br />
E-mail (auch europäisch) (22 x)<br />
Kritische Stellungnahme zu Bildungspolitik<br />
(19 x)<br />
Interessenvertretung gegenüber Politik,<br />
Dienstherren <strong>und</strong> Schulaufsicht (18 x)<br />
Diskussionsabende/ Fortbildung /<br />
Austausch (8 x)<br />
Verbesserung der Arbeitssituation (6 x)<br />
Beratung (3 x)<br />
Konfliktmanagement, Ansprechpartner<br />
vor Ort, Interessenvertretung der Sonderschullehrer<br />
im GU, Mitgestalten von<br />
Veränderungen<br />
Themenwünsche für die Fachgruppenarbeit:<br />
Integrierte Schuleingangsphase, jahrgangsübergreifender<br />
Unterricht (12 x)<br />
Förderdiagnostik/Förderkonzepte (7 x)<br />
Konfliktmanagement (3 x)<br />
Arbeitstechniken (3 x)<br />
Ganztagsschulen, Lernstandserhebungen,<br />
Qualität des GU, Supervision,<br />
Ges<strong>und</strong>heitsförderung, Teamarbeit,<br />
Stressbewältigung/ Burn Out, Streitschlichtung,<br />
Umgang mit verhaltensauffälligen<br />
Schülern, Kinder mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
in Regelklassen, Unterrichtsqualifizierung<br />
<strong>und</strong> Vernetzung,<br />
Lehrerverhalten, schulfachliche Fortbildungen<br />
zu Bewegung in der Schule,<br />
Sachrechnen 3/4, Dyskalkulie, LRS <strong>und</strong><br />
Musik, Schulen in Finnland, Moderation<br />
<strong>und</strong> Leitung von Konferenzen, Agenda<br />
21, Schule <strong>und</strong> Recht, Altersvorsorge,<br />
Be-werbungsschreiben, Personalführung<br />
im Sinne der <strong>Gewerkschaft</strong><br />
Wünsche für mehr Unterstützung<br />
der GEW bei:<br />
Einrichten einer Supervisionsgruppe<br />
Imageverbesserung für Lehrerbild in<br />
der Öffentlichkeit,<br />
Verbesserung / Entlastung / Reduzierung<br />
der Klassenstärke / Einstellung<br />
zusätzlicher LehrerInnen / Altersteilzeit<br />
ab 55,<br />
Mehr Öffentlichkeitsarbeit zu politischen<br />
Mogelpackungen,<br />
Auswirkungen der Landespolitik/<br />
Gerichtsurteile auf Schulen in Köln /<br />
Infos über Planungen <strong>und</strong> Entwicklungen<br />
im Schulamt / Beratung / Vertretung<br />
in Personal- u. Rechtsfragen im<br />
Schulamt,<br />
Interessenvertretung von EZV-Kräften<br />
z. B. Recht auf Fortbildung etc.,<br />
Viele Erneuerungen – langsam einführen<br />
+ weniger Formalismus,<br />
Reduzierung der Arbeitsbelastung<br />
(Lernstandserhebung, Gutachten, ...),<br />
Konfliktfällen,<br />
Einsatz für ausländische KollegInnen,<br />
Unterstützung gegen unsinnige Anordnungen<br />
von oben,<br />
mehr Anerkennung der Gr<strong>und</strong>schullehrerInnen,<br />
mehr Unterstützung gegen Mehrbelastung,<br />
SEITE 22<br />
Infos über neue Entwicklungen,<br />
VERA,<br />
Vereinbarkeit von Fortbildungen mit<br />
Kindern,<br />
Kontinuierliche Infos,<br />
Infos + Erfahrungsaustausch für<br />
Lehrerräte an selbstständigen Schulen.<br />
Zur Beteiligung an Protestaktionen<br />
(wenn sie mit den Inhalten <strong>und</strong> Zielen<br />
der Aktion übereinstimmen) erklärten<br />
sich ca. 50 KollegInnen bereit. 31 KollegInnen<br />
bek<strong>und</strong>eten erstmals ihre<br />
Bereitschaft, Informationsmaterial in<br />
den Gr<strong>und</strong>schulen auszulegen, während<br />
33 KollegInnen erklärten, dass sie<br />
schon diese Aufgabe in ihrer Schule<br />
übernommen hätten. An einer aktiven<br />
Mitarbeit in der Fachgruppe waren 10<br />
KollegInnen interessiert.<br />
Insgesamt brachte die Umfrage einen<br />
repräsentativen Überblick über die<br />
Interessen der Fachgruppenmitglieder<br />
<strong>und</strong> die Erwartungen/Wünsche an die<br />
GEW.<br />
Die Aktiven der Fachgruppe werden<br />
sich Mühe geben, einige der Erwartungen<br />
zu erfüllen <strong>und</strong> den stark geäußerten<br />
Themenwünschen für die Fachgruppenarbeit<br />
nachzukommen. Es<br />
muss allerdings hinzugefügt werden,<br />
dass alle Fachgruppenmitglieder ehrenamtlich<br />
in der GEW arbeiten <strong>und</strong> wir<br />
nur einige Aktive sind <strong>und</strong> deshalb auch<br />
unsere Arbeitskapazitäten begrenzt<br />
sind. Wir werden versuchen die Informations-<br />
<strong>und</strong> Beratungsarbeit der GEW<br />
zu verbessern, wissen jedoch, dass wir<br />
aufgr<strong>und</strong> unserer begrenzten Arbeitskapazitäten<br />
nicht allen Erwartungen<br />
entsprechen können. Wir wünschen uns<br />
aber noch mehr aktive Mitarbeiter <strong>und</strong><br />
Mitstreiter, um die GEW- Arbeit an den<br />
Schulen zu verbessern.
Gerhard Richter Bilder<br />
Ausstellung in der Kunstsammlung NRW<br />
von Ortrud Meschede<br />
Der Gang durch die Ausstellung begann<br />
mit einer Irritation. Ziemlich perplex<br />
starrten wir auf das erste Werk Richters:<br />
in einem großen Spiegel - dem Eingangswerk<br />
- erblickten wir unser Konterfei.<br />
Gerhard Richter selber, der als<br />
„Kurator in eigener Sache“ (art, März<br />
<strong>2005</strong>) maßgeblich am Aufbau der<br />
Ausstellung mitgewirkt hat, dürfte<br />
diesen Beginn bestimmt haben. In<br />
Richters Schaffen, so erklärte uns Dr.<br />
Tuchscherer, der in Vertretung von Frau<br />
Dr. Becker unsere Gruppe führte, spiele<br />
die Frage nach der Wirklichkeit im<br />
künstlerischen Objekt <strong>und</strong> die Wahrnehmung<br />
der Wirklichkeit durch den<br />
Betrachter eine wesentliche Rolle.<br />
Spiegel <strong>und</strong> Fotografien haben im Werk<br />
Richters zentrale Bedeutung als Abbild<br />
der Realität <strong>und</strong> in der Durchbrechung<br />
der Realität: Zweifellos waren die Gesichter,<br />
die uns aus dem Spiegel verlegen<br />
anschauten, „nur“ Abbilder unserer<br />
Wirklichkeit <strong>und</strong> in unserer Wahrnehmung<br />
dieser Abbilder spielten hinein<br />
unsere jeweilige Befindlichkeit, unsere<br />
Perspektive, die Grenzen des Spiegels<br />
<strong>und</strong> schließlich die Verkehrung der<br />
Seiten.<br />
So die Hinweise Dr. Tuchscherers, der,<br />
so meine ich mich zu erinnern, die<br />
Erläuterung des Spiegelbildes abschloss<br />
mit den Worten: „Ein Schelm, dieser<br />
Richter!“<br />
R<strong>und</strong> 110 Werke umfasst die Richter-<br />
Ausstellung im K20: Auf eine zeitliche<br />
Abfolge als Ordnungsprinzip hat Richter<br />
verzichtet. Die Darstellungen sind<br />
auf den ersten Blick sehr unterschiedlich:<br />
Landschaftsbilder (sie basieren<br />
ausschließlich auf Fotografien Richters)<br />
wechseln mit Abstrakten, mit Fotobildern,<br />
Spiegeln, Glasbildern,<br />
Grau»bildern«, Farbtafeln <strong>und</strong> Skulptu-<br />
AKTIVE RUHESTÄNDLER<br />
ren, die aus mehreren gestaffelten Klarsichtscheiben<br />
<strong>und</strong> partiell spiegelnden<br />
Elementen bestehen.<br />
Unsere beim Spiegelbild gewonnene<br />
Erfahrung half uns, unterstützt durch<br />
Dr. Tuchscherer, in der Fülle der Eindrücke<br />
nicht unterzugehen. Die Frage nach<br />
der Realität in der künstlerischen<br />
Darstellung <strong>und</strong> die Frage nach der<br />
Rolle des Betrachters waren zentraler<br />
Ausgangspunkt. Das sei belegt mit<br />
einem Beispiel, dem Bild „Landschaft<br />
bei Hubbelrath“. Das Bild, das sich auf<br />
eine fotografische Vorlage stützt, ist<br />
verwischt, unscharf. „Der Betrachter<br />
sieht wie durch einen Schleier <strong>und</strong> kann<br />
im Gr<strong>und</strong>e nichts richtig erkennen.“<br />
Aber diese Situation lässt auch Raum<br />
für eigene Stimmungen <strong>und</strong> Erinnerungen<br />
an eine irgendwo erlebte ähnliche<br />
Landschaft.<br />
Manchen aus unserer Gruppe war<br />
Richter vorher unbekannt, den meisten<br />
oder allen hat die Ausstellung sehr<br />
gefallen. Ich denke, das liegt an der<br />
ungeheuren Vielfältigkeit der Werke, die<br />
sich - Dr. Tuchscherer sei Dank! - uns<br />
als Reichtum präsentierte.<br />
Wir gratulieren unseren<br />
Mitgliedern, die just im<br />
Erscheinungszeitraum<br />
des forums<br />
(Juni bis August <strong>2005</strong>)<br />
40 Jahre <strong>und</strong> länger<br />
in der GEW sind:<br />
Ulrike Keil<br />
Sigrid Kahnert<br />
Roswitha Clemens<br />
Willi Kämper<br />
SEITE 23<br />
Einladung<br />
zum Besuch der<br />
Landesgartenschau<br />
Leverkusen<br />
(kurz: Laga) am<br />
Donnerstag, 23. Juni <strong>2005</strong><br />
um 10.30 Uhr<br />
Treffpunkt: Eingang Mitte (Nobelstraße)<br />
Zunächst werden wir gemeinsam an einer<br />
Führung zu den wichtigen Punkten auf<br />
dem Gelände teilnehmen.<br />
Danach ist jedem freigestellt den R<strong>und</strong>gang<br />
nach Belieben fortzusetzen oder den<br />
Besuch zu beenden.<br />
Für die Anfahrt zur Laga achten Sie bitte<br />
auf die zusätzliche Ausschilderung an der<br />
Autobahn bzw. am DB-Bahnhof oder<br />
Busbahnhof sowie an zahlreichen anderen<br />
Plätzen der Stadt.<br />
Anmeldung zum Besuch der Laga erfolgt<br />
durch Überweisen des ermäßigten<br />
Eintittspreises von 10 Euro auf das Konto<br />
des GEW Stadtverbandes Leverkusen bei<br />
Sparkasse Leverkusen<br />
Konto-Nr. 100017433<br />
BLZ 37551440,<br />
Stichwort: „Laga 23.6.“ bis zum 16.6.05.<br />
Wer eine Dauerkarte für die Laga besitzt<br />
oder weitere Fragen zur Anfahrt zum<br />
Gelände der Landesgartenschau hat, melde<br />
sich bitte telefonisch bei<br />
Wolfgang Rackwitz, Tel. 0214/56780.<br />
Weitere Informationen auch unter:<br />
www.lgs-lev.de<br />
Bleibt noch zu wünschen, dass das Wetter<br />
am Tage der Veranstaltung mitspielt.<br />
<strong>Gewerkschaft</strong><br />
<strong>Erziehung</strong> <strong>und</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Köln
RHEIN-BERG<br />
Gute Neuigkeiten aus Guyana<br />
von Hartmut Krüger<br />
Im Mai 2004 berichteten wir zuletzt<br />
über Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft<br />
zwischen der Hauptschule Am<br />
Hammer in Leichlingen (HS) <strong>und</strong> der<br />
Santa Rosa Secondary School (SRSS) im<br />
Regenwald von Guyana. Seitdem hat es<br />
eine ganze Reihe weiterer positiver<br />
Entwicklungen gegeben. Über einige<br />
von ihnen wollen wir nun berichten.<br />
In unserem letzten Beitrag hatten wir<br />
über das phantastische Abitur von<br />
Rachel Abraham <strong>und</strong> ihre ersten Lehrererfahrungen<br />
als 16jährige berichtet.<br />
Inzwischen studiert sie an der Pädagogischen<br />
Hochschule in Georgetown. Sie<br />
hatte ursprünglich „Integrated Science“<br />
(Naturwissenschaften) als ihr Hauptfach<br />
vorgesehen. Als sie sah, dass auch<br />
nach der neuen Lehrerzuweisung für<br />
ihre ehemalige Schule Fachkräfte für<br />
Englisch fehlten, entschloss sie sich, auf<br />
dieses Fach zu wechseln. Ein bemerkenswert<br />
perspektivisches Denken<br />
einer Jugendlichen, das sich mit dem<br />
Wunsch nach Wohlergehen der eigenen<br />
„community“ verbindet. Solche Menschen<br />
zu fördern, macht richtig Spaß.<br />
Unter den Lehrerzuweisungen<br />
für<br />
die der Santa<br />
Rosa Secondary<br />
School ist auch<br />
eine Donnel<br />
Abraham (nicht<br />
verwandt mit der<br />
Vorge-nannten).<br />
Vielmehr handelt<br />
es sich um das<br />
bemerkenswerte<br />
junge Mädchen,<br />
das als 14-jährige<br />
Schul-sprecherin<br />
1996 als erste auf<br />
den ersten Kontaktbrief<br />
der<br />
Leichlinger<br />
Hauptschule<br />
reagierte, noch<br />
vor ihrem Schulleiter.<br />
1998 hat<br />
der Projektleiter sie bei seiner Reise<br />
nach Moruca persönlich kennen gelernt.<br />
Sie war Briefpartnerin seiner<br />
Klassensprecherin <strong>und</strong> führte das<br />
„debating team“ ihrer Schule an. Nun<br />
ist sie studierte Fachkraft für „Karibische<br />
Landwirtschaft“ an ihrer ehemaligen<br />
Schule. Das kann man wohl mit Fug<br />
<strong>und</strong> Recht als nachhaltige Entwicklung<br />
bezeichnen!<br />
Seit Oktober 2004 hat die Santa Rosa<br />
Secondary School einen neuen Schullei-<br />
SEITE 24<br />
ter, Nigel Richards. In seinem Antwortbrief<br />
auf meinen Weihnachtsbrief<br />
berichtet er, dass wir uns bereits 1998<br />
kennen gelernt haben. Er war der<br />
Mathematiklehrer, den ich am Mittwoch<br />
vor Ostern – also mitten in den<br />
Ferien – mit ca. 15 Schülerinnen <strong>und</strong><br />
Schülern in der Schule vorfand, unter<br />
ihnen Donnel Abraham. Man erklärte<br />
mir, man habe festgestellt, dass man in<br />
Mathematik das zwischenzeitliche Soll<br />
noch nicht erreicht habe. Deswegen<br />
hatten die „students“ ihren Lehrer<br />
gebeten, auch in den Ferien für sie da zu<br />
sein. Da ist man als deutscher Lehrer<br />
sprachlos, <strong>und</strong> das habe ich auch in<br />
meiner Ansprache zum Ausdruck<br />
gebracht, obwohl ich nach 39-stündiger<br />
Anreise müde <strong>und</strong> hungrig war. – Nach<br />
einem Universitätsstudium ist dieser<br />
Lehrer nun an seine ehemalige Schule<br />
zurückgekehrt. Ein gutes Omen für die<br />
Zukunft.<br />
Dank an die GEW - Ausblick<br />
An dieser Stelle möchten wir der GEW<br />
für ihre jahrelange Unterstützung<br />
danken <strong>und</strong> hinzufügen, dass mit der<br />
letzten Zuwendung die Erhöhung der<br />
Speicherkapazität für die Solaranlage<br />
realisiert werden soll. Wir hoffen, dass<br />
das bis Ende März geschafft sein wird.<br />
Das ist auch sehr notwendig, denn 16<br />
Schüler haben sich für die Computerkurse<br />
eingetragen.<br />
In der nahen <strong>und</strong> mittelfristigen Planung<br />
sind die Projektdarstellung im<br />
Weltgarten der LAGA, eine eigene<br />
Solaranlage für die HS <strong>und</strong> eine Begegnungsreise<br />
für 2006 im Rahmen der<br />
Feier des zehnährigen Bestehens der<br />
Partnerschaft.
Langjährige Mitglieder<br />
der GEW Rhein-Berg<br />
wurden geehrt<br />
von Angela Blömer<br />
In diesem Jahr hatte der Kreisverband<br />
Rhein-Berg seine langjährigen Mitglieder<br />
zu einem besonderen Abend ins<br />
Schloss Eulenbroich nach Rösrath<br />
eingeladen. Die Moderation <strong>und</strong> Gestaltung<br />
des Abends übernahm Peter<br />
Helten, der Zauberer mit der Tasche.<br />
Peter Helten hat bereits mit 7 Jahren<br />
gezaubert <strong>und</strong> den Wunsch geäußert,<br />
als Erwachsener Zauberer zu werden.<br />
Seine Mutter meinte aber dazu: „Junge,<br />
beides geht nicht!“<br />
Daher nahm der Künstler einen kleinen<br />
Umweg <strong>und</strong> wurde Sonderschullehrer,<br />
um sich nun seit einigen Jahren nur<br />
noch der Zauberei zu widmen. Peter<br />
Helten kann sich bis zu 100 Namen<br />
merken, er spielt mit der Sprache,<br />
verblüfft die Zuschauer <strong>und</strong> macht sie<br />
zu zauberhaften <strong>und</strong> lachenden Mitspielern.<br />
Die anwesenden Jubilare, die für 40<br />
Jahre, 30 Jahre <strong>und</strong> 25 Jahre Mitgliedschaft<br />
in der GEW geehrt werden<br />
konnten, hatten ebenso wie ihre Gäste<br />
<strong>und</strong> interessierte Mitglieder einen<br />
vergnüglichen Abend.<br />
von Kathrin Greve<br />
„Zwangsheirat ist eine Vergewaltigung<br />
auf Lebensdauer.“ Das hat die in<br />
Deutschland aufgewachsene Türkin<br />
Serap Cileli am eigenen Leib erfahren.<br />
Sie wurde als 15jährige mit einem zehn<br />
Jahre älteren Mann verheiratet <strong>und</strong> zu<br />
ihm in die Türkei gebracht. Serap Cileli<br />
ist kein Einzelfall. In Deutschland sind<br />
Migrantinnen aus den verschiedensten<br />
Ländern betroffen: Die Frauenrechtsorganisation<br />
Terre des Femmes weiß von<br />
Fällen aus Albanien, Bangladesh, China,<br />
Indien, Italien, Jordanien, Kongo, dem<br />
Kosovo, Marokko, Nigeria, der Türkei<br />
<strong>und</strong> Vietnam. Zwangsheiraten gibt es<br />
nicht nur im islamischen Kulturkreis. In<br />
Deutschland betrifft Zwangsheirat nur<br />
deshalb so viele Türkinnen, weil sie<br />
unter den Migrantinnen die größte<br />
Gruppe stellen. Trotz nationaler <strong>und</strong><br />
internationaler Verbote sind weltweit<br />
Millionen von Mädchen betroffen.<br />
Zwar fehlen genaue Zahlen über das<br />
Ausmaß dieses menschenverachtenden<br />
Brauchs in Deutschland, aber allein in<br />
Berlin flüchteten sich 2002 nach einer<br />
Umfrage des Senats 230 Mädchen <strong>und</strong><br />
junge Frauen in Hilfseinrichtungen. Der<br />
Gr<strong>und</strong> war ihre Angst vor Zwangsverheiratung.<br />
Wo Frauen einem Mann zugeordnet<br />
werden wie eine Ware, sind nicht selten<br />
die nächsten Angehörigen mit schuld.<br />
„In den Familien fehlt das Unrechtsbewusstsein“,<br />
sagt die Berliner Rechtsanwältin<br />
Seyran Ates. Sie fordert daher<br />
einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch,<br />
der die Zwangsheirat bestraft.<br />
Im Februar <strong>2005</strong> ist nun eine Änderung<br />
in § 240 StGB in Kraft getreten, wonach<br />
ein besonders schwerer Fall der Nötigung<br />
vorliegt, wenn der Täter „eine<br />
Person zur Eingehung der Ehe zwingt“.<br />
Bisher konnten die betroffenen Mäd-<br />
SEITE 25<br />
Zwangsheirat<br />
chen oder Frauen ihre Männer oder<br />
Väter nur wegen Körperverletzung oder<br />
Vergewaltigung anzeigen. Diese Straftatbestände<br />
signalisieren den Eltern<br />
aber nicht, worum es eigentlich geht:<br />
„Dass Zwangsheirat eine Menschenrechtsverletzung<br />
ist.“<br />
Auf der Seite der deutschen Gesellschaft<br />
fehlt es bei Fre<strong>und</strong>en bzw. Fre<strong>und</strong>innen<br />
<strong>und</strong> Lehrerinnen bzw. Lehrern gleichermaßen<br />
an Verständnis für die Situation<br />
des Mädchens. Die traditionellen Strukturen<br />
sind ihnen unbekannt, <strong>und</strong> es ist<br />
ihnen unbegreiflich, wie sich die Betroffene<br />
solchen Entscheidungen fügen<br />
kann. Die Mädchen wiederum schämen<br />
sich für das, was sie in ihrem Elternhaus<br />
erleben <strong>und</strong> vertrauen sich daher<br />
niemandem an. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong><br />
hat die Münchner amnestyinternational-Gruppe<br />
1321 eine Unterrichtseinheit<br />
zu Zwangsheirat entwickelt,<br />
die die Problematik am Beispiel<br />
zweier deutscher Fälle deutlich macht<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ebenso<br />
wie Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer sensibilisieren<br />
soll. Die Unterrichtseinheit kann<br />
unter www.amnesty-muenchen.de/mrb<br />
kostenlos heruntergeladen werden <strong>und</strong><br />
richtet sich an die Jahrgangsstufen 8-13.<br />
Sie enthält auch eine Liste der Adressen<br />
von Projekten, die sich gegen Zwangsheirat<br />
einsetzen.<br />
Quellen:<br />
• Terre des Femmes (Hrsg.),<br />
Unterrichtsmappe Zwangsheirat,<br />
Tübingen 2003, S. 23<br />
E-mail: TDF@frauenrechte.de<br />
• Susanne Amann,<br />
Zwangsheirat in Deutschland: Braut<br />
wider Willen, Panorama, Spiegel online<br />
Mehr Informationen von<br />
Monika Weiß-Imroll<br />
E-mail: M. Weiss-Imroll@gmx.de
Wir freuen uns, Euch mitteilen zu<br />
können, dass wir am 26. Juni <strong>2005</strong> ein<br />
Musikfestival zu Ehren der Kölner<br />
Edelweißpiraten <strong>und</strong> verwandter naziresistenter<br />
Jugendgruppen feiern werden.<br />
Ähnlich wie es die Edelweißpiraten<br />
Anfang der 40er Jahre liebten, werden<br />
ca. 20 Kölner Bands unterschiedlichster<br />
Herkunft in lauschigen Parkwinkeln<br />
r<strong>und</strong> ums »Baui« (Fort im Friedenspark)<br />
musizieren: Das Aufeinandertreffen<br />
überraschender Kontraste -<br />
Pfadfinderchor <strong>und</strong> Electro-Punk,<br />
Zeitzeugen-Kombo <strong>und</strong> Mestizo-Band,<br />
etc. - ist dabei sehr willkommen. Dem<br />
Besucher bietet sich dadurch ein Klang-<br />
Parcours, den er nach Lust <strong>und</strong> Laune<br />
erwandern kann.<br />
Ausgangspunkt dieses von einem<br />
breiten Bündnis engagierter Bürger/<br />
innen veranstalteten Festivals war die<br />
Ausstellung »Von Navajos <strong>und</strong><br />
Edelweißpiraten? - Unangepasstes<br />
Jugendverhalten in Köln 1933 - 1945«,<br />
die im Frühjahr 2004 im NS-Dokumentationszentrum<br />
zu sehen war. Im Rahmen<br />
der Arbeit mit alten Zeitzeugen<br />
<strong>und</strong> jungen Musikern an dem CD/DVD/<br />
Buch-Projekt »Es war in Schanghai.<br />
Kölner Bands interpretieren Edelweißpiraten-Lieder«,<br />
stellten wir fest, welch<br />
wichtiges, identitätsstiftendes, regiona-<br />
VERANSTALTUNGEN<br />
Edelweißpiratenfestival<br />
Konzert-Parcours im Friedenspark<br />
les Kulturpotential hier sechzig Jahre<br />
nahezu unbeachtet blieb. Deshalb<br />
möchte das 1. Edelweißpiratenfestival,<br />
60 Jahre nach Kriegsende, nicht nur<br />
jenen fünf- bis zehntausend naziresistenten<br />
Kölner Jugendlichen ein<br />
lebendiges Denkmal setzen, die in<br />
finsterster Zeit dem übermächtigen NS-<br />
Terror getrotzt haben. Es möchte auch<br />
Gelegenheit bieten, sich weiter-hin vom<br />
Geist der Edelweißpiraten <strong>und</strong> verwandter<br />
Jugendgruppen musikalisch<br />
<strong>und</strong> moralisch inspirieren zu lassen.<br />
Auch wenn das Edelweißpiraten-Festival<br />
zu aller erst ein musikalisches<br />
Treffen der Generationen, Kulturen <strong>und</strong><br />
sozialen Gruppen - ohne Festreden <strong>und</strong><br />
Zeigefinger - sein soll, kommt natürlich<br />
der Information über die Edelweißpiraten<br />
<strong>und</strong> deren Vorbild für unsere<br />
Zeit eine wichtige Rolle zu.<br />
Die enge Kooperation mit dem »Bauspielplatz<br />
Friedenspark e. V.« betont die<br />
erwünschte Nähe zur Jugendszene <strong>und</strong><br />
zum Veedel. Darüber hinaus wird<br />
angestrebt, ein weithin sichtbares<br />
Zeichen zu setzen, welche Traditionen<br />
in Köln geehrt <strong>und</strong> belebt werden<br />
sollen; auch, um aufkeimender ideologischer<br />
Einfalt in ganzer Tiefe <strong>und</strong> Breite<br />
begegnen zu können.<br />
SEITE 26<br />
Sonntag 26.6.<strong>2005</strong><br />
ab 14:30 Uhr (bis ca. 20 Uhr)<br />
Edelweißpiraten/Zeitzeugen:<br />
Mucki Koch, Jean Jülich, Peter Schäfer<br />
Bands:<br />
La Papa Verde (Mestizo-Pop)<br />
Klaus der Geiger + Fre<strong>und</strong>e - Werle +<br />
Stankowski (Electro-Song)<br />
Eierplätzchenband (Son Cubano)<br />
Zugvögel-Gruppe (Bündische Jugend)<br />
Microphone Mafia (HipHop)<br />
Schwarzmeerflotte (Blasmusik)<br />
Harald »Sack« Ziegler (Waldhorn +<br />
Sequenzer)<br />
Rolly Brings Bänd (Liedermacher)<br />
SakkoKolonia (Kölsche Krätzchen)<br />
Rembetes + I Ap Ekso (Griechische<br />
Tradition)<br />
Chupacabras & Zu Laut (Latin Rap, etc.)<br />
Onde Blu + San Marino (Italo Rock)<br />
Menschensinfonieorchester (Folkjazzrock)<br />
<strong>und</strong> viele weitere Gäste auf<br />
fünf Bühnen.<br />
Veranstalter:<br />
Humba e.V., Jugendzentrum »Bauspielplatz<br />
Friedenspark« e.V.<br />
<strong>und</strong> engagierte Einzelpersonen in<br />
Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum<br />
der Stadt Köln. Schirmherrin:<br />
Bürgermeisterin Angela Spizig.<br />
Kontakt:<br />
Tel. 0221/9322211,<br />
email: jan@humba.de<br />
Zur virtuellen Vertiefung:<br />
www.museenkoeln.de/ausstellungen/<br />
nsd_0404_edelweiss/
Preisausschreiben.<br />
Das Dritte.<br />
Diesmal war es keine leichte Übung -<br />
wie angekündigt. Trotz Internet <strong>und</strong><br />
aktiver Ruheständler: keiner konnte<br />
diesmal Klar Schiff (von Günter<br />
Wohlfart) machen. Heutige Weltkunst<br />
(von Friedrich von Logau) bleibt aktuell,<br />
aber ungelöst. Vorwände (von<br />
Walter Helmut Fritz) gibt es dafür nicht,<br />
aber es bleibt ein Trost (von Gottfried<br />
August Bürger):<br />
Neues forum, neue R<strong>und</strong>e. Die Dritte.<br />
Diesmal fragen wir nach dem Namen<br />
des Künstlers, dem Entstehungsjahr<br />
<strong>und</strong> dem Titel des Bildes auf der<br />
Titelseite dieses forum.<br />
Zu gewinnen sind dreimal eine Karte<br />
für die Comedia -Veranstaltung des<br />
Coro Getsemnani aus Nicaragua.<br />
Einsendeschluss:<br />
Freitag, 27.Mai <strong>2005</strong>.<br />
RECHTSBERATUNG<br />
Wiedereingliederung<br />
nach langer Krankheit<br />
Regelungen für Beamte/innen <strong>und</strong> Angestellte<br />
von Christine Oberhäuser<br />
Für Beamte/innen gilt für die Wiedereingliederung<br />
nach langer Krankheit<br />
die Arbeitszeitordnung für Beamte/<br />
innen (AZVO) § 2 Absatz 4: „Einem<br />
Beamten kann im Anschluss an eine<br />
länger dauernde Erkrankung vorübergehend,<br />
höchsten für die Dauer von 6<br />
Monaten, eine Ermäßigung der regelmäßigen<br />
Arbeitszeit unter Fortzahlung<br />
der Bezüge bewilligt werden, wenn dies<br />
nach ärztlicher Feststellung aus ges<strong>und</strong>heitlichen<br />
Gründen zur Wiedereingliederung<br />
in den Arbeitsprozess<br />
(Arbeitsversuch) geboten ist. . Diese<br />
Regelung wird häufig noch „Brückenerlass“<br />
oder „Hamburger Modell“ genannt.<br />
Die Betroffenen müssen die Wiedereingliederung<br />
bei der zuständigen Dienststelle<br />
(z.b. Schulamt bzw. die Bezirksregierung)<br />
formlos beantragen; am<br />
besten zwei bis drei Wochen vor dem<br />
geplanten Antritt. Der Antrag sollte<br />
beinhalten, in welchen Arbeitszeiten<br />
<strong>und</strong> in welcher Zeit die Eingliederung<br />
verlaufen soll. Die AZVO sieht eine<br />
maximale Länge von einem halben Jahr<br />
vor. In Ausnahmefällen, die dann vom<br />
Amtsarzt bestätigt werden müssen,<br />
kann die Wiedereingelierungsphase<br />
auch darüber hinaus verlängert werden.<br />
Die Arbeitszeit sollte ansteigend festge-<br />
SEITE 27<br />
legt werden, d.h. mit wenigen St<strong>und</strong>en<br />
beginnen <strong>und</strong> sich dann langsam der<br />
vollen St<strong>und</strong>enzahl annähern. Sinnvoll<br />
ist es, dem Antrag ein ärztliches Attest<br />
beizulegen, dass einen Vorschlag zur<br />
Regelung der Arbeitszeit während der<br />
Eingliederung beinhaltet. Das Attest<br />
sollte außerdem deutlich machen, dass<br />
davon auszugehen ist, dass der/die<br />
Beamte/in nach Ablauf der Eingliederungsphase<br />
wieder voll dienst- bzw.<br />
arbeitsfähig sein wird. Während der<br />
Eingliederungsphase wird die Besoldung<br />
weitergezahlt; es entsteht kein<br />
finanzieller Nachteil.<br />
Für Angestellte gilt das gleiche Antragsverfahren.<br />
Wenn die Betroffenen<br />
sich noch in der Phase befinden, in der<br />
die Vergütung vom Arbeitgeber weiter<br />
gezahlt wird, entsteht auch hier kein<br />
finanzieller Nachteil. Anders sieht es<br />
aus, wenn den Angestellten bereits<br />
Krankengeld gezahlt wird. Dann wird<br />
lediglich das Krankengeld während der<br />
Eingliederungsphase weiter gezahlt. Der<br />
Dienstherr zahlt nichts dazu, obgleich<br />
der/die Angestellte ja schon teilweise<br />
eine Arbeitsleistung erbringt.<br />
Bei Problemen mit der Dienststelle<br />
wegen der Beantragung können die<br />
zuständigen Personalräte die Betroffenen<br />
unterstützen.
Wenn GEW, dann<br />
www.gew-koeln.de<br />
SEITE 28<br />
G 10629 F Postvertriebsstück DPAG Entgelt bezahlt<br />
Nr. 3 GEW forum Hans-Böckler-Platz 1 50672 Köln