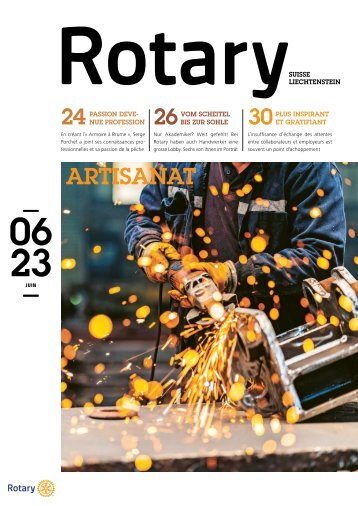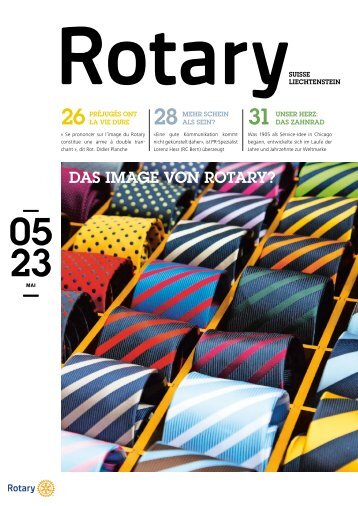Rotary Magazin 11/2014
- Text
- Rotary
- Suisse
- November
- Liechtenstein
- Menschen
- Fribourg
- Schweiz
- Prix
- Rotarier
- Meier
SCHWER PUNKT16darin
SCHWER PUNKT16darin unterscheidet sich die Medienweltauch nicht von anderen gesellschaftlichenBereichen wie etwader Finanz- und Bankenwelt. Diemoderne Mediengesellschaft birgthinter allem Glamour und allen Errungenschaftenauch echte Gefahren.Ohne Zweifel stecken hinterder andauernden Wirtschafts- undFinanzkrise nicht zuletzt die überhitztenInformationstechnologien,die in ihrer Funktionsweise letztlichnur noch von IT-Spezialisten verstandenwerden. Es scheinen sichneue Herrschaften zu installieren,denen wir alle ziemlich hilflos ausgeliefertsind. Im Sog dieser komplexentechnologischen Beschleunigungdrohen sich grosseErrungenschaften der Moderne inihr pures Gegenteil zu verwandeln.Viele vermeintliche Freiheiten werdenfür die Menschen zum Bumerang,wenn sie sich von den Technologienversklaven lassen. AlsVertreter der Kultur innerhalb derMedien spürt man dieses Dilemmaganz besonders. Es ist offensichtlich,dass die mediale Ausrichtungauf möglichst breite Massen dieQualität von Kultur und Bildung,aber auch die Qualität der menschlichenKommunikation veränderthat. Es fehlt uns mehr und mehr dieZeit, uns im Dschungel der permanentauf uns einwirkenden Datenflutnoch zu orientieren, uns eineMeinung zu bilden, eine Haltung zuentwickeln. Schmerzlich wird einembewusst, dass eine möglichstgrosse Menge von Daten noch keineigentliches Wissen bedeutet. Wissenentsteht durch Einordnung undSelektion. Einordnen und Auswählensind Denkprozesse, die Zeit erfordern.Etwas lakonisch gesagt,fehlt es uns schlicht an der Musse,zu denken. Wenn nur noch Schnelligkeit,Kommerz und möglichstbreite globale Vernetzung zählen,sind Werte wie Verständigung, Demutund Respekt nur noch bedingtgegeben.BoulevardisierungDer grösste Feind medialer Qualitätist das Boulevard mit all seinen Nebenerscheinungen.Alles wird personalisiert.Und ein Ereignis wirdnur noch zur medialen Botschaft,wenn es das Potenzial zu einemSkandal oder einer Sensation hat.Der Hang zur medialen Personalisierunghinter bald jedem Ereignis«Der Hang zur medialen Personalisierung hinter baldjedem Ereignis zeigt die Grimasse eines fehlgeleitetenIndividualismus.»zeigt die Grimasse eines fehlgeleitetenIndividualismus. Ganz normalegesellschaftliche Ereignissescheinen nur medientauglich zusein, wenn sie zu Sensationenhochstilisiert werden können, umdann als Geschichten möglichstlange nachgekocht zu werden. Daskönnen eigentlich nicht die Freiheitensein, die im Projekt der Moderneeinst gemeint waren. Zu oft gaukeltuns die schöne neue Welt vonMultimedialität eine etwas gar simpleRealität vor. In Tat und Wahrheitist unsere Welt komplexer denn je.Das tönt nun alles reichlich kritisch,um nicht zu sagen pessimistisch.Der amerikanische Informatikerund Autor Jaron Lanier, der geradein Frankfurt den Friedenspreis desDeutschen Buchhandels entgegennehmendurfte, gehört weltweit zuden Pionieren der digitalen Revolution.Seine Kritik ist weit radikalerals die hier formulierten Bedenken.Die praktischen Hoffnungen, diemit den digitalen Netzwerken verbundenwürden, sagte Lanier inseiner Rede in Frankfurt, würdenvon «einem symbolischen, fast metaphysischenProblem begleitet»:«Die digitale Technik wird in unsererZeit als massgeblicher Kanaldes Optimismus überfrachtet.» Laniermöchte aber alles tun, um einenechten Kulturoptimismus zuretten. Darum fordert er Wachsamkeitund Kritik. Die grösste Gefahrsieht er im Heranwachsen einerneuen Elite. Massenaufklärungwerde plötzlich zum Instrumentariumauch der Massenspionage. Lanierspielt hiermit auf die Datenkontrolledurch die grossen Playerder IT-Industrie wie Google oderFacebook an. «Damit haben wireine neue Klasse ultra-elitärer, extremreicher und unberührbarerTechnologen erschaffen; und allzuoft geben wir uns mit dem Rauscheines digital effizienten Hyper-Narzissmuszufrieden.» Das ist derPunkt, wo sich technologisch dasliberale und demokratische Idealdes Individualismus in einen banalenEgoismus verdreht. Wenn Bundespolitikerschon nicht mehr zurückschrecken,aus AmtsstubenSelfies ihres Gemächt zu verschicken,scheint doch offensichtlichetwas aus dem Ruder zu laufen.Und die Chinesen und Japaner inunseren Städten, die bald nur nochmit dem Handy an einem Stab inder Hand flanieren, um sich permanentselbst abzulichten, sind auchnicht eine wirkliche kommunikativeErrungenschaft.Soziale NetzwerkeEntscheidend müsste sein, wieman in Zukunft im Umgang mit derneuen Medienwelt wieder auf einenausgleichenden Mittelweg zwischenblindem Optimismus undnörgelndem Pessimismus findet.Es wird vor allem darum gehen,uns diesen technologischen Errungenschaftenund den dahinter stehendenkommerziellen Spekulationennicht kritiklos auszuliefern.Eigentlich hatten wir gehofft, unsdurch diese Technologien im privatenund beruflichen Alltag von einigenadministrativen Pflichten undNöten befreien zu können, um wiedervermehrt Zeit zu finden für Dinge,die unser Leben mit etwas mehrSinn erfüllen. Wir sind mehr als nurROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN NOVEMBER 2014
17«Ganz pragmatisch wird sich in Zukunft für jeden Menschen ganz individuell erweisenmüssen, wie er aus der grenzenlosen Datenflut herausfiltert, was ihm alskonkretes Wissen für sein Leben und seine Umgebung dringlich erscheint.»Kunden der IT-Industrie. Jaron Laniersagte dazu in Frankfurt: «Dasist auch der Grund, warum mir derTrend in den sozialen NetzwerkenSorgen bereitet, die Leute in Gruppenzusammenzutreiben, um sie zubesseren Zielscheiben für das zumachen, was sich heute Werbungnennt. In Wirklichkeit handelt essich wohl eher um das Mikromanagementder billigsten Option, dieder Verlinkung.» Das würde heissen,dass Big Data algorithmischnur die Konzentration von Reichtumschürt, so Lanier: «Facebooksteuert heute zum grossen Teil dieMuster sozialer Verbindungen inder ganzen Welt. Doch wer wirdseine Macht erben?»KulturkritikDie angestrebte Demokratisierungwürde damit schnurstracks in eineneue politische Abhängigkeit führen.Das wäre das pure Gegenteildessen, was als aufklärerischeHoffnung einst in die neuen Technologiengesteckt wurde. Dieserdrohenden Pervertierung gilt esrechtzeitig einen Riegel zu schieben.Hier muss eine solide KulturkritikPlatz haben. Entscheidendwird auch sein, wie sich die Bildungdieser Themen annimmt. UnsereKinder müssen kritisch imUmgang mit den neuen Medienbegleitet werden, damit sie ihre befreiendeund qualitative Dimensionnicht von Anfang an verspielen.Echte Aufmerksamkeit und gebührendeÖffentlichkeit werden zu denrarsten Gütern einer aufgeklärtenInformationsgesellschaft werden.Kreativ kann die digitalen Technologiennur nutzen, wer dazu eineinnere Haltung entwickelt, die ihnpersönlich zum souveränen undunabhängigen Nutzer derselbenmacht. Man wird sich vermehrtselektiv fragen müssen, wann manund warum man wo und wie welcheMittel einsetzt. Permanente Öffentlichkeitkann kein Zustand einerzivilgesellschaftlich wachen Gemeinschaftsein. Es braucht Zonender Besinnung und der Ortung. DasGesetz des Handelns auf jeden Fallsoll nicht der Logik einer Technologieüberlassen werden. Echte Freiheitbedeutet auch in einer beschleunigtenMedienwelt, dass derEinzelne für sich selbst fähig ist, zuentscheiden, wie er leben will, wasihm mehr oder weniger Wert ist.Und dass er sein Leben letztlichauch auf Aspekte einer minimalensozialen Verantwortung hin ausrichtet.Niemand kann sich ernsthaftden «gläsernen Bürger» herbeiwünschen oder das Ende jeder Privatheit.Ganz pragmatisch wirdsich in Zukunft für jeden Menschenganz individuell erweisen müssen,wie er aus der grenzenlosen Datenflutherausfiltert, was ihm als konkretesWissen für sein Leben undseine Umgebung dringlich erscheint.Das wäre das Ideal einermodernen, vernetzten und verantwortlichenZeitgenossin, die sichdurch die neuen technologischenMöglichkeiten tatsächlich auchneue Felder von Freiheit erschliesst.Daraus könnten Formenechter digitaler Lebenskunst erwachsen.Marco MeierWebcode www.rotary.ch: version française:137Marco Meier, geboren 1953 in Sursee (LU), hat in Fribourg Philosophie undTheologie studiert. Als Chefredaktor der Kulturzeitschrift «du», als Redaktionsleiterund Moderator der «Sternstunden» beim Schweizer Fernsehenund als Programmleiter des Kulturradios DRS 2 hat er während 30 Jahrenumfassende kulturelle und mediale Erfahrungen gesammelt. Marco Meierist Mitglied des Vorstands der Kunstgesellschaft Luzern und sitzt im Stiftungsratder Fotostiftung Schweiz. Er ist assoziierter Fellow am CollegiumHelveticum der ETH und Uni Zürich und arbeitet als freier Publizist undPhilosoph. Marco Meier lebt mit seiner Familie in Luzern.Ende September 2014 referierte Marco Meier im RC Am Greifensee zumThema Kultur in den Medien.ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN NOVEMBER 2014
- Seite 1 und 2: NOVEMBER 20141SUISSE LIECHTENSTEINK
- Seite 3 und 4: 3IMPRESSUMEDITORIALChefredaktionRot
- Seite 5 und 6: INHALT NOVEMBER 20145Aus dem Cluble
- Seite 7 und 8: PUBLIREPORTAGE 7Moderne chirurgisch
- Seite 9 und 10: PUBLI REPORTAGE 9PUBLIREPORTAGE 7Sc
- Seite 11 und 12: 11RC MendrisiottoGiardinoSensoriale
- Seite 13 und 14: 13RC SempacherseeFreunde edler Trop
- Seite 15: 15Der Philosoph Marco Meier zum Kul
- Seite 19 und 20: 19wendig lernen, was Üben heisst,
- Seite 21 und 22: 21Tipps für erfolgreiche Kommunika
- Seite 23 und 24: 23Avis de la rédactionÉloge de la
- Seite 25 und 26: 25Familien-SkiferienaroSa«all-in»
- Seite 27 und 28: 27«Eine Führungspersönlichkeit s
- Seite 29 und 30: DISTRIKT 200029Rotarier und Rotarac
- Seite 31 und 32: 31International Skiing Fellowship o
- Seite 33 und 34: 33amnesty1/1 RAROTARY SUISSE LIECHT
- Seite 35 und 36: 35ICC Rumänien/Moldawien - Schweiz
- Seite 37 und 38: Webshop-Sortiment exklusiv online e
- Seite 39 und 40: INNER WHEEL39IW Club FribourgEnvoye
- Seite 41 und 42: IN MEMORIAM41Stefan Barandun1943 -
- Seite 43: NEUE MITGLIEDER43Genève-SudMarc Ma
- Seite 46 und 47: AGENDA4615.11.2014 Neurotarier-Semi
- Seite 48: OYSTER PERPETUAL DATEJUST IIbuchere
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...