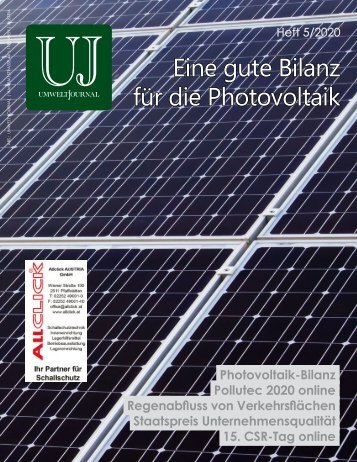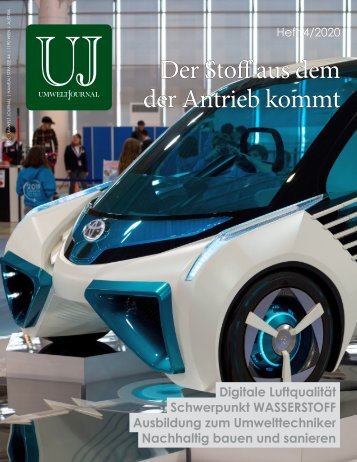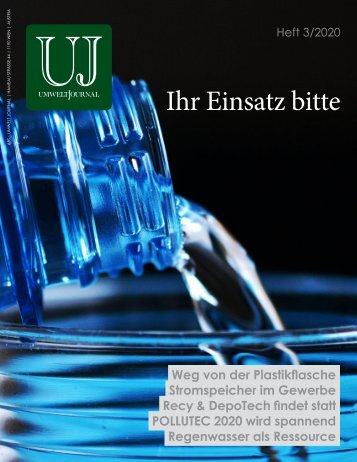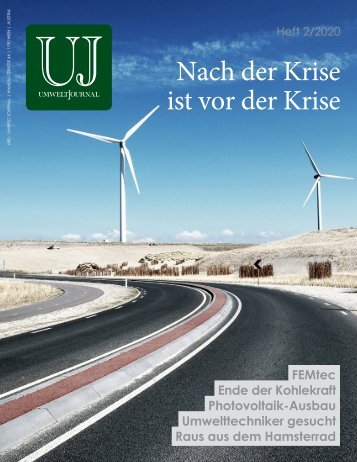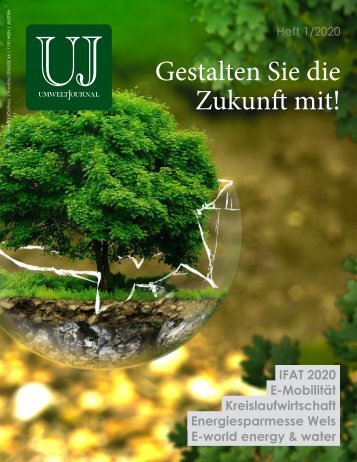UmweltJournal Ausgabe 2017-05
- Text
- Umweltjournal
- Wien
- Wasser
- Unternehmen
- Esche
- September
- Digitalisierung
- Anlagen
- Abwasser
- Zorba
- Express.com
18 ESCHENTRIEBSTERBEN
18 ESCHENTRIEBSTERBEN UmweltJournal /September 2017 Eschentriebsterben in Österreich Die Rettung der Weltenesche In der nordischen Mythologie ist die Weltenesche Yggdrasil immergrün und unverwüstlich. Hirsche fressen ihre Blätter, Drachen nagen an den Wurzeln. Doch bleibt sie stehen, hält Himmel und Erde im Lot und erst wenn sie fällt beginnt das Ende der Welt – „Ragnarök“, die Götterdämmerung. Was Hirsche und Drachen über alle Zeitalter hinweg aber nicht schaffen, scheint nun das „Falsche Weiße Stängelbecherchen“ in wenigen Jahren zu erledigen. Der durch den Fernhandel eingeschleppte Pilz setzt der Baumart in ganz Europa dermaßen zu, dass innerhalb kürzester Zeit sämtliche Blätter und Wurzeln absterben und selbst ausgewachsene Exemplare einfach umfallen. Ist das das Ende Yggdrasils? Autor: Mag. Alexander Kohl alexander.kohl@sciam.at Thomas Geburek hebt behutsam die Blätter von Jungbaum „117-31“. Das Pflänzchen ist gerade erst ein paar Monate alt und nur wenige Zentimeter gewachsen. Doch die Erwartungen, die auf seinen Zweigen lasten, sind jetzt schon hoch. Geburek begutachtet sorgsam Wuchs und Blattfarbe. Er ist zufrieden: 117-31 ist gesund und vital, so wie die meisten seiner Artgenossen, die im Versuchsgarten des BFW (Bundesforschungszentrum für Wald) bei Tulln an der Donau gezogen werden. Allesamt sind sie Teil eines noch nie da gewesenen Rettungsprogramms zur Erhaltung einer heimischen Baumart, die im Begriff ist auszusterben: Es geht um die Rettung der „Gemeinen Esche“ in Österreich. „Vor etwa 20 Jahren wurde in Nordosteuropa ein Pilz aus Asien eingeschleppt“, erinnert sich der Leiter des BFW-Instituts für Waldgenetik: „2005 wurde er erstmals bei uns in Österreich nachgewiesen.“ Seither ist der Erreger mit dem lieblich klingenden Namen „Falsches Weißes Stängelbecherchen“ unaufhaltsam am Vormarsch. Die Krankheit schädigt befallene Eschen derart, dass sie – nach anfänglichen Zuwachsverlusten – schnell zum Absterben der Bäume führt. „Eine Infektion erfolgt hauptsächlich über gebildete Sporen, die sich im Sommer an den vorjährig abgefallenen Blattspindeln der Eschenstreu entwickeln“, schildert Geburek. Mittels Wind verbreitet, besiedeln die Sporen dann das Eschenlaub, wo der Erreger in den Bast und ins Holz eindringt. Auch das Absterben der Wurzelfeinanteile gehört zum Krankheitsbild. Mittlerweile hat sich das Stängelbecherchen im gesamten Bundesgebiet ausgebreitet – zum Teil mit verheerenden Folgen. Vor allem im Donauraum ist der Befall besonders stark: Ganze Eschenbestände stehen kahl und schütter in den Auen, viele Individuen fallen einfach um, weil sie wurzel- und haltlos am Boden stehen. „Wir haben bald erkannt, dass der Pilz so massiv eingreift, dass die ‚Gemeine Esche‘ in ihrer Existenz bedroht ist“, sagt Geburek. Grund genug das größte und am breitesten angelegte Erhaltungsprogramm für eine Baumart zu starten, das das Land je gesehen hat. Eine Esche weiß ich, heißt Yggdrasil, Den hohen Baum netzt weißer Nebel; Davon kommt der Tau, der in die Täler fällt. Immergrün steht er über Urds Brunnen. Nur 25 Kilometer süd-östlich von Tulln fährt Michael Nemeth eine morgendliche Tour durch sein Forstrevier. An der Straße hinauf zur Wiener Sophienalpe stoppt er seinen Seat. Der junge Revierleiter des ÖBf-Forsts Weidlingbach blickt in die Eschenkronen zu seiner Rechten. „Vor einigen Tagen noch hatten hier nur ein oder zwei Eschen erste Krankheitssymptome“, erzählt er mit besorgtem Blick. Nun sind weitere fünf entlang des Straßenzugs offensichtlich erkrankt. „Und das obwohl zu Frühjahrsbeginn an diesem Straßenzug noch kein einziger Baum befallen war“, so der junge Förster. Vor einem Monat habe es begonnen: Der erste Baum verlor Blätter und bald ragten die meisten seiner Äste kahl in den Himmel. Neben den abgestorbenen Trieben und Zweigen bildeten sich kurzbüschelige Ersatztriebe und Wasserreiser. Nach zwei Wochen war auch der zweite Baum in der Reihe befallen – „und jetzt wird das wohl immer so weitergehen, bis der ganze Straßenzug kahl ist“, vermutet Nemeth aus Erfahrung in anderen Waldstücken. Die Geschwindigkeit aber mit der sich der Erreger ausbreitet ist neu für ihn. „Vor einigen Jahren noch hatten wir da und dort einen befallenen Baum und die Krankheit breitete sich eher langsam aus“, sagt er. „Heute geschieht das mit einer ungeheuren Rasanz – nach den Regeln der Forstwirtschaft sozusagen blitzartig.“ Zudem beobachte er das Eschentriebsterben mittlerweile in jeder Altersklasse – von den zartesten Jungbäumen bis hin zu 150 Jahre alten Exemplaren. Das Schlimmste aber sei das Symptom des Wurzelschwundes, klagt Nemeth: „Manche befallenen Bäume stehen noch voll im Laub, haben aber keinen Wurzelballen mehr.“ Nach einer windigen Nacht liegen sie am nächsten Tag am Waldboden oder lehnen an ihren Nachbarbäumen, ohne dass es davor auch nur ein Anzeichen einer Krankheit gegeben hätte. Der Pilzbefall zeigt sich mal zuerst an der Laubkrone und manchmal aber auch nur tief in den Wurzelbereichen, wo sämtliche Feinanteile abgestorben sind. Zurück bleibt ein Stumpf, der dann meist einige Zentimeter unter der Erde einfach umknickt. „So etwas kann aber kein Förster der Welt prognostizieren, wenn der Baum noch gesund und vital aussieht“, sagt Nemeth. Damit ist für den Revierleiter eines klar: Jede auch noch so grüne Esche stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Die Esche Yggdrasil duldet Unbill Mehr als Menschen wissen. Der Hirsch weidet oben, hohl wird die Seite, Unten nagt (der Drache) Nidhöggr. Thomas Geburek hat inzwischen seinen Rundgang in der Eschenplantage fortgesetzt. Gleichmäßig zischt die Besprenkelungsanlage im Hintergrund, während er die Das Falsche Weiße Stängelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) könnte sämtliche Bestände der heimischen „Gemeinen Esche“ beseitigen. Fotos: BFW größeren Jungbäume auf der Versuchsfläche begutachtet, die schon im vergangenen Jahr keimten. Zwei- bis dreimal im Monat kommt der Forscher selbst in die Anlage. Sein Blick streift über die Pflanzung – man bemerkt seine Anspannung und fühlt die Tragweite, die der Wissenschaftler dieser Erhaltungsinitiative beimisst. „Viel Herzblut steckt in diesem Projekt“, sagt er schließlich. Und wohl auch nicht weniger Idealismus und Durchhaltevermögen, denn der Kampf um die Esche wird lang und beschwerlich werden – so wie er schon vor zwei Jahren begonnen hatte: „Ungefähr 106 Millionen Eschen dürfte es in Österreich geben“, schätzt Geburek. In einem groß angelegten Suchaufruf wurden davon im Sommer 2015 1.000 optisch resistente Mutterbäume ausgesucht. „Wenn immer eine Esche grün und gesund inmitten einer Vielzahl an geschädigten stand, wollten wir das wissen“, so Geburek. Förster und Waldbesitzer informierten die Forscher. Diese rückten mit Sägen, Fangschlingen, Gummischleudern und sogar Gewehren bewaffnet in sämtliche Gebiete Österreichs aus, um das Saatgut dieser Mutterbäume zu ernten. „Jeder Baum bekam eine Nummer und nachdem seine Samen in unserem Versuchsgarten aufgegangen waren, wurde jedem Sämling zu seiner Geburt eine zusätzliche Laufnummer verpasst“, erklärt Geburek. Der Jungbaum 117-31 ist also „Nachkomme 31“ von „Mutter 117“. Jeder Keimling wird nach einigen Wochen in einen kleinen Topf umgepflanzt und kann auf geschützten und beschatteten Flächen ordentliche Wurzelballen ausbilden. Zum Jungbaum herangewachsen wird er dann auf die Versuchsfläche gesetzt. Und dort erwartet ihn die Prüfung seines Lebens: Denn zu den hier schon von Natur aus vorkommenden Pilzsporen werden die Forscher immer wieder zusätzlich befallenes Material ausstreuen. Eine künstlich erzeugte „Hammerbelastung“, wie Geburek es nennt. Nur die wirklich resistenten Individuen werden dem Stängelbecherchen trotzen, so hofft man. Die besten 50 davon werden aussortiert. Ob 117-31 dann noch dabei ist, wird sich zeigen. Wenn ja wird auch seine genetische Linie zum entsprechenden Mutter- und sogar zum Vaterbaum zurückverfolgt. Ableger der beiden Eltern sollen dann unter kontrollierten Bedingungen die Samen für die Eschen der Zukunft produzieren. Im gesamten Prozess müsse dabei über Jahre hinweg höchst präzise vorgegangen werden, so der Wissenschaftler: „Es darf keine Verwechslungen geben und die
September 2017/ UmweltJournal ESCHENTRIEBSTERBEN 19 Nachdem die Keimlinge ausgetrieben sind, können sie unter geschützten Bedingungen heranwachsen. Foto: Alexander Kohl „Unser Eschenrettungsprogramm ist wohl das umfangreichste im internationalen Vergleich.“ Thomas Geburek, Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) Foto: BFW Nummern dürfen unter keinen Umständen vertauscht werden. Ansonsten ist dieses aufwendige Prozedere völlig umsonst.“ Ratatösk heißt das Eichhorn, das auf und ab rennt An der Esche Yggdrasil: Des Adlers Worte oben vernimmt es Und bringt sie Nidhöggern nieder. Das Handy von Michael Nemeth klingelt. Ein Anrainer bittet ihn um einen Lokalaugenschein: „Die Esche hinter seinem Garten hat kahle Äste; er möchte, dass wir uns das anschauen.“ Nemeth steigt in sein Auto und fährt los. Dank der aktuellen medialen Eschenhysterie erhält der Förster täglich bis zu drei Anrufe zu diesem Thema – von besorgten Anrainern, Wandervereinen oder auch von Naturschützern, die sich über das „Eschengemetzel“ beschweren. Doch für Nemeth ist klar: „Das Sicherheitsrisiko eine Esche in der Nähe öffentlicher Räume stehenzulassen ist mir auch aus Haftungsgründen einfach zu hoch.“ Schon einmal habe er sich geirrt und eine optisch gesunde Esche stehen gelassen – mit dem Ergebnis, dass diese dann zwei Wochen später in einem Garten lag. „Gott sei Dank ist damals nichts Schlimmeres geschehen, außer dass ein kaputter Zaun wieder in Stand gesetzt werden musste – aber so etwas passiert mir kein zweites Mal.“ In den entlegeneren Forstgebieten greife er keine Esche an, meint Nemeth. „Aus meinen mehr als 3.000 Hektaren Wald nun alle Exemplare auszuforsten wäre auch Wahnsinn.“ Neben sämtlichen Wegen, Straßen und in Siedlungsbereichen wird der Revierleiter nun jedoch Sicherheitsstreifen von etwa zehn Metern Breite ausschlägern lassen. Vor allem auf der Sophienalpe ist das eine heikle Aufgabe. In unmittelbarer Nähe zur Bundeshauptstadt Wien ist dieses Gebiet an Wochenenden ein viel besuchtes Erholungsgebiet. Zahlreiche Wander- und Radwege schlängeln sich durch den Forst. Fast alle sind sie gesäumt von Eschen, einer typischen Randbaumart. Die meisten grün und unbeschadet, manche aber auch schütter und kahl. Während Nemeth zum Lokalaugenschein fährt, zeigt er immer wieder aus dem Fenster auf befallene Baumkronen und gekippte Stämme. Viele der Eschenbestände hat er selbst aufgeforstet, gepflegt und jedes Jahr von Waldreben freigeschnitten. Auch wenn ihm nun manches Mal das Herz blutet – die Eschen müssen weg. Sicherheit geht vor. Für den Straßenzug an der Sophienalpenstraße hat Nemeth nun schon ein Ernteteam mit Harvester beauftragt. Das bedeutet einiges an Vorarbeit: Genehmigungen einholen, Straßen sperren, Telefon- und Stromleitung abmontieren ... erst dann kann der Schlägerungstrupp anrücken. Doch auch danach bereitet die Esche vielen Forstwirten noch Kopfzerbrechen. Denn der mit Eschenholz überflutete Markt ist im Moment völlig eingebrochen. Viele schöne Stämme gehen daher als Beimischung in die Faserholzverwertung oder werden zu Brennholz oder Hackschnitzel. Ins erhobne Horn bläst Heimdall laut, Odhin murmelt mit Mimirs Haupt. Yggdrasil zittert, die Esche, doch steht sie; Es rauscht der alte Baum, da der Riese frei wird. Pressekonferenz des Fachverbands Holzindustrie der WKÖ im Wiener Café Museum. Nach der Präsentation zur Lage der Branche beginnt die Fragerunde. Hauptthema der Journalisten: Das Eschentriebsterben. Wie sind die Auswirkungen? Wie wird es weitergehen? Herbert Jöbstl, Vorsitzender des Sägeindustrie-Verbandes, versteht die Sorgen: „Das Szenario zeigt uns, dass unsere Bäume immer häufiger mit vom Menschen eingeschleppten Schädlingen zu kämpfen haben.“ Theoretisch könne jede Baumart in eine derart katastrophale Situation hineinschlittern; nicht auszudenken, wenn es die Fichte wäre, so Jöbstl. Sein Kollege Rainer Handl aber ist guter Dinge, dass die Esche „mittelfristig erhalten werden kann, wenn gegengesteuert wird.“ Für die Holzindustrie habe die Esche aber eine geringere Bedeutung, sagt Handl: „Sie ist im Moment nur ein Substitut, da helle Hölzer nicht im Trend liegen.“ Martin Höbarth sitzt – wie zahlreiche Branchenvertreter – im Auditorium. Die Bedeutung der Esche sieht der Forstabteilungsleiter der österreichischen Landwirtschaftskammer naturgemäß etwas anders. Forstwirtschaftlich sei die Esche sogar eine der drei wichtigsten heimischen Baumarten – neben Eiche und Rotbuche, sagt er nach der Pressekonferenz. Manchmal sei sie gewachsen wie Unkraut, doch über den Wuchs der Esche musste man sich nie Gedanken machen. „Nun ist sie zum Sorgenkind Nummer Eins geworden. Und für viele Auwaldbetriebe ist das Eschensterben nichts weniger als existenzbedrohend“, warnt Höbarth. Auch in manchen Anwendungsbereichen sei die Esche nicht ersetzbar. Etwa in der Herstellung von Werkzeugen (für Stiele) oder Sportgeräten (Bögen, et cetera). „Das sind zum Teil sehr kleine Nischen, die aber erst einmal einen Ersatzrohstoff finden müssen“, gibt er zu Bedenken. Daher verstehe es sich von selber, dass das Rettungsprogramm des BFW mit aller Kraft unterstützt werden müsse. Die Hälfte aller nötigen Mittel stellt allein die Landwirtschaftskammer zur Verfügung. Der Rest wird von Bund, Ländern und NGOs finanziert. „Wir haben vor einigen Jahren schon die Ulme verloren“, erinnert Höbarth. „Wir wollen es nicht noch einmal erleben, dass eine Baumart so radikal aus unserer Waldgemeinschaft verschwindet. Daher setzen wir alles daran die Esche bei uns zu erhalten.“ Hinab von Yggdrasils Esche gesunken, Alfengeschlechtern Idun genannt, … Schwer erträgt sie dies Niedersinken Unter des Laubbaums Stamm gebannt. Im Büro des Versuchsgartenleiters sitzt Thomas Geburek über die Einsatzpläne gebeugt und Auf der Versuchsfläche werden die ersten Testexemplare bald mit einer extremen Pilzbelastung konfrontiert. „Ich beobachte das Eschentriebsterben mittlerweile in jeder Altersklasse – von den zartesten Jungbäumen bis hin zu 150 Jahre alten Exemplaren.“ Michael Nemeth, ÖBf Ein Krankheitssymptom zeigt sich im Absterben sämtlicher Wurzelfeinanteile. Grüne Eschen fallen oft ohne Vorwarnung um. studiert die nächsten Schritte: Zahlreiche Jungbäume stehen am Testfeld, weitere werden gezogen, die Sporen sind eingesammelt. Nun wartet alles auf den Zeitpunkt X. In wenigen Wochen werden massenhaft Pilzerreger in der Plantage ausgebracht. Dann wird sich zeigen, wie viele Bäumchen dem Erreger standhalten können und ob die Esche in Österreich noch eine Zukunft hat. Geburek weiß: Theoretisch ist fast alles möglich. Das Stängelbecherchen könnte hier eine Vielzahl an resistenten Eschennachkommen vorfinden, an denen es sich die Zähne ausbeißt, aber es wäre auch möglich, dass kaum ein Baum die „Hammerbelastung“ übersteht. Um dieses Risiko zu minimieren wurde die Grundgesamtheit der Testbäume sehr hoch angesetzt. Über 60.000 verschiedene Exemplare sollen das Fortbestehen der Baumart absichern. Das österreichische Eschenrettungsprogramm ist damit auch das umfangreichste im internationalen Vergleich. „Das Besondere ist zudem, dass wir aus getestetem, resistentem Material selektieren, noch einmal zu den Eltern zurückgehen und dann erst züchten“, sagt Geburek. 2020 sollten die ersten Klongemische an ausgewählte Forstbetriebe abgegeben werden können. „Die Samenplantagen werden aber sicher 15 Jahre länger benötigen, bevor das erste Saatgut weitergegeben werden kann“, schätzt Geburek. Letztlich sei aber der gesamte Ablauf ein „work in progress“, in dem immer noch Erkrankungen möglich sein werden. „Ganz langsam aber nähern wir uns so unserem Ziel an, eine ‚Gemeine Esche‘ hervorzubringen, die gegen die zerstörerischen Umtriebe des ‚Falschen Weißen Stängelbecherchens‘ resistent ist“, so der Forscher. Vielleicht wird dann der Versuchsgarten in Tulln zum Garten Eden der Urmütter und Urväter aller künftigen Eschenpopulationen. Schwarz wird die Sonne, die Erde sinkt ins Meer, Vom Himmel schwinden die heitern Sterne. Glutwirbel umwühlen den allnährenden Weltenbaum … (Die Edda, 1851 übersetzt durch Karl Simrock)
- Seite 1 und 2: U M W E L T T E C H N I K • E N E
- Seite 3 und 4: September 2017/ UmweltJournal INNOV
- Seite 5 und 6: September 2017/ UmweltJournal IT IN
- Seite 7 und 8: September 2017/ UmweltJournal IT IN
- Seite 9 und 10: September 2017/ UmweltJournal WASSE
- Seite 11 und 12: September 2017/ UmweltJournal WASSE
- Seite 13 und 14: September 2017/ UmweltJournal ABFAL
- Seite 15 und 16: September 2017/ UmweltJournal ABFAL
- Seite 17: September 2017/ UmweltJournal ABFAL
- Seite 21 und 22: September 2017/ UmweltJournal MESST
- Seite 23 und 24: September 2017/ UmweltJournal SERVI
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...
UMWELT JOURNAL
© MJR Media World Group 2020