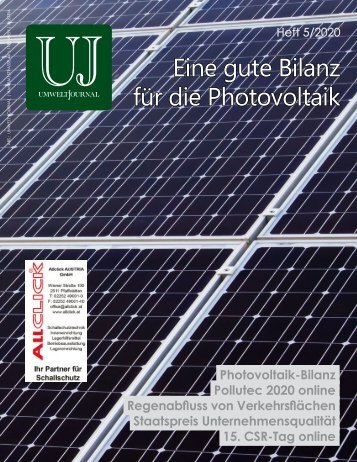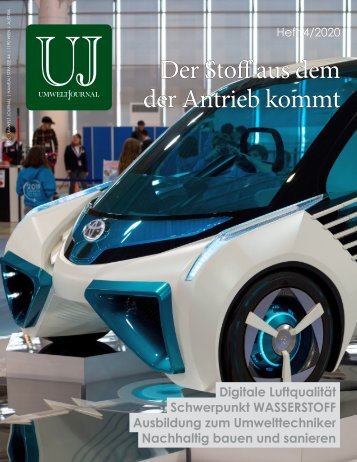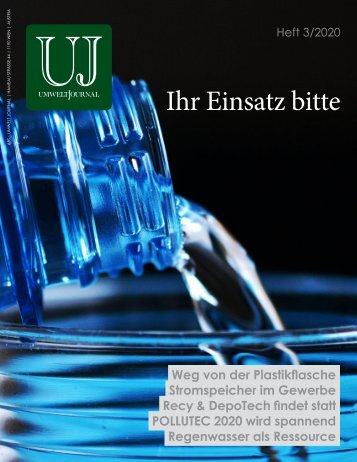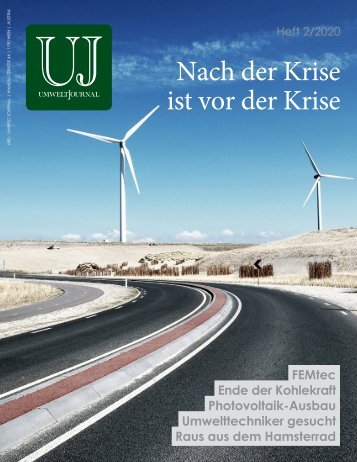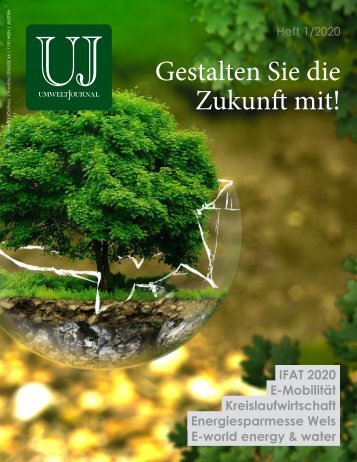UmweltJournal Ausgabe 2017-06
TECHNIK IN DER
TECHNIK IN DER KLÄRANLAGE 16 UmweltJournal /November 2017 Abwasseraufbereitung bei Bayer-Tochter Covestro Widerstandsfähige Rührwerke aus Super-Duplex Eine spezielle und effiziente Auslegung von Rührwerken verhindert die Ablagerung schwermetallhaltiger Schwebstoffe und sorgt für kontinuierliche Durchmischung von Chemieabwässern. Ein Anwenderbericht. Lothringerstraße 12 1030 Wien Tel.: +43 (0)1 532 62 83 Mail: office@vefb.at In dem 420 Hektar großen Industriepark, den die Bayer-Tochter Covestro AG in Brunsbüttel betreibt, fallen kontinuierlich biologisch abbaubare, jedoch sehr aggressive und schwermetallhaltige Chemieabwässer an. Bevor diese gemäß Wasserhaushaltsgesetz in der werkseigenen Kläranlage aufbereitet werden, wird das unbehandelte, bis zu 40 Grad Celsius warme Medium zunächst in zwei Puffertanks mit einem Fassungsvermögen von je 1.500 Kubikmetern zwischengespeichert. Dort muss für eine kontinuierliche Durchmischung gesorgt werden, da sich die mitgeführten Schwebstoffe sonst am Tankboden absetzen und eine aufwendige, teure Reinigung erforderlich machen würden. Um dies zu vermeiden, setzt Covestro seit 2015 zwei baugleiche, trocken aufgestellte Rührwerke der Landia GmbH aus Super Duplex 1.4547 ein. Die Modelle vom Typ Poptr-I verhindern zuverlässig, dass sich im Tank Ablagerungen bilden und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Abwasser der Kläranlage in einem gleichmäßigen Mischungsverhältnis zugeführt werden kann. Der Schwerpunkt der Produktion in Brunsbüttel liegt auf der Herstellung der Chemikalie Diphenylmethandiisocyanat (MDI), die für harten Schaumstoff, etwa zur Dämmung von Gebäuden oder Kühlgeräten, benötigt wird. Der pH-Wert der dabei entstehenden Abwässer schwankt zwischen eins bis zwölf ‒ je nachdem, wie viel Natriumhydroxid, Chlorwasserstoff oder Ammonium enthalten sind. Das Medium ist einphasig und nicht brennbar, enthält jedoch im Rahmen der jeweiligen Wasserlöslichkeit Anteile von Anilin, Nitrobenzol oder o-Dichlorbenzol. Hinzu kommen gelöste Schwermetalle, beispielsweise Zink, Kupfer und Nickel, sowie ein Salzgehalt von bis zu sechs Gramm je Liter. Aggressives Medium erfordert Spezial-Werkstoff Die beiden 1.500 Kubikmeter fassenden Puffertanks mit einem Damit sich keine Ablagerungen bilden, wird der Tankinhalt mit einem effizienten und robusten Rührwerk der Landia GmbH in Bewegung gehalten. Aufgrund des schwierigen Mediums sind Flansch, Getriebegehäuse und Propeller in dem Spezialwerkstoff Super-Duplex 1.4547 ausgeführt. Durchmesser von jeweils 15 Meter und einer Höhe von 8,5 Meter, in denen das anfallende Abwasser zwischengespeichert wird, dienen abwechselnd als Befüll- und Entleer-Behälter. Bei einem Füllstand von 95 Prozent werden die Zulaufventile des einen Tanks geschlossen und die des anderen geöffnet. Ab einer Überdeckung des Tankbodens von zwei Metern wird automatisch ein Rührwerk zu- beziehungsweise analog beim Entleeren wieder ausgeschaltet. Erst nachdem das Abwasser beprobt und für gut befunden wurde, darf es mengengeregelt der biologischen Kläranlage zugeführt werden. „Ohne kontinuierliche Durchmischung würden sich die mitgeführten Schwebstoffe am Boden absetzen. Um dieses Sediment in regelmäßigen Abständen zu entsorgen, müsste der Behälter aufwendig entleert, befahren und gereinigt werden“, berichtet Cord Cassens, Experte für Abwasseraufbereitung und Vertriebsleiter bei der Landia GmbH. Foto: Landia GmbH Aufgrund der schwankenden Abwasserqualität ist ein besonders zuverlässiges Rührwerk erforderlich, dessen mediumsberührende Teile ‒ Flansch, Getriebegehäuse und Propeller ‒ in dem Spezialwerkstoff Super-Duplex 1.4547 ausgeführt sind. „Die hohe chemische Beständigkeit beziehungsweise Haltbarkeit dieses Materials ist angesichts des aggressiven Mediums entscheidend für eine lange Lebensdauer der gesamten Anlage“, betont Cassens. Da es bei den bisher installierten Rührwerken Probleme mit mangelnder Energieeffizienz sowie einer zu geringen Schubkraft gab und der Ursprungslieferant keine Nachfolgemodelle in der geforderten Werkstoffqualität liefern konnte, führte Covestro 2015 eine Marktanalyse durch, um diese zu ersetzen. Landia war als einziger Hersteller in der Lage, dem Materialwunsch des Chemiekonzerns zu entsprechen. Seit der Inbetriebnahme laufen die Rührwerke einwandfrei. www.vefb.at Da für die Aufnahme des Rührwerks ein bereits vorhandenes Mannloch vorgesehen war, mussten spezielle Flansche gefertigt werden, um keine baulichen Veränderungen an dem genehmigten Lagertank vornehmen zu müssen. Die Installation an der Seitenwand des Tanks erfolgte unter einem speziellen Winkel, der eine optimale Durchmischung gewährleistet. Mit einem Drei-Blatt-Propeller (Durchmesser von 770 mm), konnten Energieeffizienz und Schubkraft verbessert werden.
November 2017/ UmweltJournal ABLUFT 17 Neue Ökodesign-Verordnung Staubsauger: Weniger Strom, weniger Lärm Eine neue Ökodesign-Verordnung mit strengeren Grenzwerte für Staubsauger schreibt ein Maximum von 900 Watt vor. Erstmals sind dabei auch die maximale Lautstärke, die Mindestlebensdauer des Motors oder Staubemissionen geregelt. Seit 1. September 2017 gelten strengere Grenzwerte für Staubsauger. „Die gesetzliche Grundlage liefert die Ökodesign-Richtlinie der EU. Ihr Ziel ist es, für Produkte und deren umweltrelevanten Eigenschaften Mindestanforderungen festzulegen“, erläutert Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. „Die Ökodesign- Richtlinie gilt für so genannte ‚energieverbrauchsrelevante Produkte‘, diese Geräte sollen umweltgerecht gestaltet werden und damit deutlich effizienter funktionieren. Das bedeutet weniger Energieverbrauch bei mindestens gleicher Leistung, neue Geräte sind in der Regel sogar deutlich besser.“ Schätzungen der EU-Kommission zufolge werden die jährlichen Energieeinsparungen im Rahmen von Ökodesign-Maßnahmen bis 2020 dem jährlichen Energieverbrauch Italiens entsprechen. So können europäische Haushalte durch die Nutzung von energieeffizienten Geräten pro Jahr Energiekosten in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrags einsparen. Strengere Anforderungen seit 1. September 2017 Die EU-Ökodesignverordnung, in der die Verbrauchsobergrenzen von Staubsaugern festgelegt ist, gilt bereits seit Herbst 2014. Mit 1. September 2017 trat nun die zweite Stufe der EU-Ökodesignverordnung in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen Staubsauger, die auf den Markt gebracht werden, strengere Anforderungen erfüllen. Neben dem geringeren Stromverbrauch sorgt die Verordnung aber auch für leistungsfähigere und langlebigere Geräte. Denn es wird auch geregelt, wie gut ein neuer Staubsauger mindestens reinigen und wie lange wichtige Bauteile halten müssen. Darüber hinaus gibt es weitere positive Effekte: beispielsweise profitieren Allergiker, da nun die Staubemission niedriger sind. Außerdem dürfen neue Staubsauger nicht mehr lauter als 80 Dezibel sein. Saubere Böden trotz geringerer Leistung? Die Absenkung der Leistung auf maximal 900 Watt bedeutet jedoch nicht, dass die Reinigungsleistung von Staubsaugern heute schlechter ist als früher. Es geht darum, wie effizient der aufgenommene Strom in Saugkraft übertragen wird. Die Geräte wurden entsprechend optimiert und aktuelle qualitativ hochwertige Modelle saugen entsprechend effektiver und effizienter. Zum Beispiel kann mehr Saugleistung trotz weniger Strom durch Verbesserungen an der Düse oder der optimalen Abstimmung von Filtertechnik und Luftführung erzielt werden. Eine weitere Änderung seit 1. September 2017 betrifft das „EU-Energielabel“ für Staubsauger. Seit drei Jahren erhalten Konsumenten über das Label einen einfachen Überblick über die wichtigsten Kaufkriterien wie Reinigungswirkung, Energieverbrauch und Geräuschentwicklung. Da die Entwicklung in Richtung effizientere Staubsauger geht, wird die bestehende Skala (A bis G) um die Klassen A+, A++ und A+++ erweitert. Die Klassen E bis G fallen weg. Damit bleibt bei Staubsaugern die Klassifizierung mit diversen Pluszeichen, die bei anderen Produktgruppen in den kommenden zwei bis drei Jahre wegfallen wird, derzeit noch als Übergangslösung bis zum Jahr 2025 bestehen. Was ist neu? Ein Überblick: seit September 2014 seit September 2017 Nennleistungsaufnahme maximal 1.600 Watt maximal 900 Watt durchschnittlicher Stromverbrauch pro Jahr maximal 62 kWh maximal 43 kWh Staubaufnahme auf harten Böden mindestens 95 Prozent mindestens 98 Prozent Staubaufnahme auf Teppichen mindestens 70 Prozent mindestens 75 Prozent durchschnittliche Maximallautstärke - 80 Dezibel Staubemissionen - maximal ein Prozent Lebensdauer des Motors - mehr als 500 Stunden Haltbarkeit des Schlauchs - min. 40.000 Schwenkungen unter Belastung Foto: colourbox
- Seite 1 und 2: U M W E L T T E C H N I K • E N E
- Seite 3 und 4: November 2017/ UmweltJournal ... UN
- Seite 5 und 6: November 2017/ UmweltJournal GREENI
- Seite 7 und 8: November 2017/ UmweltJournal ENERGI
- Seite 9 und 10: November 2017/ UmweltJournal ENERGI
- Seite 11 und 12: November 2017/ UmweltJournal TECHNI
- Seite 13 und 14: November 2017/ UmweltJournal TECHNI
- Seite 15: November 2017/ UmweltJournal SONDER
- Seite 19 und 20: November 2017/ UmweltJournal SERVIC
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...
UMWELT JOURNAL
© MJR Media World Group 2020