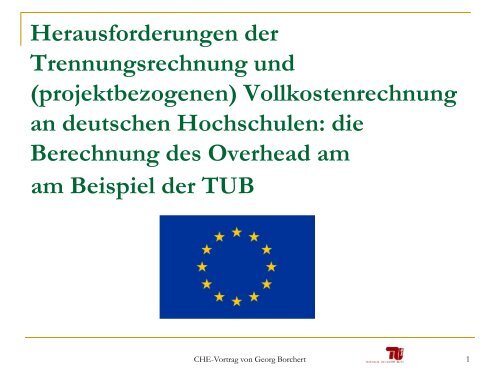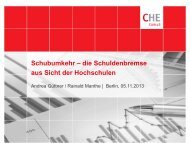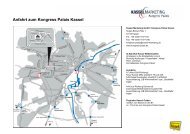Trennungsrechnung der TUB
Trennungsrechnung der TUB
Trennungsrechnung der TUB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong><br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> und<br />
(projektbezogenen) Vollkostenrechnung<br />
an deutschen Hochschulen: die<br />
Berechnung des Overhead am<br />
am Beispiel <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
1
Rechtliche Grundlage<br />
3.1.1. Staatliche Finanzierung nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten<br />
Soweit dieselbe Einrichtung sowohl wirtschaftliche als auch<br />
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, fällt die staatliche Finanzierung <strong>der</strong><br />
nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht unter Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag,<br />
wenn, zwecks Vermeidung von Quersubventionierungen, die beiden<br />
Tätigkeitsformen und ihre Kosten und Finanzierungen eindeutig voneinan<strong>der</strong><br />
getrennt werden können (24). Der Nachweis, dass die Kosten korrekt<br />
zugeordnet worden sind, kann im Jahresabschluss <strong>der</strong> Universitäten und<br />
Forschungseinrichtungen geführt werden.<br />
→Trennung<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
2
Rechtliche Grundlage<br />
3.2.1. Forschung im Auftrag von Unternehmen (Auftragsforschung<br />
o<strong>der</strong> Forschungsdienstleistungen)<br />
…… Wenn die Forschungseinrichtung einen solchen Auftrag ausführt, wird das<br />
Unternehmen von <strong>der</strong> Forschungseinrichtung in <strong>der</strong> Regel keine staatliche<br />
Beihilfe erhalten, wenn eine <strong>der</strong> folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:<br />
1. Die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung<br />
zum Marktpreis;<br />
2. die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung zu einem Preis, <strong>der</strong><br />
sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält,<br />
sofern es keinen Marktpreis gibt.<br />
→Vollkosten / Kostenrechnung<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
3
Kostenrechnung<br />
Worauf konnten wir aufbauen?<br />
Waren wir gut gerüstet?<br />
Beginn mit <strong>der</strong> Einführung einer Kostenrechnung in 2003<br />
Veröffentlichung von Kostenstellenberichten seit 2005<br />
aktuell werden bebucht:<br />
rd. 590 Kostenarten<br />
1.043 Kostenstellen, davon<br />
484 Endkostenstellen (Fachgebiete, BgA‘s, ZEH) und<br />
559 Hilfskostenstellen darunter<br />
126 Gebäudekostenstellen<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
4
Kostenstellenrechnung<br />
KOSTENARTENRECHNUNG<br />
Personalkosten <br />
Materialverbrauch <br />
Abschreibungen<br />
Sonstige<br />
Kosten<br />
Kostenstellenrechnung<br />
Hilfskostenstellen<br />
ZUV, ZE<br />
Gebäude<br />
in den Fakultäten<br />
Organe, Verwaltung,<br />
Institute<br />
Werkstätten<br />
Labore<br />
∑<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
Endkostenstellen<br />
Fachgebiete<br />
BgA‘s<br />
ZEH<br />
Umlagen<br />
Hilfskostenstellen<br />
∑<br />
5
Kostenstellenrechnung<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Als Verteilschlüssel für die Sekundärkosten werden verwendet:<br />
Zahl <strong>der</strong> Beschäftigten, ohne Unterteilung nach Art (wie z.B. HL, WM,<br />
Beamte, Entgelt, etc.) VZÄ<br />
Hauptnutzfläche je Kostenstelle m²<br />
Studierende Köpfe pro Fakultät<br />
einfache unstrittige und leicht nachvollziehbare Schlüssel<br />
Komplexe Verteilschlüssel „simulieren Gerechtigkeit“, verän<strong>der</strong>n das<br />
betriebswirtschaftliche Ergebnis aber nur nach dem Komma.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
6
Kostenstellenrechnung<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Rechenmodell<br />
Als Kostenrechnungssoftware kommt HIS-COB zum Einsatz.<br />
Zur Leistungsverrechnung wird das Gleichungsverfahren verwendet.<br />
Das Gleichungsverfahren erfasst die innerbetrieblichen<br />
Leistungsverflechtungen durch ein System linearer Gleichungen.<br />
Die Anzahl <strong>der</strong> Gleichungen entspricht <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> Kostenstellen, die<br />
wechselseitig verbunden sind.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
7
Kostenstellenbericht<br />
Rechenmodell<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
8
Rechenmodell<br />
1. Phase<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Entwicklung und Implementierung<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
9
Konsequenzen aus dem Beihilferahmen<br />
Rechenmodell<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Die wirtschaftlichen Leistungen sind zu einem Preis zu erbringen, <strong>der</strong> sowohl<br />
sämtliche Kosten (Vollkostenrechnung) als auch eine Gewinnspanne enthält<br />
(Nr. 3.2.1. EU-Beihilferahmen).<br />
<br />
Dazu bedarf es <strong>der</strong> Ermittlung von Stundensätzen für die künftige<br />
Projektkostenkalkulation, ausgehend von den Vollkosten eines Fachgebiets.<br />
In <strong>der</strong> Kostenstellenrechnung werden die Primär- und die Sekundärkosten<br />
(Umlagen) pro Fachgebiet ermittelt und im Kostenstellenbericht dargestellt. Zur<br />
Ermittlung <strong>der</strong> Stundensätze sind die Primärkosten und die Sekundärkosten als<br />
Nachweis <strong>der</strong> Berücksichtigung eines Overheadanteils relevant, um den Nachweis<br />
<strong>der</strong> Nicht-Quersubvention aus Haushaltsmitteln zu erbringen.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
10
Vollkosten<br />
Ermittlung <strong>der</strong> Vollkosten auf Ebene <strong>der</strong> einzelnen Projekte/Kostenträger <strong>der</strong><br />
wirtschaftlichen Tätigkeit.<br />
Direkte Kosten (Kostenträgereinzelkosten)<br />
werden dem Projekt direkt zugeordnet<br />
- Personalkosten (Zusatzpersonal, Landespersonal)<br />
- Sachkosten<br />
- AfA<br />
Indirekte Kosten (Kostenträgergemeinkosten)<br />
können dem Projekt nicht direkt zugeordnet werden<br />
__________________________________________<br />
Vollkosten = Kostendeckung<br />
Zuschläge (Wagnis, Gewinn, etc.)<br />
__________________________________________<br />
Gesamtkosten<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
11
Rechenmodell<br />
Rechenmodell<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Stundensatz Drittmittelmitarbeiter/innen - MA Drittm<br />
Sekundärkosten durch Gesamtzahl Mitarbeiter/innen plus tatsächliche<br />
Vergütung für Drittmittelbeschäftigte<br />
SekK HH<br />
MA HH + MA Drittm<br />
=<br />
Stundensatz Haushaltsmitarbeiter/innen - MA HH<br />
Sekundärkosten durch Gesamtzahl Mitarbeiter/innen plus Primärkosten durch<br />
Anzahl Mitarbeiter/innen Haushalt<br />
PrimK HH<br />
MA HH<br />
=<br />
420.000 = 60.000 = 60.000 = 35,71<br />
2,5 + 4,5 1.680<br />
300.000 = 120.000 = 120.000 = 71,43<br />
2,5 1.680<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
+<br />
z.B.<br />
IIa/E13 = 70,37 EUR<br />
34,66<br />
+ 35,71 = 107,14 EUR<br />
12
Rechenmodell<br />
Zwischenergebnis<br />
Vorgabe aus dem EU-Beihilferahmen<br />
Ein Fachgebiet, das ausschließlich Auftragsforschung betreibt, muss 100% <strong>der</strong><br />
Gesamtkosten Haushalt erwirtschaften, da sonst eine Quersubvention erfolgt.<br />
Anzahl Mitarbeiter Haushalt - MA HH 2,5 x 1.680 x 107,14 EUR = 450.000 EUR<br />
Anzahl Mitarbeiter Drittmittel - MA Drittm 4,5 x 1.680 x 35,71 EUR = 270.000 EUR<br />
720.000 EUR<br />
Mit den Stundensätzen wird die Vorgabe des EU-Beihilferahmens erfüllt.<br />
Da Fachgebiete nicht ausschließlich Auftragsforschung betreiben, müssen sie<br />
sich auch nicht vollständig refinanzieren. Sie würden es aber, wenn sie<br />
ausschließlich Auftragsforschung betreiben würden.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
13
Stundensätze<br />
Zwischenergebnis<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Mit dem beschriebenen Rechenmodell ergeben sich fachgebietsspezifische<br />
Stundensätze, die abhängig sind von:<br />
• <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Haushalts- und Drittmittelbeschäftigten<br />
• <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Studierenden<br />
• <strong>der</strong> in Anspruch genommenen Fläche<br />
• den Primärkosten<br />
• den Sekundärkosten (zentral und dezentral)<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
14
Stundensätze<br />
Zwischenergebnis<br />
Die Stundensätze teilen sich wie folgt auf:<br />
Anzahl FG<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
unter 60€ >60€<br />
unter 80€<br />
>80€<br />
unter<br />
100€<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
>100€<br />
unter<br />
120€<br />
>120€<br />
unter<br />
140€<br />
über<br />
140€<br />
MA Drittm<br />
MA HH<br />
Für über 65% aller Fachgebiete beträgt <strong>der</strong> Vollkosten-Stundensatz weniger<br />
als 80€ und für über 82% weniger als 100€.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
15
Zum Vergleich<br />
Zeithonorar zum Vergleich<br />
(§ 6 HOAI)<br />
Die Stundensätze betragen:<br />
Auftragnehmer 38 .. 82 EUR<br />
Mitarbeiter 36 .. 59 EUR<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Rechtsanwaltsvergütungsordnung – RVG<br />
1. Zeithonorar<br />
Die gängigen Stundensätze bewegen sich zwischen 100 Euro und 600 Euro,<br />
teilweise auch darüber.<br />
Gebühr nach § 11 Steuerberatergebührenverordnung richtet sich nach:<br />
1. <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Angelegenheit<br />
2. dem Umfang<br />
3. <strong>der</strong> Schwierigkeit <strong>der</strong> beruflichen Tätigkeit.<br />
Die Gebühren werden als Wert- o<strong>der</strong> Zeitgebühr erhoben.<br />
Die Stundensätze <strong>der</strong> Steuerberater/-in bewegen sich zwischen 75 und 125<br />
Euro, je nach Kompliziertheit und Komplexität des Mandats.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
16
Alt / Neu<br />
Auswirkungen<br />
Beispiel alt<br />
Jahr Primärkosten <br />
Gemeinkostenzuschlag<br />
Preis<br />
1 80.000 20.000 100.000<br />
2 80.000 20.000 100.000<br />
3 80.000 20.000 100.000<br />
Gesamt 240.000 60.000 300.000<br />
Beim FG<br />
verbleiben<strong>der</strong><br />
Overheadanteil<br />
50%<br />
30.000<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Primärkosten<br />
neu<br />
Sekundärkosten<br />
Preis<br />
80.000 75.000 155.000<br />
80.000 75.000 155.000<br />
80.000 75.000 155.000<br />
240.000 225.000 465.000<br />
25%<br />
56.250<br />
Der Auftrag verteuert sich um 165.000 EUR, das sind 55%.<br />
Bei Wirtschaft und Industrie besteht Verständnis für die „neuen Preise“. Um die<br />
Teuerungen zu reduzieren, wird gemeinschaftlich nach Lösungen gesucht<br />
Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen<br />
(3.2.2. EU-Beihilferahmen)<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
17
Dokumentation<br />
Zertifizierung durch<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br />
im Januar 2010<br />
Leitfaden<br />
zur <strong>Trennungsrechnung</strong><br />
an <strong>der</strong> TU Berlin<br />
Konzeption einer Kostenkalkulation für<br />
forschungsbezogene Projekte, Aufträge und sonstige<br />
Dienstleistungen<br />
Technische Universität Berlin<br />
Servicebereich Finanzen<br />
III A 1Juni 2009<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
18
2. Phase<br />
Kritik, Konsequenzen,<br />
Weiterentwicklung<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
19
Anteile in <strong>der</strong> Lehre<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
In einem Fachgebiet wird gelehrt und geforscht.<br />
Die Anteile Bestimmung in <strong>der</strong> des Lehrumfangs Lehre als Umkehrschluss - alles was nicht<br />
Forschung ist – findet keine ausreichende Akzeptanz.<br />
Die Aufteilung zwischen Lehre und Forschung erfolgt durch die<br />
Bestimmung von Prozentanteilen pro Beschäftigungskategorie <strong>der</strong> in den<br />
Fachgebieten beschäftigten Mitarbeiter/innen.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
mit den Fakultäten<br />
abgestimmte<br />
Anteile für Lehre<br />
20
Zwischenergebnis<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Die Prozentanteile variieren, tendieren aber zu 50% Lehre.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
Im Modellansatz<br />
sind<br />
Unterschiede<br />
zwischen den<br />
Fachgebieten<br />
berücksichtigt.<br />
21
Kosten <strong>der</strong> Lehre<br />
weitere Schritte<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Die Berücksichtigung <strong>der</strong> Mitarbeiterzeitanteile zur Aufteilung <strong>der</strong> Vollkosten<br />
in Lehr- und Forschungskosten ist sinnvoll, führt aber zu keiner Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Stundensätze für die Auftragsforschung, weil im Modell Zähler (Kosten) und<br />
Nenner (Mitarbeiter/innen) gekürzt werden.<br />
Mit <strong>der</strong> Aufteilung erfolgt aber <strong>der</strong> Einstieg in die Ermittlung <strong>der</strong> Kosten für<br />
die Lehre.<br />
Zu einer Entlastung <strong>der</strong> Forschungskosten kommt es, wenn einzelne<br />
Kosten direkt und ausschließlich <strong>der</strong> Lehre zugeordnet und dann auch dort<br />
weiterverarbeitet werden.<br />
Im Modell würde dadurch nur <strong>der</strong> Zähler ( Kosten) gekürzt werden.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
22
Kosten <strong>der</strong> Lehre<br />
Kosten <strong>der</strong> Lehre<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
In <strong>der</strong> Kostenrechnung 2008 wurden rd. 152,4 Mio. EUR Sekundärkosten<br />
auf die Fachgebiete verteilt.<br />
Von diesem Betrag sind rd. 56,9 Mio. EUR Gebäudekosten. Von diesen<br />
Gebäudekosten kann ungefähr ein Achtel – entsprechend den <strong>der</strong> Lehre<br />
zugeordneten Flächen – abgesetzt werden. Das sind rd. 7,1 Mio. EUR.<br />
Auch die Abt. I mit Kosten von rd. 5 Mio. EUR kann ausschließlich <strong>der</strong><br />
Lehre zugeordnet werden.<br />
Gleiches trifft für die Hälfte <strong>der</strong> Kosten des Präsidialbereichs zu, rd. 2 Mio.<br />
EUR.<br />
Wenn diese rd. 14,1 Mio. EUR <strong>der</strong> Lehre zugeordnet werden, ergeben sich<br />
die nachfolgenden Stundensätze:<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
23
Auswirkungen<br />
Auswirkungen<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Die Zuordnung von rd.<br />
14,1 Mio. EUR direkt<br />
zur Lehre führt zu einer<br />
Stundensatzreduktion<br />
von rd. 9% um die die<br />
Auftragsforschung als<br />
„zu teuer“ kalkuliert<br />
würde.<br />
24
Kuratoriumsbeschluss<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
1. Präsidiumsbeschluss<br />
Die Kostenstellenrechnung <strong>der</strong> <strong>TUB</strong> wird zur Kostenträgerrechnung mit <strong>der</strong><br />
Verteilung <strong>der</strong> Kosten auf Lehre und Forschung weiterentwickelt. In <strong>der</strong><br />
Lehre erfolgt die Verteilung <strong>der</strong> Kosten nach <strong>der</strong> Kreuztabelle auf die<br />
Studiengänge. Damit wird das Ziel verfolgt, einerseits die Kosten für die<br />
Forschung genauer darzustellen und an<strong>der</strong>erseits für interne Zwecke z.B.<br />
die Kosten für Studiengänge zu ermitteln.<br />
2. Das Risikoausfallwagnis wird nur für die direkten Kosten kalkuliert.<br />
3. Von den Gemeinkosten bei Projekten <strong>der</strong> Auftragsforschung die <strong>der</strong> <strong>Trennungsrechnung</strong> unterliegen, erhält <strong>der</strong><br />
Haushalt 50 %. Die Fakultäten und Fachgebiete teilen sich die an<strong>der</strong>en 50% zu gleichen Teilen.<br />
4. Die Weiterentwicklung des bisherigen <strong>Trennungsrechnung</strong>smodells wird<br />
den Gremien in ihren nächsten Sitzungen vorgestellt.<br />
5. Das modifizierte <strong>Trennungsrechnung</strong>smodell wird durch eine<br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zertifiziert.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
25
Kostenträgerrechnung<br />
Kostenart<br />
Primärkosten<br />
Sekundärkosten<br />
Endkostenstelle<br />
Gesamtkosten ∑<br />
y<br />
x<br />
x + y = 100 %<br />
Lehre<br />
Forschung<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
Lehrverflechtung<br />
Schlüssel<br />
Studiengang A<br />
Studiengang B<br />
Studiengang C<br />
Projekt 1<br />
Projekt 2<br />
Projekt 3<br />
26
Kostenträgerrechnung<br />
Projekt 1<br />
Projekt 1<br />
Projekt 2<br />
Projekt 3<br />
Projekt 4<br />
Projekt 1<br />
Projekt 2<br />
Projekt 1<br />
Projekt 2<br />
Projekt 3<br />
Kostenverteiler <br />
Kostenverteiler <br />
Kostenverteiler <br />
Kostenverteiler<br />
FG I<br />
Fo Le<br />
FG II<br />
Fo Le<br />
FG III<br />
Fo Le<br />
FG IV<br />
Fo Le<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
Lehreinheit<br />
3103<br />
Lehreinheit<br />
3207<br />
Studiengang<br />
A<br />
Studiengang<br />
B<br />
Studiengang<br />
C<br />
27
Was bringt das Ganze<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Möglichst genaue Ermittlung <strong>der</strong> Forschungskosten bei minimalem Aufwand<br />
durch Verzicht von<br />
− Zeitschreibungen zur Abgrenzung von Lehre und Forschung<br />
− weiteren Unterteilungen z.B. nach Grundlagenforschung,<br />
Weiterbildung<br />
Sensibilität <strong>der</strong> FG hinsichtlich<br />
− <strong>der</strong> Zuordnung von Personen, Flächen und Overheads aus <strong>der</strong><br />
eigenen Fakultät<br />
− <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> eigenen Kostenstelle mittels Unterkostenstellen<br />
Herauslösen von Kosten, die direkt <strong>der</strong> Lehre zuzuordnen sind durch direkte<br />
Buchung auf die Kostenträger <strong>der</strong> Lehre, so wie bereits bei den Kosten <strong>der</strong><br />
Forschung direkt auf die Projekte gebucht wird<br />
Kenntnis über die Kosten <strong>der</strong> Lehre, von Bedeutung z.B. bei Preismodellen<br />
Entscheidungshilfe bei Strukturentscheidungen und Vertragsverhandlungen,<br />
z.B. Studienplatzaufbau<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
28
Ende<br />
<strong>Trennungsrechnung</strong> <strong>der</strong> <strong>TUB</strong><br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
Ich freue mich auf eine anregende Diskussion.<br />
CHE-Vortrag von Georg Borchert<br />
29