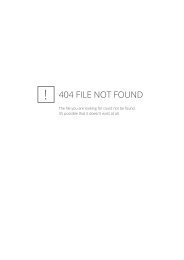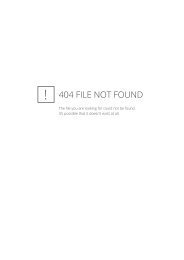Erklärung historischer Abläufe mit Computersimulationen - HSR-Trans
Erklärung historischer Abläufe mit Computersimulationen - HSR-Trans
Erklärung historischer Abläufe mit Computersimulationen - HSR-Trans
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Methoden der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin plausibel gemacht werden<br />
können, durch die Nutzung von <strong>Computersimulationen</strong> weiter reduziert<br />
werden könnte – bis hin zu einer einzigen Variante, die dann als die richtige,<br />
korrekte, wahre Geschichte identifiziert wäre. In diesem Fall wäre die Nutzung<br />
von <strong>Computersimulationen</strong> als experimentum crucis anzusehen, als Experiment<br />
also, das eine Theorie endgültig verifiziert oder falsifiziert. Wenn auch deutlich<br />
vorsichtiger ausgedrückt, findet sich dieser Anspruch bspw. bei Komlos und<br />
Artzrouni (1993: 325):<br />
Die Industrielle Revolution wird weithin als eine ausgeprägte Diskontinuität<br />
begriffen, die hauptsächlich durch eine plötzliche Welle technischen Fortschritts<br />
ausgelöst wurde. Unser Modell ersetzt dieses Paradigma durch ein anderes:<br />
die Industrielle Revolution wird als die Kulmination eines evolutionären<br />
Prozesses betrachtet. […] Mit Hilfe eines Simulationsmodells soll<br />
demonstriert werden, daß die Industrielle Revolution durch langsame aber stetige<br />
Akkumulation von Human- und Sachkapital erreicht werden konnte und<br />
so<strong>mit</strong> ein zeit-invarianter Prozeß zu sprunghaftem Wachstum führen kann.<br />
Die Ergebnisse einer Simulation sollen also letztlich zeigen, dass ein bisher<br />
verfochtenes Paradigma gegen ein anderes ausgetauscht werden müsse. Mit<br />
Imre Lakatos’ (1974) kann man diese Sichtweise nun als eine Spielart des<br />
naiven Falsifikationismus bezeichnen – und ablehnen. Ein experimentum crucis<br />
als endgültige Falsifikation einer Theorie ist unmöglich. Hierin unterscheiden<br />
sich traditionellere Prüfverfahren und <strong>Computersimulationen</strong> nicht. Falsifikationen<br />
bzw. die dafür genutzten Basissätze sind selbst theorieimprägniert, so<br />
dass sie allenfalls vorläufige Gültigkeit in Anspruch nehmen können. Liefert<br />
eine Computersimulation Ergebnisse, die als Basissätze interpretiert werden,<br />
können sie eben auch keine endgültige Falsifikation begründen. Da solche<br />
Ergebnisse von einem Computerprogramm generiert wurden, ist ihr epistemologischer<br />
Wert zudem noch geringer anzusetzen als jener einer Beobachtung.<br />
Diese rekurriert zumindest prinzipiell – eine realistische Metaphysik vorausgesetzt<br />
– auf eine bewusstseinsunabhängige Welt; für computererzeugte Basissätze<br />
lässt sich dies nicht sagen.<br />
Dies verweist auf den letzten methodologischen Aspekt, der kurz angesprochen<br />
werden soll. Computergenerierte Basissätze sind nicht nur theorie-, sondern<br />
designimprägniert. Gemeint ist da<strong>mit</strong>, dass das Design der Computersimulation<br />
weitreichenden Einfluss auf die Ergebnisse haben kann (siehe Weber<br />
2007: 118/119). In einer Simulation muss bspw. der Fluss der Zeit nachgebildet<br />
werden. Dabei kann man sich für eine diskrete oder eine kontinuierliche Modellierung<br />
entscheiden – in jedem Fall hat die Wahl aber Einfluss auf die Ergebnisse<br />
einer Simulation. Die Größe der Welt und ihre Form, bspw. ob sie<br />
Ränder hat oder geformt ist wie eine Kugel oder ein Torus, zeigt Auswirkungen<br />
auf die Bewegungsmöglichkeiten der Agenten (Hegselmann 1996). Das<br />
sind nur zwei Beispiele für Designentscheidungen. Selbst die verwendete<br />
Computersprache oder der Typ der genutzten Computer können sich auf die<br />
113