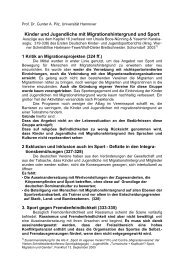Soziales Kapital, soziale Integration und Selbstorganisation
Soziales Kapital, soziale Integration und Selbstorganisation
Soziales Kapital, soziale Integration und Selbstorganisation
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die Qualität des <strong>soziale</strong>n Zusammenlebens <strong>und</strong> das <strong>soziale</strong> Vertrauen in einer Gesellschaft <strong>und</strong> damit –<br />
als indirekte Folge – für die Leistungsfähigkeit des staatlichen <strong>und</strong> ökonomischen Sektors. 18<br />
Zwar sind all diese Annahmen theoretisch bislang nur unzureichend ausgearbeitet <strong>und</strong> auch empirisch<br />
nicht überprüft. Im politischen Diskurs haben sie aber zu einer massiven Aufwertung all jener Vereine<br />
geführt, in denen prinzipiell jeder auf freiwilliger Basis Mitglied werden kann <strong>und</strong> in denen unmittelbare<br />
Gestaltungs- <strong>und</strong> Partizipationsmöglichkeiten existieren. 19 Die Sportvereine gelten dabei als einer der<br />
großen Hoffnungsträger, integrieren sie doch insbesondere die nachwachsenden Generationen, an die<br />
sich die Kritik eines vermeintlich ungezügelten Individualismus <strong>und</strong> Hedonismus besonders richtet.<br />
(2) Mit dem Stichwort der Partizipation ist bereits der wichtigste Aspekt im neuen Gemeinwohl-Diskurs<br />
angesprochen: das freiwillige Engagement, das in der öffentlichen Diskussion als Paradebeispiel für<br />
den gesellschaftlichen Zusammenhalt, als Ressource gelebter Solidarität <strong>und</strong> Prüfstein der inneren<br />
Konsistenz des Gemeinwesens gilt. 20 Wie eine repräsentative Bevölkerungsbefragung von 1999 zeigt,<br />
wird der weitaus größte Anteil des freiwilligen Engagements in Deutschland in Vereinen erbracht. 21 Dies<br />
gilt insbesondere für den Sport: Entgegen aller sorgenvollen Rhetorik von der „Krise des Ehrenamts“<br />
findet man im vereinsorganisierten Sport den vergleichsweise höchsten Anteil aller freiwillig engagierten<br />
B<strong>und</strong>esbürger. 1999 übernahmen knapp 10 % der über 14-jährigen B<strong>und</strong>esbürger regelmäßig Aufgaben<br />
in den r<strong>und</strong> 85.000 Sportvereinen. Und auch die Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen scheinen weniger ihren<br />
hedonistisch-individualistischen Egotripp auszuleben als gemeinhin angenommen wird. Auch sie binden<br />
sich nach wie vor längerfristig an die Sportvereine <strong>und</strong> engagieren sich vielfach „im Vorhof des Ehrenamts“<br />
– z.B. als Mannschaftsführer, Gruppensprecher, Schieds- oder Kampfrichter. Wie die „Jugendsport-Studie<br />
1992“ in Nordrhein-Westfalen zeigt, gilt dies für drei Viertel aller vereinsorganisierten Jugendlichen.<br />
22 Nicht ganz so hohe Mitwirkungsquoten werden von jugendlichen Vereinsmitgliedern in<br />
Ostdeutschland berichtet. Aber auch hier engagierten sich Ende der 90er-Jahre zwei Drittel freiwillig in<br />
ihrem Sportverein. 23<br />
Offenk<strong>und</strong>ig – so lassen sich die Bef<strong>und</strong>e zusammenfassen – können die Sportjugendorganisationen<br />
nicht nur damit werben, dass sie in Deutschland die attraktivste freiwillige Vereinigung für Kinder <strong>und</strong><br />
Jugendliche darstellen. Sie können auch damit werben, dass sich viele Heranwachsende freiwillig an<br />
der <strong>Selbstorganisation</strong> der Sportvereine beteiligen. Und wenn in den kleinräumig-überschaubaren<br />
Strukturen der assoziativen Lebenswelt der Nährboden bürgerschaftlicher Kompetenz in ihrer kognitiven<br />
18 Vgl. z.B. Kistler, E., H.-H. Noll <strong>und</strong> E. Priller (Hrsg.), 1999, Perspektiven gesellschaftlichen Zusammenhalts. Empirische<br />
Bef<strong>und</strong>e, Praxiserfahrungen, Meßkonzepte, Berlin.<br />
19 Vgl. z.B. Offe, C. <strong>und</strong> S. Fuchs, 2001: Schw<strong>und</strong> des Sozialkapitals? Der Fall Deutschland, a.a.O.<br />
20 Zu einer differenzierten Kritik dieser gängigen Sichtweise vgl. Friedrichs, J. <strong>und</strong> W. Jagodzinski, 1999: Theorien <strong>soziale</strong>r<br />
<strong>Integration</strong>, in: dies. (Hrsg.), Soziale <strong>Integration</strong>, Sonderband 39 der Kölner Zeitschrift für Soziologie <strong>und</strong> Sozialpsychologie,<br />
Wiesbaden, S. 9-43.<br />
21 Vgl. dazu die Ergebnisse der bislang umfangreichsten, vom B<strong>und</strong>esministerium für Familie, Senioren, Frauen <strong>und</strong> Jugend<br />
(BMFSFJ) in Auftrag gegebenen Untersuchung über das freiwillige Engagement in Deutschland, z.B. Rosenbladt, B. von<br />
(Hg.), 2000: Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Repräsentativerhebung 1999 zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit<br />
<strong>und</strong> bürgerschaftlichem Engagement (Band 1: Gesamtbericht), Stuttgart u.a.; speziell zum freiwilligen Engagement<br />
in den ostdeutschen Sportvereinen: Baur, J. <strong>und</strong> S. Braun 2000: Freiwilliges Engagement <strong>und</strong> Partizipation in<br />
ostdeutschen Sportvereinen. Eine empirische Analyse zum Institutionentransfer, Köln.<br />
22 Vgl. Kurz, D., H.-G. Sack <strong>und</strong> K.-P. Brinkhoff, 1996: Kindheit, Jugend <strong>und</strong> Sport in Nordrhein-Westfalen. Der Sportverein<br />
<strong>und</strong> seine Leistungen (Materialien zum Sport in Nordrhein-Westfalen, Heft 44), Düsseldorf.<br />
23 Vgl. Baur, J. <strong>und</strong> U. Burrmann, 2000: Unerforschtes Land, a.a.O.<br />
5