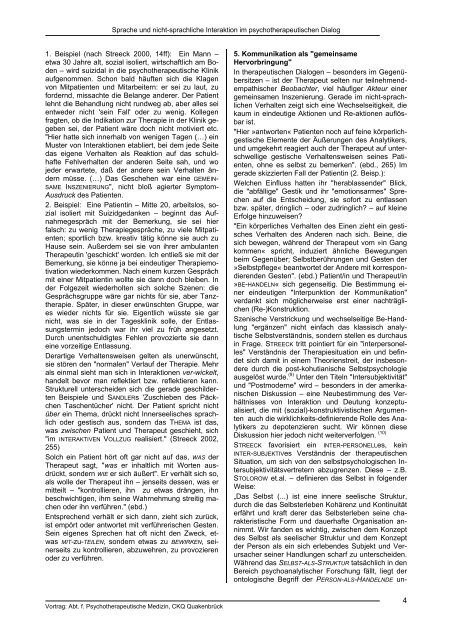'Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den ... - Rudolf Süsske
'Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den ... - Rudolf Süsske
'Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den ... - Rudolf Süsske
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sprache und nicht-sprachliche Interaktion im psychotherapeutischen Dialog<br />
1. Beispiel (nach Streeck 2000, 14ff): Ein Mann –<br />
etwa 30 Jahre alt, sozial isoliert, wirtschaftlich am Bo<strong>den</strong><br />
– wird suizidal in die psychotherapeutische Klinik<br />
aufgenommen. Schon bald häuften sich die Klagen<br />
von Mitpatienten und Mitarbeitern: er sei zu laut, zu<br />
for<strong>der</strong>nd, missachte die Belange an<strong>der</strong>er. Der Patient<br />
lehnt die Behandlung nicht rundweg ab, aber alles sei<br />
entwe<strong>der</strong> nicht 'sein Fall' o<strong>der</strong> zu wenig. Kollegen<br />
fragten, ob die Indikation zur Therapie in <strong>der</strong> Klinik gegeben<br />
sei, <strong>der</strong> Patient wäre doch nicht motiviert etc.<br />
"Hier hatte sich innerhalb von wenigen Tagen (…) ein<br />
Muster von Interaktionen etabliert, bei dem jede Seite<br />
das eigene Verhalten als Reaktion auf das schuldhafte<br />
Fehlverhalten <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite sah, und wo<br />
je<strong>der</strong> erwartete, daß <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e sein Verhalten än<strong>der</strong>n<br />
müsse. (…) Das Geschehen war eine GEMEIN-<br />
SAME INSZENIERUNG", nicht bloß agierter Symptom-<br />
Ausdruck des Patienten.<br />
2. Beispiel: Eine Patientin – Mitte 20, arbeitslos, sozial<br />
isoliert <strong>mit</strong> Suizidgedanken – beginnt das Aufnahmegespräch<br />
<strong>mit</strong> <strong>der</strong> Bemerkung, sie sei hier<br />
falsch: zu wenig Therapiegespräche, zu viele Mitpatienten;<br />
sportlich bzw. kreativ tätig könne sie auch zu<br />
Hause sein. Außerdem sei sie von ihrer ambulanten<br />
Therapeutin 'geschickt' wor<strong>den</strong>. Ich entließ sie <strong>mit</strong> <strong>der</strong><br />
Bemerkung, sie könne ja bei eindeutiger Therapiemotivation<br />
wie<strong>der</strong>kommen. Nach einem kurzen Gespräch<br />
<strong>mit</strong> einer Mitpatientin wollte sie dann doch bleiben. In<br />
<strong>der</strong> Folgezeit wie<strong>der</strong>holten sich solche Szenen: die<br />
Gesprächsgruppe wäre gar nichts für sie, aber Tanztherapie.<br />
Später, in dieser erwünschten Gruppe, war<br />
es wie<strong>der</strong> nichts für sie. Eigentlich wüsste sie gar<br />
nicht, was sie in <strong>der</strong> Tagesklinik solle, <strong>der</strong> Entlassungstermin<br />
jedoch war ihr viel zu früh angesetzt.<br />
Durch unentschuldigtes Fehlen provozierte sie dann<br />
eine vorzeitige Entlassung.<br />
Derartige Verhaltensweisen gelten als unerwünscht,<br />
sie stören <strong>den</strong> "normalen" Verlauf <strong>der</strong> Therapie. Mehr<br />
als einmal sieht man sich in Interaktionen ver-wickelt,<br />
handelt bevor man reflektiert bzw. reflektieren kann.<br />
Strukturell unterschei<strong>den</strong> sich die gerade geschil<strong>der</strong>ten<br />
Beispiele und SANDLERs 'Zuschieben des Päckchen<br />
Taschentücher' nicht. Der Patient spricht nicht<br />
über ein Thema, drückt nicht Innerseelisches sprachlich<br />
o<strong>der</strong> gestisch aus, son<strong>der</strong>n das THEMA ist das,<br />
was zwischen Patient und Therapeut geschieht, sich<br />
"im INTERAKTIVEN VOLLZUG realisiert." (Streeck 2002,<br />
255)<br />
Solch ein Patient hört oft gar nicht auf das, WAS <strong>der</strong><br />
Therapeut sagt, "was er inhaltlich <strong>mit</strong> Worten ausdrückt,<br />
son<strong>der</strong>n WIE er sich äußert". Er verhält sich so,<br />
als wolle <strong>der</strong> Therapeut ihn – jenseits dessen, was er<br />
<strong>mit</strong>teilt – "kontrollieren, ihn zu etwas drängen, ihn<br />
beschwichtigen, ihm seine Wahrnehmung streitig machen<br />
o<strong>der</strong> ihn verführen." (ebd.)<br />
Entsprechend verhält er sich dann, zieht sich zurück,<br />
ist empört o<strong>der</strong> antwortet <strong>mit</strong> verführerischen Gesten.<br />
Sein eigenes Sprechen hat oft nicht <strong>den</strong> Zweck, etwas<br />
MIT-zu-TEILEN, son<strong>der</strong>n etwas zu BEWIRKEN, seinerseits<br />
zu kontrollieren, abzuwehren, zu provozieren<br />
o<strong>der</strong> zu verführen.<br />
Vortrag: Abt. f. Psychotherapeutische Medizin, CKQ Quakenbrück<br />
5. Kommunikation als "gemeinsame<br />
Hervorbringung"<br />
In therapeutischen Dialogen – beson<strong>der</strong>s im Gegenübersitzen<br />
– ist <strong>der</strong> Therapeut selten nur teilnehmendempathischer<br />
Beobachter, viel häufiger Akteur einer<br />
gemeinsamen Inszenierung. Gerade im nicht-sprachlichen<br />
Verhalten zeigt sich eine Wechselseitigkeit, die<br />
kaum in eindeutige Aktionen und Re-aktionen auflösbar<br />
ist.<br />
"Hier »antworten« Patienten noch auf feine körperlichgestische<br />
Elemente <strong>der</strong> Äußerungen des Analytikers,<br />
und umgekehrt reagiert auch <strong>der</strong> Therapeut auf unterschwellige<br />
gestische Verhaltensweisen seines Patienten,<br />
ohne es selbst zu bemerken". (ebd., 265) Im<br />
gerade skizzierten Fall <strong>der</strong> Patientin (2. Beisp.):<br />
Welchen Einfluss hatten ihr "herablassen<strong>der</strong>" Blick,<br />
die "abfällige" Gestik und ihr "emotionsarmes" Sprechen<br />
auf die Entscheidung, sie sofort zu entlassen<br />
bzw. später, dringlich – o<strong>der</strong> zudringlich? – auf kleine<br />
Erfolge hinzuweisen?<br />
"Ein körperliches Verhalten des Einen zieht ein gestisches<br />
Verhalten des An<strong>der</strong>en nach sich. Beine, die<br />
sich bewegen, während <strong>der</strong> Therapeut vom »in Gang<br />
kommen« spricht, induziert ähnliche Bewegungen<br />
beim Gegenüber; Selbstberührungen und Gesten <strong>der</strong><br />
»Selbstpflege« beantwortet <strong>der</strong> An<strong>der</strong>e <strong>mit</strong> korrespondieren<strong>den</strong><br />
Gesten". (ebd.) Patient/in und Therapeut/in<br />
»BE-HANDELN« sich gegenseitig. Die Bestimmung einer<br />
eindeutigen "Interpunktion <strong>der</strong> Kommunikation"<br />
verdankt sich möglicherweise erst einer nachträglichen<br />
(Re-)Konstruktion.<br />
Szenische Verstrickung und wechselseitige Be-Handlung<br />
"ergänzen" nicht einfach das klassisch analytische<br />
Selbstverständnis, son<strong>der</strong>n stellen es durchaus<br />
in Frage. STREECK tritt pointiert für ein "interpersonelles"<br />
Verständnis <strong>der</strong> Therapiesituation ein und befindet<br />
sich da<strong>mit</strong> in einem Theorienstreit, <strong>der</strong> insbeson<strong>der</strong>e<br />
durch die post-kohutianische Selbstpsychologie<br />
ausgelöst wurde. (9) Unter <strong>den</strong> Titeln "Intersubjektivität"<br />
und "Postmo<strong>der</strong>ne" wird – beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> amerikanischen<br />
Diskussion – eine Neubestimmung des Verhältnisses<br />
von Interaktion und Deutung konzeptualisiert,<br />
die <strong>mit</strong> (sozial)-konstruktivistischen Argumenten<br />
auch die wirklichkeits-definierende Rolle des Analytikers<br />
zu depotenzieren sucht. Wir können diese<br />
Diskussion hier jedoch nicht weiterverfolgen. (10)<br />
STREECK favorisiert ein INTER-PERSONELLes, kein<br />
INTER-SUBJEKTIVes Verständnis <strong>der</strong> therapeutischen<br />
Situation, um sich von <strong>den</strong> selbstpsychologischen Intersubjektivitätsvertretern<br />
abzugrenzen. Diese – z.B.<br />
STOLOROW et.al. – definieren das Selbst in folgen<strong>der</strong><br />
Weise:<br />
„Das Selbst (...) ist eine innere seelische Struktur,<br />
durch die das Selbsterleben Kohärenz und Kontinuität<br />
erfährt und kraft <strong>der</strong>er das Selbsterleben seine charakteristische<br />
Form und dauerhafte Organisation annimmt.<br />
Wir fan<strong>den</strong> es wichtig, zwischen dem Konzept<br />
des Selbst als seelischer Struktur und dem Konzept<br />
<strong>der</strong> Person als ein sich erlebendes Subjekt und Verursacher<br />
seiner Handlungen scharf zu unterschei<strong>den</strong>.<br />
Während das SELBST-ALS-STRUKTUR tatsächlich in <strong>den</strong><br />
Bereich psychoanalytischer Forschung fällt, liegt <strong>der</strong><br />
ontologische Begriff <strong>der</strong> PERSON-ALS-HANDELNDE un-<br />
4