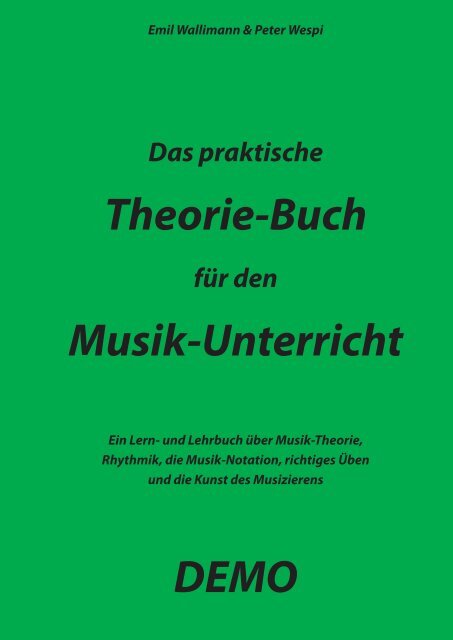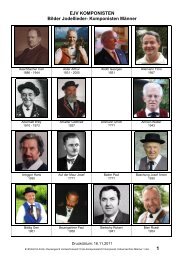Theoriebuch DEMO für die FJVZO.pdf
Theoriebuch DEMO für die FJVZO.pdf
Theoriebuch DEMO für die FJVZO.pdf
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Emil Wallimann & Peter Wespi<br />
Das praktische<br />
Theorie-Buch<br />
<strong>für</strong> den<br />
Musik-Unterricht<br />
Ein Lern- und Lehrbuch über Musik-Theorie,<br />
Rhythmik, <strong>die</strong> Musik-Notation, richtiges Üben<br />
und <strong>die</strong> Kunst des Musizierens<br />
<strong>DEMO</strong><br />
- 1 -
Inhalt Teil 1 - Grundkenntnisse<br />
Grundlagen<br />
9 Zwei Verbote<br />
10 Zubehör<br />
11 Pflege und Reinigung des Instrumentes<br />
Noten<br />
12 Zusammen musizieren<br />
14 Die Musik-Elemente<br />
15 Ein Musikstück näher betrachtet<br />
16 Üben: "Ich konnte nicht so viel üben!"<br />
17 Üben: "Wie soll ich üben?"<br />
Üben: Das Musik-Menü<br />
20 Üben: Der Hauptgang im Detail<br />
22 Üben: Der Unterschied zwischen spielen und üben<br />
23 Üben: 11 ultimative Übungs-Tipps und Übungs-Regeln<br />
24 Üben: Meine Hitparade - Die Top 10<br />
25 Musik-Unterricht<br />
Notenlehre<br />
30 Die Klavier-Tastatur: Die chromatische Tonleiter<br />
Die Klavier-Tastatur: Die Taste des Tons C<br />
31 Die Klavier-Tastatur: Die C-Dur Tonleiter<br />
32 Das Liniensystem<br />
Die Notenschlüssel<br />
33 Die Einteilung der Oktaven<br />
Die Stimmgattungen<br />
34 Die Stammtöne<br />
35 Die Versetzungszeichen: Das Kreuz – #<br />
36 Die Versetzungszeichen: Das Be – b<br />
37 Die Versetzungszeichen: Eine Gedankenstütze <strong>für</strong> # und b<br />
38 Die Versetzungszeichen: Vorzeichen, Versetzungszeichen und Auflösungszeichen<br />
40 Die enharmonischen Verwechslungen<br />
43 Die enharmonischen Verwechslungen: Der Notenbaum<br />
44 Training<br />
48 Tonleitern: Die chromatische Tonleiter<br />
50 Tonleitern: Die Dur-Tonleiter - Erklärung über <strong>die</strong> Halbtonschritte<br />
52 Tonleitern: Die Dur-Tonleiter - Erklärung über <strong>die</strong> Klaviertastatur<br />
56 Tonleitern: Die sechs # -Tonleitern<br />
57 Tonleitern: Die sechs b -Tonleitern<br />
58 Tonleitern: Eselsbrücken<br />
60 Dur und Moll: Gegensätze der Tongeschlechter<br />
61 Dur und Moll: Musikstücke aus dem Lieblingsrepertoire<br />
62 Dur und Moll: Mein Dur-Gemälde<br />
63 Dur und Moll: Mein Moll-Gemälde<br />
Rhythmik<br />
64 Die Rhythmus-Pyramide<br />
65 Die Rhythmussprache<br />
66 Rhythmische Fingerspiele<br />
68 Der Punkt nach einer Note oder Pause<br />
69 Der Haltebogen<br />
70 Das Metrum<br />
71 Das Metronom<br />
72 Der Takt<br />
73 Die Taktangabe<br />
74 Alla breve<br />
- 2 -
75 Training: Schreib- und Denkübungen, unvollständige Takte<br />
78 Training: Rhythmische Duette<br />
Vortragsangaben<br />
80 Dynamik<br />
82 Artikulation<br />
84 Acht kleine Tipps <strong>für</strong> grosse Konzertmeister<br />
Inhalt Teil 2 - Erweiterte Kenntnisse<br />
Notenlehre<br />
86 Tonleitern: Die Tonleiter-Stu<strong>die</strong>n in 12 Monaten<br />
88 Tonleitern: Die Tonleiter-Stu<strong>die</strong>n in 12 Monaten – Der Prototyp C-Dur<br />
89 Tonleitern: Die parallele Moll-Tonleiter<br />
91 Tonleitern: Der Leitton<br />
92 Tonleitern: Die harmonische Moll-Tonleiter<br />
94 Tonleitern: Die melodische Moll-Tonleiter<br />
95 Tonleitern: Eine Dur- und drei Moll-Tonleitern<br />
96 Tonleitern: Training<br />
98 Die Intervalle<br />
99 Die Intervalle: Diatonische Intervalle<br />
100 Die Intervalle: Nicht-diatonische Intervalle<br />
103 Dreiklänge<br />
106 Der Quintenzirkel<br />
Rhythmik<br />
108 Rhythmische Sicherheit<br />
110 Der Punkt nach dem Punkt<br />
111 Der Auftakt<br />
113 Einzählen<br />
115 Einzählen: Beispiele Stücke ohne Auftakt<br />
116 Einzählen: Beispiele Stücke mit Auftakt<br />
117 Synkopen und synkopische Bereiche: Die Synkope<br />
118 Synkopen und synkopische Bereiche: Synkopische Bereiche<br />
120 Die Viertel-Triole<br />
122 3/4 und 6/8 Takt<br />
124 3/8, 9/8 und 12/8 Takt<br />
125 Charakter der Dreier-Rhythmen<br />
Musikstile der Dreier-Rhythmen<br />
126 Komplexe Taktarten<br />
127 Ternäres Achtel-Feeling<br />
128 Die ternäre Rhythmussprache<br />
129 Ternäre Musik-Stile<br />
Die Bezeichnung von ternären Stücken in Notenblättern<br />
130 Lese-Training: Synkopen und synkopische Bereiche<br />
131 Lese-Training: Achteltriolen, Vierteltriolen<br />
132 Lese-Training: Dreier-Rhythmen<br />
133 Lese-Training: Duette ohne Sechzehntelnoten<br />
134 Lese-Training: Duette mit Sechzehntelnoten<br />
Vortragsangaben<br />
135 Der musikalische Charakter<br />
136 Agogik: Die Grundtempi<br />
137 Agogik: Die Tempoveränderungen
138 Die Verzierungen<br />
140 Die Fermate<br />
141 Der Phrasierungsbogen<br />
142 Abkürzungen: Mehrtaktige Pausen<br />
143 Abkürzungen: Abbreviaturen<br />
144 Die musikalischen Wegweiser<br />
148 Quiz zu Teil 1<br />
154 Quiz zu Teil 2<br />
Inhalt Teil 3 - Quiz<br />
158 Grafischer Index<br />
159 Nummerischer und alphabetischer Index<br />
162 Glossar<br />
164 Checkliste Teil 1<br />
166 Checkliste Teil 2<br />
168 Kopiervorlage Kontrolle der täglichen Übungszeit<br />
169 Kopiervorlage Meine Hitparade – The Top 10<br />
Inhalt Teil 4 - Anhang<br />
Die Autoren<br />
Emil Wallimann<br />
...wurde 1957 in Alpnach geboren. Dort verbrachte er seine Kindheit und Schulzeit. Nach sechs<br />
Jahren Handwerk im Bauspengler-Gewerbe zog es ihn vollends zur Musik: Er liess sich am<br />
Konservatorium Luzern bei Antony Morf zum Klarinetten-Lehrer ausbilden. Das Wissen und<br />
Können des Blasmusik-Dirigenten erlernte er bei Josef Gnos. Emil Wallimann ist seit 1984 Leiter<br />
der Musikschule Ennetbürgen NW, seinem Wohnort. Auch der Kinderchor, <strong>die</strong> Jungmusik und<br />
<strong>die</strong> Musikgesellschaft in Ennetbürgen unterstehen seiner Leitung. Als Komponist schrieb er<br />
schon unzählige Stücke <strong>für</strong> Blasmusik und Jodlerchor. Von ihm stammen auch Werke, <strong>die</strong> <strong>für</strong><br />
<strong>die</strong> Kombination von Blasmusik-Besetzung mit Jodlerchor geschrieben sind. Sein kompetentes<br />
Wissen über <strong>die</strong>se Materie kann er an Blasmusik- und Jodlerfesten als Experte anwenden. Als<br />
Autor verfasste er <strong>die</strong> Lehrgänge Mein erstes Musikheft und Mein zweites Musikheft, <strong>die</strong> in der<br />
musikalischen Grundausbildung der 2. und 3. Primarklasse eingesetzt werden.<br />
Peter Wespi<br />
...wurde 1966 in Rothenburg geboren. Nach einer Lehre und drei weiteren Jahren im<br />
Autogewerbe wechselte er in den Aussen<strong>die</strong>nst. Sechs Semester an der allgemeinen<br />
Abteilung der Jazz Schule Luzern bildeten <strong>die</strong> Vorbereitung <strong>für</strong> <strong>die</strong> Jazz-Berufsausbildung,<br />
<strong>die</strong> er 1994 mit Diplom <strong>für</strong> Saxophon und Piano abschloss.<br />
Der Musik-Pädagoge unterrichtet Saxophon, Improvisation auf allen Instrumenten, steht<br />
Bands und Ensembles als Coach zur Seite und leitet diverse Workshops, auch im Bereich<br />
Rhythmik (Rhythmus fühlen – Rhythmen lesen).<br />
In seinem Musik-Atelier big bang studio bietet er seine musikalischen Dienstleistungen an:<br />
Er arbeitet als Komponist, Arrangeur, Autor, Organisator, Supervisor und gehört zu den<br />
Schweizer Pionieren im Bereich Audio-Branding.<br />
Als Saxophonist (Tenor-, Sopran- und Bariton-Saxophon) ist er in Bands verschiedenster<br />
Stilrichtungen zu hören. Auf www.wespi.com sind seine Tätigkeiten detailliert beschrieben.
Notenlehre: Das Liniensystem / Die Notenschlüssel<br />
Das Liniensystem<br />
Hilfslinien <strong>für</strong> hohe Töne<br />
5. Linie<br />
4. Linie<br />
4. Zwischenraum<br />
3. Linie<br />
3. Zwischenraum<br />
2. Linie<br />
2. Zwischenraum<br />
1. Linie 1. Zwischenraum<br />
Das Liniensystem oder Notensystem besteht aus fünf Linien. Die Linien bilden vier<br />
Zwischenräume. Für einzelne Töne, welche über oder unter das System hinausgehen,<br />
gibt es Hilfslinien.<br />
Die Notenschlüssel<br />
Hilfslinien <strong>für</strong> tiefe Töne<br />
Der Violinschlüssel (oder G-Schlüssel) und der Bassschlüssel (oder F-Schlüssel) sind<br />
<strong>die</strong> gängigsten Notenschlüssel. Diese Grafik zeigt, woher ihre Namen abgeleitet wurden.<br />
&<br />
G<br />
w<br />
? w<br />
F<br />
G Linie<br />
F Linie<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Schreibe Violinschlüssel und Bassschlüssel!<br />
&<br />
?<br />
- 5 -
Notenlehre: Die Einteilung der Oktaven / Die Stimmgattungen<br />
Die Einteilung der Oktaven<br />
&<br />
?<br />
C D E F G A H c d e f g a h c‘ d‘ e‘ f‘ g‘ a‘ h‘ c‘’ d‘’ e‘’ f‘’ g‘’ a‘’ h‘’ c‘’’ d‘’’ e‘’’ f‘’’ g‘’’ a‘’’ h‘’’ c‘‘’’<br />
Grosse Oktave Kleine Oktave Eingestrichene<br />
Oktave<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
Die Stimmgattungen<br />
& œ œ bœ<br />
?<br />
œ œ bœ<br />
Bass<br />
Bariton Tenor Alt<br />
œ<br />
Zweigestrichene<br />
Oktave<br />
Dreigestrichene<br />
Oktave<br />
Diese Grafik zeigt, in welcher Lage eine Stimme oder ein Instrument<br />
klingt. Die wichtigsten Stimmgattungen sind fett dargestellt.<br />
Es gibt Instrumentenfamilien, <strong>die</strong> nach <strong>die</strong>sen Stimmgattungen unterteilt sind: Die<br />
Flöten mit Sopranflöte, Altflöte, Tenorflöte und Bassflöte. Oder <strong>die</strong> Saxophone mit<br />
Sopransaxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon, Baritonsaxophon und Basssaxophon.<br />
œ<br />
bœ<br />
bœ<br />
Koloratur-<br />
Sopran<br />
Mezzo-<br />
Sopran<br />
œ<br />
œ<br />
Sopran<br />
œ<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Welcher Stimmgattung gehört dein Instrument an?<br />
Ich spiele ________________ und <strong>die</strong> Stimmlage ist ______________.
Notenlehre: Die Stammtöne<br />
Die Stammtöne<br />
Stammtöne sind Töne ohne Veränderung durch Vorzeichen.<br />
Die einzige Tonleiter, <strong>die</strong> nur aus Stammtönen besteht ist <strong>die</strong><br />
C-Dur Tonleiter.<br />
Auf dem Klavier wird <strong>die</strong> C-Dur Tonleiter nur mit den weissen<br />
Tasten gespielt. Diese Grafik zeigt <strong>die</strong> Stammtöne C’ bis C’’ mit<br />
der Klaviertastatur.<br />
& œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
C‘ D‘ E‘ F‘ G‘ A‘ H‘ C‘‘<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Weitere Informationen über<br />
<strong>die</strong> Dur-Tonleiter findest du<br />
Seite 50 bis 55.<br />
- 7 -
Notenlehre: Vorzeichen, Versetzungszeichen und Auflösungszeichen<br />
Vorzeichen, Versetzungszeichen und Auflösungszeichen<br />
Vorzeichen<br />
Ein # oder b am Anfang einer Linie oder eines Stückes ist ein Vorzeichen.<br />
Es gilt <strong>für</strong> <strong>die</strong> ganze Linie oder <strong>für</strong> das ganze Stück.<br />
Versetzungszeichen<br />
Ein # oder b welches mitten im Stück vorkommt, ist ein Versetzungszeichen<br />
und gilt nur bis zum nächsten Taktstrich.<br />
F-Dur: B ist ein Vorzeichen<br />
& b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # ˙ œ œ œ w<br />
D-Dur: Fis und Cis sind Vorzeichen<br />
& # # 4 œ<br />
œ œ œ œ nœ<br />
˙ bœ<br />
œ ˙ œ œ œ œ ˙<br />
Auflösungszeichen - n<br />
Das Auflösungszeichen hebt bei versetzten Noten <strong>die</strong> Wirkung von<br />
# oder b auf und gilt nur bis zum nächsten Taktstrich.<br />
F-Dur: B gilt <strong>für</strong> <strong>die</strong> ganze Linie<br />
& b 4 4 œ œ œ œ œ<br />
B<br />
Cis<br />
C<br />
B ist ein Versetzungszeichen<br />
H B H<br />
H ist wieder B<br />
œ œnœ<br />
œ œ œ ˙ œ œ œ w<br />
B H H B<br />
Cis ist ein Versetzungszeichen<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Es kommt vor, dass in einer Melo<strong>die</strong> ein nicht von der Tonart verlangt versetzter<br />
Ton, sondern sein Stammton gespielt werden muss. In <strong>die</strong>sem Fall wird ein<br />
Auflösungszeichen geschrieben.<br />
Cis<br />
Cis<br />
˙
Notenlehre: Vorzeichen, Versetzungszeichen und Auflösungszeichen<br />
Ausnahme <strong>für</strong> Versetzungszeichen und Auflösungszeichen<br />
Bei tonartfremden Tönen bleibt <strong>die</strong> Wirkung über den Taktstrich hinaus<br />
aktiv, wenn eine Note durch einen Haltebogen verlängert wird.<br />
B-Dur: B und Es gelten <strong>die</strong> ganze Linie<br />
& b b 4 œ œ œ œ nœ<br />
H<br />
G-Dur: Fis gilt <strong>die</strong> ganze Linie<br />
Fis Fis<br />
F<br />
œ<br />
# œ œ œ œ œ<br />
œœœ œ nœ<br />
˙ œ Œ<br />
H bleibt aktiv<br />
& # 4 œ œ œb Des<br />
œ œbœ<br />
˙ ‰ œ œ œ F<br />
‰<br />
nœ .<br />
J<br />
B<br />
H<br />
B bleibt aktiv<br />
B<br />
Des<br />
H<br />
B<br />
H bleibt aktiv<br />
œbœ<br />
œbœ<br />
˙ œ œ Œ<br />
B<br />
H<br />
B bleibt aktiv<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
- 9 -
Notenlehre: Die enharmonischen Verwechslungen<br />
Die enharmonischen Verwechslungen<br />
Löse <strong>die</strong>se zwei Aufgaben:<br />
&<br />
Schreibe in das Liniensystem ein Fis und<br />
markiere <strong>die</strong>se Taste mit roter Farbe!<br />
Schreibe in das Liniensystem ein Ges und<br />
markiere <strong>die</strong>se Taste mit roter Farbe!<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
&<br />
Was fällt dir auf?<br />
- 10 -
Notenlehre: Tonleitern<br />
Die Dur-Tonleiter<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Thema Dur-Tonleiter zu erklären. Die<br />
gebräuchlichsten beiden Wege sind:<br />
Erklärung über <strong>die</strong> Halbtonschritte<br />
Erklärung über <strong>die</strong> Klaviertastatur<br />
Während der Arbeit mit <strong>die</strong>sem Buch stellten wir Folgendes fest: Leute, <strong>die</strong> bei einem<br />
Weg nur Bahnhof verstanden, begriffen <strong>die</strong> andere Erklärung ohne Probleme und<br />
umgekehrt.<br />
Deshalb beschreiben wir hier beide Möglichkeiten. Du wirst schnell merken, welcher<br />
Weg <strong>für</strong> dich der einfachere ist.<br />
Die Dur-Tonleiter - Erklärung über <strong>die</strong> Halbtonschritte<br />
Die chromatische Tonleiter bildet das Fundament <strong>für</strong> <strong>die</strong>se Erklärung. Diese Grafik<br />
zeigt <strong>die</strong> chromatische Tonleiter von C aus, wobei alle Stammtöne fett dargestellt<br />
sind.<br />
Eine Dur-Tonleiter besteht aus:<br />
- fünf Ganztonschritten GT<br />
- zwei Halbtonschritten HT<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
C - Cis - D - Dis - E - F - Fis - G - Gis - A - Ais - H - C<br />
GT GT HT GT GT GT HT<br />
Die Abstände der Dur-Tonleiter sind GT - GT - HT - GT - GT - GT - HT
Notenlehre: Tonleitern<br />
Die sechs Kreuz-Tonleitern<br />
G-Dur<br />
D-Dur<br />
A-Dur<br />
E-Dur<br />
H-Dur<br />
& w w w w w w # w w<br />
& w w # w w w w # w w<br />
& w w # w w w # w # w w<br />
& w<br />
& w<br />
# w # w w w # w # w w<br />
# w # w w # w # w # w w<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Fis-Dur<br />
& # w # w # w w # w # w # w # w
Die Rhythmus-Pyramide<br />
1 Ganze Note<br />
w<br />
1 Ganze Pause<br />
∑<br />
1 2 3 4<br />
2 Halbe Noten 2 Halbe Pausen<br />
F F Ó Ó<br />
1 2 3 4<br />
4 Viertelnoten 4 Viertelpausen<br />
f f f f Œ Œ Œ Œ<br />
1 2 3 4<br />
8 Achtelnoten 8 Achtelpausen<br />
f f f f f f f J<br />
f J<br />
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰<br />
1 + 2 + 3 + 4 +<br />
12 Achtel-Triolen 12 Achtel-Triolen-Pausen<br />
f f f f f f f f f f f f ‰‰‰<br />
‰‰‰<br />
‰‰‰<br />
‰‰‰<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
3 3 3 3 3 3 3 3<br />
16 Sechzehntelnoten 16 Sechzehntelpausen<br />
fffffffffffff R<br />
f R<br />
f R<br />
f R<br />
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈<br />
Zähle beim Spielen immer <strong>die</strong> durchgehenden Viertel-Werte!
Vortragsangaben: Artikulation<br />
Artikulation<br />
Unter dem Begriff Artikulation versteht man <strong>die</strong><br />
bestimmte Vortragsart einzelner oder mehrerer<br />
Töne.<br />
Die Artikulationszeichen sind ober- oder unterhalb<br />
der einzelnen Noten angegeben.<br />
Dies sind <strong>die</strong> gängigsten Artikulationen und <strong>die</strong><br />
Erklärung ihrer Spielart.<br />
legato, Bindebogen<br />
& 4 f f F f f Œ f f f f f F f f F Œ<br />
Der Bindebogen bestimmt, dass eine Passage von mindestens zwei Tönen legato,<br />
gebunden gespielt werden soll. Die erste Note des Bindebogens wird normal, <strong>die</strong> restlichen<br />
Noten innerhalb des Bogens werden sehr weich angespielt. Bei Blasinstrumenten<br />
erhalten <strong>die</strong>se Noten keinen Zungenschlag. Legato ist ein sehr weicher Effekt.<br />
portato<br />
. . . . . .<br />
. .<br />
& 4 f .<br />
f. F f<br />
. . f. Πf f<br />
. . f f<br />
. . f F f. f Œ<br />
. F<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Portato bedeutet getragen. Eine portato gespielte Tonfolge klingt ähnlich wie legato,<br />
jedoch etwas weniger weich. Bei Blasinstrumenten erzielt man <strong>die</strong>s mit einem sehr<br />
weichen Zungenschlag. Portato ist ein weicher Effekt.
Notenlehre: Intervalle<br />
Intervall-Regel Nummer 3:<br />
Die Distanz zum Zielton darf nicht in<br />
Halbtonschritten bestimmt werden.<br />
Unsere Erfahrung zeigt, dass Intervalle oft in Halbtonschritten errechnet werden. Es<br />
besteht <strong>die</strong> Gefahr, den Zielton in seiner enharmonischen Verwechslung zu benennen.<br />
Das Ergebnis klingt zwar richtig, ist aber musikalisch-orthografisch falsch:<br />
Richtig gehört, aber falsch geschrieben. Dies führt bei der Harmonielehre zu grosser<br />
Verwirrung.<br />
Beispiel:<br />
Die kleine Terz besteht aus 3 Halbtonschritten. Beim Abzählen von Grundton C aus<br />
kann man auf Dis kommen, was aber <strong>die</strong> übermässige Sekunde zu C ist. Die korrekte<br />
Bezeichnung der kleinen Terz zu C ist Es.<br />
&<br />
übermässige Sekunde ü2<br />
w<br />
FALSCH!<br />
# w<br />
kleine Terz k3<br />
Löse <strong>die</strong>se Aufgaben! Eine fertig gelöste Aufgabe enthält <strong>die</strong><br />
beiden Töne eines Intervalls und seine Bezeichnung.<br />
& w<br />
w w bw<br />
w # w w<br />
& w w bw<br />
w<br />
Richtig!<br />
bw<br />
#w<br />
bw<br />
g3 r5 r4 g2 g7<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
& w w w<br />
w w bw<br />
w<br />
w<br />
w w bw<br />
bw<br />
#w<br />
& w w w<br />
- 15 -<br />
bw<br />
k3 ü5 v4 k2 k7<br />
w
Notenlehre: Dreiklänge<br />
Dreiklänge<br />
Wiederhole bitte das Kapitel Ein Musikstück etwas näher betrachtet Seite 15. Dort steht<br />
in Abschnitt 2 Folgendes:<br />
"Akkorde bestehen aus mehreren Tönen und sind daher Mehrklänge."<br />
Gehen wir doch <strong>die</strong>sen Akkorden und Mehrklängen auf den Grund!<br />
Der Zweiklang<br />
Die erste Form eines Mehrklanges ist der Zweiklang. Ein Zweiklang bedeutet nichts<br />
anderes, als dass <strong>die</strong> beiden Töne eines Intervalls nicht nacheinander, sondern miteinander<br />
gespielt werden.<br />
Du kennst <strong>die</strong> Zweiklänge bereits aus den zweistimmigen Stücken, den so genannten<br />
Duetten.<br />
Zweiklänge können in der Kombination von sämtlichen diatonischen und nicht-diatonischen<br />
Intervallen auftreten.<br />
Der Dreiklang<br />
Ein Dreiklang besteht aus den Intervallen Terz und Quinte über dem Grundton<br />
Prime. Kombinationen von diatonischen und nicht-diatonischen Terzen und<br />
Quinten in Bezug zum Grundton ergeben verschiedene Arten von Dreiklängen.<br />
Bei der nachfolgenden Grafik sind auf über jeden Ton der C-Dur Tonleiter eine Terz und<br />
eine Quinte aufgeschichtet worden. Dabei wurden nur Töne aus der C-Dur Tonleiter<br />
verwendet.<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Ergänze <strong>die</strong>se Grafik, indem du mit deinen Intervall-Kenntnissen<br />
<strong>die</strong> Terzen und Quinten bestimmst!<br />
& w w w w w<br />
w<br />
w<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1<br />
_ 5<br />
_ 3<br />
r 1
Rhythmik: Der Auftakt<br />
Der Auftakt<br />
Untersuche <strong>die</strong>se Notenlinie! Was stimmt nicht?<br />
&b4<br />
f f f f f f f F f f f f f f J F<br />
Hier <strong>die</strong> Lösung:<br />
Die Taktart 4/4 schreibt vor, dass pro Takt vier Viertelwerte vorkommen müssen.<br />
Doch der erste und der letzte Takt entsprechen nicht <strong>die</strong>ser Regel: Der erste Takt<br />
hat nur einen Viertel und der letzte deren drei.<br />
Eine Melo<strong>die</strong> muss nicht immer auf Schlag 1 von Takt 1 beginnen. Der<br />
unvollständige Takt zu Beginn eines Stückes ist ein Auftakt.<br />
Ein Auftakt kann aus einer oder mehreren Noten bestehen und hat den Drang, auf<br />
Schlag 1 von Takt 1 zu führen.<br />
Nach den klassischen Notationsregeln muss <strong>die</strong> Summe von Auftakt und Schlusstakt<br />
zusammen einen ganzen Takt ergeben. Das ist bei der Aufgabe korrekt. Es ist heutzutage<br />
aber nicht falsch, wenn bei Stücken mit Auftakt ein kompletter Schlusstakt<br />
geschrieben wird.<br />
Demo - Nicht <strong>für</strong> den Gebrauch!<br />
Hier sind einige Stücke mit Auftakt. Spiele <strong>die</strong>se Liedanfänge<br />
und achte auf den Drang des Auftaktes zu Schlag 1!<br />
Happy Birthday<br />
4<br />
3<br />
& bb f f f f f F f f