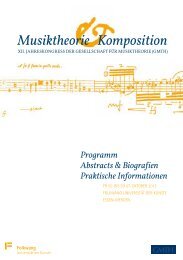Programmheft - GMTH
Programmheft - GMTH
Programmheft - GMTH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Preisverleihung<br />
Samstag, 05.10., 18:00 (Kammermusiksaal)<br />
Hartmut Fladt (Berlin)<br />
›Witz‹ als philosophische, ästhetische und musikalische Kategorie im<br />
18. Jahrhundert<br />
Um 1770 scheint die Kultur des »produktiven Witzes« als »ingenium« (Kant), englisch<br />
›wit‹, weitgehend abgelöst zu sein durch die ›Genie-Kultur‹, zumindest in<br />
der Rangordnung der für die Künste wichtigsten Voraussetzungen, wobei aber dem<br />
›Witz‹ dennoch weiter eine tragende Funktion zugesprochen wird, wie aus Sulzers<br />
Allgemeiner Theorie der schönen Künste zu entnehmen ist. Immanuel Kant bleibt<br />
bis in die 90er Jahre, besonders in der Kritik der Urteilskraft und der Anthropologie<br />
in pragmatischer Hinsicht, seiner bis heute anregenden Definition der Relation<br />
von ›Genie‹ und ›Witz‹ verpflichtet. Das Lachen, nur ein Teilmoment des »produktiven<br />
Witzes«, ist ein »Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten<br />
Erwartung in nichts«. So wird Kants Definition in der Kritik der Urteilskraft oft<br />
zitiert, doch es fehlt da ein wesentliches vorausgehendes Moment, wodurch die<br />
notwendige paradoxale Grundlegung eliminiert ist: »Es muß in allem, was ein lebhaftes,<br />
erschütterndes Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein (woran also<br />
der Verstand an sich kein Wohlgefallen finden kann). Das Lachen ist ein Affekt aus<br />
der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in nichts.«<br />
Drei (knappe) analytische Beiträge (Werke von C.Ph.E. Bach, Haydn und Mozart)<br />
erhellen die zitierten Texte – auch dieser Komponisten –, die von einer sehr lebendigen<br />
intellektuellen Streitkultur in dieser Epoche zeugen. »Es ist mit dem Witz<br />
wie mit der Musik, je mehr man hört, desto feinere Verhältnisse verlangt man.«<br />
(Lichtenberg)<br />
Hartmut Fladt, geb. in Detmold, studierte dort Komposition (Rudolf Kelterborn), in Berlin<br />
Musikwissenschaft, Philosophie, Literaturwissenschaft; Promotion bei Carl Dahlhaus.<br />
Editor bei der Richard-Wagner-Gesamtausgabe (4 Bände). 1981 Professur für Musiktheorie<br />
an der Universität der Künste Berlin, 1996 bis 2000 auch an der Universität für Musik<br />
und darstellende Kunst Wien. Habilitation Musikwissenschaft. Promotionsbetreuungen<br />
Musikwissenschaft. Mentoring-Programm zur Förderung von Hochschullehrerinnen.<br />
Editionsbeirat der Hanns Eisler Gesamtausgabe (HEGA). Gutachter für die Studienstiftung<br />
des Deutschen Volkes, für den österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen<br />
Forschung, für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und in Promotions- und Berufungs-<br />
Verfahren, auch in Urheberrechtsverfahren (u. a. im Fall Bushido).<br />
Ca. 80 Veröffentlichungen über Musik des 13. bis 21. Jahrhunderts, darunter auch<br />
Schulbücher und Populärwissenschaftliches. Kompositionen: Bühnenwerke, Ballettmusiken,<br />
Kammermusik, Lieder, Orchesterwerke, elektroakustische Musik, Chormusik und<br />
›angewandte Musik‹ (Filmmusik, Musikkabarett, Musik für Kinder, Politische Musik).<br />
17