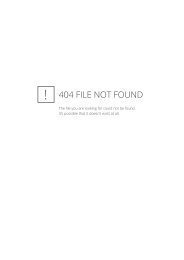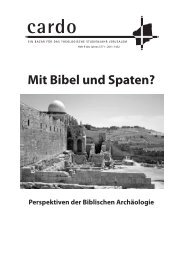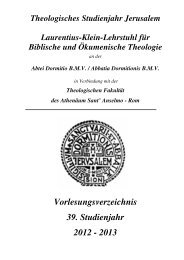Leseprobe - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Leseprobe - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Leseprobe - Theologisches Studienjahr Jerusalem
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einführung in Projekt und Thema 15<br />
miert, den man religionsgeschichtlich als »Zeit des Zweiten Tempels«<br />
bzw. als »Frühjudentum« bezeichnet. Die in den Chronikbüchern<br />
vorgenommene kulttheologische Neuformatierung national-religiöser<br />
Welt- und Selbstwahrnehmung hat nun freilich erhebliche Konsequenzen<br />
im Blick auf die Bewertung des israelitischen Königtums.<br />
Kulminiert die Geschichte Israels nämlich in der Errichtung des<br />
Tempels, so müssen sich die Könige des vormaligen Nord- und Südreiches<br />
an Salomo als dem Erbauer des Ersten Tempels, insbesondere<br />
aber an David als dessen Vordenker und Wegbereiter messen lassen.<br />
Wer unter ihnen dem exklusiven Jahwekult fördernd gegenüberstand,<br />
wird als gottgefällig beschrieben, und sein Königtum wird<br />
Bestand haben, partizipiert es doch am allein ewigen Königtum<br />
JHWHs; wer hingegen in dieser Hinsicht zu Zweifeln Anlaß gegeben<br />
haben mag, verfällt dem Verdikt der Chronisten.<br />
Genau hier erhebt sich jedoch die Frage, ob die chronistische Geschichtsschreibung<br />
als auf die Gegenwart bezogenes »bedeutungsstiftendes<br />
Ordnungshandeln […] im Modus vergangenheitsbezogenen<br />
Erzählens« 12 nicht als theologische Konstruktion von Geschichte anzusehen<br />
ist, der um der Rettung der Unverfügbarkeit Gottes willen<br />
kritisch zu begegnen sei. Den in Marburg lehrenden Bibliker KLAUS<br />
DORN interessiert vor allem diese Frage, weshalb er sich im Unterschied<br />
zu den kanonischen Exegesen von Neuhaus, Gruber und<br />
Steins auf die analytischen Methoden historischer Bibelforschung<br />
stützt, um den diachronen Sinn der von ihm untersuchten Texte zu<br />
eruieren. Anhand der gegenläufigen Geschichten um die Könige<br />
Joschija und Ahab geht Klaus Dorn der Frage nach, ob in theologisch<br />
imprägnierten Geschichtswerken wie denen der Deuteronomisten<br />
bzw. Chronisten tatsächlich die Wahrheit des Gottes Israels<br />
als des Schöpfers von Himmel und Erde an den Tag komme oder ob<br />
man es hier nicht doch zunächst und vor allem mit theokratisch voreingenommener<br />
Theologenrede zu tun habe. Was aber bedeutet<br />
dies für die theologische Gottrede als solche? Muß man zuletzt Gott<br />
als jenes Geheimnis nehmen, über das sich jenseits dessen, was Menschen<br />
intentional von ihm sagen zu dürfen vermeinen, nichts weiteres<br />
mehr sagen läßt? 13<br />
12<br />
13<br />
Knut BACKHAUS: Spielräume der Wahrheit: Zur Konstruktivität in der hellenistischreichsrömischen<br />
Geschichtsschreibung. In: Ders./Gerd Häfner: Historiographie und<br />
fiktionales Erzählen. Zur Konstruktivität in Geschichtstheorie und Exegese. Neukirchen-Vluyn<br />
(2007) 1–29, hier 4.<br />
Erinnert sei hier etwa an Walter BENJAMIN, der dieses Problem auf die aporetische<br />
Formel brachte: »Wahrheit tritt nie in eine Relation und insbesondere in keine intentionale.«<br />
(Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Gesammelte Schriften Bd. I/1.<br />
Frankfurt/M.: stw 931 [1991] 203–430, hier 216.)