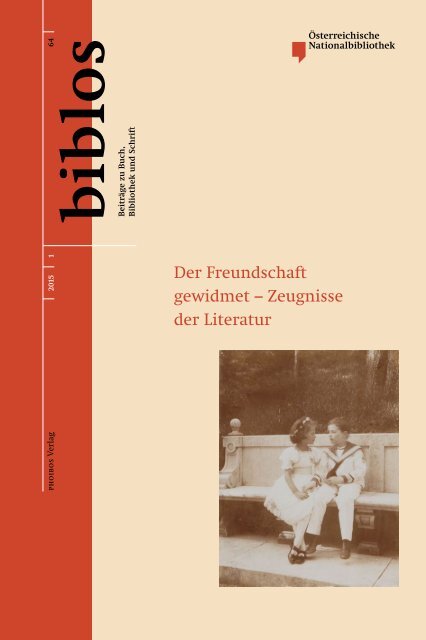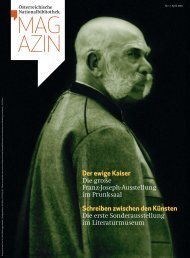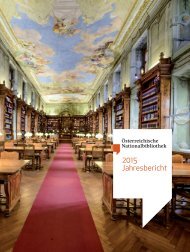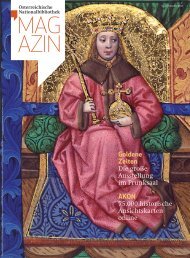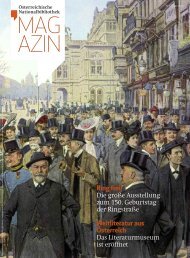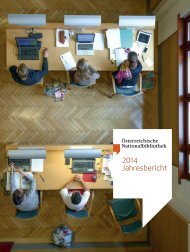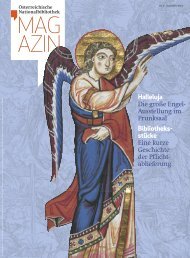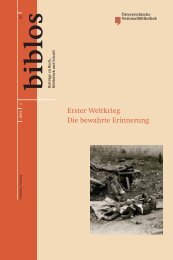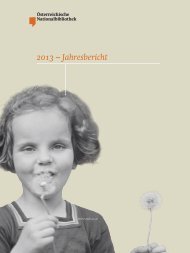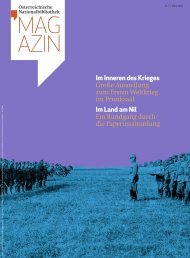Biblos_2015_64.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PHOIBOS Verlag1 64biblosBeiträge zu Buch,Bibliothek und Schrift<strong>2015</strong>Der Freundschaftgewidmet – Zeugnisseder Literatur
PHOIBOS Verlag1 64biblosBeiträge zu Buch,Bibliothek und Schrift<strong>2015</strong>Der Freundschaftgewidmet – Zeugnisseder Literatur
<strong>Biblos</strong>Beiträge zu Buch,Bibliothek und SchriftHerausgegebenvon der ÖsterreichischenNationalbibliothekHerausgeberinDr. Johanna RachingerGeneraldirektorin derÖsterreichischen NationalbibliothekRedaktionsteamAlfred Schmidt (verantwortlicherRedakteur); Michaela Brodl, FranzHalas, Katrin Jilek, Bettina Kann,Monika Kiegler-Griensteidl, DanielaLachs, Gabriele Mauthe, SolveighRumpf-DornerPostanschriftRedaktion <strong>Biblos</strong>Dr. Alfred SchmidtÖsterreichische NationalbibliothekJosefsplatz 1, A-1015 WienVerlagPhoibos Verlag, WienUmschlagbildLudwig Wittgenstein und Inky vonSchneller in Neuwaldegg 1899(Fotoalbum Cod. Ser. n. 37632© ÖsterreichischeNationalbibliothek)MedieninhaberinÖsterreichische NationalbibliothekA-1015 Wien, Josefsplatz 1Herausgeberin:Dr. Johanna Rachinger,<strong>Biblos</strong>, A-1015 Wien, Josefsplatz 1(Österreichische Nationalbibliothek)Auslieferung: Phoibos VerlagAnzengrubergasse 16/9A-1050 WienTel.: (+ 43 1) 544 03 191;Telefax: (+ 43 1) 544 03 199,e-mail: office@phoibos.atBezugsbedingungenJahresabonnement € 45, – (Inland,ohne Versandspesen): Einzelheft€ 25. – (Inland, ohne Versandspesen).<strong>Biblos</strong> erscheint halbjährlich.Wissenschaftliche Arbeiten indeutscher, englischer, französischerund italienischer Sprache, die nochnicht veroffentlicht oder einemanderen Publikationsorgan angebotenwurden, werden zur Veroffentlichungangenommen. Der Nachdruck,auch in Auszügen, bedarf derZustimmung der Herausgeberin bzw.der Redaktion. Manuskripte sind alsWord-Dokument einzusenden.Der gesamte Band ist auch onlinepubliziert unter:http://www.onb.ac.at/biblosDruckPrinted in the EUPrime Rate Kft, Budapest© <strong>2015</strong> by Phoibos Verlag WienISSN 0006-20222ISBN 978-3-85161-131-1
InhaltVanessa Hannesschläger 5Ein Leben, zwei schreiben, eine StadtLiterarische Freundschaften: Ernst Jandl und Friederike MayröckerAlfred Schmidt 15Wittgensteins WidmungenStefan Engl 25Freundschaft über StandesgrenzenMoritz Graf von Dietrichstein und Ignaz von MoselElisabeth Klecker 34Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) PolitikersJohann Benedikt Gentilotti im Stammbuch des Johann Christoph BartensteinKatrin Jilek 52Der Freundschaft gewidmetStammbücher des 16. und 17. Jahrhunderts in der Handschriftensammlungder Österreichischen NationalbibliothekMonika Kiegler-Griensteidl 63FreundschaftsschreibenMusterbriefe aus deutschsprachigen Briefstellern des 17. und 18. Jahrhunderts.Mit einer kurzen EntwicklungsgeschichteSolveigh Rumpf-Dorner 76Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechenBriefmuster und Empfehlungen für Kinder
Inhalt85 Projektberichte aus der Österreichischen Nationalbibliothek85 Achim Hölter und Paul FerstlDie Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre RekonstruktionMit besondererBerücksichtigung der an die K.K. Hofbibliothekverkauften Bestände96 Sonja HotwagnerDie Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like!102 Elisabeth Edith KamenicekWissenschaftliche Erschließung von Nachlassmaterialienzu Ludwig Wittgenstein109 BuchbesprechungenGábor Almási, Farkas GáborKiss: Europa Humanistica –Humanistes du bassin des Carpates.(HU 2 [EH 14]). Humanistes dubassin des Carpates II. JohannesSambucus. Turnhout 2014(Christian Gastgeber)Aleida Assmann, Im Dickicht derZeichen. Berlin <strong>2015</strong>(Franz Halas)Susanne Blumesberger, Handbuchder österreichischen KinderundJugendbuchautorinnen. Band 1:A-K, Band 2: L-Z. Wien u.a. 2014(Gabriele Mauthe)Laurent Cesalli, Janette Friedrich(Hrsg.): Anton Marty & KarlBühler. Between Mind and Language– Zwischen Denken und Sprache– Entre pensée et langage. Basel2014. (Christian Gastgeber)Paolo Cesaretti, Silvia Ronchey(Hrsg.): Eustathii Thessalonicensisexegesis in canonem iambicum pentecostalemRecensuerunt indicibusqueinstruxerunt. Berlin 2014(Christian Gastgeber)Bernhard Hachleitner, IsabellaLechner (Hrsg.): Traumfabrik aufdem Eis. Von der Wiener Eisrevue zuHoliday on Ice. Wien 2014(Gabriele Mauthe)Michael Hagner: Zur Sache desBuches. Göttingen <strong>2015</strong>(Martin Krickl)Ulrike Jenni, Maria Theisen:Mitteleuropäische Schulen IV (ca.1380-1400). Hofwerkstätten KönigWenzels IV. und deren Umkreis.Wien 2014 (Tomáš Gaudek)Reiner Stach: Kafka. Die frühenJahre. Frankfurt a.M. 2014(Alfred Schmidt)130 AutorInnenverzeichnis131 Abbildungsnachweis
VanessaHannesschlägerEin Leben, zwei schreiben, eine StadtLiterarische Freundschaften: Ernst Jandl undFriederike MayröckerAbb. 1: Friedericke Mayröcker, 1972 (Foto E. Jandl)Abb. 2: Ernst Jandl, 1978 (Foto F. Mayröcker)7biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Zwei lebenErnst Jandl, geboren 1925, hat die gemeinhin als solche anerkanntenMeilensteine des bürgerlichen Privatlebens in umgekehrter Reihenfolgeerreicht: Als noch Minderjähriger wurde er, ohne es zu beabsichtigen,Vater einer Tochter, heiratete 1949, allerdings nicht die Mutter seinesKindes und lernte fünf Jahre später die »Frau seines Lebens« kennen,zog bei ihr ein, zog schnell wieder aus. Trotzdem und deshalb ließensich beide, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, von ihren Ehepartnernscheiden und blieben bis zu Jandls Tod im Jahr 2000 allein lebend und ineiner Verbindung, die im Lauf von 46 gemeinsamen Jahren weder institutionalisiertnoch jemals angezweifelt wurde.Friederike Mayröcker wurde im Dezember 1924 geboren und hat damitim vergangenen Jahr das stolze Alter von 90 Jahren erreicht. Sielebt, und das nicht im übertragenen Sinn, in ihrem Schreiben: Umgebenvon Papierstapeln, zwischen denen nur kleine Gänge zur notwendigstenAlltagsausstattung der Wohnung (wie dem Bett) führen und die zuverschieben ihren Gästen verboten ist, schreibt sie unaufhörlich, meistmorgens, jeden Tag. Dass ein Schreiben, das nur aus diesem Papier- undWörterleben entstehen kann, den Alltag einer Lebensgemeinschaft nichtverträgt, ist augenscheinlich. Der nach nur wenigen Monaten unter geteiltemDach gefällten Entscheidung des Paars, ihr gemeinsames Lebenin getrennten Unterkünften zu verbringen, ist es demnach zu verdanken,dass sich ihre in und aus Freiheit gemachten Literaturen und Poetikenzu jenen Meilensteinen der Österreichischen Nachkriegsliteraturentwickeln konnten, die sie sind.Das erste Zusammentreffen Ernst Jandls und Friederike Mayröckerslässt sich dank den im Nachlass des Dichters erhaltenen TaschenkalendernJandls genau datieren: Am 7. Mai 1954 (es war ein Freitag) notierteer um 19 Uhr einen Termin in der Stöbergasse im 5. Bezirk, vermutlicheine Veranstaltung an der Volkshochschule, und vermerkte dazu folgendeNamen: »Jeannie Ebner, Fried. Mayröcker, Herta Kräftner« 1 . Zwei Wochenspäter reiste er zur Jugendkulturwoche nach Innsbruck, wo nebenGerhard Rühm 2 auch Mayröcker zugegen war; damit begann das wohl»schönste und interessanteste Beispiel einer sehr persönlichen Beziehung einer Dichterinmit einem Dichter, die in der Literaturgeschichte kaum eine Parallele kennt« 3 ,wie es der spätere Intimfreund und Reisepartner des Paares WendelinSchmidt-Dengler formulierte.Beide Schreibenden waren zu diesem Zeitpunkt mit Nicht-Schreibendenverheiratet und hauptberuflich als Schullehrende tätig. Diese Umständewaren es auch, die Jandl den damals radikalsten avantgardistischenSchriftstellern Österreichs, die sich zu dieser Zeit zur wiener gruppezusammenfanden, zu bieder erscheinen ließen. Mayröckers Ruf dagegenblieb von ihrem bürgerlichen Lebensmodell jener Zeit unbeschadet: »Gutwie Mayröcker« 4 war unter den Avantgardisten der 1950er Jahre ein Ausdruckhöchster Anerkennung. Mit ihnen stand die Dichterin über ihreenge Freundschaft zu Andreas Okopenko bereits in Austausch, noch bevorsie Ernst Jandl kennenlernte. 5 Ihr Schreiben fügte sich in die experimentellenStrömungen jener Jahre, in die sich auch Jandl zur Zeit desKennenlernens einzugliedern versuchte. Gemeinsam knüpfte das Paardie Kontakte zu den experimentellen Wienern in den Folgejahren enger.Obwohl die wiener gruppe eigentlich nur fünf Mitglieder hatte (Friedrich8biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Achleitner, H. C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und OswaldWiener), werden Jandl und Mayröcker in diversen Publikationen 6 immerwieder als Mitglieder der Gruppe angeführt; de facto versuchte vor allemJandl intensiv, »Mitglied« dieser lose verbundenen Formation zu werden,was ihm aber aufgrund seines »bürgerlichen« Auftretens nicht gelang.Auch der politischen Dimension von Jandls Dichtung, die im SchreibenMayröckers keine Rolle spielte, wurde vor allem von Gerhard Rühm kritischbis ablehnend begegnet.Eine Reminiszenz an diese Lebensphase, so darf man meinen, stellendie beiden Jandlschen Gedichte fritzi & the broom. a play und gerhard undder wolf dar, die beide am 28. Juli 1969 entstanden sind und einander imGedichtband der künstliche baum gegenüberstehen. 7 Friederike Mayröckerund Gerhard Rühm treten sichtlich als Akteure auf, erstere kehrt einezerbrochene Vase auf, letzterer labt sich in Anwesenheit eines immerwieder RÜHM rufenden Wolfs 8 an RAHM und RUM. Die experimentelleForm der beiden Texte weist ebenfalls in die zweite Hälfte der 1950erJahre, in der Jandl viel Zeit mit Mayröcker und den Wiener Avantgarde-Schriftstellern zu verbringen begann und das experimentelle Dichtenerst für sich entdeckte.Trotz der frühen und aufrichtigen Anerkennung der Radikalen fürdas in den frühen 1950er Jahren noch näher an der Konvention entlangsich bewegende Schreiben Mayröckers gelang der Durchbruch bei einembreiteren Publikum vorerst noch nicht. Ihr erstes Buch Larifari. Ein konfusesBuch erschien 1956, im selben Jahr wie Jandls ebenfalls erster GedichtbandAndere Augen – beide Werke erzeugten kaum Resonanz. AuchJandl trat in seinem Band mit konventionellen, von Brecht inspiriertenGedichten an die Öffentlichkeit, doch wirkliche Aufmerksamkeit erregteer erst im folgenden Jahr: Seine erste Publikation experimenteller Gedichtein der Zeitschrift Neue Wege, die sich in erster Linie an Schulkinderund ihre Lehrenden richtete, löste einen veritablen Skandal 9 aus. JandlsTexte teilten sich die Seite dabei mit Arbeiten von Gerhard Rühm – hierzeigt sich abermals die enge Verbindung des zu diesem Zeitpunkt schonwieder getrennt lebenden Paares zur radikalen Wiener Literatur.Entgegen dem Vorwurf der Bürgerlichkeit, mit dem speziell Jandl zukämpfen hatte, gelang ihm und Mayröcker keine »geordnete« Lebensführungmiteinander. Nachdem sich beide hatten scheiden lassen, zogen sie1956, im Jahr ihrer ersten Bücher, zusammen – bald darauf verließ Jandldie gemeinsame Wohnstätte aber wieder, in und von der er sich beengtgefühlt hatte. 10 Ihre gemeinsame Zeit verbrachten die Schreibenden daraufhinhauptsächlich in Jandls Wohnung; – das suggerieren die zahlreichenFotos, die die beiden über die Jahre dort voneinander gemachthaben (vgl. Abb. 1, 2 und 3). In ihrer beider Stadt Wien lebten Jandl undMayröcker jedenfalls nie wieder unter einem Dach, 11 das Telefon ersetztein den folgenden 44 Jahren den gemeinsamen Wohnungsschlüssel. Inder Sommerzeit teilten sie allerdings ein Domizil, meist in Rohrmoosin der Steiermark. Mehrere skizzen aus rohrmoos 12 verfasste Jandl in den1980er Jahren; jene aus dem Jahr 1982 widmete er (wie auch zahlreicheandere Gedichte, und das gilt natürlich auch umgekehrt) Friederike Mayröcker.Einige Ausschnitte daraus geben einen Eindruck davon, wie sichein solcher gemeinsamer Sommer gestaltete: »seient ihr / spazierengänger?/ ich gehabt haben / einen hirschenfänger.« »ich ginge ja gern mit dir mit / wenn du9biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Abb. 3: FriederickeMayröcker, 1997(Foto: E. Jandl)hinunter gehst in den ort / aber das hier heroben ist der ort / des stuhls auf dem ichsitze / und des tisches mit meiner maschine / und außerdem ist da noch die sache/ mit meinen füßen«, »zwei gläschen / ohne schnaps // abgereist / ist der freund«,»ihre schritte / die treppe / abwärts // schnaps / in ihrem / becher // sie hat / darangenippt«. Im folgenden Jahr hielt Jandl fest, welch große Bedeutung diesenSommern zu zweit in der Biographie des Paares zukam: »rohrmoos,der ort, zieht durch mein leben sich / als sommer, deren jeder keinem glich / obgleichvergleichbar bleibt, daß immer sie und ich / nie einer einzeln nach rohrmoos entwich/ vor sommer in der stadt«.Ein SchreibenLiterarische Zusammenarbeit zwischen Friederike Mayröcker und ErnstJandl fand vor allem in ihren frühen gemeinsamen Jahren statt, dochschon von Anfang an waren beide zurückhaltend, was das Ausmaß derKollaboration betraf. Zeitlebens lasen sie die Texte des jeweils anderenund standen einander als erste und ernste Kritiker zur Verfügung – obwohlauch dieser konstruktive Austausch mit den Jahren abnahm. 13 Nurpunktuell machten sie sich an gemeinsame Projekte, deren erstes sienicht veröffentlichten: Die Montage guten abend 14 (vgl Abb. 4) war ein Experimentim Geist der wiener gruppe und entstand in jener Zeit, in der Jandl/Mayröcker engen Kontakt zu dieser knüpften. Am 26. Mai 1957 schriebendie beiden diesen Text, der ihnen jedoch offenbar nicht gut genug gefiel,um ihn zu publizieren. Am nächsten Tag probierten sie es noch einmal– diesmal gelang die schlicht so betitelte gemeinschaftsarbeit 15 . Friederike10biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Abb. 4: Typoskript der Montage »guten abend«;ÖNB, Literaturarchiv (derzeit Literaturmuseum)11biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Mayröcker über diese erste Phase einer gemeinsamen Produktion: »Freilicherwies sich damals die Verschiedenheit der poetischen Standpunkte als ein kaum überwindbaresHindernis. Erst eine gewisse Annäherung der beiden poetischen Zentren,welche nicht so sehr durch formale Angleichung erfolgte, als durch die Entdeckung,daß beide im gleichen Feld lagen, nämlich dem der experimentellen Poesie, verspracheine erfolgreiche Zusammenarbeit.« 16 Die experimentelle Methode wurde fürdas Schreiben sowohl Jandls als auch Mayröckers gerade in jener Zeit wesentlich,in der sie ein junges Paar waren – das gemeinsame Abenteuer desErforschens und Entdeckens neuer Formen mag die Beziehung auch aufder persönlichen Ebene gestärkt und vertieft haben.Eine Gemeinschaftsarbeit war es auch, die Mayröcker/Jandl ihrenjeweils ersten und den einzigen gemeinsamen Preis eintrug: Das 1967entstandene Stereo-Hörspiel Fünf Mann Menschen wurde 1969 mit demHörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Das Hörspiel war jeneLiteraturgattung, in der Jandl/Mayröcker die meisten Zusammenarbeitenumsetzten: Noch im selben Jahr wie Fünf Mann Menschen entstandDer Gigant, im Jahr der Preisverleihung und vielleicht von dieser angeregtschrieb das Duo mit Spaltungen und Gemeinsame Kindheit zwei weitereHörspiele. »›hörspiel‹ ist ein doppelter Imperativ« 17 , hielten Mayröcker undJandl in ihren ebenfalls gemeinsam verfassten Anmerkungen zum Hörspielfest. Diese doppelte Anweisung macht vielleicht auch die Verdoppelungder Verfassenden notwendig, deren einer hörend eine passive Rolle einnimmt,während der andere spielt; diesen Gedanken drückte SiegfriedJ. Schmidt mit seinem Hinweis auf Ernst Jandls Formulierung aus, er»hätte diese vier Hörspiele ohne Friederike Mayröcker nicht gemacht.« 18 Dem stehtentgegen, wie Jandl diese »Gemeinschaftsarbeit« in der Dankrede zum Hörspielpreisbeschrieb: »ein Text, der dazu bestimmt war, als Hörspiel von mehrerenSprechern gesprochen zu werden, entstand im Zwiegespräch; die Vertrautheitder beiden Autoren miteinander sicherte die nötige Leichtigkeit – es gab keineScheu, irgend etwas zu sagen – und zugleich die nötige Kontrolle – es gab keineScheu, zu kritisieren und zu verwerfen.« 19 Friederike Mayröcker ergänzte, daszu zweit verfasste Hörspiel sei ein »erfrischendes Zwischenspiel, nach mancherhärteren, weniger hellen, geheimnisvolleren Phase der Arbeit für sich selbst« 20 .Ein zu Kunst verwandeltes Abbild ihrer Zusammenarbeit haben die»Liebesfreunde« 21 Mayröcker und Jandl mit Gemeinsame Kindheit erschaffen,einem Dialog zwischen den Figuren Mann (M) und Frau (F) über eine Kindheit,die sie vielleicht gemeinsam verbracht haben und einen Text, densie darüber gerade gemeinsam schreiben: »M: also das Generalthema ist ›GemeinsameKindheit‹ / F: Sandkasten, etc / M: das ganze ist ja eine Fiktion – / weilwir ja keine / F: insofern keine Fiktion – / als wir im Belvedere vielleicht / oder imSchweizergarten – / M: ich hab nie mit jemand anderem gespielt« 22 . In seinemKommentar zu Friederike Mayröckers Hörspiel »Zwölf Häuser – oder: Möwenpink«hat Jandl diesen Text als »eine Art innere[n] Monolog mit gelegentlichenhalluzinatorischen Abschweifungen« 23 bezeichnet; ähnlich funktioniertdie im zeitlichen Umfeld von Möwenpink entstandene Gemeinsame Kindheit.Dort sind die »halluzinatorischen Abschweifungen« die Erinnerungssequenzen,die das Gespräch zwischen Mann und Frau immer wieder unterbrechen.Das Verhältnis von Realität und Fiktionalität dieses sichtlichaus einem Gespräch der beiden Schreibenden entstandenen Texts ist dabeizentrales Thema: »F: SANDKASTEN! / M: hatten wir das nicht schon mal?/ F: das ist ein Spiel / M: das hieße ja / es wird nichts andres gemacht / als diese12biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Vorstellung, diese Fiktion / von der gemeinsamen Kindheit / auf die Probe / zu stellen«24 . Die Thematisierung der Schreibsituation des im Entstehen befindlichenTexts trägt zur »objektivierung / im sinne der zerstörung von illusion« 25bei, wie Jandl später in seinem Stück Aus der Fremde formulierte, in demer zu diesem Zweck neben dem durchgängig verwendeten Konjunktivebenfalls jene in Gemeinsame Kindheit mit Mayröcker entwickelte Praxiszum Einsatz brachte. Dass nicht nur gemeinsam entwickelte Methoden,sondern auch der jeweils andere als Figur in zahlreichen Texten der beidenSchreibenden wesentlich wurden, liegt bei solch einer Lebensverbindungnahe und wurde von Klaus Kastberger anhand von MayröckersReise durch die Nacht und Jandls Aus der Fremde im Detail gezeigt, 26 zweiPaartexten, in denen auch die Figur des Dritten zentral (jedoch nichtdazwischen) mitspielt.Zu dritt auf die Probe stellten Jandl und Mayröcker auch das MediumFernsehen, als sie in den beginnenden 1970er Jahren gemeinsammit Heinz von Cramer den Film Traube schufen. Diese Arbeit ist einweiteres Beispiel dafür, dass Mayröcker und Jandl auf künstlerischerEbene dann am besten zusammenarbeiteten, wenn es darum ging, Gattungskonventionenund Methodik zu reflektieren, zu thematisierenund schließlich zu brechen. Das legt nahe, dass sich die gemeinsamenProjekte des Paars zu wesentlichen Teilen aus theoretischen Debattenheraus entwickelten – wie auch die Gemeinsame Kindheit illustriert. Traubesetzten Mayröcker und Jandl dann zu dritt mit dem Hörspielregisseurvon Cramer um, wobei »für den Film alle drei als Urheber zeichnen, ohne Trennungin Drehbuch und Regie« 27 . Noch eine zweite Arbeit haben Jandl undMayröcker zu dritt erarbeitet – die wie jene früher erwähnten, zu zweitverfassten Montagen in den 1950ern entstanden ist. Der Dritte im Bundewar in diesem Fall der gemeinsame Freund Andreas Okopenko. SeineAusführungen zu diesem erst Jahrzehnte später, wiederum schlichtunter dem Titel Gemeinschaftsarbeit publizierten Text 28 erinnern an dieDarstellungen Gerhard Rühms zur Arbeitsweise der wiener gruppe 29 : »Daging es reihum, jeder von uns drei abwechselnd einen Satz, mit dem er an denVor-Satz des Anderen anknüpfte. Es resultierte, von mir zunächst stenographiert,später reingeschrieben, ein 3-4 Seiten langes, recht lustiges Manuskript, in demjeder Urheber trotz allem Kollektivismus wie ein grüner Hund zu erkennen war.« 30Diese experimentelle Gruppenarbeit dürfte nicht die einzige gewesensein, die Jandl/Mayröcker/Okopenko in den 1950er Jahren als Trio verfassten,31 zur Publikation erschienen ihnen die Gemeinschaftswerke allerdingszum damaligen Zeitpunkt nicht geeignet.Zwei StädteWenngleich die Avantgarde mit der wiener gruppe auch in der Bundeshauptstadtein festes Standbein hatte, geschah progressive Literatur aufbreiterer und zunehmend auch vorsichtig institutionalisierter Ebene inÖsterreich andernorts: Mit dem Kulturzentrum Forum Stadtpark und derLiteraturzeitschrift manuskripte bot Graz seit dem Ende der 1950er Jahrejungen, mit neuen Formen arbeitenden Schreibenden wie zum BeispielBarbara Frischmuth, Wolfgang Bauer oder Peter Handke Möglichkeiten,Fuß zu fassen. Auch die fortschrittlichen Wiener Literaten wandten sichbald der Steirischen Literaturstadt zu; in den manuskripten wurde etwader wiener gruppe eine Publikationsmöglichkeit gegeben. Auch für die13biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
internationale konkrete Poesie, etwa jene der »Stuttgarter Gruppe« umMax Bense, war die Zeitschrift einer der allerersten Erscheinungsorte inÖsterreich. Alfred Kolleritsch war (und ist noch heute) ihr Herausgeber;an ihn wandte sich Jandl 1963 mit seinen villgratener texten, die im selbenJahr in Heft 9 erschienen. Bald darauf reisten Jandl und Mayröcker erstmalszu einer Veranstaltung des Forum Stadtpark nach Graz – die privateund professionelle Freundschaft, die sie ab diesem Zeitpunkt mit Kolleritschpflegten, hielt und hält drei Leben lang. Mayröckers erste Textein den manuskripten erschienen 1965 in Heft 13; zu ihrem 90. Geburtstagwurde ihr kürzlich Heft 206 gewidmet.Neben dem lebenslangen Nebeneinandersein im Leben und Literarischengab es bei Jandl/Mayröcker eine literaturpolitische Gemeinsamkeit,auf die der Titel »Gemeinschaftsarbeit« vielleicht noch weit mehr zutrifftals auf alle literarische und künstlerische Produktion, die die Namen beiderSchreibenden trägt. Das gemeinsame kulturpolitische Engagementder beiden führte zum einschneidendsten Ereignis des österreichischenLiteraturbetriebs nach 1945 – das bezeichnenderweise von Graz aus eingeleitetwurde. Den folgenreichen Brief aus dem Jahr 1973, der dazu führte,haben Jandl und Mayröcker im Dreigespann mit Alfred Kolleritschmit »freundschaftlichen Grüßen« unterzeichnet. Der Briefkopf ist jener desGrazer Forums Stadtpark, die Folge die Gründung der Grazer Autorenversammlung.Dort heißt es: »Zur Diskussion steht u.a. die Frage der Gründung eineszweiten, autonomen österreichischen PEN – Zentrums. Wir bitten Euch daherdringend, an dem am 24. und 25. Februar 1973 im Forum Stadtpark Graz stattfindendenTreffen teilzunehmen, zu dem die auf der beiliegenden Liste angeführtenAutoren, Aktionisten und Filmemacher eingeladen sind.« 32 Vorangegangen warendem Schreiben aus Graz intensive Sondierungsgespräche in Wien, dienach dem Paukenschlag der von Jandl am 22. Oktober 1972 verfasstenund verlesenen 33 PEN-kritischen Grazer Erklärung einsetzten. Diese Vorarbeitenunternahmen, wie Jandls Aufstellung der im Vorfeld der Gründungder Autorenversammlung geführten »inoffiziellen Gespräche« 34 zeigt, erund Mayröcker sämtlich gemeinsam. Sie war es auch, die in diesem KontextKorrespondenzen mit Robert Neumann und Hilde Spiel führte. 35 Diewichtige Rolle Mayröckers für die Gründung der mittlerweile umgetauftenGrazer Autorinnen Autorenversammlung zwischen dem Mann aus Wien– Ernst Jandl – und dem Mann aus Graz – Alfred Kolleritsch – wird beimErzählen der Geschichte dieser Vereinigung zuweilen vernachlässigt.Ernst Jandl aber wusste um alles, was Friederike Mayröcker leisteteund bewegte. 1975 schrieb er für Gerhard Kleindls Film über FriederikeMayröcker »Oh Scirocco nimm mich auf deine Zunge«: »Alles, in diesen letzten20 Jahren, danke ich ihr. So die Erkenntnis, daß der einzige Vorteil, ein Mann zusein, der ist: daß er im Stehen pissen kann. Sie ist vollkommen emanzipiert, nichtauf stupide Suffragettenart, und ich habe es von ihr gelernt. Emanzipation, dasheißt: Emanzipation des Menschen, durch Beseitigung, jeder für sich selbst, der humanoidenModelle des Konsumschweins zur rechten, des Politschweins zur linken,zwischen denen das Leben der meisten eingeklemmt ist.« 36 Als Beleg dafür, dasssich Jandls Verständnis von und für Frauen-Emanzipation nicht ganz soprogressiv gestaltete wie seine Poetik, wird vielfach 37 ein bestimmtes Gedichtvon Friederike Mayröcker angeführt – und mit diesem sei ihr auchan dieser Stelle das letzte Wort erteilt: »du bist der Herr / ich bin der Knecht /ich bin ein Tragtier auch / (zurecht)« 3814biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
1 ÖNB, Literaturarchiv,Nachlass Ernst Jandl. Dankfür diesen Hinweis gilt HannesSchweiger.2 K. Siblewski, a kommapunkt ernst jandl. Ein Leben inTexten und Bildern. München:Luchterhand 2000, 96.3 W. Schmidt-Dengler,Bruchlinien II. Vorlesungen zurösterreichischen Literatur 1990bis 2008, hg. von JohannSonnleitner. St. Pölten, Salzburg,Wien: Residenz 2012,195.4 K. Siblewski, a kommapunkt ernst jandl (Anm. 2), 75.5 F. Mayröcker in: M.Beyer, Nachwort, in: E.Jandl, F. Mayröcker, A. Okopenko,Gemeinschaftsarbeit(=experimentelle texte 21),hg. von Marcel Beyer. Siegen1989, 13-17, 16.6 Etwa The Vienna Group.H.C. Artmann, Ernst Jandl,Friederike Mayröcker, GerhardRühm, Friedrich Achleitner, KonradBayer. Six major Austrianpoets. Translated and editedby Rosemary Waldrop andHarriett Watts, Station hillpress 1985; aber auch V.Auffermann et al., Leidenschaften:99 Autorinnen derWeltliteratur. München: btb2013.7 E. Jandl, der künstlichebaum. flöda und der schwan(= poetische werke 4). München:Luchterhand 1997, 98& 99.8 Jandl spielt mit diesemGedicht auf die ZOCK-Bewegung der 1960er Jahrean, eine Art »Nachfolgeinstitution«der wiener gruppe:Gerhard Rühms Pseudonymbei seinem Auftrittbeim ZOCK-Fest (1967) warGUSTAV WERWOLF. Vgl. T.Eder, Unterschiedenes ist / gut.Reinhard Priessnitz und dieRepoetisierung der Avantgarde.München: Wilhelm Fink2003, 172ff.9 G. Rühm, vorwort,in: Ders. (Hrsg.), Die WienerGruppe. Achleitner ArtmannBayer Rühm Wiener. TexteGemeinschaftsarbeiten Aktionen.Reinbek bei Hamburg:Rowohlt 1967, 5-36, 24.10 Ernst Jandl vernetzt.Multimediale Wege durch einSchreibleben [Daten-DVD],zusammengestellt undkommentiert von HannesSchweiger. Wien: ZONEMedia 2010.11 Das stimmt nichtganz: Zwar teilten Jandl undMayröcker nie wieder eineWohnung, in Jandls letztenJahren zog er allerdings»unter ihr Dach«, nämlich ineine Wohnung in dem Haus,in dem Mayröcker auchheute noch lebt.12 E. Jandl, idyllen. stanzen(= poetische werke 9). München:Luchterhand 1997,140-151.13 G. Marko, SchreibendePaare. Liebe, Freundschaft, Konkurrenz.Zürich, Düsseldorf:Artemis & Winkler 1995,433-453.14 Zu sehen ist diesesTyposkript in der Dauerausstellungdes neu eröffnetenLiteraturmuseums derÖsterreichischen Nationalbibliothek.15 E. Jandl, Andere Augen.verstreute gedichte 1. deutschesgedicht (= poetische werke1). München: Luchterhand1997, 143f.16 F. Mayröcker in:E. Jandl, F. Mayröcker, Redeanläßlich der Verleihungdes Hörspielpreises derKriegsblinden am 22.April 69, in: E. Jandl, Autorin Gesellschaft. Aufsätze undReden (= Poetische Werke11). München: Luchterhand1999, 293-297, 293.17 E. Jandl, F. Mayröcker,Anmerkungen zum Hörspiel,in: E. Jandl, Autor inGesellschaft (Anm. 16), 54-56,54.18 S. Schmidt,Gemeinschaft(s)Arbeit:Ernst Jandl und FriederikeMayröcker, in: K. Siblewski(Hrsg.), Ernst Jandl. Texte,Daten, Bilder. Frankfurt/M.:Luchterhand 1990, 143-152,144.19 E. Jandl in: E. Jandl,F. Mayröcker, Rede anläßlichder Verleihung des Hörspielpreisesder Kriegsblinden15biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
am 22. April 69 (Anm. 16),295f.20 F. Mayröcker ebd., 296.21 G. Marko, SchreibendePaare (Anm. 13), 453.22 E. Jandl, F. Mayröcker,Gemeinsame Kindheit, in:E. Jandl, Gesammelte Werke.Dritter Band. Stücke und Prosa.Darmstadt, Neuwied: Luchterhand1985, 75-105, 79.23 E. Jandl, Zu FriederikeMayröckers Hörspiel »ZwölfHäuser – oder: Möwenpink«,in: Ders., Autor in Gesellschaft(Anm. 16), 57-59, 58.24 E. Jandl, F. Mayröcker,Gemeinsame Kindheit(Anm. 22), 91f.25 E. Jandl, Aus der Fremde.Sprechoper in 7 Szenen,in: Ders., peter und die kuh.die humanisten. Aus der Fremde(= poetische werke 10). München:Luchterhand 1997,177-258, 223.26 K. Kastberger, Vomvom zum zum. Mayröckerbei Jandl und umgekehrt,in: B. Fetz, H. Schweiger(Hrsg.), Ernst Jandl. MusikRhythmus Radikale Dichtung(= Profile 12). Wien: Zsolnay2005, 158-179.27 E. Jandl, F. Mayröcker,Brief vom 25.1.1970 an HartwigSchmidt (WDR), ÖNB,Literaturarchiv, NachlassErnst Jandl, zit. nach C.Blümlinger, Traube – einVersuch über audiovisuelleSprache, in: B. Fetz, H.Schweiger (Hrsg.), Die ErnstJandl Show. St. Pölten, Salzburg,Wien: Wien Museum /Residenz Verlag 2010, 83-91,83.28 E. Jandl, F. Mayröcker,A. Okopenko, Gemeinschaftsarbeit(Anm. 5).29 G. Rühm in: V. Hannesschläger,D. Srienc, Derblaue Gott. Gerhard Rühmim Gespräch über KonradBayer und sich selbst, in:T. Eder, K. Kastberger, D.Srienc (Hrsg.), Konrad Bayer.Texte, Bilder, Sounds (= Profile22). Wien: Zsolnay <strong>2015</strong>, 253-266, 260f.30 A. Okopenko, Briefvom 23.6.1987 an MarcelBeyer, zit. nach M. Beyer,Nachwort, in: E. Jandl, F.Mayröcker, A. Okopenko,Gemeinschaftsarbeit (Anm. 5),13-17, 14.31 M. Beyer, Nachwort(Anm. 30).32 E. Jandl, F. Mayröcker,A. Kolleritsch, Brief vom22.1.1973 an div. österreichischeKunstschaffende, ÖNB,Literaturarchiv, NachlassErnst Jandl.33 R. Innerhofer, DieGrazer Autorenversammlung(1973-1983). Zur Organisation einer»Avantgarde«. Wien, Köln,Graz: Böhlau 1985, 25.34 E. Jandl, Aufstellungder im Vorfeld der Gründungder Grazer Autorenversammlunggeführten Gespräche,ÖNB, Literaturarchiv,Nachlass Ernst Jandl.35 Vgl. R. Neumann, Briefvom 5.12.1972 an FriederikeMayröcker, und H. Spiel,Brief vom 19.12.1972 anFriederike Mayröcker, ÖNB,Literaturarchiv, NachlassErnst Jandl. Siehe auch R.Innerhofer, Die Grazer Autorenversammlung(Anm. 33),30.36 E. Jandl, Selbst mitFünfzig. Für GerhardKleindls Film FRIEDERIKEMAYRÖCKER, 12.10.1975,ÖNB, Literaturarchiv, NachlassErnst Jandl, zit. nachdem Typoskriptfaksimile inB. Fetz, H. Schweiger (Hrsg.),Die Ernst Jandl Show (Anm.27), 98.37 z.B. K. Kastberger, Vomvom zum zum (Anm. 26),176.38 F. Mayröcker, GesammelteGedichte 1939-2003,hg. von Marcel Beyer.Frankfurt/M.: Suhrkamp2004, 425.16biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Vanessa Hannesschläger • Ein Leben, zwei schreiben, eine Stadt | 5–14
Alfred SchmidtWittgensteins Widmungen»Gewidmet sind diese Schriften eigentlich meinenFreunden. Wenn ich sie ihnen nicht förmlich widme,so ist es darum, weil die meisten von ihnen sienicht lesen werden.«(L. Wittgenstein, Manuskript 117, S.116)Abb. 1: Ludwig Wittgenstein, Aufnahme von Moritz Nähr um 1930(Pf 42.805 : C (1))17biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Persönliche Widmungen eigener Werke sind stets Ausdruck einer besonderenWertschätzung bzw. emotionalen Verbundenheit des Autorszum Widmungsempfänger.Ludwig Wittgenstein widmet sein einziges zu Lebzeiten publiziertesphilosophische Werk, den Tractatus logico-philosophicus, seinem damalsengsten Freund David Hume Pinsent, der 1918 kurz vor der Fertigstellungdieses Werkes als Testpilot der Royal Airforce tödlich verunglückte.In den 30er Jahren arbeitete Wittgenstein in immer neuen Versuchen aneiner Gesamtdarstellung seiner Philosophie – einen davon beabsichtigeer seinem Schüler und persönlichen Freund Francis Skinner zu widmen.Widmungen wie im Typoskript 202 der Logisch-Philosophischen Abhandlungan Paul Engelmann und zwei weitere an seine Schwester Margarte sindals Geschenk-Widmungen der jeweiligen Manuskript-Bände zu verstehen.1 Der folgende Artikel beschäftigt sich mit diesen Widmungen Wittgensteins,– nicht berücksichtigt sind Geschenk-Widmungen Wittgensteinsin Werken anderer AutorInnen.Persönliche Widmungen finden sich in folgenden Schriften:• Im Manuskript 104, der handschriftlichen Urfassung derLogisch-Philosophischen Abhandlung (später publiziert unter demTitel Prototractatus 2 ) an David H. Pinsent• im Typoskript 202, dem sog. Engelmann-Typoskript, wie auch imTs 204, dem Gmundner Typyoskript der Logisch-PhilosophischenAbhandlung ebenfalls an David H. Pinsent• im Manuskript 114 Philosophische Grammatik an Francis Skinner(diese Widmung ist allerdings nicht auf diesen Manuskriptbandselbst bezogen, sondern auf ein nie erschienenes Werk)• eine allgemeine Widmung »an meine Freunde« in einem Vorwortentwurfin Manuskript 117 (siehe das einleitende Motto oben)• in einem Exemplar des Blauen Buchs an seine Schwester Margarethe• und im Manuskript 142, der Urfassung der PhilosophischenUntersuchungen ebenfalls an seine Schwester Margarethe.Die Widmungen der Logisch-Philosophischen AbhandlungDas sog Engelmann-Typoskript der Logische-Philosophischen Abhandlung (Ts202), heute in der Bodleian Library in Oxford (MS. German d. 6), ist einbesonders interessantes Beispiel, weil es eine doppelte Widmung enthält:• eine Werk-Widmung an seinen 1918 tödlich verunglückten FreundDavid H. Pinsent, die sich bereits in der handschriftlichen Vorstufedieses Werkes, dem Prototractatus (Ms 104) findet und ebenso in derGmundner Fassung der Abhandlung (Ts 204) 3 .• und eine handschriftliche Geschenk-Widmung des Typoskripts anseinen Freund Paul Engelmann.Die Widmung an David Pinsent ist Ausdruck einer engen Freundschaftund gleichzeitig von Wittgensteins tiefer Erschütterung über den Todseines Jugendfreundes bei einem Testflugs der Royal Air Force am 8. Mai1918 in Farnborough. Ludwig Wittgenstein lernte den MathematikstudentenDavid Pinsent in Frühjahr 1912 bei den regelmäßigen Studententreffenin Bertrand Russells Wohnung in Cambridge kennen 4 . Späterstellte sich Pinsent auch als Testperson für Wittgensteins psychologischeExperimente zur Rhythmuswahrnehmung in der Musik zur Verfügung5 . Beide verband eine große Begeisterung für die Musik. In den18biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Abb. 2: Widmung an DavidPinsent im sog. »Prototractaus«(Ms 104) (Mit freundlicherErlaubnis der Bodleian LibraryOxford, in deren Besitz sichdas Manuskript befindet.)Abb. 3: Titelblatt der Logisch-Philosophischen Abhandlung mit der Widmung anPaul Engelmann im Ts 202 (Mit freundlicher Erlaubnis der Bodleian Library Oxford,in deren Besitz sich das Typoskript befindet.)19biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Sommerferien 1912 unternahmen sie auf Wittgensteins Vorschlag einegemeinsame Islandreise, im darauf folgenden Sommer eine Reise nachNorwegen 6 . Eine weitere geplante Ferienreise nach Andorra im Sommer1914 verhinderte der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In den folgendenJahren blieben sie brieflich in Kontakt 7 – beide im Dienst nunmehr feindlicherArmeen. Wittgenstein erfährt vom Tod seines Freundes in einemBrief von David Pinsents Mutter Ellen vom 6. Juli 1918 8 , – zu einem Zeitpunkt,als der Prototractatus (Ms 104) vermutlich die letzte Überarbeitungerfuhr oder bereits abgeschlossen war. Tief betroffen antwortet Wittgensteinmit folgendem berührenden Brief, in dem er auch die beabsichtigteWidmung seiner Logisch-Philosophischen Abhandlung an seinen Freundbereits erwähnt:»Most honoured, dear, gracious Lady,Today I received your kind letter with the sad news of David’s death. David wasmy first and my only friend. I have indeed known many young men of my own ageand have been on good terms with some, but only in him did I find a real friend, thehours I have spent with him have been the best in my life, he was to me a brotherand a friend. Daily I have thought of him and have longed to see him again. Godwill bless him. If I live to see the end of the war I will come and see you and we willtalk of David.One more thing, I have just finished the philosophic work on which I was alreadyat work at Cambridge. I had always hoped to be able to show it to him sometime,and it will always be connected with him in my mind. I will dedicate it to David’smemory. For he always took great interest in it, and it is to him I owe far the mostpart of the happy moods which made it possible for me to work. Will you please sayto Mr Pinsent and to Miss Hester how very deeply I sympathise with them in theirloss. I shall never forget the dear one so long as I live, nor shall I forget you whowere nearest to him.Yours true and thankfulL.W.« 9Die Widmung an David Pinsent »Dem Andenken meines Freundes DavidH. Pinsent gewidmet« notiert Wittgenstein handschriftlich bereits im Prototractatus,Sie wird geleichlautend ins Typoskript 202 und 204 (nichtjedoch in Typoskript 203) übernommen. Außerdem findet sie sich wortgleichauch in der ersten Publikation der Logisch-hilosophischen Abhandlungim Band XIV.(1921) der Annalen der Naturphilosophie wie auch in derzweisprachigen Ausgabe London 1922, nunmehr unter dem bekannterenTitel Tractaus logico-philosophicus.Die näheren Umstände der zweiten Widmung im Typoskript 202, jenean Paul Engelmann, dem Wittgenstein das Typoskript als Geschenk widmet,bleiben hingegen im Dunklen. Wittgensteins lebenslange Freundschaftmit Engelmann geht zurück auf seine Stationierung in Olmützim Herbst 1916, wo er Engelmann über Vermittlung seines Lehrers AdolfLoos kennen lernte. Der genaue Zeitpunkt der Widmung und der Schenkungan Engelmann ist nicht belegt. Es ist davon auszugehen, dass Wittgensteinirgendwann nach dem Erscheinen der zweisprachigen Ausgabedes Tractatus 1922 in London, das nun nicht mehr benötigte Typoskript202 seinem Freund Paul Engelmann überließ. Verwirrend ist dabei derUmstand, dass Engelmann bereits im März 1919 eine von seiner SchwesterHermine in Ludwig Wittgensteins Auftrag erstellte Abschrift des20biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Logisch-Philosophischen Abhandlung erhalten hatte, die sich heute unterden Namen »Wiener Typoskript« in der Sammlung von Handschriften undalten Drucken in der ÖNB befindet (Ts 203, Cod. Ser.n. 22.023) 10 .. Engelmannbedankt sich in seinem Brief an Ludwig vom 3. 4. 1919 für die vonHermine übersandt Kopie 11 . Das ursprüngliche »Engelmann-Typoskript« istdemnach also das Ts 203, das von Wright allerdings mit der Bezeichnung»Wiener Typoskript« in seiner Nachlassverzeichnis aufnahm, weil eres 1965 in Wien im Besitzt der Familie Stonborough vorgefunden hatte. 12Engelmann schickte dieses früher erhaltene Exemplar (Ts 203) irgendwannnach 1922 nach Wien zurück. In einem Brief an Ludwig Wittgensteinvom 23. Juni 1922 entschuldigt er sich, dass er dies noch nicht getanhabe, weil er noch dabei sei, eine davon erstellte Abschrift zu korrigieren13 . Er erhielt später von Wittgenstein – wie bereits erwähnt – das inseiner Historie wesentlich interessantere, mit zahlreichen handschriftlichenKorrekturen und einer persönlichen Widmung an ihn verseheneTyposkript 202, das heute seinen Namen trägt und sich in der Bodleianain Oxford befindet.Die Widmung im Manuskript 114 14In Wittgensteins Manuskripts 114 mit dem Titel Band X. PhilosophischeGrammatik findet sich am vorderen Vorsatzblatt folgender Eintrag:»Im Falle meines Todes vor der Fertigstellung oder Veröffentlichung dieses Buchessollen meine Aufzeichnungen fragmentarisch veröffentlicht werden unter dem Titel:›Philosophische Bemerkungen‹ und mit der Widmung: ›FRANCIS SKINNER zugeeignet‹.Er ist, wenn diese Bemerkung nach meinem Tode gelesen wird, von meinerAbsicht in Kenntnis zu setzen, an die Adresse: Trinity College Cambridge.«Wittgenstein schreibt diese Anweisung – wie in Abbildung 4 zu sehen– nach dem Wort »diese Buches…« in Code, jener simplen Geheimschrift,die er vielfach in seien Manuskripten für persönliche Bemerkungen benutzt,und die auf einer recht einfachen Vertauschung der Buchstabennach dem Prinzip az, by usf. beruht.Die beabsichtigte Widmung in MS 114 bezieht sich auf Francis Skinner,Wittgensteins engsten persönlichen Freund in dieser Zeit. Skinnerwar 1930 als hochbegabter Mathematikstudent ans Trinity College inCambridge gekommen. Bald darauf entstand eine enge Beziehung zuWittgenstein, dem er »unkritisch und fast obsessiv verfiel«, wie Ray Monkschreibt. 15 .Bald nach dem Neubeginn seiner philosophischen Arbeit im Februar1929 in Cambridge plante Wittgenstein eine zusammenfasende Darstellungseiner neuen philosophischen Ideen, beruhend auf dem Materialder in rascher Folge entstandenen Manuskriptbände (Ms 105 -114). Dadas geplante Werk allerdings in dieser Form nie erschien, blieb auchdie Widmung aus dem Ms 114 fiktiv. Die hier zitieret Anweisung zueiner Widmung an Francis Skinner bezieht sich demnach nicht auf denphysischen Manuskriptband (Ms 114) selbst, sondern auf ein fiktives,posthume zu veröffentlichendes Werk, das den Titel Philosophische Bemerkungentragen sollte. Diesen Titel verwendete Wittgenstein bereits fürdie Manuskriptbände, die ab dem Februar 1929 in Cambridge entstanden(MS 105 ff) und auch für die daraus bereits 1930 erstellte Synopse,dem Typoskript 208.21biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Abb. 4: Widmung an Francis Skinnerim Manuskript 114(Mit freundlicher Erlaubnis der TrinityLibrary Cambridge, in deren Besitzsich das Manuskript befindet)Abb. 5: Widmungan seineSchwester»Gretl« imBlauen Buch(ÖNB, Cod.Ser. n. 52.856 )Abb. 6: »Philosophische Untersuchungen« (Ms 142, ÖNB, Cod. Ser. n. 37.938)Titelblatt und Widmung an seine Schwester »Gretl« (links oben)22biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Das Manuskript 114 besteht aus zwei, deutlich voneinander getrenntenTeilen: die ersten 60 Seiten sind eine direkte chronologische Fortsetzungder Bemerkungen von Band IX. (Ms 113), während die anschließendenvon Wittgenstein selbst paginierten 228 Seiten den Versuch einer durchgehendenÜberarbeitung des Großen Typoskripts (Ts 213) darstellen, dieer in Manuskriptband 115 fortsetzte und später im so genannten GroßenFormat (Ms 140). Es ist Michael Nedos These zuzustimmen 16 , dass die Anweisungzu einer Widmung an Francis Skinner trotzt ihrer Platzierungan Anfang des Werkes diesem zweiten Abschnitts des Manuskripts 114zuzuordnen ist. Der Ausdruck »Fertigstellung oder Veröffentlichung diesesBuch« bezieht sich also auf Wittgensteins Plan, einer Veröffentlichung,zu der er mit einer intensiven Überarbeitungen des Ts 213 begann. DiesesBuchprojekt wurde von Wittgenstein später allerdings aufgegeben.Erst posthum 1964 publizierte sein Schüler Rush Rhees die PhilosophischenGrammatik, die den damaligen Intentionen Wittgensteins weitgehendentspricht, jedoch ohne der Widmung an Francis Skinner.Die Widmungen an Schwester »Gretl«Es scheint dass Margarethe Stonborough-Wittgenstein– »Gretl« – wiesie in der Familie genannte wurde – die einzige von Ludwigs Geschwisternwar, der er philosophische Schriften mit persönlichen Widmungschenkte, nämlich ein Exemplar des Blue Book und das Manuskript 142,die »Urfassung« der Philosophischen Untersuchungen.Dies mag insofern erstaunen, als gerade sein Verhältnis zu Gretl häufigals eher gespannt dargestellt wird 17 .David H. Pinsent, der engste Freund Wittgensteins aus seiner erstenZeit in Cambridge 1911-13 berichtet in seinem Reisetagebuch von ihre gemeinsamenNorwegenurlaub im September 1913, dass sich Ludwig auchdeshalb dazu entschloss, für ein Jahr in Norwegen zu bleiben, weil er erfahrenhatte, dass Margarethe mit Familie nach London übersiedeln wolle,er ihr große Nähe zu Cambridge aber als Belastung empfand. Bei derSchenkung des ererbten väterlichen Vermögens an seine Geschwisternach seiner Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft 19191, hatte er Gretlals Einzige übergangen. Auch wenn dies primär auf Margarethes gesichertenfinanziellen Verhältnisse nach der Heirat mit Jerome Stonboroughzurückzuführen war, mag es doch auch Anlass für eine Kränkungseiner Schwester gewesen sein, wie zumindest ein Brief Hermines anLudwig vom Herbst 1919 (ÖNB, Autogr. 1276/2-16) nahelegt 18 . Allerdingsdürften sich die Geschwister einerseits durch den Bau des Stadtpalais fürMargarte in der Kundmanngasse nach Plänen von Ludwig und insbesondereauch durch seine Beziehung zu Maguerite Respinger wieder nähergekommen sein. Maguerite Respinger war häufiger Gast im Hause derStonboroughs und hatte insbesondere zu Margarethe ein fast mütterlichesVerhältnis. Jedenfalls zeigen die Briefe Margarethes an Ludwig ausden 30er und 40er Jahren eine sehr große emotionale Verbundenheit.Bereits in einem Brief vom Dezember 1929 bedankt sich Margarethefür ein Manuskript eines Vortrags, vermutlich der Lecture on Ethics, dieLudwig am 17.11.1929 in Cambridge hielt 19 . Es handelt sich um eine derbeiden handschriftlichen Fassungen dieses Vortrags (Manuskript 139b),den von Wright 1952 bei Margarethe in Gmunden vorfand und der späterin Nachlass Rudolf Koders wieder auftauchte.23biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Ein mit einer Widmung versehenes Exemplar des Blue Book schenkteLudwig seiner Schwester zu Weihnachten 1934, möglicher Weise aucherst 1935. Es ist ein nach Diktaten an seine StudentInnen im Studienjahr1933/34 entstandene Zusammenfassung seiner Philosphie. Eine inder Wren Library vorhandenen Textvorstufe zum Blue Book weist nocheine Gliederung in 39 Vorlesungen auf, die allerdings im Laufe von Wittgensteinsweiterem Überarbeitungsprozess verschwunden ist 20 . Wittgensteinließ den korrigierten und überarbeiteten Text schließlich in geringerStückzahl vervielfältigen und in blaue Einbände fassen. In einemBrief an Bertrand Russell schreibt er, er habe diese Vorlesungsunterlagefür seine Studenten hergestellt: »… so that they might have something to takehome with them, in their hands, if not in their brains.« 21Beim Manuskript 142 handelt es sich um einen der interessantestenTexte in Wittgensteins Nachlass. Er enthält die bereits nahezu endgültigeFassung der ersten 188 Bemerkungen der posthum 1952 publiziertenPhilosophischen Untersuchungen. Die Widmung an Gretl »Gretl von Ludwig– zu Weihnachten 1936 – ein schlechtes Geschenk« wirft allerdings einigeRätsel auf. Wittgenstein begann die Niederschrift dieses Manuskriptes– wie auf der erste Textseite festgehalten – »anfangs November 1936« inSkjolden in Norwegen. Wie u.a. Alois Pichler überzeugend dargelegthat, entstand ein Großteil dieses Textes (ab S. 77 ff.) allerdings erst1937 22 . Es ist also anzunehmen, dass das Weihnachtsgeschenk 1936 zunächstnur symbolisch übergeben wurde, Wittgenstein das Manuskriptaber wieder mit nach Norwegen nahm, um weiter daran zu arbeiten.(Dies belegen u.a. Passagen aus den Notizbüchern MS 157a und b aus1937, die wörtlich in MS 142 übernommen wurden.) Wann genau MS142 dann auch physisch in die Hand Margarethes gelangte, ist heutekaum noch festzustellen. Jedenfalls befindet es sich bei WittgensteinsTod in Gmunden in der Villa Toscana der Stonboroughs, wo es vonWright 1952 vorfindet und in sein Nachlassverzeichnis aufnimmt 23 . Alsvon Wright 1965 wieder nach Gmunden reist, um die Manuskripte zusichten, war der Band allerdings verschwunden und blieb es für vieleJahre. Es war eine echte Sensation als 1993 im Nachlass des engenFreundes und Lehrerkollegen Wittgensteins, Rudolf Koder, vier wichtigeManuskripte wieder auftauchten, neben dem Tractatus-Typoscript204, die bis dahin völlig unbekannten Tagebücher aus den 30er Jahren(Manuskript 183), die bereits erwähnte Fassung der Lecture on Ethics (Ms139b) und eben das Manuskript 142 der Philosophischen Untersuchungen.Margarethe hatte die vier genannten Manuskripte – wie anzunehmenist – irgendwann nach Ludwigs Tod (und nachdem sie von Wright 1952noch in Gmunden gesehen hatte) Rudolf Koder als Erinnerungsstückegeschenkt, ohne dass die Nachlassverwalter in Cambridge dies erfuhren.Möglich ist auch, dass Margarethe diese Schenkung an Koder testamentarischverfügt hatte und zwar auf ausdrücklichen Wunsch Ludwigs,wie eine Stelle aus einem undatierten Brief Margarets an Ludwigaus 1944 nahelegt: »I put your order about your manuscript into my testamentin case I should perdecease you before the end oft he war.« 24 In der FamilieKoder gerieten die Manuskripte offenbar nach Rudolf Koders Tod 1977in Vergessenheit und wurden erst nach dem Tod seiner Gattin 1992 vonden Kindern wieder entdeckt 25 . Die Österreichische Nationalbibliothekerwarb alle vier Dokumente im Jahre 2003.24biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Wittgensteins beide Widmungen an »Gretl« bestätigen jedenfalls, dassLudwig seine Schwester Gretl auch als philosophische Gesprächspartnerinernst nahm und schätzte, umgekehrt auch, dass gerade sie an seinemphilosophischen Werk besonderes Interesse zeigte.1 Nicht als eigentlicheWidmungen zu sehen sindhingegen Verfügungen Wittgensteins,was im Falle seinesTodes mit bestimmtenManuskripten zu geschehenhabe, wie sie sich in MS101 (und ähnlich in MS 102)finden: »Nach meinem Tod zusenden an Frau Poldy WittgensteinXVII. Neuwaldeggerstr. 38,Wien 9 Aug, 1914 Zu senden anHon. B. Russell, Trinity College,Cambridge, England.«2 L. Wittgenstein, Prototractatus:an early version ofTractatus Logico-Philosophicus.Ed. by B. F. McGuinness London[u.a.] : Routledge 19963 Das dritte erhalteneTyposkript der Logisch-Philosophischen Abhandlung,das »Wiener Typoskript«, (TS203 = Cod. Ser.n. 22.023) trägtkeine Widmung. TS 203 undTS 204 befinden sich in derSammlung von Handschriftenund alten Drucker derÖsterreichischen Nationalbibliothek.Bezüglich derEntstehungsgeschichte unddem genauen Zusammenhangzwischen den dreiTyposkripten vgl. T. Lampert,G Graßhoff: Ludwig WittgensteinsLogisch-Philosophische Abhandlung.Entstehungsgeschichteund Herausgabe der Typoskripteund Korrekturexemplare. Wien:Springer Verlag 20044 D. H. Pinsent, Reise mitWittgenstein in den Norden:Tagebuchauszüge, Briefe.Herausgegeben von G.H.von Wright. Wien, Bozen :Folio 1994 (englische ErstausgabeOxford 1990), 75 R. Monk, Wittgenstein.Das Handwerk des Genies.Stuttgart: Klett-Cotta 1992,666 Pinsents Tagebuch zubeiden Reisen wurde späterzusammen mit seinen Briefenpubliziert, s. Fußnote (4)7 In der Sammlung vonHandschriften und AltenDrucken der ÖNB befindensich 15 Briefe von David .H.Pinsent an Ludwig Wittgensteinaus dieser Zeit : Autogr.1274/9, außerdem dreiBriefe seiner Mutter EllenPinsent an L. Wittgenstein:Autogr. 1275/10.8 Das Original des Briefesbefindet sich in der ÖNB,Sammlung von Handschriftenund alten Drucken:Autogr. 1275/10-19 L. Wittgenstein,Gesamtbriefwechsel / CompleteCorrespondence. InnsbruckerElectronic Edition. (2ndRelease). Brenner Archiv,Universität Innsbruck. Charlottesville,Virginia, USA201110 Die Entstehungsgeschichtedieses Manuskripteskann seit der genauenAnalyse von Tim Lampertund Gerd Graßhoff alsgesichert angesehen werden;vgl. Graßhoff/Lampert(2004), Fußnote 3.11 L. Wittgenstein / P.Engelmann, Briefe, Begegnungen,Erinnerungen. Hrsg. IlseSomavilla. Innsbruck, Wien: Haymon 2006, 4012 G. H. von Wright,:Wittgensteins Nachlass. In:ders : Wittgenstein, Frankfurt:Suhrkamp 1990, 4613 Wittgenstein /Engelmann(2006), 68 (Fußnote 11)14 Ich bedanke mich beiJonathan Smith von derTrinity Library Cambridgefür diesen Hinwies.15 Monk (1992), 354 (Fußnote5)16 L. Wittgenstein, PhilosophischeGrammatik. Wien,New York : Springer 1999 (=Wiener Ausgabe. StudienTexte, hrsg. von M. Nedo,Band 5) , Einleitung, VII.17 U. Prokop, MargaretStonborough-Wittgenstein. Bauherrin,Intellektuelle Mäzenin.Wien 2003, 120, 124/35,18 »Mein guter Lukas, Ichwar sehr bestürzt darüber Dichbei meiner Ankunft in Neuwaldegggar nicht mehr vorzufinden;ich hatte mir eingebildetdie grossen Veränderungenwürden so langsam im Lauf dernächsten Monate vor sich gehenund natürlich wäre ich nichtmit den Buben auf die Hochreitgefahren, wenn ich gewussthätte, dass es meine letzten Tagemit Dir sein würden. Abgesehendavon dass ich Dich gernenoch ein bischen ordentlich fürmich gehabt hätte, tut es mir25biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
jetzt auch sehr leid dass ichnicht dabei war als Du mit denGeschwistern Deine Vermögenshergabebesprachst.Ich verstehe nämlich nicht warumDu Greti dabei übergehst. Das istdoch eine grosse Kränkung glaubeich, nicht wegen des Geldessondern es ist kränkend «enterbt”zu werden. Wenn Du eine Absichtdabei verfolgst so ist das etwasAnderes, Jeder tut was er fürRecht hält, aber vielleicht hast Dues noch gar nicht von dieser Seiteangesehen. Es wäre ja, wenn Dusie nicht beteiligen willst ganzgenug, wenn Du ihr nur eineZeile schriebest, dass Du sie nichtdamit kränken willst, sonderndass Du es tust, weil wir viel vonunserem Vermögen verlierenwerden, was ihr nicht passierenwird. Möchtest du das nicht? Ichsehe Dich ja heute Nachmittagbeim Kux aber vor den Herrenwollte ich es Dir nicht sagen.Leb wohl mein Herzenslukas!Es grüsst Dich Deine SchwesterMining«Aus einem Brief von Herminean Ludwig WittgensteinHerbst 1919, ÖNB, Autogr1276/2-16, vgl. dazu Prokop(2003), 120.19 »Und ich bedanke michfür das Manuskript, eine grösserFreunde könnte ich mir nichtleicht vorstellen.« Familienbriefe(1996), S. 12320 J. Smith: Wittgenstein’sBlue Book: Reading betweenthe lines. In: N. Venturinha(ed.), The Textual Genesis ofWittgenstein’s PhilosophicalInvestigations. New York,London: Routledge 2013,37-5121 Wittgenstein, Ludwig(2011) (Fußnote 9)22 A. Pichler, WittgensteinsPhilosophische Untersuchungen:zur Textgenese von PU §§ 1 – 4.Bergen 1997, 83. Pichler gehtan dieser Stelle davon aus,dass die Widmung sich aufWeihnachten eines späterenJahres bezog, was allerdingswenig wahrscheinlich ist,da in der Widmung selbst jadie Jahreszahl »36« angegebenist.23 Von Wright (1990), S.65 (Fußnote 12)24 Wittgenstein –Familienbriefe. Hrsg. vonBrian McGuinness .Wien:Hölder-Pichler-Tempsky1996, 182. Diese BemerkungMargarethes könnte sichallerdings auch auf das Ts202 beziehen.25 Vgl. dazu J. Koder,Johannes: Verzeichnis derSchriften Ludwig Wittgensteinsim Nachlass Rudolf und ElisabethKoder. In: Mitteilungenaus dem Brenner-Archiv 12(1993), 52–5426biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Alfred Schmidt • Wittgensteins Widmungen | 15–24
Stefan EnglFreundschaft über StandesgrenzenMoritz Graf von Dietrichstein und Ignaz von MoselAbb. 1: Moritz Graf von Dietrichstein (ÖNB, Bildarchiv, Sign.: PORT0011435401)27biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
Abb. 2: Ignaz von Mosel (ÖNB, Bildarchiv, Sign.: PORT0001278401)28biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
Dem Adel verpflichtetEnde des 18. Jahrhunderts lebten in Wien an die zwanzig fürstlicheund siebzig gräfliche Adelsfamilien, die im Umfeld des Kaiserhauses überviel Macht und Geld verfügten. Moritz Graf von Dietrichstein-Proskau-Leslie (1775-1864) entstammte einer der einflussreichsten dieser Familien,deren Oberhäupter seit der Erhebung des Kardinals Franz von Dietrichstein(1570-1636) in den Fürstenstand, stets wichtige Ämter am Kaiserhofinne hatten. 1 Moritz’ Großvater, Karl Maximilian Philipp (1702-1784), warObersthofmeister und Obersthofmarschall Maria Theresias und sein Vater,Johann Baptist Karl (1728-1808), Oberststallmeister Kaiser Josephs II.Für Moritz von Dietrichstein waren diese Fußstapfen aber keineswegszu groß; im Laufe seines langen Lebens (mit seinem Tod im Alter von89 Jahren erlischt der Mannesstamm der Dietrichsteins) bekleidete erzahlreiche einflussreiche Hofämter: Hofmusikgraf, Obersthofmeisterstellvertreterdes Prinzen von Parma (Sohn von Napoleon und Marie-Louisevon Österreich), Hoftheaterdirektor, Hofbibliothekspräfekt, Direktordes Münz- und Antikenkabinetts, Obersthofmeister der Kaiserin Anna,Oberstkämmerer und Stellvertreter des 1. Obersthofmeisters. 2 Für einederartige Karriere wurden die Kinder der Familie Dietrichstein, wie in derHocharistokratie üblich, zu Hause von eigenen Hofmeistern erzogen. 3 Sieerhielten eine christliche, aber auch aufgeklärte Erziehung. Bei Moritzlag die Hauserziehung in den Händen des Piaristen Johann Steindörfer,und seine Mutter Maria Christina Dietrichstein geb. Gräfin von Thun-Hohenstein(1738-1788) folgte bei den Erziehungsanleitungen den neuen aufklärerischenPädagogikbüchern wie dem Erziehungsroman »Émile« (1762)von Jean Jaques Rousseau. Auch der Vater Johann Karl war stark von derAufklärung beeinflusst, wie seine Wahl zum Landes-Großmeister der Freimaurerin Österreich zeigt. Am Ende der Hauserziehung trat Moritz, wiezuvor sein älterer Bruder und späterer Fürst Franz Joseph Dietrichstein(1767-1854), mit sechzehn Jahren in die Armee ein und folgte auch hierder typischen Karriere eines Adeligen dieser Zeit. In den fast zehn Jahrenseines Militärdienstes stieg Moritz Dietrichstein vom Unterleutnantbis zum Oberst und ersten Generaladjutanten auf. 4 Allerdings geriet eram Ende dieser Laufbahn, von Jänner 1799 bis April 1800, in französischeKriegsgefangenschaft. Eine Erfahrung, die Dietrichstein sehr verbitterte;endlich freigelassen, kehrte er nach Wien zurück, schied aus dem Heeraus, heiratete Gräfin Therese von Gilleis (1779 – 1860) und widmete sichvon da an den schönen Künsten und Wissenschaften.Aufstieg im BürgertumIm Gegensatz zu Dietrichstein entstammte Ignaz von Mosel (1772-1844),eigentlich Ignaz Mosel (das »von« kam erst später dazu) dem klassischenBürgertum Wiens. 5 Sowohl der Großvater Cornelius Mosel (1691-1761),als auch der Vater Mathias Mosel (1730-1784) schlugen in dieser Stadt dieBeamtenlaufbahn ein. Dieser Weg wurde auch Ignaz Mosel vorgezeichnet:Er absolvierte die lateinische Schule bei den Piaristen und konntedaraufhin an der Universität Wien studieren. Mit knapp 16 Jahrentrat Mosel in den Staatsdienst ein und arbeitete sich vom unbezahltenPraktikanten bis zur höchsten Ingrossistenstelle hoch. Von seinem erstenGehalt konnte sich Mosel auch den Unterricht in der französischenund italienischen Sprache leisten – die Kenntnis dieser Sprachen war29biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
eine absolute Notwendigkeit für jeden, der in der Wiener Gesellschaftbestehen wollte. Noch wichtiger für den Aufstieg in der Gesellschaft wardie Heirat Mosels mit Marianne Haunalter (1773-1808) im Jahr 1797. Siegehörte als Tochter des Arztes Michael Julian Edlen von Haunalter einerhöheren Gesellschaftsschicht an. Sechs Jahre lang versuchten MariannesEltern diese Hochzeit aus diesem Grund zu verhindern, letztendlichvergebens. Für Mosel eröffnete sich durch diese Heirat eine glänzendeberufliche und vor allem gesellschaftliche Laufbahn. Er schaffte denSprung zu einer Anstellung im Hofstaat und machte eine steile Karrierevom Kanzlisten bis zum Hofsekretär. Gekrönt wurde dieser Aufstiegmit der Aufnahme in den Österreichisch-erbländischen Adelsstand imJahr 1818, begründet durch die 32jährige treue und eifrige Dienstleistungseines verstorbenen Vaters und seiner eigenen 28jährigen Dienstpflicht.Parallel zur beruflichen Laufbahn bildete sich Mosel stets künstlerischauf den Gebieten der Malerei, Literatur und der Musik weiter und erhieltdadurch Eingang zu maßgeblichen Gesellschafts- und Künstlerkreisen.Durch gemeinsame Interessen verbundenUm 1800 entwickelten sich in Wien durch die politischen Umwälzungender Revolutionskriege mit Frankreich zahlreiche patriotische Strömungen.Eine der bedeutendsten künstlerischen Gruppen dieser »vaterländischenBewegung« setzte sich die Schöpfung einer dramatischenGattung mit national-deutschem Charakter zum Ziel – eine deutscheOper sollte der beliebten, vorherrschenden italienischen Oper entgegentreten.Im Zentrum dieser Bewegung standen der Dichter HeinrichJoseph von Collin (1771-1811), die Komponisten Antonio Salieri (1750-1825)und Maximilian Stadler (1748-1833) sowie die Sängerin Anna Milder (1785-1838) und der Sänger Michael Vogl (Johann Michael Vogl (1768-1840?). 6Von Anfang an mit dabei war auch Moritz von Dietrichstein, der schnellCollins bester Freund wurde, obwohl dieser, wie Mosel, aus dem Bürgertumstammte und eine Beamtenlaufbahn einschlug. Das gemeinsameZiel der nationalen Oper weichte die starren Standesgrenzen auf undStandesprivilegien wurden nun eingesetzt, um schneller und besserzum Erfolg zu kommen: »Das Haus Dietrichstein war damals unter dem Vaterund den drei Brüdern Franz Joseph, Hans Karl und Moritz, Sammelplatz undVereinigungspunkt aller Geistesgrössen jener Zeit und stand an Berühmtheit demZirkel um Lobkowitz wohl kaum nach.« 7 Moritz von Dietrichstein konzentriertesich bei den Bemühungen um eine nationale Oper vor allem aufdie wichtige Vermittlerrolle zwischen den ausübenden Künstlern, demkunstinteressierten Adel und dem Kaiserhaus. Allerdings erfuhr diesepatriotische Bewegung durch den frühen Tod Collins im Jahr 1811 einenschweren Verlust. Dietrichstein verfolgte weiterhin die nationalenkulturellen Ideen Heinrich Collins. Den frei gewordenen Platz an seinerSeite als künstlerischer Berater und Freund nahm bald nach dem TodCollins Ignaz Mosel ein: »In diesem Jahre starb der als Mensch, Geschäftsmannund Dichter, gleich hochgeschätzte Hofrath Heinrich v. Collin, den ich leider zu spätkennen lernte, und ich ward Universalerbe der ganzen Summe von thätiger Freundschaft,welche der edle Graf Moriz D. ihm im Leben gewidmet, und noch nach seinemTode durch Veranlaßung des schönen Monuments in der Karlskirche bewießenhat.« 8 Mosel hatte seit jeher Interesse an der dramatischen Musik unddurch seine schriftstellerische Tätigkeit bei den »Vaterländischen Blät-30biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
tern« – neben dem Hormayrschen »Archiv« das hauptsächliche Organder patriotischen Bewegung in Wien – hatte er bereits seit 1808 Verbindungzur nationalen Bewegung. Dass solche Freundschaften zwischenKünstlern und Adeligen keineswegs üblich waren, zeigt die Reaktionder vornehmen Gesellschaft auf ein Gedicht Dietrichsteins, welches erunter dem Titel »Meinem Freunde Maximilian Korn« zu dessen Tod imJahr 1854 veröffentlichte. Es wurde als absolut unpassend empfunden,dass Dietrichstein von einem Künstler sagt, dass er sein Freund gewesensei. Als Dietrichstein das zu Ohren kam, schrieb er ein Gedicht, woriner den »Aristos« vorwirft, dass sie nicht genug Herz besäßen, um dieFreundschaft eines Künstlers zu schätzen. 9 Dabei begegneten sich Adelige,Bürger, Wissenschaftler und Künstler bereits im 18. Jahrhundert beiden Logentreffen der Freimaurer auf Augenhöhe: Gleichheit, Freiheit,Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität waren die Ideale dieser erstendemokratischen Zellen im absolutistisch regierten Habsburgerreich. FürMoritz Graf von Dietrichstein galten diese Ideale auch außerhalb der»Mauern«.Freundschaft und FreundschaftsdiensteDietrichstein und Mosel lernten einander wahrscheinlich 1810 überMaximilian Stadler kennen: »Das Jahr 1810. war übrigens das glückliche Jahr,in welchem ich die Bekanntschaft eines der edelsten, liebenswürdigsten, unterrichtetstenMänner [machte], der nachmals so großen Einfluß nicht nur auf das, wasvon mir in die Welt gekommen ist, sondern auch auf mein Schicksal, genommenhat, des trefflichen Grafen Moriz v. D., der unter die ersten Zierden des Oesterr.Adels gehört.« 10 Beide nahmen bei Stadler Musikunterricht. Dietrichsteinlernte Klavier und später wahrscheinlich auch Orgel und wurde mit derKompositionskunde vertraut gemacht. Mosel schrieb Bearbeitungenvon bekannten Oratorien und Opern für die bürgerliche Hausmusik. Ab1808 war Mosel auch schriftstellerisch tätig und gleich aus seinem erstenArtikel stammt folgendes aussagekräftige Zitat: »Die Tonkunst wirkt hier[Wien] täglich das Wunder, das man sonst nur der Liebe zuschrieb: sie macht alleStände gleich. Adelige und Bürgerliche, Fürsten und ihre Vasallen, Vorgesetzte undihre Untergebenen, sitzen an einem Pulte beisammen, und vergessen über der Harmonieder Töne die Disharmonie ihres Standes. Dem ausübenden Musiker öffnensich alle Paläste und Börsen …« 11 . Die Entwicklung des freundschaftlichenVerhältnisses zwischen Dietrichstein und Mosel ist sehr gut an der sichändernden Anrede Dietrichsteins in den Briefen Mosels zu erkennen.Beginnen die ersten Briefe auf Grund des großen Standesunterschiedesnoch mit der förmlichen Anrede »Hoch- und Wohlgeborener Herr Graf«,ändert sich das im Laufe der Zeit auf »Verehrtester« und »Theuerster HerrGraf« bis zu »Hochverehrter Freund«. 12 Der Inhalt der ersten Briefe istnoch rein sachlich; es geht um Mosels Singspiel »Die Feuerprobe«, wofürDietrichstein die Rezension übernommen hat, weiters um ein Denkmalfür Heinrich von Collin und um Vorbereitungen zu dessen Totenfeier, andenen Mosel eifrig mitarbeitete. Aber bald werden auch die Familien indiese Freundschaft miteinbezogen und gegenseitige Besuche angekündigt.Auch hier sieht man die Entwicklung von der zögerlichen Annäherungbis zum freundschaftlichen Austausch: Als die Familie Mosel einenBesuch auf einem Sommersitz der Dietrichsteins absagen muss, schreibtMosel: »… ohnehin hat meine Frau noch immer 1000. nicht ungegründete Scrupel31biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
gehabt, der Frau Gräfinn diese Ungelegenheit zu machen, nachdem Sie ihr noch garnicht aufgeführt ist.« 13 Bei dieser Frau handelt es sich bereits um die zweiteEhefrau Mosels, Katharina Lambert (1789-1832), die selbst sehr musikalischwar. Dietrichstein widmet ihr wenig später eines seiner Werke:Douze Eccossaises pour le Pianoforte composées et dediées à Madame de Mosel néeLambert par Le Comte Maurice de Dietrichstein. 14 Diese revanchiert sich wiederummit einer Widmung an Dietrichsteins Tochter Ida: Variations pourle Piano-Forte sur une Thème de Mr. le Comte Maurice de Dietrichstein composéeset dediées à Mademoiselle la Comtesse Ida de Dietrichstein par Catherine Mosel,née Lambert.In der Freundschaft zwischen Mosel und Dietrichstein war Mosel derBerater in künstlerischen Dingen, während Dietrichstein Mosel in seineramtlichen, musikalischen und gesellschaftlichen Laufbahn unterstützte.Wie weit der Einfluss Dietrichsteins reichte und wie Mosel davon profitierte,zeigt die Komposition eines »dänischen Marsches« von Mosel,die König Frederik VI. von Dänemark gewidmet ist. 15 Diese Widmung aneinen König war nur möglich, weil Dietrichstein während des WienerKongresses dem König von Dänemark als Kammerherr beigestellt war.In gewisser Weise wurden Freundschaften damals wie heute auch instrumentalisiert.So reichte Mosel seine Oper »Salem« im Jahr 1812 nichtzuerst bei der Hoftheaterdirektion ein, sondern übersandte die Partiturzunächst an den Hofkapellmeister Antonio Salieri zur Begutachtung. 16Mosel machte sich hier den damaligen Usus von »zum Vorzeigen bestimmterBriefe« zu Nutze. Man ließ sich solche Briefe von Personenausstellen, deren Urteilskraft aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz vonGewicht war. Der Höflichkeit gemäß konnte solch ein Brief nur lobendausfallen, ähnlich den heutigen Berufszeugnissen. Salieri schreibt überMosels Oper: »Ich habe Ihre sehr schöne neue tragische Oper mit Aufmerksamkeitu. Vergnügen gelesen. Die Grundsätze, welche Sie bei der Composition derselben vorAugen hatten, und die Sie mir mitzutheilen beliebten, sind eben so richtig, als indieser Musik klar ausgedrückt. Ein leichter Styl, ohne trivial zu seyn; Ausdruck ohneCarricatur; Energie ohne Convulsionen; darin besteht, nach meiner Meinung, dasVerdienst einer Arbeit dieser Gattung.« 17 Diesen »Umweg« über Salieri konnteallerdings nicht jeder beschreiten. Man musste über die nötigen gesellschaftlichenoder persönlichen Beziehungen verfügen. Wahrscheinlichkonnte sich Mosel auch in dieser Sache erst durch die Vermittlung Dietrichsteinsan den Hofkapellmeister Salieri wenden.Die Unterstützung Mosels durch Dietrichstein ging aber noch vielweiter. Im Jahr 1821 wurde Dietrichstein gefragt, unter welchen Bedingungener vom Hofmusikgrafenamt zur Stelle des Hoftheaterdirektorswechseln würde. Als erste Bedingung stellte Dietrichstein, dass ihm einMann unumgänglich erforderlich sei, vollkommen dazu geeignet, seine Aufgaben zuerleichtern 18 . Dieser gewünschte Mann war Mosel und so übernahmen sieim Juni 1821 gemeinsam die Direktion des Burgtheaters und des Kärntnertortheaters.Damit waren sie fast am Ziel ihrer seit langen Jahrenverfolgten Bemühungen angelangt, eine deutsche Oper zu etablieren. 19Aber umso schwerer der Schock, als im September desselben Jahres dasKärntnertortheater, welches für die Opernaufführungen zuständig war,ausgerechnet an den Italiener Domenico Barbaja verpachtet wurde, dermit Hilfe von Gioachino Rossini der italienischen Oper zu einem Triumphzugverhalf. Dietrichstein und Mosel blieb mit dem Burgtheater32biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
Abb. 3: Widmung der Variationen von Katharina Mosel an Ida von Dietrichstein(ÖNB, Musiksammlung, Sign.: MS89396-qu.4°)Abb. 4: Widmung des Krönungs-Marsches von Mosel an den König vonDänemark Friedrich VI. (ÖNB, Musiksammlung, Sign.: Mus.Hs.18632)33biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
somit »nur« der Bereich des klassischen Theaters. Einzig den »Freischütz«von Carl Maria von Weber schafften sie, in der Zeit ihrer Direktion nochzur Aufführung zu bringen. Und so wurde diese Oper, die als ein ersterHöhepunkt für die deutsche Oper gedacht war, nur der krönende Abschlussder Direktion Dietrichstein-Mosel im Bereich der Oper.Im Jahr 1826 wechselte Dietrichstein vom Posten des Burgtheaterdirektorsauf die Stelle des Präfekten der Hofbibliothek, vor allem, da ermit dem neuen, seit Ende 1824 agierenden Oberstkämmerer und damitobersten Leiter der Hoftheater, Johann Rudolf Czernin Graz von und zuChudenitz (1757-1845), kein gutes Auskommen fand. Und als im Jahr 1829die Stelle des ersten Kustos der Hofbibliothek durch den Tod von JohannVesque von Püttlingen (1760-1829) frei wird, folgt ihm Mosel nun auch indie Hofbibliothek. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass hier Czernindiese Übersetzung veranlasste, da er den ihm unbequemen, weil imSinne Dietrichsteins weiter arbeitenden Vizedirektor Mosel vom Theaterweghaben wollte, und so auch versuchte, Dietrichstein zu schaden: »Eswar ein geschickter Schachzug des Oberstkämmerers, der Dietrichstein überdiesbei den Beamten der Hofbibliothek – die die Hintergründe der Versetzung nichtkannten – in den üblen Ruf bringen musste, da Mosel als sein bester Freund bekanntwar und man ihm mit Recht eine Art Protektionswirtschaft zuschreiben konnte. Ausdem Aktenbestand geht jedoch klar hervor, dass Dietrichstein vor ein fait accompligestellt wurde, d.h. Czernin nur auf den Moment gewartet zu haben scheint, nachDietrichstein nun auch den ihm unbequemen Mosel aus dem Oberstkämmeramtzu entfernen.« 20 Der Wechsel von Mosel war aber zum großen Nutzen fürdie Hofbibliothek, denn Dietrichsteins und Mosels gute Zusammenarbeitwar vom Hoftheater her bekannt und Dietrichstein hatte damit dieMöglichkeit, gelegentlich die Hofbibliotheksverwaltung gänzlich in dieHände Mosels, dem er absolut vertrauen konnte, zu legen. Diese 16jährigeZusammenarbeit endete am 8. April 1844 mit dem Tod Mosels undvon seinem Freund Dietrichstein sind noch folgende Zeilen erhalten: »Icherfülle eine sehr schmerzliche Pflicht, indem ich die ergebenste Meldung erstatte,daß der k.k. wirkl. Hofrath und erste Custos der k.k. Hofbibliothek, Ignatz, Edlervon Mosel, gestern um 5 Uhr Nachmittag, an der Lungenlähmung verschieden ist.Die Hochachtung, welche dieser ausgezeichnete Staatsbeamte genoß, und die Verdienste,die seine Talente und Geschäftskenntniß in so vielseitigen Dienstzweigenwie im Fache der Literatur und Kunst geltend machten, sind zu bekannt, als daßsie meiner seits, einer Lobpreisung bedürften. Noch am Vorabend seiner letzten Erkrankungbewährten sich: der helle Geist, die richtige Beurtheilung, die Bündigkeit,die allen seinen Arbeiten eingeprägt waren in vollem Maße. Daß ich in ihm, nacheiner 34. Jahre dauernden, stets ungetrübten Freundschaft, einen unersetzlichenVerlust erlitten, erwähne ich nur, um die Größe meines Schmerzes zu bezeichnen.« 2134biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
1 Vgl. Felix Anton Edlenvon Benedikt, Die Fürsten vonDietrichstein. In: Schriften deshistorischen Vereines fürInnerösterreich. Erstes Heft.B. Beiträge aus Kärnten.Graz 1848, 164 –188.2 Zur Biografie von MoritzGraf von Dietrichsteinsiehe: Franz Carl Weidmann,Moriz Graf von Dietrichstein.Sein Leben und Wirken ausseinen hinterlassenen Papierendargestellt. Wien 1867;Wilhelm Nemecek, Moritz I.,Graf von Dietrichstein (1775-1864). (ungedr. geisteswiss.Diss.) Wien 1953.3 Vgl. Ivo Cerman,Habsburgischer Adel undAufklärung. Bildungsverhaltendes Wiener Hofadels im 18.Jahrhundert. Stuttgart 2010,357–377.4 Zur Karriere beimMilitär siehe: Weidmann,Dietrichstein, 15–39.5 Zur Biografie vonIgnaz von Mosel siehe:Theophil Antonicek, Ignazvon Mosel (1772-1844). (ungedr.geisteswiss. Diss.). Wien19626 Vgl. Antonicek, Mosel,100–109.7 Nemecek, Dietrichstein,8.8 Ignaz Mosel, Notizenüber mich selbst. In: ElisabethTheresia Hilscher (Hg.), 200Jahre Musikleben in Erinnerungen(Wiener Veröffentlichungenzur Musikwissenschaft35). Tutzing 1998, 41.9 Nemecek, Dietrichstein,7.10 Mosel, Notizen, 39.11 Ignaz Mosel, Uebersichtdes gegenwärtigenZustandes der Tonkunstin Wien. In: VaterländischeBlätter für den österreichischenKaiserstaat Nr. VI (27. 5. 1808)39.12 Vgl. Antonicek, Mosel,103.13 Antonicek, Mosel, 105.14 Antonicek, Mosel, 95f.15 Vgl. Antonicek, Mosel,108.16 Vgl. Antonicek, Mosel,118f.17 Mosel, Notizen, 45.18 Antonicek, Mosel, 171.19 Vgl. Antonicek, Mosel,176–179.20 Nemecek, Dietrichstein,162.21 Antonicek, Mosel, 247.35biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Stefan Engl • Freundschaft über Standesgrenzen | 25–33
Elisabeth KleckerDer Bibliothekar als Freund des (künftigen)PolitikersJohann Benedikt Gentilotti im Stammbuch desJohann Christoph BartensteinWährend Freundschaftsbücher, wie wir sie heute kennen, in sehr jungemAlter, meist unmittelbar nach dem Erwerb der Schreibfähigkeitgeführt werden und das Ausfüllen der oft vorgedruckten Rubriken spielerischenCharakter hat, erfüllten ihre Vorläufer, die frühneuzeitlichenAlba amicorum, während des Universitätsbesuchs und auf BildungsreisenFunktionen der gesellschaftlichen Selbstdarstellung, der Schaffung vonund Positionierung in Netzwerken, die über die Erinnerung an Klassenkameradenweit hinausgehen. In ihrer Bedeutung, die sie die für dasweitere Leben ihres Besitzers, vor allem für seine berufliche Laufbahn,erhalten konnten, sind sie weniger den Freundschaftsbüchern der Schulkinderals den social media des Internet vergleichbar 1 . Abgesehen vonvielfältigen literaturgeschichtlichen, kunsthistorischen und selbst musikologischenFragestellungen, die sich an ihre Gestaltung bzw. ihreEinträge knüpfen, stellen sie wichtige Quellen dar, wo der Betrieb unddie Ausstrahlung von Bildungsinstitutionen sowie ihre Rolle in individuellenKarrieren untersucht wird. Entsprechend dem Ausgangspunkt,den die Stammbuchsitte an der Universität Wittenberg nahm, stehenUniversitäten dabei im Zentrum des Forschungsinteresses, doch könnenStammbücher auch für Bibliotheken interessante Einblicke in die Beziehungenihrer Bibliothekare und Benützer eröffnen.Die Österreichische Nationalbibliothek besitzt in ihrem Bestand mehrereStammbücher, die mit ihrer eigenen Geschichte in Zusammenhangstehen 2 : Schon von ihrem ersten Präfekten Hugo Blotius (1534–1608) habensich zwei Alben erhalten (Cod. 9708; Cod. 9645) 3 . Einen Bezug zurHofbibliothek weist auch das Stammbuch des langjährigen Bibliothekarsder Biblioteca Vaticana, Lukas Holste / Holstenius (1596–1671) auf(Cod. 9660): Es gelangte aus dem Nachlass seines Neffen Peter Lambeck(1628–1680) in die Hofbibliothek, die dieser seit 1663 als Präfekt leitete 4 .Auch Lambecks Nachfolger Daniel Nessel (Präfekt 1680–1700), vererbteder Hofbibliothek ein Stammbuch aus Familienbesitz: das seines VatersMartin Nessel (1607 Weiskirchen in Mähren – 1673 Wien; Cod. 9711).Umgekehrt ist davon auszugehen, dass so mancher Bibliotheksbesucherden Bibliothekar um eine Eintragung im eigenen Album bat: Das genannteAlbum des Lukas Holste bietet mit dem Eintrag des Bibliothekarsder Bodleian Library Thomas James (fol. 104r; 23. Nov. 1622) ein Beispiel.Für die Bibliotheksgeschichte wäre es also nicht minder aufschlussreich,in welchen Stammbüchern sich Bibliothekare als amici verewigten. Diesist freilich kaum systematisch zu recherchieren: Auf dem derzeitigenStand der diversen Stammbuchdatenbanken 5 lassen sich etwa für Se-36biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 1: Stammbuch des Johann Christoph Bartenstein (Wienbibliothek I.N. 219.528)Abb. 2: Stammbuch des Johann Christoph Bartenstein, Titelblatt(Wienbibliothek I.N. 219.528)37biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
astian Tengnagel (1563–1636), ab 1602 Coadjutor des Blotius und nachdessen Tod sein Nachfolger, zwei Einträge nachweisen: der Eintrag imAlbum des Menold Hillebrand von Harsens (Stuttgart, WürttembergischeLandesbibliothek, Slg. Frommann) vom 13. Juni 1605 fällt zwar in seineWiener Zeit, jedoch vor die selbständige Präfektur. Im Stammbuch desWenzel P/Brunner (Stiftsbibliothek St. Florian III/228; fol. 218r 6 ) trug sichTengnagel am 29. April 1621 als iuris utriusque doctor et Caesareae Majestatisbibliothecarius ein. Im Folgenden soll ein Zufallsfund aus dem frühen 18.Jahrhundert vorgestellt werden.Das Album amicorum des Johann Christoph BartensteinNicht die Österreichische Nationalbibliothek, sondern die Wienbibliothekim Rathaus verwahrt das Album einer einflussreichen Persönlichkeitder österreichischen Geschichte: Johann Christoph Freiherr vonBartenstein (23. Okt. 1689 Strassburg – 6. Aug. 1767 Wien), der als Sohneines Strassburger Universitätsprofessors zum wichtigsten Berater KaiserKarls VI. aufstieg und dem nach einem viel zitierten Schreiben MariaTheresia die Erhaltung ihrer Monarchie schuldig zu sein bekannte. SeinStammbuch dürfte bisher weder von Historikern noch im Kontext derStammbuchforschung beachtet worden sein.Das Büchlein (Wienbibliothek, I.N. 219.528) in dem für Stammbücherbeliebten oblongen Kleinformat (11 x 16,5 cm) ist in braunes Maroquinledermit ornamentaler Blindprägung gebunden (vgl. Abb. 1), die vonmoderner Hand mit Bleistift durchpaginierten 187 Blätter weisen an allendrei Kanten Goldschnitt auf 7 . Ein eigenes Titelblatt nennt Besitzerund Zweck in Zierschrift (vgl. Abb. 2): Patronis, Fautoribus atque amicis hocsacrum esse voluit iuris utriusque licentiatus (»Johann Christoph Bartenstein, Lizenziatbeider Rechte, hat dieses Buch seinen Gönnern, Förderern und Freundengewidmet«). Das Album enthält insgesamt 68 Widmungen aus den Jahren1710 bis 1715, bei denen es sich ausschließlich um Texteinträge ohne Illustrationenhandelt, was wohl durch das hauptsächlich bürgerliche Milieubedingt ist. Die ranghöchsten Inskribenten sind die Grafen von LeiningenChristian Karl Reinhard (1695–1766) und dessen jüngerer BruderJohann Ludwig Wilhelm (1697–1742) auf den gegenüberliegenden Seiten21/22; die Seiten davor sind entsprechend der üblichen hierarchischenOrdnung als »Respektseiten« für mögliche künftige Einträge Höherstehenderfrei geblieben.Da Bartenstein auf dem Titelblatt mit dem 1711 erworbenen akademischenGrad 8 unterzeichnet (und nur ein einziger Eintrag aus dem Jahr1710 stammt), gab wohl der Studienabschluss bzw. der Aufbruch zur Bildungsreise,die zunächst nach Paris führte, den Anlass zur eigentlichenEröffnung des Stammbuchs: Die Widmungen der Strassburger Inskribenten– vor allem Angehörige der Stadtverwaltung und der Universität,denen Bartensteins Familie zu einem großen Teil verwandtschaftlichverbunden war – sind durchwegs mit Juni und Juli 1711 datiert. Mehrerebeziehen sich ganz konkret auf die Abreise, so Bartensteins Vater, dersich mit einem Vers aus dem zweiten Johannesbrief (8 βλέπετε ἑαυτούς,ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε »Seht euchvor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollenLohn empfangt«) einträgt (S. 137 cum hoc monito Apostolico te, dilectissimeFili, iter ad Exteros parantem a se dimittit … pater tuus »Mit dieser Mahnung38biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 3: Eintrag von Gottfried Wilhelm Leibniz im Stammbuch desJohann Christoph Bartenstein, S. 203 (Wienbibliothek I.N. 219.528)des Apostels entlässt dich, liebster Sohn, dein Vater auf deine Reise insAusland«). Aus Einträgen in Paris, Metz, Bern, Stuttgart, Tübingen, Ulmund Leipzig zu schließen, begleitete das Büchlein Bartenstein auf seinerperegrinatio academica.Angesichts seiner späteren Karriere dürfen die Einträge, die Bartensteinbei seinem Wienaufenthalt im Jahr 1714 sammelte, besonderesInteresse beanspruchen: Der bedeutendste unter ihnen ist zweifellosGottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der sich von Ende 1712 bis 1714in Wien aufhielt 9 , nicht zuletzt um die Gründung einer Akademie voranzutreiben.Er trug sich am 31. August 1714 mit seinem WahlspruchPars vitae quoties perditur hora perit (»Lebenszeit geht verloren, wenn eineStunde vertan wird«; vgl. Abb. 3) ein: Nobilissimo Bartenstenio μνημόσυνονhoc sui reliquit praeclara omnia merenti precatus Godefridus Guilielmus Leibnitius(»dem hochedlen Bartenstein hinterließ dies zu seinem Angedenkenmit allen Wünschen für eine strahlende Zukunft, wie er sie verdient,Gottfried Wilhelm Leibniz«; S. 203). Fügte es sich in diesem Fall günstig,dass Bartenstein eine »internationale« Berühmtheit in Wien antraf – dieswar freilich absehbar und Bartenstein mit einem Empfehlungsschreibenaus Frankreich ausgestattet 10 , so enthält das Stammbuch auch »genuine«Wiener Einträge, darunter den des Präfekten der Hofbibliothek 11 .Selbstdarstellung eines BibliothekarsJohann Benedikt Gentilotti von Engelsbrunn (Trient, 11. Juli 1672 –Rom, 20. Sept. 1725) 12 stammte aus einer Trientiner Adelsfamilie, die übergute Beziehungen nach Salzburg und an den Wiener Hof verfügte. Erstudierte in Salzburg, Innsbruck und Rom, wo er vor allem Kenntnisse in39biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
orientalischen Sprachen erwarb. Nach erfolglosen früheren Versuchen,am Wiener Hof Fuß zu fassen, wurde er 1705 zum Präfekt der Hofbibliothekernannt und trat die Stelle 1706 an 13 . In Gentilottis Amtszeit fieldie Übernahme neapolitanischer Handschriften sowie einer bedeutendenPrivatsammlung, der Bibliothek des Freiherrn Georg Wilhelm vonHohendorf († 1719), Generaladjutant des Prinzen Eugen 14 ; unter seinenVerdiensten ist aber auch die Erstellung eines Handschriftenkatalogsbzw. die Fortsetzung von Lambecks Commentarii zu nennen 15 . Wie seineVorgänger Blotius, Tengnagel und Lambeck führte er eine reiche Korrespondenzmit Gelehrten seiner Zeit 16 .In Bartensteins Album amicorum schrieb er sich am 7. Oktober 1714 ein(S. 232; vgl. Abb. 4):L’età precorse e la speranza, e prestipareano i fior, quando n‘ usciro di frutti. Torq. Tasso cant. 1 st. 58Elegans hic Italicorum Poetarum facile principis locus in te optime quadrat, mi politissime BARTENSTEIN, cuius excellens ingeniumsumma industria excultum eousque aetati antevertit, ut iis annis,quibus multi ad humanitatem informari incipiunt, non vulgarisdoctrinae et eruditionis foetum* edideris. Quare in magnae felicitatisloco pono ex tua litteraria peregrinatione et assiduo ad CaesareamBibliothecam accessu inter nos notitiam, suavissimam consuetudinemEt animorum coniunctionem extitisse. Cuius eousque duraturaeΕς ἂν ὕδωρ τε ῥέοι καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλοι, ἠέλιος τ’ἀνιὼν λάμποι,λαμπρά τε σελήνηHas tibi tabellas obsigno Vindobonae seu Wiennae Austriae ipsis NonisOctobr. A.C. MDCCXIIII Joannes Benedictus GentilottAb EngelsbrunnS.C.M. consil. et Bibliothecae Praefectus* Diatriben historico-iuridicam de belloImperatori Carolo V. a Mauritio SaxoniaeElectore illato etc. excusam Argentorati AC 1710Dem Alter eilte er voraus und der Hoffnung, und schnell erschienendie Blüten, da auch schon die Früchte hervorgekommen waren.Torquato Tasso, Gerusalemme liberata 1, Str. 58Diese feinsinnige Stelle aus dem wohl ersten der italienischen Dichter passt bestensauf Dich, mein hochgebildeter Bartenstein, dessen herausragende Begabungmit höchstem Fleiß gepflegt sosehr dem Alter voraus ist, dass Du in den Jahren,in denen viele erst mit der Ausbildung in den humanistischen Fächern beginnen,schon ein Produkt* keineswegs alltäglichen gelehrten Wissens hervorgebrachthast. Daher halte ich es für ein großes Glück, dass sich durch Deine Studienreiseund Deinen häufigen Besuch der kaiserlichen Bibliothek zwischen uns Bekanntschaft,vertrauter Umgang und Herzensfreundschaft ergeben hat. Als Zeichen,dass sie solange dauern möge,solange Wasser fließt und hohe Bäume grünen,die Sonne aufgehend scheint und der strahlende Mond,unterzeichne ich in diesem Büchlein in Vindobona bzw. Wien in Österreich, anden Nonen des Oktober (=7. Oktober) 1714 Joannes Benedictus Gentilott von Engelsbrunn,der kaiserlichen Majestät Rat und Bibliothekspräfekt40biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
* Historisch-juridische Untersuchung über den Krieg, der von Kurfürst Moritzvon Sachsen gegen Karl V. eröffnet wurde, etc. gedruckt zu Strassburg im JahreChristi 1710Als Gentilotti Bartensteins Stammbuch erhielt, hatte er bereits fast alleauch heute vorhandenen Einträge vor sich, konnte sich also an ihnenorientieren: Sie beginnen ausnahmslos mit einem »Stammbuchvers«,meist einem Zitat aus der heiligen Schrift oder der Literatur der klassischenAntike. Der Nennung des Inskribenten und der Orts- und Datumsangabenwird in der Regel eine Dedikationsformel vorgesetzt, die denBesitzer des Stammbuchs (meist verbunden mit Lob für seinen Studienerfolgund Segenswünschen) im Dativ nennt und in der um künftigesGedenken bzw. Gedenken an die Freundschaft gebeten wird. Immer wiederbietet der Eintrag zusätzlich zum eigentlichen Stammbuchspruchein zweites Motto, das an den linken Blattrand gerückt, das Lebensmottodes Inskribenten darstellt. Während die Sprache des Zitats variiert (nebenlateinischen Sprüchen kommt auch häufig Griechisch und einmalS. 274 Hebräisch zum Einsatz), ist der übrige Text mit einer einzigen Ausnahme(der französischen Eintragung des Charles-Antoine Schreÿvogel,Abb. 4: Eintrag von Johann Benedikt Gentilotti im Stammbuch desJohann Christoph Bartenstein, S. 232 (Wienbibliothek I.N. 219.528)41biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
S. 338 17 ) durchwegs in lateinischer Sprache gehalten. Die Eintragungensind auch formal nach einem einheitlichen Schema gestaltet, dem etwaauch Leibniz folgt 18 : Stammbuchvers und Dedikation sind klar voneinanderabgesetzt, wobei die Dedikation in die rechte Blatthälfte, meist dasrechte untere Blattviertel gerückt ist, oder, wenn umfangreicher, in Kolagegliedert, mittig platziert ist.Gentilottis Eintrag hebt sich von der Mehrzahl der Einträge zunächstoptisch in der Seitengestaltung, dem Abweichen von der beschriebenenStruktur, ab: Ein über die gesamte Blattbreite laufender Text findet sichsonst nur in zwei Pariser Einträgen (S. 278; 280) und demjenigen vonAnton Steyerer SJ auf der Versoseite. Und auch mit der Verwendung vondrei Sprachen, vor allem dem einleitenden Zitat, das die berühmte Vorstellungdes frühreifen Rinaldo aus Torquato Tassos Gerusalemme liberataauf Bartenstein überträgt, sticht Gentilotti durchaus hervor: Es bleibtder einzige Text in italienischer Sprache. In der folgenden Erläuterunggreift Gentilotti die Früchte des Tassozitats mit der antiken Metaphorikgeistigen Gebärens auf und formuliert die Ausbildungsstufe, auf derBartensteins Altersgenossen stünden, nach Ciceros Rede für den DichterArchias – einer Rede, die seit ihrer Wiederentdeckung durch FrancescoPetrarca als Manifest für Bildungswerte gelesen wurde: Mit ad humanitateminformari ist dort die unterste Stufe der Ausbildung im Kindesalterumschrieben, die Grundlegung einer Bildung, die erst Menschsein überein bloßes Dahinleben hinaus ermögliche 19 .Wenn Leibniz die Memorialfunktion des Album amicorum mit demgriechischen Terminus μνημόσυνον anspricht, so Gentilotti, indem erdie gewünschte Dauer der Freundschaft in traditioneller Weise durchGesetzmäßigkeiten der Natur zum Ausdruck bringt. Er bedient sich dabeieines griechischen Zitats, zweier Hexameter aus dem Grabepigrammeines Midas, das schon in der Antike Berühmtheit genoss und mehrfachüberliefert ist: Es wird etwa in Platons Dialog Phaidros (264d) zitiert, erscheintin der Vita des Kleobulos von Lindos (eines der Sieben Weisen)bei Diogenes Laertios (1, 89) und ist auch in der Griechischen Anthologieenthalten (Anthologia Palatina 7, 153). Sogar Homer wird es zugeschrieben(Vita Homeri 11) – dieser Version steht Gentilottis Zitat im Wortlautam nächsten 20 . Das Epigramm ist durch den Mund einer Statue auf demGrabmal gesprochen, die bis in alle Ewigkeit – solange Wasser fließt,hohe Bäume grünen, Sonne und Mond aufgehen – den Vorbeikommendendie Identität des Bestatteten anzeigen und so das Gedenken an ihnwachhalten will.Was ist die Funktion dieser Zitate? Stammbucheinträge richteten sichzwar primär an den Besitzer, hatten jedoch ein sekundäres Publikum inallen späteren Inskribenten, sodass sie als Selbstcharakterisierung und-stilisierung vor einer Öffentlichkeit mit ähnlichem Bildungsniveau anzulegenwaren. Gentilotti erstellt also mit der Wahl der Zitate eine Art»Profil«: Als Italiener zitiert er aus dem anerkannten italienischen Dichter– der gerade auch in Wien hochgeschätzt wurde 21 . Er zeigt sich alsguter lateinischer Stilist, indem er sich am Meister römischer Prosa (undeiner thematisch passenden Rede) orientiert. Schließlich charakterisierter sich mit einem griechischen Zitat als Gelehrter und wohl auch Leitereiner Bibliothek, die seit Lambecks Commentarii gerade für ihre Graecaberühmt war.42biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Bibliotheksbesuche als KarrierestartBereits die ersten Präfekten der Hofbibliothek, Hugo Blotius und seinNachfolger Sebastian Tengnagel, hatten von Wien aus durch Korrespondenzenund persönliche Bekanntschaft mit Bibliotheksbesuchernein Gelehrtennetzwerk aufgebaut und die Hofbibliothek zu einem Ortwissenschaftlicher Kommunikation werden lassen 22 . Nach einer wenigergut dokumentierten Phase, wohl auch kriegsbedingter Stagnationpositionierte Peter Lambeck (1628–1680; Präfekt seit 1663) mit seinenCommentarii die Bibliothek in der Gelehrtenwelt vor allem als Fundgrubevon unediertem handschriftlichem Material. Als solche war sie Ziel vongelehrten Reisenden, in der Amtszeit von Lambecks Nachfolger, DanielNessel (1680–1700) etwa Jacobus Tollius (1633–1696), der in seinem viertenReisebrief (Epistola itineraria IV: Commoratio Viennensis) vom Besuch derHofbibliothek und der Einsichtnahme in Klassikerhandschriften währendseines Wienaufenthalts berichtet 23 . An der Universität Strassburghatte schon der Historiker Johann Heinrich Böckler (1611–1672), der Vatervon Bartensteins »Dissertationsbetreuer«, mit Peter Lambeck korrespondiert,u. a. über die Historia Austrialis des Enea Silvio Piccolomini undihre Überlieferung 24 . Lambeck vermittelte in seinen Commentarii aberauch den Eindruck besonderen kaiserlichen Interesses an der Bibliothekund charakterisierte seine eigene Stellung damit als eine durch Herrschernäheausgezeichnete.Bartensteins häufige Besuche in der Hofbibliothek, wie sie von Gentilottierwähnt werden, hatten einen konkreten Anlass: Bartensteins Interessegalt einer griechischen Handschrift, einem Origenes zugeschriebenenPsalmenkommentar (recte Hesych von Jerusalem; Cod. Theol. Gr.311), den er auf Bitten von Bernard de Montfaucon für die von Charles Dela Rue (1684–1740) geplante Origenes-Ausgabe zu transkribieren versprochenhatte 25 . Der Wunsch nach einer Abschrift gab einen willkommenenAnlass, mit einem wissenschaftlichen Anliegen in der Hofbibliothekvorstellig zu werden, ein Anliegen, das zudem die guten Beziehungendes Protestanten Bartenstein zu den angesehenen Maurinern hervorhobund ihn quasi automatisch empfahl. Die Arbeit selbst hätte Bartensteinfreilich gerne delegiert. Als sich dies als unmöglich erwies, versuchteer unter Hinweis auf die beschränkte Öffnungszeit der Bibliothek eineAußerhausentlehnung der Handschrift zu erwirken, und erbat, da dieHofbibliothek in das Ressort des Obersthofmeisteramts fiel, von Leibnizeine Empfehlung an den Obersthofmeister Anton Florian von Liechtenstein– der damit grundsätzlich über die konkrete Anfrage hinaus aufden ambitionierten jungen Mann aufmerksam gemacht werden konnte 26 .Ein Besuch der Hofbibliothek gehörte für Bartenstein also nicht nurzum Pflichtprogramm eines Wienaufenthalts, er fügt sich auch gut indas Gesamtbild seiner Anfänge in Wien, wie es die Forschung anhandvon Korrespondenzen entworfen hat: Um sich für eine Laufbahn in kaiserlichenDiensten zu profilieren, nützte Bartenstein gezielt seine Kompetenzauf dem Gebiet der Geschichtswissenschaften und führte sichmit bereits bestehenden Beziehungen zu Gelehrten bei ähnlich interessiertenPersönlichkeiten ein, die zugleich eine Verbindung zum Hof eröffnenkonnten. Dass er Gentilotti dabei in einer Schlüsselposition sah,geht aus einem Brief an Montfaucon vom 8. Jänner 1716 hervor, in dem erGentilottis Verhältnis zum Kaiser als »presque le favori« beschreibt 27 . Die-43biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 5: Eintrag von Anton Steyerer im Stammbuch des Johann Christoph Bartenstein,S. 233 (Wienbibliothek I.N. 219.528)se Instrumentalisierung von Netzwerken der res publica litterarum erwiessich in der Tat als geeignete Taktik, das Fehlen familiärer Verbindungen,über die ein Adeliger verfügte, erfolgreich auszugleichen.Wie das Stammbuch dabei unterstützend wirkte, dürfte die Rückseitevon Gentilottis Eintrag zeigen: Hier schrieb sich der Jesuit Anton Steyerer(1673–1741) ein, der in gelehrten Kreisen wegen seiner historischenForschungen Ansehen genoss 28 , aber wohl auch aufgrund seiner Beziehungzum Kaiserhaus – er war Beichtvater der Töchter Josephs I. – eineninteressanten Kontakt für Bartenstein darstellte. Da die Positionierungdes eigenen Eintrags eine Aussage enthalten kann und insbesondere synoptischeEintragungen (wie die des Brüderpaars der Grafen von Leiningen)oder die Verwendung der Versoseite eines bestehenden Eintrags aufein enges Verhältnis der Inskribenten hindeuten 29 , darf angenommenwerden, dass der Kontakt von Gentilotti vermittelt worden war bzw. diefreundlichen Worte des Bibliothekars Bartenstein dem Jesuiten empfohlenhatten. Wohl bewusst gestaltete Steyerer seinen Eintrag auch formalganz ähnlich dem Gentilottis – vielleicht auch, um sich von der Vielzahlder protestantischen Strassburger Widmungen abzuheben (vgl. Abb. 5).»Social media« der Frühen NeuzeitAusführliche Stammbucheinträge mit einer direkten Anrede desStammbuchhalters im Vokativ, die in einer Ich-Aussage des Inskribentenseine Beziehung zum Stammbuchhalter thematisieren, nähern sich eineranderen Textsorte an, die ebenfalls der Pflege von amicitia und demAufbau von Netzwerken in der res publica litterarum diente: dem Freund-44biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
schaftsbrief, in dem man einander der auf gemeinsamen Interessen undIdealen – in der Regel als Orientierung an der Antike und Eifer in literarischerBetätigung gefasst – beruhenden Wertschätzung versichert. Diegrundsätzliche Nähe der Textsorten Stammbucheintrag und Brief zeigtsich nicht zuletzt darin, dass Zitate aus antiken Briefen bzw. Briefgedichtenals Einträge verwendet werden – auch in Bartensteins Stammbuch:Johann Kaspar Khun († 1720), Gatte von Bartensteins Stiefschwester MariaDorothea 30 , beginnt seinen Eintrag (S. 186) mit einem zur Situationpassenden Cicerobrief, fam. 15,21 adressiert an den nach Spanien abreisendenC. Trebonius:»Reliquum est, ut tuam profectionem amore prosequar, reditum spe exspectem,absentem memoria colam, omne desiderium litteris mittendis accipiendisque leniam.Im übrigen gibt Dir meine Liebe das Geleit auf Deiner Reise; Deine Rückkehr willich hoffnungsvoll erwarten, in Deiner Abwesenheit Dich im Gedächtnis bewahrenund alle Sehnsucht durch das Wechseln von Briefen stillen.«Unmittelbar angeschlossen sind Verse aus einem Gedicht, mit dem derunter Kaiser Domitian schreibende Papinius Statius einem vornehmenRömer gute Reise und glückliche Heimkehr wünscht (Silvae 3,2 PropempticonMaecio Celeri). Der Theologieprofessor Johann Heinrich Barth (1680–1719) hat seinen Eintrag (S. 166) aus zwei Cicerobriefen an P. CorneliusLentulus Spinther, fam. 1,6 und 1,7 zusammengesetzt. In beiden Fällensind die Zitate zwar korrekt ausgewiesen, doch kann der Inskribent unmittelbarin die Rolle des antiken Briefschreibers schlüpfen und durchdessen Mund den Stammbuchhalter als neuen Adressaten ansprechen;es passt, dass sowohl Khun als auch Barth in der folgenden Zueignungdie Anrede in der zweiten Person verwenden.Als Sammlungen von Selbstzeugnissen bzw. Selbstdarstellungen vonInskribenten bzw. Briefschreibern stellen Alba amicorum und commerciumlitterarum, Stammbücher und aufbewahrte Briefwechsel, vergleichbareDokumentationen von Netzwerken dar, und es ist ein seltener Glücksfallfür die Forschung, wenn von ein und derselben Persönlichkeit sowohlStammbuch als auch selbst angelegte Korrespondenzsammlung erhaltensind: An der Österreichischen Nationalbibliothek trifft dies etwa für denschon genannten ersten Präfekten Hugo Blotius zu. Im Falle Bartensteinshaben wir zwar keine Sammlung, die dem Stammbuch entsprechenwürde, jedoch sowohl von ihm selbst als auch von Gentilotti Briefe aneinen gemeinsamen Bekannten, den Melker Benediktiner Bernhard Pez(1683–1735), die sich komplementär heranziehen lassen. Die Bedeutung,die Bartenstein dem Kontakt zu Gentilotti beimaß, wird deutlich, wenner sich um eine neutrale Position zu den zwischen Pez und Gentilotti entstandenenUnstimmigkeiten bemüht zeigt 31 . Ein Brief Gentilottis an denselbenAdressaten wirft dagegen Licht auf die Konventionen von Stammbucheinträgen– in denen es die Höflichkeit gebot, die frühe Reife einesam Ende seiner Ausbildung stehenden jungen Mannes zu loben. Etwasüber ein halbes Jahr nach seiner Eintragung in Bartensteins Stammbuchscheint Gentilotti nicht mehr ganz so überzeugt von der Berechtigungdes Tassozitats; zu Bartensteins Verärgerung, dass sich seine Hoffnungenin Wien nicht schnell genug erfüllten, schreibt er am 22. Juni 1715 32 : eumjuvenem plurimi merito suo facio et in oculis fero, iudicium tamen quod nondumadolevit in nonullis requiro (»Diesen jungen Mann schätze ich nach Verdienst45biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
sehr hoch und behalte ihn im Auge; allerdings vermisse ich in manchemsein Urteilsvermögen, das noch nicht zur Reife gelangt ist«).Appendix: Exlibris, politische Maxime und StammbuchspruchDer Eintrag des Bibliothekspräfekten in Bartensteins Album amicorumkann die Frage aufwerfen, ob/wie Bartenstein die Hofbibliothek in späterenJahren als Leser nützte. Denn über der Funktionalisierung gelehrterNetzwerke sollte nicht übersehen werden, dass Bartensteins spätereKarriere, sowohl seine publizistische Tätigkeit im Dienst Maria Theresias,als auch seine Rolle im Unterricht des Kronprinzen durchaus denpraktischen Einsatz gelehrten Wissens, insbesondere auf dem Gebietder Reichsgeschichte und des Reichsrechts erforderte, wie er es schon inseiner Dissertation über den Konflikt zwischen Moritz von Sachsen undKarl V. unter Beweis gestellt hatte. Bartenstein verfügte jedenfalls übereine eigene Bibliothek, sie hat sich jedoch nicht geschlossen erhalten,wie auch der größte Teil seines Nachlasses verschollen ist 33 . Eine Identifizierungeinzelner Exemplare erlaubt sein Exlibris, das in der Regel aufder Innenseite des Vorderdeckels eingeklebt ist (vgl. Abb. 6). In wie weiteine Rekonstruktion für die Beurteilung des Politikers aufschlussreichwäre, lässt sich derzeit nicht erkennen; die bisher nachgewiesenen 25Titel zeigen eine allgemein späthumanistische Ausrichtung, die noch aufBuchbesitz von Bartensteins Vater zurückgehen könnte. Das in der ÖNBvorhandene Buch (59.M.119), das zusammengebunden eine vom StrassburgerProfessor (und Exilösterreicher) Matthias Bernegger (1582–1640)und dessen Schüler Johannes Freinsheim (1608–1660) besorgte Ausgabevon Justus Lipsius’ Politica (Strassburg 1641) und Johann Heinrich BoecklersAbhandlung über dieselbe Schrift (Dissertatio de politicis Justi Lipsii.Strassburg 1642) enthält (vgl. Abb. 7), mag jedoch die Grundlagen vonBartensteins politischer Orientierung in seiner Strassburger Ausbildungillustrieren 34 .Ein in dieser Hinsicht interessanter Rückbezug auf Studienzeit undfrühes Umfeld scheint vom genannten Exlibris zu einem Stammbucheintragmöglich: Der Kupferstich (Platte 14,2 x 8,5 cm) zeigt unter derÜberschrift Insignia D[omini] Io[annis] Christophori S[acri] R[omani] I[mperii]L[iberi] Baronis de BARTENSTEIN das Wappen, das Bartenstein seit seinerErhebung in den Reichsfreiherrnstand 1733 führte; als subscriptio erscheintein (ausgewiesenes) Zitat aus dem spätantiken römischen DichterClaudius Claudianus, seinem Lobgedicht zum Konsulat des FlaviusManlius Theodorus im Jahr 399 (Panegyricus dictus Manlio Theodoro consuli)227f. Peragit tranquilla potestas quod violenta nequit (»ruhige Macht führtaus, was Gewalt nicht vermag«). In der so gepriesenen Persönlichkeitdes gelehrten Schriftstellers, der hohe Hofämter bekleidete, mochte sichBartenstein wiedererkennen und er bezeichnet das Zitat in einem Vortrag(22. Okt. 1759) über den Geschichtsunterricht Erzherzog Josephs – indem er in Hinblick auf das Königreich Böhmen rücksichtsvollen Umgangmit ständischen Privilegien und Freiheiten anmahnt – explizit als seinsymbolum, als Wahlspruch und Handlungsmaxime seit jungen Jahren 35 .Sucht man eine Anregung für die Wahl, so bietet sich das Titelkupferdes 1720 erschienenen 18. Bandes des Theatrum Europaeum an, der ebendieses Claudianzitat auf die Politik des Hauses Österreich (im Gegensatzzu Frankreich und Türken) bezieht (vgl. Abb. 8) 36 .46biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 6: Exlibris des Johann Christoph Bartenstein aus: Justus Lipsius,Politicorum libri sex. Argentorati (Strassburg) 1641 (ÖNB 59.M.119)47biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 7a: Justus Lipsius, Politicorum libri sex. Argentorati (Strassburg) 1641(ÖNB 59.M.119)48biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 7b: Johann Heinrich Boeckler, Dissertatio de politicis Iusti Lipsii. Argentorati(Strassburg) 1642 (ÖNB 59.M.119 Adl.)49biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Abb. 8: Titelkupfer aus: Theatri Europaei Achtzehender Theil. Frankfurt am Main:Anton Heinscheidt 1720(Wien, Universitätsbibliothek III-23.803/18)50biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Caesaris Austriaci peragit tranquilla potestasQuod violenta nequit Galli Turcaeque furentisO nimium dilecta deo cui militat aetherAustria salva manet fato protecta supernoIn mediis turbis hanc juvat ipse Deus.In Ruhe erreicht die Macht des Kaisers aus dem Haus Österreich, was mit Gewaltdie des Franzosen und des rasenden Türken nicht vermag. O von Gott vielgeliebtesÖsterreich, für das der Himmel kämpft, vom Schicksal aus der Höhe beschütztbleibt es heil, Gott selbst unterstützt es mitten in den (Kriegs)Wirren.In nuce kommt ein verwandter Gedanke, Skepsis gegenüber Gewalt,die langfristig nicht erfolgreich sein kann, jedoch bereits in einem derStammbucheinträge zum Ausdruck: Am 1. Mai 1714 hat sich in TübingenC.L. Hölder mit Omne violentum non est diuturnum eingetragen (S. 349). Inleichter Variation ist Violentum perpetuum nullum in der frühen Neuzeitein beliebter Spruch, der letztlich auf Aristoteles, De caelo 1,2 zurückgeführtwerden kann und in unterschiedlichen Kontexten erscheint, bevorzugtjedoch – etwa in einer Sammlung von Rechtsgrundsätzen bzw.Rechtssprichwörtern 37 – in politischem Sinn als Warnung, dass einer Gewaltherrschaftkeine Dauer beschieden ist. Gewiss bedurfte Bartensteinnicht der Anregung durch diesen Stammbucheintrag; da Stammbücherjedoch auch gemeinsame Werte von Besitzer und Inskribenten reflektieren,mag er ein Schlaglicht auf das Klima werfen, das während seinerStudienzeit bzw. Studienreise in Bartensteins Umgebung herrschteund ihn prägte, und so auch die Aussagekraft eines frühneuzeitlichenFreundschaftsbuchs unter einem weiteren – auch für die Bibliothek interessanten– Aspekt beleuchten.1 Grundlegend W.W.Schnabel, Das Stammbuch.Konstitution und Geschichteeiner textsortenbezogenenSammelform bis ins erste Dritteldes 18. Jahrhunderts. Tübingen2003 (Frühe Neuzeit 78). DieAnalogien zu Netzwerkenim Internet werden in rezenterLiteratur zu frühneuzeitlichenAlba amicorum vielfachreflektiert. Eine besonderskonzise Gegenüberstellungbietet: S. Reinders, MappingSocial Networks: An OrdinaryHabit. A comparison between›old‹ and ›new‹ socialnetwork mapping serviceshttps://sophiereinders.files.wordpress.com/2014/06/mapping-social-networks.pdf (4. 6. <strong>2015</strong>).2 Das Interesse derVerfasserin wurde durchdie zu früh verstorbeneMitarbeiterin an der HandschriftensammlungderÖsterreichischen Nationalbibliothek,Mag. BrigitteMersich, geweckt; mit ihrgemeinsam entstand für dievon der Universität Wienveranstaltete Kinderuni2006 das Skriptum Wollt ihrmeine Freunde sein? Freundschaftsbücheraus alter Zeit.3 Chr. Gastgeber,Blotius und seine griechischenKontakte. LeontiosEustratios Philoponos undder Erzbischof Gabriel vonAchrida im Stammbuch desHugo Blotius. <strong>Biblos</strong> 46 (1997)247–258.4 C. Sojer, Chr. Gastgeber,Das Stammbuch desLukas Holste (1616–1623).Bericht aus dem ForschungsprojektPeter Lambeck.<strong>Biblos</strong> 62 (2013) 33–53. Vgl.auch F.J.M. Blom, LucasHolstenius (1596-1661) andEngland. In: G.A.M. Janssens,F. Aarts (edd.), Studiesin Seventeenth-centuryEnglish Literature, Historyand Bibliography. Amsterdam1984 (Costerus N.S. 46)25–39.5 Die Einträge Tengnagelslassen sich überdas von W.W. Schnabel ander UB Erlangen betreuteRepertorium eruieren:RAA=Repertorium alborumamicorum. Internationales51biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Verzeichnis von Stammbüchernund Stammbuchfragmentenin öffentlichen und privatenSammlungen http://www.raa.phil.uni-erlangen.de (4. 6.<strong>2015</strong>).6 Die Kunstsammlungendes Augustiner-ChorherrenstiftesSt. Florian, bearb.von V. Birke u.a. Red. unterder Leitung von E. Vancsavon M. Vyoral-Tschapka undTh. Brückler. Wien 1988(Österreichische Kunsttopographie48) 45.7 An allen drei Kantenlässt sich geringfügigerTextverlust feststellen, derwohl auf eine Neubindungzurückzuführen ist.8 Die Defensio der juridischenDissertation De haeredipetis(Über Erbschleicher)fand am 12. Juni 1711 statt;die historische Dissertationhatte Bartenstein dagegennach dem Titelblatt schonam 28. Oktober 1709 verteidigt:M. Braubach, JohannChristoph von BartensteinsHerkunft und Anfänge.Mitteilungen des Instituts fürösterreichische Geschichtsforschung61 (1953) 99–149; hier101f. Das zeitliche Verhältnisist verkehrt bei Wallnig(Anm. 14) 178.9 J. Bergmann, Leibnitzin Wien. Nebst fünf ungedrucktenBriefen desselbenüber die Gründung einerkais. Akademie der Wissenschaftenan Karl Gust.Heräus in Wien. Sitzungsberichteder philosophisch-historischenKlasse 13 (1854) 40–61;G. Hamann, G.W. LeibnizensPlan einer Wiener Akademieder Wissenschaften. In:Johannes Dörflinger (Hg.),Die Welt begreifen und erfahren.Aufsätze zur Wissenschafts- undEntdeckungsgeschichte. GüntherHamann zur Emeritierung.Wien 1993 (Perspektiven derWissenschaftsgeschichte 1)162–182.10 Bartenstein führtesich mit einem Schreibendes Abbé Jean Paul Bignon(1662–1743) späterer (ab1718) königlicher Bibliothekar,ein: Brief Nr. 340(datiert Isle St Cosme sousMeulan, 6. September 1713).Benützt in der Transkriptionfür die Leibniz-Akademieausgabeder Leibniz-Forschungsstelle Hannoverhttp://www.gwlb.de/Leibniz/Leibnizarchiv/Veroeffentlichungen/Transkriptionen.htm (5. 6. <strong>2015</strong>).11 Neben Gentilotti undSteyerer: Charles-AntoineSchreÿvogel (3. Juli 1714;S. 338), Sohn des kaiserlichenRats und Wechselherrnin der kaiserlichenNiederlage, GottfriedChristian von Schreyvogel,(Datenbank der FranckeschenStiftungen zu Hallehttp://192.124.243.55/cgi-bin/gkdb.pl; 5. 6. <strong>2015</strong>). In Wienhat sich am 2. Sept. 1714auch Johann Conrad Pfeffel,späterer Bürgermeistervon Colmar und Vater desSchriftstellers Gottlieb KonradPfeffel, eingetragen, undzwar auf der Rückseite desEintrags von BartensteinsReisegefährten ConradWidow. WahrscheinlichBartenstein selbst hat in derrechten bzw. linken oberenEcke S. 362/363 vermerkt:latera / amica (etwa »FreundeSeite an Seite«). Ein ähnlicherEintrag findet sich aufden Seiten 360/361 an analogerStelle: jungit / paginaamicos (»Die Seite verbindetFreunde«).12 A. A. Strnad, DerTrientiner Johann BenediktGentilotti von Engelsbrunn(1672–1725). Notizen zueinem Lebensbild. In: ders.,Dynast und Kirche. Studienzum Verhältnis von Kircheund Staat im späterenMittelalter und in derFrühen Neuzeit. Innsbruck1997 (Innsbrucker historischeStudien 18/19) 553–586. M. P.Donato, Gentilotti, GiovanniBenedetto. Dizionario Biograficodegli Italiani 53 (1999)287f.; I. Peper, Th. Wallnig,Ex nihilo nihil fit. JohannBenedikt Gentilotti und JohannChristoph Bartensteinam Beginn ihrer Karrieren.In: G. Haug-Moritz, H.-P.Hye, M. Raffler (Hg.), Adel im»langen« 18. Jahrhundert. Wien2009 (Zentraleuropa-Studien14) 167–185.13 Zum Datum des Amtsantritts:Peper (Anm. 12) 168,Anm. 514 L. Strebl, Die barockeBibliothek (1663–1739). In: J.Stummvoll (Hg.), Geschichteder Österreichischen Nationalbibliothek.Erster Teil: DieHofbibliothek (1368–1922).Wien 1968 (Museion N.F. II3,1) 165–217; hier 194-196.15 ÖNB, Cod. S.N.2207–2221, S.N. 2199–2200.Die Fortsetzung von LambecksCommentarii befindetsich in Trento, Bibliotecacomunale, mss. 1549–1553.Vgl. Donato (Anm. 12) 288.16 I. Peper, Il carteggioerudito di GiovanniBenedetto Gentilottid’Engelsbrunn (1672–1725),bibliotecario imperiale. In:C. Viola (Hg.), Le carte vive.Epistolari e carteggi nelSettecento. Atti del primoConvegno internazionale distudi del Centro di Ricercasugli Epistolari del Settecento,Verona, 4–6 dicembre2008. Roma 2011 (Bibliotecadel XVIII secolo 16), 479–487.17 Vgl. Anm. 11.18 Vgl. das Schema beiSchnabel (Anm. 1) 146.19 Cicero, Pro Archia poeta4 Nam ut primum ex puerisexcessit Archias, atque ab eisartibus quibus aetas puerilis adhumanitatem informari solet sead scribendi studium contulit… (»Sobald nämlich Archiasdem Knabenalter entwachsenwar und sich nach Vollendungder gewöhnlichenStudien, mit denen manim Knabenalter zu höhererBildung geführt wird, derSchriftstellerei zuwandte«).20 Ein Überblick überdie verschiedenen Fassungenist zu finden bei:R. Merkelbach, J. Stauber(Hgg.), Steinepigramme ausdem griechischen Osten. Bd. 1:Die Westküste Kleinasiens von52biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Knidos bis Ilion. Stuttgart,Leipzig 1998, 557–559.21 A. Aurnhammer,Torquato Tasso im deutschenBarock. Tübingen 1994 (FrüheNeuzeit 13). Im Jahr 1718sollte Gentilotti mit anderenneapolitanischen Handschriftendas Autographder Gerusalemme conquistataübernehmen: Strebl (Anm.14) 184.22 P. Molino, Viaggiatori,eruditi, famuli e cortigiani:il multiforme pubblicodella Biblioteca Imperialedi Vienna alla fine del XVIsecolo. In: B. Borello (Hg.),Pubblico e Pubblici di anticoregime. Pisa 2009, 101–125;dies., L’Impero di carta: HugoBlotius Hofbibliothekar nellaVienna di fine Cinquecento.Diss. Florenz, EuropeanUniversity Institute 2011; St.Benz, Die Hofbibliothek zuWien als Ort des Wissens.In: M. Scheutz, W. Schmale,D. Stefanová (Hgg.), Ortedes Wissens. Bochum 2004(Jahrbuch der österreichischenGesellschaft für die Erforschungdes 18. Jahrhunderts 18/19),15–48.23 Jacobi Tollii Epistolaeitinerariae ex auctoris schedispostumis recensitae [...]cura et studio Henrici ChristianiHenninii. Amstelaedai:Halma 1700 (ÖNB BE.8.M.41).24 M. Wagendorfer, DieEditionsgeschichte der »HistoriaAustrialis« des EneasSilvius Piccolomini. DeutschesArchiv für Erforschung desMittelalters 64 (2008) 65–108;Addendum: 597–602.25 Genaue Auskunft gibtein Brief Bartensteins anBernhard Pez vom 5. Sept.1714: Die gelehrte Korrespondenzder Brüder Pez. Text,Regesten, Kommentare. Hg. v.Th. Wallnig und Th. Stockinger.Bd. 1: 1709–1715. Wien2010 (Quelleneditionen desInstituts für ÖsterreichischeGeschichtsforschung 2)Nr. 353, 580f. Vgl. Wallnig(Anm. 12) 180, Anm. 74.26 Nr. 42 (August 1714):zum Text s. Anm. 10.27 Wallnig (Anm. 12) 181,Anm. 77. Ob sich dies erstdurch die Bauplanung ergaboder Bartensteins Wahrnehmungbereits 1714 durch dasvon Lambeck beanspruchteNaheverhältnis gelenktwar, lässt sich wohl kaumentscheiden.28 St. Benz, ZwischenTradition und Kritik. KatholischeGeschichtsschreibung imbarocken Heiligen RömischenReich. Husum 2003 (HistorischeStudien 473) 432–434.Zu Briefen Bartensteins anSteyerer: Wallnig – Stockinger(Anm. 25) 9, Anm. 42.29 So verwenden auchBartensteins SchwagerKhun und sein Vater dasselbeBlatt, S. 186/187. Vgl. auchAnm. 11.30 Braubach (Anm. 8)104f.31 Wallnig – Stockinger(Anm. 25) Nr. 459; 748-750.32 Wallnig (Anm. 12)Anm. 77. Der Brief ist ediertbei: Wallnig – Stockinger(Anm. 25) Nr. 406; 675f.33 Wallnig – Stockinger(Anm. 25) 32.34 An der UniversitätsbibliothekWien sind dagegenderzeit bereits sechzehn Büchermit Bartensteins Exlibrisnachgewiesen; mithilfevon Katalogen im Internetlassen sich Exemplare inamerikanischen, englischen,slowakischen, tschechischenund ungarischenBibliotheken recherchieren;auch im Antiquariatshandeltauchen einzelne Exemplareauf.35 Recht und Verfassungdes Reiches in der Zeit MariaTheresias. Die Vorträge zum Unterrichtdes Erzherzogs Josephim Natur- und Völkerrecht sowieim Deutschen Staats- und Lehnrecht.Unter Mitarbeit von G.Kleinheyer, Th. Burken undM. Herold hg. von H. Conrad.Köln [u.a.] 1964 (WissenschaftlicheAbhandlungender Arbeitsgemeinschaftfür Forschung des LandesNordrhein-Westfalen 28),116. Zitiert auch bei D. Bea-les, Writing a life of JosephII. The problem of his education.In: G. Klingenstein,G. Stourzh (Hgg.), Biographieund Geschichtswissenschaft.Aufsätze zur Theorie und Praxisbiographischer Arbeit. Wien1979 (Wiener Beiträge zurGeschichte der Neuzeit 6), 183–207; hier 201. DasZitat ist als Motto noch derposthum gedruckten SchriftKurzer Bericht von derBeschaffenheit der zerstreutenzahlreichen Illyrischen Nationin kaiserl. königl. Erblanden(Frankfurt – Leipzig 1802)vorangestellt.36 Dabei sind offenkundigweniger die Jahreim Blick, denen der Bandgewidmet ist, als Ereignissezwischen diesen unddem Erscheinungsdatum:die Türkensiege PrinzEugens und der Friede vonPassarowitz 1718, sowie dieBeendigung des spanischenErbfolgekriegs mit den Friedensschlüssenvon Utrechtund Rastatt 1713/1714.37 Georg Tobias Pistorius,Thesaurus paroemiarumGermanico-iuridicarum.Teutsch=JuristischerSprichwörter=Schatz. Lipsiae:typis Joh. Casp. Muller1716, 275f. (ÖNB 1380-A).53biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Klecker • Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) Politikers | 34–51
Katrin JilekDer Freundschaft gewidmetStammbücher des 16. und 17. Jahrhunderts in derHandschriftensammlung der ÖsterreichischenNationalbibliothekStammbücher, oft auch als Album oder Liber Amicorum bezeichnet, gibtes seit etwa 450 Jahren. In der Zeit der Reformation, ausgehend von Wittenberg,begann man damals vor allem im adeligen und bürgerlichenMilieu Stammbücher zu führen. Im Laufe der Zeit haben verschiedenesoziale Schichten die Sitte aufgegriffen. Seit etwa 1850 kennt man dieseBücher als Poesiealben.Die Alben dokumentieren den Stamm der Freunde, Verwandten undGesellen, die sich darin meist mit Lebensweisheiten und Zeichnungeneingetragen haben. Verbreitet waren vor allem kleine querformatige Lederbände,die leicht zu transportieren waren, da man die Stammbücherauf Bildungs- und Geschäftsreisen wie auch Kavalierstouren immer mitsich führte. Dabei sollten sie freundschaftliche Begegnungen festhaltenund den Inhaber nach seiner Rückkehr in die Heimat fortwährend daranerinnern, aber auch Dritte mit dem Bekanntheitsgrad der darin versammeltenPersonen beeindrucken.Als besondere Beigaben zu Eintragungen in Freundschaftsbüchernsind bereits im 16. Jahrhundert bildliche Darstellungen überliefert. Nebenden anfänglichen Wappendarstellungen waren später besondersThemen aus der klassischen Mythologie und der antiken Geschichtsschreibungsowie vor allem aus dem Alten Testament entlehnte biblischeSzenen beliebt. Meist wurden diese von talentierten Laien oder eigensdafür beauftragten Malern angefertigt.Beigaben des späteren 18. und 19. Jahrhunderts stammen oftmals ausdem Bereich des Kunsthandwerks. Neben Stickereien oder Klebe- undFlechtarbeiten aus Papier und Stoff finden sich gelegentlich auch kunstvollgeflochtene, oft mit Seidenbändern durchzogene Haarkränzchenoder gepresste Blumen.Stammbücher gelten als ein Spiegel der Gesellschaft. Sie sind für vielegeisteswissenschaftliche Disziplinen von großem Interesse, da sie überdie Biografie des Inhabers hinaus Rückschlüsse auf geschichtliche, religiöseund politische Strömungen erlauben. Die Einträge dokumentierenNetzwerke persönlicher Beziehungen und dienen Historikern bei dersystematischen Erforschung bestimmter Personenkreise. Die Literaturgeschichtefindet Hinweise auf die Bekanntheit von Autoren oder dieVerwendung literarischer Motive. Illustrationen entpuppen sich als reizvolleSchätze für die Kunstwissenschaft wie auch für die Kulturgeschichte,und Musikwissenschaftler profitieren von den darin enthaltenen Notenfunden.54biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Abb. 1: Bildnis Martin Luthers und Beginn des Eintrags von Erasmus Reinhold(Cod. Ser. n. 13996, fol. 5v/6r)Abb. 2: Eintrag von Eintrag von Nicolaus Medler und Johannes Luther(Cod. Ser. n. 13996, fol. 17v/18r)55biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Die Österreichische Nationalbibliothek besitzt in ihren Sammlungen(v.a. in der Sammlung von Handschriften und alten Drucken) ca. 250Stammbücher und unzählige Albumblätter bekannter Persönlichkeiten,darunter beispielsweise Gustinus Ambrosi, Wolfgang von Goethe, FranzGrillparzer, Immanuel Kant, Arthur Schnitzler und von Johann bzw. RichardStrauss.Ausgewählte Stammbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert sollen imfolgenden Beitrag kurz vorgestellt werden.Ein Stammbuch Martin Luthers? 1Den Anfang macht hierbei das älteste Stammbuch der ÖsterreichischenNationalbibliothek aus dem Umkreis Luthers und Melanchthons.Die Anfänge der Stammbuchsitte sind in Wittenberg zur Zeit der Reformationzu beobachten. Als zeitgenössischer Bericht über die neue Gepflogenheitist die vom Humanisten Joachim Camerarius verfasste und PhilippMelanchthon gewidmete Biografie Vita Melanchthonis 2 anzusehen, inder er en passant auch kurz schildert, dass Zeitgenossen damit begannen,eigenhändige Einträge der berühmten Persönlichkeiten auf zusammengeheftetenPapierbögen und in Büchern bzw. Büchlein zu sammeln, um sieanderen vorführen zu können. 3 Ein solches kleines Büchlein aus der Reformationszeitist das mit folgendem Titel versehene Stammbuch: Lutheriè Schola Doctorum Virorum Autographa Scripta. Von außen eher unscheinbarwirkend, umfasst die Handschrift lediglich 24 Blatt, die in einem Papierumschlagzusammengeheftet sind. Einzig der Goldschnitt kann als äußeresZierelement genannt werden. Was früher in der Autografensammlung derHandschriftenabteilung unter der Signatur Autogr. XIII/45 geführt wurde,wird heute unter der Signatur Cod. Ser. n. 13996 verwahrt und in früherenKatalogeinträgen als Stammbuch Martin Luthers bezeichnet. [Abb. 1]Es enthält Einträge von 29 Zeitgenossen Luthers, die hier in der Reihenfolgeder Einträge im Stammbuch aufgeführt werden. In Klammerwerden das Jahr des Eintrags und die Folioangaben genannt 4 :[1] Caspar Hedio (1550; fol. 2r-3v)[2] Johannes Sleidanus (1550; fol. 4r)[3] Nicolaus Gerbelius (1550, fol. 4r)[4] Erhartus Schnepfius (1556, fol. 4v)[5] Unbekannt (ohne Jahr; fol. 5v) 5[6] Erasmus Reinholdus (1547; fol. 6r-6v)[7] Philippus Melanchthon (1546; fol. 7r-9r)[8] Nicolaus Glossenus (1546; fol. 9v)[9] Caspar Cruciger (1546; fol. 10r-10v)[10] Antonius Niger (1546; fol. 11r)[11] Unbekannt (ohne Jahr; fol. 11r)[12] Paulus Eberus (1546; fol. 11v-12v) 6[13] Caspar Bornerus (ohne Jahr; fol. 13r)[14] Wolfgangus Meurerus (ohne Jahr; fol. 13r)[15] Georg Sabinus (ohne Jahr: fol. 13r)[16] Joachim Camerarius (ohne Jahr; fol. 13v)[17] Alexander Alesius (ohne Jahr; fol. 13r)[18] Johannes Langus (1547; fol. 14r-14v)[19] Victorinus Strigelius (1546; fol. 15r-15v)56biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
[20] Vitus Winsemius (ohne Jahr; fol 16r-17r) 7[21] Nicolaus Medler (1546; fol. 17v)[22] Johannes Lutherus (ohne Jahr; fol. 18r) 8[23] Unbekannt (ohne Jahr 18r) 9[24] Jacobus Milichius (ohne Jahr; 19r-19v)[25] Theodorus Fabricius (ohne Jahr; 20r-20v)[26] Johann Bugenhagen(1546; 21v) 10[27] Georgius Maior (1546; fol. 22r)[28] Joannes Stigelius (1546; fol. 22v)[29] Johannes Marcellus (1546; fol. 23r-23v)Die datierten Eintragungen des Stammbuchs stammen aus dem Zeitraum1546 bis 1556. Dies bedeutet aber, dass sie erst im Sterbejahr Luthers,er starb im Februar 1546, einsetzen und weitere zehn Jahre nachseinem Tod fortgesetzt wurden. Somit ist es als unwahrscheinlich anzusehen,dass es sich hierbei um ein Stammbuch aus dem Besitze MartinLuthers handelt, sondern eher aus dem Umkreis der Reformatoren inWittenberg. Bereits unter Hugo Blotius (kaiserlicher Hofbibliothekarvon 1575-1608) kann diese Handschrift im Besitz der Hofbibliothek nachgewiesenwerden. [Abb. 2]Bisher hat diese kleine, unscheinbare Handschrift in der Forschungwenig Aufmerksamkeit erfahren, weshalb eine genauere Analyse derHandschrift noch aussteht. Es bleibt also abzuwarten, ob zukünftig geklärtwerden kann, wer der Besitzer dieses Stammbuchs war. 11Album Amicorum des Iohannis Luzenberger 12Diese Handschrift besteht aus insgesamt 239 Blatt in einem schlichtenPergamenteinband. Das Stammbuch Johann Luzenbergers umfasstdie Jahre 1580 bis 1600. Die Eintragungen stammen aus Süddeutschlandund Italien und sind in lateinischer, italienischer und deutscher Spracheabgefasst. Viele von ihnen wurden in Ingolstadt angefertigt, da derBesitzer des Stammbuchs wohl einen Großteil seines Studiums an derhiesigen Universität zubrachte. Dieses Stammbuch bildet aber nichtnur das universitäre Netzwerk des Johann Lutzenbacher ab, sondern istauch eine besonders interessante Quelle für die rege Reisetätigkeit vonStudenten – sei es weil sie öfters die Universitäten wechselten oder Bildungsreisenin fremde Länder unternahmen. Neben den Eintragungenaus Süddeutschland sind zahlreiche Stammbuchinskriptionen aus Siena,Bologna, Padua, Venedig und Neapel zu finden. Besonders auffallend istin diesem Stammbuch aber der reiche Bilderschmuck. Nicht nur zahlreicheWappendarstellungen schmücken dieses Stammbuch, sondernbeispielsweise auch die Abbildung des Bucintoro [Abb. 3] in Venedig, demeinstigen Staatsschiff der Dogen, welches auch früher unter dem Begriffder Goldenen Barke geführt wurde. Darüber hinaus befinden sich in diesemStammbuch auch für die historische Kostümkunde von Interesseseiende Frauenbildnisse [Abb. 4] und weitere Darstellungen verschiedenerBerufe und Würdenträger, darunter ein Bildnis des venezianischenDogen oder einer Bäuerin [Abb. 5]. 13Stammbuch des Lukas Holste 14Das Stammbuch von Lukas Holste (1596-1661) zeigt beispielhaft denAufbau und die Pflege von Netzwerken unter Gelehrten des 17. Jahrhun-57biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Abb. 3: Die goldene Barke der Dogen von Venedig (Cod. 12871, fol. 8v)Abb. 4: Frauenbildnis(Cod. 12871, fol. 139v)Abb. 5: Eine Bäuerin(Cod. 12871, fol. 200v)58biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Abb. 6: Eintrag von John Rouse(Second librarian der Bodleian Library,Cod. 9660, fol. 126r/177r)Abb. 7: Zahlenrätsel des Heino Lambeck(Cod. 9660, fol. 172r/223r)59biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
dert. Lukas Holste, bekannt als Humanist, Bibliothekar und Geograph,studierte ab 1616 Medizin und klassische Sprachen in Leiden. 1617 bis1618 begleitete Holste den Historiker und Geograph Philipp Clüver aufdessen Reise durch Italien. 1622 folgte eine Reise nach England undFrankreich, wo er 1624 zum Katholizismus konvertierte. Francesco Barberini,italienischer Kardinal und Kunstmäzen, holte ihn 1627 zunächstals Sekretär, ab 1636 als Bibliothekar, zu sich. Unter Papst Urban VIII.(Onkel des Francesco Barberini) wurde Holste zum päpstlichen Konsistorialsekretärund Protonotar ernannt. Papst Innozenz X. berief Holsteschließlich zum Kustos der Biblioteca Apostolica Vaticana.Mit Beginn seines Studiums fing Lukas Holste an ein Stammbuch zuführen 15 , wenn auch nur für kurze Zeit, da die datierten Einträge mitdem Jahr 1623 bereits wieder enden. Das insgesamt 186 Blatt umfassendeStammbuch, gebunden in einem dunkelbraunen Ledereinband mitGoldprägung, kam über Holstes Neffen Peter Lambeck (kaiserlicher Hofbibliothekarvon 1663-1680) in die Bibliothek. Nicht alle Blätter sind beschriebenworden, viele von ihnen blieben frei, sei es als »Pufferblätterfür allfällige Nachträge im Umfeld von Personenkreisen« oder aus derAbsicht heraus »Distanz« schaffen zu wollen, wie es Christian Gastgeberund Claudia Sojer in ihrem Beitrag erläutern. 16Die im Stammbuch enthaltenen 60 Einträge stammen zum einen ausseinem direkten universitären Umfeld. So findet sich Johannes Meursius17 (1579-1639), Professor für Geschichte und Griechisch an der Universitätin Leiden, ebenso darin, wie auch der Historiker Philipp Clüver (1580-1622) 18 , den Holste auf seiner Italienreise begleitete. Zahlreiche Einträgescheinen anlassbezogen vor Reisen erfolgt zu sein; 19 sei es um die Eintragungenals Erinnerungen an geschätzte Personen mitnehmen zu können,sei es vielleicht auch, dass man an den bereisten Orten Eintragungenals Empfehlungsschreiben vorzeigen konnte. Zum anderen brachteer aber auch von seinen Reisen neue Stammbuchinskriptionen mit. DieEinträge von Johann Guler von Weineck 20 oder von Kaspar Schoppe 21 ,stammten vermutlich von seiner Italienreise 1618. Bei beiden Eintragungenhandelt es sich um vormals lose Blätter, die nachträglich in dasStammbuch eingeklebt wurden. Weitere Einträge stammen von seinerReise nach England und Frankreich. So beispielsweise die Eintragungender beiden Bibliothekare der Bodleian Library in Oxford: Thomas James(first librarian) 22 und John Rouse 23 (second librarian) [Abb. 6]. Buchschmuck,wie beispielsweise Wappenabbildungen und Zeichnungen, sind in diesemStammbuch kaum vertreten, dafür finden sich aber mehrere Notenbeispiele24 und ein Zahlenrätsel 25 des Heino Lambecks, Holstes Schwager[Abb. 7].Stammbuch des Laurentius von Lauriga von Lorberau 26Das Stammbuch von Laurentius von Lauriga von Loberau, ist in der Zeitzwischen 1603 und 1679 mit zahlreichen Eintragungen in Deutsch undLatein versehen worden. Es schließt auch das ältere Album von JohannJoachim Feyertager zu Haitzendorf ein. Lauriga von Loberau war Roemisch-Kayserlicher Hoffdiener und Eisenbeschreyber in Leoben [Abb. 8]. 27 Das Stammbuchbesteht aus 229 Blatt und umfasst 140 Einträge, darunter sind vieleder berühmtesten und einflussreichsten österreichischen Adelsgeschlechterder Zeit: Colloredo, Dietrichstein, Herberstein, Windischgraetz und60biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Abb. 8: Besitzvermerk durchLaurentius von Lauriga von Lorberau(Cod. Ser. n. 18954, vorderer Spiegel)Abb. 9: Der Astronomus,handkolorierter Kupferstich(Cod. Ser. n. 18954, fol. 129a)Abb. 10: Umzug eines osmanischen Prinzen (Cod. Ser. n. 18954, fol. 26v/27r)61biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Abb. 11: Eintragdes Rektors PeterLauremberg(Cod. 9711, fol. 47r)Abb. 12: Eintrag des Studenten Petrus Mederus (Cod. 9711, fol. 183r)62biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
Harrach, um nur einige wenige zu nennen. Das besondere sind bei diesemStammbuch aber die vielen und qualitativ hochwertigen Illustrationen:fünf ganzseitige Zeichnungen, ca. 100 Wappendarstellungen, ca. 40 Abbildungenvon Kostümen bzw. Trachten und 59 Kupferstiche des Totentanz,die von Eberhard Kieser nach Vorbildern von Hans Holbein gestochenwurden [Abb.9].Die meisten Einträge des Stammbuchs werden von farbigen Wappenabbildungenbegleitet. Viele der Eintragungen stammen von FreundenLauriga von Loberaus aus der Zeit der Türkenkriege und spiegelnseinen Aufenthalt von 1624 bis 1631 in Konstantinopel wieder. Aus dieserZeit stammen zweifelsfrei auch die Kostümstudien und Darstellungenverschiedener Berufe. Beeindruckend ist die Vielfalt der ganzseitigen Abbildungen,beispielsweise ein Straßenkampf bei Nacht, mythologischerSzenen wie z.B. die Sage von Pyramus und Thisbe, oder eine doppelseitigeIllustration, die einen Umzug eines osmanischen Prinzen mit seinemGefolge zeigt [Abb. 10].Stammbuch des Martin Nessel 28Das Stammbuch von Martin Nessel, der aus Weißkirchen in Mährenstammte und Vater des späteren Hofbibliothekars Daniel Nessel war,umfasst Einträge aus den Jahren 1634 bis 1643. Sein Studium in Wittenberg(seit 1629) musste er wohl wegen finanzieller Schwierigkeiten1631abbrechen. Nach einer dreijährigen Tätigkeit als Konrektor im Gymnasiumvon Schemnitz, nahm er 1634 sein Studium wieder auf, nun aber ander Universität in Rostock. Doch bereits zwei Jahre später brach er dieseswieder ab, um abermals in Gymnasien in Uelzen, Minden (1641-1644) undAurich (1646-1655) tätig zu sein. Von 1655 bis 1666 stand er der Domschulein Bremen als Rektor vor. Ein Jahr später ist seine Anwesenheit in Wienbelegt, 1673 verstarb er in Wien oder auch in Brünn. 29 Die Eintragungenin seinem Stammbuch beziehen sich auf seine Studienzeit in Rostockund stammen von Kommilitonen und Professoren, unter anderem vonPeter Lauremberg [Abb. 11], dem Rektor der Universität in Rostock, unddem Studenten Petrus Mederus [Abb. 12], der dort neben seiner Doktorwürdeauch den Dichterkranz als kaiserlich gekrönter Dichter erhielt. 30Ausgeschmückt wurde das Stammbuch mit Federzeichnungen, farbigenBildern und Musiknoten. 31Die hier gezeigte Auswahl kann – bedingt durch die vorgegebenenGrenzen – nur eine subjektive sein. Die vielen weiteren Stammbücherder Sammlung von Handschriften und alten Drucken, nicht nur aus dem16. und 17. Jahrhundert, harren weiterhin einer genaueren Untersuchungund Darstellung. Eine detaillierte Aufarbeitung (Katalogisierung) derStammbücher – beispielsweise im Rahmen eines Projekts – wäre durchausdenkbar und wünschenswert.63biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
1 ÖNB, Cod. Ser. n.13996.2 J. Camerarius, De PhilippiMelanchthonis Ortv, TotivsVitae Cvrricvllo Et Morte […].Leipzig o.J., 63. Zitiert nachW. Schnabel, Das Stammbuch.Konstitution und Geschichteeiner textsortenbezogenenSammelform bis ins erste Dritteldes 18. Jahrhunderts. Tübingen2003, 244.3 Schnabel, Stammbuch,244.4 Die Texte der einzelnenEinträge finden sichbei: G. Loesche, Ein angeblichesStammbuch Luthersin der k. k. Hofbibliothek zuWien. Zeitschrift für Kirchengeschichte23(1902), 269-278.5 Hierbei handelt essich um das Porträt MartinLuthers von unbekannterHand.6 Die Einzelblätter11r-11v und 12r-12v wurdenin falscher Reihenfolgeeingebunden. Die korrekteAbfolge wäre: 12v, 12r, 11v,was zur Folge hat, dass NigersEintrag auf Eberus folgtund nicht umgekehrt.7 Auf fol. 16r (kleinerZettel) befindet sich dasEnde des Texts und die Unterschriftvon Winsemius,auf fol. 17r der Anfang desText.8 Bei Blatt 18 handeltes sich wohl um einenausgelösten Spiegel in einerHandschrift oder einemDruck.9 Dieser Eintrag wurdemit einem ML-Monogrammunterzeichnet. Es handeltsich aber nicht um eineeigenhändige EintragungLuthers, sondern stammtvon einer fremden, nochunbekannten Hand.10 Auch bei diesem Blatthandelt es sich wieder umein aus einem Einbandspiegelausgelöstes Blatt.11 Neben kürzerenErwähnungen in Ausstellungskatalogen,diehauptsächlich das darinenthaltene Luther-Porträtbehandeln und welche überunsere Literaturdatenbank»Literatur zu Handschriften«(http://www.onb.ac.at/sammlungen/hschrift/bibliographie.htm)eingesehenwerden können, gibt eslediglich den bereits obenzitierten Aufsatz, der sichmit dem gesamten Objektauseinandersetzt: Loesche,Stammbuch, 269-278.12 ÖNB, Cod. 12871.13 Weitere Beispiele fürStammbücher von Studentenbietet folgender Aufsatzvon O. Mazal, Stammbüchervon Studenten aus demBesitz der ÖsterreichischenNationalbibliothek, in:Arbeitsgemeinschaft HoheSchulen [Hrsg.], ÖsterreichischeHochschulkunde. Wien1965, 59-68.14 ÖNB, Cod. 9660.15 Holste signierte es auffol. IIIr (neue Foliierung) mit1.April 1618.16 C. Sojer; C. Gastgeber,Das Stammbuch des LukasHolste (1616-1623). Berichtaus dem ForschungsprojektPeter Lambeck. <strong>Biblos</strong> 62/1(2013), 33-53, hier 36.17 Johannes van Meurs,ÖNB, Cod. 9660, fol. 65r/116r.Da dieses Stammbuch einealte und eine neue Zählungaufweist, werden beidegenannt (alte Zählung/neueZählung).18 ÖNB, Cod. 9660, fol.50r/101r.19 ÖNB, Cod. 9660, fol.58v-59r/fol.109v-fol. 110roder fol. 49r/100r.20 ÖNB, Cod. 9660, fol.1r/52r.21 ÖNB, Cod. 9660, fol.85r/136r.22 ÖNB, Cod. 9660, fol.104r/155r.23 ÖNB, Cod. 9660, fol.126r/177r.24 Beispielsweise: ÖNB,Cod. 9660, fol. 174r/225r.25 ÖNB, Cod. 9660, fol.172r/223r.26 ÖNB, Cod. Ser. n.18954.27 ÖNB, Cod. Ser. n.18954, Eintrag im Spiegeldes Vorderdeckels.28 ÖNB, Cod. 9711.29 Eine ausführlicheBiografie, auf der auchdiese Zusammenfassungbasiert, findet sich unter:http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Nessel.pdf [19.06.<strong>2015</strong>].30 http://www.deutschebiographie.de/sfz59733.html[19.06.15].31 http://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/BLO/Nessel.pdf[19.06.<strong>2015</strong>].64biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Katrin Jilek • Der Freundschaft gewidmet | 52–62
MonikaKiegler-GriensteidlFreundschaftsschreibenMusterbriefe aus deutschsprachigen Briefstellerndes 17. und 18. Jahrhunderts.Mit einer kurzen Entwicklungsgeschichte»Was geschrieben ist, wird genauer bemerkt, als was manbloß hört; man muß sich daher um desto mehr hüten,durch seine Briefe einen Eckel zu erwecken.« 1Die Geschichte der Brieflehre hat eine lange Tradition. Bereits das Altertum2 verwendete Briefmuster, ab dem 11. Jahrhundert finden sich erstmalsumfangreichere lateinische Zusammenstellungen von Brief- und Urkundenmustern(»formulae«), die im 12. Jahrhundert durch einen theoretischenTeil ergänzt und ab dem 14. Jahrhundert zunehmend eingedeutschtwerden. 3 Ab dem 15. Jahrhundert erscheinen regelmäßig deutschsprachigeMusterbücher mit Anweisungen zur Erstellung von Briefen, Verträgenu.ä. Durch die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und diezunehmende Verschriftlichung der Verwaltung kommt der geschriebenendeutschen Sprache auch in diesem Kontext eine immer größere Bedeutungzu. Mit dem wachsenden Bedarf für die Praxis der Schreiber, Notareund Sekretäre in den städtischen und höfischen Kanzleien nehmen diePublikationen mit Musterbriefen und -verträgen rapide zu.Der Begriff »Briefsteller«, ein aus der heute nicht mehr gebräuchlichenWendung »Briefe stellen« entstandener Begriff, begann sich im deutschsprachigenRaum als Bezeichnung für die Gattung der Brieflehr- und-musterbücher Ende des 17. Jahrhunderts durchzusetzen. 1692 verwendeteder deutsche Jurist, Rhetorikprofessor und Schriftsteller August Bohse(1661-1740) diesen Terminus erstmals in seinem Buch Der allzeitfertigeBriefsteller 4 als Bezeichnung für ein Briefmuster und Brieflehrbuch undlöste damit gängige Bezeichnungen wie »Formulari«, »Formularbuch«oder »Kanzleibüchlein« ab. Bis dahin bezog sich der Ausdruck »Briefsteller«im Allgemeinen auf die Person des (professionellen) Briefschreibers. 5Bis ins 17. Jahrhundert geht aus den deutschsprachigen Briefstellerndeutlich hervor, dass unter dem Begriff »Brief« zunächst einmal alleSchriftstücke, die in den Kanzleien zirkulierten, subsumiert wurden. Somitlässt sich der Brief bis dahin nicht eindeutig von anderen Formendes Schriftverkehrs trennen. Erst im 17. Jahrhundert kristallisiert sichder Brief im deutschsprachigen Raum in seiner heutigen Bedeutung alsGeschäfts- bzw. Privatbrief heraus. Vorlagen für Verträge, Urkunden etc.verschwinden gänzlich aus den Briefstellern oder werden zumindest getrenntvon den Briefvorlagen geführt. Das juristisch-notarielle Momenttritt zugunsten des sprachlich-stilistischen zurück. Im 18. Jahrhundertweitet sich der Briefverkehr auf breitere Kreise der Ober- und Mittelschichtaus und übernimmt als Kommunikationsmittel verstärkt auchdie Funktion des Austausches von privaten Informationen und/oder derUnterhaltung der jeweiligen Leserschaft.65biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Die soziale Dimension des Briefes gewinnt an zentraler Bedeutung -über geographische, soziale und andere Grenzen hinweg soll das freundschaftlicheGespräch fortgeführt werden können und so zur Festigungder Freundschaft dienen. 6Neben dem Schreiben von Briefen erfreut sich nun auch das Vorlesenim Freundeskreis zunehmend größerer Beliebtheit. Die laute Brieflektürein den Freundeszirkeln dient nicht nur der Unterhaltung, sonderneben auch der Vertiefung des Zugehörigkeitsgefühls der Freunde.Einhergehend auch mit dieser Entwicklung verändern sich derSchreibstil und dementsprechend die Merkmale der Anleitungen zum(richtigen) Briefschreiben. Briefsteller ermutigen zu mehr Natürlichkeitund fordern u.a. mit dem deutschen Germanisten Johann Christoph Adelung7 die »Lebhaftigkeit des Styles« 8 . Erste Vorbilder für diese Entwicklungzu mehr Gefühl und weg von dem formalhaften, trockenen und teilsüberladenen Kanzleistil kamen vor allem aus Frankreich. Federführendwar u.a. die französische Adelige Mme Sévigné 9 , die insbesondere in denBriefen an ihre Tochter aber auch an andere Adressatinnen und Adressateneinen Stil im Sinne der scheinbaren größtmöglichen Leichtigkeit,Natürlichkeit und Spontaneität kunstvoll einsetzte. Trotz des Aufwandesan Zeit und Überlegung, den sie in die Briefe investierte, dachte sie selberoffensichtlich nie daran, eine von ihr besorgte oder auch nur lizenzierteSammlung drucken zu lassen. Erste Briefsammlungen erschienen erstnach ihrem Tod und erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit. Insbesonderediese Orientierung an Frankreich und der galanten Sprache desHofes bewirken eine Wendung hin zu mehr Natürlichkeit im Schreibstilder Briefe. Eine genaue Definition des galanten Gesellschaftsideals istschwierig, ganz allgemein formuliert Tanja Reinlein in ihrem Buch DerBrief als Medium der Empfindsamkeit: »Der kleinste gemeinsame Nenner ist dabei,daß es sich um ein an Frankreich orientiertes Bildungsideal und Lebensprogrammhandelt.« 10Der deutsche Jurist und Philosoph Christian Thomasius (1655-1728), einWegbereiter der Frühaufklärung in Deutschland, bietet eine zeitgenössischeund damit unmittelbare Wahrnehmung bzw. Zuordnung:»Aber a propos was ist galant und ein galanter Mensch? Dieses dürffte uns inWarheit mehr zuthun machen als alles vorige, zumahl da dieses Wort bey uns Teutschenso gemein und so sehr gemißbrauchet worden, daß es von Hund und Katzen,von Pantoffeln, von Tisch und Bäncken, von Feder und Dinten, und ich weiß endlichnicht, ob nicht auch von Aepffel und Birn zum öfftern gesagt wird. So scheinet auch,als wenn die Frantzosen selbst nicht einig wären, worinn eigentlich die wahrhafftigeGalanterie bestehe. Mademoiselle Scudery beschreibet dieselbe […] als wennes eine verborgne natürliche Eigenschaffte wäre, durch welche man gleichsam widerWillen gezwungen würde einem Menschen günstig und gewogen zu seyn, beywelcher Beschaffenheit denn die Galanterie und das je ne Sçayquoy […] einerleywären. Ich aber halte meines Bedünckens davor, daß […] es etwas gemischtes sey,so aus dem je ne Sçay quoy, aus der guten Art, etwas zu thun, aus der Manier zuleben, so am Hofe gebräuchlich ist, auß Verstand, Gelehrsamkeit, einem guten Judicio,Hoflichkeit, und Freudigkeit zusammen gesetzet werde und dem aller Zwang,Afféction und unanständige Plumpheit zuwider sey.« 11Das Wesentliche ist also nach Thomasius das »gewisse Etwas«, das »Jene sais quoi« (»je ne Sçay quoy« , wörtlich: ich weiß nicht was), das einen66biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Menschen oder eine Sache anziehend macht(e), eine Mischung aus Verstand,Gelehrsamkeit, Urteilsvermögen, Höflichkeit und Freudigkeit imUmgang miteinander.Mit der zunehmenden Begeisterung und Liebe für das Briefeschreiben– von Zeitgenossen durchaus auch kritisch betrachteten – »Briefleidenschaft«bzw. »Briefschreibesucht« 12 vervielfachten sich im 18. Jahrhundertdie Briefsteller und publizierten Briefsammlungen als Anleitung und Anregungzum (richtigen) Briefschreiben. Demgemäß wird dieses Jahrhundertauch als das Jahrhundert der Briefe bezeichnet.Der wohl einflussreichste und populärste Vertreter der Entwicklungim deutschsprachigen Sprachraum zu mehr Natürlichkeit und Lebhaftigkeitim Schreibstil war der zu seiner Zeit wahrscheinlich meistgelesenedeutsche Dichter Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769). Seine Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen, erstmals1751 erschienen, markieren einen Wendepunkt in der Geschichteder praktischen Brieflehre. Er bietet darin Modelle, Empfehlungen undErläuterungen zu mehr briefstellerischer Natürlichkeit, einem freieren,individuelleren aber auch einfacheren und klareren Schreibstil und übtheftige Kritik an allzu starren Regeln. Gellert wendet sich gegen die Regelbriefsteller,da diese »gleichsam als Hüter, damit unsre Gedanken nicht ausihren Fesseln entrinnen können« 13 auftreten. Damit wird einer seiner – berechtigten– zentralen Kritikpunkte deutlich, nämlich dass – gemäß derIntention der Autoren der Briefsteller – nur das mitgeteilt werden kann,wofür sich eben auch ein entsprechendes Muster, ein entsprechenderInhalt in den Mustersammlungen findet. Gellert kritisiert auch Autorenanhand konkreter Beispiele wie den aus Schlesien stammenden DichterBenjamin Neukirch (1665-1729), der in seiner Anlehnung an die Modeerscheinungender Galanterie, nicht nur mehr Lebhaftigkeit im Schreibstilsondern auch eine starke Tendenz zu Ironie und Koketterie aufweist.So schreibt Gellert: »Ein Exempel von der unnatürlichen Schreibart wollen wiraus Neukirchs galanten Briefen nehmen, die man jungen Menschen zum Unglückeimmer als Muster guter Briefe, angepriesen hat.« 14 Gellert wendet sich insbesonderegegen die »unnatürliche Schreibart«, da diese seinem Ideal eineseinfachen und leichten Stils entgegensteht: »Der erste Begriff, den wir mitdem Natürlichen, insbesondere in Briefen, zu verbinden pflegen, ist das Leichte;dieses entstehet aus der Richtigkeit und Klarheit der Gedanken; und aus der Deutlichkeitdes Ausdrucks.« 15Somit markiert der Höhepunkt gewissermaßen gleichzeitig auch bereitsdas Ende der Publikationen zur praktischen Brieflehre. Mit derEntwicklung hin zu einem individuelleren, persönlicheren und daherweniger an Konventionen gebundenen Stil geht die Bedeutung und Sinnhaftigkeitvon Briefstellern insbesondere im privaten Bereich zurück.So ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Genre Mitte des 18. Jahrhundertswieder aus der Mode geriet. Anleitungen zu Briefen und dennötigen Formalien mussten und müssen dessen ungeachtet nach wie vorgegeben werden und finden sich daher bis heute in diversen Ratgebern.»Man bediene sich also keiner künstlichen Ordnung, keiner mühsamen Einrichtungen,sondern man überlasse sich der freywilligen Folge seiner Gedanken, undsetze sie nach einander hin, wie sie in uns entstehen: so wird der Bau, die Einrichtung,oder die Form eines Briefs natürlich seyn.« 1667biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Musterbriefe – Beispiele»Der Nutzen, welchen die Briefe den Menschen leisten, ist von großer Wichtigkeit.So viel Vortheile aus der Mittheilung der Gedanken fließen: so viel gutes kann manauch durch Briefe erlangen. Sie haben einen großen Einfluß in das gesellschaftlicheLeben, und sie geben das bequemste Mittel, solches auch mit den entferntesten Personenzu unterhalten.« 17Ein sehr erfolgreiches Beispiel für einen deutschsprachigen Briefstellerdes ausgehenden 17. Jahrhunderts, der allerdings noch im Zeichen desKanzleistils und der durch den gesellschaftlichen Rang der Adressaten undAbsender festgelegten Konventionen steht, ist die Teutsche Secretariat-Kunst(1673 erstmals erschienen, hier 1705) des deutschen Schriftstellers undSprachwissenschaftlers Caspar von Stieler (1632-1707), selbst mehrere Jahreals Sekretär tätig, wie – nicht weiter verwunderlich – viele der Verfasservon Briefstellern. Allein bis 1726 wurde das Werk viermal aufgelegt undlieferte dadurch zwei Generationen die Normen des Briefschreibens. Imersten Kapitel des dritten Teils »Von der allgemeinen Einteilung der Briefe« erläutertStieler die Haupt-Charakteristika eines »Freundschaftsschreibens«:»Dannenhero wir … alle und jede Briefe in zweyerlei Geschlechte sondern, und sie,entweder (.) Geschäfte- und Freundsschaftschreiben nennen. … Die Freundschaftsschreibensind, um Erhaltung guten Vertrauens, Wolwollens und Fortsetzung derBekantschafft willen, eingeführet … Oft begiebts sich, daß solche Schreiben einenguten Weg zur Erlangung der Gewogenheit, Hülfe, Beystandes, Beförderung, Ehreund Reichtums bahnen … An der gleichen Aufwartungsstelle treten diese Freundschaftsschreiben,da man bey allerhand Gelegenheiten, so die Zufälle dieses Lebensdarbieten, den guten Willen an sich ziehet, nehret und erhält. Bald erlanget einereinen Ehrenstand, er verreiset, kömt wieder, er kranket, geneset, heurahtet, wirdeines Kindes Vater, oder verlieret dasselbe durch den Tod etc. da bezeuget man seineFreude und Betrübnis, durch Glückwunsch und Beyleyd, nach Beschaffenheit derSache. … Die Seele solcher Schreiben ist die Darlegung der Gewogenheit, und weilsie der Sachen ermangelt, so behilft sie sich mit schönen Worten und Redensarten,schmücket ihre Rede aus mit der kunst und Bluhmwerk, und bemühet sich auf da8euserste, durch Eröffnung der innerlichen Liebesregung, sich beglaubt zu machen.« 19Abb. 1: Caspar vonStieler: TeutscheSecretariat-Kunst.Bd. 1. Frankfurt:Hoffmann 1705Signatur:332177-D.Alt-MagDas Zweyte Kapitel.Von den Besuchungsschreiben.S. 26568biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb. 2: Caspar von Stieler:Teutsche Secretariat-Kunst.Bd. 1. Frankfurt: Hoffmann1705.Signatur: 332177-D.Alt-Mag.Das fünfte Kapitel. Vonden Trostschreiben. Exempeleines Trostschreibenswegen übel gerahtenerKinder. Vertrauter Freund.S. 320Viel benutzt wurde auch Der Teutsche Secretarius (1661) des deutschenDichters Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658). Das vorliegende Buchstammt aus der Bibliothek des deutschen Polyhistor, Rechtsgelehrtenund Orientalisten Johann Christoph Wagenseil (1633-1705) und gelangtedurch einen späteren Ankauf in die Österreichische Nationalbibliothek. 19Harsdörffer rückt den höfischen Sprachstil neben die in den Kanzleienübliche Rhetorik stärker ins Blickfeld, so heißt es im Zwischentitel zuden »höflichen Gruß- Freund- und Feindschaffts-Brieflein«, dass diese »Nach heutzu Tag üblicher Hof-Art verabfast« sind.Er definiert seine Stilprinzipien in der Kürze, der Klarheit, der Gebräuchlichkeitder Worte und tritt insbesondere für die Pflege der deutschenMuttersprache ein. Dazu schreibt er in seinem Abschlussgedichtzur Vorrede in der Ausgabe des Teutschen Secretarius von 1661, welchesdem »verständigen Leser« gewidmet ist: »Der liebt die teutsche Sprach undpflegt rein Teutsch zu schreiben.« 20Die Brieflehre Curiöse Gedancken von Deutschen Briefen, wie ein junger Mensch,sonderlich ein zukünftiger POLITICUS; die galante Welt wohl vergnügen soll (1719)des deutschen Schriftstellers, Dramatikers und Pädagogen Christian Weise(1642-1708), der besonders für seine Schuldramen und satirischen Werkeüber soziale und politische Missstände seiner Zeit bekannt ist, zeigtbereits eine deutliche Abwendung vom starren Kanzleistil. Auch reformierter den bis dahin üblichen fünfgliedrigen Aufbau der Briefe 21 undentwickelt eine dreiteilige Struktur, die sogenannte »Chria« oder »Chrie«,die durch ein »Initial- und Final-Compliment« eingerahmt wird.69biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb. 3: Georg Philipp Harsdörffer: Der Teutsche Secretarius. Nürnberg: Endter 1661Signatur: 720714-A.Alt-Mag. Der ander Theil. bestehend In höflichen Gruß- FreundundFeindschafft-Brieflein, Nach heut zu Tag üblicher Hof-Art verabfast. S. 28-2970biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb.4: Christian Weise: Christian Weisens curiöse Gedancken von Deutschen Briefen.Leipzig [u.a.]: Mieth 1719. Signatur: BE.12.S.9.Alt-PrunkDas II. Capitel. Wie man das Fundament besser suchen soll. XVI. Eben so lässetsich ein Trost-Schreiben disponiren. S. 44-4571biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb. 5: Benjamin Neukirch: Anweisung zu Teutschen Briefen. Leipzig: Fritsch 1721.Signatur: 659569-B.Alt-Mag. Frontispiz und Titelblatt72biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb. 6: Benjamin Neukirch: Anweisung zu Teutschen Briefen. Leipzig: Fritsch 1721.Signatur: 659569-B.Alt-Mag. Das XII: Capitel. Von galanten freundschafftsbriefen.S. 210-21173biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Die »Chrie« setzt sich aus den zwei Hauptteilen, dem »Antecedens« unddem »Consequens«, zusammen, die durch die »Connexio« verknüpft waren.Im »Antecedens« soll der Briefeschreiber die Gründe seines Schreibensnennen, um dann im »Consequens« seine Erwartungshaltung zuformulieren.Benjamin Neukirch formuliert in seiner »Anweisung zu Teutschen Briefen«(1721) deutlich seine Interpretation des galanten-höfischen Stils:»Die höflichkeit ist dem menschen so nöthig, als wie das kleid am leibe. … solassen wir doch zuweilen unsren unverstand blicken. Denn wir schreiben und antwortenihm entweder gar nicht; oder wir schreiben ihm nicht, wenn er will; oderwir schreiben ihm endlich nicht, was wir sollten. Und durch solche nachlässigkeitzerfällt offt die gantze freundschafft: da wir hingegen durch eine geringe dienstfertigkeit,nicht allein unsern freund, sondern auch unsern ruhm erhalten. Zu derhöflichkeit gehören die complimente. Zu den complimenten aber höfliche worte.« 22Die Brieftheorien des deutschen Pädagogen und lutherischen TheologenJohann Christoph Stockhausen (1725-1784) Grundsätze wohleingerichteterBriefe, nach den neuesten und bewährtesten Mustern der Teutschen und derAusländer (erstmals 1751 erschienen, hier 1773) gehören mit den SchriftenGellerts zu den zentralen Publikationen, welche dem auch für diePrivat-Korrespondenz bis dahin gültigen Maßstab des im Formelhaftenerstarrten Kanzleistils die Prinzipien der Natürlichkeit entgegenstellen.So schreibt er in der Einleitung der Ausgabe seines Briefstellers von 1766:»Wo würde das Freye, das Lebhafte und Muntere bleiben, welches alles Kunstmäßigeso ungern verträgt? Wo haben Cicero und Plinius, das schöne Paar vonBriefstellern, eine Weisianische Chrie vor sich gehabt? Wo denken Frauenzimmernach dieser Form, die doch oft so vortrefflich schreiben?« 23Stockhausen findet mit seinem Werk großer Anerkennung, Gellertnennt Stockhausen in seinem Brieflehrbuch ausdrücklich als positivesBeispiel, der Schriftsteller Friedrich von Hagedorn (1708-1754) schreibtin einem Brief 1750: »Mir gefallen seine Grundsätze wohleingerichteter Briefe,die ich zu lesen, angefangen, so sehr, daß ich wünschen möchte, ihn zu kennen« 24Die Frage, ob es sich bei den Musterbriefen um reale oder fiktive Briefehandelt, bleibt in den meisten Briefstellern unbeantwortet. Stockhausenbenennt häufig Absender bzw. Adressat, so findet sich auch der hierabgebildete Brief Christian Fürchtegott Gellerts an eine Freundin mitNennung des Absenders Gellert in seiner Mustersammlung. Gellert äußertsich explizit in seinem Brieflehrbuch Briefe, nebst einer PraktischenAbhandlung von dem guten Geschmacke in Briefen (erstmals 1751 erschienen,hier 1765) dazu: »Die gegenwärtigen Briefe haben das Verdienst, an wirklichePersonen und ohn alle Absicht des Drucks, geschrieben zu sein.« 25Die Musterbriefe in Gellerts Sammlung gehen überwiegend auf Originalbriefezurück, die allerdings für den Zweck des Briefstellers stilistischund sprachlich überarbeitet und aus denen sämtliche persönliche Datengetilgt wurden.74biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
Abb. 7: Johann Christoph Stockhausen: Grundsätze wohleingerichteter Briefe.Wien: Trattner 1773. Signatur: 305704-A.Alt-MagDer zweyte Theil. Von den verschiedenen Arten der Briefe. Des zweytenTheils erstes Hauptstück. Von Complimentschreiben und scharfsinnigenBriefen. Exempel I. und Exempel II. S. 200-201Abb. 8:ChristianFürchegott Gellert:Briefe, nebst einerPraktischen Abhandlungvon dem gutenGeschmacke in Briefen.Wien: Trattner1765. Signatur:303327-A.Alt-Mag.Briefe. Vier undfunfzigster Brief.An eine Freundinn.S. 278-27975biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
1 C. F. Gellert, Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmackein Briefen. Wien: Trattner1765, 122 Es wird angenommen,dass bereits in der Antikehäufiger Mustersammlungenangelegt wurden, vondenen allerdings nur spärlicheReste erhalten blieben.3 Die mittelalterlichenMuster- und Lehrbücher, fürdie sich der Begriff Formularbücherbzw. Formulaedurchgesetzt hat, sind engan antike Vorbilder gebunden.Als Vorlagen dientenneben Urkunden und denzahlreichen im Alltag eingesetztenBriefen privatenund/oder geschäftlichenInhalts auch literarischeBriefe, Briefsammlungen,meist nur scheinbar aneinen Empfänger gerichteteBriefe philosophischen bzw.belehrenden Inhalts. BedeutendeBriefsammlungenhaben u.a. Cicero, Pliniusoder Seneca hinterlassen;die weiteste Verbreitungfanden Briefe des NeuenTestaments, die an Gemeindenoder Einzelpersonengerichtet zu theologischenFragen Stellung nehmen.4 A. Bohse, Der allzeitfertigeBriefsteller. Frankfurt [u.a.]16925 C. Furger, Briefsteller.Das Medium »Brief« im 17. undfrühen 18. Jahrhundert. Köln,Weimar, Wien: Böhlau 2010,38ff.6 Die Versendung vonBriefen setzt(e) ein funktionierendesPostwesen voraus.Vorläufer gab es bereits inaltägyptischer Zeit, seit demMittelalter entwickelte sichein ausgedehntes Botenwesen.In der Folgezeitübernahm die Familie Taxis(später Thurn und Taxis) dieTrägerschaft des Nachrichtenwesens.Privatbriefe wurdenallerdings erst ab ca.1620 befördert. 1597 erklärteKaiser Rudolf II. die Post zueinem kaiserlichen Regal.Die Familie Thurn und Taxisbehielt bis zur AbdankungKaiser Franz II. 1806 denCharakter der kaiserlichenReichspost.7 Johann ChristophAdelung (1732 -1806) ist vorallem bekannt für seinegrammatischen und lexikographischenSchriften.8 Vgl. J. C. Adelung,Ueber die Lebhaftigkeitdes Styles. In: Magazin fürdie deutsche Sprache. 2. Bd. 2.Stück. Leipzig 1784, 65-959 Marie de Rabutin-Chantal, Marquise deSévigné (1626-1696) war eineAngehörige des französischenHochadels. Als Autorinwurde sie durch ihreBriefe bekannt und wirdzum Kreis der Klassikerder französischen Literaturgerechnet10 Tanja Reinleinformuliert in ihrem BuchDer Brief als Medium derEmpfindsamkeit zusammenfassend:»›Galant‹ alsBestimmungsmerkmal derLiteratur zwischen 1675und 1730 bezeichnet dabeije nach eine mehr oder wenigerdefinitive Strömunginnerhalb barocker oderaufklärerischer StandpunktLiteratur und die in ihrvermittelten Kulturmuster… Der kleinste gemeinsameNenner ist dabei, daß essich um ein an Frankreichorientiertes ›Bildungsidealund Lebensprogramm‹handelt.«, 6811 C. Thomasius, DeßKönigl. Preussischen HerrnGeheimen Raths, ChristianiThomasii Judicium vomGracian, auß seinen kleinenSchrifften gezogen. In: B.Gracián y Morales, Hommede Cour, oder: kluger Hof- undWelt-Mann […] ins Teutscheübersetzet, von Selintes.Augsburg: Kühtz 1711, Bl.**4 v -5 r12 M. Vogt, Von Kunstwortenund -werten. Die Entstehungder deutschen Kunstkritik inPeriodika der Aufklärung.Berlin [u.a.]: de Gruyter 2010(Wolfenbütteler Studien zurAufklärung ; 32), 239f13 C.F. Gellert, Briefe, nebsteiner Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmacke inBriefen. Wien: Trattner 1765,6314 C. F. Gellert, Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmackein Briefen. Wien: Trattner1765, 20f76biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
15 C. F. Gellert, Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmackein Briefen. Wien: Trattner1765, 3616 C. F. Gellert, Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmackein Briefen. Wien: Trattner1765, 5917 B. Neukirch, Grundsätzewohleingerichteter Briefe.Wien: Trattner 1773, 1518 C. v. Stieler, Des SpatensTeutsche Sekretariat-Kunst.Bd. 1. Frankfurt: Hoffmann1705, 248-24919 Zur Bibliothek vonJohann Christoph Wagenseillässt sich auf der Homepageder Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnbergnachlesen:www.ub.uni-erlangen.de/historischer-bestand-digital/wagenseil.shtml20 G. P. Harsdörffer, DerTeutsche Secretarius. Nürnberg:Endter 1661, 2221 Der Aufbau der Briefebasierte auf den fünf Teilender mittelalterlichen »arsdictaminis«, nämlich: »salutatio«(Gruß), »exordium«(Eingang), »narratio« (Erzählung),»petitio« (Bitte) und»conclusio« (Schluss). Vgl. C.Furger, Briefsteller. Köln [u.a.]Böhlau, 14922 B. Neukirch, Anweisungzu Teutschen Briefen. Leipzig:Fritsch 1721, 823 J. C. Stockhausen,Grundsätze wohleingerichteterBriefe. Wien: Trattner 1766,78-7924 S. Martus, Friedrich vonHagedorn – Konstellationen derAufklärung. Berlin [u.a.] deGruyter 1999 (Quellen undForschungen zur LiteraturundKulturgeschichte ; 15),29625 C. F. Gellert, Briefe,nebst einer Praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmackein Briefen. Wien. Trattner1765, Vorrede Bl. 2 v77biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Monika Kiegler-Griensteidl • Freundschaftsschreiben | 63–75
SolveighRumpf-DornerMit meinen Eltern, meinen Freunden sprechenBriefmuster und Empfehlungen für KinderAbb. 1: F. M. Vierthaler,Der kleine Schreibschüler.Salzburg 1799.Signatur: 307670-A.Alt-Mag.2. Titelblatt(Kupferstich)»Es ist sehr nützlich, und oft sogar nothwendig, dass man Briefe schreiben kann.Oft möchten wir gerne mit Abwesenden reden, und diess kann nicht anders, alsdurch Briefe geschehen. Wenn ich z.B. einmal meine Vaterstadt verlassen, und inferne Orte und fremde Länder kommen werde: wie wohl wird es mir thun, wennich da, wenigstens schriftlich, mit meinen Eltern, meinen Freunden noch sprechen,ihnen danken, und sie um Rath und Hülfe bitten kann!«Mit diesen Worten umreißt der Pädagoge Franz Michael Vierthalerfür den »Kleinen Schreibschüler«, den Adressaten seines gleichnamigenÜbungsbuches 1 , Sinn und Zweck des Briefeschreibens in seiner Zeit, demspäten 18. Jahrhundert: Es ist die einzige Möglichkeit, bei räumlicher TrennungBeziehungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Ein Brief ist einschriftliches Gespräch mit einem Abwesenden, als solches soll er empfundenund auch formuliert werden. Die richtigen Worte soll das Kindselbst finden – »das muss dich dein eigenes Herz lehren«. Bei Rechtschreibung,Ausdruck und schriftlicher Form sollte man aber keine Abstriche machen,»denn beym Schreiben habe ich ja mehr Zeit, die Sache und die Worte zu überlegen,als beym Reden«. Einige formale Ratschläge, auch zum Adressieren und Verschickendes Briefs 2 , sowie zwei Musterbriefe (ein Vater an seinen Sohn,der Sohn an den Vater) runden dieses letzte Kapitel des Schreibschülers ab.Die Kürze des Kapitels »Von Briefen« erklärt sich wohl aus dem geringenUmfang des Buches, entspricht aber auch dem Gedanken des Autors: Werrichtig und deutlich schreiben kann und sich genug Zeit zum Überlegennimmt, besitzt schon die wichtigsten Grundlagen für das Briefeschreiben.78biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
Abb.2 :FormaleRegeln fürdas Briefeschreibenausdem KleinenSchreibschülerSelbst Briefe zu bekommen, ist die größte Motivation für das eigeneBriefeschreiben. Wie anregend es wirken kann, zeigt das fast zeitgleicheBeispiel der »kleinen Schreiberinn« Julie 3 , die einen Brief ihres Vaterserhält und wünscht, sie könnte ihn beantworten. Sonst schreibt sie zwargern, aber nicht systematisch – »ich kritzle, kratzle nur etwas da untereinander,weiß selber nicht was« – , jetzt aber zählt sie ihrer älteren PflegeschwesterMarie alles auf, was sie ihrem Vater gerne schreiben würde. Diesemacht sich heimlich Notizen und liest Julie diesen »Brief« vor. Julie fängtFeuer, ergänzt das Schreiben nun selbständig und wird von Marie gelobt:»Der Aufsatz könnte nicht besser seyn: Er ist natürlich, ungekünstelt, und eben deswegengut.« Die Rechtschreibfehler werden gemeinsam verbessert, dasGanze dann ins Reine geschrieben, aber das Wichtigste, die Zwiesprachemit dem Abwesenden, hat Julie ganz allein vollbracht.Diese Selbstständigkeit konnte freilich nicht für jede Anforderung vorausgesetztwerden. In vielen Namenbüchlein und Fibeln finden sich Vorlagenfür private wie für formelle Briefe. »Gratulationsbüchlein« fassenBeispiele für alles zusammen, was ein Kind an sprachlichen Leistungenim Familien- und Freundeskreis erbringen konnte und sollte. Das warenzum einen solche für den mündlichen Vortrag, etwa Gedichte fürbesondere Anlässe wie Feiertage, Geburts- und Namenstage, kleine Ansprachenoder auch Spielszenen für mehrere Kinder; diese sollten abernicht nur reproduziert werden, sondern im Idealfall als Vorlage oder,höher gegriffen, als Inspiration für eigene »Sprachgeschenke« 4 dienen.Zum anderen finden sich darin Briefmuster für verschiedene Zwecke,gerichtet an verschiedene Adressaten; nur selten folgen sie dem immerwieder hervorgehobenen Ideal der Natürlichkeit – »natürlich, ungekünstelt,und eben deswegen gut« –, die ja nur bei ganz eigenständigem Schreibenerreicht werden kann.79biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
Abb. 3: Abwechslung imAlltag: »Der Briefträgerkommt!«J. Glatz, Das grüne Buch.Wien o.J. (1820).Signatur 307655-B.Alt-Mag»Verehrteste Frau Großmama!Wenn Sie Fritzchens Herz kennen, und das kennen Sie gewiß; so wissen Sie schonalles, was er Ihnen zum neuen Jahre wünschet.Der liebe Gott lasse Sie noch viele solche Jahreswechsel zu meinem Troste in bestemWohlseyn erleben, um welches ich ihn täglich bitten werde. Schenken Sie mirauch in Zukunft Ihre Liebe und Gewogenheit, welche zu verdienen sich aufs neue[sic] bestreben wirdIhr gehorsamster Enkel, Fritz.«So wenig der Neujahrsbrief des fiktiven Knaben Fritz jene naive Frischesignalisiert, die man heute von einem Kind im Volksschulaltererwartet, ist er doch der sympathischste unter den »Wünschen kindlicherLiebe« in einem gleichnamigen Gratulationsbüchlein des ausgehenden18. Jahrhunderts. Die angesprochene Großmama hätte dem Kind zugutehaltenkönnen, dass es zwar auf einige übliche und nicht eben originelleWendungen zurückgegriffen, diese aber zu einem halbwegs kindlichpersönlichenkleinen Brief zusammengestellt habe.Dieses Gratulationsbüchlein (der volle Titel lautet Dankbare Empfindungenoder Wünsche kindlicher Liebe) 6 wurde um 1797 in Steyr gedruckt undist somit geographisch wie auch zeitlich in nächster Nähe zum KleinenSchreibschüler und der Geschichte der schreibfreudigen Julie angesiedelt.Die übrigen darin enthaltenen Musterbriefe folgen noch weniger als der80biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
von Fritz dem Ideal der Natürlichkeit und Unmittelbarkeit. Allerdingsgelten für Glückwunschbriefe immer anderen Regeln als für private,nicht anlassgebundene Nachrichten aus der Ferne. Gerade die traditionellenNeujahrsglückwünsche, die von Kindern wie auch von Erwachsenenan Freunde, Verwandte und Bekannte gingen, durften formellausfallen. Formalismen konnten hier vom Empfänger als Verstehen undBefolgen gesellschaftlicher Regeln durch das Kind und damit als erfreulichererzieherischer Erfolg verstanden werden. So wird die Mutter diesesjungen, diesmal realen Schreibers den Glückwunsch zu ihrem Namenstagsicher freundlich aufgenommen haben, obwohl –»Liebste Mutter!Ihr heutiger Namenstag erineret mich an alle die Pflichten, die ich gegeneine gute Mutter habe, und ich fühle bei dieser Erinerung den stärkstenTrieb, die Pflichten zu erfühlen In meinem Alter bin ich beynahe ganz außerStande, etwas mehr zu ihren Glücke beyzutragen, als durch Wüntsche …«(Orthographie folgt dem Original)Hat der zehnjährige Nikolaus Lenau nur die einleitende Floskel einemMusterbrief entnommen, ist die Idee des zweiten Satzes schon eine eigenständige.Hat das sprachbegabte Kind, auf früher gelesene Wendungenzurückgreifend, sie selbst formuliert? Ganz und gar nicht. Vielmehrbediente sich Nikolaus genau jener Wünsche kindlicher Liebe, aus denenauch das erste Briefzitat oben stammt, und kopierte fast wörtlich denGeburtstagsglückwunsch »Leopold an seine Mutter« 7 . Sein Beitrag: das Ersetzenvon »Geburtstag« durch »Namenstag«, mehrere Abschreib- oder(falls nach Diktat geschrieben) Rechtschreibfehler sowie der Wunsch,Gott möge der Mutter nicht nur die zeitliche, sondern auch die ewigeGlückseligkeit zuteilwerden lassen. Die weniger wahrscheinliche Versionfür diese Koinzidenz wäre ein Stille-Post-Effekt, falls der junge Lenaueinen anderen, dieser Vorlage folgenden Brief kopiert hätteWeitere Beispiele aus den Wünschen kindlicher Liebe zeigen jene Fülleallzu überschwänglicher Phrasen, die von aufgeklärten Pädagogen undSprachkritikern (nicht nur in Kinderbriefen) angeprangert wurden. »O,Vorsehung! kröne doch seine Tage! Ich flehe dich täglich darum an«, heißt es inJohanns Geburtstagsglückwunsch an den Vater. »Verehrungswürdige! ichwill sagen: bey dem helleren Scheine der Vernunft sah ich deutlich ein, daß alle Augenblickemeines bisherigen Lebens mütterliche Wohlthaten waren«, schreibt Thereseim Neujahrsbrief an die Mutter. Solche Wendungen widersprachennicht nur dem Ideal kindlicher Natürlichkeit, sondern auch jenem desgeschmackvollen schriftlichen Ausdrucks im Allgemeinen. Oft wurde daherdavon abgeraten, sich überhaupt an Vorlagen aus Briefstellern undGratulationsbüchern zu orientieren; vielmehr sollten Erwachsene wieauch Kinder möglichst viele »gute« Briefe lesen, um so nach und nach zueinem eigenen Stil zu finden. Als Quelle für solche Beispiele wurde denKindern etwa die Zeitschrift Der Kinderfreund empfohlen 9 , Erwachsenesollten sich u.a. Gellert 10 zum Vorbild nehmen.Diesen Rat finden wir zum Beispiel in der 1780 erschienenen Anleitungzur Schreibart in Briefen 11 , einem Schulbuch »zum Gebrauch in den k.k. Erbländern«.Die am Anfang dieser Anleitung aufgestellten Maximen scheinenganz im Sinne der aufgeklärten Kritiker zu sein: »Ein Brief vertritt die Stelledes mündlichen Gesprächs; daraus folget, daß ich so schreiben soll, als ich reden81biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
Abb. 4: Der zehnjährigeNikolaus Nimbsch vonStrehlenau an seineMutter 8Abb. 5: Leopold an seine Mutter, Dankbare Empfindungen oder Wünsche kindlicher Liebe aufverschiedene Familien-Feste, Steyr (um 1797). Signatur: 307674-A.Alt-Mag82biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
würde, wenn die Person gegenwärtig wäre, an die ich schreiben will.« Wenn Leute,die an sich gut zu reden verstehen, oft schlecht schrieben, so läge dasdaran, dass sie »die Sache gar zu gut, und besser machen wollen, als sie reden.Daher verfallen sie oft in das Schwülstige […]« Um dem entgegenzuwirken,lautet auch hier die Empfehlung: »Das beste Mittel, gute Briefe zu verfassen,ist das Lesen guter Schriften, und das Vergleichen derselben mit schlechten. Diesesnützet tausendmal mehr als alle Regeln.« 12In seiner umfangreichen Kritik österreichischer Schulbücher 13 , die dreiJahre nach dem Erscheinen der Anleitung in Berlin herauskam, weiß derVerleger und Historiker Friedrich Nicolai 14 über dieses Werk nicht vielGutes zu sagen. Die darin eingangs aufgestellten Maximen scheinen ihmein bloßes Lippenbekenntnis zu sein, das sogleich konterkariert wirddurch »einige Bogen von Regeln: und die gegebenen Musterbriefe sind […] ängstlichnach dem überall vorkommenden Regelleisten geformet«. Auch die Auswahlder Themen befindet er für unpassend, denn »die Briefverfasser sind meistPersonen, in deren Empfindungen und Lage deutsche Schüler sich nicht hineindenkenkönnen. Denn bald schreibt ein Rechtsgelehrter an einen Präsidenten undGrafen, bald ein Baron an einen Hofrath, bald ein Geistlicher an eine Gräfinn [… ]Solche Musterbriefe müßten an Schulfreunde, Geschwister, Eltern, Verwandte, Lehrmeister,Gönner, Wohlthäter u. gerichtet, und nur aus dem bürgerlichen häuslichenLeben hergenommen seyn« 15 . Der richtige Weg zum guten Briefstil scheintihm vielmehr der zu sein, der über den allgemeinen, guten, schriftlichenAusdruck führt. Um einen solchen zu entwickeln, empfiehlt er reichlichLektüre »guter Schriften« zeitgenössischer Autoren sowie besonders dasSchreiben von freien Aufsätzen (»Erzählungen«).Mit dieser Forderung wich Nicolai keineswegs von der Meinung der (österreichischen)Normalschul-Pädagogik 16 ab. So heißt es im Methodenbuchfür Lehrer der deutschen Schulen in den kaiserlich-königlichen Erbländern, einemumfangreichen Lehrerhandbuch 17 , im Kapitel »Von schriftlichen Aufsätzenund der Kunst Briefe zu schreiben«: »[…] Dieser gute Ausdruck ist es, dazu manhier Anleitung geben will […] wie nun unter den schriftlichen Aufsätzen die Briefedie gewöhnlichsten sind, so hat man auch vornämlich sorgen wollen die Jugendanzuführen solche gut und natürlich zu verfassen.« Der anschließende zweiteParagraph dieses Kapitels ist folgerichtig überschrieben mit »Von derEinrichtung der Anleitung zu einer natürlichen Schreibart«. Diese didaktischeMethode sieht zwar vor, dass der Lehrer auf der Basis von Tabellen undMustern den Schülern die Grundlagen des Briefeschreibens vermittelt;doch ist es nicht »nöthig gleich mit Briefen anzufangen; er erzähle ihnen, oderlese etwas aus einem Buche vor, lasse sich es bald diesen bald jenen Schüler wiedererzählen, endlich befehle er, daß jeder eben diese Erzählung schriftlich aufsetze […]Anfänglich muß der Lehrer viel Nachsicht haben, wenn die Schreibart noch mattund leer ist; wenn sie nur natürlich ist, so kann er zufrieden seyn. Er muß daraufhalten, daß jeder nach seiner eigenen Empfindung schreibe, und nichts Gezwungenesoder garzu Gekünsteltes oder auch anderwärts Entlehntes vorbringe.« 18Die »Natürlichkeit« ist und bleibt Ideal in Bezug auf Sprache und Inhaltvon Kinderbriefen. Was das Kind aus seinem Alltag berichtet, kann nurder eigenen Lebenssituation entnommen werden; allenfalls kann dieVorlage Anregungen bieten, was berichtenswert ist und wie es aufbereitetwerden soll. Konnte die häufig und zum Beispiel auch von FriedrichNicolai empfohlene Lektüre des Kinderfreund hier Hilfestellung bieten?»Ja und nein« lautet die wahrscheinlichste Antwort. Der kleine Karl, der83biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
seinen Vater auf einer Reise begleiten darf, hat vergessen, seiner SchwesterCharlotte die Pflege seines Kanarienvogels anzuvertrauen. Das tuter nun in einem Brief, in dem er ihr lustig die Vorteile schildert, dieihr das kleine Haustier verschafft, etwa wenn es durch sein Zwitschernden überkritischen Tanzmeister von ihren Fehlern beim Menuettanzenablenkt. Auch appelliert er an ihr Mitleid, indem er schildert, wie erbarmungswürdigder Anblick des verdursteten Vogels für das gutherzigeMädchen wäre: »- und … ah! du weinst? Nun bin ich außer Sorgen! nun kriegt eraußer seinem Fressen gewiß noch täglich sein bißchen Zucker und seinen Gebauermit Mäusegedärme umlaubt.« 19 Dann geht Karl zur Schilderung der herbstlichenLandschaft über, durch die er gerade reist, und von dieser zu einemkleinen Unfall, als der Überrock des Kutschers sich im Rad verheddert.Darauf folgen weitere Episoden und nach zehn Seiten ein »Die Fortsetzungfolgt«. In der nächsten Nummer des Wochenblattes erzählt Karl weiterund verabschiedet sich nach insgesamt neunzehn (!) Seiten von seinerSchwester mit der für ihn überraschenden Erkenntnis: »Ich kann kaumbegreifen, was für ein Schreibgeist mir die wenigen Stunden, die ich hier bin, in diedrey ersten Finger, vom Daumen an gerechnet, an meiner rechten Hand gefahren«– und das, obwohl eigentlich ein »ganzer Teller voll Pflaumen- und Zuckerkuchen«auf ihn wartet. Lotte bleibt dem Bruder an Schreibfreude nichtsschuldig und antwortet ihm mit einer sechzehnseitigen Zusammenfassungkleiner Neuigkeiten von daheim. Karls Sorge um den Kanarienvogelwar übrigens unbegründet, denn die Schwester hat sich bereits umihn angenommen. Besser sogar als Karl selbst, denn »bey dir ist er mehr inGefahr sich zu Tode zu fressen, als zu verhungern […] als ich seinen kleinen Käfigausfegte, fand ich wenigstens auf ein Viertel Jahr Futter drinnen […] Auf den Bodenherab konnte er gar nicht mehr: denn da war er in Gefahr verschüttet zu werden,oder wie in einer See zu versinken«.Selbst für ihre Zeit scheinen uns Karls und Lottchens Briefe für Kinderbriefeübermäßig lang zu sein. Aber auch Dorothea Schlözer 20 schrieb oftviele Seiten, wenn sie Verwandten und Freunden von ihrer (zugegebenermaßenweiten und eindrucksvollen) Italienreise mit dem Vater berichtete.Und wie der fiktive Karl die Schönheit des Herbstwaldes schildert,beschreibt die reale, elfjährige Dorothea die Schweizer Berglandschaftoder die Straßen Roms. Sicher griff sie bei diesen Briefen auf ihre Tagebucheinträgezurück und stellte diese dann zu einem längeren Berichtzusammen, wie es auch erwachsene Reisende taten. Das Ungekünsteltedes Ausdrucks litt darunter nicht: »Natürlich freut es einen bis in die Seelehinein, wenn man einen solchen Obelisken sieht. Aber so prächtig, als ich es mirvorgestellt hatte, kam mir das Ding doch nicht vor. Der Obelisk ist mit allem nur 81Fuß hoch, also lange nicht einmal halb so hoch, wie unser Johanniskirchthurm …« 21Weniger weitgereiste Kinder hatten natürlich nicht so viel zu berichten.Die so nachdrücklich empfohlene Lektüre der Briefe im »Kinderfreund«sollte aber dazu anregen, auch kleinste Begebenheiten so zuerzählen, dass das »schriftliche Gespräch« ein lebendiges blieb. Auf spöttischebis harsche Kritik stießen hingegen absurde Beispiele wie diesesaus einem 1819 in Coburg veröffentlichten Kinderbriefsteller 22 . Die LeipzigerLiteraturzeitung fragt dazu: »Ist es wohl natürlich, wenn z.B. S. 52 ein Mädchenihre Freundin einladet, sie bald zu besuchen, wenn sie ihre (der Briefschreiberin)kleine Schwester noch lebendig sehen wolle, welche warmen Kuchen gegessenund darauf getrunken habe; und wenn die betrübte Schwester nun noch eine große84biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
Anzahl von Fällen erzählt, in welchen ein ähnlicher Genuss tödlich ward?« 23 Hierist die angenommene Situation dermaßen unwahrscheinlich, dass dieVorlage wohl selbst dem ratlosesten Briefschreiber nicht mehr als Anregungdienen konnte. Viele erhaltene Kinderbriefe zeigen aber, dass diejungen Schreiber, auf sich selbst gestellt, oft ganz leicht mit den Elternund Freunden »ins Gespräch kamen«, wenn auch nicht unbedingt übersechzehn Seiten. So ruft im April 1801 ein munterer, nicht übermäßigschreibfreudiger Elfjähriger dem geliebten Vater wie im Vorbeilaufenzu:»Lieber Vater!Nehmen Sie es nicht übel, daß ich Sie nicht geschrieben habe. Ich freue mich, Siebald wiederzusehen. Ein ander Mal mehr. Leben Sie wohl und behalten Sie michlieb. Ich habe eine sehr schlechte Feder gehabt.August Goethe« 24Abb. 6: Der kleine Schreiber. Spiele und Vergnügungen der kindlich-frohenKnaben im ersten Alter. Jeux Et Amusemens Des Garçons En Bas-Âge. Wieno. J. (1819). Signatur: 308911-A.Alt-Rara85biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
1 F. M. Vierthaler, Derkleine Schreibschüler. Ein Geschenkfür Kinder, welche nichtbloß schön, sondern auch richtigzu schreiben wünschen. 2. Teil.Neueste Auflage, Salzburg1799. Kapitel »Von Briefen«115ff.2 vgl. Abb. 23 Nöthiger Unterricht in derRechtschreibung für Mädchen,wie auch für Knaben, die sichdem gemeinen Gewerbsstandewidmen wollen. 2. Aufl. Salzburg1794, 40ff.4 In Sprachkultur undBürgertum. Zur Mentalitätsgeschichtedes 19. Jahrhunderts.Stuttgart 1996, spricht dieAutorin A. Linke sehr zutreffendvon »Sprachgeschenken«.5 J. Glatz, Das grüne Buch.Ein belehrendes und unterhaltendesLesebuch für jüngereKnaben und Mädchen. Mit sechsschön ausgemahlten Kupfern.Wien o.J. (1820)6 Dankbare Empfindungenoder Wünsche kindlicher Liebeauf verschiedene Familien-Feste.Ein Gelegenheitsgeschenk fürdie liebe Jugend. Steyr o.J. (um1797). Fritz’ Brief: 12.7 Leopolds Brief:Dankbare Empfindungen, 26f.(Vgl. Abb. 5) Das Lesen vonLenaus Brief, den ich bei dereher wahllosen Suche nachrealen Kinder-Glückwunschbriefender Zeit gefundenhatte, bescherte mir einseltsames Déjà-lu-Erlebnis.Die Volltextsuche in dendigitalisierten Gratulationsbüchleinund Briefstellernder Österreichischen Nationalbibliothekführte michdann zum erst kürzlichgelesenen Musterbrief.8 Bildausschnitt entnommenaus: H. Brandt,G. Kozielek (Hrsg.), NikolausLenau. Werke und Briefe.Wien 1989, 3.9 Der von Christian FelixWeiße herausgegebeneKinderfreund gilt als erstedeutschsprachige Kinderzeitschrift.Er ist erschienenvon 1775 bis 1782 (in 24Bänden).10 Christian FürchtegottGellert (1715-1769) wareiner der meistgelesenenSchriftsteller seiner Zeit,sein Briefstil galt als vorbildlich.Sein Werk Briefe, nebsteiner praktischen Abhandlungvon dem guten Geschmacke inBriefen (Leipzig 1751) wurde u.a. von Lessing hoch gelobt.11 Anleitung zur Schreibartin Briefen, und einigen andernAufsätzen. Zum Gebrauche fürSchüler der deutschen Schulenin den kaiserlich-königlichenErblanden. Wien 1777.12 Anleitung zur Schreibartin Briefen, 4ff.13 F. Nicolai, FreymüthigeBeurtheilung der OesterreichischenNormalschulen und allerzum Behuf derselben gedrucktenSchriften. Berlin 1783.14 Christoph FriedrichNicolai (1733-1811) übernahmnach dem Tod seines Vatersdie von diesem gegründeteNicolaische Verlagsbuchhandlung.Er war ein wichtigerVertreter der BerlinerAufklärung. Seine kritischeSicht auf Wien bzw. Österreichüberhaupt zeigt sichin seiner Beschreibung einerReise durch Deutschland und dieSchweiz im Jahre 1781, die ab1783 in Berlin herauskam.15 Freymüthige Beurtheilung,203f.16 Das Konzept derNormalschule, in den1760er Jahren in Schlesienentwickelt, war das einerVolksschule, die zusätzlichals Musterschule fürangehende Lehrer (an denTrivialschulen) diente. Eswurde 1771 auch in Österreicheingeführt.17 Methodenbuch fürLehrer der deutschen Schulenin den kaiserlich-königlichenErbländern: darin ausführlichgewiesen wird, wie die in derSchulordnung bestimmte Lehrart... bei jedem Gegenstande, der zulehren befohlen ist, soll beschaffenseyn. Wien 1776. Autor desanonym erschienen Pädagogikwerkswar Johann IgnazFelbiger, der (als Abt desStifts Sagan in Schlesien) dasModell der Normalschulemitgeformt hatte.18 Methodenbuch, 180ff.19 Der Kinderfreund, einWochenblatt. 2. Aufl. Leipzig1777-1781. (Vol.4 = Theil13-16). Karls Brief 39ff., LottchensAntwort 58ff.20 Dorothea Schlözer(1770-1825), eine der Göttinger»Universitätsmamsellen«(Töchter von Professorender Universität Göttingen),promovierte mit 17 Jahrenzum Dr. phil. In Lübeckverheiratet, führte sie dorteinen aufgeklärten Salon.Ein Beispiel für DorotheasReisekorrespondenz ausRom ist z.B. der Brief an ihreTante, die Hofrätin Loder inJena, vom 29. Jänner 1782;in: F. E. Mencken (Hrsg.),Dein dich zärtlich liebenderSohn. Kinderbriefe aus 6. Jahrhunderten.München 1965.47ff.21 Mecken, 50.22 Chr. Fr. Schuck, Musterbriefemoralischen Inhalts fürdie Jugend zur Erlernung desBriefstyls. Coburg 1819.23 Leipziger Literaturzeitung1820(1), 568.24 Postskriptum zueinem Brief Christiane Goethesan Johann WolfgangGoethe vom 21. April 1801.Zitiert nach: Johann Wolfgangvon Goethe: Briefwechsel mitseiner Frau. Band 1 (ProjektGutenberg). August WalterGoethe (1789-1830) war daseinzige überlebende Kindvon Christiane und JohannWolfgang Goethe, seineGeschwister starben allebereits im Säuglingsalter.Zur Biographie Augusts vonGoethe s. z.B. W. Völker,Der Sohn. August von Goethe.Frankfurt am Main 1992.86biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Solveigh Rumpf-Dorner • Mit meinen Eltern, meinen Freunden sprechen | 76–84
Projektberichte aus der Österreichischen NationalbibliothekAchim Hölter undPaul FerstlDie Bibliothek Ludwig Tiecks undihre RekonstruktionMit besonderer Berücksichtigung der an dieK.K. Hofbibliothek verkauften BeständeAbb. 1: Aus: Chaucer, Geoffrey: The works, newly printed, with divers workes whichwere never inprint before. Lt. handschriftlichem Eintrag von 1542. ÖNB 23638-CTranskription:Diese sehr seltene Ausgabe schenkte mir im Frühling 1794 mein Freund Wackenroder,der sie für mich in einer Auction in Altenburg erstanden hatte.Ludwig Tieck.Die Bemerkungen und Striche im Werk rühren von mir her.Das Projekt »Ludwig Tiecks Bibliothek. Anatomie einer romantisch-komparatistischenBüchersammlung«Seit Oktober 2014 läuft an der Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaftder Universität Wien das FWF-Projekt P 26814 unter Leitungvon Achim Hölter, das die virtuelle Rekonstruktion der berühmtenBibliothek des deutschen Romantikers Ludwig Tieck (1773-1853) zum Zielhat. Tiecks Büchersammlung – so unsere Ausgangsthese – verkörpertals eine wissenschaftliche Privat- und Dichterbibliothek in idealer Weisedie Grundlage für genuin komparatistische Lese- und Schreibweisen. DieRekonstruktion und Würdigung dieser Bibliothek, die seltene, wertvolleDrucke von der Renaissance und dem Siglo de oro bis hin zu Tiecks Gegenwartenthielt und in einer Berliner Auktion 1849/50 verkauft wurde,87biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
stellt in der Erforschung der europäischen Romantik und dem systematischenErfassen und Evaluieren protokomparatistischer Büchersammlungeneine Pionierarbeit dar. Da die Auflösungsgeschichte der »BibliothecaTieckiana« äußerst komplex ist, besteht das Desiderat in einer Auflistungder kompletten Bibliothek nach modernen Standards der Katalogisierung,um alle Daten zu Tiecks Bücherkauf und -gebrauch festzuhaltenund darüber hinaus alle Exemplare zu lokalisieren und zu untersuchen.Die Titel befinden sich nun (soweit bereits lokalisierbar) hauptsächlichin Berlin, Breslau, Göttingen, Halle, Krakau, London, München, Wien,Wroclaw, Moskau, St. Petersburg, und wahrscheinlich in Lodz und Warschau;aber auch in Privatbesitz. Die Evaluation der Bedeutung jener Bestände,die an die K.K. Hofbibliothek in Wien verkauft wurden, stellteinen wichtigen Bereich des Projektes dar.Die Informationen zu Tiecks Bibliothek werden in einer Netzdatenbankkombiniert und erweitert bereitgestellt, die allein zu diesem Zweckmit Blick auf ihre besonderen Anforderungen hin entworfen wurde.Die Bearbeitung der Daten bzw. der Zugang zu diesen Daten wird nachden Prinzipien der Open-Access-Politik von Universität Wien und FWFerfolgen, die Tiefe und Qualität der Daten zusätzlich verbessern unddie Grundlage für neue Fragestellungen schaffen. Die Datenbank ist dienotwendige Voraussetzung für die nachhaltige Nutzung der Ergebnisseund qualifiziert das Projekt als »Treffpunkt« der internationalen Gemeinschaftvon Forschern, die sich mit Fragen zu Tieck, der Romantik oderden Anfängen der Komparatistik auseinandersetzen. Eine Printausgabestellt ein langfristiges Ziel dar. Dank dieses Unternehmens wird eine derbedeutendsten Dichterbibliotheken der Literaturgeschichte zumindestvirtuell restauriert werden und fortbestehen.Ludwig Tiecks Bibliothek: Aufbau, Zusammensetzung, Verkauf 1Die Untersuchung von Dichterbibliotheken kann bereits auf eine gewisseTradition zurückgreifen; im deutschsprachigen Raum wird RolandFolters Bibliografie 2 (1975) als maßgeblich aufgefasst. Auch Gelehrtenbibliothekensind zum Gegenstand des Forschungsinteresses geworden. 3Die Beschäftigung mit Tiecks Bibliothek liegt vor allem deshalb nahe,da er als einer der berühmtesten Bibliophilen des 19. Jahrhunderts gilt, 4was umso bemerkenswerter ist, da er weder eine Büchersammlung erbtenoch auf erhebliches Vermögen zurückgreifen konnte. Nur wenigeTitel – und keinerlei genaue Beschreibungen – sind aus der Erbmassevon Tiecks Vater überliefert, der Seilermeister war. 5 Das intertextuelleArchiv des jungen Tieck muss eher in den Sammlungen seiner Lehrerund Freunde am Friedrichswerderschen Gymnasium (Berlin) gesuchtwerden bzw. in jenen Berliner Bibliotheken, die in den 1790er Jahren derÖffentlichkeit offenstanden, wie namentlich die Königliche Bibliothek.Es lässt sich nicht feststellen, wann Tieck begann, Bücher zu kaufenund zu klassifizieren, bzw. seine Sammlung systematisch aufzubauen.Sein um 1800 wachsendes Interesse an mittelalterlicher Lyrik und dieFreundschaft zu Brentano mag ihn in seiner Sammelleidenschaft ebensobeeinflusst haben wie die durch die Säkularisierung plötzlich einsetzendeFlut an alten Büchern auf dem Markt. In seiner Studienzeit 1792-94bot die Universitätsbibliothek Göttingen (wie auch die von ihm besuchteHerzog August Bibliothek Wolfenbüttel) eine Idealvorstellung einer88biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
Büchersammlung an; Tiecks Reisen (etwa Bibliotheca Vaticana und St.Gallen 1804-6; München und Wien 1808-10; Paris, London, Oxford, Stratford1817) können auch als Bibliotheksreisen 6 angesehen werden, die demErwerb von Büchern dienten, die in Deutschland schwer zu erhaltenwaren. 1819 bezog er ein Heim in Dresden, wo er den ihm angebotenenPosten des Oberbibliothekars abgelehnt hatte. 7 In dieser Zeit sindvermehrt Hinweise etwa von seiner Tochter Dorothea auf regelmäßigeund umfangreiche Ankäufe bei Buchversteigerungen nachzuweisen. DerGroßteil seiner Sammlung dürfte in den 1820er und 1830er Jahren angeschafftworden sein, finanziert einerseits durch beträchtliche Einkünfteaus seinen Novellen, andererseits durch das private Kapital seiner GefährtinHenriette von Finckenstein. Zusätzlich ließ sich Tieck von seinenVerlegern anstelle von Tantiemen Bücher liefern und bat um Geschenkeaus deren neuesten Publikationen. Auch Widmungsexemplare undBücher aus »Tauschhandel« mit der Dresdener Bibliothek trugen zu derstets anwachsenden Privatsammlung bei. Dennoch ist die Provenienz desGroßteils seiner Sammlung bislang unerschlossen; nur vereinzelt sindAnkäufe aus berühmten Hinterlassenschaften wie etwa der berühmtenBibliothek von Johann Joachim Eschenburg (1823 8 ) oder der von Ernstvon der Malsburg (1824; Ankauf von fast 100 Bänden) nachgewiesen; inden Tieck-Beständen der ÖNB finden sich Stempel, die auf Bücher ausdem Nachlass von Karl August Böttiger hinweisen. 9 Nach dem Tod seinerTochter Dorothea und seiner Frau Amalie zog Tieck mitsamt seiner Bibliothekin die Amalienstraße 15 in Dresden (der Buchtransport dauertesechs Tage lang), dann weiter nach Berlin. Dort fand die Auktion Ende1849/Anfang 1850 statt.Tieck war Bücherliebhaber und davon überzeugt – wie er in einemBrief an Wilhelm Konrad Hallwachs vom 14. August 1836 festhielt –, dassein Gelehrter wichtige Bücher besitzen müsse und nicht borgen, vor allemwenn er – wie Tieck – es gewohnt war, die wichtigsten Passagenanzustreichen und mit Anmerkungen zu versehen. 10 Auktionskatalogelas er wie Literatur 11 und fiktionalisierte die Faszination mit großen Büchermengenin Novellen wie Der Gelehrte (»Welche Menge von Büchern, riefsie, wie entzückt, aus.« 12 ) oder Des Lebens Überfluß. 13 Tiecks Bibliothek warerkennbar die eines komparatistisch orientierten Philologen und Literaturhistorikersund enthielt neben zeitgenössischer deutscher Literatur,Geschenken von Tiecks Freunden und Bewunderern und natürlichBelegexemplaren seiner eigenen Werke, schwerpunkthaft deutsche Literaturder frühen Neuzeit, englische Dichtung mit einem markantenZentrum bei Shakespeare und seinen Nachfolgern sowie insbesondereeine auf Vollständigkeit angelegte Sammlung von Originaldrucken spanischerDramen des 17. Jahrhunderts. Sichere Erkenntnisse versprachsich der Philologe Tieck nur durch das Lesen von buchstäblich hundertenTexten gleichen Typs: »Ohngefähr alles in allem giebt es 3500 gedruckte alteStücke; ihrer habe ich bis jetzt 1200, fehlen mir ohngefähr 2300.« 14 BesonderesInteresse Tiecks für einzelne Autoren zeigt die hohe Anzahl von Ausgabenvon Dante, Boccaccio, Cervantes. Literaturhistorische Werke in fürjene Zeit bemerkenswertem Umfang waren ebenso teil der Sammlungwie vor allem die Gebiete Geschichte und Kunst; hier verspricht seineBibliothek den unmittelbarsten Aufschluss für die Kommentararbeit anden Dresdner Novellen.89biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
Tieck gab seine Bücher im Alter von 76 Jahren zur Versteigerung frei;die Sammlung wurde dadurch zerstreut, aber immerhin – wie zahlreicheDichter- und Germanistenbibliotheken – in Form eines Katalogs indirektüberliefert. 15 Als Motive für den Verkauf werden baustatische Bedenkendes Vermieters der Wohnung Friedrichstraße 208 und die akute Geldnotvon Tiecks Bruder angeführt; der eigentliche Auslöser für die Trennungvon seinen Büchern dürfte aber im psychisch-gesundheitlichen Bereichgelegen haben. Am 25.2.1849 verkaufte Tieck sie an den Berliner AuktionatorAdolf Asher für den Pauschalpreis von 7.000 Talern bei einerAnzahlung von 2.000 Talern. Dies geschah rechtswidriger Weise, da er siebereits am 8.6.1839 dem Verleger Heinrich Brockhaus für die Verzinsungvon 6.000 Talern in Form einer jährlichen Rente von 300 Talern verkaufthatte, wobei ihm bis zu seinem Tod der Nießbrauch der Bücher garantiertworden war. Brockhaus vermied einen Skandal nur dank Interventionvon Tiecks Freund Friedrich von Raumer, indem er die Bibliothek am14.4.1849 formell an Tieck zurückverkaufte. 16Bereits 1848 hatte der Antiquar Albert Cohn damit begonnen, TiecksBibliothek zu sichten und einen Auktionskatalog vorzubereiten, der unterdem Titel Catalogue de la bibliothèque célèbre de M. Ludwig Tieck qui seravendue à Berlin le 10. décembre 1849 et jours suivants par MM. A. Asher & Comp.erschien und aufgrund ihrer Bedeutung 1970 mit einem kurzen Vorwortvon Erich Carlsohn unter dem Titel Bibliotheca Tieckiana als Reprint produziertwurde. 17Die Versteigerung wurde aus Rücksicht auf den russischen SammlerSergej Sobolewskij auf den 18.12.1849 verschoben und endete am10.1.1850. Der Beauftragte der Wiener Hofbibliothek, Ferdinand JosephWolf, informierte seinen Vorgesetzen Eligius Franz Joseph Frh. vonMünch-Bellinghausen (Dichtername: Friedrich Halm) über den Verlaufder Auktion. 18 Wolf war zudem viermal (19. und 22. Dezember, 6. und 9.Januar) bei Tieck eingeladen.Asher hatte Teile des Angebots bereits en bloc verkauft, wovon in ersterLinie die Bibliothek des British Museum profitierte. Ihr Kustos AntonioPanizzi 19 hatte sich insbesondere für die deutsche Dichtung (Werke Goethesbzw. Tiecks) und für Zimelien der englischen Literatur ein Vorkaufsrechtgesichert; ca. ein Zehntel der offerierten Lose ging denn auch ohneVersteigerung nach London. Asher überschlug diese Nummern kurzerhandals fehlend und ließ die deutsche, skandinavische und niederländischeLiteratur (bis BT 1620) ganz aus. Die Bibliotheken Paris, Leipzig undWolfenbüttel beteiligten sich offenbar nicht an der Versteigerung, auchaus Dresden wurden wohl keine Bücher erworben. Die Bibliotheken ausGöttingen, Halle/S. und München 20 kauften hingegen jeweils einige Dutzend.Das nach London größte Kontingent dürfte aber aus Wien ersteigertworden sein, wobei Wolf ebenfalls unter der Hand Vorabgeschäftemit dem Auktionator abschloss. Von den 344 Titeln, die die KöniglicheBibliothek Berlin ersteigern wollte, konnten nur 125 erworben werden.Restbestände bot Asher zu Festpreisen erneut an (Catalogue d’une collectionprécieuse… 1850 21 ); Hinweise auf Remittenden aus der Auktion (vor allemin Bezug auf die Verkäufe nach London 22 ) müssen berücksichtigt werden.Zudem hatte im Vorfeld der Auktion König Friedrich Wilhelm IV. bereitseinige spanische Dramen von Asher zurückgekauft und Tieck als Weihnachtsgeschenkrestituiert. In einem raschen Impuls begann Tieck eine90biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
zweite Bibliothek aufzubauen – und am 19.5.1852 wiederholte sich dieSzene: Tieck verkaufte seine zweite Bibliothek an den schlesischen GrafenYorck von Wartenburg, wiederum für 6.000 Taler und wiederum unterder Bedingung, dass die Bücher erst nach seinem Tod geschlossen indessen Besitz übergingen, ausgenommen die vom König zurückgekauftenHispanica, die an die Berliner Bibliothek fielen. In seinem letztenLebensjahr ließ Tieck dann das Vorhandene und die Neuzugänge bereitsvon seinem Sekretär Karl Hellmuth Dammas katalogisieren und von seinemDiener Johann Glaser mit dem Yorckschen Stempel versehen. LautBrief vom 15. August 1852 handelte es sich um 11.458 Bände. 23Tiecks berühmte Büchersammlung ist heute in zahlreiche Richtungenverstreut, aber nicht spurlos. Für literaturwissenschaftliche Recherchenmaßgeblich ist primär der im ersten Katalog 1849 nachgewieseneBestand, da Tieck nach der Auktion kaum noch literarisch aktiv war.Größere Korpora befinden sich in den zentralen wissenschaftlichen Bibliothekenvon London, Wien, Berlin, Göttingen, München, Halle; Recherchenzu potentiellen weiteren Großankäufen haben bislang noch keineFrüchte getragen. Das Archiv der Firma Asher gilt als verloren und damitauch die Kundenbelege. Wie hoch der Anteil der Bücher ist, die, engros oder einzeln, in private Hände übergingen, ist schwer zu beziffern.Einzelexemplare aus Tiecks Besitz sind gelegentlich im Handel oder inBibliotheken (LB Stuttgart, Rostock) zu finden und werden zurzeit in mühevollerEinzelrecherche zusammengetragen. Kriegsverluste bzw. nachKrakau gelangte Auslagerungen der Berliner Bibliothek erschweren dieRecherche; Einzelexemplare sind in der Russischen Staatsbibliothekausgewiesen. Unklar ist auch, wie viele Bücher aus Tiecks Altbesitz zujener Sammlung gehörten, die nach seinem Tod 1853 in das schlesischeSchloss Klein-Oels überstellt wurden. Die dortige Fideikommiß-Bibliothek,150.000 Bände zählend, ging bei der Eroberung Schlesiens Endedes Zweiten Weltkriegs unter. Während Paul Graf Yorck von Wartenburg(1902-2002) 90 Bände aus Tiecks Besitz nach Westdeutschland rettenkonnte, müsste der Verbleib Yorckscher Bücher – inzwischen sind Teilbeständenachgewiesen in den Universitätsbibliotheken Lódz, Breslauund Warschau, der Nationalbibliothek Warschau, der Stadtbibliothek St.Petersburg sowie der Moskauer Rudomino-Staatsbibliothek für ausländischeLiteratur – erst präzise ermittelt werden. Außerdem muss überprüftwerden, ob und aus welcher Tieckschen Sammlung sie stammen. Zumindestfür Russland hat der 2012 in Moskau erschienene Katalog »Bücheraus der Privatsammlung der Grafen Yorck von Wartenburg in russischenBibliotheken« 24 erste Ergebnisse zutage gefördert.Forschungsansätze zu den Marginalien in elisabethanischer Literaturzeigen bereits beispielhaft, wie die Rekonstruktion von Tiecks Bibliothekseine Praxis als Shakespeare-Forscher zu beleuchten hilft. Zeydel 25 erstelltenur die alphabetische Liste des englischen Teilgebietes, doch war schonder frühen Tieck-Forschung klar, dass Tiecks Bibliothek als Arbeitsinstrumentund Zeugnis der Genese der germanistischen Mediävistik, mehraber noch der Anglistik und vor allem der Hispanistik hohen Rang besaß.H. Hewett-Thayer (1934) 26 und W. Fischer 27 gaben die Marginalien inenglischen Büchern der British Library auszugsweise wieder; ausführlicherforschte diese dann E. Neu. 28 Nicht nur in London, auch in Wien existierenwichtige Handexemplare wie die Shakespeare-Ausgabe BT 2145 (ÖNB:91biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
51 P 9), Solgers Erwin (BT 1340; 20203-B) mit Anstreichungen, Avellanedasfalscher Don Quixote (BT 2503; 26.574-A) und Spensers Faerie Queene (BT2292; 23.641-C) mit bibliographischen Notizen. Sidneys Arcadia (BT 2264;23.640-C) aber hat Tieck mit zahlreichen Unterstreichungen und Randbemerkungenversehen, ebenso All the workes (1630) von John Taylor (BT2306; 23.637-C), in die er eintrug: »Wie oft ich es durchgesehn und wie zu verschiedenenZeiten können die geschriebenen Anmerkungen bezeugen, die alle vonmir herrühren. Seit 1811 ist dieses Buch in meinem Besitz. L. Tieck.«Zahlreiche literarhistorische Einzelnotizen im Nachlass wird man imdirekten Zusammenhang mit der Lektüre bestimmter Titel sehen müssen,zumal anzunehmen ist, dass Tieck mit wachsendem Bücherbesitzseltener von öffentlichen Bibliotheken Gebrauch machte.Allgemeiner Forschungsstand und bestehende VergleichsmodelleDie Forschung zu Ludwig Tiecks Leben, Œuvre und seiner Rezeption bestehtaus einem komplexen Netz wissenschaftlicher Auseinandersetzungvor dem Hintergrund der Romantikforschung. Es gibt kaum einen Autordeutscher Sprache (abgesehen von Goethe und Kafka), der Hauptgegenstandeiner vergleichbaren Anzahl von Dissertationen wäre; Tiecks KunstmärchenDer blonde Eckbert gehört zu den meistinterpretierten literarischenTexten. Selbstverständlich hat sich ein Großteil der Tieck-Forschung aufsein literarisches Schaffen bezogen, doch mittlerweile sind auch andere Bereicheseines Schaffens – in sich nicht minder kreativ und wichtig – Gegenstandder Wissenschaft geworden: Tiecks Rolle als Vermittler von Literatur,als Herausgeber, Übersetzer, Kommentator, Kritiker, Dramenexperte, Bibliophilerund Buchhistoriker. Nach verschiedenen Ansätzen bietet das 2011erschienene Tieck-Handbuch einen Überblick zu allen Forschungs- undEditionsaktivitäten, die sich Tieck widmeten und widmen. 29In Bezug auf die Buchgeschichte wird Tieck für einen der wichtigstenBibliophilen gehalten, doch hat er bislang aus dieser Perspektive – außerhalbder Germanistik – wenig Beachtung gefunden. Der BuchhistorikerL. Thompson etwa informiert umfassend zu Privatbibliotheken –von der Antike bis zur Gegenwart – bietet aber wenig Einblick in derenstrukturelle Bedeutung und Wichtigkeit. Dies erweckt den Eindruck, siewären hauptsächlich als Produkte einer Bibliomanie aufzufassen, dochso wahr dies – vor allem im Falle Tiecks 30 – auch sein mag, so ist dochder Einfluss von wesentlichem Interesse, den sie auf andere Sammler,Literaturhistoriker und europäische Bibliotheken ausübten. J. OvermiersZusammenfassung – »Many private libraries developed far beyond the generalbooks that an educated person would read for pleasure or purpose into scholarlycollections focusing in depth on a specific subject area.« 31 – kann vollständig aufTieck angewendet werden. Gerade in jüngster Zeit haben zahlreiche Publikationendie enge Verwandtschaft zwischen dem Schicksal gewisserBibliotheken (Privat-, Adels-, Bürger- oder sonstige) und dem Ursprungund Entwicklung wissenschaftlichen Denkens herausgearbeitet. Ein beispielhaftesParadigma stellt Isolde Quadrantis Geschichte, Analyse undKatalog der Bibliothek des klassizistischen Gelehrten und ÜbersetzersIppolito Pindemonte dar. 32 Ein anderes aktuelles Beispiel ist die Neuausgabedes Katalogs der Leopardi-Bibliothek 33 in Recanati: Giacomo LeopardisVater Monaldo war ein glühender Verehrer seiner Bücher, wasdie Bildung seines Sohnes unmittelbar beeinflusste. In Dresden hat erst92biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
kürzlich eine Dissertation zur bedeutenden Bibliothek des sächsischenAdeligen Heinrich Graf von Bünau (1697-1762) die Verbindung zwischenverschiedenen Buchklassifikationssystemen und Wissensordnungen des18. Jahrhunderts hervorgehoben. Auch die Wechselwirkung zwischenAdels-, Privat- und öffentlichen Bibliotheken bzw. die Bedeutung der Bibliotheksgeschichteals Hintergrund für die Entstehung und Entwicklungder Geisteswissenschaften wird darin unterstrichen. 34Doch im Gegensatz zu berühmten Privatbibliotheken (vor allem vonadeligen Eigentümern außerhalb jener Länder, die besonders von denKriegen des 20. Jahrhunderts betroffen waren), die nach wie vor in ihrerursprünglichen Zusammensetzung und Umgebung besucht werden können,ist Tiecks Bibliothek verstreut und auch in Bezug auf ihre räumlicheOrganisation und Verwaltung kaum nachvollziehbar: Während anderestolze Sammler darauf bestanden, einen Katalog als Zeichen einer stabilenIdentität einer geschlossenen Sammlung 35 anzufertigen oder schreiben/druckenzu lassen, wurde Tiecks Sammlung erst katalogisiert, als siekurz davor stand, aufgelöst zu werden. Während Adelige und wohlhabendeBürger sich bemühten, ihren Büchern ein einheitliches Äußereszu geben (um den ästhetischen Effekt zu vergrößern und die Zukunft derSammlung sicherzustellen), hatte Tieck nur wenige Bücher geerbt undzudem kein Wappen, dass er als Supralibros hätte verwenden können– und nachdem seine Frau und seine geliebte bibliophile Tochter gestorbenwaren, waren ihm lediglich Erben geblieben, denen er – so scheintes zumindest – seine Bücher nicht zukommen lassen wollte: die beidenSöhne seiner Schwester Sophie und seine jüngere Tochter Agnes, die –wie es heißt – eigentlich die Tochter seines Freundes Wilhelm von Burgsdorffwar. Somit wurde nichts vorbereitet, um Tiecks Bibliothek durchJahrhunderte hindurch zu bewahren. Es ist wichtig, private Adelsbibliothekenvon Gelehrtenbibliotheken der Mittelschicht zu unterscheiden:Während erstere oft über Generationen gepflegt wurden, waren letzteregroße, hochspezialisierte Sammlungen, die von begrenzten finanziellenMitteln geprägt waren und während eines einzelnen Lebens zusammengestelltwurden. In Tiecks Fall ist es die Gelehrtenbibliothek, die alsLeitmodell dienen kann, wenn auch seine Sammlung eher als die einesAutors wahrgenommen wurde als die eines philologischen Experten. Inweiterer Folge ging seine »zweite« Sammlung in der Adelsbibliothek vonKlein-Oels auf und ging gemeinsam mit dieser großteils verloren. DerKatalog dieser schlesischen Sammlung verzeichnet gedruckte Werke alphabetischohne Nummerierung, Beschreibung oder Hinweise auf Provenienz.36 Es scheint darin ein umfangreicher Tieck-Bestand auf (566-571,darunter auch der erste Asher-Katalog), ansonsten gibt es keine direktenHinweise auf Vorbesitzer. In Einzelfällen ist zu überprüfen, ob beispielsweiseder 1477er Titurel (BT 285 »conservation parfaite«) identisch mit der1477er Ausgabe (»unvollst.«) aus Klein-Oels (572) ist.Die Forschung liefert nur wenige Informationen zur Verstreuung derTieckschen Bücher. Das Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschlandgibt nur beiläufige Informationen zum Bestand relevanter Bibliotheken. 37Laut dem Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich gelangten ausder Sammlung Ludwig Tieck’s [Ausgaben des 2., 3. und 4. Shakespeare-Folios] in die Hofbibliothek”. 38 Zu spanischen Texten in Wien lautet die Information:»Von den im 19. Jh. erfolgten systematischen Ergänzungen sind93biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
Ankäufe bei den Auktionshäusern Dumont in Paris, Butsch in Augsburg,Asher in Berlin (Ternaux-Compansche Sammlung aus der Auktion LudwigTieck), Leibrock in Braunschweig (Lemkesche Samlung) und Hiersemannin Leipzig (›Sueltas‹ spanischer Dramatiker) nachzuweisen. 39 In Bezug aufdie Staatsbibliothek Berlin besteht die Hauptschwierigkeit in der Nachverfolgungjener Bücher, die während des Zweiten Weltkriegs ausgelagertwurden: Verlagert, verschollen, vernichtet stellt eine Karte aller Bücherlagerwährend des Krieges zur Verfügung. 40 Die Akzessionslisten der StaBi Berlinverzeichnen 118 Titel, von denen knapp die Hälfte als Kriegsverlustgeführt wird; wenige bekannte Titel werden als Bestand der RussischenStaatsbibliothek angeführt. B. Fabians Handbuch deutscher historischer Buchbeständein Europa liefert Hinweise auf den Verkauf Tieckscher Bücher nachLondon 41 und erwähnt eine Ausgabe des Katalogs mit Anmerkungen, dieauf Kaufwünsche hindeuten; allerdings seien nicht alle Käufe getätigt worden;einzelne Bände sollen zwar nach London gebracht, danach aber alsDuplikate wieder rückgestellt worden sein. In der British Library wurdendurch Projektrecherchen zwei Ausgaben des ersten Asher-Katalogs mitAnmerkungen ausgeforscht, die zur Zeit ausgewertet und als Grundlageeines Forschungsaufenthalts in London dienen werden.Die Erforschung der Tieckschen Bibliothek kann mit der minutiösenKatalogisierung von Goethes Büchersammlung und seine Verwendungder Bibliotheken in Weimar und Jena 42 verglichen werden, oder auchmit der Rekonstruktion der Bibliothek der Brüder Grimm, 43 und zwarin Bezug auf Stellung, Geschichte, Faktenlage und Methode. Im Gegensatzzu Tiecks Sammlung war jene der Brüder Grimm (mit über 7000 Titeln)größtenteils einheitlich gebunden und mit einem Exlibris-Stempelversehen; wie Tieck führten die Grimms keine vollständige Liste ihrerSammlung, und wie auch in Tiecks Fall wurden die Bücher der Grimmszum Großteil 1869 an Asher verkauft und in viele Richtungen verstreut.Eine große Zahl verblieb in Berlin, wertvolle Texte gingen im ZweitenWeltkrieg verloren, und wie bei Tieck spielten Erben eine gewichtigeRolle. Deneckes und Teitges Vorgehensweise (die Bände wurden in Bezugauf Provenienz, Nutzungsspuren, Widmungen und Anmerkungenhin untersucht) dient als Modell für unsere Analyse der Tieckschen Bibliothek.Ihr Katalog ist nach Themen gegliedert und weist einen alphabetischenIndex sowie einige Bilder auf. Zur Zeit scheint keine TiecksSammlung vergleichbare Bibliothek in Form einer Online-Bibliothekzugänglich zu sein; auch die Schiller-Bibliothek ist lediglich in einemelektronischen File mit bibliografischen Informationen und Marginaliengespeichert, die Datenbank selbst ist über das Netz nicht zugänglich.Über diese Überlegungen hinaus lässt sich Tiecks Sammlung auch mitanderen protokomparatistischen privaten Gelehrtenbibliotheken vergleichen,etwa den Sammlungen von Johann Adolf Schlegel, Johann JoachimEschenburg, Johann Gottfried Herder (die alle vor Tieck geborenwurden) und von August Wilhelm Schlegel. 44Bestände der Tieckschen Bibliothek an der ÖNBDie Verfolgung und Analyse der Ankäufe der Wiener Hofbibliotheksteht innerhalb des Projekts an zentraler Stelle – naheliegend einerseitsdurch die gegebene räumliche Nähe und die bestehende Kooperationdes Projekts mit der ÖNB, andererseits durch den Umfang der nach Wien94biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
gelangten Bestände. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass AchimHölter bereits in der 1980er Jahren im Rahmen seiner Dissertationsrecherchenauf die freundliche Unterstützung der ÖNB zählen konnteund auf Anfrage Aktenmaterial zur Berliner Auktion aus der Sicht derHofbibliothek zur Verfügung gestellt bekam – die Ergebnisse (v.a. Korrespondenzdes Beauftragten der Wiener Hofbibliothek Ferdinand JosephWolf mit seinem Vorgesetzen Frh. von Münch-Bellinghausen über denVerlauf der Auktion 45 ) wurden bereits 1989 publiziert 46 und bilden ingewisser Weise den Ausgangspunkt der Erforschung von Ludwig TiecksBibliothek im Rahmen des 2014 bewilligten Projekts. Grundlage derzeitlaufender Autopsien ist das 333 Nummern auflistende sogenannte»Herz-Verzeichnis« 47 ; die Tieck-Provenienz etwaiger weiterer Bände derÖNB wird in Kooperation mit der ÖNB noch überprüft. Detailfragen ergebensich in Bezug auf den Umgang mit etwaigen Dubletten und derAuflösung von Adligaten. Eine wichtige Quelle hierfür ist neben demHausarchiv und den Korrespondenzen der handschriftliche Kapselkatalog.Geplant ist auch eine Erweiterung der Metadaten, sowohl mit Hinweisenauf handschriftliche Bemerkungen als auch auf die Tieck- undTieck-Wolf-Provenienz.Wolf und Münch-Bellinghausen sind hierbei von besonderem Interesse,da sie beide in der Folge der Auktion auch durch genaue Kenntnisvon Tiecks Spanien-Sammlung zu Koryphäen der sich formierendenHispanistik wurden. In Bezug auf die Frage, ob sich Wolf und Münch-Bellinghausen auch persönlich an der Auktion beteiligten, sind Quellendes Hausarchivs der ÖNB sowie des Haus-, Hof- und Staatsarchivs (Akten desObersthofmeisteramtes) einzusehen wie auch Briefe aus der Sammlung vonHandschriften und alten Drucken, etwa aus den Nachlässen Theodor Georgvon Karajans (1810-1873) und Münch-Bellinghausen (1806-1871); zudemwurde die nachgelassene Bibliothek Ferdinand Wolfs von der Hofbibliothek1866 angekauft. 48 All diese Bemühungen werden neue Informationenzur Auktion der Tieckschen Bibliothek und zur Akquisitionspolitikder Hofbibliothek zutage fördern.95biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
1 Die Geschichte derTieckschen Bibliothek wirdhier nur in geraffter Formwiedergegeben; für eineumfassende und detaillierteDarstellung vgl. A. Hölter,Tiecks Bibliothek, in: C.Stockinger u. S. Scherer(Hrsg.): Ludwig Tieck. Leben– Werk – Wirkung. Berlin/New York 2011, 314-321. Vgl.auch A. Hölter Ludwig Tieck.Literaturgeschichte als Poesie.Heidelberg 1989, 94-110, 397-424.2 R. Folter, Deutsche Dichter-und Germanisten-Bibliotheken.Eine kritische Bibliographieihrer Kataloge. Stuttgart 1975.3 Vgl. etwa W. Adam,Privatbibliotheken im 17.und 18. Jahrhundert. Fortschrittsbericht(1975-1988).IASL 15 (1990), 123-173 bzw.W. Adam, Bibliotheken alsSpeicher von Expertenwissen.Zur Bedeutung vonPrivatbibliotheken für dieinterdisziplinäre Frühneuzeit-Forschung,in: C.Brinker-von der Heyde u. J.Wolf, Repräsentation, Wissen,Öffentlichkeit. Bibliothekenzwischen Barock und Aufklärung.Kassel 2011, 61-69; auchP. Raabe, Gelehrtenbibliothekenim Zeitalter der Aufklärung.Paderborn 1987.4 Vgl. G. A. E. Bogeng,Die großen Bibliophilen. Geschichteder Büchersammler undihrer Sammlungen. 3 Bände,Leipzig 1922, 193; umfassendA. Hölter 1989, 94-110.5 Vgl. R. Köpke, LudwigTieck. Erinnerungen aus demLeben des Dichters nach dessenmündlichen und schriftlichenMitteilungen. 2 Bd. Leipzig1855 (Nachdruck Darmstadt1970), I, 7.6 Vgl. P. J. Becker, Bibliotheksreisenin Deutschlandim 18. Jahrhundert. Archivfür Geschichte des Buchwesens21 (1980), 1361-1534.7 Vgl. Köpke II, 29.8 Vgl. H. Lüdeke vonMöllendorff (Hrsg.), AusTiecks Novellenzeit. Briefwechselzwischen Ludwig Tieck und F. A.Brockhaus. Leipzig 1928, 28f.9 Z.B. Joanna Baillie, Aseries of plays, in which itis attempted to delineatethe stronger passions of themind, each passion beingthe subject of A Tragedy andA Comedy. London 1802.(ÖNB: 23716-B).10 Vgl. U. Schweikert(Hrsg.): Ludwig Tieck. 3 Bde.München: Heimeran 1971 (=Dichter über ihre Dichtungen9), 2, 142.11 Vgl. ibid. 3, 267 u. 270.12 Vgl. L. Tieck, Schriften,28 Bde. Berlin 1828-54, 22,13.13 U. Schweikert (Hrsg.):Schriften 1836-1852. Frankfurt/Main1986 (= LudwigTieck. Schriften in 12 Bänden12), 221.14 H.W. Hewett-Thayer,Tieck’s Marginalia in theBritish Museum, The GermanicReview 9 (1934), 9-17, 5.15 Vgl. Folter 1975, zuTieck 194f.16 Verträge bei Hölter1989, 398-409.17 Catalogue de la bibliothèquecélèbre de M. LudwigTieck qui sera vendue à Berlinle 10. décembre 1849 et jourssuivants par MM. A. Asher &Comp. Berlin 1849. Reprint,unter Hinzufügung einesVorworts von Erich Carlsohn,Wiesbaden 1970. Zunäheren Informationen zuKatalog und Reprint, sieheHölter, Tiecks Bibliothek,314-321.18 Vgl. die Wiener ArchivakteÖNB Wien, HB 208,222 und 249/1849 sowie HB51/1850; daraus die Korrespondenzbei Hölter 1989, S.409-423.19 Vgl. auch P.J. Weimerskirch,Antonio Panizzi’s acquisitionspolicies for the libraryof the British Museum. Diss.(Bibliothekswissenschaften)Columbia University 1977.20 Hölter 1989, 424.21 Catalogue d’une collectionprécieuse de livres rares etcurieux provenants en partiede la bibliothèque célèbre de M.Ludw. Tieck, en vente, aux prixmarqués, chez A. Asher & Co.libraires. Berlin 1850.22 Vgl. eine der Ausgabender BT 1849 in der BritishLibrary (011900ee29), dieAnmerkungen zu Inventarzweckennach erfolgtemAnkauf enthält.23 Berlin 15. August 1852,Tieck an Graf Yorck: L.Tieck, Letters. Hitherto Unpublished1792-1853.Collectedand ed. by Edwin H. Zeydel,Percy Matenko, RobertHerndon Fife. New York,London 1937, 552.24 Knigi iz sobranija grafovJork fon Vartenburg v rossijskichbibliotekach: katalog. Bücheraus der Privatsammlung derGrafen Yorck von Wartenburgin russischen Bibliotheken: Katalog.Buchzentrum Rudomino2012.25 E.H. Zeydel, LudwigTieck and England. A Studyin the Literary Relations ofGermany and England Duringthe Early Nineteenth Century.Princeton: 1931, 227-56.Siehe auch: E.H. Zeydel,Ludwig Tieck’s Library, ModernLanguage Notes 42 (1927),21-25.26 Vgl. auch H. W.Hewett-Thayer, Tieck andthe Elizabethan Drama: HisMarginalia, Journal of Englishand Germanic Philology 34(1935), 377-407.27 W. Fischer, Zu LudwigTiecks elisabethanischenStudien: Tieck als BenJonson-Philologe, Jahrbuchder deutschen Shakespeare-Gesellschaft 62 (1926), 98-131,120f.28 E. Neu, Tieck’s Marginaliaon the Elizabethan drama:The Holdings in the British Library.Phil. Diss. Cambridge:1987.29 C. Stockinger u. S.Scherer (Hrsg.), Ludwig Tieck.Leben – Werk – Wirkung. Berlin,Boston 2011.30 Vgl. L.S. Thompson,Private Libraries, in: A.Kent/H. Lancour/J.E. Daily(Hrsg.): Encyclopedia of Libraryand Information Science. Bd.24. New York, Basel: 1978,125-192, 171.96biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
31 J. Overmier, PrivateLibraries, In: W.A. Wiegandu. D.G. Davis (Hrsg.): Encyclopediaof Library History. NewYork/London 1994, 513-517,515.32 I. Quadranti, La bibliotecadi casa Pindemonte e i libridi Ippolito. Studio bibliograficofilologico.2 Bde. Verona 2009.33 A. Campana (Hrsg.), Catalogodella Biblioteca Leopardiin Recanati (1847-1899). Nuovaed. Prefazione de EmilioPasquini. Firenze: 2011.34 Vgl. T. Sander, Ex BibliotecaBunaviana. Studien zu deninstitutionellen Bedingungeneiner adligen Privatbibliothekim Zeitalter der Aufklärung.Dresden 2011, vor allem 125-135).35 Vgl. U. Jochum, DieIdole der Bibliothekare.Würzburg 1995, 44.36 Vgl. Graf Yorck vonWartenburgsche Fideicommiss-Bibliothek Klein-Oels. AlphabetischerCatalog. I. Abtheilung.[gedruckt in Breslau, o. J.,datiert 1874; 631 S.: StaBi:RLS Dr 5159; ohne Vorwort,ohne Autor]; siehe auch J.Ringelnatz, Mein Leben biszum Kriege. Reinbek: 1966;Sammlung von hervorragendenSeltenheiten vornehmlich ausLiteratur und Kunst darin dieDubletten der gräflich York v.Wartenburgschen Schloßbibliothekin Kleinoels. Berlin: MaxPerl 1907.37 B. Fabian (Hrsg.),Handbuch der historischenBuchbestände in Deutschland.27 Bde. Hildesheim/Zürich/New York 1996-2000.38 B. Fabian (Hrsg.),Handbuch der historischenBuchbestände in Österreich. 4Bde. Hildesheim/Zürich/NewYork 1994-1997, Vol. 1, 100.39 Ibid., 93.40 Staatsbibliothek zuBerlin Preußischer Kulturbesitz:Verlagert, verschollen,vernichtet... Das Schicksal derim 2. Weltkrieg ausgelagertenBestände der PreußischenStaatsbibliothek. Berlin: 1995,46 47-50 weiterführendeBibliografie. Zur Auslage-rungsgeschichte siehe auch:G. Voigt, Die kriegsbedingteAuslagerung von Beständender Preußischen Staatsbibliothekund ihre Rückführung.Eine historische Skizze auf derGrundlage von Archivmaterialien.Hannover: 1995; W.Schochow, Bücherschicksale.Die Verlagerungsgeschichte derPreußischen Staatsbibliothek.Auslagerung, Zerstörung,Entfremdung, Rückführung.Dargestellt aus den Quellen. M.e. Geleitwort v. Werner Knopp.Berlin, New York 2003.41 B. Fabian (Hrsg.), Handbuchdeutscher historischerBuchbestände in Europa. EineÜbersicht über Sammlungenin ausgewählten Bibliotheken.12 Bde. Hildesheim/Zürich/New York 1999-2001, Bd. 10,53 56sq. mit Informationenzum Autor des Asher-Katalogs,Albert Cohn, und 84»Die Sammlung Tieck«.42 Vgl. K. Bulling, Goetheals Erneuerer und Benutzer derjenaischen Bibliotheken. Jena:1932; E. Keudell, Goethe alsBenutzer der Weimarer Bibliothek.Ein Verzeichnis der vonihm entliehenen Werke., hrsg.m. e. Vorw. v. W. Deetjen.Weimar 1931; H. Ruppert,Goethes Bibliothek. Katalog.Leipzig 1978.43 L. Denecke u. I. Teitge,Die Bibliothek der BrüderGrimm. Annotiertes Verzeichnisdes festgestellten Bestandes.Hrsg. von F. Krause. Weimar1989.44 Vgl. Folter, 1975, 175f.45 Vgl. die Wiener ArchivakteÖNB Wien, HB 208,222 und 249/1849 sowie HB51/1850.46 Hölter 1989, S. 409-423.47 Verzeichnis von Büchernaus der Bibliothek LudwigTiecks, die nach Randbemerkungenin einem Exemplardes Auktionscataloges von derK.K. Hofbibliothek in Wieneingekauft worden sind. –Handschrift, ÖNB Ser. Nov.4300, Schenkung WilhelmHerz, Berlin, Akt v. 7.12.19053.1236.48 ÖNB Archiv 87 1/2/1866.97biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Achim Hölter und Paul Ferstl • Die Bibliothek Ludwig Tiecks und ihre Rekonstruktion | 85–95
Sonja HotwagnerDie Österreichische Nationalbibliothekauf Facebook? – Like!Ein trübes Wochenende zuhause. Zack, den Laptop auf den Schoß undlosgeklickt. Wohin? Auf Facebook natürlich! Hier wird gepostet, gelikedund kommentiert was das Zeug hält. Von romantischen Urlaubsfotosüber Zeitungsartikel bis hin zu skurrilen Bilder und Fun-Postings reichtdas bunte Angebot, das jederzeit zum hemmungslosen Prokrastiniereneinlädt. Sie fühlen sich jetzt fast ein wenig ertappt? Dann gehören Sievermutlich zu den aktuell 3.400.000 Facebook-UserInnen in Österreich –eine beeindruckende Zahl.Vor zweieinhalb Jahren, im Oktober 2012, entschloss sich auch die ÖsterreichischeNationalbibliothek (ÖNB) als prominente Kulturinstitutiondie Möglichkeiten von Facebook (FB) zu nutzen. Ein eigener Accountsollte angelegt werden, um neue Nutzerkreise zu erschließen und damitim Sinne einer Demokratisierung des Wissens die reichhaltigen Beständeder Bibliothek ortsungebunden auch Menschen nahe zu bringen, dienicht als ForscherInnen oder StudentInnen die Lesesäle benutzen. Andersals bei anderen von der ÖNB verwendeten Medien wie etwa demelektronischen Newsletter und dem gedruckten Magazin, können aufFacebook Bilder mit einem kurzen, meist unterhaltsamen Informationstextund dem Link zu den entsprechenden Beständen gepostet werden.Dies ermöglicht es, tagesaktuell auf Trends oder Ereignisse einzugehenund damit die Relevanz der vorhandenen Bestände sowie das moderneBild einer Bibliothek zu unterstreichen.Die Idee, möglichst viele Kulturinteressierte direkt auf FB abzuholenund für die größte wissenschaftliche Archivbibliothek des Landes zu begeistern,ging auf. Bereits im Dezember desselben Jahres verbuchte derÖNB-Account 1.000 Facebook-»Freunde« bzw. -Fans, ein Jahr nach seinemEntstehen waren es bereits über 5.500 Fans. Und es ging noch weiterbergauf: Aktuell sind es schon über 11.700 Fans. 61% aller ÖNB-Fans aufFB sind Frauen: im Vergleich zu 46% Frauenanteil auf FB insgesamt eininteressanter Wert. Die größte Altersgruppe ist jene der 25-34-Jährigen(19 % bei den weiblichen ÖNB-Fans auf FB, 11 % bei den männlichen), 3%bzw. 2% der ÖNB-Fans auf FB sind über 65 Jahre. Die meisten Fans stammenaus Österreich (aktuell 9.534) und Deutschland (aktuell 410), dazukommen jedoch auch Fans aus der Mongolei, Tunesien oder Thailand!(Stand: Mai <strong>2015</strong>)Gepostet wird, wie bereits angesprochen, Interessantes und wenigerBekanntes aus den vielfältigen Beständen des Hauses: Vom altägyptischenPapyri über den barocken Globus bis hin zu originellen Publikationender letzten Jahre. Erweitert wird der reiche Ideenpool aus den achtSammlungen der ÖNB um Inhalte aus den verschiedenen Abteilungen98biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
(beispielsweise aus Benützungsservices), die mit Anekdoten und Fundstückenimmer wieder Stoff aus dem unmittelbaren Bibliotheksalltagbieten. So fanden kürzlich etwa in Büchern vergessene Einkaufszettel(dazu später mehr) oder kurios verpackte »Büchermumien« ihren Weg aufFacebook. Zu guter Letzt dient die FB-Präsenz der ÖNB selbstverständlichauch der Information. BenützerInnen und BesucherInnen erfahren hiernicht nur Aktuelles aus der Benützung, sondern auch aktuelle Veranstaltungstermine,etwa Ankündigungen zu Sonderführungen, Musik- oderLiteratursalons im Haus. Seit 18. April kommen hier auch die zahlreichenVeranstaltungen im neueröffneten Literaturmuseum hinzu. Nichtzuletzt bietet FB auch die Möglichkeit, Interessenten innerhalb der FB-Community auf die kommenden und laufenden Sonderausstellungen inPrunksaal und Papyrusmuseum der ÖNB hinzuweisen und ihnen durchausstellungsbezogene Postings einen kleinen Vorgeschmack zu geben.Ziel war (und ist) es, alle Sammlungen, museale Bereiche und ausgewählteAbteilungen gleichermaßen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.Die ÖNB als Archivbibliothek hat hier einen nicht ganz unbedeutendenVorteil: Der Großteil der vorhandenen Bestände unterliegtaufgrund seines Alters nicht mehr dem Urheberrecht und kann daherproblemlos gepostet werden und auch von Fans weiter geteilt werden.Zudem sollte die Bekanntheit der digitalen Angebote der ÖNB erhöhtund Besuche im Digitalen Lesesaal beworben werden. Ein schönes Beispieldafür: Seitdem die ÖNB auf Facebook aktiv ist, haben sich die direktenZugriffe aus der sozialen Plattform auf das digitale Zeitungsangebotvon ANNO (anno.onb.ac.at) verdoppelt.Doch Ordnung ist alles. Um ein kohärentes und ausgewogenes Erscheinungsbildzu gewährleisten und eine Struktur in all diese Ideen zubringen, werden mögliche Inhalte in einem Content-Plan festgehalten.Der Content-Plan ist das Herzstück der Redaktion, er enthält die vorgesehenenDaten der Veröffentlichung, die Texte, die Links zu den Beständensowie nähere Informationen zum Objekt. Das Redaktionsteam istzweigeteilt: das aktiv postende Kern-Team in der Abteilung Kommunikationund Marketing der ÖNB und das erweiterte Redaktions-Team inden Sammlungen und Abteilungen, das Inhalte vorschlägt. Das Projekt»Facebook« ist in dieser Form nur durch die enge Zusammenarbeit vonKern- und erweitertem Team möglich.Apropos Kommunikation: Ein wichtiger Punkt ist last but not leastauch die Kommunikation zwischen Redaktion und FB-UserInnen. Daszeitnahe Beantworten von Fragen zu einem Posting/Objekt sowie dasBeantworten von Emails über den FB-Account gehören ebenfalls zu denAufgaben der Kernredaktion. Spezifische wissenschaftliche Auskünftezu den Objekten werden stets in Rücksprache mit den jeweiligen Expertenin den einzelnen Abteilungen gepostet. Als Sprachrohr der ÖsterreichischenNationalbibliothek ist selbstverständlich auch der FB-Accountzu einer neutralen, sachlichen Haltung verpflichtet und bemüht, in Diskussionenzwischen den UserInnen nur in Ausnahmefällen einzugreifen.Nichtsdestotrotz kommt es vor, dass UserInnen wiederholt gegendie auf der Website einsehbare Netiquette verstoßen und von der Redaktionverwarnt bzw. geblockt werden müssen. Dies ist glücklicherweisedie Ausnahme, der Regelfall sind vielmehr zahlreiche interessierte undinteressante Fragen und Kommentare von Seiten unserer ÖNB-Fans.99biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
Zu den »Abräumern« unter den Posting-Motiven zählen Bilder schönerFrauen, süßer Tiere und Regenbögen. Gerne auch alles gemeinsam. Siesind neugierig geworden? Kein Problem, hier eine kleine Auswahl derBest-of-Postings der letzten Jahre.Fast ein bisschen berühmtwurde dieser zum Lesezeichenumfunktionierte Einkaufszettelaus Pappe. In einem Buchvergessen dokumentiert er dasLeben unserer LeserInnen undwurde als originäres »Zeitdokument«der FB-Redaktion vonaufmerksamen Kollegen zugeschickt.In der Reihe »OriginelleFundstücke. Aus dem Leben einesBibliothekars« wurde das kreativeHelferlein schließlich miteinem Posting verewigt. Über130 FB-Fans waren amüsiert.Mittelalterliche Handschriften sind langweilig? Von wegen! Mit dem heroischenKampf Schnecke gegen Kentaur konnte dieses Digitalisat aus der Sammung vonHandschriften und alte Drucken bei den FB-Fans der ÖNB punkten. SpannendeDetails wie kunstvoll ausgeschmückte Initialen oder Drolerien finden sich zuhaufin den kostbaren alten Handschriften. Eine Abbildung der kompletten Seite oderein Link zum Digitalisat des Objekts im digitalen Lesesaal wird im Posting selbstverständlichstets mitgeliefert, Interessierte können also jederzeit die kompletteHandschrift/das komplette Buch online durchblättern. Vorausgesetzt natürlich,Ihr Internetanschluss ist nicht so langsam wie diese Prachtschnecke …100biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
Es ist ein offenes Geheimnis: Schöne Frauen ziehen immer. Wenn es sich bei dieserschönen Frau jedoch auch noch um Romy Schneider handelt und diese zudemauch noch ein putziges Kätzchen hält, dann muss man das doch einfach gut finden.Dieses Posting anlässlich des (leider nicht mehr erreichten) 75. Geburtstages despopulären österreichischen Weltstars zählt ebenfalls zu den beliebtesten. Franzlwäre sicher stolz.Generell sind viele FB-Beiträge der ÖNB anlassbezogen. Geburtstage, Sterbetage,diverse Aktionstage und brandaktuelle Ereignisse wie etwa der österreichische Siegbeim Songcontest 2014 durch Conchita Wurst bieten da natürlich einen willkommenen»Aufhänger«. Oder hätten Sie sonst gewusst, dass – bezugnehmend auf das Kultbuch»Per Anhalter durch die Galaxis«, den Bestseller von Douglas Adams – auch diesesJahr am 25. Mai wieder der »International Towel Day« (dt. Handtuch-Tag) gefeiert wird?101biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
Diese Dame, eine geborene Wienerin, umrundete Mitte des 19. Jahrhundertsnicht nur einmal, sondern sogar zweimal die Welt. Bildarchivund Grafiksammlung initiierten im vergangenen Jahr die Kurzserie»Österreichische Entdecker«, im Rahmen derer innerhalb von einerWoche die Porträts von EntdeckerInnen, ForscherInnen und Freibeuternder Habsburgermonarchie gepostet wurden. Ida Pfeiffer, RudolfCarl Freiherr von Slatin oder Jakob Eduard Polak – sie alle bereistendamals noch kaum bekannte Erdteile, lernten diverse Landessprachenund publizierten ihre spannenden Erlebnisse oder wissenschaftlichenErkenntnisse später zuhause.»Nicht immer findet man am Ende eines Regenbogens einen Topf mit Gold.Manchmal ist es auch die Österreichische Nationalbibliothek!«, so hießes im August 2014. Dass sich viele FB-UserInnen auch über diesen»Fund« am Ende dieses imposanten Regenbogens freuten, zeigteder Erfolg des Postings. Der Schnappschuss (zugegeben von professionellerHand gemacht) erntete sensationelle 215 Likes – und das,ohne dass mit einem Topf voll Gold nachgeholfen wurde!102biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
Und last but not least ein ganz besonderes Schmankerl.Dass man für einen lustigen Beitrag manchmal auch einfach nur mit offenenAugen durch die Welt, konkret: über den Josefsplatz, gehen muss, zeigt dieserBeitrag. Die FB-Redaktion »erwischte« diesen einsamen Cowboy vor demGebäude der Österreichischen Nationalbibliothek. Wohin er wohl wollte?Und ob er vielleicht zuvor in der Modernen Bibliothek am Heldenplatz sämtlicheKarl May-Romane durchstöbert hatte? Wir wissen es nicht. Anlass fürein spontanes Posting war der originelle Besucher aber allemal. Like!103biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Sonja Hotwagner • Die Österreichische Nationalbibliothek auf Facebook? – Like! | 96–101
Elisabeth EdithKamenicekWissenschaftliche Erschließung vonNachlassmaterialien zu Ludwig WittgensteinErschließung des Fotobestandes der Sammlung »Nachlass der FamilieWittgenstein-Stonborough«Die Österreichische Nationalbibliothek verfügt über eine umfangreicheSammlung an Originaldokumenten zu Ludwig Wittgenstein, nachden Beständen der Wren Library des Trinity College in Cambridge diezweitgrößte Wittgenstein-Sammlung weltweit. Darin enthalten ist eingrößerer Nachlassbestand aus dem Besitz der Familie Stonborough (Cod.Ser. n. 37.580-27.669). Diese hochinteressante, sehr heterogene Sammlungumfasst unter anderem Objekte von Wittgensteins Eltern Karl undLeopoldine wie auch der Geschwister Ludwigs, wie zum Beispiel Kompositionenvon Hans Wittgenstein, Skizzenbücher von Hermine, Theaterlibrettivon Margarethe und Baupläne zum Haus in der Kundmanngassevon Paul Engelmann und Ludwig Wittgenstein.Teil der Sammlung Stonborough sind auch an die 600 Fotografien vonbiografisch wie kulturgeschichtlich höchstem Wert: drei Familien-Fotoalbensowie etwa 150 Einzelfotografien. Die meisten dieser Fotos sindbislang unpubliziert, darunter auch unbekannte Momentaufnahmenaus der Kindheit Ludwig Wittgensteins. Die Fotosammlung enthält nebenPortraits der Familienmitglieder und der Freunde der Familie zahlreicheAufnahmen der Familiensitze der Wittgensteins – besonders bedeutungsvolldie von Karl Wittgenstein erbaute und von seiner Familieab den 1890er Jahren regelmäßig frequentierte Hochreith im südlichenNiederösterreich. Dazu kommen Bilder zahlreicher Reisen einzelner Familienmitglieder.Im Rahmen des von einem privaten Sponsor finanzierten, von 2013bis 2016 laufendem Forschungsprojekts werden die bislang größtenteilsunpublizierten Fotos der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemachtsowie anhand deren Analyse ein bislang fehlendes umfassendesBild der Familie und ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung gezeichnet.Die Fotoalben wie die Einzelfotografien werden im Rahmen des Projektsim Hinblick auf alle relevanten Details erschlossen. Dazu gehören:1. die Identifikation der dargestellten Personen2. die Identifikation der Fotografen (private Person bzw. Fotoatelier)3. Datierung4. Ort der Aufnahme5. Technik6. Maße7. Beschreibung des Inhalts / Anlasses8. Kommentare wie Beschriftungen der Fotografien sowie derdiesbezüglichen Hintergrundereignisse.104biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Abb. 1:Ludwig Wittgensteinund Inky von Schneller,(Ina-Maria von Schneller,Tochter von Hans und KatharinaMaria von Schneller,geborene Salzer) inNeuwaldegg anlässlichder Silbernen Hochzeitvon Karl und LeopoldineWittgenstein im Mai 1899(Fotoalbum Cod. Ser. n.37632, Seite 1)Abb. 2: Karl Wittgenstein mit seinen Enkeln Marie, Friedrich undFelix Salzer (Kinder von Max Salzer und Helene Salzer, geboreneWittgenstein) im Garten der Villa in Neuwaldegg im Juni 1905(Fotoalbum Cod. Ser. n. 37632, Seite 3)105biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Abb. 3: Die Familie Wittgenstein auf der Hochreith (Fotoalbum Cod. Ser. n. 37632, Seite 7)Bild links: Hermine Wittgenstein am Kamin, Hochreith 1905Bild rechts oben: Die Hausdame Rosalie Herrmann mit Marie und Friedrich Salzer(Kinder von Max und Helene Salzer, geborene Wittgenstein), Hochreith 1905Bild rechts unten: Die Hausdame Rosalie Herrmann, Hermine Wittgenstein,die Großmutter Marie Kallmus, Paul, Margarethe und Ludwig Wittgenstein, Hochreith 1905106biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Abb. 4: Ludwig Wittgenstein auf der Hochreith um 1900(Fotoalbum Cod. Ser. n. 37630, Seite 4)Abb. 5: Ludwig Wittgenstein auf der Hochreith um 1900(Fotoalbum Cod. Ser. n. 37630, Seite 6v)107biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Abb. 6: Der bekannte Geiger Joseph Joachim auf der Hochreith circa 1902mit Marie Salzer, Tochter von Helene Salzer, geborene Wittgenstein(Fotoalbum Cod. Ser. n. 37630, Seite 12)108biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Die Identifikation der Fotografen umfasst auch diejenige der damals inWien und in anderen europäischen Städten bekannten Fotoateliers des19. und 20. Jahrhunderts und in diesem Zusammenhang auch die angewandtenFototechniken. Dabei ist von Relevanz, ob es sich um professionelleFotografien aus Fotostudios handelt, oder um »Schnappschüsse«aus dem Familienkreis oder eines »Künstlerfreundes« der Familie – wiezum Beispiel des Malers und Stechers Ferdinand Schmutzer, des MalersJohann Victor Krämer oder auch des Fotografen der Secession MorizNähr. Ebenso sind die Arrangements und die Maße der in den Albenmontierten Fotos von wissenschaftlicher Relevanz – Indiz für die Vorliebeder Familie Wittgenstein, sie nach ihren ästhetischen Bedürfnissenund persönlichen Freiheiten zu bearbeiten –, wie dies später auch beiLudwig Wittgensteins persönlichem Fotoalbum aus den 1930er Jahrenzu beobachten ist.In Kooperation mit der Sammlung von Handschriften und Alten Druckender Österreichischen Nationalbibliothek wurde das Fotomaterialbereits digitalisiert und ist über den zentralen Katalog der ÖsterreichischenNationalbibliothek (Quicksearch) – wie auch über den Handschriftenkatalog(HANNA) – online zugänglich. Die Forschungsergebnissewerden über den Katalog frei verfügbar sein und ermöglichen es, ForscherInnender verschiedensten Wissensgebiete die Inhalte über Suchfunktionendirekt zu recherchieren und gezielt zu nutzen.Die Fotoalben und einzelnen Fotografien (Originale wie auch Abzügevon Originalen) umfassen den Zeitraum von 1865 bis in die 1950er Jahreund dokumentieren die kulturhistorische Bedeutung der Familie Wittgenstein,so deren großes Interesse an Musik, Bildender Kunst, Architekturund nicht zuletzt an der damals noch jungen Technik der Fotografie.Erschließung der Korrespondenz der Familie WittgensteinDie Sammlung von Handschriften und Alten Drucken der ÖsterreichischenNationalbibliothek verfügt über eine umfangreiche Sammlungvon Originalbriefen der Familie Wittgenstein, darunter circa 760 Briefevon beziehungsweise an Ludwig Wittgenstein. Diese sind bereits überdie Elektronische Edition des Gesamtbriefwechsels des Brenner-Archivs inInnsbruck online zugänglich und bilden wertvolles dokumentarischesMaterial für das vorliegende Projekt. Feinerschlossen werden auch circa350 Korrespondenzstücke zwischen anderen Familienmitgliedern, dienicht in der Online-Edition des Brenner-Archivs enthalten sind, jedoch fürdie biografische Wittgenstein-Forschung und die Erschließung des Fotobestandesgrößte Relevanz haben.Die Aufarbeitung der Briefe erfolgt chronologisch und ist innerhalbder Chronologie nach Familienmitgliedern geordnet. In den Online-Katalogsoll dabei Folgendes einfließen:1. Namen (Normierung und Verknüpfung mit Normdatei GND)2. Inhalt (Zusammenfassung des Inhalts in Regesten)3. Eventuell Korrekturen weiterer Angaben wie Datierung, Ort etc.Als Ergänzung werden auch zu jenen Korrespondenzen, die bereits imBrenner-Archiv publiziert sind, Inhaltsregesten formuliert und in den Online-Katalogeingegeben. Diese inhaltliche Feinerschließung stellt einenwesentlichen Mehrwert für die Wittgenstein-Forschung dar.109biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
Abb. 7: Brief von Paul Wittgenstein (Onkel) an Ludwig Wittgensteinvom 22. Oktober 1921, mit Selbstportrait: »Ich trage immer noch den Bartund sehe ungefähr jetzt so aus.« (Autogr. 1277/9-11)110biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Elisabeth Edith Kamenicek • Nachlassmaterialien zu Ludwig Wittgenstein | 102–108
BuchbesprechungenGábor Almási, FarkasGábor Kiss: EuropaHumanistica – Humanistesdu bassin des Carpates(HU 2 [EH 14]). Humanistesdu bassin des Carpates II.Johannes SambucusTurnhout: Brepols 2014,291 SeitenISBN: 978-2-503-53162-5In der Humanismusforschung hat sichseit einigen Jahren die Reihe Europa Humanisticaim Verlag Brepols als unverzichtbaresArbeitsinstrument etabliert; sie widmetsich in Ergänzung zu bestehendenoder voranschreitenden biographischenArbeiten zu Humanisten dem philologischenAspekt der Editionstätigkeit vorallem Klassischer Texte und deren buchsowiewissenschaftsgeschichtlichen Aufarbeitung.Die Initiative zu einer solchenAuseinandersetzung mit dem klassischenKulturerbe im Humanismus verdankt dasProjekt der Abteilung Humanismus desInstitut de Recherche et d’Histoire desTextes des Centre National de la RechercheScientifique (CNRS), Paris. Der Erfolgder Serie liegt in der gesamteuropäischenKonzeption; so haben neben dem französischenTeam die einzelnen Bände der deutschen,ungarischen und tschechischenArbeitsgruppe zur Internationalisierungbeigetragen. Weitere nationale Teams bisnach Mexiko haben sich bereits für Folgebändeangekündigt. Das Grundschemader Klassikerrezeptionsbände besteht nebeneiner sehr ausführlichen Einleitungin einer gründlichen Dokumentation der(zumeist) gedruckten Ausgaben, der wörtlichenWiedergabe von Praefationes undParatexten mit kurzen Einleitungen undKommentaren, wo die Texte Erklärungenverlangen.Den vorliegenden Band zu einem der bedeutendstenHumanisten im Donauraumder zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts,Iohannes Sambucus bzw. János Zsámboky,haben zwei profunde Kenner der Zeit,der Humanistenkultur und vor allem derdiesbezüglichen Quellen vorgelegt: GáborAlmási hat das maßgebliche Werkzu diesem Humanisten 2009 veröffentlicht(The Uses of Humanism. Andreas Dudith[1533–1589], Johannes Sambucus [1531–1584],and the East Central European Republic of Letters[Brill’s Studies in Intellectual History185]. Leiden: Brill); er kann mit Recht alsder beste Kenner dieser Persönlichkeit bezeichnetwerden; kongenial erarbeitet erdazu mit einem der führenden HumanismusforscherUngarns, Farkas Gábor Kiss,das breite Œuvre von Sambucus.Mit Sambucus liegt ein Glücksfall einesHumanisten und seiner nachzeichenbarenTätigkeit vor, mehr noch lässt sich bishin zu seinen benutzten Quellen die Spurzurückverfolgen. Dazu trägt bei, dass derBestand seiner griechischen Handschriftenmehrheitlich von der Hofbibliotheknach seinem Tod erworben werden konnte– en passant eines der beiden Fundamentedes griechischen Bestandes. Inder Auswahl der Texte – mit deutlichemSchwerpunkt auf griechischen Texten– ist Sambucus ein Kind des klassischenHumanismus mit deutlicher Orientierungauf die klassische Antike, allerdingssprengt er diesen zeitlichen Rahmen auchmit einigen Editionen. Das 16. Jahrhundertzeigte nämlich in der Editionstätigkeitneben verbesserten und erweitertenAusgaben der Pioniere des Humanismusauch eine regelrechte Manie bei der Suchenach jedwedem neuen Text, der denKulturhorizont erweitern konnte. EineHandschrift erlangte noch mehr Wert –als den rein materiellen –, wenn sie nochunveröffentlichtes Material enthielt. Die»Jagd« nach diesen Texten bestimmte dieGelehrten der Zeit, und damit verbundendie Veröffentlichung von editionesprincipes, emendatae und auctae. Verlassenhat Sambucus den antiken Kulturkreis1555 mit Neilos Kabasilas, 1566 mit Aristainetos,1569 mit Nonnos von Panopolis,1571 mit Theodoros Laskaris, 1572 mitPs.Hesychios, 1575 mit Ioannes Stobaiosund Georgios Gemistos Plethon undschließlich 1576 mit Zosimos, Prokopios,Agathias und Iordanes.Ergänzend – weil erst nach Abschlusserschienen – sei noch auf eine neue Arbeitzu dem wichtigen Korrespondenzpartner111biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenPiero Vettori hingewiesen: Davide Baldi,Il greco a Firenze e Pier Vettori (1499–1585).Alessandria: Edizioni dell’Orso 2014. InAnnexe 2 (S. 245), Handschriften in derÖsterreichischen Nationalbibliothek ausdem Besitz des Sambucus, die nicht in derfundamentalen Aufarbeitung von HansGerstinger 1926 bzw. dann in seiner Briefausgabe1968 Erwähnung fanden, wurdeaus dem Nachlass des ehemaligen Mitarbeitersder Handschriftensammlung,István Németh, eine bislang unveröffentlichteListe publiziert. Németh hat hierbeiallerdings zum Großteil die Arbeit des unverdientverschwiegenen Hermann Menhardt(Das älteste Handschriftenverzeichnisder Wiener Hofbibliothek von HugoBlotius 1576. Kritische Ausgabe der HandschriftSeries nova 4451 vom Jahre 1597mit vier Anhängen. Wien 1957) übernommen.Menhardt konnte dem von Gerstingererarbeiteten Bestand von Sambucus-Handschriften weitere 29 griechische und37 lateinische Codices zuweisen (S. 21–23).Einige der dort aufgezählten Handschriftenvermisst man in Némeths Liste. Diebeiden Handschriften des Supplementumgraecum sind keine neuen Werke, sondern1950 bzw. 1951 in der besagten Signaturengruppeneu aufgestellte, aus denTrägercodices (dort nur in Schutzfunktionder Codices Phil. gr. 154 bzw. 302 verwendet)herausgelöste Privaturkunden.Weitere griechische Handschriften überMenhardt hinaus wurden den Katalogenvon Herbert Hunger und Otto Krestenentnommen, wobei auch ungesicherteZuweisungen nun als Sambuciana erscheinen:Hist. gr. 61, 63, 72; Phil. gr. 53 istzwar mit Phil. gr. 54 (aus dem Besitz desSambucus) zusammengebunden, kannaber nicht aus seinem Besitz stammen,da der Codex um 1600 geschrieben ist;Phil. gr. 240, 258, 309, 336; Theol. gr. 13,51; Theol. gr. 53 ist bei Gerstinger (1928,351) bereits angeführt; 105, 131.Die Arbeit von Almási und Kiss ist einelängst fällige und höchst gewissenhafteund akribische Aufarbeitung dieser Editionen.Für die Forschung des Humanismusim Donauraum (insbesondere auch mitder Einleitung [S. V–LXXII], die sehr gutin das Netzwerk von Sambucus einführt)ist das Buch ein wahrer Gewinn. Die solideund umfangreiche Forschungsarbeit,die in dieses Werk hineingesteckt wurde,macht es zu einem monumentum aere perenniusund Vorbild für weitere Arbeiten zumHumanismus im Donauraum.Christian GastgeberAleida Assmann:Im Dickicht der Zeichen.Berlin: Suhrkamp <strong>2015</strong>,359 SeitenISBN 978-3-518-29679-0»Wir können ein Buch beenden und es zuschlagen,aber es gibt keinen roten Faden, der aus demDickicht der Zeichen herausführt.« Zu diesemSchluss gelangt Aleida Assmann im letztenKapitel ihres neuen Buches, dessen Überschriftzugleich als Titel des ganzen Buchesfungiert. In der Auseinandersetzungmit den literaturwissenschaftlichen Deutungsverfahrender Hodegetik, Hermeneutikund Dekonstruktion wird dargestellt,was trotz der methodischen Unterschiedefür alle gleichermaßen gilt: Ein Entkommenaus der Sphäre der Zeichen ist demMenschen nicht möglich. Sich in diesemDickicht zu orientieren und zurechtzufinden,ist daher umso wichtiger.In vierzehn Kapiteln setzt sich die Autorinmit dieser grundlegenden Gegebenheitdes menschlichen Daseins auseinander.Das Buch will sich aus diesem Grundauch als Beitrag zur kulturwissenschaftlichenGrundlagenforschung verstandenwissen. Es spannt dabei einen weiten Bogenund rückt das Thema Zeichen und Zeichendeutungaus verschiedenen Perspektivenin den Fokus. Dieser facettenreichePerspektivenwechsel ist zwar vor allemder Tatsache geschuldet, dass es sich – mitAusnahme eines neu verfassten Beitrags– bei den einzelnen Kapiteln um eine Zusammenführungvon bereits publiziertenTexten handelt. Das Buch dokumentiert112biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenund bündelt damit aber bisher verstreuteBeiträge zu Zeichentheorie und -praxiseiner der einflussreichsten Kulturwissenschaftlerinnender Gegenwart aus demZeitraum von 1988-<strong>2015</strong>. Die Texte wurdenfür die Neupublikation grundlegend überarbeitetund in fünf Themenkomplexegeordnet, um die jeweiligen Perspektivenwechselzu kennzeichnen.Trotz des Fehlens eines roten Fadens imDickicht der Zeichen und der generellenAusweglosigkeit des Menschen aus dieserSituation, benennt Assmann für ihr eigenesWerk die Frage »nach den Zeichen alskultureller Grundlage unserer Weltkonstruktion«als solchen. An diesem werden die ThemenkomplexeZeichenstruktur und Zeichentypen,Alte und neue Hieroglyphen, Schriftbildlichkeit,Wilde Leser und Metamorphosen des Lesensaufgereiht und miteinander verbunden.Es wird so die grundsätzliche Frage insZentrum gestellt, »wie Zeichenstrukturen,kulturelle Semantik und Welterfahrung ineinandergreifen.[…] Da Menschen nicht unmittelbarin der Welt, sondern immer schon in einer durchselbstgemachte Zeichen organisierten kulturellenUmwelt leben, ist es für ein Verständnis historischerEpochen entscheidend, etwas über dieinnerhalb dieser Epochen geltenden Zeichenlogikenzu wissen[…]. Diese semiotische Metaebenein den Texten und Diskursen freizulegen und dabeidie stets kontroversen, umkämpften und zumTeil auch Institutionen sprengenden Ordnungender Zeichen sichtbar zu machen, ist das Anliegendes Buches.«Das Buch widmet sich semiotischenGrundfragen und analysiert verschiedeneManifestationen der wechselhaften Codierungder Welt durch Signifikanten undSignifikaten. Assmann nimmt eine Strukturierungzur Identifikation und Unterscheidungvon Zeichentypen vor, um denLeser für seine Fähigkeit als homo interpreszu sensibilisieren, Deutungspotentialeaufzuzeigen und für die Beantwortung ihrerLeitfrage fruchtbar zu machen. So wirdein Bewusstsein für Zeichen unterschiedlichsterArt entwickelt. Es geht dabei gewissermaßenum eine Wiederbesinnungauf Zeichentypen, die mit dem Siegeszugder modernen Naturwissenschaft und derdamit einhergehenden Entzauberung derWelt semiotisch neutralisiert bzw. scheinbarobsolet wurden. Anzeichen, physiognomischeZeichen, Vorzeichen, Offenbarungen,Embleme und Hieroglyphen sindBeispiele dafür. Der Blick wird auf Zeichenjenseits der sprachlichen Kommunikationgerichtet, die so eine umfassendere Lesbarkeitder Welt erschließen. Es gilt dabei,die jeweilig wirkmächtige Zeichenkraftzu erkennen und produktiv werden zulassen. Auch um zu verstehen, was überhauptetwas zu einem Zeichen macht, undworauf diese Zeichenhaftigkeit gründet.Dies wird an zahlreichen Beispielen veranschaulicht,die sowohl den Blick für dieFunktionsweise von Zeichen und Zeichencodesschärfen, als auch den Wandel aufzeigen,dem die Zeichengebung und derenDeutung unterliegen. So kann der Lesernachvollziehen, wie sich die seit der Antikevorherrschende, und vor allem durchden Platonismus beförderte, Wertschätzungder tieferen Bedeutung und der damiteinhergehenden Geringschätzung deräußeren Zeichen verändert. Diese wandeltsich im Laufe der Zeit – exemplarisch anGoethes Farbenlehre dargestellt – zu einemBekenntnis der Oberfläche, also zu einemBekenntnis zum Zeichen selbst, bis in derGegenwart mit der derridaschen Philosophieder Dekonstruktion schließlich einegrundlegende Abkehr vom Idealismusvollzogen wird. »Mit der Priorität des Innenvon Platon bis Hegel wird Schluss gemacht; dasAußen wird endlich in seine Rechte eingesetzt.«Vor diesem theoretischen Hintergrundentfaltet das Buch ein vielschichtiges Panoramazum Thema Zeichen, deren Entzifferungund Deutung. Dabei werden dieGeschichte der altägyptischen Hieroglyphen,deren Rezeption in der Renaissanceund im modernen Film ebenso zum Gegenstand,wie zeichenzentrierte Lektürenvon Hofmannsthal über Jelinek zu SafranFoer. Dieses Kaleidoskop der Vielseitigkeit,die Adam als ersten Leser der Weltmit Sergej Eisenstein und der modernenWerbeindustrie in einen größeren Zusammenhangstellt, illustriert nachdrücklichdas bestehende Dickicht der Zeichen.Aleida Assmans neues Buch vermag diesesDickicht zwar nicht aufzulösen, aber113biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungensie zeigt in klarer Sprache und gut verständlicherWeise auf, wie dieses durchOrdnung durchsichtiger gemacht werdenkann. Das Buch zeichnet sich dabei besondersdurch seinen interdisziplinärenAnsatz aus, der zahlreiche Anschlussmöglichkeitenbietet, weiter zu denken unddie Ordnung der Zeichen auf den Ebenender Sprache und der Semiotik, der Medialitätund der Gattung sowie der Geschichte, desDiskurses und der Thematik voranzutreiben.Eine Lektüre des Buches ist daherJedermann als Leitfaden zu empfehlen,der sich einen Weg durch dieses Dickichtbahnen möchte.Franz HalasSusanneBlumesberger:Handbuch der österreichischenKinder- und Jugendbuchautorinnen.Band 1:A-K, Band 2: L-Z. Wien,Köln, Weimar: Böhlau2014, 1395 SeitenISBN 978-3-205-78552-1Das vorliegende Handbuch ging auseinem am Wiener Institut für Wissenschaftund Kunst durchgeführten undvom Jubiläumsfonds der ÖsterreichischenNationalbank geförderten Modul-Projekthervor, u.z. als Teilbereich des Projekts»biografiA. datenbank und lexikon österreichischerfrauen« (http://www.biografia.at). Ziel war es, alle österreichischenAutorinnen zu erfassen, die Literatur fürKinder und/oder Jugendliche veröffentlichthaben. Um einen möglichst breitenÜberblick über das Schaffen von Frauenin der Kinderliteratur bieten zu können,wurde weder Qualität und Quantitätihrer jeweiligen Publikationen nochauch ein eingrenzender Zeitrahmen alsAuswahlkriterium verwendet.Umfangreiche Recherchen und Kontaktemit ExpertInnen, Autorinnen undderen Angehörigen sowie NachlassverwalterInnenermöglichten die Erstellungvon Lebensläufen auch zu noch wenigbekannten Schriftstellerinnen. In weite-rer Folge wurden Tagungen und kleinereProjekte zum Thema im In- und Auslanddurchgeführt, wie die Autorin im Geleitwortausführt. Im einleitenden Abschnittwerden der Aufbau, die Einträge sowieHandhabung des vorliegenden Nachschlagewerkserklärt.Das zweibändige Werk enthält an die800 biografische Einträge von österreichischenAutorinnen. Grundlage bildete,wie erwähnt, die Datenbank biografiA,die in ihrem Kategorienschema besondereRücksicht auf weibliche Lebensläufenimmt und diese daher auch sehr gutabbilden kann. Die Biographien sind vonunterschiedlichem Umfang, einerseits bedingtdurch verfügbare Quellen, andererseitsgaben lebende Autorinnen und/oderVerwandte manchmal nur wenig vonsich preis. Besonders schwierig gestaltetesich die Dokumentation von Frauen,die in der Zeit des Nationalsozialismusemigrieren mussten, durch Sprachproblemenicht mehr schriftstellerisch tätigsein konnten, deren Spuren sich nachDeportation oder im Exil verloren, oderbei Autorinnen, die diese Epoche nichtüberlebt haben.Ein interessanter Aspekt sollte bei derBenützung dieses Handbuchs immermitgedacht werden: »Kinderbuchautorin«ist offenbar ein gering geschätzterBeruf: »Die Aussage ›Ich bin eigentlich keineKinderbuchautorin, sondern …‹ bekommtman recht häufig zu hören, ebenso die Bitte,die jeweilige Person nicht als ›Kinderbuchautorin‹zu präsentieren« (14) Auch heutenoch wird »Kinderliteratur« als Vorstufezu »richtiger« Literatur angesehen. DieserUmstand zeigt sich auch in den Berufender Autorinnen, die oft Journalistinnen,Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnensind und erst aus ihrer Beschäftigungmit diesen Themen zum Schreiben vonKinderbüchern kamen. Die Schreibmotivesind vielschichtig: Einige wollten undwollen gesellschaftspolitisch, pädagogisch»etwas verändern«, andere kamennach einer Lebenskrise zum Schreiben,wie zum Beispiel viele jüdische Autorinnen.Zahlreiche Autorinnen konnten ihreManuskripte nicht drucken lassen, da114biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenkein Verlag sie übernahm. Heute scheintes, als wären die Autorinnen grundsätzlichjünger als ihre Vorgängerinnen derfrüheren Generationen. Einige der lebenden,jungen Autorinnen publizieren nurnoch auf elektronischem Weg.Bei den Einträgen im Lexikon wurdendie eigenständigen kinder- und jugendliterarischenWerke so lückenlos wie möglichaufgenommen. Andere Werke findensich nur in Auswahl. Eine ausführlicheWerkrezeption war in diesem Handbuchnicht möglich, bleibt aber ein Desideratder Forschung.Das vorliegende Handbuch ist ein bemerkenswertesProjekt, wie Ernst Seibertin seinem Beitrag zum »Weiblichen Blick«verdeutlicht. Waren es doch historischfast ausschließlich Männer, die Märchen,Sagen, Volkskunde und somit auch dieKinderliteratur dominierten. DiesesHandbuch aber beweist sehr deutlichund sicher für Viele überraschend, dassweibliche Autorinnen von Beginn an ineiner nicht geahnten Quantität Anteil ander Entstehung der Literatur für Kinderund Jugendliche hatten. Noch deutlicherzeigt sich dieses Bild in der Gegenwartsliteratur,Seibert stellt fest: »Wer steht dengegenwärtigen Autorinnen wie Friedl Hofbauer,Christine Nöstlinger, Käthe Recheis oderRenate Welsh an männlicher Autorenschaftgegenüber?« (17f.) – Auch der ÖsterreichischeWürdigungspreis für Kinder- undJugendliteratur erging und ergeht fastausschließlich an Frauen.Die Frage des literarischen Ranges derverschiedenen Werke ist eine heikle. Dasvorliegende Handbuch bietet objektivierbareFakten wie Literaturpreise, Neu- undWiederauflagen, Rezeption in reicherFülle. Auch die Frage einer kinder- undjugendliterarischen Poetik kann in dieserVielzahl an biographischen Daten weiblicherAutorenschaft vielfach recherchiertwerden.Ilse Korotin betont, dass dieses zweibändigeNachschlagewerk neuerlich denBlick darauf richte, dass der Anteil unddie Leistungen von Frauen am geistesundkulturwissenschaftlichem SchaffenÖsterreichs bis dato verschwiegen,absichtlich heruntergespielt oder zumindestverkannt wurden. Die Konzentrationauf die Biographien der Frauen eröffnetein riesiges Spektrum an sozialen, ökonomischen,politischen und kulturellenGefügen und auch Machtstrukturen. DasLexikon versteht sich nicht als Einzelbaustein,sondern als eine Öffnungdes Blickes, zu einer Anerkennung desGenres Kinder- und Jugendliteratur inder geistes- und kulturwissenschaftlichenForschung.Das Handbuch ist sehr übersichtlichgeordnet, bietet bei jedem Eintrag alleerforschten Namensformen und Berufsbezeichnungen,Lebensdaten, Familienangabenund Kinderbetreuungspflichten,Ausbildungen und Karriereverläufe. Oftfindet sich auch ein photographischesPorträt der Autorin. Weiters wurdenAuszeichnungen, Mitgliedschaften undKooperationen hinzugefügt, ebensoBeschreibungen über weitere spezielleWirkungsbereiche (zum Beispiel besondereKenntnisse oder Schwerpunktein ihren Arbeiten). Ergänzt werden dieEinträge durch Angabe von Nachlässen,Archiven, Quellen, weiteren biographischenMitteilungen und Hinweisen unddurch eine Auflistung der Werke. Die Listeder Sekundärliteratur führt die aussagekräftigstenWerke an. Die alphabetischeÜbersicht und ein Namensformenregistererleichtern die rasche Suche. Der zweiteBand schließt mit einem umfangreichenQuellen- und Literaturverzeichnissowie einem Personenregister und einerKurzbiographie zu Susanne Blumesberger(www.blumesberger.at).Das »Handbuch der österreichischenKinder- und Jugendbuchautorinnen« istauch open access verfügbar:Band 1:http://phaidra.univie.ac.at/o:368982Band 2:http://phaidra.univie.ac.at/o:368983Die Autorin Dr. Susanne Blumesbergerhat mit diesem Lexikon einen Meilensteinin der in Österreich erst sehrspät einsetzenden, wissenschaftlichenErforschung dieses Genres gesetzt. Auchhier kann man nur Seiberts Aussage dazu115biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenunterstreichen und: »…auf die enormeEinzelleistung in einer Zeit, in der auf solchemGebiet hochdotierte Großprojekte die Normalitätsind.« (19) verweisen. Das zweibändigeHandbuch der österreichischen Kinder- undJugendbuchautorinnen bietet ForscherInnenund Interessierten ein grundlegendes undsehr hilfreiches Rechercheinstrumentund gibt darüber hinaus vielfältige Anregungenfür die weitere Forschungen.Gabriele MautheLaurent Cesalli,Janette Friedrich(Hrsg.): Anton Marty &Karl Bühler. Between Mindand Language – ZwischenDenken und Sprache –Entre pensée et langageBasel: Schwabe 2014,336 SeitenISBN 978-3-7965-3214-6Die Persönlichkeiten Anton Marty undKarl Bühler haben in den letzten Jahren zueiner kritischen Revision ihrer Arbeitenund ihrer Rezeption in der Philosophiebzw.Sprachforschungsgeschichte geführt.Zuletzt etwa vom 14. bis 16. Mai 2014 inPrag zu dem Thema »Mind and Language.Franz Brentano’s Legacy in Prague. AntonMarty’s Death 100 th Anniversary« – wohl verständlich,wenn man sich die bedeutendeRolle der Prager Karls-Universtät in dieserForschung vor Augen hält – oder in Einsiedeln(Schweiz) vom 11. bis 13. Dezember2014 zum Thema »Meaning and Intentionalityin Anton Marty: Debates and Influences«. Auseiner solchen Konferenz entstand auchder vorliegende Sammelband. Die Konferenzfand in Genf (dem Wirkungsort desHerausgeberduos) vom 10. bis 11. September2010 statt und hatte den Titel: »AntonMarty et Karl Bühler, philosophes du langage.Origines, relations et postérité de leur pensée.«Im Mittelpunkt stehen die prägendenArbeiten des Brentano-Schülers AntonMarty (1847 – 1914) und des Medizinersund Psychologen Karl Bühler (1879 – 1963).Zu Martys wesentlichen Werken im Bereichder Sprachphilosophie zählen: Ueberden Ursprung der Sprache (Würzburg 1875),Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinenGrammatik und Sprachphilosophie (Hallean der Saale 1908), Zur Sprachphilosophie. Die»logische«, »lokalistische« und andere Kasustheorien( Halle an der Saale 1910); weitere Arbeitenstammen aus seinem Nachlass, darunteretwa Psyche und Sprachstruktur (1950).Bühler nimmt auch für die Wiener Wissenschaftsgeschichteeine herausragendeRolle ein: 1922 wurde er zum Professorfür Psychologie an die Wiener Universitätberufen und auch Leiter des neu gegründetenPsychologischen Instituts. 1938 vonden Nationalsozialisten inhaftiert emigrierteer 1940 in die USA; wo er jedochnicht mehr an seine großen Erfolge vorder Emigration anzuschließen vermochte.Umso mehr war eine – hier mit Bezugauf Marty ausgerichtete – Auseinandersetzungder Rezeptionsgeschichte seinerWerke angebracht. Seine wichtigen Arbeitenauf diesem Gebiet sind etwa Axiomatikder Sprachwissenschaften (Frankfurt 1933)oder Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktionder Sprache (Jena 1934). Mit seinem Organon-Modellund seinen Axiomen über diemenschliche Sprache ist eine Auseinandersetzungmit Bühler in der Linguistikund Diskursforschung unumgänglich. Diebeiden Wissenschafter hier in einer Zusammenschauzu präsentieren, hat seineBerechtigung in einer direkten AuseinandersetzungBühlers mit Martys Werk: 1909rezensierte er Martys Untersuchungen zurGrundlegung der allgemeinen Grammatik undSprachphilosophie und legte das Fundamentseiner späteren Sprachtheorie.Beide treffen sich in der großen Bedeutungder Psychologie in der Sprachwissenschaftund sind damit zugleich Wegbereitermoderner soziolinguistischer undtextpragmatischer Forschung. Im wissenschaftlichenAnsatz unter den beiden undauch in deren Nachfolge zeigt sich freilichimmer das Grundsatzproblem, wie manaus der Empirie – woraus die Erkenntnisseüber Sprache schöpfen – zur umfassendenTheorie gelangen kann. Abstrahierte Empirieist eben noch nicht universelle Theorie.Hinzu kommt ein die Empirie nochzusätzlich »belastendes« Element, dass die116biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenErkenntnis aus einer Sprache – im Falle derbeiden eben aus der deutschen Sprache –noch lange keine allgemeine Aussage zurSprach allgemein und der Sprachpsychologieerlaubt. Dies wird sehr deutlich beider Kategorisierung von Sprechakten unddem Versuch einer Zuweisung von Intentionalität.Schon dies muss in seinen multikomplexenpsychologischen Nuancen aufverschiedenen Intentionalitätsebenen dieSprachforschung zur Vorsicht gemahnen.Mit dem Sammelband erhält man einensehr guten Einblick in verschiedeneAspekte der Arbeiten der beiden Forscherund des aktuellen Rezeptionsstandes –bzw. der durch ihre Arbeit weiter in Bewegunggesetzten Forschung auf dem Gebiet.So behandeln SpezialistInnen zur Philosophie-und Psychologiegeschichte das Themain vier Hauptthemen: (1) Phänomenologische,pragmatische und semiotischeAnnäherung an die Sprache (Beiträge vonClaudio Majolino zur Semiotik; FrankLiedtke zu Martys Sprachphilosophie vonAusdrücken und Bedeuten und Bühlersdiesbezügliche Kritik; Laurent Cesalli zurlinguistischen Funktion, erweitert umdie Forschungen von Ludwig Landgrebe[1902–1991]), (2) Beiträge zur deskriptivenPsychologie (Guillaume Fréchette zur deskriptivenPsychologie von Brentano undMarty bis zu Bühler; Denis Fisette zumEinfluss von Carl Stumpf auf Karl Bühler;Janette Friedrich zu Bühler Denkpsychologie),(3) Semantische und ontologischeFragen (Robin D. Rollinger zur kritischenAuseinandersetzung von Marty mit Brentanos»logischen Namen« und »linguistischerFiktion«; Arkadiusz Chrudzimski zuMartys Theorien der Wahrheitsrelevanz),(4) Empirische Dimensionen der Sprache(Didier Samain zu Philipp Wegeners, AlanGardiners und Bühlers pragmatischemSprachkonzept; Jacques Moeschler zur Relevanzvon Bühlers Theorie der Sprache ausgegenwärtiger Sprach-/Textpragmatikforschung;Clemens Knobloch zur Bedeutungvon Bühler und Marty für die Neo-Evolutionisten).In Summe eine sehr gute Einführung,eine verdiente Aufarbeitung und guteMöglichkeit, sich einmal mehr mit demPhänomen Sprache als sozialpsychologischesMedium in allen seinen Facetteneinzulesen und daran auch eigene Gedankenund Ansätze anzuschließen. Rückblickendzeigt sich bei beiden Forscherndurch den vorliegenden Band aber auch,wie jede Forschung ein Kind ihrer Zeitist. Die Erkenntnis ist daher immer nurrelational und nicht vollkommen; miteiner neuen kritischen Ansatzweise oderHinterfragung, der Einbeziehung einerweiteren Betrachtungskomponente magsich die Erkenntnis wieder relativieren.Auch diesen Aspekt kann man in dem vorliegendenBand mitlesen, bzw. vice versaauch, was von ingeniöser Forschung ausdem kritischen Ansatz einer bestimmtenZeitsituation bleibt und weiterwirkt.Christian GastgeberPaolo Cesaretti, SilviaRonchey(Hrsg.):Eustathii Thessalonicensisexegesis in canonemiambicum pentecostalemRecensuerunt indicibusqueinstruxerunt.Berlin: De Gruyter2014, 878 SeitenISBN: 978-3-11-022730-7Mit dem vorliegenden Band liegt einweiterer grundlegender Text zur Exegesearbeiteines klassisch-patristisch geschultenAutors einerseits und zum Verständnisdes byzantinischen Schulwesensandererseits vor. Berechtigterweise mussman eigentlich von zwei Büchern sprechen,denn der eigentlichen Edition vonrund 260 Seiten – gefolgt von umfangreichen,das Werk in jeder Einzelheit ausschöpfendenIndices (S. 265–486) –, demzentralen Teil, sind Prolegomena von 313Seiten, gefolgt von einer ausführlichenBibliographie (S. 324–385), vorangestellt(mit eigener Stern-Zählung; in Summeumfasst das Werk mit den Abbildungen878 Seiten. Zwei erwiesene Fachleute habensich dieser Edition angenommen: PaoloCesaretti, von dem die thematische Einleitung,die Edition von Ode IV–IX sowie117biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungendie Indices stammen, und Silvia Ronchey,die für die geschichtlich-handschriftlicheEinleitung und die Edition des Prooimionsowie der Oden I und III verantwortlichzeichnet. Das opus maximum dieser Editionsarbeitgeht immerhin auf eine 34jährigeBeschäftigung mit dem Werk nacheiner unbefriedigenden Voredition vonAngelo Mai zurück.Zum Inhalt hat die Edition den Kommentardes durch seine Erklärungen zuHomer über die Byzantinistik hinaus bekanntenProfessors und späteren Metropolitenvon Thessaloniki, Eustathios (vor1015–1198/9), zu den so genannten jambischenPfingstkanon (dieses Werk ist ca. indie Mitte des letzten Dezenniums des 12.Jahrhunderts zu datieren).Die Herausgeber profitierten von einerin der Zwischenzeit sehr gründlichen Auseinandersetzungmit dem Werk des Eustathiosvon Thessaloniki und seines ganzpersönlichen schriftlichen Umganges, da –nicht zu diesem Kommentar, jedoch zu denHomerkommentaren – Autographen vorliegen.Weiters machten auch die hymnologischeForschung Fortschritte sowie dieAuseinandersetzung mit der spielerischenDarstellungsform eines Carmen figuratum(S. 148*–158*); schließlich haben akribischepaläographische Forschungen jüngster Zeitbei der Lokalisierung und Datierung bzw.Kopistenzuweisung der Überlieferungsträgerentscheidend geholfen. Wie so oft inder Editionstätigkeit, konnten die Editorenin diesem Fall jedoch nicht auf ein Autographoder zumindest eine zeitgenössischeKopie zurückgreifen, sondern auf spätereAbschriften: Cod. Vaticanus gr. 1409 ausdem 13./14. Jh.; Codex Alexandrinus Patriarchalis62 (107) aus dem Ende des 13. Jh.;Codex Basileensis A.VII.1 (gr. 34) aus dem 15.Jh. (Exzerpte auf einem Palimpsest; ob derNucleus dieser Handschrift auf arabischemPapier wirklich aus dem 12. Jh. stammt,bleibt noch zu hinterfragen), Codex VallicellianusF 44 (gr. 94) aus dem 15. Jh.; CodexVindobonensis Theologicus graecus208 aus der Mitte des 16. Jahrhunderts; undder (seit 1671 im Brand vernichtete) Codexdeperditus Scorialensis Λ.II.11. Diese zumArchetypus verschobene Überlieferung hatauch editorische Konsequenzen erfordert;denn einerseits ist durch das Studium anden Autographen der Umgang des Gelehrtenetwa bei Enklitika oder der Akzentsetzungbei zusammengesprochenen Worteinheitenbekannt, andererseits weicht diespätere Überlieferung – byzantinischemSchreibusus entsprechend – davon wiederumab. Normalisierung aufgrund deseustathianischen Usus war die logische, akzeptableFolge. Vor ein stets auftretendesProblem hat die Interpunktion bei dieserHandschriftenbreite geführt. Hier wurdepragmatisch (mit gewisser Unterstützungdes Eustathios-Editors van der Valk) auf dasiudicium philologicum Rekurs genommen.Gerade weil der Interpunktion nicht nurals ars artis causa, sondern als Einblick indie byzantinische Lesepraxis in jüngsterZeit große Bedeutung geschenkt wurde (eszeigt sodann diachron das Leseverständnisbzw. die Gliederung in Kola in jedem einzelnenÜberlieferungsträger), wäre hierzueine ausführliche Thematisierung und Ausführungder Überlieferung in den Handschriftenwünschenswert, und das iudiciumphilologicum hängt leider nur zu oft von nationalenInterpunktionsgewohnheiten ab,wie die Stixis-Forschung der jüngsten Zeitimmer wieder zu beklagen hat.Ein minimaler Kritikpunkt mag sich andem starken Exkurs-Charakter im erstenTeil anknüpfen. Man erkennt geradezu dieFreude und Begeisterung der Herausgeberan der Materie und an der Vermittlungjeglicher Information, selbst wenn diesenicht unmittelbar mit dem Thema in Zusammenhangsteht. Passend zum Publikationsortder Rezension sei dies etwa ander Beschreibung des Codex Vindobonensisexemplifiziert. Im Zusammenhang mitAugerius Busbecks Handschriftenerwerbin Konstantinopel wird seine Aktivitätbis hin zur Einführung der Tulpenzwiebelausgeführt. Hier wäre, wenn man sosehr ins Detail geht, lokale und rezenteForschung an den Objekten miteinzubeziehenund zu zitieren, sonst bleibt zwarder erkennbare Enthusiasmus nach Vermittlungaller nur greifbaren Information,aber eben nur der greifbaren und nichtder gesamten (und rezentesten).118biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenFür ihre detaillierte Arbeit kann den Herausgebernnicht genug gedankt werden;sie ersetzt nicht nur in ihrer kritischenEdition die Vorgängerausgabe, sondernführt in die Thematik und Hintergründemit einer solchen Genauigkeit ein, dassman – wie eingangs schon betont – mitdiesem Werk 2 in 1 vor sich liegen hat.Eine Monographie zum Werk und zum literarischenTypus sowie zum Hintergrundder Verbreitung des Werkes und die Editionselbst, die in philologischer Perfektiondurch Indices erschlossen wird. DieReihe Supplementa Byzantina des VerlagesDe Gruyter hat damit die scientific communityum ein weiteres Basiswerk ihrerForschung bereichert; einzig der Preis vonfast 180 Euro trübt ein wenig die Freudeüber diese so arbeitsintensive Edition. Sobleibt es zwar nichtsdestotrotz ein Basiswerk,das aber leider nur wenigen Bibliothekenvorbehalten sein wird und dieBreite der Byzantinisten und Theologennicht erreichen kann.Christian GastgeberBernhard Hachleitner,Isabella Lechner(Hrsg.): Traumfabrikauf dem Eis. Von derWiener Eisrevue zuHoliday on Ice.Wien: Metroverlag,2014, 175 SeitenISBN 978-3-99300-194-0Die Eisrevue begeisterte 30 Jahre (1940-1970) lang Millionen von Menschen undbrachte auf Tourneen durch Europa, Nordamerika,Afrika und Israel Wien in dieWelt. Seit der Eröffnung im Jahr 1958 bisheute ist die Wiener Stadthalle Schauplatzder Eisrevue bzw. der Show Holiday on Ice.1991 übernahm die Wienbibliothek vomEhepaar Petter eine große Sammlung anDokumenten und Archivalien zur WienerEisrevue. Willi Petter leitete von 1945 bis1970 als Regisseur die Produktionen, EdithPetter zeichnete für die Choreographieverantwortlich. Die beiden sammeltenPlakate, Programmhefte, Fotografien, Zei-tungsausschnitte, Korrespondenzen undVieles mehr.2013 wurde dieser Bestand von 47 Archivboxenvon Bernhard Hachleitner aufgearbeitet,und man entschloss sich, dieGeschichte dieser Wiener Institution in einerAusstellung der Öffentlichkeit zugänglichzu machen. Kuratiert gemeinsam mitIsabella Lechner war die Ausstellung vom1. Oktober 2014 bis 25. Jänner <strong>2015</strong> in derWiener Stadthalle zu sehen.Der dazu erschienene reich bebilderteKatalog schildert in sechs Kapiteln dieGeschichte der Eisrevue und ihrer Stars,das Unternehmen und die Inszenierungen.Das gut zu lesende Buch, das wissenschaftlichfundiert und journalistisch fürein breiteres Publikum aufbereitet ist, gewährtgleichzeitig Einblick in die WienerNachkriegszeit, in den Wiederaufbau unddie Kulturgeschichte dieser Epoche.Bernhard Hachleitner leitet den Katalogmit dem Beitrag »Vom Zweiten Weltkrieg indas Fernsehzeitalter« ein. Am 23. Dezember1958 ging in der neuen Wiener Stadthalledie erste Vorstellung der Eisrevue über dieBühne und war ein Riesenerfolg. Die Symbiosevon Populärkultur und staatstragenderInszenierung war in der Nachkriegszeitvon besonderer Bedeutung. Gastspieleim Ausland hatten staatspolitische Funktion,Wien stellte sich damit als gemütlicheund harmlose Musikstadt dar. Diese Präsentation›funktionierte‹ auch in Ländern,wo Auftritte von ÖsterreicherInnen aufGrund ihrer nationalsozialistischen Vergangenheitunerwünscht waren. Vorstellungenwaren auch auf beiden Seiten desKalten Krieges möglich.Wien verfügte über die choreographischen,sportlichen, künstlerischen undhandwerklichen Ressourcen, um eine perfekteEis-Show auf die Bühne zu stellen.Gleich drei Europameisterinnen standen1958 auf dem Eis. Eine Besonderheit derWiener Eisrevue war zudem, dass diesenicht rein auf Gewinn ausgerichtet war,denn sie wurde von der Wiener Eissportgemeinschaftbetrieben, die mit den Einnahmenden Nachwuchs des Eissports unterstützte.Auch in den Sechziger Jahrenmit veränderter Wirtschaftslage und einer119biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenanderen Jugendkultur, blieb die Eisrevueein Anziehungspunkt, war sie doch nurfür wenige Wochen in der Stadt zu sehen.Anfang der Siebziger Jahre war Wien zwarimmer noch ein Zentrum der Hochkultur,aber kein großer Magnet mehr für Unterhaltungskultur.Der Verkauf der WienerEisrevue war unvermeidlich und wurdevon Vielen nicht nur als wirtschaftlicherVerlust angesehen (Umsatz 60 MillionenSchilling pro Saison), sondern als Untergangeiner Wiener Institution – was esauch tatsächlich war.Historisch basiert die Wiener Eisrevueauf den Schauläufen in der Zwischenkriegszeit,die sehr populär waren, ihrabsoluter Superstar war OlympiasiegerKarl Schäfer. Zurück aus den USA gründeteSchäfer seine eigene »Schäfer-Revue«,die nicht nur in Wien, sondern bis in dieSchweiz und Ungarn tourte. Schon unmittelbarnach Kriegsende im Mai 1945wurden erste Verträge für eine WienerEisrevue unterzeichnet. Karl Schäferselbst allerdings musste seine Eisrevueauf Grund seiner NSDAP- und SA-Mitgliedschaftdem Eissportklub Engelmannübergeben. Alle Mitglieder der Eisrevuemussten eidesstattlich erklären, keinerNS-Organisation angehört zu haben. FürAuslandsreisen waren Leumundszeugnissenotwendig.Am 25. Dezember 1945 fand in Klagenfurtdie erste Wiener Eisrevue statt. DerRegisseur Will (Wilhelm Karl) Petter stelltejede Show unter ein Leitmotiv. Die Tourneenführten schon bald durch ganz Europa,das Publikum genoss sichtlich für einpaar Stunden die Flucht aus dem Alltag:»Aus der harten Wirklichkeit in das Zauberlandder Eisprinzessinnen«. Die Wiener Eisrevueentwickelte sich zu einem profitablen Exportartikel.Das erste Kapitel des Ausstellungskatalogsschildert die frühen Jahre der WienerEisrevue: Wien war in der Zwischenkriegszeitzur Metropole des Eislaufensavanciert. Der Wiener Eislaufverein undder Eissportklub Engelmann boten exzeptionelleMöglichkeiten, diesen Sport auszuüben.Auch das Revueelement konnteim Schaulaufen perfekt umgesetzt wer-den. Hinzu kam, dass Wien eine hohehandwerkliche und kunsthandwerklicheKompetenz vorweisen konnte, die die Ausstattungder Revuen zauberhaft umsetzte.Die Eisrevue war angesiedelt zwischenSport und Spektakel: Der Olympiasiegerund mehrfache Welt- und EuropameisterSchäfer wechselte vom Amateursportlerzum bezahlten Eislaufprofi. Seine außergewöhnlichen,eislauftechnischen undkörperlichen Fertigkeiten eines Weltklasseathletenwaren richtungsweisend füralle kommenden Revuen. Alle AkteurInnenwaren höchst professionell und konntendaher auch in der Unterhaltungsindustriesehr erfolgreich reüssieren.Kapitel zwei widmet sich den Besonderheitender Wiener Eisrevue: Nebendem Bild des imaginären »Alt-Wien«, dasin die Welt getragen wurde, kam der Musikeine bedeutende Rolle zu. Robert Stolzwar eifriger Kompositeur von unzähligenLiedern für die Eisrevue und mit ihm begannauch die Ära der Live-Musik: Es spieltestatt eines Plattenspielers ein richtigesOrchester live! Ein weiteres besonderesKennzeichen war die Bilder, die einen ›rotenFaden‹ durch die Schau zogen, somiteine Handlung erzeugten und schließlicheine komplette »Eisoperette« erschufen.Auch wenn diese Intention in den späterenJahren wieder verworfen wurde, bliebdas Leitthema für jede Revue. Die Beteiligungvon Robert Stolz und seiner Musikbedeuteten nicht nur eine Weiterentwicklung,sondern auch einen ungeheurenWerbewert für das Unternehmen. Einenbesonderen Aspekt beleuchtet RomanSeeliger, der sich der Umsetzung von Notenin den Eiskunstlauf widmet und zeigt,welche Kenntnisse für einen stimmigen»Bogen« der LäuferInnen notwendig sind.Die Eisrevue wurde inoffizieller Botschafter,weil man kulturell-kommerzielleZiele verfolgte und keine politischen.Das deckte sich in den ersten zehn Jahrennach dem Zweiten Weltkrieg mit denaußenpolitischen Interessen Österreichsund Wiens. Man setzte auf die Gemütlichkeitvon Alt-Wien, das so nie existierte.Das Dritte Kapitel ist zur Gänze dem»Apparat« Wiener Eisrevue gewidmet und120biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenerlaubt einen Blick hinter die Bühne, inden Alltag und die wirtschaftlichen, technischenund personellen Herausforderungeneines derartigen Unternehmens.Die Organisation konnte professionellernicht sein: So gab es eine eigene Betriebsordnung,eine strenge Auslese der LäuferInnenund SportlerInnen, aufwendigeKostüme, intensive Pressearbeit inklusivepersönlicher Betreuung der JournalistInnen(sie wurden, wenn nötig, aucheingeflogen!), professionelle Plakate undWerbung. Die Medien wurden das gesamteJahr über mit Geschichten versorgt,sodass ständig Kontakt mit dem Publikumgehalten werden konnte. Auch dasOrganisieren der Hallen war ein ständigerKampf, so zum Beispiel mit dem Parallelunternehmen»Holiday on Ice«.Die Einnahmen kamen dem WienerEislauf-Verein zugute, der Talente wie IngridWendl und Emmerich Danzer förderte,die schon bald zu Publikumsmagnetenwurden. Professionelle EiskunstläuferInnenund SportlerInnen mit einer gutenBallettausbildung wurden bevorzugt. DieBetriebsordnung, deren 26 Punkte imBuch abgebildet sind, hatte es in sich: Sowurden etwa neben Ausgangszeiten auchdas Gewicht der Läuferinnen strengstenskontrolliert.Julia König widmet sich den detailreichkonzipierten Plakaten. Über 300 Plakatein der WienBibliothek einen Szenenbildermit TänzerInnen in Formation und hebeneinzelne TänzerInnen hervor. Die drei bedeutendstenGraphiker werden vorgestellt.Roman Seeliger fasst in seinem Berichtdie wirtschaftspolitische Mission der Eisrevuezusammen: Die Entscheidung die»Karl-Schäfer-Eisrevue« nach dem Krieg sofortin »Wiener Eisrevue« umzubenennenwar »goldrichtig«, wie Seeliger meint. Dazukam die Kombination aus internationalrenommierten Wiener Kunstlaufgrößen,mit dem Musiker Robert Stolz und einerprofessionellen Choreographie von Willund Edith Petter. Diese »Marke« durchbrachnach 1945 Österreichs Isolation auf internationalemParkett. Wirtschaftlich standdas Unternehmen nicht nur glänzend da,es bedurfte auch keiner Subventionen.Agnes Meisinger zeigt die Verbindungdes Wiener Eislaufvereins (WEV) mit derWiener Eisrevue auf. Die Wiener Eissportgemeinschaft(WEG) – ein Zusammenschlussdes Wiener Eislaufvereins und desEissport-Klubs Engelmann – waren die Basisfür den Erfolg der Eisrevue. Der WEVist nicht nur einer der weltweit ältestenund größten Sportvereine, sondern aucheiner der erfolgreichsten. Die erfolgreichenTourneen der Eisrevue ließen dasGeld in die Kassen des WEV strömen. Erst1971 kam dieser Geldfluss zum Erliegen, inder Folge wurde die Wiener Eisrevue andas Konkurrenzunternehmen »Holiday onIce« verkauft.Isabella Lechner erzählt in ihrem Beitrag»Glanz, Rüschen und Geflitter« von denphantastischen Kostümen der Revuen, dievon Gerda Gottstein mit Künstlernamen»Gerdago«, entworfen wurden. Die Schneiderwerkstattvon Ella und Leo Bei war einHerzstück der Ausstattung. Leo Bei wurdeüberdies in den folgenden Jahren zueinem Stück österreichischer Film- undTheatergeschichte. Auch der ungeheureAufwand der Bühnenbilder und der Bühnentechnikwird mit eindrucksvollen Zahlenverdeutlicht.Das Kapitel vier ist den Spielfilmen mitder Wiener Eisrevue gewidmet, überwiegendin der Inszenierung von Franz Antel.Bernd Hachleitner zeigt, wie sehr dieseFilme zur Popularität der Eisrevue beitrugen.Eisstars spielten Hauptrollen oderdoubelten auch Schauspieler in den Revueszenen,und die prominente Besetzungmit Hans Moser, Susi Nicoletti, Toni Sailerund vielen anderen Publikumslieblingengarantierten den großen Erfolg, auchwenn die Handlung meist seicht war. Daswichtigste Element dieser Filme war dieBewegung und perfekt inszenierte Eislaufszenen.Das ließ nicht nur die Kinokassenklingen, auch die Eisrevue gewann durchden Kinoerfolg neues Publikum.Das vorletzte Kapitel schildert die meiststrapaziöse Reisetätigkeit der WienerEisrevue (mit einer eindrucksvollen Karteder Spielorte), ihre Konkurrenten undschließlich das rasche Ende des Zaubers.Matthias Marschik zeigt die kleineren121biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenUnternehmungen von anderen Eisshows,die sich letztendlich nicht halten konntenund aufgekauft wurden oder scheiterten.Die Organisation der Reiserouten warstets ein Konkurrenzkampf. Mehr als eineRevue pro Stadt funktionierte nicht, dahermussten immer möglichst viele Hallen exklusivgesichert werden. Der Wandel derZeiten erforderte eine Modernisierunguund die Anpassung an zeitgemäße Standards,– gelang letztendlich aber nicht.Die finanziellen Turbulenzen, die dasEnde der Wiener Eisrevue besiegelten,waren nicht unwesentlich von den Kostenfür die Musik mitverursacht worden,denn das Honorar Robert Stolz, der auchbei Verlusten drei Prozent von den Einnahmenerhielt, trug das Übrige dazu bei.So konnte der neue Leiter Robert Opratkokeine Eigenkompositionen mehr unterbringen,und man verzichtete auf das teureLive-Orchester. Letztendlich hielt manaber auch so nur mehr zwei Jahre durch.Der Versuch, die Revue zu erneuern,gleichzeitig aber das Stammpublikumnicht zu verärgern, wollte nicht so rechtgelingen. Das Frauenbild, das Eisläuferinnenzum Objekt männlichen Voyeurismusmachte, irritierte und war den Stars wieIngrid Wendl und Regine Heitzer durchausbewusst.Bernd Hachleitners Kapitelüberschrift»Als wäre der Steffl oder das Riesenrad in fremdeHände übergegangen« verdeutlicht dieEinschätzung des Verkaufs der Wiener Eisrevueim Juli 1970 als nationale Tragödie.Die Verluste waren zu hoch, ebenso dieNachforderungen der Sozialversicherung,da Rücklagen fehlten. Das Unterhaltungsgeschäfthatte sich zu stark verändert, dieBedeutung des Fernsehens wuchs. Somitkam nach 28 Produktionen mit mehr als60 Millionen ZuschauerInnen das Ende fürdie »Wiener Eisrevue«.Seit 1974 tritt »Holiday on Ice« einmaljährlich in der Wiener Stadthalle auf.Amerikanisch ist heute nur mehr derName, das Unternehmen gehört zu eineminternational tätigen Konzern. Stars ausdem Eiskunstlauf spielen heute so gut wiekeine Rolle mehr, die Handlung ist meistaus (Zeichentrick) Filmen übernommenoder aus anderen populären Bereichen.Die österreichische Eiskunstlaufförderungwar damit kein Thema mehr.Das abschließende Kapitel stellt nocheinmal die Publikumslieblinge und ProtagonistInnenaller Shows vor.Insgesamt bietet der reich illustriertKatalog ein lebendiges Bild der InstitutionWiener Eisrevue und macht deutlich, welcherFixstern österreichsicher Unterhaltungskulturmit diesem Unternehmungverschwunden ist.Gabriele MautheMichael Hagner:Zur Sache des Buches.Göttingen: WallsteinVerlag <strong>2015</strong>, 279 SeitenISBN 978-3-8353-1547-1In Zeiten einer expansiven digitalenMedienkultur mehren sich auch Plädoyersderjenigen Buchmenschen, welchedie einfache Rede vom wenn nicht obsoletgewordenen so doch schwerfälligen MediumBuch nicht gelten lassen wollen. Anstattsich bloß in elegischen Nachreden zuergehen, machen sie es sich zur Aufgabe,Sinne und Verständnis gleichermaßen fürdie wesentliche kulturelle Errungenschaftder Typographie zu schärfen.Warum brauchen wir im digitalen Zeitalternoch gedruckte Bücher? Auf diesescheinbar einfache und doch so vertrackteFrage laufen die vom Zürcher WissenschaftshistorikerMichael Hagner zu dieserDebatte unter dem treffenden Titel ZurSache des Buches vereinten Überlegungenhinaus. Hagners Publikation ist nicht explizitTeil der im selben Verlag erscheinendenReihe Ästhetik des Buches, in dersich eine Reihe von schmalen Bändchenin vorwiegend essayistischer Form »deneinzigartigen ästhetischen, kulturellenund wahrnehmungspsychologischen Qualitätendes gedruckten Buches widmen«, um – wie esweiter in einer Ankündigung des Verlages122biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenkritik aus, wie er sie paradigmatisch inden Schriften Theodor Lessings Anfangdes vorigen Jahrhunderts findet. Überzeugendzerlegt Michael Hagner die Verschränkungvon Sorge um Dekadenz derKultur aus ihren Werkzeugen und jenerHeilserwartungen, die üblicherweise anmediale Innovationen geknüpft werden,die den modernen Menschen vom Ballastder überkommenen Artefakte befreiensollten. Michael Hagner zeigt uns in einemmetareflexiven Gestus – und darinliegt schließlich eine Stärke geisteswissenschaftlichenDenkens – wie KulturkritikZur Sache des Buches funktioniert. Bereitsim ersten Teil des Buches wird klar, dassder Autor für eine Medienkultur der Diversitäteintritt, womit er eine Diversitätmeint, in welcher Nutzer sich bewusst aufmediale Formen einlassen, um diese zunutzen, wo sie ihre Stärken haben.Dass Michael Hagner sich folglich aufdie Formen wissenschaftlichen Publizierenskonzentriert, mag man als Einschränkungverstehen, da es sich schließlich nurum ein Minoritätssegment der Buchproduktionfür eine relativ schmale Leserschafthandelt. Die Beschränkung auf einFeld, das man selbst bestellt, bringt aberauch den Bonus einer konzisen Darstellungmit sich, in diesem Fall nicht nurzur medialen Ausdifferenzierung wissenschaftlichenPublizierens, sondern darüberhinaus zum Wissenschaftsbetrieb des21. Jahrhunderts. Wie beide zunehmendunter die »Kontrolle eines Quantifizierungsregimes«(129) des kapitalistischen Marktesgeraten, ist ein argumentativer Strang,der sich durch die Analyse der Open-Access-Debatteund die Geschichte wissenschaftlicherVerlage nach dem Ende des 2.Weltkrieges zieht und geknüpft wird ausimmer wieder überzeugend formuliertenBeobachtungen zu Expansion und Wandeldes Wissenschaftsbetriebes, der Rollevon Autorschaft etwa oder der Frage nachSelektionsmechanismen innerhalb einesnicht zuletzt durch Open-Access unübersichtlichgewordenen Feldes. Ein andererStrang ist die mediale Ausdifferenzierungnach Wissenschaftsdisziplinen, wobei esauf eine Gegenüberstellung von sogenannheißt– »einen Diskurs zur Buchform und zumBuch als Form« zu schaffen, welcher sich»auf die sinnlichen und lesetechnischen Vorteiledieses Mediums konzentriert.« Dennoch teiltZur Sache des Buches das explizite Anliegender Reihe, die Unabdingbarkeit und langwährendeFlexibilität des gedruckten Bucheszu erweisen.Die Wahl eines solchen Titels suggeriertbereits beides: Dass es sich um Anmerkungenzu einer weitläufigen Debattehandelt und dass Michael Hagners Schriftgleichsam als Plädoyer zu lesen sei. Auchdas Bild eines fleckig gewordenen Bronzefirnispapieresauf dem Schutzumschlagunterstreicht, dass es hier um die historischeReichweite eines Mediums geht, daswesentlicher Teil unserer Kultur gewordenist und das es nicht wert ist, so einfachaufzugeben. Aber besteht eine derartberechtigte Sorge um das gedruckte Buch?Soviel vorweg: Die Antwort, welcheMichael Hagner den bibliophilen Leserngibt, ist beschwichtigend. Die Rede vom»Ende der Buchkultur« diagnostiziert er als»rheumatische(n) Schub gewissermaßen, derauch wieder vergeht.« (12/13) Das gedruckteBuch lässt sich nicht so einfach verdrängen,weil sich über eine lange Zeithinweg Institutionen, Kulturtechniken,Erwartungshaltungen und nicht zuletztDisziplinierungsmechanismen an das ObjektBuch angelagert und tief in unsererKultur verfestigt haben. In der kulturhistorischenFernsicht liegt eine wesentlicheStärke von Michael Hagners Buch. Eineandere, dass er nicht bloß die einfacheDichotomie vom behäbigen wie auch beständigenBuch auf der einen Seite undden innovativen wie auch flüssigen, digitalenPublikationsformen auf der anderenfort schreibt, sondern versucht, die idealistischenVerschanzungen hinter sich zulassen.Die Debatten zwischen den enthusiastischenVerfechtern digitaler Fortschrittlichkeitund den in deren Augen unzeitgemäßgewordenen Fahnenträgern einesmedialen Konservativismus scheinen sichin der Tat fest gefahren zu haben. MichaelHagner macht dahinter wiederkehrende,argumentative Muster von Kultur-123biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenten STM-Fächern (science, technology andmedicine) zu den Geisteswissenschaftenhinausläuft. Da Michael Hagner Zeit seinerForschungsvita an beiden partizipiert,sorgt das für eine überlegte Innensicht, andessen Ende jedoch merkbar eine klareEntscheidung steht.Man merkt es dem Buch an: Hierschreibt ein Geisteswissenschafter fürGeisteswissenschafter. Hierin mag ein Problemdes Buches liegen, dass es nämlichbei dem Klientel, das es bedient, im Grundekeine argumentative Überzeugungsarbeitzu leisten brauchte. Darauf wird zurückzu kommen sein.Wissenschaftsbetrieb und der Marktfür wissenschaftliche Publikationen expandierenseit Jahrzehnten ungebremst.Dass diese Expansion ökonomischenMaßgaben folgt, ist das eine Problem.Seit Ende des Zweiten Weltkrieges sindVerlage und Wissenschafter bzw. Wissenschaftsinstitutioneneine erfolgreicheSymbiose eingegangen, welche durch diekapitalistische Vereinnahmung beider zuzerbrechen droht. Michael Hagner machtim zweiten Abschnitt Alles umsonst? OpenAccess ein Bündel an »politischen, ökonomischenund epistemischen Veränderungen desakademischen Publizierens« (65) aus, das mitder Forcierung von Open Access im Grundenur zu forcierteren Abhängigkeitenfest gezurrt wurde. Die demokratischeForderung einer allzeit freien Verfügbarkeitder Wissensproduktion mit OpenAccess wurde als Reflex auf eine Spiraleder Teuerung, wie sie ausgehend von denSTM Fächern auch auf die geisteswissenschaftlichenVerlage übergriff, enthusiastischbegrüßt, brachte aber laut Hagnernur neue Abhängigkeiten mit sich. OpenAccess sollte die demokratische Utopievon der Verbreitung des Wissens jenseitsdes Marktes glaubwürdig machen, wurdesehr bald aber nur in eine Reihe »neue(r)Geschäftsmodelle des Informationskapitalismus«(111) integriert. Hagners ernüchterndeDarstellung sollte »ein wenig Luft ausdem prall mit Erwartungen gefüllten Ballonablassen« (189). Die Ideale des Open Accessseien eben unter die Räder des Marktesgekommen. All diese Überlegungen füh-ren zur fundamentalen Frage nach »Wissenals Ware oder immaterieller Wert« (120) undder Frage danach, wer aus Wissen Profitschlagen darf oder etwa, wer die Zechefür die Verbreitung des Wissens bezahlensoll? Die Ideale freier Wissensverbreitungsind an ein Moralsystem gekoppelt, dasmit der glatten Moral des nach kapitalistischenMaßgaben umgebauten Buchmarkteszunehmend konfligiert. Dass die Vermarktungvon Wissen immer schon denRuch des Amoralischen trägt, zeigte kaumjemand deutlicher als Robert Darnton inseiner Studie Glänzende Geschäfte zum SpekulationsobjektEncyclopédie.Eine andere Misere ist für Michael Hagnerdas Phänomen der Überforschung unddas Problem der Selektion innerhalb einerauf Grund des Abbaus bewährter Kontrollmechanismender Verlage entstandenenUnübersichtlichkeit. Hagner geht eswesentlich um den Verlust an Qualitätim Feld wissenschaftlichen Publizierens,wo der einzelne Beitrag quasi nicht mehrwahrgenommen wird. Mit Beobachtungenwie derjenigen, dass der Sammelband der»Packesel der Überforschung« (179) sei, gewinntMichael Hagners Untersuchung anKontur. Mit solchen gleichsam eingestreutenDetails liefert er eine Fülle an Material,was das Buch als Steinbruch weiterführenderGedanken überaus lesenswertmacht.In der Wachstumsindustrie Forschungverhärtet sich gemäß Hagner die Umklammerungunternehmerisch agierenderUniversitäten, die von ihren Wissensproduzentenein Publikationskalkülabverlangen und global agierender Verlagskonsortien,gegen die es mit geisteswissenschaftlichenBüchern explizit einReservat zu kultivieren gilt.Mit der Erfolgsgeschichte des geisteswissenschaftlichenBuches entfaltet MichaelHagner im dritten Abschnitt VomBuch zum Buch den Gedanken, dass das gedruckteBuch heute seine Bestimmung wesentlicherst in den Geisteswissenschaftenerfüllt. »Bücher sind der maßgebliche Ausweiseiner ›moralischen Ökonomie‹ der Geisteswissenschaften,nicht der einzige, aber derjenige, derzu ihrer Geltung am meisten beigetragen hat.«124biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungen(245). Buch und Geisteswissenschaftenbilden für Hagner ein Gespann der Anti-Ökonomie, das der Vereinnahmung durcheine oberflächliche Informationsindustrieeine Moral der Tiefe, Aufmerksamkeitund Langsamkeit entgegen stellt. »Prägnanz,Profil, Papier« (197) versus Expansion,Beschleunigung und Gewinnmaximierung.Geisteswissenschaftliche Verlagemit sorgfältigem Lektorat sieht Hagner alswesentliche Garanten einer qualitativenBuchproduktion und verlangt von ihnen»Widerständigkeit, Eigensinn, Fokussierung undAuswahl.« (205) Es gelte, nicht durch möglichstviele, kurzlebige Bücher die Überforschungzu befördern, sondern nachhaltigegute Bücher in angemessener Formzu verlegen. Für die Naturwissenschaftenmögen Formen digitalen Publizierens dieangemessenen sein, gute geisteswissenschaftlicheForschung brauche aber lautHagner das gedruckte Buch, denn schließlichhandele es sich um »zwei andersartigeWeisen wissenschaftlicher Artikulation«. (189)Informationsverwertung durch data miningan einem Ende, das gute Buch, welcheszur intensiven Lektüre einlädt, amanderen. Die Frage danach, was ein gutesBuch zu einem solchen mache und werdarüber entscheide, ist eine heikle, dieoft nur in einem Selbstverständnis der Bildungselitenaufgeht. Michael Hagner entgehtdem zumindest teilweise, indem erden Ausweis von Qualität an die materialenErmöglichungsbedingungen variablerLektüremodi bindet. Gute Bücher provozierenvermittels ihrer materialen Gestaltungzu jenen über Jahrhunderte eingeübtenund perfektionierten Lesetechniken,unter denen für Hagner die impegnativeLektüre mit dem Stift in Händen zweifelsohneherausragt. Der Körper des Buches(242) organisiert so die Aufmerksamkeitderjenigen, die auch bereit sind, die Herausforderungdes gedruckten Buches, essich nicht nur bequem zu machen, anzunehmen,Zeit zu investieren, Schwellenzu überwinden, und bereit sind, am Buchsich selbst zu transzendieren. (239) AmEnde plädiert Hagner für eine »flexible Ökologiedes Lesens« (226), wo Publikationsformenund Lektüretechniken bewusst sele-giert werden. Wir sind angesichts digitalerLiteratur nicht zu schlechteren Lesern geworden,es fehlt nur »die angemessene Einübungins digitale Lesen.« (226) Die angemesseneÜbung intensiver Lektüre darf abergleichwohl nicht verloren gehen, wofürnach Hagner Papier und Zeit unabdingbarist. »Es wäre schon einmal viel gewonnen,wenn sich auch in den wenig buchaffinen Kreisendie Einsicht durchsetzte, daß das Papier fürdie Geisteswissenschaften unverzichtbar bleibt.«(215) Da bleibt teilweise mit Hagner selbstzu replizieren: »Woher soll die interessierteLeserschaft denn kommen« (206), wenn nichtaus der eigenen Reihe? So lesen Geisteswissenschafteraufmerksam und gelassengedruckte Bücher von ihresgleichen mitdem Stift in der Hand, nicht zuletzt, umdie implizite Moral ihrer Disziplin gegenökonomische Vereinnahmungen zu retten.Wer etwas auf sich hält unter denGeisteswissenschaftern, lässt weiterhindie Druckerpresse laufen. Mit MichaelHagners Zur Sache des Buches hat sie uns einProdukt beschert, das lohnt, aufmerksamund gelassen mit dem Stift in der Hand gelesenzu werden.Martin KricklUlrike Jenni, MariaTheisen: Mitteleuropäische Schulen IV (ca.1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV.und deren Umkreis. Wien: Verag der Öster.Akademie der Wissenschaften 2014,Textband: 252 S., 130 Abb.; Tafelband: 56S., 272 Abb.ISBN 978-3-7001-7203-1Bereits mehr als zehn Jahre sind vergangen,seit das Buch Mitteleuropäische SchulenIII von Ulrike Jenni und Maria Theisenpubliziert wurde. In der Publikation ausdem Jahre 2004, die ein Kettenelementin den Veröffentlichungen des Institutsfür Kunstgeschichte der Universität Wiensowie der Österreichischen Akademie derWissenschaften über die illuminiertenHandschriften der genannten Region inder Handschriftensammlung der ÖNB bildet,wurde die Aufmerksamkeit auf dieZeitspanne ca. 1350 – 1400 in Böhmen,125biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenMähren, Schlesien und Ungarn gelegt. Allerdingsmit einer wichtigen Ausnahme,und zwar die der Handschriften, die manmit dem Römischen und Böhmischen KönigWenzel IV. in Verbindung stellt.Das explizite Versprechen, dass der breitenProblematik der Wenzelbibliothek einseparater Band gewidmet sein würde, unddie qualitativ hochwertige Erarbeitungdes ersten Katalogs des wissenschaftlichenDuos, war eine Kombination, die die eingeweihtenKreise lange Zeit in gespannterErwarterung hielt. Die Handschriften derWenzelbibliothek wirken schon über Jahrzehntewie ein Magnet auf die kunsthistorischeForschung, hierzu müssen zumindestJosef Krásas Monografie aus dem Jahr1971 und Gerhard Schmidts Text im Kommentarbandzum Faksimile der Wenzelsbibelaus dem Jahre 1998 genannt werden.Demnach wurden die Grundlagen inder Fachliteratur bereits gesetzt. Zugleichzeigt sich die Vielfalt der noch zu beantwortendenFragen derart bunt, dass mandie Neugierde nach möglichen neuenInterpretationen und Entdeckungen nurschwer zurückhalten kann. Einleitendkann festgestellt werden, dass sich dasWarten lohnte. Die zahlreichen Publikationennmderbeiden Autorinnen ließenschon vor dem Herbst 2014 teilweise erahnen,was sich im vorleigenden Buch findenwird. Die Publikation geht über einereine Zusammenfassung der Forschungstätigkeitjedoch weit hinaus.Die thematische Begrenzung des neuerschienenen Katalogs hat gewisse Vorteile,die sich in der Struktur wiederspiegeln.Nach dem Vorwort der Autorinnenbeginnt das Textbuch mit einer ausführlichenkunsthistorischen Einleitung (S.1-64),die die verschiedenen Aspekte des Mosaiks,sowie den historischen Hintergrund,die Embleme in den Bordüren der Handschriften,das Schicksal der BuchsammlungWenzels, sowie die Erwägungen zurBuchproduktion unter seiner Regierungin Prag, behandelt. Bis heute wurden nursieben Handschriften identifiziert, diemit Sicherheit der ursprünglichen Bibliothekdes römischen und böhmischenKönigs Wenzel zuzuordnen sind. Zweidavon finden wir nicht in Wien (die deutscheÜbersetzung der Psalterauslegungdes N. de Lyra, Salzburg, UB, M III 20 unddie Münchner Astronomische Sammelhandschrift,BSB, clm 826), fünf hingegenbefinden sich in der ÖNB: die deutscheÜbersetzung des Alten Testaments, diesog. Wenzelsbibel (Cod. 2759-2764), Willehalm(Ser. n. 2643), zwei astronomischeHandschriften,Sammelband, (Cod. 2352)und Quadripartitos des Ptolemaeus (Cod.2271),und die Goldene Bulle (Cod. 338).Weitere Handschriften werden mit einergewissen Sicherheit dazugezählt, vorallemdas Oxforder Stundenbuch (PembrokeCollege, ms. 20) und das Madrider Dragmaticonphilosophiae (BN, Res. 28).Die Einleitung verknüpft eine präziseCharakteristik und Sortierung der malerischenWerkstätten und Floratoren, diean dem grössten Projekt, der Wenzelsbibel,beteiligt waren, wobei es gelang, denmanchmal sehr engen Zusammenhangzwischen Illuminatoren und Floratorenzu veranschaulichen. Dies wurde bereitsin dem Absatz über die Buchproduktionerwähnt.Es werden die Balaam-, Siebentage-,Salomo-, Rut-, Esra-, Simson- und Morgan-Meister, sowie der Meister der GoldeneBulle, der Meister der Paulusbriefe, Franaund Nicolaus Kuthner und deren Floratorenvorgestellt. Die Autorinnen konntensich auf die Studien von Gerhard Schmidtstützen, hierbei präzisierten sie seine Beobachtungendurch neue Entdeckungen(z. B. in der Siebentage-Werkstatt, wo derKatharinen-Meister definiert wurde).Wie schon der Titel sagt, zielt das Buchnicht nur auf die fünf luxuriösen Cimelien,sondern befasst sich im Katalog auchmit neun weiteren Codices, die mit denerst genannten entweder stilistisch oderinhaltlich in der Verbinndung stehen. Soist der für den Katalog reservierte Teildes Buches mit dem astronomischenCod. 2378 eröffnet, der mit seinen etwasungelenken Figuren der Sternbilder mitschielenden Augen einen deutlichen Kontrapunktzu den höfischen Handschriftenbildet. Dieser Kodex, den der PragerKathedralkanoniker Nikolaus im Besitz126biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenhatte konnte nämlich als Vorbild des höfischenatrologischen Sammelbandes imCod. 2352 dienen, da sich dort die ältestebekannte böhmische illustrierte Redaktiondes Buches von Michael Scotus findet.Folgende Handschriften Cod. 2352 undCod. 2271 sind dann schon gänzlich höfischeWerke, deren malerische Ausstattungtrotzdem zum grössten Teil anderenWerkstätten als die von Willehalm, Bibelund Goldene Bulle beschäftigt. UlrikeJenni gibt diesen Werkstätten neueBeinamen,wie: Meister der Astronomen, JohannesDank-Meister oder auch MichaelScotus-Meister, der nur aus Cod. 2352 bekanntist. Die Sternbilder, die besondereKenntnisse für die richtige Ausführungverlangen, wurden wahrscheinlich vonSpezialisten angefertigt. UnterschiedlicheMeister waren im Quadripartitus, Cod.2271 tätig. Aus einer weiteren Werkstattstammen die Bilder im Münchener AstronomischenSammelband, clm 826, der denSternbildern aus der Paduaner Werkstatt,heute Prager Bibliothek des KöniglichenChorherrenstiftes Strahov, Cod. DA II 13,die auch aus dem Eigentum böhmischerKönige stammen, sehr nahe steht. DerMünchener Codex bleibt natürlich hinterdem Horizont des hier rezensierten Buches.Dennoch, wie Ulrike Jenni bemerkt,»die Frage, ob es in Prag Werkstätten gab, dieauf … naturwissenschaftliche Werke spezialisiertwaren, kann nicht amit Sicherhit beantwortetwerden, da nur drei astrologische Wenzelhandschrifteninsgesamt erhalten gebliebensind« (S. 67). Neben den historisierten Initialenwidmet Jenni ihre Aufmerksamkeitden Floratoren und dem Rankenschmuck,wobei sie hier schon auf die künftige Entwicklunghinweist. So ist z. B. der FloratorB aus Quadripartitus mit dem Stil aus Hasenburg-Missale,Cod. 1844, und der Bibeldes Konrad von Vechta, Amtwerpen, MuseumPlantin-Moretus, 15/1-2. verwandt (S.68, 125-127, zuvor bereits in der Einleitungvon Theisen, S. 56-57). Im Gegensatz dazubleiben die Kreationen von dem Meisterder schwungvollen Akanthusranken, dessenBordüren ab und zu von fantastischenVögeln, deren Körper und Federn aus kleinenBlättern aufgebaut sind, solitär undeinzigartig. Das Trifolium der astrologischenHandschriften eröffnet den Katalog(S. 65-131) und es sit bewunderswert, wiegut das Ulrike Jenni ads kompliziertenThema bewältigt hat.Die Katalognummern 4 und 5 wurdenfür den Willehalm, Ser. n. 2643, und dieBibel, Cod. 2759-2764, bestimmt. Weil diekunsthistorische Unterscheidung der hiertätigen Meister schon in der Einleitunggemacht wurde, konzertriert sich derKatalog vorallem auf die ikonogragischeBeschreibung der beiden Codices, dasheisst die basale Charakteristik der 19 historisiertenInitialen, der 635 gerahmtenMiniaturen in der Bibel und der 161 Initialenund 86 Miniaturen im Buch der Ritterepik.Dieser enorme Umfang bewirkt,dass beide Handschriften einen nichtgeringen Teil des Katalogs in Anspruchnehmen (S. 132-212). Die Datierung dieserHandschriften, die von Hana Hlaváčkovávorgeschlagen, und in tschechischenkunstwissenschaftlichen Kreisen bereitsoft übernommen wurde (der Arbeitsbeginnan der Bibel vor der Silvesternacht1386 und der Vollendung des Willehalmsim Jahre 1387 – siehe z. B. Hlaváčková inThe Regal Image of Richard II and the WiltonDiptych, 1997), ist nach Meinung von MariaTheissen zu früh gewählt. Auch wenn sieden Beginn mit 1385 für möglich hält, hältsie sich der Fertigstellung des Epos in den80. Jahren für nicht erwiesen.Die letzte- höfische Handschrift findetman unter der Nr. 12 (S. 233-243). Es ist dieGoldene Bulle, Cod. 338, bei der die Meisterder Goldene Bulle, Frana und die Meisterder Paulusbriefe zusammenarbeiten.Die Katalognummern 6 -11 und 13-14 (S.212-233 und 243-247) sind für jene Handschriftenreserviert, die entweder schon127biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenIn jedem derart umfangreichen Buch,stößt man auf Ungenauigkeiten. So findetman die Handschrift R 397 nicht mehrin der Brünner Universitätsbibliothek (S.32), da die Benediktiner Sammlung inzwischennach Raigrad (Rajhrad) restituiertwurde, der Brevier XV G 7 aus dem PragerNationalmuseum kommt zvar aus derRaudnitzer Bibliothek (S. 58), aber seineursprüngliche Provenienz war die PragerKathedrale. Ausserdem bin ich überzeugt– obwohl ich die Harvarder Bibliotheknoch nicht persönlich besuchen konnte– dass das Fragment aus der Harvard CollegeLibrary, Ms. Typ 268 H, höchst wahrscheinlichaus der Bibel CO 4 aus dem OlmützerStaatsarchiv stammt, da die Maßedes Fragmentes mit der Bibel übereinstimmenund dieser im heutigen Zustand geradedie Initiale zur Apostelgeschichte fehlt– d. h. das Fragment ist dem Rut-Meister,nicht dem Salomo-Meister zuzuschreiben(siehe S. 33-34 und 41-42). Die Autorinnensagen ja klar, dass die Unterscheidungzwischen den einzelnen Meistern manchmalsehr kompliziert ist und genau zwischenden zwei oben genannten führt dieGrenze durch die Landschaft mit sehr unscharfenKonturen. Diese Details könnenden positiven Eindruck des Katalogs aberin keiner Weise trüben. Überraschend istauch, wie unterschiedlich die Qualität derReproduktionen ist. Wenn man die Verschiedenartigkeitder Vorlagen abwägt,wirkt das Resultat aber nicht schlecht.Due Auswahl der Beispiele ist sehr zu .loben,da alle wichtigen Momente des Texteshinreichend veranschaulicht sind.Wie schon gesagt, stellen die Wenzelhandschriftenein anziehendes und reizvollesThema dar. Deshalb gibt es heutzutagePublikationen, auf die Ulrike Jenniund Maria Theissen zum Teil gar nicht reagierenkonnten. So hat Lenka Panuškovádie böhmische Provenienz der Handschriftaus Bernkastel-Cues, Cod. Cus. 207in Frage gestellt (im Katalog Royal Mariafrühermit königlichen Illuminatorenassoziiert wurden, aber hier nun endlicheine eingehende Aufmerksamkeit bekommen,oder die nun überhaupt zum erstenMal in diesem Kontext genannt wurden.Cod. 1668 (Nr. 6) mit der Schrift Remediariumabiecti prioris von dem KarthäuserMichael von Prag wurde von einem Floratoraus der Siebentage-Werkstatt verziert.Dieselbe Werkstatt beendete auch die inItalien verfasste kanonistische Rechtshandschrift,Cod. 2064 (Nr. 11). Cod. 1390(Nr. 7) mit zwei Werken von Richard vonSankt Victor, diese hatte eine kompliziertereGenesis: der erste Teil entstandwohl um 1375/80 und wird hier erstmalsals eine Arbeit aus dem Umkreis der Erbendes Meisters des Kreuzherrn-Breviersidentifiziert. Der zweite Teil hat nur eineIllumination mit einem Chorherr, der diehl. Katharina anbetet und möglicherweiseein Augustiner ist (er könnte auch ein Sekulärkanonikersein, aber der Vorschlagder Autorinnen gefällt auch mir besser,und ist dazu im Einklang mit dem Inhaltder Codices). Der Autor dieses Bildes wirdals Katharina-Meister bezeichnet und istder Siebentage-Werkstatt zugeordnet. Inder theologischen SammelhandschriftCod. 728 (Nr. 8) trifft man wieder auf denMeister der Paulusbriefe, der dann zusammenmit dem Simson-Meister in VitaCaroli Quarti, Cod. 619 (Nr. 10) zu findenist, und natürlich auch im berühmten Kodex,der ihm einst den Name gab: Epistolperikopenaus den Paulusbriefen, Cod.2789 (Nr. 13). Im Brevier aus der BreslauerDiözese, Cod. 1842 (Nr. 9), kann mandeutliche Spuren des Kunsteinflusses derSiebentage-Werkstatt und Nikolaus Kuthnersfinden. Der Katalog endet mit demSammelband, Cod. 4352 (Nr. 14), wo manden Florator aus der Siebentage-Werkstattwieder trifft, der vorher auch die ersteLage der Goldenen Bulle schmückte. Wiedereine neue Entdeckung für die Kunstgeschichte.128biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenge, Prague 2011), und zusammen mit Alenaund Petr Hadrava auch die Prager Provenienzder sog. Přemysliden Himmelskugelaus Kues angezweifelt, was das traditionelleImage der Prager Residenzstadtals eine der wichtigsten astrologischenZentren schon seit dem Beginn des 14.Jahrhunderts ein wenig relativiert (sieheAlena Hadravová, Petr Hadrava und LenkaPanušková: Sphaera octava, Praha 2014– die vierbändige Publikation bietet u.a.:eine lateinisch-tschechische Edition mancherastrologisch-astronomischer mittelaterlicherTraktate, wobei Alena Hadravováihr Talent als klassischen Philologin zeigt,eine gründliche wissenschaftliche Analyseder Himmelskugel von Petr Hadrava, unddie eingehende Studie zur Ikonografie derPlaneten, die von Lenka Panušková verfasstwurde, und die gleicher Maßen mitden drei oben erwähnten astrologischenHandschriften aus Prag arbeitet).Studie von Milada Studničková befasstsich ebenso mit dem Thema (siehe Gensfera …, in Umění/Art, 3/2014), in der dieForscherin mit Hilfe der mittelaterlichenTheologie für die Embleme in den Bordürender Wenzelhandschriften die bisherüberzeugendste Interpretation anbot: Diewilden Männer und andere Elemente sindoftmals als ein sophistizierter Bildkommentarzu einem konkreten biblischenText komponiert, ein anderes Mal wieeine Metapher der Gottesordnung, durchdie auch die königliche Macht und dasRecht manifestiert sind. So klingen zumTeil die älteren Motive aus den ArbeitenMaria Theissens durch, die Analyse vonStudničková stellt jedoch diese Betrachtungenauf ein festes Fundament.Die besprochenen wissenschaftlichenNeuigkeiten zeigen, wie lebendig dieseMaterie ist. Umso wichtiger ist es, einequalitativ wervolle Zusammenfassung zurHand zu haben, die wie ein Mediator inder Forschungsliteratur dienen kann. Wieein eingeweihter Begleiter, der durch dieverflochtenen Werkstätten und ihre luxuriöseKunst führt, und wie ein eifrigerForscher neue Entdeckungen und möglicheInterprationen aufzeigt. Alle diese Anforderungenwurden von Ulrike Jenni undMaria Theissen im vollem Umfang erfüllt.Jedes weitere Studium kann jetzt auf einerhöheren Ebene beginnen.Tomáš GaudekReiner Stach: Kafka.Die Frühen Jahre.Frankfurt a. M.:S. Fischer 2014,607 SeitenISBN 978-3-10-075130-0ISBN 3-10-075130-22014 erschien der letzte – eigentlich chronologischerste – Band von Reiner Stachsgroßem dreibändigen Biographieprojektzu Franz Kafka, das nunmehr abgeschlossenvorliegt. Er behandelt die Kindheit undJugend Kafkas bis zum Jahr 1911. Bereits2002 war der erste Band Die Jahre der Entscheidungerschienen, der Kafkas mittlerenLebensabschnitt (1910-15) darstellt, 2008dann Die Jahre der Erkenntnis, die Kafkas letztenLebensabschnitt von 1916 bis zu seinemTod 1924 umfassen. Der Grund für dieseetwas ungewöhnliche Reihenfolge des Erscheinenslag primär darin, dass Stach fürdie Darstellung von Kafkas frühen Jahrenauf die Zugänglichkeit der Tagebücher vonMax Brod warten wollte, diesen Plan aberschließlich wegen der immer noch andauerndenRechtsstreitigkeiten um den NachlassBrod aufgeben musste. Mit einem Umfangvon insgesamt fast 2000 Seiten undeiner beeindruckenden Fülle an gründlichrecherchierten Fakten zu Kafkas Leben undseiner Zeit kann Stachs Kafka-Biographieohne Zweifel als die Standardbiographiezu einem der größten deutsch-sprachigenAutoren des 20. Jahrhunderts gelten. Sie129biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
Buchbesprechungenvermag uns das zu tiefst rätselhafte PhänomenKafka zumindest ein Stück weit verständlichzu machen.Nach den von der Kritik hochgelobtenersten beiden Bänden, waren die Erwartungenan den dritten Band naturgemäßgroß – und Reiner Stach enttäuscht sienicht. Wie schon in den vorangegangenenBänden liegt Stachs Stärke einerseits ineiner lebendigen und detailreichen Schilderungdes kulturhistorischen, sozialenund politischen Zeithorizonts, vor demKafkas Leben erst seine Plastizität und Realitätsnähegewinnt. Seine methodischesVorgehen kann dabei als eine Art »Zoomingin« bezeichnet werden, indem ersich von allgemeinen Schilderungen despolitisch-gesellschaftlichen Zeitgeschehensimmer näher an den Ort, die Gesellschaftsschicht,die Familie schließlich biszur Hauptperson vorarbeitet. Zu Stachsgroßen Vorzügen zählt andererseits seinepisch-fließender, geradezu romanhafterStil, der die Lektüre auch zu einem echtenLesevergnügen macht. Dabei ist aber festzuhalten– wie der Autor auch ausdrücklichbetont – , dass alle geschilderten Detailsdurch Quellen belegt sind, die auchin den Fußnoten angegeben werden.Es waren keineswegs ruhige Jahre, indie Kafkas Kindheit und Jugend in Pragfällt. Immer wieder aufflammende Konfliktezwischen der deutschen und dertschechischen Volksgruppe standen ander Tagesordnung und prägten bereitsden schulischen Alltag Franz Kafkas. (Seinspäterer enger Freund, der SchriftstellerOskar Baum, verliert bei einer Straßenraufereizwischen Schülern sein Augenlicht,(411).) Dazu kam periodisch ausbrechenderJudenhass, der sich in Plünderungenund gewaltsamen Übergriffen entlud. Diedeutsch-jüdische Minderheit in Prag warso gleich ein zweifaches Feindbild: alsdeutsch-sprechende Oberschicht und alsJuden. Eine große Umwälzung für die jüdischeBevölkerung brachte außerdem dieSchleifung des alten Prager Ghettos (1893-1903), das mehr und mehr zu einem verwahrlostenElendsviertel heruntergekommenwar. Die wohlhabenderen jüdischenFamilien, zu denen auch die Kafkas gehörten,waren längst in bessere Wohnviertelausgewichen.Interessant ist, wie gegensätzlich Kafkaselbst seine familiäre Herkunft beschreibt:die Spannung zwischen dem Löwischen,eher musisch-künstlerischen Erbteil derMutter und dem von einem pragmatischenGeschäftssinn dominierten väterlichenErbe der Kafkas. Seine eigene Zugehörigkeitsah er klar im Erbteil der Mutter,damit auch seinen völligen Mangel anInteresse für das elterliche Geschäft entschuldigend.Kafkas Kindheit, war – wieStach betont – gekennzeichnet von der Abwesenheitder Eltern, die sechs Tage in derWoche bis spätabends in der familieneigenenGalanteriewarenhandlung arbeiteten.Seine primären Bezugspersonen warendaher neben seinen kurz hintereinandergeborenen drei jüngeren Schwestern, die– oft wechselnden – Kindermädchen bzw.Köchinnen der Familie. Gerade darin vermutetStach eine entscheidende lebenslangePrägung von Kafkas Charakter.Oftmals geben viel später notierte ErinnerungenKafkas die einzigen direkten Informationenzu diesem Lebensabschnitt,können aber nur mit einiger Vorsicht alsdirekte biographische Quellen benütztwerden. Dazu gehört etwa sein Brief anMilena Jesenska vom 21. 6. 1920, in demer seine täglichen Qualen und den Kampfmit der Köchin beim Weg zur Schule –Kafka besuchte die »Deutsche Volks- undBürgerschule , Prag I« – , in so anschaulicherWeise schildert. Und hierher gehörtselbstverständlich auch der psychologischaufgeladene Brief an den Vater, den der34-Jährige 1917 niederschreibt und darinseinen lebenslangen Vaterkonflikt aufzuarbeitenversucht. Ein Text, den der Vaterallerdings niemals zu Gesicht bekommt.130biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
BuchbesprechungenKafkas darin ausgesprochene Vermutung,in seiner frühen Kindheit durch die Erziehungsmethodendes Vaters eine tiefe, niemalsmehr heilende psychische Traumatisierungerlitten zu haben, ist mehr alsplausibel. Als Erklärungsmodelle von Kafkasspäteren Konflikten und Ängsten bietensich psychoanalytische Theorien quasiautomatisch an. Stach verweist aber insbesondereauf neuere Beziehungstheorienwie etwa Eric Eriksons Theorie des »Urvertrauens«und das »Verlassenheitssyndrom«der Schweizer Psychologin GermaineGuex, die einen wertvollen theoretischenHintergrund für Kafkas frühkindlicheTraumatisierungen geben können.Ausführlich dargestellt werden KafkasSchul- und Studienjahre, auf die auch seineengen, teilweise lebenslangen Freundschaftenzurückgehen, allen voran seineambivalente und vielschichtige Beziehungzu Max Brod. Stach bemüht sich hier – wiein allen umstrittenen Fragen – um einenausgewogenen, sachlich belegbarenStandpunkt.Kafkas Vorliebe für Varietees und Weinstuben,sein recht vertrautes Verhältniszu Animierdamen und Dirnen, ist ein Detail,das in ein allzu heiligenmäßiges, vonBrod gefördertes Kafkabild weniger passt,doch speziell für seine Studienjahre undfrühen Berufsjahre kennzeichnend war(in den zunächst von Brod herausgegebenenTagebüchern Kafkas fehlen allzudeutliche Stellen oftmals). Nach seinerPromotion zum Doktor der Rechte 1906und getrieben von einem eher romantischenFernweh tritt Kafka zunächst in diePrager Filiale der Assicurazioni Generaliein, wechselt allerdings schon bald in dieArbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, nunmehrStaatsbeamter mit wesentlich erträglicherenDienstzeiten, und unter den260 Angestellten der zweite Jude (349).In die Berichtszeit des vorliegende Bandesfallen auch Kafkas erste Schreibversuche:die noch ganz einem phantastischenExpressionismus verpflichtete Beschreibungeines Kampfes, sein erstes belegbares literarischesProjekt, das Kafka viele Jahre bis1911 beschäftigte. 1907 entstehen die Hochzeitsvorbereitungenauf dem Lande, in denenKafka bereits zu seinem von einer sensualistischenGenauigkeit der Beobachtunggeprägten eigenen Stil findet.Eine übersichtliche Zeitleiste, die einegrobe chronologische Orientierung in KafkasLeben ermöglichen würde, fehlt leiderauch in diesem, wie schon in den beidenvorigen Bänden.Stachs Kafka-Biographie ist allen zuempfehlen, die ein genaues, wissenschaftlichfundiertes Bild von Kafkas Leben, seinerPersönlichkeit, Familie und seinemFreundeskreis vor dem kulturhistorischenHintergrund der Epoche suchen. Für dieLeserInnen der ersten beiden Biographie-Bände ist es eine selbstverständliche, bereitsungeduldig erwartete Pflichtlektüre.Alfred Schmidt131biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Buchbesprechungen | 109–129
AutorInnenverzeichnisMag. Stefan EnglÖsterreichische NationalbibliothekMusiksammlungMag. Paul FerstlInst. für Europ. undVergl. Sprach- undLiteraturwissenschaft /Abteilung fürVergleichendeLiteraturwissenschaftUniversität WienUniversitätsring 11010 WienDr. Christian GastgeberÖsterreichische Akademieder WissenschaftenTomáš GaudekNárodní památkový ústav– generální ředitelství(National Instititut fürDenkmalpflege – Generaldirektion)Valdštejnské náměstí 3118 01 Praha 1 – MaláStranaMag. a VanessaHannesschlägerLudwig Boltzmann Institutfür Geschichte undTheorie der BiographiePorzellangasse 4/1/171090 WienUniv.-Prof. Dr. AchimHermann HölterInst. für Europ. undVergl. Sprach- undLiteraturwissenschaft /Abteilung fürVergleichendeLiteraturwissenschaftUniversität WienUniversitätsring 11010 WienMag. a Sonja HotwagnerÖsterreichischeNationalbibliothekAbteilung fürKommunikation undMarketingMag. a Katrin JilekÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten DruckenDr. Elisabeth EdithKamenicekÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten Druckenao. Univ.-Prof.Dr. Elisabeth KleckerInstitut für KlassischePhilologie, MittelundNeulateinUniversität WienUniversitätsring 11010 WienMag. a MonikaKiegler-GriensteidlÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten DruckenMag. Martin KricklÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten DruckenDr. Mag. a Gabriele MautheÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten DruckenMag. a SolveighRumpf-DornerÖsterreichischeNationalbibliothekSammlung vonHandschriften undalten DruckenDr. Alfred SchmidtÖsterreichischeNationalbibliothekGeneraldirektion132biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | AutorInnenverzeichnis | 130
AbbildungsnachweisAlle Bildrechte bei der Österreichischen Nationalbibliothek mit Ausnahme von:Artikel Alfred Schmidt: Wittgensteins WidmungenAbb. 2+3: Bodleian Library OxfordAbb. 4: Trinity Library CambridgeArtikel Elisabeth Klecker: Der Bibliothekar als Freund des (künftigen) PolitikersAbb. 1-5: WienbibliothekAbb. 8: Universitätsbibliothek Wien133biblos 64 | <strong>2015</strong> | 1 | Abbildungsnachweis | 131
www.onb.ac.at/biblosISSN 0006-20222ISBN 978-3-85161-131-1