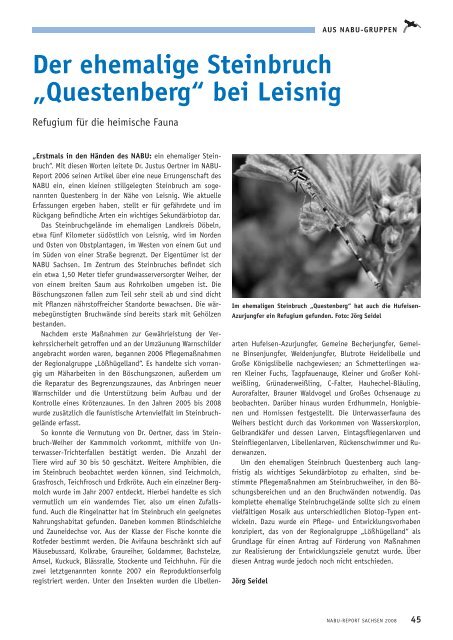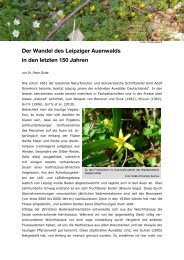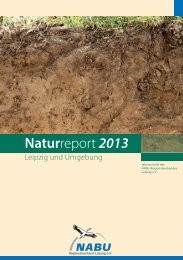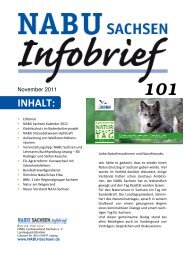Download als PDF - NABU Sachsen
Download als PDF - NABU Sachsen
Download als PDF - NABU Sachsen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der ehemalige Steinbruch<br />
„Questenberg“ bei Leisnig<br />
Refugium für die heimische Fauna<br />
„Erstm<strong>als</strong> in den Händen des <strong>NABU</strong>: ein ehemaliger Steinbruch“.<br />
Mit diesen Worten leitete Dr. Justus Oertner im <strong>NABU</strong>-<br />
Report 2006 seinen Artikel über eine neue Errungenschaft des<br />
<strong>NABU</strong> ein, einen kleinen stillgelegten Steinbruch am sogenannten<br />
Questenberg in der Nähe von Leisnig. Wie aktuelle<br />
Erfassungen ergeben haben, stellt er für gefährdete und im<br />
Rückgang befindliche Arten ein wichtiges Sekundärbiotop dar.<br />
Das Steinbruchgelände im ehemaligen Landkreis Döbeln,<br />
etwa fünf Kilometer südöstlich von Leisnig, wird im Norden<br />
und Osten von Obstplantagen, im Westen von einem Gut und<br />
im Süden von einer Straße begrenzt. Der Eigentümer ist der<br />
<strong>NABU</strong> <strong>Sachsen</strong>. Im Zentrum des Steinbruches befindet sich<br />
ein etwa 1,50 Meter tiefer grundwasserversorgter Weiher, der<br />
von einem breiten Saum aus Rohrkolben umgeben ist. Die<br />
Böschungszonen fallen zum Teil sehr steil ab und sind dicht<br />
mit Pflanzen nährstoffreicher Standorte bewachsen. Die wärmebegünstigten<br />
Bruchwände sind bereits stark mit Gehölzen<br />
bestanden.<br />
Nachdem erste Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br />
getroffen und an der Umzäunung Warnschilder<br />
angebracht worden waren, begannen 2006 Pflegemaßnahmen<br />
der Regionalgruppe „Lößhügelland“. Es handelte sich vorrangig<br />
um Mäharbeiten in den Böschungszonen, außerdem um<br />
die Reparatur des Begrenzungszaunes, das Anbringen neuer<br />
Warnschilder und die Unterstützung beim Aufbau und der<br />
Kontrolle eines Krötenzaunes. In den Jahren 2005 bis 2008<br />
wurde zusätzlich die faunistische Artenvielfalt im Steinbruchgelände<br />
erfasst.<br />
So konnte die Vermutung von Dr. Oertner, dass im Steinbruch-Weiher<br />
der Kammmolch vorkommt, mithilfe von Unterwasser-Trichterfallen<br />
bestätigt werden. Die Anzahl der<br />
Tiere wird auf 30 bis 50 geschätzt. Weitere Amphibien, die<br />
im Steinbruch beobachtet werden können, sind Teichmolch,<br />
Grasfrosch, Teichfrosch und Erdkröte. Auch ein einzelner Bergmolch<br />
wurde im Jahr 2007 entdeckt. Hierbei handelte es sich<br />
vermutlich um ein wanderndes Tier, <strong>als</strong>o um einen Zufallsfund.<br />
Auch die Ringelnatter hat im Steinbruch ein geeignetes<br />
Nahrungshabitat gefunden. Daneben kommen Blindschleiche<br />
und Zauneidechse vor. Aus der Klasse der Fische konnte die<br />
Rotfeder bestimmt werden. Die Avifauna beschränkt sich auf<br />
Mäusebussard, Kolkrabe, Graureiher, Goldammer, Bachstelze,<br />
Amsel, Kuckuck, Blässralle, Stockente und Teichhuhn. Für die<br />
zwei letztgenannten konnte 2007 ein Reproduktionserfolg<br />
registriert werden. Unter den Insekten wurden die Libellen-<br />
arten Hufeisen-Azurjungfer, Gemeine Becherjungfer, Gemeine<br />
Binsenjungfer, Weidenjungfer, Blutrote Heidelibelle und<br />
Große Königslibelle nachgewiesen; an Schmetterlingen waren<br />
Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, Kleiner und Großer Kohlweißling,<br />
Grünaderweißling, C-Falter, Hauhechel-Bläuling,<br />
Aurorafalter, Brauner Waldvogel und Großes Ochsenauge zu<br />
beobachten. Darüber hinaus wurden Erdhummeln, Honigbienen<br />
und Hornissen festgestellt. Die Unterwasserfauna des<br />
Weihers besticht durch das Vorkommen von Wasserskorpion,<br />
Gelbrandkäfer und dessen Larven, Eintagsfliegenlarven und<br />
Steinfliegenlarven, Libellenlarven, Rückenschwimmer und Ruderwanzen.<br />
Um den ehemaligen Steinbruch Questenberg auch langfristig<br />
<strong>als</strong> wichtiges Sekundärbiotop zu erhalten, sind bestimmte<br />
Pflegemaßnahmen am Steinbruchweiher, in den Böschungsbereichen<br />
und an den Bruchwänden notwendig. Das<br />
komplette ehemalige Steinbruchgelände sollte sich zu einem<br />
vielfältigen Mosaik aus unterschiedlichen Biotop-Typen entwickeln.<br />
Dazu wurde ein Pflege- und Entwicklungsvorhaben<br />
konzipiert, das von der Regionalgruppe „Lößhügelland“ <strong>als</strong><br />
Grundlage für einen Antrag auf Förderung von Maßnahmen<br />
zur Realisierung der Entwicklungsziele genutzt wurde. Über<br />
diesen Antrag wurde jedoch noch nicht entschieden.<br />
Jörg Seidel<br />
AUS <strong>NABU</strong>-GRUPPEN<br />
Im ehemaligen Steinbruch „Questenberg“ hat auch die Hufeisen-<br />
Azurjungfer ein Refugium gefunden. Foto: Jörg Seidel<br />
<strong>NABU</strong>-REPORT SACHSEN 2008<br />
45