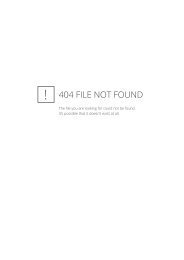QUALITAS 02/2023
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
€ 13,–<br />
AUSGABE <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>3<br />
ZEITSCHRIFT FÜR QUALITÄT UND ENTWICKLUNG IN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN<br />
www.gesundheitswirtschaft.at<br />
Kein<br />
Spiel<br />
GESTALTUNG<br />
Führungskonzept Seite 6<br />
VERNETZUNG<br />
Altenpflege Seite 38<br />
AKKREDITIERUNG<br />
Rückführbare Diagnostik Seite 40<br />
In Zusammenarbeit mit: AIHTA – Austrian Institute for Health Technology Assessment GmbH | Albert Schweitzer Institut für Geriatrie und Gerontologie |<br />
ARGE PatientenanwältInnen | AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | ÄZQ – Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin | Barmherzige Brüder Österreich |<br />
Cochrane Österreich | Deutsches Netzwerk Gesundheitskompetenz | ebm-netzwerk.at | Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz | JOANNEUM RESEARCH<br />
HEALTH | Kepler Universitätsklinikum | Krankenhaus der Elisabethinen Graz | LKH Villach | NÖ Landesgesundheitsagentur | Plattform Patient:innensicherheit |<br />
samedi | SANICADEMIA – Internationale Fortbildungsakademie für Gesundheitsberufe | Thieme Compliance | Universität für Weiterbildung Krems – Department für<br />
Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie | Verein zur Förderung der Qualität in der Betreuung älterer Menschen | Weitmoser Kreis |<br />
MZ 21Z042322 M | Österreichische Post AG: A-8041 Graz, Kasernstraße 80/8/25 |<br />
www.gesundheitswirtschaft.at | ISSN 2224-0055
AUSGABE <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>3/22.JG<br />
Inhalt<br />
EDITORIAL 3<br />
LEITARTIKEL 4<br />
Die Geschichte von Anbese<br />
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT 6<br />
Das Führungskonzept: Der Schlüssel für<br />
nachhaltiges Wertemanangement<br />
DIGITALISIERUNG 18<br />
Das digitale Unterschriftencockpit –<br />
Digitalisierung neu gedacht<br />
PLATTFORM<br />
PATIENT:INNENSICHERHEIT 19<br />
Sicherheit. Für Patient:innen.<br />
Mit Patient:innen.<br />
FÜHRUNG VERSTEHEN 23<br />
Metakognition<br />
DNGK 32<br />
Gesundheitskompetenzforschung<br />
mit Blick auf die professionelle Pflege<br />
SAMEDI 35<br />
Mit E-Health interdisziplinär erfolgreich<br />
NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR 37<br />
Sichere Patientenidentifikation<br />
an der Schnittstelle PBZ und<br />
Klinikum Niederösterreich (NÖ) – Teil II<br />
GGZ 38<br />
Das Grazer Gesundheitsmodell –<br />
Vernetzungsangebote der Geriatrischen<br />
Gesundheitszentren der Stadt Graz<br />
AKKREDITIERUNG 40<br />
Rückführbare Diagnostik = Qualität<br />
COCHRANE 46<br />
Fehl- und Überversorgung in der<br />
Gesundheits- und Krankenpflege?<br />
BÜCHER 20<br />
NEUES 24<br />
IMPRESSUM 24<br />
SELTEN SO GEDACHT 44<br />
AIHTA 36<br />
Früherkennung und Versorgung<br />
peripartaler psychischer Erkrankungen<br />
in Österreich<br />
Streckenbilder dieser Ausgabe:<br />
R. Schaffler<br />
2 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
EDITORIAL<br />
Foto: M. Schaffler<br />
Kein Spiel<br />
Krisen, kritische Lagen im ganzen Land und Krieg ganz in der Nähe. Podiumsdiskussionen,<br />
Leitartikel und Kommentare, die allen Ernstes mit Überschriften nach<br />
der Art „Wie krank ist unser Gesundheitswesen wirklich?“ versehen daherkommen.<br />
Und dazwischen Organisationsprojekte, Arbeitsgruppen, QM-Team-Meetings,<br />
Strategieworkshops, Budgetplanungen, Bauprojekte, CIRS-Treffen, Innerbetriebliches<br />
Vorschlagswesen und Digitalisierungsaktivitäten.<br />
Aus der Zeit und aus den Zusammenhängen gefallen kommt man sich als Health<br />
Professional auf allen Ebenen nun manchmal oder öfter vor. Zum einen die gruselgrauen<br />
Medienberichte auf allen Kanälen zum Ende der Welt und auf der anderen<br />
Seite die tägliche Routine. Die ist ja noch unterzubringen, die meldet sich ja selbst<br />
und fordert einen. Der täglichen Lebenspraxis kommt man nicht aus …<br />
Was mich aber sehr verwundert, ist, dass in diesem Demotivationsnieselregen, der<br />
die zunehmend versiegelten Böden benetzt, einige – ja viele – Aktivisten in ihren<br />
eigenen Herzensangelegenheiten der Veränderung und stetigen Verbesserung –<br />
seien es QM, RM, EbM, Public Health, Vernetzung und Integration der Versorgung,<br />
Führung, interne Kommunikation und Digitalisierung, Organisationsentwicklung<br />
und Patientenorientierung u.v.m. – unbeirrt weitermachen.<br />
Gäbe es fürwahr nicht genügend akzeptable Erklärungen, Treffen, Arbeitspläne<br />
oder Aufgaben in diesen Zeiten auf Notbetrieb herunterzufahren!? Respekt vor allen,<br />
die das Erreichte in jeder Gesundheitseinrichtung nicht durch Aussetzen aufs<br />
Spiel setzen. Verneigung vor den mit Verve weiter getragenen und entwickelten<br />
Errungenschaften – in Struktur, Prozess und Ergebnis.<br />
Was derzeit rund um unser Gesundheitswesen passiert, ist kein Spiel. In dieser Situation<br />
die Freude, das Interesse und die Motivation, dran zu bleiben, zu bewahren,<br />
ist auch kein Spiel. Danke fürs Herzblut und Danke fürs Hirnschmalz.<br />
Ihr Roland Schaffler<br />
Chefredakteur<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
3
LEITARTIKEL<br />
Anbese<br />
Manche Menschen …<br />
… spüren den Regen.<br />
Andere werden einfach<br />
nur nass.<br />
Anbese ist 19 Jahre alt<br />
und stammt aus Äthiopien.<br />
Er lebt dort in einem<br />
Waisen haus. Er litt an einer<br />
schweren Skoliose.<br />
Stefan Schenk<br />
Fotos: Ina Aydogan<br />
Roger Dean Miller, 1936 –1992.<br />
Z<br />
unächst kannte ich ja nur ein<br />
Photo von seinem Rücken und<br />
ein halbes Röntgenbild. Es ist<br />
dem Engagement einer gemeinnützigen<br />
Organisation und im Besonderen Frau Ulrike<br />
Kientzl zu verdanken, dass ihm eine<br />
Behandlung in Österreich im Orthopädischen<br />
Spital Speising ermöglicht wurde.<br />
Eine derart schwere Skoliose verlangt<br />
nach einem außergewöhnlichen Konzept.<br />
Nur Monate davor hatten aktuelle Berichte<br />
in der internationalen Literatur mein Interesse<br />
geweckt: Alte Strategien werden mit<br />
moderner Technik kombiniert und lieferten<br />
solide, komplikationsarme Resultate. Kontaktaufnahme<br />
mit Ferran Pellisé in Barcelona,<br />
Recherche bei Ralf Stücker in Hamburg<br />
waren hilfreich bei der Konstruktion<br />
der entsprechenden technischen Hilfsmittel<br />
und gaben Sicherheit in der Erstellung<br />
des Behandlungsplanes.<br />
Halo-Traktion<br />
vor der Operation<br />
Wir haben sorgfältig abgewogen, ob wir<br />
in dieser schwierigen sozialen Situation<br />
eine Operation anbieten sollen. Das Risiko<br />
einer Komplikation schien bei dieser extremen<br />
Krümmung hoch. Dann folgte der<br />
erste Kontakt. Die Skoliose war eindrucksvoll:<br />
124° Hauptkrümmung und 110° Kyphose<br />
(Brust-Buckel).<br />
Ebenso beeindruckt hat mich die Persönlichkeit<br />
des jungen Mannes, seine Demut<br />
gegenüber der Erkrankung und seine Zuversicht.<br />
Die präoperative Halo-Traktion ist eigentlich<br />
eine alte Technik. In den Anfängen der<br />
Skoliosechirurgie standen noch nicht so<br />
kräftige und raffinierte Verankerungsmöglichkeiten<br />
an den Wirbeln zur Verfügung,<br />
wie sie aktuelle Schrauben-, Haken-, und<br />
Bandsysteme heute bieten können. Daher<br />
konnte die korrigierende Kraft während der<br />
Operation nicht so unmittelbar eingesetzt<br />
werden. Bei der Halo-Traktion nützt man<br />
Schwerkraft und Zeit: Der Patient wird an<br />
einem Ring (Halo), der am Schädel montiert<br />
wird, in die Länge gezogen. Über einen<br />
Zeitraum von einigen Wochen wird tagsüber<br />
im Rollstuhl oder Gehgestell, nachts<br />
im schräggestellten Bett mit steigenden<br />
4 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
LEITARTIKEL<br />
Ausgangssituation<br />
124° Skoliose, 110° Kyphose<br />
Nach drei Wochen Traktion konnte wie geplant<br />
eine Korrektur von ca. 1/3 erreicht<br />
werden: Skoliose 80°. Von dem postoperativen<br />
Ergebnis waren wir begeistert: Nur<br />
27° Restskoliose und normales Profil von<br />
der Seite gesehen, Körpergröße + 14 cm.<br />
Gewichten eine langsame Verringerung der<br />
Krümmung erreicht. Die folgende Operation<br />
wird dadurch handwerklich einfacher.<br />
Der zweite große Vorteil ist das deutlich reduzierte<br />
Risiko einer Querschnittslähmung<br />
während der OP, da sich das Rückenmark<br />
langsam an die Streckung gewöhnen<br />
kann. Die Kombination der „alten“ Halo-<br />
Traktion mit modernen Materialien ermöglicht<br />
erstaunliche Ergebnisse. Sie eignet<br />
sich für sehr schwere Fälle von Skoliose,<br />
insbesondere wenn gleichzeitig eine Kyphose<br />
(Buckel) vorliegt.<br />
Die schwere erste Woche nach der OP<br />
hatte Anbese gut überstanden. Nun<br />
musste ein weiterer wesentlicher Schritt<br />
folgen: Die veränderte Form muss vom<br />
Körper angenommen werden und in sein<br />
Schema und die Selbstwahrnehmung<br />
eingebaut werden. Dies gelingt mit Hilfe<br />
der Physiotherapie, setzt jedoch Schweiß<br />
und Disziplin des Patienten voraus. Mein<br />
Dank gilt dem gesamten Skoliose-Team:<br />
Anästhesie, Pflege, Physio- und Ergotherapie<br />
bis hin zur Administration. Alle haben<br />
ihren Anteil an diesem außergewöhnlichen<br />
Ergebnis.<br />
Mittlerweile ist Anbese wieder nach Äthiopien<br />
zurückgekehrt. Ich habe Nachricht<br />
erhalten, dass es ihm gut geht.<br />
Dr. Stefan Schenk<br />
Facharzt für Orthopädie<br />
www.drstefanschenk.at<br />
Die Zeit der Halo-Traktion hat Anbese<br />
mit großer Geduld ertragen. In dieser Zeit<br />
durfte er sogar die spitalseigene Schule<br />
besuchen und erste Deutschkenntnisse<br />
erwerben.<br />
Die Streckung hat, ganz wie geplant, die<br />
Krümmung deutlich reduziert. Dennoch<br />
mussten wir während der folgenden Operation<br />
alles aufbieten, was medizinisch,<br />
technisch und handwerklich zur Verfügung<br />
steht. Ideale anästhesiologische Betreuung,<br />
Neuromonitoring und reibungslose<br />
Teamarbeit sind Voraussetzung für einen<br />
Erfolg.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
5
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
Das Führungskonzept:<br />
Der Schlüssel für nachhaltiges<br />
Wertemanagement.<br />
Der auf den Krankenhäusern lastende Druck bringt es mit sich, dass patientenbezogene<br />
Entscheidungen nicht nur durch die Bedürfnisse der Patienten, sondern auch durch die<br />
Bestandssicherungs-Interessen der Krankenhäuser geleitet werden. Die Krankenhaus-<br />
Mitarbeiter bedürfen deshalb der Unterstützung durch die organisationsethische Gestaltung<br />
der Organisation des Krankenhauses. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Konfigurierung<br />
des Führungskonzepts. Es liegt deshalb nahe, zunächst das Führungskonzept zu<br />
implementieren, bevor alle anderen Gestaltungs-Entscheidungen gefällt werden.<br />
Heinz Naegler<br />
1. Begründung des Themas<br />
Die Ergebnisse der Entscheidungen auf der Makro-Ebene, die<br />
unter anderem die finanziellen Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems<br />
prägen, sowie die Ergebnisse der Entscheidungen,<br />
die auf der Meso-Ebene im Zusammenhang mit der<br />
Umsetzung der Makro-Ebenen-Entscheidungen und der Gestaltung<br />
der Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems<br />
(Krankenhaus-Leitbild, Zielsetzung, Planung u.a.) durch die verschiedenen<br />
Instanzen des Krankenhaus-Leitungssystems gefällt<br />
werden, ragen weit in das klinische Kerngeschäft des Krankenhauses<br />
hinein 1 (siehe Abbildung 1); sie beeinflussen die Bedingungen<br />
und damit die Ergebnisse sowie die Qualität ärztlichen,<br />
pflegerischen und therapeutischen Handelns. Interessen, die<br />
von Instanzen auf der Makro- und auf der Meso-Ebene vertreten<br />
werden – einige von diesen wohl begründet –, reiben sich<br />
mit den Bedürfnissen der Patienten, für deren Befriedigung sich<br />
Ärzte, Pflegefachkräfte sowie Therapeuten auf der Mikro-Ebene<br />
einsetzen.<br />
Die finanziellen Rahmenbedingungen werden sich – zumindest<br />
in absehbarer Zeit – voraussichtlich nicht zum Besseren ändern.<br />
Die Verantwortlichen in den Krankenhäusern müssen sich deshalb<br />
fragen, wie sie mit diesem Druck angemessen umgehen<br />
wollen, um Nachteile für Patienten und Mitarbeitende nicht entstehen<br />
zu lassen. Sie müssen sich überlegen, wie sie die auf der<br />
Ebene des Krankenhaus-Leitungssystems fraglos vorhandenen<br />
Handlungsspielräume – trotz aller Einschränkungen 2 – nutzen<br />
wollen, um das skizzierte Problem lösen zu können.<br />
Wegen des erheblichen Druckes durch die finanziellen Rahmenbedingungen<br />
benötigen die für die Behandlung der Patienten<br />
verantwortlichen Akteure zusätzlich der organisationsethischen<br />
Unterstützung 3 . Es bedarf einer Institution, die das Handeln der<br />
Organisation Krankenhaus anhand ethischer Maßstäbe evaluiert<br />
4 . Es gilt, Mechanismen zu entwickeln und deren Anwendung<br />
zu sichern, damit bei den Entscheidungen auf der Meso-Ebene<br />
bedacht wird, welche Folgen diese auf den Handlungsspielraum<br />
der für die Patienten-Behandlung verantwortlichen Akteure und<br />
damit auf die Qualität der Behandlung 5 sowie auf die Nutzung<br />
der knappen Ressourcen haben. Die Organisationsethik regt<br />
an zu prüfen, ob die Bedingungen für die klinische Arbeit, ob<br />
die Strukturen und Prozesse des Krankenhauses so konfiguriert<br />
sind, wie die klinisch tätigen Akteure sie angesichts der zu verfolgenden<br />
Krankenhaus-Ziele und der notwendigen Umsetzung der<br />
für das Krankenhaus relevanten Werte benötigen. Sie verweist<br />
auf die Verantwortung der für die Gestaltung jener Bedingungen<br />
zuständigen Gremien bzw. Personen, die es den klinisch tätigen<br />
Akteuren ermöglichen, medizin- und pflegeethisch vertretbar zu<br />
entscheiden und zu handeln 6 .<br />
Es gilt, eine Organisation zu entwickeln, die ihrer – institutionell<br />
begriffenen – Verantwortung gegenüber den Patienten (und Mit-<br />
6 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
u.a. defizitäre<br />
Investitions-Finanzierung<br />
GESELLSCHAFTLICHE EBENE<br />
Gesetzliche<br />
u.a. Normen<br />
KRANKENHAUS-LEITUNGSSYSTEM<br />
Zielsetzung<br />
Planung<br />
Krankenhaus-<br />
Leitbild<br />
Führung<br />
KLINISCHER<br />
BEREICH<br />
Organisation<br />
Realisation<br />
Repräsentation<br />
Kontrolle<br />
Rendite-Erwartungen<br />
der Krankenhaus-Eigentümer<br />
Abb. 1: Der Einfluss der Makro- und der Meso-Ebenen-Entscheidungen auf die Bedingungen klinischer Arbeit 1a<br />
(mit freundlicher Genehmigung von Springer Nature)<br />
arbeitenden) nachkommen kann, für die nicht nur die Beziehung<br />
zwischen den Patienten und den diese behandelnden Akteuren,<br />
sondern auch die Beziehung zwischen den Patienten und der Institution<br />
Krankenhaus eine auf gegenseitigem Vertrauen gegründete<br />
Sorgebeziehung ist, in der das Bedachtsein auf das Wohl<br />
der Patienten eine zentrale Rolle spielt 7 .<br />
Die Bedingungen klinischer Arbeit werden durch die Entscheidungen<br />
im Zusammenhang mit allen Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems<br />
geprägt. So wird durch die Gestaltung<br />
der Teilfunktion „Planung“ festgelegt, wer mit welchen Befugnissen<br />
an den jährlichen Leistungs- und Ressourcenplanungen beteiligt<br />
wird – Geschäftsführer allein (Top-Down-Verfahren) oder<br />
Geschäftsführer gemeinsam mit Leitenden Mitarbeitern (Gegenstromverfahren)<br />
– mit möglicherweise jeweils unterschiedlichen<br />
Ergebnissen, was den Umfang der jährlich zu erbringenden<br />
medizinischen und pflegerischen Leistungen und die dafür zur<br />
Verfügung gestellten Ressourcen anbelangt. Von zentraler Bedeutung<br />
ist aber die Teilfunktion „Führung“. Sie ist eine Art Querschnitts-Funktion:<br />
Im Zusammenhang mit der Gestaltung aller<br />
anderen Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems werden<br />
Führungs-Entscheidungen gefällt. Die Gestaltung der Teilfunktion<br />
„Führung“ beeinflusst somit die Gestaltungs-Entscheidungen<br />
in allen anderen Teilfunktionen (siehe Abbildung 2). Sie<br />
ist damit von zentraler Bedeutung für die Arbeitsbedingungen<br />
im klinischen Bereich sowie für die Behandlungs-, Service- und<br />
Betriebsführungsqualität und -effizienz.<br />
Es gilt, ein Führungskonzept zu konfigurieren, das dem Einfluss<br />
der Führungskräfte 8 auf die Gestaltung der Teilfunktionen des<br />
Krankenhaus-Leitungssystems gerecht wird und das die Führungskräfte<br />
bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben unterstützt.<br />
Die Inhalte dieses Führungskonzepts und wie dieses<br />
zweckmäßigerweise entwickelt wird, werden mit diesem Beitrag<br />
vor- und zur Diskussion gestellt.<br />
Krankenhaus-Leitbild<br />
Zielsetzung<br />
TEILFUNKTION FÜHRUNG<br />
Planung<br />
Organisation<br />
Realisation<br />
Kontrolle<br />
Abb. 2: Teilfunktion Führung als Querschnittsfunktion<br />
Repräsentation<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
7
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
2. Weitere Vorgehensweise<br />
Der vorliegende Beitrag argumentiert dafür, die Personalführung<br />
als Schlüssel zu akzeptieren für die organisationsethisch orientierte<br />
Gestaltung der Organisation und damit für die Gestaltung<br />
der Arbeitsbedingungen auf der Mikro-Ebene des Krankenhauses.<br />
Er untersucht – beispielhaft – den Prozess und das Ergebnis<br />
der Gestaltung einzelner Element der Teilfunktion „Führung“ (Abschnitt<br />
4.). Dabei werden Antworten vor allem auf folgende Fragen<br />
gesucht:<br />
■ Welche für die Personalführung spezifischen, diese werden<br />
später als Grundpostulate 9 bezeichnet, sollten zusätzlich zu<br />
den für die Institution Krankenhaus relevanten Werte bei der<br />
Gestaltung des Führungskonzepts berücksichtigt werden?<br />
(Abschnitt 4.2.)<br />
■ Welche sollten die Inhalte zweier der ausgewählten Elemente<br />
des Führungskonzepts sein? (Abschnitt 4.3.)<br />
■ Welchen Einfluss hat die Gestaltung der Teilfunktion „Führung“<br />
auf die Gestaltung der anderen Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems?<br />
(Abschnitt 4.4.)<br />
■ Zunächst aber wird danach gefragt, wie der Prozess der Gestaltungs-Entscheidungen<br />
organisiert sein sollte. (Abschnitt 3.3.)<br />
Offen bleiben muss vorliegend die Charakterisierung jener Entscheidungen,<br />
die im Zusammenhang mit der Gestaltung der anderen<br />
Teilfunktionen gefällt werden 10 .<br />
3. Die Entscheidungssituation<br />
der Krankenhaus-Akteure<br />
3.1. Ein Überblick<br />
Auf der Makro-Ebene des Gesundheitssystems werden Entscheidungen<br />
gefällt, die den Handlungsspielraum der im klinischen<br />
Bereich handelnden Akteure für das Fällen patientenbezogener<br />
Entscheidungen auf der Mikro-Ebene überwiegend<br />
mittelbar beeinflussen (siehe 2 in Abbildung 3). Zu den Ergebnissen<br />
dieser Makro-Ebenen-Entscheidungen zählt unter anderem<br />
das Ausmaß der Fördermittel, die in den Haushaltsplänen<br />
der Bundesländer für die Finanzierung der von den Krankenhäusern<br />
geplanten Investitionen vorgesehen sind. Ergebnisse der<br />
Makro-Ebenen-Entscheidungen sind auch die in dem aktuellen<br />
Fallpauschalen-Katalog für die verschiedenen Diagnosen ausgewiesenen<br />
Bewertungsrelationen; diese legen zusammen mit<br />
dem aktuellen Landesbasisfallwert die Kosten fest, die für das<br />
von einem Krankenhaus geplante Leistungsprogramm maximal<br />
verursacht werden dürfen.<br />
Die Ergebnisse dieser Art von Entscheidungen werden für Ärzte,<br />
Pflegefachkräfte u.a. in der Regel erst dann wirksam, wenn sie<br />
auf der Meso-Ebene durch die dafür zuständigen Instanzen des<br />
Krankenhauses umgesetzt worden sind. Die Ergebnisse dieser<br />
Art von Meso-Ebenen-Entscheidungen sind unter anderem die in<br />
den Wirtschaftsplänen und Abteilungsbudgets der Krankenhäuser<br />
ausgewiesenen Leistungs- und Ressourcenpläne und damit<br />
zentrale Dimensionen der Arbeitsbedingungen für den klinischen<br />
Bereich.<br />
Auf der Makro-Ebene werden zudem Entscheidungen gefällt, deren<br />
Ergebnisse die Arbeitsbedingungen der im klinischen Bereich<br />
tätigen Akteure unmittelbar beeinflussen (siehe 1 in Abbildung<br />
3). Dazu zählt zum Beispiel die (Muster-)Berufsordnung für die<br />
in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte; diese verlangt von<br />
Ärztinnen und Ärzten ein bestimmtes Verhalten gegenüber den<br />
Patientinnen und Patienten, den Kolleginnen und Kollegen, anderen<br />
Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen sowie in der<br />
Öffentlichkeit 11 .<br />
Auf der Meso-Ebene werden drei Arten von Entscheidungen gefällt,<br />
die den Spielraum des Handelns im klinischen Bereich beeinflussen:<br />
■ Von zentraler Bedeutung im Sinne organisationsethischer Arbeit<br />
ist die Identifizierung der für das Krankenhaus relevanten<br />
Werte und deren Festlegung in dem Krankenhaus-Leitbild. Diese<br />
sollen zum einen für das Verhalten der handelnden Akteure<br />
gegenüber den Patienten, der Umwelt des Krankenhauses und<br />
untereinander bestimmend sein (siehe 3 in Abbildung 3); sie<br />
sollen zum anderen als Entscheidungs-Kriterien berücksichtigt<br />
werden, wenn als Ergebnis diverser Gestaltungs-Entscheidungen<br />
die Strukturen und die Prozesse des Krankenhauses und<br />
damit auch die Arbeitsbedingungen für die klinisch tätigen Akteure<br />
gestaltet werden (siehe 4 in Abbildung 3).<br />
■ Um gewährleisten zu können, dass die Werte des Krankenhaus-Leitbildes<br />
umgesetzt werden (können), gibt das Krankenhaus-Management<br />
die dafür geeigneten und für die Teilfunktionen<br />
jeweils spezifischen Strukturen und Prozesse vor (siehe 4<br />
in Abbildung 3). Für die Teilfunktion „Führung“ sind das unter<br />
anderem die Struktur der Leitung und der Führungsstil.<br />
■ Ihren Beitrag zur Umsetzung der im Krankenhaus-Leitbild<br />
ausgewiesenen Werte leisten die Führungskräfte, indem sie<br />
die durch das Krankenhausmanagement festgelegten Werte<br />
und die durch die Gestaltungs-Entscheidungen gesetzten<br />
Normen bei ihrem Umgang mit ihren Mitarbeitenden berücksichtigen<br />
(siehe 5 in Abbildung 3). Indem sie zum Beispiel ein<br />
auf gegenseitigem Vertrauen basiertes Klima schaffen und ihre<br />
Mitarbeitenden so fördern, dass diese die ihnen zugewiesenen<br />
Entscheidungsbefugnisse, die Behandlung der Patienten zum<br />
Beispiel betreffend, selbständig wahrnehmen können (siehe 6<br />
in Abbildung 3).<br />
Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten fällen patientenbezogene<br />
Einzelfall-Entscheidungen auf der Mikro-Ebene. Sie orientieren<br />
8 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
Makro<br />
Meso<br />
STEUERUNGS-INSTRUMENTE<br />
■ Gesetzliche, finanzielle, technische usw. Normen<br />
■ Erwartungen des Krankenhaus-Eigentümers, eine angemessene<br />
Rendite betreffend<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
■ Festlegung der für das Krankenhaus<br />
relevanten Werte<br />
BEISPIELE<br />
■ Bundesländerspezifische Haushaltspläne mit Ausweis der<br />
für die Krankenhäuser vorgesehenen Fördermittel<br />
■ aG-DRG-Fallpauschalen-Katalog 2<strong>02</strong>3<br />
■ Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung –<br />
PpUGV vom 9. November 2<strong>02</strong>0<br />
■ medizinethische Prinzipien sowie Werte der Pflegeethik<br />
5<br />
6<br />
■ Gestaltung der Teilfunktionen des<br />
Krankenhaus-Leitungssystems durch<br />
Meta-Entscheidungen „Strukturen und<br />
Prozesse“<br />
■ Ausführungs-Entscheidungen beim Ausüben<br />
der Teilfunktionen des Krankenhaus-<br />
Leitungssystems, unter anderem bei der<br />
Personalführung<br />
■ dezentral geprägte Leitungsstruktur<br />
■ partizipative Führung<br />
■ Förderung eines vertrauensbasierten Klimas<br />
■ Förderung der Mitarbeiter<br />
■ Abschluss von Zielvereinbarungen<br />
Mikro ■ patientenbezogene Einzelfall-Entscheidung ■ Diagnostik, Therapieplanung, Pflegeplanung, Entlassplanung<br />
Abb. 3: Einflüsse Dritter auf die patientenbezogenen Einzelfall-Entscheidungen<br />
sich dabei an diversen Regelwerken – unter anderem an den Vorgaben<br />
des Krankenhaus-Leitbildes. Diese helfen ihnen, den Bedarf<br />
an medizinischen und pflegerischen Leistungen mit den begrenzt<br />
zur Verfügung stehenden Ressourcen ethisch und rechtlich<br />
vertretbar und ökonomisch sinnvoll zu decken 12 .<br />
3.2. Entscheidungen auf der Meso-Ebene<br />
Auf der Meso-Ebene werden die Entscheidungen gefällt, die das<br />
Wertesystem des Krankenhauses und die übrigen Dimensionen<br />
der Bedingungen klinischer Arbeit prägen – soweit diese nicht<br />
durch die auf der Makro-Ebene festgelegten Normen konfiguriert<br />
werden. Es werden Vorkehrungen getroffen, mit deren Hilfe<br />
sichergestellt werden kann, dass die für das Krankenhaus relevanten<br />
Werte im Krankenhaus-Alltag wirksam werden können.<br />
Dabei handelt es sich notwendigerweise um Entscheidungen in<br />
Bezug auf alle Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems.<br />
Nachstehend werden indessen nur – es wurde schon darauf hingewiesen<br />
– die führungskonzeptrelevanten Entscheidungen thematisiert.<br />
Krankenhaus-Leitbild<br />
Eine der ersten Aufgaben der für das Krankenhaus verantwortlichen<br />
besteht darin, die Werte zu identifizieren und festzulegen,<br />
die zum einen das Handeln der Krankenhaus-Akteure, deren<br />
Umgang mit Patienten, mit dem Krankenhaus-Umfeld und miteinander<br />
leiten. Sie sollen den im klinischen Bereich tätigen Ärzten,<br />
Pflegefachkräften sowie Therapeuten Orientierung geben<br />
für das Abwägen medizinisch- und pflegerisch-fachlicher sowie<br />
wirtschaftlicher Notwendigkeiten bei ihren Entscheidungen und<br />
Handlungen im Einzelfall. Die für das Krankenhaus relevanten<br />
Werte dienen zudem – im Sinne organisationsethischer Arbeit –<br />
als Kriterien für das Fällen jener Gestaltungs-Entscheidungen, mit<br />
deren Ergebnis die Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems<br />
und damit die Arbeitsbedingungen der Krankenhaus-Akteure<br />
gestaltet werden 13 .<br />
Zu diesen Normen sollten unter anderem die Mission des Krankenhauses,<br />
dessen institutioneller Sinn als Teil der Daseinsvorsorge<br />
zählen sowie die vier Prinzipien der biomedizinischen Ethik 14 ,<br />
die pflegeethischen Pflichten und Werte in der pflegerischen Versorgung<br />
15 , kostensensible Leitlinien 16 , Klug-Entscheiden-Empfehlungen<br />
der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin 17 und<br />
Regeln für das Rationieren medizinischer Leistungen.<br />
Führung<br />
Mit der Entwicklung des krankenhausspezifischen Führungskonzepts<br />
werden die Rahmenbedingungen geschaffen für die Funktionstüchtigkeit<br />
des einer Führungskraft zugewiesenen Verantwortungsbereichs<br />
sowie für die Zusammenarbeit der weitgehend<br />
autonomen Organisationseinheiten des Krankenhauses 18 .<br />
Ob und inwieweit die für das Krankenhaus festgelegten Werte umgesetzt<br />
und die Unternehmensziele und die geplanten Größen erreicht<br />
werden, hängt auch von der Übereinstimmung ab zwischen<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
9
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
dem Verhalten, das von den Mitarbeitenden aufgrund ihrer Rolle<br />
erwartetet wird, und dem von diesen praktizierten Verhalten. Eine<br />
eventuell gegebene Diskrepanz soll durch spezifische Führungsleistungen<br />
des jeweiligen Vorgesetzten ausgeglichen werden 19 .<br />
Kontrolle<br />
Das Ergebnis der Tätigkeit der Mitarbeitenden des Krankenhauses<br />
wird durch einen Vergleich mit dem durch die Aufgabenerfüllung<br />
zu erreichenden Zustand kontrolliert. Bei sich abzeichnenden<br />
negativen Abweichungen wird durch steuernde Eingriffe in<br />
die Realisierung versucht, eine möglichst große Annäherung zwischen<br />
dem tatsächlich Erreichten und dem Ergebnis der Planung<br />
zu gewährleisten.<br />
Gegenstände der Kontrolle sind allerdings nicht nur die Ergebnisse<br />
medizinischer und pflegerischer sowie die der Tätigkeit anderer<br />
Berufsgruppen. Kontrolliert werden muss auch, ob die richtigen<br />
Vorkehrungen getroffen waren, damit die im klinischen Bereich<br />
tätigen Akteure das von ihnen erwartete Verhalten und die von<br />
ihnen erwarteten Leistungen realisieren können. Und es muss<br />
durch einschlägige Kontrollen sichergestellt werden, dass die für<br />
das Krankenhaus relevanten Werte umgesetzt werden und dass<br />
diese den Umgang der Krankenhaus-Akteure mit den Patienten<br />
sowie miteinander und mit der Umwelt des Krankenhauses auch<br />
angesichts des hohen auf den Krankenhäusern lastenden Drucks<br />
wirklich leiten 20 . Zu den Gegenständen der Kontrolle zählen deshalb<br />
alle Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems; aus<br />
Platzgründen wird hier eine Auswahl vorgestellt.<br />
■ Es wird kontrolliert, ob die für das Krankenhaus relevanten<br />
Werte bestimmt worden sind und ob das Krankenhausmanagement<br />
die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die<br />
Werte wirksam werden können. Es wird zudem geprüft, ob die<br />
in dem Krankenhaus-Leitbild verankerten Werte noch den allgemeinen<br />
gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen, die<br />
seit der Festlegung der Werte möglicherweise andere geworden<br />
sind. So hat sich zum Beispiel das Verhältnis von Arbeit zu<br />
Privatleben über Generationen hinweg verändert; die in dem<br />
bestehenden Krankenhaus-Leitbild als Wert verankerten Bedürfnisse<br />
der Krankenhaus-Mitarbeitenden sollten deshalb gegebenenfalls<br />
einer Revision unterzogen worden sein.<br />
■ Es wird überprüft, ob bei den im Zusammenhang mit der Gestaltung<br />
der Teilfunktionen zu fällenden Gestaltungs-Entscheidungen<br />
die für das Krankenhaus relevanten Werte berücksichtigt<br />
und ob – sofern Werte geändert – die einschlägigen<br />
Gestaltungs-Entscheidungen korrigiert worden sind. Weil –<br />
zum Beispiel – die Bedürfnisse der Krankenhaus-Mitarbeitende<br />
andere geworden sind, sollte das Führungskonzept des<br />
Krankenhauses gegebenenfalls entsprechend angepasst worden<br />
sein.<br />
■ Es wird untersucht, ob bei den diversen Ausführungs-Entscheidungen,<br />
die Leistungs- und die Ressourcenplanung zum<br />
Beispiel betreffend, die dafür maßgeblichen Werte berücksichtigt<br />
worden sind.<br />
■<br />
Das ist für den Leistungsplan als Bestandteil klinischer Abteilungsbudgets<br />
zum Beispiel das Grundpostulat der Planung<br />
„Bedarfsgerechtigkeit“ 21 . Dessen Berücksichtigung<br />
stellt sicher, dass nur jene medizinischen Leistungen in einen<br />
Leistungsplan eingestellt werden, für die es einen medizinisch<br />
begründeten Bedarf gibt. Damit wird gewährleistet,<br />
dass es in Folge der Realisierung des Leistungsplans nicht<br />
zur Überversorgung von Patienten kommt; es kann weitgehend<br />
ausgeschlossen werden, dass Patienten ohne medizinische<br />
Notwendigkeit in die stationäre Behandlung aufgenommen<br />
werden, nur weil ein Leistungsplan umgesetzt<br />
werden muss, bei dessen Erarbeitung das Grundpostulat<br />
„Bedarfsgerechtigkeit“ nicht berücksichtigt worden ist.<br />
■<br />
Für die Personalplanung ist neben anderen Normen die<br />
Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung bestimmend. Indem<br />
diese bei der Personalplanung zugrunde gelegt wird,<br />
kann gewährleistet werden, dass in pflegeintensiven Krankenhausbereichen<br />
eine ausreichend hohe Zahl von Pflegefachkräften<br />
zur Verfügung steht, deren Überlastung damit<br />
weitgehend vermieden wird.<br />
■ Zu den Aufgaben der Kontrolleure gehört es festzustellen, ob<br />
die diversen Gestaltungs- und Ausführungs-Entscheidungen<br />
die Ergebnisse argumentativer, dialogischer Verständigungen<br />
sind.<br />
■ Schließlich gehört es zu den Aufgaben der Controller zu prüfen,<br />
ob die Führungskräfte bei ihren Führungs-(=Ausführungs-)Entscheidungen<br />
die in dem Führungskonzept festgelegten Werte<br />
berücksichtigen. So wird – zum Beispiel – kontrolliert, ob<br />
der Leitende Arzt entsprechend den Vorgaben des Führungskonzepts<br />
einen eher partizipativen Führungsstil praktiziert.<br />
Damit soll – unter anderem – sichergestellt werden, dass die<br />
Ärzte trotz des auf den Krankenhäusern lastenden finanziellen<br />
Drucks Patienten vorrangig an deren Wohlergehen orientiert<br />
behandeln 22 .<br />
Die Realisierung der Kontrolle ist eine große Herausforderung methodischer<br />
Art. Bei den jeweils zu berücksichtigenden Normen<br />
handelt es sich vor allem um Verhaltens-Normen. Deren Erfüllen<br />
kann einerseits – sehr aufwendig – mithilfe sogenannter Verhaltensbeobachtungsskalen<br />
gemessen werden 23 . Als Alternative<br />
bietet es sich an, die Mitarbeitenden des Krankenhauses regelmäßig<br />
zu befragen, um unter anderem herausfinden zu können,<br />
wie sie die Wahrnehmung der Verantwortung des Krankenhauses<br />
gegenüber den Patienten und die Unterstützung durch ihren Vorgesetzten<br />
bewerten, ob die in dem Krankenhaus-Leitbild festgehaltenen<br />
Werte im Krankenhaus-Alltag umgesetzt werden und ob<br />
das Krankenhausmanagement die Mitarbeitenden bei der Umsetzung<br />
der Krankenhaus-Werte unterstützt 24 .*<br />
* Die Unternehmensgruppe Johnson & Johnson befragt im Abstand von zwei Jahren die<br />
etwa 120.000 Mitarbeiter, um unter anderem herauszufinden, ob sich die Einstellungen und<br />
Haltungen der Mitarbeiter zu dem Leitbild des Unternehmens (Credo genannt) möglicherweise<br />
geändert haben und wie gut diese die in dem Credo festgehaltenen Verantwortlichkeiten<br />
wahrnehmen und ob sie die notwendige personelle und strukturelle Unterstützung als<br />
Voraussetzung für die Wahrnehmung der Verantwortung erhalten (Naegler, 2011, S. 239 f.).<br />
10 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
3.3. Zur Vorgehensweise bei Gestaltungs-<br />
Entscheidungen<br />
Die Ergebnisse der einschlägigen Gestaltungs-Entscheidungen<br />
sollen Ergebnisse einer argumentativen, dialogischen Verständigung<br />
sein, an der in der Regel der Geschäftsführer, die Leitenden<br />
Ärzte, die Leitenden Pflegefachkräfte sowie Vertreter möglichst<br />
aller Berufsgruppen, Leistungsbereiche und Hierarchieebenen<br />
beteiligt sind. Auf diese Weise lernen die genannten Akteure, ihre<br />
jeweiligen Beiträge zur bestmöglichen Patientenbehandlung und<br />
zur Sicherung des Krankenhaus-Bestandes gegenseitig zu schätzen.<br />
Die von den genannten Akteuren verfolgten, unterschiedlichen<br />
und zum Teil miteinander konkurrierenden Interessen werden<br />
offengelegt und zum Ausgleich gebracht. Dabei geht es nicht<br />
nur um den Ausgleich zwischen den Interessen des Krankenhauses<br />
und denen der klinischen Fachabteilungen, sondern auch um<br />
den Ausgleich zwischen den konkurrierenden Interessen der klinischen<br />
Fachabteilungen untereinander.<br />
Nicht selten sind die erwähnten, an der argumentativen, dialogischen<br />
Verständigung beteiligten Akteure nicht hinreichend<br />
darauf vorbereitet. Das betrifft sowohl das Verständnis dafür,<br />
dass eine solche Verständigung überhaupt notwendig ist, als<br />
auch die Bereitschaft, sich daran beteiligen zu wollen, sowie die<br />
Fähigkeit für eine sachlich fundierte Diskussion. Die dafür Verantwortlichen<br />
kommen deshalb nicht umhin, in die Vorbereitung<br />
der Krankenhaus-Akteure für die Teilnahme an diesen Prozessen<br />
zu investieren.<br />
4. Das Führungskonzept<br />
4.1. Ziele der Personalführung<br />
Das Ziel der Personalführung ist es, die Rahmenbedingungen für<br />
die Funktionstüchtigkeit des einer Führungskraft zugewiesenen<br />
Verantwortungsbereichs sowie die Zusammenarbeit der weitgehend<br />
autonomen Organisationseinheiten des Krankenhauses 25 zu<br />
gewährleisten 26 . Das Ziel der Personalführung ist es, dazu beizutragen,<br />
dass die dem Krankenhaus gesetzten medizinischen und<br />
wirtschaftlichen Ziele realisiert werden. Das Ziel der Personalführung<br />
ist es zudem und vor allem, daran mitzuwirken, dass die<br />
Werte, denen sich das Krankenhaus verpflichtet hat, umgesetzt<br />
werden.<br />
Dazu bedürfen die Führungskräfte eines organisationsethisch<br />
ausgerichteten Führungskonzepts, eines Führungskonzepts also,<br />
dessen Konfiguration Personalführungs-(Einzelfall-)Entscheidungen<br />
im Sinne der weiter oben formulierten Personalführungs-Ziele<br />
unterstützt.<br />
4.2. Grundpostulate der Personalarbeit<br />
Die Bedingungen ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen<br />
Handelns werden in einem multipersonal und arbeitsteilig organisierten<br />
Krankenhaus durch Gestaltungs-Entscheidungen<br />
beeinflusst, die von einer Vielzahl von Gremien und/oder Personen<br />
gefällt werden. Nicht nur der Geschäftsführer, die Leitenden<br />
Ärzte und die Leitenden Pflegefachkräfte, sondern auch Vertreter<br />
anderer Berufsgruppen, medizinischer und nichtmedizinischer<br />
Leistungsbereiche und Hierarchieebenen verfolgen mit<br />
ihren Entscheidungen mitunter eigene und vielleicht auch miteinander<br />
konkurrierende Interessen. Hinzu kommt: Mit den im<br />
Zusammenhang mit der Gestaltung des Führungskonzepts zu<br />
fällenden Gestaltungs-Entscheidungen wird über die Verteilung<br />
von Macht und Verantwortung auf das Krankenhaus-Leitungssystem<br />
auf der einen Seite und die Gesundheitsversorgung auf<br />
der anderen sowie über das Maß an Eigenverantwortlichkeit und<br />
Selbst ständigkeit ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen<br />
Handelns entschieden.<br />
Um angesichts der damit skizzierten Komplexität der Organisation<br />
Krankenhaus die weiter oben charakterisierten Ziele der<br />
Personalarbeit erreichen zu können, bedarf es spezifischer Werte,<br />
die das Verhalten aller Akteure bei allen Personal-Entscheidungen,<br />
die diese auf der Meso-Ebene zu fällen haben, leiten.<br />
Die Entwicklung eines Führungskonzepts beginnt deshalb mit<br />
dem Identifizieren und der Festlegung der für das Krankenhaus<br />
relevanten Grundpostulate. In der Tabelle 1 sind einige Beispiele<br />
zusammengefasst 27 .<br />
Damit die Grundpostulate wirksam werden können, bedarf es<br />
deren Operationalisierung. Für jedes Grundpostulat sind Kriterien<br />
zu identifizieren, anhand derer die Qualität der Personalarbeit<br />
beurteilt werden kann. Beispielhaft sind in der Tabelle 2 für das<br />
Grundpostulat „Individualisierung“ jene Kriterien zusammengestellt<br />
28 .<br />
4.3. Gestaltung des Führungskonzepts<br />
4.3.1. Elemente des Führungskonzepts im Überblick<br />
Das Krankenhaus ist ein komplexes sozioökonomisches System,<br />
das multipersonal und arbeitsteilig organisiert ist. Angesichts dieser<br />
Struktur bedarf die Organisation Krankenhaus Regeln, deren<br />
Anwendung in diesem die zielgerichtete, die Hierarchieebenen,<br />
Leistungsbereiche und Berufsgruppen übergreifende Zusammenarbeit<br />
sichert. Diese Regeln sind die Bestandteile des Führungskonzepts,<br />
das üblicherweise aus folgenden Elementen besteht 29 :<br />
■ Führungsorganisation,<br />
■ Führungstechnik,<br />
■ Führungsstil,<br />
■ Führungsverhalten und<br />
■ Entwicklungs- und Lernperspektive.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
11
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
GRUNDPOSTULATE<br />
Patienten- und Mitarbeiterorientierung<br />
Erfolgs-/Qualitätsorientierung<br />
Flexibilisierung<br />
Individualisierung<br />
Sicherung der Akzeptanz<br />
Professionalisierung<br />
Nachhaltigkeit<br />
Stimmigkeit<br />
Begründungspflicht<br />
Berücksichtigung der Interessen<br />
der Personen und Instanzen, die von<br />
Personalführungs-Entscheidungen<br />
betroffen sind; Minimierung von<br />
Interessenkonflikten<br />
ERLÄUTERUNGEN<br />
Bei den im Zusammenhang mit der Personalführung zu fällenden Gestaltungs- und Ausführungs-Entscheidungen<br />
sollen die Erwartungen der Patienten berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter erwarten, dass das<br />
Wahrnehmen der ihnen übertragenen Aufgaben zufriedenstellend, zumutbar, erträglich und ausführbar ist<br />
und dass ihre Bedürfnisse nach Sicherheit, Wertschätzung, Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung berücksichtigt<br />
werden. Sie erwarten Chancengleichheit und Zugangsgerechtigkeit in Bezug auf den Zugang zu<br />
und auf die Teilnahme an jenen Gestaltungs-Entscheidungen, ihre Arbeitsbedingungen betreffend 1 .<br />
Die Teilfunktion Führung ist die Schlüsselfunktion für die ständige Verbesserung der Behandlungs-, Serviceund<br />
Betriebsführungsqualität und -effizienz. Sie soll dazu beitragen, dass der Bestand des Krankenhauses<br />
und damit das Angebot medizinischer Leistungen und qualifizierter Arbeitsplätze auf Dauer gewährleistet<br />
werden.<br />
Die Inanspruchnahme des Krankenhauses und die Bedingungen klinischer Arbeit ändern sich – mitunter<br />
kurzfristig. Die Personalarbeit soll dazu beitragen, dass die Krankenversorgung darauf eingestellt werden<br />
kann.<br />
Kollektive Regelungen sollen abgelöst werden durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen, mit denen die<br />
individuellen Bedürfnisse des/der Mitarbeiters/in berücksichtigt werden.<br />
Alle Elemente des Personalkonzepts müssen so gestaltet werden, dass die Personalarbeit von allen seinen<br />
Adressaten als Unterstützung akzeptiert werden kann.<br />
Erfolgreiche Personalarbeit im Sinne der in Kapitel 4.1 genannten Zielsetzung setzt voraus, dass die Führungskräfte<br />
die dafür erforderlichen Personalführungs-Fähigkeiten ständig aktualisieren und ausbauen.<br />
Angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verlangt es nach einer ressourcenschonenden Ausrichtung<br />
der Personalarbeit.<br />
Die im Zusammenhang mit der Teilfunktion Führung zu fällenden Gestaltungs-Entscheidungen sind eng<br />
abzustimmen mit den im Zusammenhang mit den übrigen Teilfunktionen zu fällenden Gestaltungs-Entscheidungen.<br />
Alle Elemente des Führungskonzepts müssen sich aus der Sicht derer, die von den im Zusammenhang mit<br />
der Personalführung zu fällenden Gestaltungs- und Ausführungs-Entscheidungen betroffen sind, mit guten<br />
Gründen rechtfertigen lassen.<br />
Die Vertreter der verschiedenen Hierarchieebenen, Berufsgruppen und Leistungsbereiche haben, bezogen auf<br />
die Personalführung, unterschiedliche Interessen. Im Rahmen der Entwicklung des Führungskonzepts sollen<br />
diese offengelegt werden. Es soll ein Führungskonzept entwickelt werden, das Interessenkonflikte bei der<br />
Umsetzung der Personalführung minimiert.<br />
Förderung der argumentativen,<br />
dialogischen Verständigung<br />
Förderung der Mündigkeit der<br />
Adressaten des Führungskonzepts<br />
Zwei Akteursgruppen bedürfen der Förderung: Diejenigen, die Gestaltungs- und/oder Ausführungs-Entscheidungen<br />
im Zusammenhang mit der Entwicklung bzw. der Umsetzung des Führungskonzepts fällen, müssen<br />
offen sein zum Dialog, zur argumentativen Auseinandersetzung mit den Adressaten des Führungskonzepts.<br />
Von Letzteren wird erwartet, dass sie imstande und bereit sind, ihre Anliegen sachgerecht zu präsentieren<br />
und zu begründen.<br />
Die Adressaten des Führungskonzepts müssen befähigt werden, auf der Basis einer kritischen Loyalität Aktivitäten<br />
des Krankenhauses infrage zu stellen und für richtig gehaltene Revisionen auch gegen Widerstand<br />
zur Geltung zu bringen.<br />
1 Brand, 2<strong>02</strong>1, S. 212<br />
Tab. 1: Grundpostulate der Personalarbeit<br />
12 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
KRITERIEN<br />
Vergütung<br />
Arbeitszeit<br />
Personalentwicklung<br />
Personalführung<br />
Personaleinsatz<br />
ERLÄUTERUNGEN<br />
Die Arbeitgeber machen zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch, Teile des Entgelts an die Verwirklichung<br />
vereinbarter Ziele zu knüpfen. Oder: Bereitschaftsdienste werden unter Berücksichtigung der Wünsche der<br />
Ärzte entweder durch Freizeitausgleich oder finanziell vergütet (siehe auch Beispiel in Kapitel 4.3.2.a).<br />
Die Arbeitszeit lässt sich unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten auf die Bedürfnisse der<br />
Mitarbeiter ausrichten.<br />
Anstelle standardisierter Laufbahnmodelle werden individuelle auf die spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnisse<br />
des Mitarbeiters ausgerichtet.<br />
Die Führungskraft bedenkt bei allen ihren Führungs-Entscheidungen die individuellen Bedürfnisse und Interessen<br />
des zu führenden Mitarbeiters und dessen individuelle Fähigkeiten.<br />
Die Mitarbeiter werden an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen beteiligt; sie können damit ihre spezifischen<br />
Bedürfnisse geltend machen. Sie werden so eingesetzt, dass die Wahrnehmung der ihnen übertragenen<br />
Aufgaben für sie auf Dauer zufriedenstellend, erträglich und ausführbar ist.<br />
Tab. 2: Kriterien des Grundpostulats Individualisierung (Beispiele)<br />
Führungskonzepte gibt es nicht von der Stange 30 . Führungskonzepte<br />
müssen von innen heraus, aufbauend vor allem auf dem<br />
der Personalführung im Krankenhaus zu Grunde liegenden Menschenbild<br />
und den für das Krankenhaus relevanten Werten und<br />
unter Berücksichtigung der für das Führungskonzept bestimmenden<br />
Ziele und Grundpostulate entwickelt werden. Der Entwicklungsprozess<br />
wird initiiert und getragen von dem Krankenhausmanagement<br />
in der obersten Leitungsebene.<br />
Aus Gründen des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes<br />
können hier nicht alle Elemente des Führungskonzepts vorgestellt<br />
werden. Im Fokus des hier präsentierten Textes stehen – wegen<br />
ihrer zentralen Bedeutung für die Gestaltung der anderen Teilfunktionen<br />
des Krankenhaus-Leitungssystems – die Führungsorganisation<br />
und der Führungsstil.<br />
4.3.2. Führungsorganisation<br />
Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Führungsorganisation<br />
sind zwei Gestaltungs-Entscheidungen zu fällen:<br />
a) Zentralisation versus Dezentralisation<br />
von Leitungsaufgaben<br />
Die Befugnis, Leitungsentscheidungen zu fällen und deren Ergebnis<br />
anderen zur Ausführung anzuweisen, und die damit im Zusammenhang<br />
stehenden Führungsaufgaben werden als Ergebnis<br />
einer einschlägigen Gestaltungs-Entscheidung entweder in einer<br />
Zentrale an der Spitze des Unternehmens zusammengefasst oder<br />
möglichst weitgehend den unteren Leitungsebenen zugeordnet.<br />
Die Zentralisierung der Leitungsaufgaben fördert – so wird geschlussfolgert<br />
– deren wirksamere Koordination in Hinblick auf die<br />
Durchsetzung unternehmerischer Entscheidungen. Die Dezentralisierung<br />
der Leitungsaufgaben dagegen erfolgt mit dem Argument,<br />
dass aufgrund der – sachlich und räumlich zu interpretierenden<br />
– Nähe der Leitenden zu dem zu lösenden Problem dieses<br />
schneller und sachlich fundierter gelöst werden kann; die Fähigkeit<br />
des Krankenhauses, die Bedürfnisse der Patienten ethisch<br />
vertretbar zu berücksichtigen sowie auf neue Herausforderungen<br />
und auf Änderungen der Rahmenbedingungen zeit- und sachgerecht<br />
zu reagieren, wird gestärkt.<br />
Die Dezentralisierung der Leitungsaufgaben hat einen intensiven<br />
Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Leitungsebenen<br />
zur Folge; Spannungen zwischen den verschiedenen Leitungsebenen<br />
werden abgebaut 31 . Die Mitarbeitenden nehmen die<br />
Dezentralisierung der Leitungsaufgaben als Befriedigung ihrer Bedürfnisse<br />
nach Wertschätzung, Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung<br />
32 wahr.<br />
Ein Beispiel:<br />
Die Bereitschaftsdienstleistungen der Krankenhaus-Ärzte werden<br />
entweder finanziell oder durch Freizeitausgleich vergütet. Wer<br />
darüber befinden soll, welche der Vergütungsformen praktiziert<br />
werden soll, wird mit dem Ergebnis einer Gestaltungs-Entscheidung<br />
festgelegt: Entweder wird die Ausführungs-Entscheidung,<br />
die Entscheidung nämlich, welche Vergütungsform bei welchem<br />
Arzt praktiziert werden soll, dem Geschäftsführer oder den Leitenden<br />
Ärzten, den Vorgesetzten der Bereitschaftsdienst leistenden<br />
Ärzte, zugewiesen. Letzteres hat den Vorteil, dass die Leitenden<br />
Ärzte bei den zu fällenden Ausführungs-Entscheidungen sowohl<br />
die ihnen bekannten Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden berücksichtigen<br />
können – vor allem die älteren Ärzte bevorzugen den<br />
Freizeitausgleich, weil sie diesen für ihre Erholung benötigen.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
13
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
Die Leitenden Ärzte wissen aber auch um die Wirkungen der mitarbeiterorientierten<br />
Entscheidungen auf das Wohl der Patienten:<br />
Weil bei der Vergütung durch Freizeitausgleich eine größere Zahl<br />
von Ärzten eingesetzt werden muss, können die Patienten während<br />
der Dauer ihrer stationären Behandlung nicht immer nur von<br />
einem Arzt betreut werden; eine auf Vertrauen basierende Sorgebeziehung<br />
zwischen Patient und Arzt kann möglicherweise nicht<br />
entwickelt werden. Während den Leitenden Ärzten auf der Grundlage<br />
ihrer Kenntnis der Patienten-Bedürfnisse und der Bedürfnisse<br />
ihrer Mitarbeitenden ein Ausgleich dieser Interessen zur Zufriedenheit<br />
der jeweils Betroffenen gelingt – mit positiver Wirkung für das<br />
Image der Abteilung und/oder für das Krankenhaus insgesamt –,<br />
würde dieses bei einer dem Geschäftsführer zugewiesenen Ausführungs-Entscheidung<br />
vermutlich eher nicht möglich sein.<br />
b) Delegation von Leitungsaufgaben<br />
Zusätzlich zu der Zentralisierung oder Dezentralisierung der Leitungsaufgaben<br />
ist festzulegen, ob und in welchem Ausmaß zur<br />
Entlastung der Führungskräfte bestimmte Entscheidungs- und<br />
Kontrollaufgaben an Mitarbeitende der Führungskräfte delegiert<br />
werden 33 . Zwei Arten der Delegation kommen dafür in Betracht:<br />
■ Die Befugnis, Entscheidungen zu fällen und gegebenenfalls<br />
Dritten zur Umsetzung anzuweisen, wird vollständig an Mitarbeitende<br />
übertragen. Die Mitarbeitenden agieren im Auftrag<br />
und im Namen ihres Vorgesetzten.<br />
■ Zur Entlastung der Führungskraft wird die Vorbereitung der<br />
Entscheidungen Mitarbeitenden zugewiesen. Das Fällen der<br />
Entscheidungen und das Veranlassen der Umsetzung durch<br />
Dritte verbleiben bei der Führungskraft.<br />
4.3.3. Führungsstil<br />
Der Führungsstil manifestiert sich in einer spezifischen Art von<br />
Vorgesetzten-Mitarbeitenden-Beziehung, in einem Informationsaustausch,<br />
der dazu dient, die möglicherweise unterschiedlichen<br />
Interessen der Krankenhaus-Mitarbeitenden und die des Krankenhauses<br />
zu überwinden und auf die Umsetzung der für das<br />
Krankenhaus festgelegten Werte und auf die Realisierung der<br />
dem Krankenhaus vorgegebenen Ziele hin abzustimmen 34 . Die im<br />
Krankenhaus-Alltag zu beobachtenden, sehr unterschiedlichen<br />
Formen dieser Art von Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften<br />
und den von ihnen geführten Mitarbeitenden lassen sich<br />
– etwas vereinfachend – als sieben Grundformen von Führungsstilen<br />
beschreiben (siehe Tabelle 3) 35 . Die Spannweite reicht von<br />
einem mehr auf die Führungskraft bezogenen – als autoritär bezeichneten<br />
– bis hin zu dem als partizipativ betitelten Führungsstil,<br />
bei dem der Entscheidungsprozess durch einen Mitarbeitenden<br />
bzw. eine Gruppe von Mitarbeitenden geprägt wird.<br />
Von der Art der Zusammenarbeit zwischen den Führungskräften<br />
und den von diesen geführten Mitarbeitenden hängt es ab, ob<br />
überhaupt bzw. in welchem Ausmaß den Bedürfnissen der Mitarbeitenden<br />
nach Sicherheit, Wertschätzung, Selbstverwirklichung<br />
und Selbstentfaltung (siehe Grundpostulat Mitarbeiterorientierung<br />
in Tabelle 1) entsprochen wird. So kann davon ausgegangen werden,<br />
dass mittels der Art der Zusammenarbeit zwischen der Führungskraft<br />
und ihren Mitarbeitenden, die sich eher als autoritärer<br />
Führungsstil beschreiben lässt, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden<br />
nicht oder nur unzureichend befriedigt werden. Die Mitarbeitenden<br />
werden ihre Arbeitssituation hingegen positiv bewerten<br />
und sich deshalb mit großer Einsatzfreude für das Umsetzen der<br />
für das Krankenhaus relevanten Werte und für das Erreichen der<br />
vereinbarten Ziele eintreten, wenn diese eine Folge der Zusammenarbeit<br />
ist, die mehr als partizipativer Führungsstil charakterisiert<br />
werden kann.<br />
Die Art des im Krankenhaus-Alltag praktizierten Führungsstils<br />
hängt einerseits von der jeweiligen Entscheidungssituation ab; sie<br />
wird aber vor allem bestimmt durch die Ausprägung der Eigenschaften<br />
der jeweils handelnden Führungskräfte und Mitarbeitenden<br />
(siehe Tabelle 4). Deshalb: Wenn die dafür Verantwortlichen<br />
– Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat und Geschäftsführung<br />
vor allem – gewährleisten wollen, dass die Interaktion und die Kommunikation<br />
zwischen den Vorgesetzten und deren Mitarbeitenden<br />
so umgesetzt werden, dass ein respektvolles Miteinander ermöglicht<br />
36 , dass den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entsprochen<br />
wird und dass die Ziele der Personalführung verwirklicht werden<br />
können, dann dürfen sie die Art der Zusammenarbeit zwischen<br />
den Führungskräften und ihren Mitarbeitenden nicht den jeweils<br />
gegebenen Umständen – Ausprägung der Führungskräfte- und<br />
Mitarbeitenden-Eigenschaften – überlassen. Sie müssen von den<br />
Führungskräften und den von diesen geführten Mitarbeitenden, –<br />
wenn es die Art der Entscheidungs-Situation zulässt, – das Praktizieren<br />
eines partizipativen Führungsstils fordern. Sie müssen die<br />
Führungskräfte und deren Mitarbeitende dafür gewinnen, diese<br />
Art der Zusammenarbeit leben zu wollen. Und sie müssen Führungskräfte<br />
und Mitarbeitende – soweit erforderlich – ermuntern,<br />
an geeigneten Maßnahmen der Personalentwicklung, sowohl im<br />
Sinne der Einstellungs- als auch der Fähigkeitsentwicklung, teilzunehmen,<br />
um damit ihre Kompetenzen so zu vervollkommnen,<br />
dass sie den partizipativen Führungsstil praktizieren wollen und<br />
können.<br />
4.4. Die Teilfunktion Führung als<br />
Querschnittsfunktion<br />
Mit Blick auf die Teilfunktionen des Krankenhaus-Leitungssystems<br />
ist die Teilfunktion „Führung“ eine Querschnittsfunktion. Die Gestaltungs-Entscheidungen,<br />
die anderen Teilfunktionen betreffend<br />
(siehe Abbildung 2), werden durch Führungskräfte gefällt – von<br />
Führungskräften, die dabei an die in dem Führungskonzept festgelegten<br />
Regeln gebunden sind. Die Gestaltung der Teilfunktionen<br />
des Krankenhaus-Leitungssystems werden mithin beeinflusst<br />
durch die Gestaltung der Teilfunktion „Führung“ und das dadurch<br />
geprägte Verhalten der Führungskräfte und das ihrer Mitarbeiten-<br />
14 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
FÜHRUNGSSTIL-GRUNDFORMEN<br />
Die Führungskraft entscheidet, gibt ihre Entscheidung bekannt und ordnet sie durch Befehl zur Durchführung an. Sie gibt nicht nur das<br />
zu erreichende Ziel, sondern auch die für die Zielerreichung notwendigen Realisierungsschritte vor. Sie kontrolliert nicht nur, ob das Ziel<br />
erreicht worden ist, sondern auch, ob die Realisierungsschritte sach- und zeitgerecht durchgeführt wurden.<br />
autoritärer<br />
Führungsstil<br />
Die Führungskraft entscheidet, wirbt für diese Entscheidung und ordnet sie durch Befehl zur Durchführung an. Sie gibt nicht nur das zu<br />
erreichende Ziel, sondern auch die für die Zielerreichung notwendigen Realisierungsschritte vor. Sie kontrolliert nicht nur, ob das Ziel<br />
erreicht worden ist, sondern auch, ob die Realisierungsschritte sach- und zeitgerecht durchgeführt wurden.<br />
Die Führungskraft präsentiert ihre Lösungsalternativen und bittet um weitere Vorschläge. Danach entscheidet sie und ordnet das Ergebnis<br />
zur Durchführung an. Sie gibt nicht nur das zu erreichende Ziel, sondern auch die für die Zielerreichung notwendigen Realisierungsschritte<br />
vor. Sie kontrolliert nicht nur, ob das Ziel erreicht worden ist, sondern auch, ob die Realisierungsschritte sach- und zeitgerecht<br />
durchgeführt wurden.<br />
Die Führungskraft präsentiert ihre noch wenig konkreten Lösungsalternativen und ermuntert die Mitarbeiter, diese zu konkretisieren und<br />
gegebenenfalls zu ergänzen. Sie entscheidet und ordnet das Ergebnis zur Durchführung an. Die Führungskraft kontrolliert das Ergebnis<br />
des Realisierungsprozesses.<br />
Die Führungskraft beschreibt das zu lösende Problem und bittet um Lösungsvorschläge. Sie entscheidet, begründet das Ergebnis ihrer<br />
Entscheidung und ordnet danach das Ergebnis zur Durchführung an. Die Führungskraft kontrolliert das Ergebnis des Realisierungsprozesses.<br />
Die Führungskraft beschreibt das zu lösende Problem und benennt die Rahmenbedingungen zur Lösung des Problems. Die Mitarbeiter<br />
lösen das Problem und setzen das Ergebnis der Entscheidung nach Abstimmung mit der Führungskraft um. Die Führungskraft kontrolliert<br />
das Ergebnis des Realisierungsprozesses.<br />
Die Führungskraft legt die Grenzen fest, innerhalb derer die Mitarbeiter frei agieren, und koordiniert den Problemlösungsprozess. Die<br />
Mitarbeiter definieren das Problem, suchen die passenden Lösungsalternativen, entscheiden und setzen das Ergebnis um. Die Führungskraft<br />
kontrolliert das Ergebnis des Realisierungsprozesses.<br />
partizipativer<br />
Führungsstil<br />
Tab. 3: Führungsstil-Grundformen 35a (mit freundlicher Genehmigung der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft)<br />
KRITERIEN<br />
Eigenschaften der Führungskraft<br />
Eigenschaften der geführten<br />
Mitarbeiter<br />
Eigenschaften der Situation<br />
AUSPRÄGUNG<br />
■ Verhalten gegenüber ihren Mitarbeitern<br />
■ Ausmaß des Vertrauens in die Mitarbeiter<br />
■ Ausmaß des Entscheidungsspielraums, der den Mitarbeitern gewährt wird<br />
■ Zuordnung der Entscheidungs- und/oder Vollzugsverantwortung<br />
■ Vorgabe des Ziels oder Vorgabe der Realisierungsschritte im Detail<br />
■ Ergebniskontrolle oder Kontrolle der Realisierungsschritte<br />
■ Art der Autoritätsausübung (Weisungen durch Befehl oder durch Empfehlungen bzw. Anregungen)<br />
■ Befugnisse in Hinblick auf Belohnung und Bestrafung<br />
■ Erfahrungen in Entscheidungsprozessen<br />
■ Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen<br />
■ Bedürfnisse der Mitarbeiter nach Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung<br />
■ Art des Problems<br />
■ Rahmenbedingungen für die Lösung des Problems<br />
Tab. 4: Kriterien, die den anzuwendenden Führungsstil bestimmen 37<br />
(mit freundlicher Genehmigung der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft)<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
15
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
den. Von der Gestaltung der Teilfunktion „Führung“ hängt es demnach<br />
ab, ob die Umsetzung der dem Krankenhaus vorgegebenen<br />
Werte in das alltägliche Handeln der Krankenhaus-Akteure – und<br />
zwar bezogen auf die anderen Teilfunktionen des Krankenhaus-<br />
Leitungssystems – gewährleistet werden kann.<br />
Ein Beispiel:<br />
Die Gestaltung der Teilfunktion „Planung“ wird im Regelfall durch<br />
den Geschäftsführer initiiert. Welche Akteure an dem Gestaltungsprozess<br />
außer dem Geschäftsführer mit welchen Befugnissen<br />
beteiligt werden, hängt weitgehend von der Art des in dem<br />
Krankenhaus vorgegebenen und praktizierten Führungsstils ab.<br />
■ Haben sich die dafür zuständigen Gremien für einen mehr autoritären<br />
Führungsstil entschieden und damit dem Geschäftsführer<br />
erlaubt, Gestaltungs-Entscheidungen weitgehend allein<br />
ohne die Beteiligung der von diesen Entscheidungen Betroffenen<br />
zu fällen, kann – muss aber nicht – damit gerechnet werden,<br />
dass der Geschäftsführer den ihm eingeräumten Handlungsspielraum<br />
nutzt und den Planungsprozess allein nach<br />
seinen eigenen Vorstellungen gestaltet.<br />
Es kann – muss aber nicht – angenommen werden, dass unter<br />
diesen Voraussetzungen der Planungsprozess im Sinne des<br />
Top-Down-Verfahrens organisiert wird mit der Folge: Die für<br />
die Umsetzung der Planung Verantwortlichen werden in die<br />
jährliche Leistungs- und Ressourcenplanung eher nicht einbezogen;<br />
die Umsetzung der in dem Krankenhaus-Leitbild festgehaltenen<br />
Werte ist möglicherweise nicht gewährleistet.<br />
■ Wenn dagegen von den Führungskräften das Praktizieren<br />
eines partizipativen Führungsstils verlangt wird und damit die<br />
Mitarbeitenden des Geschäftsführers – das sind die Leitenden<br />
Ärzte, die Leitenden Pflegefachkräfte u.a. – in die Entscheidung<br />
über die Gestaltung des Planungsprozesses im Sinne einer argumentativen,<br />
dialogischen Verständigung einbezogen werden<br />
müssen, und wenn von den Gestaltungs-Entscheidern verlangt<br />
wird, dass diese bei ihren Entscheidungen das Grundpostulat<br />
der Planung „Mitarbeiterorientierung“ berücksichtigen, kann<br />
davon ausgegangen werden, dass die Planung als Gegenstromverfahren<br />
organisiert wird. Die für die Umsetzung der<br />
Planungsergebnisse Verantwortlichen sind an dem Planungsprozess<br />
maßgeblich beteiligt und prägen dessen Ergebnis. Die<br />
Umsetzung der für das Krankenhaus relevanten Werte und die<br />
Realisierung der Planungsergebnisse sollten unter diesen Bedingungen<br />
im Regelfall gewährleistet sein.<br />
■ Nicht selten werden in einem Krankenhaus zwar die Kernfunktionen<br />
des Krankenhaus-Leitungssystems – dazu zählt unter<br />
anderem die Teilfunktion „Planung“ 38 – organisationsethisch<br />
ausgerichtet gestaltet; ein Führungskonzept dagegen fehlt. Angesichts<br />
dieser Voraussetzungen werden die Planungsprozesse<br />
zwar möglicherweise im Sinne des Gegenstromverfahrens<br />
organisiert und praktiziert; dem Leitenden Arzt einer klinischen<br />
Abteilung, der an diesem Planungsprozess mitwirkt, ist es aber<br />
unbenommen, ob er seine Mitarbeitenden, die das Ergebnis<br />
der Planung umsetzen müssen, in die Planung einbezieht (partizipativer<br />
Führungsstil) oder nicht (autoritärer Führungsstil).<br />
Damit wird deutlich, dass der Gestaltung der Teilfunktion „Führung“<br />
bei der Gestaltung der Organisation Krankenhaus eine<br />
Schlüsselrolle zukommt. Von der Konfiguration der Teilfunktion<br />
„Führung“ hängen die Art der Gestaltung aller anderen Teilfunktionen<br />
des Krankenhaus-Leitungssystems und damit die Art der<br />
Ausführung der im Rahmen der Teilfunktionen wahrzunehmenden<br />
Aufgaben ab. Wenn die dafür Verantwortlichen – das sind vor<br />
allem die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die<br />
Geschäftsführung – sicherstellen wollen, dass trotz des erheblichen,<br />
auf den Krankenhäusern lastenden finanziellen Drucks eine<br />
medizin- und pflegeethisch vertretbare Behandlung der Patienten<br />
gewährleistet werden soll, dann müssen sie zuerst die Teilfunktion<br />
„Führung“ entsprechend gestalten. Sie müssen als Ergebnis einer<br />
argumentativen, dialogischen Verständigung mit den von dem Ergebnis<br />
der Gestaltung Betroffenen und damit auf der Grundlage<br />
einer auf gegenseitigem Vertrauen und auf gegenseitiger Wertschätzung<br />
etablierten Zusammenarbeit zwischen den genannten<br />
Akteuren die Leitungsstruktur dezentralisieren und die Führungskräfte<br />
verpflichten, partizipativ zu führen.<br />
5. Fazit<br />
Der auf den Krankenhäusern und auch auf deren Mitarbeitenden<br />
lastende finanzielle Druck bringt es mit sich, dass patientenbezogene<br />
Entscheidungen durch Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten<br />
nicht nur durch die Bedürfnisse der Patienten, sondern<br />
auch durch die Bestandssicherungs-Interessen der Krankenhäuser<br />
geleitet werden. Dieser Entwicklung entgegenwirken zu<br />
wollen durch die Aufforderung an die genannten Akteurinnen und<br />
Akteure, nur medizin- und pflegeethisch vertretbare Leistungen<br />
zu erbringen 39 , wird nur teilweise erfolgreich sein können. Die<br />
Mitarbeitenden des Krankenhauses bedürfen, um entsprechend<br />
handeln zu können, der Unterstützung durch die organisationsethisch<br />
ausgerichtete Gestaltung der Organisation Krankenhaus<br />
als Ganzes.<br />
Die Teilfunktion des Krankenhaus-Leitungssystems „Führung“<br />
spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. Von der Konfigurierung<br />
des Führungskonzepts hängt es ab, wie die anderen<br />
Teilfunktionen gestaltet und ob die Arbeitsbedingungen für den<br />
klinischen Bereich des Krankenhauses so beschaffen sind, dass<br />
Ärzte, Pflegefachkräfte und Therapeuten patientenbezogene Entscheidungen<br />
primär an den Bedürfnissen der Patienten orientieren,<br />
dabei aber auch das Bedürfnis des Krankenhauses, dessen<br />
Bestand nachhaltig zu sichern, berücksichtigen können. Von der<br />
16 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG & WERTEMANAGEMENT<br />
Art des Führungskonzepts hängt es ab, ob nicht nur die Arzt-Patienten-Beziehung,<br />
sondern auch die Krankenhaus-Patienten-Beziehung<br />
eine treuhänderische Sorgebeziehung ist, ob das Wohl<br />
der Patienten als Leitmotiv des Handelns aller Krankenhaus-Akteure<br />
wirksam ist.<br />
Literatur:<br />
1 Kettner M (2005): Wozu Organisationsethik im Krankenhaus?, in: Krukemeyer MG et al.<br />
(Hg.): Krankenhaus und soziale Gerechtigkeit, Schattauer, Stuttgart 2005, 30-38<br />
1a Naegler H (2<strong>02</strong>2): Die Rolle des Controllings im Rahmen einer Organisationsethik des<br />
Krankenhauses, Ethik in der Medizin 4, 549 – 571<br />
2 Sachs I (1994): Handlungsspielräume des Krankenhausmanagements.<br />
Bestandsaufnahme und Perspektiven, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden<br />
3 Marckmann G (2<strong>02</strong>1): Ökonomisierung im Gesundheitswesen als organisationsethische<br />
Herausforderung. Ethik in der Medizin 2: 189-201<br />
4 Rabe M (2012): Ethische Reflexion und Entscheidungsfindung in der<br />
intensivmedizinischen Praxis, Salomon F (Hrsg.): Praxisbuch Ethik in der<br />
Intensivmedizin. Konkrete Entscheidungshilfen in Grenzsituationen, 2., aktualisierte und<br />
erweiterte Auflage, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin, 29-39<br />
5 Woellert K (2<strong>02</strong>1): Praxisfeld Klinische Ethik. Theorie, Konzepte, Umsetzung<br />
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Medizinisch Wissenschaftliche<br />
Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
6 Woellert K (2<strong>02</strong>3): Versorgungsqualität braucht Organisations- und Führungsethik,<br />
Riedel A., Lehmeyer S. (Hrsg.): Ethik im Gesundheitswesen, Springer Reference<br />
Pflege – Therapie – Gesundheit, Berlin – Heidelberg, 955-976. Zugang: https://<br />
www.amazon.de/Ethik-Gesundheitswesen-Springer Reference Pflege/<br />
dp/3662586797?asin=3662586797&revisionId=&format=4&depth=1, Zugriff: 24.1.2<strong>02</strong>3<br />
7 Naegler H (2<strong>02</strong>1): Medizin auf der Grundlage einer treuhänderischen Sorgebeziehung.<br />
Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement 2: 93-99<br />
8 Woellert K (2<strong>02</strong>3): Versorgungsqualität braucht Organisations- und Führungsethik,<br />
Riedel A., Lehmeyer S. (Hrsg.): Ethik im Gesundheitswesen, Springer Reference<br />
Pflege – Therapie – Gesundheit, Berlin – Heidelberg, 955-976. Zugang: https://<br />
www.amazon.de/Ethik-Gesundheitswesen-Springer Reference-Pflege/<br />
dp/3662586797?asin=3662586797&revisionId=&format=4&depth=1, Zugriff: 24.1. 2<strong>02</strong>3<br />
9 Scholz Chr (2014): Personalmanagement. Informationsorientierte und<br />
verhaltenstheoretische Grundlagen, 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag<br />
Franz Vahlen, München<br />
10 Naegler H (2<strong>02</strong>2): Die Rolle des Controllings im Rahmen einer Organisationsethik des<br />
Krankenhauses. Ethik in der Medizin 4: 549-571<br />
11 (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte - MBO-Ä<br />
1997 (2011) - in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages 2011 in<br />
Kiel, Kiel<br />
12 Marckmann G (2015): Kostensensible Leitlinien als Instrumente einer expliziten<br />
Leistungssteuerung im Gesundheitswesen: ethische Grundlagen, Marckmann G (Hrsg.):<br />
Kostensensible Leitlinien. Evidenzbasierte Leistungssteuerung für eine effiziente und<br />
gerechte Gesundheitsversorgung, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,<br />
Berlin, 31-53<br />
13 Marckmann G; Maschmann J, (2014): Zahlt sich Ethik aus? Notwendigkeit und<br />
Perspektiven des Wertemanagements im Krankenhaus. Zeitschrift für Evidenz,<br />
Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 3: 157-165<br />
14 Beauchamp TL; Childress JF (2019):, Principles of Biomedical Ethics, 8th Edition,<br />
Oxford University Press Inc, New York<br />
15 International Council of Nurses (2<strong>02</strong>1): Der ICN-Ethikkodex für Pflegefachpersonen,<br />
überarbeitet 2<strong>02</strong>1, CN - International Council of Nurses; Franke A (2017): Pflegeethik.<br />
Die Pflege zwischen Dienstleistung und Moral, GRIN Verlag, Norderstedt. Zugang:<br />
https://www.grin.com/document/427539, Zugriff: 27.10.2<strong>02</strong>2<br />
16 Marckmann G (2015): Kostensensible Leitlinien als Instrumente einer expliziten<br />
Leistungssteuerung im Gesundheitswesen: ethische Grundlagen, Marckmann G (Hrsg.):<br />
Kostensensible Leitlinien. Evidenzbasierte Leistungssteuerung für eine effiziente und<br />
gerechte Gesundheitsversorgung, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft,<br />
Berlin, 31-53<br />
17 Hasenfuß G et al. (2017): Gegen Unter- und Überversorgung, Deutsche Gesellschaft<br />
für Innere Medizin (Hrsg.): Initiative „Klug entscheiden“, Deutsches Ärzteblatt 113,<br />
Sammelband, 6-9<br />
18 Grossmann R (1993): Leitungsfunktionen und Organisationsentwicklung im<br />
Krankenhaus, Badura B et al. (Hrsg.): System Krankenhaus. Arbeit, Technik und<br />
Patientenorientierung, Juventa Verlag, Weinheim und München, 301-321; Garbsch<br />
M (2012): Systemische Führungsentwicklung. Verknüpfung von Führungskräfte- und<br />
Organisationsentwicklung am Beispiel eines Krankenhauses, Carl-Auer-Systeme<br />
Verlag, Heidelberg<br />
19 Staehle WH (1999): Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive,<br />
8., überarb. Aufl., Verlag Franz Vahlen, München<br />
20 Marckmann G (2<strong>02</strong>1): Ökonomisierung im Gesundheitswesen als organisationsethische<br />
Herausforderung, Ethik in der Medizin 2, 189-201<br />
21 Naegler H (2<strong>02</strong>2): Das Gestalten der Pflegedienst-Arbeitsbedingungen. Eine<br />
organisationsethische Herausforderung, Pflegewissenschaft 5, 295-308<br />
22 Marckmann G; Maschmann J (2014): Zahlt sich Ethik aus? Notwendigkeit und<br />
Perspektiven des Wertemanagements im Krankenhaus, Zeitschrift für Evidenz,<br />
Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 3, 157-165<br />
23 Domsch M; Gerpott TJ (1985): Verhaltensorientierte Beurteilungsskalen. Eine Analyse<br />
von Varianten eines Ansatzes zur Verbesserung der Methodik der Leistungsbeurteilung<br />
von Mitarbeitern, Die Betriebswirtschaft 6, 666-689<br />
24 Marckmann G; Maschmann J (2014): Zahlt sich Ethik aus? Notwendigkeit und<br />
Perspektiven des Wertemanagements im Krankenhaus, Zeitschrift für Evidenz,<br />
Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen 3, 157-165; Rechkemmer K (2<strong>02</strong>0):<br />
Innere Qualität: Theoretische Konzeption, Management und Politik, Vandenhoeck<br />
& Ruprecht, Göttingen; Naegler H (2011): Management der sozialen Verantwortung<br />
im Krankenhaus. Corporate Social Responsibility als nachhaltiger Erfolgsfaktor,<br />
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
25 Grossmann R (1993): Leitungsfunktionen und Organisationsentwicklung im<br />
Krankenhaus, Badura B et al. (Hrsg.): System Krankenhaus. Arbeit, Technik und<br />
Patientenorientierung, Juventa Verlag, Weinheim und München, 301-321.<br />
26 Garbsch M (2012): Systemische Führungsentwicklung. Verknüpfung von<br />
Führungskräfte- und Organisationsentwicklung am Beispiel eines Krankenhauses, Carl-<br />
Auer-Systeme Verlag, Heidelberg<br />
27 In Anlehnung an Scholz Chr. (2014): Personalmanagement. Informationsorientierte und<br />
verhaltenstheoretische Grundlagen, 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag<br />
Franz Vahlen, München; Marckmann G (2<strong>02</strong>1): Ökonomisierung im Gesundheitswesen<br />
als organisationsethische Herausforderung, Ethik in der Medizin 2, 189-201<br />
28 Scholz Chr. (2014): Personalmanagement. Informationsorientierte und<br />
verhaltenstheoretische Grundlagen, 6., neubearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag<br />
Franz Vahlen, München<br />
29 von Eiff W (2000): Führung und Motivation in Krankenhäusern. Perspektiven und<br />
Empfehlungen für Personalmanagement und Organisation, Verlag W. Kohlhammer<br />
GmbH, Stuttgart<br />
30 von Eiff W (2000): Führung und Motivation in Krankenhäusern. Perspektiven und<br />
Empfehlungen für Personalmanagement und Organisation, Verlag W. Kohlhammer<br />
GmbH, Stuttgart<br />
31 Naegler H (2019): Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführern und Chef-Ärzten<br />
verbessern, das Krankenhaus 1, 39-45<br />
32 Staehle WH (1999): Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive,<br />
8., überarb. Aufl., Verlag Franz Vahlen<br />
33 Holtbrügge D (2018): Personalmanagement, 7., überarbeitete und erweiterte Auflage,<br />
Springer-Verlag GmbH, Berlin<br />
34 Neuberger D (1977): Organisation und Führung, Verlag W. Kohlhammer GmbH,<br />
Stuttgart<br />
35 Tannenbaum R; Schmidt WH (1973): How to Choose a Leadership Pattern. Should a<br />
manager be democratic or autocratic or something in between?, Harvard Business<br />
Review 3, 162-168.<br />
35a Naegler H; Garbsch M (2<strong>02</strong>1): Personalmanagement im Krankenhaus, 5., erweiterte<br />
und aktualisierte Auflage, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
36 Burmeister Chr (2<strong>02</strong>1): Organisationsethik in Einrichtungen des Gesundheitswesens,<br />
Ethik in der Medizin 2, 153-158<br />
37 Bühner R (2005): Personalmanagement, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage,<br />
R. Oldenbourg Verlag, München-Wien und Naegler H; Garbsch M (2<strong>02</strong>1):<br />
Personalmanagement im Krankenhaus, 5., erweiterte und aktualisierte Auflage,<br />
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
38 Naegler H (2011): Management der sozialen Verantwortung im Krankenhaus. Corporate<br />
Social Responsibility als nachhaltiger Erfolgsfaktor, Medizinisch Wissenschaftliche<br />
Verlagsgesellschaft, Berlin<br />
39 „Am Krankenbett wird nicht gerechnet“ Klinikum Dortmund, Unser Kodex. Zugang:<br />
https://www.klinikumdo.de/kliniken-zentren/kliniken-abteilungen-m-z/urologie/<br />
urologischer-kodex, Zugriff: 6.2.2<strong>02</strong>3)<br />
PROF. DR. HEINZ NAEGLER<br />
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin<br />
heinz.naegler@arcor.de<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
17
DIGITALISIERUNG<br />
Das digitale Unterschriftencockpit –<br />
Digitalisierung neu gedacht<br />
D<br />
ie Pandemie hat auch in der Arbeitswelt<br />
deutliche Spuren hinterlassen.<br />
Bemerkenswert war<br />
auf jeden Fall der Sprung ins Homeoffice.<br />
Während dieser für viele Leute heute Vorteile<br />
bringt, weil es zum Beispiel manchen<br />
mehr Flexibilität ermöglicht, hat er auch<br />
eintrainierte Organisationsmuster auf die<br />
Probe gestellt.<br />
Besonders in der Digitalisierung wurden<br />
so – mehr oder weniger freiwillig – mit<br />
unerwarteter Geschwindigkeit Fortschritte<br />
gemacht. Wenn plötzlich die direkten<br />
Kontakte eingeschränkt werden, stellt sich<br />
in so manchen Bereichen alles auf den<br />
Kopf: Wie erreiche ich meine Kolleginnen<br />
und Kollegen, wenn ich eine Frage habe?<br />
Wie komme ich an Unterlagen, die ich für<br />
meine Arbeit brauche? Wie komme ich an<br />
notwendige Unterschriften?<br />
Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft<br />
wurde damit als große Organisation<br />
mit vielen Prozessbeteiligten vor<br />
eine dringende Aufgabe gestellt: Unterschriften<br />
werden oft benötigt – unabhängig<br />
davon, ob es um Kleinigkeiten geht,<br />
wie die Unterzeichnung eines Protokolls,<br />
oder wichtige Workflows, wie die Freigabe<br />
von Investitionen. Das Team „Personalsysteme<br />
und -verrechnung“ in der „OE IT-<br />
Infrastruktur und Administrative Systeme“<br />
hat mit einer adäquaten Lösung schnellstmöglich<br />
reagiert. Dabei beschränkt sich<br />
die Herausforderung, diese Prozesse zu<br />
digitalisieren, nicht nur auf Unterschriften,<br />
die ad hoc benötigt werden. Es stellen<br />
sich viele Fragen: Wie binde ich Personen<br />
außerhalb des Unternehmens ein? Wie<br />
funktionieren die Stellvertreterregelungen?<br />
In welcher Funktion unterschreibe ich? …<br />
Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft<br />
hat diese Umstellung nun hinter<br />
sich. Und obwohl sie die größte Arbeitgeberin<br />
der Steiermark ist, war der Integrationsaufwand<br />
aufgrund von optimaler<br />
Schnittstellenintegration und gutem User<br />
Interface überschaubar.<br />
Die Lösung der POS Solutions GmbH, die<br />
bei der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft<br />
in Verwendung ist, bindet<br />
sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur<br />
ein. Beim Öffnen des hauseigenen<br />
Unternehmensportals – ein browserba-<br />
18 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
PLATTFORM PATIENT:INNENSICHERHEIT<br />
siertes Intranet – kann das Unterschriftencockpit<br />
direkt geöffnet werden. Des Weiteren<br />
sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
sofort über den klassischen Windows-Einstieg<br />
am IT-Endgerät authentifiziert.<br />
In der Lösung sind die wichtigsten Prozesse<br />
sofort griffbereit:<br />
■ Hochladen von Dokumenten.<br />
■ Zugriff auf zu unterschreibende Dokumente<br />
und ihre Weiterleitung.<br />
■ Unterschrift mittels direkter Authentifizierung<br />
des Systems oder per Hand<br />
auf einem Gerät mit Touchscreen wie<br />
bei einer Paketannahme.<br />
■ Integration der Handysignatur als qualifizierte<br />
Unterschrift.<br />
Alle berechtigten Mitarbeiter können diese<br />
Lösung sofort verwenden. Somit bietet es<br />
einen einfachen Zugang zu dieser modernen<br />
Lösung.<br />
Der erste Fokus lag auf den wichtigen HR-<br />
Prozessen, wobei nun der Vollbetrieb der<br />
Lösung erreicht und zur Verwendung in<br />
sämtlichen Prozessen des Unternehmens<br />
bereit ist. Der Umstieg auf die digitale Welt<br />
hat sich mit dem System als deutliche<br />
Verbesserung gezeigt. Die Unterschriften<br />
können auch an externe Personen geschickt<br />
werden, selbst wenn sie diese Lösung<br />
nicht in ihrem Unternehmen einsetzen.<br />
Stellvertretungen können mit einem<br />
Klick für bestimmte Personen selbst aktiviert<br />
und deaktiviert werden.<br />
Die Mitarbeiter werden aktiv per E-Mail<br />
über neu zu signierende Dokumente informiert<br />
und können entweder mittels<br />
der elektronischen Unterschriftenmappe<br />
in einem Arbeitsschritt oder per Klick auf<br />
den im E-Mail übermittelten Link die Dokumente<br />
abarbeiten. Die Zeiten von gestapelten<br />
Unterschriftenmappen, Postwegen<br />
und administrativen Vorarbeiten wirken,<br />
als lägen sie schon sehr weit zurück.<br />
Kontakt:<br />
Ing. Franz Kokoth MSc<br />
Teamleiter Personalsysteme- und verrechnung,<br />
Steiermärkische Krankenanstalten -<br />
gesellschaft m.b.H.<br />
franz.kokoth@kages.at<br />
Sicherheit. Für Patient:innen.<br />
Mit Patient:innen.<br />
Patienten- und Mitarbeitersicherheit werden<br />
bei uns auch 2<strong>02</strong>3 großgeschrieben!<br />
Rückblick auf den 2. Aktionstag Second Victim<br />
Gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien, dem Wiener Gesundheitsverbund<br />
und dem Verein Second Victim veranstalteten wir am 11. Mai 2<strong>02</strong>3 den<br />
zweiten Aktionstag Second Victim im Van Swieten Saal in Wien. Dabei wurde sowohl<br />
das Phänomen Second Victim theoretisch beleuchtet als auch ein Einblick<br />
in bestehende Angebote aus der Praxis gegeben. Abgerundet wurde die Veranstaltung<br />
mit einer Podiumsdiskussion. Impressionen dazu sowie die Nachlese<br />
einiger Präsentationen finden Sie hier: www.plattformpatientensicherheit.at/<br />
bildung-2<strong>02</strong>3<br />
Patientenbeteiligung –<br />
das Motto des Internationalen<br />
Patientensicherheitstages<br />
Heuer steht beim Internationalen Tag der Patientensicherheit am 17. September<br />
2<strong>02</strong>3 die Einbeziehung und Beteiligung von Patientinnen und Patienten im Fokus.<br />
In unserer Landkarte können aber selbstverständlich auch wieder alle anderen<br />
Anstrengungen und Aktivitäten, die zur Erhöhung von Patienten- und/oder Mitarbeitersicherheit<br />
beitragen, eingetragen und somit sichtbar gemacht werden.<br />
Die orange Beleuchtung von Gesundheitseinrichtungen und anderen Gebäuden<br />
streben wir auch heuer wieder an – machen Sie mit, make it orange! Nähere Infos<br />
dazu finden Sie unter www.patientensicherheitstag.at<br />
Tagung der Österreichischen<br />
Plattform Patient:innensicherheit<br />
In Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund und dem Institut für<br />
Ethik und Recht in der Medizin findet am 13. Oktober 2<strong>02</strong>3 die Jahrestagung<br />
im Veranstaltungszentrum der Klinik Floridsdorf und online statt. Wir bieten<br />
heuer die einzige deutschsprachige Tagung zum Thema Patienten- und Mitarbeitersicherheit<br />
an und feiern dabei auch das 15-Jahr-Jubiläum der Österreichischen<br />
Plattform Patient:innensicherheit! Die Teilnahme ist kostenlos, eine<br />
Anmeldung jedoch notwendig. Im Rahmen der Tagung werden der Austrian<br />
Patient Safety Award 2<strong>02</strong>3 sowie der neu ausgelobte Journalist:innenpreis verliehen.<br />
Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter<br />
www.plattformpatientensicherheit.at<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
19
BÜCHER<br />
HR-Strategie:<br />
Demografie als Chance<br />
Alter – Gesundheit – Diversität<br />
In vielen Unternehmen geht bis zum Ende der<br />
laufenden Dekade bis zu einem Drittel der Belegschaft<br />
in den Ruhestand. Zugleich sinkt die Zahl<br />
verfügbarer Nachwuchskräfte. Unternehmen stehen<br />
damit vor großen Herausforderungen. Dieses<br />
Buch beleuchtet in zwei wissenschaftlichen Beiträgen<br />
den Gesamtkontext und präsentiert aktuelle<br />
Forschungsergebnisse. Aus der betrieblichen<br />
Praxis unterschiedlicher Unternehmensgrößen<br />
und -branchen werden in zehn spannenden Beiträgen<br />
innovative Lösungskonzepte vorgestellt.<br />
Zudem werden konkrete Umsetzungshilfen in<br />
den Themenbereichen Demografiemanagement,<br />
Gesundheitsmanagement und Altersdiversität<br />
präsentiert und Zukunftsperspektiven entwickelt.<br />
Mit zahlreichen Best Practice-Beispielen.<br />
Erfolgreiche Teams in<br />
der Selbstorganisation<br />
Sechs Aufgaben, damit Teams<br />
arbeitsfähig werden – und welche Rolle<br />
Führung dabei spielt<br />
Dieses Grundlagenwerk hilft Teams und ihren<br />
Führungskräften, sich auf die entscheidenden<br />
Herausforderungen zu konzentrieren, damit<br />
Selbstorganisation gelingen kann – jenseits von<br />
ihrer nicht selten in der Praxis vorgenommenen<br />
Idealisierung.<br />
Es basiert auf einem Forschungsprojekt mit neun<br />
Teams und deren Führungskräften aus fünf Organisationen.<br />
Darin zeigen sich sechs Aufgabenfelder,<br />
die selbstorganisierte Teams bewältigen<br />
müssen, um funktional und arbeitsfähig zu sein:<br />
mit den Außengrenzen des Teams umgehen;<br />
den Zusammenhalt wahren und für Kontinuität<br />
Karlheinz Schwuchow / Joachim Gutmann:<br />
HR-Strategie: Demografie als Chance /<br />
Alter – Gesundheit – Diversität; Haufe-<br />
Lexware GmbH & Co. KG; www.haufegroup.<br />
com/de; ISBN: 978-3-648-16507-2<br />
Brinkmann / Schattenhofer: Erfolgreiche<br />
Teams in der Selbstorganisation – Sechs<br />
Aufgaben, damit Teams arbeitsfähig werden<br />
– und welche Rolle Führung dabei spielt;<br />
Verlag Franz Vahlen GmbH; www.vahlen.de;<br />
ISBN: 978-3-8006-6691-1<br />
Heidemarie Haeske-Seeberg: Leitfaden<br />
Qualitätsmanagement im Krankenhaus –<br />
Umsetzungshinweise entlang der Qualitätsmanagement-Richtlinie<br />
des G-BA;<br />
Kohlhammer-Verlag; www.kohlhammer.de;<br />
ISBN: 978-3-17-041576-8<br />
sorgen; der Zusammenarbeit eine Form geben;<br />
Führungsaufgaben verteilen und mit Führung<br />
umgehen; Mitgliedern als Personen einen Platz<br />
geben; Reflexion – aus den eigenen Erfahrungen<br />
lernen. Darüberhinaus werden Gestaltungsprinzipien<br />
der Teamführung vorgestellt. Denn<br />
darin sind sich die interviewten Teams und Führungskräfte<br />
einig: Selbstorganisation benötigt<br />
Führung. Sie muss präsent sein, ohne das Tun<br />
der Teammitglieder zu stoppen; sie soll stärken,<br />
ohne zu stören. Entstanden ist eine Landkarte für<br />
den Schritt in die Selbstorganisation, die Rahmenbedingungen<br />
vorstellt, die Teams und ihre<br />
Führungskräfte stärken und dabei helfen, diese<br />
bewusst und erfolgreich zu gestalten.<br />
Leitfaden Qualitätsmanagement<br />
im Krankenhaus<br />
Umsetzungshinweise entlang der Qualitätsmanagement-Richtlinie<br />
des G-BA<br />
Heidemarie Haeske-Seeberg zitiert in ihrem<br />
Handbuch alle für Krankenhäuser relevanten Bestandteile<br />
der Qualitätsmanagement-Richtlinie<br />
des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 15.<br />
September 2015 sowie die seither erschienenen<br />
Ergänzungen. Das Werk bietet für jede Anforderung<br />
kurze Hinweise und Beispiele für die Umsetzung<br />
und verfolgt dabei den Anspruch, Denkanstöße<br />
für die Interpretation der Richtlinie zu<br />
geben. Dazu verweist es an zahlreichen Stellen<br />
auf Materialien, die helfen, einzelne Anforderungen<br />
und deren Konzeption und Umsetzung zu<br />
unterstützen. Damit erschließt es auf kompakte<br />
Art und Weise einen Zugang zu relevanten und<br />
meist öffentlich zugänglichen, weiterführenden<br />
Quellen. Das Buch ist damit geeignet für den Einstieg<br />
in das Qualitätsmanagement. Es hilft aber<br />
auch, die Terminologie der Qualitätsmanagement-Richtlinie<br />
für diejenigen zu übersetzen, die<br />
sich bisher eher an der Begriffswelt der DIN EN<br />
ISO 9001 orientiert haben.<br />
20 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
BÜCHER<br />
Pharmakologie<br />
Ein Lehrbuch für Pflegeassistenzund<br />
Sozialbetreuungsberufe<br />
Der Umgang mit Arzneimitteln erfordert von allen,<br />
die in der Pflege arbeiten, große Sorgfalt<br />
und hochaktuelles Wissen. Auch Pflegeassistenz<br />
und Pflegefachassistenz sind, gemäß ihren Berufsbefugnissen,<br />
an der Verabreichung beteiligt<br />
und tragen entsprechende Mitverantwortung.<br />
Dieses Lehrbuch zur Arzneimittellehre enthält<br />
in übersichtlicher und überschaubarer Form alle<br />
für diese Berufsgruppe relevanten Informationen<br />
über unterschiedliche Medikamente, deren Lagerung,<br />
Verabreichung sowie Wirkungen und<br />
Nebenwirkungen. Ein spezieller Teil ist zudem<br />
dem Thema Diabetes gewidmet. Gegliedert nach<br />
Ausbildungsjahren, ist der Band nicht nur Unterrichtshilfe,<br />
sondern auch wertvolles Nachschlagewerk<br />
im Berufsalltag. Dazu gibt es auch eine<br />
praktische Lern-App.<br />
Monika Kogler: Pharmakologie –<br />
Ein Lehrbuch für Pflegeassistenz- und<br />
Sozialbetreuungsberufe; Facultas Verlagsund<br />
Buchhandels AG; www.facultas.at;<br />
ISBN: 978-3-7089-2332-1<br />
zentrale Themen des Managements bekommen.<br />
Sie erhalten ein Verständnis darüber, wie Managementmoden<br />
entstehen, wie sie am Leben<br />
gehalten werden, wie sie vergehen und wie man<br />
sie für eigene Vorhaben nutzen kann. Eine spannende<br />
Lektüre für alle, die im Management oder<br />
in der Unternehmensberatung arbeiten, sowie für<br />
Coaches, Product Owners, Team Leads, Scrum<br />
Masters, fürsorgliche Vorgesetze, kratzbürstige<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schlaue Chefinnen<br />
und Chefs sowie Menschen, die Organisationen<br />
verstehen möchten.<br />
Leitsymptombasierte<br />
Notfallmedizin<br />
Akut- und Notfälle präzise diagnostizieren<br />
und richtig behandeln. Ein Wissenskompendium<br />
und Praxishandbuch.<br />
Fotos: Verlage<br />
Der ganz formale Wahnsinn<br />
111 Einsichten in die Welt der Organisationen<br />
Weswegen verschwindet zwangsläufig die Begeisterung<br />
in Start-ups, wenn sie größer werden?<br />
Warum werden bei Entscheidungen weder<br />
alle möglichen Alternativen in Betracht gezogen<br />
noch alle Folgen der Entscheidung mitbedacht?<br />
Wie schaffen es Organisationen immer wieder,<br />
von Regeln abzuweichen, ohne dass es zur Anarchie<br />
kommt? Prof. Dr. Stefan Kühl (Professor für<br />
Soziologie an der Universität Bielefeld) beschreibt<br />
in seinem neuen Buch, wie es zu dem ganz formalen<br />
Wahnsinn in Organisationen kommt. In<br />
kleinen Kolumnen – von Agilität bis Zynismus<br />
– wirft er auf unterhaltsame Weise ungewohnte<br />
Blicke auf kleine und große Absonderlichkeiten<br />
von Organisationen. So entsteht ein Handbuch,<br />
in dem Leserinnen und Leser einen organisationswissenschaftlich<br />
informierten Überblick über<br />
Stefan Kühl: Der ganz formale Wahnsinn –<br />
111 Einsichten in die Welt der Organisationen;<br />
Verlag Franz Vahlen GmbH;<br />
www.vahlen.de;<br />
ISBN: 978-3-8006-6887-8<br />
Martin Dünser / Michaela Klinglmair:<br />
Leitsymptombasierte Notfallmedizin –<br />
Akut- und Notfälle präzise diagnostizieren<br />
und richtig behandeln. Ein Wissenskompendium<br />
und Praxishandbuch. Trauner Verlag;<br />
www.trauner.at; ISBN: 978-3-99113-324-7<br />
„Leitsymptombasierte Notfallmedizin“ ist Wissenskompendium<br />
und Praxishandbuch zugleich.<br />
Es orientiert sich – wie in der Praxis gefordert<br />
– am Leitsymptom des Patienten und spiegelt<br />
dabei den typischen Ablauf der Versorgung eines<br />
Akut- bzw. Notfallpatienten wider. Schnell und<br />
einfach zum Nachschlagen: Im ersten Teil werden<br />
alle wichtigen Sofortmaßnahmen zur Behandlung<br />
unmittelbar lebensbedrohlicher Zustände in Form<br />
von kompakten, übersichtlichen Algorithmen zusammengefasst.<br />
Teil 2 gibt zu allen wichtigen Leitsymptomen<br />
einen vollständigen Überblick über<br />
die möglichen Differentialdiagnosen. Der dritte Teil<br />
beinhaltet strukturiertes Expertenwissen aller wesentlichen<br />
Verdachtsdiagnosen inkl. Anleitungen<br />
zur diagnostischen und therapeutischen Akutversorgung<br />
von Patienten mit notfall- und akutmedizinischen<br />
sowie toxikologischen Erkrankungen.<br />
„Leitsymptombasierte Notfallmedizin“ ist ein perfektes<br />
Unterstützungsmanual für alle Mediziner,<br />
die Akut- und Notfallpatienten versorgen müssen,<br />
sowie für Pflege- und Assistenzberufe der Notaufnahme.<br />
Kompaktes Wissen auf einen Blick.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
21
BÜCHER<br />
Soziologie der<br />
Unternehmung<br />
Erfolgreiche Führung und Organisation<br />
von komplexen Systemen<br />
Wilhelm Berning betrachtet in seinem Handbuch<br />
die Beschäftigten als Individuen mit eigenem<br />
unterschiedlichem, wechselhaftem Verhalten.<br />
In diesem Verhalten steckt die Ursache<br />
für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren<br />
von Unternehmen. Das Buch beleuchtet das<br />
menschliche Miteinander und die damit verbundenen<br />
Probleme und zeigt Handlungsmöglichkeiten<br />
auf. Dabei spielt das Thema Führung<br />
eine herausgehobene Rolle. Anhand eines idealtypischen<br />
Unternehmens mit allen erstrebenswerten<br />
Management-, Führungs- und Unternehmenswerten<br />
werden Handlungsweisen für<br />
real-existierende Unternehmen abgeleitet. Dabei<br />
bezieht sich der Autor sowohl auf Luhmanns<br />
Überlegungen zur Systemtheorie als auch<br />
auf Überlegungen zur Complexity Leadership<br />
Theory und komplexen adaptiven Systemen.<br />
Gesprächs- und<br />
Verhandlungsführung<br />
20 Konfliktsimulationen für Beratung,<br />
Training und Coaching<br />
Das Buch von Matthias Schreblowski umfasst<br />
20 Konfliktsimulationen zur Gesprächs- und<br />
Verhandlungsführung für Beratung, Training,<br />
Coaching. Mit den Simulationen können grundlegende<br />
Fähigkeiten trainiert werden, wie z.B.<br />
aktives Zuhören, verständliches Formulieren,<br />
geschicktes Fragen oder das Steuern von Gesprächen<br />
und Verhandlungen.<br />
Die Simulationen können aber auch genutzt<br />
werden, um spezielle Fertigkeiten zu üben, etwa<br />
psychologisch günstig zu argumentieren, eine<br />
Wilhelm Berning: Soziologie der<br />
Unter nehmung – Eine systemische<br />
Analyse von Organisation und Führung;<br />
Schäffer-Poeschel Verlag;<br />
www.schaeffer-poeschel.de;<br />
ISBN: 978-3-7910-58232-0<br />
Matthias Schreblowski:<br />
Gesprächs- und Verhandlungsführung –<br />
20 Konfliktsimulationen für Beratung,<br />
Training und Coaching; Schäffer-Poeschel<br />
Verlag; www.schaeffer-poeschel.de;<br />
ISBN: 978-3-7910-5829-0<br />
Christian Lagger, Clemens Sedmak:<br />
Leadership ohne Blabla – Wahrnehmen,<br />
Zuhören, Entscheiden; Molden Verlag;<br />
www.styriabooks.at/molden;<br />
ISBN: 978-3-222-15109-5<br />
positive Gesprächsatmosphäre aufzubauen und<br />
zu erhalten, Teamverhandlungen vorzubereiten<br />
und zu führen oder Grundsätze des Harvard-<br />
Konzeptes anzuwenden. Kurz gesagt: Die Simulationen<br />
sind Übungsfelder. Was die Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmer in den Simulationen<br />
üben bzw. erlernen, hängt von den Lernzielen<br />
im Einzelfall ab.<br />
Die Simulationen sind u. a. einsetzbar in offenen<br />
Weiterbildungsveranstaltungen, bei internen<br />
Firmentrainings und Webinaren, in Seminaren<br />
an Fachhochschulen und Universitäten und in<br />
Einzelcoachings. Die Konflikte in den Simulationen<br />
sind vielfältig und unterschiedlich komplex.<br />
Sie reichen von internen Konflikten zwischen<br />
Vorgesetzten und Mitarbeitenden in Organisationen<br />
über Konflikte zwischen Marktpartnern bis<br />
hin zu einer politischen Verhandlung zwischen<br />
zwei Ländern.<br />
Leadership ohne Blabla<br />
Wahrnehmen, Zuhören, Entscheiden<br />
Dieses Leadership-Buch von Christian Lagger<br />
und Clemens Sedmak ist anders als andere<br />
Leadership-Bücher. Es enthält Anregungen für<br />
(selbst)kritisches Nachdenken statt vermeintlicher<br />
Erfolgsrezepte. Es vermittelt Führungserfahrungen<br />
statt Führungstechniken. Und es<br />
beschreibt ein mögliches Werte-Fundament<br />
von Führung und verzichtet dafür auf das gängige<br />
Postulat von Führungsregeln. Denn wer<br />
mit Menschen arbeitet, nimmt zuallererst wahr<br />
und hört aufmerksam zu, bevor er oder sie entscheidet.<br />
Führungskräfte ohne Blabla verfügen<br />
neben der fachlichen auch über kognitive und<br />
emotionale Intelligenz, verknüpfen Führung mit<br />
Selbstführung, sind mutig und vor allem demütig.<br />
Denn echtes Leadership ist kein Selbstverwirklichungsprogramm,<br />
sondern dient einer<br />
sinnvollen Sache.<br />
Fotos: Verlage<br />
22 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
FÜHRUNG VERSTEHEN<br />
Metakognition<br />
Dieses Thema ergibt sich aus einem Problem,<br />
das Führung ganz besonders betrifft.<br />
Wer heute führt, muss imstande sein, aus<br />
dem unaufhörlichen „Rauschen“, aus dem<br />
Organisationen letztlich bestehen, die relevanten<br />
Informationen zu gewinnen. Relevant<br />
heißt: Den Unterschied erkennen, der einen<br />
Unterschied macht. Und Rauschen, ein Begriff<br />
aus der Nachrichtentechnik, bezeichnet<br />
die Überfülle unspezifischer Signale, die den<br />
Empfänger entweder einlullen oder ihn in<br />
die mentale Erschöpfung treiben können.<br />
Um dieses Rauschen zu bewältigen oder gar<br />
zu meistern, braucht es die anspruchsvolle<br />
Fähigkeit, das eigene Denken zu regulieren:<br />
Metakognition oder überlegtes Denken.<br />
Dazu gehört zunächst einmal ein Wissen<br />
darüber, was man als Führungskraft aus<br />
der ständigen Signalflut tatsächlich auszuwählen<br />
hat, und wann und wie die gewonnenen<br />
Informationen am zweckmäßigsten<br />
einzusetzen sind. Hinzu kommt die Bereitschaft,<br />
über die eigenen Denkprozesse zu<br />
reflektieren. Wie komme ich in meiner Führungstätigkeit<br />
vorwiegend zu Erkenntnissen<br />
– rasch und mühelos, angestrengt und<br />
kontrolliert, spontan und intuitiv, abwartend<br />
und zweifelnd, mithilfe von Logik oder durch<br />
Daumenregeln? Metakognition ist eine Bewertungsinstanz.<br />
Mit ihr werden gewohnte<br />
Denkmuster offengelegt, auf ihre Wirksamkeit<br />
geprüft und – wenn sinnvoll – durch<br />
zweckmäßigere ersetzt.<br />
Oft liest oder hört man, unser Gehirn sei ein<br />
fehleranfälliges Organ, sonst gäbe es nicht<br />
so viele Sinnestäuschungen. Das Wort „Fehler“<br />
unterstellt, dass es eine objektiv wahre<br />
Welt gibt, die das Gehirn gefälligst präzise<br />
abzubilden hat. Das Gegenteil ist der Fall.<br />
Wir haben Landkarten und nicht die Landschaft<br />
im Kopf. Die Landkarten sollen uns<br />
einigermaßen verlässlich durch den Alltag<br />
lenken. Sie entstehen, indem wir die vielfältigen<br />
Eindrücke von der Welt durch unsere<br />
Erfahrungen, Einstellungen, Vorlieben, Werte<br />
und Glaubenssätze filtern. Durch diese Verengung<br />
unserer Kognition entgehen uns oft<br />
Bilder, die passender oder nützlicher gewesen<br />
wären als die tatsächlich erfahrenen.<br />
Das Erkannte ist nicht falsch, es ist verzerrt.<br />
Beispiele für solche kognitiven Verzerrungen<br />
gibt es zuhauf. So neigen wir zum Beispiel<br />
dazu, uns für eine höhere Zahl zu entscheiden,<br />
wenn wir zuvor bereits mit hohen Zahlen,<br />
auch in einem ganz anderen Kontext,<br />
konfrontiert waren. Wir beharren störrisch<br />
auf einer Annahme, obwohl neue Informationen<br />
dagegensprechen. Im ungeordneten<br />
Rauschen von Signalen erkennen wir Muster,<br />
die einer Überprüfung gar nicht standhalten.<br />
Wir glauben hartnäckig, den Zufall<br />
beeinflussen zu können, obwohl wir gerade<br />
eine Kette von negativen Ergebnissen zu<br />
verkraften hatten. Wir wählen aus mehreren<br />
Informationen jene aus, die unsere Erwartungen<br />
bestätigen – und so fort.<br />
Krönung der Metakognition ist die Fähigkeit<br />
des Entlernens, Leerwerdens oder Zurückspulens.<br />
„Man entdeckt keine neuen Weltteile,<br />
ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus<br />
den Augen zu verlieren“, schrieb André Gide.<br />
Und der Ökonom John Maynard Keynes ergänzt:<br />
„Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr<br />
in den neuen Gedanken als in der Befreiung<br />
von den alten.“ Statt von Gedanken sprechen<br />
wir heute von mentalen Modellen. Sie<br />
haben sich oft radikal überholt und beherrschen<br />
dennoch hartnäckig unser Denken. In<br />
drei Schritten können wir uns dieser mentalen<br />
Modelle entledigen und Platz für neues<br />
Denken schaffen.<br />
Erstens, sich mit Menschen zusammenzutun,<br />
die völlig konträr an Probleme herangehen<br />
und dafür Lösungen entwickeln.<br />
Dies zwingt zum Hinterfragen des eigenen<br />
Tuns. Im nächsten Schritt sich bestimmte<br />
gewohnte Denk- und Vorgehensweisen<br />
verbieten („Nein, so mache ich das ab sofort<br />
nicht mehr!“). Und anschließend altes<br />
Wissen entsorgen, indem alle Quellen dafür<br />
– persönliche Kontakte, Handbücher,<br />
Softwareprogramme, technische Hilfsmittel<br />
etc. – trockengelegt oder eliminiert werden.<br />
Wie schwierig, aber beileibe nicht unmöglich,<br />
Entlernen sein kann, zeigt das Beispiel<br />
Radfahren. Es gehört zum prozeduralen Wissen<br />
und bleibt uns an sich ein Leben lang<br />
erhalten. Durch Üben mit einem verrückten<br />
Fahrrad („Backwards Brain Bicycle“) – wenn<br />
ich nach links lenke, so steuert das Rad nach<br />
rechts und umgekehrt – gelingt es, das Gehirn<br />
auszutricksen und eine fest verwurzelte<br />
Fähigkeit zu entlernen.<br />
Foto: © privat<br />
AO. UNIV.-PROF. DR. HEINZ K. STAHL<br />
Forschungspartner<br />
des Zentrums für<br />
systemische<br />
Forschung und Beratung,<br />
Heidelberg<br />
info@hks-research.at<br />
www.hks-research.at<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
23
NEUES<br />
Foto: © BBraun<br />
Erster Pflegedienst Österreichs<br />
nach dem ICW-Wundsiegel zertifiziert<br />
Gabriele Schneider, Madeleine Gerber (beide ICW),<br />
Peter Kurz, Friedrich Thomasberger<br />
Das ICW-Wundsiegel ® ist ein Qualitätssiegel für spezialisierte<br />
Gesundheitseinrichtungen, die Patienten mit chronischen und<br />
schwer heilenden Wunden behandeln. Die mit dem ICW-Wundsiegel<br />
® zertifizierten Wundzentren müssen nachweisen, dass sie<br />
die strukturellen und fachlichen Anforderungen an die Behandlung<br />
und Versorgung erfüllen und über ein etabliertes Qualitätsmanagementsystem<br />
verfügen.<br />
Die Anforderungen sind in Erhebungsbögen mit Qualitätskriterien<br />
zusammengefasst. Bei der Festlegung der Qualitätsindikatoren<br />
spielen Leitlinien eine wichtige Rolle. Bewertet werden u.a. die<br />
Führung des Wundzentrums, das unterstützende Netzwerk – z.B.<br />
Fachärzte und Diagnostikeinrichtungen – sowie der laufende Betrieb.<br />
Besonderes Augenmerk wird auch auf die kontinuierliche<br />
Verbesserung der Prozesse gelegt.<br />
Das WPM Wundzentrum Bad Pirawarth wurde Anfang des Jahres<br />
auditiert und erreichte in den insgesamt 44 Prüfkriterien auf Anhieb<br />
mehr als die für die Zertifizierung notwendigen Punkte. Auch<br />
wurden die Qualitätsziele beeindruckend übertroffen. So konnte<br />
z.B. eine NPS (Net Promotor Score) von 83 % erreicht werden<br />
(>80 = hervorragend). In weiterer Folge ist für Herbst 2<strong>02</strong>4 ein<br />
Überwachungsaudit geplant. Die Rezertifizierung findet dann wieder<br />
im Jahr 2<strong>02</strong>6 statt.<br />
Impressum nach § 24 MedienG: Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: Springer-Verlag GmbH, Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 Wien; T: +43(0)1/330 24 15-0,<br />
F: +43(0)1/330 24 26, E: springer@springer.at, Web: www.gesundheitswirtschaft.at. Geschäftsführung: Dr. Alois Sillaber, Joachim Krieger, Juliane Ritt. Chefredakteur:<br />
Mag. Roland Schaffler, schaffler@iqm.at. Anzeigen: Michaela Pfeffinger, michaela.pfeffinger@springer.at. Druck: F&W Mediencenter GmbH, Kienberg. Grafik: Ad-Ventures,<br />
Graz. Auf die Hinzufügung der jeweiligen weiblichen Formulierungen wird bei geschlechtsspezifischen Hinweisen im Sinne der flüssigen Lesbarkeit und einer angemessenen<br />
Sprachqualität zum Teil verzichtet. Alle personalen Begriffe sind sinngemäß geschlechtsneutral zu lesen. Weitere Informationen und Offenlegung nach § 25<br />
MedienG: www.gesundheitswirtschaft.at „Impressum“. Datenschutzerklärung: www.gesundheitswirtschaft.at/datenschutzerklaerung<br />
24 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
NEUES<br />
IQM Mitgliedskrankenhäuser<br />
veröffentlichen Qualitätsergebnisse<br />
Unter dem Motto „konsequent transparent<br />
– medizinische Behandlungsqualität<br />
im Fokus“ veröffentlichten rund 500 IQM<br />
Mitgliedskrankenhäuser am 24.05.2<strong>02</strong>3<br />
ihre Qualitätsergebnisse für das Jahr 2<strong>02</strong>2.<br />
„Von Krankenhäusern wird zurecht die<br />
bestmögliche medizinische Versorgung erwartet.<br />
Mit der Initiative Qualitätsmedizin<br />
(IQM) wollen wir eine hochwertige Behandlungsqualität<br />
auch bei zunehmenden Patientenzahlen<br />
und trotz Fachkräftemangels<br />
sicherstellen und weiter verbessern – heute<br />
und in Zukunft“, sagt Axel Ekkernkamp,<br />
kommissarischer Vorsitzender von IQM,<br />
an deren Qualitätssicherungssystem sich<br />
inzwischen rund 500 Krankenhäuser in<br />
Deutschland und der Schweiz beteiligen.<br />
Um eine kontinuierliche Verbesserung von<br />
Prozessen zu erreichen, setzt die Initiative<br />
auf die transparente Veröffentlichung von<br />
nicht manipulierbaren, sogenannten Routinedaten.<br />
Für das Jahr 2<strong>02</strong>2 haben die<br />
Kliniken jetzt ihre Qualitätsdaten vorgelegt.<br />
Die Ergebnisse werden auf Grundlage<br />
der German Inpatient Quality Indicators<br />
(G-IQI) bzw. der Swiss Inpatient Quality<br />
Indicators (CH-IQI) berechnet. Sie ermöglichen<br />
einen Vergleich mit dem Bundesreferenzwert,<br />
jedoch ohne ein öffentliches<br />
Ranking der IQM Mitgliedskrankenhäuser.<br />
„Nach außen sind die IQM Ergebnisse<br />
dem Fachpublikum sowie der breiten Öffentlichkeit<br />
eine transparente und neutrale<br />
Informationshilfe in Bezug auf die Qualität<br />
der medizinischen Versorgung. Nach innen<br />
sind sie der Motor zur kontinuierlichen<br />
Verbesserung, beispielsweise durch Peer<br />
Reviews“, so Jörg Martin, 1. Direktor – öffentlich-rechtliche<br />
Trägergruppe.<br />
Für die teilnehmenden Krankenhäuser<br />
sind die Qualitätsergebnisse Aufgreifkriterien<br />
für die Durchführung von Peer Reviews.<br />
Das interdisziplinäre und auf kollegialen<br />
Austausch fokussierte Verfahren<br />
identifiziert Optimierungspotenziale bei<br />
der Behandlung im IQM Mitgliedskrankenhaus,<br />
die am Ende in einem Maßnahmenplan<br />
zur kontinuierlichen Verbesserung<br />
der medizinischen Behandlungsqualität<br />
festgehalten werden. Allein in den vergangenen<br />
6 Monaten konnten nach der<br />
Pandemie bereits wieder knapp 50 Peer<br />
Reviews durchgeführt werden. Mit diesen<br />
Bemühungen zeigen die Mitgliedskrankenhäuser,<br />
dass sie auch weiterhin am<br />
kontinuierlichen Verbesserungsprozess<br />
festhalten wollen und werden.<br />
Quelle, weitere Informationen sowie Gesamtergebnisse<br />
der IQM Mitgliedskrankenhäuser:<br />
www.initiative-qualitaetsmedizin.de<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
25
NEUES<br />
IGeL-Report 2<strong>02</strong>3<br />
Selbstzahlerleistungen in der Arztpraxis weiterhin<br />
fragwürdig − Patientinnen und Patienten müssen<br />
besser informiert werden<br />
negativ“, „negativ“ oder „unklar“ ab. Für<br />
den Nutzen gibt es meistens keine ausreichende<br />
Evidenz. Keine dieser Leistungen<br />
konnte mit „positiv“ bewertet werden, mit<br />
„tendenziell positiv“ schneiden lediglich 2<br />
Selbstzahlerleistungen ab.<br />
Der IGeL-Monitor hat zum vierten Mal<br />
Versicherte zu Individuellen Gesundheitsleistungen<br />
(IGeL) und zum Umgang damit<br />
in den ärztlichen Praxen befragt. Das<br />
Geschäft mit diesen Verkaufsangeboten<br />
läuft auf hohem Niveau. Zu den Top-Sellern<br />
gehören IGeL, die nachweislich mehr<br />
schaden als nützen. Patientenrechte werden<br />
oft nicht beachtet. Die gestiegene<br />
Nachfrage durch junge Patientinnen und<br />
Patienten gibt Anlass zur Sorge – viele<br />
wissen wenig über Nutzen und Schaden<br />
von IGeL.<br />
In einer repräsentativen Befragung hat<br />
der IGeL-Monitor für seinen IGeL-Report<br />
2<strong>02</strong>3 knapp 6.000 Versicherte im Alter von<br />
20 bis 69 Jahren befragt. Die Bekanntheit<br />
von IGeL ist unverändert groß: Fast 80<br />
Prozent der Befragten gaben an, Selbstzahlerleistungen<br />
zu kennen. Nur gut jeder<br />
Vierte (28 Prozent) weiß, dass es verbindliche<br />
Regeln beim Verkauf von IGeL in der<br />
Praxis gibt. Dazu gehört, dass Patientinnen<br />
und Patienten über den wahrscheinlichen<br />
Nutzen und mögliche Risiken oder<br />
Schäden durch die Leistung aufzuklären<br />
sind. Über den Nutzen wurden 78 Prozent<br />
informiert, über mögliche Schäden nur<br />
56 Prozent. Fast jeder Fünfte (18 Prozent)<br />
gibt sogar an, dass seine Behandlung mit<br />
einer Kassenleistung vom Kauf einer IGeL<br />
abhängig gemacht wird.<br />
Die Top 10 der am meisten verkauften<br />
Selbstzahlerleistungen sind im Vergleich<br />
zum IGeL-Report 2<strong>02</strong>0 nahezu unverändert:<br />
Ultraschalluntersuchungen der<br />
Eierstöcke und der Gebärmutter zur<br />
Krebsfrüherkennung sowie verschiedene<br />
Glaukom-Früherkennungsuntersuchungen,<br />
zusätzlicher Abstrich zur Früherkennung<br />
von Gebärmutterhalskrebs,<br />
der PSA-Test zur Früherkennung von<br />
Prostatakrebs, zusätzliche Hautkrebsscreenings,<br />
zusätzliche Ultraschalluntersuchungen<br />
in der Schwangerschaft,<br />
Ultraschall der Brust zur Krebsfrüherkennung<br />
und Untersuchungen des Blutbilds.<br />
Ultraschall der Eierstöcke am<br />
meisten verkauft − obwohl der<br />
Schaden überwiegt<br />
Der Ultraschall zur Krebsfrüherkennung<br />
der Eierstöcke und der Gebärmutter wurde<br />
nach der Befragung am meisten verkauft.<br />
Die Leistung bewertet der IGeL-Monitor<br />
mit „negativ“ und „tendenziell negativ“.<br />
Denn bei dieser Untersuchung kann es<br />
häufig zu falsch-positiven Befunden und<br />
dadurch zu unnötigen weiteren Untersuchungen<br />
und Eingriffen kommen, die erheblich<br />
schaden können. „Die oft jungen<br />
Frauen werden völlig unnötig in Angst und<br />
Schrecken versetzt. Die Untersuchung<br />
hat als Früherkennung keinen Nutzen; sie<br />
kann aber definitiv schaden und wird deshalb<br />
auch von den gynäkologischen Fachgesellschaften<br />
abgelehnt. Diese Leistung<br />
dürfte überhaupt nicht mehr angeboten<br />
werden, wenn man Patientensicherheit<br />
ernst nimmt“, sagte Stefan Gronemeyer,<br />
Vorstandsvorsitzender des Medizinischen<br />
Dienstes Bund.<br />
Die Gesamtbilanz der IGeL<br />
überzeugt nicht – die Evidenz<br />
ist meistens dünn<br />
Aber auch bei den anderen Selbstzahlerleistungen<br />
sind Zweifel angebracht. Das<br />
Wissenschaftsteam des IGeL-Monitors<br />
bewertet seit über zehn Jahren evidenzbasiert<br />
den Nutzen und Schaden von Individuellen<br />
Gesundheitsleistungen und bereitet<br />
die Informationen für die Versicherten<br />
laienverständlich auf. Ziel ist es, den Patientinnen<br />
und Patienten eine wissensbasierte<br />
Entscheidungshilfe anzubieten.<br />
Der IGeL-Monitor hat 55 IGeL bewertet<br />
– 53 Leistungen schließen mit „tendenziell<br />
Bewertungen stehen im Einklang<br />
mit medizinischen Leitlinien<br />
Das Wissenschaftsteam des IGeL-Monitors<br />
wertet bei der Analyse des Nutzenund<br />
Schadenpotenzials nicht nur wissenschaftliche<br />
Studien aus, sondern gleicht<br />
seine Ergebnisse auch mit internationalen<br />
Leitlinien ab. Leitlinien sind evidenzbasierte<br />
Empfehlungen zu medizinischen Maßnahmen,<br />
die von den Fachgesellschaften<br />
konsentiert werden und die Ärztinnen und<br />
Ärzte sowie Patientinnen und Patienten<br />
bei der Entscheidungsfindung unterstützen<br />
sollen. Der IGeL-Monitor hat seine Bewertungen<br />
zu den Top 10 der am meisten<br />
verkauften IGeL aktuell mit den Empfehlungen<br />
in den Leitlinien abgeglichen: Sie<br />
stehen damit in Einklang.<br />
Junge Patientinnen und Patienten<br />
besser informieren<br />
Die Bekanntheit von IGeL hat bei den jüngeren<br />
Patientinnen und Patienten deutlich<br />
zugenommen. Beim IGeL-Report 2<strong>02</strong>3<br />
gaben 73 Prozent der 20- bis 39-Jährigen<br />
an, IGeL zu kennen; 2<strong>02</strong>0 waren es 63<br />
Prozent. Jeder Zweite schätzte dabei die<br />
Leistungen als wichtig für den Erhalt der<br />
Gesundheit ein. Diese Altersgruppe ist<br />
auch bereit, dafür Geld auszugeben, und<br />
nutzt Pauschal- und Kombiangebote in<br />
den Praxen, bei denen mehrere Leistungen<br />
zu einem vergünstigten Paketpreis<br />
angeboten werden. Das ist eine deutliche<br />
Veränderung: Vor einigen Jahren<br />
wurden IGeL vor allem an Versicherte ab<br />
50 Jahren verkauft. Inzwischen werden<br />
die IGeL immer häufiger auch an jüngere<br />
Menschen verkauft. Das zeigt, dass es<br />
sehr wichtig ist, junge Menschen besser<br />
abzuholen und zielgruppengerecht zu informieren.<br />
Quelle: Medizinischer Dienst Bund,<br />
IGeL-Monitor, www.igel-monitor.de<br />
26 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
NEUES<br />
Die Simulationsfläche des Living Lab<br />
ergänzt mit Augmented Reality.<br />
Foto: © Ramon Lehmann<br />
Swiss Center for Design and Health<br />
Das Swiss Center for Design and Health<br />
(SCDH) in Nidau ist das jüngste nationale<br />
Technologiekompetenzzentrum. An der<br />
Schnittstelle von Design und Gesundheit<br />
entwickelt es Lösungen und Standards für<br />
aktuelle Herausforderungen im Gesundheitswesen.<br />
Das Living Lab ist das Herzstück des als<br />
Public-Private-Partnership gegründeten<br />
nationalen Technologiekompetenzzentrums.<br />
An der Schnittstelle von Design und<br />
Gesundheit verbindet es interdisziplinäre<br />
Forschung und Privatwirtschaft mit dem<br />
Blick auf den Wissens- und Technologietransfer.<br />
Ziel des Zentrums sind die Entwicklung<br />
und Implementierung nachhaltiger<br />
Lösungen und Standards für aktuelle<br />
Herausforderungen im Gesundheitswesen.<br />
Hierzu gehören beispielsweise die<br />
steigenden Gesundheitskosten, der Fachkräftemangel<br />
und der Anpassungsdruck<br />
von Räumen und Architektur an physisches<br />
und psychisches Wohlbefinden<br />
oder gesteigerte ökologische Ansprüche.<br />
Pläne und Räume im Maßstab 1:1<br />
evaluieren und optimieren<br />
Das Living Lab als schweizweit größte Extended-Reality-Simulationsfläche<br />
und die<br />
Musterzimmer bieten eine Planungs- und<br />
Simulationsplattform. Auf der 560 Quadratmeter<br />
großen Fläche können Grundrisse<br />
komplexer Bauvorhaben im Maßstab 1:1<br />
projiziert, mit Leichtbauwänden und Mobiliar<br />
ergänzt und mit Augmented-Reality<br />
erlebbar gemacht werden. Auf weiteren<br />
300 Quadratmetern können Musterzimmer<br />
für Institutionen wie Krankenhäuser oder<br />
Pflegeeinrichtungen probeweise gestaltet<br />
und eingerichtet werden. Damit werden<br />
Materialen geprüft und Faktoren rund um<br />
Licht, Farbe, Akustik oder Haptik gemessen.<br />
Beide Simulationen ermöglichen es,<br />
in einer frühen Projektphase Fehler zu vermeiden<br />
und Prozesse zu optimieren. Die<br />
Beteiligten können in die Planung involviert<br />
werden. Das gibt beispielsweise bei Bauprojekten<br />
mehr Planungssicherheit und<br />
hilft Kosten zu sparen.<br />
Quelle: Gemeinsame Medienmitteilung<br />
des Kantons Bern und des<br />
Swiss Center for Design and Health.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
27
NEUES<br />
Ende der Pandemie: Eine offene, kritische und<br />
konstruktive „Nachbesprechung“ ist unverzichtbar<br />
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.<br />
Die Pandemie ist das Brennglas, das Mängel<br />
im System überdeutlich zeigt. Oder –<br />
die Pandemie ist die größte Herausforderung<br />
für Land und Gesellschaft seit dem<br />
Zweiten Weltkrieg. Diese und ähnliche<br />
Aussagen begleiten uns seit März 2<strong>02</strong>0<br />
und fordern eigentlich unabdingbar eine<br />
intensive Aufarbeitung des Umgangs mit<br />
dem Verlauf der letzten drei Jahre, sowohl<br />
mit dem medizinischen und virologischen<br />
Fortgang wie auch vor allem mit Nutzen<br />
und Schaden der diversen Maßnahmen.<br />
Umso erstaunlicher, wie unterschiedlich<br />
in den Ländern und Gesellschaften damit<br />
umgegangen worden ist. Von der expliziten<br />
Verweigerung, um nicht in einem<br />
Kampf um die Deutungshoheit zu landen,<br />
bis hin zu einer bereits während der Pandemie<br />
begonnenen Aufarbeitung ist alles<br />
zu beobachten. Und das mit allen bekannten<br />
Schwachpunkten wie der Evaluation<br />
durch Kommissionen und Projekte mit<br />
den gleichen Personen, die zuvor tragende<br />
Rollen in der Politikberatung während<br />
der Pandemie hatten. Oder auch die Verlagerung<br />
in Projekte, deren Ergebnisse bei<br />
Erscheinen vorhersagbar niemanden mehr<br />
interessieren und im politischen Tagesgeschäft<br />
untergehen.<br />
Gerade wegen der großen Einigkeit – über<br />
fast alle Interessengruppen hinweg – betreffend<br />
weitere Pandemien in der Zukunft<br />
erscheint die Aufarbeitung nicht nur wünschenswert,<br />
sondern geradezu unvermeidlich.<br />
Diese Situation und ihre Komplexität<br />
wurde sehr konzise in einem offenen<br />
Brief beschrieben, der mit 44 Erstunterzeichnern<br />
am 20. April 2<strong>02</strong>3 veröffentlicht<br />
wurde und seitdem für weitere Unterstützung<br />
durch Unterschriften im Internet zugänglich<br />
ist (pandemieaufarbeitung.net).<br />
Das Besondere an diesem Brief ist, dass<br />
er – sowohl durch die Erstunterzeichner<br />
wie auch durch die weiteren Unterstützer<br />
– in der Thematisierung über die übliche,<br />
beschränkte virologisch-medizinischen<br />
Perspektive hinausgeht und konsequent<br />
die gesamtgesellschaftliche Betrachtung<br />
einmahnt:<br />
„Eine offene, kritische und konstruktive<br />
‚Nachbesprechung‘ ist unverzichtbarer<br />
Teil eines jeden professionellen Krisenmanagements.<br />
Dabei ist neben dem objektiven<br />
Lernprozess auch die integrative<br />
Wirkung einer offenen Debatte auf die<br />
Zivilgesellschaft wesentlich. Hierzu gehört<br />
ein sachlicher Austausch unterschiedlicher<br />
Standpunkte als zentrales Merkmal<br />
einer demokratischen Diskussions- und<br />
Lösungskultur.“ Damit greift der Brief<br />
einen der zentralen Schwachpunkte der<br />
letzten drei Jahre auf: den Fokus auf den<br />
engen, nur auf die gesundheitlichen Gefahren<br />
und Lebensgefahr durch das Virus<br />
beschränkten vermeintlichen Nutzen der<br />
Maßnahmen zu legen. Bewertungen von<br />
Maßnahmen fußen immer auf der Abwägung<br />
zwischen Nutzen und Schaden unter<br />
Berücksichtigung der Kosten. Jahrzehnte<br />
der Entwicklung der HTA-Methodik haben<br />
dafür ein Fundament entwickelt, das genutzt<br />
werden sollte und muss.<br />
Quelle: Gerd Antes, ehemaliger Leiter<br />
des Deutschen Cochrane Zentrums,<br />
Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-<br />
Universität Freiburg, Editorial des HTA Austria<br />
Newsletters Mai 2<strong>02</strong>3. aihta.at<br />
Wege zur Entlastung<br />
der Pflege<br />
Immer mehr Menschen haben Anspruch auf Leistungen aus der<br />
sozialen Pflegeversicherung: Zwischen 2016 und 2<strong>02</strong>1 ist die Zahl<br />
der pflegebedürftigen Menschen von 3,1 Millionen auf 5 Millionen<br />
gestiegen. Voraussetzung für den Bezug von Pflegeleistungen<br />
ist die Pflegebegutachtung beim Medizinischen Dienst. Die<br />
Begutachtungszahlen des Medizinischen Dienstes sind von 1,8<br />
Millionen im Jahr 2016 auf 2,6 Millionen in 2<strong>02</strong>2 gestiegen − Tendenz<br />
weiter steigend. Durch den Fachkräftemangel stehen jedoch<br />
immer weniger Pflegefachkräfte für die Begutachtung zur Verfügung.<br />
Um die Pflegebegutachtung und damit die Versorgung<br />
der Pflegebedürftigen zeitnah gewährleisten zu können, ist eine<br />
Flexibilisierung der Begutachtungsformate notwendig, sodass in<br />
bestimmten Fällen neben der Begutachtung im Hausbesuch auch<br />
das strukturierte Telefoninterview und die Videobegutachtung eingesetzt<br />
werden können. Ein wichtiger Schritt, um die Versorgung<br />
im demografischen Wandel sicherzustellen.<br />
Zur Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung und Entlastung<br />
in der Pflege (PUEG) am 26. Mai erklärt Carola Engler,<br />
stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes<br />
Bund: „Der Medizinische Dienst Bund begrüßt ausdrücklich,<br />
dass mit dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz die<br />
Möglichkeit geschaffen wird, in bestimmten Fällen die Pflegebegutachtung<br />
mittels strukturierten Telefoninterviews zu ermöglichen.<br />
Dies ist ein wichtiger Schritt, um für die Versicherten auch<br />
in Zeiten des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels<br />
den zeitnahen Zugang zu Pflegeleistungen sicherstellen<br />
zu können.<br />
Quelle: Pressemitteilung Medizinischer Dienst Bund, www.md-bund.de<br />
28 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
NEUES<br />
Sektorenübergreifende Patientenbefragung:<br />
Ergebnisbericht 2<strong>02</strong>2<br />
EMA<br />
annual report 2<strong>02</strong>2<br />
Mit dem Bundes-Zielsteuerungsvertrag 2013 wurde die Erhebung der Zufriedenheit<br />
der Bevölkerung mit dem Gesundheitssystem beschlossen.<br />
Die regelmäßige Durchführung von sektorenübergreifenden Befragungen<br />
zur Patientensichtweise in Hinblick auf die Leistungen im Gesundheitswesen<br />
ist im laufenden Bundes-Zielsteuerungsvertrag verankert.<br />
Patientinnen und Patienten sind wichtige Informationsträger im Gesundheitswesen,<br />
da sie Stärken, Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten<br />
über Sektorengrenzen hinweg wahrnehmen und diese aus ihrer Sichtweise<br />
beurteilen. Die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden, bieten<br />
die Möglichkeit, konkrete Maßnahmen abzuleiten, die zu einer kontinuierlichen<br />
Optimierung des gesamten Versorgungsprozesses führen und damit<br />
dazu beitragen, die Qualität des österreichischen Gesundheitswesens<br />
weiter zu steigern.<br />
Schwerpunkt der von der GÖG in Kooperation mit Bund, Ländern und<br />
Sozialversicherung entwickelten Befragung ist die Erhebung der Patientensicht<br />
zu den Prozessen innerhalb der einzelnen Versorgungsbereiche<br />
sowie insbesondere zu den Abläufen zwischen dem ambulanten und dem<br />
stationären Gesundheitsversorgungsbereich.<br />
Methodischer Hintergrund<br />
Der Fragebogen, der bereits im Jahr 2015 zum Einsatz kam, wurde im<br />
Vorfeld der Befragung 2<strong>02</strong>2 teilweise sprachlich vereinfacht bzw. wurden<br />
Antwortoptionen geschärft. Weiters wurden zwei Fragen zum Thema CO-<br />
VID-19 ergänzt. Die Befragung 2<strong>02</strong>2 wurde wie im Jahr 2015 schriftlich<br />
durchgeführt, die Fragebogen wurden auf dem Postweg versandt. Die Patientinnen<br />
und Patienten konnten den Fragebogen entweder postalisch<br />
retournieren oder online ausfüllen. Insgesamt konnte bei 10.001 ausgesandten<br />
Fragebögen eine Stichprobe von 2.306 Patientinnen und Patienten<br />
erzielt werden, das entspricht einem Rücklauf von 23 Prozent.<br />
Ergebnisse<br />
Alle Ergebnisse sind im Ergebnisbericht (Download unter https://jasmin.<br />
goeg.at/id/eprint/2772) dargestellt und interpretiert. Die Mitbestimmung<br />
des Termins zur Aufnahme finden 60,2 % der Befragten für ausreichend.<br />
Die Einbeziehung in Entscheidungen über die eigene Behandlung findet<br />
bei 90,1 % Zustimmung. Die Verständlichkeit der Informationen wird von<br />
95,5 % der Befragten bestätigt, die Einbeziehung in Entscheidungen zur<br />
weiteren Behandlung zu 94,2 %. Die Zusammenarbeit der Gesundheitsdienstleister<br />
wird zu 87 % als gut eingeschätzt. Den Wunsch nach einer<br />
professionellen Ansprechperson für die Koordination der Behandlung bzw.<br />
Betreuung unterstreichen dennoch 80,7 %.<br />
Quelle: BMSGPK (2<strong>02</strong>3): Sektorenübergreifende Patientenbefragung. Ergebnisbericht<br />
2<strong>02</strong>2. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Wien<br />
EMA published its annual report 2<strong>02</strong>2 on May 15.<br />
The report provides an overview of the Agency’s<br />
activities to protect and promote public and<br />
animal health in the European Union (EU).<br />
The digital report outlines the most important<br />
highlights regarding the evaluation and monitoring<br />
of human and veterinary medicines and a selection<br />
of key figures. It also contains an interactive<br />
timeline of important milestones in 2<strong>02</strong>2, with<br />
advanced functionalities that allow readers to<br />
explore each topic in more depth by accessing<br />
additional documents, audio-visual materials and<br />
infographics.<br />
Ongoing and newly emerging public health emergencies<br />
remained a key focus area of EMA and its<br />
partners within the European medicines regulatory<br />
network in 2<strong>02</strong>2. Based on EMA’s scientific assessments,<br />
new vaccines and treatment options<br />
were added to the EU’s arsenal in the fight against<br />
COVID-19. When an outbreak of the mpox (monkeypox)<br />
virus brought an additional challenge to<br />
public health, the crisis preparedness tools established<br />
in the context of the Agency’s extended<br />
mandate were put to use, ensuring a coordinated<br />
EU response. The report includes an overview of<br />
EMA’s recommendations on vaccines and treatments<br />
for COVID-19 and for mpox. In addition, it<br />
highlights the Agency’s activities carried out to implement<br />
the EU regulation reinforcing EMA’s role in<br />
crisis preparedness and management for medicinal<br />
products and medical devices.<br />
EMA’s annual report also draws attention to other<br />
major achievements of the Agency, high-impact<br />
activities and challenges in 2<strong>02</strong>2. These include<br />
the implementation of the Clinical Trials Regulation,<br />
which entered into application in January 2<strong>02</strong>2, as<br />
well as the successful launches of the Clinical Trials<br />
Information System (CTIS) and the Accelerating<br />
Clinical Trials in the EU (ACT EU) initiative, which<br />
are remodelling the way clinical trials in Europe<br />
are initiated, designed and run. Additionally, the<br />
report presents EMA’s initiatives aimed at driving<br />
transformation in regulatory decision-making by<br />
building capability and capacity in the analysis<br />
and use of data and real-world evidence.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
29
NEUES<br />
Foto: © EKH/Hude<br />
Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt<br />
als europäisches Wundzentrum zertifiziert<br />
Das Team des Wundzentrums<br />
Als erstes Krankenhaus in Österreich und erst dritte Klinik in Europa<br />
ist das Elisabethinen-Krankenhaus Klagenfurt jetzt auch ein<br />
zertifiziertes Wundzentrum der „European Wound Management<br />
Association (EWMA)“. Bei der Behandlung von Patienten mit<br />
chronischen Wunden werden die Erfahrung der Beteiligten und<br />
die wissenschaftlichen Erkenntnisse der modernen Wundversorgung<br />
intensiv genutzt.<br />
Die Anerkennung ist eine Bestätigung der hohen Versorgungsqualität<br />
von akuten und chronischen Wunden und gleichzeitig eine<br />
Verpflichtung zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität,<br />
stets nach den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese<br />
Zertifizierung unterliegt regelmäßigen Kontrollen, welche alle<br />
drei Jahre durchgeführt werden und so dazu beitragen, die Qualität<br />
immer auf höchstem Niveau zu halten.<br />
Geleitet wird das frisch zertifizierte Wundzentrum von Jurij<br />
Gorjanc, Leiter der Allgemeinchirurgie am Elisabethinen-Krankenhaus<br />
Klagenfurt. Der Präsident der Europäischen Wundgesellschaft<br />
EWMA, Sebastian Probst, persönlich überbrachte dem interdisziplinären<br />
Team mit zertifizierten Wundmanagern der Pflege<br />
seine Glückwünsche zur erfolgreichen Zertifizierung. „Die Wundversorgung<br />
ist ein gemeinsames Anliegen vieler Disziplinen. Dank<br />
des multidisziplinären Ansatzes werden alle Aspekte der Wundbehandlung<br />
in einen umfassenden Behandlungsplan eingebunden,<br />
die dann dem Patienten und dem gesamten Gesundheitssystem<br />
zugute kommen.“<br />
Ganzheitliche Behandlung<br />
Bereits seit Jahren befasst sich das interdisziplinäre Team der<br />
Wundambulanz um Christiane Dreschl intensiv mit chronischen<br />
Wunden und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit fachgerechter<br />
Versorgung und den richtigen Therapiemaßnahmen den Heilungsprozess<br />
optimal in Gang zu setzen.<br />
Diese ganzheitliche Behandlung erfolgt im Wundzentrum fächerübergreifend.<br />
Dazu zählt auch eine umfassende Aufklärung der<br />
Erkrankten und begleitende Beratung bei sozialmedizinischen<br />
Fragen. Dabei garantiert die Zusammenarbeit mit Partnern und<br />
Organisationen der Hauskrankenpflege außerhalb des Krankenhauses<br />
eine umfassende und maßgeschneiderte Therapie.<br />
Quelle: Pressemitteilung A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt GmbH<br />
30 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
NEUES<br />
Aktionsbündnis Patientensicherheit<br />
stärkt Sicherheit in der medizinischen<br />
Behandlung<br />
Am 16. Februar 2<strong>02</strong>3 titelt die BILD-Zeitung: „Neue Schock-Zahlen aus Arztpraxen,<br />
Kliniken, Pflegeheimen. Jeden Tag 300 Mal Medizin-Pfusch“. Vorweg dazu: Wie hoch<br />
die Zahlen wirklich sind, ist in Deutschland nicht bekannt. Ob es wirklich 100.000<br />
Behandlungsfehler im Jahr in Deutschland sind, bleibt offen. Sicher ist, dass da, wo<br />
Menschen arbeiten, Fehler passieren. „Wir finden es gut, auf das Thema aufmerksam<br />
zu machen, allerdings wollen wir nicht skandalisieren“, betont Ruth Hecker, Vorsitzende<br />
des Aktionsbündnis Patientensicherheit.<br />
„Warum wir nicht skandalisieren wollen? Im Gesundheitswesen arbeiten Menschen<br />
und Menschen machen Fehler und meistens liegen diese Fehler nicht in der Fachlichkeit<br />
des medizinischen Personals, sondern in der Organisation, im Prozess selbst.<br />
Medizinische Behandlungsprozesse sind sehr komplex. Es gilt, diese Fehler zu analysieren<br />
und die fehlerbeeinflussenden Faktoren abzustellen, damit sich die Fehler<br />
nicht wiederholen und wiederholt zu Patientenschäden führen!“, sagt Hecker.<br />
Die Unbekannte in den Behandlungsfehler-Zahlen liegt in der sogenannten Haftungslücke<br />
(litigation gap) begründet (Schrappe, APS-Weißbuch Patientensicherheit,<br />
2018). Es gibt eine Lücke zwischen den passierten Vorfällen und den gemeldeten Ereignissen.<br />
Laut dem APS-Weißbuch Patientensicherheit (S. 331) liegen die folgenden<br />
Zahlen vor:<br />
■ 20 Millionen Krankenhauspatienten im Jahr.<br />
■ Unerwünschte Ereignisse (UE): zwischen 5 % und 10 %<br />
(ein bis zwei Millionen Menschen).<br />
■ Vermeidbare UE: zwischen 2 % und 4 % (400.000 – 800.000).<br />
■ Behandlungsfehler bei 1 % (200.000 Ereignisse).<br />
■ Vermeidbare Mortalität bei 0,1 % (20.000 Patienten).<br />
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) fördert aktiv Sicherheitskultur. Es<br />
entwickelt Maßnahmen, um Fehler zu vermeiden, und befördert mit Projekten die<br />
aktive Nutzung von Methoden und Instrumenten, damit im ganzen Gesundheitssystem<br />
präventiv agiert und mögliche Fehler vermieden werden können. Mit seinem<br />
Netzwerk aus allen Bereichen des Gesundheitswesens stärkt das APS Patientensicherheit.<br />
Um insbesondere die Vorkommnisse mit hohem Schadenspotenzial zu vermeiden,<br />
hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit die sogenannte SEVer-Liste herausgegeben:<br />
https://www.aps-ev.de/wp-content/uploads/2<strong>02</strong>1/09/SEVer-Liste_APS.pdf –<br />
„Schwerwiegende Ereignisse, die wir sicher Verhindern wollen“ (SEVer-Liste). Das<br />
Ziel der Liste: dass die Einrichtungen des Gesundheitswesens ihre Anstrengungen<br />
nochmals erhöhen, die gelisteten Vorkommnisse mittels geeigneter Maßnahmen sicher<br />
zu verhindern.<br />
Wichtig ist generell zu wissen: Mehr als ein Drittel aller unerwünschten Ereignisse<br />
während der medizinischen Behandlung ist vermeidbar. Dazu gibt es geeignete und<br />
gezielte Maßnahmen und Methoden. Null Fehler sind allerdings niemals möglich.<br />
Alle Informationen über das Aktionsbündnis Patientensicherheit: www.aps-ev.de<br />
Klima und<br />
Gesundheit<br />
auf dem EbM-<br />
Kongress 2<strong>02</strong>3<br />
Die neu gewählte Vorsitzende des<br />
EbM-Netzwerks, Michaela Eikermann,<br />
sieht das Netzwerk als kompetenten<br />
Akteur und Partner für<br />
Klimaschutz-Interventionen im Gesundheitsbereich.<br />
Jetzt sei es an<br />
der Zeit zu handeln – auch für das<br />
EbM-Netzwerk, wobei auch die bestehenden<br />
Kompetenzen der Netzwerkmitglieder<br />
eingebracht werden<br />
können.<br />
Der Jahreskongress des EbM-Netzwerks<br />
bot viele spannende Einsichten<br />
dazu, wie Klima auf Gesundheit<br />
wirkt, aber auch umgekehrt das<br />
Gesundheitswesen das Klima beeinflusst.<br />
Beide Themen müssen<br />
dringend gemeinsam angegangen<br />
werden, so Michaela Eikermann in<br />
der Schlussdebatte.<br />
Wie viel klimabedingte Übersterblichkeit<br />
in Deutschland lassen Modellrechnungen<br />
für 2030 befürchten?<br />
Wo im Gesundheitswesen<br />
können wir schädliche Umweltwirkungen<br />
am ehesten vermeiden? Und<br />
wie valide können oder müssen die<br />
Daten sein, bevor man mit dem Handeln<br />
beginnt? Diese und ähnliche<br />
Fragen wurden auf der 24. Jahrestagung<br />
des Netzwerks Evidenzbasierte<br />
Medizin in Potsdam vom 22. bis<br />
24. März diskutiert. Das Netzwerk<br />
wurde im Jahr 2000 gegründet, um<br />
Konzepte und Methoden einer evidenzbasierten<br />
und patientenorientierten<br />
Medizin in Praxis, Lehre und<br />
Forschung zu verbreiten und weiter<br />
zu entwickeln, und hat heute ca.<br />
1.000 Mitglieder.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ebm-netzwerk.de<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
31
DNGK<br />
Gesundheitskompetenz -<br />
forschung mit Blick auf die<br />
professionelle Pflege<br />
Dass die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland, also die Fähigkeit,<br />
Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden 1 , nach<br />
wie vor gering ist, zeigen die Berichte der HLS-GER-Studien 2 , ebenso die zeitlichen<br />
Trends 3 . Diese seit Jahren bekannte Situation sollte insbesondere die Akteure des<br />
Gesundheitswesens auffordern, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen den Zugang zu<br />
Gesundheitsinformationen zu erleichtern, ihr Verständnis und ihre Fähigkeit<br />
zur Beurteilung zu fördern und sie somit in der Anwendung<br />
gesundheitsrelevanter Informationen zu unterstützen.<br />
Nadine Fischbock, Friederike Guenther, Johannes Stephan<br />
H<br />
ierfür werden inzwischen gesundheitskompetenzfördernde<br />
Organisationen gefordert 4 , in<br />
denen auf allen Ebenen des Managements<br />
und der Versorgung das Thema Gesundheitskompetenz<br />
der Nutzerinnen und Nutzer<br />
eine wichtige Rolle spielen sollte. Als<br />
Personen, die im direkten Kontakt zu den<br />
Erkrankten und deren An- und Zugehörigen<br />
stehen, sind in der direkten Umsetzung<br />
explizit Angehörige der Gesundheitsprofessionen<br />
gefragt 5, 6 .<br />
Aufgrund des breiten Wirkungsspektrums<br />
(über die gesamte Lebensspanne, von<br />
ambulant bis stationär, von Akut- über<br />
Kurzzeit- bis Langzeitpflege), der häufigen<br />
Kontaktfrequenzen und der hohen<br />
Interaktionsarbeit 7 sind besonders Angehörige<br />
der Pflegeberufe prädestiniert,<br />
die individuelle Gesundheitskompetenz<br />
ihrer Patientinnen und Patienten explizit<br />
zu stärken und zu fördern. Zudem erlernen<br />
Pflegefachpersonen in ihrer Ausbildung<br />
Aspekte der Gesundheitskompetenz wie<br />
präventive, rehabilitative und gesundheitsfördernde<br />
Beratungs- und Schulungsfähigkeiten<br />
8 . Es ist daher davon auszugehen,<br />
dass Maßnahmen zur Förderung und<br />
Stärkung der Gesundheitskompetenz von<br />
Pflegefachkräften nicht explizit benannt,<br />
aber dennoch implizit im Alltag umgesetzt<br />
werden. Dies belegen auch erste wissenschaftliche<br />
Analysen 9, 10, 11, 12 .<br />
In einer weiteren Studie wird derzeit der<br />
Interaktionskontakt zwischen Pflegefachpersonen<br />
und Patienten in der akutstationären<br />
Versorgung im Hinblick auf die<br />
(implizite) Unterstützung zur Förderung<br />
und Stärkung der Gesundheitskompetenz<br />
untersucht 13 . Die Ergebnisse zeigen auch<br />
hier, dass Gesundheitskompetenzförderung<br />
im akutstationären Sektor durchaus<br />
geleistet wird. Bei der Analyse der Daten<br />
des Interaktionskontaktes anhand der Dimensionen<br />
der Gesundheitskompetenz<br />
nach Sørensen 1 liegt der Schwerpunkt<br />
der Stärkung und Förderung der Gesundheitskompetenz<br />
auf den Dimensionen Zugang<br />
und Verstehen. Pflegefachpersonen<br />
sind für Patientinnen und Patienten ein<br />
wichtiger Zugang zu Gesundheitswissen<br />
– die Praxis zeigt jedoch, dass eine explizite<br />
Vermittlung von Gesundheitswissen<br />
und gesundheitsrelevanten Informationen<br />
durch Pflegefachpersonen an Patienten<br />
nicht selbstverständlich ist. Erklärungen<br />
und Erläuterungen zu bestimmten Sachverhalten<br />
werden beispielsweise oft erst<br />
durch aktives Nachfragen seitens der<br />
Patienten gegeben. Durchgängig zu beobachten<br />
ist jedoch, dass, – wenn Pflegefachpersonen<br />
Gesundheitswissen und -informationen<br />
vermitteln, – sie dies stets in<br />
einer patientenorientierten und verständ-<br />
32 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
DNGK<br />
Eine Möglichkeit der Adaption der Gesundheitskompetenzförderung<br />
könnte<br />
unter anderem über den Pflegeprozess<br />
erfolgen – ein Prozess, der zu den Kernaufgaben<br />
professioneller Pflege zählt und<br />
sich in allen Sektoren der Pflege wiederfindet.<br />
Das Pflegeberufegesetz 8 definiert<br />
die Gestaltung, Organisation und Steuerung<br />
des Pflegeprozesses als vorbehaltene<br />
Tätigkeit von Pflegefachpersonen und<br />
kann als Denk- und Problemlösungsstrategie<br />
bezeichnet werden, in der Pflegefachpersonen<br />
zielgerichtet, strukturiert<br />
und partizipativ arbeiten. Als mehrschrittiger<br />
Prozess dient der Pflegeprozess zunächst<br />
der Informationssammlung, der Erhebung<br />
und Feststellung des individuellen<br />
Pflegebedarfs (Ressourcen und Probleme)<br />
sowie der Festlegung der Pflegeziele, die<br />
anhand der geplanten und durchzuführenden<br />
Pflegemaßnahmen erreicht werden<br />
können. Der letzte Prozessschritt gilt der<br />
Evaluation. Hier werden die durchgeführten<br />
Maßnahmen entsprechend ihrem Zielerreichungsgrad<br />
überprüft und ggf. der<br />
neuen Situation angepasst. Der Pflegeprozess<br />
hat je nach Modell zwischen vier<br />
und sechs Prozessschritte, wobei sich vier<br />
Kernschritte (Assessment, Planung, Intervention,<br />
Evaluation) in allen Modellen wiederfinden.<br />
Wenn es gelänge, das Konzept der Gesundheitskompetenz<br />
mit den gesundheitskompetenzfördernden<br />
Interventionen<br />
und Maßnahmen in den Pflegeprozess zu<br />
integrieren, wäre dies ein großer Schritt<br />
zur expliziten Förderung und Stärkung der<br />
Gesundheitskompetenz durch Pflegefachpersonen.<br />
Fazit<br />
lichen Sprache vollziehen. Deutlich wird,<br />
dass die implizite Unterstützung in der Gesundheitskompetenzförderung<br />
stark vom<br />
individuellen beruflichen Selbstverständnis<br />
jeder einzelnen Pflegefachperson abhängt.<br />
Es wäre daher notwendig, Prozesse und<br />
Strukturen zu etablieren, die über das persönliche<br />
Selbstverständnis hinaus Maßnahmen<br />
zur Förderung und Stärkung der<br />
Gesundheitskompetenz mit fassen. Eine<br />
erste, förderliche Maßnahme wäre hier<br />
etwa eine Sensibilisierung der Pflegefachpersonen<br />
hinsichtlich der positiven Wirkung,<br />
die Erläuterungen und Erklärungen<br />
im direkten Handeln für Erkrankte haben 13 .<br />
Um von einer impliziten zu einer expliziten<br />
Umsetzung zu gelangen, sollten – mit<br />
dem Blick auf Adaptionsmöglichkeiten des<br />
Konzepts der Gesundheitskompetenz – die<br />
Prozesse und Strukturen der verschiedenen<br />
Versorgungssektoren (ambulant, akutstationär,<br />
Langzeit- und Kurzzeitpflege) geprüft<br />
werden. Denn die derzeitigen Herausforderungen,<br />
wie der Fachkräftemangel bei<br />
gleichzeitig steigender Anzahl an Pflegebedürftigen<br />
14 , lassen es nicht zu, ein neues,<br />
zusätzliches Konzept einzuführen.<br />
Richtig und wichtig ist, dass die Bemühungen<br />
dahin gehen, dass Studien pflegesektorenspezifisch<br />
(ambulant, stationär,<br />
u.a.) angelegt sind. Nur so kann es gelingen,<br />
Strukturen und Prozesse sowie Bedarfe<br />
und Ressourcen zielgruppengenau<br />
zu analysieren und Maßnahmen und Interventionen<br />
abzuleiten. Eine erfolgreiche<br />
Umsetzung des Konzepts der Gesundheitskompetenz<br />
bedingt, neben dem Zusammenspiel<br />
zwischen Pflegepraxis, -management,<br />
-pädagogik und -wissenschaft,<br />
vor allem auch die Anpassung struktureller<br />
Rahmenbedingungen sowie die Bereitstellung<br />
von Ressourcen in der Praxis.<br />
Welche expliziten gesundheitskompetenzfördernden<br />
Interventionen in den unterschiedlichen<br />
Bereichen der professionellen<br />
Pflege umsetzbar sind, ist partizipativ<br />
mit Pflegefachpersonen und Leistungsempfangenden<br />
zu entwickeln. Denn die<br />
Profittragenden sind in erster Linie nicht<br />
die Pflegefachpersonen, sondern die Patienten,<br />
Klienten, Bewohner und deren Anund<br />
Zugehörige.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
33
DNGK<br />
Implikationen für den Bereich<br />
der professionellen Pflege<br />
■ Für die Pflegepraxis: Die implizite<br />
Umsetzung des Konzepts der Gesundheitskompetenz<br />
ist in der Pflege vorhanden.<br />
Es gilt, diese durch Adaption<br />
an vorhandene Strukturen und Prozesse<br />
der unterschiedlichen Sektoren in<br />
explizites gesundheitskompetenzförderndes<br />
Handeln zu entwickeln.<br />
■ Für die Pflegepädagogik: Das Konzept<br />
der Gesundheitskompetenz ist sowohl<br />
in der grundständigen Ausbildung als<br />
auch in der Fort- und Weiterbildung zu<br />
verankern. Auch die Curricula der Pflegestudiengänge<br />
sollten diesbezüglich<br />
Einheiten integrieren. Nur so können<br />
Pflegefachpersonen auf allen Ebenen<br />
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im<br />
Hinblick auf explizite gesundheitskompetenzfördernde<br />
Aspekte, Maßnahmen<br />
und Interventionen für die Pflegepraxis<br />
umsetzen.<br />
■ Für das Pflegemanagement: Die Aufgabe<br />
des Pflegemanagements besteht<br />
– neben der Stützung der Aufnahme<br />
von Fortbildungseinheiten zum Konzept<br />
der Gesundheitskompetenz – in der Gestaltung<br />
der förderlichen Strukturen und<br />
Prozesse zur Förderung und Stärkung<br />
von Gesundheitskompetenz im Verantwortungsbereich.<br />
Hierzu zählt neben<br />
der Adaption und Implementierung von<br />
Maßnahmen und Interventionen an bestehenden<br />
pflegerischen Prozessen<br />
auch die reflektierte Haltung hinsichtlich<br />
der Pflegeorganisationssysteme.<br />
■ Für die Pflegewissenschaft: Forschende<br />
können die Einflüsse, die auf<br />
die Etablierung des Konzepts der Gesundheitskompetenz<br />
im Bereich der<br />
professionellen Pflege einwirken, spezifisch<br />
auf die Wirksamkeit hin untersuchen.<br />
Gerade dieser Bereich ist von<br />
Bedeutung, da wissenschaftliche Studienergebnisse<br />
zur Argumentation und<br />
Begründungen für die Implementierung<br />
des Konzepts der Gesundheitskompetenz<br />
elementar sind.<br />
Literatur<br />
1 Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan,<br />
J., Slonska, Z., Brand, H., & (HLS-EU) Consortium Health Literacy<br />
Project European. (2012). Health literacy and public health: A<br />
systematic review and integration of definitions and models. BMC<br />
Public Health, 12(1), 80. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80<br />
2 Schaeffer, D., Berens, E.-M., Gille, S., Griese, L., Klinger,<br />
J., de Sombre, S., Vogt, D., & Hurrelmann, K. (2<strong>02</strong>1).<br />
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland vor<br />
und während der Corona Pandemie: Ergebnisse des HLS-GER<br />
2 (S. 5180909 bytes) [Application/pdf]. Universität Bielefeld,<br />
Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung.<br />
https://doi.org/10.4119/UNIBI/2950305<br />
3 Hurrelmann, K., Klinger, J., & Schaeffer, D. (2<strong>02</strong>0).<br />
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland:<br />
Vergleich der Erhebungen 2014 und 2<strong>02</strong>0 (S. 635185 bytes)<br />
[Application/pdf]. Universität Bielefeld, Interdisziplinäres Zentrum<br />
für Gesundheitskompetenzforschung. https://doi.org/10.4119/<br />
UNIBI/2950303<br />
4 Brach, C., Keller, D., University of California, San Francisco<br />
School of Medicine, Hernandez, L., Institute of Medicine, Baur,<br />
C., Centers for Disease Control and Prevention, Parker, R., Emory<br />
University School of Medicine, Dreyer, B., New York University<br />
School of Medicine, Schyve, P., The Joint Commission, Lemerise,<br />
A. J., Institute of Medicine, Schillinger, D., University of California<br />
San Francisco School of Medicine, & Agency for Healthcare<br />
Research and Quality. (2012). Ten Attributes of Health Literate<br />
Health Care Organizations. NAM Perspectives, <strong>02</strong>(6). https://doi.<br />
org/10.31478/201206a<br />
5 Parker, R. (2009). Measuring Health Literacy: What? So What? Now<br />
What? In Measures of Health Literacy: Workshop Summary. National<br />
Academies Press (US). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/<br />
NBK45386/<br />
6 Weiland, R., & Büscher, A. (2<strong>02</strong>2). Förderung von<br />
Gesundheitskompetenz als Aufgabe der Gesundheitsprofessionen?:<br />
Eine qualitative Untersuchung. Prävention und<br />
Gesundheitsförderung, 17(3), 344–348. https://doi.org/10.1007/<br />
s11553-<strong>02</strong>1-00874-5<br />
7 Bauknecht, J., & Wesselborg, B. (2<strong>02</strong>2). Psychische Erschöpfung<br />
in sozialen Interaktionsberufen von 2006 bis 2018: Ein Vergleich<br />
der Bereiche Pflege, frühkindliche Bildung, Schule, Soziale Arbeit<br />
und Polizei. Prävention und Gesundheitsförderung, 17(3), 328–335.<br />
https://doi.org/10.1007/s11553-<strong>02</strong>1-00879-0<br />
8 Gesetz über die Pflegeberufe (Pflegeberufegesetz—PflBG). (2017).<br />
https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/PflBG.pdf (letzter Zugriff<br />
am 13.04.2<strong>02</strong>3)<br />
9 Messer, M., & Murau, T. (2<strong>02</strong>2). Förderung organisationaler<br />
Gesundheitskompetenz aus Sicht von Pflegefachpersonen.<br />
Ergebnisse einer qualitativen Studie. Prävention und<br />
Gesundheitsförderung. https://doi.org/10.1007/s11553-<strong>02</strong>2-00993-7<br />
10 Rathmann, K., Lutz, J., Salewski, L., Dadaczynski, K., &<br />
Spatzier, D. (2<strong>02</strong>2). Tools zur Förderung der organisationalen<br />
Gesundheitskompetenz in Krankenhaus, Pflege und<br />
Eingliederungshilfe: Eine systematische Übersicht. https://www.<br />
monitor-versorgungsforschung.de/wp-content/uploads/2<strong>02</strong>3/01/<br />
MVF_01-22_Rathmann.pdf<br />
11 Stephan, J. (2<strong>02</strong>2). Maßnahmen zur Förderung der<br />
Gesundheitskompetenz von Pflegekräften in Deutschland. Eine<br />
empirisch-qualitative Exploration. https://doi.org/10.13140/<br />
RG.2.2.26390.83528<br />
12 Vogt, D., & Schaeffer, D. (2<strong>02</strong>2). Gesundheitskompetente<br />
Organisationen. Erster Teilbericht – Bestandsaufnahme vorliegender<br />
Konzepte und Basis-Materialsammlung. Bielefeld: Interdisziplinäres<br />
Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung (IZGK), Universität<br />
Bielefeld.<br />
13 Fischbock, N. (in Erscheinung, 2<strong>02</strong>3). Arbeitstitel:<br />
Gesundheitskompetenz und Pflege – eine Analyse der<br />
organisationalen und professionsbezogenen Förderung von<br />
Gesundheitskompetenz in der akutstationären Versorgung. https://<br />
www.mhh.de/institut-fuer-epidemiologie/promotionsprogrammcheg/stipendiatinnen/nadine-fischbock<br />
(letzter Zugriff am<br />
14.04.2<strong>02</strong>3)<br />
14 Statista GmbH, R., & Radtke, R. (2<strong>02</strong>2). Fachkräftemangel—<br />
Bedarf an Pflegekräften in Deutschland bis 2035. Statista. https://<br />
de.statista.com/statistik/daten/studie/172651/umfrage/bedarf-anpflegekraeften-2<strong>02</strong>5/,<br />
(letzter Zugriff am 13.04.2<strong>02</strong>3)<br />
NADINE FISCHBOCK<br />
Dipl. Pflegewirtin, Krankenschwester<br />
und Doktorandin im<br />
Promotionsprogramm „Chronische<br />
Erkrankungen und Gesundheitskompetenz<br />
(ChEG)“ am Institut für<br />
Epidemiologie, Sozialmedizin und<br />
Gesundheitssystemforschung der<br />
Medizinischen Hochschule Hannover,<br />
gefördert durch die Robert<br />
Bosch Stiftung.<br />
Korrespondierende Autorin:<br />
fischbock.nadine@mh-hannover.de<br />
FRIEDERIKE GUENTHER<br />
Gesundheits- und Krankenpflegerin,<br />
Pflegewissenschaftlerin<br />
(BSc); Masterstudentin Barrierefreie<br />
Kommunikation (MA) an der<br />
Stiftung Universität Hildesheim,<br />
Masterstudentin Public Health<br />
(MScPH) an der Medizinischen<br />
Hochschule Hannover, ist tätig<br />
als studentische Hilfskraft an der<br />
Forschungsstelle Leichte Sprache<br />
an der Stiftung Universität<br />
Hildesheim.<br />
JOHANNES STEPHAN<br />
Fachgesundheits- und Krankenpfleger<br />
für Psychiatrie, Praxisanleiter,<br />
Pflegewissenschaftler<br />
(BScN), Pflegepädagoge (MSc),<br />
Public Health (MScPH); ist als<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter<br />
und Doktorand am Lehrstuhl<br />
für Soziale Determinanten der<br />
Gesundheit, Fakultät für Sportund<br />
Gesundheitswissenschaften<br />
der Technische Universität<br />
München tätig.<br />
34 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
SAMEDI<br />
Mit E-Health<br />
interdisziplinär<br />
erfolgreich<br />
Wie die Ordination der Zukunft Gestalt annimmt:<br />
Österreichs Ärztinnen und Ärzte sind mit den Primärversorgungseinheiten<br />
(PVE) auf dem Weg ins<br />
Primary Health Care-Zeitalter. Umfangreiche E-Health-<br />
Lösungen unterstützen sie dabei nachhaltig.<br />
D<br />
ie landesweite Errichtung interdisziplinärer<br />
Primärversorgungseinheiten<br />
(PVE) verlagert<br />
die Versorgung zum Point of Care und<br />
bietet der österreichischen Bevölkerung<br />
eine umfassende medizinische Grundversorgung<br />
mit niedrigschwelligem Zugang.<br />
So wird eine hohe Versorgungsqualität gewährleistet,<br />
während die Spitalsambulanzen<br />
entlastet werden. Heuer gibt es bereits<br />
40 aktive PVE, bis 2<strong>02</strong>5 soll ihre Anzahl<br />
nach Angaben des Gesundheitsministeriums<br />
verdreifacht werden. E-Health<br />
unterstützt die Ziele der österreichischen<br />
Gesundheitsreform und verstärkt die Effekte<br />
noch:<br />
Interdisziplinäre<br />
Behandlungskoordination<br />
Der breite Versorgungsauftrag der PVE<br />
lässt sich nur in einem multiprofessionellen<br />
Team abbilden, wodurch die Komplexität<br />
der Termin- und Ressourcensteuerung<br />
zunimmt. Erst die automatisierten Praxisabläufe<br />
aus dem zentralen Terminkalender<br />
heraus gesteuert mit Echtzeitabgleich in<br />
der Verfügbarkeit und die Einbeziehung<br />
der Patienten von Beginn an schaffen wieder<br />
die selbstbestimmte Zeit und Freiräume,<br />
die gerade die Ärzte in der Primärversorgung<br />
für ihre Patienten benötigen. So<br />
setzen PVE Standards, die dem Anspruch<br />
einer modernen und zukunftsweisenden<br />
Gesundheitsversorgung gerecht werden.<br />
Patientenservice<br />
auf neuem Niveau<br />
Patienten nehmen zunehmend eine aktiv<br />
gestaltende Rolle im Behandlungsprozess<br />
ein: Die beginnt bei der selbstbestimmten<br />
Terminvereinbarung online oder über eine<br />
digitale Telefonassistenz. Chatbots und<br />
Videosprechstunden lösen niedrigschwellige<br />
Anliegen schnell und direkt – auch am<br />
Abend und an den Wochenenden. Automatisierte<br />
Benachrichtigungen erinnern<br />
Patienten an Termine und Online-Patientenformulare<br />
(etwa zur Anamnese) bereiten<br />
Termine optimal vor.<br />
Fachliche Expertise und Kapazitäten<br />
überregional nutzen<br />
In Ergänzung zur Primärversorgung<br />
schaffen telemedizinische Lösungen eine<br />
überregionale Verfügbarkeit von fachlicher<br />
Expertise und Versorgungskapazitäten<br />
gleichermaßen. Telekonsile und asynchrone<br />
Befundungen herausfordernder<br />
Fälle steigern die Behandlungsqualität<br />
durch schnelle Experteneinschätzungen,<br />
während Videosprechstunden ein ortsunabhängiges<br />
Versorgungsangebot für Patienten<br />
schaffen und Anfahrtszeit sowie<br />
-kosten sparen.<br />
Fazit und Ausblick<br />
E-Health bringt die Versorgung näher<br />
zum Point of Care und trägt damit ebenso<br />
wie die Einrichtung der PVE zu einer qualitativ<br />
hochwertigen, wohnortnahen medizinischen<br />
Grundversorgung bei. Auch die<br />
Entlastung der Spitäler wird durch niedrigschwellige,<br />
hybride Versorgungsangebote<br />
unterstützt. Diese Entwicklung setzt<br />
sich fort: In Zukunft wird eine valide Diagnose<br />
durch Verknüpfung von Smart Medical<br />
Devices und medizinischer Software<br />
ohne Anwesenheit eines Arztes möglich<br />
sein. Der Arzt gewinnt dadurch wertvolle<br />
Zeit, um sich persönlich um die tatsächlich<br />
notwendigen Fälle kümmern zu<br />
können. Das wird dann nicht nur die Spitalsambulanzen<br />
entlasten, sondern auch<br />
zu weniger Krankenhausaufenthalten führen,<br />
weil Diagnose und<br />
Behandlung einen qualitativen<br />
Sprung machen<br />
werden und Therapien<br />
nahtlos und zielgerichtet<br />
an die Befundung durch<br />
den Arzt anschließen.<br />
Jetzt mehr<br />
erfahren:<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
35
AIHTA<br />
Früherkennung und Versorgung<br />
peripartaler psychischer<br />
Erkrankungen in Österreich<br />
Das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) hat internationale Versorgungsmodelle<br />
und -pfade sowie die Situation in Österreich in Bezug auf peripartale psychische<br />
Gesundheit analysiert. Die beiden Berichte sind Teil eines vom Österreichischen Fonds zur Förderung<br />
der wissenschaftlichen Forschung (FWF) finanzierten Projektes zur Verbesserung der<br />
peripartalen psychischen Gesundheit in Tirol, das von der Medizinischen Universität Innsbruck<br />
geleitet wird. Ein integriertes Gesamtkonzept für Prävention,<br />
Früherkennung und Behandlung wird dringend angeraten –<br />
die österreichische Angebotsstruktur weicht nämlich erheblich<br />
von den internationalen Empfehlungen ab.<br />
P<br />
sychische Erkrankungen von Eltern<br />
sind eine häufige und schwerwiegende<br />
Komplikation in der peripartalen<br />
Phase, also der Zeit während der Schwangerschaft<br />
und im ersten Jahr nach der Geburt. Trotz der unmittelbaren<br />
und langfristigen potenziell schwerwiegenden<br />
Auswirkungen auf Mutter, Vater und insbesondere<br />
das Kind, die von Verhaltensproblemen<br />
bis zu einem erhöhten Suizidrisiko reichen und mit<br />
großen Belastungen im Gesundheits-, Sozial- und<br />
Bildungssystem einhergehen, gibt es in Österreich<br />
bisher weder eine nationale Strategie noch ein nationales<br />
Versorgungsmodell für peripartale psychische<br />
Gesundheit.<br />
Das AIHTA analysierte sechs Dokumente aus<br />
UK, Irland, Kanada und Australien, die von multiprofessionellen<br />
Arbeitsgruppen, Expertinnen und<br />
Experten sowie Betroffenen erstellt wurden. Alle<br />
Dokumente enthielten Informationen zu verschiedenen<br />
Aspekten der Versorgung, einschließlich<br />
Primärprävention, Früherkennung, Diagnostik,<br />
Überweisung und Behandlung. Die Analyse zeigte,<br />
dass für integrierte Versorgungsmodelle, in<br />
denen verschiedene Leistungserbringer und Berufsgruppen<br />
über den ganzen Behandlungs- und<br />
Betreuungsprozess kontinuierlich und strukturiert<br />
zusammenarbeiten, klar definierte Pfade und abgestufte<br />
Betreuungskonzepte für die Organisation<br />
der peripartalen psychischen Versorgung und die<br />
Bereitstellung von Leistungen notwendig sind. Im<br />
Rahmen der Primärprävention sollten werdende<br />
Eltern über psychische Gesundheit im Allgemeinen<br />
und mögliche psychische Probleme während der<br />
Schwangerschaft und nach der Geburt aufgeklärt<br />
werden. Für Frauen mit bereits bestehenden oder<br />
früheren psychischen Problemen oder einem erhöhten<br />
Risiko für psychische Erkrankungen wird<br />
auch eine Beratung vor Eintritt der Schwangerschaft<br />
empfohlen. In allen Dokumenten wird die<br />
frühzeitige Identifizierung von Menschen mit peripartalen<br />
psychischen Erkrankungen als essenziell<br />
ausgewiesen. Ein Screening von Müttern auf diese<br />
Erkrankungen wird einhellig empfohlen – dieses ist<br />
jedoch im „Mutter-Kind-Pass“ bisher nicht routinemäßig<br />
vorgesehen.<br />
Die Bestandsaufnahme zum vorhandenen Präventions-,<br />
Früherkennungs- und Versorgungsangebot<br />
in Österreich zeigte überdies, dass Inhalt und Kapazität<br />
der Angebote höchst unterschiedlich sind und<br />
keine nationalen Qualitätsstandards und Leitlinien<br />
zu Versorgungspfaden existieren. Eine stärkere<br />
Koordination und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen<br />
Sektoren – wie Gesundheits- und Sozialsektor<br />
– ist österreichweit für die Implementierung<br />
und Umsetzung von peripartalen psychischen<br />
Versorgungsmodellen notwendig. Neben einer<br />
nationalen Strategie und der Definition von Verantwortlichkeiten<br />
empfiehlt das AIHTA eine nationale<br />
Leitlinie zur Bestimmung von Versorgungspfaden<br />
und, dass Daten des nationalen Geburtsregisters<br />
mit jenen zur psychischen Gesundheit erweitert<br />
werden, die auch der Forschung zur Verfügung<br />
stehen. Auf dieser Basis sollen mit Fachkräften aus<br />
allen involvierten Berufen und betroffenen Eltern in<br />
Tirol Verbesserungsansätze priorisiert und wissenschaftlich<br />
begleitet umgesetzt werden.<br />
Originalpublikation:<br />
• Zechmeister-Koss, I. (2<strong>02</strong>3): Prävention und<br />
Versorgung peripartaler psychischer Erkrankungen<br />
in Österreich: Eine Bestandsaufnahme<br />
bestehender Präventions-, Früherkennungs-<br />
und Versorgungsstrukturen mit spezifischem<br />
Fokus auf Tirol. HTA-Projektbericht 151.<br />
https://eprints.aihta.at/1437/.<br />
• Reinsperger, I. und Paul, J. (2<strong>02</strong>2): Modelle<br />
zur Prävention und Versorgung peripartaler<br />
psychischer Erkrankungen. HTA-Projektbericht<br />
148. https://eprints.aihta.at/1420/.<br />
Kontakt:<br />
Ozren Sehic, M.A.<br />
ozren.sehic@aihta.at<br />
36 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
NÖ LANDESGESUNDHEITSAGENTUR<br />
Sichere Patientenidentifikation an der Schnittstelle<br />
PBZ und Klinikum in Niederösterreich (NÖ) – Teil II<br />
Die NÖ Landesgesundheitsagentur sorgt mit<br />
einer Maßnahme des klinischen Risikomanagements<br />
für sichere Patientenidentifikation an<br />
der sensiblen Schnittstelle zwischen Pflege-,<br />
Betreuungs- und Förderzentren (PBZ, PFZ)<br />
sowie den niederösterreichischen Universitätsund<br />
Landeskliniken. Den Risiken der Patientenverwechslung,<br />
die sich beim Transport<br />
zwischen den Gesundheitseinrichtungen<br />
ergeben, soll dadurch<br />
präventiv<br />
entgegengewirkt<br />
werden.<br />
T<br />
äglich werden Bewohnerinnen und Bewohner aus den<br />
NÖ PBZ und PFZ in die NÖ Kliniken gebracht – zur<br />
akuten oder geplanten Versorgung in den Ambulanzen<br />
oder zur stationären Aufnahme auf einer der Fachabteilungen.<br />
In der sektorenübergreifenden Versorgung mit ihrer Vielzahl an<br />
Schnittstellen und Akteuren steigt das Risiko einer Patientenverwechslung.<br />
Eine solche Verwechslung kann schwerwiegende<br />
Folgen haben. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Bewohner<br />
bzw. Gäste der PBZ/PFZ aufgrund ihres Allgemeinzustandes<br />
nicht immer in der Lage sind, sich selbst zu identifizieren.<br />
Es war also das Ziel, eine verlässliche Patientenidentifikation als<br />
Voraussetzung einer sicheren Patientenversorgung an der Schnittstelle<br />
PBZ/PFZ und Klinikum zu etablieren (siehe auch Qualitas<br />
Ausgabe <strong>02</strong>/22). Im Falle eines Transports in die Klinikambulanz<br />
findet die Identifikation der Bewohner mittels Anlegen eines farblich<br />
vom Klinikstandard abweichenden Identifikationsarmbands<br />
im PBZ statt.<br />
Ausrollung Thermenregion<br />
Diese Maßnahme wurde durch das Department Beschwerdemanagement,<br />
Patientensicherheit der NÖ LGA initiiert und gemeinsam<br />
mit Expertinnen und Experten der Langzeitpflege und<br />
Kliniken erarbeitet. In ausgewählten Kliniken und PBZ-Standorten<br />
wurde das Ergebnis getestet und nach einem durchgehend positiven<br />
Feedback 2<strong>02</strong>2 auf die gesamte Thermenregion (5 Kliniken,<br />
14 PBZ/PFZ) erweitert.<br />
Die beiden Kernfragen der Evaluierung „Unterstützt Sie das ID-<br />
Band bei der Identifikation der Patienten und Bewohner?“ und<br />
„Wie bewerten Sie den Einsatz des ID-Bandes im Hinblick auf die<br />
Sicherheit der Patienten und Bewohner?“ wurden von den Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeitern der PBZ/PFZ und Kliniken mit großer<br />
Mehrheit äußerst positiv bewertet.<br />
Basierend auf den Evaluierungsergebnissen wurden sowohl der<br />
Prozess als auch die dazugehörigen Dokumente adaptiert. Insbesondere<br />
wurden auch die Rettungsdienste, als wichtige Schnittstelle<br />
im Transportprozess, verstärkt über die implementierte<br />
Maßnahme informiert.<br />
Ausrollung auf ganz NÖ ab Juni 2<strong>02</strong>3<br />
Durch den Erfolg der Pilotphase bestärkt, wurde der Beschluss<br />
gefasst, diesen Prozess ab dem 1. Juni 2<strong>02</strong>3 auf alle Gesundheitseinrichtungen<br />
der NÖ LGA auszuweiten. Ab diesem Zeitpunkt<br />
wird das magenta-farbige Identifikationsarmband in ganz<br />
NÖ im Einsatz sein, um Mitarbeiter dabei zu unterstützen, Patienten-<br />
und Bewohnerverwechslungen effektiv vorzubeugen.<br />
Kontakt:<br />
Department Beschwerdemanagement, Patientensicherheit<br />
Abteilung Strategie und Qualität Medizin,<br />
Direktion Medizin und Pflege<br />
sqm@noe-lga.at<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
37
GGZ<br />
Das Grazer Gesundheitsmodell –<br />
Vernetzungsangebote der Geriatrischen<br />
Gesundheitszentren der Stadt Graz<br />
Der demografische Wandel schreitet schnell und unaufhaltsam voran und<br />
wirkt sich dabei auf viele Gesellschaftsbereiche aus. Besonders stark<br />
betroffen davon ist die Pflege, insbesondere die Altenpflege.<br />
Verena Matz<br />
Entgeltliche Einschaltung<br />
Zukünftige Herausforderungen<br />
in der Versorgung älterer<br />
Menschen<br />
Die immer größer werdende Anzahl an älteren und<br />
pflegebedürftigen Menschen wird in den nächsten<br />
Jahren weiterhin anwachsen. Im Jahr 2030 werden<br />
bereits 23,2 % der Österreicherinnen und Österreicher<br />
65 Jahre und älter sein 1 , die Anzahl der über<br />
85-Jährigen wird sich mehr als verdoppeln. Diese<br />
oft chronisch kranken Menschen sind auf eine professionelle<br />
Pflege durch hochqualifizierte Pflegefachkräfte<br />
angewiesen. Doch gerade an diesen fehlt<br />
es zusehends. Prognosen zufolge wird es bis zum<br />
Jahr 2030 in Österreich an bis zu 76.000 Pflegekräften<br />
mangeln. 42.000 Stellen müssen aufgrund<br />
von Pensionierungen nachbesetzt werden, 34.000<br />
Pflegepersonen werden zusätzlich benötigt, 21.000<br />
davon im Langzeitbereich 2 . Der aktuell überdimensionale<br />
Ausbau von stationären Betreuungsplätzen<br />
verstärkt den bereits vorhandenen Pflegekräftemangel<br />
zusätzlich und widerspricht auch den Ansprüchen<br />
von pflegebedürftigen Personen. Diese<br />
Menschen wünschen sich vermehrt, möglichst lange<br />
selbstständig und vor allem selbstbestimmt im<br />
gewohnten Umfeld – dem eigenen Zuhause – leben<br />
zu können 3, 4, 5 . Die notwendige niederschwellige<br />
Versorgung kann jedoch meist aufgrund fehlender<br />
Strukturen (z.B. Pflegefachkräfte, Finanzierung)<br />
nicht in Anspruch genommen werden. Durch die<br />
Vielfalt der Anbieter im geriatrischen Bereich<br />
wird es für ältere Personen außerdem zusehends<br />
schwieriger, sich im fragmentierten österreichischen<br />
Gesundheitssystem zurechtzufinden. Vor allem<br />
geriatrische Patientinnen und Patienten benötigen<br />
ein breites Spektrum an Leistungen, welche in<br />
der Regel nicht von einem Anbieter erbracht werden<br />
und daher einer Koordination bedürfen.<br />
Selbstständiges Leben –<br />
gesunde Lebensjahre schenken<br />
Möglichst lange und selbstständig zu Hause leben<br />
und dabei den gewohnten Lebensstil aufrechterhalten<br />
– das ist der Wunsch der älteren Generation.<br />
Die steigende Lebenserwartung und die Versorgung<br />
der immer älter werdenden Bevölkerung<br />
erfordern es, Maßnahmen zur Förderung eines<br />
gesunden und aktiven Alterns zu ergreifen. Aktuelle<br />
Statistiken zeigen, dass Österreicherinnen und<br />
Österreicher bei gesunden Lebensjahren im europäischen<br />
Vergleich unter dem Durchschnitt liegen.<br />
So verbringen in Österreich Frauen rund 59,3 Jahre<br />
und Männer 58,2 Jahre in Gesundheit. Demgegenüber<br />
liegt Schweden bei der Erwartung gesunder<br />
Lebensjahre sowohl bei den Frauen (72,7 Jahre) als<br />
auch bei den Männern (72,8 Jahre) an der Spitze 6 .<br />
Auch leben Frauen und Männer in Schweden – im<br />
Vergleich zu Österreich – ab 65 Jahren rund acht<br />
(Frauen) bzw. sieben (Männer) Jahre länger 7 . Um<br />
auch in Österreich diese hohe Anzahl an gesunden<br />
Lebensjahren und ein aktives Altern zu erreichen,<br />
bedarf es eines Paradigmenwechsels hin zu einem<br />
niederschwelligen Versorgungssystem mit dem Fokus<br />
auf Gesundheit und Gesunderhaltung.<br />
Integrierte Versorgung alter<br />
Menschen: erfolgreicher<br />
personenzentrierter Ansatz<br />
Mit zunehmendem Alter steigt die Anfälligkeit für<br />
Erkrankungen bzw. Multimorbidität. Diese oftmals<br />
chronischen Krankheiten bedürfen der Vernetzung<br />
aller betreffenden Leistungsträger in der jeweiligen<br />
Versorgung. Den Mittelpunkt dieses optimierten Behandlungsprozesses<br />
bildet neben der Einbindung<br />
der Patientinnen und Patienten auch die Berücksichtigung<br />
der individuellen Bedürfnisse. Oftmals<br />
sind bei Erkrankungen und Einschränkungen im<br />
Alter punktuelle, akut versorgende und pflegende<br />
sowie rehabilitative Maßnahmen ausreichend. Der<br />
Fokus auf Prävention und Erhalt der Unabhängigkeit<br />
sowie Pflege, die auf die gesamte Bandbreite<br />
der Bedürfnisse eines Menschen abgestimmt ist,<br />
anstatt der Fokus auf einzelne Krankheiten stellen<br />
den Schlüssel einer erfolgreichen integrierten Versorgung<br />
dar 8 . (s. Abb. 1)<br />
Das Grazer Gesundheitsmodell<br />
Das Grazer Gesundheitsmodell stellt den Menschen<br />
mit all seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt und<br />
38 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
ietet ein bedarfsgerechtes abgestuftes Angebot<br />
aus Beratung, Information, Versorgung, Steuerung,<br />
(Nach-)Behandlung sowie Betreuung am Best Point<br />
of Care zur Verbesserung der Lebensqualität. Das<br />
Versorgungsangebot reicht hier von niederschwelligen<br />
Angeboten (z.B. Tageszentren) bis hin zu<br />
stationären Einrichtungen wie Akutgeriatrie/Remobilisation,<br />
wobei die Vernetzung und Abstimmung<br />
weiterer Gesundheitsdiensteanbieter essenzieller<br />
Bestandteil ist. Im Rahmen dieser vernetzten Kooperation,<br />
bei gleichzeitigem Fokus und Einbindung<br />
des zu versorgenden älteren Menschen, kann eine<br />
optimierte Betreuung und bedarfsgerechte Versorgung<br />
gelingen. (s. Abb. 2)<br />
Abbildung 1: Integrierte Versorgung alter Menschen: erfolgreicher personenzentrierter Ansatz 9 .<br />
Vorteile des Grazer<br />
Gesundheitsmodells<br />
FÜR BETREUUNGSBEDÜRFTIGE<br />
ÄLTERE PERSONEN:<br />
■ Personenzentrierte Betreuung und<br />
Versorgung sowie Abstimmung der Angebote<br />
(Betreuung, Pflege, medizinische Versorgung)<br />
auf die jeweiligen Bedürfnisse des älteren<br />
Menschen.<br />
■ Miteinbeziehung der betreuungsbedürftigen<br />
Person in die Gestaltung des persönlichen<br />
Betreuungs- und Pflegeangebotes.<br />
■ Lenkung zum Best Point of Care zur<br />
Reduktion der Fehlversorgung.<br />
FÜR DIE GESELLSCHAFT:<br />
■ Innovativer Ausbau des niederschwelligen<br />
Versorgungsangebotes, um bestehende<br />
Lücken zu schließen.<br />
■ Prävention von Krankheit und<br />
Pflegebedürftigkeit.<br />
■ Aufbau von wohnortnahen Betreuungsund<br />
Pflegeangeboten.<br />
■ Erweiterung und Attraktivierung der<br />
Arbeitsmöglichkeiten in der Pflege.<br />
FÜR DIE GESUNDHEITSÖKONOMISCHE<br />
ENTWICKLUNG:<br />
■ Geringere Inanspruchnahme stationärer<br />
Versorgung bzw. Verringerung von Krankenhausaufenthalten<br />
und Aufrecht erhaltung der<br />
Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems trotz<br />
fortschreitender Alterung der Bevölkerung.<br />
■ Schonung der Gesamtkosten im Gesundheitswesen<br />
durch Dämpfung der Kosten<br />
im Pflegewesen und zielgerichtete<br />
Betreuung und Versorgung.<br />
Literatur<br />
1 Statistik Austria. (2<strong>02</strong>0). Bevölkerungsprognose<br />
2<strong>02</strong>0. Verfügbar unter: https://www.statistik.at/<br />
web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/<br />
bevoelkerung/demographische_prognosen/<br />
bevoelkerungsprognosen/<strong>02</strong>7308.html [18.08.2<strong>02</strong>1].<br />
2 Rappold, E. & Juraszovich, B. (2019). Pflegepersonal-<br />
Bedarfsprognose für Österreich. (Bundesministerium für<br />
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,<br />
Hrsg.). Wien.<br />
3 Jacobs, K., Kuhlmey, A., Greß, S. & Schwinger, A.<br />
(2015). Pflege-Report 2015 „Pflege zwischen Heim und<br />
Häuslichkeit“. Stuttgart: Schattauer.<br />
4 Franken, G. (2017). Wohnen im Alter. Wohnpräferenzen<br />
von Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Witten:<br />
Private Universität Witten/Herdecke GmbH.<br />
5 Kolland, F., Rohner, R., Hopf, S. & Gallistl, V. (2018).<br />
Wohnmonitor Alter 2018: Wohnbedürfnisse und<br />
Wohnvorstellungen im Dritten und Vierten Lebensalter in<br />
Österreich. Wien: Studien Verlag.<br />
6 Eurostat. (2<strong>02</strong>3). Healthy life years statistics. Verfügbar<br />
unter: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/<br />
index.php?title=Healthy_life_years_statistics#Healthy_<br />
life_years_at_birth [18.04.2<strong>02</strong>3].<br />
Abbildung 2: Das Grazer Gesundheitsmodell.<br />
7 Eurostat. (2<strong>02</strong>2). Gesunde Lebensjahre im Alter von 65<br />
Jahren. Verfügbar unter: https://ec.europa.eu/eurostat/<br />
databrowser/view/tepsr_sp320/default/table?lang=de<br />
[18.04.2<strong>02</strong>3].<br />
8 Oliver, D., Foot, C. & Humphries, R. (2014). Making our<br />
health and care systems fit for an ageing population.<br />
London: The King's Fund.<br />
9 Hartinger, G. in Anlehnung an Oliver, D., Foot, C. &<br />
Humphries, R. (2014). Making our health and care<br />
systems fit for an ageing population. London: The<br />
King's Fund.<br />
Foto: © Foto Furgler<br />
Autorin:<br />
Verena Matz, BA MA<br />
Strategische und<br />
operative Planung<br />
Geriatrische<br />
Gesund heitszentren<br />
der Stadt Graz<br />
verena.matz<br />
@stadt.graz.at<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
39
AKKREDITIERUNG<br />
Rückführbare Diagnostik = Qualität<br />
Labor-Akkreditierung nach ISO 15189<br />
Stellen Sie sich vor, Sie steigen in Ihr Auto und fahren einfach<br />
los, vorher angurten und natürlich starten. Machen Sie sich<br />
jemals Gedanken, ob Ihr Motor auch wirklich gut geschmiert<br />
ist? Ob die Kühlflüssigkeit korrekt umläuft? Ob Ihre Abgaswerte<br />
den Normen entsprechen? Höchstens, wenn Sie durch ein<br />
Lamperl aufgefordert werden, Ölstand etc. zu kontrollieren.<br />
Die „Qualitätssicherung“ für Ihr Autofahren erledigt „irgendjemand“<br />
im Hintergrund. Nachvollziehbar sind das der Autohersteller,<br />
die Zulieferer, die kontrolliert werden und enge<br />
Qualitäts korsette zu erfüllen haben, die Werkstatt Ihres Vertrauens,<br />
in der Wartungen, Kontrollen, Messungen (mit hoffentlich<br />
kalibriertem Prüfmittel) etc. durchgeführt werden, die Tankstelle,<br />
an der Sie kontrollierten Treibstoff kaufen, und so weiter.<br />
Milo Halabi<br />
A<br />
uch in der Medizin und vor allem<br />
in der medizinischen Labor-<br />
Diagnostik (medizinisch-chemisches<br />
Labor, Mikrobiologie, Pathologie,<br />
Genetik) muss sichergestellt sein, dass ein<br />
Befundergebnis mit höchster Sicherheit<br />
richtig ist, da dieses Ergebnis Grundlage<br />
einer therapeutischen Entscheidung sein<br />
kann. Die klinischen Kollegen verlassen<br />
sich naturgemäß auf die Ergebnisse, sie<br />
können die „Black Box Labor“ im stressigen<br />
Alltag auch nicht mehr hinterfragen.<br />
Diesen Ansatz des vollkommenen Vertrauens<br />
kann ein seriös arbeitendes medizinisches<br />
Labor nur dann bieten, wenn<br />
es qualitätsgesichert arbeitet, also alle<br />
Prozesse, alle Ergebnisse in hohem Maße<br />
standardisiert sind, nachvollziehbar gemacht<br />
werden und rückverfolgbar sind.<br />
Und jetzt stellen Sie sich nochmals die<br />
Sache mit dem Auto vor: Sie haben eine<br />
Panne oder gar einen Unfall, aus irgendeinem<br />
Grund steht auch die Haftung von<br />
Werkstatt oder Hersteller zur Diskussion,<br />
Daten müssen ausgewertet werden, Sie<br />
bestehen auf Wartungsprotokollen oder<br />
auch auf Lieferkettenrückverfolgung. Das<br />
alles bekommen Sie auch, weil die Industrie<br />
längst begriffen hat, dass nur ein „klar<br />
definierter Eiskanal“ den Viererbob ins Ziel<br />
bringt, um wieder ein Bild zu strapazieren.<br />
Klare Prozesse, klare Standards, die wenig<br />
Abweichung erlauben, Kontrollstellen,<br />
an denen geprüft wird etc.<br />
Und schließlich wieder das medizinische<br />
Labor: Auch hier muss alles nachvollziehbar,<br />
rückverfolgbar, aufrollbar sein,<br />
damit bei Unklarheiten nicht erst die Frage<br />
nach der Verantwortung im Labor gestellt<br />
werden muss und man vielleicht so<br />
draufkommt, dass irgendein Prozess nicht<br />
funktioniert hat.<br />
Zertifizierung und<br />
Akkreditierung<br />
Viele Labors sind daher nach ISO 9000<br />
zertifiziert, wenige nach der ISO 15189 akkreditiert.<br />
Der Unterschied? Bei einer Zertifizierung<br />
überprüft eine zugelassene Stelle<br />
(Zertifizierungsstelle), ob eine Einrichtung<br />
(in diesem Fall das Labor) einer konkreten<br />
Norm (der ISO 9000) entspricht, wobei<br />
neben den üblichen QM-Themen wie Fehlermanagement,<br />
Beschwerdemanagement<br />
etc. vor allem die Prozesse im Fokus stehen,<br />
egal worum es letztlich geht.<br />
40 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
AKKREDITIERUNG<br />
Bei einer Akkreditierung nach ISO 15189<br />
wird ein Labor ebenfalls „begutachtet“<br />
(= auditiert), allerdings direkt von einer<br />
staatlichen Einrichtung, der Akkreditierung<br />
Austria (die auch die Zertifizierungsstellen<br />
zulässt). Das geschieht mithilfe von Sachverständigen,<br />
die eigens geschult werden<br />
für die jeweiligen Fachgebiete. Denn<br />
bei einer Akkreditierung werden nicht<br />
nur die QM-Themen der ISO 9000 abgefragt,<br />
sondern steht auch die fachliche<br />
Kompetenz auf dem Prüfstand. Personalqualifikationen,<br />
Einschulungsprozesse,<br />
Fortbildungsaktivitäten, räumliche Umgebungsbedingungen,<br />
Reagenzien- und<br />
Gerätemanagement, Implementierung von<br />
Untersuchungsmethoden, Verifizierung<br />
und Validierung von Methoden, Ringversuche<br />
sind natürlich obligat und ebenso<br />
der Freigabeprozess von Befundergebnissen.<br />
Immer im Vordergrund steht die Konformität<br />
mit den Anforderungen der ISO<br />
15189, also die Frage, ob der Prozess in<br />
dem jeweiligen Labor den Anforderungen<br />
der Norm entspricht oder nicht. Nichtentsprechung<br />
bedeutet „Non-Konformität“,<br />
was wiederum bedeutet, dass das Labor<br />
diese kompensieren muss mit Maßnahmen<br />
oder Änderungen von Prozessen.<br />
ISO 15189-Konformität<br />
in der Praxis<br />
Nehmen wir als praktisches Beispiel<br />
das leidige Thema „Corona“ her. Eine<br />
Behörde oder ein Patient hinterfragt ein<br />
Ergebnis selten – höchstens, wenn es<br />
Ungereimtheiten gibt. Das Labor muss<br />
einen klaren Prozess für diese Analyse<br />
fahren, damit jeder Schritt im System<br />
qualitätsgesichert ist. Beginnen wir mit<br />
dem PCR-Kit. Dieser muss von einem<br />
Hersteller stammen, der das Produkt als<br />
IVD-CE auf den Markt gebracht hat. Das<br />
Labor muss in so einem Fall nur intern<br />
anhand von bekannten Proben vor der<br />
Erstverwendung prüfen, ob der Kit auch<br />
hält, was er verspricht (= Verifizierung).<br />
Ist der Kit z.B. ein sogenannter RUO (research<br />
use only), dann muss das Labor<br />
sogar eine umfängliche Leistungskennzahlerhebung<br />
durchführen (=Validierung),<br />
um zu beweisen, dass der Kit den Anforderungen<br />
in Bezug auf z.B. Spezifität,<br />
Sensitivität etc. entspricht. Das kann mitunter<br />
komplex werden. Das „bloße“ Verwenden<br />
eines kommerziellen Kits vom<br />
Stand weg ist in einem akkreditierten Labor<br />
nicht zulässig.<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23<br />
41
AKKREDITIERUNG<br />
Der Kit muss natürlich bis zur Verwendung<br />
(für den vom Hersteller festgelegten<br />
Zweck, z.B. Nachweis von SARS-CoV-2<br />
aus Nasen-Rachenabstrichen, was bedeutet,<br />
dass ein Abstrich z.B. aus einer<br />
anderen Stelle nicht mehr in der Zweckbestimmung<br />
liegt und eigentlich vom Labor<br />
validiert werden muss) so gelagert<br />
werden, wie das der Hersteller vorgibt.<br />
Bei Kühlschranklagerung muss natürlich<br />
gewährleistet sein, dass die Kühlschranktemperatur<br />
stimmt, dass also 5° C tatsächlich<br />
5° C sind. Das wiederum lässt<br />
sich nur mit einer regelmäßigen (üblicherweise<br />
einmal jährlichen) Kalibrierung<br />
feststellen. Die Kühlschrank-Temperatur<br />
muss gegen eine Referenz gemessen<br />
werden, diese Referenz, meist ein kalibriertes<br />
(früher: geeichtes) Thermometer,<br />
muss von einer ebenfalls akkreditierten<br />
Kalibrierstelle kalibriert worden sein. Damit<br />
die Zeit zwischen zwei Kalibrierungen<br />
nicht ungenutzt verstreicht, muss der<br />
Kühlschrank noch dazu täglich überwacht<br />
(und dokumentiert) werden, denn<br />
es könnte ja ein Ausfall eines Thermostats<br />
wieder eine neue Situation schaffen.<br />
Bis hierher ist alles qualitätskontrolliert.<br />
Jetzt wird der Kit verwendet, das Probenmaterial<br />
stimmt. Jetzt möchte das Labor,<br />
aus Kostengründen, Proben poolen. Pool<br />
en bedeutet, dass definierte Aliquots aus<br />
mehreren Proben in ein Probengefäß zusammengeführt<br />
werden und als „eine Probe“<br />
behandelt werden. Wenn die Gesamtprobe<br />
negativ ist, ist davon auszugehen,<br />
dass alle darin aliquotierten Proben es<br />
auch sind. Ist die Pool-Probe „positiv“, ist<br />
also Virus-RNA nachweisbar, müssen alle<br />
Originalproben einzeln wiederholt werden,<br />
damit man die positive Probe der Originalprobe<br />
zuordnen kann. Nur: Diese Abänderung<br />
der Zweckbestimmung durch das<br />
Labor muss natürlich validiert werden, es<br />
muss ein Validierungsbericht vorliegen,<br />
aus dem letztlich hervorgeht, dass unter<br />
qualitätsgesicherten Gegebenheiten in<br />
einer Serie von Analysen bestätigt wurde,<br />
dass die Vorgangsweise zu den gleichen<br />
Ergebnissen führt, wie wenn die ursprüngliche<br />
Zweckbestimmung eingehalten worden<br />
wäre. Auch hier also: Das Poolen vom<br />
Fleck weg als Maßnahme des Labors ist<br />
im akkreditierten Rahmen nicht zulässig.<br />
So eine PCR muss von qualifiziertem Personal<br />
durchgeführt werden, das zu diesem<br />
Zweck eingeschult und befugt ist,<br />
bei einem Audit würde dies auch überprüft<br />
werden. Nach einem Lauf müssen<br />
alle Kit-immanenten Freigabekriterien<br />
überprüft und dokumentiert werden, erst<br />
dann darf ein Befund freigegeben werden.<br />
Auch die Befundfreigabe ist im akkreditierten<br />
Setting genau zu definieren.<br />
Im Zuge der Umsetzung der In vitro-Diagnostika-Richtlinie<br />
der EU aus 2017 ergibt<br />
sich zusätzlich ein Aspekt, der zu<br />
einer gewissen Unruhe unter den Labors<br />
in Österreich geführt hat. Wendet sich die<br />
IVD-R zwar überwiegend an den Hersteller<br />
eines IVD-Produktes, so gibt es einen<br />
Passus, der sich auch an die Labors<br />
selbst wendet, in dem festgelegt wird,<br />
dass, wenn ein Labor von der Zweckbestimmung<br />
abweicht, eine Validierung mit<br />
einem geeigneten QM-System durchzuführen<br />
ist; analog der ISO 15189, die hier<br />
implizit erwähnt ist. Mit anderen Worten:<br />
Ideal wäre es, wenn man ein QM-System<br />
nach ISO 15189 betreibt, denn dann kann<br />
man bei einer konkreten Abweichung von<br />
der Zweckbestimmung (was durchaus<br />
immer wieder gemacht wird und sogar oft<br />
nötig ist) unter dem Schirm der ISO 15189<br />
beruhigt validieren.<br />
Akkreditierung:<br />
selten aber sinnvoll<br />
Aus diesem Grund streben einige medizinische<br />
Labors in Österreich (derzeit<br />
sind es nur wenige, die akkreditiert sind)<br />
eine Akkreditierung an, die in Österreich<br />
grundsätzlich für medizinische Labors<br />
nicht verpflichtend ist, anders als in vielen<br />
anderen europäischen Staaten. Vorteil<br />
einer breiten Akkreditierung unter den Labors<br />
wäre ein gewisses Maß an Standardisierung<br />
in den Methoden und letztlich<br />
eine externe Bestätigung für die Labors,<br />
dass Kunden (Zuweiser, Patienten) in die<br />
Analyseergebnisse höchstes Vertrauen<br />
haben können – ein AMA-Gütesiegel für<br />
medizinische Labors gewissermaßen.<br />
Der Aufwand, zu einer Akkreditierung zu<br />
kommen, ist nicht gering – sowohl was<br />
die Kosten für die Akkreditierung selbst<br />
betrifft als auch die internen Kosten. Aber<br />
letztlich – und ich kann das aus mittlerweile<br />
14 Jahren Akkreditierungserfahrung<br />
sagen – zahlt es sich aus: Denn irgendwann<br />
gibt es nur mehr qualitätsgesicherte<br />
Prozesse, die zwar Fehler nicht verhindern<br />
können, aber die Fehleraufarbeitung<br />
derart gestalten, dass gesichert ist, dass<br />
man versucht, strukturiert aus Fehlern zu<br />
lernen und so den Kreislauf der Qualitätssicherung<br />
aufrecht zu erhalten.<br />
DR. MILO HALABI<br />
Facharzt für klinische Pathologie und Molekularpathologie<br />
Vinzenz Pathologieverbund GmbH<br />
Standortleiter Institut f. Pathologie Ried<br />
Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist<br />
Foto: © RSF ®<br />
Institutsanschrift:<br />
Institut für klinische Pathologie, Mikrobiologie und molekulare Diagnostik<br />
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried<br />
4910 Ried, Schlossberg 1<br />
milo.halabi@pathologieverbund.at<br />
42 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
Digitale Arzt-Patienten-<br />
Kommunikation<br />
Von der Erfassung der Anamnesedaten zu Hause,<br />
über die Aufnahme bis zur Aufklärung<br />
Patient*innen erfassen die Anamnesedaten<br />
zu Hause – losgelöst von Ort und Zeit.<br />
Kundeneigene Dokumente werden<br />
bereits bei der Aufnahme digital<br />
ausgefüllt und unterschrieben.<br />
Die Ärzt*in klärt ihre Patient*in<br />
über den bevorstehenden Eingriff auf.<br />
Die erfassten Anamnesedaten werden<br />
strukturiert weiterge geben und stellen<br />
eine bedarfsgerechte Versorgung sicher.<br />
Mehr Informationen unter<br />
www.thieme-compliance.de
SELTEN SO GEDACHT<br />
Das Spiel<br />
mit der Wahrheit<br />
ist auch immer<br />
ein Spiel<br />
mit dem Leben.<br />
Franz Kafka (1883 – 1924)<br />
44<br />
<strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
Klimawandel,<br />
Gesundheit und<br />
Resilienz<br />
Klimawandel, Gesundheit<br />
und Resilienz<br />
Fachsymposium – Save the Date<br />
21. bis 22. Fachsymposium September 2<strong>02</strong>3, - Save Villach, the Date Österreich<br />
21. bis 22. September 2<strong>02</strong>3<br />
Information: Expert:innen aus Lehre, Villach, Forschung Österreich und Praxis präsentieren die neuesten<br />
Erkenntnisse im Bereich Gesundheit und Klima.<br />
Information: Expert:innen aus Lehre, Forschung und Praxis präsentieren die neuesten<br />
Ideenaustausch: Erkenntnisse im Forschende Bereich Gesundheit Lehrende und Klima teilen ihre Ideen, Erfahrungen und Visionen<br />
für den Umgang mit dem Klimawandel und machen sie der Praxis zugänglich.<br />
Ideenaustausch: Forschende und Lehrende teilen ihre Ideen, Erfahrungen und Visionen<br />
Vernetzung: Key Player aus dem Gesundheitswesen, der Wissenschaft und Wirtschaft<br />
für den Umgang mit dem Klimawandel und machen sie der Praxis zugänglich<br />
vernetzen sich, um Best Practices im Bereich der Ökologie, Gesundheit und Resilienz<br />
auszutauschen und Synergien zu bilden.<br />
Vernetzung: Key Player aus dem Gesundheitswesen, der Wissenschaft und Wirtschaft<br />
vernetzen sich, um Best Weitere Practices Informationen im Bereich der und Ökologie, Anmeldung: Gesundheit und Resilienz<br />
auszutauschen https://blog.fh-kaernten.at/kligs/fachsymposium-call-for-papers/<br />
und Synergien zu bilden.<br />
Weitere Informationen und Anmeldung:<br />
https://blog.fh-kaernten.at/kligs/fachsymposium-call-for-papers/<br />
Jetzt anmelden!<br />
Jetzt anmelden!
COCHRANE<br />
Fehl- und Überversorgung in der<br />
Gesundheits- und Krankenpflege?<br />
Die Initiative „Gemeinsam gut entscheiden“ sensibilisiert seit 2017 zum Thema Über- und Fehlversorgung<br />
im Gesundheitswesen. Bisher standen medizinische Themen im Fokus. Nun kommt eine neue Liste mit<br />
der Ausrichtung auf die Gesundheits- und Krankenpflege hinzu. „Gemeinsam gut entscheiden“ ist eine<br />
Kooperation von Cochrane Österreich an der Universität für Weiterbildung Krems und dem Institut für<br />
Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Versorgungsforschung an der Medizinischen Universität Graz. Die<br />
Kampagne ist Teil der internationalen Initiative Choosing Wisely. Ziel ist, das Bewusstsein für gesundheitsbezogene<br />
Maßnahmen zu schärfen,<br />
die wenig oder keinen Nutzen<br />
haben.<br />
Pflegerelevante Choosing<br />
Wisely-Empfehlungen<br />
Die Gesundheits- und Krankenpflege<br />
ist seit Jahren mit Personalengpässen<br />
und damit verbundenen Leistungs- und<br />
Qualitätseinbußen sowohl national als<br />
auch international konfrontiert. Vor diesem<br />
Hintergrund gilt es umso mehr, die<br />
Arbeitszeit der Pflegenden angemessen<br />
zu nützen und in effektive und nachhaltige<br />
Maßnahmen zu investieren, denn mehr<br />
Pflege bedeutet nicht zwingend bessere<br />
Pflege. Im internationalen Kontext finden<br />
sich mehr als 60 Empfehlungen aus der<br />
Gesundheits- und Krankenpflege verschiedener<br />
nationaler Choosing Wisely-<br />
Initiativen. Diese richten sich weniger<br />
nach medizinischen Fachrichtungen,<br />
sondern fokussieren auf Settings, Alter<br />
der Zielgruppe oder auch bestimmte Phänomene<br />
wie z.B. Schmerz.<br />
Vorgehensweise<br />
Zur Entwicklung der Top-5-Liste wurden<br />
bereits vorhandene internationale Empfehlungen<br />
für die allgemeine Gesundheits-<br />
und Krankenpflege von Experten<br />
und erfahrenen Pflegenden in mehreren<br />
Delphi-Prozessen priorisiert. Der Österreichische<br />
Gesundheits- und Krankenpflegeverband<br />
übernahm dabei die initiale<br />
Abstimmung mit den Experten. Die<br />
Evidenz zu den ausgewählten Empfehlungen<br />
wurde durch die universitären Partner<br />
in Graz und Krems überprüft.<br />
Top-5-Empfehlungen:<br />
Gesundheits- und Krankenpflege<br />
■ Wecke ältere Menschen nachts nicht<br />
für routinemäßige Pflegehandlungen,<br />
solange es weder ihr Gesundheitszustand<br />
noch ihr Pflegebedarf zwingend<br />
verlangen.<br />
■ Vermeide bewegungseinschränkende<br />
Maßnahmen bei älteren Menschen.<br />
■ Lass ältere Erwachsene während ihres<br />
Krankenhausaufenthalts nicht im Bett<br />
liegen oder nur auf einem Stuhl sitzen<br />
und fordere ältere Menschen während<br />
eines Krankenhausaufenthalts nicht zur<br />
Bettruhe auf, es sei denn, dies ist medizinisch<br />
angezeigt.<br />
■ Verzichte bei der Pflege von an Demenz<br />
Erkrankten, die Verhaltensauffälligkeiten<br />
und psychische Symptome<br />
zeigen, auf körperliche oder chemische<br />
Zwangsmaßnahmen, es sei denn, es<br />
handelt sich um einen Notfall.<br />
■ Gehe bei älteren Erwachsenen nicht<br />
von einer Demenzdiagnose aus, wenn<br />
sich diese mit einem veränderten mentalen<br />
Status und/oder Verwirrungssymptomen<br />
vorstellen, ohne ein kurzes,<br />
sensitives und validiertes Beurteilungsinstrument<br />
zu verwenden, um ein Delirium<br />
oder ein der Demenz überlagertes<br />
Delirium festzustellen.<br />
Weitere Informationen und die Hintergründe<br />
der Empfehlungen für Gesundheitsdienstleister,<br />
Patienten bzw. deren<br />
An-/Zugehörige sind ab Juni 2<strong>02</strong>3 auf der<br />
Website www.gemeinsam-gut-entscheiden.at<br />
verfügbar. Dort kann auch die Broschüre<br />
kostenfrei bezogen werden.<br />
Autoren und Kontakt:<br />
Martin Fangmeyer, BScN, MScN<br />
Dr. in Brigitte Piso, MPH<br />
Department für Evidenzbasierte Medizin und<br />
Evaluation – Cochrane Zentrum Österreich<br />
martin.fangmeyer@donau-uni.ac.at<br />
www.gemeinsam-gut-entscheiden.at<br />
#cochraneAT<br />
46 <strong>QUALITAS</strong> • <strong>02</strong>/23
INTEGRI 2<strong>02</strong>4<br />
Einreichstart<br />
für Ihre<br />
Initiative:<br />
September<br />
2<strong>02</strong>3!<br />
Fotorechte: Werner Redl | Bildinhalt: Die „INTEGRI Glasskulptur” des Künstlers Robert Comploj, Glashütte Comploj, https://www.studiocomploj.com<br />
Der INTEGRI, Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung,<br />
wird 2<strong>02</strong>4 zum nunmehr sechsten Mal vergeben. Im September<br />
2<strong>02</strong>3 startet die Einreichphase - reichen Sie Ihre Initiative ein!<br />
Eine unabhängige Expertenjury wird erneut Organisationen<br />
und Personen auszeichnen, die den veränderten Anforderungen<br />
an ein funktionierendes Versorgungssystem mittels innovativer<br />
Modelle der Integrierten Versorgung begegnen.<br />
Die INTEGRI-Preisverleihung wird im Rahmen des<br />
Gesundheitswirtschaftskongresses 2<strong>02</strong>4 in Wien stattfinden.<br />
www.integri.at
FÜHRUNGSLABOR 2<strong>02</strong>3<br />
Ärztliche Führungskräfte von morgen treffen Profis von heute.<br />
EXKLUSIVSEMINAR DES WEITMOSER KREISES<br />
Vom 14. bis 16. September 2<strong>02</strong>3 in St. Florian/OÖ<br />
INFORMATION & ANMELDUNG: www.weitmoser-kreis.at<br />
INTEGRI