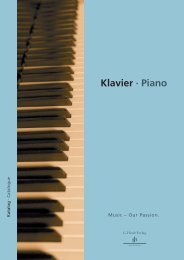Vorwort (PDF, 1698 KB) - Henle Verlag
Vorwort (PDF, 1698 KB) - Henle Verlag
Vorwort (PDF, 1698 KB) - Henle Verlag
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
XIII<br />
ge an den <strong>Verlag</strong> und schrieb dazu: „Nehmen<br />
Sie denn die Intermezzi in Gunst auf […]<br />
Ich habe noch sorgsam gefeilt und gelichtet,<br />
hoffe mir damit auch mehr den Dank des<br />
Künstlers, als des Publikums zu erwerben.“<br />
Bis zur Veröffentlichung des neuen Werkes<br />
dauerte es dann aber noch ein dreiviertel<br />
Jahr. Erst im Juli 1833 erhielt Schumann<br />
erste Korrekturfahnen. Erschienen sind die<br />
Intermezzi dann wohl im September 1833.<br />
Trotz des nicht allzu großen Umfangs und<br />
obwohl zwischen Nr. 3 und 4 ein attacca-<br />
Anschluss vorgesehen ist, wurden sie in<br />
zwei Hefte, Part I (Nr. 1 – 3) und Part II<br />
(Nr. 4 – 6), aufgeteilt. Gewidmet sind sie dem<br />
Komponisten und Violinvirtuosen Johannes<br />
Wenzeslaus Kalliwoda (1801 – 66). Auf dem<br />
Titelblatt des Autographs ist allerdings noch<br />
Clara Wieck als Widmungsempfängerin genannt,<br />
außerdem ist als Opuszahl noch die<br />
Ziffer III angegeben. Widmung und Opuszahl<br />
wurden auf Schumanns Wunsch vom<br />
<strong>Verlag</strong> geändert.<br />
Die Kritik nahm die Intermezzi recht<br />
unterschiedlich auf. War die Besprechung<br />
im ALLGEMEINEN MUSIKALISCHEN ANZEIGER<br />
eher wohlwollend, so meinte Rellstab in der<br />
Zeitschrift IRIS IM GEBIETE DER TONKUNST,<br />
Schumann befinde sich „auf einem völligen<br />
Irrwege“ und versuche lediglich, „originell<br />
durch Seltsamkeit zu seyn“.<br />
Impromptus op. 5<br />
Schumann setzt sich in seiner frühen Zeit<br />
sehr intensiv mit den klassischen Formen<br />
der Klaviermusik auseinander, insbesondere<br />
mit den Gattungen der Sonate und der<br />
Variation. Fünf der 23 ersten Opera für<br />
Klavier sind Sonaten oder Sonatensatzkompositionen<br />
(Op. 8, 11, 14, 17 und 22), drei<br />
Variationenwerke – Op. 1 und 13 sowie die<br />
Impromptus op. 5. Unter den zahlreichen<br />
bei McCorkle verzeichneten verloren gegangenen<br />
oder Fragment gebliebenen Werken<br />
befinden sich weitere sechs Variationenwerke<br />
(Schumann Werkverzeichnis, F7 – 9 und<br />
F24 – 26). Die Gattung der Variation nahm<br />
also Schumanns besondere Aufmerksamkeit<br />
in Anspruch. Er machte immer wieder<br />
Front gegen die den damaligen Musikmarkt<br />
geradezu überschwemmenden, seiner Meinung<br />
nach allzu seichten Stücke reisender<br />
Klaviervirtuosen über populäre (Opern-)<br />
Themen. Nicht von ungefähr veröffentlichte<br />
er mit den Abegg-Variationen op. 1 (1831)<br />
und den Impromptus op. 5 (1833) gleich in<br />
den ersten Jahren seiner öffentlichen Laufbahn<br />
als Komponist zwei Variationenwerke,<br />
mit denen er regelrecht demonstrierte, wie<br />
man es auch anders machen könne. In seinem<br />
„Musikalischen Lebenslauf“ bis 1833<br />
schrieb er dazu rückblickend: „Die meiste<br />
Zeit fast beschäftigte ich mich mit Bach; aus<br />
solcher Anregung entstanden die Impromptus<br />
op. 5, die mehr auf eine neue Form zu<br />
variiren angesehen werden mögen.“<br />
Zu der „neuen Form“ gehörte auch, dass<br />
in diesen Impromptus gleich zwei Themen<br />
variiert und auf besonders kunstvolle Art<br />
miteinander verbunden sind. Um diese Besonderheit<br />
augenfällig zu machen, stellte<br />
Schumann im Erstdruck die beiden Themen<br />
getrennt vor, zuerst das Bassthema, danach<br />
die darüber aufgebaute Melodie. Nach den<br />
Angaben im Titel der Erstausgabe stammt<br />
sie von Clara Wieck. Tatsächlich beginnt<br />
deren ebenfalls 1833 veröffentlichte und<br />
Robert Schumann gewidmete Romance variée<br />
op. 3 mit diesem Thema. Die vier ersten<br />
Takte tauchen jedoch bereits viel früher in<br />
einem Tagebuch Roberts auf, der sich auf<br />
der Reise von Heidelberg über Düsseldorf<br />
nach Paderborn am 28. oder 29. September<br />
1830 vier Themenanfänge notierte, von<br />
denen der zweite praktisch identisch ist mit<br />
dem Beginn des Romanzenthemas:<br />
&<br />
?<br />
w<br />
2<br />
4<br />
2<br />
4<br />
œ œ œ<br />
˙<br />
><br />
˙<br />
œ œ œ<br />
˙<br />
><br />
˙<br />
œ<br />
̜<br />
˙<br />
><br />
˙<br />
œ<br />
œ œ œ<br />
˙<br />
><br />
œ bœ<br />
˙ œ<br />
Die Keimzelle des Themas stammt also nicht<br />
von Clara, sondern von Robert Schumann.<br />
Bei dem engen musikalischen Austausch,