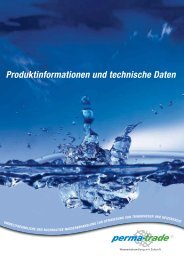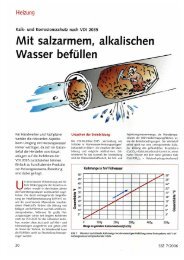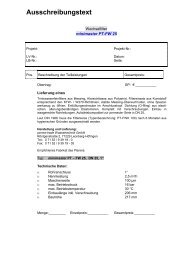Alternative Kalkschutzsysteme - Perma-Trade Wassertechnik GmbH
Alternative Kalkschutzsysteme - Perma-Trade Wassertechnik GmbH
Alternative Kalkschutzsysteme - Perma-Trade Wassertechnik GmbH
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Alternative</strong> <strong>Kalkschutzsysteme</strong><br />
••<br />
mit Zertifikat im Uberblick<br />
"Nano» hat sich in der Industrie zu einem Synonym für Innovation und Fortschritt<br />
entwickelt. Moderne <strong>Kalkschutzsysteme</strong> arbeiten mit der Bildung von Nanokristallen,<br />
auf Deutsch: Zwergenkristalle. Diese Kriställchen - rund zehntausendfach<br />
kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares - werden in grosser Anzahl<br />
benötigt, um den bei der Erwärmung ausfallenden Kalk zu binden. Dies ist das<br />
Grundprinzip der physikalischen Härtestabilisierung. Beleuchten wir dieses alternative<br />
Kalkschutzverfahren nun im Detail.<br />
Ende der 90er-Jahre hatte man<br />
sich endlich auf ein einheitliches<br />
Prüfverfahren geeinigt, um so ge<br />
nannte physikalische Wasserbe<br />
handlungsgeräte (Dauermagnete,<br />
Elektrospulen, Opferanoden, Hoch<br />
spannungssysteme usw.) auf ihre<br />
Wirksamkeit hin zu bewerten.<br />
Bis zu diesem Zeitpunkt legten<br />
deren Hersteller vielfach Kristalli<br />
sationsbilder von Kalkrückstän<br />
den (vorher/nacher) oder Ergeb<br />
nisse aus Versuchen mit einem<br />
Kapillarprüfstand (miniaturisierter<br />
Röhrenversuch nach Prof. Frahne)<br />
zum Wirkungsnachweis vor. Mit<br />
dem Kapillarprüfstand konnte die<br />
verzögerte Kalksteinbildung an<br />
Rohrinnenwänden durch be<br />
stimmte Geräte zwar eindeutig<br />
nachgewiesen werden, allerdings<br />
wurden an diesem Versuchsauf<br />
bau die nicht praxisrelevanten<br />
Strömungsbedingungen kritisiert.<br />
Das neue Prüfverfahren,<br />
sowie die zur Erlangung des<br />
SVGW + DVGW-Leistungszei<br />
chens notwendige Gebrauchs-<br />
tauglichkeitsprüfung W 510 arbei<br />
tet mit Elektroboilern. Die Anforde<br />
rung sieht vor, dass hier das vor<br />
geschalteteWasserbehandlungs gerät den Kalkausfall im Boiler um<br />
80% vermindern muss. Das heisst,<br />
ein alternatives Wasserbehand<br />
lungsgerät ist - im Sinne des Ar<br />
beitsblattes - erst dann ausrei<br />
chend wirksam, wenn sich durch<br />
das Behandlungsgerät die Kalk<br />
menge im Boiler auf ein Fünftel<br />
vermindern lässt. Diese hohe Hür<br />
de machte Neuentwicklungen<br />
notwendig, eine neue Generation<br />
von alternativen Kalkschutzgerä<br />
ten kam auf den Markt.<br />
Verfahren zur Minimierung<br />
der Steinbildung<br />
Harte Wässer verursachen bei<br />
Temperaturerhöhung oder auch<br />
bei Verwirbelungen Probleme<br />
durch Belagsbildung auf den<br />
Werkstoffoberflächen. Dies führt<br />
zu einem Mehrverbrauch an Ener<br />
gie durch die notwendige Über<br />
windung von thermischen und hy<br />
draulischen Widerständen. Zur<br />
Minimierung der Steinbildung bie<br />
ten sich an:<br />
• Stabilisierung durch Polyphos<br />
phatdosierung<br />
• Enthärtung durch Ionenaus<br />
tausch<br />
• Entsalzung durch Membranver<br />
fahren<br />
• <strong>Alternative</strong> Kalkschutzverfahren<br />
mit Zertifikat<br />
Grundsätzlich gilt für alle Verfah<br />
ren, dass die Trinkwasserverord<br />
nung eingehalten werden muss.<br />
Die älteste Methode Kalkablage-<br />
rungen zu vermindern ist die Zu<br />
gabe von Polyphosphaten. Mittels<br />
mengenproportional arbeitender<br />
Dosierstationen wird hier dem<br />
Trinkwasser maximal 5 mg/I Phos<br />
phat (als P205) zugegeben. Durch<br />
Komplexbildung werden die Här<br />
tebildner stabilisiert und mit dem<br />
Wasser ausgeschwemmt. Nach<br />
teilig ist - neben der gezielten Zu<br />
gabe von Chemikalien ins Trink<br />
wasser - die Bildung von Schläm<br />
men oberhalb von 60°C sowie<br />
ungünstige Einflüsse auf die Flä<br />
chenkorrosion metallischer Werk<br />
stoffe.<br />
Stehen technische<br />
Anforderungen<br />
oder Komfortansprüche im Vor<br />
dergrund, bietet sich der klassi<br />
sche Ionenaustausch an. Hier<br />
werden die Härtebildner Kalzium<br />
und Magnesium mit Hilfe von<br />
Kunstharzen gegen Natrium aus<br />
getauscht, welches nur leichtlös<br />
liche Verbindungen bildet. Das<br />
Wasser wird tatsächlich enthärtet,<br />
dadurch als weich empfunden<br />
und auf Sanitärkeramiken bleiben<br />
weniger Rückstände. Auch kann<br />
an Spül- und Waschmaschinen ei<br />
ne andere Härteeinstellung bzw.<br />
Dosierung vorgenommen werden.<br />
Erkauft wird dies mit Unterhalts<br />
kosten für das Regeneriersalz<br />
und, im Falle von verzinkten In<br />
stallationen, einer oft notwendigen<br />
Zudosierung von Deckschicht<br />
bildnern (Orthophosphat) zum<br />
Schutz vor wasserseitiger Korro<br />
sion.<br />
Die technisch aufwändigste An-<br />
p1aner+1n8taIlat8ur 8-2008<br />
lagentechnik erfordern die Mem<br />
branverfahren (Nanofiltration, Um<br />
kehrosmose) welche rein physika<br />
lisch das Wasser enthärten. Ähn<br />
lich einem Sieb, werden grössere<br />
Ionen (inkl. Wasserhülle) wie Kalzi<br />
um und Magnesium zurückgehal<br />
ten und als Konzentrat verworfen.<br />
Hierbei entstehen jedoch Abwas<br />
serverluste von 30% bis 50%.<br />
Alle drei Methoden verändern die<br />
Wasserzusammensetzung mehr<br />
oder weniger deutlich, sei es<br />
durch Zugabe von Phosphaten,<br />
der Erhöhung des t'Jatriumgehal<br />
tes oder der Entfernung von zum<br />
Teil physiologisch wertvollen Mi<br />
neralien.<br />
Verminderte Steinbildung ohne<br />
Veränderung der Wasser<br />
zusammensetzung?<br />
Sollen die Mineralien Kalzium und<br />
Magnesium im Wasser enthalten<br />
bleiben und darf dem Wasser<br />
nichts aktiv zudosiert werden,<br />
muss eine andere Technologie an<br />
gewendet werden. Diese Techno<br />
logien wurden Mitte der 90er Jah<br />
re mit dem Ziel einer natürlichen<br />
Härtestabilisierung entwickelt. Vo<br />
rausgegangen waren diverse phy<br />
sikalische Kalkschutztechnologien<br />
auf der Basis der beschleunigten<br />
Kristallkeimbildung, jedoch er<br />
zeugten diese Geräte bis dato<br />
nicht die notwendige Dichte an<br />
Kristallisationszentren, um bei<br />
stark unterschiedlichen Wasser<br />
qualitäten und hohen Heizflächen<br />
belastungen reproduzierbar gros<br />
se Effekte hervorzurufen.<br />
Zielführend für die Generierung ei<br />
ner hohen Dichte von Kristallisati<br />
onszentren im Trinkwasser war<br />
vor allem die Entwicklung von<br />
dreidimensionalen elektrolyti<br />
schen Zellen zur homogenen Kris<br />
tallkeimbildung. Daneben hat sich<br />
auch die verfahrenstechnische<br />
Umsetzung des Prinzips der Bio-