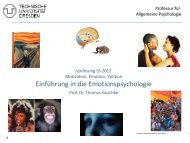Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Skriptum<br />
Sommersemester 2006<br />
Soziologie / <strong>Sozialisation</strong><br />
Literatur:<br />
H. P. Henecka (1985): Grundkurs Soziologie, Opladen<br />
M. Prisching (1995): Soziologie, Wien u.a.<br />
H. Gudjons (1999): Pädagogisches Grundwissen, Bad Heilbrunn<br />
Oerter / Montada (1995³): Entwicklungspsychologie, Weinheim<br />
A. Giddens (2001): Sociology, Oxford<br />
H. Joas (Hg) (2001): Lehrbuch der Soziologie, Frankfurt / New York<br />
K. Feldmann (2001) Soziologie kompakt, Wiesbaden<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 1
<strong>Sozialisation</strong>:<br />
Übersicht:<br />
Zur Begriffsklärung<br />
• <strong>Sozialisation</strong> – Enkulturation – Personalisation<br />
• Mensch und Gesellschaft – Mitgliedschaft in der Gesellschaft<br />
• <strong>Sozialisation</strong> als soziale Interaktion<br />
• Lebensaltersphasen und <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen<br />
• <strong>Sozialisation</strong>ssequenz<br />
• Rolle – Ich-Identität – Verfügbarkeit über soziale Rollen<br />
• Empathie – Rollendistanz – Ambiguitätstoleranz – Kommunikation<br />
• Phasen im <strong>Sozialisation</strong>sprozess<br />
Schichtspezifische <strong>Sozialisation</strong><br />
• Soziale Ungleichheit<br />
• Idealtypen<br />
• Schicht und Handlungskompetenz<br />
• Sozialmilieu – Mentalitätsfelder<br />
• Individualisierungsthesen<br />
<strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit<br />
• Familie<br />
• Kinder<br />
• Jugendliche<br />
• Erwachsene – Arbeitslosigkeit<br />
• Jugend und Beruf – Berufswahl<br />
• Alte Menschen<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 2
SOZIALISATION<br />
Zur Begriffsklärung: Abgrenzung und Konkretisierung<br />
Der Begriff <strong>Sozialisation</strong> ist dem Bereich sozialer Prozess zuzuordnen.<br />
<strong>Sozialisation</strong> ist als Teilbereich sozialer Prozesse zu verstehen.<br />
Sozialer Prozesse: sozialer Wandel (Reformen, Revolutionen),<br />
sozialer Einfluss, Kommunikation, Erziehung<br />
Sozialer Einfluss: richtet sich auf einen eng umgrenzten Verhaltensbereich<br />
oder Einstellungsbereich; Zielsetzung ist klar umschrieben,<br />
gezielt gerichtet<br />
Erziehung: (vgl. Begriffsklärung: Skriptum Bildungssoziologie)<br />
Sie kann als Teilbereich der <strong>Sozialisation</strong> bezeichnet werden.<br />
Absichtsgeleitetes Handeln, intentional; Adressat bezogen; bewusst<br />
geplant; vom Erwachsenen zum Heranwachsenden (Lehrer -<br />
Schüler, Meister - Lehrling, Eltern - Kind)<br />
Kommunikation: Prozess der Informationsübertragung zwischen Menschen;<br />
Sender - Empfänger: befolgen sozial eingespielter Regeln;<br />
aber auch Beziehungsaspekt wichtig (Sinngehalt)<br />
Der Begriff: S o z i a 1 i s a t i o n wurde von E. Durkheim 1923 erstmals zur Kennzeichnung der<br />
Abhängigkeit der Erziehung von der Gesellschaft verwendet. Mensch als "tabula rasa" bei der<br />
Geburt gesehen. Die Gesellschaft bzw. verschiedene soziale Milieus (<strong>Sozialisation</strong>sdeterminanten)<br />
bestimmen nun, was aus dem Menschen werden soll (Idealvorstellungen).<br />
G. Wurzbacher:<br />
„<strong>Sozialisation</strong> ist die Eingliederung des Menschen in die soziale Gruppe.“<br />
In den folgenden Definitionen wird dieser sehr eng gefasste Begriff in vielfältiger Weise erweitert!<br />
Gerhard Wurzbacher selbst unterscheidet zwischen folgenden Prozessen:<br />
<strong>Sozialisation</strong>:<br />
ist der Vorgang der Führung, Betreuung und Prägung des Menschen<br />
durch die Verhaltenserwartungen und Verhaltensrollen seiner Beziehungspartner.<br />
Enkulturation:<br />
ist die Aneignung oder Verinnerlichung von Erfahrungen, Gütern,<br />
Maßstäben und Symbolen der Kultur zur Erhaltung, Entfaltung und<br />
Sinndeutung der eigenen Existenz wie der Gruppenexistenz.<br />
Personalisation:<br />
ist die Ausbildung und Anwendung der menschlichen Fähigkeit zur Integration des sozialen und<br />
kulturellen Pluralismus.<br />
Andere Autoren sehen den <strong>Sozialisation</strong>sprozess unter anderen Gesichtspunkten<br />
H. Fend:<br />
Sozialisierung ist ein Prozess, in dessen Verlauf Heranwachsende<br />
Norme- -und Werte, die sie durch Erwachsene kennen lernen, übernehmen.<br />
(Vgl. Fend, Sozialisierung und Erziehung, S 13, a.a.0.)<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 3
J. Wössner:<br />
<strong>Sozialisation</strong> umfasst Prozesse der Vermittlung gesellschaftlicher<br />
Handlungs-, Denk- und Einstellungsmuster auf die Person.<br />
Es handelt sich dabei um Aufbau, Verstärkung und Veränderung von<br />
Wissen, Werten und Fähigkeiten/Fertigkeiten.<br />
I.L. Child:<br />
Er weist darauf hin, dass durch <strong>Sozialisation</strong> Handlungsspielräume eingeschränkt werden; die Fülle<br />
der bei der Geburt gegebenen Handlungsspielräume / Handlungsmöglichkeiten wird auf einen viel<br />
engeren Bereich des tatsächlichen Verhaltens/Handelns begrenzt.<br />
J. A. Clausen:<br />
Eine schärfere Abgrenzung des Begriffes ist nur dann möglich, wenn auf Teilbereiche bezug<br />
genommen wird: politische <strong>Sozialisation</strong>, religiöse Soz., berufliche Soz., schulische Soz., u.a.<br />
T. Parsons:<br />
Er versteht damit die Einverleibung neuer Elemente von Handlungsorientierungen in das<br />
Handlungssystem individueller Handelnder.<br />
M. Mead:<br />
Sie meint, dass diese Veränderung von Handlungsorientierungen mit einer Vielfalt von Bedingungen<br />
und Forderungen, die von menschlichen Gesellschaften überhaupt den in ihnen lebenden und sich<br />
entwickelnden Individuen auferlegt werden, in Zusammenhang stehen.<br />
F. Elkin:(ähnlich anpassungstheoretisch wie M. Mead)<br />
<strong>Sozialisation</strong> ist ein Prozess, durch den die Lebensformen, die Verhaltensweisen einer bestimmten<br />
Gesellschaft oder sozialen Gruppe erlernt werden, damit das Funktionieren innerhalb dieser sozialen<br />
Einheit gewährleistet sei.<br />
L. Rosenmayr:<br />
<strong>Sozialisation</strong> sei als ein normativ orientierter sozialer Vermittlungsprozess definiert, der sich -unter<br />
sozialstrukturellen Rahmenbedingungen zwischen Sozialisatoren und Sozialisanden durch ineinander<br />
verschränkte Handlungsabläufe der Weitergabe und Rezeption vollzieht.<br />
<strong>Sozialisation</strong> erfolgt in und durch Institutionen, Organisationen, aber auch in weniger strukturierten<br />
Interaktionsfeldern; sie kann sowohl stabilisierende als auch innovatorische Ziele bzw.<br />
Auswirkungen haben.<br />
<strong>Sozialisation</strong> wird als ein Vorgang bestimmt, der das Sich- Aneignen- von gesellschaftlich erlaubten,<br />
gebilligten oder geforderten Verhaltensweisen durch Rezeption von Werten, Formen und Symbolen<br />
und deren Einübung, Anwendung und Internalisierung umfasst.<br />
Hilfen zur Begriffsklärung:<br />
Individuelle <strong>Sozialisation</strong> - Gruppensozialisation: <strong>Sozialisation</strong> ist nicht nur auf das Individuum<br />
bezogen, sondern auch auf Gruppen von Individuen (Organisationen, Institutionen (Gruppenleiter,<br />
Schulklasse, u.a.)<br />
Die Richtung der Prozesse verläuft von gesellschaftlichen Instanzen zum Individuum (Schule<br />
-Schüler). Es finden aber auch gegenläufige Prozesse statt. Es wird als zumeist nicht nur eine<br />
Person/Gruppe sozialisiert, sondern auch die <strong>Sozialisation</strong>sinstanzen mitsozialisert (z.B.: die Eltern<br />
im Interaktionsprozess mit den Kindern).<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 4
<strong>Sozialisation</strong> umfasst alle Einflüsse von außen,<br />
ob sie nun intentional sind oder zufällig.<br />
Sozialisator: der, von dem die Soz. ausgeht.<br />
Sozialisand: der, auf den die Soz. gerichtet ist.<br />
Im jeweiligen <strong>Sozialisation</strong>sprozess kontrolliert der Sozialisand auf dreierlei Weise den<br />
<strong>Sozialisation</strong>svorgang. Der Sozialisand ist keineswegs nur Objekt!<br />
• er verstärkt oder baut ab die Interaktion mit dem Sozialisator<br />
• er bestimmt die Verhaltenssequenz mit<br />
• die vorher gelernten und in die Situation/Interaktion eingebrachten Wertorientierungen,<br />
Normbindungen, Gefühle und Kenntnisse beeinflussen den Erfolg des Sozialisators.<br />
„Mensch" und „Gesellschaft"<br />
Die folgenden Darlegungen von H. P. Henecka sind der Versuch, den Bezug systematisch<br />
anzusprechen (H.P. Henecka; Grundkurs Soziologie, S 56 - 59)<br />
2.2 Das soziologische Menschenbild oder<br />
„man is not born human "<br />
Peter L. Berger (geb. 1929) verdeutlicht in seiner<br />
spannend geschriebenen „Einladung zur Soziologie"<br />
unsere „soziologische Perspektive" durch einen<br />
Vergleich von zwei für das Tier wie den Menschen<br />
charakteristischen Situationen.<br />
In der ersten Situation trifft eine hungrige Katze auf<br />
eine vorbeihuschende Maus. Da Katzen einen ererbten<br />
„Instinktapparat" haben, muss niemand der Katze erst<br />
beibringen, was zu tun ist, um eine Maus zu fangen.<br />
Vielmehr ist der durch diese Situation ausgelöste<br />
Verhaltensablauf bereits entsprechend<br />
vorprogrammiert. Das Auftauchen der Maus bedeutet<br />
für die Katze einen „Reiz", auf (teil sie eine fix (lull<br />
fertige "Reaktion" als Antwort parat hat.<br />
„Wahrscheinlich", vermutet Berger, „steckt etwas in<br />
der Katze, das, sobald sie eine Maus sieht,<br />
unüberhörbar verlangt: Friss, friss, friss. Die Katze fasst<br />
nicht etwa den Entschluss, auf ihre innere Stimme zu<br />
hören. Sie folgt einfach dem Gesetz ihrer angeborenen<br />
Natur und packt die unselige Maus, deren innere<br />
Stimme übrigens wahrscheinlich nicht minder<br />
unüberhörbar fordert: Lauf, lauf, lauf. Die Katze aber<br />
kann nicht anders." (Berger 1971: 100).<br />
In der zweiten Situation kreuzt ein Mädchen den Weg<br />
eines Jünglings und erweckt in ihm vielleicht zum<br />
ersten Male heftige und leidenschaftliche Gefühle der<br />
Zuwendung und Liebe. Zwar gibt es auch hier für den<br />
jungen Mann einen Imperativ, den er - wie Berger<br />
verschmitzt bemerkt - mit allen jungen Katern,<br />
Schimpansen oder Krokodilen gemeinsam hat. Doch<br />
für diesen hinreichend bekannten Imperativ<br />
interessieren wir uns hier nicht, da er den jungen Mann<br />
in aller Regel eben nicht erfolgssicher leitet, um seine<br />
Angebetete für immer zu besitzen. Im Gegenteil, ein<br />
allzu ungestümer und plumper Annäherungsversuch<br />
würde wohl auf heftige Widerstände stoßen und das<br />
erstrebte Ziel wahrscheinlich endgültig verfehlen<br />
lassen. Berger zeigt, wie an die Stelle eines ererbten<br />
„primitiven" Programms beim Tier in der<br />
Menschenwelt ein „komplexeres" Programm als<br />
Katalog gesellschaftlicher Spielregeln tritt, das im<br />
Sinne einer sozialen „Strategie" und „Taktik" einen<br />
verlässlichen Rahmen absteckt, wie man sich in solchen<br />
Fällen zu verhalten hat. Ein solcher „sozialer<br />
Imperativ" ist wiederum sehr stark kulturell abhängig<br />
und hat die unterschiedlichsten Ausprägungen, wenn<br />
wir etwa an die entsprechenden Gepflogenheiten in der<br />
Türkei, bei den Nuba in Afrika, den Eskimos auf<br />
Grönland oder irgendeiner anderen Kultur denken. Er<br />
formuliert auch die Regeln, die einzuhalten sind, wenn<br />
im Rahmen unserer Gesellschaft ein junger Mann die<br />
Verbindung zu einem Mädchen sucht, wie ein<br />
„anständiges" Mädchen darauf zu reagieren hat und wie<br />
schließlich eine zwischengeschlechtliche Verbindung in<br />
der Institution Ehe als rechtens und dauerhaft<br />
angesehen werden soll. Zugunsten der Regeln, die eine<br />
Gesellschaft vorschreibt, werden alle anderen<br />
denkbaren Optionsmöglichkeiten ausgeschlossen. Der<br />
soziale Imperativ präsentiert in unserer Kultur die<br />
Formel: „Begehren bedeutet lieben und heiraten. Alles,<br />
was unser Mann zu tun hat, ist, die im Programm<br />
vorgeschriebenen Schritte nachzuvollziehen. Nur ganz,<br />
ganz selten einmal werden wir in die Lage versetzt,<br />
neue Typen zu erfinden, uns selbst die Modelle für<br />
unser Verhalten zu schaffen." (Berger 1971: 101).<br />
Kaum eine Verhaltensweise, die der Mensch benötigt,<br />
um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, kaum<br />
eine „Strategie", auf Grund derer er seine Wünsche<br />
verwirklichen kann, werden dem Menschen etwa durch<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 5
ein erblich verankertes Steuerungsprogramm einfach in<br />
die Wiege gelegt. Vielmehr sind nahezu alle<br />
menschlichen Verhaltensweisen nach soziologischer<br />
Auffassung Ergebnisse von Erfahrungen und<br />
Lernprozessen, die das Individuum ,in einem<br />
komplizierten Wechselspiel mit seiner Umwelt<br />
erwerben muss, egal„ob es sich um die Art und Weise<br />
handelt, sich verständlich zu machen, einander Freude<br />
zu bereiten oder Leid zuzufügen oder, wie in Bergers<br />
Beispiel, Kontaktwünsche zu signalisieren.<br />
Um Missverständnisse bei der Erläuterung ihres<br />
Menschenbildes zu vermeiden, sprechen Soziologen<br />
daher heute lieber von der „sozialkulturellen<br />
Persönlichkeit", als dass sie den mit philosophischen<br />
Wertungen befrachteten Begriff der „Person"<br />
verwenden. In diesem Sinne wird der .Mensch<br />
paradoxerweise auch nicht als „Mensch". geboren,<br />
sondern erst dazu „gemacht" („man is not born<br />
human", Burgess & Locke 1945: 213). Zwar ist das<br />
Menschsein bei der Geburt als Anlage vorhanden, doch<br />
ohne humane Umgebung kann ein neugeborenes<br />
menschliches Leben nicht zu dem werden, was seiner<br />
Gattung entspricht. Der Mensch muss seine<br />
Lebensform,, die er in der Kultur der ihn umgebenden<br />
Gesellschaft vorfindet, erst in verwickelten und<br />
vielschichtigen Prozessen erlernen.<br />
Bei dieser nach der Geburt beginnenden Phase der<br />
„Menschwerdung" geht es nur bedingt um schlicht<br />
körperliche Vorgänge. Das Kind spürt zwar körperlich<br />
Hunger und Durst, Hitze und Kälte, Licht und<br />
Dunkelheit, Behagen und Unbehagen. Doch auch diese<br />
frühkindlichen Erfahrungen werden in der Regel von<br />
anderen -Menschen beeinflusst. Sie stillen<br />
beispielsweise Hunger öder Durst in einer ganz<br />
bestimmten Form und auf eine ganz bestimmte Weise<br />
mit kulturell typischen Nahrungsmitteln und nach<br />
kulturell für richtig gehaltenen Zeitplänen. „Auf diese<br />
simple Weise drückt die Gesellschaft dem kindlichen<br />
Verhalten ihren Stempel auf. Sie reicht bis in das Kind<br />
hinein, weil sie die Funktionen seines Magens<br />
organisiert hat. Dasselbe gilt natürlich auch für<br />
Ausscheidung, Schlaf und andere organische<br />
Vorgänge." (Berger & Berger 1974: 35).<br />
In anderen Worten: Ursprünglich „offene" und<br />
unangepasste Impulse, Affekte und Reaktionen des<br />
Menschen werden durch die Übernahme<br />
sozial-kultureller Elemente (wie Normen, Werte,<br />
Sprache, Symbole usw.) überformt. Dies geschieht<br />
durch eine starke und in diesem Ausmaß der<br />
menschlichen Gattung allein eigentümlichen<br />
Einbindung in ein Geflecht sozialer Beziehungen. Diese<br />
„Menschwerdung" wird deshalb nach<br />
übereinstimmender Meinung von<br />
Sozialwissenschaftlern als ein sozialer und kultureller<br />
Prozess verstanden, als eine zweite, die so genannte<br />
sozial-kulturelle Geburt (König 1955: 127). Erst im<br />
„sozialen Mutterschoss" der Familie werden in<br />
vielfältiger Weise und Ausprägung die<br />
Voraussetzungen für die Entwicklung grundlegender<br />
menschlicher Eigenschaften und Fähigkeiten<br />
geschaffen.<br />
Wie fundamental eine sozial-kulturelle Umgebung<br />
Voraussetzung für die Entwicklung des Menschen und<br />
für die menschliche Existenz ist, zeigt die Tatsache,<br />
dass bloße physische Aufzucht ohne jede<br />
gefühlsmäßige Zuwendung und Sprachvermittlung<br />
letztlich scheitert. Besonders eindrucksvoll wird dies<br />
durch jene Schilderungen von „wilden Kindern" belegt,<br />
die ohne Einfluss von Mitmenschen, sozialen<br />
Beziehungen, Sprache und kulturellen Einrichtungen<br />
aufwuchsen (vgl. Malson, Itard & Mannoni 1974). Am<br />
bekanntesten sind die Kinder Kamala und Amala, die<br />
man 1920 in Indien in der Gesellschaft von Wölfen<br />
aufgefunden hatte und die bei ihrer Entdeckung weder<br />
aufrecht gehen, sprechen oder sich sonst wie sinnhaft<br />
artikulieren konnten (vgl. Singh 1964). Da ihnen der<br />
soziale Mutterschoss fehlte, hatten sie typische<br />
menschliche Fähigkeiten nicht ausbilden können; aber<br />
auch typische Verhaltenssteuerungen instinktiver Art,<br />
wie sie immerhin noch bei isoliert aufgewachsenen<br />
Tieren anzutreffen sind, hatten diese „Wolfskinder"<br />
nicht entwickelt. Wie diese Fallstudien belegen auch<br />
die Beispiele so genannter „Kaspar- Hauser-<br />
Schicksale“, dass ohne zwischenmenschliche<br />
Beziehungen und Hilfen grundlegende soziale<br />
Fertigkeiten nicht erworben werden können.<br />
Vergleichbare Ergebnisse für die Wirkungen solcher<br />
„Deprivationen " von sozialen Interaktionen<br />
insbesondere im Säuglings- und Kleinkindalter<br />
erbrachten auch die Beobachtungen des in den USA<br />
lehrenden Psychoanalytikers René Spitz (vgl. Spitz<br />
1974) und seiner Schüler (insbesondere Goldfarb &<br />
Bowlby). Frühe Trennung von den Eltern,<br />
beispielsweise bei hospitalisierten, längere Zeit ohne<br />
feste Bezugspersonen in Krankenhäusern, Anstalten<br />
oder Heimen untergebrachten Kindern führt mit<br />
zunehmender Dauer zu tief greifenden psychischen und<br />
auch physischen Entwicklungsstörungen<br />
(Hospitalismus). Da - so die Deprivationsforscher -<br />
infolge der in klinischen und vielen sozial-<br />
pädagogischen Institutionen üblichen, geregelten<br />
Schichtarbeit diese Kinder bei ständig wechselndem<br />
Personal nur mangelhafte individuelle und emotionale<br />
Beziehungen zu festen Zuneigungspersonen aufnehmen<br />
können und als Folge der geringeren sozialen Kontakte<br />
auch nur verminderte entwicklungsfördernde taktile<br />
und visuelle Sinnesreize erfahren, erleiden sie in<br />
solchen Einrichtungen häufig irreversible Schädigungen<br />
.kognitiver und affektiver Art mit entsprechenden<br />
psycho-somatischen Effekten, die ab einem gewissen<br />
Zeitpunkt nicht mehr ausgeglichen oder allenfalls nur<br />
mit großen Schwierigkeiten wieder (z.B.<br />
psychotherapeutisch) „repariert" werden können (vgl.<br />
hierzu Casler 1968, Hassenstein 1975, Lehr 1975,<br />
Schmalohr 1975).<br />
Halten wir jedoch abschließend fest, dass der Begriff<br />
der sozio- kulturellen Persönlichkeit nicht den<br />
Menschen in seiner Gesamtheit umschreibt, sondern<br />
eben nur die Summe von relativ stabilen Motiv-, Denk-,<br />
Gefühls- und Verhaltensstrukturen, die er haben bzw.<br />
lernen muss, um die Erwartungen seiner sozialen und<br />
kulturellen Umwelt zu erfüllen und an deren<br />
produktiven Fortführung mitwirken zu können. Bis zu<br />
einem gewissen Grade stellt die sozial-kulturelle<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 6
Persönlichkeit ein Spiegelbild der sozial-kulturellen<br />
Verhältnisse dar, die sie geprägt haben. Später wird<br />
allerdings noch zu zeigen sein, dass die sozialkulturelle<br />
Persönlichkeit nicht einfach als ein Ergebnis der<br />
passiven Anpassung des Individuums an die<br />
Gesellschaft zu verstehen ist.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Hans Paul Bahrdt, Zur Frage des Menschenbildes in<br />
der Soziologie. In: Europäisches Archiv für Soziologie,<br />
1, 1961.<br />
Alfred Bellebaum, Soziologische Grundbegriffe. Eine<br />
Einführung für Soziale Berufe. (Darin Kapitel 3:<br />
„Instinktverhalten und soziales Handeln", S. 22 29).<br />
Kohlhammer: Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1972.<br />
Es sind jedoch gerade diese Lernvorgänge, die den<br />
Soziologen besonders interessieren. Denn dass der<br />
Mensch durch seine Umwelt geformt werden kann, ist<br />
zunächst keine exklusive Erkenntnis der<br />
Sozialwissenschaft: alle Erziehung fußt auf dieser<br />
Voraussetzung. Unser Alltagswissen verbucht erst dann<br />
durch die soziologische Perspektive einen Zugewinn an<br />
„Weltverständnis", wenn prägende Einflüsse dort<br />
entdeckt werden, wo man zunächst keine vermutet,<br />
oder wenn wir als Soziologen zeigen können, dass die<br />
intendierte Erziehung oder die geplante Ausbildung<br />
noch andere als die beabsichtigten Effekte hat: eben die<br />
Vermittlung jener sozialen Regeln und Gepflogenheiten<br />
menschlichen Zusammenlebens und konkreter<br />
Lebenswirklichkeit, die kein Erziehungsprogramm und<br />
kein Curriculum thematisieren.<br />
2.4 <strong>Sozialisation</strong> und soziale Rolle: <strong>Sozialisation</strong> begegnet uns damit als ein relativ weit<br />
Wir alle spielen Theater<br />
(ebendort, S 66 – 75)<br />
2.4.1 Die Mitgliedschaft in der<br />
Gesellschaft: <strong>Sozialisation</strong><br />
Die Vermittlung sozialer Normen und<br />
Wertvorstellungen erfolgt in einem Prozess, den die<br />
Soziologie als <strong>Sozialisation</strong> bezeichnet. Der Begriff<br />
<strong>Sozialisation</strong> (engl.: socialisation) stammt aus den<br />
angelsächsischen Sozialwissenschaften. Gelegentlich<br />
wird er auch mit „Sozialisierung" (z.B. Seger 1970,<br />
Fend 1972) übersetzt, was jedoch leicht zu<br />
Missverständnissen führt, da dieses. Wort durch seine<br />
wirtschaftspolitische Bedeutung (= Verstaatlichung der<br />
Privatwirtschaft) bereits belegt" ist.<br />
<strong>Sozialisation</strong> meint mehr als der klassische<br />
pädagogische Begriff der „Erziehung", der sich ja vor<br />
allem auf jene in der Regel absichtsvollen und bewusst<br />
geplanten Bemühungen und Handlungsschritte von<br />
Eltern oder Lehrern bezieht, die zum Ziel haben, die<br />
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes pädagogisch<br />
positiv zu beeinflussen, d.h. bestimmte<br />
Verhaltensdispositionen zu entwickeln oder vorhandene<br />
zu verändern (vgl. hierzu Kob 1976: 9, Hurrelmann<br />
1976: 19 f.).<br />
Vielmehr schließt <strong>Sozialisation</strong> den Vorgang der<br />
Erziehung mit ein und umfasst darüber hinaus auch jene<br />
ungeplanten, aber persönlichkeitsprägenden<br />
Lernvorgänge, die sowohl das Kleinkind wie auch<br />
später noch der Erwachsene durch eigene Erfahrungen<br />
machen kann. Hierzu zählen jene unspezifischen<br />
Lernvorgänge, für die auch in Gesellschaften mit breit<br />
entwickeltem Erziehungswesen keine erziehende<br />
Instanz und keine erzieherischen Maßnahmen als<br />
explizite Einwirkungen auszumachen sind. Überhaupt<br />
lassen sich solche Einflüsse - denkt man beispielsweise<br />
an die prägenden Wirkungen von jugendlichen<br />
Freundschaftsgruppen, Fan-Clubs, Reklame,<br />
Massenmedien, Interessenorganisationen, politische<br />
Öffentlichkeit usw. - nach pädagogischem<br />
Selbstverständnis schwerlich alle sinnvoll als Erziehung<br />
oder Ausbildung charakterisieren, während sie faktisch<br />
indessen zweifellos sozialisierende Prozesse darstellen.<br />
gefasster Begriff, der alle sozialen Geschehensverläufe<br />
abbildet, durch die das Individuum, das mit<br />
rudimentären Instinkten, aber mit dispositionell großer<br />
Plastizität und Lernfähigkeit, also „mit einer enormen<br />
Variationsbreite von Verhaltensmöglichkeiten geboren<br />
wird, zur Ausbildung seines faktischen, weit enger<br />
begrenzten Verhaltens geführt wird wobei die Grenzen<br />
(Im Üblichen und akzeptablen Verhaltens durch die<br />
Normen der Gruppe, der es angehört; bestimmt<br />
werden" (Child 1959: 665). In anderen Worten: der<br />
Begriff <strong>Sozialisation</strong> bezeichnet einen Vorgang, der aus<br />
unendlich vielen Einzelereignissen zusammengesetzt<br />
ist, die sich unmöglich nur einem einzigen, z.B. dem<br />
„pädagogischen" Handlungssystem und -Feld zuordnen<br />
lassen. <strong>Sozialisation</strong> ist vielmehr allgegenwärtig und<br />
beinhaltet alle prozessualen Zusammenhänge, durch die<br />
der zunächst nur „biologisch" geborene Mensch<br />
allmählich zu einem Mitglied seiner ihn umgebenden<br />
Gruppe und Gesellschaft wird, eben zur<br />
sozial-kulturellen Person. Von daher lässt sich<br />
<strong>Sozialisation</strong> auch mit „Vergesellschaftung der<br />
menschlichen Natur" (Hurrelmann 1976: 15)<br />
umschreiben.<br />
Die - biologisch gesehen - „defizitäre" Ausstattung des<br />
„Mängelwesens" Mensch (Gehlen 1961 ) erweist sich<br />
damit gerade aufgrund ihres „Nicht- festgelegt- Seins"<br />
als eine positive, den Menschen auszeichnende<br />
Voraussetzung zu einer fast unendlichen Lernfähigkeit<br />
und sozial-kulturellen Variabilität. So ist der Mensch<br />
,,Nesthocker" und „Nestflüchter" zugleich, -ein<br />
„hilfloser Nestflüchter" (Portmann 1969)', der zunächst<br />
auf intensive Pflege und ständige Zuwendung durch<br />
seine soziale Umwelt angewiesen .ist, aber andererseits<br />
infolge seiner entwickelten Sinnesorgane und der damit<br />
korrespondierenden Weltoffenheit und<br />
Entscheidungsfreiheit sich verschiedenen kulturellen<br />
Umgebungen und gesellschaftlichen Alternativen<br />
anpassen kann bzw. dieselben auch nach seinen<br />
Wünschen und Bedürfnissen umzugestalten in der Lage<br />
ist, um in ihnen leben zu können. In diesem Sinne kann<br />
der Mensch als zugleich Schöpfer und Geschöpf der<br />
Kultur bezeichnet werden (Landmann 1961, Mühlmann<br />
1962).<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 7
Im Gegensatz zur rein biologischen Geburt stellt die<br />
<strong>Sozialisation</strong> keine „biomechanische", unabänderliche<br />
und situationsunabhängige Größe dar. Das zu sehen ist<br />
wichtig, da die Kultur und Gesellschaft, in der wir<br />
leben und der wir angehören, nur eine von vielen<br />
möglichen Arten der Konkretisierung menschlicher<br />
Lebensformen ist, innerhalb derer Neugeborene auf<br />
eine nach Ort und Zeit bemerkenswert unterschiedliche<br />
Art und Weise „Menschen werden". Welche Vielfalt<br />
gesellschaftlicher und kultureller Organisationsformen,<br />
den einzelnen prägenden Sitten und Bräuche es<br />
wirklich gibt, haben uns vor allem die Berichte der<br />
modernen Völkerkunde (Ethnologie) gezeigt. Dass das,<br />
was man - auch in der Wissenschaft - lange für<br />
„natürlich" gehalten hat, im ,wesentlichen kulturell<br />
bedingt ist und durch <strong>Sozialisation</strong> vermittelt und<br />
gelernt erscheint, hat beispielsweise die amerikanische<br />
Ethnologin Margaret Mead sehr anschaulich in den<br />
Berichten über ihre Forschungsreisen zu Naturvölkern<br />
der Südsee illustriert. Bei einem Vergleich dreier nahe<br />
beieinander lebender „primitiver" Gesellschaften auf<br />
Neuguinea, die sie in den Jahren 1925 -1933 besuchte,<br />
zeigte sich, dass nicht nur soziale Gewohnheiten,<br />
Bräuche und Sitten, sondern auch das Temperament<br />
und das geschlechtsspezifische Verhalten jedes<br />
einzelnen Menschen zutiefst von seiner Kultur geprägt<br />
sind. Selbst Eigenschaften wie „Männlichkeit" und<br />
„Weiblichkeit", die ja nach landläufiger Meinung<br />
unmittelbar aus der biologischen Mitgift erklärt werden,<br />
sind in hohem Masse sozialer Natur, d.h. Ergebnis der<br />
Auffassungen vom Mann und von der Frau, die in der<br />
jeweiligen Gesellschaft dominieren.<br />
Gemessen an unserer eigenen Kultur waren bei einem<br />
der von Margaret Mead untersuchten Stämme, den<br />
Tchambuli, die Rollen von Mann und Frau geradezu<br />
vertauscht. Die Frauen besaßen dort aktive,<br />
sachorientierte, planende und „herrische"<br />
Eigenschaften, zogen zum Fischen aus und ernährten<br />
dir Familie. Die "typisch fraulichen" Interessen gingen<br />
Ihnen völlig ab. Ihre Männer dagegen blieben Im Dorf<br />
und widmeten sich der Herstellung von Kostümen und<br />
Masken, der Malerei, dem Tanz und der Gestaltung von<br />
Festlichkeiten. Bei den benachbarten Arapesh und<br />
Mundugumor fand die Ethnologin eine völlig andere<br />
Form der Rollenverteilung und nur sehr geringe<br />
Temperamentunterschiede zwischen Mann und Frau.<br />
Bei den Arapesh zeigten Männer und Frauen eine<br />
gleichermaßen sanfte und eher ängstliche<br />
Persönlichkeitsstruktur und einen ausgesprochen<br />
altruistischen Sozialcharakter, gutmütig, freundlich und<br />
verständnisvoll gegenüber den Wünschen und<br />
Bedürfnissen anderer Menschen; bei den<br />
kannibalistischen Mundugumor erschienen beide<br />
Geschlechter in ihrem Charakter dagegen rücksichtslos<br />
und egoistisch, misstrauisch und ehrgeizig, gewalttätig<br />
und aggressiv gegenüber ihrer Umwelt.<br />
Aus den Beobachtungen geht hervor, dass diese großen<br />
Unterschiede nicht auf eine allgemeine Natur des<br />
Menschen zurückzuführen sind, sondern auf die<br />
<strong>Sozialisation</strong>, und diese wieder auf die kulturbedingten<br />
Normen, Werte und Institutionen, die sich in ihr<br />
ausdrücken. So werden die Kinder der Arapesh<br />
liebevoll umsorgt, erhalten jede Zuwendung und<br />
werden von allen Kümmernissen ferngehalten. Die<br />
Mutter ist dauernd bei ihnen; sie stillt sie sehr lange, sie<br />
ist sehr zärtlich. Das Arapesh- Kind erfährt so eine<br />
freundliche, bejahende Umgebung, in der nach<br />
Möglichkeit es nie abgewiesen und verletzt wird.<br />
Dagegen gelten Kinder bei den Mundugumor als<br />
Ärgernis und Quelle ehelicher Spannungen und<br />
Konflikte. Sie werden oft unmittelbar nach der Geburt<br />
getötet oder - sofern sie am Leben blieben mit betonter<br />
Gefühlskälte, Härte und Gleichgültigkeit behandelt. Die<br />
Mundugumor- Kinder erfahren ihre Umwelt als einen<br />
permanenten Kampfplatz, auf dem es nur um das<br />
Überleben geht. Jede „Weichheit" ist Ausdruck von<br />
Schwäche, keinem Menschen kann man vertrauen, alles<br />
muss man gewaltsam' erringen und gegen Feinde<br />
behaupten.<br />
Margaret Mead folgert aus diesen sehr<br />
unterschiedlichen <strong>Sozialisation</strong>seffekten bei Stämmen,<br />
die gar nicht so weit voneinander entfernt leben, „dass<br />
die menschliche Natur außerordentlich formbar ist und<br />
auf verschiedene Kulturbedingungen entsprechend<br />
reagiert. Individuelle Unterschiede zwischen Menschen<br />
verschiedener Kulturmilieus beruhen fast ausschließlich<br />
auf verschiedenen Umweltbedingungen, vor allem auch<br />
der frühesten Kindheit, und die Beschaffenheit dieser<br />
Umwelt wird durch die Kultur bestimmt" (Mead 1970:<br />
250).<br />
Wenn auch die Beobachtungsweisen von Margaret<br />
Mead aus heutiger methodologischer Sicht stark<br />
problematisiert und kritisiert werden können -was ja<br />
unlängst in populären und wissenschaftlichen<br />
Publikationen besonders massiv und teilweise auch<br />
polemisch geschah -, so werden doch die aus ihren<br />
Beobachtungen gezogenen allgemeinen<br />
Schlussfolgerungen in der modernen<br />
Kulturanthropologie und Ethnologie überhaupt nicht in<br />
Frage gestellt. Wir können somit festhalten, dass selbst<br />
biologische Vorgaben wie das Geschlecht oder<br />
physische Merkmale wie Körperstärke, Haarfarbe,<br />
Stellung der Nase oder des Kinns, Körpergröße u.ä., die<br />
zweifellos durch genetische Programme bestimmt sind,<br />
durch die im <strong>Sozialisation</strong>sprozess vermittelte<br />
gesellschaftliche Sinngebung erst diese oder jene<br />
soziale Bedeutung erhalten. D.h., welche tatsächliche<br />
Bedeutung das Geschlecht, der Besitz physischer Kräfte<br />
usw. hat, wird erst durch die damit verbundenen<br />
Definitionen und Zuschreibungen im jeweiligen<br />
Sozialsystem erhellt.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Die<br />
gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine<br />
Theorie der Wissenssoziologie. (Darin Kapitel II:<br />
„Gesellschaft als objektive Wirklichkeit", S. 49 - 138).<br />
Fischer: Frankfurt/Main<br />
1974.<br />
Claude Levi-Strauss, Natur und Kultur. In: Wilhelm<br />
Emil Mühlmann & Ernst W. Müller (Hrsg.),<br />
Kulturanthropologie, S. 80 - 107. Kiepenheuer &<br />
Witsch: Köln, Berlin 1966.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 8
2.4.2 Aspekte und Dimensionen der<br />
<strong>Sozialisation</strong>: <strong>Sozialisation</strong> als<br />
soziale Interaktion<br />
Aus unseren bisherigen Darlegungen wurde schon<br />
deutlich, dass sich <strong>Sozialisation</strong>svorgänge nicht auf die<br />
Kindheit beschränken, sondern als relativ allgemeiner<br />
Bestandteil des menschlichen Lebenszyklus zu<br />
verstehen sind.<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesse lassen sich zunächst danach<br />
unterscheiden, ob es darum geht, die grundlegende<br />
Mitgliedschaft in der Gesellschaft und damit die<br />
Fähigkeit zur Teilnahme am sozialen Geschehens<br />
überhaupt erst zu erwerben, oder darum, neue<br />
Möglichkeiten der Verwirklichung dieser Beteiligung<br />
zu lernen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass<br />
nicht nur die <strong>Sozialisation</strong> als ein dynamischer Prozess,<br />
sondern auch der Begriff der Person dynamisch zu<br />
verstehen ist. Leben bedeutet eine komplexe Abfolge<br />
von Prozessen des Lernens, Verlernens und neuen<br />
Lernens.<br />
„So erfährt ein Kleinkind, dass die Umwelt auf sein<br />
Schreien in ganz bestimmter Weise reagiert. Wenn das<br />
Kind dann später eine elementare Sprache gelernt hat,<br />
wird erwartet, dass sich von da ab das Kind der Sprache<br />
bedient, statt undifferenziert zu schreien: Schreien als<br />
Form der Kommunikation ist zu verlernen, Sprechen<br />
selbst bei sehr dringlichen Bedürfnissen zu erlernen.<br />
Weinen als Form der Mitteilung des Kindes, nun<br />
wünsche es Trost und zumindest Aufmerksamkeit, wird<br />
in unserem Kulturkreis über viele Lebensjahre hinweg<br />
akzeptiert, wird dann aber mit dem Beginn des<br />
Schulalters immer weniger legitim. Zunächst soll das<br />
Kind sich vertrauensvoll an alle Erwachsenen wenden.<br />
In dem Masse, wie der Kreis der Erwachsenen, denen<br />
das Kind begegnet, differenzierter wird, soll das Kind<br />
lernen, sich differenziert zu verhalten und unbekannten<br />
Erwachsenen gegenüber misstrauisch zu sein."<br />
(Scheuch & Kutsch 1972: 103 f.). Mit anderen Worten:<br />
Die Erwartungen, die mit der Teilnahme am<br />
gesellschaftlichen Leben verknüpft sind, ändern sich<br />
mit zunehmendem Alter und mit der Erweiterung der<br />
Lebenskreise. Veränderte Situationen und Umgebungen<br />
stellen an das Individuum neue Probleme der sozialen<br />
Beteiligung und Beanspruchung. Manches muss<br />
korrigiert, manches neu erworben werden.<br />
Man bezeichnet die erste und elementare <strong>Sozialisation</strong><br />
in der frühen Kindheit als primäre <strong>Sozialisation</strong>. Sie<br />
erfolgt in der Regel in der Familie und vermittelt<br />
inhaltlich und formal die Grunderfahrungen des<br />
sozialen. Lebens in einer kleinen und vertrauten<br />
Gruppe: Das Kind lernt, welche Bedeutungen die<br />
Menschen seiner unmittelbaren Umgebung mit ihren<br />
Worten, Gesten, Mienen und mit ihrem Tun und Lassen<br />
verbinden; es lernt, sich selbst, bestimmte<br />
Verhaltensweisen bzw. vorsprachliche und dann auch<br />
sprachliche Ausdrucksformen anzueignen die die<br />
anderen verstehen und gelten lassen; und schließlich<br />
muss das Kind lernen, seine Bedürfnisse mit den<br />
Erwartungen seiner Umwelt in Einklang zu bringen.<br />
Fachlich gesprochen werden damit kognitive,<br />
sprachliche, motivationale und affektiv-emotionale<br />
Persönlichkeitsmerkmale in der primären <strong>Sozialisation</strong><br />
zunächst elementar ausgeformt.<br />
Die hierbei vermittelten gesellschaftlichen<br />
Verhaltensmuster und Erfahrungen legen zwar ein<br />
relativ solides Fundament, das im Verlauf späterer<br />
Lebensphasen jedoch nach zahlreichen Richtungen hin<br />
weiter ausgebaut und ergänzt, aber auch differenziert<br />
und modifiziert werden muss. Dies geschieht in der so<br />
genannten sekundären <strong>Sozialisation</strong>, die auf der Basis<br />
primärer Sozialisiertheit aufbaut, hingegen im<br />
wesentlichen im außerfamiliären Raum verläuft, wie<br />
z.B. im Kindergarten, in der Schule und in<br />
Freundschaftsgruppen, im Beruf, in der Freizeit, in<br />
Vereinen, in religiösen Gruppen, aber auch in<br />
„anonymen" Feldern der Konsumindustrie, der<br />
Massenmedien usw.<br />
<strong>Sozialisation</strong> müssen wir darum auch als einen<br />
kumulativen, aktuell sich vollziehenden lebenslangen<br />
Prozess verstehen, der nicht - wie manche Autoren<br />
(z.B. Schelsky 1963: 84 ff.) noch annahmen – mit dem<br />
Ende der Jugendphase als abgeschlossen gelten kann. In<br />
jeder neuen Lebensphase ergeben sich insbesondere<br />
auch unter veränderten materiellen Bedingungen und<br />
durch den Wechsel von sozialen Beziehungen (z.B. bei<br />
Eheschließung, Berufswechsel, Arbeitslosigkeit, Wahl<br />
in einen Vereinsvorstand, Pensionierung, Umzug in ein<br />
Altersheim) immer wieder neue<br />
<strong>Sozialisation</strong>skonstellationen, die beim Individuum<br />
Veränderungen von bestehenden bzw. die Übernahme<br />
neuer Handlungsfähigkeiten erforderlich machen. So<br />
lässt sich unter soziologischer Perspektive für unsere<br />
Kultur und Gesellschaft als eine mögliche<br />
Strukturgliederung im Lebenslauf beispielsweise<br />
folgende Phaseneinteilung der sozialen Bedingungen<br />
und Folgen des lebenslangen <strong>Sozialisation</strong>sprozesses<br />
vornehmen.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 9
Tab. l:<br />
Kulturspezifische Lebensalterphasen und <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen eines lebenslangen<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesses in der industriellen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland<br />
(Österreich)<br />
Soziologische Soziales Feld, sozialisationsdominante Orientierungen und<br />
Lebensaltersphasen<br />
1) Kleinstkind<br />
(bis 2 Jahre)<br />
2) Familienkind (ca. 2. - 4.<br />
Lebensjahr)<br />
3) Nachbarschaftliches<br />
Spielkind (ca.4. - 6.<br />
Lebensjahr)<br />
4) Schulkind (ca. 6. - 15.<br />
oder 16. Lebensjahr)<br />
5) Lehrling, Berufs-, Fach-<br />
oder Hochschüler<br />
(ca. 15. - 18. Lebensjahr<br />
und vielfach darüber<br />
hinaus)<br />
6) Lediger, junger<br />
Erwachsener (ca. 18.<br />
Lebensjahr -Heirat,<br />
durchschnittliches<br />
weibliches Heiratsalter<br />
22,9 männliches 25,6 /<br />
auf ca. 29 Lj. gestiegen)<br />
7) Phase des mittleren<br />
Erwachsenendaseins<br />
(etwa von der<br />
Heirat bis zum<br />
Ausscheiden<br />
der Kinder aus dem<br />
elterlichen Haushalt, ca.<br />
v. 24. bis zum 45./ S O.<br />
Lebensjahr)<br />
8) Phase des älteren<br />
Erwachsenen (etwa vom<br />
45./50. bis zum 60./65.<br />
Lebensjahr; u, zur<br />
beruflichen<br />
Pensionierung)<br />
9a) Die Phase des<br />
rüstigen alten<br />
Menschen im<br />
Pensionsalter<br />
(ab 60./65. Lebensjahr)<br />
9b) Die Phase des<br />
pflegebedürftigen alten<br />
Menschen<br />
Rollenpartner<br />
Mutter (und zusätzliche andere Mitglieder der Kleinfamilie). .<br />
Kleinfamilie und ihr Verkehrskreis (Verwandte, Nachbarn, Freunde, Handwerker,<br />
Postbote, Arzt, Kaufleute u.a.m.).<br />
Neben Feld 1 und 2 werden nachbarschaftliche Spielgruppe und Kindergarten- bzw.<br />
Vorschulgruppe einflussreich.<br />
Neben den Feldern 1 - 3 erhält die staatlich bestimmte Organisationsstruktur der Schule<br />
mit den Lehrern als Autoritätspersonen in Schulorganisation, !.ehre und Prüfung große<br />
Bedeutung; Motivierung und Disziplinierung tätig zu systematischem schulischen Leinen,<br />
individuelle Leistungskonkurrenz.<br />
Zu den <strong>Sozialisation</strong>sinstanzen aus den Feldern 1 - 4 kommen der Betrieb, die<br />
Berufsschule, die Verkehrsgruppe der Gleichaltrigen in einer stark jugendspezifischen<br />
Freizeitsubkultur; Probleme der Berufswahl, der Ausbildungsplatzsuche und der<br />
Geschlechtspartnerbeziehung werden dominant.<br />
Der öffentliche Raum mit Wahlpflicht und mit der militärischen oder der<br />
Ersatzdienstorganisation kommen zu den Feldern 1 - 5; mit Ende der Lehrzeit ergibt sich<br />
eine stärker selbst bestimmte berufliche Mobilität. Fragen der Ehepartnersuche und<br />
Orientierung auf eine familiale und berufliche Lebensperspektive treten in den<br />
Vordergrund.<br />
Soziale Strukturen aus den Feldern 1 - 6 wirken selektiv nach. Neue<br />
<strong>Sozialisation</strong>sanforderungen ergeben sich aus eigenem Haushalt, Gattenrolle, Elternrolle;<br />
aus der Erfahrung der Abhängigkeit des eigenen und des familialen Status von beruflicher<br />
Ausbildung, Fortbildung und Initiative. Dazu treten evtl. zusätzliche<br />
<strong>Sozialisation</strong>swirkungen durch Mitgliedschaften bei Verbänden, Elternbeiräten,<br />
Freizeitvereinigungen.<br />
Schwiegerkinder und schwiegerelterliche Rollenprobleme.<br />
Nachlassen beruflicher Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit, Konfrontation mit<br />
konkurrierendem jüngerem beruflichen Nachwuchs; Altersabstieg der eigenen Eltern in<br />
die statusmindernde Pensionierung, .die Verwitwung und evtl. in die Pflegebedürftigkeit.<br />
1) Konfrontation mit dem Problem der stetigen Altersfreizeit und des<br />
Ausgeschiedenseins aus Berufstätigkeit und Berufseinfluss;<br />
2) mit Fragen und Möglichkeiten früherer oder Entwicklung neuer Hobbies, der<br />
hobbyartigen Weiterführung früherer Berufsinteressen und Berufsbeziehungen;<br />
3) Konfrontation mit einem schrumpfenden Haushalt, mit Pflegebedürftigkeit und<br />
Verlust des Ehepartners,<br />
4) mit dem Problem einer adäquaten und optimalen Distanz zu Haushalt, Ehe und<br />
Familie der Kinder;<br />
5) zunehmende Begegnung mit den Organisationsstrukturen des Gesundheitswesens<br />
und der Altersfürsorge und<br />
6) mit dem Problem des sich nähernden Lebensendes.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 10
Bei der Untersuchung einfacher, d.h. überschaubarer<br />
und relativ „stabiler", nicht-industrieller Gesellschaften<br />
der Vergangenheit wird dieser lebenslange<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess möglicherweise weniger<br />
offenkundig als in den hoch differenzierten und<br />
dynamischen Industriegesellschaften der Gegenwart,<br />
deren ökonomische, politische, soziale und kulturelle<br />
Strukturen raschen Wandlungen und rapiden<br />
Umbrüchen unterworfen sind. Gerade in unserer<br />
Gegenwart gewinnt daher dieser Prozess - und damit<br />
verbunden die Notwendigkeit lebenslangen Lernens -<br />
sowohl individuell als auch sozial zunehmend an<br />
existentieller und funktionaler Bedeutung.<br />
Schließlich soll nochmals ausdrücklich auf dir<br />
Eigenaktivität des Individuums im<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess verwiesen werden. Zwar Ist das<br />
zu sozialisierende Kind in seinen ersten Lebensjahren<br />
in seinem physischen Überleben völlig abhängig von<br />
seiner sozialen Umwelt, was es damit „bezahlt", dass es<br />
sich dieser Umwelt anpasst. Aber diese „Anpassung"<br />
erfolgt ja nicht so,, dass das Kind einfach alles<br />
aufnimmt, sondern es trifft schon unbewusst eine<br />
Auswahl .aus der angebotenen Fülle. Was ihm nicht<br />
passt, das sieht und hört es nicht; es lernt also durchaus<br />
nicht alles, und was es lernt, lernt es verschieden gut.<br />
So setzt sich also das Individuum - mit zunehmendem<br />
Alter immer deutlicher -auch bewusst und unbewusst<br />
mit seiner materiellen und gesellschaftlichen Umwelt<br />
auseinander, wirkt auf dieselbe zurück und macht sie<br />
sich auf seine eigene Art und Weise zu eigen.<br />
<strong>Sozialisation</strong>svorgänge sind deshalb keineswegs<br />
einseitig, sondern müssen notwendigerweise als soziale<br />
Interaktionsprozesse begriffen werden, - ein Aspekt,<br />
den beispielsweise Goslin (1969) betont, wenn er die<br />
<strong>Sozialisation</strong> als einen „two- way" - Prozess<br />
charakterisiert.<br />
In einem sozialen Interaktionssystem wie z.B. der<br />
Familie wird jedes Mitglied das Verhalten eines jeden<br />
anderen Familienmitglieds beeinflussen, regulieren und<br />
somit wechselseitig sozialisieren. Solche Effekte kann<br />
man ja immer wieder beobachten, wenn ein Ehepaar<br />
bei der alltäglichen physischen und psychischen<br />
Versorgung seines ersten Kindes allmählich jene<br />
Handlungsfähigkeiten lernt, die seine Elternrolle<br />
schließlich konstituieren, oder wenn der junge, eben<br />
von der Hochschule entlassene Lehrer erst „mit Hilfe"<br />
seiner Schüler in seine Lehrerrolle hineinwächst.<br />
Zwar könnte hierzu angemerkt werden, dass in dem<br />
angeführten Beispiel der Eltern-Kind-Beziehung die<br />
Eltern ja ihren Säugling in seiner prägsamsten Zeit<br />
(primäre <strong>Sozialisation</strong>) beeinflussen, während<br />
umgekehrt die beispielsweise durch das Lächeln des<br />
Kindes hervorgerufenen <strong>Sozialisation</strong>seffekte die<br />
Eltern zu einem Zeitpunkt treffen, in dem ihre<br />
Persönlichkeitsentwicklung im allgemeinen bereits eine<br />
bestimmte Strukturierung, Ausprägung und Reife<br />
erreicht hat (sekundäre <strong>Sozialisation</strong>), also solche<br />
wechselseitigen <strong>Sozialisation</strong>sprozesse auf zwei<br />
verschiedenen qualitativen Ebenen ablaufen. Doch<br />
lassen sich solche gegenseitigen<br />
<strong>Sozialisation</strong>swirkungen natürlich auch in<br />
„horizontalen" Interaktionsbeziehungen altersgleicher<br />
Partner nachweisen, - etwa zwischen Geschwistern,<br />
den Spielgefährten in 'der Kindergartengruppe,<br />
zwischen den Schülern einer Klasse und<br />
selbstverständlich auch zwischen Erwachsenen.<br />
So lässt sich also sagen, dass im <strong>Sozialisation</strong>sprozess<br />
das Individuum psychisch und sozial zu einem<br />
potentiell handlungsfähigen menschlichen Subjekt<br />
wird, das nicht nur in der Lage ist, sich seiner<br />
gesellschaftlichen Umwelt anzupassen und sich ihren<br />
Erwartungen entsprechend zu verhalten, sondern das<br />
zugleich auch kommunikativ und interaktiv auf deren<br />
Gestaltung Einfluss zu nehmen vermag.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Michael Argyle, Soziale Interaktion. (Darin<br />
insbesondere Kapitel 2: „Biologische und kulturelle<br />
Ursprünge der Interaktion", S. 26 - 89). Kiepenheuer<br />
&. Witsch: Köln 1969.<br />
George McCall & J.L. Simmons, Identität und<br />
Interaktion. Untersuchungen über<br />
zwischenmenschliche Beziehungen im Alltagsleben.<br />
(Darin Kapitel 8: „Der interaktive Werdegang des<br />
Individuums", S. 213 - 237). Schwann: Düsseldorf<br />
1974.<br />
Karl Reinhold Mühlbauer, <strong>Sozialisation</strong>. Eine<br />
Einführung in Theorien und Modelle. (Darin „Zum<br />
wissenschaftlichen Stand der<br />
<strong>Sozialisation</strong>sforschung", S. 13 - 26). Fink: München<br />
1980.<br />
Im Prinzip wird damit der <strong>Sozialisation</strong>svorgang nicht<br />
nur als Integrations-, sondern auch als Durchdringungs-<br />
(Interpenetrations-) Prozess von Kultur, Gesellschaft<br />
und Person gedeutet. <strong>Sozialisation</strong> selbst erscheint<br />
bereits inhaltlich mit den gegebenen<br />
allgemeingesellschaftlichen bzw.<br />
subkulturell-spezifischen Normen, Werten und<br />
sozial-strukturell verankerten Institutionalisierungen<br />
festgelegt. Der <strong>Sozialisation</strong>sprozess ist um so<br />
erfolgreicher, je mehr das Individuum seine Rolle auch<br />
„ist".<br />
Das dieser Denkfigur unterliegende „elementare<br />
Modell" einer <strong>Sozialisation</strong>ssequenz lässt sich graphisch<br />
wie folgt veranschaulichen:<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 11
Abbildung 5:<br />
Struktur einer elementaren <strong>Sozialisation</strong>ssequenz<br />
SAG<br />
<strong>Sozialisation</strong>sagent<br />
Rollenerwartung<br />
Bereich des sozialen Systems,<br />
in dem das Individuum mit der<br />
Rollenerwartung konfrontiert<br />
wird (Bezugsgröße)<br />
I II III<br />
RT<br />
Sozialisand<br />
Quelle: Frey 1914: 42, entnommen Henecka 1980:98<br />
Das Feld I bezeichnet gewissermaßen einen „Input" von<br />
Seiten des „<strong>Sozialisation</strong>sagenten" (z.B. Eltern, Lehrer<br />
u.ä.), mit dem der Sozialisand interagiert und<br />
kommuniziert. In der Konsequenz dieses Inputs wird in<br />
Feld Il auf der personalen Ebene des Sozialisanden und<br />
potentiellen Rollenträgers ein individual-<br />
psychologischer Umsetzungs- und Lernprozess in Gang<br />
gebracht, der die individuellen Bedürfnisse des<br />
Handelnden mit den Erwartungen seiner<br />
Interaktionspartner in Einklang bringt. Dies äußert sich<br />
dann in Feld III als „Output" in einem mehr oder<br />
weniger angepassten faktischen Verhalten des<br />
Rollenträgers. Allzu starke Abweichungen von der<br />
idealen Entsprechung der Rollenerwartung werden als<br />
„Pannen" oder „Defekte" im <strong>Sozialisation</strong>sprozess<br />
angesehen bzw. als individuelle „Kurzschlüsse" und<br />
„Fehlreaktionen" bedauert und je nach dem Grad der<br />
Abweichung entsprechend scharf negativ sanktioniert.<br />
Die strukturell-funktionale Handlungs- und<br />
<strong>Sozialisation</strong>stheorie geht also aus - insbesondere in der<br />
Version von Parsons - von der Frage nach den<br />
Bedingungen, unter denen soziale Systeme stabil und<br />
überlebensfähig sind. Eine relative Gleichförmigkeit des<br />
Verhaltens und Handelns verschiedener Individuen in<br />
gleichen sozialen Situationen wird hierfür als<br />
entscheidende Voraussetzung angenommen.<br />
Entsprechend wird der Vermittlungsprozess von<br />
Individuum und Gesellschaft einseitig oder zumindest<br />
primär von der gesellschaftlichen Ebene her betrachtet,<br />
wenn <strong>Sozialisation</strong> in anpassungsmechanistischer<br />
Tendenz als ein Vorgang begriffen wird, durch den ein<br />
Individuum von diversen <strong>Sozialisation</strong>sagenturen und<br />
-medien in bestehende soziale Rollen- und<br />
Faktoren<br />
der<br />
Persönlichkeitsstruktur<br />
„Dispositionen“<br />
Verarbeitung der Rollenerwartung<br />
durch das Individuum als<br />
Potentieller Rollenträger (RT)<br />
V RT<br />
Schwankungsbereich des<br />
tatsächlichen Rollenverhaltens V<br />
innerhalb des sozialen<br />
Systems (Messgröße)<br />
VEE<br />
ideale<br />
Ent-<br />
sprechung<br />
der<br />
Rollen-<br />
erwartung<br />
Interaktionssysteme integriert wird, in denen es die<br />
normativen Erwartungen seiner Kultur lernt,<br />
verinnerlicht und dann ihnen entsprechend handelt.<br />
Letztlich geht diese <strong>Sozialisation</strong>stheorie von einem<br />
voll sozialisierten Individuum aus, das selbst wieder<br />
vorwiegend als Element eines integrierten<br />
Sozialsystems verstanden und in dieser<br />
Betrachtungsweise vorrangig auf seine Funktionalität<br />
für dieses System untersucht wird. Unterstellt wird<br />
gleichzeitig, dass beim einzelnen Menschen jeglicher<br />
„Naturrest" in Form von Triebimpulsen und Affekten<br />
kulturell überformt bzw. von den gesellschaftlichen<br />
Wertvorstellungen und Institutionen absorbiert worden<br />
ist. Fraglos bleiben hierbei aber jene Dimensionen<br />
möglicher Freiheitsgrade des Handelns und Denkens<br />
weitgehend unberücksichtigt, "in denen das Verhältnis<br />
des handelnden Subjekts zu seinen Rollen gefasst<br />
werden kann" (Habermas 1968: 8).<br />
Mit anderen Worten: Die Anteile des .Individuums (das<br />
immer noch „mehr" ist als das Bündel der von ihm<br />
„getragenen" Rollen) am konkreten Rollenspiel,<br />
Probleme der autonomen Stellungnahme und der<br />
kritischen Auseinandersetzung des Individuums mit<br />
seinen Rollen werden von einer. rein rollentheoretisch<br />
arbeitenden, strukturell-funktional orientierten<br />
<strong>Sozialisation</strong>sforschung nicht erfasst, „es sei denn mit<br />
dem Hinweis auf das im Prinzip über den Mechanismus<br />
der Sanktionen erfolgende ,Einspielen` des Menschen<br />
auf seine Rolle, eine Grundannahme, die ein deutlich<br />
pessimistisches Bild vom Menschen verrät" (Hartfiel<br />
1973: 28).<br />
Empirisch ist unschwer nachweisbar, dass es sich bei<br />
den Annahmen des Parsonsschen <strong>Sozialisation</strong>s- und<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 12
Rollenmodells eher um idealtypische Annahmen<br />
handelt. Explizit deutlich wird das bei Dahrendorf, der<br />
ja seine Rollentheorie nicht auf wirkliche Menschen<br />
bezog, sondern eben auf die Konstruktion von „homo-<br />
sociologicus" (analog den wirtschafts- und<br />
politikwissenschaftlichen Konstrukten des „homo<br />
oeconomicus" und des „homo politicus"), - auf ein<br />
Modell vom „soziologischen Menschen" also, an dem<br />
man das „ideale" Rollenverhalten ableiten kann.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Hans-Peter Frey, Theorie der <strong>Sozialisation</strong>. Integration<br />
von system- und rollentheoretischen Aussagen in<br />
einem mikrosoziologischen Ansatz. (Darin<br />
insbesondere Teil I/3: „Die Funktion von<br />
<strong>Sozialisation</strong>smechanismen Im gesell- Systemmodell<br />
vom Parsons", S. 4 - 18). Enke: Stuttgart 1914.<br />
Rainer Geissler, Die <strong>Sozialisation</strong>stheorie von Talcott<br />
Parsons. Anmerkungen zur Parsons-Rezeption in der<br />
deutschen Soziologie. In: Kölner Zeitschrift für<br />
Soziologie und Sozialpsychologie, 31. Jahrgang, H. 2,<br />
1979, S. 267 - 281.<br />
2.4.5 Sind wir wirklich alle Schauspieler? -<br />
Zur Kritik und Erweiterung des<br />
Rollenmodells<br />
Kritische Einwände gegen die analytische<br />
Fassungskraft und theoretische Reichweite des<br />
strukturell-funktionalen <strong>Sozialisation</strong>s- und<br />
Rollenkonzepts kamen vor allem von jenen, die weniger<br />
an einer (idealtypischen) Rekonstruktion sozialer<br />
Systeme als an Aussagen über das tatsächliche soziale<br />
Alltagshandeln interessiert waren. Bedenken gegen die<br />
übermäßige Betonung des gesellschaftlich Normativen<br />
und damit auch gegen die, die sozialisierende Seite des<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesses akzentuierenden Rollentheorie<br />
(= sog. „normatives Paradigma") wurden insbesondere<br />
von jenen Soziologen und Sozialpsychologen<br />
formuliert, die sich eher der Schule des so genannten<br />
„Symbolischen Interaktionismus" verpflichtet fühlen<br />
(z.B. Gouldner 1960, Turner 1962, Goffmann 1973,<br />
Wilson 1973 u. a.).<br />
Dieser von George Herbert Mead (1862 - 1931)<br />
begründete - allerdings erst nach dessen Tod zur<br />
breiteren wissenschaftlichen Anerkennung und Geltung<br />
gelangende - soziologisch-sozialpsychologische<br />
Theorieansatz (vgl. Mead 1973, zuerst 1934 postum)<br />
berücksichtigt zur Erfassung des alltäglichen<br />
Normalfalles von sozialem Handeln nämlich stärker die<br />
individuierenden Aspekte des <strong>Sozialisation</strong>sgeschehens,<br />
indem es ihm. darauf ankommt, im Spannungsfeld<br />
zwischen den rollenmäßigen Begrenzungen und<br />
Zwängen der Gesellschaft und den primären<br />
Bedürfnissen und Voraussetzungen des Individuums<br />
jene individuellen Freiheitsräume sozialen Handelns<br />
auszumachen und jene menschlichen<br />
Grundqualifikationen zu erkennen, die eine relative<br />
Autonomie bzw. subjektive Interpretation des<br />
Individuums beim Rollenspiel ermöglichen (= sog.<br />
„interpretatives Paradigma").<br />
Der symbolische Interaktionismus deutet die<br />
Entwicklung des zwischenmenschlichen Handelns und<br />
Verhaltens nicht nach dem Lernmodell von „Reiz"<br />
(Stimulus) und „Reaktion" (Response), sondern betont<br />
nachhaltig die kommunikativen und symbolischen<br />
Aspekte vom <strong>Sozialisation</strong>. Menschliches Verhalten<br />
entsteht zwar aus der Teilnahme an sozialen Prozessen<br />
innerhalb sozialer Strukturen und Ordnungen, beruht<br />
jedoch grundlegend auf Interaktion und Kommunikation<br />
und bedient sich überwiegend symbolischer- Zeichen,<br />
insbesondere der Sprache. Durch gemeinsame<br />
Interpretationen erhalten alle Gegenstände, Strukturen,<br />
Personen und Verhaltensweisen der jeweiligen Kultur<br />
soziale Bedeutungen („meanings"), die es dem<br />
Individuum ermöglichen, soziales Handeln - wie<br />
beispielsweise Rollenhandeln - stets intentional, d.h. mit<br />
einem bestimmten Sinngehalt, zu verwirklichen (vgl.<br />
Krappmann 1975: 20 f., Lindesmith & Strauss 1974: 27<br />
ff.) D.h., die soziologische Grundfrage nach den<br />
Entwicklungsgesetzen menschlichen Zusammenlebens<br />
beantwortet der symbolische Interaktionismus mit dem.<br />
Prinzip einer einvernehmlichen Interpretation über<br />
Gegenstandsbedeutungen im Rahmen sozialer<br />
Beziehungen, in die sich die Persönlichkeitsentwicklung<br />
als Zusammenhang von „Interaktion" und „Selbst"-<br />
Entwicklung eingliedern lässt („Modell einer<br />
vereinbarten Ordnung", Strauss 1969: 19J.<br />
Diese nicht ganz einfachen Ableitungen versucht Mead<br />
im amerikanischen Original seiner Schriften mit den<br />
Termini ,J" und "me" zu erhellen. Beide Begriffe wären<br />
im Deutschen mit „ich" wiederzugeben, was jedoch die<br />
von Mead beabsichtigte Differenzierung verwischen<br />
würde. Mit der grammatikalischen Unterscheidung von<br />
„1" als Subjektfall und "me" als Objektfall der ersten<br />
Person Singular möchte Mead vielmehr bewusst auf<br />
zwei verschiedene Seiten des sozialen Handelns<br />
aufmerksam machen. Auf die uns bereits geläufige<br />
Theatermetapher bezogen, stellt das "me" die objektive<br />
Seite des Rollenspiels dar, das von anderen auf die<br />
Aufführungsrichtigkeit und „Werktreue" des „sozialen<br />
Textes" hin beobachtet und kontrolliert wird, während<br />
das „I" den subjektiven Aspekt, nämlich den<br />
Schauspieler in seiner persönlichen Originalität und<br />
individuellen Unverwechselbarkeit sowie der<br />
schöpferischen Interpretation seiner Rolle zum<br />
Ausdruck bringt. Oder allgemeiner formuliert: Das<br />
"me" besteht aus einer Reihe von gesellschaftlich<br />
vorbestimmten und normierten Rollen (z.B. Lehrer oder<br />
Schüler, Sohn oder Tochter, Katholik oder Protestant)<br />
und stellt meine soziale Identität dar, während das nach<br />
Verwirklichung meiner genuin eigenen Bedürfnisse<br />
drängende „1" das Freiheitspotential meines „Selbst",<br />
d.h. meine personale Identität bezeichnet. Das „I" denkt<br />
über die zugemuteten oder vorgeschriebenen Rollen<br />
nach, sucht sie individuell zu gestalten oder kennt auch<br />
Wege, sich unter bestimmten Voraussetzungen dem<br />
Zwang tradierter Kulturmuster zu entziehen.<br />
Aus dieser Konstruktion von „I" und "Me" ergibt sich<br />
für die Binnenstruktur des Selbst ein labiles<br />
Gleichgewicht. Begreift man bildhaft die analytische<br />
Trennung zwischen „I" und "me" gewissermaßen als<br />
eine flexible Membrane, so lassen sich die<br />
Austauschprozesse zwischen „I" und "me" etwa<br />
folgendermaßen erläutern:<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 13
Abbildung 6:<br />
Das labile Gleichgewicht der Ich-Identität<br />
Tendenzen der<br />
Individuation<br />
und<br />
Personalisation<br />
H. P. Henecka 1980: 122<br />
„Selbst“<br />
Je stärker die Umwelt seitens ihrer<br />
<strong>Sozialisation</strong>sagenturen bestimmte Erziehungsziele<br />
verfolgt und z.B. den Wert der sozialen Anpassung und<br />
Gleichförmigkeit über den der individuellen Originalität<br />
und Kreativität stellt (und derartige Ziele über damit<br />
korrespondierende Erziehungspraktiken und<br />
<strong>Sozialisation</strong>skontrollen absichert), um so mehr wird<br />
das Individuum gesellschaftlichem Druck ausgesetzt<br />
werden und seine (tendenziell gleichfalls<br />
expandierenden) Selbstverwirklichungstendenzen<br />
einschränken müssen. Das heißt, der individuelle<br />
Gestaltungs- und Einflussbereich des Individuums wird<br />
entsprechend beschnitten. Im äußersten Fall kann dies<br />
zu pathologischen Grenzfällen zwischenmenschlicher<br />
Beziehungen verkümmern, wie dies in extremen<br />
lnteraktionssystemen wie Kasernen, Gefängnissen oder<br />
(psychiatrischen) Kliniken – so genannten „totalen<br />
Institutionen" (Goffman 1973 a) - vorkommen -mag,<br />
wenn die Insassen auf nur eine einzige und überdies<br />
noch sehr rigide definierte Rolle fixiert werden. Einen<br />
umgekehrten Fall stellt gewissermaßen die ausufernde<br />
Tendenz zur Ignorierung gesellschaftlicher Ansprüche<br />
und Notwendigkeiten dar, wie sie beispielsweise in<br />
extremer Form als soziale Extravaganz, übersteigerter<br />
Egozentrismus oder in gesellschaftsfeindlichen,<br />
„asozialen" Attitüden in Erscheinung treten kann. Von<br />
daher wird es verständlich, dass sich das pädagogische<br />
Problem der Vermittlung und Gewinnung von<br />
Ich-Identität mit zunehmender Modernität und<br />
wachsender Komplexität einer Gesellschaft verschärft.<br />
Infolge des Pluralismus von Werten und daraus<br />
resultierenden partiellen oder grundsätzlichen<br />
Widersprüchen in Bezug auf Ziele der Erziehung oder<br />
„I“ „me“ Tendenzen<br />
der<br />
Vergesellschaftung<br />
Personale Identität Soziale Identität<br />
Ich - Identität<br />
Inhalte der <strong>Sozialisation</strong> werden pädagogische<br />
Probleme in dem Ausmaße schwieriger, „wie die Zahl<br />
der Gruppen, in denen der einzelne lebt, größer und ihre<br />
Heterogenität intensiver wird" (Braun & Hahn 1973: 11<br />
1).<br />
Die im Anschluss an die Überlegungen von Mead<br />
vorgenommene Kritik und Erweiterung der<br />
herkömmlichen Rollentheorie geht über die begriffliche<br />
Darstellung der An- und Einpassungsprozesse des<br />
Menschen an und in ein soziales System vorgegebener<br />
Rollenstrukturen und -funktionen hinaus, indem auch<br />
die Prozesse menschlicher Individuation und<br />
Personalisation thematisiert werden. Gleichzeitig wird<br />
der Versuch unternommen, die sozialstrukturellen<br />
Bedingungen. aufzudecken und auszuleuchten, die einer<br />
sozial wirksamen Individualität bzw. Autonomie dm<br />
Person eher förderlich oder eher hinderlich sind.<br />
Illustrieren lässt sich dieses analytische Vorgehen an<br />
einem Versuch Hans Peter Dreitzels, soziale Rollen<br />
entsprechend zu klassifizieren. Auch Dreitzel geht<br />
hierbei zunächst von zwei Grenzfällen des sozialen<br />
Handelns aus: zum einen von rigide festgelegten Rollen,<br />
zum anderen vom Rollen mit einem relativ hohen<br />
Toleranz- und Gestaltungsspielraum. Im ersten Fall<br />
wird der Rollenträger dazu gezwungen, sich mit seiner<br />
Rolle zu identifizieren, im zweiten Fall wird es ihm<br />
aufgrund der verhältnismäßig vagen und „offenen"<br />
Rollenerwartungen ermöglicht, aktive Ich-Leistungen<br />
einzubringen und die Rolle individuell und schöpferisch<br />
zu gestalten. Die zunehmende Verfügbarkeit des<br />
Individuums über seine sozialen Rollen ergibt sich dann<br />
aus den beiden Koordinaten „abnehmende<br />
Identifikation" und „zunehmende Ich-Leistungen":<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 14
Abbildung 7:<br />
Determinanten der Verfügbarkeit über soziale Rollen<br />
Abnehmende<br />
Identifikation<br />
Quelle: Dreitzel 1972: 138<br />
„Die Verfügbarkeit der sozialen Rollen wächst mit dem<br />
Abstand vom Nullpunkt beider Koordinaten: je größer<br />
die geforderten Ich-Leistungen und je geringer die<br />
erforderliche Identifikation bei einer sozialen Rolle ist,<br />
desto leichter kann der Rollenspieler über seine Rolle<br />
verfügen, sich von ihr lösen oder auch sie abwandeln<br />
und ausgestalten" (Dreitzel 1972: 138).<br />
Dreitzel begründet dieses Modell mit dem Hinweis<br />
darauf, dass die Dimension „abnehmende<br />
Identifikation" eng mit der gesellschaftlichen Herkunft<br />
der Rollennormen zusammenhängt, während die<br />
Dimension „zunehmende Ich-Leistungen" in hohem<br />
Maße von der Art der sich mit einer Rolle verbindenden<br />
Verhaltenserwartungen abhängig ist. Das folgende<br />
Klassifikationsschema zeigt denn auch, wie sich der<br />
Wachsende Verfügbarkeit<br />
Zunehmende Ich-Leistungen<br />
Zwang des Rollenspielers zur Identifikation mit seiner<br />
Rolle graduell verändert. Während die weitgehend<br />
verinnerlichten „personenbezogenen" Rollen noch einen<br />
sehr hohen Identifikationsgrad voraussetzen, nimmt<br />
über die „organisationsbezogenen" bis hin zu den<br />
„situationsbezogenen" Rollen der Identifikationsdruck<br />
sukzessiv ab. Entsprechend wachsen die Möglichkeiten<br />
des Individuums zu interpretierenden Ich-Leistungen<br />
mit dem graduell abnehmenden Zwangscharakter der<br />
sozialen Normen. Die individuelle Verfügbarkeit über<br />
soziale Rollen und damit die subjektive<br />
Interpretationschance ist bei den <strong>Sozialisation</strong>srollen<br />
(Kind, Patient) am geringsten, bei den situativ<br />
gestaltbaren Kontaktrollen (Nachbar, Gastgeber) am<br />
umfassendsten.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 15
Abbildung 8:<br />
Klassifikationsschema für soziale Rollen (nach Dreitzel 1972: 140).<br />
Abnehmende Identifikation<br />
Interaktions-<br />
normen<br />
situations-<br />
bezogen<br />
Herrschafts-<br />
normen<br />
organisations-<br />
bezogen<br />
Kulturelle<br />
Normen<br />
personen-<br />
bezogen<br />
Herkunft<br />
der<br />
Normen<br />
Art<br />
der<br />
Normen<br />
Spiel- Rollen<br />
Verkehrs-<br />
Teilnehmer<br />
Fußball-<br />
Spieler<br />
Ausführungsrollen<br />
Soldat<br />
Strafgefangener<br />
Sozialisierungs-<br />
Rollen<br />
Kind<br />
Patient<br />
Vollzugsnormen<br />
Gehorsam<br />
gegenüber<br />
Regeln<br />
In ähnlicher Weise unterscheidet auch Habermas in<br />
seinen „Thesen zur Theorie der <strong>Sozialisation</strong>" soziale<br />
Rollen „nach dem Grad ihrer Repressivität, dem Grad<br />
ihrer Rigidität und der Art der von ihnen auferlegten<br />
Verhaltenskontrollen" (Habermas 1968: 10). Dadurch<br />
lassen sich unterschiedliche faktische oder potentielle<br />
Interpretationsmargen ausmachen, die das Gleichnis<br />
vom Menschen als Schauspieler und die<br />
Veranschaulichung des sozialen Handelns durch das<br />
Szenario des Theaters in entscheidenden Punkten<br />
ergänzen. Ist der Auftritt des Akteurs auf der<br />
Theaterbühne durch seinen Rollentext und die<br />
Regieanweisung weitgehend festgelegt und sind auch<br />
die Mitspieler entsprechend auf bestimmte Stichwörter<br />
fixiert und auf bestimmte, ihren Part auslösende<br />
Handlungen angewiesen, so erweist sich doch im<br />
sozialen Alltag der Rahmen der vorgegebenen Aktions-<br />
und Reaktionsweisen bei den meisten Rollen offen für<br />
mehrere Handlungsalternativen. Mit anderen Worten:<br />
Trotz aller Präskriptionen von Normen, trotz<br />
institutioneller Verfestigungen und trotz vielfältiger<br />
sozialer Kontrollen ist in den meisten Fällen die<br />
Bewältigungsrollen<br />
Prüfling<br />
Diskussions-<br />
Leiter<br />
Arbeitsrollen<br />
Postbeamter<br />
Arbeiter<br />
Vereins-<br />
vorsitzender<br />
Helfer – Rollen<br />
Eltern<br />
Doktorvater<br />
Seelsorger<br />
Qualitätsnormen<br />
Bewältigung<br />
von<br />
Aufgaben<br />
Kontaktrollen<br />
Nachbar<br />
Gastgeber<br />
Leistungsrollen<br />
Politiker<br />
Schauspieler<br />
Wissenschafter<br />
Beziehungsrollen<br />
Ehemann<br />
Liebhaber<br />
Charismatischer<br />
Führer<br />
Gestaltungsnormen<br />
Stil<br />
der<br />
Wertrealisierung<br />
Zunehmende Ich- Leistungen<br />
Darstellung der jeweiligen Rolle für den Rollenträger<br />
durchaus ein schöpferischer Akt, fordert. ihn in der<br />
konkreten Situation zur Konstruktion seines Verhaltens<br />
auf und zwingt ihn auch zur gelegentlichen<br />
Improvisation. Wie das Individuum hierbei die Rolle<br />
entwirft und den gegebenen bzw. wahrgenommenen<br />
Spielraum ausfüllt, hängt sehr stark davon ab, wie es<br />
das sich entfaltende Verhalten seiner Interaktionspartner<br />
berücksichtigt, abschätzt und „versteht", wie die am<br />
Rollenspiel Beteiligten ihre Situation erkennen und<br />
definieren und ihre wechselseitigen Erwartungen<br />
aufeinander abstimmen.<br />
Bezugspunkte der Situationsdefinition sind neben den<br />
subjektiv wahrgenommenen „äußeren" Bedingungen<br />
der Situation das Konzept des Selbst in der jeweiligen<br />
Situation und die (oft sehr unterschiedlichen)<br />
Vorstellungen, die die Handelnden mit der Rolle ihres<br />
Gegenübers verbinden (vgl. Mead 1973). Über ein in<br />
der Regel von außen nicht wahrnehmbares und<br />
beobachtbares und auch nur teilweise den Handelnden<br />
selbst immer ganz bewusstes wechselseitiges Sich-<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 16
Abtasten, Sich- Vergleichen, Sich- Ausprobieren<br />
vollzieht sich zwischen den Interaktionspartnern ständig<br />
ein „Handel um Identität" (McCall & Simmons 1974).<br />
Ziel und Zweck ist es, dabei herauszufinden, wie der<br />
andere mich wohl in meiner Rolle haben möchte, bzw.<br />
den anderen deutlich zu machen, wie ich meine Rolle in<br />
dieser Situation auffasse. Die Rollenpartner<br />
kommunizieren bei diesem permanenten Prozess des<br />
Aushandelns über Zeichensysteme und Symbole, deren<br />
Bedeutung sie gemeinsam haben, wobei das Verhalten<br />
eines jeden teilweise eine Reaktion auf das Verhalten<br />
des anderen ist. Je nach den Interaktionspartnern kann<br />
deshalb ein und die selbe Rolle im Alltag durchaus<br />
variieren und je nachdem mit mehr oder weniger stark<br />
abweichenden Handlungsfolgen verbunden wer-. den.<br />
(Vgl. hierzu beispielsweise die Anwendung der<br />
„pragmatischen Axiome" menschlicher Kommunikation<br />
von Watzlawick et al. 1974 auf die<br />
Lehrer-Schüler-Beziehung in Henecka 1978: 104 ff.).<br />
Die Rollenspieler bringen also in ihr soziales Handeln<br />
über ihre sinnhafte Deutung der Situation auch ihre<br />
persönlichen Gefühle und Bedürfnisse, ihre<br />
individuellen Erwartungen und Fähigkeiten, ihre eigene<br />
Lebensgeschichte und Lebenserfahrungen, ihre<br />
gegenwärtige soziale und materielle Lage usw. ein,<br />
-insgesamt alles Bedingungen, die sich wiederum<br />
gegenseitig beeinflussen. Damit wird anerkannt, dass<br />
die Prozesse der individuellen Rollenprägung auch von<br />
Naturmomenten mitbestimmt sind, die sich einer<br />
einseitigen soziologischen Reduzierung auf<br />
gesellschaftliche Normenmuster entziehen. Das, was in<br />
interaktionellen Prozessen geschieht, ist also niemals<br />
völlig und ausschließlich von sozialstrukturellen oder<br />
sozialkulturellen Kräften determiniert, wenn wir auch<br />
davon ausgehen können, dass derartige Wirkkräfte u. U.<br />
erheblich die Möglichkeiten von Denken und Handeln<br />
des Individuums einzuengen in der Lage sind.<br />
Andererseits haben aber sozial Handelnde immer auch<br />
„gewisse" Freiheitsspielräume, und zwar insoweit sie<br />
selbst ihre Lebenswelt sehen und interpretieren als auch<br />
innerhalb von Handlungsalternativen, die in bestimmten<br />
Situationen ergriffen werden können. Da zudem einem<br />
objektiv beobachtbaren Handeln sehr unterschiedliche<br />
subjektive Motive zugrunde liegen können, wird<br />
deutlich, dass ein Unterschied besteht zwischen der<br />
herkömmlichen Rekonstruktion des sozialen Handelns<br />
als Zusammenspiel von Rollenerwartung und<br />
Rollenentsprechung und den alltäglich erfahrbaren<br />
Handlungsabläufen.<br />
Es ist das Verdienst der erweiterten interaktionistischen<br />
Rollenperspektive, dass sie über die<br />
sozialpsychologische Analyse der differenzierten und<br />
zum Teil sehr subtilen sozialen Interaktions- und<br />
Kommunikationsvorgänge im Rahmen des sozialen<br />
Handelns die subjektiven Interpretationen der je<br />
institutionellen Bedingungen und Strukturen in den<br />
Vordergrund rückt. Alle sozialen Beziehungen und<br />
Systeme, in denen wir zusammen leben und arbeiten,<br />
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen wie Familie und<br />
Schule, Arbeitsorganisationen wie Betriebe und<br />
Verwaltungen, politische Parteien, Verbände, Kirchen<br />
und Freizeitgruppen, ja selbst das Militär (vgl. hierzu<br />
das Konzept der „Inneren Führung" bei der<br />
Bundeswehr) lassen sich deshalb daraufhin überprüfen,<br />
inwiefern sie ihren Mitgliedern dazu verhelfen bzw. sie<br />
daran hindern, das Dilemma zwischen der sozialen<br />
Identität (= Normen, denen das Individuum im<br />
Interaktionsprozess gegenübersteht) und der personalen<br />
Identität (= die dem Individuum zugeschriebene<br />
Einzigartigkeit) zu bewältigen.<br />
Um den Menschen in Gesellschaften, die sich als<br />
offene, freiheitliche und demokratische politische<br />
Ordnungssysteme verstehen, ein optimales Maß an<br />
individueller Verfügbarkeit über ihre sozialen Rollen zu<br />
gewährleisten, sind indessen nicht nur strukturelle und<br />
normative Voraussetzungen zu überprüfen, sondern<br />
auch von seiten der handelnden Individuen selbst sind<br />
bestimmte soziale Kompetenzen nachzuweisen. In<br />
diesem Zusammenhang postuliert Lothar Krappmann<br />
(1975) einige Grundqualifikationen, die dem<br />
handelnden Subjekt im Erziehungs- und<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess zu vermitteln sind und mittels<br />
derer es fähig werden soll, das labile Gleichgewicht der<br />
Ich- Identität auszubalancieren und die notwendige<br />
individuelle Präsentation des Selbst im Rollenhandeln<br />
des Alltags zu sichern. Diese sozialen Lernziele sind:<br />
o Rollendistanz<br />
Das Individuum kann sich über die Anforderungen<br />
seiner Rolle erheben, um bestimmte Erwartungen<br />
auswählen, negieren, modifizieren und interpretieren zu<br />
können.<br />
o Empathie<br />
Das Individuum besitzt kognitive und affektive<br />
Fähigkeiten zur Antizipation und Übernahme der<br />
Erwartungen des Interaktionspartners.<br />
o Ambiguitätstoleranz<br />
Das Individuum toleriert die Ambivalenzen von Rollen<br />
(Ambiguität = Doppeldeutigkeit, Widersprüchlichkeit)<br />
und findet sich mit deren Divergenzen,<br />
Inkompatibilitäten und unvollständiger<br />
Bedürfnisbefriedigung ab.<br />
o Identitätsdarstellung<br />
Das Individuum kann eigene Erwartungen und<br />
Bedürfnisse darstellen und damit sein Selbst<br />
artikulieren.<br />
Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />
Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Die<br />
gesellschaftliche Konstruktion der<br />
Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie.<br />
(Darin Kapitel III: „Gesellschaft als subjektive<br />
Wirklichkeit", S. 139 - 198). Fischer: Frankfurt/Main<br />
1974.<br />
Erving Goffmann, Interaktion: Spaß am Spiel -<br />
Rollendistanz, S. 93 - 130. Piper: München 1973.<br />
Lothar Krappmann, Soziologische Dimensionen der<br />
Identität. Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme<br />
an lnteraktionsprozessen. 4. Aufl. (Darin insbesondere<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 17
das Kapitel „Identität und Rolle", S. 97 - 131 ). Klett:<br />
Stuttgart 1975.<br />
Alfred R. Lindesmith & Anselm L. Strauss, Symbolische<br />
Bedingungen der <strong>Sozialisation</strong>. Teil 1. (Darin<br />
insbesondere das Kapitel „Der symbolische<br />
Interaktionismus", S. 27 - 41 ). Schwann: Düsseldorf<br />
1974.<br />
George McCall & J.L. Simmons, Identität und<br />
Interaktion. Untersuchungen über zwischenmenschliche<br />
Beziehungen im Alltagsleben. (Darin Kapitel 9:<br />
„Logistik der Identität", S. 238 - 263 ). Schwann:<br />
Düsseldorf 1974.<br />
(Der oben vorgenommene Exkurs ist dem Buch von<br />
H.P. Henecka: (1985):.Grundkurs, Soziologie, UTB,<br />
Opladen, S 55 ff. entnommen.)<br />
Besonders die ersten Phasen im lebenslangen <strong>Sozialisation</strong>sprozess stehen im Mittelpunkt des<br />
Interesses.<br />
In besonderer Weise soll auf den frühkindlichen <strong>Sozialisation</strong>sprozess in der Familie bzw. in den<br />
ersten Lebensjahren des Kindes hingewiesen werden. Dabei ist T. Parsons Darstellung von fünf<br />
Phasen aufschlussreich (in L. Helbig: Politik, <strong>Sozialisation</strong>, Frankfurt/M., 1979, S. 42f ):<br />
3.4. Der <strong>Sozialisation</strong>sprozess – Phasen nach T. Parsons<br />
<strong>Sozialisation</strong> ist also nach Parsons Rollenlernen. Rollen werden (lern Individuum von anderen<br />
zugeschrieben und aufgrund subtiler Sanktionen während des <strong>Sozialisation</strong>sprozesses gelernt. Das<br />
heißt: <strong>Sozialisation</strong> ist an Interaktionen gebunden. Die Mutter agiert in einer bestimmten Weise<br />
gegenüber dem Kind. Dieses ihr Agieren ist gegenüber einem männlichen Kind anders als gegenüber<br />
einem weiblichen Kind. Die Mutter erwartet auf ihr Agieren hin bestimmte Reaktionen (z. B.<br />
"männliche" vom Knaben, „weibliche" vom Mädchen). Kommen die falschen Reaktionen, so werden<br />
diese bestraft, kämmen die richtigen, so werden sie belohnt. Eines Tages hat das Kind die<br />
„richtigen", d.h. die von der Mutter erwarteten Reaktionen, „gelernt" und kann sie autonom<br />
einsetzen, d.h., nunmehr seinerseits von dieser Rolle aus agieren und damit in anderen die<br />
entsprechenden Reaktionen auslösen. Das Rollen-Ich (Rollenselbst) ist dann zugleich Reaktion auf<br />
die Aktion des Rollenpartners als auch Aktion, indem es immer wieder die gleichen Reaktionen auch<br />
des anderen gegenüber (lein Rollenselbst auslöst.<br />
Im Rahmen der allgemeinen Handlungstheorie voll Parsons Ist <strong>Sozialisation</strong> jener Lernprozess, der<br />
der „Übernahme der notwendigen Orientierungen zum befriedigenden Handeln in einer Rolle" dient<br />
(Parsons 1951, S.205). <strong>Sozialisation</strong> ist Rollenerwerb, ist Internalisierung der als Rollenerwartungen<br />
institutionalisierten Normen und Werte einer gegebenen Kultur. Durch <strong>Sozialisation</strong>sprozesse<br />
werden Individuen in das soziale System integriert, also in Rollensystemen handlungsfilzig aufgrund<br />
der Internalisierung der Wertorientierungen des kulturellen Systems.<br />
<strong>Sozialisation</strong>:<br />
Kulturelles System<br />
Werte / Normen<br />
<strong>Sozialisation</strong><br />
Individuum soziales System (Rollensystem)<br />
= Integration<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 18
Die menschliche Natur, fassbar in ihren Triebimpulsen, wird durch <strong>Sozialisation</strong>sprozesse so<br />
bearbeitet, dass die individuellen Bedürfnisdispositionen im optimalen Fall mit den<br />
gesellschaftlichen, in Rollennormen institutionalisierten Wertvorstellungen zur Deckung kommen.<br />
Dies erst macht zwischenmenschliches Handeln rational, d.h. kalkulierbar.<br />
In Anlehnung an Freud unterscheidet Parsons fünf Phasen der <strong>Sozialisation</strong>. In jeder Phase<br />
internalisiert das Individuum ein bestimmtes, immer komplexer werdendes Verhältnis zur Umwelt,<br />
oder es lernt in jeder Phase, sich in einer spezifischen, immer differenzierter werdenden Weise zur<br />
Umwelt zu verhalten. Voraussetzung für den erfolgreichen <strong>Sozialisation</strong>sprozess sind voll<br />
sozialisierte <strong>Sozialisation</strong>sagenten, zumindest für die ersten drei Phasen. Was das Individuum jeweils<br />
internalisiert, nennt Parsons Objektsysteme: Das Mutter-Kind-Objektsystem und das Vater-<br />
Mutter-Kind-Objektsystem sind dabei die grundlegenden Orientierungsmuster, auf denen die<br />
folgenden aufbauen. Der Internalisierungsprozess ist ebenfalls analog zu Freud zu sehen: Der<br />
<strong>Sozialisation</strong>sagent löst Lernprozesse aus. indem er erwünschtes Verhalten belohnt, bis eine gewisse<br />
Verhaltenssicherheit erreicht ist. Dann wird nicht mehr belohnt, und es setzt eine Phase der<br />
Frustration ein, die dazu führt, sich neuen Bindungen zuzuwenden. Anders ausgedrückt: Bestimmte<br />
Objektsysteme sind so Inge positiv besetzt, bis sie verinnerlicht sind. Dann erfolgt die Frustration.<br />
was zum Abzug der positiven Besetzungen führt, und es werden neue, komplexere Objektsysteme<br />
positiv besetzt. Dies soll an den fünf Phasen der <strong>Sozialisation</strong> nach Parsons verdeutlicht werden.<br />
Die erste Phase<br />
In den ersten Lebenstagen internalisiert das Kind die Mutter. Das Kind ist noch nicht in der Lage, die<br />
Quelle seiner Bedürfnisbefriedigung, die Mutter, als von sich geschieden zu betrachten. Daher nennt<br />
Parsons die erste Phase auch die der Mutter-Kind-Identität. Da es die Mutter von sich nicht<br />
differenzieren kann, ist es auch noch nicht fähig, eine Interaktionsbeziehung zu ihr aufzunehmen. Es<br />
ist in seiner Bedürfnisbefriedigung total von ihr abhängig. Es lernt in dieser Phase das Objektsystem<br />
Abhängigkeit.<br />
Die zweite Phase<br />
Allmählich lernt (las Kind. die verschiedenen Akte seiner Bedürfnisbefriedigung zu verallgemeinern<br />
und mit der Mutter als von ihm getrennten Objekt zu verbinden. Mit dieser Ausdifferenzierung der<br />
Mutter aus dem Selbst wird es zum Interaktionspartner. zum Rollenspieler: Es orientiert seine<br />
Erwartungen am Verhalten der Mutter, wie auch diese sich am Kind orientiert. In dieser Phase der<br />
Mutter- Kind - Dyade (Zweiheit) verstärkt sich einerseits das Objektsystem Abhängigkeit, zum<br />
anderen aber internalisiert das Kind das Objektsystem Autonomie. Es hat nunmehr zwei<br />
Objektsysteme verinnerlicht.<br />
Die dritte Phase<br />
Man könnte diese Phase auch als die Vater- Mutter- Kind- Triade bezeichnen. Es tritt also nunmehr<br />
die Familie als Struktur ins Bewusstsein des Kindes und lässt es die grundlegende Rollenverteilung<br />
in der Kernfamilie erkennen: Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Dabei wird die Rolle des Vaters als die<br />
instrumentelle Rolle erkannt: Aufgrund seiner Rolle reguliert er das Verhältnis der Familie zur<br />
Umwelt (Berufsrolle, Lebenssicherung der Familie). Die Rolle der Mutter wird als expressive<br />
erkannt: Sie bewältigt die innerhalb des Familiensystems auftretenden Spannungen und hat eine die<br />
Familie integrierende Funktion. Durch Identifikation mit dem Vater findet der Sohn seine<br />
instrumentell geprägte Geschlechtsrolle und analog die Tochter ihre expressive Rolle durch<br />
Identifikation mit der Mutter. Am Ende der dritten Phase hat damit das Kind die beiden Basisrollen<br />
gelernt: die Generationsrolle, die auf den Objektsystemen Abhängigkeit (der Kinder) und Autonomie<br />
(der Eltern) beruht. sowie die Geschlechtsrolle, die beim Knaben auf dem Objektsystem<br />
Instrumentalität, beim Mädchen auf dem Objektsystem Expressivität beruht. Da auch der Knabe das<br />
Objektsystem Expressivität als das .,andere" lernt, d.h. sich in Aktion und Reaktion gegenüber<br />
Mutter oder Schwester auf dieses einzustellen hat, wie umgekehrt das Mädchen auf diese Weise<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 19
Instrumentalität lernt, haben die Kinder also am Ende dieser Phase vier Objektsysteme - Kategorien<br />
zum erfolgreichen Rollenhandeln -gelernt.<br />
Die vierte Phase<br />
In dieser Phase verstärkt das Kind seine Interaktionen mit Gleichaltrigen (peers). Diese Peer-group--<br />
Orientierung lässt das Kind über die eigene Familie hinausschauen. (Es erkennt, dass bestimmte<br />
Verhältnisse, die es in seiner Familie antrifft, überall gellen, also universell sind, andere nur in der<br />
eigenen Familie gelten. also partikular sind. Damit erwirbt es die Kategorien Universalität und<br />
Partikularität. was gleichbedeutend ist mit der Befähigung, in allgemeinen Kategorien zu denken. So<br />
wird ihm z.B. bewusst, dass der eigene Vater nicht der Vater schlechthin ist, sondern zu der<br />
allgemeinen Kategorie Vater gehört.<br />
Diese beiden neuen Objektsysteme treten nun nicht einfach zu den vier bereits gelernten hinzu,<br />
sondern sie ermöglichen es dem Kinde, die Objektsysteme Abhängigkeit, Autonomie,<br />
Instrumentalität und Expressivität daraufhin zu befragen. ob sie in einer bestimmten ihnen<br />
begegnenden Rolle oder Rollenausführung partikular oder universell sind. Die Kinder werden also z.<br />
B. erkennen, dass ihre eigene Generationsrolle in bestimmter Weise von Abhängigkeit universell<br />
geprägt ist, dass es aber bei verschiedenen Kindern verschiedene Grade der Abhängigkeit gibt usw.<br />
Die Objektsysteme Universalität und Partikularität differenzieren also die bisher gelernten<br />
Objektsysteme und damit die Fähigkeiten des Rollenhandelns.<br />
Die fünfte Phase<br />
Die letzte Phase der <strong>Sozialisation</strong> ist dann erreicht, wenn das Individuum in die Berufsausbildung<br />
oder in den Beruf eintritt. Es lernt jetzt zu differenzieren zwischen Rollen, die ihm zugeschrieben<br />
werden (z.B. Geschlechtsrolle, Geschlechtsrolle), und Rollen, die es erworben hat (wie z.B. die<br />
Berufsrolle). Parsons nennt die damit erworbenen Objektsysteme "quality" und "performance".<br />
Bisher hatte das Individuum mit der Generations- und der Geschlechtsrolle Rollen gelernt, die ihm<br />
zugeschrieben, gewissermaßen oktroyiert worden sind ("qualitiy"); mit dem Erwerb der Berufsrolle<br />
erkennt es, dass es auch Rollen gibt, für die man sich aktiv selbst entscheidet ("performance"), in der<br />
man dann allerdings, hat man sie einmal erworben, sich verhalten maß wie in den anderen, nämlich<br />
gemäß den Erwartungen.<br />
Damit ist ein weiteres Orientierungsmuster für das Rollenhandeln erworben: Alle bisherigen<br />
Orientierungsmuster (Objektsysteme) können nun darauf befragt werden. ob in ihnen "quality" oder<br />
"performance", Zugeschriebenes oder Erworbenes, dominiert. Damit hat das Individuum 16<br />
Objektsystem erworben, und Parsons geht davon aus, dass es damit alle jenen Orientierungsmuster<br />
übernommen hat, die zum Rollenhandeln in allen Situationen befähigen. Gleichzeitig sind damit die<br />
Wertvorstellungen des kulturellen Systems übernommen, also die als Erwartungen auftretenden<br />
Rollennormen voll internalisiert. Was das Individuum nunmehr ,.will", entspricht den Rollennormen:<br />
Seine Bedürfnisdispositionen entsprechen voll den normativen Erwartungen - Personalsystem und<br />
Sozialsystem greifen störungsfrei ineinander.<br />
T. Parsons: Sozialstruktur und Persönlichkeit. Frankfurt a. M. 1968<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 20
Klassen und soziale Schichten in westlichen<br />
Industriegesellschaften – neue Entwicklungstendenzen<br />
(vgl. H. Strasser):<br />
H. Strasser kommt durch die- Analyse der letzten Jahrzehnte in den Industriegesellschaften zum<br />
Schluss, dass es eine Verhärtung der Klassenstruktur gibt. Die Ungleichheit wird rigider und<br />
deutlicher. Gegen die Individualisierungsthese von Beck führt er an: 4 Entwicklungstendenzen in<br />
westlichen Industriegesellschaften:<br />
1) Merkliche Einkommensverbesserung: durch Wirtschaftwachstum seit dem 2. Weltkrieg<br />
Tertiarisierung: Dienstleistungsgesellschaft<br />
Vermehrung der Bildungsmöglichkeiten öffentlicher und privater Sektor nehmen zu<br />
2) Bürokratisierung notwendige Vorraussetzung: komplexe Organisationen<br />
Delegationsprinzip: braucht Machtbefugnisse Qualifikationsprofil: Bildungshöhe<br />
3) Professionalisierung: „wir werden überall belehrt, bedient, beraten, betreut, ..."<br />
4) Größenwachstum der öffentlichen und privaten Betriebe<br />
Besitz, Macht, Organisationsstrukturen, Qualifikationsressourcen, etc. führen „zu einer Streckung<br />
der Ungleichheit und zu einer stärkeren sozialen Schließung".<br />
Soziale Mobilität herrscht innerhalb einer sozialen Klasse, aber nicht zwischen den Klassen.<br />
Bildung macht Klassenschranken deutlicher; es kommt zum Einsatz des ,.ökonomischen Kapitals"<br />
(vgl. Bordleu), daher zur Festigung der Klassenstruktur.<br />
Politische Konsequenzen: Einkommensverhältnisse<br />
relativer Reichtum<br />
Sockel` an ökonomischen und sozialen Absicherungen<br />
d.h.: die Industriegesellschaften sind reich genug, um sich soziale Ungleichheit - ja sogar noch mehr<br />
-leisten zu können.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 21
Schichtspezifische <strong>Sozialisation</strong> /<br />
milieuspezifische <strong>Sozialisation</strong><br />
Idealtypische Gegenüberstellung (Hartfiel /Holm: Erziehung in der modernen<br />
Industriegesellschaft)<br />
Grad der Dispositionsfreiheit<br />
Grad der Überwachung<br />
Kommunikationsstruktur<br />
Arbeiterfamilien Familien von<br />
Beamten/Angelten<br />
Arbeitsplatz / gesellschaftliche Arbeitsplatz / gesellschaftliche<br />
Stellung<br />
Stellung<br />
geringer Grad an<br />
Dispositionsfreiheit<br />
unteres Ende der betrieblichen<br />
Hierarchie<br />
eingeschränkt da für Arbeitsprozess<br />
nur minimal erforderlich<br />
Tätigkeitsmerkmale Umgang mit Sachen weitere<br />
Merkmale: hohe Unfallgefahr<br />
Untergebene, Vorgesetzte<br />
Möglichkeit der Delegation schafft<br />
Bewusstsein von<br />
Selbständigkeit/Verantwortung<br />
Kommunikation ist Teil der Arbeit,<br />
hauptsachlicher Umgang mit<br />
Symbolen und Menschen<br />
große berufliche Sicherheit<br />
ansteigendes Gehalt<br />
Pensionsanspruch<br />
Lärm., Schmutz, Akkord,<br />
Schichtarbeit<br />
Fließband, berufliche Unsicherheit<br />
Familiäre Lebensbedingungen Familiäre Lebensbedingungen<br />
Starke Rollentrennung<br />
In der Familie<br />
Kommunikation und<br />
Interaktion: Verwandt<br />
Schaft, Nachbarschaft<br />
Starke Trennung:<br />
Fremdgruppe / Eigengruppe<br />
Geschlechtertrennung<br />
(Kinderzahl / Wohnung)<br />
Bewusstseinsstruktur,<br />
Wertesystem, Erziehung<br />
Gesellschaftsbild dichotom (Machtmodell)<br />
Kollektivbewusstsein<br />
Allgem. Wertsystem eher fatalistisch Orientierung<br />
Stärkere Bedeutung der Gegenwart<br />
Politische Apathie<br />
Geschlechtsrollenstereotypes<br />
Wertsystem (Männlichkeit, Kraft,<br />
Dominanz) Autoritarismus<br />
Traditionalismus Stabilität und<br />
Sicherheit, Anti-Intellektualismus<br />
(Schema gekürzt)<br />
eher partnerschaftliches Verhältnis<br />
Feld von Freunden und Bekannten<br />
(meist Berufskollegen/innen)<br />
Einbezug mehrerer Positionen der<br />
Hierarchie<br />
Auflösung rigider Geschlechtsrollen<br />
- Definition<br />
Bewusstseinsstruktur,<br />
Wertesystem, Erziehung<br />
hierarchisches Modell<br />
(Prestige-Modell) Individuelles<br />
Leistungsbewusstsein aktivistisch<br />
-individualistische<br />
Wertorientierung<br />
karrierebewusstes, mobilitäts-<br />
orientiertes Wertsystem<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 22
Soziale Schicht<br />
Übliche Schichtkriterien<br />
Schichtunterschiede<br />
schaffen unter-<br />
schiedliche Umwelten<br />
und unterschiedliche<br />
<strong>Sozialisation</strong>sbe-<br />
dingungen<br />
Begriff:<br />
„Handlungskompetenz“<br />
Dieser Sachverhalt wird in der Soziologie unter dem Stichwort<br />
„schichtspezifische <strong>Sozialisation</strong>" untersucht und diskutiert.<br />
Der Begriff der sozialen Schicht ist in den Sozialwissenschaften zwar weit<br />
verbreitet, aber es gibt kein einheitliches Verständnis darüber, welche<br />
Merkmale Schiräten kennzeichnen und voneinander unterscheiden. Je nach<br />
dem Untersuchungsinteresse des Forschers kann er andere Kriterien<br />
verwenden für die Betrachtung von Unterschieden in der Gesellschaft. In<br />
jedem Fall wird mit der Konstruktion sozialer Schichten immer ein Maßstab<br />
gesucht für die Analyse und Bewertung sozialer Ungleichheiten in einer<br />
Gesellschaft.<br />
In den Forschungen zur schichtspezifischen <strong>Sozialisation</strong> hat man sich im<br />
wesentlichen auf die Unterscheidung von Unter- und Mittelschicht<br />
konzentriert und zur deskriptiven Kennzeichnung von Unterschieden<br />
Kombinationen aus sozialstatistischen (Einkommen, Ausbildung, Beruf etc.)<br />
und kulturellen (Werthaltungen, Lebensstil, Einstellungen usw.) Kriterien<br />
verwendet. In der Realität sind die Übergänge zwischen Unter- und<br />
Mittelschicht fließend, die „Grenzziehung" des Sozialwissenschaftlers ist<br />
insofern künstlich. Die Unterscheidung als solche ist dagegen empirisch sehr<br />
wohl brauchbar, weil immer wieder Beziehungen zwischen<br />
Schichtzugehörigkeit und konkretem Verhalten festgestellt wurden.<br />
Die materiellen und kulturellen Unterschiede zwischen Schichten schaffen<br />
nun im Grundsatz unterschiedlich strukturierte Umwelten. Das heißt, Kinder<br />
und Jugendliche, die in Unter- oder Mittelschicht aufwachsen, haben<br />
unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten und werden unter jeweils anderen<br />
Bedingungen, "vergesellschaftetet".<br />
Die unterschiedlichen <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen beeinflussen auch<br />
entscheidend die Chancen, aneignungsrelevantes ,Wissen" zu erwerben. Den<br />
Zusammenhängen zwischen Schicht und verschiedenen Aspekten des<br />
„Wissens" gehen wir im folgenden nach.<br />
10.2. Schicht und Handlungskompetenz<br />
Der Begriff der Handlungskompetenz wurde von Ralf Bohnsack entwickelt und<br />
meint die Fähigkeit, auf der Grundlage der Beherrschung der Basisregeln, d.h.<br />
der Grundstruktur von Interaktion (Rollenübernahme ist beispielsweise ein<br />
Element der Grundstruktur, s.o.) situative soziale Erfahrungen zu<br />
abstrahieren und zu generalisieren. Man könnte auch sagen, es geht um die<br />
Fähigkeit, strukturelle Ähnlichkeiten unterschiedlichster sozialer Situationen zu<br />
erkennen und aufgrund dieser Erkenntnis Definitionen und Verhaltensweisen in<br />
einer "angemessenen", „richtigen" Weise miteinander zu verknüpfen und<br />
gewissermaßen zu "transferieren".<br />
Wir sind dieser speziellen Fähigkeit, die mit dem Begriff der<br />
Handlungskompetenz ausgedrückt wird, in Ansätzen bei der Darstellung der<br />
Bedeutung des "generalisierten Anderen" im <strong>Sozialisation</strong>sprozess begegnet.<br />
Der generalisierte Andere ließe sich durchaus als sozialisatorische Instanz für<br />
die Entwicklung von Handlungskompetenz bezeichnen. Zur Verdeutlichung<br />
d B i h i l äh t d d li i t A d d<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 23
Beispiel<br />
„Sanktionsverhalten“<br />
Mangelnde<br />
Handlungskompetenz<br />
Illustration mangelnder<br />
Handlungskompetenz<br />
des Bezugs sei noch einmal erwähnt, dass der generalisierte: Andere das<br />
unmittelbare Produkt des <strong>Sozialisation</strong>sprozesses, gewissermaßen die<br />
„Sammelstelle der Vergesellschaftungserfahrungen" ist und zudem der „Ort",<br />
an dem diese Erfahrungen zugeordnet, abstrahiert und verknüpft werden. Der<br />
generalisierte Andere ist für das Individuum der „Partner" eines inneren<br />
„Dialogs", der als „Kenner der Gesellschaft" hilft, Situationen, Handlungen<br />
und Handlungspläne vom Standpunkt der Welt außerhalb des Ichs zu<br />
beurteilen und zu bewerten.<br />
Lassen Sie sich bitte durch der Gebrauch der Metaphern nicht täuschen: In<br />
,Wirklichkeit" ist der generalisier Andere natürlich nur die Bezeichnung für eine<br />
bestimmte Art von Denkprozessen.<br />
Theoretisch einleuchtend und empirisch nachweisbar ist nun, dass die<br />
Generalisierungsfähigkeit unter den Gesellschaftsmitgliedern sehr<br />
unterschiedlich ausgeprägt ist. Wie weit diese Fähigkeit entwickelt ist, hängt<br />
wesentlich ab von der Struktur der angesammelten sozialen Erfahrungen,<br />
kaum dagegen von deren Inhalt.<br />
Als Beispiel für den Unterschied von Struktur und Inhalt kann das Sanktionsverhalten der<br />
Eltern gegenüber Kindern genannt werden. Die Struktur der Sanktionserfahrung beträfe die<br />
Ar und Weise und die Konsequenz bzw. Dauerhaftigkeit der Sanktionen, der Inhalt wären<br />
beliebige Situationen des Alltagslebens, die in der Verhaltensstruktur der Eltern<br />
„sanktionsreif' sind. Es ist offen kundig, dass die Struktur der angesammelten sozialen<br />
Erfahrungen eines Kindes anders ist, wenn die Eltern z.B. nicht nur auf Fehlverhalten<br />
negativ, sondern auch auf „richtiges" Verhalten positiv reagieren. Das Kind verarbeitet die<br />
Reaktionen der Eltern anders, wenn Sanktionen begründet und einsehbar gemacht werden<br />
oder wenn das Sanktionsverhalten i= der Grundstruktur gleich bleibt und damit für das<br />
Kind , ,berechenbar" wird, als wenn es fast nur Strafen, aber kaum Belohnungen gibt und<br />
das Sanktionsverhalten starken Schwankungen unterliegt.<br />
Die unterschiedlich ausgeprägte Generalisierungsfähigkeit ist nicht nur von<br />
theoretischer Relevanz, sondern ha: Bedeutung für das konkrete Handeln<br />
von Individuen. Mangelnde Handlungskompetenz bezeichnet<br />
dementsprechend strukturelle Schwächen im Handlungspotential eines<br />
Individuums. Das bedeutet konkret, dass ein Individuum nur unzureichend in<br />
der Lage ist, Situationen anlassgemäß zu definieren, und als Folge davon<br />
häufig „falsche", „unvernünftige" Handlungsentscheidungen trifft<br />
Konsequenzen von Handlungen werden falsch eingeschätzt,<br />
Handlungsalternativen und strukturelle Ähnlichkeiten zu bereits früher<br />
erlebten Situationen werden nicht erkannt. Umgekehrt werden die<br />
Erfahrungen einer Situation zu schnell verallgemeinert oder Einzelmerkmale<br />
(Halo-Effekt) überbewertet.<br />
Auf der Ebene interpersonaler Interaktionen drückt sich mangelnde<br />
Handlungskompetenz in besonderen Schwierigkeiten der Rollenübernahme<br />
aus, d. h. Erwartungen und Absichten des Interaktionspartners werden nicht<br />
angemessen anerkannt und folglich auch nicht in das eigene Handeln<br />
einbezogen. Der Akteur mit mangelnder Handlungskompetenz „klebt"<br />
gewissermaßen an einer sozialen Situation, er „verliert" sich in ihr, weil er<br />
die Erscheinungen einer Situation für die einzige, die „ganze" Realität hält<br />
und die Bedingtheit durch andere, abstraktere Wirklichkeitsebenen nicht<br />
erkennt.<br />
Nehmen Sie als einfaches Beispiel. einen Jugendlichen, der die Freundlichkeit und<br />
Herzlichkeit eines Buchklubwerbers in der Fußgängerzone nicht als professionelle,<br />
zielorientierte Handlungsstrategien erkennt, die ihre Quellen außerhalb der konkreten<br />
Situation hat, Sonde - der in der Situation „aufgeht" und die Freundlichkeit des Werbers<br />
ganz situationsbezogenen als spontanes Interesse an seiner Person interpretiert und sich<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 24
Mangelnde<br />
Handlungskompetenz und<br />
Unterschicht<br />
dieser Interpretation entsprechend verhält (und z.B. einen Vertrag unterschreibt).<br />
Mangelnde Handlungskompetenz ist nun zum einen ein besonderes Problem<br />
der Lebensphasen ;,Kindheit"_ und „Jugend", zum anderen aber auch ein<br />
Problem der <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen bzw. Erfahrungsmöglichkeiten.<br />
Dass Kinder und Jugendliche über mangelhafte Kompetenzen verfügen, ist<br />
nach den vorangegangenen Erläuterungen nicht weiter verwunderlich. Der<br />
Erwerb von Wissen und Kompetenzen mit dem Ziel der Aneignung von<br />
Umwelt und der Identitätsbildung (Ich-Identität) ist ja gerade Gegenstand<br />
des <strong>Sozialisation</strong>sprozesses. Aber Handlungskompetenz ist nur zum Teil<br />
eine quantitative Frage, d.h. eine Frage der Erfahrungsmenge, die mit<br />
zunehmendem Lebensalter gewissermaßen ,-natürlich" angesammelt wird<br />
und wächst. Zum anderen Teil ist Handlungskompetenz eben auch ein<br />
qualitatives Problem, d.h. davon abhängig, auf welche Weise soziale<br />
Erfahrungen erworben werden und wie diese Erfahrungen strukturiert sind.<br />
Insofern betreffen Kompetenzunterschiede nicht nur Kinder und<br />
Jugendliche, sondern auch Erwachsene.<br />
Bei Erwachsenen machen sich Kompetenzmängel allerdings in erster<br />
Linie nur bemerkbar in Situationen, die außerhalb der eingespielten und<br />
erarbeiteten Alltagsroutine lugen. Man könnte auch sagen: Je kleiner und<br />
geschlossener die Alltagswelt und je enger die Sinnhorizonte gesteckt sind,<br />
um so begrenzter ist auch die Handlungskompetenz.<br />
Kinder und Jugendliche, die aus Familien kommen, die aufgrund<br />
sozialstatistischer und kultureller Faktoren der Unterschicht zuzuordnen<br />
sind, haben nun besondere Schwierigkeiten in der Entwicklung von<br />
Handlungskompetenz (und damit in der Entwicklung von Fähigkeiten, die<br />
notwendig sind für die Aneignung von Umwelt). Zum einen sind sie wie<br />
alle Jugendlichen von der in der Gesellschaftsstruktur angelegten Tatsache<br />
betroffen, dass „Jugend" eine Übergangsphase mit besonderen<br />
sozialisatorischen Anforderungen ist. Die Entwicklung von<br />
Handlungskompetenz wird für sie jedoch dadurch weiter erschwert, dass<br />
wesentliche Teile der Handlungsmuster und -Strategien, die in der<br />
familialen <strong>Sozialisation</strong> gelernt und internalisiert werden, der Aneignung<br />
von Umwelt relativ enge Grenzen setzen.<br />
Wir werden uns mit den Erziehungsstilen und besonders mit den Sprachstilen in<br />
Unter- und Mittelschicht weiter unten noch näher befassen, wollen aber schon hier<br />
Bedingungen für eine geringere Entwicklung von Handlungskompetenz in der<br />
Unterschiss etwas konkreter andeuten. Ein wesentliches Element sind<br />
unterschiedliche Sprachstile in Unter- und Mittelschicht (die Unterschiede werden<br />
ebenfalls weiter unten noch erläutert). Unterschichtspezifische Sprachformen sind<br />
weniger komplex und differenziert. Wenn Sie sich an den oben ausführlich<br />
dargestellten Zusammenhang von Sprache, Denken, Ordnung von Erfahrung und<br />
Aneignung vor-- Umwelt erinnern, wird Ihnen klar, dass geringere Komplexität und<br />
Differenziertheit von Sprache über das Denken auch das Vermögen des Kindes<br />
begrenzen, „Welt" zu begreifen und Umwelt anzueignen.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 Das Kind wird sowohl durch Elemente der Sprachstruktur an eine jeweilige Situation<br />
gebunden, indem situationsübergreifende, allgemeinere Prinzipien der Geltung und<br />
Begründung von Regeln nicht mehr vermittelt werden, als auch durch besondere<br />
Inkonsistenz im Erziehungsverhalten der Eltern, die auf gleiche Handlungen des Kindes für<br />
dieses völlig uneinsichtig unterschiedlich reagieren -mal bestrafen, mal straflos zur Kenntnis<br />
nehmen, mal ignorieren. Die grundlegende Erfahr des Kindes im Rahmen derartiger<br />
<strong>Sozialisation</strong>sbedingungen ist die der "Auslieferung" an jeweils aktuelle soziale Situationen<br />
mit nur bedingter Vorhersehbarkeit der Erwartungen und Reaktionen des<br />
Interaktionspartners. Die Notwendigkeit zur Entwicklung eines situativen Opportunismus<br />
begrenzt die Autonomie des Kindes und das Maß, in dem es andere, abstraktere Ebenen<br />
sozialer (gesellschaftliche') Realität in sozialen Situationen zu erkennen und sich handelnd<br />
25
Mangelnde<br />
Handlungskompetenz und<br />
„kumulative<br />
Benachteiligung“<br />
Beispiele der<br />
Benachteiligung und<br />
Negativselektion<br />
an ihnen zu orientieren vermag. Ein Planungsverhalten, das auf längere Zeiträume zielt,<br />
kann nicht ausgebildet werden.<br />
Dass die Handlungskompetenz vieler Unterschichtjugendlicher besonders<br />
mangelhaft entwickelt ist, träg wesentlich dazu bei, dass sie durch<br />
gesellschaftliche Auswahl- und Zuweisungsprozesse (Selektion und<br />
Allokation) auf Positionen und in Rollen geraten, die nicht mit grundlegend<br />
anderen Erfahrungsmöglichkeiten verbunden sind. Es entsteht ein negativer<br />
Kreislauf, durch den individuelle Entwicklungsrückstände gesellschaftlich<br />
verstärkt und verfestigt werden. Da die Benachteiligung in einem Bereich<br />
(z.B. Familie) dazu führt, dass das Kind auch in anderen Bereichen (z.B.<br />
Schule) Benachteiligungen erfährt, die ihrerseits wieder zusätzliche<br />
Benachteiligungen verursachen (z.B. im Beschäftigungssystem), kann man<br />
hier auch von einem Prozess „kumulativer Benachteiligung" sprechen (vgl.<br />
Kloas/Stenger 1980).<br />
Sie können sich als Bespiel vielleicht vorstellen, dass Kinder mit derartigem Hintergrund<br />
aufgrund anfälligen (i.S.v. "unüblichen") Verhaltens in Grundschulklassen häufig zu<br />
,Störenfrieden" werden, die als pädagogisch „hoffnungslose Fälle" trotz "normaler"<br />
Intelligenz schneller als andere zur Sonderschule geschickt werden- Für den Lehrer<br />
verstärkt sich der Eindruck von „Hoffnungslosigkeit" nicht selten durch eine relative<br />
Gleichgültigkeit der Eltern gegenüber der Schulsituation des Kindes, so dass relativ bald<br />
auch in der Schule die Weichen für einen verminderten Erwerb sozialisationsnotwendigen<br />
Wissens in jeder Form gestellt sind. Damit ist auch bereits sehr früh der Zugang zu<br />
Positionen des Beschäftigungssystems versperrt, die durchschnittliche oder<br />
überdurchschnittliche schulische Qualifikation oder gar besondere kognitive und soziale<br />
Kompetenzen verlangen und dafür besondere Gratifikationen in Form von Entlohnung,<br />
Prestige und Entfaltungsmöglichkeiten bieten.<br />
Ein anderes Beispiel der Verknüpfung von mangelnder Handlungskompetenz und<br />
gesellschaftlicher Negativselektion findet sich im Bereich „Jugendkriminalität".<br />
Kriminologische Untersuchungen haben einerseits gezeigt, dass delinquentes, strafrechtlich<br />
relevantes Verhalten ein jugendtypisches Phänomen ist, das alle sozialen Schichten<br />
gleichermaßen betrifft. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass die Jugendlichen. die in<br />
Jugendstrafvollzugsanstalten einsitzen, in ihrer großen Mehrheit der Unterschicht<br />
zuzurechnen sind.<br />
Wesentliche Gründe für die schichtspezifisch unterschiedliche Behandlung der<br />
Jugendlichen durch die Instanzen sozialer Kontrolle (Polizei, Jugendamt,<br />
Jugendgerichtshilfe, Jugendgericht) liegen in der etwas anderen Struktur der Delinquenz von<br />
Unterschichtjugendlichen (die ihrerseits wieder Produkt der <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen und<br />
des daraus resultierenden Handlungspotentials ist), der fehlenden Unterstützung durch die<br />
Eltern (die z.B. bei Mittelschichtkindern versuchen, es gar nicht erst zu einem Verfahren<br />
kommen zu lassen bzw. sich bei einem Verfahren engagieren - etwa durch Einschaltung<br />
eines Rechtsanwaltes), und vor allem in der schispezifisch geringeren Handlungskompetenz<br />
der Unterschichtjugendlichen.<br />
Die geringe Handlungskompetenzen wirkt sich doppelt negativ aus: Zum einen tragen viele<br />
delinquente Handlungen den Charakter von „Dummheiten", die ohne Planung spontan in<br />
einer aktuellen Situation häufig schnelles „Erwischen" nach sich ziehen, zum anderen ist die<br />
Aufmerksamkeit der Kontrollinstanzen aufgrund entsprechender Erfahrungen auch gerade<br />
auf solche Jugendlichen „fixiert", die ihrem gesamten äußeren Habitus nach der Unterschicht<br />
zuzuordnen sind.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 26
Deutschland<br />
Raum deutscher Sozialmilieus<br />
% - Veränderungen<br />
Kulturelles<br />
Kapital +<br />
Selbstbestimmung<br />
+<br />
Hedonistisches M.<br />
10,4 – 13,0%<br />
Alternatives M. 4,0 –<br />
2,1%<br />
Kapitalvolumen +<br />
Distinktion +<br />
Satus: hoher Rang<br />
Aufstiegsorientiertes<br />
M.<br />
20,3 – 26,5%<br />
Traditionsloses<br />
Arbeitermilieu<br />
9,2 – 12,3%<br />
Konservatives gehobenes Milieu<br />
8,7 – 7,2%<br />
Traditionelles<br />
Arbeiterm.<br />
9,8 – 5,6%<br />
Kapitalvolumen –<br />
Distinktion –<br />
Status: niedriger Rang<br />
geringe Auszeichnung<br />
Technokratisches M.<br />
9,1 – 9,2%<br />
Kleinbürgerliches M.<br />
28,3 – 24,0%<br />
Ökonomisches<br />
Kapital +<br />
Konven-<br />
tionalismus<br />
+<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 27
Das Mentalitätsfeld der neuen sozialen Milieus<br />
eher<br />
elitär<br />
eher<br />
egalitär<br />
-<br />
eher alternativ<br />
unkonventionell eher alternativ<br />
-<br />
(1)<br />
HUA<br />
GAN<br />
(2)<br />
(4) NAT<br />
(3)<br />
EFO<br />
konventionell<br />
(5) NTLO<br />
Es handelt sich um fünf nach Habitusformen gut voneinander abgrenzbare, in sich aber durchaus „heterogene“<br />
Varianten neuer sozialer Milieus:<br />
(1) ein humanistisch aktives Milieu mit ausgeprägter beruflicher Ethik, Professionalität und<br />
Leistungsorientierung;<br />
(2) das sog. ganzheitliche Milieu, das einen Kompromiss sucht zwischen dem Aktivismus alternativer<br />
Lebensführung und dem realistischen Akzeptieren der eigenen Grenzen;<br />
(3) das sog. erfolgsorientierte Milieu, das die soziale Ungleichheit als unveränderliche Realität nimmt,<br />
aber kooperativer gestalten möchte; die Chancen des beruflichen Erfolgs und hedonistische<br />
Freizeit nutzt und im Strom symbolischer Progressivität schwimmt;<br />
(4) der sog. neue Arbeitertypus, dem vielseitige Selbstverwirklichung in Arbeit, Freizeit und<br />
Gesellung sowie egalitäre und solidarische Werte zu wichtig sind, als dass er darauf um eines<br />
permanenten sozialen Aufstiegs willen verzichten würde;<br />
(5) ein sog. neuer traditionsloser Arbeitertypus, der sich primär auf einen engen<br />
Vergemeinschaftungskreis und das Bemühen konzentriert, in Familie und Arbeit der ständigen<br />
Gefahr anomischer Destabilisierung entgegen zu arbeiten.<br />
Die Habitusdimension der „Distinktion“ (hier egalitär bis elitär) ist auf der vertikalen Achse, die<br />
Habitusdimension der „Individualisierung“ (hier konventionell bis alternativ) auf der horizontalen Achse<br />
abgetragen.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 28
Individualisierungsthese:<br />
(Vgl. U. Beck:)<br />
Im Gegensatz zu H. Strasser sieht U. Beck [(1982): Risikogesellschaft] durch die „Individualisierung“ von Lebenslagen<br />
einen Auflösungsprozess von sozialen Schichten und Klassen. Die belegt er:<br />
„Aber nicht nur durch einkommens- und bildungsbezogene Niveauverschiebungen können sich (bei konstanten<br />
Ungleichheitsrelationen) die Lebensbedingungen der Mensch drastisch - und zwar in Richtung auf eine<br />
„Individualisierung" von Lebenslagen und Lebenswegen - verändern. Dies ist auch dadurch möglich,<br />
• dass durch Mobilität (im Sinne von sozialer und geographischer Mobilität) die Lebenswege der Menschen aus<br />
dem Herkunftsmilieu herausgelöst, durcheinander gewirbelt und in diesem Sinne „individualisiert" werden,<br />
wodurch neue soziale Beziehungsmuster in Bekanntschaft und Nachbarschaft und neue Formen des<br />
Zusammenlebens -entstehen können;7)<br />
• dass durch die Schaffung sozialstaatlicher Sicherungs- und Steuerungssysteme grundlegende Risiken der<br />
Lohnarbeiterexistenz (und daraus entstehende Ansatzpunkte zur Ausbildung von „Klassensolidaritäten")<br />
reduziert oder sogar teilweise abgebaut werden (z. B. Arbeitslosenversicherung, Krankheitsschutz); 8)<br />
• dass „künstliche" Binnendifferenzierungen (z. B. in Gestalt von Bildungsabschlüssen und bei betrieblichen<br />
Statushierarchien) und damit die Möglichkeit für gruppeninterne Auf- und Abstiege geschaffen werden, die<br />
ihrerseits die Ausbildung entsprechender individueller Aufstiegsorientierungen selbst dort erzwingen, wo von<br />
"sozialem Aufstieg" im Sinne der Ungleichheitsforschung noch lange nicht die Rede sein 'sann; 9)<br />
• dass Konkurrenzbeziehungen (und die mit ihnen verbundenen Zwänge zur individuellen Abschottung und<br />
Vereinzelung) in zeitlicher und sozialer Hinsicht ausgeweitet, d. h_ lebenszeitlich früher und in mehr sozialen<br />
Beziehungen erfahren werden;10)<br />
• dass alte Wohngebiete durch neue urbane Großstadtsiedlungen mit ihren lockeren Bekanntschafts- und<br />
Nachbarschaftsverhältnissen ersetzt werden. 11)<br />
• dass die Arbeitsmarktdynamik immer weitere Bevölkerungskreise erfasst (die Gruppen der<br />
Nichtlohnabhängigen also immer kleiner und die Gruppe der Lohnabhängigen immer größer wird), damit bei<br />
allen Unterschieden auch die Gemeinsamkeiten, insbesondere die Gemeinsamkeiten der Risiken<br />
(Arbeitslosigkeit, Dequalifizierung usw.) über unterschiedliche Einkommenshöhen, Bildungsabschlüsse hinweg<br />
wachsen 12)<br />
• dass die Erwerbsarbeitszeit kontinuierlich sinkt, wodurch sich (bei gleichzeitiger Verbesserung des<br />
Lebensstandards und Bildungsniveaus) gruppen- und generationsspezifisch unterschiedliche Entfaltungs- und<br />
Gestaltungschancen in der Privatsphäre ergeben 13)<br />
• dass durch alle diese Prozesse und Veränderungen traditionale, subkulturelle Differenzierung und<br />
„sozialmoralische Milieus" relativiert und ausgehöhlt werden und damit die vorgängige Einbindung der<br />
Menschen in alltags- und lebensweltlich identifizierbare Klassenstrukturen an sozialer Evidenz und Bedeutung<br />
verliert.14)<br />
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich in diesem Sinne - das ist die These - ein rapider Wandel in den<br />
materiellen und soziokulturellen Lebensbedingungen und -perspektiven der Menschen unterhalb der<br />
Aufmerksamkeitsschwelle der Ungleichheitsforschung ereignet, und dieser Wandel hält immer noch an. Darin<br />
liegt zunächst einmal ein gravierendes Problem dieser Forschungsrichtung, der ihr Gegenstand sozusagen. unter den<br />
„Begriffshänden" weg geflossen ist. Die Wirklichkeit hat sich von der in gesamtgesellschaftlichen<br />
Schichtungsmodellen denkenden Ungleichheitsforschung verabschiedet; sie ist ihr gleichsam davongelaufen, und<br />
hier dürfte auch ein entscheidender Grund dafür liegen, dass sich die soziologische Ungleichheitsforschung,<br />
(übrigens nicht nur sie) mehr und mehr in die Schmollecke der gesellschaftlicher Irrelevanz gedrängt sieht.15)<br />
Dieses Auseinander entwickeln von Forschung und Wirklichkeit ist allein äußerst interessant und<br />
erklärungsbedürftig. Doch diese mehr forschungssoziologischen und forschungstheoretische Fragen sind hier nicht<br />
Thema. In diesem Beitrag soll vielmehr die skizzierte Perspektive systematisch entwickelt werden, dass sich in den<br />
vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten in allen reichen westlichen Industrieländern und besonders deutlich in der<br />
Bundesrepublik Deutschland unter dem Deckmantel weitgehend konstanter Ungleichheitsrelationen ein<br />
gesellschaftlicher "Individualisierungsschub ereignet hat“.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 29
<strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit<br />
(Vgl. Klaus Hurrelmann:)<br />
S 51ff.<br />
Für Hurrelmann stellt sich die Frage, wieweit soziale Bedingungen individuelle Gesundheit<br />
beeinflussen. Ausgehend vom familiären Bereich analysiert er Kindheit, Jugend und<br />
Erwachsensein.<br />
Belastungen im Kindesaster<br />
Lebensbereich Familie:<br />
Familien sind in allen Industriegesellschaften relativ kleine Systeme.<br />
Sie ist als Hauptbetreuungsorganisation von Kindern in Schwierigkeiten geraten;<br />
auf Unterstützung durch öffentliche Einrichtungen angewiesen.<br />
Ursache: in hohem Grad von Individualisierung von Lebensweisen.<br />
Erziehungsverantwortliche und verantwortlich für die Innenbeziehungen nur noch<br />
in wenigen Fällen die Frau.<br />
Gleichberechtigte außerhäusliche Berufstätigkeit:<br />
Gleichberechtigte Arbeitsteilung in Familie:<br />
Eigenständige Gestaltung von Sozialbeziehungen:<br />
In allen drei Bereiche Benachteiligung von Frauen.<br />
Belastungen:<br />
Trennung der Eltern:<br />
Durch Scheidung starke psychische und soziale Belastungen der Kinder.<br />
Beziehungsstörung schwer nachvollziehbar; Tragweite nicht abzuschätzen;<br />
für Kinder keine Verarbeitungsstrategien zugänglich.<br />
Durch Trennung wird Beziehungsasymmetrie verstärkt.<br />
Psychische und soziale Belastung des Alleinerziehers; finanzielle Erschwerungen;<br />
Mütter in höherem Maße nicht berufstätig - Trennung vom Kind - Bezugsperson.<br />
Wechsel von Wohn- und sozialer Umgebung.<br />
Scheidungswaisen:<br />
Stigmatisierungen - abweichendes Verhalten; emotionale Beziehungskonflikte -<br />
Stiefgeschwister u.ä.<br />
Materielle und immaterielle Deprivation:<br />
Materielle Bedingungen und kindliche Entwicklungsbedürfnisse: Armut im Wohlfahrtsstaat durch:<br />
• Arbeitslosigkeit<br />
• Straffälligkeit der Eltern<br />
• ...<br />
Folgen:<br />
gespannte, zerrüttete Beziehungen; aggressive, gewalttätige Auseinandersetzungen, unkontrollierte<br />
und unberechenbare Erziehungsstile; wenig pos. Voraussetzungen für soziale. psychische und<br />
körperliche Entwicklung.<br />
Kinder brauchen in den ersten Lebensjahren stabile, zuverlässige und berechenbare soziale<br />
Beziehungsstrukturen:<br />
+ Grad der Stimulation:<br />
+ Grad der Angemessenheit:<br />
+ Grad der Varietät:<br />
+ Grad der Annahmebereitschaft<br />
+ Grad der Responsivität Grad der Zuneigung:<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 30
"Um ein positives Selbstwertgefühl, um Selbstkontrolle, prosoziale Orientierungen, freundliches und<br />
kooperatives Verhalten im Umgang mit Gleichaltrigen und Erwachsenen, Selbstverantwortlichkeit<br />
und Leistungsbereitschaft zu entwickeln, benötigt ein Kind kontinuierliche Unterstützung und<br />
Wärme, konsistente Kontrolle und Disziplinierung, einfühlend- erklärendes Erziehungsverhalten<br />
Erweiterung des Handlungsspielraumes.<br />
Interaktionsqualität der Familie:<br />
Bestimmte Beziehungsbedingungen - für gesunde Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Unausgeglichene und spannungsvolle Beziehungen - starker Risikofaktor; ebenso<br />
finanzielle Schwierigkeiten, Arbeitsprobleme, Alkoholismus, Streit zwischen Eltern, ...<br />
beeinträchtigen den Aufbau von Verhaltenskompetenz. Geringere Sorge und Kinder;<br />
geringere emotionale Anteilnahme am Kind;<br />
Ungünstiger sozialer Status - stresshafte Konstellationen:<br />
Höhere Verletzlichkeit der Buben gegenüber Mädchen:<br />
Zu den spezifischen Risikofaktoren für soziale Abweichung (Delinquenz) und<br />
psychische Auffälligkeit (Dissozialität bzw. Aggressivität) gehören:<br />
• die dauerhafte Trennung von Mutter/Vater unter 5 Jahren<br />
• Alter der Mutter unter 18 Jahren bei Geburt wiederholte<br />
Krankenhausaufenthalte in den ersten zwei Lebensjahren<br />
• längere Trennung von der Mutter in den ersten Lebenswochen<br />
• häufiger Wechsel der Bezugspersonen innerhalb der Familie<br />
• häufiger Ortswechsel in den ersten Lebensjahren des Kindes<br />
• (daneben die bekannten Risikofaktoren bei und vor der Geburt).<br />
Außerfamiliärer Lebensbereich:<br />
Durch die gesamte physische und räumliche Umwelt sind Kinder stark auf Schulung optischer<br />
und akustischer Sinneseindrücke angewiesen (teilw. Überstimulierung). In motorischen und<br />
anderen Sinnesbereichen teilweise nicht ausreichend stimuliert.<br />
Verbaute Umwelt - künstliche Bau- und Ausstattungsmaterialien - Spielzeug - fehlende<br />
Körperkontakte mit emotionaler Zuwendung; starke Reglementierung.<br />
Erkennbare Schädigungen der körperlichen, sozialen und psychischen Entwicklung:<br />
Straßenverkehr:<br />
Umweltbelastung:<br />
Ernährung:<br />
Tagesrhythmus:<br />
Mangelnde Bewegungsmöglichkeiten:<br />
Wirkung dieser Risikofaktoren über Jahre latent; Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge daher<br />
schwer zu klären.<br />
Akut belastende Lebensereignisse. (für Kinder im Grundschulalter)<br />
Tod eines Elternteils<br />
Sitzen bleiben<br />
Handgreiflichkeiten zwischen Eltern<br />
bei Diebstahl ertappt werden<br />
als Lügner verdächtigt werden<br />
eine Klassenbucheintragung<br />
sich einer Operation unterziehen<br />
sich verlaufen<br />
von der Klasse ausgelacht werden<br />
in eine andere Schule überwechseln müssen<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 31
einen Albtraum<br />
nicht alle Hausaufgaben lösen können<br />
als Letzter in eine Mannschaft gewählt werden<br />
in einem Wettspiel verlieren<br />
Deutlicher Zusammenhang : Lebensbelastungen - psychisch und körperliche Beeinträchtigungen<br />
Zusammenhänge über Stressoren und Stresshormone.<br />
Zusammenhänge personaler und sozialer Belastungsfaktoren:<br />
Statt allein auf genetische oder Umweltfaktoren zu verweisen,<br />
wäre Konstrukt: Temperament / Habitus sinnvoll.<br />
Viele Untersuchungen: Buben sind stärker von Temperamentsvariablen abhängig als Mädchen;<br />
offenbar sind männliche Kleinkinder gegenüber prä- und postnatalen Störungen anfälliger; Buben<br />
wird höheres Maß an Aggressivität zugestanden, zugleich aber scheinen recht enge Vorstellungen<br />
von Normalität bei Buben gegeben zu sein; Fehlanpassungen an soziale Forderungen,<br />
Störung der Geschlechtsrollenidentität, Störungen im kognitiven und emotionalen Bereich<br />
sind bei Buben stärker ausgeprägt. Das gleiche gilt für Aggressivität und Hyperaktivität.<br />
Für gesunde Entwicklung von Kindern entscheidend:<br />
die soziale, ökologische und materielle Lebensbedingung;<br />
geordneter, berechenbarer sozialer Kontext;<br />
Krisen: plötzlicher, abrupter Bruch in den Erwartungen und der Erwartbarkeit von<br />
Verhalten für das Kind.<br />
K. Hurrelmann: <strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit<br />
Jugendspezifische Risikofaktoren:<br />
1. Hoher Erwartungsdruck bei schwieriger schulischer Leistungssituation durch die Eltern<br />
2. Hohe Belastungen bei emotionalen Spannungen mit Eltern; Nichtübereinstimmung bei der<br />
längerfristigen Lebensplanung<br />
3. Gesundheitsbeeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten bei schwieriger Integration in<br />
Gleichaltrigengruppe<br />
Kriminelles Verhalten ist der Endpunkt einer langen Kette von Belastungen:<br />
ungünstige <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen in der Familie, geringer Schulerfolg, fehlender<br />
Schulabschluss, mangelhafte Berufsausbildung, Arbeitslosigkeit.<br />
Tabelle 7: Schichtzugehörigkeit und psychische Auffälligkeiten (1040 Patienten der kinder- und<br />
jugendpsychiatrischen Universitätspoliklinik Berlin zwischen 6 und 18 Jahren, Prozentangaben)<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 32
(Nach Petri 1979, 107)<br />
Gesamt UnterschichtMittelschichtOberschicht<br />
N = 354 N = 528 N = 158<br />
Kontaktstörungen 54,0 45,1 44,9<br />
Einordnungsstörungen 34,7 26,1 25,3<br />
Nägelknabbern 32,2 24,6 27,8<br />
Hypermotorik 28,2 214 22,2<br />
Ängstlichkeit 26,6 25,2 17,1<br />
Wegnehmen/Stehlen 16,9 10,2 11,4<br />
Gesteigerte Aggression 16,1 11,6 7,6<br />
Überanpassung 12,7 17 4 10,1<br />
Leistungsversagen 29,9 27,5 38,0<br />
Depressive Verstimmung 12,1 17,2 10,1<br />
Allg. Stimmungsstörung 10,2 12,5 17,1<br />
Darmfunktionsstörung 6,5 8,3 13,3<br />
Magenbeschwerden 6,2 6,4 11,4<br />
Offensichtlich sind Belastungen, die sich Kinde m und Jugendlichen in sozial und materiell<br />
benachteiligten Familien stellen, von ihnen schwieriger zu bewältigen.<br />
Angehörige sozial Privilegierter Familien verfügen über mehr Macht und Einfluss,<br />
über mehr ökonomische Ressourcen, mittels derer sie die Belastungssituationen<br />
besser bewältigen können – z.B: Selbstmord:<br />
1) gespannte und zerrüttete soziale Beziehungen zu den Eltern<br />
2) Leistungsschwierigkeiten in der Schule /Schulversagen<br />
3) Krisen in Beziehungen zu Gleichaltrigen / anderes Geschlecht<br />
Risikokonstellationen für gesundheitliche Beschwerden<br />
Tabelle 8:<br />
Bildungsstand des Vaters, Schulformzugehörigkeit und psychosomatische Beschwerden (13-16jährige Jugendliche),<br />
%-Anteile mit überdurchschnittlicher Symptomhäufigkeit<br />
Schulformzugehörigkeit<br />
Bildungsgrad Haupt- Real- Gym- Gesamt<br />
des Vaters schule schule nasium schule<br />
niedrig 43% 51% 44% 61%<br />
mittel 43% 44% 43% 54%<br />
hoch 52% 58% 36% 39%<br />
Tab. 8 zeigt, dass der Wert für psychosomatische Beschwerden in den Subgruppen besonders<br />
hoch liegt, in denen Eltern den höchsten Bildungsgrad besitzen, die befragten Schüler/innen<br />
jedoch nur Hauptschulabschluss erreichen.<br />
D.h. im hohen Erwartungsdruck liegen erhebliche Belastungsmomente.<br />
Belastungen im Erwachsenenalter:<br />
Lebensbedingungen, die zu Beeinträchtigungen führen:<br />
1) Berufs- und Erwerbbereich<br />
2) Familien- und Freizeitbereich<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 33
Tabelle 9: Sterbewahrscheinlichkeit der Männer zwischen dem 35. und 60. Lebensjahr nach<br />
ausgewählten Berufen sowie nach fernerer Lebenserwartung<br />
(Frankreich, 1975-1980)<br />
(nach Oppolzer 1986, 100)<br />
Beruf, Berufsgruppe Fernere Lebenserwartung<br />
im Alter von 35 (in Jahren)<br />
Professor 43,2<br />
Ingenieur 42,3<br />
Selbständiger/Freie Berufe 42,0<br />
Lehrer 41,1<br />
Verwaltungsfachleute d. höh. Ebene 41,4<br />
Techniker 40,3<br />
Landwirte 40,3<br />
Arbeitgeber aus Industrie und Handel 39,5<br />
Kleinere Kaufleute 38,8<br />
Angestellte des Handels 38,4<br />
Büroangestellte 38,5<br />
Facharbeiter 37,5<br />
Dienstpersonal 36,0<br />
Ungelernte Arbeiter 34,3<br />
Erwerbstätige zusammen 38,8<br />
Die Stellung im Beruf führt nachweislich zu einem unterschiedlichen Risiko für<br />
Sterblichkeit und Erkrankungshäufigkeit. Die Unterschiede im Sterblichkeitsrisiko<br />
beginnen bereits mit der Geburt. Je niedriger die soziale Schicht, umso höher die<br />
Häufigkeit der Fehlgeburten.<br />
Der wesentliche Grund Für die höheren Krankheits- und Sterblichkeitsraten bei Angehörigen<br />
niedriger Berufsgruppen muss im signifikanten Zusammenhang zwischen beruflicher Stellung<br />
und Qualifikation und dem Ausmaß an Gesamtbelastung in den Arbeits- und den davon<br />
beeinflussten Lebensbedingungen gesehen werden.<br />
Daher: Berufsposition, Einkommen, Ausbildung und Wohnqualität - Faktoren für soziale<br />
Schichtzugehörigkeit.<br />
Tabelle l0: Häufigkeit verschiedener Arten von (behandelten) Psychosen nach<br />
Sozialschichten (pro 100.000 Einwohner, alters- und geschlechtskorrigiert;<br />
New-Haven /USA, 1950)<br />
Krankheitsarten Sozialschicht<br />
I-lI III IV V<br />
Affektive Psychosen' 40 41 68 105<br />
Alkohol- und Suchtpsychosen 15 29 32 116<br />
Organische Psychosen 9 24 46 254<br />
Schizophrene Psychosen 111 168 300 895<br />
Alters-Psychosen 21 32 60 175<br />
Schichteinteilung:<br />
I Unternehmer, hohe Beamte, Freie Berufe etc.<br />
II Kleinunternehmer, mittlere Manager, angestellte Akademiker etc.<br />
III Verwaltungsangestellte, Techniker, qualifizierte Handwerker, kleine Ge<br />
werbe treibende<br />
IV Gelen» und angelernte Arbeiter und Verkäufer etc.<br />
V An- und ungelernte Arbeiter<br />
(Nach Hollingshead & Redlich 1958)<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 34
Berufsbezogene Risikofaktoren<br />
Arbeitslosigkeit<br />
So sehr sich ungünstige Arbeitsbedingungen<br />
negativ auf die Gesundheit niederschlagen -<br />
noch wesentlich belastender als schlechte<br />
Arbeitsbedingungen ist Arbeitslosigkeit. In der<br />
Untersuchung von Jahoda, Lazarsfeld und<br />
Zeisel aus dem Jahre 1933 über die<br />
Arbeitslosen von Marienthal wird zum ersten<br />
Mal umfassend versucht, die sozialen,<br />
psychischen und gesundheitlichen<br />
Auswirkungen der existenziell bedrohlichen<br />
Arbeitslosigkeit zu analysieren. Die Autoren<br />
beschreiben vier „Haltungstypen" als Reaktion<br />
auf bzw. Bewältigungsversuche von<br />
Arbeitslosigkeit: Ungebrochene, Resignierte,<br />
Verzweifelte, Apathische. Diese<br />
Haltungstypen stehen in enger Beziehung zur<br />
ökonomischen Lage: Die Ungebrochenen<br />
haben das höchste Einkommen, die<br />
Apathischen das geringste. Diese Beziehung<br />
wird auch Für den Gesundheitszustand der<br />
Kinder hergestellt: Bei Kindern mit dem<br />
besten gesundheitlichen Befund stehen noch<br />
38,4 % der Väter in Arbeit, bei Kindern mit<br />
dem schlechtesten Befund keiner der Väter<br />
(Jahoda 1983).<br />
Die sozialen, psychischen und körperlichen<br />
Folgen von Arbeitslosigkeit sind nur im Blick<br />
auf die Verlusterlebnisse zu verstehen, die<br />
Arbeitslosigkeit auch unter den heute<br />
veränderten Beziehungen zwischen Leben und<br />
Arbeit mit sich bringt:<br />
• Verlust der Struktur des Tages durch<br />
die Arbeit<br />
• Verlust der ökonomischen Sicherheit<br />
und der Möglichkeit der<br />
Bedürfnisbefriedigung durch<br />
finanzielle Mittel<br />
• Verlust der Perspektive, die in<br />
individueller Form (Karriere) und<br />
sozialer Form (Anerkennung) mit dem<br />
Beruf verknüpft ist.<br />
• Verlust der sozialen Kontakte mit<br />
Berufskollegen<br />
• Verlust der Arbeit als Lebensäußerung<br />
und Verlust der<br />
Befriedigungsmöglichkeit des<br />
produktiven Bedürfnisses<br />
• Verlust des Gefühls der eigenen<br />
Wichtigkeit in der Gesellschaft<br />
• Verlust von Anregungen durch die<br />
soziale Umwelt<br />
• Verlust der Ernährerrolle in der<br />
Familie, usw.<br />
Wie ein Überblick über neuere<br />
Untersuchungen von Walter (1985, 57) zeigt,<br />
erhöht sich im Falle von Arbeitslosigkeit die<br />
Belastung der Betroffenen enorm. Bereits die<br />
Ankündigung von geplanten<br />
Werkschließungen kann bei den Beschäftigten<br />
und bei ihren Familien zu massiven<br />
psychosomatischen Beschwerden und<br />
Gesundheitsbeeinträchtigungen führen<br />
insbesondere zu Kopfschmerzen,<br />
Schlafstörungen, Magenbeschwerden,<br />
Herzbeschwerden, Blutdruckerhöhungen.<br />
Kommt es dann zur Arbeitslosigkeit und<br />
dauert diese länger an, so erhöht sich das<br />
Risiko der Gesundheitsbeeinträchtigungen der<br />
Betroffenen erheblich: Herzkrankheiten,<br />
Bluthochdruck und Störungen der<br />
Verdauungsorgane stehen dabei im<br />
Vordergrund der durch Arbeitslosigkeit<br />
bedingten Krankheiten. Außerdem werden die<br />
Quoten von Selbstmord, psychiatrisch<br />
erfassbaren Krankheiten und auch von<br />
Delinquenz spürbar gesteigert.<br />
In neueren deutschen Untersuchungen<br />
(Benninghaus 1987) wurden die Dimensionen<br />
Aufgabenvielfalt, Entscheidungsspielraum,<br />
psychische I Arbeitsanforderungen und<br />
Umgang mit anderen Personen erfasst. Im<br />
Vordergrund steht auch hier die Dimension<br />
Aufgabenvielfalt, die stärker als alle anderen<br />
Variablen mit solchen Faktoren wie der<br />
Zufriedenheit mit der Arbeit, dem<br />
Selbstwertgefühl, dem Kompetenzgefühl, dem<br />
Gefühl der Depressivität und<br />
psychosomatischen Beschwerden sowie dem<br />
psychischen und physischen Gesamtbefinden<br />
korreliert. Weiterhin erwiesen sich auch die<br />
Dimensionen Entscheidungsspielraum und<br />
Arbeitsanforderungen als signifikante<br />
Prädiktoren für einzelne Variablen. Der Grad,<br />
bis zu dem Fachkenntnisse eingebracht und<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 35
schöpferische Begabungen und Ideen<br />
entwickelt werden und umfangreiche<br />
Kenntnisse und hohe Qualifikationen sowie<br />
eine breite Facette von Arbeitsanforderungen<br />
stimuliert werden können, erweist sich auch<br />
hier als wesentlich.<br />
Als ungünstig für das Wohlbefinden stellen<br />
sich hingegen schlechte ergonomische<br />
Arbeitsbedingungen (nach Temperatur, Staub,<br />
Licht, Lärm), schwere körperliche Arbeit,<br />
monoton- repetetive, anforderungsarme<br />
Arbeitstätigkeiten, mangelnde soziale<br />
Anerkennung und Fehlen von Kooperations-<br />
und Kommunikationsbeziehungen am<br />
Arbeitsplatz sowie das Gefühl von geringer<br />
Kontrolle über die Arbeitssituation heraus. Je<br />
mehr diese Merkmale auf einen Arbeitsplatz<br />
zutreffen, desto höher ist die allgemeine<br />
Belastung von Arbeitenden und desto<br />
wahrscheinlicher ist das Auftreten von<br />
psychischen und körperlichen<br />
Beeinträchtigungen. Kombinationen von<br />
Stressoren aus dem physiologischen und<br />
psychologischen Bereich erweisen sich als<br />
besonders belastend.<br />
Anforderungsarme Arbeitstätigkeit, fehlende<br />
Kooperation, geringe Autonomie und<br />
Selbstbestimmung und mangelnde<br />
Transparenz führen demnach zu Störungen im<br />
Wohlbefinden und zu andauernden<br />
psychischen und körperlichen Beschwerden,<br />
zu einem Abbau der intellektuellen<br />
Leistungsfähigkeit und der geistigen<br />
Beweglichkeit, zu einem passiven<br />
Freizeitverhalten und zu geringem<br />
Engagement im politischen und auch<br />
gewerkschaftlichen Bereich und haben<br />
Auswirkungen auf<br />
den gesamten Lebensstil. Der Zusammenhang<br />
zwischen der Arbeitsgestaltung und der<br />
übrigen Lebensgestaltung ist deutlich<br />
ersichtlich: Die Persönlichkeit eines Menschen<br />
entwickelt sich maßgeblich in<br />
Auseinandersetzung mit der Arbeitstätigkeit<br />
und strahlt auf die übrigen Lebensbereiche aus<br />
(Kohn & Schooler 1983).<br />
Durch die neue technologische Entwicklung<br />
kommt es zu neuartigen Risiken.<br />
Psychosoziale Nebeneffekte der<br />
elektronisch-technischen Innovation<br />
(verstärkte Automation, verstärkte Trends zu<br />
Riesenunternehmen usw.) können wachsende<br />
Anonymität und Heterogenität der sozialen<br />
Beziehungen sein. In vielen Bereichen kommt<br />
es zu einer immer intensiveren und strengeren<br />
Arbeitsteilung mit segmentierten<br />
Arbeitsbereichen und sozialer Distanz<br />
zwischen den Berufstätigen. Die soziale und<br />
psychische Verträglichkeit der neuen<br />
Techniken ist teilweise noch nicht erwiesen.<br />
Daneben bestehen die „alten" Risiken der<br />
herkömmlichen Technik am Arbeitsplatz<br />
weiter: Der Gebrauch verschiedener<br />
chemischer und anderer toxischer Stoffein<br />
Bergbau, Industrie und Landwirtschaft kann zu<br />
Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen,<br />
verschiedenen Haut-, Lungen-, Blasen- und<br />
andere Krebskrankheiten und Krankheiten<br />
durch Strahlen führen; der rücksichtslose<br />
Gebrauch von kapitalintensiven<br />
Produktionsmethoden verursacht<br />
Arbeitsunfälle, Arbeitsunfähigkeit und damit<br />
verbunden Angst, Depression, Alkoholismus<br />
sowie vermehrtes Rauchen mit der Folge von<br />
Bronchitis und Lungenkrebs; der Einsatz von<br />
Arbeitskräften für passive, repetive und<br />
maschinenähnliche Arbeitsvollzüge kann<br />
psychosomatische und Stress-Krankheiten zur<br />
Folge haben; die Umweltverschmutzung<br />
betrifft (z.B. durch Bleivergiftung,<br />
Vergiftungen durch Schwefeldioxid usw.) den<br />
Gesundheitszustand breiter<br />
Bevölkerungsgruppen; der Zwang zur<br />
Beschleunigung der Arbeitsvollzüge führt zur<br />
Zunahme der Risiken von Arbeitsunfällen und<br />
Straßenverkehrsunfällen; der Zwang zur<br />
Nutzung neuer und nicht ausreichend geprüfter<br />
Energiequellen hat Gesundheitsrisiken und<br />
Todesfälle z.B. durch Atomkraftwerke zur<br />
Folge (Walter 1985, 31).<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 36
Auswirkungen belastender Ereignisse und Übergänge im Lebenslauf:<br />
Wie bereits bei der Analyse von Belastungen im Kindesalter diskutiert, ist in der psychologischen<br />
Forschung zur Erlassung berstender Ereignisse in Familie, Freundeskreis und Freizeit, teilweise unter<br />
Einschluss des Arbeitsbereiches, ein differenziertes Instrumentarium entwickelt<br />
Die Social Readjustment Rating Scale (SRRS) umfasst insgesamt 43 Life- Events, darunter (mit dem<br />
jeweilig Durchschnitts-Punktwert der Belastung):<br />
1. Tod des Ehepartners 100<br />
2. Scheidung 73<br />
3. Trennung vom Ehepartner 65<br />
4. Haftstrafe 65<br />
5. Tod eines nahen Familienangehörigen 63<br />
6. Eigene Verletzung oder Krankheit 53<br />
7. Heirat 50<br />
8. Verlust des Arbeitsplatzes 47<br />
9. Aussöhnung mit dem Ehepartner 45<br />
10. Pensionierung 45<br />
11. Änderung im Gesundheitszustand<br />
eines Familienmitglieds 44<br />
12. Schwangerschaft 40<br />
13. Sexuelle Schwierigkeiten 39<br />
14. Familienzuwachs 39<br />
15. Geschäftliche Veränderung 39<br />
16. Erhebliche Einkommensveränderung 38<br />
17. Tod eines nahen Freundes 37<br />
Die vorliegenden Untersuchungen weisen au!<br />
einen Zusammenhang zwischen Belastungen<br />
und den alltäglichen Lebensaktivitäten, den<br />
Mustern des Lebensstils und der Lebensweise<br />
ein-,. Bevölkerungsgruppe, hin. Alle<br />
einschlägigen Studien liefern Belege = eine<br />
stärkere Ausprägung verschiedener Symptome<br />
von Lebensbelastung in Bevölkerungsgruppen<br />
mit ungünstigem sozio- ökonomischem Status.<br />
Offenbar sind sowohl die objektiven<br />
Belastungskomponente: wie auch die subjektiv<br />
wahrgenommenen Belastungen in den<br />
unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen<br />
höher. Auch herrscht in stärkerem Maße das<br />
Gefühl vor, den Entwicklungsaufgaben und<br />
den alltäglich= Herausforderungen des Lebens<br />
nicht in vollem Maße gewachsen zu sein, so<br />
dass es zu einem Gefühl von Machtlosigkeit<br />
gegenüber Lebensforderungen, fehlendem<br />
Selbstvertrauen sowie zur Entwicklung von<br />
ungeeigneten Strategien der<br />
Lebensbewältigung kommt.<br />
Durch die objektiven Lebensumstände sind<br />
Unterschichtangehörige also einer größeren<br />
Zahl von belastenden Ereignissen und<br />
Situationen ausgesetzt und sie sind zugleich<br />
„verletzlicher" durch diese objektiven<br />
Belastungen als es in den sozialen<br />
Mittelschichten und Oberschichten.<br />
der Fall ist. Kessler und Cleary (1980)<br />
erklären das durch die relativ begrenzten<br />
Zugangsmöglichkeiten sowohl zu<br />
intrapsychischen als auch zu sozialen<br />
Ressourcen, also zu den<br />
Bewältigungsmechanismen und<br />
Kontrolltechniken der Lebenssituation auf der<br />
einen Seite und den materiellen und<br />
immateriellen Unterstützungsmöglichkeiten<br />
auf der anderen Seite.<br />
Diese Merkmale der Lebensweise drücken<br />
sich in unterschiedlichen sozialen Definitionen<br />
von Gesundheit und Krankheit aus. Wie Baur<br />
(1987) betont, wird Krankheit bei Mitgliedern<br />
unterer sozialer Schichten oft als Schwäche<br />
interpretiert, welche die gewohnte Nutzung<br />
des Körpers beeinträchtigt oder behindert.<br />
Krankheit wird dann zur Kenntnis genommen,<br />
wenn sie sich, jenseits einer relativ hohen<br />
Schmerzschwelle, nicht mehr übergehen lässt.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 37
Körperliche Empfindungen und Krankheit<br />
signalisierende Symptome unterhalb dieser<br />
Schwelle scheinen nicht wahrgenommen zu<br />
werden. Dementsprechend sind ärztliche<br />
Konsultationen bei Mitgliedern unterer<br />
Schichten relativ seltener als bei denen<br />
höherer Schichten, auch wenn der<br />
Gesundheitszustand schlechter ist.<br />
Entsprechend der Idee einer längerfristig<br />
perspektivierten „Fitness" nehmen Mitglieder<br />
der höheren Schichten deutlich mehr das<br />
medizinische Vorsorgesystem in Anspruch<br />
und suchen den Arzt häufiger aus<br />
prophylaktischen Gründen auf (Baur 1987,<br />
196).<br />
Unterschiedliche Gesundheitsvorstellungen<br />
finden ihren Ausdruck auch in<br />
Ernährungsgewohnheiten. In den unteren<br />
sozialen Schichten werden Nahrungsmittel<br />
bevorzugt, die als nahrhaft und kräftigend<br />
gelten und Lebenskraft und Stärke geben<br />
sollen, während in höheren sozialen Schichten<br />
eher leichte und natürlich zubereitete Speisen<br />
überwiegen. In den höheren sozialen<br />
Schichten herrscht zudem ein besseres<br />
Ernährungswissen vor, das durch neue<br />
Informationen auf dem Laufenden gehalten<br />
wird.<br />
Wie die Analysen von Bourdieu (1984, 298)<br />
zeigen, sind Unterschiede nicht nur im<br />
Nahrungsmittelkonsum und der<br />
Essenszubereitung auszumachen, sondern<br />
auch in der Art und Weise des Essens und<br />
Trinkens. Sie lassen sich auch in<br />
Unterschieden der Körpersprache und der<br />
Körperkontrolle erkennen: Angehörige<br />
höherer Schichten treiben häufiger Sport und<br />
verwenden dafür mehr Freizeit. Der Zugang<br />
zum Sport wird diesen Schichten auch deshalb<br />
erleichtert, weil sie ihre eigenen<br />
Wertorientierungen, die sie im Zusammenhang<br />
mit ihrer spezifischen Art der<br />
Lebensbewältigung entwickeln, in den Sport<br />
einbringen können, z.B. Selbständigkeit,<br />
Selbstverantwortung, Leistungsstreben,<br />
Selbstdisziplin, Ausdauer, Erfolgsmotivierung,<br />
gezielte Risikobereitschaft (Baur 1987, 302).<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 38
Ad 8) Jugend und Beruf<br />
Determinanten der Berufswahl:<br />
An dieser Stelle kann selbstverständlich weder die fehlende Theorie der Berufswahl entwickelt, noch<br />
die Datenfülle empirischer Erhebungen wiedergegeben werden. Dennoch sollen - ausgehend von<br />
einem Determinantenschema einige Aspekte verschiedener Disziplinen zur Berufswahl angedeutet<br />
und als Diskussionsanreiz angeboten werden. Dieses Angebot ist ein Weg, um den )privaten(<br />
Charakter der Berufswahl aufzubrechen, um die gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen<br />
Dimensionen bewusst zu machen, um auf diese Weise Berufswahl-Handeln durch sachliche<br />
Überlegungen vorzubereiten.<br />
Präferenzen- Erwartungs-.<br />
hierarchie hierarchie<br />
1. Unmittelbare Determinanten<br />
Berufsinformation Technische<br />
Qualifikation, Werthierarchie<br />
2. Sozialpsychologische<br />
Attribute<br />
Allgemeiner Wissensstand,<br />
Fähigkeiten.. Schulniveau,<br />
soziale Stellung und<br />
Beziehungen, Einstellung zum<br />
Berufsleben .<br />
3. Individuelle Entwicklung ,<br />
Schulische Entwicklung,<br />
Veränderungen<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozess.<br />
Familieneinfluss<br />
Berufswahl.<br />
und Selektion<br />
Biologische Konditionen Soziale Struktur,<br />
soziale Stratifikation,<br />
Normen, Demographie<br />
Determinantenschema zur Berufswahl<br />
Ideale Realistische<br />
Standards Einschätzung<br />
I. Unmittelbare<br />
Determinanten<br />
normale Nachfrage, Funktionale<br />
und nichtfunktionale Erfordernis;<br />
Entlohnung'<br />
II. Soziökonomische Organisation',<br />
Berufsbesetzung und Abgangsraten;<br />
, Arbeitsteilung, Politik der<br />
relevanten Organisationen<br />
III. Historischer Wandel<br />
Trend in der sozialen Mobilität;<br />
Veränderungen in der industriellen<br />
Zusammensetzung, Wandel an der<br />
Konsumfront<br />
Wirtschaftliche Grundlagen<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 39
Determinanten der Berufswahl<br />
Eine Möglichkeit, sich des Umfeldes und der Voraussetzungen der individuellen Studien- und<br />
Berufswahl bewusst zu werden, ist ein Blick auf ein sog. Determinantenschema. Die Abbildung<br />
zeigt das in der einschlägigen Literatur häufig zitierte Schema von Peter Blau.<br />
Es geht bei diesem Schema nicht um alle Details und die letzte Eindeutigkeit aller Begriffe.<br />
Entscheidend ist die Aussage, dass die Berufsfindung als ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren<br />
aufgefasst und - abweichend vom vorherrschenden privaten Ereignischarakter - als komplexes<br />
Einflussfeld interpretiert wird. Nach Blau sind es insgesamt acht Faktoren, die die Berufsfindung<br />
determinieren, vier auf der Seite der Berufswelt, vier auf der Seite des Individuums:<br />
Berufswelt:<br />
1. Nachfrage, die zu einer bestimmten Zeit besteht<br />
2. Funktionale Anforderungen (technische Qualifikation)<br />
3. Nicht-funktionale Anforderungen (Status, Religion)<br />
4. Art der Gegenleistung (Prestige, Entlohnung, Aufstiegschancen ...)<br />
Individuum:<br />
5. Informationsniveau über die Berufswelt<br />
6. Eignung<br />
7. Andere, nicht leistungsrelevante Merkmale sozialer Art<br />
8. Allgemeine Wertorientierung<br />
Legt man einen noch gröberen Raster an, dann lassen sich unterscheiden: soziologische Faktoren<br />
ökonomische Faktoren psychologische Faktoren<br />
Unter Bezug auf diese Gliederung sollen einige Aspekte zur Berufswahl dargestellt werden als<br />
Ansatzpunkte zur Reflexion, zur Diskussion - und zum Widerspruch.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 40
<strong>Sozialisation</strong> - Strukturmodell<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 41
Informationstheoretisches Modell der Berufswahl (Ries, Berufswahl)<br />
Start<br />
nein<br />
---------<br />
ja<br />
Gesellschaft und<br />
ihre Normen<br />
bewirken ...<br />
beim Jugendlichen<br />
eine<br />
Statusunvollständig<br />
keit<br />
Jugendlicher<br />
antizipiert einen<br />
Zielstatus<br />
Qualifiziert die<br />
erhaltenen<br />
Informationen.<br />
Informationen<br />
ü ?<br />
Informationen<br />
bestätigen die<br />
Rangreihe und<br />
führen zum<br />
E t hl<br />
nein / ja<br />
Der Jugendliche<br />
meldet<br />
Statusansprüche<br />
an<br />
Entwurf einer<br />
entsprechenden<br />
Rangreihe<br />
alternativer<br />
B f ll<br />
Informationsermittl<br />
ung und<br />
Reaktivierung des<br />
Informationspotenti<br />
l<br />
Gesellschaft gibt<br />
über die<br />
Rollenstruktur<br />
Informationen frei<br />
Gesellschaft als<br />
Rollendistributeur<br />
prüft die<br />
Ansprüche und<br />
h ißt i t<br />
nein / ja<br />
Jugendlicher<br />
übernimmt Rolle,<br />
Statusunvollständig<br />
keit behoben -<br />
i t i t<br />
Fehlende<br />
Orientierung über<br />
die Zugänglichkeit<br />
dieser berufsrollen<br />
Stopp<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 42
3.4. Beruflicher Habitus<br />
In Anlehnung an den französischen Bildungs- und<br />
Kultursoziologen Bourdieu hat Windolf (1981) den<br />
Begriff des „beruflichen Habitus" als Resultat der<br />
Verknüpfung von <strong>Sozialisation</strong> und Familie, Schule<br />
und Erwerbstätigkeit, die allesamt durch die<br />
gesellschaftliche Reproduktion durch Arbeit geprägt<br />
sind, diskutiert. Der berufliche Habitus ist ein stabiles<br />
System verinnerlichter interner Handlungsregeln, die<br />
nicht nur der Anpassung an die Arbeitsanforderungen,<br />
sondern auch der Selbstinterpretation und der Deutung<br />
gesellschaftlicher Verhältnisse dienen. Die sozialen<br />
Anforderungen, die beim Erlernen und Ausüben eines<br />
Berufs erfüllt werden, führen zu Akteuren mit einem<br />
gleichen Habitus, d. h. gemeinsamen Denk- und<br />
Beurteilungsmustern sowie Handlungsschemata.<br />
Der berufliche Habitus ist ein idealtypisches Konstrukt,<br />
ein Bezugsrahmen für individualisierende<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesse. Er konkretisiert sich durch die<br />
Beteiligung am betrieblichen Arbeitsprozess, wodurch<br />
die Erwerbstätigen in den jeweiligen kulturellen Code<br />
der Organisation eingefügt werden; dies geschieht durch<br />
Initiationsprozesse und Statuspassagen, nachdem<br />
Selektionskriterien überwunden sind. Dabei geht es<br />
darum, die impliziten Spielregeln oder den „geheimen<br />
Lehrplan" der Arbeitsorganisation zu entschlüsseln. Der<br />
Betrieb rekrutiert Mitglieder, die soziale und kulturelle<br />
Grundqualifikationen mitbringen und unterzieht sie<br />
einer Einweisungsphase (z. B. als Trainee,<br />
Referendar/in, Volontär/in, Assistent/in), um das für den<br />
beruflichen Habitus konstitutive „Betriebswissen" zu<br />
vermitteln. Auch wenn der Betrieb keine expliziten<br />
Lernprozesse neben der Berufsausbildung und<br />
Weiterbildung organisiert, so verweist das Konzept des<br />
beruflichen Habitus auf mehr oder weniger lange<br />
berufliche Orientierungsphasen, die vor allem für die<br />
akademischen Professionen von Bedeutung sind.<br />
Als Leitmotiv der beruflichen <strong>Sozialisation</strong>sforschung<br />
ist nach Schumm (1982) die Fragestellung zu sehen, ob<br />
und wie Arbeitserfahrungen die Fähigkeiten zu<br />
selbstverantwortlichen Handeln stärken oder<br />
schwächen. Dabei stehen beruflichfachliche<br />
Qualifikationen und verinnerlichte normative<br />
Orientierungen in Bezug auf Arbeitsleistung,<br />
Zuverlässigkeit, Aufstieg, Kollegialität, Konflikt und<br />
Kooperation im Betrieb im Mittelpunkt. Im Hinblick<br />
auf die Einführung neuer Arbeitstechniken und<br />
Umstellungen in der Betriebsorganisation gewinnen<br />
Eigenverantwortung und die Bereitschaft zur<br />
Mitgestaltung von Arbeitsabläufen an Bedeutung.<br />
Bei der Untersuchung der <strong>Sozialisation</strong>seffekte<br />
beruflicher Arbeit sind drei Ebenen zu unterscheiden:<br />
• Welche Arbeitsanforderungen und<br />
-bedingungen sind überhaupt<br />
sozialisationsrelevant;<br />
• auf welche Weise wird die Identität bzw.<br />
Persönlichkeitsstruktur durch Arbeitserfahrung<br />
geprägt und<br />
• welche langfristig wirksamen<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesse gehen von der<br />
beruflichen Arbeit aus und inwieweit tragen sie<br />
zur Reproduktion des gesellschaftlichen<br />
Normen- und Wertesystems bei?<br />
Sie bilden den Rahmen für das Ausmaß an Akzeptanz<br />
bzw. Kritik von betrieblichen Herrschaftsstrukturen,<br />
Entscheidungsprinzipien und Arbeitsbelastungen. Zur<br />
Erfüllung konkreter Arbeitsaufgaben sind schließlich<br />
regulative Nonnen notwendig, die alltagssprachlich als<br />
„Arbeitstugenden", wie Disziplin, Gründlichkeit,<br />
Sorgfältigkeit und Übersicht, bezeichnet werden.<br />
Die technisch-organisatorischen Arbeitsanforderungen<br />
verweisen auf ein Bündel von Qualifikationen, die aus<br />
Kenntnissen, praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten<br />
zusammengesetzt sind. Die normativen Orientierungen<br />
beziehen sich auf subjektive Ansprüche, Erwartungen<br />
und Motivation, insbesondere das Ausmaß der inneren<br />
Verpflichtung der Berufstätigen bei der Erfüllung von<br />
Aufgabenstellung im Betriebszusammenhang. Die<br />
berufsbezogenen normativen Orientierungen sind in<br />
soziale Deutungsmuster eingelagert, die Vorstellungen<br />
über die gerechte Verteilung gesellschaftlicher<br />
Privilegien und materieller Ressourcen enthalten.<br />
Aus sozialisationstheoretischer Sicht stellt sich damit<br />
die Frage nach dem Verhältnis von Berufsarbeit und<br />
persönlicher Identität (Leithäuser & Heinz 1976).<br />
Entsprechend der Theorie des symbolischen<br />
Interaktionismus führen <strong>Sozialisation</strong>sprozesse nicht zu<br />
einer mechanischen Verinnerlichung von<br />
Handlungserwartungen, vielmehr wer<br />
den diese durch die Akteure interpretiert und mit ihrer<br />
Biographie in Verbindung gebracht. Dementsprechend<br />
schlagen sich auch restriktive Arbeitsbedingungen nicht<br />
in einer total angepassten Arbeitspersönlichkeit nieder.<br />
Auch bei begrenzten Handlungsspielräumen und<br />
anspruchslosen Tätigkeiten entwickeln die Arbeitenden<br />
Bewältigungsstrategien, die der Identitätsverteidigung<br />
dienen (Heinz 1982). Berufliche Anforderungen und<br />
Arbeitssituationen prägen also das Arbeitshandeln nicht<br />
direkt, sie sind durch berufliche <strong>Sozialisation</strong>sprozesse<br />
vermittelt und werden von den Beteiligten interpretiert.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 43
Das Bild vom Alter<br />
Verachtet, hoch geehrt, konfliktreich,<br />
beziehungslos<br />
Die neue Art von Berufstätigkeit der Jungen<br />
außerhalb der „Haushalte" hatte zur Folge,<br />
SN 2/02<br />
dass der unmittelbar sichtbare Beitrag der<br />
hat sich im Lauf der Zeit sehr gewandelt- und<br />
damit die Wert- oder Geringschätzung der<br />
Alten.. Keine Rede kann jedenfalls davon sein,<br />
dass die heutige Gesellschaft das Alter<br />
besonders gering schätzt oder dass die<br />
Übereinstimmung der Generationen verloren<br />
gegangen sei. Das traute Miteinander der<br />
Alten zur Produktion verloren ging. Eine<br />
staatliche Altersvorsorge war erst im Aufbau.<br />
Die Alten wurden zur Last. Paradoxerweise<br />
trugen dazu auch die Fortschritte der Medizin<br />
bei: Immer mehr Menschen überlebten bis ins<br />
hohe Alter- die Alten wurden mehr und mehr<br />
zu Pflegefällen.<br />
Generationen gab es so gut wie nie -und wenn<br />
doch, hatte es eher materielle denn<br />
romantische Gründe. Das wurde längst auch in<br />
sozialwissenschaftlichen Arbeiten belegt.<br />
Mit der Wende zum 20. Jahrhundert war es<br />
vorbei mit dem ehrfurchtsvollen Aufblicken<br />
der Jugend zum Alter. Jugendliche<br />
Verhaltensmaßstäbe - Leistung, Aktivität,<br />
Aggressivität setzten sich durch, der Status der<br />
Alten sank und sank. Die Einführung der<br />
Pensionsversicherung brachte zwar große<br />
Fortschritte in der sozialen Absicherung- das<br />
systematische und kollektive Ausscheiden<br />
ganzer Jahrgänge aus dem Berufsleben wurde<br />
aber bald mit Begriffen wie Entbehrlichkeit<br />
oder gar Nutzlosigkeit der Pensionisten<br />
verknüpft.<br />
Schlimm dürfte es den meisten Alten von der<br />
frühen Neuzeit bis ins 17. Jahrhundert<br />
gegangen sein. Damals wurden die<br />
Abgearbeiteten als nicht mehr vollwertige<br />
Mitglieder der Gesellschaft gesehen, folglich<br />
schlechter behandelt und an den Rand<br />
gedrängt. Der alte Mensch wurde jedenfalls in<br />
Europa verachtet. Kein Wunder, dass die<br />
Furcht vor dem Alter damals oft größer als die<br />
Furcht vor dem Tod war. Und als alt galt man<br />
einst schon mit 40 Jahren.<br />
An Ansehen gewann das Alter erst im 18.<br />
Jahrhundert. Hauptursache für den<br />
Prestigegewinn: In der landwirtschaftlich<br />
geprägten Gesellschaft hatte alle Macht und<br />
Verfügungsgewalt, wer Land und Hof besaß.<br />
Wer sich gegenüber den Eltern wohl verhielt,<br />
konnte damit rechnen, einen größeren Erbteil<br />
zu bekommen. Zu keiner Zeit - weder vorher<br />
noch nachher -erreichte die „Verehrung" der<br />
Alten ein derart großes Maß.<br />
Sehr lange währte diese Phase nicht. Zwar<br />
erfuhren die älteren Menschen auch im 19.<br />
Jahrhundert Wertschätzung, gleichzeitig<br />
wurde aber der Status der Jungen deutlich<br />
aufgewertet. Ende des 19. Jahrhunderts<br />
standen die Zeichen schließlich endgültig auf<br />
Generationenkonflikt: Dank der<br />
fortschreitenden Industrialisierung fanden die<br />
Jungen außerhalb des heimatlichen Hofes<br />
Arbeit und konnten unabhängig vom<br />
elterlichen Erbe Existenz und Familie gründen<br />
- die Eltern büßten Macht und<br />
Einflussmöglichkeit ein.<br />
Und heute? Die einen Wissenschafter sagen,<br />
das Verhältnis der Generationen sei Anfang<br />
des 21. Jahrhunderts eher von<br />
Beziehungslosigkeit denn von<br />
Konfliktreichtum gekennzeichnet, wobei sich<br />
immer mehr der "kompetente, selbstständige<br />
und selbstbestimmte ältere Mensch"<br />
herauskristallisiert. Andere Wissenschafter<br />
sagen, das Verhältnis der Generationen sei<br />
beziehungsvoller als früher, die gegenseitige<br />
Unterstützung funktioniere jedenfalls<br />
innerhalb der Familie sehr gut. Sowohl die<br />
Jungen als auch die Alten seien in einer Art<br />
"Solidaritätsdrehscheibe" Geber und Nehmer<br />
zugleich, kaum jemand bleibe im Notfall allein<br />
wobei die Älteren den Wohlstand der Jungen<br />
stützen, indem sie ihnen finanziell unter die<br />
Arme greifen (und zwar kräftig), während die<br />
Jungen den Älteren bei der Hausarbeit zur<br />
Hand gehen oder sie pflegen. Der große<br />
Schönheitsfehler: Zwar sind es (öfter) die<br />
Söhne, die elterliche Unterstützung<br />
entgegennehmen, es sind aber (meist) die<br />
Töchter, die sich mit Arbeit und Pflege<br />
bedanken. i.b.<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 44
Die „neuen Alten" - neue Freuden, neue Fragen<br />
Fröhlich, optimistisch, gesund, interessiert und konsumfreudig. Vor gar nicht langer Zeit wäre<br />
niemand auf die Idee gekommen, "die Alten" so zu charakterisieren. Unterdessen charakterisieren<br />
sich "die Alten" selbst so. Abwegig finden sie bloß, dass man sie als aalt" bezeichnet.<br />
Womit wir auch schon bei einem Paradoxon sind: Wer aus dem Berufsleben ausscheidet, wird sofort<br />
in die Schublade mit der Aufschrift „alt` gesteckt (manche stecken sich freilich kokett selbst hinein).<br />
Die Einteilung eines Lebens in bloß drei Phasen - Jugend, Erwerbszeit, Alter - mag vor gut 1V0<br />
Jahren gestimmt haben, als die Kindheit abrupt in Fabriken endete und die staatliche<br />
Altersversorgung für die Abgearbeiteten erst im Aufbau war. Anfang des 21. Jahrhunderts ist es aber<br />
höchste Zeit, sich eine neue Etikettierung für einen Lebensabschnitt auszudenken. der von der Lage<br />
am Arbeitsmarkt und den Regeln der Pensionsversicherung bestimmt wird. aber so gut wie nie von<br />
den körperlichen und geistigen Kräften der Betroffenen. Weshalb wir es eben längst nicht mehr mit<br />
„den Alten' zu tun haben, sondern mit mehreren Generationen von nicht mehr Jungen: Da sind die<br />
"neuen Alten" (viele von ihnen noch keine 60), dann sind da die "Älteren" (65 bis 70 und aufwärts),<br />
und erst viel später kommen wir zu jenen, die man vielleicht wirklich alt nennen kann.<br />
Bleiben wir kurz bei Letztgenannten: Die Zahl der 80- bis 90-jährigen hat sich seit den 50er Jahren<br />
verfünffacht, die Zahl der 90-Jährigen und Älteren hat sich verneunfacht. Dass der medizinische<br />
Fortschritt (an dem in Europa dankenswerterweise alle, unabhängig von ihrer Brieftasche, teilhaben<br />
können) seine Wirkung tat. ist hoch erfreulich. Gleichzeitig kündigt sich ein Engpass bei der<br />
Altenpflege an. Derzeit werden noch fast alle Alten (mehr als 90 Prozent) in der Familie - also in<br />
Wahrheit: von den Töchtern und Schwiegertöchtern gepflegt. Da anzunehmen ist, dass die Töchter<br />
und Schwiegertöchter demnächst selbst bis 65 berufstätig sein werden und noch mehr anzunehmen<br />
ist, dass die Söhne und Schwiegersöhne auch weiterhin kaum Bereitschaft zur Altenpflege innerhalb<br />
der Familie zeigen, wird es mit "Gratis"- Pflegern knapp.<br />
Das ist aber nur eines der Probleme, die sich beim Thema Alter auftun. Zwar bemüht sich die Politik<br />
oft redlich, Lösungen anzubieten (hochlöblich etwa die Einführung des Pflegegeldes: lobenswert<br />
auch die Karenz zur Sterbebegleitung, die demnächst kommen wird) - oft geht ihr aber auch der Mut<br />
aus. Und: So notwendig die nächste Pensionsreform ist allein mit ihr wird man die Fragen der neuen<br />
Generation nicht lösen können. Ihren Beitrag müssen auch die jungen Alten selbst leisten und wenn<br />
es bloß der ist, Körper und Geist so lange wie möglich fit zu erhalten und sich nicht in die<br />
Zuschauerloge zurückzuziehen.<br />
Inge Baldinger<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 45
Inhaltsverzeichnis:<br />
Soziologie / <strong>Sozialisation</strong>...................................................................................................................1<br />
Literatur:.............................................................................................................................................1<br />
<strong>Sozialisation</strong>: ......................................................................................................................................2<br />
Übersicht: .......................................................................................................................................2<br />
Zur Begriffsklärung....................................................................................................................2<br />
Schichtspezifische <strong>Sozialisation</strong> ................................................................................................2<br />
<strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit.....................................................................................................2<br />
Zur Begriffsklärung: Abgrenzung und Konkretisierung....................................................................3<br />
G. Wurzbacher: ..............................................................................................................................3<br />
Personalisation: ..........................................................................................................................3<br />
Andere Autoren sehen den <strong>Sozialisation</strong>sprozess unter anderen Gesichtspunkten ...................3<br />
H. Fend:..........................................................................................................................................3<br />
J. Wössner: .....................................................................................................................................4<br />
I.L. Child: .......................................................................................................................................4<br />
J. A. Clausen: .................................................................................................................................4<br />
T. Parsons:......................................................................................................................................4<br />
M. Mead: ........................................................................................................................................4<br />
Hilfen zur Begriffsklärung: ........................................................................................................4<br />
<strong>Sozialisation</strong> umfasst alle Einflüsse von außen,.........................................................................5<br />
„Mensch" und „Gesellschaft".............................................................................................................5<br />
Kulturspezifische Lebensalterphasen und <strong>Sozialisation</strong>sbedingungen eines lebenslangen<br />
<strong>Sozialisation</strong>sprozesses in der industriellen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland<br />
(Österreich)...............................................................................................................................10<br />
Soziologische Lebensaltersphasen ...........................................................................................10<br />
Soziales Feld, sozialisationsdominante Orientierungen und Rollenpartner.............................10<br />
Struktur einer elementaren <strong>Sozialisation</strong>ssequenz ...................................................................12<br />
Das labile Gleichgewicht der Ich-Identität...............................................................................14<br />
Ich - Identität ................................................................................................................................14<br />
Determinanten der Verfügbarkeit über soziale Rollen.............................................................15<br />
Klassifikationsschema für soziale Rollen (nach Dreitzel 1972: 140). .....................................16<br />
3.4. Der <strong>Sozialisation</strong>sprozess – Phasen nach T. Parsons................................................................18<br />
<strong>Sozialisation</strong>: ............................................................................................................................18<br />
Die erste Phase .............................................................................................................................19<br />
Die zweite Phase ..........................................................................................................................19<br />
Die dritte Phase ............................................................................................................................19<br />
Die vierte Phase............................................................................................................................20<br />
Die fünfte Phase ...........................................................................................................................20<br />
Klassen und soziale Schichten in westlichen Industriegesellschaften – neue<br />
Entwicklungstendenzen....................................................................................................................21<br />
Schichtspezifische <strong>Sozialisation</strong> / ....................................................................................................22<br />
milieuspezifische <strong>Sozialisation</strong> ........................................................................................................22<br />
Idealtypische Gegenüberstellung (Hartfiel /Holm: Erziehung in der modernen<br />
Industriegesellschaft) ...............................................................................................................22<br />
Allgem. Wertsystem.............................................................................................................22<br />
Dieser Sachverhalt wird in der Soziologie unter dem Stichwort „schichtspezifische<br />
<strong>Sozialisation</strong>" untersucht und diskutiert.......................................................................................23<br />
10.2. Schicht und Handlungskompetenz......................................................................................23<br />
Raum deutscher Sozialmilieus .........................................................................................................27<br />
Das Mentalitätsfeld der neuen sozialen Milieus ..............................................................................28<br />
Individualisierungsthese:..................................................................................................................29<br />
<strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit...........................................................................................................30<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 46
Belastungen im Kindesaster.........................................................................................................30<br />
Lebensbereich Familie: ............................................................................................................30<br />
Belastungen:.................................................................................................................................30<br />
Trennung der Eltern: ................................................................................................................30<br />
Materielle und immaterielle Deprivation:....................................................................................30<br />
Interaktionsqualität der Familie: ..................................................................................................31<br />
Außerfamiliärer Lebensbereich:...................................................................................................31<br />
Akut belastende Lebensereignisse. (für Kinder im Grundschulalter)..........................................31<br />
Zusammenhänge personaler und sozialer Belastungsfaktoren: ...............................................32<br />
Für gesunde Entwicklung von Kindern entscheidend:.............................................................32<br />
K. Hurrelmann: <strong>Sozialisation</strong> und Gesundheit.............................................................................32<br />
Jugendspezifische Risikofaktoren:...............................................................................................32<br />
Risikokonstellationen für gesundheitliche Beschwerden.........................................................33<br />
Belastungen im Erwachsenenalter: ..............................................................................................33<br />
1) Berufs- und Erwerbbereich..................................................................................................33<br />
2) Familien- und Freizeitbereich..............................................................................................33<br />
Berufsbezogene Risikofaktoren ...................................................................................................35<br />
Arbeitslosigkeit ........................................................................................................................35<br />
Auswirkungen belastender Ereignisse und Übergänge im Lebenslauf:...................................37<br />
Determinanten der Berufswahl: ...................................................................................................39<br />
Determinanten der Berufswahl.....................................................................................................40<br />
Berufswelt: ...................................................................................................................................40<br />
Individuum: ..................................................................................................................................40<br />
<strong>Sozialisation</strong> - Strukturmodell.....................................................................................................41<br />
Informationstheoretisches Modell der Berufswahl (Ries, Berufswahl) .......................................42<br />
3.4. Beruflicher Habitus ...............................................................................................................43<br />
Das Bild vom Alter ..........................................................................................................................44<br />
Die „neuen Alten" - neue Freuden, neue Fragen..........................................................................45<br />
Inhaltsverzeichnis:........................................................................................................................46<br />
Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 47