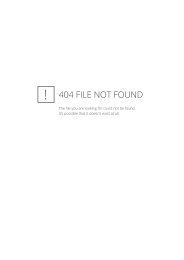Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
21<br />
25. 5. 2011<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong><br />
Bollettino dei medici svizzeri<br />
Bulletin des médecins suisses<br />
Editorial 781<br />
Zwischen Wirtschaftlichkeitsprüfung<br />
und Hausarztmedizin<br />
FMH 783<br />
Wie weit ist die Schweiz mit der Tabakprävention?<br />
Organisationen der Ärzteschaft 786<br />
Tschernobyl – Fukushima: ärztliche Verantwortung<br />
in der Atompolitik<br />
Standpunkt zur Masernepidemie 2011 814<br />
Impfkampagnen müssen vermehrt<br />
auf Adoleszenten fokussieren<br />
«Zu guter Letzt» von Jean Martin 826<br />
«Some records are impossible to break with<br />
a natural body» … Ja und?<br />
Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch<br />
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch<br />
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
FMH<br />
Editorial<br />
781 Zwischen Wirtschaftlichkeitsprüfung<br />
und Hausarztmedizin<br />
Ignazio Cassis<br />
Prävention<br />
783 Wie weit ist die Schweiz mit der Tabakprävention?<br />
Thomas Beutler, Nicolas Broccard,<br />
Verena El Fehri<br />
Im September findet in New York der UNO-Gipfel zu nicht<br />
übertragbaren Krankheiten statt, die Tabakkontrolle steht<br />
zuoberst auf der Prioritätenliste. Die Schweiz hat die ent-<br />
sprechende Konvention aus dem Jahr 2004 noch immer<br />
nicht ratifiziert. Was steht dem entgegen?<br />
785 Personalien<br />
Organisationen der Ärzteschaft<br />
PSR / IPPNW<br />
786 Tschernobyl – Fukushima:<br />
ärztliche Verantwortung in der Atompolitik<br />
Martin Walter, Günter Baitsch, Jacques Moser<br />
Fukushima sei nicht Tschernobyl, ist in vielen Medien im-<br />
mer wieder zu lesen. Doch die Autoren stellen die Frage,<br />
bei welchem Störfall die Folgen eigentlich gravierender<br />
sind. Es sei Zeit, endlich über Strategien des vorsorglichen<br />
Gesundheitsschutzes Entscheidungen zu fällen.<br />
Briefe / Mitteilungen<br />
789 Briefe an die SÄZ<br />
790 Facharztprüfungen /<br />
Mitteilungen<br />
FMH Services<br />
792 Seminare 2011<br />
FMH Services<br />
FMH Services<br />
798 Le bon diagnostic peut être<br />
une question de vie ou de mort<br />
FMH Consulting Services<br />
799 Zahlungseingang pünktlich<br />
FMH Factoring Services<br />
800 Etesvous bien conseillé(e)?<br />
FMH Fiduciaire Services<br />
801 Assurance responsabilité civile<br />
professionnelle<br />
FMH Insurance Services<br />
803 Stellen und Praxen<br />
Tribüne<br />
Standpunkt<br />
814 Impfkampagnen müssten vermehrt<br />
auf Adoleszenten fokussieren<br />
Markus Gassner<br />
Das aktuelle Impfkonzept sei ungenügend.<br />
Wolle man die Masern eliminieren, so reiche<br />
es nicht, «nur» Kleinkinder zu impfen, denn<br />
die höchste Erkrankungsrate gibt es<br />
bei den 15–19-Jährigen. Der Beitrag<br />
sagt, welche Massnahmen ergriffen<br />
werden müssten, um die Impfrate<br />
in dieser Altersklasse zu erhöhen.<br />
Tagungsbericht<br />
817 Médecines complémentaires<br />
à l’Université, pour les étudiants…<br />
et pour les professeurs<br />
Bertrand Graz<br />
INHALT<br />
Komplementärmedizin einmal unter einem anderen Blick-<br />
winkel: Stephen Ray Mitchell von der Georgetown Univer-<br />
sity in Washington D.C. beleuchtete bei einer Tagung der<br />
Universität Lausanne, welche Bedeutung sie für Lehrende<br />
und Studierende der Medizin haben kann.<br />
820 Spectrum
IMPRESSUM<br />
Horizonte<br />
Redaktion<br />
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli<br />
(Chefredaktor)<br />
Dr. med. Werner Bauer<br />
Dr. med. Jacques de Haller (FMH)<br />
PD Dr. med. Jean Martin<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Prof. Dr. med. Hans Stalder<br />
Dr. med. Erhard Taverna<br />
lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)<br />
Redaktion Ethik<br />
PD Dr. theol. Christina Aus der Au<br />
Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo<br />
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz<br />
Redaktion Medizingeschichte<br />
PD Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann<br />
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff<br />
Redaktion Ökonomie<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Redaktion Recht<br />
Fürsprecher Hanspeter Kuhn (FMH)<br />
Managing Editor<br />
Annette Eichholtz M.A.<br />
Delegierte der Fachgesellschaften<br />
Allergologie und Immunologie:<br />
Prof. Dr. A. Bircher<br />
Allgemeinmedizin: Dr. B. Kissling<br />
Anästhesiologie und Reanimation:<br />
Prof. P. Ravussin<br />
Angiologie: Prof. B. Amann-Vesti<br />
Arbeitsmedizin: Dr. C. Pletscher<br />
Chirurgie: Prof. Dr. M. Decurtins<br />
Dermatologie und Venerologie:<br />
PD Dr. S. Lautenschlager<br />
Endokrinologie und Diabetologie:<br />
Prof. Dr. G.A. Spinas<br />
Gastroenterologie: Prof. Dr. W. Inauen<br />
Geriatrie: Dr. M. Conzelmann<br />
Gynäkologie und Geburtshilfe:<br />
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Holzgreve<br />
Begegnung mit …<br />
821 «Ich bin immer noch demütig<br />
vor jeder Operation»<br />
Daniel Lüthi<br />
Er beginnt den Tag morgens früh um 5.00 Uhr – an der<br />
Orgel der Bieler Pasquart-Kirche: Urban Laffer, Chefarzt<br />
Chirurgie am Spitalzentrum Biel und Präsident des Ver-<br />
bandes chirurgisch und invasiv tätiger Ärztinnen und<br />
Ärzte der Schweiz (fmCh). Im Gespräch mit Daniel Lüthi<br />
gewährt er Einblicke in seine Arbeit, Ansichten und Pläne.<br />
Streiflicht<br />
824 Ludwik Fleck (1896–1961)<br />
Erhard Taverna<br />
Der Mikrobiologe Fleck gilt <strong>als</strong> Vordenker der Erkenntnis-<br />
theorie und Wissenschaftssoziologie. Schon im Jahr 1935<br />
veröffentlichte er eine seiner bedeutendsten Schriften, und<br />
sie ist noch immer aktuell. Der Beleg: An der Universität<br />
Zürich finden regelmässig «Fleck Lectures» statt.<br />
Redaktionssekretariat<br />
Margrit Neff<br />
Redaktion und Verlag<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: redaktion.saez@emh.ch<br />
Internet: www.saez.ch, www.emh.ch<br />
Herausgeber<br />
FMH, Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,<br />
Postfach 170, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
E-Mail: info@fmh.ch<br />
Internet: www.fmh.ch<br />
Herstellung<br />
Schwabe AG, Muttenz<br />
Marketing EMH<br />
Thomas Gierl M.A.<br />
Leiter Marketing und Kommunikation<br />
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: tgierl@emh.ch<br />
Hämatologie: Dr. M. Zoppi<br />
Handchirurgie: PD Dr. L. Nagy<br />
Infektologie: Prof. Dr. W. Zimmerli<br />
Innere Medizin: Dr. W. Bauer<br />
Intensivmedizin: Dr. C. Jenni<br />
Kardiologie: Prof. Dr. C. Seiler<br />
Kiefer- und Gesichtschirurgie:<br />
Dr. C. Schotland<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie: Dr. R. Hotz<br />
Kinderchirurgie: Dr. M. Bittel<br />
Medizinische Genetik: Dr. D. Niedrist<br />
Neonatologie: Prof. Dr. H.-U. Bucher<br />
Nephrologie: Prof. Dr. J.-P. Guignard<br />
Neurochirurgie: Prof. Dr. H. Landolt<br />
Neurologie: Prof. Dr. H. Mattle<br />
Neuropädiatrie: Prof. Dr. J. Lütschg<br />
Neuroradiologie: Prof. Dr. W. Wichmann<br />
Zu guter Letzt<br />
826 «Some records are impossible to break<br />
with a natural body» … Ja und?<br />
Jean Martin<br />
Es geht um Doping. Ist es ein essenti-<br />
eller Bestandteil des Leistungssports?<br />
Zu dieser Ansicht neigt der belgische<br />
Bioethiker Jean-Noël Missa. Doping ent-<br />
spreche durchaus dem Gedanken des<br />
Wettbewerbs, und die Anti-Doping-<br />
Praktik sei fragwürdig. Fragwürdig seien<br />
eher diese Thesen, findet Jean Martin.<br />
Anna<br />
Inserate<br />
Werbung<br />
Ariane Furrer, Assistentin Inserateregie<br />
Tel. 061 467 85 88, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: afurrer@emh.ch<br />
«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»<br />
Matteo Domeniconi, Inserateannahme<br />
Stellenmarkt<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: stellenmarkt@emh.ch<br />
«Stellenvermittlung»<br />
FMH Consulting Services<br />
Stellenvermittlung<br />
Postfach 246, 6208 Oberkirch<br />
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86<br />
E-Mail: mail@fmhjob.ch<br />
Internet: www.fmhjob.ch<br />
Abonnemente<br />
FMH-Mitglieder<br />
FMH Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte<br />
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
Nuklearmedizin: Prof. Dr. J. Müller<br />
Onkologie: Prof. Dr. B. Pestalozzi<br />
Ophthalmologie: Dr. A. Franceschetti<br />
ORL, H<strong>als</strong>- und Gesichtschirurgie:<br />
Prof. Dr. J.-P. Guyot<br />
Orthopädie: Dr. T. Böni<br />
Pädiatrie: Dr. R. Tabin<br />
Pathologie: Prof. Dr. G. Cathomas<br />
Pharmakologie und Toxikologie:<br />
Dr. M. Kondo-Oestreicher<br />
Pharmazeutische Medizin: Dr. P. Kleist<br />
Physikalische Medizin und Rehabilitation:<br />
Dr. M. Weber<br />
Plast.-Rekonstrukt. u. Ästhetische Chirurgie:<br />
Prof. Dr. P. Giovanoli<br />
Pneumologie: Prof. Dr. E. Russi<br />
INHALT<br />
EMH Abonnemente<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Abonnemente, Postfach, 4010 Basel<br />
Tel. 061 467 85 75, Fax 061 467 85 76<br />
E-Mail: abo@emh.ch<br />
Jahresabonnement: CHF 320.–,<br />
zuzüglich Porto<br />
© 2011 by EMH <strong>Schweizerische</strong>r<br />
Ärzteverlag AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Nachdruck, elektronische<br />
Wiedergabe und Übersetzung, auch<br />
auszugsweise, nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlages gestattet.<br />
Erscheint jeden Mittwoch<br />
ISSN 0036-7486<br />
ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)<br />
Prävention und Gesundheitswesen:<br />
Dr. C. Junker<br />
Psychiatrie und Psychotherapie:<br />
Dr. G. Ebner<br />
Radiologie: Prof. Dr. B. Marincek<br />
Radioonkologie: Prof. Dr. D. M. Aebersold<br />
Rechtsmedizin: Prof. T. Krompecher<br />
Rheumatologie: Prof. Dr. M. Seitz<br />
Thorax-, Herz- und Gefässchirurgie:<br />
Prof. Dr. T. Carrel<br />
Tropen- und Reisemedizin: PD Dr. C. Hatz<br />
Urologie: PD Dr. T. Zellweger
Editorial FMH<br />
Wirtschaftlichkeitsprüfung<br />
und Hausarztmedizin<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Im Jahr 2007 macht die Überprüfung<br />
der Wirtschaftlichkeit<br />
Schlagzeilen: Ein Entscheid<br />
des Bundesgerichts<br />
verlangt von der Ärzteschaft<br />
die Rückzahlung der Vergütungen<br />
für Leistungen,<br />
wenn deren Wirtschaftlichkeit<br />
nicht gegeben ist – unabhängig<br />
davon, ob es sich um<br />
direkte oder indirekte Kosten<br />
handelt. Gemäss Art. 56 Abs. 1<br />
und 2 KVG muss sich der Leistungserbringer in seinen Leistungen<br />
auf das Mass beschränken, das im Interesse des Versicherten<br />
liegt und für den Behandlungszweck erforderlich<br />
ist. Für Leistungen, die über dieses Mass hinausgehen, kann<br />
die Vergütung verweigert werden, und der Versicherer kann<br />
die Rückzahlung von zu Unrecht bezahlten Vergütungen<br />
verlangen. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde von der<br />
Die Notwendigkeit der Kontrollen<br />
hat die Ärzteschaft nie angezweifelt,<br />
beanstandet haben wir indessen<br />
die Überprüfungsmethode.<br />
Ärzteschaft oft kritisiert: Schlecht aufgenommen wurden<br />
insbesondere die intransparente Methode der Versicherer<br />
und deren Haltung gegenüber den Ärzten.<br />
Die Notwendigkeit der Kontrollen hat die Ärzteschaft<br />
nie angezweifelt. Beanstandet haben wir indessen die Überprüfungsmethode,<br />
insbesondere nach der Einführung der<br />
ANOVAMethode. Vor allem die Hausärzte wiesen auf die<br />
Gefahr hin, dass Patienten mit schweren und komplexen<br />
chronischen Krankheiten, die sehr hohe Kosten verursachen,<br />
nicht mehr behandelt werden können. Diese Befürchtung<br />
war Teil eines allgemeinen Unbehagens der<br />
Grundversorger, das ab 2006 wiederholt zum Ausdruck gebracht<br />
wurde.<br />
Um dieses Problem zu lösen, habe ich am 5. Oktober<br />
2007 im Hinblick auf eine Änderung der Spielregeln eine<br />
parlamentarische Initiative eingereicht (07.485). Zur Unterstützung<br />
meines Vorstosses reichten die Nationalrätinnen<br />
Thérèse Meyer (07.484) und Bea Heim (07.483) ähnliche<br />
Initiativen ein. Wir wollen mit einer Verbesserung des Ver<br />
fahrens für die Wirtschaftlichkeitsprüfung die Hausärzte<br />
unterstützen. Nach vier Jahren und vielen Diskussionen<br />
wird unser Vorstoss nun in den Gesundheitskommissionen<br />
der beiden Räte von einer Mehrheit unterstützt, so dass in<br />
der nächsten Sommersession darüber beraten werden kann.<br />
Bei einer Annahme wird er ab dem 1. Januar 2012 im KVG<br />
verankert sein.<br />
Anschliessend haben die Leistungserbringer und die Versicherer<br />
zwölf Monate Zeit, um gemeinsam eine Methode<br />
für die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Leistungen<br />
festzulegen, die für die ganze Schweiz gilt. Die Versicherer<br />
müssen somit ihre Berechnungsmodelle zur Diskussion stellen<br />
und die verschiedenen Phasen des Verfahrens definieren.<br />
Falls nach zwölf Monaten keine Einigung erzielt werden<br />
kann, wird voraussichtlich der Bundesrat entscheiden.<br />
Mit dieser Änderung soll eine qualitative Kontrolle der<br />
Wirtschaftlichkeit der Leistungen des betreffenden Arztes<br />
eingeführt werden, welche die Morbidität all seiner Patientinnen<br />
und Patienten berücksichtigt. Art. 56 KVG wird mit<br />
einem neuen Absatz 6 ergänzt: «Versicherer und Leistungserbringer<br />
legen vertraglich eine Methode zur Kontrolle der<br />
Wirtschaftlichkeit fest.» Diese Gesetzesänderung steht im<br />
Zur Unterstützung der Rolle der Hausärzte streben wir mit drei parlamentarischen<br />
Initiativen eine Änderung der Spielregeln an.<br />
Wirtschaftlichkeitsprüfung:<br />
Zu berücksichtigen ist die Morbidität<br />
aller Patientinnen und Patienten.<br />
Einklang mit aktuellen Entscheiden des Bundesgerichts, in<br />
denen sich dieses kritisch zur derzeit geltenden Überprüfungsmethode<br />
geäussert hat. Dieser kleine Gesetzesartikel ist<br />
ein grosser Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
der selbständigen Ärzte, insbesondere der Grundversorger.<br />
Wir warten daher ungeduldig auf das letzte Wort des Parlaments!<br />
Dr. med. Ignazio Cassis,<br />
Vizepräsident der FMH und Nationalrat<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
781
Prävention FMH<br />
Welttag ohne Tabak vom 31. Mai<br />
Wie weit ist die Schweiz mit der Tabakprävention?<br />
Thomas Beutler a ,<br />
Nicolas Broccard b ,<br />
Verena El Fehri a<br />
a Arbeitsgemeinschaft<br />
Tabakprävention Schweiz,<br />
Bern<br />
b Wissenschaftsjournalist, Bern<br />
Korrespondenz:<br />
Verena El Fehri<br />
Geschäftsführerin<br />
Arbeitsgemeinschaft<br />
Tabakprävention Schweiz AT<br />
Haslerstrasse 30<br />
CH-3008 Bern<br />
Tel. 031 599 10 20<br />
Fax 031 599 10 35<br />
info@at-schweiz.ch<br />
www.at-schweiz.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Als Thema des Welttags ohne Tabak 2011 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO<br />
die internationale Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle bestimmt. Die Schweiz<br />
hat die Konvention 2004 unterzeichnet, bisher aber nicht ratifiziert. Hindernis für<br />
eine Ratifizierung ist vor allem das fehlende Verbot von Werbung, Promotion und<br />
Sponsoring für Tabakprodukte.<br />
Die WHO-Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle<br />
enthält die Grundsätze, die im 21. Jahrhundert die<br />
globale Verbreitung des Tabaks und der Tabakwaren<br />
lenken sollen. Die Konvention trat 2005 in Kraft. Bis<br />
jetzt haben sie 172 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation<br />
ratifiziert. Wie die Grundsätze umzusetzen<br />
sind, wird in den Richtlinien zu einzelnen<br />
Artikeln festgelegt. Bei den Verhandlungen hat die<br />
Schweiz bloss Beobachterstatus. Die Vertragsparteien<br />
haben bereits mehrere Richtlinien verabschiedet, unter<br />
anderem zu Werbung, Promotion und Sponsoring<br />
(Art. 13), Schutz vor Passivrauchen (Art. 8), Verpackung<br />
und Etikettierung (Art. 11), Schutz vor den Interessen<br />
der Tabakindustrie (Art. 5.3), Information (Art. 12) und<br />
Verminderung der Nachfrage (Art. 14).<br />
Werbung, Promotion, Sponsoring<br />
Die (von der Tabakindustrie unabhängige) Forschung<br />
hat eindeutige Resultate ergeben:<br />
– Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring für<br />
Tabakwaren erhöhen den Tabakkonsum.<br />
– Ein umfassendes Verbot derartiger Aktivitäten<br />
senkt den Konsum.<br />
Die entsprechenden Richtlinien verlangen ohne Ausnahme<br />
ein Verbot aller Aktivitäten, die direkt oder indirekt<br />
den Tabakkonsum fördern. In der Schweiz ist auf<br />
nationaler Ebene nur Werbung in Radio und Fernsehen<br />
sowie Werbung, die sich speziell an Jugendliche unter<br />
18 Jahren richtet, untersagt. Hinzu kommen zusätzliche<br />
Einschränkungen in 14 Kantonen. Solche Verbote<br />
in Teilbereichen haben meist zur Folge, dass die Tabakfirmen<br />
ihre Werbeaktivitäten auf andere Teilbereiche<br />
verlagern. Verkaufsförderung und Sponsoring sind in<br />
der Schweiz grösstenteils unbeschränkt möglich.<br />
Einzig ein Verbot, das alle Bereiche einschliesst,<br />
trägt wirksam zur Senkung des Tabakkonsums bei. In<br />
Europa kennen bereits Norwegen, Irland, Grossbritannien<br />
(ab Oktober 2011) und Finnland (ab Januar<br />
2012) ein umfassendes Verbot, das auch für Werbung<br />
und Auslage an den Verkaufsstellen gilt.<br />
Passivrauchen<br />
Jährlich sterben in der Schweiz ungefähr 1000 Personen<br />
vorzeitig an den Folgen des Passivrauchens. Um<br />
Zusammenfassung<br />
Die WHO-Rahmenkonvention über die Tabakkontrolle<br />
enthält die Grundsätze, die im 21. Jahrhundert die<br />
globale Verbreitung des Tabaks und der Tabakwaren<br />
lenken sollen. Zu den wirksamen <strong>als</strong> auch kosten-<br />
günstigen Massnahmen, um den Tabakkonsum zu<br />
senken, zählen unter anderem ein umfassendes Ver-<br />
bot aller Werbeformen für Tabak und Gesetze für<br />
rauchfreie Lebenswelten. Die Schweiz hat die Kon-<br />
vention 2004 unterzeichnet, bisher aber nicht ratifi-<br />
ziert. Hindernis für eine Ratifizierung ist vor allem<br />
das fehlende Verbot von Werbung, Promotion und<br />
Sponsoring für Tabakprodukte. Verkaufsförderung<br />
und Sponsoring sind in der Schweiz grösstenteils un-<br />
beschränkt möglich. Auch hinsichtlich des Schutzes<br />
vor Passivrauchen enthält das Bundesgesetz zum<br />
Schutz vor Passivrauchen grosse Lücken. Für einen<br />
vollständigen Schutz reichte im Mai 2010 die Allianz<br />
«Schutz vor Passivrauchen», in der auch die Verbin-<br />
dung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH ver-<br />
treten ist, eine eidgenössische Volksinitiative ein.<br />
Vom 19. bis 20. September 2011 findet in New York<br />
der UNO-Gipfel zu nicht übertragbaren Krankheiten<br />
statt. In einem Aufruf in «The Lancet» haben über<br />
vierzig Expertinnen und Experten aus der ganzen<br />
Welt die Tabakkontrolle zuoberst auf die Prioritäten-<br />
liste des UNO-Gipfels gesetzt. Als Ziel für 2040 for-<br />
dern sie, dass weniger <strong>als</strong> 5 Prozent aller Menschen<br />
Tabak konsumieren.<br />
Krankheit, Invalidität und Tod durch Passivrauchen<br />
zu senken, fordern die Richtlinien strenge Massnahmen<br />
zum Schutz vor Passivrauchen:<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
783
Prävention FMH<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
– Nur hundertprozentig rauchfreie Innenräume ermöglichen<br />
einen wirksamen Schutz. Andere Massnahmen<br />
wie Lüftungsanlagen oder Rauchzonen<br />
sind erwiesenermassen unwirksam.<br />
– Alle Menschen sind vor Passivrauchen zu schützen.<br />
Alle Arbeitsplätze in Innenräumen und alle<br />
öffentlich zugänglichen Innenräume müssen<br />
rauchfrei sein.<br />
– Für den Schutz vor Passivrauchen sind Gesetze<br />
notwendig. Freiwillige Selbstbeschränkungen,<br />
wie von der Tabakindustrie bevorzugt, haben sich<br />
wiederholt <strong>als</strong> unwirksam herausgestellt.<br />
In Europa schreiben 18 Länder einen strengen Schutz<br />
vor Passivrauchen vor. Die Schweiz gehört noch nicht<br />
zu diesen Ländern. Das Bundesgesetz zum Schutz vor<br />
Passivrauchen erlaubt das Rauchen an Einzelarbeitsplätzen<br />
und gestattet in der Gastronomie Rauchräume<br />
mit Bedienung und Rauchbetriebe. Verschiedene<br />
Kantone haben weitergehende Vorschriften <strong>als</strong><br />
der Bund beschlossen.<br />
Eidgenössische Volksinitiative<br />
Die Allianz «Schutz vor Passivrauchen», in der auch<br />
die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte<br />
FMH vertreten ist, reichte im Mai 2010 eine Volksinitiative<br />
ein. Diese will die Lücken des Bundesgesetzes<br />
schliessen:<br />
– Alle Arbeitsplätze in Innenräumen sind rauchfrei.<br />
– Ebenso sind in der Regel öffentlich zugängliche<br />
Räume inklusive Restaurations- und Hotelbetriebe<br />
rauchfrei.<br />
– In der ganzen Schweiz soll die gleiche Regelung<br />
gelten. So schafft die Initiative einheitliche Bedingungen<br />
für alle Gastwirtinnen und Gastwirte<br />
sowie alle Gäste.<br />
Im November 2010 entschied der Bundesrat, die<br />
Volksinitiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. In<br />
der Botschaft an das Parlament von März 2011<br />
schreibt er, «die derzeitige Gesetzgebung reicht aus,<br />
um die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
und der Bevölkerung zu schützen». Dies ist<br />
unzutreffend, besonders in bedienten Rauchräumen<br />
und Rauchbetrieben sind die Beschäftigten dem Passivrauchen<br />
schutzlos ausgeliefert. Zudem will der Bundesrat<br />
zuerst «Erfahrungen sammeln» und daraus «Lehren<br />
ziehen». Das ist unnötig. Die Auswertungen der<br />
Erfahrungen aus unzähligen Ländern laufen stets auf<br />
dieselbe Schlussfolgerung hinaus: Allein in vollständig<br />
rauchfreien Innenräumen ist ein wirksamer<br />
Schutz vor Passivrauchen garantiert.<br />
Rauchstopp-Wettbewerb 2011<br />
Die effizienteste Massnahme, um die durch das Rauchen verursachte Sterblichkeit zu<br />
senken, ist die Erhöhung der Anzahl von Rauchern, die den Tabakkonsum aufgeben.<br />
Dazu führt das Nationale Rauchstopp-Programm jährlich zum Welttag ohne Tabak<br />
den Rauchstopp-Wettbewerb durch. Teilnehmen können alle Raucherinnen und<br />
Raucher, die vom 4. Juni bis zum 4. Juli 2011 eine Rauchpause einschalten. Anmeldung<br />
und Bestellung von Unterlagen bei der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention<br />
auf www.at-schweiz.ch oder unter Nummer 031 599 10 20.<br />
Verpackung<br />
Gerade Raucherinnen und Raucher unterschätzen<br />
häufig die Gesundheitsrisiken des Tabakkonsums.<br />
Unmissverständliche Warnhinweise auf Tabakpackungen<br />
erhöhen nachweislich die Aufmerksamkeit<br />
für die Risiken und die Bereitschaft zum Rauchstopp.<br />
Die in der Schweiz vorgeschriebenen Warnhinweise<br />
mit Bild und Text entsprechen der EU-Richtlinie<br />
von 2001 über Herstellung, Aufmachung und Verkauf<br />
von Tabakprodukten. Die Richtlinie wird zurzeit<br />
überarbeitet. In der Vernehmlassung haben Nichtregierungsorganisationen<br />
sich unter anderem eingesetzt<br />
für Einheitspackungen ohne Werbung. Als erstes Land<br />
plant Australien Einheitspackungen auf Juli 2012 einzuführen.<br />
Interessen der Tabakindustrie<br />
Jede Art des Tabakkonsums macht süchtig und verursacht<br />
Krankheit und Tod. Wirksame Massnahmen zur<br />
Tabakprävention und -kontrolle lösen einen Rückgang<br />
des Tabakkonsums aus. Aber die Tabakindustrie lehnt<br />
wirksame Präventionsmassnahmen ab. Stattdessen ist<br />
sie bestrebt, möglichst viele Tabakwaren zu verkaufen<br />
und einen möglichst hohen Gewinn zu erwirtschaften.<br />
Folglich besteht zwischen den Interessen von<br />
Public Health und den Interessen der Tabakindustrie<br />
ein grundlegender und unversöhnlicher Konflikt. Bei<br />
der Ratifizierung der Rahmenkonvention muss sich<br />
deshalb jede Vertragspartei verpflichten, die Massnahmen<br />
zur Tabakkontrolle vor den Interessen der<br />
Tabakindustrie zu schützen.<br />
UNO-Gipfel über nicht übertragbare Krankheiten<br />
Weltweit sterben heute an den Folgen des Tabakkonsums,<br />
gemäss Schätzungen der WHO, jährlich fünf<br />
Millionen Menschen. Wird die Tabakepidemie nicht<br />
gestoppt, werden es im Jahr 2030 acht Millionen<br />
Menschen sein.<br />
Vom 19. bis 20. September 2011 findet in New<br />
York der UNO-Gipfel über nicht übertragbare Krankheiten<br />
statt. In einem Aufruf in «The Lancet» haben<br />
über vierzig Expertinnen und Experten aus der ganzen<br />
Welt die Tabakkontrolle zuoberst auf die Prioritätenliste<br />
des UNO-Gipfels gesetzt. Nötig sei die volle<br />
Umsetzung der WHO-Rahmenkonvention [1]. Als<br />
Ziel für 2040 wird im Aufruf gefordert, dass weniger<br />
<strong>als</strong> 5 Prozent aller Menschen Tabak konsumieren; in<br />
der Schweiz rauchen heute mehr <strong>als</strong> 25 Prozent der<br />
Bevölkerung. Zu den wirksamen <strong>als</strong> auch kostengünstigen<br />
Massnahmen, um den Tabakkonsum zu senken,<br />
zählen die Expertinnen und Experten hohe Tabaksteuern,<br />
gesetzlich vorgeschriebene Warnhinweise,<br />
Gesetze für rauchfreie Lebenswelten und ein umfassendes<br />
Verbot aller Werbeformen für Tabak.<br />
1 Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams C, Alleyne G,<br />
Asaria P. Priority actions for the non-communicable<br />
disease crisis. The Lancet. 2011; 377:1438–47.<br />
Mehr zur WHO-Rahmenkonvention siehe www.who.<br />
int/fctc/en<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 784
Personalien<br />
Todesfälle / Décès / Decessi<br />
André Nauer (1925), † 27.4.2011,<br />
Facharzt für Dermatologie und Venerologie,<br />
6045 Meggen<br />
Praxiseröffnung /<br />
Nouveaux cabinets médicaux /<br />
Nuovi studi medici<br />
BE<br />
Hannes Balmer,<br />
Facharzt für Innere Medizin,<br />
Hauptstrasse 43, 3800 Unterseen<br />
Judith Balmer-Gysin,<br />
Fachärztin für Innere Medizin,<br />
Hauptstrasse 43, 3800 Unterseen<br />
LU<br />
Bernward Heinrich Mölle,<br />
Facharzt für Chirurgie,<br />
Zinggentorstrasse 1A, 6006 Luzern<br />
VD<br />
Rachel Voellinger-Pralong,<br />
Spécialiste en prévention et santé publique et<br />
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,<br />
Le Bourg 11, 1610 Oron-la-Ville<br />
ZH<br />
Rita Spalinger-Scherrer,<br />
Fachärztin für Gynäkologie<br />
und Geburtshilfe,<br />
Am Schanzengraben 15, 8002 Zürich<br />
Aargauischer Ärzteverband<br />
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband<br />
haben sich <strong>als</strong> ordentliche praktizierende<br />
Mitglieder angemeldet:<br />
Dr. med. Hartmut Bauer, D-Baltmanssweiler,<br />
Praktischer Arzt, Praxiseröffnung in Boswil<br />
am 17. Juni 2011<br />
Dr. med. Ute Dahm, Basel, Fachärztin für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Leitende<br />
Ärztin in der Klinik Schützen, Rheinfelden,<br />
seit 2004<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Dr. med. Christoph Fux, Spiegel, Facharzt für<br />
Innere Medizin FMH, Facharzt für Infektiologie<br />
FMH, Chefarzt am Kantonsspital Aarau<br />
AG seit 1. März 2011<br />
Dr. med. Zsolt Hernadi, Oberurnen, Praktischer<br />
Arzt FMH. Praxiseröffnung in Kirchleerau-<br />
Mooslerau am 1. August 2011<br />
Cornel Stöckli, Zürich, Facharzt für Innere Medizin<br />
FMH, Praxis in Bremgarten seit 1. Mai<br />
2011<br />
Als Assistenz- und Oberarzt-Mitglied hat sich<br />
angemeldet:<br />
Dr. med. Lukas Schlatter, Waltenschwil, Facharzt<br />
für Innere Medizin FMH, Facharzt für<br />
Pneumologie FMH, Oberarzt in der Klinik<br />
Barmelweid<br />
Diese Kandidaturen werden in Anwendung<br />
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen<br />
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen<br />
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung<br />
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung<br />
des Aargauischen Ärzteverbandes<br />
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist<br />
entscheidet die Geschäftsleitung<br />
über Gesuch und allfällige Einsprachen.<br />
Ärztegesellschaft des Kantons Bern<br />
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio<br />
Zur Aufnahme <strong>als</strong> ordentliche Mitglieder<br />
haben sich angemeldet:<br />
Ruta Edelmann, Fachärztin für Psychiatrie und<br />
Psychotherapie FMH, prakt. Ärztin FMH,<br />
Oberstrasse 8, 3550 Langnau (ab 1.8.2011<br />
Mottastrasse 31, 3005 Bern)<br />
Folkert Maecker, Facharzt für Allgemeine Innere<br />
Medizin FMH, prakt. Arzt FMH, Ärztezentrum<br />
Jegenstorf, Bernstr. 12, 3303 Jegenstorf<br />
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen<br />
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung<br />
schriftlich und begründet beim Präsidenten<br />
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern<br />
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der<br />
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über<br />
die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen<br />
Einsprachen.<br />
Ärztegesellschaft<br />
des Kantons Luzern<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
FMH<br />
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion<br />
Stadt haben sich angemeldet:<br />
Dr. med. Jörg Eimers, Facharzt für Allgemeinmedizin<br />
FMH, ab 1. Juli 2011: CSS Versicherungen<br />
AG, Tribschenstrasse 21, 6002 Luzern<br />
Dr. med. Claudia Hirschi, Fachärztin für Gastroenterologie<br />
FMH, Luzerner Kantonsspital,<br />
6000 Luzern 16. Ab 1. August 2011: Gastropraxis<br />
Luzern GmbH, Hirschengraben 33,<br />
6003 Luzern<br />
Dr. med. Martin Keller, Facharzt für Psychiatrie<br />
und Psychotherapie FMH, Grendel 6/15,<br />
6004 Luzern<br />
Einsprachen sind innert 20 Tagen zu richten<br />
an das Sekretariat, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern,<br />
Fax 041 410 80 60<br />
Ärztegesellschaft Thurgau<br />
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau<br />
hat sich angemeldet:<br />
Dr. med. Ralf Florian, Facharzt für Innere Medizin,<br />
Frauenfeld<br />
Einsprachen gegen die Aufnahme sind innerhalb<br />
von 10 Tagen seit der Publikation beim<br />
unterzeichneten Sekretariat schriftlich zu erheben.<br />
Unterwaldner Ärztegesellschaft<br />
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft<br />
hat sich <strong>als</strong> ordentliches Mitglied<br />
angemeldet:<br />
Prof. Dr. med. Markus Pfister, HNO Facharzt,<br />
Ennetriederstrasse 20, 6060 Sarnen. Er übernimmt<br />
am 1.8.2011 die Praxis von Dr. Hug.<br />
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit<br />
Begründung innert 20 Tagen nach der Publikation<br />
dem Präsidenten des Verbandes einzureichen.<br />
Sekretariat Unterwaldner Ärztegesellschaft,<br />
Dr. med. Bettina Mende.<br />
785
PSR / IPPNW ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Tschernobyl – Fukushima:<br />
ärztliche Verantwortung in der Atompolitik<br />
Martin Walter,<br />
Günter Baitsch,<br />
Jacques Moser<br />
Für den Vorstand Physicians for<br />
Social Responsibility (PSR) und<br />
International Physicians for the<br />
Prevention of Nuclear War<br />
(IPPNW) Schweiz<br />
Korrespondenz:<br />
Dr. med. Martin Walter<br />
PSR/IPPNW Schweiz<br />
Winkelriedstrasse 64<br />
CH-6003 Luzern<br />
sekretariat@ippnw.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
«Soll die Medicin daher ihre grosse Aufgabe wirklich<br />
erfüllen, so muss sie in das grosse politische Leben<br />
eingreifen; sie muss die Hemmnisse angeben, welche<br />
der normalen Erfüllung der Lebensvorgänge im Wege<br />
stehen, und ihre Beseitigung erwirken.»<br />
(Rudolf Virchow [1])<br />
Ionisierende Strahlung erzeugt maligne Tumoren und<br />
genetische Schäden. Das ist bekannt. Weniger bekannt<br />
ist, dass Strahlenbelastungen auch transgenetisch<br />
schädlich sein können. Kinder von Eltern, die<br />
vor der Zeugung bestrahlt wurden, können Tumoren<br />
und Genschäden aufweisen [2, 3]. Dafür sprechen<br />
viele Indizien auch molekular-biologischer Natur [4].<br />
Teratogenese, Totgeburten und Genominstabilität in<br />
den Folgegenerationen sind auf diesem Gebiet weitere<br />
Themen [5]. Im folgenden Beitrag wollen wir<br />
auf einige spezifische, für Ärzte besonders wichtige<br />
Aspekte hinweisen. Es ist Zeit, nach der Havarie von<br />
Fukushima die Debatte über ionisierende Strahlung<br />
in der Ärzteschaft wieder aufzunehmen.<br />
Die Freisetzung von Reaktormaterial in<br />
die Biosphäre<br />
Ein Reaktorunfall setzt im Falle einer Kernschmelze<br />
in der Regel einen mehr oder weniger grossen Teil des<br />
radioaktiven Reaktorinventars frei. So ist es geschehen<br />
in Tschernobyl und erneut in Fukushima Daiichi<br />
in Japan. Dort hat zwar beim Erdbeben die Reaktornotabschaltung<br />
funktioniert, die Reaktoren sind aber<br />
wegen der Erderschütterung alle in den Inselbetrieb<br />
übergegangen, das heisst, sie haben den Anschluss<br />
ans Stromnetz verloren. Die Notkühlsysteme sind<br />
zum Teil angesprungen, Batterien und Dieselmotoren<br />
haben über angeschlossene Generatoren Strom für<br />
die Kühlpumpen geliefert; die Motoren wurden dann<br />
aber durch den Tsunami abgewürgt.<br />
In abgeschalteten Reaktoren fällt die Energieproduktion<br />
nicht auf null, obschon die Kettenreaktion<br />
gestoppt ist. Die zerfallenden Spaltprodukte in<br />
den Brennstäben produzieren weiterhin Wärme. Der<br />
Reaktorkern muss wegen dieses Zerfallsprozesses, der<br />
zur Produktion der Nachzerfallswärme führt, über<br />
sehr lange Zeit gekühlt werden. Dadurch soll verhindert<br />
werden, dass er zu glühen beginnt, ja sogar<br />
schmilzt, was zu einer erneuten, unkontrollierbaren<br />
Kettenreaktion und einer exzessiven Energieexkursion<br />
führen könnte. Der schmelzende Kern kann<br />
durch die Stahlhülle des Reaktorbehälters dringen,<br />
oder durch den Betonboden des Containments und<br />
mit Grundwasser in Berührung kommen, was zu<br />
einer Dampfexplosion führen kann und zur Freisetzung<br />
des ganzen Reaktorinventars. Dies entspricht<br />
einem Super-GAU.<br />
Bei einer Zerstörung des Sicherheitsbehälters oder<br />
bei einer Leckage im Dampf- und Wasserkreislauf<br />
nach Kernschmelze (wie in Fukushima in mehreren<br />
Reaktoren) werden zuerst gasförmige Stoffe, zum<br />
Beispiel Edelgase wie Krypton und Xenon, freigesetzt,<br />
ebenfalls leicht flüchtige Stoffe wie Iodisotope,<br />
137 Cäsium und 134 Cäsium. Weniger flüchtige Stoffe,<br />
90 Strontium, Uranisotope und Transurane wie 239 Plutonium<br />
liegen <strong>als</strong> Partikel (Aerosole) vor, oder sind an<br />
Staubteilchen gebunden. Ob von diesen Stoffen das<br />
gesamte im Reaktor enthaltene Inventar oder nur<br />
Teile freigesetzt werden und wie weit diese transportiert<br />
werden, hängt vom Verlauf der Kernschmelze<br />
und von den meteorologischen Bedingungen ab. In<br />
Fukushima wurde Plutonium in der Umgebung der<br />
Reaktoren gemessen. Anzunehmen ist deshalb, dass<br />
auch 90 Strontium, Transurane und weitere Isotope<br />
freigesetzt wurden.<br />
«Es gibt keine Toleranz des Organismus für ionisierende Strahlung.<br />
Jede Strahlung kann einen Krebs auslösen oder eine Schädigung des<br />
Genoms bewirken.»<br />
Jedes Isotop hat seine eigene Pharmakokinetik.<br />
Bei Mensch und Wirbeltieren verhalten sich 137 Cäsium<br />
und 134 Cäsium wie Kalium. Sie gelangen in alle<br />
Zellen. Die Muskelmasse ist beim Menschen besonders<br />
gross, weshalb Cäsium zum grossen Teil dort aufgenommen<br />
wird, so auch in der Herzmuskulatur.<br />
Bandashewski beschrieb eine Kardiomyopathie [6]<br />
bei Kindern in Weissrussland in der Folge des Reaktorunfalls<br />
von Tschernobyl.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
786
PSR / IPPNW ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
90 Strontium verhält sich im Stoffwechsel wie Calcium.<br />
Es ist sehr «knochenavid». Als Betastrahler ist<br />
90 Strontium vor allem für Kinder bedrohlich. Diese<br />
Teilchenstrahlung penetriert nicht sehr tief in die Gewebe.<br />
Weil aber das kindliche Knochenmark fettarm<br />
ist, und das 90 Strontium sich auch subendostal anlagert,<br />
liegt es nahe am blutbildenden Knochenmark<br />
und belastet die hämatologischen Stammzellen viel<br />
höher <strong>als</strong> beim Erwachsenen.<br />
239 Plutonium hat wohl die höchste Radiotoxizität<br />
aller Transurane. Die Verweildauer von 239 Plutonium<br />
im menschlichen Organismus ist äusserst lang: einmal<br />
im Körper, wird es kaum mehr ausgeschieden.<br />
Plutonium penetriert in den Organismus durch Inhalation.<br />
Mit der Nahrung eingenommen, passiert ein<br />
grosser Teil den Darm, ohne resorbiert zu werden.<br />
In Tschernobyl wurden viele Isotope, auch Transurane<br />
freigesetzt, darunter 133 Xe, 131 I, 134 Cs, 137 Cs,<br />
132 Te, 89 Sr, 90 Sr, 140 Ba, 95 Zr, 99 Mo, 103 Ru, 106 Ru, 141 Ce,<br />
144 Ce, 239 Np, 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 241 Pu, 242 Cm [7], jedes<br />
mit seiner eigenen Pharmakokinetik und spezifischen<br />
Radiotoxizität. Ähnliches ist in Fukushima zu erwarten.<br />
Allen aus Reaktoren freigesetzten Isotopen – wie<br />
auch den natürlich vorkommenden Strahlenquellen –<br />
ist gemeinsam die Potenz zur Erzeugung von Krebs,<br />
Gefässkreislaufkrankheiten, Endokrinopathien und<br />
Schädigung des Erbgutes. Strahlenbiologisch ist gesichert,<br />
dass die Dosiswirkungsrelation linear ist. Mit<br />
anderen Worten: Es gibt keine Toleranz des Organismus<br />
für ionisierende Strahlung. Jede Strahlung kann<br />
einen Krebs auslösen oder eine Schädigung des Genoms<br />
bewirken.<br />
Fukushima ist nicht Tschernobyl – oder doch?<br />
Reflexartig berichteten die Medien, der Unfall in<br />
Fukushima sei nicht vergleichbar mit dem in Tschernobyl.<br />
Doch stellt sich die Frage: Welcher der beiden<br />
Unfälle ist gravierender für die Umgebung? Für die<br />
lokale Bevölkerung war der Tschernobylunfall wegen<br />
seines Mechanismus (Explosion, Graphitbrand, Kaminbildung,<br />
Verteilung der Isotopen über die ganze<br />
Nordhalbkugel) im Ganzen gesehen ein Glück im Unglück:<br />
Sie bekam nicht alles ab. Die havarierten Fukushimareaktoren<br />
hingegen setzen wie ein Schwelbrand<br />
alles in der näheren Umgebung ab. Wenn <strong>als</strong>o geschrieben<br />
wird, es sei in Fukushima nur etwa 1 ⁄10 der<br />
in Tschernobyl entwichenen Radioaktivität freigesetzt<br />
worden – was pure Spekulation ist, denn<br />
niemand weiss es – bedeutet das keineswegs, dass der<br />
Unfall für die japanischen Anwohner nicht viel<br />
gravierender ist <strong>als</strong> der von Tschernobyl für die dortige<br />
Bevölkerung. Erst nach vielen Jahren wird das<br />
wahre Ausmass der Katastrophe bilanzierbar sein.<br />
Nein, Fukushima ist nicht Tschernobyl. In der<br />
Sowjetunion haben 600000 Soldaten, Zivilschützer<br />
und Reservisten aufgeräumt. In Japan spricht man<br />
bisher von 500 Arbeitern, die bis zur physischen<br />
und psychischen Erschöpfung zur Arbeit getrieben<br />
werden. Sie werden hohen Strahlendosen ausgesetzt.<br />
Die Rekrutierung neuer Arbeiter sei schwierig,<br />
hören wir heute schon. Wenn die 500 Mann an der<br />
Grenze der möglichen Strahlenbelastung angelangt<br />
sind (250 mSievert akkumulierte Dosis), wer wird<br />
dann die Arbeit weiterführen?<br />
Die Folgen von Tschernobyl sind hinlänglich bekannt,<br />
wenn auch nicht genügend untersucht und<br />
In Fukushima (Aufnahme vom 16.3.2011) wurde Plutonium in der Umgebung der Reaktoren gemessen. Anzunehmen<br />
ist deshalb, dass auch 90 Strontium, Transurane und weitere Isotope freigesetzt wurden.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 787<br />
Digital Globe/wikipedia
PSR / IPPNW ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Atomunfälle<br />
Kanada, Dezember 1952: In einem Reaktor in Chalk<br />
River bei Ottawa kommt es zu einer schweren Explosion.<br />
Der Reaktorkern wird bei einer partiellen Kernschmelze<br />
zerstört.<br />
Russland, September 1957: In einer Wiederaufbereitungsanlage<br />
in Kyschtym explodiert ein Tank mit<br />
radioaktiven Abfällen. Dabei werden grosse Mengen<br />
an radioaktiven Substanzen freigesetzt.<br />
Grossbritannien, Oktober 1957: Im Kernreaktor in<br />
Windscale – ab 1983 Sellafield genannt – wird nach<br />
einem Brand eine radioaktive Wolke freigesetzt, die<br />
sich über Europa verteilt.<br />
Schweiz, Januar 1969: Beim Versagen des Kühlsystems<br />
eines experimentellen Reaktors im Versuchsatomkraftwerk<br />
Lucens kam es zu einer partiellen Kernschmelze.<br />
Grossbritannien, Juli 1973: Wieder kommt es in<br />
der Wiederaufbereitungsanlage Windscale zu einer<br />
schweren Explosion, bei der ein grosser Teil der<br />
Anlage kontaminiert wird.<br />
Deutschland, Januar 1977: Kurzschlüsse in zwei Hochspannungsleitungen<br />
führen im Atomkraftwerk Gundremmingen<br />
in Bayern zu einem Tot<strong>als</strong>chaden. Das<br />
Reaktorgebäude ist mit radioaktivem Kühlwasser verseucht.<br />
USA, März 1979: Maschinen und Bedienungsfehler<br />
führen im Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg<br />
zum Ausfall der Reaktorkühlung, die eine partielle<br />
Kernschmelze und die Freisetzung von radioaktiven<br />
Gasen zur Folge hat.<br />
Sowjetunion, April 1986: Explosion und Kernschmelze<br />
im Reaktor Nr. 4 des Atomkraftwerkes von Tschernobyl.<br />
Der radioaktive Niederschlag kontaminiert grosse<br />
Teile der Welt. Das Ausmass der Folgen ist bis heute<br />
unklar. Nach einer kürzlichen Publikation der Akademie<br />
für Wissenschaften, New York, erreicht jedoch die<br />
Zahl der Todesopfer beinahe eine Million.<br />
Japan, September 1999: In einem Brennelementewerk<br />
in der Stadt Tokaimura setzt nach einer unvorschriftsmässigen<br />
Befüllung eines Vorbereitungstanks eine<br />
unkontrollierte Kettenreaktion ein. Starke radioaktive<br />
Strahlung tritt aus.<br />
Tschechien, Oktober 2000: Das umstrittene Atomkraftwerk<br />
Temelin geht ans Netz. Bis August 2006 werden<br />
von der Anlage fast hundert Störfälle gemeldet.<br />
Deutschland, Dezember 2001: Eine Wasserstoffexplosion<br />
verursacht im Atomkraftwerk Brunsbüttel einen<br />
Störfall. Der Reaktor wird erst auf Drängen der Kontrollbehörden<br />
im Februar 2002 zur Inspektion vom<br />
Netz genommen.<br />
Schweden, Juli 2006: Nach einem Kurzschluss wird<br />
im Kernkraftwerk Forsmark einer von drei Reaktoren<br />
automatisch von der Stromversorgung getrennt. Der<br />
Reaktor wird heruntergefahren.<br />
Japan, März 2011: Im Atomkraftwerk Fukushima fallen<br />
nach einem schweren Erdbeben mit Tsunami<br />
mehrere Kühlanlagen aus, mit anschliessenden WasserstoffExplosionen,<br />
und es ist zu partiellen Kernschmelzen<br />
gekommen.<br />
heute noch umstritten. Nur noch wenige Gremien,<br />
darunter die WHO [8] und die IAEA [9], verharmlosen<br />
weiterhin die Folgen der Katastrophe. Alexey V. Yablokov<br />
hat sie in einem kürzlich erschienenen, sehr<br />
vollständigen Band beschrieben [10]. Nur wenn die<br />
Lügen und die Verharmlosung so weitergehen, diskutieren<br />
wir in 100 Jahren noch über die Folgen von<br />
Fukushima.<br />
Für eine Entscheidfindung über die Strategie des<br />
vorsorglichen Gesundheitsschutzes in Sachen Atomenergie<br />
brauchen wir keine Studien mehr. Wir wissen<br />
genug, um zu handeln.<br />
Literatur<br />
1 Virchow R. Abhandlungen zur wissenschaftlichen<br />
Medicin. Frankfurt; 1856. Zitiert aus der 2. unv.<br />
Auflage, 1862. S. 56.<br />
2 Gardner MJ et al. Results of case-control study of<br />
leukaemia and lymphoma among young people near<br />
Sellafield nuclear plant in West Cumbria. British<br />
Medical Journal. 1990;300:423–9.<br />
3 Gardner Martin J. Methods and basic data of<br />
case-control study of leukaemia and lymphoma<br />
among young people near Sellafield nuclear plant in<br />
West Cumbria. British Medical Journal.<br />
1990;300:429–34.<br />
4 Walter M. Strahlenschutz – Argumente gegen die<br />
von der ICRP (Internationale Kommission für<br />
Strahlenschutz) vorgesehenen Lockerungen der<br />
Regeln. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2005;86(26):1584.<br />
5 Parker L, Pearce MS, Dickinson HO, Aitkin M, Craft AW.<br />
Stillbirths among offspring of male radiation workers<br />
at Sellafield nuclear reprocessing plant. The Lancet.<br />
1999; 354:1407–14.<br />
6 Chronic Cs-137 incorporation in children’s organs,<br />
Y. I. Bandazhevsky, Swiss Med Wkly. 2003;133:<br />
488–90.<br />
7 Chernobyl source term, atmospheric dispersion,<br />
and dose estimation, EnergyCitationsDatabase.<br />
1 November 1989.<br />
8 Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Sitz<br />
in Genf. Homepage: www.who.int/en/<br />
9 Internationale Atomenergieorganisation mit Sitz<br />
in Wien. Homepage: www.iaea.org/<br />
10 Yablokov AV, Nesterenko VB, Nesterenko AV.<br />
Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for<br />
People and the Environment, Ann<strong>als</strong> of the New<br />
York Academy of Sciences. 2009; Vol. 1181.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 788
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE<br />
Briefe an die SÄZ<br />
Hungerstreik und Zwangsernährung<br />
An die Gültigkeit einer Vorausverfügung sind<br />
bei einem Hungerstreikenden die gleichen<br />
Massstäbe anzusetzen wie bei anderen Patienten<br />
und Patientinnen, die eine Lebensverlängerung<br />
ablehnen. Der Nachweis der Urteilsfähigkeit<br />
ist eine selbstverständliche,<br />
nicht bestrittene Bedingung für die Unterlassung<br />
lebensrettender Hilfeleistung, ebenso<br />
wie für die Beihilfe zur Lebensverkürzung. Bei<br />
der Sterbehilfe ist bekanntlich ausserdem<br />
auch die Nachhaltigkeit des Sterbewunsches<br />
und der ihn auslösenden Gründe eine unabdingbare<br />
Voraussetzung. Analoges hat für die<br />
Unterlassung der Hilfeleistung für einen<br />
Hungerstreikenden zu gelten, dessen Sterbewunsch<br />
mit einer Forderung verbunden ist.<br />
Die Gründe für einen Hungerstreik, ob dieser<br />
nun politisch oder durch persönliche Verhältnisse<br />
und Krisen motiviert ist, dürften<br />
aber meistens nicht dauerhaft sein. Der Protestcharakter<br />
des Streikes wird im Übrigen<br />
durch die Zwangsernährung nicht gebrochen.<br />
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit,<br />
dass ein Hungerstreikender, der gegen<br />
seinen Willen am Leben erhalten wird, später<br />
einmal für diese Massnahme dankbar sein<br />
wird. Diese Aspekte sind in vielen Beiträgen<br />
in der SÄZ, zuletzt in jenem von Dr. R. Bridler<br />
übergangen worden [1].<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
PD Dr. med. Mario Gmür, Zürich<br />
1 Bridler R. Patientenverfügung und Zwangsernährung.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(19):7147.<br />
Orthopädenmangel 2020 [1]<br />
Das Problem für Ärztinnen aller Fachgebiete<br />
besteht gemäss meiner Erfahrung <strong>als</strong> Ärztin<br />
in eigener Praxis und Mutter von drei Schulkindern<br />
nicht primär darin, dass Ärztinnen<br />
neben der Berufstätigkeit auch den Haushalt<br />
führen müssen. Hausarbeiten können teilweise<br />
an bezahltes Personal delegiert werden<br />
(Putzen) und auch mit dem Partner zusam-<br />
men erledigt werden. Die Hauptschwierigkeit<br />
besteht darin, die Bedürfnisse des Berufs und<br />
der Kinder unter einen Hut zu bringen. Auch<br />
wenn ein Kind in einer guten «Fremdbetreuung»<br />
genauso gedeiht, wie wenn es nur von<br />
Mutter (oder Vater) betreut wird, braucht es<br />
ein Mindestmass an Zeit, die Eltern und Kinder<br />
zusammen verbringen können. Lange<br />
Arbeitszeiten bis in den Abend hinein und<br />
häufige Abwesenheit an Wochenenden für<br />
Dienste, Weiter- und Fortbildung usw. sind<br />
nicht kinderverträglich.<br />
Früher wurde dieses Problem im Gesundheitswesen<br />
so «gelöst», dass Pflegende häufig<br />
Ordensschwestern, Diakonissen oder ledige<br />
Frauen waren, während von den (vorwiegend<br />
männlichen) Ärzten selbstverständlich erwartet<br />
wurde, dass sie ihre Familie zugunsten des<br />
Berufs vernachlässigten. Gewisse Berichte<br />
über das Wirken von Hausärzten auf dem<br />
Land, die rund um die Uhr erreichbar sind,<br />
legen davon heute noch Zeugnis ab. Da aber<br />
zum Glück für die betroffenen Kinder (und<br />
Ehepartner) immer mehr (auch männliche)<br />
Ärzte die Bedürfnisse ihrer Familie nicht länger<br />
ignorieren wollen, kommt die Medizin<br />
nicht darum herum, die Arbeitsbedingungen<br />
familienfreundlicher zu gestalten. Mit genug<br />
Phantasie und Flexibilität gibt es dazu auch<br />
Möglichkeiten. Abwesenheiten von Ärzten<br />
wegen Militärdienst, Kongressen usw. wurden<br />
übrigens auch schon früher akzeptiert.<br />
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil<br />
1 Brandenberg JE. Orthopädenmangel 2020.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2011;92(18):676–8.<br />
Der Hausbesuch ist die Kernkompetenz<br />
des Hausarztes. Editorial von Dr. Gähler<br />
[1]<br />
«Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt<br />
der Glaube»! Noch selten hat sich ein oberstes<br />
Organ der FMH in derart klarer Weise zu<br />
einer Teilfunktion des Hausarztes geäussert.<br />
Als ehemaliger Allgemeinpraktiker und Hausarzt<br />
unterstütze ich diese Meinung von<br />
Dr. Gähler voll und ganz. Tägliche Hausbesuche<br />
(notfalls auch nachts) waren mir während<br />
Jahren eine Selbstverständlichkeit. In<br />
Einzelpraxen in ländlicher Umgebung mit ent-<br />
sprechender «Be-Rufung» des Praxisinhabers<br />
dürfte dies wohl weiter möglich sein. In<br />
Gruppenpraxen, vor allem in Städten und<br />
Agglomerationen, wird es wohl eher so aussehen,<br />
dass nach Ende der Bürozeiten das<br />
Telefon vom Automaten bedient wird. Die<br />
Notfälle werden an die Notfall-Praxen in den<br />
Spitälern bzw. die Hausbesuche an Spitex<br />
oder 144 delegiert.<br />
Aber ist diese Versorgung der Patienten zu<br />
Hause, seien es Notfälle oder chronischkranke<br />
Patienten, wie sie von Dr. Gähler gewünscht<br />
und einleuchtend begründet wird,<br />
eine Frage des Tarifs? Ich nehme kaum an,<br />
dass sich Anzahl und Dauer der Hausbesuche<br />
durch die Einführung der Besuchs-Inkonvenienz-Pauschale<br />
erhöhen und deren Verlängerung<br />
diese halten werden.<br />
Aus dem Gesagten ergibt sich auch, dass für<br />
den Patienten die Einzelpraxis eines Arztes <strong>als</strong><br />
Einzelkämpfer in keiner Weise ausgedient<br />
hat, wie dies vor wenigen Wochen von Herrn<br />
Bundesrat D. Burkhalter verkündet wurde.<br />
Zeit zu haben bzw. zu machen und (fast)<br />
dauernd da zu sein, ist halt doch des Patienten<br />
erster Wunsch an seinen Hausarzt.<br />
Dr. med. C. Estermann, emerit. Hausarzt,<br />
Adligenswil<br />
1 Gähler E. Der Hausbesuch ist die Kernkompetenz<br />
des Hausarztes. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(18):647.<br />
Ökonomisierung der Medizin<br />
Sehr geehrter Herr Kollege Picard<br />
Sie sprechen mir mit Ihrem Leserbrief [1]<br />
zum Artikel «Führungsentwicklung im Spital»<br />
aus dem Herzen. Ärztliche Bürokraten, sogenannte<br />
Gesundheitsökonomen und Gesundheitspolitiker<br />
sind seit langem daran, mit<br />
dem Ziel einer Ökonomisierung der Medizin<br />
das Gesundheitswesen in der Schweiz zu zerstören.<br />
Ihr Zerstörungswerk versuchen sie mit<br />
ständig neuen, aber nicht glaubwürdigeren,<br />
fadenscheinigen Worthülsen zu kaschieren.<br />
Mit ihrer zynischen, nicht bewiesenen, wie in<br />
einer Gebetsmühle wiederholten Behauptung<br />
einer Qualitätssteigerung versuchen sie<br />
ihr Ansinnen zu untermauern. Als ob das Gesundheitswesen<br />
in der Schweiz am Boden<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
789
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE / mIttEIlungEn<br />
läge, Ärzte sich nie fortgebildet hätten, noch<br />
nie vernetzt gewesen wären. Menschen bzw.<br />
PatientInnen sind längstens verschwunden,<br />
übriggeblieben sind Human Resources.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Dr. med. Willy A. Stoller, Bern<br />
1 Picard G. Führungsentwicklung im Spital.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2011;92(19):699.<br />
MehrFachArzt – das Gütezeichen für<br />
Top Hausärzte [1]<br />
Mit viel Geschick ist es den Pionieren der<br />
Managed-Care-Netzwerke gelungen, die Qualitätsdiskussion<br />
massgeblich zu beeinflussen<br />
und sogar die gesundheitspolitischen Überlegungen<br />
unseres Gesundheitsministers auf<br />
Managed Care (MC) zu fokussieren bzw. einzuengen.<br />
Die Absicht ist offensichtlich: Man<br />
will beweisen, dass die Patienten auch in<br />
Modellen, die von Leistungsverhinderung<br />
profitieren, kein Absinken der medizinischen<br />
Versorgung befürchten müssen, so wie jede<br />
Versicherung das «Blaue vom Himmel» verspricht<br />
bis zum ersten Schadenfall! Deshalb<br />
unterziehen sich die MC-Kollegen gerne<br />
mitteilungen<br />
Facharztprüfungen<br />
Facharztprüfung zur Erlangung des<br />
Facharzttitels für Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
und -psychotherapie<br />
Ort: Kinder- und Jugendpsychiatrische<br />
Poliklinik, Effingerstrasse 12, 3011 Bern<br />
Datum: Samstag, 17. März 2012 und<br />
Samstag, 24. März 2012<br />
Anmeldefrist: 26. August 2011<br />
Weitere Informationen finden Sie auf der<br />
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung<br />
AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen<br />
Facharztprüfung zur Erlangung<br />
des Facharzttitels Rheumatologie<br />
Ort: Inselspital, Bern<br />
Datum: Mittwoch, 18. Januar 2012<br />
Anmeldefrist: 31. Oktober 2011<br />
allerlei Massnahmen, die angeblich die Qualität<br />
ihrer ärztlichen Tätigkeit beweisen sollen,<br />
und versehen dann jegliche Papiere,<br />
sogar automatische EKG-Auswertungen (offenbar<br />
wurde auch der EKG-Apparat equam ®<br />
qualifiziert) mit ihren fragwürdigen Qualitätslabeln.<br />
Nun hat die argomed sogar ihr eigenes Qualitätsinstrument<br />
erschaffen, und die Mitglieder<br />
(auch anderer MC-Netzwerke) dürfen sich<br />
nach Erfüllen der Kriterien fortan «Mehr-<br />
FachArzt» nennen und ihre Rezeptformulare<br />
und Bestellkärtchen mit dem entsprechenden<br />
Logo schmücken. (Nur 1 Kandidat von<br />
38 konnte nicht berücksichtigt werden, da<br />
er das Grundkriterium mindestens 50 % <strong>als</strong><br />
Grundversorger tätig zu sein, nicht erfüllte,<br />
offenbar konnte er schlecht lesen!?)<br />
Cui bono? Wir leben eben in einer völlig verschulten<br />
Gesellschaft, in der es darum geht,<br />
Qualität zu zeigen – ob man sie dann auch<br />
liefert, ist völlig nebensächlich. Erich Fromms<br />
«Haben oder Sein» lässt wieder einmal grüssen!<br />
Anstatt seine Zeit den Patienten zu widmen,<br />
verblödet man immer mehr Zeit mit<br />
administrativem Unsinn und schafft sich<br />
nun freiwillig noch mehr unsinnige Auflagen,<br />
um sich selbst, den Patienten, die es<br />
sonst offenbar nicht merken würden, und<br />
irgendwelchen «Gesundheitsfachleuten» zu<br />
beweisen, wie gut man ist. Und die Erfinder<br />
solcher Qualitätslabel sind noch der absolut<br />
Weitere Informationen finden Sie auf der<br />
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung<br />
AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen<br />
pro humanis<br />
Eberhard Ketz Preis<br />
Die Gönnervereinigung Neurorehabilitation<br />
pro humanis verleiht 2011 zum ersten Mal<br />
den Eberhard Ketz Preis in Höhe von 10000<br />
Franken. Er wird alle zwei Jahre vergeben werden.<br />
Der Preis wird vergeben für<br />
– eine wissenschaftliche Arbeit aus der klinischen<br />
Forschung der Neurorehabilitation,<br />
die in den letzten zwei Jahren in<br />
einem international anerkannten Fachorgan<br />
publiziert wurde.<br />
– technische oder methodische Innovationen<br />
aus dem Gebiet der Neurorehabilitation,<br />
die in den letzten zwei Jahren<br />
zur klinischen Anwendung gekommen<br />
sind.<br />
naiven Überzeugung, mit solchen Massnahmen<br />
die zunehmende Misere der hausärztlichen<br />
Tätigkeit mildern und den Beruf wieder<br />
attraktiver machen zu können. Wie wenn<br />
es für junge Kollegen nicht schon so genügend<br />
Auflagen zu erfüllen gäbe, die vom<br />
Wesentlichen ablenken. Wem gegenüber<br />
müssen wir Ärzte eigentlich was und mit welchen<br />
demütigenden Mitteln dauernd beweisen,<br />
in einer Gesellschaft, in der es normal<br />
geworden ist, dass bald jede «frustrierte Hausfrau»<br />
sich in kürzester Zeit im Gesundheitsbereich<br />
ohne richtige Kontrolle breit machen<br />
kann und solche Methoden erst noch in der<br />
Verfassung «geschützt» werden?<br />
Es ist ja auch nicht zufällig, dass die argomed<br />
selbsternannte Gesundheitspolitikerinnen, die<br />
sich nie einer entsprechenden Qualitätsprüfung<br />
unterzogen haben, ins Zertifizierungs-<br />
Gremium dieses «Qualitätslabels» geholt hat.<br />
Unter dem Kapitel «Inhalte des Labels» steht<br />
u.a. «Berufsstolz fördern, Selbstbewusstsein<br />
stärken, sympathische Autorität ausstrahlen».<br />
Dieses Label scheint wohl die letzte<br />
Krücke zu sein, wenn einem diese Qualitäten<br />
bereits abhanden gekommen sind.<br />
Dr. med. F. Tapernoux, Rüti<br />
1 argomed. MehrFachArzt – das Gütezeichen<br />
für Top Hausärzte. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(18):661.<br />
– ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus<br />
dem Gebiet der Neurorehabilitation.<br />
Die Arbeit muss von einem oder mehreren<br />
Wissenschaftlern, die an einer Klinik oder einem<br />
Institut in der Schweiz tätig sind, verfasst<br />
worden sein. Bewerbungen mit Curriculum<br />
Vitae und Publikationsliste (nur peer-reviewed<br />
Originalarbeiten) in fünffacher<br />
Ausführung inkl. Separata sind zu richten an<br />
Prof. Dr. R. Müri, Präsident des wissenschaftlichen<br />
Beirats der pro humanis, Abteilung für<br />
Kognitive und Restorative Neurologie, Universitätsklinik<br />
für Neurologie, Inselspital,<br />
3010 Bern.<br />
Anmeldefrist: 30. September 2011<br />
Armeelager für Behinderte 2012<br />
Armeelager vom 9.6.–19.6.2012 im<br />
Feriendorf Fiesch (VS)<br />
Im Jahr 2012 wird ein Armeelager für Behinderte<br />
(AlB) im Feriendorf Fiesch (VS) durchgeführt.<br />
Ein Spitalbataillon der Logistikbrigade<br />
1 ist für die Durchführung des AlB ver-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 790
edaktion.saez@emh.ch mIttEIlungEn<br />
antwortlich. Die Zielsetzung des Armeelagers<br />
für Behinderte ist die Förderung der Zusammenarbeit<br />
zwischen der Armee und zivilen<br />
Stellen im Sinne des Koordinierten Sanitätsdienstes<br />
(KSD). Es sollen abwechslungsreiche<br />
Möglichkeiten für Behinderte geschaffen und<br />
Angehörige und Pflegende von Behinderten<br />
während der Dauer des Armeelagers entlastet<br />
werden.<br />
Maximal 50 Gäste können in das AlB aufgenommen<br />
werden. Da aus Erfahrung die Anzahl<br />
der Anmeldungen wesentlich höher<br />
liegt, wird durch die Triageverantwortlichen<br />
eine entsprechend seriöse Auswahl getroffen.<br />
Aufgenommen werden Personen mit<br />
– schwerem Rheuma;<br />
– schwerer Arthrose und anderen Gelenkveränderungen;<br />
– Amputationen;<br />
– Multipler Sklerose und Muskeldystrophie;<br />
– Para- und Tetraplegie;<br />
– chronischen Erkrankungen.<br />
Von der Aufnahme ausgeschlossen sind<br />
Personen<br />
– unter 18 und über 70 Jahren<br />
– mit ansteckenden Krankheiten; instabilem<br />
Kreislauf / Kreislaufstörungen;<br />
– mit schweren Stoffwechselstörungen;<br />
– mit erheblichen Kommunikationsschwierigkeiten;<br />
– mit psychischen Erkrankungen, welche<br />
Betreuung durch ausgebildetes Psychiatriepflegepersonal<br />
erfordern.<br />
Anmeldung<br />
Für die Anmeldung muss ein militärischer<br />
Fragebogen abgefragt werden. In dieser<br />
Anfrage müssen folgende Angaben zum Teilnehmer<br />
gemacht werden: Name, Vorname;<br />
Adresse, Postleitzahl, Wohnort; Geburtsdatum;<br />
fakultativ: Telefonnummer, Bezugsperson.<br />
Dieser ist zu senden an:<br />
LBA Sanität<br />
Gästeadministration AlB<br />
Worblent<strong>als</strong>trasse 36<br />
3063 Ittigen<br />
Anmeldefrist Fragebogen: 7. Oktober 2011<br />
Interessierte erhalten einen ausführlichen,<br />
militärischen Fragebogen. Dieser muss vollständig<br />
ausgefüllt (allenfalls durch den Hausarzt<br />
unterzeichnet) bis 28. Oktober 2011 bei<br />
der Gästeadministration AlB eintreffen. Damit<br />
gelten die Interessierten <strong>als</strong> angemeldet –<br />
die Triage entscheidet danach über die definitive<br />
Teilnahme.<br />
Auswahl der Gäste (Triage)<br />
Im Dezember 2011 werden alle eingereichten<br />
Anmeldungen durch den verantwortlichen<br />
Triagearzt, gemeinsam mit dem/der Dienst-<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
chef/in Pflegedienst, beurteilt. Für die Aufnahme<br />
in das AlB werden in erster Priorität<br />
Angemeldete berücksichtigt, die erstm<strong>als</strong> an<br />
einem Lager teilnehmen möchten. Im Verlauf<br />
Januar/Februar 2012 werden alle Angemeldeten<br />
schriftlich über eine Teilnahme<br />
oder eine Nichtteilnahme im AlB 2012 orientiert.<br />
Kosten<br />
Die Gäste zahlen pro Lager einen pauschalen<br />
Kostenbeitrag von 253 Franken. (inklusive<br />
Versicherung und Unterhaltung). Dieser Betrag<br />
wird zu Beginn des Armeelagers durch<br />
den Finanzverantwortlichen der Truppe in<br />
bar eingezogen.<br />
Weitere Informationen:<br />
gaestealb@vtg.admin.ch<br />
www.lba.admin.ch → Themen → Sanität/Gesundheit<br />
→ Armeelager für Behinderte<br />
gesundheitsökonomie<br />
Symposium «Zukunft der medizinischen<br />
Versorgung und der kantonalen Gesundheitspolitik<br />
ab 2012»<br />
Der «Countdown» läuft: Wenige Monate<br />
trennen uns nur noch vom «Tag X», dem<br />
1. Januar 2012, an dem weitere wichtige Teile<br />
der revidierten Gesetzgebung zur Spitalfinanzierung<br />
in Kraft treten, allem voran das Patientenklassifikations-<br />
und Leistungsfinanzierungssystem<br />
SwissDRG. Noch sind verschiedene<br />
Fragen offen oder bedürfen doch<br />
ihrer Konkretisierung, so die Zulassung und<br />
Finanzierung medizinischer Innovationen,<br />
die Finanzierung von Investitionen sowie der<br />
Weiterbildung in den Medizinalberufen.<br />
Auch wenn diese und weitere aktuelle Fragen<br />
das Tagesgeschehen prägen und viele Kräfte<br />
binden, sollten deren Einordnung und ihre<br />
Auswirkungen auf Grundsatzfragen nicht<br />
vernachlässigt werden. Der «Charme des<br />
eklektischen Pragmatismus», der unseren (gesundheits-)politischen<br />
Alltag charakterisiert,<br />
birgt die Gefahr einer ordnungspolitischen<br />
Verwahrlosung. Eine Rückbesinnung auf die<br />
ordnungspolitischen Grundlagen unseres<br />
Gesundheitssystems ist deshalb dringender<br />
denn je.<br />
Unter den Referenten des Zürcher Symposiums<br />
finden sich auch zwei Schweizer Experten<br />
mit langjähriger Erfahrung in Deutschland:<br />
Josef Rohrer, Geschäftsführer eines deutschen<br />
Grossklinikums, und Prof. Dr. med.<br />
Marc Reymond, Viszeralchirurg und Chefarzt<br />
am Evangelischen Krankenhaus in Bielefeld.<br />
Der Anlass wird moderiert von Prof. Dr. oec.<br />
Tilman Slembeck, Professor für Volkswirtschaftslehre,<br />
Zürcher Hochschule für Angewandte<br />
Wissenschaften und Universität<br />
St.Gallen, sowie Frau Roswitha Scheidweiler,<br />
RS Medical Consult GmbH.<br />
Das Symposium findet am 23. Juni 2011 im<br />
Kongresshaus Zürich statt. Detailliertes Programm,<br />
weitere Informationen und Online-<br />
Anmeldung unter www.rsmedicalconsult.com –<br />
die <strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> ist Medienpartner<br />
der Veranstaltung.<br />
Forum Familienfragen<br />
Am Puls der Familien – Familien und<br />
Gesundheit im Wechselspiel<br />
Familie und Gesundheit beeinflussen sich<br />
gegenseitig. Familien können Wohlbefinden<br />
oder Unwohlsein verursachen und dazu beitragen,<br />
dass sich die Familienmitglieder gesund<br />
fühlen oder nicht.<br />
Manchmal können Familien auch krankmachen.<br />
In der Familie eignen wir uns grundlegende<br />
Denk- und Erlebensweisen, Verhaltens-<br />
und Handlungsmuster an, die unser<br />
«Gesundsein» bzw. «Kranksein» prägen. Solche<br />
Muster – wie z.B. Ernährungsgewohnheiten,<br />
Bewegungsverhalten, Wahrnehmung<br />
von und Umgang mit Gesundheit bzw.<br />
Krankheit – verinnerlichen wir und geben sie<br />
später an unsere Kinder weiter.<br />
Was bedeutet Gesundheit, was Krankheit im<br />
Kontext von Familie? Wann fühlen wir uns<br />
gesund, wann krank? Wie gehen wir mit Gesundheit<br />
und Krankheit um? Die Eidg. Koordinationskommission<br />
für Familienfragen<br />
(EKFF) will im Rahmen des diesjährigen<br />
Forums folgenden Fragen nachgehen: Welche<br />
Gesundheitsdeterminanten finden sich<br />
in Familien? Wie wird Gesundheit bzw.<br />
Krankheit «konstruiert»? Wie werden Gesundheit<br />
und Krankheit aus biologischer, psychosozialer<br />
und soziokultureller Perspektive<br />
betrachtet? Wie familienfreundlich sind die<br />
Gesundheitsversorgung und das Gesundheitssystem<br />
in der Schweiz? Kann eine Familienmedizin,<br />
mit ihren Family Doctors, <strong>als</strong><br />
Grundpfeiler von Gesundheitsförderung betrachtet<br />
werden? Fachpersonen mit medizinischem,<br />
gesundheits- und sozialwissenschaftlichem<br />
Hintergrund beleuchten das Themenfeld<br />
Familie – Gesundheit – Krankheit in<br />
Form von Referaten und einer Podiumsdiskussion.<br />
Die Tagung findet am 21. Juni 2011 im Kursaal<br />
Bern statt. Weitere Informationen und Anmeldung<br />
unter www.forum-familienfragen.ch/de<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 791
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Seminare 2011<br />
Praxiseröffnung/-übernahme<br />
Themen<br />
Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung<br />
zur Sozialversicherung, Vertragswesen), Gesellschaftsformen<br />
/ Ehe- und Erbrecht (Trennung Privat-<br />
vom Geschäftsvermögen, Ehegüterstand, Erbschaftsplanung),<br />
Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung,<br />
Kostenberechnung), Praxisadministration<br />
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme), Unternehmensbewertung<br />
einer Arztpraxis (Berechnung<br />
und Beurteilung des Unternehmenswertes), Finanzierung<br />
der Arztpraxis (Businessplan, Kredite,<br />
Absicherungsmöglichkeiten), Versicherungen/Vorsorge/Vermögen<br />
(Personen- und Sachversicherungen,<br />
Vorsorgeplanung).<br />
Sponsoren<br />
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren (siehe<br />
www.fmhservices.ch) gedeckt.<br />
Daten<br />
K03 Donnerstag, 9. Juni 2011 Schmiedstube<br />
9.00–16.30 Uhr Bern<br />
K04 Donnerstag, 1. September 2011 FMT<br />
9.00–16.30 Uhr Zürich<br />
Praxisübergabe<br />
Themen<br />
Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg.<br />
Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten),<br />
Unternehmensbewertung einer Arztpraxis (Berechnung<br />
Inventarwert und Goodwill <strong>als</strong> Verhandlungsbasis),<br />
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung<br />
von Versicherungsverträgen, Pensions-<br />
und Finanzplanung), Steuern (Steueraspekte<br />
bei der Praxisübergabe, Optimierung der steuerlichen<br />
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer,<br />
Bestimmung des optimalen Übergabezeitpunktes).<br />
Sponsoren<br />
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren (siehe<br />
www.fmhservices.ch) gedeckt.<br />
Daten<br />
K08 Donnerstag, 16. Juni 2011 Schmiedstube<br />
13.30–18.00 Uhr Bern<br />
K09 Donnerstag, 8. September 2011 FMT<br />
13.30–18.00 Uhr Zürich<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Praxiscomputerworkshop<br />
Inhalt<br />
Die Workshopteilnehmer/innen erhalten im 1. Teil<br />
eine Einführung in die Anforderungen an ein Praxisinformationssystem.<br />
Anhand einer modernen vernetzten<br />
Praxisinfrastruktur werden die Beurteilungskriterien<br />
für eine praxis- und zukunftstaugliche<br />
Softwarelösung dargestellt. Checklisten sollen die<br />
schnelle Orientierung unterstützen und bei der Beurteilung<br />
und Wahl des Produkts konkrete Hilfe bieten.<br />
In Zusammenarbeit mit der Kommission Informatics –<br />
e-Health der Hausärzte Schweiz werden die zentralen<br />
Elemente der elektronischen Krankengeschichte aufgezeigt.<br />
Ein Erfahrungsbericht eines EDV-Anwenders<br />
(Arzt) rundet den 1. Teil ab. Der 2. Teil umfasst die Präsentation<br />
von sechs Praxisadministrationssoftwarelösungen<br />
(Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen<br />
unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,<br />
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte,<br />
Finanzbuchhaltungslösungen usw.).<br />
Ziel<br />
Die Teilnehmer/innen erhalten einen Anforderungskatalog,<br />
welcher ihnen erlaubt, ihre Vorstellungen für<br />
ein modernes Praxisinformationssystem besser zu<br />
formulieren und diese dem Softwarehersteller zu dessen<br />
Vorbereitung zu kommunizieren. Zudem erhalten<br />
sie einen ersten Überblick über führende Softwarelösungen.<br />
Daten<br />
K14 Donnerstag, 30. Juni 2011 BEa Bern<br />
9.30–16.30 Uhr Expo Bern<br />
K15 Donnerstag, 24. November 2011 Stadttheater<br />
9.30–16.30 Uhr Olten<br />
Anmeldung und Auskunft<br />
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services,<br />
Cornelia Steinmann, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,<br />
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.<br />
Hinweis<br />
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise<br />
oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt<br />
werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen<br />
Sponsoren zur Verfügung gestellt.<br />
annullierungsbedingungen<br />
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende<br />
Unkostenbeiträge erhoben:<br />
–50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;<br />
–100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn<br />
oder Fernbleiben.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 792
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Seminarsponsoren 2011<br />
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht<br />
es der FMH Consulting Services AG, ihre<br />
Seminarreihen für FMH-Mitglieder teils kostenlos,<br />
teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir<br />
Ihnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor.<br />
Medics Labor AG<br />
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern<br />
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44<br />
info@medics-labor.ch<br />
www.medics-labor.ch<br />
Medizinisches Labor und mehr<br />
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen, zu<br />
Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren<br />
erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.<br />
Geschätzt <strong>als</strong> persönliches, unkompliziertes Gegenüber,<br />
überzeugt Medics Labor durch fachliches und<br />
menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen<br />
und Dienstleistungen. Wir verstehen uns <strong>als</strong> sozialer<br />
Arbeitgeber und beschäftigen auch behinderte<br />
Personen.<br />
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte. Es<br />
gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das<br />
Unternehmen gemeinsam führen.<br />
Bioanalytica AG<br />
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern<br />
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30<br />
service@bioanalytica.ch<br />
www.bioanalytica.ch<br />
Engagierte Kompetenz<br />
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert auf<br />
einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und<br />
ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner<br />
bilden das Fundament unserer Kompetenz.<br />
Qualität und Seriosität – das sind die Werte, denen<br />
wir uns verschrieben haben. Aus der Überzeugung,<br />
dass dies auch unseren Kunden wesentliche<br />
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre 2000<br />
akkreditieren lassen.<br />
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr,<br />
sind wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund<br />
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation<br />
und Informationstechnologie sind unsere Laborresultate<br />
in kürzester Zeit verfügbar.<br />
Bei Bioanalytica stehen Sie <strong>als</strong> Kunde im Mittelpunkt.<br />
Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit<br />
gerne optimal im persönlichen Kontakt und<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.<br />
Polyanalytic SA<br />
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne<br />
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50<br />
info@polyanalytic.ch<br />
www.polyanalytic.ch<br />
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen,<br />
das auf dem Gebiet der Kantone Waadt und<br />
Neuenburg tätig ist.<br />
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den<br />
Dienst der Patientinnen und Patienten und der Ärzteschaft<br />
stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende<br />
Palette von medizinischen Analysen.<br />
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das<br />
Unternehmen für herausragende Qualität und kundennahe<br />
Dienstleistungen bekannt. Den frei praktizierenden<br />
Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher<br />
Konstanz verlässliche, rasche und kompetente<br />
Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst<br />
ausüben können.<br />
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und Ärzte<br />
nicht nur über einen Partner, der auf ihre Bedürfnisse<br />
eingeht, sondern auch tagtäglich über echte<br />
Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.<br />
Polyanalytic ist mehr <strong>als</strong> ein Unternehmen: Dank<br />
der Kompetenz der Menschen, die dort arbeiten,<br />
kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den<br />
Patientinnen und Patienten, für die es verantwortlich<br />
ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet<br />
sind.<br />
Dianalabs SA<br />
Rue de la Colline 6, 1205 Genève<br />
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44<br />
info@dianalabs.ch<br />
www.dianalabs.ch<br />
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen,<br />
das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der Ärzteschaft<br />
und den Patientinnen und Patienten optimale<br />
Laborkontrollen zu bieten.<br />
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen<br />
ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie<br />
international anerkannt.<br />
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen<br />
Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin<br />
abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr <strong>als</strong> ein polyvalentes<br />
Allround-Labor: Dank seinem Spezialisten-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 793
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
team deckt es eine Vielzahl von Fachgebieten ab und<br />
bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen<br />
Fachgebiet mit seinen besonderen Bedürfnissen.<br />
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit<br />
den Ärztinnen und Ärzten und den universitären<br />
Zentren wurde uns klar, dass nur ein regionales Unternehmen,<br />
das grundlegende menschliche Werte<br />
wie Qualität, Austausch und Dienstleistungsbereitschaft<br />
in den Vordergrund stellt und mit den lokalen<br />
Verhältnissen vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung<br />
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.<br />
MOGELSBERG<br />
MEDIPRINT •CLASSICPRINT<br />
Schmid Mogelsberg AG, Ärztedrucksachen<br />
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg<br />
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81<br />
info@schmid-mogelsberg.ch<br />
www.schmid-mogelsberg.ch<br />
Seit über 70 Jahren auf Ärztedrucksachen<br />
spezialisiert!<br />
Bei der Gestaltung von zweckmässigen Arztformularen<br />
(Patientenkarten, KG-Einlagenblätter usw.) profitieren<br />
Sie von der langjährigen Erfahrung. Die Vergangenheit<br />
hat gezeigt, dass sich kaum zwei Ärzte<br />
für den gleichen Druck entscheiden. Zweckmässige<br />
Materialauswahl, einwandfreie Verarbeitung, freundliche<br />
und kompetente Beratung, schnelle Lieferung<br />
und die Ausführung von Spezialwünschen – diese<br />
Dienstleistungen schaffen die Grundlage für ein<br />
langjähriges Vertrauensverhältnis. Auf Wunsch versenden<br />
wir eine individuell auf Ihre Fachrichtung<br />
zusammengestellte Druckmusterkollektion.<br />
An über 9000 Ärzte liefern wir Drucksachen, Papiere<br />
und Büroartikel für den Praxisalltag.<br />
<strong>Schweizerische</strong> Ärzte-Krankenkasse<br />
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen<br />
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28<br />
info@saekk.ch<br />
www.saekk.ch<br />
Die richtige adresse für Erwerbsausfalldeckungen,<br />
Kollektivkrankenkasse und Versicherungsplanung<br />
Mit mehr <strong>als</strong> 100 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation<br />
auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen<br />
und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und<br />
kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen<br />
wie auch für selbständige und angestellte<br />
Ärztinnen und Ärzte.<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft<br />
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9<br />
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56<br />
versa@versa.ch<br />
www.versa.ch<br />
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen und<br />
Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung<br />
der Schweizer Ärzte Genossenschaft individuelle, den<br />
jeweiligen Bedürfnissen angepasste Versicherungslösungen<br />
im Bereich der privaten Vorsorge an.<br />
www.unilabs.ch<br />
UNILaBS – Ihr Qualitätslabor<br />
schnell, zuverlässig und nah<br />
Unilabs ist im Bereich der medizinischen Analysen<br />
ein kompetenter, transparenter und zuverlässiger<br />
Partner. Wir bieten Ihnen überall in der Schweiz ein<br />
komplettes Analysenspektrum, umfassende Dienstleistungen<br />
und kompetente Fachberatung an. In der<br />
Deutschschweiz sind dies Unilabs Mittelland mit<br />
den Standorten Basel, Bern, Langnau, Solothurn,<br />
Thun; Unilabs Zürich und Unilabs Dr. Weber.<br />
Unilabs bietet Weiterbildungen für das gesamte Praxis-Team<br />
sowie Beratung bei Praxis- und Laborbedarf.<br />
Unsere vielseitigen und regionalen Dienstleistungen<br />
basieren auf einer fundierten wissenschaftlichen<br />
Struktur und hochstehenden Qualität.<br />
Unilabs Schweiz – aktuell 900 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter, 72 Wissenschaftler und 22 Labors in<br />
Ihrer Nähe.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
verlag@emh.ch<br />
www.emh.ch<br />
EMH, der Verlag der Ärztinnen und Ärzte<br />
Der Verlag EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
wurde 1997 gegründet. EMH ist ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen<br />
und Ärzte FMH und der Schwabe AG, Basel, dem<br />
mit Gründung 1488 ältesten Druck- und Verlagshaus<br />
der Welt.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 794
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Hauptpublikationen von EMH sind die Zeitschriften<br />
«<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong>», das offizielle Publikationsorgan<br />
der FMH, «Swiss Medical Forum» mit praxisorientierten<br />
Fortbildungsbeiträgen, sowie «Swiss<br />
Medical Weekly», die Plattform für klinisch orientierte<br />
Wissenschaftler. Ebenfalls zu den Hauptpublikationen<br />
zählt «PrimaryCare», die offizielle «<strong>Schweizerische</strong><br />
Zeitschrift für Hausarztmedizin».<br />
Als erfolgreiches Online-Angebot ist unter anderem<br />
die Fortbildung des «Swiss Medical Forum» unter<br />
www.smf-cme.ch zu nennen. Steigende Zugriffszahlen<br />
und die Akkreditierung durch die Fachgesellschaften<br />
SGAM und SGIM <strong>als</strong> strukturierte und<br />
nachweisbare Fortbildung belegen diesen Erfolg.<br />
Weitere medizinische Fachzeitschriften, ein ständig<br />
wachsendes Buchprogramm sowie viele Kooperationen<br />
und Dienstleistungen runden das umfangreiche<br />
Verlagsangebot ab.<br />
MEDIZINISCHE LABORATORIEN DR. F. KAEPPELI AG<br />
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien<br />
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich<br />
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09<br />
info@medica-labor.ch<br />
www.medica-labor.ch<br />
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker<br />
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm<br />
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und<br />
gründete <strong>als</strong> dessen Leiter und Inhaber die Einzelfirma<br />
medica. Der wichtigste unternehmerische<br />
Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche<br />
Innovation und Schaffung wegweisender Standards<br />
auf allen Gebieten der Labormedizin: Mikrobiologie<br />
inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie,<br />
klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik<br />
und Pathologie in Human- und Veterinärmedizin.<br />
So entstand ein Kompetenz-Zentrum für<br />
Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser<br />
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien<br />
werden laufend erweitert und befinden sich im Herzen<br />
von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors,<br />
begleitet von Spezialisten aus Medizin,<br />
Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik,<br />
garantieren für höchste Professionalität.<br />
IVF HARTMANN AG<br />
Victor-von-Bruns-Strasse 28, 8212 Neuhausen<br />
Tel. 052 674 31 11, Fax 052 672 74 41<br />
info@ivf.hartmann.info<br />
www.ivf.hartmann.info<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Die IVF HARTMANN AG ist einer der führenden Anbieter<br />
für medizinische Verbrauchsgüter im Bereich<br />
Heilung, Pflege und Hygiene in der Schweiz. Ihre<br />
Lösungen helfen überall dort, wo Menschen geholfen<br />
wird. Zu ihren Kunden zählen somit Spitäler,<br />
Alters- und Pflegeheime, Spitex-Organisationen, niedergelassene<br />
Ärzte, Apotheken, Drogerien und der<br />
Lebensmitteleinzelhandel. Das breite Angebot der<br />
IVF HARTMANN AG umfasst über 2000 Produkte –<br />
vom therapeutisch wirksamen Pflaster (z.B. Isola ®<br />
Capsicum N) über funktionelle Verbände bis hin zu<br />
Produkten für die moderne Wundbehandlung (z.B.<br />
TenderWet ® oder CompriGel ® ) und Erste Hilfe (z.B.<br />
DermaPlast ® ). Die IVF HARTMANN GRUPPE ist eine<br />
60-prozentige Tochtergesellschaft der PAUL HART-<br />
MANN AG mit Sitz in Heidenheim an der Brenz (D)<br />
und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter. Neben ihrem<br />
Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall (SH) verfügt<br />
die IVF HARTMANN AG über weitere Produktionsstätten<br />
in Gommiswald (SG) und Netstal (GL).<br />
Mepha Pharma AG<br />
Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch<br />
Tel. 061 705 43 43<br />
www.mepha.ch<br />
Mepha – wir setzen Massstäbe<br />
Mepha, die führende Generika-Herstellerin der<br />
Schweiz, steht im 7. Jahrzehnt ihrer denkwürdigen<br />
Erfolgsgeschichte. Unseren Beitrag zu wirksamer Prophylaxe<br />
und Therapie sehen wir in der Entwicklung,<br />
Produktion und Vermarktung von günstigen, gut<br />
verträglichen und hochwertigen Generika. Wir entwickeln<br />
und produzieren in der Schweiz mit modernsten<br />
Hightechverfahren und nach höchstem<br />
Schweizer Qualitätsstandard. Unsere innovativen,<br />
kreativen Lösungen begeistern unsere Kunden immer<br />
wieder aufs Neue: Zum Beispiel neuartige und<br />
verbesserte Anwendungsformen unserer Medikamente,<br />
die den Behandlungserfolg und das Wohlbefinden<br />
von Patientinnen und Patienten steigern. Alle<br />
unsere Leistungen gründen auf einer ganzheitlichen<br />
Sicht, welche die Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter<br />
und Aktionäre, aber auch jene der übrigen<br />
Anspruchsgruppen in den Mittelpunkt stellt. Erstklassige<br />
Produkte, ein komplettes Package gefragter<br />
Dienstleistungen und offene Kommunikation sind<br />
weltweit Basis der Zufriedenheit unserer Kunden.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 795
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Salzmann AG<br />
Salzmann MEDICO<br />
Rorschacher Strasse 304, 9016 St. Gallen<br />
Tel. 071 282 12 12, Fax 071 282 12 10<br />
medico.sg@salzmann-group.ch<br />
www.salzmann-group.ch<br />
Salzmann MEDICO wurde 1980 durch Herrn Daniel<br />
Künzli, Präsident der Salzmann Group, gegründet.<br />
Die sehr kundenorientierte Handelsfirma vertreibt<br />
medizinische Verbrauchsgüter und Einwegprodukte.<br />
Die innovativen medizinischen Kompressionsstrümpfe<br />
der Marken VENOSAN ® und VENOFIT ® aus<br />
der Produktion von Salzmann MESH werden weltweit<br />
exportiert.<br />
Produktesortiment: Produkte aus Produktion der<br />
Salzmann Abteilung MESH Marke VENOSAN ® ; Exklusiv-Vertretungen<br />
unter Original-Markennamen;<br />
Private Label Produkte (SAMA ® , SAMA Orthopaedics ® ,<br />
Tale ® , Thermoban ® ); Wundkompressen; Wundtupfer;<br />
diverse Verbandsmaterialien; Heftpflaster / Wundschnellverbände;<br />
elastische Binden; medizinische<br />
Kompressionsstrümpfe / Stützstrümpfe; Körperbandagen,<br />
Orthesen, Schienen; Chirurgisches Nahtmaterial;<br />
Fixationsprodukte (Gips / synthetische<br />
Steifverbände); OP-Handschuhe; OP-Abdeckungen /<br />
OP-Bekleidung; OP-Sets steril; Produkte für die Sterilisation<br />
und Sterilisations-Kontrolle; Inkontinenzprodukte.<br />
Galexis AG<br />
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp<br />
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14<br />
info@galexis.com<br />
www.galexis.com<br />
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im Schweizer<br />
Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden<br />
ganz nach dem Motto «Alles aus einer Hand» mit<br />
Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik<br />
und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen<br />
in der Gesundheitslogistik – schweizweit.<br />
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg<br />
ihrer Kunden.<br />
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch,<br />
funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier<br />
kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer<br />
langjährigen Erfahrung professionell beraten und<br />
unterstützen!<br />
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie rechnen!<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
MSD Merck Sharp & Dohme-Chibret AG<br />
Schaffhauserstrasse 136, 8152 Opfikon-Glattbrugg<br />
Tel. 044 828 71 11, Fax 044 828 72 10<br />
www.msd.ch<br />
www.univadis.ch<br />
MSD ist die Schweizer Niederlassung von Merck & Co.,<br />
Inc. Whitehouse Station mit Hauptsitz in New Jersey,<br />
USA.<br />
DEM PATIENTEN VERPFLICHTET.<br />
Das Wohl des Patienten steht in unserer täglichen<br />
Arbeit an erster Stelle.<br />
Als weltweit tätiger, forschender Arzneimittelhersteller<br />
entwickeln, produzieren und vertreiben wir<br />
innovative Medikamente und Impfstoffe. Wir tun<br />
dies seit mehr <strong>als</strong> 100 Jahren und heute in über<br />
20 Therapiegebieten.<br />
In unserer Verpflichtung dem Patienten gegenüber<br />
ermöglichen wir weltweit die Versorgung mit dringend<br />
benötigten Medikamenten und unterstützen<br />
nachhaltige Gesundheitsprogramme vor Ort.<br />
Helvepharm AG<br />
Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld<br />
Tel. 052 723 28 50, Fax 052 723 28 58<br />
info@helvepharm.ch<br />
www.helvepharm.ch<br />
Als Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Generika<br />
tun wir alles dafür, um mit Innovationsgeist und<br />
Qualität eine führende Rolle im Schweizer Markt zu<br />
erreichen.<br />
Helvepharm setzt auf preiswerte Generika. Auf Medikamente,<br />
die sich in Wirkstoff, Darreichungsform<br />
und Dosierung an die Originalpräparate anlehnen<br />
und mit diesen austauschbar sind. Auch unsere Arzneimittel<br />
werden durch Swissmedic auf Herz und<br />
Nieren geprüft. Helvepharm Generika sind gleich<br />
wirksam wie das Original, jedoch ungleich günstiger.<br />
Mit über 60 Wirkstoffen in über 330 Darreichungsformen<br />
bieten wir kluge Alternativen zu Antihypertonika,<br />
Antidepressiva, Lipidsenkern, Gastrotherapeutika<br />
und für weitere relevante Gebiete. Helvepharm<br />
ist die günstige Basis im Gesundheitswesen.<br />
Helvepharm in Frauenfeld gehört zu Zentiva und<br />
damit zum drittgrössten Generikaanbieter in Europa.<br />
Zentiva ist Teil der sanofi-aventis-Gruppe.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 796
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
LabTop Medizinische Laboratorien AG<br />
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil<br />
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31<br />
info@labtop.ch<br />
www.labtop.ch<br />
Das externe Labor in Ärztehand<br />
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärzten<br />
aufgebautes und von Labor-Profis geführtes Privatlabor.<br />
Seit 10 Jahren unterstützt es den Arzt in seinem<br />
Sinne. LabTop ist überwiegend im Besitz von<br />
Ärzten und steht beteiligungswilligen Ärzten weiterhin<br />
offen.<br />
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten gestartet,<br />
klein, modern, unabhängig, exakt – typisch schweizerisch<br />
eben – bietet LabTop bestechend einfache<br />
und modernste Lösungen für die Arztpraxis. Bei Lab-<br />
Top bleibt die externe Analytik in Ärztehand.<br />
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein webbasiertes<br />
Geschäftsmodell, von dem Sie in verschiedener<br />
Hinsicht profitieren: Ressourcen-Einsparungen<br />
in Ihrer Praxis dank optimierter Prozesse, top<br />
Service, Messqualität, die höchsten Ansprüchen genügt,<br />
und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung<br />
ist LabTop etwas wert.<br />
LabTop – von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.<br />
Teva Pharma AG<br />
Industriestrasse 111, 4147 Aesch<br />
Tel. 061 756 97 50, Fax 061 756 97 55<br />
office@tevapharma.ch<br />
www.tevapharma.ch<br />
auf den ersten Blick Generika.<br />
auf den zweiten noch viel mehr.<br />
Teva steht für Generika. Und für noch viel mehr. Denn<br />
mit unserer Philosophie, stets mehr zu leisten, sind wir<br />
zu einem international aktiven Pharmaunternehmen<br />
mit mehreren Standbeinen herangewachsen.<br />
Weil wir Gesundheit nicht nur erhalten, sondern<br />
auch erschwinglich machen wollen, stehen wir mittlerweile<br />
an der Spitze der weltweit führenden Generika-Hersteller.<br />
Mit diesen Kompetenzen möchten wir Ihnen <strong>als</strong> verlässlicher<br />
Partner auf dem Schweizer Pharmamarkt<br />
zur Seite stehen. Dabei bieten wir Ihnen stets mehr:<br />
mehr Service, mehr Engagement und mehr Sicherheit<br />
und Qualität, welche wir in unseren eigenen<br />
Produktionsstätten optimal kontrollieren können.<br />
Mehr über uns erfahren Sie unter<br />
www.tevapharma.ch<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Mundipharma Medical Company<br />
Zweigniederlassung Basel<br />
St. Alban-Rheinweg 74, Postfach, 4020 Basel<br />
Tel. 061 205 11 11, Fax 061 205 11 87<br />
info@mundipharma.ch<br />
www.mundipharma.ch<br />
Mundipharma Medical Company ist die Schweizer<br />
Firma einer mittelgrossen, international erfolgreichen<br />
Pharmagruppe. Schmerztherapie, Onkologie<br />
und Atemwegserkrankungen sind die Kompetenzschwerpunkte<br />
unserer Forschung. Wir verstehen uns<br />
heute <strong>als</strong> modernes Dienstleistungsunternehmen,<br />
das hochwirksame Arzneimittel mit grösstmöglicher<br />
Verträglichkeit entwickelt und somit die Therapie für<br />
Arzt und Patient wesentlich erleichtert.<br />
Dieser Anspruch, unsere Arbeit eng an den Bedürfnissen<br />
der Menschen auszurichten, fordert uns täglich<br />
bei der Suche nach noch besseren Wirkmechanismen<br />
neu heraus. Die Motivation, durch hochwirksame<br />
Medikamente helfen zu können, ist dabei<br />
Ansporn und Herausforderung zugleich.<br />
Zur Rose<br />
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld<br />
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20<br />
Tel. Versandapotheke 0848 842 842<br />
info@zur-rose.ch<br />
www.zur-rose.ch<br />
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller<br />
Partner von mehr <strong>als</strong> 3000 Ärztinnen und Ärzten<br />
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution<br />
in den Bereichen Medikamentenversand<br />
und Arztpraxisbelieferung. Als standeseigenes<br />
Unternehmen vertritt Zur Rose die Interessen<br />
der Ärzteschaft.<br />
Zur Rose für Ärzte<br />
Mehr <strong>als</strong> 3000 Arztpraxen in der ganzen Schweiz erhalten<br />
von Zur Rose alles geliefert, was sie täglich benötigen:<br />
Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren,<br />
Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und<br />
Röntgenbedarf sowie Praxisgeräte und Instrumente<br />
aller Art.<br />
Zur Rose für Patienten<br />
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt die<br />
Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente<br />
an über 200000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose<br />
führt die Medikamenten- oder Bezugschecks kostenfrei<br />
aus und gewährt zusätzlich bis zu 12% Rabatt.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 797
Le bondiagnostic peut<br />
êtreune question de vie<br />
ou de mort.<br />
Facilitez-vous les tâches journalières.<br />
Nous vous soutenons dans les domaines suivants:<br />
Aussi sur le plan<br />
économique!<br />
•Questions liées àlafondation d’un cabinet •Administration du cabinet •Transfert /reprise decabinet<br />
•Financement du cabinet et planification financière •Prévoyances risque et vieillesse personnelles •Assurance<br />
du cabinet, assurance dommages et assurance responsabilité civile professionnelle •Optimisation de la<br />
planification fiscale •Séminaires portant sur divers thèmes, parmi lesquels: ouverture/reprise de cabinet, comp-<br />
tabilité/fiscalité, ateliersrelatifs<br />
àl’informatique •Remises ou reprises de cabinets etmarché des cabinets médi-<br />
caux en ligne sur www.fmhprax.ch •Planification et gestion de la succession •Calculs de la valeur de cession<br />
globale/vente ducabinet médical •Plateforme d’annonces en ligne sur le site www.fmhjob.ch •Factoring<br />
(rachat des créances d’honoraires) •Encaissement des notes d’honoraires impayées<br />
FMH Consulting Services<br />
Burghöhe 1•Case postale 246•6208 Oberkirch<br />
Tél. 041 925 00 77 •Fax 041 921 05 86<br />
mail@fmhconsulting.ch•www.fmhconsulting.ch
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.<br />
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht<br />
auch mal pünktlich sein?<br />
Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle<br />
Neuengasse 5 n 2502 Biel<br />
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66<br />
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch<br />
Inkassodienstleistungen<br />
für Ärzte<br />
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen<br />
über das komplette Leistungspaket von:<br />
o FMH Inkasso Services<br />
o FMH Factoring Services<br />
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:<br />
Telefon: Beste Anrufzeit:<br />
NEU<br />
mediserv AG n Koordinationsstelle<br />
Neuengasse 5 n 2502 Biel<br />
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11<br />
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch<br />
Honorarabrechnung für Ärzte<br />
inklusive Übernahme des Verlustrisikos<br />
und Auszahlung innert Sekunden<br />
Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11<br />
Name der Praxis:<br />
Ansprechpartner:<br />
Adresse /Stempel:<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
21/11<br />
35/09
Etes-vous bien conseillé(e)?<br />
"<br />
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
FMH Fiduciaire Services – principale société fiduciaire pour le corps médical<br />
Vous recherchez de l’aide pour créer ou gérer un cabinet médical ou encore pour un cas de succession? Quel<br />
que soit votre besoin – élaboration d’un plan d’affaires, comptabilité, clôture de l’exercice, déclaration d’im-<br />
pôts ou révision des comptes – nos experts fiduciaires vous apporteront des solutions sur mesure. Nous<br />
sommes bien implantés dans les trois régions linguistiques, et parfaitement au fait de la législation cantonale et<br />
des dispositions légales spécifiques à votre profession.<br />
Nous vous proposons un large éventail de prestations de services<br />
Finances et comptabilité<br />
n Plan d’affaires, plan financier n Possibilités de financement<br />
n Gestion de la trésorerie n Aide à l’établissement et à la clôture des comptes<br />
n Comptabilité n Administration du personnel et comptabilité des salaires<br />
n Compte des investissements n Etablissement des décomptes d’assurances sociales<br />
n Tenue des comptes créditeurs et débiteurs<br />
avec gestion des relances<br />
Analyses<br />
n Analyse de l’état financier et du résultat en cas de problèmes financiers<br />
n Interprétation du «Miroir du cabinet» (TrustCenter)<br />
Fiscalité<br />
n Etablissement des déclarations d’impôts n Conseil en matière de TVA<br />
n Conseil en matière d’impôts et n Etablissement du décompte de TVA<br />
planification fiscale stratégique<br />
Faites confiance à notre vaste et solide réseau de spécialistes!<br />
Talon-réponse Prière de l’envoyer ou le faxer au: 041 921 05 86<br />
Prénom / Nom<br />
Adresse<br />
NPA / Lieu<br />
Date de naissance<br />
Téléphone privé/cabinet<br />
Atteignable le plus facilement (heure)<br />
m Je suis intéressé(e) par les prestations<br />
de FMH Fiduciaire Services.<br />
Veuillez me contacter.<br />
FMH FIDUCIAIRE<br />
/ FMH TS<br />
21/11<br />
FMH Consulting Services n Coordination<br />
Burghöhe 1 n 6208 Oberkirch<br />
Téléphone 041 925 00 77 n Fax 041 921 05 86<br />
mail@fmhfiduciaire.ch n www.fmhfiduciaire.ch Talon-Code:
Redaktionelle ResponsabilitéVerantwortung: rédactionnelle: FMH SERVICES<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Assurance responsabilité civile professionnelle<br />
Augmentation de la somme assurée dans notre contrat collectif<br />
"<br />
Les demandes de dédommagement ont malheureusement augmenté ces derniers temps. Les exigences<br />
ont également augmenté considérablement. Ainsi une récente décision du tribunal fédéral a accepté la<br />
responsabilité d’un hôpital impliqué dans un cas tragique en 1997. La demande de dédommagement<br />
se monte à 13 millions francs.<br />
Ces développements nous ont poussés à négocier des nouvelles couvertures pour l’assurance responsabilité<br />
civile professionnelle des médecins indépendants:<br />
Activité Somme assurée<br />
Sans chirurgie 5000000 CHF<br />
Avec chirurgie 10000000 CHF<br />
Si vous le désirez vous pouvez demander de plus hautes sommes d’assurances. Tous les médecins qui<br />
sont déjà assurés par la convention d’assurance FMH Insurance Services sont en mesure d’augmenter<br />
la couverture de la somme assurée avant l’expiration du contrat. Vous ne bénéficiez pas encore des<br />
avantages de la convention d’assurance FMH Insurance Services? Faites-nous parvenir une copie de votre<br />
police d’assurance actuelle. Nous vérifierons pour vous à quel moment un changement de convention<br />
d’assurance serait possible et vous soumettrons une offre adéquate.<br />
Talon-réponse A envoyer ou faxer au: 031 959 50 10<br />
Prénom / Nom ________________________________________________________________________<br />
Adresse ________________________________________________________________________<br />
NPA / Lieu ________________________________________________________________________<br />
Date de naissance ________________________________________________________________________<br />
Téléphone privé / cabinet ________________________________________________________________________<br />
Atteignable le plus facilement (heure) ________________________________________________________________________<br />
Adresse e-mail ________________________________________________________________________<br />
m Prière de m'envoyer une offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle<br />
(Prière de joindre une copie de votre police existante).<br />
Activité<br />
Spécialités<br />
Acitivité avec le laser? m Non m Oui ’ m Laquelle?<br />
Degré d'occupation<br />
Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):<br />
– Nombre de personnes<br />
– Degré d'occupation par personne<br />
Nom de l'assureur précédent<br />
Sinistres dans les 5 dernières années? m Non m Oui ’ m Quoi?<br />
m Je désire un conseil personnalisé,<br />
téléphonez-moi.<br />
m Je suis intéressé à:<br />
m Placement financier m Caisse de pension LPP<br />
m Pilier 3a m Protection juridique<br />
m Planification financière m Caisse-maladie<br />
m<br />
Roth Gygax & Partner AG n Service de coordination<br />
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen<br />
Téléphone 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10<br />
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch<br />
Talon-Code: IN2111 / Berufshaftpflicht
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Anmerkungen zur Masernepidemie 2011<br />
Impfkampagnen müssten vermehrt<br />
auf Adoleszenten fokussieren<br />
Markus Gassner<br />
Korrespondenz:<br />
Dr. med. Markus Gassner<br />
Arzt für Innere Medizin FMH<br />
speziell Allergologie<br />
und klin. Immunologie<br />
Spit<strong>als</strong>tr. 8<br />
CH-9472 Grabs<br />
m.gassner@hin.ch<br />
Abbildung 1<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Im April 2011 orientierte das Bundesamt für Gesundheit<br />
(BAG) via kantonale Gesundheitsdepartemente<br />
zur aktuellen Masernepidemie [1]. Die Angaben zu<br />
den 239 Patienten, die zu diesem Zeitpunkt gemeldet<br />
waren (erfasst wurden die 12 letzten Wochen; aktuelle<br />
Woche = 14) zeigen auch die Altersverteilung der<br />
Erkrankten (Abb. 1).<br />
Nur 8,4% der Masernfälle betreffen<br />
Kleinkinder<br />
Bei der Epidemie 2011 ist knapp die Hälfte der Erkrankten<br />
(118 von 239 oder 49,3 %) über 20 Jahre alt.<br />
Beginn der Masernepidemie 2011: Altersverteilung der ersten 239 Erkrankten (Quelle: [1]).<br />
Abbildung 2<br />
Masernerkrankungen in der Schweiz 2011 (Woche 2–14, n 239) nach Alter<br />
Anzahl in der Schweiz verkaufter Masernimpfdosen(1966–1993) in Tausend<br />
(Quelle: Info BAG 1994, zit. in [2]).<br />
Anzahl verkaufter Masernimpfdosen in der Schweiz<br />
Im Adoleszentenalter, zwischen 15 und 25 Jahren,<br />
sind es 86 bzw. 36,0%. Nur 20 (8,4%) der Fälle betreffen<br />
Kleinkinder im Alter von unter 4 Jahren und 51<br />
(22,2%) die Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen, <strong>als</strong>o<br />
Schüler, die meist eine öffentliche Schule besuchen.<br />
Für das Verständnis der Masernepidemiologie in<br />
der Schweiz sind Kenntnisse der vergangenen Impfpolitik<br />
essentiell. Gemäss der Statistik verkaufter<br />
Impfdosen (Abb. 2) wurde die Masernimpfung in der<br />
Schweiz 1966–1986 generell kontinuierlich eingeführt<br />
[2], allerdings mit kantonalen Unterschieden.<br />
Vergleiche mit ausländischen Impfkampagnen sind<br />
deshalb nicht möglich. 1974 überstieg die Anzahl<br />
verkaufter Dosen erstm<strong>als</strong> jene der registrierten Geburten.<br />
Erst 1986 war aber die Zahl der verfügbaren<br />
Impfdosen deutlich höher <strong>als</strong> diejenige der im selben<br />
Jahr geborenen Kinder. Es ist anzunehmen, dass<br />
seit dieser Zeit mit steigender Tendenz die meisten<br />
Kinder geimpft wurden. Entsprechend nimmt<br />
das Erkrankungsrisiko für Masern mit zunehmendem<br />
Alter kontinuierlich ab (Abb. 1: Alterskategorien<br />
20–64 Jahre).<br />
Die Daten aus den ersten Sentinella-Statistiken<br />
(Abb. 3) ergaben, dass bis 1990 die Masernviren noch<br />
frei zirkulierten [3]. Die Kinder erkrankten im Kleinkinder-<br />
oder Schulalter. Erkrankungen bei Adoleszenten<br />
und Erwachsenen waren sehr selten (Nicht-<br />
Geimpfte erkrankten bereits im Schulalter). Erst ab<br />
1988/90 ergab sich eine Tendenz zur Verschiebung in<br />
das Alter nach Abschluss der öffentlichen Schulpflicht.<br />
Die Daten der aktuellen Epidemie zeigen<br />
diese Verschiebung nun sehr deutlich: Die Masern<br />
sind keine Kinderkrankheit mehr.<br />
Impfkonzept ungenügend<br />
Wenn man die Masern eliminieren möchte, genügt<br />
das aktuelle Impfkonzept nicht, das darin besteht,<br />
«nur» Kleinkinder optimal zu impfen (siehe dazu<br />
Kasten 1). Die Verdienste und Bemühungen der Kinder-<br />
und Hausärzte sollen damit nicht geschmälert<br />
werden. Man müsste aber sofort mit einer Impfaktion<br />
bei den Adoleszenten beginnen: Die höchste Erkrankungsrate<br />
besteht in der Alterskategorie der 15- bis<br />
19-Jährigen. Die Impfkampagne müsste auch in den<br />
nächsten Jahren konsequent fortgesetzt werden. Adoleszente<br />
besuchen Schulen, in denen sie noch einfach<br />
gezielt erfasst und geimpft werden könnten. Jedes<br />
Jahr ohne unkomplizierte Impfaktion bei Adoleszenten<br />
in den Schulen ist deshalb gleichbedeutend mit<br />
einem verlorenen Jahrgang. Erkrankungen im Er-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
814
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Abbildung 3<br />
Altersverteilung der Masernerkrankungen in Sentinella-Praxen 1986–1990 (Quelle: [3]).<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
werbsleben kosten ein Vielfaches. Gerade hier wird<br />
ein Nichthandeln (Laisser-faire) immer teurer.<br />
Kasten 1<br />
Altersverteilung<br />
Vergleich der Altersverteilungen<br />
– Die Masernimpfung ist sehr wirksam.<br />
– Pädiater und Hausärzte impfen Kleinkinder<br />
sehr gut.<br />
– Adoleszente und Erwachsene werden schlecht<br />
geimpft.<br />
– Nicht-Geimpfte werden älter und infizieren<br />
sich gegenseitig.<br />
– Die aktuelle Impfkampagne ist für Adoleszenten<br />
irrelevant.<br />
– Die gesetzlichen Grundlagen zum Impfen<br />
sind ungenügend.<br />
In der Schweiz werden die Kosten der Prävention<br />
mit Impfungen zum Schutze vor Epidemien der Eigenverantwortung<br />
überlassen bzw. den Krankenkassen.<br />
Diese Konzepte sind mit Sicherheit bei ansteckenden<br />
Krankheiten ungenügend. Vor der Einführung des<br />
Krankenversicherungsgesetzes (KVG) wurden Impfungen<br />
im Schulalter in den meisten Kantonen vom<br />
Staat (meist von der Schulgemeinde) bezahlt, Impfungen<br />
beim Hausarzt galten für Krankenkassen <strong>als</strong><br />
nicht zu bezahlende präventive Leistung. Impfstoffe<br />
wurden entsprechend bis 1995 wie Hustenbonbons<br />
behandelt, meist nicht bezahlt.<br />
In der Schweiz will man in erster Linie Steuern<br />
sparen. Deshalb wurden mit der Einführung des KVG<br />
die Impfkosten ohne gesetzliche Notwendigkeit auch<br />
im Schularztdienst den Krankenkassen überwälzt.<br />
Zudem wollte man die Praxispädiatrie und die Hausarztmedizin<br />
fördern. Dies ist nach wie vor wichtig<br />
und effektiv bezüglich Durchimpfungsrate bei Klein-<br />
kindern, was mit der Abnahme von Masernerkrankungen<br />
bei Kindern in dieser Epidemie gut belegt<br />
werden kann. Dieses Konzept funktioniert aber nicht<br />
bei Schulkindern, und bei jungen Erwachsenen wirkt<br />
sich zudem negativ aus, dass man mit hohen Franchisen<br />
im Gesundheitswesen Kosten sparen möchte. Gesunde<br />
Erwachsene müssen Impfungen in der Schweiz<br />
de facto selbst bezahlen, was das Impfen eindeutig<br />
erschwert.<br />
Kasten 2<br />
Impfaktion bei Adoleszenten<br />
– Gratisimpfung<br />
– Impfungen müssen in allen höheren Schulen<br />
angeboten werden<br />
– Impfungen in Sprachschulen<br />
– Impfung aller Asylbewerber<br />
– Keine unnötigen Formalitäten<br />
– Der Bund übernimmt Haftpflicht für Impfschäden<br />
– Impfungen: nicht nur Masern (MMR), sondern<br />
auch Hepatitis B<br />
Der Schularztdienst wurde über das KVG desavouiert.<br />
Mit Formularen zum Impfen zu Dumpingpreisen<br />
wurde diese Arbeit zusätzlich erschwert [4].<br />
Man verlangt bei 15-Jährigen von den Eltern ein<br />
schriftliches Einverständnis zum Impfen (wird der<br />
Arzt von den gleichen Kindern wegen einer Schwangerschaft<br />
konsultiert, darf er die Eltern nicht orientieren!).<br />
Konsequente Impfungen werden im obligatorischen<br />
Schularztdienst nicht mehr flächendeckend<br />
durchgeführt. Teilweise wurde der Schularztdienst<br />
sogar ganz abgeschafft.<br />
Schweiz in Sachen Masernprävention<br />
ein Entwicklungsland<br />
Die aktuelle Masernepidemie zeigt, dass die Schweiz<br />
im Hinblick auf die Prävention mit Impfungen ein<br />
Entwicklungsland geblieben ist. Die Durchimpfungsrate<br />
bei Adoleszenten bleibt ungenügend und wird<br />
sich in den nächsten Jahren kontinuierlich verstärken,<br />
weil immer mehr Nicht-Geimpfte erwachsen<br />
werden. Wie <strong>als</strong> Beispiel aus dem Umfeld des Schreibenden<br />
bei früherer Gelegenheit berichtet, hat am<br />
7. Juni 2008 in Buchs SG ein 53-jähriger erkrankter<br />
Gewerbeschullehrer in der Praxis seiner Hausärztin<br />
eine weitere 43-jährige Patientin infiziert [5].<br />
Die aktuelle Impfkampagne im Rahmen der Europäischen<br />
Impfwoche ist sehr gut für die Masernprävention<br />
bei Kleinkindern (Kerze zum ersten Geburtstag),<br />
aber völlig ungenügend zur Prävention<br />
bei Adoleszenten. Ein Konzept, wie Adoleszenten in<br />
höheren Schulen unkompliziert geimpft werden<br />
könnten, fehlt schlichtweg. Deshalb die Vorschläge<br />
im Kasten 2:<br />
Natürlich ist es ungünstig, Schüler während der<br />
Examen zu impfen; zumal die Masernviren sich eben-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 815
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
falls an den Schulplan zu halten scheinen – Epidemien<br />
brechen bevorzugt im Frühling vor den Examen<br />
aus! Deshalb wären die nächsten Wochen für dieses<br />
Jahr der letztmögliche Zeitpunkt für die Impfungen<br />
vor dem Lehrabschluss. Leider wird wohl kaum jemand<br />
in unserem Gesundheitswesen diese Empfehlung<br />
ernst nehmen. Im Herbst wird auch die aktuelle<br />
Epidemie dann vergessen sein, in 2–3 Jahren folgt mit<br />
Sicherheit die nächste, und man wird wieder genau<br />
gleich (nicht) handeln. Unsere Adoleszenten werden<br />
weiterhin Masernviren exportieren. Früher wurden in<br />
der Schweiz schützende Impfviren produziert und<br />
exportiert, heute verbreiten Schweizer im Ausland<br />
krankmachende Viren!<br />
Auch Hepatitis-B-Impfung wichtig<br />
Wichtig ist im übrigen, dass nicht nur gegen Masern,<br />
Röteln ( und Mumps) geimpft wird. Pro Jahr registriert<br />
das BAG auch 50–80 akute (!) Hepatitis-B-Fälle.<br />
Gesunde Erwachsene müssen<br />
Impfungen in der Schweiz de facto<br />
selbst bezahlen, was das Impfen<br />
eindeutig erschwert.<br />
Die Kosten der Behandlung sind um ein Vieltausendfaches<br />
höher <strong>als</strong> diejenigen der Impfungen. Epidemiologisch<br />
langfristig wichtiger ist, dass dank Impfungen<br />
auch Mutter–Kind-Infektionen vermieden<br />
werden. Dies verhindert neue Träger von Hepatitisviren<br />
und somit künftige Infektionen. Auch die Impfung<br />
gegen Poliomyelitis ist nach wie vor sehr<br />
wichtig.<br />
Anzuraten sind auch Impfaktionen im Rahmen<br />
von Sprachkursen bei Fremdsprachigen. Dies gilt insbesondere<br />
für Frauen, welche infolge Heirat dauernd<br />
hier leben werden. Nicht nur die Sprache, sondern<br />
auch die Immunität der Mutter ist für das Wohl ihrer<br />
Kinder wesentlich.<br />
Aktuelle juristische Empfehlungen sind konfus,<br />
speziell im Zusammenhang mit der Informationspflicht<br />
und Haftpflichtfragen. Ausser einer Schwangerschaft<br />
und Nebenwirkungen bei früheren Impfungen<br />
gibt es bei gesunden Adoleszenten und Erwachsenen<br />
keine relevante Kontraindikation. Kranke<br />
sollen nach wie vor beim Hausarzt geimpft werden.<br />
Der Bundesrat hat am 3. Dezember 2010 einen<br />
Gesetzesentwurf zur Revision des Epidemiegesetzes<br />
an das Parlament überwiesen. Wesentliche Vorschläge<br />
von FMH, SAMW, Public Health Schweiz und<br />
der <strong>Schweizerische</strong>n Gesellschaft für Allergologie und<br />
Immunologie SGAI bei der Vernehmlassung wurden<br />
nicht berücksichtigt. Einfach passiv beobachten, was<br />
Parlamentarier beschliessen, ist politisch unklug. Wie<br />
war das mit dem Transplantationsgesetz?<br />
Der Einsatz aller Ärzte für ein gutes Epidemiegesetz<br />
(EpiG) ist jetzt sinnvoll und notwendig!<br />
Literatur<br />
1 Mitteilung BAG vom 19.4.2011, gemäss Information<br />
des Kantonsarzts St.Gallen.<br />
2 Gassner M. Masernimpfung: Gute Herdimmunität<br />
gefährdet. Ars Medici. 1996:86(9): 572–7.<br />
3 Gassner M., Zimmermann H.P. Masern, Röteln,<br />
Mumps. In: Sentinella 1989/90. Ein Bericht der<br />
Sentinella-Arbeitsgemeinschaft. Bern: Bezugsquelle<br />
BAG; 1991. S. 65–76.<br />
4 Gassner M. Schularztdienst und Sozialversicherungen.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2002;83(35):1830–2.<br />
5 Gassner M. Die Masern sind erwachsen geworden.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2008;89(32):1358–9.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 816
Tagungsbericht TRIBÜNE<br />
Reflets d’une conférence donnée par Stephen Ray Mitchell,<br />
Doyen à Georgetown University, Washington D.C.<br />
Médecines complémentaires à l’Université:<br />
aussi pour le développement personnel<br />
des étudiants… et des professeurs<br />
Bertrand Graz<br />
Remerciements à E. Bonvin,<br />
PA. Michaud et PY. Rodondi<br />
pour leurs commentaires sur<br />
une version antérieure de ce<br />
compte rendu.<br />
1 Stephen Ray Mitchell<br />
(Professor and Dean of<br />
Medical Education at<br />
Georgetown University,<br />
Washington D.C.):<br />
Complementary and<br />
Alternative Medicine in the<br />
spirit of St Ignatius: The<br />
development of Cura<br />
Personalis at Georgetown.<br />
Conférence donnée<br />
au CHUV, Lausanne,<br />
le 22 février 2011.<br />
Correspondance:<br />
Dr Bertrand Graz<br />
Unité de recherche et<br />
d’enseignement sur les<br />
médecines complémentaires<br />
Département Formation et<br />
Recherche Faculté de Biologie<br />
et Médecine<br />
Bugnon 21<br />
CH-1011 Lausanne<br />
bertrand.graz@chuv.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
A l’occasion d’une visite d’accréditation à l’Université<br />
de Lausanne en février 2011 [1], le Professeur Stephen<br />
Ray Mitchell nous a présenté un historique et l’état<br />
actuel des enseignements et recherches en matière de<br />
Médecines complémentaires (MC) dans son Ecole de<br />
médecine, en insistant sur un usage original de cellesci:<br />
l’aide au développement personnel des étudiants<br />
et des professeurs. Comment en sont-ils arrivés là?<br />
Voici quelques reflets des explications du professeur<br />
Mitchell.<br />
Distinguer le bon grain de l’ivraie?<br />
A l’Université Georgetown, comme dans bien des institutions<br />
aux Etats-Unis, les années ’90 ont été marquées<br />
par une prise de conscience de l’ampleur du phénomène<br />
de l’utilisation des MC par la population et<br />
par un nombre croissant de médecins. Avec le pragmatisme<br />
qui caractérise les Américains, la question n’a pas<br />
été tant de décider si on était «pour» ou «contre» ces<br />
approches non-conventionnelles, mais bien plutôt de<br />
savoir ce qu’on allait faire de ce phénomène.<br />
Pour commencer, un programme d’enseignement<br />
et de recherche a été développé avec le soutien du<br />
«National Center for Complementary and Alternative<br />
Medicine» (NCCAM), qui fait partie du National Institute<br />
of Health (NIH). Depuis la fin des années ’90,<br />
le NCCAM met au concours environ 100 millions de<br />
dollars par an pour des projets de recherche sur les<br />
MC, les «Complementary and Alternative Medicines»<br />
ou «CAM». Aujourd’hui, le budget de la recherche sur<br />
les MC dépasse 300 millions de dollars par an au niveau<br />
national et Georgetown poursuit son programme de<br />
recherche et d’enseignement depuis dix ans. Les recherches<br />
menées sur les MC sont essentiellement de<br />
trois types: les recherches épidémiologiques sur l’utilisation<br />
des MC; les recherches cliniques sur l’efficacité<br />
et les effets secondaires ou interactions de di-<br />
verses approches dans des situations spécifiques; la<br />
recherche fondamentale sur les mécanismes d’action<br />
au niveau physiologique, moléculaire ou génétique.<br />
En 2002, Georgetown a été parmi les premiers à<br />
rejoindre le nouveau Consortium des centres académiques<br />
de médecine intégrative, qui réunit les institutions<br />
nord-américaines ayant un programme d’enseignement<br />
sur les MC. On dénombre 45 membres<br />
aujourd’hui, parmi lesquels Georgetown, UCSF, Stanford,<br />
Harvard, etc. Le terme «médicine intégrative»<br />
est relativement récent et se réfère à la volonté d’intégrer<br />
dans les soins conventionnels les prestations MC<br />
pour lesquelles de solides données factuelles d’efficacité<br />
et de sécurité existent.<br />
Une attitude professionnelle pour une<br />
information objective du patient<br />
Avant d’utiliser les MC pour aider les étudiants à<br />
atteindre d’autres objectifs d’enseignements, l’Ecole de<br />
médecine de Georgetown a participé à l’élaboration<br />
d’une liste des connaissances, attitudes et compétences<br />
principales à enseigner vis-à-vis des MC elles-mêmes.<br />
Ce travail a coïncidé avec la publication, en 2005, de<br />
recommandations de l’Institute of Medicine (organe<br />
Le «National Center for Complementary and Alternative Medicine»<br />
met au concours environ 100 millions de dollars par an pour des projets<br />
de recherche sur les MC.<br />
du «National Academy of Sciences») sur la manière<br />
d’incorporer une information suffisante sur les MC<br />
dans le curriculum médical, de manière à rendre les<br />
médecins capables de conseiller leurs patients sur le sujet.<br />
Il ne s’agit pas d’enseigner des méthodes (par<br />
exemple, l’acupuncture) mais d’acquérir quelques<br />
connaissances générales sur les MC et de développer<br />
des attitudes et des compétences permettant de dialoguer<br />
adéquatement avec le patient sur le sujet. L’apprentissage<br />
par l’expérience est un élément important<br />
à Georgetown. Une technique utilisée consiste à discuter<br />
de l’évidence à partir d’un article rapportant une ou<br />
des études cliniques sur une prestation classée parmi<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
817
Tagungsbericht TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
les MC, puis d’essayer de traduire cette discussion dans<br />
la rencontre avec le patient. A noter que, contrairement<br />
à ce qui est souvent dit, il existe une littérature<br />
clinique non-négligeable sur le sujet, avec quelques<br />
milliers d’essais randomisés contrôlés publiés et plus<br />
de 300 revues systématiques (www2.cochrane.org/<br />
reviews/en/topics/22_reviews.html).<br />
Un professeur de physiologie à Georgetown,<br />
Aviad Haramati, a proposé d’insérer, déjà durant les<br />
études précliniques, des notions sur les MC: explications<br />
sur les effets possibles des massages pendant les<br />
cours d’anatomie, mécanismes d’action du biofeedback<br />
en physiologie, recherches en cours sur les effets<br />
de programmes de réduction du stress en endocrinologie,<br />
pharmacologie de quelques plantes médicinales<br />
d’usage courant, etc.<br />
En plus de l’enseignement sur les MC, Aviad Haramati<br />
a proposé d’utiliser certaines MC pour répondre<br />
à de nouveaux objectifs d’enseignement pour les étudiants<br />
en médecine. Dès lors, il ne s’agirait plus d’enseignement<br />
sur les MC, mais d’utilisation des MC au<br />
service de l’enseignement.<br />
De nouvelles techniques au service<br />
de la formation des futurs médecins<br />
Au début des années 2000, les nouveaux objectifs<br />
d’enseignement incluent désormais des notions<br />
comme le soin de soi, la conscience de soi et le développement<br />
personnel (self care, self awareness et personal<br />
growth). Ces compétences sont considérées<br />
comme importantes par un grand nombre d’écoles de<br />
médecine. La raison peut être résumée ainsi: Chez les<br />
jeunes médecins, la compétence technique est en<br />
général bonne, mais les patients ont souvent l’impression<br />
qu’il manque chez leur soignant la capacité<br />
à communiquer avec attention, empathie et respect.<br />
On a par exemple observé que l’empathie des étudiants<br />
en médecine, élevée en première année, diminue<br />
sensiblement au cours des études. De nom-<br />
breuses écoles ont adopté des objectifs «d’attitude»<br />
aux Etats-Unis. En Europe le mouvement est lancé,<br />
comme on le voit avec les objectifs proposés dès l’an<br />
2000 pour le Scottish Doctor, qui incluent le personal<br />
development, lui-même comprenant selfawareness,<br />
selfcare & relaxation (www.scottishdoctor.org/node.<br />
asp?id=1200000000). En Suisse on trouve déjà dans le<br />
Swiss Catalogue of Learning Objectives for Undergraduate<br />
Medical Training la reconnaissance de son propre<br />
stress et l’attention à sa propre santé, ainsi que la<br />
place centrale des souhaits et préférences du patient<br />
dans la décision médicale (http://sclo.smifk.ch/<br />
downloads/sclo_2008.pdf),<br />
Pourquoi chercher du côté des MC pour aider les<br />
étudiants à atteindre de tels objectifs? A cette proposition<br />
de son collègue Aviad Haramati, le Professeur Mitchell<br />
admet volontiers qu’il fut le premier à sursauter.<br />
A Georgetown, les bases d’inspiration plongent plutôt<br />
leurs racines du côté de la religion catholique, au<br />
moins jusqu’à Ignace de Loyola et sa «cura personalis».<br />
Dans un tel milieu, on aurait songé d’abord à réintroduire<br />
des cours de philosophie, voire de métaphy-<br />
Contrairement à ce qui est souvent dit, il existe une littérature clinique<br />
non-négligeable sur les Médecines complémentaires, avec quelques<br />
milliers d’essais randomisés.<br />
Le professeur Stephen Ray<br />
Mitchell de l’Université<br />
Georgetown, Washington<br />
D.C., a présenté ses idées de<br />
l’utilisation des Médecines<br />
complémentaires au service<br />
de l’enseignement.<br />
sique ou de théologie. Serait-ce possible dans une<br />
Faculté de médecine à l’aube du XXI e siècle? Devraiton<br />
préférer des cours de psychologie appliquée à soimême,<br />
des cours d’introspection, d’hygiène de vie?<br />
Tout cela semblait sans doute assez peu faisable à notre<br />
époque, trop daté, démodé. De plus, des enquêtes préalables<br />
montraient que le problème principal des étudiants<br />
en médecine était le stress et ses conséquences:<br />
états dépressifs et burnout, lesquels s’avéraient avoir des<br />
conséquences néfastes sur les attitudes qu’on cherchait<br />
à promouvoir, telle l’empathie.<br />
La question se précisait dès lors ainsi: Comment<br />
aider les étudiants à gérer le stress, d’ailleurs largement<br />
généré par l’école elle-même et la compétition<br />
qui y règne? Aviad Haramati proposait une approche<br />
qui faisait appel à des techniques considérées comme<br />
MC, et voici comment il l’argumentait: Des techniques<br />
développées récemment à Harvard on été élaborées<br />
dans le but précis de lutter contre le stress; de<br />
plus, elles ont été validées par des études cliniques<br />
comparatives. Il s’agit de la gestion (ou réduction) du<br />
stress par «pleine conscience» (mindfullnessbased<br />
stress management), qui se présente comme des exercices<br />
personnels apparentés notamment au training<br />
autogène et sont regroupés sous le terme générique de<br />
techniques mindbody. Du moment qu’elles ne sont<br />
pas (ou pas encore) parmi les outils standard en médecine<br />
conventionnelle, elles font partie des MC.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 818
Tagungsbericht TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Implanter, évaluer, répliquer<br />
A première vue, développer ou maintenir son empathie,<br />
gérer son stress et sa fatigue, tout cela n’a rien à<br />
voir avec les MC. C’est pourtant du côté des MC que<br />
Georgetown a choisi de se tourner pour aider les étudiants<br />
à atteindre de tels objectifs. En fait, l’empathie,<br />
la régulation du stress, etc., sont à la fois des objectifs<br />
d’apprentissage – puis des objectifs de bonne pratique –<br />
et le but affiché par certaines MC. Un but plus qu’affiché,<br />
d’ailleurs, puisqu’on dispose de données factuelles<br />
montrant que ces buts sont atteints avec certaines<br />
MC de type mindbody dans un nombre<br />
appréciable de cas.<br />
Voilà pourquoi le Professeur Haramati a reçu le<br />
feu vert pour introduire un enseignement pilote de<br />
réduction du stress par des techniques mindbody<br />
pour les étudiants en médecine de Georgetown. Dans<br />
cette Ecole, il y avait dès lors deux types d’enseignement<br />
bien distincts mais tous deux en rapport avec<br />
les MC: un enseignement sur les MC et un enseignement<br />
par les MC, ce dernier dévolu à l’apprentissage<br />
de la gestion du stress. Il a joint au cours de réduction<br />
du stress par les techniques mindbody une évaluation<br />
soigneuse par questionnaires et un dosage d’une<br />
«hormone de stress», le cortisol salivaire. Résultats: Le<br />
cortisol salivaire reste stable pendant les examens<br />
chez les étudiants qui ont suivi le cours de réduction<br />
du stress, alors qu’il augmente chez les autres. Suite à<br />
des évaluations positives, cet enseignement est proposé<br />
facultativement aux étudiants de la 1 re à la 4 e année.<br />
La moitié des étudiants y participent. L’histoire<br />
ne dit pas, cependant, si la participation à ce cours<br />
améliore les résultats aux examens!<br />
Il reste surtout à vérifier si des étudiants plus aptes<br />
à gérer leur stress deviennent de meilleurs médecins.<br />
Est-ce qu’ils développent ces «attitudes» souhaitées,<br />
empathie, ouverture d’esprit, écoute – tout en gardant<br />
la rigueur nécessaire? Les témoignages d’étudiants<br />
ayant terminé leurs études le laissent espérer,<br />
mais, comme le rappelle le conférencier, «the plural of<br />
anecdotes is not data». Autrement dit, il reste souhaitable<br />
de documenter scientifiquement les premières<br />
impressions.<br />
En attendant d’avoir assez de recul pour tenter de<br />
répondre, Stephen Mitchell et son équipe sont en<br />
train de développer d’autres instruments de mesure,<br />
telle une «échelle d’empathie» pour voir si les techniques<br />
mises en œuvre aident aussi à préserver cette<br />
qualité qui semble habituellement s’amenuiser au<br />
cours des études. L’enseignement du stress management<br />
a fait des émules dans la Faculté de Droit de la<br />
même université. Les résultats étaient si encourageants<br />
que Mitchell a proposé la méthode à ses collègues,<br />
les professeurs de l’Ecole de médecine. Les collègues<br />
ont bien voulu se prêter à l’expérience. Résultats<br />
selon le Doyen: «It changed my life», cela lui a<br />
changé la vie, car les réunions de professeurs sont devenues<br />
plus agréables, avec une meilleure écoute et<br />
un dialogue plus respectueux et plus constructif. Là<br />
aussi on attend les résultats de recherche sur les perceptions<br />
des professeurs et peut-être le cortisol salivaire.<br />
En bref…<br />
Lors de cette conférence, originale dans le milieu<br />
médical académique, on a pu percevoir une sorte de<br />
«saut logique»: A la suite d’un enseignement sur les<br />
MC, un autre enseignement a été introduit, qui se fait<br />
Il ne s’agirait plus d’enseignement sur les Médecines complémentaires,<br />
mais de leur utilisation au service de l’enseignement.<br />
cette fois par des méthodes relevant des MC. On peut<br />
se demander si l’introduction d’expérimentations par<br />
l’étudiant durant ses études (self awareness etc.) pourrait<br />
occulter la confrontation à ces pratiques dans une<br />
perspective clinique: Est-ce que des données tirées de<br />
l’expérience sur des étudiants ou des professeurs<br />
peuvent servir à légitimer l’application de ces méthodes<br />
à l’échelle de populations de malades? Là n’est<br />
sans doute pas le but de ces nouveaux enseignements.<br />
Il semble en tout cas utile de garder à l’esprit le risque<br />
que contient une approche qui consisterait à favoriser<br />
le marché des recettes et de la «trucologie», si cela<br />
devait se faire au détriment de la qualité des aptitudes<br />
relationnelles d’un médecin et sa capacité à appréhender<br />
la singularité de chacun de ses patients.<br />
Deux propositions à méditer ressortent de cette<br />
conférence:<br />
– La place et le statut des médecines complémentaires<br />
ont profondément changé ces dernières années<br />
de l’autre côté de l’Atlantique; le milieu académique,<br />
pragmatique, y trouve des sujets de<br />
recherches et y puise de nouvelles pratiques.<br />
– Les qualités humaines du médecin (écoute, respect,<br />
empathie,…), loin d’être mises de côté<br />
comme certains détracteurs de notre profession<br />
l’ont souvent dit, font au contraire l’objet de<br />
préoccupations toujours renouvelées; ceci passe<br />
actuellement par l’inscription du développement<br />
d’attitudes et capacités professionnelles spécifiques<br />
parmi les objectifs d’enseignement, par le<br />
développement d’enseignements qui visent à aider<br />
les étudiants à atteindre ces objectifs – et qui font<br />
appel à des techniques nouvelles appartenant aux<br />
Médecines complémentaires.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 819
Spectrum TRIBÜNE<br />
Journée européenne contre<br />
l’obésité: halte au yo-yo<br />
La Journée européenne contre<br />
l’obésité est une campagne consa-<br />
crée à la lutte contre l’obésité orga-<br />
nisée chaque année dans toute<br />
l’Europe le troisième samedi du<br />
mois de mai. L’objectif de la JEO est<br />
d’encourager les citoyens européens<br />
présentant une surcharge pondérale<br />
à mettre en place les changements<br />
de style de vie qui s’imposent pour<br />
retrouver un poids sain afin d’amé-<br />
liorer leur santé et leur qualité de<br />
vie. Car l’obésité est une des pre-<br />
mières causes de décès et de maladie<br />
qu’il est possible de prévenir en<br />
Europe. D’après l’Organisation mon-<br />
diale de la Santé (OMS), la surcharge<br />
pondérale et l’obésité sont chaque<br />
année à l’origine de plus d’un mil-<br />
lion de décès et de 12 millions d’an-<br />
nées de vie en mauvaise santé.<br />
Mehr Aidsfachleute<br />
für Simbabwe<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
(JEO)<br />
Das Ausbildungszentrum, das die<br />
Newlands Clinic dank einer gross-<br />
zügigen Spende der Bernhart-Mat-<br />
ter-Stiftung in Simbabwes Haupt-<br />
stadt Harare eröffnen konnte, hat<br />
seinen Betrieb erfolgreich aufge-<br />
nommen. Dank dem neuen Zen-<br />
trum der Stiftung Swiss Aids Care<br />
International von Prof. Ruedi Lüthy<br />
können deutlich mehr einheimi-<br />
sche Ärzte und Pflegepersonen im<br />
Umgang mit der Krankheit Aids<br />
ausgebildet werden <strong>als</strong> bisher. Pro<br />
Jahr absolvieren mehr <strong>als</strong> 200 Per-<br />
sonen die Kurse und wenden ihr<br />
Wissen anschliessend in Kliniken in<br />
ganz Simbabwe an.<br />
(Swiss Aids Care International)<br />
Gefässtachometer<br />
in der Testphase<br />
Forscher der Berliner Charité, des Gefässzentrums<br />
Berlin und des Max-Delbrück-Zentrums haben ein<br />
Verfahren entdeckt, das mit Ultraschall und einem<br />
Zusatzgerät erstm<strong>als</strong> messen kann, wie schnell das<br />
Blut in der Arterie maximal beschleunigt und entschleunigt<br />
wird. Das Gerät könnte helfen, den Zustand<br />
der Durchblutung bei Risikopersonen genauer<br />
und einfacher darzustellen. Der Gefässtachometer<br />
misst die Duchblutung mit einer<br />
Ultraschallsonde von aussen an der H<strong>als</strong>schlagader,<br />
im Bereich des Ohres, in der Leiste oder im<br />
Kniebereich. Damit können Gefässerkrankungen<br />
möglicherweise schon früher entdeckt werden,<br />
ohne dass Patienten eine aufwendigere Farbdoppleruntersuchung<br />
oder Angiographie mit Kontrastmittel<br />
benötigen. Zurzeit wird das Gerät in einer<br />
Studie geprüft.<br />
(Deutsche Gesellschaft für Angiologie)<br />
Diabetes schränkt Berufsleben kaum ein<br />
Häufiges Blutzucker-Messen am Arbeitsplatz stösst bei<br />
informierten Arbeitskollegen auf viel Verständnis.<br />
Ob ein neues Messgerät aufwendige Angiographien<br />
(hier eine tiefe Beinvenenthrombose) ersetzen kann,<br />
untersucht eine Studie der Berliner Charité.<br />
Plus de responsabilisation pour la santé des femmes et des enfants<br />
La Commission de l’information et de la responsabilisation<br />
en matière de santé de la femme et de<br />
La Commission de l’information et de la responsabilisation<br />
en matière de santé de la femme et de<br />
l’enfant des Nations Unies a approuvé de nouvelles<br />
recommandations.<br />
Schulabgänger mit Diabetes Typ 1 sind oft unsicher,<br />
ob sie den Wunschberuf ergreifen dürfen. Und Berufstätige<br />
mit Diabetes Typ 2 halten ihre Krankheit am<br />
Arbeitsplatz geheim. Dabei macht Diabetes Typ 1<br />
oder 2 nur selten eine Versetzung oder Umschulung<br />
nötig. Darauf hat diabetesDE anlässlich des Welttages<br />
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz am<br />
28. April hingewiesen. Das Wissen der Arbeitskollegen<br />
um die Erkrankung fördert das Verständnis z.B.<br />
für Blutzucker-Messungen. Auch für Notfälle ist ein<br />
gutinformiertes Umfeld vorteilhaft. Nur für die Ausübung<br />
von Berufen, bei denen Diabetiker wegen Unterzuckerung<br />
sich selbst und andere gefährden könnten,<br />
etwa Pilot oder Busfahrer, gilt die Erkrankung <strong>als</strong><br />
Hinderungsgrund. (diabetesDE)<br />
l’enfant des Nations Unies a approuvé de nouvelles<br />
recommandations appelant à un niveau de responsabilisation<br />
sans précédent pour sauver plus de vies<br />
de femmes et d’enfants dans les pays en développement.<br />
Les dix recommandations prévoient des<br />
approches spécifiques pour aider les pays à élaborer<br />
de meilleures méthodes de collecte de données sanitaires<br />
importantes pour mieux comprendre les<br />
besoins en matière de santé et savoir où concentrer<br />
les ressources, de mettre sur pied un système coordonné<br />
pour le suivi des dépenses de santé concernant<br />
les femmes et les enfants et d’assurer une surveillance<br />
nationale et mondiale. Le rapport final de<br />
la Commission sera soumis au Secrétaire général de<br />
l’ONU, M. Ban Ki-moon. Pour plus d’informations:<br />
www.everywomaneverychild.org<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
(ONU)<br />
820
Begegnung mit … HORIZONTE<br />
… Urban Laffer, Chefarzt Chirurgie am Spitalzentrum Biel und Präsident des<br />
Verbandes chirurgisch und invasiv tätiger Ärztinnen und Ärzte der Schweiz (fmCh)<br />
«Ich bin immer noch demütig<br />
vor jeder Operation»<br />
Daniel Lüthi<br />
Text und Bilder<br />
danielluethi@gmx.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Der Tag von Urban Laffer beginnt immer gleich und<br />
immer früh, seit Jahren. Nämlich um fünf Uhr morgens<br />
in der Bieler Pasquart-Kirche – mit seiner eigenen<br />
Art von Morgen-Meditation: Eine Stunde lang<br />
spielt er dann jeweils Orgel, Bach und Mendelssohn<br />
zum Beispiel, für sich und ganz allein, «da stört mich<br />
niemand». Am Samstag gönnt er sich eine Stunde<br />
mehr Schlaf. Und am Sonntag macht er – zumindest<br />
an der Orgel – frei.<br />
Im Spital sieht man ihn auch dann.<br />
Kirche und Klinik<br />
Immer schon haben Kirchenmusik und Orgel im<br />
Leben des Chef-Chirurgen eine wichtige Rolle gespielt.<br />
«Das war der Vorteil der Klosterschule», sagt er, «da<br />
hatte man Zeit und Raum für solche Dinge.» 20 Jahre<br />
lang leitete er ab 1967 in seinem Geburtsort Bärschwil<br />
einen Kirchenchor, «dann ging das mit dem Beruf<br />
nicht mehr zusammen.» Kirchenmusik ja, Kirche aber<br />
eher nein: «Davon hatte ich nach acht Jahren Einsiedeln<br />
genug.» Gemeint ist wohlgemerkt die Institution,<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 821
Begegnung mit … HORIZONTE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
nicht etwa die Religion. Denn Urban Laffer bekennt<br />
ganz selbstverständlich: «Ja, ich bin gläubig. Ich glaube<br />
an Gott, und ich glaube ans Gebet.»<br />
Eindrücklich, wie er diesen Glauben in seinem Spital-Alltag<br />
integriert: «Vor jeder Operation muss ich ja<br />
drei Minuten lang die Hände waschen. Und weil ich<br />
ein Gebet kenne, das genau so lange dauert, brauche<br />
ich beim Händewaschen schon lange keine Uhr mehr.»<br />
Und weiter: «Bei all meinen Eingriffen bin ich mir bewusst,<br />
dass ich etwas mache, was auch schlecht herauskommen<br />
könnte. Das Leben eines Menschen liegt<br />
in solchen Momenten in meinen Händen, ja – und<br />
eben doch nicht. Wir Chirurgen sind weder Herrgötter<br />
noch Halbgötter, sondern normale Menschen,<br />
die gelernt haben, Chirurgie zu praktizieren. Deshalb<br />
sind mir Kollegen suspekt, die von sich behaupten,<br />
sie hätten keine besonderen Gefühle, keinen Respekt,<br />
wenn sie einen Operationssaal betreten. Bei mir jedenfalls<br />
gilt auch heute, mit 40 Jahren Erfahrung: Ich bin<br />
immer noch demütig vor jeder Operation.»<br />
Glück gehört dazu<br />
40 Jahre praktische Tätigkeit <strong>als</strong> Chirurg: Das sind<br />
bei Urban Laffer wahrscheinlich gegen 1000 operierte<br />
Dickdärme, rund 500 Gallenblasen und 300 Schilddrüsen,<br />
«und dazu natürlich viele, viele Leistenhernien<br />
und Blinddärme, aber die macht man irgendwann halt<br />
nicht mehr selber».<br />
Mit spürbarer Befriedigung und Erleichterung<br />
stellt Laffer nach all diesen Operationen vor allem<br />
eines fest, nämlich dass ihm noch nie ein schlimmer,<br />
das heisst irreparabler Fehler passiert sei. Das habe<br />
mit Können und Wissen zu tun, ja, mit Vorsicht<br />
und Erfahrung. Aber: «Ich bin mir bewusst, dass in<br />
meinem Beruf immer auch eine Portion Glück dazugehört.»<br />
Und wenn trotz allem einmal etwas schiefgehen<br />
würde? «Dann ist in erster Linie Transparenz angesagt,<br />
Offenheit dem betroffenen Patienten und seinen Angehörigen<br />
gegenüber. Das Problem beginnt immer<br />
dort, wo ein Arzt das Gespräch verweigert.» Natürlich<br />
sei es für einen jungen Arzt – mit Blick auf die bevorstehende<br />
Karriere – schwieriger, einen Fehler einzugestehen,<br />
schränkt Laffer ein, für ihn <strong>als</strong> alten Hasen<br />
sei es einfacher, diese Kultur nicht bloss zu predigen,<br />
sondern im Ernstfall auch zu leben.<br />
Überhaupt würden ihm seine jungen Kollegen oft<br />
leidtun, sagt er, denn bei ihnen habe der Druck markant<br />
zugenommen – gerade mit der gesetzlich festgeschriebenen<br />
50-Stunden-Woche.<br />
«Mich fragte dam<strong>als</strong> niemand, wie viel ich arbeite,<br />
ich konnte mir meine Zeit noch selber einteilen. Da<br />
reichte es ab und zu sogar für eine Kaffeepause im OPS<br />
oder einen Schwatz mit einer Schwester.» Dass er zu<br />
Beginn seiner Karriere in der Neurochirurgie auch mal<br />
eine Woche lang praktisch durchgearbeitet und nur<br />
einmal acht Stunden am Stück geschlafen habe, dürfe<br />
er heute ja fast nicht mehr erzählen. Etwas Stolz über<br />
das Geleistete drückt trotzdem durch.<br />
Urban Laffer<br />
Prof. Dr. med. Urban Laffer wurde 1946 in Bär-<br />
schwil (SO) geboren. Das Gymnasium besuchte<br />
er an der Stiftsschule in Einsiedeln, wo er 1967<br />
die Matura machte. Medizin studierte er in Ba-<br />
sel (Staatsexamen 1974). Weiterbildungen führ-<br />
tenihn nach Chicago (1977/78) und Davos, wo<br />
er 1979/80 auch Club-Arzt des EHC Davos war.<br />
Am Universitätsspital Basel bildete er sich bis<br />
1983 zum Facharzt Chirurgie weiter, hier wurde<br />
er dann auch Oberarzt und leitender Oberarzt.<br />
Seit 1995 ist Urban Laffer Chefarzt der chirur-<br />
gischen Klinik und seit 1996 auch Mitglied der<br />
Geschäftsleitung am Spitalzentrum Biel, seit<br />
1998 Professor für Chirurgie an der Universität<br />
Bern und seit 2004 Präsident des Verbandes<br />
chirurgisch und invasiv tätiger Ärztinnen und<br />
Ärzte der Schweiz (fmCh).<br />
Urban Laffer ist verheiratet und Vater von drei<br />
erwachsenen Töchtern. Mit seiner Frau wohnt<br />
er in Bellmund bei Biel.<br />
Beim Blick auf Gegenwart und Zukunft dominiert<br />
das Bedauern über eine angespannte Situation: «In<br />
den Spitälern musste die Effizienz massiv gesteigert<br />
werden.» Dieser Druck werde sich mit den Fallpauschalen<br />
(DRG) wohl nur noch verschärfen: «Ich will<br />
die alten Zeiten nicht glorifizieren – aber heute schon<br />
kommen zum Beispiel die Gespräche mit den Patienten<br />
oder die Weiterbildung im Handwerk eindeutig<br />
zu kurz.» Wenn immer mehr in immer weniger Zeit<br />
erledigt werden müsse, liege das ja auf der Hand. So<br />
werde auch der Kostendruck mit DRG nur noch grösser<br />
– «und gleichzeitig schwebt immer das Damoklesschwert<br />
der Juristen über uns.»<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 822
Begegnung mit … HORIZONTE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Ein Unfall und ein Zufall<br />
Perspektiven-Wechsel: War der Herr Professor selber<br />
auch schon mal Patient? «Eine richtige Operation<br />
hatte ich selber noch nie», antwortet er spontan. Und<br />
erzählt dann die Geschichte, wie er während seiner<br />
Zeit <strong>als</strong> Assistenz-Arzt Opfer eines Verkehrsunfalls und<br />
dann in jenes Spital eingeliefert wurde, in dem er dam<strong>als</strong><br />
arbeitete. Unter anderem war die Hüftpfanne gebrochen,<br />
der Chef wollte operieren. Laffer sprach sich<br />
mit Kollegen ab und entschied gegen eine Operation:<br />
«Nein, nein, Angst hatte ich keine – aber ich ging davon<br />
aus, dass das auch ohne Operation gut kommt.»<br />
«Mich fragte dam<strong>als</strong> niemand, wie viel ich arbeite,<br />
ich konnte mir meine Zeit noch selber einteilen.»<br />
* www.skalpell-blog.ch/<br />
Und die gebrochene Hand? «Ach ja, die Mittelhand-Knochen<br />
mussten verschraubt werden. Aber das<br />
ist ja fast keine richtige Operation», sagt einer, der in<br />
der grossen Viszeral-Chirurgie heimisch ist. Und der<br />
eigentlich durch einen Zufall Chirurg geworden ist:<br />
«Eigentlich wollte ich zuerst ja Pfarrer und dann Landarzt<br />
werden», erinnert sich Urban Laffer amüsiert,<br />
«der Hausarzt meiner Eltern beindruckte mich sehr, er<br />
machte seine Visiten noch zu Pferd.» Aber ein Zufall<br />
entschied anders.<br />
In einem kleinen Region<strong>als</strong>pital habe er <strong>als</strong><br />
Unterassistent – noch vor der Abschlussprüfung <strong>als</strong>o –<br />
Abenddienst leisten müssen, erzählt Laffer. Eines<br />
Abends sei ein Bauer gekommen, der sich bei einem<br />
Unfall mit einer Milchkanne drei Viertel der Zunge<br />
abgebissen habe. «Eigentlich hätte ich den Chef rufen<br />
müssen. Aber ich holte das Lehrbuch von Allgöwer und<br />
nähte die Zunge an.» Der Chef sei zuerst erschrocken.<br />
Als er dann aber das Resultat sah, habe er gesagt: «Sie<br />
müssen Chirurg werden.»<br />
Lieber Standespolitik <strong>als</strong> Politik<br />
Chirurg ist Urban Laffer immer noch mit Begeisterung.<br />
Aber bloss zu etwa 40 Prozent. Den Rest seiner Zeit<br />
widmet er administrativen Aufgaben, seinen Funktionen<br />
<strong>als</strong> ärztlicher Leiter des Spit<strong>als</strong>, <strong>als</strong> Leiter seiner<br />
Klinik und <strong>als</strong> Standespolitiker. «All dies aber nicht in<br />
10 Stunden pro Tag, gell», fügt er lachend bei.<br />
Als Präsident der fmCh, der chirurgischen Dachgesellschaft,<br />
die 16 Fachgesellschaften vereint, ist Laffer<br />
ein Kämpfer: «Zum Beispiel müssen wir uns immer<br />
Die nächste «Begegnung mit …»<br />
wieder gegen die Grundversorger behaupten. Ihre Anliegen<br />
werden in der Ärztekammer, dem Ärzte-Parlament,<br />
ernster genommen <strong>als</strong> diejenigen der Spezialisten.»<br />
Spricht Laffer jetzt vom Lohn? «Ja, auch. Es ist<br />
einfach nicht richtig, dass die Grundversorger auf Kosten<br />
der Chirurgen mehr verdienen sollen, wir haben<br />
ein grösseres Risiko und eine grössere Verantwortung.»<br />
Auch gelte es für ihn <strong>als</strong> Standespolitiker, für beruflichen<br />
Nachwuchs zu sorgen. Denn die Perspektiven<br />
seien düster: «In fünf Jahren werden wir in der<br />
Schweiz einen dramatischen Ärztemangel haben, bei<br />
Grundversorgern und Spezialisten, vor allem in Randregionen.»<br />
Oder anders gesagt, in gewohnt humorvoller<br />
Laffer-Manier: «Wenn ich mal ins Alter komme<br />
und krank werde, finde ich keinen Arzt mehr.»<br />
Wer so spricht, könnte ja auch vom Standespolitiker<br />
zum Politiker werden wollen, wie dies zur Zeit<br />
unter anderem bei FMH-Präsident Jacques de Haller<br />
(SP) der Fall ist. Laffer missfallen solche Ambitionen,<br />
und er schreibt in seinem «Skalpell-Blog»* auch entschieden<br />
dagegen an. Dabei spielt die Partei-Zugehörigkeit<br />
offenbar nur eine sekundäre Rolle. Denn auch<br />
die Kandidatur seines Chirurgen-Kollegen Thierry<br />
Carrell (FDP) versteht er nicht: «Politik braucht Zeit –<br />
und die wird diesem begnadeten Chirurgen im Spital<br />
fehlen.» Für ihn selber <strong>als</strong>o ist die Politik auch mit<br />
Blick auf die Pensionierung keine Option.<br />
Urban Laffer wird dieses Jahr 65-jährig. Aber von<br />
Aufhören ist bei ihm noch keine Rede. Sein Stellvertreter<br />
wird in drei Jahren pensioniert, ein Stabwechsel<br />
zum jetzigen Zeitpunkt mache deshalb keinen Sinn.<br />
Vor allem aber: «Ich arbeite nach wie vor gern.» Zwölf<br />
Stunden pro Tag sind normal, sieben Tage die Woche<br />
die Regel, und dies seit Jahrzehnten. Dass dabei einiges<br />
auch zu kurz kommt oder gar auf der Strecke bleibt,<br />
ist klar. Bei Urban Laffer ist es, wie bei vielen anderen<br />
Ärzten auch, die Familie. Etwas wehmütig betrachtet<br />
er die Fotografie, die in seinem Büro hängt und ihn<br />
zusammen mit seinen drei Töchtern zeigt: «Ja, ich bedaure,<br />
dass ich für sie nicht mehr Zeit hatte.» Übrigens:<br />
Keine der drei wollte Ärztin werden.<br />
Jetzt, gegen Abend, ist unter anderem noch ein<br />
Rundgang durch die Intensiv-Station angesagt. «Gegen<br />
halb acht Uhr komme ich in der Regel nach Hause.»<br />
Tischdecken, essen, Zeitung lesen – und um halb zehn<br />
Uhr ins Bett. Und schlafen, wenn nicht etwas dazwischenkommt.<br />
Diese Nacht zum Beispiel hat Urban<br />
Laffer Notfalldienst.<br />
Und um 5 Uhr morgens sitzt er wieder in der Kirche<br />
an der Orgel.<br />
Am Ende jeden Monats stellt die <strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> eine Persönlichkeit vor, die sich im<br />
Gesundheitswesen engagiert. Im Juni schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit der Hausärztin Elisabeth<br />
Müller, die im Juni am Kongress des Kollegiums für Hausarztmedizin in Luzern <strong>als</strong> «Kopf des Jahres»<br />
ausgezeichet wird.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 823
Streiflicht Horizonte<br />
Ludwik Fleck (1896–1961)<br />
Erhard Taverna<br />
erhard.taverna@saez.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Es sei unmöglich, wurde gesagt, die Biografie des polnischen<br />
Mediziners, Bakteriologen und Soziologen<br />
<strong>als</strong> geschlossene Individualgeschichte zu konzipieren.<br />
Denn seine Lebensbeschreibung illustriere die Normalität<br />
des Unwahrscheinlichen und die Unwahrscheinlichkeit<br />
des Normalen. Sein Geburtsort Lemberg steht<br />
exemplarisch für die vielen Brüche seiner Existenz.<br />
Dam<strong>als</strong> ein Kultur- und Verwaltungszentrum im habsburgischen<br />
Ostgalizien, nach dem Ersten Weltkrieg<br />
polnisch, dann ein Teil der Sowjetunion, bis 1945 von<br />
den Deutschen besetzt, erneut ein Teil der UdSSR und<br />
seit deren Zerfall der Ukrainischen Republik zugehörig.<br />
Leben und Werk<br />
Ludwik Fleck war Assistent des bekannten Typhusspezialisten<br />
Rudolf Weigl, der das Institut für Fleckfieber<br />
und Virusforschung in Lemberg leitete. Er arbeitete<br />
an einem öffentlichen Krankenhaus und führte<br />
danach ein Privatlabor für medizinische Analysen. Im<br />
Lemberger Ghetto entwickelte Fleck einen Impfstoff<br />
gegen Typhus, bevor er mit Frau und Sohn 1943 nach<br />
Auschwitz deportiert und einige Monate später im KZ<br />
Buchenwald interniert wurde. Weil seine Kenntnisse<br />
für die SS kriegswichtig waren, überlebte er mit seiner<br />
Familie und wurde nach der Befreiung Professor in<br />
Lublin und Warschau. 1957 immigrierte der schwer<br />
Erkrankte nach Israel, wo er mit Ehefrau und Sohn bis<br />
zu seinem Tod 1961 lebte und forschte.<br />
Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten machten<br />
ihn in der Fachwelt <strong>als</strong> Mikrobiologen bekannt. Heute<br />
gilt er <strong>als</strong> bedeutender Vordenker der Erkenntnistheorie<br />
oder Wissenschaftssoziologie. Seine deutsch geschriebene<br />
Abhandlung «Entstehung und Entwicklung<br />
einer wissenschaftlichen Tatsache – Einführung<br />
in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv» [1]<br />
wurde 1935 zuerst im Verlag Benno Schwabe & Co. in<br />
Basel publiziert. Zwar wurde das Buch in der «<strong>Schweizerische</strong>n<br />
Medizinischen Wochenschrift» besprochen<br />
und empfohlen, es blieb aber, trotz beträchtlicher<br />
Werbeanstrengungen des Verlages, mehr oder weniger<br />
unbeachtet. Fleck historisierte und sozialisierte die<br />
Naturwissenschaften, insbesondere die Medizin, und<br />
relativierte damit jede Erkenntnistätigkeit; ein Machtverlust,<br />
den ihm viele Autoritäten übelnahmen. Er<br />
betonte drei soziale Faktoren: das Gewicht der Erziehung,<br />
die Last der Tradition und die Wirkung der Reihenfolge<br />
des Erkennens. «Jedes Wissen hat einen eigenen<br />
Gedankenstil mit seiner speziellen Tradition und<br />
Erziehung. Im beinahe unendlichen Rahmen des Möglichen<br />
wählt jedes Wissen andere Fragen, verbindet sie<br />
Ludwik Fleck (vorne Mitte) im Kreise seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einiger tierischer Freunde.<br />
(Quelle: Archiv für Zeitgeschichte, ETH Zürich)<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
824
Streiflicht Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Umschlag der Originalausgabe von Ludwik Flecks<br />
«Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv»<br />
aus dem Jahr 1935, erschienen im Schwabe-Verlag.<br />
nach anderen Regeln und zu anderen Zwecken.» Die<br />
ehem<strong>als</strong> fehlende Anerkennung seiner Studien illustriert<br />
auf tragische Weise die Richtigkeit seiner Erkenntnisse,<br />
die aus verschiedenen Gründen übergangen<br />
wurden. Zwei totalitäre Systeme und die Folgen<br />
des kalten Krieges isolierten den Autor, dessen Monografie<br />
erstm<strong>als</strong> 1962 im Vorwort von Thomas S. Kuhn<br />
«The Structure of Scientific Revolutions» [2] Erwähnung<br />
fand: «… eine Arbeit, die viele meiner Gedanken<br />
vorwegnimmt.»<br />
Von der Fussnote zum Pionier<br />
Als Mediziner entwickelte Ludwik Fleck seine Theorie<br />
am Beispiel der Entwicklungsgeschichte des Syphilisbegriffs<br />
und der Wassermann-Reaktion, wobei er den<br />
Fleck gilt heute <strong>als</strong> bedeutender Vordenker<br />
der erkenntnistheorie oder Wissenschaftssoziologie.<br />
Fortschritt nicht <strong>als</strong> ein «Besserwerden» sondern lediglich<br />
<strong>als</strong> kollektive Weiterentwicklung des Denkstils<br />
begriff. Es blieb Thomas Kuhn vorbehalten, ähnliche<br />
Ideen <strong>als</strong> «Paradigmen-Wechsel» bekannt zu machen.<br />
Seither ist dieser Begriff «für eine Konstellation von<br />
Meinungen, Werten und Methoden einer gegebenen<br />
Gemeinschaft» weithin akzeptiert. Wenn eine Entdeckung<br />
die Grundlagen der geltenden Naturwissen-<br />
schaft erschüttert, wird eine Umdeutung des Lehrgebäudes<br />
unumgänglich. Doch zuerst muss diese Entdeckung<br />
alle Prüfungen des Konsensverfahrens, etwa<br />
im Nachvollzug durch andere, bestehen, erst dann wird<br />
sie <strong>als</strong> Paradigmenwechsel bezeichnet. Letztm<strong>als</strong> war<br />
das der Fall bei der Quantentheorie. Die Methoden der<br />
empirischen Wissenschaften, zum Beispiel ihre Experiment<strong>als</strong>ysteme<br />
<strong>als</strong> Suchmaschinen und Orte neuen<br />
Wissens, sind inzwischen Vorbilder für jede ernsthafte<br />
Forschung. Die Naturwissenschaft <strong>als</strong> Teil der Kulturgeschichte<br />
ist heute ein Fachgebiet vieler Disziplinen.<br />
Als Fundament der Technik ist sie seit Ludwik Fleck<br />
zum wichtigsten Pfeiler aller Zivilisationen geworden.<br />
Die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft ist<br />
eine andere Sache, denn die Abläufe, die zu einer Entdeckung<br />
führen und ihre nachträgliche, mediale Aufbereitung<br />
sind oft zwei sehr verschiedene Dinge. Vieles<br />
geschieht zufällig, es wurde etwas gefunden, was gar<br />
nicht gesucht war. Mit den Worten von Christoph<br />
Georg Lichtenberg (1742–1799), Mathematiker, Physiker<br />
und Schriftsteller, auf die eigene Frage: «Warum<br />
die meisten Erfindungen durch Zufall müssen gemacht<br />
werden?» folgte seine Antwort: «Die Hauptursache ist<br />
wohl die, dass die Menschen alles so ansehen lernen,<br />
wie ihre Lehrer und ihr Umgang es ansieht.» Man weiss<br />
oft nicht genau, was man nicht weiss. Dass das Neue<br />
sich dennoch ereignet, hat auch Fleck nicht bestritten.<br />
Seine Aufmerksamkeit galt den Ausgangsbedingungen,<br />
die den Weg zu diesem Neuen mitbestimmen.<br />
Dass Wissenschaft nicht wertfrei im Elfenbeinturm<br />
geschieht, sondern immer von menschlichen Interessen<br />
beeinflusst wird, vernehmen wir täglich. Industrie,<br />
Wirtschaft, Militär und Politik beeinflussen die Forschung.<br />
Neugier und Erkenntnisdrang der Forschenden<br />
sind das eine, Projektanträge und Finanzierung<br />
das andere. Die notwendigen Kontroversen in einer<br />
«multiplen Öffentlichkeit» setzen eine demokratisch<br />
organisierte Zivilgesellschaft voraus, die auch befähigt<br />
ist mitzudenken. Auch das gehört zum Denkstil und<br />
Denkkollektiv von Ludwik Fleck.<br />
Wer sich in sein Werk vertiefen möchte, findet im<br />
Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich [3] Kopien<br />
seiner wichtigsten Schriften. Zudem belegen an beiden<br />
Hochschulen regelmässige «Fleck Lectures» die<br />
Aktualität seines Denkens [4].<br />
referenzen<br />
1 Fleck L. Die Entstehung und Entwicklung einer<br />
wissenschaftlichen Tatsache. Frankfurt a. M.:<br />
Suhrkamp; 1980.<br />
2 Kuhn TS. Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen.<br />
Frankfurt a. M.: Suhrkamp Taschenbuch;<br />
1976.<br />
3 ETH, Archiv für Zeitgeschichte, Hirschengraben 62,<br />
8092 Zürich, Tel. 044 632 40 03. www.afz.ethz.ch<br />
4 Ludwik Fleck Zentrum am Collegium Helveticum,<br />
Schmelzbergstrasse 25, 8092 Zürich.<br />
www.ludwikfleck.ethz.ch<br />
www.ludwik-fleck-kreis.org<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21 825
Höchstleistung um jeden<br />
Preis? Welchen Preis?<br />
Wofür?<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
ZU GUTER LETZT<br />
«Some records are impossible to break with<br />
a natural body» … Ja und?<br />
1 Missa JN. Sport, enhancement<br />
and the inefficacy of antidoping<br />
policy. Bioethica<br />
Forum. 2011;4(1):14–6.<br />
2 Kayser B, Mauron A, Miah A.<br />
Current anti-doping policy:<br />
a critical appraisal. BMC<br />
Medical Ethics. 2007;8:2.<br />
3 Martin J. Dopage: rien de<br />
changé depuis Rome et<br />
«panem et circenses»?<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2006;87(41):1791–2.<br />
4 Martin J. Ethique sportive.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2010;91(23):920–1.<br />
In der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift «Bioethica<br />
Forum» der <strong>Schweizerische</strong>n Gesellschaft für Biomedizinische<br />
Ethik ist mir der Artikel des belgischen Bioethikers<br />
Jean-Noël Missa aufgefallen [1]. Zunächst<br />
durch den Satz, den ich <strong>als</strong> Titel gewählt habe. Müssen<br />
wir sportliche Rekorde immer wieder brechen?<br />
Was würden wir verlieren, wenn jeweils die Besten<br />
des Moments gekürt würden, ohne die Ergebnisse<br />
zwangsläufig mit Olympischen Spielen zu vergleichen?<br />
Würde man damit an den fatalen Trieb der<br />
Menschen rühren, immer noch schneller und noch<br />
schneller sein zu wollen? Doch in Zeiten, in denen<br />
uns Fukushima und anderes – Klimawandel und eine<br />
Wirtschaft, in der die Kluft zwischen Arm und Reich<br />
immer grösser statt kleiner wird – erneut vor essentielle<br />
Fragen über unsere Fortschrittsauffassung stellen,<br />
ist es dringend geboten, diesen Trieb einzudämmen,<br />
ihm entgegenzuwirken.<br />
Missa erachtet die aktuelle Anti-Doping-Praktik<br />
<strong>als</strong> fragwürdig. Besonders aufmerksam machen Aussagen<br />
wie Doping sei eine der essentiellen Komponenten<br />
des Leistungssports und die (leistungssteigernde)<br />
Biomedizin-Technologie bilde das Herz des Elitesports.<br />
Missa stellt überdies die Frage, ob es nicht paradox anmute,<br />
ein Verhalten (nämlich die Verwendung künstlicher<br />
Hilfsmittel) zu verbieten, das den Dreh- und Angelpunkt<br />
des Leistungssports bilde. Hat er das substantielle<br />
Charakteristikum des Sports damit wirklich<br />
treffend beschrieben?<br />
Jeder hat das Recht, sich selbst in Gefahr zu bringen,<br />
indem er z. B. Klettersport betreibt, Autorennen<br />
fährt oder einfach nur raucht. Wenn <strong>als</strong>o viele Athleten<br />
verbotene Substanzen einnehmen, würde man<br />
gegen ihren Willen ihre Freiheit beschneiden? Im<br />
Sinne einer an möglichen Folgen ausgerichteten<br />
Ethik spreche ich mich weiterhin für die Bekämpfung<br />
des Dopings aus, denn die Schäden durch eine liberale<br />
Praxis, die zwar «medizinisch überwacht», aber<br />
larga manu betrieben würde, wären schwerwiegender.<br />
Zwar kann man behaupten, der-zeit seien Sportfunktionäre<br />
und Athleten gezwungen, heimlich «höher,<br />
schneller, weiter» zu kommen. Sicher ist aber, dass auf<br />
das Gesamtkollektiv der Sportler betrachtet derzeit<br />
weniger potentiell toxische Substanzen eingenommen<br />
werden, <strong>als</strong> bei einer Liberalisierung.<br />
Es ist eine Illusion zu glauben, erlaubtes Doping<br />
unter medizinischer Kontrolle sei weniger pathogen.<br />
Dazu muss man an die Unfehlbarkeit des Menschen,<br />
der Ärzte und der Verfahren glauben. Wir wissen alle,<br />
dass jedes System die Kreativität des Menschen anstachelt,<br />
damit er es drehen oder an seine Grenzen trei-<br />
ben kann – Kollegen kritisieren das Gutmenschentum<br />
bzw. die Weltfremdheit der Anti-Doping-Verfechter,<br />
begehen aber denselben Fehler, wenn Sie<br />
glauben, alles wäre «in Ordnung», solange ein Spezialist<br />
den Athleten überwacht. Wenn aber dann Dutzende<br />
von Sportlern den ärztlich verordneten Substanzen<br />
zum Opfer fallen, wird es ein grosses Geschrei<br />
geben und man wird Kontrollen (z.B. der Kompetenzen<br />
der Ärzte – denn es gibt auch schlechte) und Beschränkungen<br />
fordern (um kurz- oder langfristig zu<br />
gefährliche Mittel auszuschliessen) usw. Was würde<br />
sich dann <strong>als</strong>o am aktuellen Paradigma ändern?<br />
Man muss der Tatsache Rechnung tragen, dass der<br />
Leistungssport weltweit ein Millionenpublikum begeistert.<br />
Der Sport hat darüber hinaus eine Beispielfunktion,<br />
was die Verantwortlichen im Sport und im<br />
gesellschaftlichen Leben mit Nachdruck betonen. Ich<br />
finde es sonderbar, wie Missa für eine liberale Dopingpraxis<br />
mit der Behauptung zu argumentieren, durch<br />
Doping und Einsatz der besten Wissenschaftler auf<br />
diesem Gebiet Vorteile zu erreichen – sportliche und<br />
finazielle – , entspreche durchaus dem Gedanken des<br />
Wettbewerbs [2].<br />
Auf dem Gebiet der allgemeinen Drogenpolitik hat<br />
mich die Erfahrung gelehrt, Doktrinen abzulehnen,<br />
die auf Strafen und Postulaten der «Tugendhaftigkeit»<br />
basieren, da sie, indem sie die Abstinenz <strong>als</strong> einzig<br />
statthaftes Ziel darstellen, bei geschwächten Personen<br />
grossen Schaden anrichten können. Ich habe mich für<br />
unterstützende Massnahmen für Drogenabhängige,<br />
die vom Leben «Gebrochenen», eingesetzt; dazu gehört<br />
auch die Gabe von Betäubungsmitteln (z. B. Methadon).<br />
Diese Haltung führt aber nicht zur Anerkennung<br />
von Doping im Sport. Der Hochleistungssport<br />
ist eine besondere Subgruppe der Gesellschaft. Vertreter<br />
der Gesundheitsberufe, die dem Grundsatz Primum<br />
non nocere verpflichtet sind, haben nicht die<br />
Aufgabe, a priori gesunden Menschen gefährliche<br />
Substanzen zu verabreichen auf die Gefahr hin, auch<br />
aus ihnen vom Leben Gebrochene zu machen, –<br />
nicht zuletzt wegen der Spätschäden.<br />
Und schliesslich ist niemand gezwungen, in den<br />
Wettkampf einzutreten, wenn ihm die Regeln nicht<br />
passen. Die Doping-Debatte ist komplex, aber das<br />
Modell «anything goes» ist entschieden zu schön, um<br />
wahr zu sein. Die Gesellschaft ist gut beraten, zu bedenken,<br />
dass Freiheit nur wertvoll ist, wenn ihr auch<br />
Grenzen gesetzt werden [3, 4].<br />
Jean Martin, Mitglied der Redaktion<br />
und der Nationalen Ethikkommission<br />
826
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die letzte Seite der SÄZ wird von Anna frei gestaltet, unabhängig von der Redaktion.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 21<br />
ANNA<br />
www.annahartmann.net