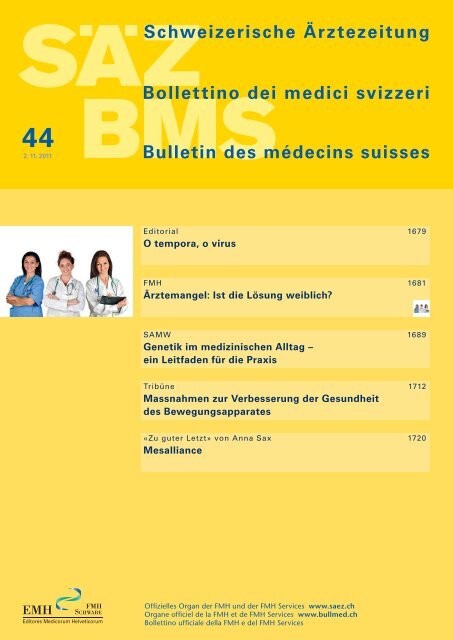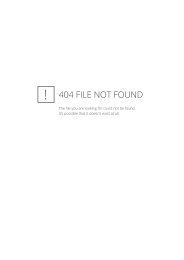Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Gesamtausgabe als PDF - Schweizerische Ärztezeitung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
44<br />
2. 11.2011<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
S chweizerische <strong>Ärztezeitung</strong><br />
Bollettino dei medici svizzeri<br />
Bulletin des médecins suisses<br />
Editorial 1679<br />
O tempora, o virus<br />
FMH 1681<br />
Ärztemangel: Ist die Lösung weiblich?<br />
SAMW 1689<br />
Genetik im medizinischen Alltag –<br />
ein Leitfaden für die Praxis<br />
Tribüne 1712<br />
Massnahmen zur Verbesserung der Gesundheit<br />
des Bewegungsapparates<br />
«Zu guter Letzt» von Anna Sax 1720<br />
Mesalliance<br />
Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch<br />
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch<br />
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
FMH<br />
Editorial<br />
1679 O tempora, o virus<br />
Gert Printzen<br />
Thema<br />
1681 Ärztemangel: Ist die Lösung weiblich?<br />
Esther Bieri, Jacqueline Wettstein,<br />
Barbara Buddeberg-Fischer, Brigitte Muff,<br />
Patrizia Kündig<br />
Als A Coach, Supervisorin und Projektleiterin<br />
in Schweizer Spitälern<br />
hat Esther Bieri einen reichen Erfahrungsschatz.<br />
Sie erörtert, wel-<br />
che<br />
Veränderungen nötig wären,<br />
um<br />
das Nachwuchsproblem zu lösen.<br />
Ihre<br />
ganz persönlichen Erfahrungen<br />
<strong>als</strong><br />
Frau im Arztberuf schildern dann<br />
eine<br />
Professorin und Fachärztin für<br />
Psychiatrie und Psychotherapie,<br />
eine Chirurgie-Chefärztin sowie<br />
eine Medizinstudentin.<br />
1686 Personalien<br />
Organisationen der Ärzteschaft<br />
FME<br />
1687 Keine Hinweise für erhöhtes Krebsrisiko bei<br />
Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken<br />
Jürg Schädelin<br />
Zwei Studien zum gleichen Thema – zwei unterschiedliche<br />
Ergebnisse: Anders <strong>als</strong> die deutsche KiKK-Studie konnte<br />
die CANUPIS-Studie nichts Bedrohliches an einem KKWnahen<br />
Wohnort (s. Titel) finden. Der Beitrag vergleicht<br />
beide Studien hinsichtlich Daten und Methode.<br />
INHALT<br />
Weitere Organisationen und Institutionen<br />
SAMW<br />
1689 Genetik im medizinischen Alltag –<br />
ein Leitfaden für die Praxis<br />
Deborah Bartholdi, Sabina Gallati,<br />
Hansjakob Müller<br />
Aufgrund des hohen Interesses der Ärztinnen und Ärzte<br />
war die SAMW-Broschüre «Genetische Untersuchungen<br />
im medizinischen Alltag» rasch vergriffen. Jetzt ist eine<br />
überarbeitete Neuauflage erschienen. Darin findet sich<br />
Hilfe bei der Auseinandersetzung mit medizinischen, ethischen,<br />
rechtlichen, und psychosozialen Fragen der modernen<br />
Genetik.<br />
SCTO<br />
1690 Die Swiss Clinical Trial Organisation<br />
v eröffentlicht Qualitätsrichtlinien<br />
Maya Grünig, Claudia Weiss, Peter Meier-Abt<br />
In Zusammenarbeit mit der <strong>Schweizerische</strong>n Arbeitsgemeinschaft<br />
für klinische Krebsforschung SAKK und Clinical<br />
Trial Units von Spitälern hat die STCO ein übergreifendes<br />
Konzept zur Qualitätssicherung erarbeitet. Ziel dabei ist,<br />
die Integrität von Daten klinischer Versuche zu verbessern<br />
und damit auch die Patientensicherheit.<br />
Briefe / Mitteilung<br />
1691 Briefe an die SÄZ<br />
1693 Mitteilung<br />
FMH Services<br />
1694 Seminare 2011 / Séminaires 2011<br />
FMH Services<br />
1702 Krankenversicherung<br />
FMH Insurance Services<br />
1703 Zahlungseingang pünktlich<br />
FMH Factoring Services<br />
1704 Stellen und Praxen
IMPRESSUM<br />
Tribüne<br />
Standpunkt<br />
1712 Massnahmen zur Verbesserung<br />
der Gesundheit des Bewegungsapparates<br />
Mathis Brauchbar, Françoise Allaz, Bettina<br />
Schulte, Regine Strittmatter, Andreas Stuck<br />
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 53<br />
wurde in zahlreichen Projekten die Gesundheit des Bewegungsapparats<br />
der Schweizer Bevölkerung untersucht. Der<br />
Beitrag schildert die wichtigsten Erkenntnisse und Forderungen<br />
zur Verbesserung der Versorgungsqualität.<br />
1716 Informer le maximum de<br />
personnes responsables<br />
Stéphane Reymond<br />
1717 Spectrum<br />
Horizonte<br />
Redaktion<br />
Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli<br />
(Chefredaktor)<br />
Dr. med. Werner Bauer<br />
Dr. med. Jacques de Haller (FMH)<br />
PD Dr. med. Jean Martin<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Prof. Dr. med. Hans Stalder<br />
Dr. med. Erhard Taverna<br />
lic. phil. Jacqueline Wettstein (FMH)<br />
Redaktion Ethik<br />
PD Dr. theol. Christina Aus der Au<br />
Prof. Dr. med. Lazare Benaroyo<br />
Dr. phil., dipl. biol. Rouven Porz<br />
Redaktion Medizingeschichte<br />
PD Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann<br />
PD Dr. rer. soc. Eberhard Wolff<br />
Redaktion Ökonomie<br />
Anna Sax, lic. oec. publ., MHA<br />
Redaktion Recht<br />
Fürsprecher Hanspeter Kuhn (FMH)<br />
Managing Editor<br />
Annette Eichholtz M.A.<br />
Streiflicht<br />
1718 Schrumpfkopf<br />
Erhard Taverna<br />
Eine Geschichte aus dem wahren Leben und zudem ein<br />
beängstigender Fall: Eine Mutter berichtet verzweifelt, der<br />
Kopf ihres Babys werde immer kleiner. Der Arzt kann jedoch<br />
nichts Krankhaftes finden – eine Fehldiagnose?izonte<br />
Redaktionssekretariat<br />
Margrit Neff<br />
Redaktion und Verlag<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: redaktion.saez@emh.ch<br />
Internet: www.saez.ch, www.emh.ch<br />
Herausgeber<br />
FMH, Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,<br />
Postfach 170, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
E-Mail: info@fmh.ch<br />
Internet: www.fmh.ch<br />
Herstellung<br />
Schwabe AG, Muttenz<br />
Marketing EMH<br />
Thomas Gierl M.A.<br />
Leiter Marketing und Kommunikation<br />
Tel. 061 467 85 49, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: tgierl@emh.ch<br />
Horizonte<br />
INHALT<br />
Buchbesprechung<br />
1719 Wissenschaftlich fundierte Information<br />
Walter Felix Jungi<br />
Diese findet sich nach Meinung des Rezensenten in dem<br />
Buch von Jutta Hübner über Komplementäre Therapien.<br />
Er ist überzeugt, dass es für viele Krebspatienten bei der<br />
Krankheitsbewältigung hilfreich ist. Angst, Unsicherheit<br />
und Passivität sollen, nicht zuletzt mit Hilfe des Arztes,<br />
überwunden werden.<br />
Zu guter Letzt<br />
1720 Mesalliance<br />
Anna Sax<br />
Die SÄZ-Redaktorin ist seit 20 Jahren HMO-versichert,<br />
12 Jahre davon in einer ärzteeigenen Gruppenpraxis<br />
mit Budgetmitverantwortung. Mit der hitzigen Managed-<br />
Care-Debatte hat sie ihre Probleme – vielleicht weil sie<br />
<strong>als</strong> Ö konomin davon ausgeht, dass sich Menschen in der<br />
R egel rational verhalten?<br />
Anna<br />
Inserate<br />
Werbung<br />
Ariane Furrer, Assistentin Inserateregie<br />
Tel. 061 467 85 88, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: afurrer@emh.ch<br />
«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»<br />
Matteo Domeniconi, Inserateannahme<br />
Stellenmarkt<br />
Tel. 061 467 86 08, Fax 061 467 85 56<br />
E-Mail: stellenmarkt@emh.ch<br />
«Stellenvermittlung»<br />
FMH Consulting Services<br />
Stellenvermittlung<br />
Postfach 246, 6208 Oberkirch<br />
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86<br />
E-Mail: mail@fmhjob.ch<br />
Internet: www.fmhjob.ch<br />
Abonnemente<br />
FMH-Mitglieder<br />
FMH Verbindung der Schweizer<br />
Ärztinnen und Ärzte<br />
Elfenstrasse 18, 3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11, Fax 031 359 11 12<br />
EMH Abonnemente<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Abonnemente, Postfach, 4010 Basel<br />
Tel. 061 467 85 75, Fax 061 467 85 76<br />
E-Mail: abo@emh.ch<br />
Jahresabonnement: CHF 320.–,<br />
zuzüglich Porto<br />
© 2011 by EMH <strong>Schweizerische</strong>r<br />
Ärzteverlag AG, Basel. Alle Rechte vorbehalten.<br />
Nachdruck, elektronische<br />
Wiedergabe und Übersetzung, auch<br />
auszugsweise, nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Verlages gestattet.<br />
Erscheint jeden Mittwoch<br />
ISSN 0036-7486<br />
ISSN 1424-4004 (Elektronische Ausg.)
Editorial FMH<br />
O tempora, o virus<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Frei nach Ciceros (106–43<br />
v. Chr.) O tempora, o mores –<br />
gibt die bevorstehende Influenza-Periode<br />
wieder einmal<br />
Anlass, vor dem «Verfall der<br />
Gesundheit» zu warnen.<br />
Denn es hüstelt, niest und<br />
schnieft bereits schon wieder<br />
heftig in Zügen, Trams und<br />
Bussen.<br />
Pünktlich zur bevorstehenden<br />
Infektionsperiode<br />
durch das Grippevirus kam der Film «Contagion» in die<br />
K inos. Dieser Actionthriller handelt vom Ausbruch eines<br />
tödlichen Virus und dem Versuch der Menschheit, sich global<br />
gegen dessen Ausbreitung mittels eines internationalen<br />
Teams von Ärzten zu wehren. Von den hochkarätigen<br />
Schauspielern hat man leider relativ wenig – sie werden<br />
meist innert Kürze dahingerafft, denn natürlich lässt sich<br />
das Virus nicht unter Kontrolle halten. Der Zuschauer wird<br />
mit verschiedenen Sicht- und Herangehensweisen von Ärzten,<br />
der medizinischen Versorgung und den Meinungen von<br />
Politikern zum Thema Pandemie und globalen Zusammenhängen<br />
konfrontiert.<br />
Eine neue Grippepandemie droht<br />
durchschnittlich alle 30 Jahre.<br />
Pandemien sind für die Bevölkerung längst keine Unbekannte<br />
mehr: Mit SARS (2002), Vogelgrippe (1996/2003)<br />
und H1N1 oder Schweinegrippe (2009) ist die Angst vor dem<br />
Ausbruch einer Viruserkrankung immer aktuell gewesen.<br />
Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation WHO<br />
droht eine neue Grippepandemie durchschnittlich alle 30<br />
Jahre. Die bislang verheerendste Pandemie war die Spanische<br />
Grippe von 1918/19. Ihr Erreger war – wie bei der<br />
Schweinegrippe – eine Variante des H1N1-Grippevirus, der<br />
aber unmittelbar von einem Vogelgrippevirus abstammte.<br />
Diese Pandemie raffte innert weniger Monate um die 50 Millionen<br />
Menschen dahin, davon allein in Europa über 20 Millionen.<br />
Die Seuche forderte jedoch auch in Amerika, Japan,<br />
Indien u. a. Opfer. Insgesamt waren wohl rund 500 Millionen<br />
Menschen infiziert, was einem Drittel der damaligen<br />
Weltbevölkerung entsprach! *<br />
In den Jahren 1996 und 2003 trat das Vogelgrippevirus<br />
(H5N1) auf – «nur» rund 400 Menschen sind daran gestorben,<br />
die meisten in Asien. Das Thema ist leider noch nicht<br />
abgeschlossen: auch dieses Jahr wurde bis September das<br />
hochpathogene aviäre Influenzavirus H5N1 bereits acht Mal<br />
auf den Menschen übertragen (u. a. in Indien, Indonesien).<br />
Und schliesslich wurde <strong>als</strong> letzte Pandemie 2009/10 das glo-<br />
bale Auftreten von Influenza-Erkrankungen definiert, die<br />
durch eine im Jahr 2009 entdeckte Influenzavirus-Variante<br />
des Typs A H1N1, Subtyp A/California/7/2009 und weiteren<br />
mit diesem genetisch eng verwandten Subvarianten hervorgerufen<br />
werden. Die Erkrankung ist allgemein unter den<br />
N amen Schweinegrippe und Neue Grippe bekannt.<br />
Eine Prognose, ob eine Grippewelle sich zu einer Pandemie<br />
entwickeln kann, ist schwierig. Eine definitive Klassifi-<br />
Bis ein neuer Impfstoff zur<br />
Verfügung steht, braucht es rund fünf<br />
Monate Zeit.<br />
kation kann meist erst im Nachhinein erfolgen. Saisonale<br />
Grippevirenstämme registriert die WHO seit Jahrzehnten in<br />
einem Frühwarnnetz. Gemeinsam mit den Behörden koordiniert<br />
die WHO die Bedingungen für eine Zulassung neuer<br />
Impfstoffe und überwacht allfällige Resistenzen gegen Grippemedikamente.<br />
Auch diesen Herbst stellt sich wieder die Frage: «Impfen<br />
oder nicht?» Bis ein neuer Impfstoff zur Verfügung steht,<br />
braucht es übrigens rund fünf Monate Zeit – zu viel Zeit bei<br />
einem akuten Auftreten eines hochvirulenten, mutierten Erregers,<br />
während der sich das Virus ungehindert ausbreiten<br />
kann. Schwere Verläufe sowie die Letalität der Influenza sind<br />
zum Teil mit einer bakteriellen Superinfektion assoziiert.<br />
Entsprechende prophylaktische und therapeutische Massnahmen<br />
zur Bekämpfung bakterieller Infektionen sind daher<br />
wichtige Methoden, um die Komplikationen inklusive<br />
der Sterblichkeit bei Influenza zu minimieren.<br />
Eine Entwarnung zum Schluss: Lassen wir uns trotz aller<br />
medialen und cineastischen Beeinflussung nicht aus der<br />
Ruhe bringen, wenn es um uns herum hustet, tropft und<br />
keucht. Glücklicherweise handelt es sich in den meisten<br />
Fällen nicht um eine Grippe, sondern um einen «grippalen<br />
Infekt» – <strong>als</strong>o eine Erkältung. Diese unechte Grippe macht<br />
uns im Schnitt fünfmal pro Jahr das Leben schwer. In drei<br />
Tagen kommt sie, drei Tage bleibt sie – und nach drei<br />
weiteren Tagen ist der Spuk bereits wieder vorbei.<br />
In diesem Sinne wünsche ich schon einmal gute<br />
Besserung!<br />
Dr. med. Gert Printzen, Mitglied des Zentralvorstandes,<br />
Verantwortlicher Ressort Heilmittel<br />
* Weitere weniger katastrophale Grippepandemien waren<br />
die Asiatische Grippe von 1957, die weltweit auch noch<br />
immerhin zwei Millionen Tote forderte, und die Hongkong-<br />
Grippe von 1968, bei der etwa eine Million Menschen<br />
starben.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1679
Thema FMH<br />
Ärztemangel: Ist die Lösung weiblich?<br />
Esther Bieri<br />
Esther Bieri aus Luzern ist<br />
Supervisorin und Coach FH IAP.<br />
Sie ist <strong>als</strong> Projektleiterin in<br />
Schweizer Spitälern tätig.<br />
* N ame von der Redaktion<br />
geändert.<br />
Korrespondenz:<br />
FMH Kommunikation<br />
Jacqueline Wettstein<br />
Elfenstrasse 18<br />
CH-3000 Bern 15<br />
Tel. 031 359 11 11<br />
Fax 031 359 11 12<br />
kommunikation(at)fmh.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Der Ärztemangel in der Schweiz wird immer deutlicher. Hat man am Anfang dieses<br />
Jahrhunderts noch von einer Ärzteschwemme gesprochen, zeigt der Trend heute<br />
ein deutig in die umgekehrte Richtung. Trotz der Anerkennung von 210 ausländischen<br />
Diplomen [1] blieben im Jahr 2010 zahlreiche Stellen unbesetzt. Eine wichtige<br />
Rolle spielen dabei das Geschlechterverhältnis bei den Studierenden und die steigende<br />
Quote der diplomierten Ärztinnen.<br />
Über Jahre richteten sich die Arbeitszeiten nach den<br />
Bedürfnissen der Klinik und waren entsprechend<br />
nach oben unbegrenzt. 2005 wurde in den Spitälern<br />
die Arbeitszeit für Assistenz- und teilweise auch für<br />
Oberärzte auf 50 Stunden pro Woche begrenzt.<br />
Andererseits nimmt der Bedarf an medizinischen<br />
Leistungen mit steigender Lebenserwartung der Bevölkerung<br />
zu. Entsprechend mussten zusätzliche Stellen<br />
geschaffen werden. Zunehmend zeigt sich, dass<br />
zahlreiche Assistenz- und Kaderarztstellen nicht<br />
mehr besetzt werden können. In einigen Fachrichtungen,<br />
zum Beispiel der Hausarztmedizin – mangelt<br />
es <strong>als</strong>o bereits heute an Nachwuchs.<br />
Dabei gilt das Medizinstudium nach wie vor <strong>als</strong><br />
attraktiv. Entsprechend ist die Nachfrage nach den<br />
Studienplätzen ungebrochen gross: Für das Studienjahr<br />
2011/2012 haben sich an den Universitäten Basel,<br />
Bern, Freiburg und Zürich 2936 Personen für das<br />
Studium der Humanmedizin angemeldet. Das sind<br />
dreieinhalb Mal mehr Anmeldungen <strong>als</strong> Studienplätze.<br />
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und<br />
FMH: konkrete Projekte gefordert<br />
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte<br />
FMH sieht eine Ursache des Ärztemangels darin,<br />
dass zu wenig Ärzte ausgebildet werden. Ein Kapitel<br />
ihres Zielpapiers für die Legislaturperiode 2008 bis<br />
2012 [3] widmet sie denn auch der «Förderung des<br />
beruflichen Nachwuchses». Sie setzt sich auf den<br />
verschiedenen politischen Ebenen für eine Erhöhung<br />
der Studierendenzahl von 20 % ein.<br />
Die zweite wichtige Ursache des Ärztemangels<br />
liegt im Bedürfnis der jungen Ärztinnen und Ärzte,<br />
Familie und medizinische Laufbahn zu vereinbaren.<br />
Viele unterbrechen ihre Karriere oder steigen zum<br />
Zeitpunkt der Familiengründung sogar ganz aus<br />
dem Beruf aus. Die FMH unterstützt deshalb konkrete<br />
Projekte ihrer Mitglieder, die zeitgemässe und<br />
familienfreundliche Arbeitsbedingungen in den<br />
Ins titutionen des Gesundheitswesens (Horte, Teilzeitarbeit<br />
usw.) zum Ziel haben.<br />
Ärzte FMH fordert deshalb, dass die Anzahl Studienplätze<br />
um 20 Prozent angehoben werden muss.<br />
Medizinstudium: 63 % Frauen<br />
Ein Blick in die Studierendenstatistik der Universität<br />
Zürich macht eine Feminisierung im Fach Humanmedizin<br />
deutlich. Bereits im Jahr 2000 lag der Frauenanteil<br />
bei 63 %. Nur: Haben Ärztinnen dieselben<br />
K arrierechancen wie ihre männlichen Kollegen? Wie<br />
gut ist eine medizinische Laufbahn mit der Gründung<br />
einer Familie vereinbar? Eine Untersuchung des<br />
UniversitätsSpit<strong>als</strong> Zürich zur gleichberechtigten<br />
Nachwuchsförderung von Ärztinnen und Ärzten [2]<br />
zeichnet ein klares Bild: Der Frauenanteil bei den<br />
A ssistenzärzten liegt bei 40 %, auf der Stufe Oberärztinnen<br />
noch bei 30 %. Weiter oben auf der Karriereleiter<br />
sind Frauen eine Seltenheit: 8 % bei Leitenden<br />
Ärzten und Ärztinnen.<br />
Ehemann übernimmt Rolle des Familien-<br />
und Hausmanns<br />
Dr. med. Karin Alpiger* ist heute Mutter von zwei<br />
schulpflichtigen Kindern. 1993 schloss sie ihr Medizinstudium<br />
ab. Für sie war immer klar, dass sie nach<br />
ihrem Praxisjahr eine chirurgische Laufbahn einschlagen<br />
würde. Während ihrer Zeit <strong>als</strong> Assistenz ärztin – in<br />
der sie die Ausbildungsjahre und die nötige Anzahl<br />
Operationen für den Facharzttitel FMH C hirurgie absolvierte<br />
– wurde die talentierte Ärztin von ihren Chefs<br />
gefördert. «Mit dem Fortschritt der Karriere liess diese<br />
Förderung jedoch nach», erinnert sich Alpiger. Stattdessen<br />
hat man ihr vermehrt unliebsame Auf gaben<br />
übertragen, die sie im Erlernen des Basishandwerks behinderten.<br />
«Während meiner Funktion <strong>als</strong> Oberärztin<br />
kamen meine beiden Kinder zur Welt. Die komplikationslosen<br />
Schwangerschaften liessen es zu, dass ich<br />
bis zum Geburtstermin im Vollzeitpensum a rbeiten<br />
konnte. Glücklicherweise hatte mein Ehemann die<br />
Grösse, die Rolle des Familien- und Hausmanns zu<br />
übernehmen. Er hat <strong>als</strong> IT-Manager eines grossen Verlagshauses<br />
seine Karriere schon gemacht und wollte<br />
mir nun meine Laufbahn im Spital ermöglichen.»<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1681
Thema FMH<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Teilzeitpensum für Kaderärzte: sinnvoll?<br />
Für Karin Alpiger kam ein Teilzeitpensum nie in<br />
Frage. «Chirurgie ist ein Handwerk, das viel Übung<br />
und Erfahrung verlangt. Mit einem reduzierten Pensum<br />
hätte ich für die Oberarztreife entsprechend länger<br />
gebraucht», meint sie. Heute, da sie eine eigene<br />
Praxis betreibt, kann sie die Arbeitszeiten besser nach<br />
ihrer Familie ausrichten. Trotzdem arbeitet sie Vollzeit.<br />
«Nach einer so langen Ausbildung habe ich mir<br />
eine Menge Knowhow und Erfahrung angeeignet. Ich<br />
habe mich entschieden, beides zugunsten meiner<br />
P atientinnen und Patienten zu verwenden.» Zwar<br />
versteht Karin Alpiger den Wunsch junger Ärztinnen<br />
und Ärzten sich die Kombination von Beruf und<br />
F amilie im Rahmen einer Teilzeitstelle zu ermöglichen.<br />
«Gerade vor dem Hintergrund des Ärztemangels<br />
sollte man den drohenden Knowhow-Verlust bei<br />
der Entscheidung über die Pensumgrösse berücksichtigen.»<br />
Kinderbetreuung bis 22.00 Uhr<br />
Bis heute gibt es nur wenige Kliniken, die in einem<br />
chirurgischen Fach Teilzeitstellen für Kaderärztinnen<br />
und -ärzte geschaffen haben. Eine davon ist die<br />
O rthopädie des Luzerner Kantonsspit<strong>als</strong> in Wolhusen.<br />
Hier teilen sich zwei Frauen und ein Mann<br />
zwei Oberarztstellen. Alle drei haben Familie. «Ich<br />
habe das Talent dieser angehenden Fachärzte gesehen<br />
und wollte sie weiterhin fördern – unabhängig vom<br />
Geschlecht», sagt Chefarzt Dr. med. Richard F. Herzog.<br />
«Ja, es ist ein Experiment. Es funktioniert nur<br />
dann, wenn die Oberärzte mit Teilzeitpensen bereit<br />
sind, die Arbeitszeiten genauso einzuhalten wie alle<br />
anderen Kollegen auch.» Der Personalbestand einerseits<br />
und die Tagesstruktur der Klinik andererseits<br />
l assen es nicht zu, das Haus bereits um 18.00 Uhr zu<br />
verlassen. Als Kaderarzt trägt man für seine Patienten<br />
die gesamte Verantwortung. Es wird gearbeitet, bis<br />
der letzte Patient untersucht und der letzte OP-<br />
Bericht diktiert ist. «Deshalb sind die Spitäler gefordert,<br />
endlich Kinderbetreuung von 6.00 bis 22.00 Uhr<br />
zu organisieren. Diese muss vom Arbeitsplatz des<br />
E lternteils gut erreichbar sein.» Im Gegensatz zu<br />
K arin A lpiger glaubt Chefarzt Herzog, dass Teilzeitarbeit<br />
eine wichtige Rolle spielen wird, wenn es darum<br />
geht, dem Ärztemangel nachhaltig zu begegnen.<br />
Nur so könnten Mütter mit einem chirurgischen<br />
Facharzt- Titel dem Gesundheitswesen <strong>als</strong> Leistungserbringerinnen<br />
langfristig erhalten bleiben. «Dazu<br />
braucht es allerdings angepasste Arbeitsbedingungen,<br />
wie die Möglichkeit der familienexternen Kinderbetreuung<br />
oder der Spezialisierung in einem Teilbereich.»<br />
Koordination der Ausbildung<br />
bis zur Facharztreife<br />
Sowohl Karin Alpiger wie auch Richard F. Herzog<br />
wünschen sich von der FMH und von den Fachgesellschaften,<br />
dass sie die Schaffung von Ausbildungsregionen<br />
unterstützen. Diese müssten aus verschieden<br />
grossen Spitälern bestehen, damit die Kandidatinnen<br />
und Kandidaten ihre Ausbildungsjahre bis zur Facharztreife<br />
planen können. Gerade die Ausbildung von<br />
Kandidatinnen in Teilzeitpensen ist für die Klinikverantwortlichen<br />
besonders anspruchsvoll. Eine langfristige<br />
Planung ist für das Spital eine wichtige Voraussetzung,<br />
um Personalengpässe zu vermeiden und<br />
dem zunehmenden Facharztmangel zu begegnen.<br />
Literatur<br />
1 Suter P, de Haller J, Täuber M, Gassmann B.<br />
Zukünftiger Bedarf an Ärztinnen und Ärzten in der<br />
Schweiz. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2006;87(17):713–4.<br />
2 Jacquemart C, Boos L. Gleichberechtigte Nachwuchsförderung<br />
von Ärztinnen und Ärzten am Universitätsspital<br />
Zürich; 2000.<br />
3 Strategische Ziele der FMH für die Legislaturperiode<br />
2008–2012, www.fmh.ch<br />
Drei Ärztinnen, drei Erfahrungsberichte<br />
Prof. Dr. med. Barbara Buddeberg-Fischer,<br />
Professorin und Fachärztin Psychiatrie<br />
und Psychotherapie FMH und Kinder- und<br />
Jugend psychiatrie und -psychotherapie FMH<br />
sowie Fähigkeitsausweis für Psychosomatische<br />
und Psychosoziale Medizin (SAPPM)<br />
Ich befinde mich auf der letzten Etappe meiner beruflichen<br />
Tätigkeit. Wenn ich zurückblicke, dann staune<br />
ich, wie ich alles unter einen Hut gebracht habe: den<br />
Erwerb von zwei Facharzttiteln, meine Praxistätigkeit<br />
und parallel dazu die Kindererziehung und meine<br />
wissenschaftliche Tätigkeit. Bereits früh habe ich mir<br />
ein Standbein in der sozialwissenschaftlichen Forschung<br />
aufgebaut und zum Beispiel Studien mit<br />
J ugendlichen zu Essstörungen durchgeführt. Als Forscherin<br />
finde ich es schade, dass die Wissenschaft<br />
noch immer männerorientiert ist und Frauen seltener<br />
diesen Einstieg suchen. Während sich 12 Prozent<br />
der Männer für eine medizinisch-akademische Berufslaufbahn<br />
entscheiden, schlagen nur gerade 2 Prozent<br />
der Medizinerinnen diese Richtung ein. Und<br />
auch auf den Chefetagen der Spitäler sind die Frauen<br />
immer noch stark untervertreten. Ich hoffe, dass sich<br />
dies in den nächsten Jahren ändern wird, schliessen<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1682
Thema FMH<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
doch seit einigen Jahren mehr Frauen <strong>als</strong> Männer das<br />
Studium der Humanmedizin ab.<br />
Ich finde es eine positive Entwicklung, dass vor<br />
a llem jüngere Ärztinnen und Ärzte nicht mehr bereit<br />
sind, rund um die Uhr zu arbeiten. Doch leider sind<br />
die Weiterbildung und die Anstellungsbedingungen<br />
vielfach noch an männlichen Lebensläufen orientiert.<br />
Die 50-Stunden-Woche in der Weiterbildungsphase<br />
wird in vielen Spitälern und manchen Fachbereichen<br />
nicht eingehalten. Ebenso richten sich die<br />
Kinderkrippen von Spitälern oft nicht nach den Bedürfnissen<br />
von Ärztinnen, zum Beispiel in Bezug auf<br />
ihre Arbeitszeiten. Dies muss unbedingt geändert<br />
werden. Gerade für Frauen braucht es viel mehr<br />
Teilzeitstellen von etwa 80 bis 60 Prozent, damit sich<br />
Beruf und Familie kombinieren lassen. Und auch die<br />
Weiterbildung ist meiner Ansicht nach in einem<br />
80-Prozent-Pensum machbar, selbst in der Chirurgie.<br />
Ob jemand eine gute Ärztin oder ein guter Arzt ist,<br />
entscheidet sich bekanntlich nicht an der Anzahl<br />
Überstunden, sondern u. a. an der Persönlichkeit.<br />
Medizinstudentinnen und ihren Kollegen rate ich,<br />
sich möglichst früh zu entscheiden, welchen Facharzt<br />
sie erwerben wollen. Damit lässt sich die Weiterbildung<br />
optimal und effizient gestalten. Denkbar<br />
wäre zum Beispiel, dass die Weiterbildung zentral<br />
o rganisiert ist: Ein Jahr vor dem Staatsexamen entscheiden<br />
sich die Medizinstudierenden für eine Fachrichtung<br />
und melden sich bei der entsprechenden<br />
zentralen Stelle. Von dieser erhalten sie dann verschiedene<br />
Angebote für die gesamte Weiterbildungs-<br />
Dr. med. Brigitte Muff, Chefärztin Chirurgie,<br />
Fachärztin für Chirurgie FMH mit Schwerpunkten<br />
Viszeralchirurgie sowie Allgemein- und<br />
Unfallchirurgie und Fähigkeitsausweis psychosoziale<br />
und psychosomatische Medizin<br />
Ich bin seit über 20 Jahren Chirurgin und seit 2005<br />
<strong>als</strong> Chefärztin an der Chirurgischen Klinik im Spital<br />
Bülach tätig. Mein Beruf bereitet mir auch nach all<br />
den Jahren immer noch grosse Freude, die operative<br />
Tätigkeit sowie der Kontakt zu den Patienten sind<br />
dafür die Hauptgründe. Weiter liegt mir das Einführen<br />
junger Ärztinnen und Ärzte in den Klinikalltag<br />
und das Lehren des chirurgischen Handwerks sehr<br />
am Herzen. Natürlich gibt es auch in unserem Beruf<br />
Schattenseiten. Diese sind aber nicht unbedingt wie<br />
oftm<strong>als</strong> vermutet die hohen Präsenzzeiten oder die<br />
anstrengenden Dienste, sondern die Tatsache, dass<br />
immer mehr Personen, die mit unserem Kerngeschäft<br />
nichts zu tun haben, uns diktieren (wollen),<br />
was wir tun und lassen sollen. Der Verwaltungsapparat<br />
in den Spitälern hat sich in den letzten Jahren<br />
massiv vergrössert. Dadurch resultieren zwangsläufig<br />
mehr (sinnlose) Schnittstellen mit der Ärzteschaft.<br />
Die ständigen Rechtfertigungen für unser Tun gegenüber<br />
allen möglichen Bereichen im Spital sind je-<br />
Barbara Buddeberg-Fischer: «Heute schliessen mehr<br />
Frauen <strong>als</strong> Männer das Medizinstudium ab. Darum sind<br />
Veränderungen notwendig in der Weiterbildung, in den<br />
institutionellen Rahmenbedingungen in den Spitälern,<br />
in der Berufswelt und auch in der Forschung.»<br />
zeit, auf die sie sich bewerben können. Meiner Meinung<br />
nach dauert die ärztliche Weiterbildung derzeit<br />
zu lange. Man könnte sie ohne Qualitätseinbusse auf<br />
vier bis fünf Jahre beschränken und jeweils zu erreichende<br />
Jahresziele definieren. Die Weiterbildung<br />
setzt sich ja in die kontinuierliche Fortbildung während<br />
der ganzen Berufstätigkeit fort. Eine verkürzte,<br />
effizienter gestaltete Weiterbildung käme vor allem<br />
auch den Frauen in unserem Beruf zugute.<br />
Brigitte Muff: «Mein Beruf bereitet mir auch nach all<br />
den Jahren immer noch grosse Freude, die operative<br />
Tätigkeit sowie der Kontakt zu den Patienten sind dafür<br />
die Hauptgründe.»<br />
doch zermürbend, demotivierend und sicher nicht<br />
qualitätsfördernd.<br />
Spitäler werden durch Manager geführt, was zwangsläufig<br />
einen Paradigmenwechsel zur Folge hat. Mit<br />
ihrem betriebswirtschaftlichen Hintergrund sind sie<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1683
Thema FMH<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
überzeugt, dass Spitäler <strong>als</strong> Dienstleistungsbetriebe<br />
gleich geführt werden können und sollen wie irgendwelche<br />
Sachgüterproduktionsbetriebe*. Früher gab<br />
es kranke Menschen, <strong>als</strong>o Patienten, die eine Therapie<br />
benötigten. Die daraus entstandenen Kosten<br />
wurden über Subventionen, Prämien oder direkt beglichen.<br />
Heute spricht man von Kunden, und im<br />
Zentrum steht nicht mehr die sinnvollste Therapie<br />
für den Einzelnen, sondern die Gewinnoptimierung<br />
für den Betrieb. Ein sozialer Auftrag soll nach marktwirtschaftlichen<br />
Regeln umgesetzt werden. Eine paradoxe<br />
Situation, in der wir uns befinden.<br />
Als Frau und Mutter von zwei fast erwachsenen<br />
Töchtern werde ich oft mit der Frage konfrontiert,<br />
ob und wie ich Familie und Arztberuf unter einen<br />
Hut bringe. Diese Frage sollte heute eigentlich gar<br />
nicht mehr relevant sein. Vielmehr sollte es eine<br />
Selbstverständlichkeit sein, dass Mütter auch leitende<br />
Funktionen in sämtlichen Berufsrichtungen<br />
innehaben. Natürlich müssen dafür gewisse Voraussetzungen<br />
erfüllt sein: Zunächst braucht es die Erkenntnis<br />
seitens der Eltern, aber auch der Bevölkerung,<br />
dass eine Fremdbetreuung der Kinder nichts<br />
Schlechtes ist. Es müssen genügend Krippenplätze<br />
vorhanden sein, und die Betreuung sollte auch für<br />
Familien gewährleistet sein, in denen einer der<br />
E ltern oder beide im Schichtbetrieb arbeiten. Dieses<br />
Modell wird übrigens in Frankreich oder in den<br />
skandinavischen Ländern bereits angewendet. Heute<br />
sind Ärztinnen in leitender Spitalfunktion oder in<br />
Patrizia Kündig, Medizinstudentin an der<br />
medizinischen Fakultät Basel<br />
Ich studiere im 5. Studienjahr Humanmedizin an der<br />
Universität Basel. Für mich war bereits vor der Matura<br />
klar, dass ich diese Richtung einschlagen werde.<br />
Und ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meiner<br />
Wahl. Generell würde ich mir wünschen, dass die<br />
praktische Tätigkeit auch bereits während der Ausbildung<br />
ein stärkeres Gewicht hätte. Zwar sieht das<br />
Studium mehr Praxis vor <strong>als</strong> noch vor einigen Jahren,<br />
aber diese findet leider meist nur im Rahmen<br />
einzelner Stunden statt. Die Form der Vorlesung hat<br />
immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Auch<br />
wenn diese Art der Vermittlung ihre Berechtigung<br />
hat für manchen Lernstoff, so ist sie wahrscheinlich<br />
nicht in jedem Fall die beste Methode. Man täte gut<br />
daran, diese didaktische Form zu überdenken und<br />
das bestehende Curriculum dahingehend zu analysieren,<br />
welche Inhalte sinnvollerweise <strong>als</strong> Vorlesung<br />
präsentiert und welche Themen wie viele Stunden<br />
gelehrt werden. Eine problemorientierte oder eine<br />
praktische Vermittlung der Lerninhalte wäre in manchen<br />
Fächern angezeigt. Wichtig ist für mich und<br />
meine Kolleginnen und Kollegen vor allem, dass die<br />
Lernziele so gewichtet sind, dass sie unserer späteren<br />
der Lehre klar untervertreten. Wenn frau jedoch will<br />
(und das ist die wichtigste Voraussetzung) und die<br />
Spitalwelt nicht von vornherein <strong>als</strong> frauen- und<br />
mütterfeindlich akzeptiert, dann kann dieses geschlechtliche<br />
Ungleichgewicht korrigiert werden.<br />
Man kann dafür auch Jobsharing-Modelle anwenden,<br />
wie es beispielsweise die Maternité des Stadtspit<strong>als</strong><br />
Triemli in Zürich erfolgreich tut durch zwei<br />
Chefärztinnen mit Teilpensen.<br />
Für die kommende Ärztegeneration hoffe ich, dass<br />
medizinfremde Diktate wie beispielsweise das Arbeitsgesetz<br />
für Ärzte in Weiterbildung (für operative Disziplinen<br />
eher hinderlich) oder das Ausfüllen von<br />
Formularen für irgendwelche Pseudoqualitätssicherung<br />
nicht weiter zunehmen. Ferner müsste die<br />
Ö konomisierung in der Medizin gestoppt werden,<br />
sodass der Patient wieder im Mittelpunkt steht und<br />
nicht der dienstleistungskaufende Kunde. Ich für<br />
meine Person kann mir gut vorstellen, irgendwann<br />
in Zukunft auch in einem Krisengebiet oder Entwicklungsland<br />
tätig zu sein. Genau dort eben, wo es<br />
darum geht, kranken Menschen zu helfen ohne<br />
ö konomische Hintergedanken.<br />
* Dieses Phänomen beschreibt Mathias Binswanger<br />
in seinem Buch «Sinnlose Wettbewerbe: Warum wir<br />
immer mehr Unsinn produzieren.», Herder-Verlag,<br />
sehr schön. Ebenso widmet sich Bernard Lown in<br />
«Die verlorene Kunst des Heilens. Anstiftung zum<br />
Umdenken», Suhrkamp-Verlag, diesem Thema.<br />
Patrizia Kündig: «Es muss ein Umdenken stattfinden,<br />
und die Arbeitsbedingungen für Ärzte und Ärztinnen<br />
müssen den heutigen Bedürfnissen angepasst werden.»<br />
ärztlichen Tätigkeit im heutigen Gesundheitswesen<br />
entsprechen. Ich habe mich noch nicht entschieden,<br />
in welchem Fachbereich ich später tätig sein möchte.<br />
Am meisten interessiert mich gegenwärtig die Notfallmedizin,<br />
deshalb sehe ich mich z.B. in der Inten-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1684
Thema FMH<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
sivmedizin oder bei der Rega. Und ich plane, meinen<br />
Facharzt möglichst rasch zu erwerben. Weil ich die<br />
medizinische Ausbildung mitgestalten will, engagiere<br />
ich mich bereits heute auch verbandspolitisch<br />
im Vorstand der Swiss Medical Students’ Association<br />
(swimsa).<br />
Auch nach meinem Studium möchte ich weiterhin<br />
in der Standespolitik und in der ärztlichen Aus- und<br />
Weiterbildung aktiv sein. Ich kann mir auch gut vorstellen,<br />
eine Familie zu haben, und hoffe, dass sich<br />
Kinder und die ärztliche Tätigkeit kombinieren lassen,<br />
da ich meinen Beruf nicht aufgeben möchte.<br />
Weil auch viele andere Medizinstudentinnen und<br />
-studenten später weder auf Beruf noch auf Familie<br />
verzichten wollen, muss endlich auch im Arztberuf<br />
Teilzeitarbeit möglich sein und gefördert werden.<br />
Viele Ärztinnen und auch immer mehr Ärzte wollen<br />
heute Teilzeit arbeiten, ohne dass sie <strong>als</strong> arbeitsscheu<br />
angesehen werden und auf das Karriereabstellgleis<br />
geraten. Zudem braucht es mehr Kinderkrippen an<br />
Jetzt ProJekte einreichen! Bis 29.02.2012<br />
Spitälern, und deren Angebote müssen ausgebaut<br />
und den Bedürfnissen der Ärztinnen und Ärzte angepasst<br />
werden. Ebenso möchte die jüngere Generation<br />
von Ärztinnen und Ärzten nicht ständig auf<br />
Freizeit und damit Erholung verzichten müssen. Es<br />
tut somit dringend Not, dass die gesetzlich geregelte<br />
maximale Arbeitszeit für Assistenzärztinnen und<br />
-ärzte von 50 Stunden nicht nur auf dem Papier<br />
steht, sondern auch eingehalten wird. Weil heute<br />
schon mehr Frauen ein Medizinstudium absolvieren<br />
<strong>als</strong> Männer, weil die Bedürfnisse von angehenden<br />
Ärztinnen und Ärzten sich geändert haben, braucht<br />
es einen Wandel in der ärztlichen Berufswelt und vor<br />
allem mehr Flexibilität vonseiten der Arbeitgeber.<br />
Trotzdem, auch wenn die Strukturen und die Arbeitsbedingungen<br />
in anderen Berufen komfortabler sind,<br />
bin ich nach wie vor begeistert von der Medizin,<br />
freue mich auf meine spätere Tätigkeit <strong>als</strong> Ärztin und<br />
wünsche mir, dass mir genügend Zeit bleiben wird<br />
für den individuellen Patienten.<br />
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen<br />
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt<br />
auf www.swissqualityaward.ch an.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1685
Personalien<br />
Todesfälle / Décès / Decessi<br />
Annemarie Staehelin (1923), † 23.9.2011,<br />
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,<br />
4056 Basel<br />
Wladislaw Dalucas (1920), † 9.10.2011,<br />
4051 Basel<br />
Karl Rimensberger-Amsler (1926),<br />
† 12.10.2011,<br />
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,<br />
6024 Hildisrieden<br />
Michael Iten (1969), † 14.10.2011, Facharzt<br />
für Allgemeine Innere Medizin, 4125 Riehen<br />
Praxiseröffnung /<br />
Nouveaux cabinets médicaux /<br />
Nuovi studi medici<br />
SG<br />
Cornelia Brüssow, Fachärztin für Allgemeine<br />
Innere Medizin, Alte Jonastrasse 24,<br />
8640 Rapperswil SG<br />
TG<br />
Sonja Tacconi-Eugster, Praktische Ärztin und<br />
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,<br />
Untermoosstrasse 11, 8355 Aadorf<br />
VD<br />
Jean-Claude R. Givel, Spécialiste en chirurgie,<br />
8, avenue Jomini, 1004 Lausanne<br />
Patricia Medinger Bossel, Spécialiste en<br />
médecine interne générale, 18, rue des<br />
Remparts, 1400 YverdonlesBains<br />
ZH<br />
Roland Burren, Spécialiste en psychiatrie et<br />
psychothérapie d’enfants et d’adolescents et<br />
Spécialiste en médecine interne générale,<br />
Schaffhauserstrasse 138, 8302 Kloten<br />
Stephan Bauer, Facharzt für Urologie,<br />
Rämistrasse 39, 8001 Zürich<br />
Corinne Tanja Eberhardt, Fachärztin für<br />
Kinder und Jugendmedizin, Hammerweg 4,<br />
8304 Wallisellen<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Ärztegesellschaft des Kantons Bern<br />
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio<br />
Zur Aufnahme <strong>als</strong> ordentliche Mitglieder haben<br />
sich angemeldet:<br />
Christian Jost, Facharzt für Gastroenterologie,<br />
FA ERCP und Innere Medizin FMH, Roschistrasse<br />
7, 3007 Bern<br />
Patricia Hirt-Minkowski, Fachärztin für Nephrologie<br />
und Innere Medizin FMH, Bubenbergplatz<br />
5, 3011 Bern<br />
Zur Aufnahme <strong>als</strong> ordentliches Mitglied in<br />
leitender Funktion hat sich angemeldet:<br />
Josef Faller, Facharzt für Innere Medizin FMH,<br />
Medi24, Bolligenstrassse 54, 3006 Bern<br />
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen<br />
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung<br />
schriftlich und begründet beim Präsidenten<br />
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio<br />
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist<br />
entscheidet der Vorstand über die<br />
Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen<br />
Einsprachen.<br />
Ärztegesellschaft<br />
des Kantons Luzern<br />
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion<br />
Stadt hat sich angemeldet:<br />
Heidi Ulrich, Fachärztin für Dermatologie und<br />
Venerologie, Dermatologische Praxis Hirslanden<br />
Klinik St. Anna, St. AnnaStrasse 32,<br />
6006 Luzern<br />
Einsprachen sind innert 20 Tagen zu rich <br />
ten an das Sekretariat, Schwanenplatz 7,<br />
6004 Luzern, Fax 041 410 80 60.<br />
Ärztegesellschaft<br />
des Kantons Schwyz<br />
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des<br />
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:<br />
Andreas Hirlinger, Chefarzt Institut für Anästhesiologie<br />
FMH, Spital Lachen<br />
Einsprache gegen diese Aufnahme richten Sie<br />
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo<br />
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
FMH<br />
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug<br />
Zur Aufnahme in die ÄrzteGesellschaft des<br />
Kantons Zug <strong>als</strong> ordentliches Mitglied hat<br />
sich angemeldet:<br />
Von Atzigen Winistörfer Priska, Fachärztin für<br />
Innere Medizin FMH, Centramed, Baarerstrasse<br />
8, 6300 Zug<br />
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen<br />
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung<br />
schriftlich und begründet beim Sekretariat<br />
der ÄrzteGesellschaft des Kantons Zug<br />
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist<br />
entscheidet der Vorstand über<br />
Gesuch und allfällige Einsprachen.<br />
1686
FME ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Zu den Ergebnissen der CANUPIS-Studie<br />
Keine Hinweise für erhöhtes Krebsrisiko<br />
bei Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken<br />
Jürg Schädelin<br />
Dr. med., ehemaliger medizinischer<br />
Leiter der Abteilung<br />
Epidemiologie und Medikamentensicherheit<br />
bei Novartis.<br />
Mitautor der FMEBroschüre<br />
«Kinderleukämie und Kernkraftwerke<br />
– (K)Ein Grund zur<br />
Sorge?»<br />
Korrespondenz:<br />
Dr. med. Christian von Briel<br />
Forum Medizin und Energie<br />
Postfach<br />
CH8040 Zürich<br />
Tel. 043 501 18 50<br />
kontakt(at)fme.ch<br />
www.fme.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die CANUPIS-Studie konnte keine signifikante Erhöhung von Krebserkrankungen bei<br />
Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken feststellen. Sie kommt damit zu einem<br />
a nderen Ergebnis <strong>als</strong> die deutsche KiKK-Studie. Der folgende Beitrag vergleicht die<br />
beiden Studien hinsichtlich der gewählten Methode und der verwendeten Daten.<br />
Wenn man in einem beobachtenden oder experimentierenden<br />
Fachgebiet eine Studie gezielt plant,<br />
um die Ergebnisse einer früheren Untersuchung zu<br />
bestätigen oder zu widerlegen, ist immer ein kardinaler<br />
Entscheid, wie weit man das vorherige Studiendesign<br />
exakt kopiert, um eine möglichst<br />
v ollständige Vergleichbarkeit zu erreichen, oder ob<br />
man die Schwachpunkte der ersten Arbeit durch<br />
verbesserte Studienanlage ausmerzen soll. Genau<br />
diese S ituation traf auch für die CANUPISStudie<br />
zu, die vom Bundesamt für Gesundheit und der<br />
<strong>Schweizerische</strong>n Krebsliga in Auftrag gegeben<br />
wurde, um die unerwarteten Ergebnisse der deutschen<br />
KiKKStudie für schweizerische Verhältnisse<br />
zu überprüfen.<br />
Es lohnt sich daher, vor der Besprechung der<br />
R esultate die wichtigsten Unterschiede der Studienanlage<br />
und ihre Auswirkungen zu erläutern. Wie zumeist<br />
beim Studium seltener Ereignisse in der Epidemiologie<br />
wurde in der KiKKStudie eine Fallkontrolle<br />
vorgenommen. Dabei werden die Fälle der Fragestellung<br />
einzeln eruiert und die interessierenden Parameter<br />
erhoben, die Vergleichspopulation wird aber in<br />
e iner zufällig ausgewählten Stichprobe abgeschätzt,<br />
da die entsprechenden Informationen in den allgemeinen<br />
Statistiken nicht verfügbar sind und deren Erhebung<br />
bei der gesamten Normalbevölkerung einen<br />
unzumutbaren Aufwand bedeuten würde. Man<br />
nimmt damit eine StichprobenUnsicherheit in Kauf<br />
und ist natürlich sehr verwundbar bezüglich unsauberer<br />
Zufallsauswahl der Vergleichsgruppe. Die exakte<br />
Entfernung des Wohnortes vom Kernkraftwerk – was<br />
<strong>als</strong> Mass für das zusätzliche Erkrankungsrisiko gewertet<br />
wurde – muss so nur in den ausgewählten Kontrollen<br />
eruiert werden. Den Forschern der CANUPIS<br />
Studie in der Schweiz kam hingegen zugute, dass<br />
durch die Volkszählungen alle 10 Jahre eine detaillierte<br />
Aufnahme der Bevölkerungsstruktur vorliegt,<br />
die auch die Wohnadresse angibt. Damit konnte die<br />
Vergleichspopulation für ihre Altersverteilung wie<br />
auch ihren exakten Abstand vom Kernkraftwerk<br />
g enau beschrieben werden. Und da die Vergleichsgruppe<br />
alle statistisch erfassbaren Personen beinhaltet,<br />
stellt sich die Frage nicht, ob die Stichprobe auch<br />
repräsentativ sei.<br />
Zeitpunkt der Erkrankung massgebend<br />
Eine zweite und wesentliche Differenz zwischen<br />
den beiden Studien gibt es beim Zeitpunkt der Erkrankung,<br />
an dem die Patienten mit ihrer Vergleichsgruppe<br />
in Beziehung gesetzt werden. Die<br />
KiKKStudie verwendete dafür den Moment der<br />
D iagnose der Erkrankung. Die CANUPISStudie<br />
gibt zwar dieses Resultat auch an, bezeichnet jedoch<br />
eine Berechnung für den Tag der Geburt <strong>als</strong><br />
die wesentliche Analyse. Dies aus der gerechtfertigten<br />
Überlegung, dass die meisten Patienten mit<br />
j uveniler Leukämie schon bei der Geburt riskante<br />
Mutationen zeigen und die grösste Empfindlichkeit<br />
für Strahlenschäden in der vorgeburtlichen<br />
Entwicklung liegen. Allerdings leidet dadurch die<br />
Vergleichbarkeit mit der deutschen Studie, da die<br />
untersuchte Bevölkerungsgruppe doch recht anders<br />
zusammengesetzt ist. Für einen erheblichen Teil<br />
der Erkrankten war bei der Schweizer Studie kein<br />
Vergleich möglich, da deren Geburtstag vor der<br />
Zeitspanne der exakten Dokumentation lag oder<br />
der Geburtsort sich im Ausland befand. Aber in<br />
der sekundären Analyse nach Wohnort zur Zeit der<br />
Diagnose ist ein direkter Vergleich mit der KiKK<br />
Studie auf einem identischen Erhebungsmaterial<br />
möglich.<br />
Ein dritter, wesentlicher Unterschied liegt darin,<br />
wie das berechnete Risiko – die Nähe zum Kernkraftwerk<br />
– für die statistische Analyse gruppiert wird.<br />
Praktisch alle früheren Studien verwenden ein politisch<br />
definiertes Gebiet, für das Bevölkerungs und<br />
Krankheitsstatistiken zusammengefasst vorliegen.<br />
Diese Grenzen entsprechen naturgemäss nur sehr<br />
grob dem Abstand vom Kernkraftwerk. Wesentlich<br />
präziser ist da die Berechnung innerhalb konzentrischer<br />
Kreise, wie sie bei beiden Studien angewendet<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1687
FME ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAFT<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
wurde. Doch auch dieses Vorgehen beinhaltet eine<br />
e rhebliche Fehlerquelle, denn die gewählten Abstände<br />
sind arbiträr und nicht aus einem Naturgesetz<br />
der Risikoverteilung abgeleitet. Da die Leukämieerkrankungen<br />
seltene Einzelfälle darstellen, können geringfügig<br />
verschobene Grenzen schon ganz wesentliche<br />
Änderungen in der Risikoberechnung hervorrufen.<br />
Um diese Fehlerquelle zu vermeiden, wurde in der<br />
KiKKStudie erstm<strong>als</strong> eine Regressionsrechnung angewandt.<br />
Dabei wird – vereinfacht dargestellt – das<br />
E rkrankungsrisiko, d. h. das Verhältnis erkrankter zu<br />
gesunden Kindern, für jede Distanz vom Kernkraftwerk<br />
aufgetragen. Ist die verbindende Linie flach, so<br />
hat die Nähe keinen Einfluss auf das Krankheitsrisiko;<br />
steigt sie hingegen an, so spricht dies für ein erhöhtes<br />
Risiko in der näheren Umgebung. Fehler durch künstliche<br />
Abgrenzungen können nicht mehr vorkommen,<br />
da alle Abstände gleichermassen zum Anstieg<br />
beitragen. Dies bedingt allerdings, dass der Berechnung<br />
eine gleichmässige Risikoabschätzung zugrunde<br />
gelegt wird. Ein sogenanntes mathematisches M odell.<br />
Üblicherweise wird angenommen, dass sich das<br />
R isiko um den Faktor 1 / Abstand vermindert, was<br />
z. B. dem Konzentrationsverlauf eines in einen See<br />
g ebrachten Giftstoffes entspricht. Beide Studien haben<br />
diese Berechnungsart angewendet, die deutsche<br />
KiKKStudie <strong>als</strong> hauptsächliche Analyse, die CANU<br />
PISStudie <strong>als</strong> sekundäre Methodik.<br />
Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass beide<br />
Studien im Aufbau ausreichend ähnlich konzipiert<br />
wurden und direkt vergleichbare Berechnungsmethoden<br />
offerieren, auch wenn die Wahl des primären<br />
Analysewegs verschieden ist.<br />
Resultate<br />
Die von den Autoren der CANUPISStudie favorisierte<br />
Berechnung für das Risiko bei Geburt zeigt<br />
im Bereich 0–5 km eine geringe Erhöhung um 20 %<br />
für das Auftreten einer Leukämie bis zum vollendeten<br />
4. Lebensjahr, im Bereich 5–10 km ein um 40 %<br />
vermindertes Risiko und zwischen 10 und 15 km<br />
wieder eine Erhöhung um 10 %. Diese Unterschiede<br />
sind völlig erklärt durch die Zufallsabweichungen,<br />
die sich bei der geringen Anzahl von Fällen<br />
statistisch ergeben. Werden alle Altersgruppen<br />
oder alle Krebserkrankungen zusammengenommen,<br />
so rücken die Risikoabschätzungen gegen das<br />
Normalrisiko 1 hin. Schon das jährliche Erkrankungsrisiko<br />
für Leukämie schwankt zwischen<br />
–30 % und +20 %, obwohl jährlich etwa 5mal so<br />
viele Fälle gezählt werden, <strong>als</strong> über die ganze Zeit<br />
in einer der Abstandskategorien aufgetreten waren.<br />
Dass diese Unterschiede auf Zufall beruhen, zeigt<br />
sich anschaulich an den Konfidenzintervallen,<br />
die jedes Mal über die Marke 1 für unverändertes<br />
Risiko hinausgehen. Ebenso fehlt ein eindeutiger<br />
Trend, das Risiko sinkt erst und steigt anschliessend<br />
erneut mit zunehmendem Abstand, was physikalisch<br />
nicht plausibel erscheint.<br />
Werden die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose<br />
mit den Gesunden verglichen, so zeigen sich<br />
weitgehend die gleichen Resultate. Im innersten<br />
B ereich bis 5 km ist das Risiko 40 % höher, zwischen<br />
5 und 10 km 15 % niedriger und all diese Verhältniszahlen<br />
sind durch Zufallsfehler bei kleinen Absolutzahlen<br />
erklärbar.<br />
Die Analyse mit der Regressionsrechnung ist in<br />
der CANUPISStudie nur kurz dargestellt. Für Leuk ämien<br />
nimmt das Risiko ab, je näher der Geburtsort an<br />
einem Kernkraftwerk liegt. Wird der Wohnort zur Zeit<br />
der Diagnose zur Berechnung verwendet, so zeigt sich<br />
eine Zunahme um nahezu 100 % bei 1 km Entfernung.<br />
Eine derartige Diskrepanz ist nur dadurch<br />
e rklärbar, dass diese Art der Berechnung die allernächsten<br />
Wohnorte ausserordentlich stark gewichtet.<br />
Kleinste Differenzen im Anteil der ausgeschlossenen<br />
Patienten können das Resultat gleich ins Gegenteil<br />
verkehren. Dies muss auch für die Interpretation der<br />
KiKKStudie in Betracht gezogen werden.<br />
Zusätzlich und ausführlich werden noch eine<br />
Reihe von Sensitivitätsanalysen dargestellt. Solche<br />
Zusatzauswertungen sollen die Frage klären, inwieweit<br />
ein anderer, <strong>als</strong> mögliche Ursache bekannter<br />
Faktor zum signifikanten Resultat geführt haben<br />
könnte. Die Berechnungen werden dann einzeln<br />
für jedes andere vermutete Risiko korrigiert. Da<br />
aber die Hauptanalyse nicht signifikant ist, bleiben<br />
derartige Überlegungen weitgehend bedeutungslos,<br />
die Resultate ändern sich nicht. Es wäre allerdings<br />
f<strong>als</strong>ch, daraus zu schliessen, dass all diese<br />
Z usatzfaktoren keinen Einfluss haben. Sie sind<br />
zum Teil sehr kursorisch formuliert und die Studienanlage<br />
ist schlicht nicht darauf angelegt, z. B.<br />
den Einfluss von Hochspannungsleitungen auf<br />
dieses Krankheitsgeschehen abzuschätzen. Bei besserer<br />
Kooperation der Versuchspersonen wären<br />
dazu auch aus der KiKKStudie viele bedeutendere<br />
Informationen zu gewinnen gewesen.<br />
Man hat der CANUPISStudie vorgeworfen, dass<br />
sie infolge mangelnder Fallzahlen nicht aussagekräftig<br />
sei, <strong>als</strong>o zu wenig Power habe. Dies ist angesichts<br />
unseres kleinen Landes sicher der Fall, andererseits<br />
muss man klarstellen, dass bei einem nicht<br />
e rhöhten Risiko keine Studie genügend P ower hat,<br />
um einen kleinsten Beitrag zum Erkrankungsrisiko<br />
auszuschliessen. Man muss sich bei der Interpretation<br />
bei diesen Gegebenheiten darauf beschränken,<br />
dass diese Studie keinen ernstzunehmenden Hinweis<br />
auf eine zusätzliche Gefährdung für Leukämie<br />
oder generell Krebskrankheiten im Kindesalter in<br />
Folge Schwangerschaft oder Wohnort in der Nähe<br />
eines Kernkraftwerkes zeigt. Der Vergleich mit der<br />
KiKKStudie ist so präzis möglich und zeigt, dass die<br />
schweizerischen Daten denjenigen aus Deutschland<br />
nicht entsprechen, sei es w egen eines unbekannten<br />
anderen Grundes oder wegen der Zufälligkeiten, die<br />
sich aus dem in Deutschland gewählten Studiendesign<br />
ergeben können.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1688
SAMW WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN<br />
Genetik im medizinischen Alltag –<br />
ein Leitfaden für die Praxis<br />
Deborah Bartholdi a ,*<br />
Sabina Gallati b ,*<br />
Hansjakob Müller c *<br />
a P D Dr., Institut für<br />
Medizinische Genetik,<br />
Universität Zürich<br />
b P rof. Dr., Abteilung für<br />
Humangenetik, Universitätsklinik<br />
für Kinderheilkunde,<br />
Inselspital, Bern<br />
c P rof. Dr., Abteilung<br />
Medizinische Genetik,<br />
UKBB/DBM,<br />
Universität Basel<br />
* M itglieder<br />
des Redaktionsteams<br />
Korrespondenz:<br />
<strong>Schweizerische</strong> Akademie der<br />
Medizinischen Wissenschaften<br />
(SAMW)<br />
Petersplatz 13<br />
CH-4051 Basel<br />
mail(at)samw.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Das «Human Genome»-Projekt machte die Genetik<br />
zu einer Schlüsseldisziplin der modernen Medizin.<br />
Die Identifizierung der einzelnen Gene und die<br />
A ufklärung ihrer Funktion ermöglichen ein besseres<br />
Verständnis der Pathogenese seltener Erbkrankheiten;<br />
ebenso eröffnen sie einen immer besseren Einblick<br />
in die komplexen Mechanismen der Entstehung<br />
der häufigen multifaktoriell verursachten Krankheiten.<br />
Nicht nur Mutationen der Nukleotidsequenz wirken<br />
sich auf das Erscheinungsbild und somit die Gesundheit<br />
aus, sondern auch Modifikationen der DNA<br />
und der Histone oder die topologische Lage einer<br />
Chromosomenregion im Zellkern. Solche epigenetischen<br />
Phänomene spielen bei der Stammzellenentwicklung<br />
oder bei der Krebsentstehung eine grosse<br />
Rolle. Neue Technologien (man spricht vom «next generation<br />
sequencing») erlauben die Generierung einer<br />
immer grösseren Menge von Daten über unser Erbgut<br />
und dies zu einem immer günstigeren Preis. Diese<br />
Verfahren werden im medizinischen Alltag baldige<br />
Anwendung finden, sei es zur raschen Krankheitsdiagnostik<br />
oder für die Wahl von massgeschneiderten<br />
Medikamenten für den einzelnen Patienten. Genetische<br />
Untersuchungen dienen auch der Familienplanung<br />
und der Erfassung von Personen mit Krankheitsveranlagungen,<br />
damit diese vor deren Auswirkungen<br />
rechtzeitig geschützt werden können.<br />
Man tut sich allgemein schwer mit dieser raschen<br />
Entwicklung der Genetik. Mehr Informationen über<br />
Genetik, über genetische Diagnostik, über deren Vor-<br />
und Nachteile sowie über die rechtlichen und ethischen<br />
Rahmenbedingungen sind gefragt. Die <strong>Schweizerische</strong><br />
Akademie der Medizinischen Wissenschaften<br />
(SAMW) hat dieses Bedürfnis früh erkannt und<br />
2004 eine Broschüre mit dem Titel «Genetische Untersuchungen<br />
im medizinischen Alltag» veröffentlicht,<br />
dies mit der Absicht, einen Beitrag zu leisten zur<br />
besseren Nutzung des neuen genetischen Wissens in<br />
der Praxis. Diese Schrift fand in der Ärzteschaft, bei<br />
Studierenden der Medizin oder in der Ausbildung<br />
von Pflegenden eine gute Aufnahme und war daher<br />
rasch vergriffen. Nun erscheint sie in einer 2., überarbeiteten<br />
und erweiterten Auflage. Mehrere Autoren<br />
Inhalt des Leitfadens<br />
«Genetik im medizinischen Alltag»<br />
1. Bedeutung der Genetik in der Medizin<br />
2. Abklärung von Erbkrankheiten<br />
3. Durchführung von genetischen<br />
Untersuchungen<br />
4. Familienplanung und Genetik<br />
5. Pränatales Screening und pränatale<br />
Diagnostik<br />
6. Genetische Krankheiten bei Kindern und<br />
Jugendlichen<br />
7. Genetische Krankheiten bei Erwachsenen<br />
8. Epigenetik<br />
9. Genetik und personalisierte Medizin<br />
10. Entwicklungen in der genetischen<br />
Diagnostik<br />
11. Ethische Aspekte genetischer<br />
Untersuchungen<br />
12. Gesetzliche Grundlagen (inkl. Bundes-<br />
gesetz über genetische Untersuchungen<br />
beim Menschen)<br />
trugen diesmal dazu bei, und ein erweitertes Redaktionsteam<br />
bemühte sich, nicht nur deren Textteile,<br />
sondern auch die wertvollen Anregungen von Einzelpersonen<br />
und Fachgesellschaften – besonders erwähnt<br />
sei die <strong>Schweizerische</strong> Gesellschaft für Medizinische<br />
Genetik – einzuarbeiten.<br />
Die Broschüre möchte auch in Zukunft eine nützliche<br />
Informationsquelle und Hilfe bei der konkreten<br />
Auseinandersetzung mit medizinischen, ethischen,<br />
rechtlichen, und psychosozialen Fragen im Zusammenhang<br />
mit der modernen Genetik sein. Gerne hoffen<br />
wir, dass sie diesem hohen Anspruch gerecht<br />
wird; selbstverständlich sind wir interessiert an Rückmeldungen,<br />
und zwar sowohl an kritischen Bemerkungen<br />
<strong>als</strong> auch an Anregungen für Verbesserungen<br />
und Ergänzungen.<br />
Der Leitfaden kann bei der SAMW <strong>als</strong> gedruckte<br />
Broschüre bestellt oder unter www.samw.ch/de/<br />
Publikationen/Leitfaden heruntergeladen werden.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1689
SCTO WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN<br />
Die Swiss Clinical Trial Organisation<br />
veröffentlicht Qualitätsrichtlinien<br />
Maya Grünig a ,<br />
Claudia Weiss b ,<br />
Peter Meier-Abt c<br />
a M anager Quality, Swiss<br />
Clinical Trial Organisation<br />
b D r., Geschäftsführerin, Swiss<br />
Clinical Trial Organisation<br />
c P rof. Dr. med., Präsident,<br />
Swiss Clinical Trial<br />
Organisation<br />
Korrespondenz:<br />
Swiss Clinical Trial<br />
Organisation<br />
Petersplatz 13<br />
CH-4051 Basel<br />
info(at)scto.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) ist die<br />
Dachorganisation für die klinische Forschung in<br />
der Schweiz. Sie setzt sich für die Koordination und<br />
eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den<br />
l okalen Studienzentren ein, insbesondere den<br />
Clin ical Trial Units (CTUs) an den Universitätsspitälern<br />
(Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich) und<br />
am Kantonsspital St. Gallen; dies hauptsächlich<br />
in den Bereichen Spezifikation von Qualitätsstandards,<br />
Aus- und Weiterbildung sowie nationale<br />
und internationale Studienvermittlung.<br />
Mit der Zielsetzung, die Patientensicherheit und<br />
die Integrität der erhobenen Daten in klinischen Versuchen<br />
zu verbessern, erarbeitete die SCTO in Zusammenarbeit<br />
mit allen CTUs und der <strong>Schweizerische</strong>n<br />
Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung<br />
(SAKK) ein übergreifendes Konzept zur Qualitätssicherung.<br />
Das Konzept empfiehlt allen Tri<strong>als</strong> Units<br />
die Einführung eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems<br />
(QMS) wie z. B. ISO 9001:2008<br />
oder ähnlichen Systemen.<br />
Als wichtigen Eckpfeiler des Qualitätssicherungskonzepts<br />
erarbeitete eine von der SCTO geleitete<br />
A rbeitsgruppe die Guidelines for Good Operational<br />
Practice (GGOP) für das CTU-Netzwerk. Gestützt auf<br />
Richtlinien anderer europäischer akademischer Netzwerke<br />
repräsentieren diese Guidelines gemeinsam<br />
festgelegte Qualitätsstandards für die operationelle<br />
Praxis an den einzelnen CTUs. Sie betreffen sowohl<br />
das Managementsystem der individuellen Organisationen<br />
<strong>als</strong> auch die Durchführung von klinischen<br />
Forschungsprojekten.<br />
Die Guidelines for Good Operational Practice sind in<br />
zwei Teile strukturiert. Der erste Teil beschreibt die<br />
Anforderungen an das Managementsystem der Organisation,<br />
d.h. an die Struktur, die internen Prozesse,<br />
die Ressourcen und die Aktivitäten der CTUs. Der<br />
zweite Teil behandelt den wichtigsten Dienstleistungsprozess<br />
der CTUs, das Management von klinischen<br />
Forschungsprojekten. In diesen Kapiteln werden<br />
die Anforderungen an Studienprojekte beschrie-<br />
Die Guidelines for Good Operational Practice<br />
(GGOP) liegen in englischer Sprache vor und<br />
können <strong>als</strong> gedruckte Broschüre bei der SCTO<br />
bestellt (info@scto.ch) oder auf der Website<br />
(www.scto.ch) in elektronischer Form heruntergeladen<br />
werden.<br />
ben, die von CTUs durchgeführt oder betreut werden.<br />
Dabei folgt das Dokument dem zeitlichen Ablauf<br />
e ines Studienprojekts: von der Konzeptphase über die<br />
Entwicklung, das Set-up, von der Durchführung bis<br />
zum Abschluss des Projekts. Jedes Kapitel listet die<br />
Anforderungen auf, die mit detaillierten Kriterien,<br />
Verantwortlichkeiten, Prozessen und Zielen spezifiziert<br />
werden.<br />
Im Rahmen des Qualitätssicherungskonzepts sind<br />
periodische Überprüfungen der QMS innerhalb des<br />
Netzwerks geplant. Ein erster Schritt in diese Richtung<br />
wurde bereits mit der Initiierung von System-<br />
Inspektionen durch Swissmedic gemacht, deren<br />
Durchführung im Sommer 2011 eine erste wertvolle<br />
Analyse der QMS bei allen CTUs ergeben hat. Basierend<br />
auf den Inspektionsberichten können nun die<br />
CTUs gezielte Verbesserungsmassnahmen in Angriff<br />
nehmen.<br />
Mit der Freigabe der Guidelines for Good Operation al<br />
Practice haben die SCTO und das CTU-Netzwerk einen<br />
wichtigen Meilenstein erreicht und die konstruktive<br />
Zusammenarbeit im Netzwerk unter Beweis gestellt.<br />
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Harmonisierung<br />
und kontinuierlichen Qualitätsverbesse-<br />
Ein übergreifendes Konzept zur Qualitätssicherung soll die Patientensicherheit<br />
und die Integrität der erhobenen Daten in klinischen Versuchen<br />
verbessern.<br />
rung der Dienstleistungen innerhalb des CTU-Netzwerkes<br />
und damit zur Anerkennung der Fachkompetenz<br />
der CTUs auf nationaler und internationaler<br />
Basis. Wenn diese Guidelines von anderen (bestehenden<br />
oder im Aufbau begriffenen) Studienzentren und<br />
klinisch tätigen Netzwerken umgesetzt werden,<br />
würde dies einen grossen Schritt in Richtung Verbesserung<br />
und Harmonisierung der Studienkultur in der<br />
Schweiz bedeuten.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1690
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE<br />
Briefe an die SÄZ<br />
Beleidigender Vorwurf<br />
Zum Artikel von Gerhard Kocher<br />
Im Zusammenhang mit Fehlanreizen im Gesundheitswesen<br />
nennt Gerhard Kocher [1]<br />
die Umsatzbolzerei durch die Selbstdispensation<br />
auf Seite 1469. Dieser pauschale Vorwurf<br />
ist ungeheuerlich und beleidigend für<br />
alle Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich<br />
ihren Patientinnen und Patienten die notwendige<br />
Medizin unkompliziert und ohne Zeitverzug<br />
in der Praxis bereitstellen. Die Tatsache,<br />
dass die Medikamentenkosten pro Versicherten<br />
in Kantonen mit Selbstdispensation<br />
keineswegs höher sind <strong>als</strong> in Kantonen mit<br />
Abgabe über die Apotheke, belegt auch die<br />
Haltlosigkeit seiner Polemik. Er verkennt,<br />
dass rezeptpflichtige Medikamente nur bei<br />
entsprechender Indikation und in klar definierter<br />
Menge abgegeben werden – alles andere<br />
würde die Kranken schädigen. Die Idee<br />
«Dörf’s es bitzeli meh sii?» stammt aus dem<br />
Käseladen. Wenn ein Patient seinem Arzt den<br />
korrekten, wirtschaftlichen Umgang mit<br />
M edikamenten nicht zutraut, dann soll er ein<br />
Rezept verlangen oder den Arzt wechseln.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Dr. med. Walter Grete, Bachenbülach<br />
1 Kocher G. Die Gründe der «Kostenexplosion»<br />
im Gesundheitswesen. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(38):1466–9.<br />
«Kostenexplosion»<br />
Sehr geehrter Herr Kocher<br />
Zurück von den Ferien, bin ich beim Durchblättern<br />
der <strong>Schweizerische</strong>n <strong>Ärztezeitung</strong><br />
Nr. 38 auf Ihren Artikel [1] über die Gründe<br />
der «Kostenexplosion» gestossen und habe<br />
ihn mit Interesse gelesen. Als Grundversorger<br />
mache ich mir über dieses Thema auch Gedanken<br />
und Beobachtungen. Erfreut nahm<br />
ich zur Kenntnis, dass das primitive Menschenbild<br />
– der Mensch, der kein anderes Ziel<br />
<strong>als</strong> die Maximierung seines Einkommens verfolgt<br />
– sich <strong>als</strong> f<strong>als</strong>ch erwiesen hat. Betrübt<br />
hat mich aber, dass dies offenbar für selbstdispensierende<br />
Ärzte – ich gehöre auch dazu –<br />
nicht gilt, da sie diesen f<strong>als</strong>chen Anreiz zu ihren<br />
Gunsten ausnützen. Dies unterstellen Sie<br />
ihnen auf jeden Fall zwischen den Zeilen und<br />
theoretisch haben Sie recht. Es könnte ja<br />
wirklich so sein. Nun war ich bis jetzt der<br />
Meinung, dass die Medikamentenkosten in<br />
den Kantonen mit Selbstdispensation nicht<br />
höher, wie es aufgrund Ihrer Aussage zu erwarten<br />
wäre, sondern sogar tiefer liegen.<br />
Wenn Sie mit Zahlen belegen können, dass<br />
selbstdispensierende Ärzte wirklich noch<br />
dem primitiven homo oeconomicus entsprechen,<br />
muss ich wohl meine Meinung korrigieren.<br />
Andernfalls bezeichne ich Ihre Aussage<br />
<strong>als</strong> Unterstellung. Es würde mich dann<br />
natürlich noch interessieren, was Sie dazu<br />
motiviert.<br />
Dr. med. U. Müller, Bremgarten<br />
1 Kocher G. Die Gründe der «Kostenexplosion»<br />
im Gesundheitswesen. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(38):1466–9.<br />
Steigert die Selbstdispensation<br />
die Gesundheitskosten?<br />
Es ist eine bekannte Tatsache, dass eine Aussage<br />
nicht dadurch an Wahrheitsgehalt gewinnt,<br />
wenn sie immer und immer wiederholt<br />
wird, obwohl die Fakten diese Aussage<br />
entkräften oder gar widerlegen können. Dies<br />
muss dem bekannten, von Politikern und<br />
manchen Standesorganisationen häufig zitierten<br />
und auch von den Kostenträgern im<br />
G esundheitswesen vielfach konsultierten<br />
G esundheitsökonomen Gerhard Kocher ins<br />
Stammbuch geschrieben werden. Er hat kürzlich<br />
[1] in dieser Zeitschrift interessante<br />
Z ahlen über die Gründe der Kostenexplosion<br />
publiziert. Darin hat er zwar lesenswerte<br />
s tatistische Fakten aufgelistet, aber er hat der<br />
Versuchung nicht widerstehen können, es<br />
dabei nicht bewenden zu lassen. Vielmehr<br />
hat er eigene Ansichten und Interpretationen<br />
hineingeschmuggelt, denen widersprochen<br />
werden muss. So nennt er – wahrscheinlich<br />
zutreffend – <strong>als</strong> 7. Grund für die Kostenexplosion<br />
im Gesundheitswesen «medizinischen<br />
Überkonsum, Mengenausweitung durch die<br />
Leistungserbringer, unnötige Leistungen».<br />
Dieser Topf beinhaltet ganz unterschiedliche<br />
Untergruppen und ist somit nicht sehr aussagekräftig.<br />
Schlimmer ist aber die Interpretation<br />
des Autors, dass nämlich oft die Aussage,<br />
aber ohne zuverlässige Quellenangabe, genannt<br />
werde, wonach die Gesundheitsausgaben<br />
zu rund 70 % von Ärzten und anderen<br />
Leistungsanbietern «verursacht» oder mindestens<br />
bestimmt werden. Stichwörter dazu<br />
seien «Therapiefreiheit, Ärztemonopol für<br />
zahlreiche Therapien, Behandlungen durch<br />
den Arzt selbst, Verschreibung und Selbstdispensation<br />
von Medikamenten etc». – Etwas<br />
später beklagt der Autor alte Zöpfe wie Einzelpraxen,<br />
Selbstdispensation und überholte<br />
Medikamente. Auch diese Bemerkung wird<br />
ohne jeglichen statistischen Beleg <strong>als</strong> Faktum<br />
hingestellt – vielmehr ist es aber nur eine viel<br />
gehörte Behauptung von G. Kocher selbst, die<br />
auch schon oft durch Patientenbefragungen<br />
widerlegt wurde. – Das Fass zum Überlaufen<br />
bringt schlussendlich die ebenfalls nicht bewiesene<br />
Meinungsäusserung unter dem Stichwort<br />
«Umsatzbolzerei und Gewinnmaximierung»,<br />
wie es (ich zitiere) der Medikamentenhandel<br />
in der Arztpraxis darstelle. Das mag<br />
G. Kocher zwar persönlich so denken, der<br />
Vergleich zwischen den Gesundheitskosten<br />
in den selbstdispensierenden Kantonen und<br />
den rezeptierenden Landesteilen zeigt aber<br />
ein anderes Bild.<br />
Ich finde es schade, dass eine an sich wertvolle<br />
Arbeit eines anerkannten Gesundheitsökonomen<br />
durch die zahlreichen persönlichen,<br />
nicht belegten, ärztekritischen Meinungsäusserungen<br />
entwertet wird, und ich<br />
bin enttäuscht, dass die SÄZ diesen Artikel<br />
ohne kontradiktorische Diskussion übernommen<br />
hat.<br />
Dr. med. Hans-Ulrich Kull, Präsident APA<br />
(Ärzte mit Patientenapotheke), Küsnacht<br />
1 Kocher G. Die Gründe der «Kostenexplosion»<br />
im Gesundheitswesen. Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>.<br />
2011;92(38):1466–9.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1691
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE<br />
Palliativmedizin und<br />
Freitodbegleitung<br />
Ich finde den Artikel von Frau Kollegin Erika<br />
Preisig [1] sehr eindrücklich und kann gut<br />
nachvollziehen, dass sie die erwähnten Freitodbegleitungen<br />
mit ihrem Gewissen vereinbaren<br />
konnte. Ihrer Äusserung, wir Ärzte sollten<br />
lernen, auch unangenehme Wünsche<br />
u nserer Patienten zu akzeptieren, kann ich so<br />
aber nicht zustimmen. Es geht ja hier nicht<br />
darum, dass ein Patient erwartet, dass wir<br />
seine Vorstellungen über die Behandlung seiner<br />
Krankheit akzeptieren, auch wenn es<br />
nicht unsere sind, oder dass wir bereit sein<br />
müssen, auch über «schwierige» Themen wie<br />
Sexualität oder Gewalt mit unseren Patienten<br />
zu sprechen, sondern um eine Frage, die das<br />
Gewissen der Ärztinnen und Ärzte betrifft. So<br />
wie keine Ärztinnen und keine Ärzte gezwungen<br />
werden dürfen, an einem Schwangerschaftsabbruch<br />
mitzuwirken, darf auch kein<br />
Druck auf Ärztinnen und Ärzte ausgeübt werden,<br />
Suizidhilfe zu leisten.<br />
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil<br />
1 Preisig E. Palliativmedizin und Freitodbegleitung:<br />
Erfahrungsbericht einer Hausärztin.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2011;92(41):1588–9.<br />
Man reibt sich die Augen<br />
Palliativmedizin und Freitodbegleitung:<br />
Erfahrungsbericht einer Hausärztin [1]<br />
Da zitiert ein 84jähriger, in einer Klinik hospitalisierter<br />
Mann an einem Sonntag seine<br />
Hausärztin zu sich – hat sie überhaupt einen<br />
Behandlungsauftrag? Der alte Mann möchte<br />
sterben, und zwar subito. Dies nicht etwa,<br />
weil er unerträgliche Schmerzen hätte, nein,<br />
sondern weil er sich nicht von einer Pflegefachperson<br />
den Hintern putzen lassen will.<br />
Die folgsame Hausärztin macht’s möglich, indem<br />
sie eigens von der französischen Grenze<br />
bis nach Zürich fährt, um das begehrte Gift<br />
zu besorgen. Binnen 24 Stunden ist der ehemalige<br />
Bankdirektor im Jenseits.<br />
Ging da nicht alles ein bisschen schnell? Und<br />
wie frei ist ein Tod, der so ungeduldig herbeigesehnt<br />
wird, weil es der eigene Stolz nicht<br />
zulässt, sich von einer Pflegefachperson den<br />
Hintern putzen zu lassen? Hätte die Kollegin<br />
nicht so überengagiert auf die offensichtlich<br />
aus einem Impuls heraus vorgetragene Forde<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
rung des Greises reagiert, hätte er vielleicht<br />
sogar lernen können, erstm<strong>als</strong> in seinem<br />
L eben Schwäche zuzulassen.<br />
Nun, wir können unseren Patienten solche<br />
Erfahrungen natürlich nicht «verordnen», es<br />
ist aber gut, wenn wir uns bewusst bleiben,<br />
dass auch ein Leiden, das scheinbar ohne<br />
Sinn ist, aus einem andern Blickwinkel durchaus<br />
einen solchen haben kann. Jedenfalls<br />
scheint mir unabdingbar, wenn es darum<br />
geht, ein Leben gewaltsam zu beenden, dass<br />
ein solcher Entscheid 1. nur nach Rücksprache<br />
mit Fachkollegen und 2. erst nach einer<br />
Bedenkzeit von deutlich mehr <strong>als</strong> 24 Stunden<br />
umgesetzt werden darf. Nur so lassen sich<br />
kollusive Schnellschüsse vermeiden, die unserem<br />
Berufsstand keine Ehre erweisen.<br />
Dr. med. Walter Meili, Basel<br />
1 Preisig E. Palliativmedizin und Freitodbegleitung:<br />
Erfahrungsbericht einer Hausärztin.<br />
Schweiz <strong>Ärztezeitung</strong>. 2011;92(41):1588–9.<br />
Cavete Collegae – Eine Studie wird<br />
missbraucht [1]<br />
Eine Studie – zwei Interpretationen<br />
Die an der Medizinischen Poliklinik der Universität<br />
Zürich durchgeführte Studie «Ferrim»<br />
wurde 2006 von Dr. Beat Schaub für 200 Patienten<br />
konzipiert. Ihre Ergebnisse sind im<br />
Juni 2011 publiziert worden (BloodJournal).<br />
Offensichtlich bereitete es den Studienleitern<br />
Schwierigkeiten, Patientinnen zu finden, die<br />
bereit waren, ein «PlaceboRisiko» einzugehen.<br />
Oder gibt es vielleicht einen anderen<br />
Grund, weshalb die Patientenaufnahme nach<br />
43 VerumPatientinnen abgebrochen werden<br />
musste?<br />
Ergebnis dieser Pilotstudie war: Eisenbehandlungen<br />
sind bei Eisenmangelpatientinnen<br />
mit einem Ferritinwert unter 50 ng/ml signifikant<br />
wirksam. In der Publikation ist zu lesen:<br />
65 % der Behandelten profitieren nachhaltig<br />
von den Eisengaben.<br />
Allerdings sei es angesichts der zu geringen<br />
Zahl von Patientinnen nicht erlaubt, einen<br />
Ferritinwert zu definieren, unter dem eine<br />
E isensubstitution wirksam sei. Auch das steht<br />
so in der Publikation.<br />
Die Ärztlichen Eisenzentren führen seit 2006<br />
auch eine Studie durch – die Praxisstudie<br />
« Eurofer» mit 2168 Patientinnen [2]. Deren<br />
Resultate wurden bislang dreimal mit zunehmender<br />
Fallzahl publiziert. Dabei konnte<br />
nachgewiesen werden, dass ebenfalls 65 %<br />
der Behandelten von den Eisengaben profitieren.<br />
Die Universität Zürich hat <strong>als</strong>o im Sommer 2011<br />
die Resultate von «Eurofer» durch ihre eigene<br />
P ilotstudie wissenschaftlich bestätigt:<br />
– Das Eisenmangelsyndrom existiert.<br />
– Bei zwei von drei Patienten bessert sich<br />
die Müdigkeit durch Eisensubstitution.<br />
Im Widerspruch dazu behaupten nun aber der<br />
Studienleiter Dr. P. Krayenbühl und die Universitätsklinik<br />
Zürich: «Nur Patientinnen mit<br />
einem Ferritinwert unter 15 ng/ml können von<br />
E isengaben profitieren». Diese unbegründete,<br />
weil von der Zürcher Studie nicht gedeckte<br />
Schlussfolgerung hat Dr. Krayenbühl nun<br />
b ereits über zwei Fachzeitschriften, eine Publikumszeitschrift<br />
und sogar das Schweizer<br />
Fernsehen in die Öffentlichkeit getragen. Besonders<br />
bedauerlich ist jedoch, dass sich die<br />
Universitätsklinik Zürich hinter den Studienleiter<br />
stellte und dessen unrichtige Aussage in<br />
einer Medienmitteilung vom 29. Juni 2011<br />
übernommen hat. Es ist <strong>als</strong>o damit zu rechnen,<br />
dass diese Unwahrheit durch weitere<br />
Medien verbreitet wird.<br />
Fakt ist aber: 2003 hat die Universität Lausanne<br />
[3] nachgewiesen, dass bei Ferritinwerten<br />
unter 50 ng/ml Eisenmangelsymptome<br />
auftreten können, die nach Eisengaben verschwinden.<br />
Die Swiss Iron Health Organisation<br />
SIHO hat durch die eigene Praxisstudie<br />
ebendiesen Wert definiert, der nun auch von<br />
der Universität Zürich bestätigt wurde. Vifor<br />
Pharma bewirbt sogar neuerdings ihre Eisenprodukte<br />
mit dem Argument, dass aufgrund<br />
der Studie «Ferrim» Eisenmangelsymptome<br />
schon bei einem Ferritinwert von 50 ng/ml<br />
auftreten können.<br />
Was ist das Motiv von Dr. Krayenbühl und der<br />
Universitätsklinik Zürich, dem publizierten<br />
Sachverhalt ihrer eigenen Studie zu widersprechen?<br />
Und was treibt sie an, ihre f<strong>als</strong>che<br />
Interpretation an die Medien weiterzugeben?<br />
Die SIHO wünscht eine berichtigende Stellungnahme.<br />
Die Schweiz ist das erste Land, in dem viele<br />
Ärzte den Eisenmangel ihrer Patienten schon<br />
in dessen Frühstadium, dem Eisenmangelsyndroms<br />
IDS (Iron Deficiency Syndrome),<br />
erkennen und behandeln. Ihrem verantwortungsbewussten<br />
Handeln im Sinne ihrer<br />
Pa tienten steht leider immer noch das schulmedizinische<br />
Dogma entgegen. Durch akademische<br />
Streithähne werden sie sich indes<br />
nicht verunsichern lassen.<br />
«Die Hunde bellen – doch die Karawane zieht<br />
weiter!»<br />
Vorstand der SIHO: lic. iur. David Fischer,<br />
Dr. med. Cyrill Jeger, Dr. med. Harald Rauscher,<br />
Dr. med. Beat Schaub, Dr. med. Peter Wagner<br />
1 Krayenbühl PA et al. Intravenous iron for the<br />
treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal<br />
women with low serum ferritin<br />
concentration (blood201104346304).<br />
(FerrimStudie).<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1692
edaktion.saez@emh.ch BRIEFE / MITTEILUNG<br />
2 Schaub BS et al. Ars Medici. 2009; 23 (dritte<br />
Publikation). (EuroferPraxisstudie).<br />
3 Verdon F et al. Iron supplementation for<br />
unexplained fatigue in nonanaemic women.<br />
BMJ. 2003;326. (Lausanner Studie).<br />
Stellungnahme zum Brief «Cavete<br />
Collegae – Eine Studie wird missbraucht»<br />
der SIHO<br />
Als Verantwortliche der FerrimStudie und<br />
Autoren des in Blood publizierten Artikels [1]<br />
nehmen wir zu dem durch die SIHO eingereichten<br />
Brief gerne Stellung. Es sei einleitend<br />
festgehalten, dass wir <strong>als</strong> wissenschaftlich tätige<br />
Ärzte vor allem möglichst g enau unsere<br />
Studienresultate vertreten und vermitteln<br />
wollen:<br />
1. In unserer randomisierten, doppelblinden<br />
und placebokontrollierten Studie behandelten<br />
wir 90 unter Müdigkeit l eidende<br />
P atientinnen mit einem SerumFerritin<br />
unter 50 ng/ml mit entweder E isen oder<br />
Placeboinfusionen. Bei allen Patientinnen<br />
untersuchten wir eine allfällige Reduktion<br />
der Müdigkeit mittels zweier Fragebogen,<br />
dem BFI (brief fatigue inventory) und dem<br />
SPI (short performance inventory). Die<br />
Änderung der Müdigkeit anhand des BFI<br />
wurde <strong>als</strong> primärer Endpunkt definiert, da<br />
die Erfassung von Müdigkeit mit diesem<br />
Fragebogen wissenschaftlich etabliert und<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
in deutscher Version validiert ist. Die Befragung<br />
der 90 Patientinnen mit dem BFI<br />
Fragebogen ergab keine statistisch signifikante<br />
Wirkung hinsichtlich der Eisentherapie,<br />
verglichen mit Placebo, <strong>als</strong>o dem<br />
primären Endpunkt. Im Gegensatz dazu<br />
zeigte die Befragung mit dem SPIFragebogen<br />
eine statistisch signifikante Wirkung<br />
der Eisentherapie. Dieser Diskrepanz<br />
bewusst, führten wir in unserer Publikation<br />
beide Resultate auf, gewichteten aber<br />
– wissenschaftlich korrekt – das mit dem<br />
BFIFragebogen erzielte Resultat stärker, da<br />
dieses Resultat dem definierten primären<br />
Endpunkt entsprach.<br />
2. Die weitere Analyse unserer Studienresultate<br />
wies zudem darauf hin, dass die unter<br />
Punkt 1. besprochene Diskrepanz zwischen<br />
den 2 Fragebögen nicht entscheidend<br />
ist: (a) Für Patientinnen, welche<br />
bei Studienbeginn ein SerumFerritin von<br />
15 ng/ml oder tiefer aufwiesen, liess sich<br />
gleichermassen mit dem BFI und dem<br />
SPIFragebogen ein signifikanter Benefit<br />
der Eisenbehandlung gegenüber Placebo<br />
feststellen. (b) Für Patientinnen, welche<br />
bei Studienbeginn ein SerumFerritin zwischen<br />
16 und 50 ng/ml aufwiesen, liess<br />
sich weder mit dem BFI noch mit dem<br />
SPIFragebogen ein signifikanter Benefit<br />
der Eisenbehandlung gegenüber Placebo<br />
feststellen. Das Gleiche gilt, wenn <strong>als</strong> Cut<br />
Mitteilung<br />
off eine Transferrinsättigung von 20 % gewählt<br />
wird. Somit bestehen, was unsere<br />
Studienresultate anbetrifft, klare Verhältnisse.<br />
3. Wir sind uns selbstverständlich bewusst<br />
(und so ist es auch in unserer Publikation<br />
und im auf die Publikation bezogenen Editorial<br />
im Blood festgehalten [2]), dass aufgrund<br />
der limitierten Anzahl der Studienteilnehmerinnen<br />
(n = 90) kein endgültiger<br />
Cutoff hinsichtlich des SerumFerritins<br />
oder der Transferrinsättigung festgelegt<br />
werden kann, unterhalb dessen unter Müdigkeit<br />
leidende Patientinnen von einer Eisentherapie<br />
profitieren können. Zudem<br />
wird die ärztliche Beurteilung und Evaluation<br />
des Müdigkeitszustandes einer Patientin<br />
immer wesentlicher bleiben – auch<br />
für die Entscheidung, ob und welche Therapie<br />
durchgeführt werden soll.<br />
Dr. Pierre-Alexandre Krayenbühl<br />
Prof. Dr. Edouard Battegay<br />
Prof. Dr. Georg Schulthess<br />
1 Krayenbuehl PA, Battegay E, Breymann C,<br />
Furrer J, Schulthess G. Intravenous iron for the<br />
treatment of fatigue in nonanemic, premenopausal<br />
women with low serum ferritin<br />
concentration. Blood 2011;118(12):3222–7.<br />
2 Ironing out fatigue. Blood 2011;118(12):3191–2.<br />
<strong>Schweizerische</strong> Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefässchirurgie<br />
Preis der <strong>Schweizerische</strong>n Gesellschaft<br />
für Herz- und thorakale Gefässchirurgie<br />
(SGHC)<br />
Die <strong>Schweizerische</strong> Gesellschaft für Herz und<br />
thorakale Gefässchirurgie verleiht jährlich<br />
eine mit 10 000 Franken dotierte Auszeichnung<br />
für eine hervorragende wissenschaftliche<br />
Arbeit aus dem Gebiet der Herz und thorakalen<br />
Gefässchirurgie.<br />
Die vorgelegte Arbeit darf nicht für einen an<br />
deren Preis eingereicht worden sein. Sie kann<br />
<strong>als</strong> Manuskript oder <strong>als</strong> Sonderdruck vorgelegt<br />
werden. Im Falle einer bereits erfolgten<br />
Veröffentlichung darf diese nicht länger <strong>als</strong><br />
sechs Monate zurückliegen.<br />
Bewerber reichen ihre Arbeit in 4facher Ausführung<br />
bis 31. Dezember 2011 dem Sekretär<br />
der <strong>Schweizerische</strong>n Gesellschaft für Herz<br />
und thorakale Gefässchirurgie ein: PD Dr. M.<br />
Stalder, Sekretär der SGHC, Klinik für Herz<br />
und Gefässchirurgie, Inselspital, 3010 Bern.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1693
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Seminare 2011 / Séminaires 2011<br />
Praxiscomputerworkshop<br />
Inhalt<br />
Die Workshopteilnehmer/innen erhalten im 1. Teil<br />
eine Einführung in die Anforderungen an ein Praxisinformationssystem.<br />
Anhand einer modernen vernetzten<br />
Praxisinfrastruktur werden die Beurteilungskriterien<br />
für eine praxis- und zukunftstaugliche Softwarelösung<br />
dargestellt. Checklisten sollen die<br />
schnelle Orientierung unterstützen und bei der Beurteilung<br />
und Wahl des Produkts konkrete Hilfe bieten.<br />
In Zusammenarbeit mit der Kommission Informatics –<br />
e-Health der Hausärzte Schweiz werden die zentralen<br />
Elemente der elektronischen Krankengeschichte aufgezeigt.<br />
Ein Erfahrungsbericht eines EDV-Anwenders<br />
(Arzt) rundet den 1. Teil ab. Der 2. Teil umfasst die<br />
Präsentation von sechs Praxisadministrationssoftwarelösungen<br />
(Leistungserfassung, elektronisches<br />
Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,<br />
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische<br />
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen<br />
usw.).<br />
Ziel<br />
Die Teilnehmer/innen erhalten einen Anforderungskatalog,<br />
welcher ihnen erlaubt, ihre Vorstellungen für<br />
ein modernes Praxisinformationssystem besser zu<br />
formulieren und diese dem Softwarehersteller zu dessen<br />
Vorbereitung zu kommunizieren. Zudem erhalten<br />
sie einen ersten Überblick über führende Softwarelösungen.<br />
Datum<br />
K15 Donnerstag, 24. November 2011 Stadttheater<br />
9.30–16.30 Uhr Olten<br />
Folgende Softwareanbieter können Sie im<br />
2. Teil des Workshops kennenlernen:<br />
Ärztekasse, Urdorf (CB 7 – das Praxiscockpit)<br />
Standeseigene Genossenschaft seit 1964. Die Ärztekasse<br />
unterstützt Praxen in ihrer unternehmerischen<br />
Tätigkeit und übernimmt berufsfremde Aufgaben. Im<br />
Bereich Praxisadministration bietet die Ärztekasse<br />
ganzheitliche und individuelle Lösungen, abgestimmt<br />
auf Ihre Bedürfnisse. Von der Beratung und<br />
Mithilfe bei einer Eröffnung oder Übernahme einer<br />
Praxis, Evaluation von Hard- und Software, Netzwerkaufbau,<br />
Installation, Schulung bis zur Abrechnung<br />
und Eintreibung ausstehender Forderungen.<br />
Auch betriebswirtschaftlich unterstützen wir Schweizer<br />
Praxen und bieten Hand für statistische Erhebungen,<br />
z. B. für die FMH Roko oder kantonale Verbände.<br />
Wir treiben I nnovationen voran und stellen diese<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
nach gründ licher Prüfung allen unseren Mitgliedern<br />
meist kostenlos zur Verfügung. Kundennähe nehmen<br />
wir w örtlich, deshalb sind wir in der ganzen Schweiz<br />
mit 10 Agenturen <strong>als</strong> Anlaufstelle für wichtige und/<br />
oder dringende Anliegen da. Ob Fragen zu Rechnungen,<br />
Support vor Ort (innert nützlicher Frist) oder <strong>als</strong><br />
I nformationszentrum. Unsere Standorte befinden sich<br />
in Basel, Bern, Chur, Crissier, Genf, Lugano, Luzern,<br />
Neuchâtel, St. Gallen, Thônex und Zürich. Unser<br />
G ewinn ist Ihr Erfolg!<br />
Delemed AG Medical Software, Kehrsatz<br />
(pex II)<br />
Delemed AG entwickelt bereits über 19 Jahre erfolgreich<br />
Medizinsoftware für die Praxen. Die Software<br />
besticht durch den sympathischen, effizienten, einfachen<br />
und modularen Aufbau und lässt in keiner<br />
Praxis Wünsche offen. Dank unserer Vielseitigkeit im<br />
medizinischen Umfeld sind wir Ihr optimaler Partner.<br />
Gartenmann Software AG, Seuzach<br />
(PRAXIS*DESKTOP)<br />
Kompetent, effizient und innovativ – an diesen Werten<br />
orientieren wir uns seit der Gründung der Gartenmann<br />
Software AG 1992. Den Ausgangspunkt all<br />
u nserer Überlegungen und Tätigkeiten bilden dabei<br />
immer unsere Kunden. PRAXIS*DESKTOP ist mit den<br />
neusten Technologien ausgestattet und überzeugt<br />
durch eine intuitive und effiziente Benutzerführung<br />
und optimierte Prozessabläufe. Mit dem integrierten<br />
Berichtswesen werden Dokumente einfach erstellt<br />
und erfüllen die heute gestellten Qualitätsanforderungen.<br />
HCI Solutions AG, Gümligen (TriaMed ® )<br />
Die Abteilung Triamun von HCI Solutions, ein Unternehmen<br />
der Galenica-Gruppe, entwickelt und vermarktet<br />
innovative Softwarelösungen für das Praxis-,<br />
Apotheken- und Unternehmensmanagement. Individuelle<br />
Beratung, die gesamte Soft- und Hardware,<br />
einen umfassenden Support und Schulung aus einer<br />
Hand. Unsere Softwarelösung TriaMed ® für Arztpraxen,<br />
Gruppenpraxen, medizinische Zentren und<br />
Ärzteketten basiert auf der neusten Technologie und<br />
wurde zusammen mit Ärzten entwickelt. So ist eine<br />
intuitiv bedienbare Praxismanagement-Lösung entstanden,<br />
die sämtliche Bedürfnisse von integriertem<br />
und vernetztem Arbeiten befriedigt. Um den stetig<br />
wachsenden Anforderungen an eine praxisgerechte<br />
Softwarelösung gerecht zu werden, wird TriaMed ® stetig<br />
weiterentwickelt. Folgende wichtige Neuerungen<br />
wurden im vergangenen Jahr vorgenommen: elektronisches<br />
Rezept, Reichweitencheck mit Abgabevorschlag<br />
Medikamente, graphische Darstellung von<br />
Messwerten, DocBox-Schnittstelle, Perzentilen-Berech-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1694
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
nung, spezielle Gynäkologie- und Pädiatrie-Module,<br />
FMH Factoring Services, tel.search.ch, VEKA-Versichertenkarte,<br />
Parametrierbarkeit, mandantenübergreifende<br />
Bonitätsprüfung und Belegsuche, Outlook<br />
mit TriaMed.<br />
TMR Triangle Micro Research AG, Hölstein<br />
(WinMed ® )<br />
Die TMR AG wurde von Ärzten, Wissenschaftlern, Unternehmern<br />
und Dozenten der Uni Basel 1993 <strong>als</strong><br />
«Spin-Off»-Firma gegründet. Den Schwerpunkt in der<br />
Entwicklung der TMR AG bilden Anwendungen im Bereich<br />
der med. Telekommunikation, Internet sowie der<br />
mehrmandanten- und mehrplatzfähigen Ärztesoftware<br />
WinMed ® . WinMed ® ist ein vollständiges, äusserst<br />
einfach zu bedienendes Arztpraxisadministrationssystem<br />
mit integrierter Kommunikationsplattform,<br />
Bild- und Dokumentenverwaltung sowie<br />
modernster elektronischer Krankengeschichte. Win-<br />
Med ® wird nach ausgereifter mehrjähriger Pilotphase<br />
erfolgreich seit 1998 verkauft und zählt heute zu den<br />
meistgekauften Ärztesoftwarepaketen. Vertrieben wird<br />
WinMed ® in der Deutschschweiz von TMR AG selbst<br />
und im Tessin von GFP Mediconsul in Mas sagno.<br />
Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)<br />
Die Vitodata AG besteht seit 30 Jahren. Das Unternehmen<br />
konzentriert sich auf Praxis- und Kliniklösungen.<br />
Die innovative Haltung eröffnet laufend<br />
neue Einsatzgebiete – immer mit dem entsprechenden<br />
Nutzen für die Anwender. In den ersten 25 Jahren<br />
stand die Abrechnung mit der ICT im Vordergrund.<br />
Heute ist die Vitodata AG auch bei der elektronischen<br />
Krankengeschichtenführung und in der<br />
Vernetzung der Systeme und der Anwender an der<br />
Spitze im Schweizer Markt. Neben der konventionellen<br />
PC-Lösung in der Praxis bietet die Vitodata AG<br />
auch das ASP-Modell (Application Service Providing –<br />
Software mieten statt kaufen) an. Vitodata AG ist vertreten<br />
in vielen Arztpraxen, Instituten, Kliniken und<br />
Spitälern in der Schweiz. Zusätzlich entwickelte das<br />
Unternehmen in jüngster Zeit grosse Applika tionen<br />
für kantonale Gesundheitsdirektionen, Zahnkliniken<br />
und universitäre Institutionen im Gesundheitswesen.<br />
Die Marktführerschaft ist für das ganze Team der<br />
Vitodata AG eine Verpflichtung, im Sinne des Investitionsschutzes<br />
für die Kunden den Fortbestand zu<br />
s ichern und unternehmerisch und ethisch korrekt zu<br />
handeln. Auch deshalb setzt sich die Vitodata AG<br />
a ktiv für den Branchenverband VSFM (www.vsfm.info)<br />
und das Thema Datenaustausch (siehe www.smeex.ch)<br />
aktiv und auf allen Ebenen ein.<br />
Praxisübergabe<br />
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen.<br />
Hinweis: Vor allem aus steuer- und vorsorgeplanerischer<br />
Sicht lohnt es sich, sich bereits<br />
frühzeitig (5–10 Jahre) mit diesem Thema auseinanderzusetzen.<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Themen<br />
Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag, allg.<br />
Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten),<br />
Unternehmensbewertung einer Arztpraxis (Berechnung<br />
Inventarwert und Goodwill <strong>als</strong> Verhandlungsbasis),<br />
Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung<br />
von Versicherungsverträgen, Pensions-<br />
und Finanzplanung), Steuern (Steueraspekte<br />
bei der Praxisübergabe, Optimierung der steuerlichen<br />
Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer,<br />
Bestimmung des optimalen Übergabezeitpunktes).<br />
Sponsoren<br />
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren (siehe<br />
www.fmhservices.ch) gedeckt.<br />
Datum<br />
K10 Donnerstag, 10. November 2011 Hotel Victoria<br />
13.30–18.00 Uhr Basel<br />
Ouverture et reprise d’un cabinet médical<br />
Contenu<br />
Business plan (préparation du plan de financement<br />
et crédit d’exploitation, financement par la banque),<br />
Aménagement (implantation, projet et concept<br />
d’aménagement, choix du mobilier, budget), Estimation<br />
d’un cabinet (inventaire et goodwill), Administration<br />
d’un cabinet médical (dans le cabinet, par<br />
la banque), Assurances (toutes les assurances à l’intérieur<br />
et autour du cabinet), Passage du statut de<br />
s alarié à celui d’indépendant et fiscalité.<br />
Sponsors<br />
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir<br />
www.fmhservices.ch).<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1695<br />
Date<br />
K23 Jeudi, 10 novembre 2011 Genève<br />
17.00–21.30 h Crowne Plaza<br />
Remise d’un cabinet médical<br />
Contenu<br />
Aspects juridiques (autour du contrat de remise/reprise),<br />
Estimation d’inventaire et goodwill d’un cabinet,<br />
Assurances (prévoyance, assurances à<br />
l’intérieur et autour du cabinet), Conséquences fiscales<br />
d’une remise.<br />
Sponsors<br />
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir<br />
www.fmhservices.ch).<br />
Date<br />
K25 Jeudi, 17 novembre 2011 Genève<br />
17.00–21.30 h Crowne Plaza
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Anmeldung und Auskunft /<br />
Inscription et information<br />
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services,<br />
Cornelia Steinmann, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,<br />
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.<br />
Hinweis / Remarque<br />
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise<br />
oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt<br />
werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen<br />
Sponsoren zur Verfügung gestellt.<br />
Les adresses des participants aux séminaires dont les<br />
coûts sont couverts en partie ou totalement par des<br />
sponsors sont communiquées aux sponsors concernés.<br />
Seminarsponsoren 2011<br />
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht<br />
es der FMH Consulting Services AG, ihre<br />
Seminarreihen für FMH-Mitglieder teils kostenlos,<br />
teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir<br />
I hnen diese Firmen in einem Kurzporträt vor.<br />
Medics Labor AG<br />
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern<br />
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44<br />
info@medics-labor.ch<br />
www.medics-labor.ch<br />
Medizinisches Labor und mehr<br />
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen, zu<br />
Hause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren<br />
erfolgreich tätig im Kanton sowie weiteren Regionen.<br />
Geschätzt <strong>als</strong> persönliches, unkompliziertes Gegenüber,<br />
überzeugt Medics Labor durch fachliches und<br />
menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen<br />
und Dienstleistungen. Wir verstehen uns <strong>als</strong> sozialer<br />
Arbeitgeber und beschäftigen auch behinderte<br />
Personen.<br />
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte. Es<br />
gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das<br />
Unternehmen gemeinsam führen.<br />
Bioanalytica AG<br />
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern<br />
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30<br />
service@bioanalytica.ch<br />
www.bioanalytica.ch<br />
Engagierte Kompetenz<br />
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert auf<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Annullierungsbedingungen /<br />
Conditions d’annulation<br />
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende<br />
Unkostenbeiträge erhoben:<br />
Un montant est perçu pour une absence ou une annulation.<br />
Il est de:<br />
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn/<br />
par personne dans les 15 jours avant le début du<br />
séminaire;<br />
– 1 00 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn<br />
oder Fernbleiben / par personne dans les 7 jours<br />
avant le début du séminaire.<br />
einer langjährigen Tradition. Stetige Innovation und<br />
ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner<br />
bilden das Fundament unserer Kompetenz.<br />
Qualität und Seriosität – das sind die Werte,<br />
d enen wir uns verschrieben haben. Aus der Überzeugung,<br />
dass dies auch unseren Kunden wesentliche<br />
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre 2000<br />
akkreditieren lassen.<br />
Schnell, wenn notwendig auch rund um die Uhr, sind<br />
wir für Sie da. Mit dem Know-how von rund<br />
85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation<br />
und Informationstechnologie sind unsere Laborresultate<br />
in kürzester Zeit verfügbar.<br />
Bei Bioanalytica stehen Sie <strong>als</strong> Kunde im Mittelpunkt.<br />
Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit<br />
gerne optimal im persönlichen Kontakt und mit zahlreichen<br />
wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.<br />
Analytica Medizinische Laboratorien AG<br />
Falkenstrasse 14<br />
8024 Zürich<br />
Tel. 044 250 50 50<br />
kundendienst@analytica.ch<br />
Werte. Verbinden.<br />
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr Kollege<br />
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG wurde<br />
1957 von meinem Vater gegründet, und ich durfte<br />
das Labor 1985 in zweiter Generation übernehmen.<br />
Eigentlich mag ich es gar nicht, mich unpersönlich<br />
und mit schönen Worten vorzustellen. Ich bin durch<br />
und durch Praktiker, gibt es ein Problem, dann löse<br />
ich es, und kennt mich ein Kunde noch nicht persönlich,<br />
dann komme ich gerne vorbei und stelle<br />
mich vor.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1696
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Wir haben uns nach langen Diskussionen für den<br />
Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden. Der Punkt<br />
zwischen den Worten ist kein Schreibfehler. Wir<br />
h aben Werte. Werte, die uns einen persönlichen<br />
Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die<br />
Qualität unserer Arbeit beschreiben und Werte, die<br />
wir mit Ihnen – unseren Kunden- teilen. Diese Werte<br />
verbinden uns miteinander und stellen das tragfähige<br />
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren<br />
trägt. Für das bin ich dankbar.<br />
Dr. med. Peter Isler<br />
Polyanalytic SA<br />
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne<br />
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50<br />
info@polyanalytic.ch<br />
www.polyanalytic.ch<br />
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische Analysen,<br />
das auf dem Gebiet der Kantone Waadt und<br />
Neuenburg tätig ist.<br />
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den<br />
Dienst der Patientinnen und Patienten und der Ärzteschaft<br />
stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende<br />
Palette von medizinischen Analysen.<br />
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist das<br />
U nternehmen für herausragende Qualität und kundennahe<br />
Dienstleistungen bekannt. Den frei praktizierenden<br />
Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher<br />
Konstanz verlässliche, rasche und kompetente<br />
Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst<br />
ausüben können.<br />
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und Ärzte<br />
nicht nur über einen Partner, der auf ihre Bedürfnisse<br />
eingeht, sondern auch tagtäglich über echte<br />
Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.<br />
Polyanalytic ist mehr <strong>als</strong> ein Unternehmen: Dank der<br />
Kompetenz der Menschen, die dort arbeiten, kann<br />
die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen<br />
und Patienten, für die es verantwortlich ist,<br />
optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.<br />
Dianalabs SA<br />
Rue de la Colline 6, 1205 Genève<br />
Tel. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44<br />
info@dianalabs.ch<br />
www.dianalabs.ch<br />
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen,<br />
das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde, der Ärzteschaft<br />
und den Patientinnen und Patienten optimale<br />
Laborkontrollen zu bieten.<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen<br />
ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie<br />
international anerkannt.<br />
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen<br />
Analysen, um alle Bedürfnisse der Medizin<br />
abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr <strong>als</strong> ein polyvalentes<br />
Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam<br />
deckt es eine Vielzahl von Fachgebieten ab und<br />
bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen<br />
Fachgebiet mit seinen besonderen Bedürfnissen.<br />
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit<br />
den Ärztinnen und Ärzten und den universitären<br />
Zentren wurde uns klar, dass nur ein regionales<br />
U nternehmen, das grundlegende menschliche Werte<br />
wie Qualität, Austausch und Dienstleistungsbereitschaft<br />
in den Vordergrund stellt und mit den lokalen<br />
Verhältnissen vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung<br />
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen<br />
kann.<br />
MOGELSBERG<br />
MEDIPRINT • CLASSICPRINT<br />
Schmid Mogelsberg AG, Ärztedrucksachen<br />
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg<br />
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81<br />
info@schmid-mogelsberg.ch<br />
www.schmid-mogelsberg.ch<br />
Seit über 70 Jahren auf Ärztedrucksachen<br />
spezialisiert!<br />
Bei der Gestaltung von zweckmässigen Arztformularen<br />
(Patientenkarten, KG-Einlagenblätter usw.)<br />
p rofitieren Sie von der langjährigen Erfahrung. Die<br />
Vergangenheit hat gezeigt, dass sich kaum zwei Ärzte<br />
für den gleichen Druck entscheiden. Zweckmässige<br />
Materialauswahl, einwandfreie Verarbeitung, freundliche<br />
und kompetente Beratung, schnelle Lieferung<br />
und die Ausführung von Spezialwünschen – diese<br />
Dienstleistungen schaffen die Grundlage für ein<br />
langjähriges Vertrauensverhältnis. Auf Wunsch versenden<br />
wir eine individuell auf Ihre Fachrichtung<br />
zusammengestellte Druckmusterkollektion.<br />
An über 9000 Ärzte liefern wir Drucksachen, Papiere<br />
und Büroartikel für den Praxisalltag.<br />
<strong>Schweizerische</strong> Ärzte-Krankenkasse<br />
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen<br />
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28<br />
info@saekk.ch<br />
www.saekk.ch<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1697
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Die richtige Adresse für Erwerbsausfalldeckungen,<br />
Kollektivkrankenkasse und Versicherungsplanung<br />
Mit mehr <strong>als</strong> 100 Jahren Erfahrung kennt unsere<br />
O rganisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen<br />
und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte<br />
und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen<br />
wie auch für selbständige und angestellte<br />
Ärztinnen und Ärzte.<br />
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft<br />
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9<br />
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56<br />
versa@versa.ch<br />
www.versa.ch<br />
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen und<br />
Ärzten und deren Ehegatten, bietet die Versicherung<br />
der Schweizer Ärzte Genossenschaft individuelle, den<br />
jeweiligen Bedürfnissen angepasste Versicherungslösungen<br />
im Bereich der privaten Vorsorge an.<br />
www.unilabs.ch<br />
UNILABS – Ihr Qualitätslabor<br />
schnell, zuverlässig und nah<br />
Unilabs ist im Bereich der medizinischen Analysen<br />
ein kompetenter, transparenter und zuverlässiger<br />
Partner. Wir bieten Ihnen überall in der Schweiz ein<br />
komplettes Analysenspektrum, umfassende Dienstleistungen<br />
und kompetente Fachberatung an. In der<br />
Deutschschweiz sind dies Unilabs Mittelland mit<br />
den Standorten Basel, Bern, Langnau, Solothurn,<br />
Thun; Unilabs Zürich und Unilabs Dr. Weber.<br />
Unilabs bietet Weiterbildungen für das gesamte Praxis-Team<br />
sowie Beratung bei Praxis- und Labor bedarf.<br />
Unsere vielseitigen und regionalen Dienstleistungen<br />
basieren auf einer fundierten wissenschaftlichen<br />
Struktur und hochstehenden Qualität.<br />
Unilabs Schweiz – aktuell 900 Mitarbeiterinnen und<br />
Mitarbeiter, 72 Wissenschaftler und 22 Labors in<br />
I hrer Nähe.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz<br />
Tel. 061 467 85 55, Fax 061 467 85 56<br />
verlag@emh.ch<br />
www.emh.ch<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
EMH, der Verlag der Ärztinnen und Ärzte<br />
Der Verlag EMH <strong>Schweizerische</strong>r Ärzteverlag AG<br />
wurde 1997 gegründet. EMH ist ein Gemeinschaftsunternehmen<br />
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen<br />
und Ärzte FMH und der Schwabe AG, Basel, dem<br />
mit Gründung 1488 ältesten Druck- und Verlagshaus<br />
der Welt.<br />
Hauptpublikationen von EMH sind die Zeitschriften<br />
«<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong>», das offizielle Publikationsorgan<br />
der FMH, «Swiss Medical Forum» mit praxisorientierten<br />
Fortbildungsbeiträgen, sowie «Swiss<br />
Medical Weekly», die Plattform für klinisch orientierte<br />
Wissenschaftler. Ebenfalls zu den Hauptpublikationen<br />
zählt «PrimaryCare», die offizielle «<strong>Schweizerische</strong><br />
Zeitschrift für Hausarztmedizin».<br />
Als erfolgreiches Online-Angebot ist unter anderem<br />
die Fortbildung des «Swiss Medical Forum» unter<br />
www.smf-cme.ch zu nennen. Steigende Zugriffszahlen<br />
und die Akkreditierung durch die Fachgesellschaften<br />
SGAM und SGIM <strong>als</strong> strukturierte und<br />
nachweisbare Fortbildung belegen diesen Erfolg.<br />
Weitere medizinische Fachzeitschriften, ein ständig<br />
wachsendes Buchprogramm sowie viele Kooperationen<br />
und Dienstleistungen runden das umfangreiche<br />
Verlagsangebot ab.<br />
MEDIZINISCHE LABORATORIEN DR. F. KAEPPELI AG<br />
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien<br />
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich<br />
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09<br />
info@medica-labor.ch<br />
www.medica-labor.ch<br />
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker<br />
Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm<br />
1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und<br />
gründete <strong>als</strong> dessen Leiter und Inhaber die Einzelfirma<br />
medica. Der wichtigste unternehmerische<br />
L eitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche<br />
Innovation und Schaffung wegweisender Standards<br />
auf allen Gebieten der Labormedizin: Mikrobiologie<br />
inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie,<br />
k linische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik<br />
und Pathologie in Human- und Veterinärmedizin.<br />
So entstand ein Kompetenz-Zentrum für<br />
Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser<br />
Bedeutung. Die modernst ausgebauten Laboratorien<br />
werden laufend erweitert und befinden sich im Herzen<br />
von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors,<br />
begleitet von Spezialisten aus Medizin,<br />
Pharma kologie, Naturwissenschaften und Technik,<br />
garantieren für höchste Professionalität.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1698
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
IVF HARTMANN AG<br />
Victor-von-Bruns-Strasse 28, 8212 Neuhausen<br />
Tel. 052 674 31 11, Fax 052 672 74 41<br />
info@ivf.hartmann.info<br />
www.ivf.hartmann.info<br />
Die IVF HARTMANN AG ist einer der führenden Anbieter<br />
für medizinische Verbrauchsgüter im Bereich<br />
Heilung, Pflege und Hygiene in der Schweiz. Ihre<br />
L ösungen helfen überall dort, wo Menschen geholfen<br />
wird. Zu ihren Kunden zählen somit Spitäler,<br />
Alters- und Pflegeheime, Spitex-Organisationen, niedergelassene<br />
Ärzte, Apotheken, Drogerien und der<br />
Lebensmitteleinzelhandel. Das breite Angebot der<br />
IVF HARTMANN AG umfasst über 2000 Produkte –<br />
vom therapeutisch wirksamen Pflaster (z.B. Isola ®<br />
Capsicum N) über funktionelle Verbände bis hin zu<br />
Produkten für die moderne Wundbehandlung (z.B.<br />
TenderWet ® oder CompriGel ® ) und Erste Hilfe (z.B.<br />
DermaPlast ® ). Die IVF HARTMANN GRUPPE ist eine<br />
60-prozentige Tochtergesellschaft der PAUL HART-<br />
MANN AG mit Sitz in Heidenheim an der Brenz (D)<br />
und beschäftigt rund 350 Mitarbeiter. Neben ihrem<br />
Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall (SH) verfügt<br />
die IVF HARTMANN AG über weitere Produktionsstätten<br />
in Gommiswald (SG) und Netstal (GL).<br />
Mepha Pharma AG<br />
Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch<br />
Tel. 061 705 43 43<br />
www.mepha.ch<br />
Mepha – wir setzen Massstäbe<br />
Mepha, die führende Generika-Herstellerin der<br />
Schweiz, steht im 7. Jahrzehnt ihrer denkwürdigen<br />
Erfolgsgeschichte. Unseren Beitrag zu wirksamer Prophylaxe<br />
und Therapie sehen wir in der Entwicklung,<br />
Produktion und Vermarktung von günstigen, gut<br />
verträglichen und hochwertigen Generika. Wir entwickeln<br />
und produzieren in der Schweiz mit modernsten<br />
Hightechverfahren und nach höchstem<br />
Schweizer Qualitätsstandard. Unsere innovativen,<br />
kreativen Lösungen begeistern unsere Kunden immer<br />
wieder aufs Neue: Zum Beispiel neuartige und<br />
verbesserte Anwendungsformen unserer Medikamente,<br />
die den Behandlungserfolg und das Wohlbefinden<br />
von Patientinnen und Patienten steigern. Alle<br />
unsere Leistungen gründen auf einer ganzheit lichen<br />
Sicht, welche die Interessen unserer Kunden, Mitarbeiter<br />
und Aktionäre, aber auch jene der übrigen<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Anspruchsgruppen in den Mittelpunkt stellt. Erstklassige<br />
Produkte, ein komplettes Package gefragter<br />
Dienstleistungen und offene Kommunikation sind<br />
weltweit Basis der Zufriedenheit unserer Kunden.<br />
Salzmann AG<br />
Salzmann MEDICO<br />
Rorschacher Strasse 304, 9016 St. Gallen<br />
Tel. 071 282 12 12, Fax 071 282 12 10<br />
medico.sg@salzmann-group.ch<br />
www.salzmann-group.ch<br />
Salzmann MEDICO wurde 1980 durch Herrn Daniel<br />
Künzli, Präsident der Salzmann Group, gegrün-<br />
det. Die sehr kundenorientierte Handelsfirma ver-<br />
treibt medizinische Verbrauchsgüter und Einwegprodukte.<br />
Die innovativen medizinischen Kompressionsstrümpfe<br />
der Marken VENOSAN ® und VENOFIT ® aus<br />
der Produktion von Salzmann MESH werden weltweit<br />
exportiert.<br />
Produktesortiment: Produkte aus Produktion der<br />
Salzmann Abteilung MESH Marke VENOSAN ® ; Exklusiv-Vertretungen<br />
unter Original-Markennamen;<br />
Private Label Produkte (SAMA ® , SAMA Orthopaedics ® ,<br />
Tale ® , Thermoban ® ); Wundkompressen; Wundtupfer;<br />
diverse Verbandsmaterialien; Heftpflaster / Wundschnellverbände;<br />
elastische Binden; medizinische<br />
Kompressionsstrümpfe / Stützstrümpfe; Körperbandagen,<br />
Orthesen, Schienen; Chirurgisches Nahtmaterial;<br />
Fixationsprodukte (Gips / synthetische Steifverbände);<br />
OP-Handschuhe; OP-Abdeckungen / OP-Bekleidung;<br />
OP-Sets steril; Produkte für die Sterilisation<br />
und Sterilisations-Kontrolle; Inkontinenzprodukte.<br />
Galexis AG<br />
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp<br />
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14<br />
info@galexis.com<br />
www.galexis.com<br />
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im Schweizer<br />
Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden<br />
ganz nach dem Motto «Alles aus einer Hand» mit<br />
Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik<br />
und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen<br />
in der Gesundheitslogistik – schweizweit.<br />
Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg<br />
ihrer Kunden.<br />
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis praktisch,<br />
funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1699
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
kann Sie Galexis mit ihren Fachpartnern und einer<br />
langjährigen Erfahrung professionell beraten und<br />
unterstützen!<br />
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie rechnen!<br />
MSD Merck Sharp & Dohme-Chibret AG<br />
Schaffhauserstrasse 136, 8152 Opfikon-Glattbrugg<br />
Tel. 044 828 71 11, Fax 044 828 72 10<br />
www.msd.ch<br />
www.univadis.ch<br />
MSD ist die Schweizer Niederlassung von Merck & Co.,<br />
Inc. Whitehouse Station mit Hauptsitz in New Jersey,<br />
USA.<br />
DEM PATIENTEN VERPFLICHTET.<br />
Das Wohl des Patienten steht in unserer täglichen<br />
Arbeit an erster Stelle.<br />
Als weltweit tätiger, forschender Arzneimittelhersteller<br />
entwickeln, produzieren und vertreiben wir<br />
innovative Medikamente und Impfstoffe. Wir tun<br />
dies seit mehr <strong>als</strong> 100 Jahren und heute in über<br />
20 Therapiegebieten.<br />
In unserer Verpflichtung dem Patienten gegenüber<br />
ermöglichen wir weltweit die Versorgung mit dringend<br />
benötigten Medikamenten und unterstützen<br />
nachhaltige Gesundheitsprogramme vor Ort.<br />
Helvepharm AG<br />
Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld<br />
Tel. 052 723 28 50, Fax 052 723 28 58<br />
info@helvepharm.ch<br />
www.helvepharm.ch<br />
Als Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Generika<br />
tun wir alles dafür, um mit Innovationsgeist und<br />
Qualität eine führende Rolle im Schweizer Markt zu<br />
erreichen.<br />
Helvepharm setzt auf preiswerte Generika. Auf Medikamente,<br />
die sich in Wirkstoff, Darreichungsform<br />
und Dosierung an die Originalpräparate anlehnen<br />
und mit diesen austauschbar sind. Auch unsere Arzneimittel<br />
werden durch Swissmedic auf Herz und<br />
Nieren geprüft. Helvepharm Generika sind gleich<br />
wirksam wie das Original, jedoch ungleich günstiger.<br />
Mit über 60 Wirkstoffen in über 330 Darreichungsformen<br />
bieten wir kluge Alternativen zu Antihypertonika,<br />
Antidepressiva, Lipidsenkern, Gastrotherapeutika<br />
und für weitere relevante Gebiete. Helvepharm<br />
ist die günstige Basis im Gesundheitswesen.<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Helvepharm in Frauenfeld gehört zu Zentiva und<br />
d amit zum drittgrössten Generikaanbieter in Europa.<br />
Zentiva ist Teil der sanofi-aventis-Gruppe.<br />
LabTop Medizinische Laboratorien AG<br />
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil<br />
Tel. 043 399 30 30, Fax 043 399 30 31<br />
info@labtop.ch<br />
www.labtop.ch<br />
Das externe Labor in Ärztehand<br />
Ärzte halten zusammen: LabTop ist ein von Ärzten<br />
aufgebautes und von Labor-Profis geführtes Privatlabor.<br />
Seit 10 Jahren unterstützt es den Arzt in seinem<br />
Sinne. LabTop ist überwiegend im Besitz von<br />
Ärzten und steht beteiligungswilligen Ärzten weiterhin<br />
offen.<br />
Zur Selbsthilfe von praktizierenden Ärzten gestartet,<br />
klein, modern, unabhängig, exakt – typisch schweizerisch<br />
eben – bietet LabTop bestechend einfache<br />
und modernste Lösungen für die Arztpraxis. Bei Lab-<br />
Top bleibt die externe Analytik in Ärztehand.<br />
Vorteile für Sie: Als Novum bietet LabTop ein webbasiertes<br />
Geschäftsmodell, von dem Sie in verschiedener<br />
Hinsicht profitieren: Ressourcen-Einsparungen<br />
in Ihrer Praxis dank optimierter Prozesse, top<br />
Service, Messqualität, die höchsten Ansprüchen genügt,<br />
und nicht zuletzt, Ihr Beitrag bei der Analyseerfassung<br />
ist LabTop etwas wert.<br />
LabTop – von Ärzten aufgebaut, für Ärzte geführt.<br />
Teva Pharma AG<br />
Industriestrasse 111, 4147 Aesch<br />
Tel. 061 756 97 50, Fax 061 756 97 55<br />
office@tevapharma.ch<br />
www.tevapharma.ch<br />
Auf den ersten Blick Generika.<br />
Auf den zweiten noch viel mehr.<br />
Teva steht für Generika. Und für noch viel mehr. Denn<br />
mit unserer Philosophie, stets mehr zu leisten, sind wir<br />
zu einem international aktiven Pharma unternehmen<br />
mit mehreren Standbeinen heran gewachsen.<br />
Weil wir Gesundheit nicht nur erhalten, sondern<br />
auch erschwinglich machen wollen, stehen wir mittlerweile<br />
an der Spitze der weltweit führenden Generika-Hersteller.<br />
Mit diesen Kompetenzen möchten wir Ihnen <strong>als</strong> verlässlicher<br />
Partner auf dem Schweizer Pharmamarkt<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1700
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
zur Seite stehen. Dabei bieten wir Ihnen stets mehr:<br />
mehr Service, mehr Engagement und mehr Sicherheit<br />
und Qualität, welche wir in unseren eigenen<br />
Produktionsstätten optimal kontrollieren können.<br />
Mehr über uns erfahren Sie unter<br />
www.tevapharma.ch<br />
Mundipharma Medical Company<br />
Zweigniederlassung Basel<br />
St. Alban-Rheinweg 74, Postfach, 4020 Basel<br />
Tel. 061 205 11 11, Fax 061 205 11 87<br />
info@mundipharma.ch<br />
www.mundipharma.ch<br />
Mundipharma Medical Company ist die Schweizer<br />
Firma einer mittelgrossen, international erfolgreichen<br />
Pharmagruppe. Schmerztherapie, Onkologie<br />
und Atemwegserkrankungen sind die Kompetenzschwerpunkte<br />
unserer Forschung. Wir verstehen uns<br />
heute <strong>als</strong> modernes Dienstleistungsunternehmen,<br />
das hochwirksame Arzneimittel mit grösstmöglicher<br />
Verträglichkeit entwickelt und somit die Therapie für<br />
Arzt und Patient wesentlich erleichtert.<br />
Dieser Anspruch, unsere Arbeit eng an den Bedürfnissen<br />
der Menschen auszurichten, fordert uns täglich<br />
bei der Suche nach noch besseren Wirkmechanismen<br />
neu heraus. Die Motivation, durch hochwirksame<br />
Medikamente helfen zu können, ist dabei<br />
Ansporn und Herausforderung zugleich.<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Zur Rose<br />
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld<br />
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20<br />
Tel. Versandapotheke 0848 842 842<br />
info@zur-rose.ch<br />
www.zur-rose.ch<br />
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauensvoller<br />
Partner von mehr <strong>als</strong> 3000 Ärztinnen und Ärzten<br />
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution<br />
in den Bereichen Medikamentenversand<br />
und Arztpraxisbelieferung. Als standeseigenes<br />
Unternehmen vertritt Zur Rose die Interessen<br />
der Ärzteschaft.<br />
Zur Rose für Ärzte<br />
Mehr <strong>als</strong> 3000 Arztpraxen in der ganzen Schweiz erhalten<br />
von Zur Rose alles geliefert, was sie täglich benötigen:<br />
Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren,<br />
Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und<br />
Röntgenbedarf sowie Praxisgeräte und Instrumente<br />
aller Art.<br />
Zur Rose für Patienten<br />
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt die<br />
Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente<br />
an über 200 000 Kundinnen und Kunden. Zur Rose<br />
führt die Medikamenten- oder Bezugschecks kostenfrei<br />
aus und gewährt zusätzlich bis zu 12 % Rabatt.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1701
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Krankenversicherung<br />
Sonderkonditionen für Ärztinnen und Ärzte<br />
"<br />
Jeder zweite Schweizer zahlt jährlich über<br />
600 Franken zu viel Krankenkassen prämie.<br />
Gehören Sie auch dazu? U nsere Spezialisten<br />
überprüfen kostenlos und unverbindlich,<br />
wie hoch Ihr Sparpo ten tial ist. Zudem profitieren<br />
Sie in den FMH Insurance Services-<br />
Rahmenver trä gen von bis zu 50% Rabatt<br />
auf den Zusatzversicherungen.<br />
Bestellen Sie mit dem unten stehenden<br />
Talon Ihren persönlichen Offertvergleich.<br />
Bitte s enden Sie uns eine Kopie Ihrer<br />
a ktuellen Police, damit wir Ihnen ein vergleichbares<br />
Angebot berechnen können.<br />
Antworttalon<br />
Vorname / Name<br />
Adresse<br />
PLZ / Ort<br />
Geburtsdatum<br />
Telefon privat / Geschäft<br />
Beste Zeit für einen Anruf<br />
E-Mail-Adresse<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
Bitte einsenden oder per Fax an: 031 959 50 10<br />
m Ja, ich will Krankenkassenprämien sparen! Bitte senden Sie mir eine Offerte.<br />
(bitte aktuelle Policenkopie beilegen)<br />
m Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER<br />
m Ich möchte eine Offerte der folgenden Kasse (max. 2 Offerten)<br />
m Innova m KPT<br />
m Helsana-Gruppe<br />
m Bitte rufen Sie mich für eine persönliche Beratung an.<br />
m Ich interessiere mich für:<br />
m Finanz-/Steuerplanung m Pensionskasse BVG<br />
m Säule 3a m Rechtsschutzversicherung<br />
m Kapitalanlage m Berufshaftpflichtversicherung<br />
m<br />
Roth Gygax & Partner AG n Koordinationsstelle<br />
Moosstrasse 2 n 3073 Gümligen<br />
Telefon 031 959 50 00 n Fax 031 959 50 10<br />
mail@fmhinsurance.ch n www.fmhinsurance.ch Talon-Code: IN4411 Krankenkasse
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES<br />
Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.<br />
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht<br />
auch mal pünktlich sein?<br />
Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle<br />
Neuengasse 5 n 2502 Biel<br />
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66<br />
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch<br />
Inkassodienstleistungen<br />
für Ärzte<br />
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen<br />
über das komplette Leistungspaket von:<br />
o FMH Inkasso Services<br />
o FMH Factoring Services<br />
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:<br />
Telefon: Beste Anrufzeit:<br />
NEU<br />
mediserv AG n Koordinationsstelle<br />
Neuengasse 5 n 2502 Biel<br />
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11<br />
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch<br />
Honorarabrechnung für Ärzte<br />
inklusive Übernahme des Verlustrisikos<br />
und Auszahlung innert Sekunden<br />
Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11<br />
Name der Praxis:<br />
Ansprechpartner:<br />
Adresse /Stempel:<br />
FMH SERVICES<br />
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation<br />
44/11<br />
35/09
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Muskuloskelettale Gesundheit in der Schweiz<br />
Massnahmen zur Verbesserung der Gesundheit<br />
des Bewegungsapparates*<br />
Mathis Brauchbar a ,<br />
Françoise Allaz b ,<br />
Bettina Schulte c ,<br />
Regine Strittmatter d ,<br />
Andreas Stuck e<br />
a U msetzungsbeauftragter<br />
NFP 53, advocacy AG<br />
b P rof. Dr. med., Mitglied des<br />
Vorstands der SAMW,<br />
Universitätsspital Genf<br />
c Vizedirektorin<br />
Gesundheitsförderung<br />
Schweiz<br />
d s tv. Geschäftsleiterin<br />
Rheumaliga Schweiz<br />
e P rof. Dr. med., Präsident der<br />
Leitungsgruppe des NFP 53,<br />
Inselspital Bern<br />
* K urzfassung des White<br />
Papers «Förderung der<br />
Gesundheit des Bewegungsapparates<br />
– Ein Gewinn für<br />
Betroffene und Gesellschaft»,<br />
zu beziehen auf der Website<br />
des NFP 53<br />
Korrespondenz:<br />
Mathis Brauchbar<br />
advocacy AG<br />
Forchstrasse 70<br />
CH8008 Zürich<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 53 wurde zwischen April<br />
2004 und März 2009 in zahlreichen Projekten die Gesundheit des Bewegungsapparats<br />
der Schweizer Bevölkerung untersucht. Der Beitrag schildert die wichtigsten<br />
Erkenntnisse und Forderungen zur Verbesserung der Versorgungsqualität. Es mache<br />
jedoch wenig Sinn, die muskuloskelettale Gesundheit isoliert zu betrachten.<br />
Im Jahr 2003 hat der Bundesrat den <strong>Schweizerische</strong>n<br />
Nationalfonds damit beauftragt, ein Nationales Forschungsprogramm<br />
zur Gesundheit des Bewegungsapparates<br />
durchzuführen. Er entschied sich für diese<br />
Fragestellung, weil die Schweizer Bevölkerung in<br />
h ohem Masse von Beschwerden und Krankheiten des<br />
Bewegungsapparats betroffen ist: Fast alle Menschen<br />
haben irgendwann im Verlauf ihres Lebens eine muskuloskelettale<br />
Erkrankung.<br />
Diese Erkrankungen belasten die gesamte Volkswirtschaft<br />
mit hohen Kosten: In den Betrieben führen<br />
muskuloskelettale Leiden zu Absenzen, die jährlich<br />
betriebliche Kosten von 0,97 Milliarden Franken<br />
verursachen. Hinzu kommt die verlorene Produktionsleistung<br />
in der Höhe von jährlich rund 3,3 Milliarden<br />
Franken [1]. Ein Fünftel aller Renten werden<br />
vor allem wegen chronischer Rückenbeschwerden gesprochen<br />
[2]. Alleine in der Invalidenversicherung<br />
entstehen so jährliche Kosten von rund einer Milliarde<br />
Franken. In den kommenden Jahren ist zudem mit<br />
e iner starken Zunahme muskuloskelettaler Erkrankungen<br />
und der daraus resultierenden Kosten zu<br />
rechnen. Es ist daher dringend notwendig, Strategien<br />
umzusetzen, die darauf abzielen, die Krankheitslast<br />
zu mindern. Die Leitungsgruppe des Nationalen Forschungsprogramms<br />
NFP 53, die Akademie der Medizinischen<br />
Wissenschaften, die Rheumaliga Schweiz<br />
und Gesundheitsförderung Schweiz haben deshalb<br />
ein «White Paper» entwickelt, das Schlüsse aus dem<br />
NFP 53 und dem aktuellen, internationalen Stand des<br />
Wissens zieht [3].<br />
Prävention besser koordinieren<br />
Die Gesundheit des Bewegungsapparats betrifft neben<br />
dem Gesundheitswesen auch das Sozialwesen, die<br />
Arbeits welt, den Verkehr, die Freizeit oder den Städtebau.<br />
Muskuloskelettale Gesundheit ist daher Aufgabe<br />
des gesamten Staats und Gemeinwesens. In den letzten<br />
Jahrzehnten wurden genügend Erkenntnisse gewonnen,<br />
welche die Wirksamkeit der Prävention gewisser<br />
muskuloskelettaler Erkrankungen belegen.<br />
Mesures à prendre pour améliorer<br />
la santé de l’appareil locomoteur<br />
Le programme national de recherche PNR 53 a montré<br />
qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de<br />
prévention, de traitement et de réadaptation pour diminuer<br />
la charge de morbidité liée aux maladies musculosquelettiques.<br />
Les programmes de prévention déjà mis<br />
en place par la Confédération, les cantons et l’économie<br />
privée doivent être mieux coordonnés et plus axés sur<br />
les maladies de l’appareil locomoteur. La prévention<br />
en entreprise devrait quant à elle mettre davantage<br />
l’accent sur les maladies chroniques, notamment les<br />
m aladies de l’appareil locomoteur.<br />
Pour améliorer la qualité des soins pour les personnes<br />
souffrant de ces maladies il faut continuer à développer<br />
des directives de traitement et veiller à ce que prestataires<br />
de soins les appliquent plus systématiquement.<br />
Pour ce faire les autorités régulatrices et les instances financières<br />
doivent s’entendre sur les directives et sur leur<br />
financement. Par ailleurs, il est essentiel que les patients<br />
prennent une part active dans leur traitement et dans<br />
les mesures de réadaptation afin d’en améliorer l’efficacité.<br />
Pour mettre à profit ce potentiel encore sousexploité,<br />
les patients doivent être mieux formés et les<br />
mesures indicatives pour les prestataires mieux définis.<br />
Enfin, la recherche portant sur l’optimisation de la prise<br />
en charge – aussi bien en ce qui concerne les soins que<br />
la réadaptation – des personnes touchées par ces maladies<br />
devraient se concentrer davantage sur les traitements<br />
non-médicamenteux (moyens auxiliaires, soins,<br />
physiothérapie, ergothérapie, programmes de réadaptation).<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1712
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
NFP 53 – Forschung zur<br />
muskuloskelettalen Gesundheit<br />
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms<br />
NFP 53 haben zwischen April 2004 und März<br />
2009 insgesamt 26 verschiedene Forschungsprojekte<br />
die Gesundheit des Bewegungsapparats<br />
ausgeleuchtet. Dabei haben Forschende die Ursachen<br />
der Beschwerden untersucht, die bestehenden<br />
Therapien kritisch hinterfragt und neue Ansätze<br />
entwickelt, die helfen, die Gesundheit des<br />
Bewegungsapparates aufrechtzuerhalten oder<br />
wiederherzustellen. Die Resultate der Projekte<br />
und des Programms <strong>als</strong> Ganzes sind auf der Website<br />
des Programms erhältlich (www.nfp53.ch).<br />
Auch mehrere Projekte des NFP 53 konnten neue<br />
Hinweise für die Wirksamkeit präventiver und gesundheitsförderlicher<br />
Massnahmen liefern.<br />
Auf der Basis bestehender Evidenz lassen sich allgemeine<br />
Empfehlungen, etwa im Bereich der Bewegung<br />
oder der Ernährung, ableiten. Die meisten Emp<br />
«Die Gesundheitsförderung sollte am Arbeitsplatz<br />
einen höheren Stellenwert erhalten.»<br />
fehlungen zielen aber nicht alleine auf die muskuloskelettale<br />
Gesundheit allein ab, sondern auch auf<br />
andere gesundheitliche Aspekte wie etwa die Gesundheit<br />
des HerzKreislaufSystems, die Krebsprävention<br />
oder die Vorbeugung von Diabetes. Aus diesem<br />
Grund macht es wenig Sinn, die muskuloskelettale<br />
Gesundheit isoliert zu betrachten oder gar breite, nationale<br />
Programme zu fordern: Bereits existierende<br />
Gesundheitsprogramme und ansätze helfen, die Gesundheit<br />
des Bewegungsapparats zu fördern. Dazu gehören<br />
das Nationale Programm Ernährung und Bewegung,<br />
die Kantonalen Aktionsprogramme Gesundes<br />
Körpergewicht, das Nationale Präventionsprogramm<br />
Tabak oder das Nationale Präventionsprogramm<br />
Alko hol. Diese Ansätze müssen aber harmonisiert<br />
und unter Berücksichtigung der Gesundheit des Bewegungsapparates<br />
optimiert werden.<br />
Wenn Prävention in der Schweiz in der Vergangenheit<br />
oft ungenügend effizient war, dann auch weil<br />
die Präventionsaktivitäten zu sehr aus dem Blickwinkel<br />
der Prävention einzelner Krankheiten betrachtet<br />
wurden und nicht auf der Basis zu erreichender Gesundheitsziele.<br />
Das Präventionsgesetz bietet nun die<br />
Gelegenheit, bestehende Präventionsaktivitäten auf<br />
Basis gemeinsamer Gesundheitsziele sachgerecht zu<br />
harmonisieren. Bei der Formulierung der Präventionsziele<br />
muss aber – schon alleine aufgrund der<br />
h ohen Krankheitslast und der volkswirtschaftlichen<br />
Kosten – die Gesundheit des Bewegungsapparates adäquat<br />
berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollten<br />
die Präventionsziele so gesetzt werden, dass Prävention<br />
und Gesundheitsförderung jenen Personengruppen<br />
zugute kommen, die am stärksten behindert sind<br />
oder die am stärksten sozial benachteiligt sind.<br />
Die Arbeitswelt verändert sich im Zuge der Globalisierung<br />
und durch die demographischen Trends:<br />
Die Arbeitsbelastung nimmt zu, von den Arbeitnehmenden<br />
wird eine höhere Flexibilität gefordert und<br />
es ist damit zu rechnen, dass der Anteil älterer Männer<br />
und Frauen in den Betrieben stark zunehmen<br />
wird. Es ist zudem bekannt, dass Stress im Zusammenhang<br />
mit Krankheiten des Bewegungsapparates<br />
zu Dauerschäden führen kann. Die Gesundheitsförderung<br />
sollte daher am Arbeitsplatz einen höheren<br />
Stellenwert erhalten. Sie macht schon alleine deshalb<br />
Sinn, weil der finanzielle Nutzen für einen Betrieb gemäss<br />
einschlägigen internationalen Studien höher ist<br />
<strong>als</strong> die Ausgaben für die Gesundheitsförderung [4].<br />
Massnahmen sind auf mehreren Ebenen notwendig:<br />
– Um die betriebliche Gesundheitsförderung besser<br />
zu etablieren, müsste sie besser erforscht werden.<br />
– Anreizsysteme sollten eingeführt werden, die es<br />
den Betrieben erleichtern, in der betrieblichen<br />
Gesundheitsförderung aktiv zu werden. Dies<br />
kann beispielsweise über die betrieblichen<br />
Versicherungen erfolgen.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1713
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
– Bisher war die Prävention am Arbeitsplatz stark<br />
auf die Unfallprävention ausgerichtet. Dies sollte<br />
sich angesichts der Zunahme chronischer, nicht<br />
unfallbedingter Erkrankungen ändern, was aber<br />
wiederum gesetzliche Anpassungen etwa im<br />
Unfallversicherungsgesetz oder im Arbeitsgesetz<br />
nötig macht.<br />
Neben allgemeinen Empfehlungen für die gesamte<br />
Bevölkerung gilt es, sich vermehrt auf Zielgruppen<br />
mit spezifischen Risiken zu konzentrieren. Dies können<br />
Kinder und Jugendliche sein, die sich etwa im<br />
Sport besonderen Gefahren aussetzen oder Angestellte,<br />
die an Arbeitsplätzen arbeiten, die häufig mit<br />
Problemen des Bewegungsapparates einhergehen. Bei<br />
«Im Hinblick auf Richtlinien besteht<br />
bei Arthrose und Rehabilitation<br />
im Alter noch Nachholbedarf.»<br />
Betagten stehen unter anderem die Risiken von Stürzen<br />
mit Knochenbrüchen im Vordergrund. Bereits<br />
heute gibt es kostengünstige Methoden, wie ältere<br />
Personen mit einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche<br />
gezielt identifiziert und im Hinblick auf die<br />
Prävention beraten und begleitet werden können.<br />
Doch das Potential dieser Interventionsformen wird<br />
in der Schweiz noch ungenügend genutzt.<br />
Behandlung optimieren<br />
Untersuchungen der letzten Jahre zeigen, dass die<br />
Qualität der medizinischen Versorgung in der<br />
Schweiz von Region zu Region stark verschieden ist.<br />
Dies betrifft auch Krankheiten des Bewegungsapparates.<br />
Diese starke Ungleichheit verweist auf grosse Unterschiede<br />
in der Versorgungsqualität innerhalb des<br />
Gesundheitssystems.<br />
Wenn grosse qualitative Unterschiede in der<br />
B ehandlung bestehen, sollten allgemein gültige<br />
Richtlinien helfen, die Qualität zu sichern. Solche<br />
Guidelines sollten dazu beitragen, klinische Evidenz<br />
in die medizinische Praxis zu überführen und dadurch<br />
die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern.<br />
Für die Entwicklung dieser Richtlinien sind die<br />
Schweizer Fachgesellschaften und medizinischen<br />
Verbände verantwortlich. Die <strong>Schweizerische</strong> Gesellschaft<br />
für Rheumatologie und internationale Organisationen<br />
(European League Against Rheumatism<br />
EULAR, American College of Rheumatology ACR,<br />
B ritish Society for Rheumatology BSR) haben bereits<br />
zahlreiche Behandlungsrichtlinien und Therapieempfehlungen<br />
erarbeitet. Während die bestehenden<br />
Behandlungsrichtlinien das Thema Rückenschmerzen<br />
relativ umfassend behandeln, besteht bei der Arthrose<br />
und der Rehabilitation im Alter jedoch noch<br />
Nachholbedarf.<br />
Doch Richtlinien, die nicht angewendet werden,<br />
sind nutzlos: Die Aus und Weiterbildung der Leistungserbringer<br />
muss sich auch an diesen Richtlinien<br />
orientieren. Die Anreize im Gesundheitssystem sollten<br />
vermehrt so gesetzt werden, dass diese Richtlinien<br />
und damit die korrekte Behandlung auch im Praxisalltag<br />
umgesetzt werden. Um die Qualität der Behandlung<br />
zu fördern, sollten die Leistungserbringer<br />
auch erheben, wie sie behandeln und ob diese Richtlinien<br />
eingehalten werden. Letztlich muss es das Ziel<br />
sein, dass möglichst allen Patientinnen und Patienten<br />
eine adäquate Behandlung zukommt und dass<br />
Über oder Unterversorgung weitgehend vermieden<br />
werden können.<br />
Angesichts der wachsenden Zahl muskuloskelettaler<br />
Behandlungen und der steigenden Kosten im<br />
Gesundheitswesen nimmt der Druck zu, nur noch<br />
solche Interventionen durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung<br />
zu finanzieren, für deren<br />
Wirksamkeit klare Belege (Evidenz) vorliegen. In vielen<br />
Bereichen fehlt aber dieser Wirksamkeitsnachweis,<br />
was auch dadurch bedingt ist, dass es für bereits<br />
etablierte Methoden wenig Anreiz für Forschung gibt.<br />
Die Erfahrungen der letzten Jahre belegen denn auch,<br />
dass unabhängige Forschung im Bereich der Behandlung<br />
der Beschwerden des Bewegungsapparates<br />
schwer zu finanzieren ist.<br />
Öffentlich finanzierte Forschung sollte vor allem<br />
dort ansetzen, wo die privat finanzierte, industrielle<br />
Forschung nicht oder ungenügend tätig ist. Die Wirksamkeitsforschung<br />
sollte sich daher stärker auf nicht<br />
medikamentöse Behandlungsformen konzentrieren,<br />
zumal diese bei muskuloskelettalen Beschwerden<br />
wichtige Interventionen darstellen (Physiotherapie,<br />
Ergotherapie, Pflege, Hilfsmittel).<br />
Das Potential der Selbstbeteiligung der Patientinnen<br />
und Patienten in der Behandlung wird noch zu<br />
wenig genutzt und sollte auf mehreren Ebenen gefördert<br />
werden: Die Motivation der Patientinnen und<br />
Patienten sollte in der Arztpraxis einen hohen Stellenwert<br />
erhalten. Im Praxisalltag ist dieser Anspruch<br />
derzeit aber schwer umzusetzen. Die Anreize – auch<br />
finanzieller Art – sollten daher so gesetzt werden, dass<br />
das motivierende Gespräch mit den Betroffenen attraktiv<br />
und gefördert wird. Niederschwellige Angebote<br />
zur Patientenbildung sollten darauf ausgerichtet<br />
sein, auch jene Personen zu erreichen, die über ein<br />
geringes Gesundheitswissen verfügen (Health Literacy).<br />
Bereits existierende Angebote von Gesundheitsorganisationen<br />
sollten sich vermehrt an diesen Zielgruppen<br />
ausrichten und sollten von Bund und Kantonen<br />
gefördert werden.<br />
Rehabilitation effizienter gestalten<br />
Die Förderung der Gesundheit des Bewegungsapparats<br />
konzentriert sich bei Erwachsenen im Erwerbsalter<br />
vor allem darauf, ihre Arbeitsfähigkeit möglichst<br />
umfassend zu erhalten. Um das Potential des betrieblichen<br />
Gesundheitsmanagements besser nutzen zu<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1714
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
können, sind Massnahmen auf mehreren Ebenen<br />
notwendig:<br />
– In der medizinischen Ausbildung an den Universitäten<br />
wie auch in den Ausbildungen zu Gesundheitsberufen<br />
(Ergotherapie, Pflege, Physiotherapie)<br />
sollte die Arbeitsmedizin stärker <strong>als</strong> bisher berücksichtigt<br />
werden.<br />
– Die Unternehmen, Grossbetriebe wie auch kleinere<br />
und mittlere Unternehmen (KMUs) sollten<br />
das betriebliche Gesundheitsmanagement im<br />
Rahmen ihrer unternehmerischen Verantwortung<br />
besser verankern.<br />
– Die Versicherer sollten durch geeignete Anreizstrukturen<br />
in ihren Versicherungsmodellen das<br />
betriebliche Gesundheitsmanagement fördern.<br />
Es reicht nicht, chronische Verläufe am Arbeitsplatz<br />
frühzeitig zu erkennen. Vielmehr gilt es, den Betroffenen<br />
angemessene und wirksame Massnahmen anzubieten,<br />
damit diese möglichst rasch und möglichst<br />
vollständig ihre Arbeit wieder aufnehmen können.<br />
Neben den stationären Rehabilitationseinrichtungen<br />
sind in der Schweiz vermehrt auch ambulante Angebote<br />
notwendig. Dies ermöglicht eine Form der Rehabilitation,<br />
die einen starken Bezug zur Arbeitswelt<br />
hat. Sie vermindert das Risiko deutlich, dass ein Arbeitnehmer<br />
seine Arbeitsfähigkeit permanent verliert.<br />
Massnahmen dringlich umsetzen<br />
Die Verbesserung der Prävention, der Behandlung<br />
und der Rehabilitation von Erkrankungen des Bewegungsapparats<br />
ist dringlich, denn die Krankheitslast<br />
und die volkswirtschaftlichen Folgen wiegen schwer.<br />
Die Mittel und Möglichkeiten, um die Häufigkeit,<br />
den Schweregrad und die Folgen von muskuloskelettalen<br />
Erkrankungen zu vermindern, sind vorhanden.<br />
Aufgerufen die notwendigen Massnahmen zu ergreifen<br />
sind einerseits Ärzte, Physiotherapeuten, Pflegende,<br />
Präventionsfachleute aber auch die Arbeitgeber. Gefordert<br />
sind aber auch die Betroffenen selbst. Sie sollten<br />
sich vermehrt aktiv an ihrer Rehabilitation und Heilung<br />
beteiligen und so die Chancen eines posi tiven<br />
Verlaufes ihrer Beschwerden erhöhen.<br />
Andererseits sind Massnahmen auf der Ebene des<br />
Gesundheitssystems und der Wirtschaft notwendig.<br />
Gesetzgeber, Verwaltungen bei Bund und Kantonen,<br />
aber auch die Versicherer müssen Rahmenbedingungen<br />
und Anreize schaffen, welche die muskuloskelettale<br />
Gesundheit fördern und die Effizienz der Behandlung<br />
verbessern.<br />
Neben der Umsetzung des Wissens in die Praxis<br />
braucht es aber auch weiterhin Forschung. Sie muss<br />
dazu beitragen, der Schweizer Bevölkerung neue Formen<br />
der Prävention oder neue Therapieverfahren zu<br />
ermöglichen. Gleichzeitig muss sie dazu beitragen,<br />
die Effizienz und die Qualität im Bereich der Prävention,<br />
der Behandlung und der Rehabilitation wesentlich<br />
zu steigern.<br />
Literatur<br />
1 Staatssekretariat für Wirtschaft seco; 2009.<br />
2 IVStatist. Bundesamt für Sozialversicherungen; 2008.<br />
3 u. a. European Action Towards Better Musculoskeletal<br />
Health 2005. The Bone and Joint Decade.<br />
4 u. a. Gesundheitsförderung Schweiz. Studien zur<br />
Gesundheitsförderung. Bern; 2010.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1715
Standpunkt TRIBÜNE<br />
Réactions à la lettre ouverte adressée au Conseiller fédéral Didier Burkhalter<br />
«Agonie du médecin de périphérie»<br />
Informer le maximum de personnes responsables<br />
Stéphane Reymond<br />
Correspondance:<br />
Dr Stéphane Reymond<br />
Rue du Petit-Bois 11<br />
CH-2316 Les Ponts-de-Martel<br />
stephane.reymond(at)gmail.com<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Le 21 mars 2011, j’informais Monsieur le Conseiller<br />
fédéral Didier Burkhalter de la disparition future des<br />
cabinets individuels de campagne, ceci pour raison<br />
économique.<br />
Plusieurs années seront encore nécessaires pour<br />
que des cabinets de groupe les remplacent, pour<br />
a utant que le tarif soit aussi adapté.<br />
Pour un revenu AVS de 200 000 franc par an en<br />
travaillant 42 heures la semaine, sans laboratoire, le<br />
point TARMED devrait se situer à 1.40. Actuellement,<br />
il reste 22 % du chiffre d’affaires après déduction de<br />
l’AVS et des cotisations pour la retraite. La lettre avec<br />
le graphique des pourcentages est à disposition sur le<br />
site www.primary-care.ch.<br />
Suite à la large diffusion de cette lettre (autorités<br />
fédérales, cantonales, au monde politique suisse,<br />
aux médias), de nombreuses réactions me sont parvenues.<br />
Dans sa réponse, M. Didier Burkhalter rappelle<br />
que «le Conseil fédéral est chargé de vérifier que les<br />
conventions tarifaires s’étendant à toute la Suisse<br />
sont conformes à la loi et à l’équité et qu’elles satisfont<br />
au principe d’économie (art. 46, al. 4, LAMal).<br />
Les partenaires tarifaires sont en train de la réviser<br />
pour que la médecine de base soit mieux valorisée. Je<br />
suis ces travaux de près et avec un grand intérêt. En<br />
fait, j’ai invité les partenaires tarifaires à m’informer<br />
sur les travaux en cours et sur la date butoir tout en<br />
étant disposé à m’engager si nécessaire en faveur de la<br />
révision.»<br />
Il ajoute que le «Managed Care a notamment<br />
pour objectif de revaloriser le rôle du médecin de<br />
p remier recours».<br />
M. Pierre-Yves Maillard, Président de la CDS,<br />
« partage mon inquiétude et va la relayer encore<br />
d avantage».<br />
M. Jacques de Haller, Président de la FMH, «espère<br />
une réponse constructive».<br />
Les parlementaires contactés, quelque soit leur<br />
appartenance politique, reconnaissent le problème et<br />
vont soutenir les mesures utiles à l’amélioration de la<br />
situation. Parmi les réponses des présidents des partis<br />
suisses, M. Fulvio Pelli «partage que, dans un souci<br />
d’efficience, les cabinets de groupe doivent se développer.<br />
Cela ne peut se faire sans égard aux personnes<br />
qui assument encore un cabinet individuel.» En<br />
Suisse encore 2 ⁄3 des médecins de famille travaillent de<br />
manière individuelle.<br />
Mme Gisèle Ory, Conseillère d’Etat NE, rappelle<br />
que «le Conseil d’Etat a jusqu’ici, dans le cadre de la<br />
procédure de fixation de la valeur du point TARMED,<br />
veillé à ce que les médecins neuchâtelois puissent<br />
maintenir des conditions financières stables. Notre<br />
canton participe au Programme d’assistanat en cabinet.»<br />
Elle ajoute que «la législation ne nous donne pas<br />
de compétence en matière de planification de l a médecine<br />
ambulatoire… et de subventionnement…»<br />
Les autorités communales contactées ont été<br />
très réceptives et répondent qu’elles soutiendront<br />
les i nstallations de médecins de famille, le cas<br />
échéant.<br />
«Depuis cet été, une évolution<br />
positive se dessine.»<br />
Plusieurs collègues, également de Suisse alémanique,<br />
m’ont répondu que les pourcentages correspondaient<br />
grosso modo aux leurs et qu’ils devaient<br />
beaucoup travailler pour vivre correctement. Tous<br />
soutiennent la démarche.<br />
Depuis cet été, une évolution positive se dessine.<br />
Dans son communiqué du 16. 9. 2011, le Conseil<br />
f édéral vient de décider (initiative populaire «Oui à la<br />
médecine de famille»: transmission du message avec<br />
un contre-projet, al. 5) «de prolonger pour 2012 le<br />
supplément de transition pour les laboratoires en<br />
c abinet» et de soutenir «une initiative parlementaire<br />
l’habilitant à procéder à des adaptations de la structure<br />
tarifaire, si celle-ci s’avère inappropriée et si<br />
les partenaires ne peuvent s’entendre sur une révision».<br />
Pour agir rapidement, il serait opportun de créer<br />
une nouvelle position TARMED, utilisable de suite:<br />
«prise en charge par le médecin de famille» de l’ordre<br />
de 20 francs, valable aussi pour les pédiatres, qui<br />
s erait utilisée à chaque consultation et s’ajouterait au<br />
temps calculé actuellement.<br />
Informer le maximum de personnes responsables<br />
au niveau des autorités politiques me paraît<br />
important.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1716
Spectrum TRIBÜNE<br />
Deutschland: Kooperation<br />
und Delegation gegen<br />
Versorgungsdefizite<br />
Zu den Plänen im deutschen Ver<br />
sorgungsstrukturgesetz, beispielhaft<br />
die Tätigkeiten festzulegen, in denen<br />
Angehörige medizinischer Assistenzberufe<br />
ärztliche Leistungen erbringen<br />
können, erklärt der Präsident<br />
der Bundesärztekammer Frank<br />
Ulrich Montgomery: «In Zeiten des<br />
Ärztemangels und des steigenden<br />
Versorgungsbedarfs der Bevölkerung<br />
ist die Kooperation von Ärzten<br />
mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen<br />
wichtiger denn je. Die Delegation<br />
bestimmter Leistungen kann<br />
angesichts begrenzter Ressourcen<br />
helfen, eine gute, wohnortnahe medizinische<br />
Versorgung zu erhalten.»<br />
Hingegen lehne die Ärztekammer<br />
die Substitution ärztlicher Tätigkeit<br />
und die Lockerung des Arztvorbehaltes<br />
für Diagnostik und Therapie<br />
im Interesse der Patientensicherheit<br />
strikt ab.<br />
(BÄK)<br />
Explizites Verbot der<br />
weib lichen Genital -<br />
verstümmelung<br />
National und Ständerat stimmten<br />
in der Schlussabstimmung am<br />
30. September der Ergänzung des<br />
Strafgesetzes um einen spezifischen<br />
Artikel zum Verbot der Verstümmelung<br />
weiblicher Genitalien zu. Bereits<br />
am 14. September hatte der<br />
Nationalrat die letzte Differenz zum<br />
Ständerat bereinigt. Der neue Gesetzesartikel<br />
erlaubt die strafrechtliche<br />
Verfolgung von Personen, die ein in<br />
der Schweiz wohnhaftes Mädchen<br />
im Ausland beschneiden lassen –<br />
selbst dann, wenn sie in einem Land<br />
vorgenommen wird, in dem diese<br />
Menschenrechtsverletzung gesetzlich<br />
nicht verboten ist. UNICEF<br />
Schweiz begrüsst den Entscheid.<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
(unicef)<br />
Promouvoir la sécurité sur<br />
le chemin de l’école<br />
Promouvoir la sécurité sur le chemin de l’école,<br />
telle a été l’une des exigences de l’initiative internationale<br />
intitulée Walk to School Month en septembre<br />
2011. Une campagne qui promeut donc<br />
plus d’autonomie, de mobilité et, en fin de compte,<br />
plus d’activité physique de la part des enfants<br />
sur le chemin de l’école. Les enfants doivent apprendre<br />
très tôt à intégrer l’activité physique (et<br />
pas seulement des activités sportives) dans leur<br />
quotidien. Pédibus, le projet d’activité physique<br />
destiné aux enfants et soutenu par Promotion<br />
Santé Suisse, représente la Suisse pour la campagne<br />
internationale Walk to School Months. Pédibus de<br />
l’Association Transports et Environnement ATE a<br />
connu, depuis le début 2000, une diffusion importante<br />
dans tous les cantons romands et a également<br />
été intégré dans les programmes d’action. Au<br />
début 2011, le 4 e centre de coordination cantonal<br />
a été mis en place (dans le canton de Vaud).<br />
(Promotion Santé Suisse)<br />
Hilfe bei seltenen Krankheiten<br />
Orphanbiotec hat das Informationsangebot für<br />
Menschen mit seltenen Krankheiten ausgebaut.<br />
Durch die neue Forenpartnerschaft mit der gemeinnützigen<br />
Organisation MyHandicap können<br />
sich Betroffene weltweit über seltene Krankheiten<br />
informieren und austauschen. Die Vernetzung<br />
von Wissen trägt entscheidend zum<br />
Fortschritt bei Heilung und Entwicklung neuer<br />
Therapien bei. Als einer der Experten im Online<br />
Forum berät der renommierte Gastroenterologe<br />
Etats-Unis: moins de cancers du poumon parmi les femmes<br />
Les cas de cancer du poumon chez les femmes ont<br />
commencé à régresser entre 2006 et 2008.<br />
Stop! Pendant le «Walk to School Months» il faut<br />
marcher à l’école!<br />
PD Dr. Walter Rexroth aus Heidelberg. Die<br />
g emeinnützige Forschungsstiftung Orphanbiotec<br />
will einen Beitrag leisten zur Entwicklung<br />
von Medikamenten für seltene Krankheiten und<br />
baut dazu ein Kompetenzzentrum auf, das Betroffene,<br />
Angehörige, Organisationen, Forscher<br />
und Pharmaspezialisten verbindet.<br />
(MyHandicap/Orphanbiotec)<br />
Publié en septembre 2011, un rapport des centres<br />
pour le contrôle et la prévention des maladies du ministère<br />
américain de la santé porte sur le tabagisme<br />
et l’évolution des nouveaux cas de cancer du poumon<br />
entre 1999 et 2008. Alors que les cas de cancer<br />
du poumon chez les femmes n’ont cessé d’augmenter<br />
ces dernières décennies, ils ont commencé à régresser<br />
pour la première fois entre 2006 et 2008.<br />
Chez les hommes, cette tendance s’est amorcée depuis<br />
plusieurs décennies et se poursuit. L’évolution<br />
du cancer du poumon est directement liée aux habitudes<br />
tabagiques: cinq ans après le recul des taux de<br />
tabagisme, le cancer du poumon commence aussi<br />
déjà à diminuer. Des impôts élevés sur le tabac, une<br />
protection complète contre le tabagisme passif et des<br />
aides au sevrage tabagique faciles d’accès font partie<br />
des mesures principales dans ce but.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
(at)<br />
1717
Streiflicht Horizonte<br />
Schrumpfkopf<br />
Erhard Taverna<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Sie kam aus einem Nachbarkanton mit einem<br />
Kind. Der männliche Säugling schrie und strampelte.<br />
Ein kräftiges Kerlchen ohne auffällige Befunde<br />
und bisher nicht geimpft. Nein, so etwas<br />
komme überhaupt nicht in Frage. Er habe ganz<br />
a ndere Probleme. Was mochte das sein? Die Ernährungsanamnese<br />
war in Ordnung, er wurde teilgestillt,<br />
Gewicht und Länge entsprachen den altersgemässen<br />
Prozentilenwerten im oberen Bereich. Er<br />
schaute noch einmal hin, eine leichte Windeldermatitis,<br />
gesunde Schleimhäute, weisse Skleren und<br />
keine Hernie. Auch das nochmalige Auskultieren<br />
brachte nichts Neues, die Reflexe stimmten, und<br />
i nzwischen lag er friedlich auf seinem Kissen. Ja,<br />
haben Sie denn genau gemessen? Also noch einmal<br />
mit dem Messband nachgeprüft und sicherheitshalber<br />
wieder auf die Waage. Die gleichen Resultate.<br />
Er zeigte ihr seine Eintragung auf dem Kontrollblatt.<br />
Der Kopf sei das Problem, er schrumpfe<br />
täglich, werde langsam immer kleiner. Die Not war<br />
nun gegenseitig. Wie sie denn darauf komme, ob<br />
es denn frühere Messwerte gebe? Natürlich habe<br />
sie das viele Male überprüfen lassen, bei dem war<br />
sie und bei der, es folgte eine beachtliche Aufzählung<br />
fast aller Spezialisten der Region. Doch niemand<br />
habe die Veränderungen bemerkt. Er war<br />
ratlos, tat aber so, <strong>als</strong> würde er ihren Angaben vertrauen,<br />
und vereinbarte einen nächsten Termin.<br />
«Der Kopf sei das Problem, er schrumpfe täglich, werde<br />
langsam immer kleiner.»<br />
erhard.taverna(at)saez.ch<br />
Später telefonierte er, bekam die auswärtigen Befunde<br />
und blieb so schlau wie zuvor. Doch, doch, die<br />
Frau sei auch bei ihnen aufgefallen. Das erste Kind<br />
und zudem Alleinerziehende, das könne schon mal<br />
überfordern, aber helfen lasse sie sich nicht, schon gar<br />
nicht von der Mütterberaterin. Die war nicht genehm,<br />
weil am Ort mit einer gewissen Person verwandt. Sie<br />
kam tatsächlich noch einmal und brachte die empfohlenen<br />
Fotos, einige wenige Polaroidbilder, viele<br />
ungeeignet, aber darunter doch einige brauchbare<br />
Nahaufnahmen. Er betrachtete die Abbildungen mit<br />
der Lupe und zeigte der Mutter den statistisch normalen<br />
Verlauf der Wachstumskurven. Er hatte damit<br />
keinen Erfolg. Die Frau wurde ungeduldig, sie habe<br />
langsam genug von Ärzten. Auch er enttäusche ihre<br />
Erwartungen, wieder sei sie für nichts gekommen.<br />
Es stellte sich heraus, dass ihr Kind vom bösen<br />
Blick der Nachbarin verhext war. Diese war bekannt<br />
für ihren Schadenzauber, quälte damit das Vieh und<br />
tat auch den Menschen Übles an. Der Mutter zuliebe<br />
untersuchte er erneut den Kopf und fand unverändert<br />
weich gespannte Fontanellen unter dem schon<br />
reichlich wachsenden Haar. Der Säugling folgte ihm<br />
interessiert mit seinen Augen, wendete den liegenden<br />
Kopf, schien aktiv mitzuhelfen. Der brauchte keine<br />
medizinische Hilfe, dass die Mutter krank war, schien<br />
offensichtlich. Doch wie helfen? Ein Kollege hatte<br />
ihn am Telefon gewarnt: «Erwähnen Sie ja keinen<br />
P sychiater, die wird handgreiflich und rennt aus dem<br />
Sprechzimmer. Fort auf Nimmerwiedersehen.» Danke<br />
für den Hinweis, dieser Ausweg blieb verschlossen. Er<br />
musste andere Fragen stellen. «Sind Sie gläubig, ich<br />
meine, besuchen Sie die Messe?», fragte er, während<br />
sie das Kind ankleidete. Sie ging jeden Sonntag in die<br />
Kirche, das Kind war selbstverständlich getauft, der<br />
Pfarrer sei ein guter Mensch und die Kapuziner des<br />
nahen Klosters ganz besonders. Sollte er sich auf die<br />
Äste hinauswagen, ihr einen alten Pater empfehlen,<br />
den er kannte? «Ich kenne einen Priester, der Ihnen<br />
vielleicht helfen kann, soll ich ihn mal fragen?» Die<br />
Frau war schwierig einzuschätzen. Er hatte sich bei<br />
der Hebamme erkundigt. Sie habe gelehrig und<br />
g eschickt alle Anweisungen im Spital befolgt, und<br />
nein, von einer Wochenbettdepression sei ihr nichts<br />
bekannt. Also noch einmal: «Könnte Ihnen ein Priester<br />
helfen?» Wenn das Kind verhext war, konnte vielleicht<br />
ein Gegenzauber helfen, ein Ritual, das stärker<br />
war <strong>als</strong> die Magie der bösen Nachbarin. Er erkundigte<br />
sich. Es gab Seminare an theologischen Fakultäten für<br />
Gesundbeter und Austreiber von Dämonen. Die wenigen<br />
Spezialisten für exorzistische Rituale hängten<br />
ihre Tätigkeit nicht an die grosse Glocke. Offiziell<br />
hielt sich die Kirche bedeckt. Man wolle damit dem<br />
zunehmenden Satansglauben etwas entgegensetzen.<br />
Seine Mission war heikel, er fürchtete, <strong>als</strong> Aussenstehender<br />
auf Ablehnung zu stossen. Doch der Pater<br />
War dieser Babykopf kleiner geworden? Laut Massband<br />
nicht, doch die Mutter war anderer Meinung.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
1718
Streiflicht / Buchbesprechung Horizonte<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
zeigte Verständnis. Er werde zuerst mit der Frau reden<br />
und es dann versuchen, wenn sie dazu bereit sei.<br />
Mehrere Monate waren vergangen, er hatte nichts<br />
mehr gehört, weder von ihr noch vom Priester. Von<br />
Letzterem hatte er nichts anderes erwartet, denn<br />
«ich kenne einen Priester, der ihnen vielleicht helfen<br />
kann, soll ich ihn mal fragen?»<br />
schliesslich war Diskretion wichtig und das Beichtgeheimnis<br />
bedeutsamer <strong>als</strong> seine Schweigepflicht. Eine<br />
Sekretärin meldete sich aus einer fernen Stadt, sie wolle<br />
ihn gleich mit dem Chef verbinden. Einen Patientennamen<br />
wollte oder konnte sie ihm nicht nennen. Das<br />
werde er gleich erfahren. Hatte er etwas f<strong>als</strong>ch gemacht,<br />
eine Diagnose verpasst? Ein mulmiges Gefühl machte<br />
sich breit. Die Begrüssung fiel b eruhigend aus, keine<br />
f<strong>als</strong>chen Töne, kein Vorwurf. «Können Sie mir vielleicht<br />
weiterhelfen, Herr Kollege? Ich habe da ein gesundes<br />
Menschlein, genauer ein Knäblein, auf der<br />
Liege. Die Mutter erzählt mir, dass sie bei Ihnen in der<br />
Sprechstunde war. Sie hätten sie an einen Spezialisten<br />
überwiesen, an wen, wollte sie nicht sagen. Der habe<br />
das Kind behandelt, angeblich sehr erfolgreich. Ich verstehe<br />
das nicht.» Er fühlte sich schuldig, was war hier<br />
f<strong>als</strong>ch gelaufen? Den Priester durfte er auf keinen Fall<br />
erwähnen, das hatte er ihm hoch und heilig versprechen<br />
müssen. «Worum geht es denn genau?», fragte er<br />
voller Bangen. «Wissen Sie, die Frau benimmt sich sehr<br />
auffällig. Sie behauptet, dass der Kopf des Kleinen<br />
i mmer grösser werde. Sie wünscht eine erneute Überweisung.<br />
Können Sie mir bitte weiterhelfen?»<br />
Wissenschaftlich fundierte information<br />
Jutta Hübner<br />
Diagnose Krebs …<br />
was mir jetzt hilft<br />
Stuttgart: Schattauer; 2011.<br />
182 Seiten, zahlreiche<br />
Abbildungen, 34.45 CHF.<br />
ISBN 978-3-7945-2830-1<br />
Bereits zwei Jahre nach ihrem ersten Ratgeber für Patienten<br />
und Angehörige – «Aloe, Ginkgo, Mistel &<br />
Co.» legt Jutta Hübner, Leiterin Palliativmedizin, supportive<br />
und komplementäre Onkologie am Universitätsklinikum<br />
Frankfurt am Main, einen zweiten Ratgeber<br />
vor. In meiner Besprechung des ersten Buches<br />
(SÄZ 48/2010, S. 1921) habe ich hervorgehoben, wie<br />
wichtig solch wissenschaftlich fundierte Information<br />
und Beratung für Krebspatientinnen und patienten<br />
ist. Offensichtlich ist die Nachfrage so gross, dass sich<br />
Hübner und Verlag zu einer erweiterten Neukonzeption<br />
entschlossen haben. Das neue Buch unterscheidet<br />
sich vom Vorgänger vor allem in der viel breiteren<br />
Darstellung komplementärer Behandlungsmöglichkeiten.<br />
Unverändert ist die Grundhaltung der Autorin:<br />
kritisch, aber positiv, mit viel Verständnis für<br />
die Situation, die Angst, Verunsicherung und Hilfesuche<br />
von Krebspatienten. Bereits die Definition der<br />
«komplementären Onkologie» überzeugt mit dem<br />
Hinweis auf die unumgängliche Notwendigkeit der<br />
klinischen Prüfung aller Methoden, die erst nach positiven<br />
Resultaten, d.h. Nachweis der Evidenz, die heute<br />
oft pro pagierte «Integration» rechtfertigt. Vor angeblichen<br />
Alternativen wird, mit Beispielen von «Methoden<br />
und Substanzen ohne Wirksamkeit», deutlich<br />
g ewarnt.<br />
Nach einem kurzen Abriss über Diagnose und<br />
Therapiemethoden der «Schulmedizin», Ernährung<br />
und Sport, werden wie im früheren Buch, aber neu<br />
gegliedert, zahlreiche komplementäre Wirkstoffe<br />
knapp, aber aussagekräftig besprochen. Neu sind<br />
kurze, fast zu kurze Abschnitte über Anthroposophische<br />
Medizin, Homöopathie, Traditionelle Chine sische<br />
Medizin, Ayurveda und sog. MindBodyTherapien<br />
wie Meditation, Qigong, Reiki, TaiChi und Yoga. Angesichts<br />
der Beliebtheit solcher Methoden unter dem<br />
Überbegriff «Achtsamkeit» suchen Patientinnen dabei<br />
wohl etwas mehr Information und Rat.<br />
Sehr zu begrüssen sind zwei neue Kapitel: Zum ersten<br />
Ratschläge für komplementäre Massnahmen gegen<br />
Beschwerden durch die Erkrankung oder Thera<br />
pie – eine willkommene Erweiterung der Tabelle im ersten<br />
Ratgeber – gutbegründet und vorsichtig formuliert<br />
(im wohltuenden Gegensatz zu einem gleichzeitig erschienenen<br />
Buch über «Integrative Onkologie»). Zum<br />
zweiten dasjenige über die Behandlung der einzelnen<br />
Krebserkrankungen. Nach wenigen Bemerkungen zur<br />
Palliativmedizin folgt ein kleines Wörterbuch wichtiger<br />
medizinischer Fachbegriffe. An seiner Stelle hätte<br />
ich mir allerdings ein dringend vermisstes Sachwortregister<br />
gewünscht, das die rasche Suche e rmöglichen<br />
würde. Die wichtigen Kontaktadressen beschränken<br />
sich auf Deutschland. Das Layout mit farbig gegliederten<br />
Kapiteln und vielen Bildern ist sehr ansprechend.<br />
Besonders geschickt und hilfreich ist die farbige Hervorhebung<br />
wichtiger Tatsachen und Ratschläge.<br />
Ich bin überzeugt, dass der neue, umfassendere<br />
Ratgeber für viele Krebspatienten noch hilfreicher ist,<br />
um ihre Krankheit besser zu bewältigen, ihre Angst<br />
und Unsicherheit zu überwinden und – zusammen<br />
mit ihrem Hausarzt und Krebsspezialisten – eine sinnvolle<br />
Möglichkeit eines eigenen Beitrags zu finden.<br />
Ich kann ihn Patienten und Angehörigen bestens<br />
empfehlen. Für eine eventuelle 2. Auflage würde ich<br />
raten, einzelne besonders populäre Gebiete wie die<br />
Anthroposophische Medizin, die Ernährung und<br />
«MindBodyTherapien» etwas ausführlicher zu behandeln,<br />
der palliativen Situation mehr Gewicht zu<br />
geben und ein Sachregister und Kontaktadressen für<br />
Österreich und die Schweiz aufzunehmen.<br />
Dr. med. Walter Felix Jungi, Wittenbach<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44 1719
Mesalliance<br />
Anna Sax<br />
* A nna Sax, lic. oec. publ.,<br />
MHA, Mitglied der<br />
Redaktion, ist Mitinhaberin<br />
und Geschäftsführerin der<br />
Tradig GmbH für transdisziplinäre<br />
Analysen im<br />
Gesundheitswesen.<br />
anna.sax(at)saez.ch<br />
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Seit es Managed Care gibt, <strong>als</strong>o seit gut 20 Jahren,<br />
bin ich HMO-versichert; 12 Jahre davon in einer<br />
ärzteeigenen Gruppenpraxis mit Budgetmitverantwortung.<br />
In all diesen Jahren habe ich nie den Eindruck<br />
gehabt, man wolle mir eine Leistung vorenthalten.<br />
Die ärztlichen Aktionärinnen und Aktionäre<br />
betreiben weder eine Medizin zweiter Klasse<br />
noch machen sie den Eindruck, <strong>als</strong> würden sie<br />
vom Spardruck gebeutelt. Das Vertrauensverhältnis<br />
zwischen meiner Hausärztin und mir ist intakt,<br />
obwohl sie mir nicht bei jedem Besuch ein MRI verordnet.<br />
Zweimal war sie im Mutterschaftsurlaub –<br />
gut, so etwas wäre beim Familiendoktor meiner<br />
Kindheit nicht vorgekommen. Auch dass sie Teilzeit<br />
arbeitet, mag für einige Patienten gewöhnungsbedürftig<br />
sein. Aber eigentlich ist das nicht<br />
wirklich ein Problem, denn ihre Kolleginnen und<br />
Kollegen sind gut dokumentiert, sollte einmal ein<br />
Notfall eintreten.<br />
Ich weiss: Die freie Arztwahl ist den Schweizerinnen<br />
und Schweizern heilig. Einige meiner Verwandten<br />
und Bekannten sträuben sich noch immer dagegen,<br />
sich in einem Hausarztmodell zu versichern,<br />
auch wenn sie seit Jahrzehnten beim gleichen Doktor<br />
ein- und ausgehen. Irgendwie nagt an ihnen die<br />
Angst, dass sie, wenn sie «einmal wirklich krank<br />
sind», keine optimale Betreuung erhalten könnten.<br />
Ich kenne diese Angst nicht, obwohl auch ich Wahlfreiheit<br />
zu schätzen weiss. So bin ich froh, dass ich<br />
meine Hausärztin aus über 20 Ärztinnen und Ärzten<br />
auswählen konnte. Im Grunde genommen mache ich<br />
nichts anderes <strong>als</strong> meine Nicht-HMO-versicherten<br />
Freundinnen, wenn ich ein gesundheitliches Problem<br />
habe: Ich gehe zur Hausärztin. Sie wird mich weiter<br />
verweisen an einen Spezialisten, wenn es nötig ist,<br />
und sie wird im Ernstfall nicht die billigste Lösung<br />
s uchen, sondern diejenige, die sich im Gespräch mit<br />
mir <strong>als</strong> die beste herausstellt.<br />
Nun hat das Parlament entschieden, dass ein normaler<br />
Fall wie ich zum Normalfall werden soll. Für die<br />
allermeisten Leute, die medizinische Hilfe brauchen,<br />
ändert sich damit nichts. Nur wer Ärzte-Hopping<br />
praktizieren und nach Belieben Spezialistinnen ausprobieren<br />
will, wird einen kleinen Aufpreis in Kauf<br />
nehmen müssen. Für die wachsende Zahl der chro-<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
ZU GUTER LETZT<br />
nisch und mehrfach Kranken zeichnet sich sogar eine<br />
Verbesserung ab, weil nämlich zugleich mit der gesetzlichen<br />
Verankerung integrierter Versorgungsnetze<br />
auch der Risikoausgleich zwischen den Krankenkassen<br />
verfeinert wird. Für die Versicherer wird es dann<br />
attraktiv, ihren älteren und kränkeren Versicherten<br />
ein gutes Angebot zu machen, statt immer nur nach<br />
den gesündesten Kunden Ausschau zu halten.<br />
Einige Ärzteorganisationen ergreifen nun mit<br />
U nterstützung von Linken und Gewerkschaften das<br />
Referendum gegen die neue Managed-Care-Gesetzgebung,<br />
und wahrscheinlich werden sie damit Erfolg<br />
haben: Mit Sätzen wie «Das ist das Ende der freien<br />
Arztwahl», oder «Sozial Schwächere werden benachteiligt»<br />
oder «Das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient<br />
wird untergraben» lässt sich jede Abstimmung gewinnen.<br />
Doch mit Verlaub: Das alles ist gar nicht Gegenstand<br />
dieser Vorlage. Wogegen genau richtet sich <strong>als</strong>o<br />
der Widerstand? Gegen die integrierte Versorgung?<br />
«Doch mit Verlaub: Das alles ist gar nicht Gegenstand dieser Vorlage.»<br />
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn alle, aber<br />
auch wirklich alle, mit denen ich rede, sind für mehr<br />
Zusammenarbeit, Interdisziplinarität und ganzheitliche<br />
Betreuung. Oder ist es der verfeinerte Risikoausgleich,<br />
der stört? Das wäre erstaunlich, denn auch<br />
hier gibt es ausser ein paar orthodox-marktliberalen<br />
Krankenkassenvertretern niemanden, der das f<strong>als</strong>ch<br />
findet.<br />
Kann ich deshalb nicht verstehen, was hier passiert,<br />
weil ich Ökonomin bin und fälschlicherweise<br />
davon ausgehe, die Menschen verhielten sich in aller<br />
Regel rational? Für einige Vertreter der hochspezialisierten<br />
Apparatemedizin mag es ein Vorteil sein,<br />
wenn alles beim Alten bleibt. Aber für die Gewerkschaften?<br />
Was haben ihre Mitglieder davon? Und wie<br />
kommt es zu dieser merkwürdigen Mesalliance? Auf<br />
diesen Abstimmungskampf dürfen wir jedenfalls<br />
g espannt sein, denn er wird uns zeigen, welche<br />
Ängste und Sorgen die Ärztinnen und Patienten umtreiben.<br />
Und in zwei Punkten können wir alle beruhigt<br />
sein: Managed Care wird auch ohne gesetzliche<br />
Änderung weiterleben und sich entwickeln; und wir<br />
können unseren Hausärzten treu bleiben, egal wie die<br />
Abstimmung ausgehen wird.<br />
Anna Sax*<br />
1720
Editores Medicorum Helveticorum<br />
Die letzte Seite der SÄZ wird von Anna frei gestaltet, unabhängig von der Redaktion.<br />
<strong>Schweizerische</strong> <strong>Ärztezeitung</strong> | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 44<br />
ANNA<br />
www.annahartmann.net