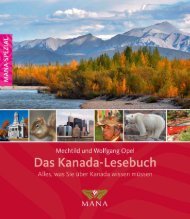Schauen Sie mal ins Buch! - MANA-Verlag
Schauen Sie mal ins Buch! - MANA-Verlag
Schauen Sie mal ins Buch! - MANA-Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Bildnachweis:<br />
Die Bilder des Textteils : Alexander Ehlert<br />
Coverfoto: Dorothea Holzapfel<br />
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen<br />
Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im<br />
Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.<br />
© <strong>MANA</strong>-<strong>Verlag</strong> 2008, www.mana-verlag.de<br />
Das Werk ist in allen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberschutzgesetzes ist<br />
ohne Zustimmung des <strong>Verlag</strong>es unzulässig. Das gilt <strong>ins</strong>besondere<br />
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die<br />
E<strong>ins</strong>peicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Umschlagentwurf und Layout:<br />
tomcom-potsdam.de<br />
Satz:<br />
Chronik Press im <strong>MANA</strong>-<strong>Verlag</strong><br />
Endlektorat:<br />
Kristina Frenzel, Anke Reintsch<br />
Druck:<br />
Interpress<br />
ISBN 978-3934031-89-0<br />
Alexander Ehlert<br />
Wo zum Teufel liegt Herbertville?<br />
Neuseeland – die Welt von unten gesehen
In vino veritas – besonders im Cloudy Bay Chardonnay<br />
Inhalt<br />
Vorwort ...............................................................................................6<br />
Deutschland, Schwaben: Am dunklen Ende der Welt ..............8<br />
Ab ans andere Ende der Welt ...................................................... 16<br />
Die Adaption neuseeländischer Lebensweise ........................ 24<br />
Zurück zu den Wurzeln ................................................................. 31<br />
Tribute an Wellington ................................................................... 40<br />
Neuseeländische Problemlösungen .......................................... 45<br />
Hummeressen in Hummeressen ............................................... 48<br />
Die unverschämteste Lüge der Welt ......................................... 56<br />
Feiertags in Neuseeland .............................................................. 62<br />
Sex in the City................................................................................. 67<br />
Das Spiel mit dem Ei ..................................................................... 71<br />
Der kälteste Winter ist der Sommer in San Francisco ......... 76<br />
Politik ist Politik ist Politik ........................................................... 97<br />
Der Hort neuseeländischer Männlichkeit ..............................102<br />
Schnee auf dem Vulkan ..............................................................108<br />
Ein guter Deal ...............................................................................116<br />
Restaurantführer..........................................................................118<br />
Neuseeland auf dem Motorrad, Teil I .....................................124<br />
Where the f**k is Herbertville? ................................................137<br />
Willkommen in Schilda ...............................................................144<br />
The World’s Fastest Indian .........................................................149<br />
Fischers Fritz fischt … .................................................................153<br />
Die Pulververschwörung ............................................................157<br />
Neuseeland auf dem Motorrad, Teil II ....................................160<br />
The Master of Desaster ..............................................................178<br />
Road Trip im Dezember ..............................................................181<br />
Epilog: Zurück ans dunkle Ende der Welt ...............................189
8 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
9<br />
Deutschland, Schwaben: Am dunklen<br />
Ende der Welt<br />
Nun, mir geht es wie so vielen Vertretern der Golfgeneration:<br />
wir sind gut ausgebildet und mit sozialer Intelligenz ausgestattet,<br />
haben die nicht in Rente gehenden Versager der ehe<strong>mal</strong>s<br />
taxifahrenden 68er Generation in den wichtigen Positionen<br />
vor der Nase und die nachfolgende Generation von Ehrgeizlingen<br />
der Internetkultur im Nacken sitzen. Was uns fehlt sind<br />
die Ambitionen, wirklich etwas zu bewegen. Den erschreckend<br />
schwachen Durchschnitt um uns herum stecken wir doch alle<strong>mal</strong><br />
in die Tasche. Eventuell, wenn wir es nur wollen würden.<br />
So bleibt uns nichts anderes übrig, als uns „einzurichten“ – eine<br />
Maßnahme, die wir eigentlich zutiefst verachten. Wer sich<br />
einrichtet, kann sich im Rathaus auch gleich für tot erklären<br />
lassen, dann spart er wenigstens Steuern.<br />
Ich habe einen Job, den ich bloß habe, weil ich verliebt gewesen<br />
bin. Ich dachte zumindest, dass ich es wäre, war es aber<br />
nicht. „Verrückt“ wäre wohl die bessere Beschreibung meines<br />
da<strong>mal</strong>igen Geisteszustands gewesen. Also passierte mir das,<br />
was meine Freunde zusammenfassend als „dich hat wohl der<br />
Teufel geritten!“ beschrieben: Ich suchte mir einen „anständigen“<br />
Job, weil ich fatalerweise dachte, dass das zum Erwachsenwerden<br />
dazugehörte. Ich heuerte also bei einem großen, sogar<br />
sehr großen Energieversorger an. Als es um die Berufswahl<br />
ging, wollte mein Vater mich früher immer überzeugen, dass<br />
ich Beamter werden solle, das hätte doch so viele Vorteile. Ich<br />
habe das immer entrüstet abgelehnt, weil ich der Ansicht war,<br />
dass das überhaupt nichts für mich sei und so etwas Ähnliches<br />
wie „sich einrichten“ wäre. Ich hatte Recht, das ist immer noch<br />
nichts für mich. Ich hätte auf seinen gut gemeinten, väterlichen<br />
Rat hören sollen, denn jetzt bin ich bei einem übergroßen<br />
Stadtwerk gelandet. Selbst meine absurdesten und perversesten<br />
Phantasien hätten da<strong>mal</strong>s nicht ausgereicht, um mir vorzustel-<br />
len, wie das so ist, für einen Energieversorger zu arbeiten. Die<br />
Folgenschwere meines Irrtums ist schlimmer als permanente<br />
Tritte dahin, wo es richtig weh tut, aber manche Männer stehen<br />
da wohl drauf. Ich nicht.<br />
Um die Tragik meines Arbeitslebens zu veranschaulichen,<br />
erzähle ich zusammenfassend gern die folgende kleine<br />
Geschichte. <strong>Sie</strong> verdeutlicht die Unfähigkeit, mit der ich mich<br />
tagtäglich beschäftigen und umgeben muss. Rock’n’Roll ist<br />
jedenfalls etwas anderes.<br />
„Herr Ehlert, könnten <strong>Sie</strong> mir kurz helfen?“, fragte mich<br />
mein Chef. „Bitte erstellen <strong>Sie</strong> zwei Folienpräsentationen für<br />
unseren Geschäftsführer. Er muss übermorgen eine Präsentation<br />
im Holdingvorstand halten. Ach ja, <strong>Sie</strong> haben bis morgen<br />
Mittag Zeit.“ Eine ganz nor<strong>mal</strong>e Bitte? Ein ganz alltäglicher<br />
Auftrag? Nein! An diesem Beispiel werde ich erstaunliche Parallelen<br />
von kapitalistisch ausgerichteten Großkonzernen der<br />
Energiewirtschaft zur Planwirtschaft der ehe<strong>mal</strong>igen kommunistischen<br />
Blockländer verdeutlichen – jedenfalls stelle ich mir<br />
ineffektive Planwirtschaft so vor.<br />
Wenn <strong>Sie</strong> jemand fragt, ob <strong>Sie</strong> kurz helfen könnten, dann<br />
sollten <strong>Sie</strong> grundsätzlich mit einem entschiedenen „Nein“ antworten,<br />
denn wenn die Angelegenheit tatsächlich in kurzer<br />
Zeit zu erledigen wäre, dann würde man <strong>Sie</strong> nicht fragen. Also<br />
handelt es sich bei dem zu erwartenden Auftrag entweder um<br />
eine langwierige oder komplizierte Arbeit. Meistens verbirgt<br />
sich hinter dem Begriff „kurz“ aber beides. Positiver Nebeneffekt<br />
Ihrer Ablehnung ist, dass man <strong>Sie</strong> dadurch in die Kategorie<br />
des harten Hundes einordnen wird und <strong>Sie</strong> somit auf der Liste<br />
derjenigen vorgemerkt sind, deren Karriere gefördert wird.<br />
Wenn <strong>Sie</strong> nicht „Nein“ sagen können, sollten <strong>Sie</strong> kurzfristig<br />
krank werden oder spontan verreisen, aber machen <strong>Sie</strong> nie<strong>mal</strong>s<br />
den Fehler, mit „Ja, gerne“ zu antworten. Ich habe, weil es<br />
meinem freundlichen und hilfsbereiten Charakter entsprach,<br />
naiverweise mit „Ja“ geantwortet und war, ohne es zu diesem<br />
Zeitpunkt gemerkt zu haben, mittendrin in den Mühlen der<br />
Umständlichkeit und der Demütigungen.<br />
Um die Tragik meines<br />
Arbeitslebens zu veranschaulichen,<br />
erzähle ich<br />
zusammenfassend gern die<br />
folgende kleine Geschichte.<br />
<strong>Sie</strong> verdeutlicht die Unfähigkeit,<br />
mit der ich mich<br />
tagtäglich beschäftigen und<br />
umgeben muss.
24 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
25<br />
„Wenn <strong>Sie</strong> deutscher<br />
Staatsangehöriger sind,<br />
dann kreuzen <strong>Sie</strong> bitte das<br />
Kästchen an, neben dem<br />
steht: „Deutscher“...<br />
Die Adaption neuseeländischer Lebensweise<br />
Ich habe es geschafft, 35 Jahre alt zu werden und einigermaßen<br />
anständig, unanständig und selbständig durchs Leben<br />
zu kommen. Herzlich Willkommen zurück in der Schule!<br />
Da ich nur zehn Finger zum Rechnen habe, weiß ich nicht,<br />
wie lange meine Schullaufbahn schon beendet ist, aber das ist<br />
schon ziemlich dunkle Vergangenheit. Ich gehe also wieder<br />
an die Uni, an die Victoria University of Wellington. Da die<br />
Erstsemester ungefähr halb so alt sind wie ich, zum ersten Mal<br />
allein in einer so großen Stadt wie Wellington und Papa und<br />
Mama noch öfter zu Besuch kommen werden, um zu prüfen,<br />
ob es den Kindern auch gut geht, hat die Uni für Studenten<br />
eine besondere Fürsorgekultur entwickelt, die eine Allround-<br />
Betreuung und drei Monate Alkoholverbot in Studentenwohnheimen<br />
umfasst. Alles wird einem mehr<strong>mal</strong>s sorgfältig<br />
erklärt, die E<strong>ins</strong>chreibeprozedur zog sich über eine Woche hin<br />
und irgendwie ist dieses Verhätscheln ja auch wirklich nett<br />
gemeint. Beim Ausfüllen eines Krankenversicherungsformulars<br />
hatte ich dann allerdings genug und bin nicht mehr auf<br />
diese Veranstaltungen, die sich „Orientation and Enrollment<br />
Weeks“ nennen, gegangen.<br />
„Wenn <strong>Sie</strong> deutscher Staatsangehöriger sind, dann kreuzen<br />
<strong>Sie</strong> bitte das Kästchen an, neben dem steht: „Deutscher“. In das<br />
Kästchen „Geburtsdatum“ tragen <strong>Sie</strong> bitte den Tag ein, an dem<br />
<strong>Sie</strong> geboren worden sind. Vergessen <strong>Sie</strong> bitte das Jahr nicht. Da<br />
wo „Name“ steht, tragen <strong>Sie</strong> bitte ihren Namen ein. Bitte auch<br />
den Vornamen.“<br />
Das Formular hatte fünf Seiten, die Prozedur dauerte eine<br />
halbe Stunde und ich war genervt. Einziger kleiner Lichtblick<br />
sind meine vier Vornamen. Diese treiben die Leute, die die<br />
Formulare im PC erfassen müssen, hoffentlich immer an den<br />
Rand der Verzweifelung, weil die Namen länger sind als der<br />
dafür vorgesehene Platz im Computerformular und bei Schulungen<br />
wird keine Lösung für dieses Problem gelehrt. Mein<br />
Berliner Freund Axel würde das die Rache des kleinen Mannes<br />
nennen.<br />
Nachdem ich locker zwei Wochen mit E<strong>ins</strong>chreibung, Kontoeröffnung,<br />
Wohnungssuche etc. herumgebracht hatte, kamen<br />
zwei echte Herausforderungen auf mich zu, deren Bewältigung<br />
ewig und drei Tage dauerte: Studentenvisum beantragen und<br />
Internetzugang einrichten. Vorweg gesagt, Einwanderungsbehörden<br />
sind überraschenderweise deutlich schneller und<br />
besser organisiert als ehe<strong>mal</strong>ige staatliche Monopolbetriebe.<br />
„Bringen <strong>Sie</strong> den Pass zu uns in die Uni, wir können das<br />
Studentenvisum ausstellen und das haben <strong>Sie</strong> dann nach drei<br />
Tagen. Bei der Einwanderungsbehörde dauert das bis zu neun<br />
Wochen.“<br />
Das ist ein Trick, um Geld zu verdienen, denn an der Uni<br />
kostet das Visum $ 110 und bei der Einwanderungsbehörde nur<br />
$ 70. Montagnachmittag warf ich meinen Pass bei der Immigration<br />
ein. Am Mittwochmorgen hatte ich die Benachrichtigung<br />
des Postboten im Briefkasten, dass eine Zustellung nicht<br />
geklappt habe, aber mein Pass beim Depot Nummer 01 bereitliegen<br />
würde. Ich könnte ihn dort abholen, sonst würde automatisch<br />
eine zweite Zustellung am Samstagvormittag erfolgen.<br />
Wenn diese ebenfalls erfolglos wäre, würde das Paket an den<br />
Absender zurückgeschickt werden.<br />
Wo zum Teufel ist Depot Nr. 01? Diese aus meiner Sicht notwendige<br />
Information befand sich leider nicht auf dem Schreiben.<br />
Also, nichts wie hin zum Postshop am Courtney Place.<br />
„Ich habe hier eine Benachrichtigung bekommen. Ich bin<br />
noch nicht so lange in der Stadt, wo bitte ist Depot Nr. 01? Ich<br />
möchte dort ein Päckchen für mich abholen.“ Ich habe wirklich<br />
selten in ein fragenderes und verwirrteres Gesicht geschaut.<br />
„Ich habe keine Ahnung, wo Depot Nr. 01 ist! Ich frage <strong>mal</strong><br />
meinen Kollegen. Pete, wo ist Depot Nr. 01?“<br />
„Woher soll ich das wissen?“, schallte es fragend aus dem<br />
hinteren Teil des Postshops zurück.
26 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
27<br />
Manche Fragen werden auch<br />
von netten Telefonstimm-<br />
chen nicht beantwortet. In<br />
Schulungen bekommt man<br />
beigebracht, auf verärgerte<br />
Kunden am besten gar nicht<br />
zu reagieren.<br />
„Nur zum Verständnis: die Post wirft bei mir eine Karte ein,<br />
auf der handschriftlich steht, dass ich das Päckchen im Depot<br />
Nr. 01 abholen kann, ich gehe zur Post und frage, wo das ist,<br />
und niemand weiß, wo sich Depot Nr. 01 befindet?“<br />
„Haben <strong>Sie</strong> die Nummer auf der Karte <strong>mal</strong> angerufen?<br />
Nein? Tun <strong>Sie</strong> das bitte. Ich glaube aber, dass Depot Nr. 01 sich<br />
in der Hauptpost befindet, sicher bin ich mir allerdings nicht.“<br />
OK, ab zur Hauptpost am anderen Ende der Stadt. Dort<br />
wiederholte sich die Prozedur, mit der kleinen Ausnahme, dass<br />
jemand wusste, dass das Depot Nr. 01 etwa 15 km nördlich von<br />
Wellington im Hutt Valley liegt. Ganz sicher war man sich aber<br />
auch nicht. Gut, also rief ich bei der Kundenhotline an.<br />
„Ich möchte Ihnen sagen, dass ich am Samstag bei dem<br />
erneuten Zustellversuch nicht anwesend sein kann. Können <strong>Sie</strong><br />
mir das Päckchen an die Hauptpost in Wellington liefern?“<br />
„Oh“, erwiderte eine nette Telefonstimme. Sätze, die mit<br />
„Oh“ anfangen, bergen im weiteren Verlauf erfahrungsgemäß<br />
meist unangenehme Überraschungen. „Das wird schwierig, der<br />
Fahrer soll heute versuchen, Ihnen die Sendung zuzustellen.“<br />
„Heute ist aber Freitag. Wieso schreiben <strong>Sie</strong> dann auf Ihre<br />
Karte Samstag?“<br />
Manche Fragen werden auch von netten Telefonstimmchen<br />
nicht beantwortet. In Schulungen bekommt man beigebracht,<br />
auf verärgerte Kunden am besten gar nicht zu reagieren. Die<br />
beruhigen sich schon wieder von ganz allein.<br />
„Ich funke den Fahrer an, der kann sich mit dem Fahrer,<br />
der die Sendungen für die Hauptpost ausliefert, treffen und<br />
ihm das Paket geben. Heute Nachmittag ist Ihr Pass dann da!“<br />
Um die Sache abzukürzen: das hat natürlich nicht geklappt<br />
und unter lautem Fluchen mit übelsten Vergleichen zwischen<br />
Neuseeland und der dritten Welt verließ ich am Freitag entnervt<br />
die Hauptpost. Mittlerweile habe ich aber meinen Pass.<br />
Mir war auch neu, dass sich aus der Beantragung eines<br />
Internetanschlusses heutzutage ein modernes Abenteuer entwickeln<br />
könnte. Nor<strong>mal</strong>es Dial-In und Abrechnung über die<br />
Telefonrechnung gibt es in Neuseeland nicht. Man muss einen<br />
Pre-Paid-Vertrag abschließen und bekommt dann die Telefonnummer,<br />
einen Benutzernamen und ein Zugangspasswort.<br />
Schon wieder eine Kundendienstnummer eines ehe<strong>mal</strong>igen<br />
Monopolisten.<br />
„Schicken <strong>Sie</strong> mir bitte ein Formular, damit ich Ihnen eine<br />
Einzugsermächtigung geben kann?“ Das englische Wort für<br />
„Einzugsermächtigung“ hatte ich vorher selbstverständlich<br />
nachgeschlagen. Die Benutzung bestimmter Fachbegriffe in<br />
der Umgangssprache assoziiert: „Nicht übel, der kann aber gut<br />
englisch sprechen.“<br />
„Gern, das schicken wir Ihnen zu. Nach fünf Tagen wird Ihr<br />
Konto auf unserem Server freigeschaltet und <strong>Sie</strong> können dann<br />
das Internet von zu Hause aus benutzen. Thanks for choosing<br />
paradise.net.”<br />
Bitteschön. Ein ausgefülltes Formular. Nun sehen einige<br />
europäische Zahlen anders aus als die, die im englischsprachigen<br />
Raum benutzt werden. Meine Bank konnte leider die<br />
<strong>Sie</strong>ben auf dem Antrag nicht als <strong>Sie</strong>ben entziffern und schickte<br />
die Einzugsermächtigung zurück an paradise.net. Davon<br />
wusste ich allerdings nichts. Ich erhielt kommentarlos einen<br />
neuen Vordruck.<br />
„Was soll ich damit?“<br />
„Bitte schicken <strong>Sie</strong> dieses Formular ausgefüllt an uns<br />
zurück.“<br />
„Habe ich doch schon.“<br />
„Ja, aber in der Kontonummer waren so komische Zeichen.“<br />
„Bitte, wir machen das jetzt <strong>mal</strong> ganz anders. Ich gebe Euch<br />
meine Kreditkartennummer und Ihr bucht von dort ab.“<br />
„Wenn <strong>Sie</strong> das so wünschen, dann machen wir das so. <strong>Sie</strong><br />
müssen aber ein Kreditkartenformular ausfüllen.“<br />
Ich glaube, dass man die Gereiztheit in meiner Stimme bei<br />
meiner nicht so netten Antwort deutlich wahrnehmen konnte.<br />
„Na gut“, sagte die freundliche Stimme, „ich schalte <strong>Sie</strong> jetzt<br />
frei, schicke Ihnen das Formular für die Kreditkarte zu und <strong>Sie</strong><br />
füllen das aus.“<br />
Nun sehen einige europäische<br />
Zahlen anders aus als<br />
die, die im englischsprachigen<br />
Raum benutzt werden.<br />
Meine Bank konnte leider<br />
die <strong>Sie</strong>ben auf dem Antrag<br />
nicht als <strong>Sie</strong>ben entziffern...
44 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
45<br />
aber nicht gegen den Nachbarn Australien. <strong>Sie</strong>gen ist hier<br />
Pflicht. Aber da die Neuseeländer nicht nachtragend sind, ist<br />
es nicht wirklich schlimm, wenn auch <strong>mal</strong> ein Spiel verloren<br />
wird. Das Bier danach im Pub schmeckt dann nicht schlechter,<br />
als nach einem gewonnenen Spiel.<br />
Mit diesem <strong>Buch</strong> kann der Leser die schönsten <strong>Sie</strong>gesbilder<br />
und Erinnerungen noch ein<strong>mal</strong> Revue passieren lassen.<br />
9. 100 Bücher, die niemand braucht<br />
Selten habe ich einen so selbstbeschreibenden <strong>Buch</strong>titel<br />
gelesen.<br />
10...<br />
Na ja, die Liste kann endlos weitergeführt werden. Ich bin<br />
zuversichtlich, dass die derzeit bestehende Lücke in sehr naher<br />
Zukunft geschlossen wird. Bizzy Bee’s Bookshop liegt gleich<br />
um die Ecke.<br />
Neuseeländische Problemlösungen<br />
Während meines Studienaufenthaltes habe ich eine weitere,<br />
durchaus bemerkenswerte intellektuelle Auseinandersetzung<br />
mitbekommen. Angeblich unterhalten sich<br />
Neuseeländer auf Partys und sonstigen Festivitäten nur über<br />
Immobilienpreise und das Wetter. Damit kokettieren sie ein<br />
wenig, natürlich stimmt das so nicht. Neben vielen anderen<br />
Themen wie Rugby (bei uns Fußball), Politik (bei uns Frau<br />
Merkel und so weiter) und – je nach Geschlecht – Frauen<br />
oder Männer (das ist dasselbe wie bei uns) scheint ein wichtiges<br />
Gesprächsthema vor allem in Intellektuellenkreisen die<br />
Gemüter zu erregen: das Hase-Ente-Dilemma. (The Essential<br />
Rabbit-Duck-Problem).<br />
Es handelt sich hierbei um ein Bild, auf dem entweder<br />
eine Ente oder ein Hase zu sehen ist. Man kann es wortwörtlich<br />
so drehen und wenden, wie man will, das Dilemma<br />
bleibt bestehen. Wir sehen entweder einen Hasen oder eine<br />
Ente, aber nicht beides zusammen. Das nennt sich reversible<br />
Figur – nicht zu verwechseln mit einer Illusion. Mit diesem<br />
bedeutenden Problem haben sich ganze Philosophengenerationen<br />
auseinandersetzen müssen, denn es wirft die Frage<br />
auf, was „sehen“ eigentlich bedeutet. Jastrow, nicht, wie weit<br />
verbreitet angenommen, Wittgenstein, hat sich zuerst damit<br />
beschäftigt. Wittgenstein hat es nur verwendet, um seine<br />
logische Philosophie anschaulich zu verdeutlichen. Feldversuche<br />
um die Osterzeit haben ergeben, dass Kinder in der<br />
Figur eher einen Hasen, im Oktober dagegen eher eine Ente<br />
erkennen. Sehen hängt also deutlich mit bestimmten Assoziationen<br />
zusammen und scheint subjektiv beeinflussbar zu<br />
sein. Das Dilemma bleibt allerdings bestehen: ist es ein Hase<br />
– oder eine Ente?<br />
Das Thema ist als Gesprächsstoff unerschöpflich und<br />
lässt sich je nach Höhe des Intoxikationsgrades beliebig<br />
erweitern. Ich habe erlebt, wie die Köpfe einiger Neuseelän-<br />
Angeblich unterhalten sich<br />
Neuseeländer auf Partys<br />
und sonstigen Festivitäten<br />
nur über Immobilienpreise<br />
und das Wetter.
46 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
47<br />
„Serge, it is not hair, it is a<br />
duck!”<br />
der nach dem Genuss unzähliger Flaschen Rotwein langsam<br />
die Farbe des Merlots in den Gläsern annahmen, weil sie<br />
sich in intensiven Diskussionen über das Ente-Hase-Problem<br />
die Gemüter erhitzten. Vor allem die Abwandlung<br />
eines berühmten englischen Kellnerwitzes unter Berücksichtigung<br />
dieses Dilemmas stand im Mittelpunkt der Diskussionen.<br />
Der Witz macht nur auf Englisch Sinn, sodass ich<br />
hier keine Übersetzung angebe.<br />
Guest: “Waiter, there is a hare in my soup.”<br />
Waiter: “Do you mean “hair”, Sir?”<br />
Guest: “No, I mean “hare”.<br />
Waiter: “Oh no, it is a duck!”<br />
Das Ding ist grandios, oder? Es ist einer der besten<br />
Witze, die es gibt – wenn man ihn denn versteht, was ohne<br />
ein gewisses intellektuelles Niveau nahezu ausgeschlossen<br />
ist. Nach der schwierigen Entwicklung dieses Witzes als<br />
besten geme<strong>ins</strong>amen Nenner zur Erklärung des Problems<br />
war uns leider der Wein ausgegangen, denn wir alle – und<br />
vor allem meine intellektuell ausgelaugten Freunde – hatten<br />
es verdient, nach getaner Denkarbeit noch ein paar überflüssige<br />
Hirnzellen in Merlot zu ertränken. Also Jacke an,<br />
Geld eingesteckt und schnell zum Liquorshop unten an der<br />
Majoribanks gelaufen. Dieser Laden ist mein Lieblingsalkoholgeschäft,<br />
weil jedes Mal absolut schräge Typen bedienen.<br />
Der Eigentümer stellt nur wahnsinnige Paradiesvögel<br />
ein. An diesem Abend stand Serge, ein homosexueller, zwei<br />
Meter großer Farbiger, hinter der Kasse.<br />
„Hi Alex, you German beauty, how are you?“, flötete Serge<br />
mich an, aber außer einem „Good, how are you?” brachte ich<br />
aufgrund meines Alkoholmissbrauchs nichts mehr heraus.<br />
Ich holte zwei Flaschen aus dem Regal und ging zur Kasse.<br />
„Two Merlots? And, oh, you have real nice hair today!“<br />
Serge sparte <strong>mal</strong> wieder nicht mit Komplimenten, aber<br />
meine Antwort ließ ihn schon ein wenig an meinem Verstand<br />
zweifeln.<br />
„Serge, it is not hair, it is a duck!”<br />
Essentielle Problemlösungen sind nur etwas wert, wenn<br />
sie in der Praxis angewendet werden können. Die zwei Flaschen<br />
waren schnell geleert und wir von einer wahrhaft<br />
produktiven oder gar innovativen Lösung des Ente-Hase-<br />
Problems genauso weit entfernt wie am Anfang des Abends.
48 Wo zum Teufel liegt Herbertville?<br />
Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
49<br />
Die Stühle in Kaikoura sind<br />
ähnlich groß wie Hummer<br />
Hummeressen in Hummeressen<br />
Es gibt da einen wahnsinnig schönen Ort in Neuseeland.<br />
Wahrscheinlich gibt es auch noch mehrere, soviel habe ich ja<br />
noch nicht gesehen. Manch<strong>mal</strong> klingt es ein wenig pathetisch,<br />
aber ich bin davon überzeugt, dass es so etwas wie magische<br />
Orte gibt. Orte, an denen die Atmosphäre irgendwie anders ist.<br />
Die Menschen, die an solchen Orten wohnen, unterscheiden<br />
sich von anderen. Man empfindet das Wetter als besonders. Es<br />
gibt so viele Gründe, warum ein Ort magisch sein kann, wie es<br />
Menschen gibt. Man kann zwar nicht so genau erklären, worin<br />
der eigentliche Unterschied zu herkömmlichen Orten wie<br />
Schwieberdingen bei Stuttgart denn nun tatsächlich besteht,<br />
aber irgendetwas muss ja anders sein. Ausschlaggebend ist<br />
natürlich die persönliche Empfindung und man muss ja nicht<br />
immer alles erklären können. Dies unterscheidet die Naturwissenschaftler<br />
von den Geisteswissenschaftlern. Naturwissenschaftler<br />
wollen immer alles erklärt bekommen und geben<br />
nicht auf, bevor sie nicht eine zufriedenstellende Antwort oder<br />
umfassende Lösung haben. Diese Eigenschaft ist von hohem<br />
Nutzen, wenn es um die Erforschung und Weiterentwicklung<br />
von Computerchips oder um die Planung von Marsmissionen<br />
für kleine, ferngesteuerte Raupenfahrzeuge mit vielen Kameras<br />
geht, die viele überflüssige Bilder von der Marsoberfläche zur<br />
Erde funken, bei deren Anblick ganze Forscherhorden in „Ahs“<br />
und „Ohs“ verfallen, der herkömmliche Betrachter aber bloß<br />
roten Sand erkennen kann. Aber für das Auffinden von magischen<br />
Orten ist sie vollkommen nutzlos.<br />
Der Ort, den ich meine, heißt Kaikoura und liegt an der<br />
nördlichen Ostküste der Süd<strong>ins</strong>el. (Anmerkung: Es ist mir nunmehr<br />
in meiner kreativen Schaffenszeit erst<strong>mal</strong>ig gelungen, drei<br />
Himmelsrichtungen in einem Satz zur genauen geographischen<br />
Lokalisierung unterzubringen, ohne Verwirrung zu stiften.<br />
Eine genaue geographische Bezeichnung, die alle vier Himmelsrichtungen<br />
enthält, ist meines Erachtens nicht möglich.)<br />
Kaikoura heißt für alle, die nicht Maori beherrschen, übersetzt<br />
„Hummeressen“. Ich finde es gut, wenn Orte so heißen,<br />
dass man genau weiß, was da Sache ist. Mit Städtenamen in<br />
Deutschland funktioniert das meistens nicht so gut, wenigstens<br />
nicht bei Berlin oder München. Und wen interessiert schon,<br />
dass Frankfurt ein<strong>mal</strong> eine Furt für Handelswege durch den<br />
Main war? Spätestens seit dem Bau der ersten Brücke und der<br />
Frankfurter Börse niemanden mehr, weil man jetzt seine Handelsgeschäfte<br />
abschließen kann, ohne nasse Füße zu kriegen.<br />
Kalte Füße kann man allerdings auch noch in der modernen<br />
Businesswelt bekommen, und deswegen ist Frankfurt auch<br />
kein magischer Ort, sondern eher langweilig, und wird auch<br />
nie einer werden. Es sei denn, man muss den Main irgendwann<br />
ein<strong>mal</strong> wieder abenteuerlich in einer Furt durchwaten.<br />
Wenn man mit dem Motorrad der Küstenstraße in Richtung<br />
Norden folgt, dann fährt man irgendwann eine Kurve<br />
um eine Klippe. Rechts hat man den Pazifik, links die Berge<br />
und vor einem den grandiosen Blick auf die Kaikoura Pen<strong>ins</strong>ula<br />
und den 2.610 Meter hohen, schneebedeckten Gipfel des<br />
Manakau, des höchsten Berges der Seaward Kaikoura Range. In<br />
diesem Moment bleibt einem nichts anderes übrig, als in einer<br />
verdammt gefährlichen Kurve anzuhalten, weil man sonst vor<br />
Staunen glatt vergessen würde, Gas zu geben, und dann vom<br />
Motorrad fallen würde. Anhalten ist also zum Staunen besser.<br />
Man nimmt den Helm ab und staunt. Es geht zwar auch mit<br />
Helm, aber die Qualität des Staunens ist erhöht, wenn man die<br />
ungetrübte akustische Wonne der Meeresbrandung ohne die<br />
geräuschdämmende Wirkung des Helmes wahrnehmen kann.<br />
Das rundet das Ganze erst ab und macht es zu einem, sagen<br />
wir <strong>mal</strong>, schönen Erlebnis. Anstelle des brachialen Dröhnens<br />
der frisierten und damit unverschämt lauten Auspufftüten<br />
– was zugegebenermaßen natürlich auch seinen Reiz hat, vor<br />
allem, wenn man durch einen Tunnel fährt – hört man also<br />
das Meer.<br />
Meeresrauschen ist ein ziemlich essentieller Bestandteil von<br />
magischen Orten. Logischerweise gilt diese Qualitätsklassifi-<br />
Kaikoura heißt für alle, die<br />
nicht Maori beherrschen,<br />
übersetzt „Hummeressen“.
50 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
51<br />
Es gibt kaum etwas Bes-<br />
seres, als sich morgens an<br />
einer heruntergekommenen<br />
Fischerbude namens „Nin’s<br />
Bin“, direkt am Küstenhigh-<br />
way gelegen, von Nin den<br />
frischen nächtlichen Fang<br />
kochen zu lassen und mit<br />
heißer Butter und einem<br />
Blick auf den Pazifik zu<br />
genießen.<br />
zierung nur für Orte, die auch tatsächlich am Meer liegen. Ich<br />
will damit sagen, dass es natürlich auch ein paar magische Orte<br />
gibt, die nicht am Meer liegen, aber das sind nicht so viele und<br />
sie heißen schon gar nicht „Hummeressen“. Ich liebe Hummer<br />
– „Crayfish“, wie er hier genannt wird. Es gibt kaum etwas Besseres,<br />
als sich morgens an einer heruntergekommenen Fischerbude<br />
namens „Nin’s Bin“, direkt am Küstenhighway gelegen,<br />
von Nin den frischen nächtlichen Fang kochen zu lassen und<br />
mit heißer Butter und einem Blick auf den Pazifik zu genießen.<br />
Wenn man Glück hat und es gerade Ebbe ist, dann verstärkt<br />
sich der Geruch noch, der vom Meer her kommt, und so sind<br />
fast alle Sinne beteiligt: Schmecken, Riechen und Sehen. Es soll<br />
ja allerdings auch Leute geben, die Hummer mit anderen Dips<br />
essen, wie Chilisoße oder Mayonnaise, aber die haben ja keine<br />
Ahnung, denn sie verfälschen damit nur den wunderbaren<br />
Geschmack des Hummers.<br />
Außer Hummer gibt es noch einige andere Tiere, die sich<br />
im Wasser vor der Küste tummeln. Relativ nah an der Küste<br />
befindet sich ein 2.000 Meter tiefer unterseeischer Canyon. In<br />
solchen Wassertiefen findet der Sperm Whale seine Nahrungsgrundlage.<br />
Nun, die Bezeichnung „Sperm Whale“ sollte nicht<br />
wörtlich übersetzt werden, denn einen Sperma-Wal gibt es bei<br />
aller Zoologik nicht, es handelt sich vielmehr um einen Pottwal,<br />
den „Physeter Macrocephalus“.<br />
Natürlich kann man auch Ausflüge mit Walbesichtigungsbooten<br />
unternehmen, und leider lässt es sich nicht vermeiden,<br />
dass die ganze Sache ziemlich touristisch aufgezogen ist.<br />
Die Walbesichtigungsindustrie ist Hauptwirtschaftsfaktor der<br />
Stadt. Merkwürdigerweise enden hier in Neuseeland alle Wirtschaftszweige<br />
irgendwie auf „Industry“, was sich für meine<br />
Ohren ein wenig großspurig anhört, wenn man es wörtlich<br />
übersetzt: die Energieindustrie, die Hummerindustrie oder<br />
die Outdoorindustrie. Interessant ist, dass sich diese Bezeichnung<br />
nicht nur auf legale, sondern auch auf illegale berufliche<br />
Tätigkeiten bezieht. So wird auch der gewerbsmäßige Groß-<br />
und Einzelhandel mit verbotenen berauschenden Substanzen<br />
„Drogenindustrie“ genannt, wobei einem nicht der assoziative<br />
Fehler unterlaufen darf, anzunehmen, dass es sich hier nur um<br />
synthetisch hergestellte Mittelchen handeln würde. Nein, auch<br />
die natürlichen bewusstse<strong>ins</strong>erweiternden Produkte sind im<br />
fein diversifizierten Portfolio der Industrie enthalten.<br />
Zurück zu den Walen. Als ich zum Walbesichtigungscenter<br />
fuhr, fiel mir mit meinem über Jahre geschulten Blick für<br />
Absonderlichkeiten und Absurditäten ein Straßenschild auf,<br />
auf dem zu lesen war: „Reduce Speed. Sperm Whale Bump<br />
Ahead“, was soviel heißt wie „Runter vom Gas. Da vorne ist<br />
ein Pottwal-Buckel.“ Ich gebe zu, dass die Übersetzung ein bisschen<br />
schräg klingt, aber das liegt nur daran, dass ich nicht den<br />
blassesten Schimmer habe, wie diese Buckel heißen, die in verkehrsberuhigten<br />
Zonen auf der Straße zu finden sind. Ende der<br />
80er Jahre hatte der da<strong>mal</strong>s rot-grüne Berliner Senat nach dem<br />
sensationellen <strong>Sie</strong>g über die CDU überall in den Seitenstraßen<br />
im Zentrum Westberl<strong>ins</strong> diese Buckel bauen lassen, damit die<br />
Bürger genervt waren und häufiger mit dem Bus fuhren. Da<strong>mal</strong>s<br />
wurden diese Buckel von der Berliner Schnauze „Momperhügel“<br />
benannt, nach dem Bürgermeister Walter Momper. Nach<br />
der nächsten Wahl und dem daraus resultierenden Machtverlust<br />
für Rot-Grün waren die Buckel dann auch ganz schnell<br />
wieder weg, und damit auch die Bezeichnung. Wie heißen bloß<br />
diese Dinger? Ich bin mir sicher, dass es dafür einen amtlichen<br />
Ausdruck gibt.<br />
Auf der Straße befand also ein „Bump“ in Form eines Pottwals<br />
und da die Straße ziemlich breit war, hatte man einen Pottwal-Bump<br />
in Originallänge auf den Asphalt gesetzt. Man möge<br />
es mir glauben, rein vom psychologischen und emotionalen<br />
her betrachtet, macht es einen deutlichen Unterschied, ob man<br />
über einen hundsgewöhnlichen Verkehrsberuhigungsbukkel<br />
oder einen in Pottwalform fährt. Ich meine, festgestellt zu<br />
haben, dass die Fahrzeuge tatsächlich mit der Geschwindigkeit<br />
heruntergingen, bevor sie den Wal überquerten – als wollten<br />
sie ihn nicht verletzen. An magischen Orten gehen Autofahrer<br />
also vom Gaspedal, weil sie einem Pottwal, der in Zement
52 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
53<br />
Weil die Kaikourianer ganz<br />
genau wissen, an was für<br />
einem besonderen Ort sie<br />
leben, haben sie für ihre<br />
Region auch ein marketing-<br />
gerechtes Label kreiert:<br />
das Ganze ist nämlich das<br />
gegossen als Verkehrsberuhigungsbuckel auf der Straße liegt,<br />
nicht wehtun wollen. Vielleicht hatten sie aber auch bloß Angst,<br />
dass sie sich die Achse beschädigen – das Ding war nämlich<br />
verdammt hoch.<br />
Weil die Kaikourianer ganz genau wissen, an was für einem<br />
besonderen Ort sie leben, haben sie für ihre Region auch ein<br />
marketinggerechtes Label kreiert: das Ganze ist nämlich das<br />
„Alpine Pacific Triangle“. Ein Vorteil dieses Dreiecks ist, dass<br />
man an einem Samstagmorgen im Juli nach dem Aufstehen <strong>mal</strong><br />
locker und unglaublich cool sich und/oder seinem eventuellen<br />
Partner oder Partnerin folgende Frage stellen kann: „Schatzi<br />
(dieser wirklich einfallslose Kosename ist geschlechtsneutral,<br />
so bin ich nicht gezwungen, politisch korrekt beide Formen zu<br />
verwenden; ansonsten interessieren mich politische Korrektheiten<br />
aber einen Teufel!), was wollen wir den heute machen?<br />
Hast du Lust auf Hochseeangeln oder wollen wir lieber Skilaufen?<br />
Oder vielleicht beides?“ An welchem verdammten Ort auf<br />
unserem Planeten kann man noch diese Frage stellen? Ich hätte<br />
bei dieser Frage ein unglaublich unverschämtes Gr<strong>ins</strong>en im<br />
Gesicht und würde mich an den Spruch meines Freundes dirki<br />
erinnern: „Wenn das das Leben ist, dann hat man mich doch<br />
nicht beschissen.“<br />
Wo wir schon ein<strong>mal</strong> beim Bescheißen sind, kann ich auch<br />
noch über die Seehunde schreiben, die auf der Kaikoura Pen<strong>ins</strong>ula<br />
eine Kolonie errichtet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob<br />
man die Ansiedlung von Seehunden an einem Küstenstreifen<br />
Kolonisierung nennt – die Erklärung des Begriffs in der Enzyklopädie<br />
bezieht sich nur auf Menschen, nicht auf Seehunde.<br />
Ihre Kolonien kann man jedenfalls bei Windstille schon aus<br />
einiger Entfernung wahrnehmen, es stinkt nämlich erbärmlich<br />
nach Seehundkacke. Ich finde, dass bei bestimmten Gerüchen<br />
der Begriff „Exkrement“ die Realität nicht adäquat wiedergibt.<br />
Bei Seehunden ist das der Fall, aber wahrscheinlich würde es<br />
beim Menschen auch nicht anders riechen, wenn dieser sich<br />
ausschließlich von rohen, unausgenommenen Fischen und<br />
Muscheln ernähren würde.<br />
In Kaikoura kann man mit Seehunden im offenen Meer<br />
schwimmen und das ist ein besonderes Erlebnis. Die Viecher<br />
sind neugierig und machen verrückte Sachen im Wasser. Aber<br />
sie stinken erbärmlich und das drängt sie offensichtlich in der<br />
maritimen Welt in eine Außenseiterrolle, sonst würden sie ja<br />
keine Kolonie an Land errichten. Vielleicht haben sie das aber<br />
auch nur gemacht, weil es in Kaikoura so schön ist.<br />
Jedes kleine und große Paradies hat irgendwelche Nachteile.<br />
Schon seit der Entstehungsgeschichte in der Bibel wissen<br />
wir, dass nicht alles perfekt ist. Man kann sich durchaus darüber<br />
streiten, welche der vier Komponenten – Adam, Eva, die<br />
Schlange oder der Apfel – die Affären im biblischen Paradies<br />
aus dem Ruder laufen lassen haben. Ich ganz persönlich bin der<br />
Meinung, dass das Nichtvorhandensein von Bier für die Konfusion<br />
ausschlaggebend war. Ich habe von Religion allerdings<br />
keine Ahnung. Aber wenn dort schon nicht alles rund lief,<br />
dann ist es doch kein Wunder, dass sich auch in Neuseeland bei<br />
genauerer Betrachtung ein paar gravierende Haken auftun.<br />
Schlimmer als Biernotstand sind Sandfliegen. Die Viecher<br />
findet man überall da, wo es Sand und Wasser gibt. Wenn<br />
man von einem Neuseeländer vor irgendetwas gewarnt wird<br />
(Erdbeben, Taifune, Haie, Sandfliegen), dann sollte man das<br />
zumindest im Falle der Sandfliegen durchaus nicht mit einem<br />
lässigen Schulterzucken abtun. Die Biester sind ziemlich klein,<br />
vielleicht so zwei Millimeter groß, und man bemerkt sie erst,<br />
wenn sie zugebissen haben. Natürlich klatscht man sie dann<br />
platt, und viele Sandfliegen haben auch an meinen Armen und<br />
Beinen ihr Leben im heroischen Kampf um Nahrung gelassen.<br />
Aber um in der Militärsprache zu bleiben: die Verwundungen<br />
in meinen Reihen waren zahlreich und schmerzhaft. Meine<br />
Ignoranz gegenüber den Warnungen meiner gr<strong>ins</strong>enden neuseeländischen<br />
Freunde hat mein Leben um einige schmerzhafte<br />
Momente bereichert. Das Problem ist, dass da, wo eine<br />
Fliege zubeißt und erschlagen wird, sogleich eine zweite, dritte<br />
– und so fort – auftaucht und dir den Krieg erklärt. Ohne chemische<br />
Keule führt man dann in kürzester Zeit an allen Ecken<br />
„Alpine Pacific Triangle“. In Kaikoura kann man mit<br />
Seehunden im offenen Meer<br />
schwimmen und das ist ein<br />
besonderes Erlebnis.
54 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen 55<br />
und Enden quasi einen Vielfrontenkrieg. Mit etwa 20 Stichen<br />
ist man schon gut bedient, aber danach geht die Leidenszeit<br />
erst richtig los. Ein stinknor<strong>mal</strong>er mitteleuropäischer Mückenstich<br />
ist dagegen lächerlicher Kinderkram. So ein Biss tut eine<br />
Woche lang höllisch weh und man wird durch unablässigen<br />
Juckreiz daran erinnert, dass man Kiwiwarnungen nicht achtlos<br />
ignorieren sollte.<br />
Zum Glück gibt es in allen Supermärkten und Apotheken<br />
ganze Regale gefüllt mit Sprays, die die Biester fernhalten. Auf<br />
alle Dosen sind große Totenköpfe gedruckt, die die Hochgiftigkeit<br />
des Mittels symbolisieren. Egal wie schädlich das Zeug<br />
für die Haut ist, es ist alle<strong>mal</strong> besser, als als Nahrungsmitteldepot<br />
für Sandfliegen zu dienen. Ich vertraue dem Insektenspray<br />
„Bushman Plus – entwickelt in Australiens tropischem Norden“.<br />
Wer schon ein<strong>mal</strong> in seinem Leben im tropischen Norden<br />
Australiens war, der weiß, dass dort einiges mehr an nahrungssuchendem<br />
Ungeziefer geräuschvoll durch die Lüfte schwirrt<br />
als in Neuseeland. Nebenbei bemerkt, besitzt ein hochpreisiges<br />
Parfüm für die Dame, welches von einer Firma hergestellt wird,<br />
die im Kerngeschäft hochwertige Herrenanzüge produziert, ein<br />
großes Outlet in Metzingen betreibt und deren Name auch ein<br />
Synonym für „Chef “ ist, genau die gleiche Wirkung auf Sandfliegen<br />
wie „Bushman Plus“ – wobei ich finde, dass letzteres<br />
deutlich angenehmer riecht. Dieser Damenduft wird von Sandfliegen<br />
gehasst und die Firma könnte sich überlegen, ob sie ihr<br />
Portfolio, bestehend aus Anzügen, Parfüms und Sonnenbrillen,<br />
nicht zumindest in Neuseeland und Australien um Insektenspray<br />
erweitern sollte.<br />
Ein weiterer wesentlicher Standortnachteil dieses Paradieses<br />
sind „Pies“. Das sind Pasteten, die in Blätter- oder Mürbeteig<br />
verpackt sind. An jeder Tankstelle, in Pubs und Dairies<br />
bekommt man diese merkwürdigen Dinger. <strong>Sie</strong> liegen in Wärmeschränken,<br />
die einen verdammt an die Biologiestunden in<br />
der Grundschule erinnern, wo man in solchen Apparaturen<br />
Bakterienkolonien oder Schimmelpilze gezüchtet hat, die man<br />
hinterher unter dem Mikroskop betrachten konnte. Wo andere<br />
Nationen Bakterien züchten, lagert der Neuseeländer seine Pies.<br />
Womit die Pasteten genau gefüllt sind, steht auf kleinen Kärtchen,<br />
aber ob die Information auf der Karte auch mit dem tatsächlichen<br />
Inhalt übere<strong>ins</strong>timmt, wage ich in Zweifel zu ziehen.<br />
Wenn die Pies nicht in einem Wärmeschrank liegen, dann in<br />
einer Kühltheke. <strong>Sie</strong> werden vor dem Verzehr in einer Mikrowelle<br />
schnell aufgewärmt, sodass die Soße darin kochend heiß<br />
wird und man sich beim ersten, ahnungslosen „Genuss“ den<br />
Gaumen verbrennt. Das Gefühl ist ungefähr so, als wenn man<br />
in eine zu heiße Pizza beißt, der Unterschied besteht lediglich<br />
in der Konsistenz, die bei Pies an einen alten Schwamm erinnert.<br />
Alleinreisenden Neuseelandfahrern sei vor allem in entlegeneren<br />
Gebieten vom Konsum dieser „Spezialität“ abgeraten,<br />
weil man danach in der Regel jemanden braucht, der Hilfe holt,<br />
während man sich selbst mit Magenkrämpfen auf dem Boden<br />
windet. Die Neuseeländer sind ganz wild auf ihre Pies und<br />
essen sie am liebsten mit Ketchup. Für Mägen, die eher andere<br />
Speisequalitäten gewohnt sind, stellt der Verzehr so etwas wie<br />
eine Mutprobe dar. Ich habe mich diesem Wagnis erst- und<br />
letzt<strong>mal</strong>ig in dem Ort „Arthur’s Pass“ im Restaurant „Swiss<br />
Chalet“ gestellt. Widerwillig meisterte ich auch diese Herausforderung,<br />
aber die Weiterfahrt nach Christchurch war keine<br />
Freude, weil das Motorengeräusch in immer kürzeren Abständen<br />
von fiesen Lauten aus meinem Magen übertönt wurde, die<br />
sich mangels anderer Nahrungsaufnahme nur durch den Verdauungsprozess<br />
eines Beef-Meatpies ergeben haben können.<br />
Seitdem mache ich voller Respekt einen großen Bogen um<br />
Pies und hungere lieber, als mir das noch ein<strong>mal</strong> anzutun. Vor<br />
einem Laden, der sich „One Dollar Pies“ nennt, sollte man sich<br />
besonders in Acht nehmen, denn er erfüllt meines Erachtens<br />
schon allein dem Namen nach den Tatbestand der gefährlichen<br />
Körperverletzung, wobei die Qualifikation „mit Todesfolge“<br />
nicht aus den Augen gelassen werden sollte.<br />
Die Magie von Kaikoura basiert auch darauf, dass es dort<br />
weder Sandflies noch Pies gibt.<br />
Am Arthur‘s Pass
62 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
63<br />
Bed & Breakfast Sea Breeze:<br />
Cafer und Fiona Unac, 281<br />
Marine Parade, Napier,<br />
Telefon: 0064-6-8358067,<br />
E-Mail: Seabreeze.<br />
Napier@xtra.co.nz.<br />
Feiertags in Neuseeland<br />
Ich komme aus einem überregulierten Land. Grundsätzlich<br />
sind Regeln ja sinnvoll, schließlich kann man seinem Nachbarn<br />
nicht einfach den Schädel e<strong>ins</strong>chlagen, nur weil er im<br />
Spätsommer Kirschen von einem Baum geklaut hat, dessen<br />
Zweige zufällig über seinem Grundstück hängen. Vor allem<br />
Kinder würden dann ja zu Zeiten der Kirschernte Opfer blutiger<br />
Gemetzel werden. Da es in unserer Gesellschaft irgendwie<br />
nicht angemessen erscheint, kirschenklauenden Kindern den<br />
Schädel einzuschlagen, hat der Gesetzgeber dies verboten. Nun<br />
steht in unseren Gesetzen nicht „Kinder, die Kirschen klauen,<br />
dürfen nicht erschlagen werden“, sondern das Ganze ist von<br />
Juristen so abstrakt formuliert worden, dass es zum Beispiel<br />
auch auf Tomaten oder Birnen und sogar Geld anwendbar ist,<br />
und auch auf Menschen, die keine Kinder mehr sind. Da man<br />
schon seit Jahren nichts von spätsommerlichen, in Schrebergärten<br />
stattfindenden Kinderdahinmetzeleien gehört hat, scheint<br />
das Gesetz Wirkung zu haben und ist somit guten Gewissens<br />
als sinnvoll zu bezeichnen. Es gibt aber auch viele Gesetze, die<br />
– man möge mir den Ausdruck verzeihen – kranken Gesetzgeberhirnen<br />
entsprungen sein müssen, da niemand weiß, wozu<br />
diese Gesetze nötig sind. In Deutschland nennt man solche<br />
Gesetze Bundesgesetze.<br />
Wie in jedem Land, gibt es solche Gesetze auch in Neuseeland.<br />
Zu Ostern habe ich die Konfrontation mit einem besonders<br />
absurden Gesetz erleben dürfen. Ich hatte in Napier ein<br />
kleines Bed & Breakfast mit drei wunderschönen Zimmern<br />
entdeckt, welches der Besitzer, Cafer, in vierjähriger Arbeit<br />
hergerichtet hatte. Erst traute ich mich gar nicht nachzufragen,<br />
weil es so teuer aussah. Aber der Preis, die Gastfreundschaft,<br />
das Design mit Liebe zum Detail, das Frühstück und die Lage<br />
sind unvergleichlich. Das Doppelzimmer kostet zwischen $ 80<br />
und $ 110 und jeder Dollar davon lohnt sich. Als ich am Ostersonntag-Abend<br />
gerade auf dem Weg zu meiner Unterkunft war,<br />
kam ich auf der Marine Parade an einem kleinen Restaurant<br />
mit angeschlossener Bar vorbei. Der Laden sah schrecklich aus<br />
und es roch nach richtig ranzigem Fett, aber eine aufregende<br />
Cocktailkarte lächelte mich von der Wand an: „Alle Cocktails<br />
nur 6 Dollar. Immer“, war auf der Tafel zu lesen. Solche Schilder<br />
machen mich neugierig und misstrauisch zugleich. Sechs<br />
Dollar sind umgerechnet ungefähr drei Euro. Nur am Rande<br />
bemerkt sei, dass für Deutsche, die beim Einkaufen immer<br />
noch heimlich den Euro in Deutsche Mark umrechnen, Neuseeland<br />
schöne Erinnerungen wachrufen könnte, denn ein neuseeländischer<br />
Dollar entspricht derzeit etwa dem Gegenwert<br />
einer Mark. Man kann hier quasi mit DM einkaufen. Für drei<br />
Euro bekommt man keinen anständigen Cocktail. Bei solchen<br />
Preisen gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder die Getränke<br />
sind gut und preiswert oder sie sind preiswert und schlecht.<br />
Nor<strong>mal</strong>erweise ist letzteres der Fall. Ich ging also in die Bar und<br />
bestellte einen „Sex on the Beach“, der Name des Getränks ist<br />
fürchterlich, aber das Zeug schmeckt lecker.<br />
Mein Misstrauen in die Qualität der kredenzten Produkte<br />
wuchs sprunghaft an, als ich den Kellner, der meine Bestellung<br />
aufgenommen hatte, aus einer Schublade einen Karteikartenkasten<br />
herausholen sah. Offensichtlich suchte er die Karte mit<br />
der Rezeptur für einen „Sex on the Beach“, um mir dann in<br />
einem Halbliterbierglas einen Cocktail zu mixen. Der Cocktail<br />
war die volle Ladung mit guter Qualität. In einem solchen Fall<br />
lohnt es sich tatsächlich, einen neuen Plan zu machen und den<br />
Zeitpunkt des Nachhausegehens nach hinten zu verschieben.<br />
Der „Sex on the Beach“ war schnell vorbei (doofes Wortspiel,<br />
langweilig und einfallslos, aber man kann ja nicht immer in<br />
Bestform sein) und ich wollte einen zweiten Drink bestellen,<br />
einen „Cuba Libre“. Im Deutschen gibt es meiner Meinung<br />
nach keine wirklich treffende Übersetzung für den englischen<br />
Begriff „smooth“, aber wenn man einen Cuba Libre trinkt und<br />
der Barkeeper zwölf Jahre alten „Havanna Club“-Rum als Zutat<br />
verwendet hat, dann ist das Gefühl beim ersten Schluck in der<br />
Kehlkopfgegend „smooth“. Dies<strong>mal</strong> wollte eine Kellnerin mit
64 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
65<br />
„Warum muss ich etwas<br />
essen?“, stellte ich nunmehr<br />
die richtige Frage.<br />
„SO LAUTET DAS GESETZ!“<br />
dem eigenartigen Namen Fionnuala die Bestellung aufnehmen.<br />
„Ich hätte gerne einen Cuba Libre.“<br />
„OK, und was möchtest du dazu zu essen haben?“, fragte<br />
mich die Kellnerin. Nun war es gegen zehn Uhr abends und ich<br />
hatte in einem <strong>mal</strong>lorquinischen Restaurant das schlechteste<br />
Abendessen meines bisherigen Neuseelandaufenthaltes gegessen.<br />
Ich hatte überhaupt keinen Hunger mehr.<br />
„Essen? Ich möchte nichts essen. Ich hätte gern einen Cuba<br />
Libre.“<br />
„Das geht leider nicht. Wenn du etwas trinken willst, musst<br />
du etwas essen.“ Die Kellnerin blieb hart.<br />
„Ich habe aber gar keinen Hunger. Dies ist doch eine Bar.<br />
Ich will nur etwas trinken.“<br />
„Du musst etwas essen, wenn du trinken willst.“ Die gute<br />
Dame hörte sich langsam ziemlich mütterlich an.<br />
„Warum muss ich etwas essen?“, stellte ich nunmehr die<br />
richtige Frage.<br />
„SO LAUTET DAS GESETZ!“ Es gibt Antworten, die ich<br />
überhaupt nicht leiden kann, und dazu gehört diese in Großbuchstaben<br />
gesprochene. Nur hatte ich den Sinn immer noch<br />
nicht verstanden.<br />
„Ich habe doch aber eben bei deinem Kollegen einen Drink<br />
bekommen, ohne etwas zu essen bestellt zu haben. Kann ich bei<br />
ihm bestellen?“ Es ist ja nicht so, dass ich leicht aufgebe oder<br />
nicht spitzfindig sein kann.<br />
„Er wird dir dasselbe sagen.“ Ich hatte Durst und Fionnuala<br />
ließ sich nicht erweichen.<br />
„Was soll ich denn essen?“, fragte ich.<br />
„Nimm einfach eine Portion Pommes Frites“, entgegnete sie<br />
schulterzuckend.<br />
Pommes Frites ist die korrekte Übersetzung, diese Bezeichnung<br />
ist aber, genauso wie der in den USA gebräuchliche Ausdruck<br />
„French Fries“, in Neuseeland politisch nicht korrekt.<br />
Hier sagt man wie in England „Chips“. Dies hat einerseits einen<br />
historischen Hintergrund, nämlich die immer noch sehr enge<br />
Verbindung zu Großbritannien, aber auch einen politischen<br />
Bezug, und zwar die sehr zwiespältige Haltung zu Frankreich<br />
und allem Französischen. Seit den französischen Atombombenversuchen<br />
im Südpazifik und dem Versenken des Greenpeace-Schiffes<br />
„Rainbow Warrior“ durch den französischen<br />
Geheimdienst im Hafen von Auckland gibt es erhebliche Vorbehalte<br />
gegen Franzosen. Deswegen heißen Pommes nicht<br />
French Fries.<br />
Kurz darauf kamen meine „Chips“ und der Cuba Libre, aber<br />
„SO LAUTET DAS GESETZ“ klang mir immer noch in den<br />
Ohren. In der Tat gibt es eine Verordnung, welche einem verbietet,<br />
vor und an Feiertagen alkoholische Getränke zu konsumieren,<br />
wenn man nicht gleichzeitig etwas zu essen bestellt hat.<br />
Ein Wirt, der ausschenkt, ohne eine Speise zu servieren, verstößt<br />
gegen das Gesetz und riskiert den Verlust seiner Schanklizenz.<br />
Diese strikte Einhaltung von Gesetzen erschien in<br />
Anbetracht des hygienischen Zustandes der Küche, der Toilette<br />
und des Personals mehr als paradox. Jedes Mal, wenn ich nunmehr<br />
einen Drink bestellte, orderte ich eine Portion Pommes<br />
dazu. Diese waren dicke, fette, nur kurz anfrittierte, labberige<br />
Dinger und nicht ein<strong>mal</strong> mit dem Hungertod vor Augen könnte<br />
ein nor<strong>mal</strong>er Magen dieses Zeug verdauen. Eher würde es den<br />
Sterbeprozess noch beschleunigen. So standen dann gegen<br />
Mitternacht sieben Portionen kalter Pommes, durchweicht mit<br />
roter, an Tomatensoße erinnernder Flüssigkeit, vor mir auf der<br />
Bar, sowie neun leere Cocktailgläser. Mein Verdacht hatte sich<br />
bestätigt: eine Tafel, auf der $ 6-Cocktails angeboten werden,<br />
kann nicht die ganze Wahrheit widerspiegeln. Ein Cocktail in<br />
dieser Bar kostete mich sechs Dollar und eine Portion Pommes<br />
vier Dollar. Nach Adam Riese macht das zehn Dollar für einen<br />
Cocktail. Das Schöne an der Sache war aber, dass man pro<br />
Bestellung nur eine Portion mitordern musste und sich damit<br />
nicht strafbar machte. Das bedeutete, dass sich nach und nach<br />
ein paar nette Kiwis an meinen Tisch gesellten, wir jeweils<br />
vier Cocktails und eine Portion „Chips“ bestellten und so den<br />
durchschnittlichen Cocktailpreis auf $ 7 drückten, ohne gegen
76 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
77<br />
Der kälteste Winter ist der Sommer in<br />
San Francisco<br />
Martin, der von den äußeren Hebriden stammt – einer schottischen<br />
Inselgruppe, irgendwo zwischen den Färöer Inseln,<br />
Island und dem schottischen Festland mitten in den Atlantik<br />
gesetzt – hat es letztens ein<strong>mal</strong> so ausgedrückt: „Ich weiß gar<br />
nicht, warum Ihr Euch immer alle so über das Wetter in Wellington<br />
aufregt. Es ist doch im Winter tagsüber nie kälter als<br />
zehn Grad. Das ist bei mir zu Hause die absolute Höchsttemperatur<br />
im Sommer an einem heißen Tag.“ Damit mag er ein<br />
wenig übertrieben haben, aber er trifft den Kern der Sache in<br />
zweierlei H<strong>ins</strong>icht: erstens ist es gar nicht so schlimm und zweitens<br />
kommt es auf den Standpunkt des Betrachters an.<br />
Ich bin im Nachhinein ganz froh, dass ich als Trainingseinheit<br />
und zur Abhärtung drei Jahre in Kiel verbracht habe. Der<br />
kälteste Winter ist nämlich der Sommer in Kiel. Ursprünglich ist<br />
dies ein Zitat, welches den Sommer in San Francisco beschreiben<br />
soll. Überflüssigerweise wird es in jedem Film zitiert, der<br />
dort spielt und in dem es um eine völlig verregnete Liebesgeschichte<br />
geht. Anständige Liebesgeschichten mit einem Happy<br />
End, welches sich schon während der Handlung abzeichnet<br />
und nicht erst drei Minuten vor Ultimo, spielen nie in Städten<br />
wie San Francisco oder Kiel, sondern in Rom oder Paris. Der<br />
Unterschied zum Winterwetter in Wellington ist lediglich, dass<br />
es in Kiel nur ein<strong>mal</strong> im Jahr regnet, nämlich von September<br />
bis Ende April. In dieser Zeit kann man eine erstaunliche Metamorphose<br />
bei sich feststellen: es wachsen einem bei längeren<br />
Aufenthalten im Freien Schwimmhäute zwischen den Fingern<br />
und das Umschalten von Lungen- auf Kiemenatmung funktioniert<br />
mit der Zeit auch immer besser. Man entwickelt ähnliche<br />
Fähigkeiten wie Patrick Duffy in der unglaublich schlechten<br />
Serie „Der Mann aus dem Meer“.<br />
Bei diesem muss man allerdings berücksichtigen, dass er<br />
die Serie nach „Dallas“ gedreht hat. Mit diesem Umstand im<br />
Hintergrund könnte es für ihn sogar ein Karrieresprung gewesen<br />
sein – zumindest, was die schauspielerische Herausforderung<br />
betrifft, bestimmt aber nicht die Gage. Vor Jahren habe<br />
ich zufällig ein<strong>mal</strong> das Theaterstück „Art“ von Yasmin Reza<br />
auf einer Londoner Bühne sehen dürfen, und zwar mit Patrick<br />
Duffy in der Hauptrolle. Ich muss ehrlich zugeben, dass er ganz<br />
ausgezeichnet gespielt hat. Was für ein Aufstieg – vom Dallas-<br />
Seriendarsteller zum Theaterschauspieler in London!<br />
Da Wellington direkt an der Cook Strait liegt, der Wasserstraße<br />
zwischen Nord- und Süd<strong>ins</strong>el und damit der Verbindung<br />
zwischen der Tasmanischen See und dem Pazifik, ist<br />
das abwechslungsreiche Wetter eine schöne Metapher für die<br />
Vielfältigkeit der Wellingtonians. Der Wetterbericht stimmt nie<br />
und die Drei-Tage-Vorhersagen in der „Dominion Post“ schon<br />
<strong>mal</strong> gar nicht. Wenn man sich darauf verlässt, dann ist man<br />
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit falsch angezogen.<br />
Der Schutz gegen die meteorologische Anarchie fällt<br />
durch diese Unberechenbarkeit besonders schwer. Der Erwerb<br />
eines Regenschirms entpuppt sich meist nach drei bis spätestens<br />
fünf Minuten als glatte Fehlinvestition, weil der Wind<br />
so stark ist, dass der Schirm im Nu umknickt und kaputt ist.<br />
Wenn man Glück hat und der Schirm dem Sturm standhält,<br />
dann sollte man sich darauf e<strong>ins</strong>tellen, dass man erhebliche<br />
Mühe haben wird, ihn festzuhalten. Unangenehmer Nebeneffekt<br />
des Windes in der Stadt ist, dass damit der Regen auch<br />
von der Seite kommt, nicht nur von oben, was die konservative<br />
Art, einen Regenschirm zu benutzen, also ihn über dem Kopf<br />
zu halten, ad absurdum führt. In der Tat sieht man bei starkem<br />
Wind viele Leute mit dem Schirm vor dem Körper gegen<br />
den Seitenregen ankämpfen. Da gewöhnliche Schirme nur bei<br />
Zwergen den ganzen Körper bedecken, bleibt es leider nicht aus,<br />
dass ein bis zwei Körperteile immer nass werden, und das sind<br />
in der Regel unangenehmerweise die Füße und der Kopf. Der<br />
Kauf eines Regenschirmes kommt also dem „aus dem Fenster“-<br />
Werfen von Geld oder dem Verbrennen von Banknoten gleich.<br />
Da Wellington direkt an<br />
der Cook Strait liegt, der<br />
Wasserstraße zwischen<br />
Nord- und Süd<strong>ins</strong>el und<br />
damit der Verbindung<br />
zwischen der Tasmanischen<br />
See und dem Pazifik, ist das<br />
abwechslungsreiche Wetter<br />
eine schöne Metapher für<br />
die Vielfältigkeit der Wellingtonians.
78 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
79<br />
„Goretex“, schreit der outdoorerprobte, besserwissende<br />
Zeitgenosse, „Goretex“. „Scheiße“, sagt der wellingtonerprobte<br />
Zeitgenosse. Meine Gortexklamotten haben den immensen<br />
Wassermassen auch nicht länger als dreißig Minuten standgehalten.<br />
Analysiert man die Problematik des opti<strong>mal</strong>en Schutzes<br />
vor ekelhaft kaltem Regen, so landet man bei seiner Suche<br />
schließlich bei der Arbeitskleidung von Hochseefischern und<br />
Bauarbeitern – zwei Berufsgruppen, die bei Wind und Wetter<br />
immer draußen arbeiten. Bitte schön, hat irgendjemand schon<br />
ein<strong>mal</strong> einen Bauarbeiter oder Fischer in Goretexkleidung<br />
gesehen? Eben, die Jungs tragen Ölzeug, um sich vor dem<br />
durchweichen zu schützen. Nun, seit ich mit Gummistiefeln<br />
und gelbem Regenmantel in frühester Kindheit durch<br />
schlammbraune Pfützen gewatet bin, hatte ich solche Kleidung<br />
nicht mehr getragen, aber jetzt weiß ich sie zu schätzen. Ölzeug!<br />
Alles andere ist Mist.<br />
Damit wäre aber das Problem der Kälte noch nicht vom<br />
Tisch und das stellt ein echtes Problem dar. Weniger draußen,<br />
denn da kann man sich ja warm anziehen. Es besteht eher in<br />
den eigenen vier Wänden, denn für Privathäuser gibt es kein<br />
Zentralheizungssystem und viele Häuser sind so miserabel isoliert,<br />
dass es an allen Ecken und Enden durchzieht und pfeift.<br />
Manch<strong>mal</strong> kommt es mir vor, als wäre es drinnen kälter als<br />
draußen. Nun ist es ziemlich ungemütlich, zu Hause immer<br />
mit Wintermantel und Stiefeln herumzulaufen. Der Kiwi hat<br />
gegen drohenden Erfrierungstod erstaunliche Überlebensstrategien<br />
entwickelt. Eine Wärmflasche, die bei uns in Deutschland<br />
höchstens noch bei Magenschmerzen Anwendung findet,<br />
ist Standardausrüstung und zuverlässiger Begleiter im eigenen<br />
Haus. Ferner boomt der Verkauf von Heizdecken, deren Preise<br />
bei umgerechnet 15 Euro beginnen.<br />
Ich habe mich bisher geweigert, solch eine Decke zu<br />
kaufen, weil die Heizdeckenindustrie meiner Meinung nach<br />
eine mafiaähnliche Struktur aufweist. Ich stelle mir vor, wie<br />
der Vertrieb über Kaffeefahrten organisiert wird, um die Produkte<br />
zu Wucherpreisen in niedersächsischen Landgasthöfen<br />
an arme, vere<strong>ins</strong>amte Rentner zu verscherbeln, die dann auf<br />
Jahre hinaus verschuldet sind und sich schlimme Vorwürfe von<br />
ihren erwachsenen Kindern anhören müssen. Diese Bedenken<br />
h<strong>ins</strong>ichtlich des Kaufes einer Heizdecke und der damit verbundenen<br />
Unterstützung organisierter Kriminalität schilderte<br />
ich meinen neuseeländischen Freunden, die allerdings nicht<br />
den blassesten Schimmer hatten, wovon ich überhaupt redete.<br />
Dagegen habe ich bei mehreren weiblichen Freunden, die sich<br />
durchgerungen hatten, eine Heizdecke zu erwerben, erlebt, wie<br />
sich ihr Gesichtsausdruck verklärt verträumt veränderte, wenn<br />
sie begeistert von ihren Heizdecken und den nunmehr warmen<br />
Nächten sprachen. Da konnte man manch<strong>mal</strong> schon fast ein<br />
wenig eifersüchtig werden. Allerdings kann man Erstbenutzer<br />
mit haarsträubenden Geschichten über Leute verunsichern, die<br />
nachts in ihren Betten qualvoll verbrannten, weil eine defekte<br />
Heizdecke die Laken in Flammen gesetzt hatte. Das macht<br />
schon Spaß.<br />
Der Handel mit Heizlüftern und Heizkörpern, die simpel<br />
an eine Steckdose angeschlossen werden, ist ebenso lukrativ<br />
wie der Heizdeckenverkauf, und zwar nicht nur für die Hersteller,<br />
sondern vor allem für die Stromlieferanten. Unsere monatliche<br />
Stromrechnung hat sich in den Wintermonaten auf $ 250<br />
fast verdreifacht. Das Heizen mit diesen Methoden erfordert<br />
außerdem einen genau durchdachten Plan, wann welches Gerät<br />
wie lange eingeschaltet werden darf. Waschmaschine, Trockner<br />
und Heizlüfter zugleich geht schon <strong>mal</strong> gar nicht. Jede neuseeländische<br />
Sicherung fliegt einem da um die Ohren. Ebenso<br />
wenig funktioniert die Kombination mit der Spülmaschine<br />
oder einem Fön – ein Problem, das sich bei meiner Frisur<br />
zugegebenermaßen eher weniger stellt. So ist gerade in Wohngeme<strong>ins</strong>chaften<br />
mit mehreren Personen zunächst die Frage zu<br />
klären, wer wann nicht da ist und wer wann lieber friert, damit<br />
die Wäsche gewaschen werden kann. Irgendwie lässt sich aber<br />
auch dieses Problem kreativ lösen. Ich habe schon Austauschstudenten<br />
gesehen, die im Schlafsack (Komfortbereich 0 Grad)<br />
in ihren Wohnungen herumgehüpft sind, um sich vor der Kälte
80 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
81<br />
zu schützen. Das halte ich für etwas übertrieben, ein Schlafsack<br />
im Komfortbereich +10 Grad ist vollkommen ausreichend.<br />
Na gut, na gut, na gut, so schlimm ist es nun auch wieder<br />
nicht. Im Schnitt scheint an drei Tagen in der Woche die Welt<br />
unterzugehen und an den anderen vier lächelt die Sonne verführerisch,<br />
was sich allerdings innerhalb von zehn Minuten<br />
rapide ändern kann. Dann hat man dummerweise weder seine<br />
Regensachen noch ein warmes Fleece dabei und ärgert sich<br />
unglaublich, dass man wieder dem Wetterbericht vertraut hat,<br />
setzt sich fluchend aufs Motorrad und kommt durchweicht und<br />
halb gefroren zu Hause an. Aber die der Stadt so anhaftende<br />
Gelassenheit gewinnt mit der Zeit auch bei Zugezogenen die<br />
Oberhand und der immer beruhigende Gedanke, dass alles<br />
auch hätte schlimmer kommen können, holt einen zurück in<br />
die wunderbare Realität von Wellington: ich bin am besseren<br />
Ende der Welt, da kann ich auch <strong>mal</strong> nass werden und frieren.<br />
Camp am Mt Cook<br />
Mt Taranaki
82 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
83<br />
Cape Reinga, wo Pazifik und Tasmanische See zusammentreffen<br />
Auf der Halb<strong>ins</strong>el<br />
Coromandel<br />
Pflichtveranstaltung im<br />
Abel-Tasman-National-<br />
Park: Paddeln<br />
Am Milford Sound
136 Wo zum Teufel liegt Herbertville? Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
137<br />
Wellington begrüßte mich<br />
so, wie es mich verab-<br />
schiedet hatte, nämlich<br />
verregnet, und ich hatte das<br />
Gefühl, wieder zu Hause<br />
zu sein.<br />
Landes. Ich stellte das Motorrad ab und nahm mir den Tag Zeit,<br />
die Weingüter zu besuchen und ordentlich zu probieren. Der<br />
hässliche Hund vom Hunter-Weingut erinnerte mich wieder<br />
an das schon erwähnte <strong>Buch</strong> „Australasian Winery Dogs“ und<br />
lenkte mich von meinem ursprünglichen Vorhaben ab: fortan<br />
war ich weniger an der Qualität des Weines der besuchten Güter<br />
interessiert, als an den Hunden, die meist irgendwo gelangweilt<br />
im Schatten herumlungerten und sich so gar nicht von<br />
Hunden unterschieden, die nicht auf Weingütern leben. Der<br />
Hunter-Weingut-Hund kann allerdings der Legende nach den<br />
Säuregehalt der Trauben schmecken, und die Winzer machen<br />
ihren Wein erst, wenn der Hund nach einer Verköstigung<br />
zustimmend die Qualität bejault. Die Idee, daraus ein <strong>Buch</strong> zu<br />
machen, grenzt schon fast an Genialität.<br />
Nach den Weinguthunden folgte die Überfahrt zurück<br />
nach Wellington, die ein bisschen anstrengend war, weil ich<br />
eine besoffene Irin, die irgendwie Gefallen an meiner Gesellschaft<br />
gefunden hatte, nicht mehr loswurde und ich nicht den<br />
Mut hatte, sie über Bord zu werfen. Wellington begrüßte mich<br />
so, wie es mich verabschiedet hatte, nämlich verregnet, und ich<br />
hatte das Gefühl, wieder zu Hause zu sein.<br />
Where the f**k is Herbertville?<br />
Der Winter schien so langsam vorbei zu sein. Frühling lag in der<br />
Luft und außer der damit untrennbar verbundenen Freisetzung<br />
von Hormonen, die ein gesteigertes Interesse am jeweils anderen<br />
Geschlecht auslösen, wird auch das sogenannte Benzinhormon<br />
bei Motorradfahrern aktiviert. Der Plan war, geme<strong>ins</strong>am<br />
mit meinem langhaarigen, kurz vor dem Wahnsinn stehenden,<br />
tschechischen Freund Martin einen Kurztrip nach Castle Point<br />
und Herbertville an der Ostküste der Nord<strong>ins</strong>el, etwa drei bis vier<br />
Stunden von Wellington entfernt, zu unternehmen. Der Wahnsinnige,<br />
der Motorrad fährt, als hätte er Kerosin im Tank und<br />
eine Lunte als Zündung, musste sich erst ein Motorrad leihen. In<br />
Deutschland muss man zunächst sein Fahrzeug zulassen, versichern<br />
und die TÜV-Untersuchung passieren, bevor man endlich<br />
öffentliches Straßenland befahren darf. In diesem Zusammenhang<br />
möchte ich erwähnen, dass zielloses Umherfahren in<br />
Deutschland eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Zumindest hat<br />
mir das ein frischgebackener Jurist erzählt. Der TÜV heißt in<br />
Neuseeland „WOF“, Warrant of Fitness, und die Zulassung Registration,<br />
aber versichert muss man nicht sein, weil alle Unfallfolgen<br />
gesetzlich durch den Accident Compensation Act abgesichert<br />
sind. Das heißt, kein einziger Unfall landet vor Gericht. Die<br />
Anwaltslobby und Versicherungsindustrie haben lange und<br />
erfolglos gegen die Einführung dieser Regelung gekämpft.<br />
Martin kreuzte mit einer geliehenen, steinalten Honda Eliminator<br />
mit 98 Pferdestärken unter dem Hintern am verabredeten<br />
Treffpunkt auf. In der Eile war natürlich weder eine<br />
Zulassung noch ein WOF zu bekommen, sodass ein bisschen<br />
Dreck auf dem Nummernschild als Tarnung vor wachsamen<br />
Augen des Gesetzes ausreichen sollte.<br />
„Was machst du, wenn die Polizei dich anhält? Das kostet<br />
dich richtig Asche, ohne Rego und WOF zu fahren! Für die<br />
Strafe könnten wir das ganze Wochenende zwei Harleys mieten,<br />
und zwar neue!“<br />
Der Wahnsinnige, der<br />
Motorrad fährt, als hätte er<br />
Kerosin im Tank und eine<br />
Lunte als Zündung, musste<br />
sich erst ein Motorrad<br />
leihen.
138 Wo zum Teufel liegt Herbertville?<br />
Neuseeland – die Welt von unten gesehen<br />
139<br />
Castle Point<br />
Der Wahnsinnige ließ diesen aus meiner Sicht absolut<br />
berechtigten Einwurf nicht gelten und wischte ihn kurzerhand<br />
mit einem Totschlagsargument beiseite: „Hast du schon <strong>mal</strong><br />
versucht, einen fliehenden Tschechen auf einem 98 PS-Motorrad<br />
einzuholen? Eben!“<br />
Ich musste innerlich zugeben, dass ich angesichts der armseligen<br />
Fahrkünste neuseeländischer Kraftfahrer keinerlei<br />
Bedenken hatte, dass Martin aus einer eventuellen Verfolgung<br />
mit Renncharakter als eindeutiger <strong>Sie</strong>ger hervorgehen würde.<br />
Ich machte mir nur ernsthafte Sorgen um die Gesundheit der<br />
Polizisten und hoffte, dass im Fall der Fälle deren Ehrgeiz,<br />
Martin einzuholen, seine Grenze im fahrerischen Können<br />
finden würde. Auf dem Highway heraus aus der Stadt sah ich<br />
dann nur noch Rücklicht und Auspuffgase des motorisierten<br />
Anarchisten, für den Geschwindigkeitsbegrenzungen eine E<strong>ins</strong>chränkung<br />
der persönlichen Freiheit darstellen und daher<br />
geflissentlich ignoriert werden. Neuseeland ist ein extrem<br />
freies Land, aber schneller als 100 km/h zu fahren, ist nicht<br />
erlaubt. In manchen ländlichen Gebieten würde ich aufgrund<br />
der Straßenverhältnisse sogar das Fahren an dieser zulässigen<br />
Höchstgeschwindigkeitsgrenze als halsbrecherisches Risiko<br />
bezeichnen. Ich habe noch nie so viele Kreuze am Straßenrand<br />
gesehen wie hier, nicht ein<strong>mal</strong> auf Brandenburger Alleen. In<br />
einigen Gegenden hat man das Gefühl, über einen Friedhof zu<br />
fahren. In nahezu jeder Kurve steht ein Kreuz, geschmückt mit<br />
Blumen, Kerzen und Fotos der Opfer.<br />
Vor mir fuhr also jemand mit 160 km/h, als ob die Karre<br />
gestohlen wäre, in Richtung Nordosten. Mit der alten BMW<br />
ist alles über 120 km/h anstrengend, laut und unbequem.<br />
Deshalb genieße ich das Cruisen bei gemütlichen 80 bis<br />
100 km/h, denn ich will nicht als Letztes in meinem Leben<br />
Bremslichter vor mir sehen, oder Feuerwehrleute mit einem<br />
Schweißbrenner, die mir beruhigend zureden, obwohl sie es<br />
besser wissen. Ankommen ist die Prämisse, und da das Leben<br />
schnell vorbeigeht, muss ich mich nicht auch noch beeilen<br />
(Heinz Erhardt).<br />
Die erste Etappe führte uns nach Masterton in Wairarapa.<br />
Überraschenderweise machte die Stadt einen ziemlich lebendigen<br />
Eindruck und so entschlossen wir uns, eine kleine Kaffeepause<br />
einzulegen. Wir parkten die Maschinen vor dem Café<br />
und keine drei Sekunden später hatten wir einen Parkwächter<br />
an der Backe.<br />
„<strong>Sie</strong> können Ihre Motorräder hier nicht parken, hier ist<br />
absolutes Halteverbot.“<br />
Womit er zweifelsohne Recht hatte. Der Anarchist und ich<br />
beharrten aber darauf, dass die Motorräder doch niemanden,<br />
absolut niemanden stören würden. Der Parkfuzzi ließ sich aber<br />
nicht erweichen, zückte seinen kleinen Strafzettelblock und<br />
setzte sein offizielles Wenn-<strong>Sie</strong>-hier-nicht-wegfahren-gibt-eseinen-Strafzettel-Gesicht<br />
auf. Wir gaben uns geschlagen und<br />
parkten die Maschinen um die Ecke vor einem Modegeschäft,<br />
welches „Encore – Near New Clothing“ hieß. „Fast neue Kleidung“<br />
– die Übersetzung klingt ein bisschen merkwürdig,<br />
beschreibt aber genau das, was man in dem Laden kaufen<br />
konnte, nämlich Second-Hand-Kleidung. „Fast neu“ hört sich<br />
aber besser an als „gebraucht“. Wahrscheinlich hat die Ladeninhaberin<br />
einem Businessconsultant aus Auckland ein Heidenhonorar<br />
für dieses Marketingkonzept gezahlt. Vielleicht<br />
hat sie sich das aber auch selbst ausgedacht. Das angedachte<br />
Kaffeetrinken artete in eine Frühstücksschlemmerei aus, und<br />
mit dicken Bäuchen bestiegen wir nach einer Stunde wieder die<br />
Maschinen.<br />
„Martin, lass uns hier im Supermarkt noch ein paar fette<br />
Steaks für unser Barbecue und Bier und zwei Fläschchen Wein<br />
für heute Abend kaufen. Vielleicht bekommen wir in Castle<br />
Point nichts Ansprechendes.“<br />
Mart<strong>ins</strong> bedenkenloses Wegwischen meines Vorschlages<br />
sollte sich aber verdammt noch <strong>mal</strong> bald rächen.<br />
Von Masterton bis Castle Point an der Ostküste waren es<br />
noch gut 70 Kilometer, die durch hügeliges Farmland führten.<br />
Schafe, Schafe und noch<strong>mal</strong>s Schafe. Neugeborene Lämmer<br />
hüpften vergnügt und verspielt über die Weiden. Nor<strong>mal</strong>er-<br />
Von Masterton bis Castle<br />
Point an der Ostküste waren<br />
es noch gut 70 Kilometer,<br />
die durch hügeliges Farmland<br />
führten. Schafe, Schafe<br />
und noch<strong>mal</strong>s Schafe. Neugeborene<br />
Lämmer hüpften<br />
vergnügt und verspielt über<br />
die Weiden.