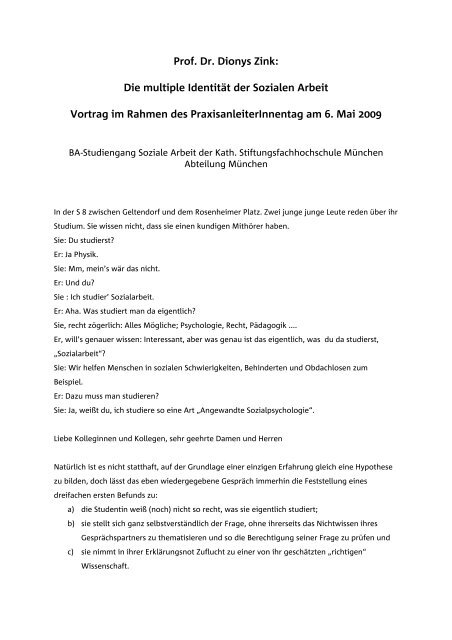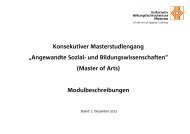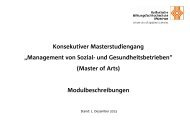Prof. Dr. Dionys Zink: Die multiple Identität der Sozialen Arbeit ...
Prof. Dr. Dionys Zink: Die multiple Identität der Sozialen Arbeit ...
Prof. Dr. Dionys Zink: Die multiple Identität der Sozialen Arbeit ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>:<br />
<strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
Vortrag im Rahmen des PraxisanleiterInnentag am 6. Mai 2009<br />
BA-Studiengang Soziale <strong>Arbeit</strong> <strong>der</strong> Kath. Stiftungsfachhochschule München<br />
Abteilung München<br />
In <strong>der</strong> S 8 zwischen Geltendorf und dem Rosenheimer Platz. Zwei junge junge Leute reden über ihr<br />
Studium. Sie wissen nicht, dass sie einen kundigen Mithörer haben.<br />
Sie: Du studierst?<br />
Er: Ja Physik.<br />
Sie: Mm, mein’s wär das nicht.<br />
Er: Und du?<br />
Sie : Ich studier’ Sozialarbeit.<br />
Er: Aha. Was studiert man da eigentlich?<br />
Sie, recht zögerlich: Alles Mögliche; Psychologie, Recht, Pädagogik ....<br />
Er, will’s genauer wissen: Interessant, aber was genau ist das eigentlich, was du da studierst,<br />
„Sozialarbeit“?<br />
Sie: Wir helfen Menschen in sozialen Schwierigkeiten, Behin<strong>der</strong>ten und Obdachlosen zum<br />
Beispiel.<br />
Er: Dazu muss man studieren?<br />
Sie: Ja, weißt du, ich studiere so eine Art „Angewandte Sozialpsychologie“.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren<br />
Natürlich ist es nicht statthaft, auf <strong>der</strong> Grundlage einer einzigen Erfahrung gleich eine Hypothese<br />
zu bilden, doch lässt das eben wie<strong>der</strong>gegebene Gespräch immerhin die Feststellung eines<br />
dreifachen ersten Befunds zu:<br />
a) die Studentin weiß (noch) nicht so recht, was sie eigentlich studiert;<br />
b) sie stellt sich ganz selbstverständlich <strong>der</strong> Frage, ohne ihrerseits das Nichtwissen ihres<br />
Gesprächspartners zu thematisieren und so die Berechtigung seiner Frage zu prüfen und<br />
c) sie nimmt in ihrer Erklärungsnot Zuflucht zu einer von ihr geschätzten „richtigen“<br />
Wissenschaft.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 2<br />
Wer unter uns war nicht schon einmal selbst in ähnlicher Verlegenheit?<br />
Kaum jemand aber stellt eine ähnliche Frage etwa an einen Physiker, einen Mediziner o<strong>der</strong><br />
Ingenieur und meist wohl würden diese und die Vertreter und vieler an<strong>der</strong>er Wissenschaften eine<br />
solche Frage auch mit dem Hinweis auf die Allgemeinbildung zurückgeben.<br />
Noch ehe also unser Thema zu Wort kommt, mag uns schon <strong>der</strong> Eindruck zu denken geben, es sei<br />
die Soziale <strong>Arbeit</strong> eine irgendwie studiengestützte Berufstätigkeit, die sich ständig nach ihrer<br />
<strong>Identität</strong> befragen lässt und selbst befragt – und damit zu erkennen gibt, dass sie noch immer –<br />
o<strong>der</strong> vielleicht sogar prinzipiell – nicht „bei sich“ ist.<br />
Recht komplex – das ist jetzt schon erkennbar - ist daher die Thematik, die zu bearbeiten ich<br />
deshalb mit gehörigem Respekt von den Verantwortlichen des PraxisanleiterInnentags<br />
übernommen habe. Ihr zu entsprechen, befinde ich mich – in den Jahren des Ruhestands ein<br />
wenig langsamer und bedächtiger geworden – heute vor Ihnen in einer Situation, die Ihnen im<br />
Beruf täglich begegnet, auf eine Anfor<strong>der</strong>ung nämlich spontan, nur gestützt auf die aktuell<br />
paraten Kenntnisse und Fertigkeiten, tätig zu werden. Bitte betrachten Sie also das Folgende in<br />
formaler Hinsicht als Versuch, Ihrer berufsalltäglichen Anfor<strong>der</strong>ung nahezukommen und dazu die<br />
mir verbliebenen Einsichtsressourcen zu nutzen.<br />
1. Der Begriff <strong>der</strong> <strong>Identität</strong><br />
Wenn in <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> von „<strong>Identität</strong>“ die Rede ist, dann öffnet sich in unserem<br />
Wissensgedächtnis meist und schnell die Schublade <strong>der</strong> Psychologie. Sie gibt uns Namen wie<br />
Erikson 1 (1) o<strong>der</strong> Taylor 2 (2) preis, Forscher also, die den Begriff vor allem in den Human- und<br />
Sozialwissenschaften populär gemacht haben.<br />
Dennoch ist er uralt und vor allem: Bestandteil einer Wissenschaft, die nicht nur in <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> ein eher staubiges Kellerdasein führt, <strong>der</strong> Logik nämlich.<br />
Dort ist von „<strong>Identität</strong>“ die Rede, wenn in einer Beziehung die vollkommene Übereinstimmung<br />
von etwas mit etwas – mathematisch ausgedrückt mit dem Gleichheitszeichen ( = ) – behauptet<br />
wird. Soll diese Behauptung nicht bloß Wie<strong>der</strong>holung desselben, also tautologisch, aber zugleich<br />
auch wi<strong>der</strong>spruchsfrei sein, so müssen ihre Glie<strong>der</strong>, obgleich durch alternative Hinsichten<br />
verschieden, dennoch dasselbe bezeichnen. Das ist zum Beispiel <strong>der</strong> Fall, wenn verschiedene<br />
Namen dieselbe Person bezeichnen, ein Subjekt sich durch seine Verän<strong>der</strong>ungen im Verlauf <strong>der</strong><br />
Zeit als „<strong>Die</strong>ses“ durchhält o<strong>der</strong> eine Gesellschaft unabhängig vom Wechsel ihrer Mitglie<strong>der</strong><br />
Bestand hat.<br />
L o g i s c h e <strong>Identität</strong> o<strong>der</strong> Wesensgleichheit liegt vor, wenn mehrere Seiende, also Dinge<br />
1 Erikson, Erik, <strong>Identität</strong> und Lebenszyklus, Frankfurt/M, 1966<br />
2 Taylor, Charles, Quellen des Selbst, Frankfurt/M, 1996
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 3<br />
o<strong>der</strong> Ereignisse, im selben Begriff zum Ausdruck kommen, z.B.: „Anna und Peter sind<br />
Menschen“. Von r e a l e r o<strong>der</strong> sachlicher <strong>Identität</strong> spricht man, wenn – umgekehrt – ein<br />
Seiendes mehrere Begriffe auf sich vereinigt: „Alle Menschen sind <strong>der</strong> Endlichkeit, also<br />
Sterblichkeit unterworfen“. I n t e n t i o n a l e <strong>Identität</strong> schließlich bezeichnet das existentielle<br />
Ausgerichtetsein eines Seienden auf ein ihm wesensgleich An<strong>der</strong>es, das ihm zugleich aber doch<br />
schon prinzipiell zugehört: die „Göttlichkeit <strong>der</strong> Seele“, zum Beispiel 3 .<br />
Aus dem Keller <strong>der</strong> Logik wie<strong>der</strong> ans Tageslicht gekommen, haben wir den Eindruck, es<br />
tauge vor allem die l o g i s c h e <strong>Identität</strong> zur weiteren Gewinnung eines angemessenen<br />
Verständnisses <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong>, jene <strong>Identität</strong> also, die in einem Begriff verschiedene Zustände<br />
o<strong>der</strong> Entfaltungen desselben versammelt. Folgt man dem damit eingeschlagenen Erkenntnisweg,<br />
dann ist, unter Beibehaltung des Begriffs <strong>der</strong> „<strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong>“ jetzt nach dem in ihren<br />
verschiedenen Facetten gleichwohl Eigentümlichen zu suchen.<br />
2. Suchrichtungen zur <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
Noch ehe wir freilich mit dieser Suche beginnen können, haben wir mit <strong>der</strong> alltagssprachlichen<br />
Schlamperei in unseren eigenen Reihen aufzuräumen, die im Begriff <strong>der</strong> „<strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong>“ keinen<br />
Unterschied macht zwischen dem praktischen Handlungsgefüge, seiner Organisation und den,<br />
beidem zugrundeliegenden Wissensbeständen, <strong>der</strong> S o z i a l a r -b e i t s w i s s e n s c h a f t also,<br />
die – genau genommen – allein doch nur Gegenstand und Inhalt eines entsprechenden Studiums<br />
sein kann. Unter <strong>der</strong> Voraussetzung dieser Differenzierung stellt sich dann zunächst also die Frage<br />
nach <strong>der</strong> <strong>Identität</strong> eben dieser spezifischen W i s s e n s c h a f t.<br />
2.1 Der wissenschaftstheoretische Zugang zur Sozialarbeitswissenschaft<br />
Zur Klärung <strong>der</strong> Eigenständigkeit einer Wissenschaft gebraucht die Wissenschaftstheorie bis auf<br />
den heutigen Tag die zwei Kriterien des Material- und Formalobjekts. Material bestimmt sie dabei<br />
den Gegenstand <strong>der</strong> zu prüfenden Wissensbestände; formal benennt sie den auswählenden Blick,<br />
unter dem dieser Gegenstand das Interesse <strong>der</strong> spezifischen Forschung und Lehre findet.<br />
Eigenständig ist daher eine Wissenschaft dann, wenn sie sich in wenigstens einem <strong>der</strong><br />
Objektbereiche von je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>en unterscheidet. Der Unterschied zwischen Physik und Chemie<br />
mag dies verdeutlichen: bei<strong>der</strong> Materialobjekt ist die Natur – die sie daher auch als<br />
Naturwissenschaften ausweist. Im Unterschied aber zur Physik, <strong>der</strong>en formaler Zugang zur Natur<br />
vom Interesse an ihren Energieformen bestimmt ist, beschäftigt sich die Chemie mit ihr unter <strong>der</strong><br />
3 vgl. de Vries, <strong>Identität</strong>, in: Brugger, Walter, Philosophisches Wörterbuch, Freiburg/Basel/Wien,<br />
(14) 1976, S. 177- 178 und Wagner, Tim, idion, in: Horn/Rapp, (Hg.) Wörterbuch <strong>der</strong> antiken<br />
Philosophie, München, 2002, S. 221
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 4<br />
formalen Bedingung ihrer stofflichen Beschaffenheit. Weil formal also unterschieden, können die<br />
beiden Wissenschaften tatsächlich selbständige genannt werden. .<br />
Zweifelsohne ist das Materialobjekt <strong>der</strong> Sozialarbeitswissenschaft <strong>der</strong> Mensch. Weil sie dieses<br />
aber auch mit an<strong>der</strong>en Wissenschaften teilt, muss sie sich deshalb, um als eigenständige<br />
Wissenschaft zu gelten, nunmehr in formaler Hinsicht von allen an<strong>der</strong>en mit dem Menschen<br />
befassten Wissenschaften unterscheiden. <strong>Die</strong>s gelingt, wie leicht ersichtlich, nicht mit den<br />
herkömmlichen Bestimmungen des <strong>Sozialen</strong>, <strong>der</strong> Erziehung <strong>der</strong> Bildung, <strong>der</strong> Resozialisierung o<strong>der</strong><br />
Rehabilitation und Ähnlichem. Lediglich <strong>der</strong> seinerseits zu klärende Begriff <strong>der</strong> „S o z i a l e n<br />
K o m p e t e n z“ scheint geeignet, die Sozialarbeitswissenschaft formal zu definieren und damit<br />
auch zu verselbständigen<br />
<strong>Die</strong> Sozialarbeitswissenschaft, so können wir jetzt sagen, ist jene<br />
Wissenschaft, die den Menschen zum Gegenstand hat, <strong>der</strong> in seinen unterschiedlichen<br />
Lebensverhältnissen und –beziehungen sozialer Kompetenzen und zu <strong>der</strong>en Erwerb beruflicher<br />
Hilfe bedarf.<br />
Wie die Medizin- und Ingenieurwissenschaften ist allerdings auch die Sozialarbeitswissenschaft<br />
eine im strengen Sinne theorielose Praxiswissenschaft, die mit ihrem Formalobjekt – <strong>der</strong> eben<br />
genannten beruflichen Hilfe zu sozialer Lebenskompetenz – bestimmte Teile einschlägiger<br />
Grundlagenwissenschaften auswählt, vereinigt und nutzt.<br />
2.2 Der historische Zugang zur <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> Sozialarbeitspraxis<br />
Auch wenn mit <strong>der</strong> beruflichen Hilfe zu sozialer Lebenskompetenz das Forschungs – und<br />
Lehrinteresse markiert werden kann, das die Sozialarbeitswissenschaft kennzeichnet, so haben wir<br />
damit zwar eine <strong>Identität</strong>sgrundlage auch für die praktische <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> entdeckt, doch bleibt<br />
<strong>der</strong> Eindruck, es sei gerade die Praxis eine zusätzliche, vielleicht sogar entscheidende Quelle, sie<br />
zusätzlich zu profilieren. Einem traditionellen Erkenntnisweg folgend, vergewissern wir uns daher<br />
jetzt ihrer Geschichte.<br />
<strong>Die</strong>se beginnt in Europa mit <strong>der</strong> Armenfürsorge <strong>der</strong> mittelalterlichen Städte, welche die religiöse<br />
Pflicht zum individuellen Almosen durch bürgerliche Mitverantwortung für die unverschuldet in<br />
Not Geratenen ergänzt. „Residuale Wohlfahrt“ – Restveranstaltung also – ist denn auch <strong>der</strong><br />
sozialwirtschaftliche Fachbegriff dieser Form <strong>der</strong> Unterstützung.<br />
Mit dem Aufkommen <strong>der</strong> Massenverelendung mit ihrer Landflucht und ihren, die Lebenskosten<br />
nicht mehr deckenden Niedriglöhnen zu Beginn <strong>der</strong> neuzeitlichen Industrialisierung gerät diese<br />
Organisationsform sozialer Hilfe jedoch an ihre Leistungsgrenze. Weil nunmehr prinzipiell je<strong>der</strong><br />
Bürger nicht mehr unter allen Umständen in <strong>der</strong> Lage ist, sein Leben aus eigener Kraft zu fristen<br />
und angemessen zu gestalten, wird diese Aufgabe zur öffentlichen Daseinsvorsorge des Staates,
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 5<br />
<strong>der</strong> sie dann auch folglich <strong>der</strong> Institutionalisierung unterwirft. Sie transformiert die bisher<br />
individuell erbetene Hilfe in einen öffentlich garantierten Anspruch; aus dem Almosen wird eine<br />
standardisierte Sozialleistung, die flächendeckend organisiert und mit Ordnungsprinzipien<br />
verknüpft, kaum mehr ehrenamtlich gewährt, son<strong>der</strong>n beruflich vermittelt wird.<br />
Im mo<strong>der</strong>nen Sozialstaat erfährt diese Entwicklung ihre Fortsetzung und Verdichtung durch eine<br />
ihm eigene Bürokratie. Mit ihren <strong>Arbeit</strong>sprinzipien <strong>der</strong> normierten Ausgangslagen, Vorgänge,<br />
Mittel und Zwecke, mit einem Instrumentarium also, das Max Weber diagnostisch<br />
„Maschinenförmigkeit“ nennt, begegnet diese Sozialbürokratie zwar den häufigsten sozialen<br />
Problemlagen, doch ist sie gerade aufgrund <strong>der</strong> ihr eigenen Prinzipien kaum in <strong>der</strong> Lage,<br />
diejenigen anzutreffen, die als vielfach darin verwickelte „Problemeigentümer“ <strong>der</strong> persönlichen<br />
Motivation, Vermittlung, Beratung und Begleitung bedürfen. In und zwischen <strong>der</strong><br />
sozialbürokratischen Leistung des Sozialstaates und den persönlichen Bedürfnissen und<br />
Kompetenzen seiner Hilfsbedürftigen wird es nunmehr einem neuen Beruf aufgetragen, die<br />
notwendigen sozialdiagnostischen und -praktischen Übersetzungsaufgaben zu bewältigen.<br />
Bis auf den heutigen Tag gehört es daher auch zur gesellschaftlichen Bestimmung <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>, sich vor allen sonstigen Hilfeagenturen immer neuen sozialen Problemen zu stellen, sie<br />
primärdiagnostisch und experimentell – praktisch aufzubereiten und sie für nachfolgende<br />
Spezialistenberufe zu erschließen. <strong>Die</strong> Beispiele dieser sozial – strategischen Funktion <strong>der</strong><br />
<strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> reichen von <strong>der</strong> frühen ambulanten Gesundheitshilfe über die <strong>Arbeit</strong> mit<br />
Suchtmittelabhängigen und chronisch Viruserkrankten bis zur Schulsozialarbeit.<br />
Nicht verwun<strong>der</strong>lich unter solchen Bedingungen ist dann die Tatsache – nur nebenbei sei dies<br />
bemerkt – , dass seine Angehörigen deshalb von allen, an ihrer <strong>Die</strong>nstleistung Interessierten als<br />
GrenzgängerInnen betrachtet und daher auch mit gewissem Argwohn bedacht werden. <strong>Die</strong>sen<br />
Umstand, gilt es beruflicherseits nicht permanent zu beklagen. Vielmehr ist ihm im offensiven<br />
Bewusstsein <strong>der</strong> Zugehörigkeit zu einem, die Sozialbürokratie überschreitenden und sozialfachlich<br />
unabdingbaren Diagnose-, Experimentier- und Zuweisungsberuf zu begegnen, mit dem<br />
Bewusstsein <strong>der</strong> Zugehörigkeit zu einem Beruf, dessen spezifischen Status es mit Kompetenz,<br />
Engagement und Gelassenheit zu repräsentieren und gegebenenfalls auch zu verteidigen gilt.<br />
Auch wenn dieser historische Rückblick recht skizzenhaft bleibt, so macht er doch auf ein<br />
zusätzliches Bestimmungsstück <strong>der</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> aufmerksam, die institu-tionell<br />
gebundene persönliche <strong>Die</strong>nstleistung mit gesellschaftlich immer nur vorläufiger Bestimmung. In<br />
Ergänzung zur Objektbestimmung <strong>der</strong> Sozialarbeitswissenschaft können wir daher – jetzt schon<br />
praxisnäher – sagen:<br />
Soziale <strong>Arbeit</strong> ist institutionell gebundene und prinzipiell vorläufige, persönliche <strong>Die</strong>nstleistung<br />
für Menschen, die in unterschiedlichen Lebensverhältnissen und –beziehungen sozialer<br />
Kompetenzen und zu <strong>der</strong>en Erwerb beruflicher Hilfe bedürfen.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 6<br />
Auch wenn es den Anschein hat, dass diese Formel das <strong>Identität</strong>sspektrum <strong>der</strong> beruflichen<br />
<strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> schon zur Genüge füllt, so zeigt eine weitere, nunmehr s o z i a l p o –<br />
l i t i s c h - s y s t e m a t i s c h e Perspektive ihre weitere Ergänzungsbedürftigkeit.<br />
2.3 Der sozialpolitisch - systematische Zugang zur <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
Mit ihrer Industrialisierung haben alle seither so genannten Gesellschaften auch ihr Wirtschaften<br />
weiterentwickelt und zur zunächst liberalen Marktwirtschaft ausgebaut. <strong>Die</strong>se gründet in <strong>der</strong><br />
Umwandlung prinzipiell nicht marktfähiger, weil nicht beliebig herstell- und vermehrbarer Dinge,<br />
<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> nämlich, des Bodens und auch <strong>der</strong> mit „Kapital“ bezeichneten Kaufkraft zu daher nur<br />
fälschlicherweise so genannten „Gütern“. Mit ihrer Entscheidung, diese Nicht – Güter einem Markt<br />
auszusetzen, haben sich diese Gesellschaften mehr o<strong>der</strong> weniger öffentlich darauf verständigt, die<br />
elementaren Lebensbedingungen des Menschen - mit seiner <strong>Arbeit</strong> sogar ihn selbst – dem „Spiel“<br />
von Angebot und Nachfrage auszusetzen. Unvermeidlich schädigt dieses „Spiel“ aber diejenigen,<br />
die auf diesen Märkten nichts – we<strong>der</strong> Boden, noch <strong>Arbeit</strong>, noch Geld – anzubieten haben. Ihre<br />
Boden-, <strong>Arbeit</strong>s- und Mittelllosigkeit macht sie daher wertlos im Marktgeschehen und reduziert<br />
damit zugleich ihre gesellschaftlichen Teilnahmechancen auf ein Minimum. Um überleben zu<br />
können, bedürfen solche Menschen demnach gesellschaftlicher Stützsysteme. <strong>Die</strong>se sind denn<br />
auch folgerichtig, doch bemerkenswerterweise allesamt außerökonomisch mit dem Zweck<br />
entstanden, die „Kolateralschäden“ <strong>der</strong> liberalen Marktwirtschaft zu kompensieren. In <strong>der</strong><br />
Transformation <strong>der</strong> liberalen zur sozialen Marktwirtschaft „erfindet“ daher die mo<strong>der</strong>ne<br />
Gesellschaft die allseits bekannten, die marktwirtschaftliche Erosion des Humanums begrenzen<br />
sollenden Agenturen und Instrumente: die Sozialversicherungen und Gewerkschaften gegen die<br />
Risiken auf dem <strong>Arbeit</strong>smarkt, die gesetzlichen Regelungen des Boden-, Wohnungs-, Erbschafts-<br />
und Steuerrechts gegen die Wucherungen auf dem Bodenmarkt, die öffentlichen monetären<br />
Steuerungswerke zur Erhaltung <strong>der</strong> Kaufkraft.<br />
Obgleich noch immer gewisse gesellschaftliche Teilsysteme die Fiktion aufrechterhalten, es<br />
genügten die eben genannten „Erfindungen“ zur Lebenssicherung <strong>der</strong> auf den drei Basismärkten<br />
aus welchen Gründen auch immer Benachteiligten, zeigt die bloße Existenz <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> –<br />
auch sie eine gesellschaftliche, wenn auch späte „Erfindung“ – eine zusätzliche Notlage auf, die<br />
wohl zutreffend als „m u l t i p l e“ zu kennzeichnen ist und daher von keiner <strong>der</strong> herkömmlichen<br />
Agenturen mit ihren speziellen Leistungsspektren und auftragsspezifischen Instrumenten allein<br />
zureichend bearbeitet werden kann. Ihr und ihren „Inhabern“ gerecht zu werden erfor<strong>der</strong>t, „von<br />
unten“ betrachtet, einen auf die Vielfältigkeit <strong>der</strong> Notlage gerichteten Handlungsansatz mit<br />
problemorientierten Verfahren, „von oben“ jedoch die integrative Nutzung <strong>der</strong> unterschiedlichen<br />
Systeme im Rahmen eines problemlösungsfähigen, i n t e n t i o n a l konstruierten Suprasystems<br />
o<strong>der</strong> schlicht: einer von „höherer“ Problemeinsicht und Lösungsperspektive getragenen und<br />
motivierten <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong>.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 7<br />
Auch dieser Befund gibt Anlass, die <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> zu modifizieren:<br />
Soziale <strong>Arbeit</strong> ist institutionell gebundene und prinzipiell vorläufige, persönliche <strong>Die</strong>nstleistung<br />
für Menschen, die sich in unterschiedlichen Lebensverhältnissen und –beziehungen in komplexen<br />
sozialen Problemlagen befinden, zu <strong>der</strong>en Bearbeitung sie beruflich vermittelter sozialer<br />
Kompetenzen und system- und maßnahmenintegrieren<strong>der</strong> Hilfe bedürfen.<br />
<strong>Die</strong>se Auskunft über die <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> nötigt uns schon zu einem gewissen Respekt.<br />
Dennoch gibt es noch immer eine Erkenntnisebene, die berücksichtigt zu werden verdient, die<br />
topologische nämlich.<br />
2.4 Der Zugang zur <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> über ihre Topologie<br />
Vergleichbar nur mit <strong>der</strong> <strong>Prof</strong>ession <strong>der</strong> Juristen, sind auch SozialarbeiterInnen beinahe „überall“<br />
tätig. Ihre Beschäftigungsweite reicht in <strong>der</strong> Tat vom Strafvollzug über den Gesundheitsdienst bis<br />
in die Jugend- und Erwachsenenbildung und weiter ins Organisationsmanagement. Kaum ein<br />
gesellschaftliches System kann offenbar auf sie verzichten. Auffällig ist dabei allerdings, dass<br />
dieser Beruf nicht zu den jeweils systemtypischen Berufen zählt: we<strong>der</strong> zu den Ärzten o<strong>der</strong><br />
PflegerInnen im Krankenhaus, noch zu den Juristen und Vollzugsbeamten im Strafvollzug, in den<br />
Kirchen nicht zu den Priestern, Pastoren, Diakonen o<strong>der</strong> Laientheologen, in den Schulen nicht zum<br />
Lehrpersonal.... die Reihe ließe sich nach Belieben fortsetzen. Wohl aber gehören sie in allen<br />
diesen Organisationen und Betrieben zu den, den jeweiligen Systemzweck ergänzenden und<br />
unterstützenden <strong>Die</strong>nstleistungsberufen. <strong>Die</strong>s trifft selbst in <strong>der</strong> öffentlichen Verwaltung zu, <strong>der</strong>en<br />
Primärzweck ja die Garantie <strong>der</strong> öffentlichen Ordnung ist. .<br />
Wie zu erwarten, folgt daher auch die Tätigkeit <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> nicht den, dem jeweiligen<br />
System typischen Aufgaben. Bezogen auf die s o z i a l e n B e g l e i t u m s t ä n d e <strong>der</strong><br />
eigentlichen Systemzwecke und die davon berührten Bedürfnisse und Kompetenzen <strong>der</strong><br />
KlientInnen, besteht ihre wenigstens dreifache Aufgabe in formaler Hinsicht zunächst darin,<br />
- den NutzerInnen des speziellen Systems dessen Angebote und Anfor<strong>der</strong>ungen zugänglich und<br />
sie damit vertraut zu machen;<br />
- die sozialen Hilfesysteme den Bedürfnissen ihrer NutzerInnen entsprechend zu gestalten und<br />
zu optimieren; und schließlich<br />
- <strong>der</strong>en <strong>Die</strong>nste im Einzelfall zu einem klienten- und problembezogenen Verbund zu<br />
koordinieren und komplexitätsreduziert einzusetzen.<br />
Ein weiteres Mal haben wir also Grund, die <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> zu modifizieren und in<br />
einer angemessen knappen Formel zusammenzufassen:
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 8<br />
Soziale <strong>Arbeit</strong> ist eine gesellschaftlich notwendige, institutionell gebundene und prinzipiell<br />
vorläufige, doch persönlich – professionelle <strong>Die</strong>nstleistung. Sie gilt Menschen, die in aktuellen<br />
Lebenslagen mit komplexen sozialen Problemen konfrontiert sind und daher system- und<br />
maßnahmenintegrieren<strong>der</strong> Hilfe bedürfen. In unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen,<br />
besteht ihre <strong>Die</strong>nstleistung daher in <strong>der</strong> Organisation und Gestaltung systemübergreifen<strong>der</strong><br />
Prozesse, die den Erwerb, die Optimierung und den Erhalt sozialer Kompetenz zum Ziel haben.<br />
Begreift man diese noch immer nicht ganz hinreichende <strong>Identität</strong>sbestimmung <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
doch immerhin als ein allgemeines Anfor<strong>der</strong>ungsprofil an eine entsprechende <strong>Prof</strong>ession, so<br />
ergibt sich daraus eine Konsequenz, die abschließend skizziert werden soll.<br />
3. Das generalistische Berufsbild <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
Unter dem Gesichtspunkt des Aufmerksamkeitsfeldes ihrer Wissenschaft und ihres Handlungsfelds<br />
unterscheiden sich <strong>Prof</strong>essionen in generalistische und spezialisierte. Während die meisten <strong>der</strong><br />
mo<strong>der</strong>nen Wissenschaften ihre großen, freilich auch mit gegenseitigen<br />
Verständnisschwierigkeiten erkauften Erfolge <strong>der</strong> Spezialisierung verdanken, bemühen sich einige<br />
wenige – von ihrer spezialisierten „Konkurrenz“ oftmals gar nicht als echte Wissenschaften<br />
gewürdigt – um die Wahrung einer umfassenden Sicht und Handlungsintention auf die ganze<br />
Wirklichkeit. „Generalistische“ Wissenschaften werden sie deshalb genannt. Ihre Eigentümlichkeit<br />
besteht darin, die Formalobjekte vieler Einzelwissenschaften auf ein einziges Materialobjekt hin<br />
zu vereinen und miteinan<strong>der</strong> zu integrieren. Ihnen entspricht daher auch eine Praxis, welche die<br />
Verfahren und Techniken <strong>der</strong> einzelwissenschaftlichen Praktiken kennt, koordiniert und<br />
zielführend einsetzt. Auch wenn <strong>der</strong> diesbezügliche Begriff <strong>der</strong> Militärwissenschaft entstammt, so<br />
benennt er doch diese integrative Praxis recht genau mit dem Wort „Strategie“, das ja in seiner<br />
ursprünglichen Bedeutung „Führung mit kluger Übersicht“ heißt.<br />
Erkenntnisgeleitete, unvoreingenommene und von diversen Interessen freie Einsicht kommt<br />
angesichts des bisher Vorgetragenen und zuletzt auch <strong>der</strong> realen beruflichen Tätigkeit <strong>der</strong><br />
SozialarbeiterInnen nicht umhin, <strong>der</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> eine – vielleicht ungewohnte –<br />
s t r a t e g i s c h e Komponente hinzuzufügen:<br />
1. Soziale <strong>Arbeit</strong> ist eine gesellschaftlich notwendige, institutionell<br />
garantierte, prinzipiell vorläufige und professionell angebotene<br />
persönliche <strong>Die</strong>nstleistung.<br />
2. Sie gilt Menschen, die in aktuellen Lebenslagen mit komplexen sozialen<br />
Problemen konfrontiert sind und daher system- und maßnahmen-<br />
integrieren<strong>der</strong> Hilfe bedürfen.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 9<br />
3. In unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen tätig, initiiert,<br />
organisiert, koordiniert und lenkt sie problembezogene individuelle und<br />
kollektive soziale Verän<strong>der</strong>ungsprozesse.<br />
4. <strong>Die</strong>se haben den Erwerb, die Optimierung o<strong>der</strong> den Erhalt sozialer<br />
Kompetenz zum Ziel.<br />
Das zugegeben jetzt doch recht komplex gewordene <strong>Prof</strong>il eines auf diese Weise bestimmten<br />
s t r a t e g i s c h e n Berufs liegt auf <strong>der</strong> Hand.<br />
Nicht Spezialisierung in einzelnen seiner Grundlagenwissenschaften darf ihn kennzeichnen,<br />
son<strong>der</strong>n die Kenntnis ihrer s o z i a l p r o b l e m r e l e v a n t e n Erklärungs-, Verstehens- und<br />
Handlungs p o t e n z e n. Solide Kenntnis <strong>der</strong> gesellschaftlichen O r g a n i s a t i o n e n und<br />
Instanzen <strong>der</strong> sozialen Hilfe, ihrer W i r k m e c h a n i s m e n vor allem, gehören ebenso zum<br />
Berufsbild strategisch verstandener Sozialer <strong>Arbeit</strong>, wie die unter allen, auch widrigen Umständen<br />
aktivierbare P h a n t a s i e zum Entwurf alternativer und zukunftsfähiger Perspektiven und<br />
Programme individueller und kollektiver Problemlösung.<br />
Für den Beruf <strong>der</strong>/des Sozialarbeiterin/Sozialarbeiters bedeutsamer noch als diese<br />
notwendigerweise ständig parat zu haltenden Wissensbestände, Fertigkeiten und Realutopien<br />
sind freilich die s t r a t e g i s c h e n Fähigkeiten<br />
• <strong>der</strong> systemischen Wahrnehmung und Analyse sozialer Wirklichkeit,<br />
• <strong>der</strong> umfassenden Bewertung ihrer Entwicklungs- und Behin<strong>der</strong>ungspotenzen,<br />
• <strong>der</strong> realistischen Zielsetzung und Hilfeplanung,<br />
• <strong>der</strong> Beschaffung und Integration ideeller, materieller, energetischer und prozessualer<br />
Ressourcen,<br />
• <strong>der</strong> überlegten und klugen Lenkung des Hilfeprozesses und<br />
• <strong>der</strong> kriteriengeleiteten Evaluation des Erreichten.<br />
Zwei <strong>der</strong> vielen möglichen Folgerungen aus diesem eher nur grob konturierten Anfor<strong>der</strong>ungs-<br />
profil 4 mögen die Eine o<strong>der</strong> den An<strong>der</strong>en unter uns jetzt erschrecken, weil sie einerseits die<br />
Berufsmentalität <strong>der</strong> SozialarbeiterInnen und zum an<strong>der</strong>en <strong>der</strong>en Ausbildung betreffen.<br />
Nicht die in einem „schönen“ Beruf ästhetisierte, idealisierte und auch vielfach gewünschte<br />
„Mitmenschlichkeit“ nämlich kann unter den aufgewiesenen Bedingungen und Folgerungen das<br />
Mentalitätszentrum <strong>der</strong> in <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> Handelnden sein, son<strong>der</strong>n die berufliche<br />
Befähigung von Partnern zu sozialkompetentem L e b e n s m a n a g e m e n t.<br />
4<br />
vgl. alternativ dazu das neue Berufsbild für Sozialarbeiterinnen des DBSH unter:<br />
http://www.dbsh.de/html/berufsbild.html
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 10<br />
Unabhängig davon sind auch in <strong>der</strong> Ausbildung die Gewichte zwischen den fachspezifischen<br />
Grundlagenwissenschaften und jenen Teilen des Studiums genauer zu tarieren, in denen die,<br />
einen strategischen Beruf kennzeichnenden K o m p l e x h a n d l u n g e n g e ü b t und<br />
wenigstens zu Basisroutinen entwickelt werden können. Zu denken ist in diesem Zusammenhang<br />
vor allem an die Modifikation <strong>der</strong> „Handlungslehre“, die bis dato zwischen Selbst- und<br />
Gruppenerfahrung sowie situationsdiagnostischer und handlungsentwerfen<strong>der</strong> Übung mehr o<strong>der</strong><br />
weniger spontanpraktisch oszilliert und damit den TeilnehmerInnen gerade die r a t i o n a l e<br />
Anstrengung und Einübung k o m p l e x e r Wahrnehmung und Handlung vorenthält.<br />
Zu einer umfassenden „Rhetorik <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong>“ zu ergänzen ist daneben aber auch die<br />
vorwiegend <strong>der</strong> Beratung gewidmeten „Gesprächsführung“, zu einer Rhetorik, die auch die<br />
Gesprächsformen <strong>der</strong> Meinungsbildung und Überzeugung, <strong>der</strong> Verteidigung und Durchsetzung,<br />
und – als „ideativ - praktische – wohl auch zum Beispiel <strong>der</strong> Anteilnahme und des Trostes zu<br />
Gegenständen hat.<br />
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren<br />
Mit <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>holung meiner Vorbemerkung über meine nach etlichen Jahren des Ruhestands<br />
nur noch begrenzten Kenntnisse <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> und ihrer Ausbildung beende ich meinen<br />
Vortrag. Nicht nur aus Altersgründen, son<strong>der</strong>n vor allem aus <strong>der</strong> Haltung eines wissenschaftlich<br />
Interessierten erinnere ich mich gerne an den jeweils letzten Satz eines akademischen Lehrers<br />
zum Ende je<strong>der</strong> seiner Lehrveranstaltungen: „Wer’s besser weiß, tritt vor und teilt’s mit!“<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong><br />
6.5.2009
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 11<br />
Vorläufige <strong>Identität</strong>sformeln <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
1. Sozialarbeitswissenschaft ist jene Wissenschaft, die den<br />
Menschen zum Gegenstand hat, <strong>der</strong> in seinen<br />
unterschiedlichen Lebensverhältnissen und –<br />
beziehungen sozialer Kompetenzen und zu <strong>der</strong>en<br />
Erwerb beruflicher Hilfe bedarf.<br />
2. Soziale <strong>Arbeit</strong> ist institutionell gebundene und<br />
prinzipiell vorläufige, persönliche <strong>Die</strong>nstleistung für<br />
Menschen, die in unterschiedlichen Lebensverhältnissen<br />
und –beziehungen sozialer Kompetenzen und zu <strong>der</strong>en<br />
Erwerb beruflicher Hilfe bedürfen.<br />
3. Soziale <strong>Arbeit</strong> ist institutionell gebundene und<br />
prinzipiell vorläufige, persönliche <strong>Die</strong>nstleistung für<br />
Menschen, die sich in unterschiedlichen<br />
Lebensverhältnissen und –beziehungen in komplexen<br />
sozialen Problemlagen befinden, zu <strong>der</strong>en Bearbeitung<br />
sie beruflich vermittelter sozialer Kompetenzen und<br />
system- und maßnahmenintegrieren<strong>der</strong> Hilfe bedürfen.<br />
4. Soziale <strong>Arbeit</strong> ist eine gesellschaftlich notwendige,<br />
institutionell gebundene und prinzipiell vorläufige, doch<br />
persönlich – professionelle <strong>Die</strong>nstleistung. Sie gilt<br />
Menschen, die in aktuellen Lebenslagen mit komplexen<br />
sozialen Problemen konfrontiert sind und daher system-<br />
und maßnahmenintegrieren<strong>der</strong> Hilfe bedürfen. In<br />
unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen besteht<br />
ihre <strong>Die</strong>nstleistung daher in <strong>der</strong> Organisation und<br />
Gestaltung systemübergreifen<strong>der</strong> Prozesse, die den<br />
Erwerb, die Optimierung und den Erhalt sozialer<br />
Kompetenzen zum Ziel haben.
<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Dionys</strong> <strong>Zink</strong>: <strong>Die</strong> <strong>multiple</strong> <strong>Identität</strong> <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong> 12<br />
<strong>Die</strong> <strong>Identität</strong>sformel <strong>der</strong> <strong>Sozialen</strong> <strong>Arbeit</strong><br />
- ein Vorschlag -<br />
1. Soziale <strong>Arbeit</strong> ist eine gesellschaftlich notwendige,<br />
institutionell garantierte, prinzipiell vorläufige und<br />
professionell angebotene persönliche <strong>Die</strong>nstleistung.<br />
2. Sie gilt Menschen, die in aktuellen Lebenslagen mit<br />
komplexen sozialen Problemen konfrontiert sind und<br />
daher system- und maßnahmenintegrieren<strong>der</strong> Hilfe<br />
bedürfen.<br />
3 In unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen tätig,<br />
initiiert, organisiert, koordiniert und lenkt sie<br />
problembezogene individuelle und kollektive soziale<br />
Verän<strong>der</strong>ungsprozesse.<br />
4 <strong>Die</strong>se haben den Erwerb, die Optimierung o<strong>der</strong> den<br />
D. <strong>Zink</strong><br />
6.5.09<br />
Erhalt sozialer Kompetenz zum Ziel.