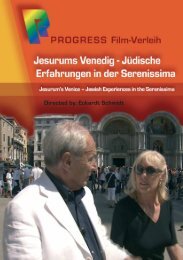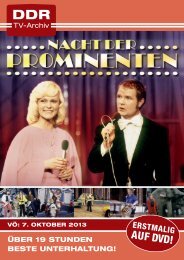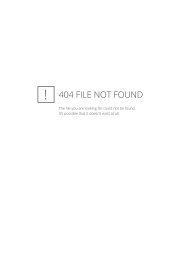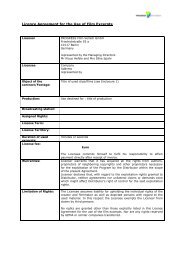Presseheft als PDF - PROGRESS Film-Verleih
Presseheft als PDF - PROGRESS Film-Verleih
Presseheft als PDF - PROGRESS Film-Verleih
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
J E D E R M A N N S F E S T<br />
KLAUS MARIA BRANDAUER<br />
und JULIETTE GRÉCO<br />
IN EINEM FILM VON<br />
FRITZ LEHNER<br />
Eine Produktion der WEGA-<strong>Film</strong><br />
in Koproduktion mit<br />
Studio Babelsberg,<br />
Star Production und<br />
Westdeutscher Rundfunk.<br />
im Progress <strong>Film</strong>-<strong>Verleih</strong><br />
Burgstraße 27, 10178 Berlin<br />
Fon: 030 – 24 00 34 –00/- 01/-02/<br />
Fax: 030 – 24 00 34 - 99<br />
e-mail: s.geerdts@progress-film.de<br />
Presse Fon: 030 – 24 00 34 –71<br />
Presse Fax: 030 – 24 00 34 –79<br />
e-mail: i.pengel@progress-film.de<br />
www.progress-film.de
J E D E R M A N N S F E S T<br />
Spielfilm von Fritz Lehner mit Klaus Maria Brandauer und Juliette Gréco<br />
Super 35 mm, Farbe; 1:2,35; 24 Bilder /sec; Lichtton; 4.741m; 173 min<br />
DARSTELLER<br />
Jan Jedermann KLAUS MARIA BRANDAUER<br />
Yvonne Becker JULIETTE GRÉCO<br />
Sophie SYLVIE TESTUD<br />
Daniel REDBAD KLYNSTRA<br />
Cocaine VERONIKA LUCANSKA<br />
Isabelle ALEXA SOMMER<br />
Maria SUSAN LYNCH<br />
Jurek PIOTR WAWRZYNCZAK<br />
Jedermanns Vater OTTO TAUSIG<br />
Gerry Benning JIM RAKETE<br />
TV-Journalistin CAROL CAMPBELL<br />
Salome ELLEN UMLAUF<br />
MODELS<br />
PAULINA POPELLO PILAR FANTOVA<br />
NATASA MILKOVIC DAGMAR JAZUDEKOVA<br />
KATRIN LASKOWSKA MILVA SPINA<br />
ALICE MEIRINGER SONNET HART<br />
SIMONIDA SELIMOVIC KRISTA CASSIDY<br />
NINA ERBER MARTINA FELLINGER<br />
LUCIE NEDORNOVA IVETA PORTELOVA<br />
BRIGITTE RÖSSL KATRINA SOVIKOVA<br />
ANNA UHLICH-TREUBORN GABRIELA WINTERSTEINER<br />
OPERNBALLETT<br />
MITGLIEDER DES WIENER STAATSOPERNBALLETTS<br />
Junge Salome DAGMAR KRONBERGER<br />
Hirumi MY-HA FORBERGER<br />
Chefkellner KA-TROUC LAU<br />
Vietnamesische Kellnerin HIEN HOANG, CLAUDIA NGUYEN<br />
Vietnamesischer Kellner VAN LONG NGUYEN, BA TOAN NGUYEN<br />
Vietnamesische Köchin HANH HOANG, PHAN TUYET-NHUNG,<br />
MUNG DHI DINGH<br />
Vietnamesischer Koch LA VAN PHUONG; VAN LIN NGUYEN<br />
Konditor GARCIA CARLOS<br />
2
STAB<br />
DREHBUCH & REGIE FRITZ LEHNER<br />
KAMERA GERNOT ROLL bvk, WOLFGANG TREU bvk<br />
STEADICAM MIKE BARTLETT, MICHAEL REINECKE<br />
VIDEOKAMERA JERZY PALACZ<br />
PLAKAT-& STANDFOTOGRAF JIM RAKETE<br />
SCHNITT TANJA SCHMIDBAUER,<br />
JUNO SYLVA ENGLANDER<br />
PRIMÄRTON MICHAEL ETZ, HEINZ EBNER,<br />
MOHSAN NASIRI<br />
AUSSTATTUNG ANNA PRANKL<br />
MAKE UP SUPERVISING GINO ZAMPRIOLI<br />
MAKE UP GAIA BANCHELLI<br />
KOSTÜM ULI FESSLER<br />
REGIEASSISTENZ ULI DICKMANN, ANTON MARIA AIGNER<br />
GÜNTHER RUCKDESCHEL<br />
CASTING RISA KES<br />
MUSIK PETER PONGER<br />
CHOREOGRAPHIE RENATO ZANELLA<br />
PRODUKTIONSLEITUNG MICHAEL KATZ<br />
BERNHARD SCHMATZ<br />
HERSTELLUNGSLEITUNG CHRISTINE ROTHE<br />
CO-PRODUZENTEN STUDIO BABELSBERG<br />
VOLKER SCHLÖNDORFF<br />
STAR PRODUCTION<br />
RENÉ LETZGUS<br />
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK<br />
MARTIN WIEBE, MICHAEL ANDRÉ<br />
AUSFÜHRENDER PRODUZENT WEGA-FILMPRODUKTION<br />
VEIT HEIDUSCHKA<br />
Hergestellt mit Unterstützung von ORF <strong>Film</strong>/Fernseh-Abkommen<br />
Wiener <strong>Film</strong> Fonds<br />
Österreichisches <strong>Film</strong> Institut<br />
Eurimages<br />
Niederösterreich Kultur<br />
Abteilung Kultur und Wissenschaft und<br />
Abteilung Tourismus des Amtes der NÖ Landesregierung<br />
Aktionsplan 16:9 der Europäischen Union<br />
3
Synopsis<br />
„Der Stoff ist kostbar von dem Spiel, Dahinter aber liegt noch viel,<br />
Das müßt ihr zu Gemüt führen Und aus dem Inhalt die Lehr ausspüren.“<br />
(Spielansager)<br />
Der Wiener Modeschöpfer „JM“ Jan Jedermann (Klaus Maria Brandauer) hat fast alles,<br />
was sein Herz begehrt. Schöne Frauen, der notwendige Assistent im Hintergrund und ein<br />
schneller Wagen stehen für seinen Erfolg.<br />
Die letzte Stufe seiner Karriereleiter sieht er sich schon erklimmen. Den Schlüssel zu<br />
seinem Triumph hält Yvonne Becker (Juliette Gréco), Göttin der Mode und Verkörperung<br />
von „Tout Paris“, in der Hand. Doch nicht nur Jan Jedermann buhlt um die Gunst<br />
von Paris, auch seine Models auf dem Laufsteg drängen den Gast wie einst in der antiken<br />
Sage zu einem Urteil über ihre Schönheit.<br />
Auf dem Dach der altehrwürdigen Wiener Oper inszeniert der exzentrische Jedermann<br />
eine Modeschau, mit der er willentlich den Skandal sucht. Auffallen um jeden Preis gelingt<br />
ihm dieses Mal mit dem betörenden Tanz der Salome (Ellen Umlauf/ Dagmar Kronberger).<br />
Ganz im Bann von Erotik und Sinnlichkeit erschrickt das Publikum am Ende der<br />
Vorstellung über die eigene Täuschung: Hinter Salomes Schleier verbirgt sich ein alter,<br />
faltiger Körper. Salomes Gehilfinnen reichen der jubelnden Menge den wächsernen Kopf<br />
des Couturiers.<br />
„Ich geb Ehr, wem Ehr gebühr,<br />
Und läster nicht wo ich die Macht verspür“<br />
(Jedermann)<br />
Anlässlich seines größten Triumphs lädt Jan Jedermann seine „Familie“ zu einem intimen<br />
Fest in den eigenen Lustgarten außerhalb der Stadttore Wiens ein. Allerdings sind die<br />
Models und der Assistent, „der kleine Daniel“ (Redbad Klynstra), nicht mehr <strong>als</strong> bloße<br />
Staffage für den eigentlichen Gast Yvonne Becker.<br />
Doch das Schicksal durchkreuzt Jedermanns Lebenspläne. Auf dem Weg zu seinem Fest<br />
verunglückt der Modemacher bei einem Ausweichmanöver. Er schießt über Leitplanke<br />
und Gestrüpp hinaus und landet mit seinem roten Ferrari mitten im Dreck, in einem ölverschmierten<br />
Löschteich der nahen Raffinerie. Der Tod begegnet ihm <strong>als</strong> ein räudiger<br />
Hund.<br />
„Soll ich aus dieser Erdenwelt Hinaus, und kein Geleite haben?<br />
Und war doch hier niem<strong>als</strong> allein, mußt allerwegen gesellig sein.“<br />
(Jedermann)<br />
In diesem Moment hat Jedermann Zeit, über sein Leben nachzudenken.<br />
Und sein Fest geht weiter...<br />
Nur diese eine Nacht, ohne die sein Leben nur die Hälfte wert ist, bettelt der Todgeweihte<br />
erfolgreich dem Tod ab. So macht sich Jedermann auf die Suche.<br />
In dem Glashaus seines Gartens versammeln sich die Gäste um Jedermann zu einem<br />
aufwändigen und exotischen Mahl. Doch Yvonne Becker lässt auf sich warten.<br />
Jan Jedermann betrachtet das Treiben um sich mit distanziertem Blick und zieht sich zurück<br />
auf sein eingerüstetes Schloss, in dem Luxus und marode Bausubstanz, Marmor,<br />
Gold und Dreck nahe beieinander liegen.<br />
4
„Der Mann kommt in Turm, da mag nichts frommen,<br />
Dem Weib gewähr ich ein Unterkommen, Und was sie nötig hat zum Leben“<br />
(Jedermann)<br />
Hier in seiner Schutzhöhle lässt er einige<br />
Lebensetappen Revue passieren. Hier kommt es<br />
auch zu einer Begegnung mit dem polnischen<br />
Liebespaar Jurek (Piotr Wawrzynczak) und Maria<br />
(Susan Lynch), das er für seine<br />
Parfümwerbekampagne <strong>als</strong> schockierendes<br />
Beiwerk gebraucht hat. Während er den Mann in<br />
den Tod drängen will, möchte er Maria <strong>als</strong> sein<br />
„Neues Gesicht“, <strong>als</strong> eine Figur mit dem Hauch<br />
eines Tiers aufbauen und plant erneut den Erfolg<br />
durch schockierendes Gebaren. Dieser kurze<br />
Augenblick einer Zukunftsperspektive zerrinnt ihm unter seinen Händen, denn das Paar<br />
macht sich davon und begeht gemeinsam Selbstmord.<br />
„Es hieß: Solang einer im Glück ist, Der hat Freunde die Menge,<br />
Doch wenn ihm das Glück den Rücken kehrt, Dann verläuft sich das Gedränge.“<br />
(Jedermann)<br />
Endlich erscheint die inständig erwartete Yvonne Becker, die jedoch missgestimmt ist, da<br />
sie sich provoziert fühlt und die Figur der alten Salome <strong>als</strong> kleine, aber feine Anspielung<br />
auf ihre Person wertet. Jedermann hofft, seine letzten Stunden so zu feiern, dass sie<br />
keiner jem<strong>als</strong> vergessen kann. Doch der Star des Abends macht ihm einen Strich durch<br />
seine Rechnung und so sitzt er am Ende allein mit der jungen Krankenschwester Sophie<br />
(Sylvie Testud), die sein alter Vater (Otto Tausig) <strong>als</strong> Vertretung auf das Fest geschickt<br />
hat. Jedermann muss das Misslingen seiner ehrgeizigen Pläne hinnehmen: Niemandem<br />
wird Jedermann nach seinem Tod fehlen, aber auch Jedermann selbst wird niemand fehlen.<br />
„Ihr Freunde, ich mein, wir gehen selbdritt,<br />
Von euch will ich mich scheiden nit.“<br />
(Jedermann)<br />
Nachdem für Jedermann auch Sophie <strong>als</strong> Geleit in den Tod nicht in Frage kommt, rast er<br />
mit seinem Ferrari in das Unausweichliche, wohlwissend, dass seine geliebte Isabella,<br />
sein Model (Alexa Sommer) und sein Freund Gerry, der Fotograf (Jim Rakete) zur verabredeten<br />
Zeit an entsprechendem Ort erscheinen werden. Zur blauen Stunde im Morgenlicht<br />
fotografiert Gerry Isabella <strong>als</strong> schwarze Braut neben dem verunglückten Jan Jedermann<br />
vor dem Hintergrund der Industriesilhouette.<br />
Mit „Mein Gott, das ist Sex!“ und den Auftrag an Isabella, den Toten <strong>als</strong> das neue Gesicht<br />
zu vermarkten, verabschiedet sich Jan Jedermann aus dem Leben.<br />
Die Zitate entstammen dem „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal.<br />
5
Regisseur<br />
Fritz Lehner (* 1948 in Freistadt/Österreich)<br />
Von 1970 bis 1975 besuchte Fritz Lehner die Wiener<br />
<strong>Film</strong>akademie. Er selbst bezeichnete es <strong>als</strong> sein Glück,<br />
dass er mit dem <strong>Film</strong>emachen anfing, <strong>als</strong> der<br />
österreichische Fernsehfilm seine Hochblüte hatte.<br />
Aufgrund der dam<strong>als</strong> herrschenden Produktionsbedingungen<br />
gehört Lehner zu der Generation von<br />
österreichischen Regisseuren, für die der Fernseh- und<br />
nicht der Kinofilm Arbeitsalltag war. In den<br />
Produktionen im Auftrag des ORF hat er sich einen<br />
Namen <strong>als</strong> eigenwilliger, bild- und stimmungsbetont<br />
erzählender Regisseur und Drehbuchautor gemacht.<br />
Um die Authentizität seiner <strong>Film</strong>e zu steigern, arbeitete<br />
Lehner auch mit Laiendarstellern, deren Dialoge frei formuliert waren.<br />
FILMOGRAFIE<br />
1988 „Notturno“, Schuberts letzte Jahre, Kinofassung, (A/F), mit: Udo Samel und Monika Bleibtreu<br />
1986 „Mit meinen heißen Tränen“, Schubert-Trilogie, Fernsehfassung, (A/BRD/CH), Buch und<br />
Regie, mit Udo Samel<br />
1981 „Schöne Tage“, (A)<br />
1978 „Der Jagdgast“, (A), mit: W. Berger<br />
1977/1982/1983 „Das Dorf an der Grenze“ (A), Fernsehdokumentarspiel (drei Teile), mit: Monika<br />
Bleibtreu<br />
1977 „Sprachgestört“, (A), Kurzfilm mit Laiendarstellern<br />
1977 „Edwards <strong>Film</strong>“, Buch und Regie<br />
1976 „Freistadt“, (A), <strong>Film</strong>essay<br />
1976 „Der große Horizont“, Buch und Regie<br />
AUSZEICHNUNGEN<br />
2002 Diagonale in Graz, Bester österreichischer <strong>Film</strong> für „Jedermanns Fest“<br />
1999 Landeskulturpreis Oberösterreich für <strong>Film</strong><br />
1993 Landeskulturpreis Oberösterreich für Literatur<br />
1989 Goldene Kamera, D, für „Notturno“<br />
1989 Festival von Barcelona: Best Actor Award für „Mit meinen heißen Tränen“<br />
1986 Fernsehpreis der Österreichischen Volksbildung<br />
1986 Adolf-Grimme-Preis in Gold<br />
1983 Prix Italia, Premio Speciale für Teil 3 von „Das Dorf an der Grenze“<br />
1983 Fernsehspielpreis der Deutschen Akademie der darstellenden Künste für „Schöne Tage“<br />
1983 Adolf-Grimme-Preis in Gold für „Schöne Tage“<br />
1982 Prix Italia der RAI für „Schöne Tage“<br />
1980 Erich-Neuberg-Nachwuchspreis für „Das Dorf an der Grenze“<br />
1979 Fernsehpreis der Österreichischen Volksbildung für „Das Dorf an der Grenze“<br />
6
Darsteller<br />
Klaus Maria Brandauer (* 1944 in Altaussee/Oberösterreich)<br />
Klaus Maria Brandauer gehört zu den wenigen<br />
deutschsprachigen Schauspielern, die auf der internationalen<br />
Bühne Anerkennung finden. Nach einer klassischen<br />
Schauspielausbildung erlebte er seinen weltweiten<br />
Durchbruch 1981 in der Rolle des Hendrik Höfgen in<br />
„Mephisto“, der 1982 <strong>als</strong> bester ausländischer <strong>Film</strong> mit<br />
einem „Oscar“ ausgezeichnet wurde. 1984 mimte Brandauer<br />
den Bösewicht und Gegenspieler von Sean Connery in dem<br />
James-Bond-Streifen ”Never Say Never Again”. 1985 spielte<br />
er den ungeliebten Ehemann der Heldin in Sidney Pollacks<br />
<strong>Film</strong> ”Out of Africa". Wichtig blieb für ihn die Zusammenarbeit<br />
mit seinem Freund, dem Regisseur Szabó, mit dem er ”Oberst Redl” (1985) und ”Hanussen”<br />
(1987) drehte. Zusammen mit ”Mephisto” bildeten diese <strong>Film</strong>e eine ”Deutsche Trilogie” um<br />
das Porträt von karrieresüchtigen Emporkömmlingen in einem autoritären Staatsgefüge.<br />
Heute gilt Brandauer nach zahlreichen Erfolgsfilmen <strong>als</strong> eine nicht wegzudenkende Größe des<br />
deutschsprachigen Theaters und des internationalen Kinos. Die Rolle des Jedermann war für ihn<br />
vertrautes Terrain, da er schon in den Jahren 1983 bis 1989 den Jedermann während der Salzburger<br />
Festspiele gab. 1991 verfasste Brandauer seine Autobiografie mit dem Titel „Das schwerste<br />
ist am leichtesten“.<br />
Klaus Maria Brandauer ist Ehrendoktor der Universität Tel Aviv und unterrichtet <strong>als</strong> Professor für<br />
Rollengestaltung am Max-Reinhardt-Seminar der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in<br />
Wien.<br />
FILMOGRAFIE (Schauspieler)<br />
2001 „Between Strangers“, (USA), R: Edoardo Ponti, mit: Sophia Loren und Gerard Depardieu<br />
2000 „Druids“, (F/C), R: Jacques Dorfman, mit: Christoph Lambert und Max von Sydow<br />
1999 „Introducing Dorothy Dandridge“, (USA), R: Martha Coolidge, mit Halle Berry und Brent Spiner<br />
1999 „Die Bibel: Jeremia“, (D/I/USA), R: Harry Winer, mit: Patrick Dempsey und Oliver Reed<br />
1994 „Mario und der Zauberer“, (D), R: Klaus Maria Brandauer, mit: Julian Sands und Anna Galiena<br />
1992 „Colette“, (D/GB/F), R: Danny Huston, mit: Mathilda May und Virginia Madson<br />
1990 „Das Russlandhaus“, (USA), R: Fred Schepisi, mit: Sean Connery und Michelle Pfeiffer<br />
1989 „Das Spinnennetz“, (D/A/I), R: Bernhard Wicki, mit: Ulrich Mühe und Andrea Jonasson<br />
1989 „Georg Elser – Einer aus Deutschland“, (D), R: Klaus Maria Brandauer,<br />
mit: Brian Dennehy und Rebecca Miller<br />
1988 „Hanussen“, (D/U), R: István Szabó, mit: Erland Josephson und Grazyna Szapolowska<br />
1985 „Jenseits von Afrika“, (USA), R: Sydney Pollack, mit: Robert Redford und Meryl Streep<br />
1984 „Oberst Redl“, (D/U/A), R: István Szabó, mit: Armin Mueller-Stahl und Gudrun Landgrebe<br />
1983 „Sag niem<strong>als</strong> nie“, (USA), R: Irvin Kershner, mit: Sean Connery und Kim Basinger<br />
1981 „Mephisto“, (U/D/A), R: István Szabó, mit: Rolf Hoppe und Martin Hellberg<br />
1979 „Ein Sonntag im Oktober“, (U/D), R: Andras Kovacs, mit: Ferenc Bacs und Martin Lüttge<br />
1971 „Salzburg Connection“, (USA), R: Lee H. Katzin, mit: Barry Newman und Udo Kier<br />
„Rembrandt“, (F/D/N), R: Charles Matton, mit: Romane Bohringer und Jean Rochefort<br />
AUSZEICHNUNGEN<br />
2000 „Joseph-Krainer-Preis“<br />
1993 „Magdeburger Otto“ der Internationalen <strong>Film</strong>festtage Magdeburg<br />
1990 Deutscher <strong>Film</strong>preis, <strong>Film</strong>band in Gold für die darstellerischen Leistungen in „Georg Elser“<br />
und in „Spinnennetz“<br />
1986 Golden Globe (USA) für die Rolle in „Out of Africa“<br />
1985 Deutscher <strong>Film</strong>preis, <strong>Film</strong>band in Gold für die darstellerischen Leistungen <strong>als</strong> „Oberst Redl“<br />
1983 Bambi Bild und Funk<br />
1982 Oscar Academy Awards <strong>als</strong> bester fremdsprachiger <strong>Film</strong> und höchste italienische Auszeichnung,<br />
David-di-Donatello-Preis, für den besten ausländischen <strong>Film</strong>, für „Mephisto“<br />
1981 Prix de la Critique Internationale (F.I.P.R.E.S.C.I.) und Prix du scénario in Cannes für „Mephisto“<br />
1981 Jussi-Preis der finnischen <strong>Film</strong>akademie für die Darstellung des Höfgen in „Mephisto“<br />
7
Juliette Gréco (* 1927 in Montpellier/Frankreich)<br />
Nur Könige und bedeutende Persönlichkeiten erhalten<br />
Beinamen, die auf ihren außergewöhnlichen Stellenwert<br />
hinweisen. Juliette Gréco, die mit ihrer tiefen, samtigen<br />
Stimme, die „Grande Dame des Chanson“, kann viele<br />
Ehrenbezeichnungen ihr Eigen nennen: „Muse und Königin<br />
der Existenzialisten“, „Schwarze Rose von St.-<br />
Germain“, „Schwarze Sonne von Paris“. Alle nehmen Bezug<br />
auf das über fünfzigjährige, erfolgreiche Bühnenleben,<br />
das an der Pariser Rive Gauche, in den Kellerlokalen<br />
von St-Germain-des-Prés begann. Dort entdeckten die<br />
französischen Existentialisten sie <strong>als</strong> Muse, machten ihr<br />
Albert Camus und Jean-Paul Sartre Mut, Chansons zu<br />
singen. Beide schrieben Texte für sie, aber auch berühmte<br />
Autoren wie Jean Cocteau, Jacques Prevert und Serge<br />
Gainsbourg. Miles Davis verehrte Juliette Gréco, die er<br />
auf seiner ersten Europareise Ende der 40er Jahre kennen<br />
lernte.<br />
Schon 1949 begann sie ihre zweite Karriere – <strong>als</strong> Schaupielerin:<br />
Cocteau trug ihr die Rolle der Königin der Bacchantinnen<br />
in „Orphée“ an. In den folgenden Jahren<br />
stand sie neben Schauspielergrößen wie Gregory Peck, Omar Sharif, Orson Welles, Ingrid Bergman,<br />
Jean Seberg und Ava Gardner und vielen mehr. In zwei Dokumentarfilmen „Désordre“ (Lotterleben,<br />
F, 1951) und „Le Désordre à vingt ans“ (F, 1967) gewährte Juliette Greco neben anderen<br />
französischen Existentialisten einen zuweilen satirischen Einblick in das Leben von St.-<br />
Germain. Die Existenzialisten traten von der ersten Reihe der Bühne zurück, Juliette Gréco blieb<br />
weiterhin ganz vorn. In ihrem schwarzen, bodenlangen Kleid stilisierte sie ihr eigenes Bild zum<br />
Kunstwerk. 1982 veröffentlichte sie ihre Autobiografie „Jujube“, angelehnt an ihren Kindheitsnamen,<br />
den die Franzosen noch heute zärtlich für sie verwenden. Nach einer mehrjährigen Bühnenabstinenz<br />
gab sie 1991 im Pariser Olympia ihr gefeiertes Comeback. Mehr <strong>als</strong> 50 Alben hat sie in<br />
ihrem bisherigen Leben veröffentlicht und immer noch geht sie auf Konzertreise. 1999 erhielt sie<br />
den Nationalen Verdienstorden Frankreichs und wurde damit in den Rang eines „officiers“ erhoben.<br />
Die deutsche Synchronstimme spricht die Wiener Schauspielerin Mijou Kovacs.<br />
FILMOGRAFIE<br />
2000 „Belphégor, das Phantom des Louvre“, (F), R: Jean-Paul Salomé, mit: Sophie Marceau und<br />
Julie Christie (Remake der 60er Jahre Fernsehkultserie „Belphégor, das Phantom der Oper“<br />
mit J. Gréco in der Hauptrolle)<br />
1975 „Lily, aime-moi“, (F), R: Maurice Dugowson, mit: Patrick Deweare und Zouzou<br />
1973 „Far West“, (B), R: Jacques Brel, mit: Lino Ventura und Michel Piccoli<br />
1966 „Die Nacht der Generale“, (GB/F), R: Anatole Litvak, mit: Peter OToole und Omar Sharif<br />
1965 „Onkel Toms Hütte“, (D/I/F), R: Geza von Radvanyi,mit: O. W. Fischer und Thomas Fritsch<br />
1965 „Das erste Erotikal der Welt“, (I), R: Vittorio Sala, mit: Gilbert Becaud und Dean Martin<br />
1961 „Das Haus der Sünde“, (F), R: Henri Decoin, mit: Jean-Marc Bory und Liselotte Pulver<br />
1960 „Drama im Spiegel“, (USA), R: Richard Fleischer, mit: Orson Welles und Bradford Dillman<br />
1959 „Die schwarze Lorelei“, (GB), R: Lewis Allen, mit: O. W. Fischer und Muriel Pavlow<br />
1958 „Die Wurzeln des Himmels“, (USA), R: John Huston, mit: Errol Flynn und Orson Welles<br />
1957 „Zwischen Madrid und Paris“, (USA), R: Henry King, mit: Ava Gardner und Errol Flynn<br />
1957 „Bonjour Tristesse“, (USA), R: Otto Preminger, mit: David Niven und Jean Seberg<br />
1956 „Weiße Margeriten“, (F/I), R: Jean Renoir, mit: Ingrid Bergman und Jean Marais<br />
1956 „Die Herrscherin vom Libanon“, (F/I), R: Richard Pottier, mit: Omar Sharif und<br />
Jean Servais<br />
1956 “Gangster, Rauschgift und Blondinen”, (F), R: Raoul Andre, mit: Eddie Constantin und<br />
Jacqueline Ventura<br />
1953 „Parfum explosive“,(F), R: Maurice de Canonge, mit: Edith Piaf und Gregory Peck<br />
1949 „Orphée“, (F), R: Jean Cocteau, mit: Jean Marais und Marie Dea<br />
8
Sylvie Testud (* 1971 in Lyon/Frankreich)<br />
FILMOGRAFIE<br />
In Deutschland wurde Sylvie Testud einem breiten Publikum<br />
bekannt durch die Rolle der Lara im Oscar-nominierten <strong>Film</strong><br />
"Jenseits der Stille” von Caroline Link. Dafür wurde sie 1997 <strong>als</strong><br />
beste Darstellerin mit dem <strong>Film</strong>band in Gold ausgezeichnet. Mit<br />
"Pünktchen und Anton” setzte die französische Schauspielerin<br />
ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Caroline Link fort.<br />
Sylvie Testud spielte u.a. in internationalen Produktionen wie<br />
“Flammen im Paradies” mit Elodie Bouchez, “Ich geh nach<br />
Hause” mit Michel Piccoli, in dem auf der Berlinale 1999<br />
gezeigten “Karnaval” und in dem während der <strong>Film</strong>festspiele<br />
Cannes 2000 aufgeführten “Die Gefangene” von Chantal<br />
Akerman.<br />
2001 “Ich geh nach Hause”, (PORT/F), R: Manoel Oliveira<br />
2000 “Die Gefangene”, (F/B), R: Chantal Akerman<br />
1998 “Pünktchen und Anton”, (D), R: Caroline Link<br />
1998 “Karnaval”, (F/CH/B), R: Thomas Vincent<br />
1998 “In Heaven”, (A), R: Michael Bindlechner<br />
1997 “Flammen im Paradies”, (CH/F/D), R: Markus Imhoof<br />
1996 “Jenseits der Stille”, (D), R: Caroline Link<br />
1995 “Maries Lied 'Ich war, ich weiß nicht wo'”, (D), R: Niko Brücher<br />
Susan Lynch (* 1971 in Newry/Irland)<br />
Susan Lynch studierte an der “Central School of Speech and<br />
Drama” in London, wo sie auch den “Kenneth Branagh's<br />
Renaissance Award” <strong>als</strong> aussichtsreichste Absolventin gewann.<br />
Ihren internationalen Durchbruch schaffte Susan Lynch 1994 an<br />
der Seite von Tom Cruise in “Interview mit einem Vampir”. Dem<br />
deutschen Publikum ist sie bekannt von der irischen Erfolgskomödie<br />
"Lang lebe Ned Devine". Als James Joyce's Ehefrau<br />
“Nora” im gleichnamigen <strong>Film</strong> spielte sie an der Seite von Ewan<br />
McGregor. Für diese Rolle wurde sie <strong>als</strong> beste Schauspielerin mit<br />
dem “Irish <strong>Film</strong> and Television Award” ausgezeichnet. Zuletzt<br />
war sie in dem Thriller “From Hell” mit Johnny Depp zu sehen.<br />
Mit “Jedermanns Fest” spielt Susan Lynch erstm<strong>als</strong> auf<br />
deutschsprachigem Raum.<br />
FILMOGRAFIE<br />
2001 “From Hell”, (USA), R: Albert und Allen Hughes<br />
2001 “Morlang”, (NL), R: Tjebbo Penning<br />
2000 “Beautiful Creatures. Zum Sterben schön...”, (GB), R: Bill Eagles<br />
2000 “Nora”, (GB), R: Pat Murphy<br />
1998 “Lang lebe Ned Devine”, (GB/IR/USA), R: Kirk Jones<br />
1997 “Downtime”, (GB), R: Bharat Nalluri<br />
1996 “Ein königlicher Skandal”, (GB), R: Sheree Folkson<br />
1996 “Lügenspiele”, (GB), R: John Madden<br />
1995 “Der Racheengel”, (GB), R: John Woods<br />
1995 “Perfect Match”, (GB), R: Nick Hurran<br />
1994 “Interview mit einem Vampir”, (USA), R: Neil Jordan<br />
1994 “Das Geheimnis des Seehundbabys”, (USA), R: John Sayles<br />
1978 “Nordlicht in Dakota”, (USA), R: John Hanson, Rob Nilsson<br />
9
Otto Tausig (* 1922 in Wien/Österreich)<br />
Otto Tausig emigrierte <strong>als</strong> 16 Jähriger 1938 nach England und<br />
besuchte nach seiner Rückkehr von 1946 bis 1948 das Max Reinhardt<br />
Seminar in Wien. 1948 gab er sein Debüt an der Wiener "Scala", wo er<br />
auch <strong>als</strong> Chefdramaturg und Spielleiter wirkte. Nach der Auflösung der<br />
Scala ging er mit einigen seiner Kollegen an das Deutsche Theater in<br />
Ost-Berlin (1957-60), es folgten Engagements in der Schweiz, in<br />
Deutschland und Österreich (1971 bis 1983 Ensemblemitglied des<br />
Wiener Burgtheaters). Er lehrte <strong>als</strong> Professor am Max Reinhardt<br />
Seminar und war <strong>als</strong> Regisseur bei österreichischen und deutschen<br />
Fernsehproduktionen (u. a. "Sketches" von E. Kishon) tätig. 1999<br />
verabschiedete sich Otto Tausig von der Bühne in einen, wie er sagt,<br />
„eher unruhigen Ruhestand“, um sich von nun an im Kampf gegen die<br />
Armut in den Entwicklungsländern zu engagieren.<br />
FILMOGRAFIE<br />
2001 „Old love“, (D), R: Jan Schütte<br />
2001 “Epstein's Nacht”, (Ö/D/CH), R: Urs Egger<br />
2000 “Nobel”, (I/F/U/DN), R: Fabio Carpi<br />
2000 “Hirnschal gegen Hitler”, (D), R: Hans-Christoph Blumenberg/Eva Kammerer<br />
1998 “Place Vendomé”, (F), R: Nicole Garcia<br />
1996 “Das Geständnis”, Fernsehdrama, (Ö), R: Kitty Kino<br />
1993 „Reigne Margot“, (F/D/I), R: Patrice Chereau<br />
1993 „Auf Wiedersehen, Amerika“, (D/POL), R: Jan Schütte<br />
1988 „Nächtliches Indien“, (F), R: Alain Corneau<br />
1967 „Kurzer Prozeß“, (D), R: Michael Kehlmann<br />
Redbad Klynstra (* 1969 in Amsterdam/Holland)<br />
Der holländisch-polnische Schauspieler Redbad Klynstra studierte an<br />
der Akademia Teatralna in Warschau. Im deutschsprachigen Raum<br />
debütierte Redbad Klynstra an der Seite von Heiner Lauterbach und<br />
Gudrun Landgrebe in dem Fernsehfilm “Eine Sünde zuviel”. 2000<br />
wurde "Das Leben <strong>als</strong> eine auf dem Geschlechtsweg übertragene<br />
tödliche Krankheit" von Krzysztof Zanussi mehrfach prämiert, in dem<br />
Redbad Klynstra die Rolle des Sängers spielt. Als vielseitiger Künstler<br />
schrieb er für ein experimentelles Hörspiel mit Piano und Synthesizer<br />
“EPIPHORA, for piano and tape” (1996) im Auftrag des Polnischen<br />
Radios die textliche Ausgestaltung. Ebenso führte er für den<br />
Musikclip der polnischen Popgruppe “Hey” mit der Bandleaderin<br />
Kasia Nosowska 2000 die Regie. 2002 setzte er seine Zusammenarbeit<br />
mit dem Regisseur Zanussi fort. In Polen ist Redbad<br />
Klynstra durch seine <strong>Film</strong>- und Theaterengagements ein bekannter<br />
und beliebter Schauspieler.<br />
FILMOGRAFIE<br />
2002 “Suplement”, (POL), R: Krzysztof Zanussi<br />
2000 "Das Leben <strong>als</strong> eine auf dem Geschlechtsweg übertragene tödliche Krankheit", (POL),<br />
R: Krzysztof Zanussi<br />
1999 "Ich schau dir in die Augen, Mary“, (POL), R: Łukasz Barczyk<br />
1997 “Eine Sünde zuviel“, Fernsehfilm, (D), R: Udo Witte<br />
10
Jim Rakete (* 1951 in Berlin/Deutschland)<br />
Ausgelöst durch seine Begegnung mit Nina Hagen und<br />
ihrer Band wurde Jim Rakete Ende der 70er Jahre<br />
Musikproduzent, Manager und Fotograf der Stars der<br />
Neuen Deutschen Welle. Über zehn Jahre arbeitete er<br />
äußerst erfolgreich mit Künstlern wie Nina Hagen, Nena,<br />
Spliff und Die Ärzte. Doch danach besinnt er sich auf<br />
seinen früher eingeschlagenen Berufsweg und seine<br />
eigentliche Leidenschaft, die Fotografie und wird schnell<br />
zu einem der angesehensten Fotografen Deutschlands.<br />
Mit dem Medium des <strong>Film</strong>s hatte er diverse<br />
Berührungspunkte: Viele seiner Porträts zeigen Größen<br />
nicht nur des neuen deutschen <strong>Film</strong>s. Zudem wirkte er<br />
auch in dem Dokumentarfilm „Jazz seen“ (D/2001, R:<br />
Julian Benedikt) mit.<br />
Jim Rakete spielt den Fotografen Gerry Benning und fotografierte die Stills zum <strong>Film</strong>.<br />
Ellen Umlauf (* 1925 in Wien, Ϯ 2000 in Neuseeland)<br />
Nach ihrem Studium am Wiener Max Reinhardt Seminar arbeitete Ellen Umlauf zunächst <strong>als</strong> Ballett-Solotänzerin<br />
in den Opernhäusern von Breslau und Graz. Später wirkte sie <strong>als</strong> Schauspielerin<br />
in den deutschsprachigen Theatern und war auch <strong>als</strong> <strong>Film</strong>schauspielerin erfolgreich (u. a. „Die<br />
Wunder des Malachias“, D/1961, R: Bernhard Wicki; „Die letzten Tage“, D/1973, R: Helma Sanders;<br />
1999 „Dolphins“, D/1999, R: Farhad Yawari). Ihre freie Zeit verbrachte sie auf den Fidschi-<br />
Inseln, die ihr zur zweiten Heimat geworden waren. Als Autorin, Regisseurin und Produzentin<br />
schuf sie mehrere Dokumentationen über diese Region und ihr harmonisches Zusammenleben mit<br />
den dort ansässigen Menschen („Nabuli“, D/FID/1987; „Traumland“, D/1993).<br />
11
HINTERGUNDINFORMATIONEN<br />
Grundlage von Fritz Lehners <strong>Film</strong> ist das allegorische Spiel „Jedermann. Das Spiel vom Sterben<br />
des reichen Mannes“ von Hugo von Hoffmannsthal (1874-1929). 1911 wurde es in der Inszenierung<br />
von Max Reinhardt im Berliner Zirkus Schumann uraufgeführt und 1920 anlässlich der ersten<br />
Salzburger Festspiele wiederaufgeführt. Bis heute – mit einer Unterbrechung unter den Nation<strong>als</strong>ozialisten<br />
– ist der „Jedermann“ Grundbestandteil der Salzburger Festspiele, weitere Jedermann-Festspiele<br />
(u. a. in Berlin, Hamburg, Erfurt und Nürnberg) haben sich etabliert. Viele große<br />
Darsteller, von Will Quadflieg bis Curd Jürgens, von Maximilian Schell bis Klaus Maria Brandauer<br />
(1983-1989) haben dem Salzburger „Jedermann“ einen jeweils eigenen, unverwechselbaren<br />
Stempel aufgedrückt.<br />
Das Hofmannsth<strong>als</strong>che Bühnenwerk um die Nichtigkeit irdischer Schätze beruht auf verschiedenen<br />
Quellen. Schon orientalische Parabeln thematisieren den „reichen Prasser“ und seinen Tod.<br />
Der Titel „Everyman“ erscheint zum ersten Mal im 15. Jahrhundert in einem englischen Mysterienspiel.<br />
Weitere Dichter wie Hans Sachs („Ein comedi von dem reichen sterbenden menschen“),<br />
Jakob Bidermann („Cenodoxus“) oder Calderon („Balthasars Nachtmahl“) verwenden ebenfalls<br />
das Jedermann-Sujet.<br />
Hugo von Hofmannsthal schrieb über die Entstehungsgeschichte seines Jedermanns:<br />
„Alle diese Aufschreibungen stehen nicht in jenem Besitz, den man <strong>als</strong> den lebendigen des deutschen<br />
Volkes bezeichnen kann, sondern sie treiben im toten Wasser des gelehrten Besitzstandes.<br />
Darum wurde hier versucht, dieses allen Zeiten gehörige und allgemeingültige Märchen aberm<strong>als</strong><br />
in Bescheidenheit aufzuzeichnen. Vielleicht geschieht es zum letztenmal, vielleicht muß es später<br />
durch den Zugehörigen einer künftigen Zeit noch einmal geschehen.“<br />
Fritz Lehner transferiert sein Epos frei nach Hofmannsthal in die Gegenwart und überschreitet in<br />
Dramaturgie und Gestaltung übliche Sehgewohnheiten, ohne dabei seine Wurzeln in der europäischen<br />
Kulturgeschichte zu negieren.<br />
In dem Tanz seiner Salome kündigt Lehner wie in einer Ouvertüre zusammengefasst das kommende<br />
Schicksal seines Heldens an. Lehners Bildsprache verwendet bekannte Symbole wie den<br />
schwarzen Hund <strong>als</strong> Todesboten und den Apfel <strong>als</strong> Versinnbildlichung der Frau. Kenner des Original-Jedermanns<br />
werden mit Interesse viele Zitate und Umdeutungen aus der Vorlage dechiffrieren:<br />
In der Überschwemmung, durch Jedermanns/Brandauers Unachtsamkeit ausgelöst, werden sie<br />
leicht verändert die Pläne seines Vorgängers über sein zukünftiges Lusthaus wieder erkennen<br />
(„Desgleichen an einer verborgenen Stätte/ Recht wie der Nymphe quillend Bette/ Laß ich aus<br />
kühlem glatten Stein/ Eine fließende Badstub errichtet sein.“ Jedermann). Das zeitgemäßexotische<br />
Mahl aus Schwalbennester für die Festgäste findet sich auch schon in der Vorlage aus<br />
dem vorigen Jahrhundert („Hab sagen hören, es gibt einen Stein, Den trägt die Schwalbe in ihrem<br />
Bauch, Den haben die großen Ärzt im Brauch ...“ Ein anderes Fräulein; „... Ist Mächtig gegen die<br />
Melancholie“).<br />
Doch ist die Auseinandersetzung mit dem Tod ein<br />
zeitloses Thema, so dass auch ein weniger versiertes<br />
Publikum sich, angeregt durch den <strong>Film</strong>, mit der<br />
eigenen Vergänglichkeit konfrontiert sieht. Fritz Lehner<br />
möchte sowohl die „Verdrängung des Todes aus dem<br />
Leben“ <strong>als</strong> auch den „Zwang, Karriere zu machen“,<br />
d.h. das gesellschaftliche Ethos „Wer keine Karriere<br />
macht, ist nichts wert“ transportiert wissen (O-Ton<br />
Lehner anlässlich der <strong>Verleih</strong>ung während der Grazer<br />
Diagonale 2002).<br />
Allerdings ermöglicht die neue Interpretation des Jedermann-Stoffes<br />
seinem Protagonisten nicht mehr die<br />
Katharsis, die in der Ursprungsfassung noch gegeben war: Der Protagonist bleibt der „verstockte<br />
Sünder“ und bereut nicht. Lehner meint dazu: „Ich glaube ja, dass man so stirbt – wenn man Zeit<br />
dazu hat – wie man lebt“. Damit spiegelt der Regisseur ein neues Bild seiner Epoche, zu dem<br />
auch zukünftige Generationen Stellung beziehen können.<br />
12
<strong>Film</strong>musik<br />
„Salome“ vom Richard Strauss (1864-1949). Er war Freund und Librettist von Hugo von Hofmannsthal<br />
und gründete mit ihm und Max Reinhardt die Salzburger Festspiele. Sein bedeutendstes<br />
Bühnenwerk, die Oper „Salomé“, löste während seiner Uraufführung 1905 in Dresden einen<br />
Skandal aus. Da es in kein gängiges Schema passte, wurde es vom Publikum <strong>als</strong> zu modern abgelehnt.<br />
Salome ist die „Todesbotin“ aus dem Markusevangelium, sie fordert für ihren verführerischen<br />
Tanz von Herodes den Kopf von Johannes dem Täufer.<br />
„Stabat Mater“ von Giacomo Battista Pergolsesi. Der italienische Komponist Battista lebte von<br />
1710 bis 1736. Die Übersetzung seines Titels „Stabat Mater“ lautet: „Es stand die Mutter<br />
schmerzerfüllt“ und geht auf ein mittelalterliches Marienlied zurück, das in der kirchlichen Messliturgie<br />
verwendet wurde. In der Hofmannsth<strong>als</strong>chen Fassung des Jedermanns ist es die Mutter<br />
(und nicht der Vater wie bei Lehner), die sich große Sorgen über den Lebenswandel ihres Sohnes<br />
macht. Mit der Wahl dieses Titels stellt Lehner die Verbindung zum klassischen „Jedermann“ her.<br />
Edyta Bartosiewicz: „Zanim coś...“ („Bevor etwas ...“), „Boogie“<br />
Die 1966 in Warschau geborene Edyta Bartosiewicz ist in ihrem Heimatland eine gefeierte und<br />
beliebte Rocksängerin, die aufgrund ihrer musikalischen Brillanz schon 1994 zum berühmten Festival<br />
in Sopot und Opole eingeladen wurde. Zahlreiche Preise erhielt sie <strong>als</strong> beste Sängerin bzw.<br />
wurde ihr Album <strong>als</strong> Bestes prämiert. Edyta Bartosiewicz komponierte und arrangierte vor „Jedermanns<br />
Fest“ die <strong>Film</strong>musik für den polnischen <strong>Film</strong> „Die Egoistin“ (gleichnamiger Song).<br />
PREISE UND FESTIVALS<br />
2001 Hong Kong Max! <strong>Film</strong> Festival, Goethe-Institut Inter Nationes Hong Kong (Okt.)<br />
2002 1. Internationales <strong>Film</strong> Festival Frankfurt 2002/16. <strong>Film</strong>schau Frankfurt (Jan.)<br />
2002 Victoria Independent <strong>Film</strong> and Video Festival (VIFVF), Kanada (Febr.)<br />
2002 Diagonale in Graz/Festival des österreichischen <strong>Film</strong>s, Auszeichnung <strong>als</strong><br />
„Bester österreichischer <strong>Film</strong>“ (März)<br />
2002 Internationales <strong>Film</strong>festival Moskau (Juni)<br />
2002 20. <strong>Film</strong>fest München (Juni/Juli)<br />
13
PRESSESTIMMEN<br />
„Ein <strong>Film</strong> für jeden, der sich mit der eigenen Oberflächlichkeit, Endlichkeit<br />
und Fehlbarkeit auseinandersetzen will.“<br />
cineplexx.at/ Österreich, Januar 2002<br />
„Neulich sah ich Bilder von Watteau wieder, drei kurze Stunden lang. Die<br />
Ausstellung hieß Jedermanns Fest und war ein <strong>Film</strong>, in dem schwerelos<br />
wirkende Figuren durch Parklandschaften lustwandelten. Die Bilder waren<br />
alle richtig gehängt, und sie sind wie bei Watteau gleichzeitig opulent und<br />
aufs Wesentliche reduziert, wie die Sätze in einem großen Roman.“<br />
wespennest film-theater/Österreich, Nr. 127, 2002<br />
14<br />
Über Brandauer: „Tatsächlich beschenkt er jedenfalls diesen <strong>Film</strong><br />
mit einer großartig reduzierten Performance. Es ist, <strong>als</strong> würde er,<br />
wenn Jedermann in Allüren verfällt, sich selbst aus einer ungeheuer<br />
wehmütigen, uneitlen, fast beschämten Distanz beobachten. Vor<br />
dreißig Jahren hätte vielleicht Oskar Werner Vergleichbares geboten.<br />
Im österreichischen Kino sucht es seinesgleichen.“<br />
Der Standard/Österreich, 21. Januar 2002<br />
„Auf der Leinwand entfaltet sich ein barockes <strong>Film</strong>gedicht, wie man es in<br />
dieser optischen Opulenz und Bildfantasie (Kamera Gernot Roll) lange<br />
nicht mehr sah.“<br />
Freitag/Dtld, 5. April 2002<br />
„“Jedermanns Fest“ bietet eine<br />
reichliche Dosis Kunstfilmwahnsinn<br />
alter Schule und besteht zu<br />
gleichen Teilen aus Unsinn und<br />
Schönheit. Der große österreichische<br />
Mime Klaus Maria Brandauer<br />
hat seinen größten <strong>Film</strong>auftritt seit<br />
Jahren in der Rolle eines Modezars,<br />
der seine letzte nacht auf Erden<br />
erlebte.“<br />
Variety/USA, 13. bis 19. Mai 2002<br />
„Die Kongenialität der Adaption des Jedermann-Stoffes liegt in der<br />
Form, die Lehner fand, in diesem Spiegelkabinett irrlichternder<br />
(Kamera)Blicke und (Regie)Gesten, die sich alle ad infinitum reflektieren,<br />
bis der <strong>Film</strong> selbst zum Spiegel geworden ist, zur planen Reflektionsfläche<br />
für den Zuschauer.“<br />
Die Welt/Dtld, 12. April 2002<br />
Serving up large helpings of old scholl<br />
art film madness, „Jedermann´s Fest“<br />
is equal parts nonsense and beauty,<br />
with great Austrian thesp Klaus<br />
Maria Brandauer getting his biggest<br />
screen workout in years as a highfashion<br />
maven facing his last night on<br />
earth.“<br />
„Mit strenger Ästhetik und surrealistischer Symbol-Wucht hat Lehner<br />
den Jedermann-Stoff in die stilisierte Fassadenwelt der Mode-<br />
Branche gestemmt. „Jedermanns Fest“ ist eine bildergewaltige Herausforderung<br />
an die Anspruchs- und Genussgesellschaft, die sich gegen<br />
jede Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit wehrt. Makabrer<br />
Alptraum .“<br />
Abendzeitung, München 04. Juli 2002
TERMINE UND KONTAKTE<br />
Bundesweiter Kinostart: 10.10.2002<br />
im Progress <strong>Film</strong>-<strong>Verleih</strong>, Berlin<br />
e-mail: info@progress-film.de<br />
www.progress-film.de<br />
Der Progress <strong>Film</strong>-<strong>Verleih</strong> pflegt neben<br />
einigen ausgewählten Premierenfilmen ein<br />
vielseitiges Repertoire aller Genres. Deutsche<br />
und internationale Spielfilmklassiker und<br />
Dokumentarfilme, Animations-, Kurz und Kinderfilme aus vier Jahrzehnten halten wir ständig<br />
für Ihr Kino bereit. Mit Klaus Maria Brandauer in den Hauptrollen bieten wir folgende<br />
Spielfilmklassiker an: „Das Spinnennetz“, „Hanussen“, „Oberst Redl“ und „Mephisto“.<br />
<strong>Verleih</strong>: Sigrid Geerdts und Gabriele Rauschenbach<br />
Tel: 030 - 24 00 34 00 + 01 + 02<br />
Fax: 030 – 24 00 34 99<br />
e-mail: s.geerdts@progress-film.de<br />
oder: g.rauschenbach@progress-film.de<br />
Presse/ ÖA: Inis P.-Schönfelder<br />
und Barbara Löblein<br />
Tel: 030 – 24 00 34 71 + 73<br />
Fax: 030 – 24 00 34 79<br />
e-mail: i.pengel@progress-film.de<br />
15