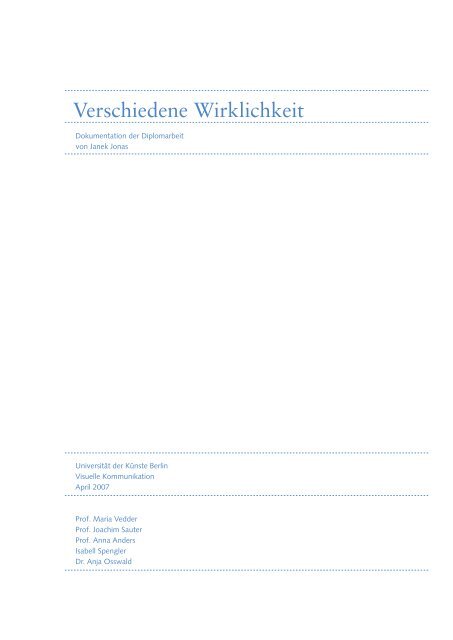Verschiedene Wirklichkeit
Verschiedene Wirklichkeit
Verschiedene Wirklichkeit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Verschiedene</strong> <strong>Wirklichkeit</strong><br />
Dokumentation der Diplomarbeit<br />
von Janek Jonas<br />
Universität der Künste Berlin<br />
Visuelle Kommunikation<br />
April 2007<br />
Prof. Maria Vedder<br />
Prof. Joachim Sauter<br />
Prof. Anna Anders<br />
Isabell Spengler<br />
Dr. Anja Osswald<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 1
2 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 3<br />
Inhalt<br />
Einleitung<br />
Motivation 4<br />
Hintergrund<br />
<strong>Verschiedene</strong> <strong>Wirklichkeit</strong> 6<br />
Mindfuck-Filme 10<br />
Andere <strong>Wirklichkeit</strong>sebenen 12<br />
Mockumentary 14<br />
Eigene Referenzen 16<br />
Mondmanns Faden<br />
Konzept-Ansätze 34<br />
Zwei Orte - Konzept 36<br />
Dreharbeiten in Uganda 40<br />
Weiterentwicklung des Konzeptes 48<br />
Dreharbeiten in Berlin 50<br />
Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en 52<br />
Anregungen und Quellen 62
4 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Einleitung<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 5<br />
Motivation<br />
Everyone lives in his own fantasy world, but most people don’t understand that. No one<br />
perceives the real world. Each person simple calls his private, personal fantasies the Truth.<br />
– Frederico Fellini<br />
<strong>Verschiedene</strong> <strong>Wirklichkeit</strong><br />
Mich interessiert der Begriff der <strong>Wirklichkeit</strong>. Wie ent-<br />
steht unsere <strong>Wirklichkeit</strong>? Wovon hängt sie ab? Durch<br />
welche Informationen entsteht sie? Wie nehmen wir<br />
<strong>Wirklichkeit</strong> wahr? Inwieweit ist es möglich ein objekti-<br />
ves <strong>Wirklichkeit</strong>sbild zu erhalten? Besonders interessiert<br />
mich hierbei die Auseinandersetzung mit filmischen<br />
<strong>Wirklichkeit</strong>en. Wie entstehen <strong>Wirklichkeit</strong>en im Film<br />
und wie entstehen <strong>Wirklichkeit</strong>en durch Film?<br />
In meiner Arbeit möchte ich aus verschiedenen Fragmen-<br />
ten unterschiedlicher <strong>Wirklichkeit</strong>en eine neue, andere<br />
„<strong>Wirklichkeit</strong>” entstehen lassen. Diese neue, andere<br />
<strong>Wirklichkeit</strong> soll sich innerhalb des Prozesses der Diplom-<br />
marbeit entwickeln. Das Ziel ist einen Film zu schaffen,<br />
der auf dieses Thema aufbaut.<br />
Im ersten Teil dieser Dokumentation werde ich mich<br />
anhand von Texten von Paul Watzlawick und Heinz von<br />
Foerster mit dem Begriff der <strong>Wirklichkeit</strong> auseinander-<br />
setzen.<br />
Darauf folgend werde ich mich mit einigen Filmbeispie-<br />
len, u.a. aus dem Genre des sogenannten „Mindfuck“-<br />
Films, beschäftigen, welche sich auf eine besondere Wei-<br />
se mit dem Begriff von <strong>Wirklichkeit</strong> auseinandersetzen.<br />
Im Anschluss werde ich einige meiner bisherigen Arbei-<br />
ten vorstellen, die ebenfalls die Wahrnehmung von<br />
<strong>Wirklichkeit</strong> thematisieren.<br />
Der abschließende Teil der Dokumentation beschreibt<br />
die Entstehung des praktischen Teils der Diplomarbeit.
6 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Hintergrund<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 7<br />
<strong>Verschiedene</strong> <strong>Wirklichkeit</strong><br />
Wie entsteht <strong>Wirklichkeit</strong>? Eine Auseinandersetzung mit dem <strong>Wirklichkeit</strong>sbegriff anhand der Bücher<br />
Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners von Heinz von Foerster (Physiker, Mitbegründer der kybernetischen<br />
Wissenschaft, Philosoph) im Gespräch mit Bernhard Pörksen und Wie wirklich ist die<br />
<strong>Wirklichkeit</strong>? von Paul Watzlawicks (Kommunikationswissenschaftler, Philosoph).<br />
Ordnung ist des Himmels oberstes Gesetz. – Alexander Pope<br />
Die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. – Albert Einstein<br />
<strong>Wirklichkeit</strong><br />
<strong>Wirklichkeit</strong> ist das Ergebnis von Kommunikation. Laut<br />
Paul Watzlawick ist das wackelige Gerüst unserer All-<br />
tagsauffassungen der <strong>Wirklichkeit</strong> im eigentlichen Sinne<br />
wahnhaft. Es gibt vielmehr zahllose <strong>Wirklichkeit</strong>sauf-<br />
fassungen, die sehr widersprüchlich sein können. Sie alle<br />
sind Ergebnis von Kommunikation und nicht Wider-<br />
schein ewiger, objektiver Wahrheiten.<br />
Menschen beeinflussen sich gegenseitig durch Kommu-<br />
nikation, wodurch ganz verschiedene „<strong>Wirklichkeit</strong>en”,<br />
Weltanschauungen oder Wahnvorstellungen entstehen<br />
können.<br />
So ist der Glaube, dass die eigene Sicht der <strong>Wirklichkeit</strong><br />
die <strong>Wirklichkeit</strong> schlechthin bedeute, eine gefährliche<br />
Wahnidee. Sie wird dann noch gefährlicher, wenn sie<br />
sich mit der messianischen Berufung verbindet, die Welt<br />
dementsprechend aufklären und ordnen zu müssen<br />
– gleichgültig, ob die Welt diese Ordnung nun wünscht<br />
oder nicht.<br />
Für Heinz von Foerster bedeutet Erkennen, dass inner-<br />
halb des Nervensystems Zusammenhänge zwischen<br />
Empfindungen hergestellt werden. Das Erkennen stellt<br />
einen unendlichen und in ständiger Zirkularität ab-<br />
laufenden Vorgang dar. Von Foerster beschreibt die<br />
Wahrnehmung der Welt stets als „Konstruieren” und<br />
„Erfinden” von <strong>Wirklichkeit</strong>.<br />
Die Welt wird an den Erkennenden gekoppelt; er ist es,<br />
der sich für ihre Existenz entscheidet. Die Welt als eine<br />
Erfindung aufzufassen heißt, sich als ihren Erzeuger zu<br />
begreifen; es entsteht Verantwortung für ihre Existenz.<br />
Kommunikation<br />
Wo entsteht Kommunikation? Für von Foerster entsteht<br />
sie in demjenigen, der mit einem Signal etwas anfangen<br />
kann. Sie ist kein Gebrauchsgegenstand, der sich außer-<br />
halb des wahrnehmenden Bewusstseins befindet. Bücher<br />
und Zeitungen, Ton- und Videobänder, Straßenschilder<br />
usw. enthalten keine Information, sondern sie sind Trä-<br />
ger potentieller Information.<br />
Die Welt enthält keine Information. Sie ist, wie sie ist.<br />
Somit lässt sich Kommunikation als eine individuelle<br />
Sinnkonstruktion beschreiben.<br />
Konfusion und die Entstehung von <strong>Wirklichkeit</strong>sauffas-<br />
sungen<br />
Man kann laut Watzlawick den Zustand der Konfusion<br />
als das Spiegelbild der Kommunikation auffassen. Wir<br />
Menschen hängen, wie alle anderen Lebewesen, von<br />
unserer Umwelt ab. Diese Abhängigkeit bezieht sich<br />
nicht nur auf die Erfordernisse des Stoffwechsels, son-<br />
dern auch auf hinlänglichen Informationsaustausch. Wir<br />
spüren Konfusion wenn wir eine Situation erleben, die<br />
wir nicht kennen, in der wir nicht wissen wie wir uns<br />
verhalten sollen.<br />
Nach einer ursprünglichen Lähmung löst jeder Zustand<br />
der Konfusion eine sofortige Suche nach Anhaltspunkten<br />
aus, die zur Klärung der Ungewissheit und dem damit<br />
verbundenen Unbehagen dienen können. Daraus folgt<br />
zweierlei. Erstens wird diese Suche, wenn erfolglos, auf<br />
alle möglichen und unmöglichen Bezüge ausgedehnt und<br />
wird unter Umständen die unbedeutendsten und abwe-<br />
Verstehen und Begreifen entstehen in Form einer Wech-<br />
selwirkung zwischen dem, was gesagt wird und dem,<br />
was jemand bereits – aufgrund seiner besonderen Kultur<br />
oder Herkunft – weiß, kennt und erwartet.<br />
Daraus ergibt sich für von Foerster das hermeneutische<br />
Prinzip: Der Hörer, nicht der Sprecher bestimmt die<br />
Bedeutung einer Aussage.<br />
gigsten Zusammenhänge einbeziehen. Zweitens neigt<br />
man in einem Zustand der Konfusion ganz besonders<br />
dazu sich an die erste konkrete Erklärung zu klammern,<br />
die man durch den Nebel der Konfusion zu erkennen<br />
glaubt.<br />
Eine andere Folge der Konfusion besteht darin, dass sie<br />
unsere Wahrnehmung für unter Umständen kleinste Ein-<br />
zelheiten schärft. In ungewöhnlichen Situationen, zum<br />
Beispiel in großer Gefahr, sind wir unvermutet gewisser<br />
Reaktionen fähig, die vollkommen aus dem Rahmen<br />
unseres Alltagsverhalten fallen können.<br />
Die durch Konfusion erzeugte Unwirklichkeit löst also<br />
eine sofortige Suche nach Ordnung aus.<br />
Es können merkwürdige Störungen der <strong>Wirklichkeit</strong>s-<br />
auffassung auftreten, wenn diese Ordnung schwer zu<br />
erfassen ist oder überhaupt nicht besteht.
8 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Hintergrund<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 9<br />
Es gibt eine Unzahl von Lebenslagen, für deren Bewäl-<br />
tigung man auf seine eigene Umsicht und Findigkeit<br />
angewiesen ist, da diese Situationen neuartig sind und<br />
zu ihrer Lösung keine (oder nur unzureichende) frühere<br />
Erfahrungen zur Verfügung stehen. Dieser Mangel an<br />
direkt anwendbarer Erfahrung und die sich daraus erge-<br />
bende Unfähigkeit, das Wesen der Situation auf Anhieb<br />
Interpunktion<br />
Ein alter Witz von der Laborratte, die einer anderen<br />
Ratte das Verhalten des Versuchsleiters mit den Worten<br />
erklärt: „Ich habe diesen Mann so trainiert, dass er mir<br />
jedes Mal Futter gibt, wenn ich den Hebel drücke.”<br />
Es ist, laut Watzlawick, unerlässlich zu punktieren, das<br />
heißt der <strong>Wirklichkeit</strong> eine bestimmte Ordnung zuzu-<br />
weisen. Ohne diese Ordnung erschiene uns unsere Welt<br />
regellos, chaotisch, völlig unvorhersehbar und daher<br />
äußerst bedrohlich. Das verschiedene Ordnen von Er-<br />
eignisabläufen erzeugt im eigentlichen Sinne des Wortes<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong>en.<br />
Glaubwürdigkeit von Informationen<br />
Laut Watzlawick hängt die Glaubwürdigkeit einer<br />
Information von zwei Faktoren ab: von der Wahrschein-<br />
lichkeit der Information selber und von der Glaubwür-<br />
digkeit ihrer Quelle.<br />
Von Foerster weist darauf hin, dass schon das englische<br />
Wort für Wahrheit, truth, wenn man die Wortgeschichte<br />
analysiert, auf den Begriff der Treue und des Vertrauens,<br />
trust zurück geht. Wenn ich die Wahrheit als ein Ver-<br />
trauen von Mensch zu Mensch begreife, dann brauche<br />
ich keine externen Referenzen mehr.<br />
zu erfassen, führt bei allen Lebewesen zu einer soforti-<br />
gen Suche nach Ordnung und Erklärung. Sobald einmal<br />
das Unbehagen eines Desinformationszustandes durch<br />
eine wenn auch nur beiläufige Erklärung gemildert ist,<br />
führt zusätzliche, aber widersprüchliche Information<br />
nicht zu Korrekturen, sondern zu weiteren Ausarbeitun-<br />
gen und Verfeinerungen der Erklärung.<br />
So entstehen viele zwischenmenschliche Konflikte da-<br />
durch, dass übersehen wird, dass die Konfliktpersonen<br />
ihre zwischenpersönliche <strong>Wirklichkeit</strong> widersprüchlich<br />
geordnet haben und nun blind annehmen, dass es nur<br />
eine <strong>Wirklichkeit</strong> und daher auch nur eine richtige Wirk-<br />
lichkeitsauffassung (nämlich die eigene) gibt. Wir neigen<br />
dazu, nach einer Ordnung im Ablauf der Geschehnisse<br />
zu suchen und sobald wir eine solche Ordnung (Inter-<br />
punktion) in sie hineingelesen haben, wird diese Welt-<br />
schau durch selektive Aufmerksamkeit selbstbestätigend.<br />
Des weiteren geht von Foerster auf die Beständigkeit<br />
und die Absolutheit von Gesetzen und Naturgeset-<br />
zen ein. Ein Naturgesetz hat immer einen Autor. Alle<br />
Gesetze sind Erfindungen, die von uns geschaffen und<br />
verändert werden können. Der Wechsel der Perspektive<br />
macht es möglich den Urheber eines Gesetzes ganz ins<br />
Zentrum zu rücken und sich zu fragen, ob die von ihm<br />
erfundenen Regeln eine Sozialstruktur begünstigen, die<br />
ein schöpferisches, kreatives und freundliches Miteinan-<br />
der gestattet.<br />
Verantwortung<br />
In seiner Abhandlung Laws of Form geht der englische<br />
Logiker George Spencer-Brown davon aus, dass jede<br />
Beobachtung mit dem Akt des Unterscheidens beginnt.<br />
Will ich etwas bezeichnen, muss ich mich zunächst für<br />
eine Unterscheidung entscheiden.<br />
“Draw a distinction and a universe comes into being.”<br />
Der Akt des Unterscheidens wird von ihm als Funda-<br />
mentaloperation des Denkens begriffen. Sie lässt ein<br />
ganzes Universum entstehen und erzeugt <strong>Wirklichkeit</strong>en,<br />
die man vermeintlich in einem externen und von der<br />
eigenen Person losgelösten Raum vermutet.<br />
Medienwirklichkeit<br />
Von Foerster sagt über die Medien, dass sie sich über die<br />
Verantwortung im Klaren sein sollten.<br />
„It is as you tell it!”<br />
Von Foerster stellt des weiteren fest: Wir haben doch nur<br />
Bilder, die wir mit Bildern vergleichen können, wir kön-<br />
nen uns entscheiden, welchem der Berichte und welchem<br />
Foto oder Bild wir eher glauben möchten.<br />
Zu der Frage ob Fotos nicht die <strong>Wirklichkeit</strong> abbilden<br />
erzählt von Foerster einen Witz:<br />
Laut von Foerster steht die Haltung des unbeteiligten Be-<br />
schreibens der Haltung des Mitfühlenden und Beteiligten<br />
gegenüber, der sich selbst als Teil der Welt begreift und<br />
von der Prämisse ausgeht: Was immer ich tue verändert<br />
die Welt! Er ist mit ihr und ihrem Schicksal verbunden,<br />
er ist verantwortlich für seine Handlungen. Die Welt<br />
kann aus dieser Perspektive nicht zu etwas Feindlichem<br />
werden: Sie erscheint als ein Organ, als ein Teil des eige-<br />
nen Körpers, der sich nicht abtrennen lässt.<br />
Da besucht ein reicher amerikanischer Reisender, der genug Geld hat, um ein<br />
Gemälde zu kaufen, Picasso in seinem Schloss. Picasso ist entzückt, führt ihn herum<br />
und zeigt ihm seine Bilder. Schließlich sagt der Amerikaner:<br />
“ Lieber Herr Picasso, warum malen Sie die Menschen nicht so, wie sie sind?” Und<br />
Picasso fragt nach: “Wie soll ich das machen? Wie geht das? Wie sind die Menschen?<br />
Können Sie mir ein Beispiel geben?”<br />
Da zückt der Amerikaner seine Brieftasche und nimmt ein kleines Foto heraus – und<br />
sagt: “Hier sehen Sie, meine Frau, wie sie ist.“ Fasziniert nimmt Picasso das Bild in die<br />
Hand und dreht es herum und meint: “ Aha, das ist Ihre Frau. So klein<br />
ist sie und so flach!”
10 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Hintergrund<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 11<br />
Mindfuck<br />
A sudden boomlet of movies intentionally lie to the audience and manipulate viewers’ emotional investment<br />
in the heroes. In critical circles, these movies have developed a trendy name: mindfucks.<br />
– Jonathan Eig<br />
In einem neueren Genre des Films, dem sogenannten<br />
Mindfuck-Film, geschieht eine besondere Behandlung<br />
des Themas <strong>Wirklichkeit</strong>.<br />
Hierbei scheint eine Fokussierung eher auf dem “Wie”<br />
des filmischen Erzählens zu liegen. Diese Art von Film<br />
besitzt ein beachtliches Irritationspotenzial für die<br />
Zuschauer und stellt eine erhebliche Herausforderung in<br />
Rezeption und Aneignung der Filme dar.<br />
Viele der aktuellen Filme, wie zum Beispiel Donnie<br />
Darko, The Sixth Sense, The Others und Fight Club,<br />
thematisieren und problematisieren in ihrer Narration<br />
die Identität ihrer Hauptfiguren. Eine Verunsicherung<br />
der Identität findet statt. Hauptfiguren sind Subjekte,<br />
deren Identisch-Sein-Mit-Sich-Selbst das Produkt von<br />
Traumata und psychotischer Halluzinationen oder der<br />
Effekt virtueller Realitäten und der Simulation von<br />
<strong>Wirklichkeit</strong>en ist. Sie beinhalten eine andere Struktur<br />
als der herkömmliche Hollywoodfilm, der sich auf den<br />
im Laufe der Zeit herausstrukturierten Aufbau aus “Ex-<br />
position-Konflikt-Auflösung” bezieht.<br />
Filmprotagonisten begegnen nach ihrer Vorstellung und<br />
der Einführung in Ort und Zeit des Geschehens (Ex-<br />
position) mindestens einem Problem, das zu lösen ist<br />
(Konflikt), was sie schließlich zumeist unter Aufbietung<br />
trickreicher Mittel und dem Einsatz aller Kräfte auch<br />
schaffen (Auflösung).<br />
In neueren Filmen mit Bezug zur Identitätsthematik<br />
ist die “Auflösung” allerdings keine Problemlösung.<br />
Vielmehr wird die bisher erzählte Geschichte (Exposition<br />
und Konflikt) aufgelöst in einem anderen Sinne, jenem<br />
der Dekonstruktion:<br />
Exposition und Konflikt erweisen sich als eine Sinnver-<br />
schiebung, welche in der verzerrten Wahrnehmung der<br />
Hauptfigur begründet liegt.<br />
In verschiedenen Filmen ( z.B. The Others, The Sixth<br />
Sense) halten sich bereits tote Hauptfiguren bis zum<br />
Ende der Geschichte für lebendig und normal. Sie hallu-<br />
zinieren sich in ein anders Leben hinein.<br />
Der Erzähler (die Hauptfigur) kommt in diesen Filmen<br />
seiner Aufgabe der Wissensvermittlung in höchstem<br />
Maße “unzuverlässig” nach und steht in einem starken<br />
Missverhältnis zu dem, was “eigentlich” passiert. Dieses<br />
beruht auf Auslassungen, Non-Linearität des Gezeigten<br />
und vor allem der Präsentation der Narration aus der<br />
Traumata wurden schon in früheren Filmen als Thema<br />
behandelt, zum Beispiel in Suspense-Filmen, wie Vertigo<br />
und Spellbound von Alfred Hitchcock. Dort weiß jedoch<br />
sowohl die Hauptfigur als auch der Zuschauer rasch um<br />
seinen traumatisierten Zustand Bescheid. Bei Filmen hin-<br />
gegen, die sich dem Genre des Mindfuck-Films zuordnen<br />
lassen, sitzt der Zuschauer der Täuschung bis zum Ende<br />
auf.<br />
Die meisten herkömmlichen Mainstream-Filme zeigen,<br />
dass sich der Film auf einen idealen Endzustand zube-<br />
wegt, der die aufgeworfenen Probleme löst, seine Fragen<br />
beantwortet und mit Weltsicht, Werthaltungen und<br />
Sympathien übereinstimmt. Dies zeigt auch das Modell,<br />
das Michaela Krützen in dem Buch Die Dramaturgie<br />
des Films entwirft. Hierbei vollführt der Held während<br />
des Films eine Reise ( sowohl eine innere als auch eine<br />
äußere ), bei der er aus seinem ihm bekannten Umfeld<br />
heraus aufbricht, in eine unbekannte Welt reist und am<br />
Ende wieder in seiner ihm bekannten Welt ankommt.<br />
verzerrten Perspektive des Helden. Dies führt dazu, dass<br />
der Zuschauer Zusammenhänge konstruiert, welche<br />
sich am Ende des Films, wenn die ganze Geschichte<br />
rekonstruierbar wird, meist als falsch herausstellen. Der<br />
Zuschauer hat durch die Struktur des Films an der ima-<br />
ginierten bzw. simulierten Realität des Helden, seinen<br />
Wahnvorstellungen und Halluzinationen oder Träumen,<br />
ohne dies zu wissen, teilgenommen. So schreibt der<br />
Filmkritiker und Drehbuchautor Jonathan Eig in seiner<br />
Abhandlung A beautiful Mind(fuck): Hollywood struc-<br />
tures of identity:<br />
„First, in these films the character with the surprise invariably is the protagonist, as<br />
opposed to a supporting character who affects a more “normal” hero. The next two<br />
characteristics work in tandem. The hero in question does not know the true nature of<br />
his identity and so is not simply keeping a secret from us. And the audience does not<br />
know the backstory either. We are not let in on a secret the hero does not know.“<br />
Das Auftauchen des Genre des Mindfucks lässt sich<br />
vielleicht durch die Erfahrung der Virtualiät der<br />
Welt erklären: Vor allem mit der Veralltäglichung der<br />
<strong>Wirklichkeit</strong>seffekte produzierenden Medien TV, Kino,<br />
Radio, Computer und Internet und der entsprechenden<br />
Installation eines immer schwieriger zu reduzierenden<br />
Möglichkeitsraums alternativer Sinn- und Deutungsan-<br />
gebote geht dem Menschen die Unterscheidbarkeit von<br />
„<strong>Wirklichkeit</strong>” und „Fiktion” verloren.<br />
Der Mindfuck-Film könnte den Zuschauer auf die<br />
Konstruktionsleistungen aufmerksam machen, die not-<br />
wendig sind, damit uns unsere <strong>Wirklichkeit</strong> als objektiv<br />
gegeben und selbstverständlich erscheint und damit<br />
Relativität und Kontingenz der scheinbar selbstverständ-<br />
lichen Alltagswelt betonen.<br />
Er wird somit vielleicht auch zu einer Aufklärung über<br />
die Medien.
12 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Hintergrund<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 13<br />
In dem Film Stranger Than Fiction wird die Hauptperson durch eine grafische Ebene zusätzlich charakterisiert.<br />
Andere <strong>Wirklichkeit</strong>sebenen<br />
In einigen Filmen taucht eine die normale Filmwirklichkeit brechende Ebene auf. Sie erweitert<br />
den Film, beziehungsweise die Hauptfigur, um eine weitere Aussage.<br />
Weitere Beispiele für eine, meiner Meinung nach, interes-<br />
sante Auseinandersetzung mit <strong>Wirklichkeit</strong> sind Eternal<br />
Sunshine of the Spotless Mind, I Heart Huckabees und<br />
Stranger Than Fiction.<br />
Eternal Sunshine of the Spotless Mind setzt sich in einer<br />
besonderen Weise mit der <strong>Wirklichkeit</strong> auseinander.<br />
Über weite Teile des Films befinden wir uns in den<br />
Erinnerungen eines Mannes, der seine Erinnerungen<br />
an seine Freundin löschen will. Während des Lösch-<br />
vorganges, der von einer Firma durchgeführt wird, die<br />
die Möglichkeit Erinnerungen zu löschen entwickelt<br />
hat, möchte er sich nicht mehr von den Erinnerungen<br />
an seine Freundin trennen. Er versteckt sie in anderen<br />
Erinnerungen. Der Film wird zu einer bildlich umgesetz-<br />
ten Collage aus wirklichen Erinnerungen und “neu-<br />
entstandenen” Erinnerungen, die durch den Versuch<br />
die Freundin der Hauptfigur zu verstecken, entstehen.<br />
I Heart Huckabees und Stranger Than Fiction sind auf<br />
eine andere Art interessant. Sie erweitern die bildliche<br />
filmische Realität um eine weitere Komponente: eine gra-<br />
fische. Diese grafische Komponente bricht die eigentliche<br />
filmische Realität, vermittelt aber eine weitere Aussage<br />
über den Hauptcharakter bzw. die Philosophie des Films.<br />
Der Film I Heart Huckabees setzt sich mit zwei unter-<br />
schiedlichen Weltanschauungen auseinander: Alles ist<br />
verbunden und Nichts ist verbunden, alles ist Chaos.<br />
Während des Films kommt es mehrmals zu einer visuel-<br />
len Veranschaulichung dieser Theorien,<br />
wodurch die filmische Realität um eine grafische<br />
Ebene gebrochen aber gleichzeitig erweitert wird.<br />
Bei dem Film Stranger Than Fiction tauchen wiederum-<br />
mehrmals grafische Elemente auf, die die Darstellung<br />
des Hauptcharakters unterstützen. Die Hauptfigur<br />
des Films ist ein sehr ordentlicher, präziser, korrekter,<br />
ständig berechnender Mensch. Die grafische Ebene<br />
unterstützt dieses Bild, da sie seine Kalkulationen visu-<br />
alisiert. Des weiteren könnten sie auch einen Bezug zu<br />
dem Thema des Films herstellen. Die Hauptfigur ist eine<br />
Romanfigur der in dem Film vorkommenden Autorin.<br />
Szene aus dem Film I Heart<br />
Huckabees bei der die Philo-<br />
sophie, alles sei miteinander<br />
verbunden, visualisiert wird.
14 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Hintergrund<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 15<br />
Mockumentary<br />
Eine andere Form des Films, die sich auf eine ganz andere Art und Weise mit dem Thema <strong>Wirklichkeit</strong><br />
beschäftigt ist der sogenannte Mockumentary. Hier wird der Zuschauer durch die gewählte Form<br />
in dem Glauben gelassen, es handele sich bei dem betrachteten Film um einen Dokumentarfilm.<br />
Hierfür sei Kubrick, Nixon und der Mann im Mond<br />
als Beispiel genannt. Dieser Film, für den William Karel<br />
2003 den Adolf-Grimme-Preis erhielt, behandelt als<br />
zentrales Thema die Möglichkeit der Manipulation und<br />
Irreführung durch Medien.<br />
Die vermeintliche Dokumentation „beweist“ mit<br />
geschickt zusammengeschnittenen Informationsfetzen<br />
aus anderen Filmen und realen und fiktiven Interviews,<br />
dass Stanley Kubrick von der US-amerikanischen<br />
Regierung engagiert worden war, um die erste Landung<br />
auf dem Mond zu inszenieren und somit vorzutäuschen.<br />
Hiermit sollte vom Vietnamdesaster abgelenkt werden.<br />
Dieser Film berichtet nicht über Manipulationsfälle,<br />
sondern führt die Manipulation selbst gelungen vor.<br />
Er stellt Zusammenhänge zwischen Nixon, Kubrick,<br />
der Mondlandung und dem Vietnamkrieg her und wird<br />
im Verlauf langsam aber stetig immer abstruser, bleibt<br />
jedoch immer der Form des Dokumentarfilms treu.<br />
Auch durch das Auftreten von bekannten realen Zeit-<br />
zeugen wie Buzz Aldrin (Astronaut der Apollo 11),<br />
Henry Kissinger, Donald Rumsfeld und der Ehefrau<br />
Stanley Kubricks, Christiane Kubrick, wird weitere<br />
Glaubwürdigkeit beim Zuschauer erzeugt.<br />
Weitere Manipulationen des Filmes bestehen auch in<br />
der Aneinanderreihung kurzer, ausgewählter Interview-<br />
fragmente, so dass durch den nun entstanden Kontext<br />
eine völlig neue, vom Interviewten nicht beabsichtigte<br />
Bedeutung aufgebaut wird. Bei Interviews in Sprachen,<br />
die dem vermeintlichen Zuschauer fremd sind, wurden<br />
die Untertitel bewusst falsch und in der Form über-<br />
setzt, dass sie der Aussage des Filmes entsprachen.<br />
Zu authentischen Ton- und Bildaufnahmen erzählt<br />
eine als glaubwürdig wahrgenommene Erzählerstimme<br />
von nicht immer wahren „Tatsachen“ und konstruiert<br />
so in Zusammenhang mit der stimmig untermalenden<br />
Musik eine neue der Theorie entsprechende „Wirklich-<br />
keit“. Weitere „Glaubwürdigkeit“ erhält der Film durch<br />
die Tatsache, dass einer der Interviewten (Vernon<br />
Walters) kurz nach dem Interview starb, was als Beweis<br />
für eine Vertuschung hingestellt wird.<br />
Der Abspann des Films löst die scheinbare <strong>Wirklichkeit</strong><br />
des Dokumentarfilmes jedoch auf, indem einige entlar-<br />
vende Versprecher und Kommentare von„Zeitzeugen”<br />
gezeigt werden.<br />
Interessant ist hierbei auch, dass dieser Film von eini-<br />
gen Anhängern dieser Verschwörungstheorie, trotz des<br />
Abspannes, für wahr erachtet und damit als Beweis für<br />
die eigene Theorie gesehen wurde. Künstliche “Wirk-<br />
lichkeit” wird zu einer neuen <strong>Wirklichkeit</strong>.<br />
Dieses Beispiel bestätigt wieder die Theorie Watzla-<br />
wicks, dass man sich von einer, zunächst für wahr<br />
gehaltenen Theorie, trotz gegensätzlicher Beweise<br />
schwer wieder trennen kann.<br />
In dem Film Kubrick, Nixon und der Mann im Mond wird Kubrick mit der Inszenierung der Mondlandung in Verbindung gebracht.
16 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 17<br />
U2x2<br />
Berlin erkundet anhand der Umgebung von 29 U-Bahnstationen der U-Bahnlinie 2. Fotografiert<br />
aus der Sicht von zwei Fotografen. Zwei verschiedene Wahrnehmungen der Orte im Vergleich.<br />
U2x2 ist ein Fotoprojekt, das in Zusammenarbeit mit<br />
Valeria Galassi im Jahre 2004 entstand. Diese Arbeit<br />
beschäftigt sich mit der Thematik der unterschiedlichen<br />
Wahrnehmung des gleichen Ortes durch unterschiedliche<br />
Personen. Wie nimmt eine Person einen Ort wahr? Was<br />
erscheint ihr als Motiv interessant?<br />
Hierbei wählten wir das direkte Umfeld sämtlicher<br />
Stationen der U-Bahnlinie 2 als zu fotografierende Orte<br />
Gleisdreieck aus der Sicht von Valeria Galassi<br />
aus und fotografierten diese unabhängig von einander.<br />
Dabei sollte ein Zeitrahmen von nur wenigen Minuten<br />
pro Station eingehalten werden, so dass nur eine kurze<br />
Orientierung möglich war und das Motiv durch den<br />
Zeitdruck relativ intuitiv gefunden werden musste.<br />
Die dabei entstandenen Fotos stellten wir einander<br />
gegenüber.<br />
Gleisdreieck aus der Sicht von Janek Jonas
18 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen – U2x2<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 19<br />
Kasierdamm<br />
Deutsche Oper<br />
Nollendorfplatz<br />
Potsdamer Platz<br />
Klosterstraße<br />
Märkisches Museum<br />
Sophie-Charlotte-Platz<br />
Ruhleben
20 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 21<br />
Noisulli<br />
Ein Mann, eine Frau, eine zufällige Begegnung, die jedoch unbemerkt bleibt. Wie oft laufen wir an<br />
Menschen vorbei, die es wert wären kennengelernt zu werden, ohne sie zu bemerken? In dem Kurzfilm<br />
Noisulli schenken die Spiegelbilder der Begegnung jedoch Beachtung.<br />
Noisulli aus dem Jahr 2005, ist ein Kurzfilm mit ver-<br />
schiedenen <strong>Wirklichkeit</strong>sebenen. Die erste Ebene<br />
beinhaltet einen Mann und eine Frau, die eine zufällige<br />
Begegnung haben, sich aber nicht bemerken. Auf der<br />
zweiten Ebene befinden sich ihre Spiegelbilder. Die Spie-<br />
gelbilder des Mannes und der Frau bemerken einander<br />
und scheinen sich gegenseitig interessant zu finden. Auf<br />
der dritten Ebene kommuniziert das männliche Spiegel-<br />
bild mit seinem realen „Vorbild”.<br />
Das Spiegelbild bringt sein Vorbild dazu ihm zu folgen.<br />
Es kommt schließlich zu einem Wiedersehen der Spiegel-<br />
bilder und der realen Menschen. Die realen Menschen<br />
bemerken sich erneut nicht, während sich die Spiegelbil-<br />
der (auch als Sinnbild der Fiktion zu betrachten) jedoch<br />
freudig in die Arme schließen und gemeinsam ihre realen<br />
Vorbilder verlassen.
22 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 23<br />
Zu dem, was er mal war...<br />
Die Vergangenheit ist nicht rekonstruierbar, sondern nur von uns mit Hilfe der Sprache beschreibbar.<br />
Was war, ist weg.<br />
– Heinz von Foerster<br />
Der Film Zu dem, was er mal war... ist u.a. eine Ausei-<br />
nandersetzung mit Erinnerung und Rekonstruktion von<br />
Vergangenem. Er entstand in Zusammenarbeit mit Tarik<br />
Schirmer im Jahr 2005/2006 im Rahmen der Ausein-<br />
andersetzung mit dem Lenné-Park in Baruth, Branden-<br />
burg. Der Film stellt eine Erforschung der Geschichte<br />
des Parks dar. Zeitzeugen wandern durch den Park<br />
und berichten von ehemals im Park vorhandenen aber<br />
inzwischen verschwundenen Anlaufpunkten wie einer<br />
Freilichtbühne, einem Parkrestaurant, einem Sportplatz,<br />
einer Schule, einem Kindergarten und einem Kino.<br />
In ihren Erinnerungen lebt das Vergangene wieder auf,<br />
was, je nach Erzähler, manchmal zu unterschiedlichen<br />
vergangenen <strong>Wirklichkeit</strong>en führt.<br />
Zeitzeugen berichten von ihren Erinnerungen.
24 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 25<br />
Janis Vartukapteinis<br />
Er war ein anerkannter Künstler und Fotograf, der sich mit dem Thema Identität auseinandersetzte.<br />
In den 60er - 80er Jahren lebte und arbeitete er in New York. Vartukapteinis war ein produktiver Künstler.<br />
Jedoch war er nur erfunden.<br />
Fotoprojekt i am you<br />
Während des Seminars im Wintersemester 2005/2006<br />
Das Medium Lüge bei Professor Gerburg Treusch-Dieter<br />
entstand in Zusammenarbeit mit Daniel Urria die Kunst-<br />
figur Janis Vartukapteinis. Wir schufen für Vartukaptei-<br />
nis eine Lebensgeschichte und einige Kunstwerke. Eine<br />
im Internet entdeckte Sammlung an Passfotos diente der<br />
Erschaffung seiner Identität. Als Herkunftland wählten<br />
wir Lettland, von dem wir annahmen, dass seine Ge-<br />
schichte den Kursteilnehmern nicht näher bekannt sei.<br />
Ziel dieses Projektes war der Versuch, eine real nicht<br />
existierende Person zum Leben zu erwecken und zu<br />
erproben, ob sich dies im Rahmen einer universitären<br />
Veranstaltung umsetzen ließ.<br />
Janis Vartus (Vartukapteinis)<br />
18.12.1939 Geboren in Ludza, Lettland.<br />
1958 –1960 Kunststudium an der Hochschule der<br />
Künste Reskene.<br />
1960 Umzug nach Riga.<br />
1961 – 64 Studium an der Kunstakademie Riga.<br />
Anschluss an die Lettische Künstler-<br />
bewegung Melideja (Lügentanz).<br />
1965 Flucht nach New York.<br />
ab 1967 Mitarbeit als freier Fotograf für ver<br />
1989 gestorben in NY<br />
schiedene Zeitungen und Zeitschriften<br />
Ausgewählte Arbeiten<br />
1973 Fotoaustellung you are me<br />
Passfotos von anderen Menschen mit Namen von Janis<br />
Vartukapteinis<br />
1974 Fotoaustellung i am you<br />
Passfotos von Janis Vartukapteinis, auf denen er die Na-<br />
men anderer Personen annimmt und sich entsprechend<br />
verkleidet<br />
1975 Performance Do you look like me? / Ausstellung<br />
Do I look like you?<br />
Veröffentlichung der Biografie
26 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 27<br />
Dame mit Teddy<br />
Eine ältere Frau sitzt an einem öffentlichen Platz. Sie hat einen Teddybär auf ihrem Schoß.<br />
Eine Handkamera beobachtet das Geschehen.<br />
Man weiß nicht wer die ältere Dame ist, was sie macht.<br />
Sie wirft einen Teddybären freudig in die Luft, spielt<br />
mit ihm. Sie schaut ihn sich genauer an, stutzt seine<br />
Fingernägel und bemalt seine Ohren. Sie scheint ein inni-<br />
ges Verhältnis zu ihm zu haben. Sie scheint in einer<br />
anderen <strong>Wirklichkeit</strong> zu sein, nur auf ihren Teddybär<br />
konzentriert. Es ist eine skurrile Situation. Der Film lässt<br />
nicht erkennen, ob er inszeniert ist oder ob es sich nur<br />
um eine zufällige Aufnahme handelt.<br />
Wer ist diese Frau? Ist sie eine Schauspielerin oder eine<br />
reale Person? Was ist wirklich? Dieser Film enstand<br />
im jahre 2006.
28 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 29<br />
Nearly one year me<br />
Was ist mein stabiler Wert? Wie verändere ich mich im Laufe der Diplomarbeit? Verändere ich mich?<br />
Ich erkenne mich immer wieder. Ich bleibe ich. Es entstand ein kurzer Film, bei dem jede Sekunde durch<br />
12 Tage gefüllt wird. Das Ich in einem zeitlichem Fluss.<br />
Selbst:<br />
Die Vorsilbe Selbst- enthält ein Moment der Zirkulari-<br />
tät, der Begriff verweist auf denjenigen, der ihn ge-<br />
braucht zurück. Das Bewusstsein des Bewusstseins ist<br />
das Selbstbewusstsein. Das Selbst erscheint nicht als<br />
etwas Statisches oder Festes, sondern wird permanent<br />
und immer wieder erzeugt. Es gerät in Bewegung. Das<br />
Selbst ändert sich, in jedem Moment, in jeder einzigen<br />
Sekunde. Der Begriff des Selbst ist die engste und letzte<br />
Spielform der Zirkularität. Es ist die Zirkularität des<br />
Ichs.<br />
Das Ich ist demnach die Reflexion der Reflexion ad infi-<br />
nitum. Das Ich kann als der Eigenwert der unendlichen<br />
Reflexion über sich selbst verstanden werden.<br />
Selbsterkennen:<br />
Man sieht sich morgens im Spiegel und gelangt zu der<br />
Überzeugung man ist es selbst, der da in den Spiegel<br />
schaut. Jedoch sieht man niemals dasselbe Bild in dieser<br />
ununterbrochenen, sich verändernden Welt. Wie lässt<br />
sich jetzt dieser Eindruck von Stabilität vor dem Hinter-<br />
grund des fortwährenden Wandels begründen? Mathe-<br />
matisch kann man dieses Phänomen als das Errechnen<br />
von Invarianten begreifen: als die Errechnung von<br />
Konstanz und stabilen Werten in einem Prozess fortwäh-<br />
render Transformation.<br />
(Aus dem Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners<br />
von Heinz von Foerster und Bernhard Pörksen)
30 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – eigene Referenzen – Nearly one year me<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 31<br />
Das Projekt begann im Mai 2006. Fast täglich nahm ich ein Foto auf. Die letzten Bilder entstanden im April 2007.
32 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 33<br />
„Mondmanns Faden“<br />
Der folgende Teil dieser Dokumentation beinhaltet die Entwicklung des Diplomprojektes<br />
– von den ersten konzeptionellen Ansätzen bis zum fertigen Film.
34 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Projektansätze<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 35<br />
Konzept-Ansätze<br />
Während der Überlegungen zu der Umsetzung des praktischen Teils schwankte ich zwischen verschiedenen<br />
Konzepten, die mir interessant erschienen. Eine kurze Beschreibung einiger Ansätze.<br />
Weißraum<br />
Entwicklung einer episodenartigen Geschichte, in der<br />
sich der Protagonist in einem undefinierbaren Raum<br />
befindet. Er hat keinerlei Erinnerungen an sein vorheri-<br />
ges Leben. Er ist zu schwach um das Bett zu verlassen.<br />
Informationen über sein Leben erhält er durch Besucher,<br />
Fake-Dokumentation<br />
Entwicklung eines Mockumentary um eine in Deutsch-<br />
land unbekannte Musikgruppe, die in einem anderen<br />
Land großen Erfolg hat. Mit Hilfe von Interviewschnip-<br />
seln von bekannten Persönlichkeiten der Musikbranche,<br />
Video-Tagebuch<br />
Entwicklung eines videotagebuchartigen Kurzfilmes. An<br />
mehreren Stellen gibt es einen Bezug zu tatsächlichen<br />
aktuellen Ereignissen. Der Film beschreibt die Zeit eines<br />
Virtuelles Kunstwerk<br />
Die Entwicklung eines virtuellen Kunstwerks. Mit<br />
verschiedenen Mitteln, beispielsweise „gefälschten”<br />
Presseberichten, Ausstellungskatalogen, Programman-<br />
zeigen, Nachrichten, Reportagen usw. wird versucht ein<br />
Zwei Orte<br />
Entwicklung eines Kurzfilms, welcher an zwei verschie-<br />
denen Orten spielt. An diesen Orten leben zwei Men-<br />
schen, die auf irgendeine Art und Weise verbunden sind.<br />
Ihre Leben beeinflussen sich gegenseitig. Sie sind abhän-<br />
die ihm über sich selber, sein früheres Leben und die<br />
Welt “draußen” erzählen. In verschiedenen Episoden, in<br />
denen dieselben Schauspieler als Charaktere auftreten,<br />
werden dem Protagonisten hierdurch verschiedene Iden-<br />
titäten übergestülpt. Mal ist er Held, mal der Schurke.<br />
montierten Konzerten vor scheinbar riesigem Publikum,<br />
Interviews mit Band und Fans und mit Hilfe von Mon-<br />
tage und Effekten, Auftritten in Shows und Nachrichten<br />
soll die Fiktion einer Band entstehen.<br />
Studenten in der Diplomphase. Er beginnt scheinbar<br />
realistisch und könnte ein authentisches Videotagebuch<br />
sein, wird jedoch immer abstruser und unwirklicher.<br />
Kunstwerk entstehen zu lassen, welches nicht existiert.<br />
Es wird eine Geschichte um dieses Kunstwerk geschaf-<br />
fen.<br />
gig voneinander. Begegnen sie sich? Kennen sie sich?<br />
Die beiden Personen leben in unterschiedlichen Wirk-<br />
lichkeiten, werden jedoch durch eine gemeinsame Wirk-<br />
lichkeit verbunden.
36 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – zwei Orte – Konzept<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 37<br />
Zwei Orte - Konzept<br />
Nach einiger Recherche entschied ich mich für das Konzept der zwei Orte. Mir erschien es als sehr interessant<br />
zwei verschiedene Orte, die vermeintlich nicht sehr viel miteinander zu tun haben zu verbinden,<br />
an zwei unterschiedlichen Orten eine gemeinsame <strong>Wirklichkeit</strong> zu konstruieren.<br />
Ich suchte nach Hintergründen und Konstruktionen,<br />
die die Verbindung zwischen den beiden Orten bzw. den<br />
beiden Personen, die an diesen beiden Orten leben,<br />
erklären konnten. Während meiner Suche stieß ich auf<br />
einige Mythen, Redewendungen und Ansätze, die<br />
im Zusammenhang mit Verbundenheit stehen.<br />
Der Mann im Mond bindet vor der Geburt jedem Neugeborenen einen Faden um<br />
den großen Zeh. Das andere Ende des Fadens bindet er um den Zeh eines zweiten<br />
Neugeborenen. Auf diese Art und Weise entsteht eine Verbundenheit zwischen zwei<br />
Menschen, die sich an völlig verschiedenen Orten befinden können.<br />
Chinesischer Mythos<br />
Der Wind ist ein Faden, der die Welt zusammen hält.<br />
Altindische Vorstellung<br />
Jeder kennt jeden über sechs Ecken.<br />
Allgemeinbekannte Theorie<br />
Wenn in China ein Reissack umfällt, kann er bewirken, dass in Europa ein Sturm<br />
entsteht.<br />
Volksweisheit<br />
Im Mond spiegelt sich das Antlitz der Erde.<br />
Altgriechischer Philosoph<br />
Yin und Yang<br />
Begriffe aus der chinesischen Philosophie. Bei Yang handelt es sich um das Prin-<br />
zip Himmel, bei Yin um das Prinzip Luft. Der Übergang von Yin zu Yang ist dabei<br />
fließend. Yin und Yang sind vor allem durch ihr Zusammenspiel gegeben. Harmonie<br />
und Ausgeglichenheit zwischen diesen beiden entgegengesetzten Kräften sind in der<br />
chinesischen Philosophie ein zentraler Punkt.<br />
In dem Buch Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners<br />
von Heinz von Foerster und Bernhard Pörksen stieß ich<br />
ebenfalls auf ein paar Ansätze zum Thema der Verbun-<br />
denheit:<br />
Im Englischen heißt es: You can’t tango alone! You need two to tango. Man braucht<br />
den anderen und führt sich gegenseitig, erspürt den gemeinsamen nächsten Schritt und<br />
verschmilzt mit den Bewegungen des anderen zu ein und derselben Person, zu einer<br />
Wesenheit, die mit vier Augen sieht. <strong>Wirklichkeit</strong> wird zur Gemeinsamkeit und zur<br />
Gemeinschaft.<br />
Die Frage, ob wir von der Welt getrennt oder mit ihr<br />
verbunden sind, so von Foerster, lässt sich prinzipiell<br />
nicht endgültig klären. Wir können uns nur für eine<br />
dieser beiden Haltungen entscheiden und für diese Wahl<br />
Verantwortung übernehmen. Man entschließt sich, die<br />
Dinge, die Welt und seine Mitmenschen auf eine beson-<br />
dere Weise zu betrachten und entsprechend zu handeln.<br />
Man wird verantwortlich für die Entscheidung, die<br />
Ich begab mich auf die Suche nach zwei zu verbinden-<br />
den Orten. Meine Wahl fiel relativ schnell auf Berlin und<br />
Hoima (Uganda). Berlin aus dem Grund, weil ich hier<br />
lebe und so jederzeit unter dem Einfluss der Stadt stehe,<br />
ich dadurch die Möglichkeit habe in unmittelbarer Nähe<br />
ohne großen Aufwand drehen zu können.<br />
Viele Leute sehen diese Verbindung nicht, sie schneiden die Seile durch - und stürzen<br />
in die Tiefe. Aber gemeinsam am Seil zu gehen heißt, dass wir ganz<br />
und gar eins sind. Man trennt sich nicht, sondern ist verbunden mit der Welt und dem<br />
anderen, der einen nicht fallen lässt. Und was dir geschieht,<br />
geschieht mir. Und was mir geschieht, geschieht dir.<br />
man getroffen hat und die einem niemand abnehmen<br />
kann.<br />
Von Foerster und Pörksen sprechen an einer Stelle des<br />
Buches konkret über die Idee der Verbundenheit zwi-<br />
schen Menschen. Die Betrachtung des Bergsteigens, bei<br />
dem die Bergsteiger mit einem Seil miteinander verbun-<br />
den sind, führt zu der Vorstellung des gemeinsamen Am-<br />
Seil-Gehens als Konkretion der Idee von Verbundenheit:<br />
Für Hoima entschied ich mich, weil mein Vater in dieser<br />
Stadt zur Zeit arbeitet und mir so die Möglichkeit gege-<br />
ben war an einen Ort zu gelangen, den ich nicht kannte<br />
und der eine im Gegensatz zu Berlin andere „Wirklich-<br />
keit” zu besitzen schien.
38 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 39<br />
Mondmanns Faden<br />
In Anlehnung an den chinesichen Mythos, der die Verbindung zwischen Menschen durch den Mann im<br />
Mond beschreibt, entschied ich mich für den Titel „Mondmanns Faden“.<br />
Nach verschiedenen Ansätzen eine konkrete Geschichte<br />
zu erzählen verabschiedete ich mich von der Idee, im<br />
Vorfeld der Reise nach Uganda ein konkretes Drehbuch<br />
zu erarbeiten. Ich wollte mir Freiheiten lassen, da ich<br />
das erste Mal in Uganda sein würde. Ich kannte weder<br />
das Land noch die Menschen. Ich wusste nicht, was<br />
mich erwarten würde. Daher war es mir nicht möglich,<br />
mich im Vorhinein gedanklich an diesen Ort zu ver-<br />
setzen und eine mir nicht bekannte <strong>Wirklichkeit</strong> zu<br />
konstruieren. Mich reizte die Idee, mich von dem Ort,<br />
von den Gegebenheiten und den Menschen inspirieren<br />
zu lassen.<br />
So entstand das Konzept zuerst in Afrika zu drehen<br />
und dann auf diese Bilder aufbauend in Berlin mit<br />
einer Schauspielerin den Film weiterzuentwickeln.<br />
Aus diesem Grund erarbeitete ich im Vorfeld der Reise<br />
einen Katalog an möglichen Einstellungen und Kon-<br />
zepten, die Verbindungen zwischen den beiden Orten<br />
und Personen darstellen könnten, von denen ich einige<br />
umsetzen wollte. Daraus ergaben sich folgende<br />
mögliche Verbindungen...<br />
Inhaltlich:<br />
Ein erklärender verbindender Mythos<br />
Ein Erzähler erzeugt eine Verbindung<br />
Eine gemeinsame Handlung<br />
Ein Buch erzählt die Geschichte<br />
Sich überschneidene Ereignisse: Nachrichten<br />
Übertreten von Gegenständen, Objekten, Gebäuden von einem Ort zum anderen:<br />
Fliegende Objekte: Seifenblasen, Luftballon, Papierflieger<br />
Treibende Objekte: Flasche, Papierschiff, Abfall,<br />
Inhaltliche Objekte: Zeitung, Bild, Stoff, Elefant, Briefe, Geld<br />
Sich überschneidene Handlungen: Radio hören, Fernsehen, Suchen / Finden<br />
Wasser wird verschüttet und wird zu Regen<br />
Staub wird zu Schnee<br />
Formal:<br />
Farbe: gleiche Farbwerte, die die beiden Orte verbinden<br />
Form: gleiche bzw. ähnliche Form<br />
Bewegung: U-Bahn, Fahrtaufnahmen, gleiche Bewegungen, die fortgesetzt<br />
werden können:<br />
Gehen, umrühren, Musizieren, Ballspielen (Tennis, Tischtennis), Hände-<br />
schütteln, Schreiben, Hinstellen, Wegstellen, Schwimmen, Geben / Nehmen<br />
Ton: derselbe Ton, Musik oder Geräusche, die sich ergänzen, afrikanische<br />
und europäische Anteile<br />
Schnitt: Schnitt / Gegenschnitt, Blickrichtung, Bewegung, Reißschwenks<br />
Grafisch: grafische Übergänge, Elemente aus Kulturkreisen,<br />
Fäden, Verwandlung vom Abstrakten zum Bild, Verwandlung<br />
vom Text zum Bild, Zeichnungen, Cartoon, Bild zur Karte<br />
Collage: ineinander komponierte Bilder, Wasser und Spiegelungen,<br />
Foto im Hintergrund, das sich langsam bewegt, Splitscreen<br />
Gegensätze: hell-dunkel; Sommer-Winter; Glück-Trauer;<br />
einsam-gesellig; warm-kalt; aktiv-passiv
40 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 41<br />
Dreharbeiten in Uganda<br />
Mit dem im vorherigen Abschnitt erwähnten Konzept im Gepäck reiste ich nach Uganda.<br />
Während eines Aufenthaltes in der Hauptstadt Kampala entstanden erste Aufnahmen.<br />
Erste Impressionen und Stimmungsbilder wurden einge-<br />
fangen, die im späteren Film mit Berliner Aufnahmen<br />
kombiniert werden und auch als Sehnsuchtsort, der<br />
Berliner Person, die sich an einen anderen fernen Ort<br />
wünscht, dienen konnten. Dabei entstanden auch Auf-<br />
nahmen von Zwischenorten, Orte die sich beim losge-<br />
lösten Betrachten nicht eindeutig vom Zuschauer als<br />
zu Uganda gehörig zuordnen ließen. Diese sollten beim<br />
Betrachter ein Gefühl der Konfusion und Irritation<br />
auslösen, ihn loslösen von einer <strong>Wirklichkeit</strong> mit realen,<br />
getrennten Orten und ihn zu einer andern <strong>Wirklichkeit</strong><br />
eines verbundenen Ortes führen.<br />
Während einer Rundreise entstanden auch einige stereo-<br />
type Sehnsuchtsbilder von Landschaft und wilden Tier-<br />
en, Fahrtaufnahmen, die mit Fahrtaufnahmen in Berlin<br />
verbunden werden und so eine surreale Reise entstehen<br />
lassen konnten.
42 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Dreharbeiten in Uganda<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 43<br />
Während meines Aufenthaltes wurde mir klar, dass ich<br />
mich, so wie ich mich der mir zugänglichen ugandischen<br />
<strong>Wirklichkeit</strong> näherte, der <strong>Wirklichkeit</strong> des Filmprojektes<br />
nähern wollte; das ganze Projekt mehr als einen ständig<br />
sich entwickelnden Prozess zu sehen.<br />
In Hoima entstanden konkretere Bilder. Ich wollte Bilder<br />
einfangen, die mit Berliner Situationen vergleichbar<br />
waren, jedoch auf ihre afrikanische Art und Weise auch<br />
total verschieden. Ich nahm verschiedene Stadtimpres-<br />
sionen auf, versuchte möglichst viel abzudecken und mir<br />
so später in der Kombination mit den Berliner Aufnah-<br />
men viel Freiheit zu lassen.<br />
Da ich in Berlin bereits eine mögliche Schauspielerin<br />
ausgewählt hatte, wollte ich auch in Uganda mit einer<br />
Frau als Schauspielerin arbeiten. Einerseits um eine<br />
bessere Vergleichbarkeit der beiden Personen zu erzielen<br />
und andererseits um beim Betrachter nicht zu sehr die<br />
Idee einer Liebesgeschichte aufkommen zu lassen.
44 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Dreharbeiten in Uganda<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 45<br />
Über eine Arbeitskollegin meines Vaters lernte ich die<br />
Studentin Juliet kennen, die Interesse hatte am Projekt<br />
mitzuwirken. Mit ihr führte ich zunächst ein Interview<br />
zu einigen Themen von <strong>Wirklichkeit</strong> und Wahrnehmung<br />
der Welt. Welche Probleme sieht sie? Welche Verbin-<br />
dungen? Mögliche Vorurteile von Afrikanern gegenüber<br />
Europäern und umgekehrt. Die Idee war, später im Film<br />
mit Hilfe von Schnitt und Gegenschnitt und passenden<br />
Aufnahmen der Berliner Person ein Gespräch entstehen<br />
zu lassen.<br />
Während des Interviews stieß ich allerdings auf einen<br />
Teil der ugandischen <strong>Wirklichkeit</strong>. Zu dem Zeipunkt des<br />
Interviews gab es einen der relativ häufigen Stromaus-<br />
fälle und im Nachbarhaus lärmte ein Generator, der den<br />
Ton relativ unbrauchbar machte.<br />
Im Folgenden entstanden einige Aufnahmen und ich<br />
konnte einige der im Vorfeld erdachten Szenen umset-<br />
zen.<br />
Ich hatte die Idee, dass die beiden Personen in einer Art<br />
Traum direkt miteinander kommunizieren und sich<br />
gegenseitig ihre Welt zeigen könnten. Dazu entstanden<br />
dokumentarische Aufnahmen in denen Juliet in direkter<br />
Kommunikation durch ihr Wohnhaus und die Stadt<br />
Hoima führt.<br />
Unter anderem entstand so auch eine Szene vor einem<br />
Spiegel, die im Film eine direktes Erblicken der anderen<br />
Person ermöglichen sollte. Die beiden Personen sehen in<br />
dem Anderen ihr eigenes Spiegelbild.<br />
Im späteren Film sollten verbindende Übergänge von der<br />
einen Welt zur anderen entstehen. In diesem Zusam-<br />
menhang entstand die Aufnahme eines Kindes, das mit<br />
einem Spielzeugauto spielte. Die Nahaufnahme des<br />
Autos sollte in eine Aufnahme eines realen in Berlin<br />
aufgenommen Autos übergehen und so eine Verbindung<br />
erschaffen.<br />
Juliet hatte nur begrenzt Zeit zum Drehen, weil sie wie-<br />
der in die Hauptstadt zum Studieren zurück musste. Mit<br />
den aufgenommen Bildern war ich schon recht zufrie-<br />
den. Jedoch hatte ich das Gefühl noch nicht alles, was<br />
ich an Aufnahmen brauchen würde, mitgenommen zu<br />
haben.
46 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Dreharbeiten in Uganda<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 47<br />
Im Verlauf des Aufenthaltes lernte ich einen Journalisten<br />
aus Hoima kennen, der sich für das Projekt interessier-<br />
te. Mit ihm zusammen entwickelte ich einen typischen<br />
Tagesablauf einer in Hoima wohnenden Person. Über<br />
ihn lernte ich auch die Darstellerin für diese Aufnahmen,<br />
Jovia, kennen.<br />
Das Filmen des zum Teil inszenierten Tagesablaufes<br />
ermöglichte mir im Vorfeld der Aufnahme eine bessere<br />
Planung der Kamerapositionierung. Dies führte im Ver-<br />
gleich zu den vorherigen Aufnahmen zu ruhigeren und<br />
konzentrierteren Bildern.
48 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 49<br />
Weiterentwicklung des Konzeptes<br />
Nach dem Sichten und Vorschneiden des in Uganda gedrehten Materiales entwickelte ich das ursprüngliche<br />
Konzept weiter. Auf das Sammeln des Materiales folgte eine Rückbesinnung zur Frage,<br />
was ich erzählen wollte.<br />
Ich entwickelte verschiedene Ansätze einer Geschichte,<br />
die man mit dem vorhandenen Material erzählen könn-<br />
te. Hierzu entstanden zunächst einige gröbere Verbin-<br />
dungskonzepte:<br />
Ein Buch tritt als Erzähler auf. Dieses Buch taucht sowohl in der ugandischen als<br />
auch in der deutschen <strong>Wirklichkeit</strong> auf. Es erzählt von dem Mythos und schafft so die<br />
Verbindung. Die Person in Hoima und die Person in Berlin lesen voneinander in dem<br />
Buch und treten so miteinander in Verbindung. Sie bemerken, dass sie die Geschichte<br />
verändern können, indem sie sie schreiben.<br />
Ein weiblicher Erzähler erzählt die Geschichte beider Personen. Es ist nicht genau<br />
zuzuordnen, zu wem diese Stimme gehört. Sie könnte zu beiden gehören. Durch die<br />
Stimme werden die beiden Personen zu einer.<br />
Zwei Personen an zwei Orten. Der Ort des einen ist der Imaginationsraum des ande-<br />
ren. Dinge, die er sich vorstellt, passieren an dem anderem Ort.<br />
Ein Erzähler versucht der Berliner Person, sie heißt Lena, davon zu überzeugen, dass<br />
es eine Geschichte gibt. Er stellt zunächst beide Personen vor. Lena hört irgendwann<br />
die Stimme des Erzählers und diskutiert mit ihm. Sie glaubt ihm nicht. Der Erzähler<br />
versucht immer wieder auf unterschiedlichste Art sie davon zu überzeugen, dass es<br />
eine Verbindung gibt. Schließlich zeigt er ihr den verbindenden Faden. Sie sagt, dann<br />
müsste ja jeder Mensch einen Faden an seinem Zeh haben. Dies bestätigt der Erzähler.<br />
Man sieht Menschen an deren Füßen Fäden gebunden sind. Daraufhin bemerkt Lena,<br />
dass der ganze Globus ein Netz aus Fäden sein müsste. Man sieht den Globus von<br />
Fäden umspannt. Der Wind ist ein Faden, der die Welt zusammenhält.<br />
Nachdem mich keiner der Geschichtsansätze wirklich<br />
überzeugte, entfernte ich mich davon eine konkrete<br />
Handlung zeigen zu wollen. Mich interessierte mehr die<br />
Möglichkeit mit gestalterischen Mitteln aus Alltagssitua-<br />
tionen der beiden Personen eine Verbindung zu entwi-<br />
ckeln. Was wollte ich also erzählen?<br />
Mir war die Aufladung verschiedener Bedeutungen Af-<br />
rikas in der westlichen Welt durchaus bewusst. Afrika,<br />
zum einen als Sehnsuchtsort, mit der Weite der Natur,<br />
der Ursprünglichkeit, der mystischen Andersartigkeit<br />
und Afrika, zum anderen als KKKK-Kontinent. Krank-<br />
heit, Krisen, Krieg, Katastrophen.<br />
In dem Buch Ach, Afrika - Berichte aus dem Inneren<br />
eines Kontinents von Bartholomäus Grill heißt es zu der<br />
Berichterstattung über Afrika:<br />
Der Erzähler sucht. Fährt nach Afrika. Sucht nach Verbindungen. Eine Metageschich-<br />
te. Er erzählt von dem Mythos. Von der Reise. Von den Dingen, die passieren. Er stellt<br />
beide Personen vor. Das hier ist Lena. Und das Juliet. Lena lebt in Berlin und macht<br />
sich auf die Suche nach Verbindungen. Konstruiert sie. Der Erzähler wird in seinem<br />
Alltag gezeigt. Der Alltag der anderen Personen wird gezeigt. Der Erzähler kommt<br />
mit seiner Geschichte nicht voran. Er liest. Surft im Internet. Beobachtet die Nach-<br />
barn. Redet mit Mitbewohnern. Wälzt sich im Bett. Flieht vor der Realität. Träumt.<br />
Verschwindet in anderen Welten, um nicht an seiner Geschichte arbeiten zu müssen.<br />
Schließlich kommt der Erzähler darauf, dass die Geschichte hier spielt. Auch in der<br />
Fremde ist nur Alltag.<br />
„Gefragt ist in der Regel die oberflächliche, flinke Depe-<br />
sche, die Sensationsmeldung oder die impressionistische<br />
Katastrophenstory, nicht die nachdenkliche Analyse<br />
oder die gelassen erzählte Geschichte.“<br />
Ich wollte keinen politischen Film über Afrika schaffen,<br />
sondern eine gelassen erzählte Geschichte über die Idee<br />
der Verbindung zwischen Menschen an unterschiedli-<br />
chen Orten.<br />
Das Problem war an diesem Punkt, dass immer noch<br />
alles zu offen war. Noch war jede Richtung möglich. Ich<br />
entschied mich aufgrund der ruhigeren und konzentrier-<br />
teren Art der Bilder, und der besseren Kombinierbarkeit<br />
gegen die Aufnahmen mit Juliet und für die Aufnahmen<br />
mit der Darstellerin Jovia und konzentrierte mich dar-<br />
auf, welche Art von Berliner Aufnahmen ich mit diesen<br />
in Verbindung bringen konnte.
50 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 51<br />
Dreharbeiten in Berlin<br />
Die Aufnahmen in Berlin bauen auf den Aufnahmen aus Uganda auf. Es werden den in Uganda<br />
gedrehten Szenen entsprechende, weiterführende und vorhergehende Bilder aufgenommen.<br />
In Berlin entstanden Aufnahmen, die eine parallele<br />
Handlung zeigten. Ich ließ mich von ugandischen Auf-<br />
nahmen inspirieren und entwickelte sie weiter. Ein weite-<br />
res Element war die Suche nache einem Zwischenort auf<br />
Berliner Seite. Hierfür bot sich der Botanische Garten<br />
an, der beim Betrachter im ersten Momente eine gewis-<br />
sen Konfusion erzeugen sollte. Eine künstliche Welt ent-<br />
steht, deren Künstlichkeit durch Aufnahmen des derzei-<br />
tigen Umbauprozesses verdeutlicht werden. Es ent-<br />
steht eine Sehnsucht nach der anderen Welt.<br />
Kleine Details erzeugen weiterhin eine Verbindung. So<br />
findet sich die Farbe der Morgenbekleidung der Person<br />
aus Hoima in dem Rock der Berliner Person wieder.<br />
Die Berliner Person läuft an einem Treff-International<br />
vorbei. Passend zu den ugandischen Aufnahmen<br />
entstehen Bilder, die einen direkten Blickkontakt zwi-<br />
schen den beiden Hauptpersonen erzeugen können und<br />
scheinbar direkte Interaktion zulassen.<br />
Des weiteren nahm ich Bilder auf, die in der Postpro-<br />
duktion die Entstehung kleiner, traumartiger Verbindun-<br />
gen und Verweise zur anderen Welt ermöglichten.<br />
Zusätzlich entstanden Szenen, die den chinesischen<br />
Mythos der Verbindung illustrierten, Bilder die mit der<br />
Idee des verbindenden Fadens spielten. Hierbei wurde<br />
die Idee in Bilder umgesetzt, jeder Mensch hätte tatsäch-<br />
lich eine von dem Mann im Mond geknüpfte Verbin-<br />
dung am Zeh, die ihn mit jemand anderem auf der Welt<br />
verbindet.
52 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 53<br />
Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en<br />
Im auf die Dreharbeiten folgenden Prozess entwickelte ich zunächst verschiedene Szenen, die die Protagonisten<br />
und die beiden Welten miteinander verbinden. Aus diesen Sequenzen baute sich der fertige<br />
Film auf.<br />
Dabei entstanden zunächst einerseits Sequenzen, die<br />
durch den Schnitt in Verbindung gebracht wurden.<br />
Zum anderen kreierte ich kurze Sequenzen, bei denen<br />
kleine vom Betrachter vielleicht nur unbewusst wahr-<br />
genommene traumartige beziehungsweise surreale<br />
Momente eine Verbindung zur anderen Welt erzeugten.<br />
Diese entstanden in der Postproduktion durch Kom-<br />
bination von Aufnahmen aus Hoima und Berlin.<br />
Während des morgendlichen Zähneputzen bemerkt die Person aus Hoima etwas. Im anschließenden Bild ist die<br />
Berliner Person zu sehen. Sie scheint auch etwas bemerkt zu haben und wirft einen genaueren Blick in den Spiegel.<br />
An dem einen Ort werden Milch und Kaffee in die Tasse gegossen, an dem anderen Ort werden sie umgerührt,<br />
vermischt und ausgetrunken.<br />
Beide hören scheinbar das Gleiche im Radio. Wenn die eine Person den Sender verstellt, bemerkt die andere es.<br />
Durch die Montage entsteht ein kurzer Zweikampf um die Wahl des Senders.<br />
Mittagspause: Ein kleiner Snack in der U-Bahn. Eine Stärkung im Bistro. Ein zugeworfener Blick.<br />
Bemerken sie sich gegenseitig?
54 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 55<br />
Nachdem sich beide Personen scheinbar auf einen Sender geinigt haben, schauen sie sich durch einen Blick durch den<br />
Betrachter hindurch gegenseitig an.<br />
Eine an den Füßen der ugandischen Person auftauchende Reflexion inspirierte mich zu dieser Szene. Die Person in<br />
Berlin betrachtet sich in einem Handspiegel. Sie bewegt den Spiegel hin und her. Eine Reflexion wandert über ihr<br />
Gesicht. Im nächsten Bild in Hoima ist die Reflexion zu erkennen.<br />
Eine Bewegung wird von einer Person angefangen und von der anderen weitergeführt. In diesem Fall setzt sich das<br />
Überschlagen der Beine von der einen Welt in die andere fort.<br />
Eine Person ruft jemanden an. Die andere Person wird angerufen. Telefonieren sie miteinander oder telefonieren<br />
sie nur zufällig zur selben Zeit?<br />
Die beiden Personen scheinen sich zu bemerken. Es komt scheinbar zu einem direktem Blickwechsel.
56 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 57<br />
In Berlin tritt die Person auf den Balkon. In der Spiegelung der Glastür ist zunächst eine Spiegelung der umliegen-<br />
den Häuser zu sehen. Wird sie jedoch geöffnet ist eine Spiegelung eines in Hoima stehenden Hauses zu erkennen.<br />
Eine U-Bahnfahrt in Berlin. Im Hintergrund sieht man<br />
zunächst Berliner Landschaft vorbeiziehen. Langsam<br />
verdeutlichen sich in der Spiegelung des Fensters<br />
Fahraufnahmen aus Hoima.<br />
Im Stadtbild Berlins taucht ein Elefanten-Graffiti auf. Es bewegt sich ganz langsam und erzeugt so eine<br />
sehnsuchtsvolle Verbindung zu dem anderen Ort.<br />
Die Berliner Person läuft an einer Häuserwand aus<br />
Hoima vorbei.
58 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 59<br />
Durch das Hineinmontieren unaufälliger Gegenstände<br />
wird bei dem Betrachter eine teilweise unbewusste<br />
Irritation ausgelöst. Im weiteren Verlauf deutlicher<br />
werdende Bilder lösen eine Konfusion über die Eindeu-<br />
tigkeit eines Ortes aus. In einer ugandischen Zeitung<br />
lassen sich Berliner Bilder erkennen. Der Bildschirm-<br />
hintergrund zeigt eine Berliner Stadtansicht.<br />
Ein Ansatz war durch grafische Elemente die beiden Orte zu verbinden. Ein Ort zerfließt in Farben.<br />
Aus diesen Farben entsteht der andere Ort.<br />
Ein in Hoima gekaufter Stoff dient der Berliner Person als Vorhang. Er kommt in beiden Welten vor und verbindet sie.<br />
Eine direkte Visualisierung des verbindenden Fadens. Die Bewegung einer Person löst die Bewegung der anderen<br />
Person aus. Nur wer beeinflusst wen?
60 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> – Mondmanns Faden – Verbindung der beiden <strong>Wirklichkeit</strong>en<br />
verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 61<br />
Direkte Visualisierung des verbindenden Fadens. Der Faden an einem Zeh. Der Faden am Zeh jedes Menschen.<br />
Fäden verbinden die Welt.<br />
Zu Beginn des entstandenen Films gibt es eine Sequenz,<br />
bei der die Berliner Figur im Schlaf abwechselnd mit<br />
eindeutig afrikanischen Impressionen gezeigt wird.<br />
Diese Impressionen können zum einen als Traum-, aber<br />
auch als eigenständige Welt gedeutet werden. In dieser<br />
anderen Welt wird ein Stück Stoff erworben, welches der<br />
Berliner Person als Vorhang dient. Diese zieht nach dem<br />
sie aufgewacht ist den Vorhang auf. Durch das Fenster<br />
sieht man ugandische Landschaft. Das Fenster zur ande-<br />
ren Welt ist, zumindest für den Betrachter, geöffnet.<br />
Der Film ist so geschnitten, dass sich reale, teilweise<br />
dokumentarisch erscheinende Bilder mit Bildern aus<br />
einer anderen <strong>Wirklichkeit</strong> mischen. Beide Personen<br />
werden eingeführt und in ihrem Alltag vorgestellt. Es<br />
entsteht eine Verbindung der beiden. Sie treten in<br />
einigen Szenen scheinbar direkt miteinander in Interak-<br />
tion. Szenen, in denen sich Hinweise auf die andere Welt<br />
befinden, treten verstärkt auf. Die Berliner Person<br />
bemerkt etwas von dieser anderen Welt, es entsteht<br />
eine Sehnsucht. Sie begibt sich auf die Suche und landet<br />
an einem Zwischenort.<br />
Die beiden Welten vermischen sich zusehends. Auf der<br />
Audioebene entwickelt sich aus dem anfänglichen<br />
O-Ton eine Verbindung der beiden Welten. Es entsteht<br />
ein gemeinsamer Audioraum.<br />
Zum Ende des Films gibt es einen Blickkontakt, bei<br />
dem sich die beiden Personen scheinbar direkt an-<br />
schauen und sich einander bewusst werden. Danach<br />
sind sie wieder alleine. Sind sie verbunden oder nicht?<br />
Zum Abschluss dieser Dokumentation möchte ich an<br />
dieser Stelle noch einmal auf Heinz von Foerster zurück-<br />
kommen.<br />
Die Frage, ob wir von der Welt getrennt oder mit ihr<br />
verbunden sind, so von Foerster, lässt sich prinzipiell<br />
nicht endgültig klären. Wir können uns nur für eine<br />
dieser beiden Haltungen entscheiden und für diese Wahl<br />
Verantwortung übernehmen. Man entschließt sich, die<br />
Dinge, die Welt und seine Mitmenschen auf eine beson-<br />
dere Weise zu betrachten und entsprechend zu handeln.<br />
Man wird verantwortlich für die Entscheidung, die man<br />
getroffen hat und die einem niemand abnehmen kann.
62 verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> verschiedene <strong>Wirklichkeit</strong> 63<br />
Anregungen und Quellen<br />
Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners<br />
Heinz von Foerster / Bernhard Pörksen, Heidelberg 2004<br />
Wie wirklich ist die <strong>Wirklichkeit</strong>?<br />
Paul Watzlawick, München 1976<br />
Ach, Afrika – Berichte aus dem Inneren eines Kontinents<br />
Bartholomäus Grill, München 2005<br />
Afrika - Mythos und Zukunft<br />
Katja Böhler / Jürgen Hoeren, Freiburg am Breisgau 2003<br />
Lost in the Funhouse<br />
Bill Zehme, New York 1999<br />
Das Gefühl des Augenblicks<br />
– zur Dramaturgie des Dokumentarfilms<br />
Thomas Schadt, Bergisch Gladbach 2002<br />
Dramaturgie des Films. Wie Hollywood erzählt<br />
Michaela Krützen, Frankfurt 2004<br />
Handbuch der Filmmontage<br />
Hans Beller, München 1993<br />
A beautiful mind(fuck): Hollywood structures of identity<br />
Jonathan Eig<br />
http://www.ejumpcut.org/archi-<br />
ve/jc46.2003/eig.mindfilms/<br />
Der mindfuck als postmodernes Spielfilm-Genre<br />
Alexander Geimer<br />
http://www.jump-cut.de/mindfuck1.html<br />
Dank an:<br />
Prof. Maria Vedder, Prof. Joachim Sauter, Prof. Anna Anders, Isabell Spengler,<br />
Dr. Anja Osswald, Jovia Tumuhaise, William Rwebembera, Juliet Tsume,<br />
Virginia Maiorino, Holger Jonas, Sigrid Jonas, Irene von Alberti, Frieder Schlaich,<br />
Jonas von Poser, Nina Ahrens, Anke Schmidt, Sören Stange, Johannes Edelhoff<br />
und Merle Völkner.<br />
Ich versichere, meine Diplomarbeit ohne fremde<br />
Hilfe angefertigt zu haben.<br />
Berlin im April 2007<br />
Janek Jonas