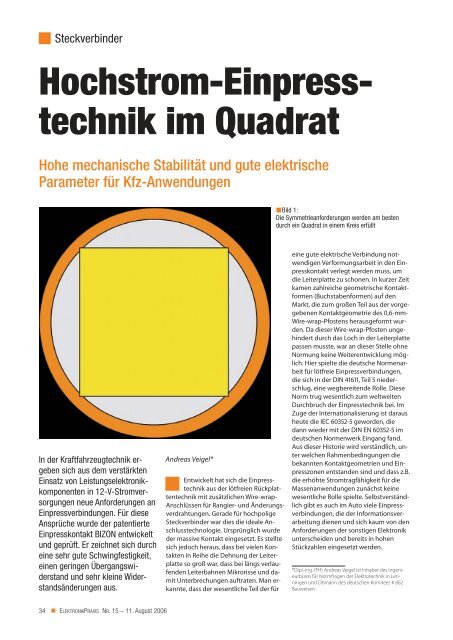Artikel Elektronik Praxis
Artikel Elektronik Praxis
Artikel Elektronik Praxis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Steckverbinder<br />
Hochstrom-Einpresstechnik<br />
im Quadrat<br />
Hohe mechanische Stabilität und gute elektrische<br />
Parameter für Kfz-Anwendungen<br />
In der Kraftfahrzeugtechnik ergeben<br />
sich aus dem verstärkten<br />
Einsatz von Leistungselektronikkomponenten<br />
in 12-V-Stromversorgungen<br />
neue Anforderungen an<br />
Einpressverbindungen. Für diese<br />
Ansprüche wurde der patentierte<br />
Einpresskontakt BIZON entwickelt<br />
und geprüft. Er zeichnet sich durch<br />
eine sehr gute Schwingfestigkeit,<br />
einen geringen Übergangswiderstand<br />
und sehr kleine Widerstandsänderungen<br />
aus.<br />
34 � ELEKTRONIKPRAXIS NR. 15 – 11. August 2006<br />
Andreas Veigel*<br />
Entwickelt hat sich die Einpresstechnik<br />
aus der lötfreien Rückplattentechnik<br />
mit zusätzlichen Wire-wrap-<br />
Anschlüssen für Rangier- und Änderungsverdrahtungen.<br />
Gerade für hochpolige<br />
Steckverbinder war dies die ideale Anschlusstechnologie.<br />
Ursprünglich wurde<br />
der massive Kontakt eingesetzt. Es stellte<br />
sich jedoch heraus, dass bei vielen Kontakten<br />
in Reihe die Dehnung der Leiterplatte<br />
so groß war, dass bei längs verlaufenden<br />
Leiterbahnen Mikrorisse und damit<br />
Unterbrechungen auftraten. Man erkannte,<br />
dass der wesentliche Teil der für<br />
■Bild<br />
1:<br />
Die Symmetrie anforderungen werden am besten<br />
durch ein Quadrat in einem Kreis erfüllt<br />
eine gute elektrische Verbindung notwendigen<br />
Verformungsarbeit in den Einpresskontakt<br />
verlegt werden muss, um<br />
die Leiterplatte zu schonen. In kurzer Zeit<br />
kamen zahlreiche geometrische Kontaktformen<br />
(Buchstabenformen) auf den<br />
Markt, die zum großen Teil aus der vorgegebenen<br />
Kontaktgeometrie des 0,6-mm-<br />
Wire-wrap-Pfostens herausgeformt wurden.<br />
Da dieser Wire-wrap-Pfosten ungehindert<br />
durch das Loch in der Leiterplatte<br />
passen musste, war an dieser Stelle ohne<br />
Normung keine Weiterentwicklung möglich.<br />
Hier spielte die deutsche Normenarbeit<br />
für lötfreie Einpressverbindungen,<br />
die sich in der DIN 41611, Teil 5 niederschlug,<br />
eine wegbereitende Rolle. Diese<br />
Norm trug wesentlich zum weltweiten<br />
Durchbruch der Einpresstechnik bei. Im<br />
Zuge der Internationalisierung ist daraus<br />
heute die IEC 60352-5 geworden, die<br />
dann wieder mit der DIN EN 60352-5 im<br />
deutschen Normenwerk Eingang fand.<br />
Aus dieser Historie wird verständlich, unter<br />
welchen Rahmenbedingungen die<br />
bekannten Kontaktgeometrien und Einpresszonen<br />
entstanden sind und dass z.B.<br />
die erhöhte Stromtragfähigkeit für die<br />
Massenanwendungen zunächst keine<br />
wesentliche Rolle spielte. Selbstverständlich<br />
gibt es auch im Auto viele Einpressverbindungen,<br />
die der Informationsverarbeitung<br />
dienen und sich kaum von den<br />
Anforderungen der sonstigen <strong>Elektronik</strong><br />
unterscheiden und bereits in hohen<br />
Stückzahlen eingesetzt werden.<br />
*Dipl.-Ing. (FH) Andreas Veigel ist Inhaber des Ingenieurbüros<br />
für Normfragen der Elektrotechnik in Lenningen<br />
und Obmann des deutschen Komitees K 662<br />
Bauweisen.
Bei Leistungsanwendungen erfordert das<br />
12-V-Netz jedoch Ströme im zwei- und<br />
dreistelligen Ampèrebereich. Zusätzlich<br />
sind die mechanischen, thermischen und<br />
chemischen Umweltbedingungen verschärft.<br />
Dieser besondere Mix rechtfertigt<br />
auch die besondere Vorsicht, mit<br />
der ganz allgemein Änderungen und<br />
Neuerungen im Automotive-Bereich<br />
eingeführt werden.<br />
Symmetrie als maßgebliche<br />
Eigenschaft<br />
Welche Eigenschaften ein Einpresskontakt<br />
im Idealfall aufweisen sollte, ist im<br />
Kasten zusammengefasst. Auf der Basis<br />
der hohen Anforderungen der Automobilindustrie<br />
wurde der patentierte<br />
BIZON-Kontakt entwickelt.<br />
Wesentlich ist dabei die Symmetrie. Diese<br />
Anforderung wird am besten durch<br />
ein Quadrat im Kreis erfüllt. Durch eine<br />
derartige Kombination ergeben sich vier<br />
symmetrisch verteilte, weit auseinander<br />
liegende, definierte Kontaktflächen.<br />
Das Bild 2 zeigt einen Querschliff des<br />
BIZON-Kontaktes. Der reale Kontakt<br />
kommt dem o.g. quadratischen Ideal<br />
recht nahe und zeigt vier gleiche radiale<br />
Kontaktkräfte, die zu einer sehr guten<br />
Selbstzentrierung des Kontaktes im Loch<br />
führen und eine symmetrische Abstützung<br />
bewirken. Das Verformen des Kontaktes<br />
beim Einpressen ergibt kein Drehmoment<br />
und keine Achsverlagerung. Die<br />
im Winkel von ca. 90° wirkenden Kontaktkräfte<br />
verteilen die Druckspannungen<br />
gleichmäßig in die Leiterplatte, sodass<br />
sich bei vielen Kontakten in Reihe die<br />
Kräfte nicht summieren und das Basismaterial<br />
nicht unzulässig gedehnt wird.<br />
Eine weitere, sehr positive Wirkung ergibt<br />
sich durch die um 90° gespreizten Kräfte:<br />
Steckverbinder<br />
■Bild<br />
2:<br />
Schliffbild eines BIZON-Kontaktes<br />
Die Summe der vier wirksamen Normalkräfte<br />
liegt sehr viel höher als die Verformungskraft,<br />
die auf den Kontakt zurückwirkt.<br />
Fast die Hälfte der Krafteinwirkungen<br />
wird von den massiven Schenkeln<br />
aufgenommen – dies schont den<br />
plastisch/elastischen Teil. Dadurch kann<br />
als Kontaktwerkstoff das gut leitende<br />
und billigere Messing verwendet werden.<br />
Der Querschnittsgewinn durch einen fast<br />
quadratischen Kontakt wird im Bild 3<br />
deutlich, wo ein herkömmlicher, gestanzter<br />
Kontakt (Nadelöhr) einem BIZON-<br />
Kontakt gegenübergestellt ist. Es ist<br />
deutlich weniger „Luft“ im Loch. Dies bedeutet,<br />
dass bei gleicher Stromstärke ein<br />
wesentlich kleineres Loch gewählt werden<br />
kann. Die Rasterabstände können<br />
verringert und dadurch kompaktere Anordnungen<br />
erzielt werden. Dadurch wird<br />
ein hohes Verhältnis von Stromstärke pro<br />
Leiterplattenfläche (A/cm2) erzielt, was<br />
den Trend zur verstärkten Miniaturisierung<br />
unterstützt.<br />
▶<br />
■Bild<br />
3:<br />
Querschnittsgewinn durch einen fast quadratischen Kontakt: links: gestanzter Kontakt<br />
(Nadelöhr), rechts: BIZON-Kontakt<br />
ELEKTRONIKPRAXIS NR. 15 – 11. August 2006 � 35
36 � ELEKTRONIKPRAXIS NR. 15 – 11. August 2006<br />
Steckverbinder<br />
▶<br />
Bild 4 zeigt Kontakte mit einem Querschnitt<br />
von 1,5 mm × 1,5 mm aus vorverzinntem<br />
Messingband für 2-mm-Löcher<br />
in einer 1,6 mm starken Leiterplatte. An<br />
diesen Kontakten wurden die Qualitätsund<br />
Zulassungsprüfungen durchgeführt.<br />
Durch die vollkommen getrennten<br />
Schenkel des Kontaktes ergeben sich positive<br />
mechanische und dynamische Eigenschaften,<br />
die auch durch die Finite-<br />
Elemente-Simulation (Bild 5) bestätigt<br />
wurden.<br />
Der größte Kraftanteil wird in eine plastische<br />
Verformung des Kontaktes umgesetzt,<br />
dadurch überbrückt er auch größere<br />
Lochtoleranzen, ohne dass sich die Ein-<br />
■Bild<br />
4: BIZON-Kontakt mit einem Querschnitt<br />
von 1,5 mm × 1,5 mm aus vorverzinntem<br />
Messingband für 2-mm-Löcher<br />
presskräfte zu sehr ändern. Der Lochdurchmesser<br />
kann mit ±0,1 mm toleriert<br />
werden. Da beim Herstellen des Kontaktes<br />
der Grundwerkstoff Messing nur<br />
geringfügig verformt und nicht kaltverfestigt<br />
wird, können die Materialeigenschaften<br />
von vornherein festgelegt werden<br />
und verändern sich nicht. Dies ist für<br />
viele Anwendungen ein großer Vorteil.<br />
Im Bild 6 ist zu erkennen, dass der Kontakt<br />
beim Einpressen an der Spitze keine<br />
Gegenkraft erzeugt, da er sich öffnen<br />
kann. Die Kräfte sind in der Mitte und im<br />
hinteren Anbindungsbereich am größten.<br />
Dies garantiert eine schonende Einführung<br />
und eine hohe Haltekraft des<br />
■Bild<br />
6: Der Kontakt erzeugt beim Einpressen an der Spitze keine Gegenkraft,<br />
das Nadelöhr kann nicht nach innen einknicken und versagen<br />
■Bild<br />
5:<br />
FEM-Simulation<br />
des<br />
Kontaktes
Kontaktes im Loch. Die Trennung der<br />
Schenkel im Anbindungsbereich halbiert<br />
das Widerstandsmoment des ansonsten<br />
sehr steifen Pfostens, sodass Rastertoleranzen<br />
leicht ausgeglichen werden, ohne<br />
dass es bei einer 1,6-mm-Leiterplatte zu<br />
ungleichen und einseitigen Kontaktdrücken<br />
kommt. Bei seitlichem Versatz<br />
verschieben sich die Kontaktschenkel<br />
gegeneinander, ohne dass sich Form und<br />
Eigenschaften verändern.<br />
Bild 6 zeigt ebenfalls, warum bei diesem<br />
Kontakt das Nadelöhr nicht nach innen<br />
einknicken und unbemerkt versagen<br />
kann. Sollte einmal ein Loch zu klein sein,<br />
werden die Schenkel maximal bis zur gegenseitigen<br />
Anlage zusammengedrückt,<br />
weiter passiert nichts.<br />
Im Querschliff in Bild 7 sind die vier definierten,<br />
gasdichten Kontaktzonen erkennbar.<br />
Alle vier Radien drücken sich<br />
gleichmäßig in die Kupferhülse ein, ohne<br />
dass die Kupferhülse erkennbar ausgebeult<br />
wird. Dies zeigt, dass der Kontakt<br />
die Kupferhülse und die Leiterplatte sehr<br />
schont, ohne Haltekraft einzubüßen. Eine<br />
Delaminierung der Leiterplatte und inneres<br />
Reißen der Kupferhülse durch Kerbwirkung<br />
bei scharfen Kanten ist ausgeschlossen.<br />
Kein Problem mehr: Reparatur<br />
von Einpresskontakten<br />
Die selten benötigte, aber oft betonte<br />
Reparaturmöglichkeit einer Einpressverbindung<br />
stellt kein Problem dar. Der<br />
neue Kontakt benutzt das alte Kontaktbett,<br />
ohne dass wesentliche Änderungen<br />
bemerkbar sind.<br />
Durch die besondere Geometrie ist die<br />
Bildung von Zinnspänen praktisch ausgeschlossen.<br />
Der Kontakt benötigt keine<br />
Zinnschicht zur „Schmierung“. Er funktioniert<br />
auch ohne Zinnauflage. Für erhöhte<br />
Temperaturanforderungen ist bei Messing<br />
jedoch immer ein Verzinnen empfehlenswert.<br />
Beim Einpressvorgang verläuft<br />
die Einpresskraft entsprechend<br />
Bild 8 sehr gleichmäßig, bis der Kontakt<br />
in seine Endposition gleitet. Die maximale<br />
Einpresskraft von ca. 220 N liegt für<br />
einen stabilen Kontakt in erträglichen<br />
Dimensionen.<br />
Im Diagramm der Ausdrückkraft in Bild 9,<br />
das 24 Stunden nach dem Einpressen<br />
aufgenommen wurde, ist in der markant<br />
ausgebildeten Spitze deutlich der Beweis<br />
für eine sichere Kaltverschweißung der<br />
Kontaktzonen erkennbar. Bemerkenswert<br />
ist auch die dadurch erreichte Höhe<br />
der Haltekraft von mehr als 150 N bei<br />
einer Einpresskraft von ca. 220 N. ▶<br />
Steckverbinder<br />
■Bild<br />
7: Querschliff der vier definierten,<br />
gasdichten Kontaktzonen<br />
Eigenschaften<br />
Einpresskontakt<br />
■Seine<br />
Geometrie ergibt eine<br />
symmetrische Krafteinleitung in<br />
die Leiterplatte und eine symmetrische<br />
Abstützung im Loch.<br />
■Er<br />
erzeugt beim Einpressen kein<br />
Drehmoment und keine Achsverlagerung.<br />
■Er<br />
hat klar begrenzte und definierte<br />
Kontaktflächen mit angrenzendem<br />
Freiraum für Materialverdrängung,<br />
Fremdschichten und<br />
Korrosionsprodukte.<br />
■Es<br />
ergeben sich gasdichte Kontaktflächen<br />
mit einer Gesamtfläche<br />
entsprechend dem Kontaktquerschnitt,<br />
zur vollen Nutzung des<br />
Kontaktquerschnittes als Stromleiter.<br />
■Ein<br />
möglichst großer Leiterquerschnitt<br />
im Loch ergibt bei gleichem<br />
Strom ein kleineres Loch und damit<br />
weniger Platzbedarf auf der<br />
Leiterplatte.<br />
■Ein<br />
weicher, sanfter Einlaufbereich<br />
schont die Kupferhülse und<br />
die Leiterplatte. Der Kraftverlauf<br />
entspricht einem schlanken Konus.<br />
■Der<br />
Kontakt toleriert einen<br />
großen Toleranzbereich des Loches<br />
bei möglichst konstanter Einpresskraft.<br />
■Die<br />
plastische Verformung von<br />
Kupferhülse und Kontakt ergeben<br />
eine gute Anpassung der Kontaktflächen<br />
an das Loch.<br />
■Eine<br />
hohe Haltekraft gibt<br />
elektrische und mechanische<br />
Sicherheit.<br />
ELEKTRONIKPRAXIS NR. 15 – 11. August 2006 � 37
Steckverbinder<br />
▶<br />
Der aus gängigem Messingblech kostengünstig<br />
gefertigte Kontakt wurde durch<br />
die Firma catem in Anlehnung an DIN EN<br />
60352-5 unter den verschärften Bedingungen<br />
für kritische Anwendungen im<br />
Kfz (elektrische Zuheizsysteme) geprüft<br />
und hat alle Tests mit sehr guten Ergebnissen<br />
bestanden. So wurde beispielsweise<br />
für die obere Prüftemperatur bei<br />
den Wärmeprüfungen 125 °C gewählt,<br />
während die Norm 85 °C fordert. Die zulässige<br />
Umgebungstemperatur wurde<br />
auf 110 °C festgesetzt. Die Schwingprüfungen<br />
bei 5 bis 200 Hz erfolgten in 990<br />
Zyklen unter Strombelastung und Temperaturwechsel<br />
von –40/85 °C sowie<br />
Schock 30 g. Durch die gleichmäßige Abstützung<br />
der vier Kontaktflächen im Loch<br />
ergibt sich automatisch eine sehr gute<br />
Merkmale BIZON Nutzen<br />
größtmöglicher, fast quadratischer Querschnitt<br />
im Loch, vier symmetrische, radiale<br />
Kontaktkräfte, hoher Strom (Kontakt 1,5 ×<br />
1,5 mm über 40 A bei 85 °C im 2-mm-Loch)<br />
keine Feinstanz- und Präzisions-Prägetechnik,<br />
geringe Materialverformung ohne Pressung,<br />
keine Kaltverfestigung<br />
großzügige, überwiegend plastische<br />
Rückformung beim Einpressen, vollständige<br />
Nutzung des E-Moduls<br />
großer Toleranzbereich des Loches von<br />
±0,1 mm moderate Einpresskräfte (230 N),<br />
hohe Haltekräfte (150 N)<br />
38 � ELEKTRONIKPRAXIS NR. 15 – 11. August 2006<br />
■Bild<br />
8: Beim Einpressen<br />
verläuft die Einpresskraft<br />
sehr gleichmäßig,<br />
bis die Endposition<br />
erreicht ist. Die<br />
max. Kraft liegt typisch<br />
bei 220 N.<br />
■Bild<br />
9: Diagramm<br />
der Ausdrückkraft<br />
24 Stunden nach dem<br />
Einpressen. Die Spitze<br />
markiert eine sichere<br />
Kaltverschweißung<br />
der Kontaktzonen.<br />
Schwingfestigkeit in allen Richtungen.<br />
Die Stromprüfungen ergaben, dass trotz<br />
spezieller Prüfleiterplatten der Engpass<br />
die Leiterbahnen auf der Leiterplatte waren,<br />
d.h. die Erwärmung der Prüflinge<br />
rührte überwiegend von den Strompfaden<br />
der Leiterplatte.<br />
Engpass für die Erwärmung<br />
nur noch die Leiterplatte<br />
Angesichts der gemessenen, sehr niedrigen<br />
Übergangswiderstände ist dies allerdings<br />
nicht verwunderlich. Bei neuen,<br />
sauberen Kontakten ist der reine Übergangswiderstand<br />
selten ein Problem.<br />
Aussagefähiger für den <strong>Praxis</strong>einsatz ist<br />
eher die Änderung des Widerstandes<br />
nach den Belastungsprüfungen. Die<br />
hohe Stromtragfähigkeit bei geringstem<br />
Platzbedarf, hohe mechanische Stabilität, hohe<br />
Wärmeleitfähigkeit, geringe mechanische<br />
Belastung der Leiterplatte<br />
schnelle Entwicklung, unkritische Werkzeuge,<br />
höhere Grundfestigkeit des Werkstoffes möglich<br />
preiswertes Standard-Grundmaterial (CuZn37),<br />
gute elektrische Leitfähigkeit, geringe<br />
Toleranzanforderungen<br />
geringere Leiterplattenkosten, leichte<br />
Verarbeitbarkeit, hohe Kontaktsicherheit<br />
herstellerunabhängige Lizenzierung patentrechtlich abgesicherte, neue Technologie<br />
ohne Abhängigkeit von Wettbewerbsinteressen<br />
Norm lässt hier eine Änderung von<br />
0,5 mΩ zu. Der maximale Wert für die<br />
gemessene Widerstandsänderung nach<br />
den vorgenannten scharfen Prüfungen<br />
betrug bei BIZON 4 μΩ, das ist 100-mal<br />
weniger. Unter optimalen Bedingungen<br />
und entsprechend leitfähigem Werkstoff<br />
trägt der neue Kontakt dieser Größe<br />
(Lochdurchmesser 2 mm) einen Strom<br />
von bis zu 50 A bei einer Temperatur<br />
von 85 °C. Wegen des großen Querschnittes<br />
im Loch kann der Kontakt bei<br />
richtiger Gestaltung des Kontaktträgers<br />
Wärme aus der Leiterplatte heraus transportieren<br />
und nebenbei als Kühlkörper<br />
fungieren. Der BIZON-Kontakt steht allen<br />
potenziellen Anwendern zur Verfügung.<br />
Der Autor des Beitrags ist an Linzenzvergaben<br />
interessiert. (kr)<br />
Ingenieurbüro Andreas Veigel<br />
Tel. +49(0)7026 3004<br />
www.elektronikpraxis.de<br />
■ Mehr zum Verfahren und Hinweis zur<br />
Normung<br />
■ Deutsche Kommission Elektrotechnik,<br />
<strong>Elektronik</strong>, Informationstechnik im DIN<br />
und VDE<br />
■ Internationale Elektrotechnische<br />
Kommission IEC<br />
177507