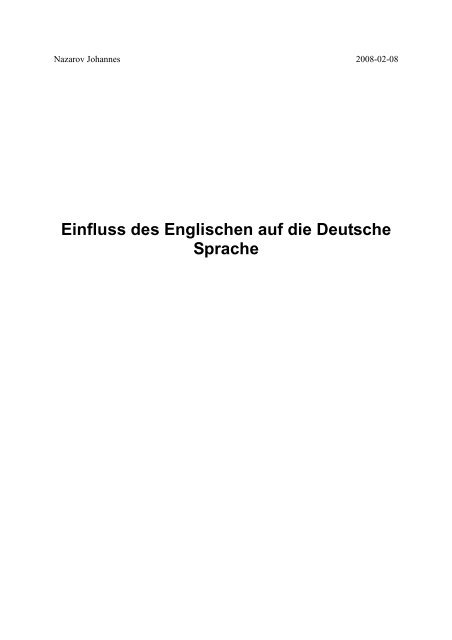Einfluss des Englischen auf die Deutsche Sprache - johny7.de
Einfluss des Englischen auf die Deutsche Sprache - johny7.de
Einfluss des Englischen auf die Deutsche Sprache - johny7.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nazarov Johannes 2008-02-08<br />
<strong>Einfluss</strong> <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> <strong>auf</strong> <strong>die</strong> <strong>Deutsche</strong><br />
<strong>Sprache</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis 2<br />
1. Einführung 3<br />
2. Bedeutung und <strong>Einfluss</strong> <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> in der <strong>Sprache</strong> <strong>des</strong> Berufsfel<strong>des</strong><br />
Elektrotechnik 3<br />
2<br />
Berufssprache 4<br />
Fachspezifische Bildungssprache 4<br />
Wirtschaftsorientierte Fachsprache 4<br />
3. Einflüsse <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> <strong>auf</strong> das deutsche Sprachsystem 5<br />
4. Gründe für <strong>die</strong> Einflüsse 5<br />
5. Pro und Kontra 6<br />
6. Anglizismen im Internet 8<br />
7. Erhaltung der deutschen <strong>Sprache</strong> 9<br />
8. Resümee 9<br />
Mist bleibt Mist 9<br />
Wert <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n 10
1. Einführung<br />
Haben Sie <strong>die</strong> Firewall Ihres Computers auch schon upgedatet? Oder war Ihr letztes Meeting<br />
nicht gut getimed? Dann haben Sie sich wahrscheinlich auch schon überlegt, in welcher<br />
<strong>Sprache</strong> Sie das nächste Angebot für Ihren neuen Kunden formulieren.<br />
Wer heute durch <strong>die</strong> Stadt oder in den Supermarkt geht, stößt immer häufiger <strong>auf</strong> englische<br />
Begriffe. In den Me<strong>die</strong>n sind Wortneubildungen und Verschmelzungen aus Wörtern der<br />
englischen und deutschen <strong>Sprache</strong>n schon lange in. Dieses neuartige Sprachgemisch wird<br />
umgangssprachlich Denglisch genannt, und ist genauso beliebt wie verachtet. Jugendliche, <strong>die</strong><br />
besonders cool erscheinen möchten, sprechen immer weniger deutsch. Der Technologievorsprung<br />
der letzten Jahre hat <strong>die</strong> Übernahme englischer Bezeichnungen in das <strong>Deutsche</strong><br />
enorm gefördert. Im Zuge der Globalisierung werden Anglizismen auch von Geschäftsleuten<br />
vermehrt eingesetzt. Ältere Menschen dagegen haben ernste Probleme beim Verständnis der<br />
Jugendlichen. Die Liebhaber der eigenen <strong>Sprache</strong> und Poeten warnen vor einer<br />
Überschwemmung der deutschen <strong>Sprache</strong> durch Anglizismen, <strong>die</strong> genauso gut oder sogar<br />
noch besser <strong>auf</strong> Deutsch ausgedrückt werden könnten.<br />
Die vorliegende Facharbeit will den <strong>Einfluss</strong> und <strong>die</strong> Bedeutung der englischen <strong>Sprache</strong><br />
sowohl allgemein im täglichen Sprachgebrauch als auch speziell im Berufsfeld der<br />
Elektrotechnik beleuchten. Dabei werden <strong>die</strong> Einflüsse aus der gesamten englischen <strong>Sprache</strong><br />
verschiedener Länder (England, USA, Australien etc.) in dem Begriff „Anglizismen“<br />
zusammengefasst. Es werden keine separaten Ausdrücke für „Amerikanismen“ etc.<br />
verwendet.<br />
2. Bedeutung und <strong>Einfluss</strong> <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> in der <strong>Sprache</strong> <strong>des</strong><br />
Berufsfel<strong>des</strong> Elektrotechnik<br />
Besonders in den Berufen der Elektrotechnik, Elektronik und Informatik, welche stark<br />
innovativ geprägt sind, ist mit einem starken Zuwachs an Einflüssen der englischen <strong>Sprache</strong><br />
zu rechnen. Das erklärt sich zum Einen dadurch, dass für neue Technologien und Produkte <strong>die</strong><br />
englischen Bezeichnungen ins <strong>Deutsche</strong> übernommen werden. Zum Anderen erzielt in<br />
Deutschland gerade <strong>die</strong> Elektronikbranche <strong>die</strong> größten Exporte. Deswegen wird <strong>die</strong> englische<br />
<strong>Sprache</strong> als Handelssprache für Berufe der Elektrotechnik zunehmend wichtig.<br />
Trotzdem sind der <strong>Einfluss</strong> und <strong>die</strong> Zunahme der Anglizismen nicht in allen Teilen der<br />
Branche gleich. Die Fachsprache der Elektrotechnik kann in mehrere Untermengen gegliedert<br />
werden, in denen <strong>die</strong> Entwicklung unterschiedlich verläuft.<br />
Abb. 1: Sprachbereiche einer Fachsprache<br />
3
Berufssprache<br />
Die Berufssprache stellt im Wesentlichen <strong>die</strong> Umgangssprache eines Berufsfel<strong>des</strong> dar. Es ist<br />
<strong>die</strong> gesprochene Fachsprache, <strong>die</strong> jedoch durch Begriffe aus dem „Marketing“ und durch viele<br />
umgangssprachliche „Fachbegriffe“ ergänzt wird. So wird zum Beispiel der Ausdruck<br />
„Glühbirne“ weder in einem Werbeprospekt der Vertriebsabteilung noch in einem Fachbuch<br />
der Technikerschule zu finden sein. Von einem berufsausübenden Elektriker bekommt man so<br />
etwas trotzdem zu hören.<br />
Der <strong>Einfluss</strong> <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> ist in <strong>die</strong>sem Bereich verhältnismäßig gering. Es sind<br />
vorwiegend Produktnamen, <strong>die</strong> aus der Ursprungssprache direkt übernommen und verwendet<br />
werden. Seltener werden Technologien mit englischen Begriffen bezeichnet – meist wird eine<br />
deutsche Variante gefunden. Das Handwerkzeug hört (fast) ausschließlich <strong>auf</strong> deutsche<br />
Namen. Ebenso verhält es sich mit den fachtheoretischen Grundlagen: Man wird kaum einen<br />
Elektroniker von Levels sprechen hören; es heißt immer noch Potential. Dagegen weigert sich<br />
<strong>die</strong> Hardware auch von einem Elektriker eingedeutscht zu werden.<br />
Als Verkehrssprache wird Englisch angesichts der vermehrten Zusammenarbeit von<br />
Fachleuten aus verschiedenen Herkunftsländern immer bedeutender. Oft werden Anlagen bei<br />
ausländischen Kunden oder Filialen der eigenen Firma installiert. Manchmal findet ein<br />
Austausch oder Schulungen von Facharbeitern statt. Deswegen wird in den Berufsschulen<br />
nicht nur <strong>auf</strong> technisches Englisch Wert gelegt – <strong>die</strong> Umgangssprache ist ebenso wichtig.<br />
Fachspezifische Bildungssprache<br />
Die fachspezifische Bildungssprache der Elektrotechnik verwendet ausschließlich deutsche<br />
Begriffe. Eine Sonderheit ergibt sich z.B. bei Tabellenbüchern, wo zur deutschen<br />
Bezeichnung <strong>die</strong> englische Übersetzung mit angegeben wird. Damit werden nur pädagogische<br />
Zwecke verfolgt – der Schüler lernt den englischen Ausdruck und versteht englische<br />
Dokumentationsunterlagen. Der eigentliche Text bleibt reines Deutsch. Alles, was in einer<br />
vernünftigen Weise <strong>auf</strong> Deutsch gesagt oder geschrieben werden kann, wird hier in deutscher<br />
<strong>Sprache</strong> formuliert. Eine Ausnahme bilden geschützte Markenzeichen (z.B. Styropor®) und<br />
fest etablierte Begriffe (z.B. Computer, Mikrocontroller etc).<br />
Die Bildungssprache erreicht eine sehr hohe „Reinheit“, weil sie sich mit der sehr präzise<br />
formulierten Wissenschaftssprache überschneidet. Es wird Wert gelegt <strong>auf</strong> korrekte,<br />
genormte, deutsche Begriffswahl, <strong>auf</strong> apodiktische (eindeutige) Aussageweise, <strong>auf</strong><br />
pädagogisch verwertbare und bildungsgerechte Formulierung. Bei <strong>die</strong>sen Regeln haben<br />
Anglizismen sehr wenig Raum.<br />
Diesen Sprachbereich trifft man vorwiegend in Büchern und technischen Dokumenten. Es ist<br />
auch <strong>die</strong> <strong>Sprache</strong>, <strong>die</strong> von Pädagogen gesprochen wird. In der breiten Masse der einfachen<br />
Facharbeiter (keine Techniker und Ingenieure) wird Englisch nicht <strong>auf</strong> dem Niveau der<br />
fachspezifischen Bildungssprache unterrichtet. Von einem ausgebildeten Elektroniker wird<br />
verlangt, in englischer Bildungssprache abgefasste technische Dokumentationen verstehen<br />
und <strong>auf</strong> dem Niveau der Berufssprache formulierte Dokumentationen verfassen zu können.<br />
Selten wird für <strong>die</strong> Beherrschung der englischen <strong>Sprache</strong> in Schrift ein so hohes Maß an<br />
Präzision und fachlicher Formulierung gefordert, welches der Beherrschung der eigenen<br />
(deutschen) Bildungssprache gleichen könnte.<br />
Wirtschaftsorientierte Fachsprache<br />
Wenn man in der Bildungssprache <strong>des</strong> Bereiches Elektrotechnik keine und in der<br />
Berufssprache nur wenige Anglizismen trifft, so nimmt ihre Anzahl im Bereich der Wirtschaft<br />
stark zu. Als Verkehrssprache ist hier Englisch im Zuge der Globalisierung und<br />
Konkurrenzfähigkeit <strong>auf</strong> dem Weltmarkt besonders wichtig. Deswegen wird von K<strong>auf</strong>leuten<br />
eine fließende, saubere <strong>Sprache</strong> erwartet. Aber auch im Wirtschaftsbereich der<br />
4
Elektrobranche werden englische Ausdrücke sehr häufig verwendet. So gibt es heute kaum<br />
einen Fachkatalog mehr, in dem keine Anglizismen vorkommen. Die meiste Werbung und<br />
auch <strong>die</strong> Firmendevisen (heute heißt das schon Slogan) ist von Anglisierung ergriffen. Das<br />
rührt vor allem daher, dass viele neue Produkte und Verfahren englische Bezeichnungen<br />
tragen, <strong>die</strong> in <strong>die</strong> Werbeschriften und Kataloge übernommen werden. Anderseits bezeichnen<br />
viele Unternehmen ihre Fabrikate mit englisch klingenden Namen, damit <strong>die</strong>se für <strong>die</strong><br />
Verwendung <strong>auf</strong> dem Weltmarkt nicht erst übersetzt werden müssen und „globalisch“<br />
klingen. Sie wecken dann in jeder <strong>Sprache</strong> an jedem Ort sofort Assoziationen zu <strong>die</strong>sem<br />
Produkt. Außerdem ist es leichter, solche Slogans und Labels markenrechtlich zu schützen,<br />
als Bezeichnungen und Mottos in deutscher <strong>Sprache</strong>. 1<br />
Durch den Gebrauch von Anglizismen wirken <strong>die</strong> Unternehmen wie Global-Player,<br />
international stark vertreten und modern. Aus dem Vertrieb wird eine Marketingabteilung, zu<br />
einem Kundengespräch werden Sie nun in ein Office eingeladen. Alles in Allem klingen dann<br />
solche Einladungen, Werbeprospekte und Kataloge wie schlecht übersetzte, ursprünglich<br />
englische Erzeugnisse. Das weckt bei dem Kunden den Eindruck, er habe es mit einem<br />
amerikanischen Großkonzern zu tun. Da <strong>die</strong> Globalisierung vorrangig durch <strong>die</strong> Vereinigten<br />
Staaten gelenkt und angeschoben wird, wird dadurch <strong>die</strong> Impression <strong>des</strong> Internationalismus<br />
intensiviert.<br />
3. Einflüsse <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> <strong>auf</strong> das deutsche Sprachsystem<br />
Die äußere Verfärbung der deutschen <strong>Sprache</strong> durch englische Begriffe und Formen kann<br />
„echt“, „halbecht“ oder „unecht“ sein; sie dringt aber auch unbemerkt in das Innere der<br />
<strong>Sprache</strong> ein.<br />
Die äußere Anglisierung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n durch <strong>die</strong> Einwanderung im <strong>Englischen</strong> tatsächlich<br />
gebräuchlicher Worte und Formulierungen, wird durch <strong>die</strong> „halb-„ und „unechten“<br />
Redeweisen noch verstärkt. Während es den Shop im <strong>Englischen</strong> noch gibt, ist <strong>die</strong> Bedeutung<br />
<strong>des</strong> Wortes Teenager verschoben. Da Handy gibt es in der Form in den USA oder<br />
Großbritannien überhaupt nicht. Bei vielen unserer „denglischen“ Ausdrucksweisen würden<br />
englischsprachige Gesprächspartner leicht verwirrt. Denn wenn das Mädchen seine Mutter als<br />
Power Woman preist, würde wohl freundlich nachgefragt werden, ob sie für ein<br />
Elektrizitätswerk <strong>die</strong> Zähler ablese. Sollte <strong>die</strong> Tochter dann noch anmerken, ihr Vater sei ein<br />
Streetworker, wäre das Gegenüber doch ein wenig verdattert. Und bei der Zeitungsüberschrift<br />
„Berichterstatter live vor Ort“ würden Englischsprachige besorgt bestätigt wissen, ob er lebt<br />
und fragen, wie viele denn gestorben seien.<br />
Neben den äußeren Einflüssen, gibt es noch <strong>die</strong> weniger bemerkte, innere Anglisierung der<br />
deutschen <strong>Sprache</strong>. So werden viele Ausdrücke und Redewendungen ins <strong>Deutsche</strong> übersetzt<br />
und <strong>die</strong> deutschen Begriffe erleben dabei eine Bedeutungsverschiebung. So heißt meinen jetzt<br />
auch bedeuten. Das Wort denken wird nunmehr nicht allein für <strong>die</strong> Hirntätigkeit eingesetzt,<br />
sondern auch für Meinungen. Wenn wir früher von immer mehr sprachen, so heißt es heute<br />
mehr und mehr. Die zunehmende Schreibweise <strong>des</strong> Genitivs mit Apostroph bereitet so<br />
manchem Linguisten Sorgen. 2<br />
4. Gründe für <strong>die</strong> Einflüsse<br />
Für <strong>die</strong> zunehmende Anglisierung der deutschen <strong>Sprache</strong> kann man einige Faktoren<br />
verantwortlich machen:<br />
(a) Vertreter der Me<strong>die</strong>n und der Werbung betonen immer wieder, Englisch sei<br />
grammatikalisch einfacher und nicht so umständlich im Ausdruck. Es erlaube eine<br />
wesentlich kürzere und einprägsamere Formulierung, welche bei Zeitmangel wichtig<br />
1 Doehlemann, Martin; Münster; Waxmann Verlag 2003; „Die deutsche <strong>Sprache</strong> in Not“, S. 5<br />
2 Doehlemann, Martin; Münster; Waxmann Verlag 2003; „Die deutsche <strong>Sprache</strong> in Not“, S. 2-4<br />
5
6<br />
ist. Die meisten englischen Übersetzungen sind wesentlich kürzer, als ihre deutschen<br />
Originale.<br />
(b) Wie im Abschnitt 2 bereits ausführlich behandelt, wirkt Englisch als Weltsprache<br />
besonders stark <strong>auf</strong> Bereiche, <strong>die</strong> von der Globalisierung betroffen sind.<br />
(c) Der „Mythos Amerika“, durch Me<strong>die</strong>n und Filme aus den Traumfabriken gefördert,<br />
welchem viele Menschen in vielen Erdteilen erlegen sind, stärkt das Prestige der USA.<br />
Es steht überall für „unbegrenzte Möglichkeiten“, Menschenrechte und Freiheit. Diese<br />
Dominanz der Vereinigten Staaten spiegelt sich auch in dem <strong>Einfluss</strong> <strong>auf</strong> <strong>die</strong> <strong>Sprache</strong><br />
wider.<br />
(d) Die deutsche Mentalität hat ein sehr schwaches Nationalbewusstsein. Die deutsche<br />
Geschichte vor dem Ende <strong>des</strong> Zweiten Weltkrieges hat uns mit einem Grundverdacht<br />
gegen alles ausgestattet, was deutsch klingt. Man möchte anderen gegenüber nicht „so<br />
deutsch“ dastehen. Deswegen wird <strong>die</strong> Pflege und das Interesse an der eigenen<br />
<strong>Sprache</strong> vernachlässigt. Man unterwirft sich teilweise der amerikanischen Leitkultur<br />
aus Wirtschaft und Unterhaltung. All das begünstigt <strong>die</strong> Anglisierung <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n. 3<br />
5. Pro und Kontra<br />
Natürlich gibt es viele Argumente für <strong>die</strong> Einführung von englischen Begriffen ins <strong>Deutsche</strong>.<br />
Für eine objektive Entscheidung müssen <strong>die</strong> Motive und <strong>die</strong> Nützlichkeit in Betracht gezogen<br />
werden. Manche Worte drücken den Sachverhalt kurz und präzise aus, so dass sich eine<br />
Übernahme in <strong>die</strong> deutsche <strong>Sprache</strong> lohnt. Manche Begriffe jedoch könnten durch<br />
prägnantere deutsche ersetzt werden. Im folgenden wird eine Seite <strong>auf</strong>geführt, welche 2005<br />
von der „Stiftung <strong>Deutsche</strong> <strong>Sprache</strong>“ <strong>auf</strong> der Website der „Aktion lebendiges Deutsch“ unter<br />
der Internet-Adresse http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/gefaellt.php veröffentlicht<br />
wurde:<br />
A. DIE SCHÖNEN IMPORTE: kurz, treffend und von allen verstanden.<br />
1. Im Idealfall werden sie noch dazu wie deutsche Wörter geschrieben und<br />
gesprochen.<br />
Bar, Drops, Fit, Flop, Grill, Hit, Lift, Partner Sport, Spurt, Star, Start, Test, Tipp, Trip<br />
2. Oder unsere Ahnen haben sie rücksichtslos eingedeutscht:<br />
statt cakes<br />
cheque<br />
cokes<br />
shawl<br />
strike<br />
Keks<br />
Scheck<br />
Koks<br />
Schal<br />
Streik<br />
3. Auch wenn sie sich der deutschen Rechtschreibung oder der deutschen<br />
Aussprache nicht fügen, sind <strong>die</strong> kurzen, treffenden und allgemein<br />
verständlichen zu loben:<br />
clever, Clown, fair, Fan, Flirt, Job, Hobby Party, Sex, Slip, Steak, Team, Toast, Training<br />
3 Doehlemann, Martin; Münster; Waxmann Verlag 2003; „Die deutsche <strong>Sprache</strong> in Not“, S. 4-5
B. DIE ÜBERFLÜSSIGEN, HÄSSLICHEN ODER NICHT ALLGEMEIN<br />
VERSTÄNDLICHEN, für <strong>die</strong> wir <strong>die</strong> längst vorhandenen deutschen<br />
Wörter mobilisieren wollen:<br />
Zum Beispiel Zeitlupe statt „slow motion“ oder Sprühdose statt <strong>des</strong> Zwitters „Spraydose“<br />
C. DIESELBEN WIE B, bei denen wir aber eine deutsche Entsprechung<br />
suchen wollen, von all-inclusive über Downsizing bis running gag. Der<br />
Gipfel der Hässlichkeit: englische Verben in deutscher Konjugation.<br />
Ich cancle , du coverst , er downloadet, wir outsourcen, ihr relaxt, sie recyceln, ich relaunche,<br />
du updatest, er hat upgedated, wir haben geupdated<br />
D. Erfolgreiche Eindeutschungen<br />
Abstand<br />
Augenblick<br />
Ausflug<br />
Briefwechsel<br />
Oberfläche<br />
Tatsache<br />
Vertrag<br />
Zufall<br />
distance<br />
Moment<br />
Excursion<br />
Correspondance<br />
superficies<br />
matter of fact<br />
contract<br />
accidens<br />
Urheber der Eindeutschung, soweit bekannt:<br />
Jens Baggesen (1764-1826)<br />
Joachim Heinrich Campe (1746-1818)<br />
Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658)<br />
Philipp von Zesen (1619-1689).<br />
1874 nahm <strong>die</strong> <strong>Deutsche</strong> Reichspost <strong>auf</strong> Weisung Bismarcks mit einem Schlag 760<br />
Eindeutschungen vor, bald dar<strong>auf</strong> auch <strong>die</strong> Reichsbahn und das Heer. 1903 veranstaltete eine<br />
Kuchenfabrik ein Preisausschreiben, wie das englische Wort cakes <strong>auf</strong> Deutsch heißen<br />
könnte; <strong>die</strong> Keks siegten vor dem Reschling und dem Knusperchen – ein mutig<br />
anverwandelter Anglizismus also über allzu viel Phantasie.<br />
33 Beispiele deutscher Kürze<br />
Dass englische Texte oft kürzer sind als ihre deutsche Entsprechung, ist unbestritten. Zum<br />
Teil liegt das am Satzbau: Den gloriosen Buchtitel “50 famous English poets we could do<br />
without“ müssen wir mit „ohne <strong>die</strong> wir leicht auskommen könnten“ übersetzen.<br />
Die deutschen Wörter sind überwiegend länger teils durch den größeren Buchstaben-Aufwand<br />
(zum Beispiel sch – aber auch nicht immer: Tod = death), teils durch <strong>die</strong> höhere Silbenzahl:<br />
Schreibtisch statt <strong>des</strong>k.<br />
Dies alles ist bekannt. Selten beredet aber wird der Umstand, dass viele deutsche Wörter<br />
kürzer, oft auch saftiger sind als ihr englisches Pendant. Unsere Anglizismen mit der<br />
angeblich überlegenen Kürze <strong>des</strong> englisches Wortes zu begründen ist weithin falsch.<br />
DEUTSCHE EINSILBER<br />
Geld<br />
Mord<br />
Mut<br />
nichts<br />
ENGLISCHE ZWEISILBER<br />
money<br />
murder<br />
courage<br />
nothing<br />
7
weil<br />
Berg<br />
DEUTSCHE EINSILBER<br />
echt<br />
Trotz<br />
trotz<br />
vor<br />
Dom<br />
Glück<br />
Trost<br />
DEUTSCHE ZWEISILBER<br />
Neugier<br />
Mangel<br />
alles<br />
Technik<br />
Zufall<br />
bequem<br />
Umwelt<br />
peinlich<br />
Nachteil<br />
Bahnhof<br />
Fluchtpunkt<br />
Trödler<br />
DEUTSCHE DREISILBER<br />
irrtümlich<br />
vielsilbig<br />
Erwägung<br />
Notausgang<br />
Aufseher<br />
Staubsauger<br />
Verarmung<br />
vorgestern<br />
8<br />
because<br />
mountain<br />
ENGLISCHE DREI- und VIERSILBER<br />
genuine<br />
defiance<br />
in spite of<br />
in front of<br />
cathedral<br />
happiness<br />
consolation<br />
ENGLISCHE VIER- und FÜNFSILBER<br />
curiosity<br />
deficiency<br />
everything<br />
technology<br />
coincidence<br />
comfortable<br />
environment<br />
embarrassing<br />
disadvantage<br />
railway station<br />
vanishing point<br />
second-hand dealer<br />
ENGLISCHE FÜNF- bis SIEBENSILBER<br />
erroneously<br />
polysyllabic<br />
consideration<br />
emergency exit<br />
superintendent<br />
vacuum cleaner<br />
impoverishment<br />
the day before yesterday<br />
Gerade plastische und literarisch beliebte englische Wörter haben nicht selten viele Silben:<br />
bespectacled (bebrillt), flabbergasted (verblüfft), highfalutin (hochtrabend), tatterdemalion<br />
(zerlumpt), discombobulate (durcheinanderbringen).<br />
Soweit das Zitat. Zusammenfassend kann man sagen, dass Anglizismen, wenn sie angebracht<br />
sind, ihre Berechtigung haben. Trotzdem sollte man <strong>die</strong> deutschen Worte nicht vergessen.<br />
6. Anglizismen im Internet<br />
Einen kleinen Sonderbereich nehmen <strong>die</strong> im Internet verwendeten Anglizismen ein. Während<br />
<strong>die</strong> meisten Texte der Websites einem Sprachbereich (Berufs- Umgangs- Bildungssprache)<br />
zugewiesen werden können, sind <strong>die</strong> Texte, <strong>die</strong> in Foren und in elektronischen Briefen (E-<br />
Mails) formuliert werden etwas anders: Hier gibt es auch unabhängig von der Anglisierung<br />
eine besondere <strong>Sprache</strong>ntwicklung. Um <strong>die</strong> Gedanken möglichst kurz zu äußern, hat sich hier<br />
eine stark verkürzte und oft verunglimpfte <strong>Sprache</strong> entwickelt. Auf <strong>die</strong> Rechtschreibung und<br />
Grammatik wird weitestgehend nicht geachtet.
Hier sieht man durch den weltweiten Zugang von Menschen verschiedener Kulturen <strong>die</strong><br />
Internationalisierung besonders stark. Um möglichst vielen Lesern verständlich zu sein,<br />
steigen viele ganz <strong>auf</strong> Englisch um. Oft entsteht jedoch ein babylonisches Sprachgemisch aus<br />
englischem Vokabular in deutscher Grammatik. Viele Seiten bieten mittlerweile eine<br />
abgespeckte Version <strong>des</strong> <strong>Englischen</strong> an – Simple English. So hat z.B. das Online-Lexikon<br />
Wikipedia (http://de.wikipedia.org) neben Artikeln in traditionellem English <strong>die</strong>selben<br />
Themen in der SE-Version.<br />
7. Erhaltung der deutschen <strong>Sprache</strong><br />
Es gibt einige Organisationen und Aktionen, <strong>die</strong> es sich zur Aufgabe gemacht haben, <strong>die</strong><br />
deutsche <strong>Sprache</strong> zu erhalten und zu Fördern. Dazu gehören u.a.:<br />
Aktion lebendiges Deutsch www.aktionlebendigesdeutsch.de<br />
Haus der deutschen <strong>Sprache</strong> www.hausderdeutschensprache.eu<br />
Verein <strong>Deutsche</strong> <strong>Sprache</strong> e.V. vds-ev.de<br />
Es kann aber auch jeder persönlich dazu beitragen, dass <strong>die</strong> deutsche <strong>Sprache</strong> gefördert wird:<br />
� Sprechen Sie ein klares, richtiges, schönes Deutsch!<br />
� Benutzen Sie Anglizismen nur sinnvoll und setzten Sie <strong>die</strong>se sparsam ein!<br />
� Schreiben Sie richtig, beachten Sie <strong>die</strong> Rechtschreibung und Grammatik<br />
unabhängig davon, ob Sie ein Geschäftsbrief oder eine Einladung per E-Mail<br />
schreiben!<br />
8. Resümee<br />
Über <strong>die</strong> Anglisierung der deutschen <strong>Sprache</strong> gibt es genug Karikaturen und witzige Texte. Es<br />
sei hier ein Gedicht von Wolfgang Günther angeführt, welches den Sachverhalt <strong>auf</strong><br />
humoristische Art recht gut <strong>auf</strong> den Punkt bringt:<br />
Mist bleibt Mist 4<br />
Die Leute haben einen Schplien,<br />
denn "sauber" heißt ein Ungeist klien,<br />
<strong>die</strong> Kinder aber nennt er Kids<br />
und Rundfunkschlager sind <strong>die</strong> Hits.<br />
Zur Moddern-Art zählt <strong>die</strong> Graffiti,<br />
ein Stadtzentrum wird schlicht zur Sitti,<br />
<strong>des</strong> Menschen Arbeit bloß zum Job,<br />
der große Reinfall nur ein Flop.<br />
Das Bier trinkt man in Zukunft leiht,<br />
geteimt heiß neudeutsch - gut in Zeit.<br />
man spricht von Logo, Expo, Disko,<br />
be<strong>die</strong>nt Kompjuter, zahlt mit Euro.<br />
Man sörft herum im Internet<br />
und fliegt davon im Superjet.<br />
Die Jugend sketet, beikt, ist in -<br />
und laaft nach Techno in Berlin.<br />
Wer einst Barbier ist nun Steilist...<br />
Dem Himmel Dank –<br />
der Mist bleibt Mist!<br />
4 http://vds-ev.de/literatur/humor/index.php; letzte Änderung 2008-02-01<br />
9
Wert <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n<br />
Wegen seiner Stellung als Weltsprache hat das Englische recht großen <strong>Einfluss</strong> <strong>auf</strong> andere<br />
<strong>Sprache</strong>n. Die sinnvolle Übernahme von Anglizismen ist zu befürworten. Trotzdem darf nicht<br />
das passieren, was Rudi Carrell 5 einmal ausgedrückt hat: „Als ich nach Deutschland kam,<br />
sprach ich nur Englisch - aber weil <strong>die</strong> deutsche <strong>Sprache</strong> inzwischen so viele englische<br />
Wörter hat, spreche ich jetzt fließend Deutsch!“ Oft wird mit der Benutzung englischer<br />
Begriffe Modernität verbunden. „Wer seine <strong>Sprache</strong> mit Englisch garniert, gibt sich<br />
weltgewandt und modern. Und kann sich abgrenzen gegen all jene, <strong>die</strong> ihn nicht verstehen<br />
sollen, weil er in Wahrheit gar nichts mitzuteilen hat.“ (Bastian Sick)<br />
Wir dürfen <strong>die</strong> Bedeutung der Muttersprache als Kulturgut nicht unterschätzen. Die deutsche<br />
<strong>Sprache</strong> hat einen großen Reichtum, der aber von den meisten <strong>Deutsche</strong>n noch nicht entdeckt<br />
worden ist. „Dinge, <strong>die</strong> 'schön', 'wunderbar', 'reizvoll', 'faszinierend', 'bezaubernd' oder<br />
'prächtig' sind, werden heute nur als 'cool' bezeichnet.“ (Prof. Wolfgang Frühwald, Präsident<br />
der Alexander-von-Humbold-Stiftung)<br />
Unser kolossales Kulturerbe, welches von so großen Meistern wie Goethe, Schiller, Heine,<br />
Kästner und vielen anderen hinterlassen wurde, bedarf einer sorgsamen Pflege. Die darinnen<br />
liegenden Schätze können erst mit gutem Beherrschen der deutschen <strong>Sprache</strong> für sich<br />
erschlossen werden.<br />
Uns außerdem: "Die Muttersprache ist <strong>die</strong> entscheidende Basis - auch für das Erlernen von<br />
Fremdsprachen." (Josef Kraus, Vorsitzender <strong>des</strong> <strong>Deutsche</strong>n Lehrerverbands)<br />
5 Zitate in <strong>die</strong>sem Abschnitt: http://www.vds-ev.de/literatur/promisprueche.php; letzte Änderung 2008-02-01<br />
10