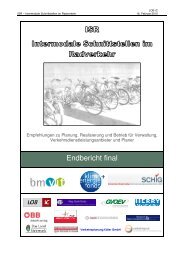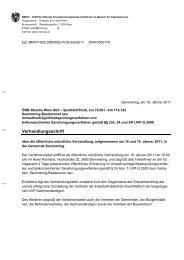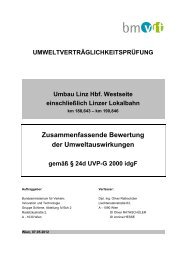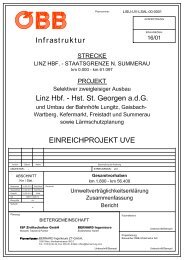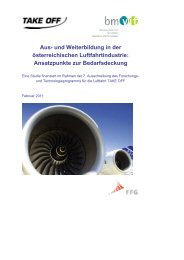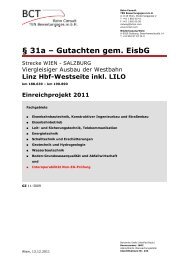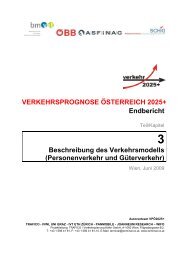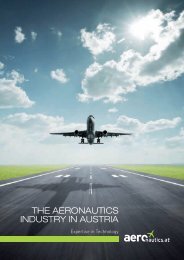Gesamtbericht: Ausbauplan Bundesverkehrsinfrastruktur 2012-2017
Gesamtbericht: Ausbauplan Bundesverkehrsinfrastruktur 2012-2017
Gesamtbericht: Ausbauplan Bundesverkehrsinfrastruktur 2012-2017
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur<br />
Klug investieren,<br />
verantwortungsvoll sparen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:<br />
mag a marianne Lackner<br />
Pressesprecherin der Bundesministerin<br />
t: +43-1-711 62 65 8121<br />
marianne.lackner@bmvit.gv.at<br />
Bundesministerium für Verkehr, innovation und technologie<br />
stubenring 1, 1010 Wien
strategie<br />
1) Einleitung: Aufgabenstellung 2<br />
2) Strategien für den Ausbau der österreichischen Verkehrsinfrastruktur 2<br />
2.1 Allgemeine Vorgehensweise 2<br />
2.2 Übergeordnete Zielsetzungen zum Infrastrukturausbau 3<br />
2.3 Das Bundesverkehrswegenetz 5<br />
2.4 Einheitliches Zielsystem: Bewertungskriterien 6<br />
3) Verkehrsprognose Österreich 2025+:<br />
Einheitliches Verkehrsmengengeüst als eine der Entscheidungsgrundlagen 7<br />
3.1 Hintergrund und Aufgabenstellung 7<br />
3.2 Methode der Verkehrsprognose Österreich 2025+ 8<br />
3.3 Szenarien und Prognosehorizonte 9<br />
3.4 Berücksichtigung der Wirtschaftskrise 10<br />
3.5 Ergebnisse der Prognose 12<br />
ausBauPLan asfinag<br />
1) Überblick Bauprogrammsentwurf 21<br />
2) Methodische Entwicklung des Zielnetzes 21<br />
2.1 Bereich Neubau 22<br />
2.2.Bereich Bestandsnetz 22<br />
2.3 Entwicklung von Rastplätzen 23<br />
3) Bauprogramm <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong> 23<br />
3.1 Bereich Neubau 23<br />
3.2 Bereich Bestandsnetz 24<br />
ausBauPLan öBB<br />
1) Überblick 29<br />
1.1 Die Grundlagen und die Realisierung der verkehrspolitischen Ziele 29<br />
1.2 Verkehrsprogose 29<br />
1.3 Das Zielnetz unterstützt die Ziele von Eigentümer und ÖBB 30<br />
1.4 Systemadäquanz 30<br />
1.5 Kapazitätssteigerung und Knoten/Kantenzeiten 30<br />
2) Evaluierung Rahmenplan 33<br />
2.1 Basis der Evaluierung 33<br />
2.2 Evaluierungskriterien 33<br />
2.3 Evaluierungsergebnis 33<br />
2.4 Definition und Reihung der Achsen 34<br />
2.5 Priorisierungsvorschlag: 10 netzwirksame Etappen auf dem Weg zum Zielnetz 35<br />
2.6 Exkurs: exemplarische Beispiele zu Projektdimensionierungen 35<br />
3) Rahmenplan <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong> 36<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 1<br />
inhaltsverzeichnis
1) einleitung: aufgabenstellung<br />
Das österreichische Verkehrssystem ist geografisch ein zentraler Bestandteil eines europäischen Gesamtsystems.<br />
Es ist unbestritten, dass ein leistungsfähiges Verkehrssystem in Österreich ein wichtiges<br />
Entscheidungskriterium für wirtschaftliche Entwicklung und Industrieansiedlung und darüber hinaus<br />
die Grundlage für die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung des Landes darstellt. Es ist ebenso<br />
unbestritten, dass ein leistungsfähiges und barrierefrei zugängliches Verkehrssystem in Österreich ein<br />
wesentliches Kriterium für die Gewährleistung der Mobilität der Menschen in Österreich ist und als<br />
wesentlicher Faktor für die Erhaltung der Lebensqualität bewertet wird.<br />
Die Entscheidungen zum Aus- und Umbau der Infrastruktur sind aufgrund der entstehenden Kosten und<br />
der Langfristigkeit der Infrastrukturnutzung von großer Tragweite. Das bmvit ist bestrebt, diese Entscheidungen<br />
fundiert aufzubereiten und eine klare Strategie für die Verkehrsinfrastruktur vorzugeben.<br />
im einzelnen soll diese strategie folgende elemente umfassen:<br />
• Festlegung der grundsätzlichen Zielsetzungen für die Gestaltung der Infrastruktur.<br />
• Verkehrsprognose für Österreich.<br />
• Festlegung von Zielnetzen für Österreich.<br />
• Darauf aufbauend können die Festlegung des Investitionsbedarfs,<br />
der mittelfristigen Rahmenpläne für die ÖBB und der Bauprogramme der ASFINAG erfolgen.<br />
Durch die Vorgaben des Bundesfinanzrahmengesetzes, aber auch durch eine geänderte Verkehrsentwicklung<br />
aufgrund der Wirtschaftskrise waren Anpassungen der bisherigen Infrastrukturprogramme<br />
erforderlich. Die erfolgte Evaluierung der Projekte führt zu einer Dringlichkeitsreihung, einer Redimensionierung<br />
der Projekte und – in einigen Fällen – auch einer Anpassung der Netze.<br />
2) strategien für den ausbau der<br />
österreichischen Verkehrsinfrastruktur<br />
2.1 Allgemeine Vorgehensweise<br />
Für die Entwicklung der Strategien zum Ausbau der österreichischen Verkehrsinfrastruktur werden<br />
folgende Ebenen unterschieden:<br />
• Auf einer netzebene erfolgt die grundsätzliche Gestaltung der Netze sowie die Abgrenzung eines<br />
„Bundesverkehrswegenetzes“.<br />
• In einer Prioritätenreihungsebene werden die Prioritäten für den Ausbau des Netzes festgelegt; die<br />
zeitliche Dringlichkeit der Projekte wird anhand der verkehrlichen Dringlichkeit, der Netzwirkung und<br />
der Umsetzungsreife der Projekte bestimmt.<br />
• Auf Basis dieser Prioritätenreihungen können in einer Programmebene die konkreten Finanz- und<br />
Bauprogramme entwickelt werden (Rahmenplan der ÖBB und Bauprogramm der ASFINAG).<br />
• Die Dimensionierung von Projekten und die eigentliche Umsetzung einschließlich der zugehörigen<br />
Behördenverfahren erfolgt auf der Ebene der Einzelprojekte (Projektebene).<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 2
Die übergeordneten Ziele des bmvit zur Infrastrukturpolitik stellen den Überbau in dem Prozess dar, mit<br />
welchem der Ausbau der österreichischen Verkehrsinfrastruktur festgelegt wird.<br />
Aufbauend auf diesen Zielen werden Vorgaben für die Umsetzung der Prioritätenreihung in Form von übergeordneten<br />
Kriterien abgeleitet, die die Grundlage zur evaluierung der infrastrukturprojekte darstellen.<br />
Die Evaluierung der Projekte geht über eine reine Prioritätenreihung hinaus: Sie umfasst einerseits Elemente<br />
der Projektebene, wenn eine mögliche Redimensionierung der Projekte geprüft wird. Andererseits<br />
kann die Evaluierung von Projekten auch die Netzebene betreffen, wenn in einzelnen Fällen auch<br />
eine Redimensionierung des Bundsverkehrswegenetzes untersucht wird.<br />
Die Evaluierung erfolgt für jeden Verkehrsträger getrennt, aber unter gemeinsamen Zielsetzungen.<br />
Schwerpunktsetzungen zwischen den Verkehrsträgern werden durch das bmvit vorgegeben.<br />
Die Ergebnisse der Verkehrsprognose Österreich 2025+ stellen das Verkehrsmengengerüst für die<br />
Bewertung der Infrastrukturentscheidungen dar.<br />
2.2 Übergeordnete Zielsetzungen zum Infrastrukturausbau<br />
Das bmvit sieht es als aufgabe,<br />
• den Wirtschaftsstandort Österreich durch eine Sicherung und Verbesserung der Erreichbarkeit im<br />
Personen- und Güterverkehr zu stärken und die Bedürfnisse der Bevölkerung an einer regionalen und<br />
überregionalen Mobilität abzudecken;<br />
• die Abwicklung der dadurch entstehenden Verkehrsleistungen unter weitestgehender Schonung von<br />
Umwelt, Anrainern und natürlicher Ressourcen sicherzustellen und insbesondere eine Reduktion von<br />
Treibhausgasen zu erzielen;<br />
• die Sicherheit der Infrastrukturbenutzer („Verkehrssicherheit“), aber auch die Sicherheit der Verfügbarkeit<br />
der Infrastruktur in einem hohen Ausmaß zu gewährleisten und<br />
• diese Ziele auch vor dem Hintergrund knapper finanzieller Ressourcen bewerkstelligen zu können.<br />
Deswegen werden folgende übergeordnete Zielsetzungen im infrastrukturausbau gesehen:<br />
• erreichbarkeit: Sicherung und Verbesserung der Erreichbarkeit zentraler ebenso wie peripherer<br />
Regionen und die zu erwartende Verkehrsentwicklung erfordern Maßnahmen zum Ausbau bzw. der<br />
Optimierung der Infrastruktur.<br />
• Zuverlässigkeit: Ein zuverlässiges Verkehrssystem ist die Basis für einen zuverlässigen Betrieb der<br />
Infrastruktur und damit für ein zuverlässiges Verkehrsangebot. In Zeiten immer komplexer werdender<br />
Transport- und Wegketten mit einem stark steigenden Qualitätsanspruch an das Verkehrsangebot<br />
tritt die Verlässlichkeit des Angebots – die Verlässlichkeit der Reisezeiten („Pünktlichkeit“) – in den<br />
Vordergrund. Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur müssen daher die Erhöhung der Zuverlässigkeit<br />
des Verkehrssystems insgesamt zum Ziel haben.<br />
• sicherheit: Damit sind sowohl die Sicherheit für den Endnutzer des Verkehrssystems, etwa Fahrgäste<br />
des öffentlichen Verkehrs oder Autofahrer, gemeint als auch die Betreiber des Verkehrssystems,<br />
die nicht nur ihre Mitarbeiter und ihren Teil des Systems in Sicherheit und damit geschützt wissen<br />
wollen sondern auch nicht zuletzt das ihnen anvertraute Transportgut. Daher müssen Maßnahmen<br />
zur Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur stets unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der<br />
Sicherheit stehen.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 3
• Verträglichkeit und umweltfreundlichkeit: Angesichts der Vorteile der Schiene und der Wasserstraße<br />
in Bezug auf die Umweltauswirkungen ist eine Priorisierung des Ausbaus dieser Verkehrsträger<br />
anzustreben, um eine Verlagerung von Verkehren von der Straße zu unterstützen. Den intermodalen<br />
Verknüpfungspunkten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Bei der Schiene ist aber die Systemadäquanz<br />
zu prüfen: Die Schiene ist nur dort effektiv und effizient einsetzbar, wo sich die Nachfragepotentiale<br />
mit den Systemmerkmalen der Schiene decken. Neben der Schwerpunktsetzung mit<br />
dem Ziel, eine sinnvolle Verkehrsverlagerung zu unterstützten ist es ebenfalls erforderlich, innerhalb<br />
der Verkehrsträger die Infrastruktur so auszubauen, dass die Abwicklung des Verkehrsaufkommens<br />
unter weitestgehender Schonung von Umwelt, der Anrainer und der natürlichen Ressourcen und<br />
unter Steigerung der Sicherheit erfolgen kann.<br />
• Bedarfsgerechte Verkehrsinfrastruktur: Das Schienennetz ist so auszubauen, dass ein vom Bund<br />
festgelegtes Grundangebot für den Nahverkehr, sowie das Angebot aufgrund derzeit bestehender<br />
bzw. als fix zugesagter Verkehrsdiensteverträge der Länder bzw. der Kommunen in der jeweils vereinbarten<br />
Betriebsqualität mit hoher Pünktlichkeit in einem Taktfahrplan mit vorgegebenen Kantenzeiten<br />
abgewickelt werden können. Der durch den Zugang weiterer Marktteilnehmer zu erwartende<br />
Kapazitätsbedarf ist zu berücksichtigen. Beim Straßenausbau ist die Qualität des Bestandes zu<br />
erhalten bzw. auszubauen und ein bedarfsgerechter ausbau zu forcieren.<br />
exkurs:<br />
Beispiele für die Vorteile der schiene aber auch die Bedeutung der Beachtung der systemadäquanz:<br />
Klimaschutz:<br />
Der Bahnverkehr – insbesondere mit elektrischer Traktion – weist deutlich geringere C0 2 Emissionen<br />
auf als der Straßenverkehr. Auf Strecken mit Dieseltraktion sind diese Vorteile stark reduziert oder –<br />
wie beim Personenverkehr im Vergleich mit dem Bus – gar nicht vorhanden.<br />
abbildung 1: spezifische Co 2 emissionen im Personenverkehr<br />
datenquelle: umweltbundesamt, postbus aG, bmvit; berechnungen bmvit; datenstand 2007<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 4
abbildung 2: spezifische Co 2 emissionen im güterverkehr<br />
datenquelle: umweltbundesamt, postbus aG, bmvit; berechnungen bmvit, datenstand 2007<br />
sicherheit:<br />
Die Bahn zählt zu den sichersten Verkehrsmitteln. Im Jahr 2008 verunglückten rund 30.000 Menschen<br />
im Pkw, 367 davon starben. Bei der Bahn verunglückten 83 Fahrgäste, 2 davon tödlich (Quelle: Statistik<br />
Austria, BAV). Die Wahrscheinlichkeit, bei einer vergleichbaren Wegstrecke als Insasse eines Pkw zu<br />
verunglücken ist damit rund 50 Mal höher als bei der Benutzung der Bahn.<br />
2.3 Das Bundesverkehrswegenetz<br />
Das österreichische Bundesverkehrswegenetz soll folgende Zielsetzungen erfüllen:<br />
• Sicherung der überregionalen Erreichbarkeit von Zentren in Österreich einschließlich<br />
deren Verbindung zu benachbarten Zentren.<br />
• Verknüpfung des Netzes mit wesentlichen intermodalen Knoten.<br />
• Sicherung der Anbindung Österreichs an wesentliche europäische Wirtschaftsregionen<br />
und an bedeutende internationale Häfen.<br />
Das Bundesnetz enthält:<br />
• sämtliche Strecken der transeuropäischen Verkehrsnetze in Österreich,<br />
• sonstige Strecken von überregionaler Bedeutung und mit hohem Anteil an überregionalem Verkehr,<br />
• Anbindungen an intermodale Terminals und Knotenpunkte mit nationaler und internationaler<br />
Bedeutung.<br />
Der Bund gibt für das Bundesnetz Qualitätsstandards sowohl hinsichtlich der Infrastruktur als auch<br />
hinsichtlich des Angebots im Fall des öffentlichen Verkehrs vor und trägt Sorge für die Errichtung und<br />
Erhaltung der Infrastruktur sowie die Gewährleistung der betrieblichen Qualitätsstandards.<br />
Das Bundesnetz der Straße ist durch das Bundesstraßengesetz (BStG) definiert, die Elemente des<br />
Bundesstraßennetzes sind in den Anhängen 1 und 2 des BStG festgelegt. Veränderungen und Erweiterungen<br />
des Bundesstraßennetzes unterliegen der Strategischen Prüfung Verkehr, in deren Rahmen<br />
auch die Hochrangigkeit der Netzveränderung mitzuberücksichtigen ist. Eine mögliche Reduktion des<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 5
Bundesstraßennetzes um einzelne Netzelemente wurde im Zuge der Evaluierungen geprüft.<br />
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Veränderungen des Bundesverkehrswegenetzes im Straßen- wie im<br />
Schienenbereich jedenfalls vom Gesetzgeber (Parlament) bzw. von der Bundesregierung zu verankern sind.<br />
Im Bereich der Schiene besteht im Bundesbahngesetz der Auftrag an die ÖBB zur Festlegung eines<br />
Zielnetzes als Grundlage für die Erstellung der Rahmenpläne. Diesem Auftrag wird als Vorstufe zum<br />
Evaluierungsprozess Folge geleistet.<br />
Innerhalb des Netzes sind Hochleistungsstrecken verordnet. Die Verordnung weiterer Hochleistungsstrecken<br />
ist einer Strategischen Prüfung Verkehr zu unterziehen.<br />
Als Bundesnetz im Bereich der Binnenschifffahrt wird die im Schifffahrtsgesetz definierte Wasserstraße<br />
verstanden.<br />
Innerhalb des Bundesverkehrswegenetzes kann über die Einstufung der Transeuropäischen Netze<br />
Verkehr (TEN-V) eine weitere Kategorisierung erfolgen. Derzeit wird innerhalb der Transeuropäischen<br />
Netze zwischen dem Basisnetz und einzelnen, vorrangigen Projekten unterschieden. Die Kommission<br />
arbeitet gerade an einer neuen Strukturierung der TEN-V, die dem Basisnetz ein konsistentes höchstrangiges<br />
Kernnetz gegenüberstellt.<br />
Überlegungen zu einer weiteren Kategorisierung des Bundesnetzes sind in Arbeit. Sie haben aber<br />
keinen Einfluss auf die Ergebnisse und Festlegungen des Evaluierungsprozesses.<br />
Das Bundesverkehrswegenetz ist einerseits ein auf Jahrzehnte hinaus angelegter Plan für den Ausbau<br />
der österreichischen Verkehrsinfrastruktur. Insofern sind Entscheidungen über Veränderungen<br />
des Netzes von langfristigem Charakter und bedürfen entsprechend massiv fundierter Grundlagen.<br />
Andererseits müssen getroffene Entscheidungen laufend evaluiert werden und Feinjustierungen<br />
zur Anpassung an aktuelle Herausforderungen möglich sein. Eine wesentliche Grundlage dafür sind<br />
Untersuchungen zur Entwicklung der Verkehrsnachfrage, wie etwa der Verkehrsprognose Österreich<br />
2025+, einem Meilenstein in der Beobachtung und Vorschau der Verkehrsentwicklung.<br />
2.4. Einheitliches Zielsystem: Bewertungskriterien<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Wirtschaftsstandort<br />
einheitliches<br />
Zielsystem<br />
Verkehrssicherheit<br />
umwelt<br />
Aufbauend auf den in Abschnitt 2.2. definierten Zielsetzungen werden für die Bewertungen der<br />
Straßen- und Schienenprojekte übergeordnete Kriterien festgelegt. Angesichts der unterschiedlichen<br />
Rahmenbedingungen werden diese Kriterien bei Straße und Schiene in spezifischen Bewertungsinstrumenten<br />
zumindest implizit berücksichtigt.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 6
Sicherung der<br />
Erreichbarkeit<br />
Ziele Kriterien für straßenprojekte Bahnprojekte<br />
Sozial- und<br />
Umweltverträglichkeit,<br />
Ressourcenschonung<br />
• Bewertung der Hochrangigkeit<br />
und des Status im TEN-Netz<br />
• Erreichbarkeitsverbesserungen<br />
• Verlagerungen innerhalb des<br />
Verkehrsträgers zu Straßen mit<br />
minimaler Beeinträchtigung von<br />
Anrainern<br />
• Verbesserung des Verkehrsflusses<br />
• negative Effekte durch Rückverlagerung/Neuverkehr<br />
Sicherheit • Verlagerungen innerhalb des<br />
Verkehrsträgers zu Straßen mit<br />
geringerer Unfallrate<br />
• Erhöhung der Systemsicherheit<br />
Finanzierbarkeit/<br />
Wirtschaftlichkeit/<br />
Umsetzbarkeit<br />
• Nutzen-Kosten-Verhältnis<br />
• Projektergebnisrechnung<br />
• Prüfung von Redimensionierungsmöglichkeiten<br />
• Durchführbarkeit<br />
• Rolle des Projektes im Bundeszielnetz:<br />
Beitrag zur Erfüllung der<br />
Zielvorgaben zu Kantenfahrzeiten<br />
gem. Achsenbetrachtungen<br />
• Beitrag zur Erfüllung der Zielvorgaben<br />
für ein ausreichendes Kapazitätsangebot<br />
auf Achsen<br />
• Verlagerungswirkung<br />
• Einsparungen an volkswirtschaftlichen<br />
Kosten durch Reduzierung von<br />
CO und Luftschadstoffen (Klima-<br />
2<br />
schutz) nach Verlagerung<br />
auf die Schiene<br />
• Verlagerungswirkung<br />
• Erhöhung der Systemsicherheit<br />
• Deckung der variablen & semivariablen<br />
Kosten der ÖBB-Infrastruktur AG<br />
• Höhe der Annuitäten im derzeitigen<br />
Rahmenplan<br />
• Prüfung der Redimensionierungen<br />
• Durchführbarkeit<br />
3) Verkehrsprognose österreich 2025+:<br />
einheitliches Verkehrsmengengerüst<br />
als eine der entscheidungsgrundlagen<br />
3.1 Hintergrund und Aufgabenstellung<br />
Als Grundlage für die Bewertung der Infrastrukturvorhaben dienen die Ergebnisse des Projektes „Verkehrsprognose<br />
Österreich 2025+“, kurz „VPÖ 2025+“, als fundierte Einschätzung der zukünftigen Entwicklung<br />
der Verkehrsnachfrage.<br />
Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, die ASFINAG, die SCHIG mbH und die<br />
ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG beauftragten 2003 ein Team bestehend aus TRAFICO, dem Institut für<br />
Volkswirtschaftslehre der Universität Graz, Panmobile, dem Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme<br />
der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Joanneum Research und dem Österreichischen<br />
Institut für Wirtschaftsforschung mit der Durchführung des Projekts. Die Projektleitung und -steuerung<br />
erfolgte durch Dipl.-Ing. A. Käfer, TRAFICO, seit 1. 7. 2009 Verkehrsplanung Käfer GmbH. Die Arbeiten<br />
wurden im Zeitraum 2003 bis 2006 erstellt, eine Aktualisierung erfolgte bis 2008.<br />
Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 abzuzeichnen begann,<br />
konnte in den Annahmen der Szenarien noch nicht berücksichtigt werden. Der Einbruch in der Verkehrsnachfrage,<br />
der sich 2009 abzeichnete, muss aber für die anstehenden Überlegungen zur Neubewertung<br />
der Infrastrukturinvestitionen berücksichtigt werden. Eine komplette Neuberechnung der Prognose schied<br />
aus Gründen der Bearbeitungsdauer aus.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 7
Das bmvit beauftragte das Institut für Höhere Studien mit einer ergänzenden Beurteilung darüber, welche<br />
Auswirkungen die Wirtschaftskrise auf die langfristige Verkehrsentwicklung haben könnte und wie die<br />
Ergebnisse der „Verkehrsprognose Österreich 2025+“ angesichts der Krise zu interpretieren sind.<br />
Die nachfolgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über die Methoden des Hauptauftrags der<br />
„Verkehrsprognose Österreich 2025+“, die ergänzenden Berechnungen, die zur Berücksichtigung der<br />
Wirtschaftskrise erfolgten, und stellt die Erwartungen für die zukünftige Verkehrsnachfrage dar, wie sie<br />
sich aus heutiger Sicht präsentiert.<br />
3.2 Methode der Verkehrsprognose Österreich 2025+<br />
Die „Verkehrsprognose Österreich 2025+“ setzt sich im Wesentlichen aus einem Personenverkehrsmodell<br />
und einem güterverkehrsmodell zusammen, welchen ein umfassendes Wirtschaftsmodell<br />
vorgelagert ist. Das Güterverkehrsmodell wurde hierfür eigens entwickelt und ermöglicht erstmals eine<br />
Prognose des Güterverkehrs, die auf abgeleiteten funktionalen Zusammenhängen beruht.<br />
abbildung 1: genereller aufbau des Verkehrsmodells österreich<br />
Zentrales Element der VPÖ 2025+ ist das „Verkehrsmodell Österreich“ (VMÖ). Die VPÖ 2025+ unterscheidet<br />
im Personenverkehr 40 verhaltenshomogene Gruppen, 4 Raumtypen, 5 Verkehrsmittel<br />
(Fußgänger, Radfahrer, ÖV, Pkw-Lenker, Pkw-Mitfahrer) und 16 Wegezwecke. Als Grundlage wurde eine<br />
eigene Motorisierungsprognose erstellt.<br />
Die güterverkehrsprognose der VPÖ2025+ differenziert die Verkehrsträger Straße, Schiene, Schiff- und<br />
Luftfahrt, 14 Gütergruppen und 4 Relationsgruppen (Binnen-, Quell-, Ziel- und Transitverkehr).<br />
Mit MultiREG, dem den Verkehrsmodellen vorgelagerten Wirtschaftsmodell, wurde die räumliche<br />
Verteilung der Nachfrage, der Produktion, des Einkommens und der Beschäftigung prognostiziert. Daraus<br />
wurden Mengen- und Wertströme sowohl innerhalb Österreichs als auch im Austausch mit dem<br />
Ausland ermittelt. In weiterer Folge wurden diese Mengen mit dem VMÖ auf die Verkehrsträger verteilt<br />
und in transportierte Tonnagen und Fahrten des Güterverkehrs umgelegt.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen<br />
8
Die Prognose des Wegeaufkommens im Personenverkehr ist in Österreich räumlich auf Gemeindeebene<br />
untergliedert, im Ausland ist die Unterteilung gröber. Für jede Quell-/Zielbeziehung zwischen zwei<br />
räumlichen Einheiten wurde das Fahrtenaufkommen prognostiziert und als Streckenbelastungen im<br />
Verkehrsnetz des VMÖ abgebildet.<br />
Die Ergebnisse des Projektes „Verkehrsprognose Österreich 2025+“ stellen als Produkt mehr dar, als die<br />
hier zusammengefassten Berichte: Die Auftraggeber bmvit, ASFIANG und die jetzige ÖBB-Infrastruktur<br />
AG verfügen über die Nutzungsrechte am Verkehrsmodell Österreich (VMÖ) und können die Ergebnisse<br />
daher als umfassendes Planungstool für verschiedene Fragestellungen einsetzen.<br />
3.3 Szenarien und Prognosehorizonte<br />
Grundlegende Entwicklungsperspektiven aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und dem<br />
Verkehrssektor wurden der Verkehrsprognose einheitlich im Sinne von wahrscheinlichen Trends unterstellt.<br />
Die der Prognose zugrunde gelegten Bevölkerungsprognosen gehen weiterhin von einer leicht<br />
wachsenden Bevölkerung, aber mit sinkendem Anteil junger Menschen aus. Die Prognose der Veränderungsraten<br />
der Wirtschaft, die vor dem Eintreten der Finanz- und Wirtschaftskrise erstellt wurde, ging<br />
in Übereinstimmung mit internationalen Prognosen von einem stetigen Wachstum aus.<br />
Die wichtigsten Prognoseannahmen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst (soweit nicht<br />
anders angegeben, beziehen sich Veränderungen auf den Zeitraum 2005–2025):<br />
tabelle 1: Wesentliche einflussgrößen und Basisannahmen<br />
Einflussgröße Annahmen<br />
Bevölkerung geringfügiges Anwachsen der österreichischen Bevölkerung,<br />
Änderungen der Altersstruktur; z. T. Bevölkerungsrückgänge im Ausland<br />
Wirtschaft Wirtschaftswachstum in Österreich:<br />
+2 % p. a.; im Ausland: Differenzierung je Land<br />
Infrastruktur Ausbauten im In- und Ausland bis 2025 gemäß Planungsstand 2007<br />
(Maßnahmen des Bundesstraßengesetztes bei der Straße, im Bahnbereich<br />
Rahmenplan 2009/2014 sowie darüber hinausgehende Maßnahmen<br />
gemäß Zielnetz)<br />
Verkehrspolitische<br />
Rahmenbedingungen<br />
szenario 1:<br />
keine wesentlichen Änderungen der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen<br />
(keine Anlastung externer Kosten, Pkw-Maut, etc.), Kfz-Benutzung<br />
wird real nicht teurer<br />
szenario 2:<br />
Zunahme bei den Nutzerkosten auf der Straße (Pkw +30 %, Lkw +70 %)<br />
verdichtetes Angebot im ÖV, Änderungen in der Flächennutzung<br />
Hinsichtlich spezifischer Rahmenbedingungen im Verkehrsbereich unterscheidet die Prognose zwei<br />
Szenarien. Diese variieren hinsichtlich der Annahmen der Benutzerkosten, aber auch anderer verkehrlicher<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Während Szenario 1 hinsichtlich der Kostenentwicklung von einer unveränderten Kostenstruktur im<br />
Straßenverkehr ausgeht, unterstellt demgegenüber Szenario 2 eine Zunahme der variablen Kosten<br />
auf der Straße, sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr. Beide Szenarien gehen im öffentlichen<br />
Personenverkehr von real konstanten Tarifen aus, lediglich Zeitkarten erfahren eine Erhöhung.<br />
Im Schienengüterverkehr erfolgen Kostenreduktionen aufgrund der Liberalisierung und Verbesserungen<br />
im Bereich der Interoperabilität auf Hauptstrecken.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 9
In Bezug auf die Entwicklung der Treibstoffpreise wurden 2 gleichwertige Szenarien betrachtet: Szenario<br />
1 nimmt eine Beruhigung der Kostenentwicklung an, wodurch die variablen IV-Kosten gegenüber dem<br />
Bestand real konstant bleiben. Szenario 2 unterstellt einen kontinuierlichen Anstieg der Treibstoffpreise,<br />
der sich auch in den variablen Kfz-Kosten niederschlägt. Das Fahrplanangebot im ÖV wird noch stärker<br />
erweitert und auch in der Regionalplanung werden Siedlungsverdichtungen unterstellt.<br />
3.4 Berücksichtigung der Wirtschaftskrise<br />
Der langfristige Trend der letzten Jahrzehnte mit wachsendem Verkehr ist durch die Finanzkrise<br />
2008 jäh gestoppt worden. Der im Jahr 2009 einsetzende Verkehrsrückgang ist in dieser Größenordnung<br />
bisher noch nie beobachtet worden und zeigt ein asymmetrisches Verhalten des Verkehrs in<br />
Krisenzeiten: Der Einbruch des Güterverkehrs ist viermal stärker als der Rückgang im Wirtschaftswachstum<br />
und lässt den möglichen Ausblick zu, dass es sich in diesem Fall nicht um einen üblichen<br />
konjunkturbedingten Rückgang handelt, sondern um einen Strukturbruch in der bisher beobachteten<br />
Beziehung zwischen Wirtschaftswachstum und Verkehrsentwicklung in Österreich. Die empirische<br />
Basis für diesen Rückgang in der Verkehrsentwicklung ist allerdings zu schwach, um gesicherte ökonometrische<br />
Aussagen treffen zu können, und daher ist der einzig mögliche Weg, um das Spektrum<br />
der zukünftigen Entwicklung abzuschätzen, eine Szenariensimulation.<br />
in den untersuchten szenarien für die entwicklung des Wirtschaftswachstums hat sich das iHs auf<br />
3 typen beschränkt:<br />
• u-typ: Rückkehr zum alten Wachstumspfad nach etwa 10 Jahren<br />
• V-typ: einmaliger Trendbruch in der Größenordnung bis Mitte 2009,<br />
danach ein Wachstumstrend wie bisher<br />
• L-typ: nach Trendbruch setzt eine halbierte Wachstumsrate verglichen mit vor der Krise ein<br />
abbildung 2: szenario Potentialoutput, mrd. euro (Basis 2005)<br />
Quelle: statistik austria, ihs 2009<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 10
Empirische und theoretische internationale Studien der OECD deuten für die Entwicklung des<br />
Wirtschaftswachstums auf den U-Typ bzw. V-Typ als wahrscheinlichste Szenarien hin. Da das IHS<br />
der Ansicht ist, dass die in der Krise freigesetzten Produktionsfaktoren mittel- bis langfristig wieder<br />
produktiv eingesetzt werden, wird ein U-Typ Szenario, also eine vollständige Erholung der Wirtschaft<br />
auf ihr Potenzial vor der Krise, als wahrscheinlichstes angesehen. Gemäß Einschätzungen<br />
des Instituts wird die vollständige Erholung etwa 2020 eintreten, jedoch ist diese gegenwärtige<br />
Einschätzung der Nachwirkungen der Wirtschaftskrise mit hohen Unsicherheiten behaftet. Am unwahrscheinlichsten<br />
wird eine nachhaltige Schwächung des Wachstums, das L-Szenario, angesehen.<br />
Wird diese Einschätzung auf die vier Teilergebnisse der VPÖ 2025+ (Güter – Personen und Straße –<br />
Schiene) angewendet, so ergeben sich für die IHS-Autoren folgende Konsequenzen:<br />
Da der Personenverkehr stark mit der nationalen wirtschaftlichen Entwicklung gekoppelt ist, wird<br />
auch für den Verkehr das U-Szenario angenommen. Es ist deshalb zwischen 2010 und 2020 mit<br />
einem niedrigeren Niveau und höherem Wachstum als in der VPÖ 2025+ zu rechnen. Danach kann<br />
mit einem weiteren Verlauf des ursprünglichen Trends der Verkehrsprognose Österreichs (VPÖ<br />
2025+) in unveränderter Form gerechnet werden. Da das IHS keine nachhaltigen Auswirkungen der<br />
Wirtschaftskrise auf den Ölpreis unterstellt (d. h. ein langfristiges Wachstum von 3 % p. a.), werden<br />
keine Veränderungen für die langfristige Verkehrsmittelwahl (Modal Split) angenommen. Deshalb<br />
nimmt der Personenverkehr auf Schiene und Straße einen gleichen Verlauf.<br />
Der güterverkehr ist im exportintensiven Österreich zudem noch stark von internationalen Entwicklungen<br />
und dem Welthandel abhängig. Die Rahmenbedingungen haben sich durch die globale<br />
Finanzkrise 2008 eingetrübt: Das hohe kreditfinanzierte Konsumniveau der USA in den Jahren vor<br />
Ausbruch der Krise wird langfristig wohl nicht mehr erreicht werden. Zudem werden die Budgetkonsolidierungen<br />
östlicher Nachbarländer die Nachfrage drosseln. Der Güterverkehr Österreichs<br />
weist hohe Anteile an Transit- und Quell-/Zielverkehr auf, welche stark durch den Transport von<br />
Fahrzeugen, Maschinen und Halb-/Fertigwaren geprägt sind. Da die Automobilbranche stark von<br />
der Krise betroffen ist und zusätzlich schon jetzt weitgehende Überlegungen zur ökologischen<br />
Umstrukturierung der Produktion in einigen Sektoren anlaufen, wird in der Auto- und Zulieferindustrie<br />
zukünftig wohl nachhaltig weniger nachgefragt und transportiert werden. Investitionen<br />
für Maschinen zur Produktion dürften ebenfalls mittelfristig (wegen des nun einsetzenden Nachfragerückgangs)<br />
weniger nachgefragt werden als vor der Krise. Aus diesen Gründen ist im Güterverkehr<br />
mittelfristig von einem unveränderten Wachstum auf niedrigerem Niveau auszugehen (V-Typ).<br />
Aufbauend auf den Schlussfolgerungen des IHS und vorliegenden Verkehrsnachfragedaten für das<br />
Jahr 2009 wurden vom bmvit folgende Anpassungen der Ergebnisse der Verkehrsprognose Österreich<br />
2025+ auf der Ebene von Globalzahlen durchgeführt:<br />
Die Ergebnisse zum Personenverkehr behalten für 2025 ihre volle Gültigkeit.<br />
Im Güterverkehr wird das Jahr 2009 als neues Zwischenjahr eingefügt. Auf dieses Jahr werden die<br />
Wachstumsraten, die sich aus der Verkehrsprognose Österreich 2025+ ergeben, aufgesetzt, um<br />
neue Prognosewerte zu erreichen.<br />
mit diesen Wachstumsfaktoren wurde berechnet:<br />
• welche Verkehrsnachfrage in den Jahren 2015 und 2025 zu erwarten ist und<br />
• wann mit einem Erreichen der ursprünglichen Prognosewerte zu rechnen ist .<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 11
3.5 Ergebnisse der Prognose<br />
3.5.1. Personenverkehr<br />
Die gesamte Personenverkehrsleistung steigt im Szenario 1 von 85 Mio. Personenkilometern im<br />
Basisjahr 2005 um +24 % auf 105 Mio. im Prognosejahr 2025 (siehe Tabelle 2 und Abbildung 3). Die<br />
prognostizierte Steigerung der ÖV-Passagierkilometer in diesem Zeitraum beträgt +20 %, die im Pkw<br />
zurückgelegten Personenkilometer erhöhen sich um +25 % (siehe Abbildung 3). Bedingt durch die<br />
Ausbauten der Hauptstrecken und die resultierenden Reisezeitverkürzungen zeigen sich dort starke<br />
Zuwächse im Bahnverkehr (z. B. Westbahn bei St. Pölten +67 %, Südbahn Semmering +76 %). Noch<br />
stärker wächst der grenzüberschreitende Verkehr. In den inneralpinen Regionen hingegen verursachen<br />
steigende Motorisierung und die soziodemographischen Entwicklungen Rückgänge im Bahnverkehr.<br />
tabelle 2: ergebnisse Personenverkehr Verkehrsleistung szenario 1 1s<br />
Jahr<br />
Lenker* Mitfahrer<br />
Mio. Pkm/a<br />
Bahn** Regionalbus*** Gesamt<br />
2005 61 362 10 204 9 508 4 028 85 102<br />
2015 72 776 10 081 11 073 3 840 97 770<br />
2025 79 439 9 746 12 393 3 835 105 413<br />
* pkm lenker = pkw-km<br />
** bahn-verkehrsleistung ohne u-bahn und straßenbahn<br />
*** bus-verkehrsleistung enthält nur jene buslinien, die zur Öv-erschließung sämtlicher Gemeinden notwendig sind<br />
1 unter annahme, dass die jährlichen Wachstumsraten, die die vpÖ 2025+ für 2015 bis 2025 ausweist, auch für die folgejahre gelten<br />
Die in Szenario 2 prognostizierte Steigerung der Personenverkehrsleistung beträgt lediglich +10 % auf<br />
94 Mio. Personenkilometer. Hierbei nehmen die ÖV-Passagierkilometer um +28 % zu, die mit dem Pkw<br />
(lenkend und mitfahrend) zurückgelegten Personenkilometer nur um +6 % (siehe Tabelle 2 und Abbildung<br />
3). Die unterstellten steigenden Pkw-Benutzerkosten führen in Szenario 2 daher zu einer deutlichen<br />
Reduktion der Fahrtweiten, indem eine Umorientierung auf nähere Ziele stattfindet. Ebenso findet<br />
eine Verlagerung zu alternativen Verkehrsmitteln statt.<br />
tabelle 3: ergebnisse Personenverkehr Verkehrsleistung szenario 2<br />
Jahr<br />
Lenker* Mitfahrer<br />
Mio. P-km/a<br />
Bahn** Regionalbus*** Gesamt<br />
2005 61 362 10 204 9 508 4 028 85 102<br />
2015 64 957 10 529 11 375 3 930 90 790<br />
2025 65 695 10 518 13 460 3 866 95 539<br />
* pkm lenker = pkw-km<br />
** bahn-verkehrsleistung ohne u-bahn und straßenbahn<br />
*** bus-verkehrsleistung enthält nur jene buslinien, die zur Öv-erschließung sämtlicher Gemeinden notwendig sind<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 12
abbildung 3: Verkehrsleistung Personenverkehr straße<br />
abbildung 4: Verkehrsleistung Personenverkehr schiene<br />
3.5.2 Güterverkehr<br />
Die VPÖ 2025+ prognostiziert im Szenario 1 einen Anstieg der Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr<br />
um 55 %, von 36,0 Mrd. tkm im Jahr 2005 auf 56,0 Mrd. tkm im Jahr 2025 (siehe Tabelle 4 und<br />
Abbildung 5). Aufgrund der Wirtschaftskrise verschiebt sich dieses Wachstum aber bis nach 2030, bis<br />
2025 wird – gegenüber 2005 – ein Wachstum von 22 % erwartet.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 13
tabelle 4: ergebnisse güterverkehrsleistung straße<br />
Verkehrsleistung Straßengüterverkehr [Mrd. tkm/Jahr]<br />
Jahr Binnenverkehr Quellverkehr Zielverkehr Transitverkehr Summe<br />
2005 15.6 5.2 5.4 9.8 36<br />
2009 15.0 9.3 12.1 36.4<br />
SZENARIO 1<br />
2015 red 17 5 5 17 44<br />
2025 red 18 6 6 21 51<br />
Prognosewert 20.0 7.2 7.4 21.3 56.0<br />
wird erreicht 2035 2044 2040 2025 2031<br />
SZENARIO 2<br />
2015 red 16 4.8 5 15 41<br />
2025 red 18 4.9 5 17 45<br />
Prognosewert 19.3 5.8 5.9 17.0 47.9<br />
wird erreicht 2036 2117 2057 2025 2033<br />
erklärungen:<br />
2015 red, 2025 red: aufgrund der Wirtschaftskrise reduzierte Werte aus der vpÖ 2025+.<br />
prognosewert: ursprünglicher Wert der vpÖ 2025 für 2025.<br />
wird erreicht: Zeitpunkt, wann der ursprüngliche prognosewert erreicht wird.<br />
(1) einschließlich schätzungen für innerhalb der verkehrszellen erbrachte verkehrsleistungen<br />
Die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr hätte ursprünglich im Szenario 1 von 18,1 Mrd. tkm im Jahr<br />
2005 auf 27,9 Mrd. tkm ansteigen sollen (+54 %, siehe Tabelle 5). Der Einbruch von 2009 lässt nun darauf<br />
schließen, dass diese Nachfrage erst im Jahr 2033 erreicht wird und das Wachstum bis 2025 27 % beträgt.<br />
tabelle 5: ergebnisse güterverkehrsleistung schiene<br />
Verkehrsleistung Schienengüterverkehr [Mrd. tkm/Jahr]<br />
Jahr Binnenverkehr Quellverkehr Zielverkehr Transitverkehr Summe<br />
2006 4.4 4 5.3 4.4 18.1<br />
2009 4.5 3.1 4.1 4.3 15.9<br />
2015 red 5<br />
SZENARIO 1<br />
3 5 6 19<br />
2025 red 5 4 5 8 23<br />
Prognosewert 5.5 5.6 7.5 9.3 27.9<br />
wird erreicht 2027 2043<br />
SZENARIO 2<br />
2043 2032 2036<br />
2015 red 5 4 5 7 21<br />
2025 red 6 5 7 12 30<br />
Prognosewert 6.4 7.7 9.8 15.9 39.8<br />
wird erreicht 2028 2039 2039 2031 2033<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 14
Die Verkehrsleistung von Straße und Schiene zusammen wächst (ursprünglich) im Prognosezeitraum<br />
um 55 %. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 2,2 %. Das Güterverkehrswachstum liegt<br />
damit geringfügig über dem Wirtschaftswachstum, eine Entkoppelung von Wirtschafts- und Verkehrswachstum<br />
findet nicht statt.<br />
abbildung 5: Verkehrsleistung güterverkehr straße<br />
abbildung 6: Verkehrsleistung güterverkehr schiene<br />
In Szenario 1 findet keine wesentliche Änderung des Modal Split statt. Der Anteil der Straße beträgt<br />
im gesamten Prognosezeitraum rund 63 %, jener der Schiene 31 %, jener des Schiffsverkehrs 6 %, der<br />
Modal Split Straße – Schiene betrug 67 %:33 %.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 15
Das Ergebnis, dass die Schiene die Marktanteile halten kann, steht durchaus im Einklang mit den Entwicklungen<br />
der letzten Jahre in Österreich, wenn auch auf europäischer Ebene eher mit einer weiteren<br />
Zunahme des Straßenanteils gerechnet wird. So wird im Szenario auch eine relative Verbilligung der<br />
Schiene gegenüber der Straße angenommen: real konstante Preise im Straßengüterverkehr und auf<br />
den Hauptachsen sinkende Preise im Schienengüterverkehr. Maßnahmen, die eine weitere Verbilligung<br />
der Straße mit sich brächten, wie etwa die Zulassung von Gigalinern, sind in den Annahmen nicht<br />
unterstellt.<br />
Wie zuvor dargelegt, entwickelt sich das Transportaufkommen (Tonnen) im Güterverkehr anders als<br />
die Transportleistung (Tonnenkilometer). Im Transportaufkommen weist die Straße ein geringeres<br />
Wachstum auf als die Schiene. Dazu ist anzumerken, dass im Straßentransportaufkommen der Anteil<br />
der Gütergruppe „Mineralien und Baustoffe“ sehr hoch (31 % des Binnenverkehrs) ist. Diese Transporte<br />
weisen aber sehr kurze Transportweiten auf (z. B. Baustellenverkehre, Schotter- und Aushubtransporte)<br />
und sind daher bei den Transportleistungen weniger bedeutend. Da diese Güter aber ein unterdurchschnittliches<br />
Wachstum aufweisen, führt das dazu, dass die Tonnagen auf der Straße deutlich langsamer<br />
wachsen als jene auf der Schiene.<br />
Im Szenario 2 würde die Straßengüterverkehrsleistung auf 47,9 Mrd. tkm im ursprünglichen Prognosejahr<br />
2025 ansteigen (+33 % bezogen auf 2005, -14 % im Vergleich zu Szenario 1). Die Fahrleistung<br />
würde 5,6 Mrd. Kfz-Kilometer betragen, was einer Steigerung von 29 % bezogen auf 2005 entspricht.<br />
Die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr würde im Szenario 2 auf 39,8 Mrd. tkm ansteigen. Im<br />
Vergleich zu Szenario 1 entspricht dies einer Steigerung um 43 %. Der Modal Split Straße – Schiene<br />
würde sich damit von 33 % Schienenanteil auf 45 % verschieben.<br />
3.5.3 Umweltauswirkungen<br />
Für die Beurteilung der prognostizierten Verkehrszunahmen ist die Frage nach den Umweltauswirkungen<br />
von großer Bedeutung. Den Verkehrszunahmen stehen auf der anderen Seite deutliche technische<br />
Verbesserungen bei den Fahrzeugen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gegenüber.<br />
Bei den Stickoxiden ist durch die verbesserte Fahrzeugtechnologie mit einer deutlichen Reduktion<br />
der Emissionen zu rechnen. Der Zielwert für 2010 kann zwar nicht 2010, aber in etwa <strong>2012</strong> erreicht<br />
werden.<br />
Bei den CO 2 -Emissionen bewirkt der technische Fortschritt in Szenario 1, dass trotz steigender Verkehrsleistungen<br />
eine Stagnation der Emissionen eintritt. Ein Rückgang ist hier nicht zu verzeichnen,<br />
wohl aber in Szenario 2.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 16
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur<br />
ausbaupläne<br />
asfinag und öBB
ausBauPLäne asfinag<br />
einsparungen beim neubau.<br />
investitionen in Bestand und sicherheit.
millionen euro<br />
1) Überblick Bauprogrammsentwurf<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Bauprogramm <strong>2012</strong>-<strong>2017</strong> - Dimensionen<br />
<strong>2012</strong> 2013 2014<br />
Neubau und Erweiterungen<br />
Bauliche Erhaltung<br />
2) methodische entwicklung<br />
des Zielnetzes<br />
2.1 Bereich Neubau<br />
2015 2016 <strong>2017</strong><br />
Das Bundesstraßengesetz 1971 (BStG 1971) nennt in den Verzeichnissen 1 (Bundesstraßen A – Bundesautobahnen)<br />
und 2 (Bundesstraßen S – Bundesschnellstraßen) taxativ sämtliche Bundesstraßen<br />
in Österreich. Die Verzeichnisse umfassen dabei sowohl bereits in Betrieb als auch in Vorbereitung<br />
(Planung und Bau) befindliche Strecken und Streckenabschnitte.<br />
Der Bund (die Bundesstraßenverwaltung) hat die Aufgabe, die in den Verzeichnissen 1 und 2 des BStG<br />
genannten und noch nicht unter Verkehr stehenden Bundesstraßen zu errichten. Diesbezüglich nennt<br />
das BStG jedoch keine konkreten Ausbauzeitpunkte. Dies eröffnet die Möglichkeit, gleichzeitig aber<br />
auch die Verpflichtung, diese Neubauvorhaben mit enormen Investitionsvolumina in ihrer Umsetzung<br />
zeitlich sinnvoll zu reihen.<br />
Ein sinnvoller und naheliegender Schwerpunkt für eine zeitliche Staffelung war dabei zunächst der<br />
Bereich der kostenintensiven Neubauprojekte.<br />
Effizientes Verhalten führte in diesem Zusammenhang zur Erzielung eines angestrebten Ergebnisses<br />
(orientiert an einem bedarfsgerechten Ausbau) und hielt dabei gleichzeitig die dafür notwendigen Kosten<br />
möglichst gering. Potential für eine weitere Optimierung im Sinne einer Erhöhung der Effizienz boten dabei<br />
beide Komponenten: Sowohl die Konkretisierung des angestrebten Ergebnisses als auch eine Reduktion des<br />
dafür notwendigen Aufwands mussten Beiträge leisten.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 21
Unter Beachtung knapper Budgets und der laufenden Bestrebungen zur Steigerung der Effizienz<br />
kommt der methodischen Entwicklung des Zielnetzes für Bundesstraßen große Bedeutung zu.<br />
Zur Entwicklung und sinnvollen zeitlichen Staffelung des Zielnetzes ist eine Prioritätenreihung<br />
anstehender Großprojekte unumgänglich. Die Prioritätenreihung hat dabei die oben<br />
genannten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und erfolgt nach offengelegten Kriterien.<br />
In Anlehnung an die Bestimmungen und Inhalte des BStG, des Bundesgesetzes über die<br />
strategische Prüfung im Verkehrsbereich (SP-V-Gesetz) sowie den einschlägigen Leitfaden<br />
zur SP-V orientiert sich eine Prioritätenreihung von Vorhaben im Bundesstraßennetz an<br />
folgenden Parametern:<br />
• Funktionelle Bedeutung der Strecke (z. B. Verbindung Bundeshauptstädte/Landeshauptstädte<br />
einschließlich gleichwertiger Zentren)<br />
• Erfordernisse des Verkehrs/Beitrag zur Verkehrssicherheit<br />
• Wirtschaftlichkeit<br />
• Bedeutung für den Durchzugsverkehr<br />
(d. h. keine reine funktion der „lokalen aufschließung“)<br />
• Realisierung eines Netzschlusses im (bestehenden) hochrangigen Bundesverkehrswegenetz<br />
(einschließlich gleichwertiger netzschluss im ausland)<br />
• Ausreichend hohe Verkehrsnachfrage für eine hochrangige Verkehrsverbindung<br />
Zur einheitlichen Beurteilung der in den Verzeichnissen 1 und 2 des BStG genannten und<br />
noch nicht dem Verkehr freigegebenen Neubauvorhaben wurde ein nutzwertanalytischer<br />
Ansatz gewählt:<br />
Zunächst wurden Kriterien für die Beurteilung ausgewählt. Anschließend wurde jedes Projekt<br />
im Hinblick auf diese Kriterien beurteilt (nach umgekehrten Schulnoten: 5 = hohe Zielerfüllung,<br />
1 = niedrige Zielerfüllung). Nach einer Gewichtung der Kriterien – nicht alle sind gleich<br />
bedeutend – erfolgte dann eine Addition der Noten. Ergebnis war ein „Nutzwert“ für jedes<br />
einzelne Neubauprojekt. Die qualitative (z. T. quantitative) Beurteilung der einzelnen Vorhaben<br />
erfolgte unter besonderer Beachtung von Relativvergleichen der Projekte zueinander.<br />
Dieser Nutzwert stellte eine Entscheidungshilfe, eine Grundlage für etwaige weitere Schritte<br />
wie die Prioritätenreihung der Projekte dar. Eine weitere wesentliche Rahmenbedingung im<br />
Hinblick auf eine sinnvolle zeitliche Staffelung sind beispielsweise bestehende Restriktionen<br />
in den Budgets.<br />
2.2 Bereich Bestandsnetz<br />
2.2.1 Zustandserfassung am Bestandsnetz<br />
Am ASFINAG-Netz finden regelmäßig alle fünf Jahre Zustandserfassungen der Fahrbahn statt.<br />
Dabei werden beispielsweise folgende Merkmale untersucht: Griffigkeit, Risse und Oberflächenschäden.<br />
Diese Zustandsmerkmale werden dann in Zustandsklassen (1–5) eingeteilt. Mittels<br />
einer Auswertesoftware wird eine objektive Darstellung des Ist-Zustandes durchgeführt.<br />
Unter Berücksichtigung der Faktoren/Erhaltungsziele:<br />
• Verkehrssicherheit,<br />
• Fahrkomfort und<br />
• Erhaltung der Substanz<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 22
erfolgt dann eine wirtschaftliche Beurteilung von möglichen Erhaltungsstrategien. Diese Vorgangsweise<br />
ermöglicht eine Abschätzung der Entwicklung des Erhaltungsbedarfes im Zusammenhang mit der<br />
Entwicklung des Straßenzustandes.<br />
Weiters erfolgt dadurch eine optimierte Dringlichkeitsreihung von Erhaltungsmaßnahmen. Bei den<br />
Kunstbauten (Brücken, Tunnel, Wannen, Mauern, Ankerwänden, Lärmschutzwänden) erfolgt die Ermittlung<br />
des Bedarfs an Erhaltungsmaßnahmen durch regelmäßig durchgeführte Prüfungen und Kontrollen.<br />
Die dabei ermittelten Instandsetzungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit den notwendigen<br />
Straßeninstandsetzungsprojekten geplant und im Bauprogramm abgebildet.<br />
2.3 entwicklung von rastplätzen<br />
Die Grundlage jeder Rastplatzplanung bildet das ASFINAG-Rastplatzkonzept. Das Ziel dieses Konzeptes<br />
ist es, eine ausreichende Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen und für den Benutzer zweckmäßig<br />
ausgestatteten Rastplätzen sicherzustellen. Neben den qualitativen werden auch quantitative Ziele mit<br />
diesem Rastplatzkonzept in einer Leitplanung und einer Netzplanung verfolgt.<br />
Neben den bestens ausgelasteten rund 90 Raststationen gehören zu einer intakten Infrastruktur an den<br />
Autobahnen und Schnellstraßen ansprechende Rastplätze. Dabei ergibt sich eine Abfolge von Rastplätzen<br />
und Raststationen in einem Intervall von rund 20 bis 25 km. Aus diesem Konzept resultierend sind<br />
in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Rastplatzprojekte umgesetzt worden, oder befinden sich<br />
gerade in Planung. 23 dieser Rastplätze im Corporate Design sind bereits in Betrieb, 80 weitere sollen<br />
in den kommenden Jahren folgen.<br />
3) Bauprogramm <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong><br />
3.1 Bereich Neubau<br />
Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Evaluierung wurde in Abstimmung mit den Bundesländern<br />
weiter konkretisiert.<br />
30 neubauprojekte wurden evaluiert.<br />
9 tunnelprojekte:<br />
Analog zur 2010 durchgeführten Evaluierung der Neubauprojekte wurden 2011 die 12 (gem. STSG<br />
notwendigen) Projekte zum Tunnelvollausbau evaluiert. Die Ergebnisse bestätigten die Priorisierung<br />
der Tunnel-Projekte.<br />
3 prioritäre straßenbauprojekte:<br />
• A5 Schrick–Poysbrunn<br />
• S7 Riegersdorf–Dobersdorf<br />
• S1 Schwechat–Süßenbrunn (Lobauquerung)<br />
2 straßenbauprojekte werden nicht hochrangig realisiert:<br />
• A23 Spange Flugfeld Aspern innerer Teil (Hirschstetten–Heidjöchl), der äußerer Teil (Heidjöchl–Raasdorf)<br />
wird als hochrangige Verkehrsanbindung zur Entlastung des Großraumes Wien hochrangig realisiert<br />
• S31 Süd<br />
• A 26 Nord<br />
• A 24 Verbindungsspange Rothneusiedl<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 23
4 straßenbauprojekte werden redimensioniert und bedarfsgerecht nach aktuellen<br />
Verkehrszahlen realisiert:<br />
• A5 Poysbrunn–Staatsgrenze<br />
• S3 Hollabrunn–Guntersdorf<br />
• S34 Traisentalschnellstraße<br />
• S37 Klagenfurter Schnellstraße<br />
3 straßenbauprojekte werden in gemeinsamer abstimmung mit dem jeweiligen Bundesland einer<br />
weiteren Bedarfsprüfung unterzogen, um den bestmöglichen nutzen für das hochrangige straßennetz,<br />
den umweltschutz und die anrainende Bevölkerung zu gewähren:<br />
• s1 schwechat–süßenbrunn (Lobauquerung)<br />
Errichtung in zwei Verwirklichungsabschnitten:<br />
Groß Enzersdorf - Süßenbrunn 2014-2016,<br />
Schwechat - Großenzersdorf (Lobauquerung) 2018-2025<br />
• s36 murtal schnellstraße<br />
Gemeinsam mit dem Land Steiermark wurde eine vertiefte Bedarfsprüfung durchgeführt. Die Maßnahmen<br />
(Unterflurtrassen) zur Entlastung der Bevölkerung in St. Georgen und Unzmarkt werden<br />
kurzfristig umgesetzt. Eine Attraktivierung der Route für den Durchzugsverkehr wird vermieden<br />
(der Korridor ist durch die bestehende A 2 gegeben).<br />
• a26 Westring Linz<br />
Mit dem Land OÖ und der Stadt Linz wurde eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Der Nordteil der A<br />
26 wird nicht hochrangig umgesetzt. Für den Südteil wurde eine Kostenbeteiligung vereinbart.<br />
3.2 Bereich Bestandsnetz<br />
3.2.1 a 8 sicherheitsausbau meggenhofen – Haag<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Der Abschnitt Meggenhofen – Haag wird durch einen vollwertigen Pannenstreifen verbreitert und mit<br />
einem lärmmindernden und griffigeren Belag versehen.<br />
nutzen:<br />
• Verkehrssicherheit wird erhöht<br />
• Reduktion der Behinderung durch Minimierung zukünftiger Instandsetzungsarbeiten<br />
• verbesserte Umweltschutzmaßnahmen für Fahrbahnwässer<br />
• Errichtung von Lärmschutz<br />
• Gesamtkosten 38 Mio. Euro<br />
• A 8, km 30,4 bis km 42,4<br />
• April <strong>2012</strong> bis Mitte 2015<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 24
3.2.2 a 10 einhausung Zederhaus<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Durch die Errichtung von Katschbergtunnel und Tauerntunnel wurden 2008 bzw. 2011 die letzten Flaschenhälse<br />
auf der A 10 beseitigt. Aufgrund der steigenden Verkehrszahlen wurden mit den Gemeinden<br />
entlang der A 10 Umweltentlastungsmaßnahmen vereinbart. Eine zentrale Maßnahme ist dabei die<br />
Einhausung Zederhaus.<br />
nutzen:<br />
• Einhaltung der Lärmschutzziele<br />
• Optimale Landschaftseinbindung<br />
• Künftig verringerte Erhaltungskosten<br />
• Gesamtkosten 67,3 Mio. Euro<br />
• A 10, km 92,2 bis km 95,5<br />
• September 2013 bis <strong>2017</strong><br />
3.2.3 A 4 / A 23 Generalerneuerung Knoten Prater<br />
Kurzbeschreibung:<br />
Der Knoten Prater ist einer der höchstbelasteten Abschnitte. Die Erdberger Brücke ist am Ende ihrer<br />
Lebensdauer. Zur Aufrechterhaltung des Verkehrs in der Bauphase werden zusätzliche Entflechtungsbauwerke<br />
errichtet, die auch nach der Brückensanierung erhalten bleiben und die Kapazität im Knoten<br />
nachhaltig erhöhen.<br />
nutzen:<br />
• Erneuerung und langfristige Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit der Brückentragwerke<br />
• Verbesserung der verkehrlichen Situation in den Verflechtungsbereichen<br />
durch die Errichtung von Entflechtungsbauwerken<br />
• Erhöhung der Verkehrssicherheit<br />
• Verbesserung der Verkehrsqualität<br />
• Gesamtkosten 80,7 Mio. Euro<br />
• A 23, km 10,1 bis 11,0<br />
• A 04, km 0,0 bis 0,7<br />
• März 2013 bis November <strong>2017</strong><br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 25
3.2.4 rastplätze<br />
Ziele des asfinag rastplatzkonzeptes:<br />
• Erweiterung des Rastangebotes, angepasst an die laufende Verkehrsentwicklung<br />
• Errichtung zusätzlicher LKW-Stellflächen<br />
• Schaffung von Stellflächen für Sondertransporte<br />
• Sicherheitsbedürfnissen der Kunden mit einem Videoüberwachungssystem Rechnung tragen<br />
• Sicherstellung eines hohen Standards in den Sanitäranlagen<br />
• Gewährleistung eines einheitlichen Erscheinungsbildes<br />
Beispiel: A2, Rastplatz Bad Blumau & Hainersdorf/km 134,0<br />
Projektbeschreibung:<br />
Am östlichen Standort sind 38 LKW- und 32 PKW-Stellplätze vorgesehen, am westlichen Standort sind<br />
36 LKW- und 32 PKW-Plätze geplant.<br />
Kosten/Termin:<br />
Die Gesamtkosten betragen 6,7 Mio. EUR. Die Umsetzung ist für <strong>2012</strong> vorgesehen.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 26
ausBauPLan öBB<br />
mehr Power für die Bahn:<br />
30 % mehr Kapazität bis 2025.
1) Zielnetz 2025+<br />
1.1 Die Grundlagen und die Realisierung der verkehrspolitischen Ziele<br />
Gemäß § 42 Bundesbahngesetz wurde vom Unternehmen ÖBB-Infrastruktur AG ein mit den Eigentümervertretern<br />
abgestimmtes Eisenbahnzielnetz entwickelt. Dieses Eisenbahnzielnetz wird die zukünftige,<br />
prognostizierte Nachfrage nach Schienenverkehr im Güter- und Personenverkehr bewältigen können.<br />
Die verkehrspolitischen Hauptziele sind:<br />
1) Schaffung der Voraussetzungen für die schrittweise Einführung eines Knoten/Kantenzeitmodells im<br />
Personenverkehr mit stabilen und pünktlichen Fahrzeiten<br />
2) Unterstützung der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene durch Infrastrukturmaßnahmen<br />
3) Aufbau von Kapazitäten, um eine Reduktion von verkehrsbedingten CO 2 Emissionen<br />
(Kyoto-Protokoll) durch Verkehrsverlagerung zu erreichen<br />
Weitere Ziele:<br />
1) Modernisierung und Erneuerung von Bahnhöfen und Haltestellen (Barrierefreiheit, Sicherheit etc.)<br />
2) Fokus auf Bahnlinien mit ausreichendem Potential im Güter- und/oder Personenverkehr<br />
3) Optimierung und damit Kostenreduktion von Eisenbahnanlagen und -betrieb<br />
Um die genannten Ziele realisieren zu können, bedarf es sowohl für den Eigentümervertreter als<br />
auch das Unternehmen ÖBB-Infrastruktur AG verbindlicher Planungsgrundlagen, damit z. B. auch im<br />
entsprechenden Bahninfrastrukturfinanzierungsmodell nachhaltig stabil sämtliche erforderlichen<br />
Vorhaben abgearbeitet werden können.<br />
1.2 Verkehrsprognose<br />
Die zukünftigen Verkehrsmengen, die das Zielnetz aufnehmen wird müssen, wurden aus einer vom<br />
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, der ASFINAG, der SCHIG mbH und der<br />
ÖBB-Infrastruktur AG beauftragten Verkehrsprognose Österreich (VPÖ) entnommen und bildeten die<br />
Basis für die erforderlichen Kapazitätsberechnungen.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 29
1.3 Das Zielnetz unterstützt die Ziele von Eigentümer und ÖBB<br />
stärkung der marktposition<br />
der schiene<br />
flächenpräsenz<br />
steigerung der<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Weiterentwicklung<br />
der sicherheit<br />
1.4 Systemadäquanz<br />
Das Zielnetz verbessert dort das anlagenangebot, wo hohes<br />
Potential für weitere Verkehrsverlagerungen gegeben ist.<br />
• Fortführung der Investitionen für Marktsegmente mit<br />
systemadäquater Nachfrage<br />
Das Zielnetz reduziert dort das anlagenangebot, wo geringes<br />
Potential gegeben ist.<br />
• keine Investitionen in Infrastruktur mit nicht system-adäquater<br />
Nachfrage<br />
Das Zielnetz erhöht den Deckungsgrad der infrastruktur<br />
• Rationalisierungsinvestitionen und Anlagenoptimierung<br />
Das Zielnetz stellt sicher, dass die anlagen dem stand der<br />
technik entsprechen<br />
• Bestandserneuerung auf Infrastruktur mit systemadäquater<br />
Nachfrage sowie Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben<br />
Jeder Verkehrsträger hat seine systembedingten Vor- und Nachteile bei Transport von Menschen und<br />
Gütern. Schienenverkehr ist Massenverkehr und hat dort große Vorteile, wo viele Menschen und Güter<br />
zu befördern sind. Daher gilt es im Bahnverkehr, diese Stärken weiter auszubauen.<br />
Systemadäquates Zielnetz Nicht systemadäquate Nachfrage<br />
Das System Schiene weist bestimmte Systemmerkmale<br />
auf – z. B. Geschwindigkeit,<br />
Kapazität der Infrastruktur, Kapazität der<br />
Gefäße, Netzbildungsfähigkeit.<br />
Das System Schiene ist dann systemadäquat<br />
eingesetzt, wenn seine Systemmerkmale ihre<br />
Nutzenwirkung optimal entfalten können.<br />
Die Schieneninfrastruktur ist daher so zu planen,<br />
dass ihre Systemmerkmale bestmöglich<br />
zum Einsatz kommen.<br />
Personennah- und -regionalverkehr außerhalb<br />
von Ballungsräumen<br />
• Strecken: Potenzial < 2.000 Reisende pro<br />
Tag in einer 60 Minuten Isochrone<br />
güterverkehr auf Zubringerstrecken<br />
• Strecken: Transportpotential der Zubringerstrecke<br />
< 4.000–5.000 Wagen bzw.<br />
250.000 GBt pro Jahr<br />
Das Zielnetz ist ein strategisch konsistentes und optimiertes gesamtkonzept.<br />
1.5 Kapazitätssteigerung und Knoten/Kantenzeiten<br />
Das Bahnzielnetz soll einerseits entsprechende Kapazitäts- und Qualitätserfordernisse erfüllen und<br />
zukünftige Steigerungen aufnehmen, andererseits hat es einen bestimmten Personenzugsfahrplan mit<br />
Blick auf Pünktlichkeiten und Erreichbarkeiten zu erfüllen. Dazu zählen auch sogenannte Kantenfahrzeiten<br />
zwischen den größeren Städten, die das Grundgerüst des öffentlichen Verkehrs mit aufeinander<br />
abgestimmten Fahrzeiten darstellen.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 30
auf Basis der VPö würden sich am heutigen, bestehenden Bahnnetz die Kapazität und die fahrzeiten<br />
im Jahr 2030 wie folgt darstellen:<br />
Knoten-Kantenmodell mit<br />
infrastruktur Bestand 2009<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 31
auf Basis der VPö würden sich durch die realisierung des Zielnetzes 2025+ die Kapazität und die<br />
fahrzeit im Jahr 2030 wie folgt darstellen:<br />
Knoten–Kantenmodell mit<br />
infrastruktur Zielnetz 2025+<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 32
2) evaluierung rahmenplan 2011–2016<br />
2.1 Basis der Evaluierung<br />
Die Projekte des bisher gültigen Rahmenplans 2011–2016 als Teil des Zielnetzes 2025+ waren aufgrund<br />
verminderter Finanzmittel des Bundes neu zu priorisieren.<br />
Wirkungsanalyse Bedingungen<br />
Wirkungsbeurteilung bezüglich unternehmerischer<br />
Ziele:<br />
• Strecken: Beurteilung der Projekte in Bezug<br />
auf jenes Ziel/jene Ziele, zu dessen/deren<br />
vorrangiger Bedienung die Projekte ausgewählt<br />
wurden<br />
• Wirtschaftlichkeitsbeurteilung pro Achse<br />
• Vergleich der Projekte bzw. Achsen jeweils<br />
im Hinblick auf ein spezifisches Ziel<br />
Wirkungsbeurteilung bezüglich volkswirtschaftlicher<br />
Ziele:<br />
• Darstellung von Beschäftigungseffekten<br />
und steuerlichen Rückflüssen gem. WIFO/<br />
Joanneum Research/IHS<br />
• Abschätzung der Umweltwirkungen<br />
netzwirksame etappen auf dem Weg<br />
zum Zielnetz<br />
• Entwicklung von Teilsystemen zur Realisierung<br />
von (Teil-)Netzwirkungen und etappenweisen<br />
Umsetzung aufgrund verkehrlicher<br />
und anlagenspezifischer Bedingungen<br />
Disponibilität der Projekte<br />
Berücksichtigung der Disponibilität der<br />
Projekte in Bezug auf<br />
• Projektstatus – in Bau/in Planung<br />
• vertragliche Bindung<br />
• Mittelbindung<br />
Priorisierungsvorschlag<br />
• Zuordnung der Projekte zu netzwirksamen etappen unter Berücksichtigung ihrer<br />
Wirkungen sowie Disponibilität<br />
• Begründung der Projektzuordnung auf grundlage der Wirkungsanalyse<br />
• ableitung von erfordernissen weiterer Präzisierungen von Zielen und maßnahmen<br />
2.2 Evaluierungskriterien<br />
Das Zielnetz 2025+ und alle darin enthaltenen einzelvorhaben wurden<br />
mittels evaluierungskriterien im Hinblick auf ausgewählte Ziele beurteilt:<br />
a) Kapazitätssteigerung<br />
b) Erhöhung der Reisegeschwindigkeit<br />
c) Barrierefreiheit und/oder Modernisierung von Bahnhöfen und Haltestellen<br />
d) Steigerung des Güterumschlags<br />
e) Sicherheit<br />
f) Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
g) Beitrag zum Klima-/Umweltschutz<br />
2.3 Evaluierungsergebnis<br />
Das Evaluierungsergebnis der ÖBB-Infrastrukturprojekte hat einen wesentlichen Konsolidierungsbeitrag<br />
zum bmvit-Budget geleistet.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 33
evaluierung Zielnetz:<br />
Im Herbst 2010 fand auf Grund der gemeinsam in der Bundesregierung beschlossenen Budgetkonsolidierung<br />
für das BFRG <strong>2012</strong> - 2015 eine Evaluierung sämtlicher Rahmenplanprojekte auf Basis des Rahmenplans<br />
2009-2014 statt und ergab ein Einsparungsvolumen von rund 1.500 Mio eur, welches im Rahmenplan<br />
2011-2016, der vom Ministerrat am 1.2.2011 zur Kenntnis genommen wurde, umgesetzt wurde.<br />
Nunmehr war es im Rahmen des Stabilitätspaketes bis 2016 für das bmvit notwendig, nochmals über<br />
200 Bahninfrastrukturprojekte auf Basis des bestehenden Rahmenplanes 2011 – 2016 zu evaluieren.<br />
Damit soll ein Teil des Budgetkonsolidierungsbeitrages des bmvit für das BFRG 2013-2016 aus dem<br />
Bereich Bahninfrastruktur geleistet werden.<br />
Dabei wurden folgende evaluierungskriterien angelegt:<br />
• Kapazitätssteigerung<br />
• Erhöhung der Reisegeschwindigkeit<br />
• Barrierefreiheit und/oder Modernisierung von Bahnhöfen und Haltestellen<br />
• Steigerung des Güterumschlags<br />
• Sicherheit<br />
• Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
• Beitrag zum Klima-/Umweltschutz<br />
Das mit dem Rahmenplan 2011 - 2016 festgelegte Investitionsprogramm wurde unter Beachtung der<br />
oben bereits angeführten Zielsetzungen und Kriterien einer neuerlichen Evaluierung auf Grund der<br />
Budgetkonsolidierung unterzogen und ergab einen budgetwirksamen Konsolidierungsbeitrag von 920<br />
Mio. eur (investitionswirksam eur1.063 Mio.) für den Zeitraum bis 2016. Rund ein Drittel dieser Mittel<br />
wirken als nachhaltige Einsparungen, zwei Drittel werden durch zeitliche Verschiebungen aus dem<br />
Betrachtungszeitraumes erreicht.<br />
Zusammenfassung der evaluierung:<br />
• Das Zielnetz stellt ein integriertes Gesamtkonzept zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsposition<br />
der Schiene sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr dar.<br />
• Die Projekte des Zielnetzes wurden daher so ausgewählt, dass sie höchstmögliche Zielerfüllung in<br />
Bezug auf die Zielsetzungen der Infrastruktur aufweisen – die Wirkungsanalyse fasst die im Zielnetz<br />
durchgeführten Projektbeurteilungen zusammen.<br />
• Für jene sehr wenigen Projekte, die eine niedrigere Zielerfüllung aufweisen, wird eine Präzisierung der<br />
jeweiligen Projektziele und -inhalte in die Wege geleitet.<br />
• Gleichzeitig verzeichnen die ausgewählten Projekte unterschiedliche Dringlichkeiten, die eine etappenweise<br />
Umsetzung nahelegen.<br />
• Das aus dem Konjunktureinbruch 2009/10 erwartete spätere Eintreffen der Güterverkehrsprognose<br />
wurde bei der Etappengestaltung berücksichtigt (Institut für Höhere Studien: Ökonomische Begleitszenarien<br />
der Verkehrsprognose Österreich 2025+. Wien, 2009).<br />
Prämissen bei der Definition der etappen:<br />
• Zusammenfassung von Maßnahmen zu netzwirksamen Etappen mit der konkreten Zielsetzung<br />
Nutzen zu stiften, der über die Summe der Einzelnutzen der jeweiligen Maßnahmen hinausgeht.<br />
• Maßnahmen mit dem Ziel der Verkürzung von Fahrzeiten werden derart zusammengefasst, dass<br />
die Zwischenschritte wieder in einem integrierten Taktmodell abgebildet werden können.<br />
• Zeitliche Reihung von Maßnahmen entsprechend der Dringlichkeit.<br />
• Modulare, schrittweise Steigerung der Kapazität auf den internationalen Achsen (Westbahn-,<br />
Südbahn- und Brennerachse) gemäß verkehrlicher Entwicklung.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 34
2.4 Definition und Reihung der Achsen<br />
auf Basis einer Wirkungsanalyse wurden Definitionen und reihungen<br />
der wesentlichen Bahnachsen definiert, die sich wie folgt darstellen:<br />
1 disponibilität in bezug auf den umsetzungsgrad laufender projekte bzw. erforderliche realisierungszeiträume von geplanten projekten<br />
2 optimaler umsetzungszeitpunkt der jeweiligen etappe<br />
2.5 Priorisierungsvorschlag: 10 netzwirksame Etappen auf dem Weg zum Zielnetz<br />
Die in Punkt 2.4. definierten Ausbauetappen wurden in einem konkreten Umsetzungsplan mit<br />
10 netzwirksamen Etappen zur optimalen Erreichung des Zielnetzes 2025+ aufgrund der geänderten<br />
Rahmenbedingungen wie Rückgang der Verkehrsmengen und geringere Finanzmittel festgelegt. Die<br />
Umsetzung erfolgt nach Maßgabe der finanziellen Bedeckung.<br />
1) in jeder etappe werden durch die realisierung der Maßnahmen netzwirkungen erzeugt, die über die summe der einzelwirkungen der<br />
Maßnahmen hinausgehen. die Jahreszahl jeder etappe bezeichnet den spätesten Zeitpunkt, zu dem sämtliche Maßnahmen verkehrswirksam<br />
sein sollten; frühere fertigstellung steht dem etappenziel nicht entgegen, wobei nutzen von einzelmaßnahmen aufgrund der<br />
noch fehlenden netzwirksamkeit jedoch eingeschränkt sind .<br />
2) internationale vereinbarungen für den grenzüberschreitenden ausbau erforderlich<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 35
3) rahmenplan <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong><br />
Als Ergebnis der Evaluierung und des daraus resultierten Priorisierungsvorschlages zur Umsetzung<br />
von netzwirksamen Etappen sind die Einzelprojekte des Rahmenplanes entsprechend angepasst worden<br />
und finden sich nunmehr wie folgt im neuen Rahmenplan <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong>. In Summe wird rund<br />
1 Milliarde Euro weniger als bisher vorgesehen in der 6-jährigen Rahmenplanperiode investiert.<br />
anpassung der investitionsquoten für einzelne Projekte aufgrund aktualisierter Kosten- und Bauzeitpläne<br />
bzw. aufgrund erforderlicher Projektanpassungen:<br />
Brennerbasistunnel<br />
• Neuer Projektablauf mit Konsolidierung<br />
• Ziel der Inbetriebnahme 2026 (wie bisher)<br />
• Einsparung EUR 485 Mio.:<br />
361 mio.: Verschiebung von kostenintensiven Bauphasen durch optimierte Projektabwicklung auf<br />
Basis neuer Erkundungserkenntnisse<br />
124 mio.: Entfall des Erkundungsstollen um 1/3 (15 von 45km), Entfall der Innenschale beim verbleibenden<br />
Erkundungsstollen, Entfall von 2 Weichenverbindungen zwischen den Haupttunneln,<br />
Entfall eines Überholgleises, örtliche Verschiebung eines unterirdischen Bahnhofes<br />
Zusammenziehen der fertigstellung der wichtigen südbahnprojekte im sinne der achsenwirkung<br />
von semmeringbasistunnel neu und Koralmbahn von zwei Jahren auf ein Jahr :<br />
• Koralmbahn Inbetriebnahme von 2022 auf 2023, Einsparung eur 274 Mio.<br />
• Semmeringbasistunnel Inbetriebnahme 2024 (wie bisher), Einsparung eur 44 Mio.<br />
evaluierung güterverkehrsstrecke gänserndorf-marchegg-staatsgrenze, einsparung eur 58 mio.<br />
evaluierung götzendorfer spange, einsparung eur 53 mio.<br />
optimierte Projektumsetzung Linz-Wels, einsparung eur 64 mio.<br />
optimierung Betriebsfernsteuerung, einsparung eur 23 mio.<br />
redimensionierung güterterminal inzersdorf, einsparung eur 27 mio.<br />
redimensionierung Zugabstellanlage Bahnhof amstetten, einsparung eur 17 mio.<br />
neuaufnahme folgender Projekte in den rahmenplan aufgrund der Zielnetzevaluierung:<br />
• Ausbau des Marchegger Astes (Wien-Bratislava „Nord“), Wiener Abschnitt, EUR 116 Mio.<br />
• Sicherheitsinvestitionen sowie Planungsprojekte, EUR 61 Mio.<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 36
millionen euro<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
rahmenplan <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong><br />
<strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 <strong>2017</strong><br />
Investitionen Bestandsnetz<br />
Neubauinvestitionen<br />
Presseinformation<br />
ausbauplan bundesverkehrsinfrastruktur: klug investieren, verantwortungsvoll sparen 37
Infrastrukturprojekte <strong>2012</strong>–<strong>2017</strong> *<br />
Jihlava<br />
Brünn<br />
Ceske Budejovice<br />
Prag<br />
*Auszugsweise Darstellung,<br />
Detaildarstellung auf Bundesländerebene<br />
Gmünd<br />
9<br />
A5<br />
8<br />
S3<br />
S10<br />
10<br />
6<br />
Passau<br />
Autobahnen<br />
in Betrieb<br />
Autobahn Neu<br />
Autobahnprojekte nach <strong>2017</strong><br />
A22<br />
Krems<br />
S5<br />
A7<br />
Linz<br />
13<br />
S8<br />
Bratislava<br />
26 27<br />
15 12<br />
11<br />
St. Pölten<br />
A8<br />
Bahnstrecken<br />
Bahnstrecke Bestand<br />
Bahnstrecke Neu<br />
A23<br />
S1<br />
17<br />
18<br />
19<br />
S33<br />
8<br />
13<br />
7<br />
Wien<br />
A1<br />
7<br />
14<br />
S34<br />
A4<br />
20<br />
A21<br />
Wels<br />
A1<br />
21<br />
A3<br />
A9<br />
Salzburg<br />
München<br />
A2<br />
Eisenstadt<br />
Sopron<br />
S4<br />
Wr. Neustadt<br />
5<br />
5<br />
München<br />
6<br />
Györ<br />
Budapest<br />
15<br />
S31<br />
16<br />
1<br />
S6<br />
9<br />
4<br />
Wörgl<br />
2<br />
Bregenz<br />
24<br />
1<br />
Zürich<br />
Bruck/Mur<br />
23<br />
21<br />
4<br />
A14<br />
S35<br />
A10<br />
Innsbruck<br />
25<br />
A12<br />
12<br />
A13<br />
S16<br />
S36<br />
3<br />
2<br />
Szombathely<br />
Budapest<br />
14<br />
S7<br />
Graz<br />
A2<br />
A9<br />
10 11<br />
Lienz<br />
Bozen<br />
Rom<br />
Klagenfurt<br />
Villach<br />
Maribor<br />
A11<br />
3<br />
Rom<br />
Ljubljana<br />
10 A 5 Schrick – Poysbrunn<br />
11 S 1 Wiener Außenringschnellstraße,<br />
Schwechat – Süßenbrunn<br />
12 S 8 Knoten Dt. Wagram – Gänserndorf<br />
13 S 8 Gänserndorf – Staatsgr. Marchegg<br />
14 S 7 Riegersdorf – Staatsgrenze<br />
15 A 23 Landstraße Eurogate<br />
Sanierung Bestandsröhre<br />
5 A 9 Tunnelkette Klaus; 2. Röhre<br />
6 S 10 Unterweitersdorf – Freistadt<br />
7 S 34 St. Pölten Hafing – Wilhelmsburg<br />
8 S 3 Hollabrunn – Guntersdorf<br />
9 A 5 Poysbrunn – Staatsgrenze (Teilrealisierung<br />
Umfahrung Drasenhofen)<br />
Autobahnprojekte:<br />
1 A 14 Pfändertunnel; 2. Röhre inkl.<br />
Sanierung Bestandsröhre<br />
2 Sicherheitstechnische Maßnahmen<br />
Arlbergstraßentunnel<br />
3 A 11 Karawankentunnel;<br />
Sicherheitsausbau<br />
4 A 9 Bosrucktunnel; 2. Röhre inkl.<br />
19 Wien Hbf.<br />
20 Südbahn Wien – Wiener Neustadt;<br />
4-gleisiger Ausbau<br />
21 Müllendorf – Eisenstadt;<br />
Errichtung Schleife<br />
22 Schladming Bf.; Umbau<br />
23 Bruck/Mur Bf.; Umbau<br />
24 Brixlegg Bf.; Umbau<br />
25 Zeltweg Bf.; Umbau<br />
26 Strasshof Bf.; Umbau<br />
27 Wien – Bratislava<br />
11 Werndorf – Spielfeld-Straß;<br />
2-gleisiger Ausbau (inkl. Bf. Leibnitz)<br />
12 Graz Hbf.; Umbau<br />
13 Ybbs – Amstetten;<br />
4-gleisiger Ausbau<br />
14 St. Pölten; Neubau<br />
Güterzugumfahrung<br />
15 Gloggnitz – Mürzzuschlag;<br />
Sanierung Bestandsstrecke<br />
16 Semmering Basistunnel<br />
17 Wien – St. Pölten; Neubaustrecke<br />
18 Lainzer Tunnel<br />
Bahnprojekte:<br />
1 St. Margrethen – Lauterach; Ausbau<br />
2 Attraktivierung Außerfernbahn<br />
3 Brenner Basistunnel<br />
4 Kundl/Radfeld – Baumkirchen;<br />
4-gleisiger Ausbau<br />
5 Salzburg Hbf. – Freilassing;<br />
3-gleisiger Ausbau<br />
6 Salzburg Hbf.; Umbau<br />
7 Linz – Wels; 4-gleisiger Ausbau<br />
8 Linz – Summerau; Ausbau<br />
9 Bosrucktunnel neu, Planung<br />
10 Koralmbahn Graz – Klagenfurt