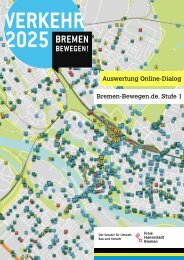Rolândia [PDF, 124 Kb] - Radio Bremen
Rolândia [PDF, 124 Kb] - Radio Bremen
Rolândia [PDF, 124 Kb] - Radio Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
RADIO BREMEN<br />
Feature-Redaktion 167 829<br />
Tel.: 0421 – 246 42634 Fax -52634 - email: michael.augustin@radiobremen.de<br />
Tel.: 0421 – 246 42624 Fax: -52624 - email: feature-ndhsp@radiobremen.de<br />
Mitwirkende:<br />
Erzählerin: Cornelia Schramm<br />
<strong>Rolândia</strong><br />
Bremer Spuren in der brasilianischen Provinz<br />
von Gudrun Fischer<br />
Sprecher 1: Senta Bonneval (Übersetzung O-Ton 9 & 10)<br />
Sprecher 2: Peter Kaempfe (Übersetzung O-Ton 11 & 12)<br />
Sprecher 3: Joachim Bliese (Übersetzung O-Ton 26 & 27)<br />
Redaktion: Michael Augustin<br />
Regie: Ilka Bartels<br />
Assistenz: Wolfgang Seesko<br />
Ton und Technik:<br />
Sendung: 10.02.2013 / 09.05-10.00 Uhr Nordwestradio<br />
Produktion:<br />
Wortaufnahme: 07.01.2013 / 10.00 -18.00 h/ P30 beim Sendesaal /RB<br />
Fertigstellung: 08.-11.00.2013 /10.00-18.00 h/ Regie 1 <strong>Radio</strong> <strong>Bremen</strong><br />
© „COPYRIGHT“<br />
Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt.. Es darf ohne<br />
Genehmigung nicht verwertet werden. Insbesondere darf es nicht<br />
ganz oder teilweise oder in Auszügen abgeschrieben oder auf eine<br />
andere Art vervielfältigt werden. Für Zwecke des Rundfunks darf<br />
das Manuskript n u r mit Genehmigung von RADIO BREMEN<br />
benutzt werden.
Atmo 1 (leiser städtischer Autoverkehr, Hupen, mit dem für Brasilien damals und heute<br />
noch typischen Knattergeräusch eines VW-Käfers): ein paar Sekunden steht diese Atmo<br />
frei, dann unter Sprecherin und O-Ton 1 legen & stehen lassen<br />
Erzählerin<br />
Wir befinden uns in Brasilien in einer Kleinstadt in der Provinz. Der Name: <strong>Rolândia</strong>. Man<br />
schreibt das Jahr 1977. Hermann Bresslau, deutscher Honorarkonsul von <strong>Rolândia</strong>, hält<br />
eine Rede. Seit über 40 Jahren lebt er in Brasilien. Heute empfängt er hohen Besuch. Eine<br />
Bremer Senatsdelegation steht andächtig vor einer fast fünf Meter hohen Roland-Statue<br />
O-Ton 1 Hermann Bresslau Lg. 0:52<br />
Verehrte Mitglieder der Bremer Senatsdelegation!<br />
Die besonderen Bande, die unser junges Gemeinwesen mit der altehrwürdigen Hansestadt <strong>Bremen</strong><br />
verknüpfen, könnten wohl an keiner Stelle eindrucksvoller in Erscheinung treten als hier, vor unserem<br />
Roländer Roland. Vor fast genau 20 Jahren zum 25. Jahrestag unserer Stadtgründung, brachte eine Bremer<br />
Delegation dies Abbild des steinernen Riesen nach <strong>Rolândia</strong>. Die Statue Roland des Riesen wurde durch ein<br />
Dekret unserer Munizipalkammer zum Stadtwappen erhoben. Damit waren die bislang nur gefühlsmäßig<br />
bestehenden Freundschaftsbande auch offiziell verankert.<br />
Ansage<br />
Am Roland von <strong>Rolândia</strong><br />
Bremer Spuren in der brasilianischen Provinz<br />
Ein Feature von Gudrun Fischer<br />
Erzählerin<br />
Die subtropische Sonne sticht den deutschen Gästen in die Augen, es ist kochend heiß.<br />
Hermann Bresslau präsentiert <strong>Rolândia</strong> von seiner besten Seite. Seine Gäste werden<br />
nach der Ansprache eine Schule besuchen, wo Kinder ein deutsches Lied anstimmen<br />
sollen, und in einem Club wird man brasilianisch speisen. Einige Damen und Herren aus<br />
der Bremer Senatsdelegation sind Mitglieder im Verein „Bremer Freunde von <strong>Rolândia</strong>“.<br />
Sie wollen die Geschäftsverbindungen zwischen den beiden Städten verbessern.<br />
In brasilianischen Ohren mag der Name <strong>Rolândia</strong> ungewöhnlich klingen, doch eigentlich<br />
weiß hier ein jedes Schulkind, dass im Einwanderungsland Brasilien viele Städte nach der<br />
Heimat ihrer Großeltern heißen.<br />
Rolandia 2
Atmo 1 (leiser städtischer Autoverkehr, Hupen, VW-Käfer): ein paar Sekunden steht diese<br />
Atmo frei, dann 2. O-Ton hoch, Atmo läuft leise weiter<br />
O-Ton 2 Hermann Bresslau Lg. 0:43<br />
Wie war es zu dem Namen Roland, oder <strong>Rolândia</strong>, gekommen? Die für die Planung und den Aufbau<br />
entscheidenden Gründer unserer Siedlung, der ehemalige Reichsminister Erich Koch-Weser und der<br />
Siedlungsberater Oswald Nixdorf waren Bremer. Dazu kam, genau wie bei Ihrem Bremer Roland, ein<br />
bisschen Legende. Wir wissen heute nicht mehr ganz genau, an welchem Lagerfeuer eines Abends dieser<br />
Name aufgekommen ist. Aber er schlug ein und blieb haften. Dazu verhalf auch das Wortspiel Roland,<br />
Rodeland, rotes Land. Oder rohes Land.<br />
Atmo 1 (leiser städtischer Autoverkehr, Hupen, VW-Käfer) wird leiser, überblenden Atmo 2<br />
(auf dem Lande in Brasilien, Vögel, Grillen), bleibt leise bis unter den 3. O-Ton stehen.<br />
Erzählerin<br />
Nicht <strong>Rolândia</strong>, sondern „Roland“ nannten zu Anfangszeiten die deutschen Gründer ihr<br />
brasilianisches Städtchen, das damals noch von Urwald umgeben war. Ich selber kenne<br />
diesen alten Namen noch aus meiner Kindheit. Mein Vater war für zehn Jahre Pastor in<br />
der evangelisch-lutherischen Gemeinde von <strong>Rolândia</strong>. Meine Kindheit in den 60er und<br />
70er Jahren war brasilianisch geprägt, auch wenn bei uns am Esstisch deutsch<br />
gesprochen wurde. Ganz anders muss es bei Eta Koch-Weser gewesen sein, der als<br />
Siebenjähriger mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder Jan nach <strong>Rolândia</strong> kam.<br />
O-Ton 3 Eta Koch-Weser: Lg. 0:41<br />
Ich bin eben mit meinem Vater und meiner Mutter 1934 nach Roland gekommen. Roland existierte aus zehn<br />
Siedlern am alten Kolonieweg, und unser Haus, wie wir hin kamen, war gerade zur Hälfte fertig, da zogen wir<br />
ein. Wir pflanzten Zuckerrohr und Tung. Der ganze Anbau hat entsetzlich wenig gegeben, bis wir auf die Idee<br />
gekommen sind, Kaffee zu pflanzen. Mein Vater war ja ausgewandert, weil er schon 1933 sagte, Hitler ist<br />
Krieg, und da ist er eben ausgewandert.<br />
Atmo 2: Unter dem O-Ton 3 langsame Kreuzblende zu Lied 1 (romantischer Bolero aus<br />
Brasilien) hier setzt der Gesang ein, leise, bleibt bis nach dem Sprecherinnentext.<br />
Erzählerin<br />
Der Politiker Erich Koch-Weser, der 1875 in Bremerhaven auf die Welt kam, hatte den<br />
Aufstieg der Nationalsozialisten hautnah miterlebt. Er wurde Anfang 1901 zunächst<br />
Bürgermeister von Delmenhorst, dann Stadtdirektor in Bremerhaven, außerdem Mitglied<br />
der Bremer Bürgerschaft und, bevor er als Abgeordneter der Deutschen Demokratischen<br />
Partei in die Reichspolitik ging, auch noch Bürgermeister von Kassel. Danach bekleidete<br />
er den Posten des Innenministers, später des Justizministers und diente zudem der<br />
Weimarer Republik für einige Jahre als Vizekanzler. 1933 entzogen die Nationalsozialisten<br />
Rolandia 3
ihm seine Rechtsanwaltszulassung in Berlin. Seine Mutter war Jüdin. Erich Koch-Weser<br />
und seine zweite Frau Irma von Blanquet sahen die Zeit gekommen, Deutschland zu<br />
verlassen. So geschah es, dass die brasilianische Siedlung <strong>Rolândia</strong> auch für andere<br />
Migranten aus Deutschland eine ganz besondere Anziehungskraft entwickelte. Denn, so<br />
sagte man sich, wenn ein prominenter Politiker wie Erich Koch-Weser ausgerechnet hier<br />
einen Neuanfang versucht, dann könnte das vielleicht ein Ort mit Zukunft sein.<br />
Lied 1 (romantischer Bolero aus Brasilien) hier soll die Musik zum ersten Mal ein paar<br />
Sekunden frei stehen, mit einem dramatischen Element des Liedes, dann unter dem<br />
nächsten O-Ton wieder leise.<br />
O-Ton 4 Eta Koch-Weser: Lg 0: 56<br />
Mein Vater hat gesagt, ohne Krieg wird Deutschland Hitler nicht wieder los. So war es ja auch. Es war für ihn<br />
sehr schwer, denn er war ja schon über 50 wie er nach Brasilien kam, ohne meine Mutter, die eben 20 Jahre<br />
jünger war, hätte er es auch gar nicht sich getraut. Aber es musste eben sein, also hat man es gemacht.<br />
Mein Vater hat die Natur genossen, denn das hatte er sein Leben praktisch noch nicht gehabt. So viel Natur<br />
um sich herum. Dann haben wir, die erste anständige Kaffeeernte haben wir erst 1946 gehabt. Das hat er<br />
gar nicht mehr erlebt. Er hat zum Schluss eigentlich immer gesagt, wir gehen noch mit dem weißen Stab<br />
vom Land. Die Bettler hatten früher einen weißen Stab, oder sowas. Irgendwie hatte er die Hoffnung etwas<br />
aufgegeben – aber hinterher hat es sich fantastisch bewährt.<br />
Lied 1 (romantischer Bolero aus Brasilien) etwas hoch, nur kurz frei, dann wieder leise,<br />
bleibt bis nach dem 8. O-Ton.<br />
Erzählerin<br />
Eta Koch-Weser ist heute hoch in den Achzigern. Er übernahm 1944 nach dem Tod seines<br />
Vaters mit 17 Jahren die brasilianische „Fazenda“, die Farm. Bei der Verwaltung half ihm<br />
seine Mutter und sein zweiundzwanzig Jahre älterer Bruder Geert aus der ersten Ehe<br />
seines Vaters. Auch Geert Koch-Weser hatte Deutschland rechtzeitig verlassen und war<br />
mit seiner Frau auf eine "Fazenda" in die Nachbarschaft seines Vaters gezogen. Er hatte<br />
Landwirtschaft studiert und war damit unter den Neuankömmlingen in <strong>Rolândia</strong> einer der<br />
wenigen Fachleute. Seine Tochter Frauke kam in <strong>Rolândia</strong> auf die Welt. Heute ist sie 76<br />
Jahre alt.<br />
O-Ton 5 Frauke Decurtins Lg. 0:31<br />
Ich bin 1934 im sehr stark noch bestehenden Urwald geboren, meine Mutter hat eine sehr schwierige Geburt<br />
gehabt in einem Hospital für Waldschläger, wir haben beide überlebt, und dann bin ich 19 Jahre in Brasilien<br />
heran gewachsen. Mein Vater ist belastet, wie man das so, jedenfalls hab ich das so gehört, ein komisches<br />
Wort. Hatte jüdisches Blut angeblich in den Adern.<br />
Atmo: Lied 1 (romantischer Bolero aus Brasilien) kurz hoch kommen lassen<br />
Rolandia 4
O-Ton 6 Frauke Decurtins Lg. 1:02<br />
Mein Vater hat eine wunderschöne Farm produziert in Brasilien, mein Vater ist durchdacht gewesen, mit der<br />
Einteilung der Kaffeefelder, und Maisfelder, wo die Arbeiterkolonie und Ställe sein sollten. Der Bach, erinnere<br />
ich sehr gut, da gab es eine Mühle und der Stausee, in dem lernten wir schwimmen an einem<br />
Bananenstamm, der hat ja lauter Lufträumchen. und so ein Stamm ist so im Durchmesser dick wie man mit<br />
zwei Händen gut umfassen kann, und daran haben wir uns gehalten und haben mit den Beinen gestrampelt<br />
und haben so schwimmen gelernt. Ich erinnere mich als kleines Mädchen, dass dann der Großvater Erich,<br />
also vor 1944, wie ich also noch kleiner war, vielleicht 8- oder 9-jährig, da konnten wir bei ihm sitzen auf dem<br />
Schoß und er las uns aus Brehms Tierleben vor.<br />
Erzählerin<br />
Eine paradiesische Kindheit in Brasilien, und paradiesische Einnahmen aus dem<br />
Kaffeeanbau. Frauke Koch-Weser und ihre vier Geschwister konnten aufgrund der<br />
Gewinne aus den fantastischen Kaffeeernten in Deutschland studieren. Frauke Koch-<br />
Weser heiratete, nahm nach der Heirat den Namen Decurtins an und ging mit ihrem Mann<br />
wieder nach Brasilien. Von ihren Geschwistern ist sie die Einzige, die auch als<br />
Erwachsene in Brasilien lebte. Sie liebte dieses Land und war schon als Kind beeindruckt<br />
von der subtropischen Natur.<br />
O-Ton 7 Frauke Decurtins Lg. 0:40<br />
Da war dieser große Peroba Baum stehen geblieben, wo rundherum Grass stand und später Mais und so<br />
was. Wir saßen beim Käsekuchen und es regnete in Strömen und es donnerte und da ist der Blitz<br />
eingeschlagen in diese Peroba, die 100 Meter allerhöchstens von unserem haus entfernt stand. Dann waren<br />
so zwei-etagig hohe Splitter, rotes Holz, es regnete nass auf dieses Holz, vor unseren Augen, wahnsinnig,<br />
und das ist uns sehr eingefahren, die Gewalt der Natur.<br />
Lied 1 (romantischer Bolero aus Brasilien) kurz frei stehen lassen<br />
O-Ton 8 Frauke Decurtins Lg. 0:55<br />
Wir gingen ja dann am Anfang in die Schule zu Ziegler, der hatte vorher Eta und Jan unterrichtet, die waren<br />
nun fertig und dann hat Herr Ziegler uns übernommen und wir gingen zu dritt zu ihm in die Schule diese vier<br />
Kilometer, die wir laufen mussten auf der kaum noch Verkehr habenden Straße, auf dem Höhenzug, wir<br />
kamen auf der einen Seite hoch und wir gingen auf der anderen Seite wieder runter. Und da haben wir<br />
zusammen Unterricht gehabt. Nur wir drei, ich war ein Jahr zu alt, meine Schwester Elke war ok und meine<br />
Schwester Anke musste immer mitgezogen werden. Es gab ja nichts anderes. Nachher konnten wir reiten,<br />
dann wurde es angenehmer.<br />
Lied 1 (romantischer Bolero aus Brasilien) unter dem nächsten Sprecherinnentext<br />
Kreuzblende zu Atmo 3 (Autoverkehr, Lastwägen, an der Rolandstatue heute)<br />
Rolandia 5
Erzählerin<br />
Reiten durch den Urwald – und am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen auf der<br />
Veranda. Vieles was bei anderen brasilianischen Familien unüblich war, habe auch ich als<br />
Kind deutscher Eltern in Brasilien erlebt. Die Koch-Wesers wie auch meine Eltern<br />
bemühten sich um eine Schulbildung für ihre Kinder, in der die deutsche Sprache noch<br />
einen Platz hatte – und sei es, dass dafür der Unterricht privat organisiert werden musste.<br />
Atmo 3: (Autoverkehr, Lastwägen, an der Roland-Statue) wird lauter, ein<br />
Lautsprecherwagen fährt vorbei, laute, dröhnende Männerstimme (portugiesisch), zitiert<br />
aus der Bibel, es wird von Jesus gesprochen. Dann wieder leiser Autoverkehr, Sprecherin<br />
beginnt.<br />
Erzählerin<br />
Ich stehe wie einst 1977 die Bremer Senatsdelegation an der Roland-Statue in <strong>Rolândia</strong>.<br />
Um mich herum strömt der Verkehr. Lastwagen, Pick-Ups und Fahrräder fahren vorbei.<br />
Ein Lautsprecherwagen schleicht auf dem Seitenstreifen entlang. Bibelpassagen über das<br />
Leben von Jesus erschallen. In <strong>Rolândia</strong> haben, wie überall in Brasilien, die evangelikalen<br />
Christen Einzug gehalten. Sie betreiben kleine Gebetshäuser in den ärmeren Vororten von<br />
<strong>Rolândia</strong>. Das sind die „vilas“ – von der Gemeinde gebaute Reihenhaus-Siedlungen für<br />
die Armen. Auch dort hat man inzwischen die Straßen geteert, es gibt Wasser,<br />
Kanalisation, Müllabfuhr, Kindergärten, Schulen und Geschäfte. Nur die Banken und auch<br />
das Krankenhaus befinden sich im Zentrum <strong>Rolândia</strong>s, in der Nähe der Roland-Statue.<br />
Atmo 3: (Autoverkehr, Lastwägen, an der Roland-Statue, ohne Lautsprecherwagen) kurz<br />
frei stehen lassen, dann wieder leiser, zum Ende des nächsten Textes Kreuzblende zu<br />
Atmo 4<br />
Erzählerin<br />
Nicht weit vom Roland erstreckt sich der lange Flachbau des zentralen Busbahnhofs.<br />
Wenige Meter dahinter konzentriert sich an der Hauptkreuzung der Stadt die kleine<br />
Einkaufszone. <strong>Rolândia</strong> ist Zentrum für das landwirtschaftlich geprägte Umland. Hier<br />
werden Saatgut, Traktoren, Unkrautvernichtungsmittel, Reifen, Werkzeuge, Kleidung und<br />
haltbare Nahrungsmittel eingekauft. <strong>Rolândia</strong> unterscheidet sich kaum von den<br />
Nachbarstädtchen. Auch hier gibt es eine prunkvolle katholische Kirche, nur wenige<br />
Hochhäuser und eine Vielzahl alter Bäume in den Straßen. Die reicheren Leute leben<br />
zentrumsnah in einstöckigen Bungalows mit gepflegten Vorgärten.<br />
Rolandia 6
Die alten Urwaldbäume in den Gärten sind gefällt, jetzt umrahmen Malvenbüsche und<br />
Christussternhecken die Rasenflächen. Hinter manchen Häusern sind von den zahlreichen<br />
Obstbäumen, die früher überall standen, nicht viel mehr als ein einzelner Mangobaum<br />
oder Zitronenbusch übrig geblieben. In den letzten Jahren wurden die alten Holzhäuser<br />
mit Veranda aus der Anfangszeit durch Steinhäusern ersetzt. Die rote Erde des Umlands<br />
hinterlässt an den Wegen, Gehsteigen und Häusern <strong>Rolândia</strong>s einen rostbraunen<br />
Schimmer.<br />
Atmo 4: (am Busbahnhof, Busmotoren rattern im Leerlauf, ein Blinker klickt laut, Stimmen<br />
murmeln im Hintergrund), kurz frei, dann unter dem Text stehen lassen, bleibt bis 10. O-<br />
Ton.<br />
Erzählerin<br />
Vom Busbahnhof der Stadt starten regionale Busse in die Umgebung und bequeme<br />
Überlandbusse in das acht Reisestunden entfernte São Paulo. Zwei ältere Frauen, sie<br />
heißen beide Maria, sitzen im Wartebereich und halten Ausschau nach dem Bus in die<br />
Nachbarstadt Arapongas. Die gesprächigere von beiden ist Maria Élia.<br />
O-Ton 9 Maria Élia Lg. 1:04<br />
Nós somos duas irmãs em cristo. Somos da mesma igreja. Nós está procurando uma casa para comprar<br />
para entrar num projeto de compra para ela vim para cá. Tem mãe doente, irmã doente e ela quer vim para<br />
cá. Tem que vim de mudança. A gente foi direto para a prefeitura, minha casa minha vida, sobrou uma mas<br />
nem a prefeitura, nem a Caixa informou nada para a gente. Eu vim com doze anos para cá, meu pai e<br />
minha mae e sete filho e estamos aqui até hoje. A gente tinha parente aqui, induziu para a gente vim e tudo,<br />
e meu pão vendeu tudo lá de Fortaleza e veio. Só que a gente tinha este restaurantezinho lá, meu pai<br />
vendeu tudo, iludido. Mas a gente não se deu tão mal porque chegamos aqui eu já fui trabalhar no hospital<br />
já mesmo com doze anos, já conheci o médico, que era dono antigamente era o Vilanueva, ele deu apoio<br />
para a gente, achamos um braço para protejer a gente vai em frente.<br />
Sprecher 1 (Übersetzung)<br />
Wir sind zwei Schwestern in Christus, wir gehören zu ein und derselben Kirchengemeinde.<br />
Heute sind wir den ganzen Tag herumgelaufen, denn meine Freundin, die in der<br />
Nachbarstadt wohnt, möchte nach <strong>Rolândia</strong> ziehen. Sie will mithilfe des neuen<br />
Wohnungsprogramms der Regierung ein Häuschen kaufen, aber niemand informierte uns<br />
ordentlich darüber. Meine Freundin hat in <strong>Rolândia</strong> eine kranke Mutter und eine kranke<br />
Schwester, sie ist gezwungen her zu ziehen. Ich selbst lebe hier schon seit ich zwölf Jahre<br />
alt bin. Verwandte haben uns überredet, alles zu verkaufen und her zu ziehen, obwohl wir<br />
ein kleines, gut gehendes Restaurant in Fortaleza im Nordosten von Brasilien hatten.<br />
Rolandia 7
Aber es ist uns hier nicht schlecht ergangen. Ich fand gleich nach der Ankunft im<br />
Krankenhaus Arbeit. Der Arzt dort, irgendwie hatte er eine ausländische Herkunft, hat uns<br />
geholfen. Er reichte uns gleich zu Anfang einen stützenden Arm.<br />
Atmo 4: (am Busbahnhof), kurz frei, dann leiser<br />
Erzählerin<br />
Ihre ganze Familie, ihre Geschwister und auch ihre Kinder waren in <strong>Rolândia</strong> nie<br />
arbeitslos, sagt Maria Élia. Sie konnten sich sogar bald ein kleines Stückchen Land am<br />
Rand der Stadt kaufen.<br />
O-Ton 10 Maria Élia Lg. 0:55<br />
A gente se deu muito com japoneses também. A gente tinha um sítio, plantava muita fruta verdura e agriao,<br />
eles vinham com caminhoneta catava e enchia as caixas de fruta verdura e agrião e trazia para as<br />
quitnadas deles para vender, nós se deu muito bem com eles. Japones e alemão tinha bastante, agora<br />
menos, mas tinha muito, no começo né. Nossa era, tudo matagal quando a gente chegou. Aonde é a nossa<br />
casa não tinha rua era tudo, uma vilinha assim, uma casinha lá, outra longe, tudo mato. Depois foi abrindo,<br />
foi vindo gente, foi abrindo. Agora está muito grande, a população aumentou muito mas também aumentou<br />
o lugar para trabalhar, aumentou, tem Duri, Cotan, Itamaraty, tem várias fábricas, a Jandele que é muito<br />
grande.<br />
Sprecher 1 (Übersetzung)<br />
Wir haben uns sehr gut mit einigen japanischen Familien verstanden. Jeden Morgen<br />
kamen sie mit ihren Pick-Ups und füllten ihre Kisten mit unserem Obst, Wasserkresse,<br />
Gemüse und Salat. Das verkauften sie in ihren Gemüseläden in der Stadt. Am Anfang<br />
lebten in <strong>Rolândia</strong> viele Japaner und auch Deutsche. Heute sind es weniger. Als wir hier<br />
ankamen, gab es vor unserem Haus noch keine Straße, es war alles Buschwerk. Hier ein<br />
Häuschen, dort ein Häuschen. Dann wurde mehr und mehr gebaut, Leute zogen zu und<br />
jetzt ist die Stadt groß und es gibt viel Arbeit. Wir haben hier verschiedene Fabriken: Die<br />
Keksfabrik Duri, die Kaffeefabriken Cotan und Itamaraty und die Hühnchenfabrik Jandele,<br />
wo ich auch gearbeitet habe.<br />
Atmo 4: (am Busbahnhof) unter dem nächsten Text Kreuzblende zu Atmo 5<br />
Rolandia 8
Erzählerin<br />
Wirtschaftlich geht es nach einem Tief in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in<br />
<strong>Rolândia</strong> wieder aufwärts. Besonders der Einzelhandel profitiert vom Wachstum der Stadt.<br />
Farbenverkäufer César Concato kann sich nicht beklagen. In seinem Geschäft mit Namen<br />
“<strong>Bremen</strong> Tintas” ist immer Betrieb. In den Ecken stapeln sich die Farbeimer in<br />
verschiedenen Größen. Hinter einem Durchgang liegt das Lager, dort schiebt ein<br />
Mitarbeiter ein Wägelchen mit Kisten vor sich her. Der Straßenlärm dringt durch die hohen,<br />
offen Türen ins Geschäft. Abends werden einfach die schweren Metall-Rollos<br />
heruntergelassen. César Concato, ein grauhaariger, breitschultriger Mann, sitzt am<br />
Tresen.<br />
Atmo 5: (Straßengeräusche) bleibt bis zum Text vor O-13 stehen.<br />
O-Ton 11 César Concato Lg. 0:29<br />
Eu quando fui abrir esta loja ha 18 anos atrás, eu estava com um problema de nomes. Eu não queria<br />
colocar o sobrenome, o nome da cidade ou alguma coisa. Eu estava vendo um livro sobre <strong>Rolândia</strong> e citava<br />
muito a cidade de <strong>Bremen</strong>, eu falei está resolvido, <strong>Bremen</strong> Tintas. Tenho vontade de ir, conhecer lá. De<br />
<strong>Bremen</strong> sempre a gente ve aqui em <strong>Rolândia</strong>, a estatua de Roland, que tem aqueles pŕedios muito bonitos<br />
que tem.<br />
Sprecher 2 (Übersetzung)<br />
Als ich vor 18 Jahren mein Geschäft eröffnete, fiel mir kein Name ein. Mein Nachname war<br />
mir zu langweilig. Da schaute ich mir Bücher über die Entstehung <strong>Rolândia</strong>s an und darin<br />
wurde über die Stadt <strong>Bremen</strong> berichtet. Da wusste ich, “Farben <strong>Bremen</strong>” sollte mein Laden<br />
heißen. Irgendwann will ich <strong>Bremen</strong> besuchen. Wir haben hier ja diese Roland-Statue und<br />
dann auch ein paar Häuser, die deutsch aussehen.<br />
Erzählerin<br />
César Concato meint damit zwei mehrstöckige Häuser, die mit Fachwerk und einem<br />
Türmchen geschmückt sind. Sie passen nicht so recht ins Stadtbild, denn die meisten<br />
Häuser sind einstöckig, viele haben ein Flachdach. Fünf Minuten von den<br />
Geschäftsstraßen entfernt, zwischen Fußballplatz und Sporthalle hat man ein paar<br />
Fachwerkhauspappfassaden aufgestellt, die vor etwa 20 Jahren gemalt worden sind. Sie<br />
dienen als Kulisse für das jährlich stattfindende Oktoberfest. Die Gäste aus dem Umland<br />
stört es nicht, dass der niedliche künstliche Straßenzug ein wenig fremd wirkt in der<br />
subtropischen Hitze.<br />
Rolandia 9
Zwar sinken in <strong>Rolândia</strong> im Wintermonat Juli für einige Tage die Temperaturen unter zehn<br />
Grad. Im Oktober aber ist es längst wieder heiß. Vom Oktoberfest in <strong>Rolândia</strong> weiß man<br />
außerhalb der Region kaum etwas. Berühmt in Brasilien ist das Oktoberfest in der Stadt<br />
Blumenau mit jährlich achthunderttausend Gästen. Blumenau wurde, genau wie <strong>Rolândia</strong>,<br />
einst von Deutschen gegründet und liegt 700 Kilometer südlich von <strong>Rolândia</strong>. In ganz<br />
Brasilien wachsen die Städte, sagt Farbenverkäufer César Concato.<br />
O-Ton 12 César Concato Lg. 0:47<br />
A própria população de <strong>Rolândia</strong> que era de 40 mil habitantes já está com 57. Então tem uma evolução<br />
muito grande na construção civil, ela está muito acelerada não é só em <strong>Rolândia</strong>, no Brasil todo. Eu<br />
particularmente gosto muito de madeira mas infelizmente está acabando. Minha casa é de madeira. Tem<br />
casas de 50, 60 anos, muito bem conservadas ainda. Meu avô ele veio para cá em 1910. Eles vieram para<br />
Minas Gerais, e aqui meu pai veio para cá em 1950. Meu avô é italiano.<br />
Sprecher 2 (Übersetzung)<br />
<strong>Rolândia</strong> ist sehr gewachsen. Bei der Eröffnung meines Geschäfts hatten wir 40.000, jetzt<br />
haben wir schon 57.000 Einwohner. Für mich ist das gut, die Leute brauchen Farben. Im<br />
Moment boomt alles und ganz besonders boomt das Baugewerbe in Brasilien. Ich<br />
persönlich mag Holz, ich wohne in einem der alten Holzhäuser. Leider werden sie<br />
zunehmend durch Steinhäuser ersetzt. Dabei halten sie gut, manche Holzhäuser sind 50<br />
oder 60 Jahre alt. Mein Großvater, der Italiener war, kam schon 1910 nach Brasilien. Er<br />
ging zuerst in den Bundesstaat Minas Gerais. 1950 kam mein Vater hierher.<br />
Atmo 5: (Straßengeräusche) Kreuzblende zum Lied 2 (sehnsuchtsvoller Bossa)<br />
Erzählerin<br />
Zu Millionen strömten Anfang des letzten Jahrhunderts arbeitswillige Menschen aus Japan<br />
und aus Italien nach Brasilien. Dagegen nimmt sich die Zahl der 20.000 jüdischer<br />
Immigranten aus Osteuropa klein aus. Dazu flohen ein paar Jahrzehnte später, als in<br />
Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht kamen, noch einmal 10.000 deutsche<br />
Jüdinnen und Juden nach Brasilien. Eine dieser Verfolgten ist Susanne Behrend, heute in<br />
ihren Neunzigern. Sie war 18 als ihre Familie – die Familie Stern – sich 1939 in <strong>Rolândia</strong><br />
niederließ. Susanne Behrend stammt aus Breslau, dem heutigen Wroclaw in Polen. In<br />
ihrem holzgetäfelten sonnigen Wohnzimmer warten verschlissene Ledersessel auf<br />
Besuch, doch es kommt nur noch selten jemand vorbei. Ein paar Familienfotos<br />
schmücken das Regal, ansonsten ist das Wohnzimmer sparsam eingerichtet.<br />
Rolandia 10
Im Flur zieht die Angestellte, die Susanne Behrend vormittags zur Hand geht, die<br />
Bohnermaschine über den Boden. Sohn Renato lebt im Haus seiner Mutter und kümmert<br />
sich um alles Notwendige. Susanne Behrend ist klein, gebeugt, eine energische,<br />
hellwache Frau. Schlohweiß steht ihr volles, kurz geschnittenes Haar in die Höhe.<br />
Lied 2 (sehnsuchtsvoller Bossa) wird unter dem vorherigen Text leiser, Kreuzblende zu<br />
Atmo 6: (Wohnungsatmo, eine Bohnermaschine brummt)<br />
Nach den letzten Worten der Sprecherin:<br />
Atmo 7: (Schritte, Frauenstimme): „Mein Gott, es geht niemand ans Telefon. Hallo, ehm?“<br />
Blende zu Atmo 6: Die Bohnermaschine kommt kurz wieder hoch, dann Kreuzblende zu<br />
Lied 2. Die Blende zur Musik soll markieren, dass wieder aus der Vergangenheit erzählt<br />
wird. Nach ein paar Sekunden Musik setzt der O-Ton ein.<br />
O-Ton 13 Susanne Behrend Lg. 0:45<br />
Aber wie der Führer dann kam und ich mit zwölf Jahren vom Biologielehrer vor die Klasse gerufen wurde als<br />
ein typisches Beispiel der üblen, semitischen Rasse – krumme Nase, krumme Beine, die ich gar nicht habe,<br />
lockiges Haar, dunkel, klein – fanden meine Eltern, es wäre nun an der Zeit, raus aus der deutschen Schule<br />
und haben uns in die einzige damals existierende jüdische Schule in Breslau gegeben. Eine sehr orthodoxe<br />
Schule, für uns zuerst sehr schwierig, weil wir vom Judentum zuerst nichts wussten, aber gar nichts.<br />
Lied 2 (sehnsuchtsvoller Bossa), bleibt kurz frei stehen<br />
O-Ton 14 Susanne Behrend Lg. 1:10<br />
Meine Eltern hatten auch einen Flügel, der verkauft wurde, und die Frau, die den Flügel gekauft hat, hat uns<br />
eine Wärmflasche mitgegeben, aus Kupfer, meine Mutter hat gelacht und hat gesagt, „wir gehen doch in die<br />
Tropen“ und da hat sie gesagt, „Sie werden sich noch dankbar an mich erinnern“. Und wie oft haben wir das.<br />
Die wurde ins Bett gestellt und da war das Bett angeheizt und dann ging man ins Bett. Wir durften<br />
mitnehmen, was man eben in einem gutbürgerlichen Haushalt hatte, natürlich silbernes Besteck, für jeden<br />
von uns durften wir zwei Gabeln, zwei Messer, zwei Löffel mitnehmen, alles andere durften wir da lassen, na<br />
ja und Töpfe und Geschirr, das haben wir alles mitgenommen. Aber das Geschirr war so schlecht gepackt,<br />
dass alles zerbrochen ankam, und das war ein riesiger Verlust, denn meine Eltern hatten viel kostbares altes<br />
Porzellan. Weg!<br />
Lied 2 (sehnsuchtsvoller Bossa), bleibt kurz frei stehen<br />
O-Ton 15 Susanne Behrend Lg. 0:46<br />
Meine Ankunft, ich erinnere mich wie furchtbar ich die Landschaft fand. Denn es war ja abgeholzt und es war<br />
eben unordentlich, die Landschaft. Hier, wo heute mein Haus steht, war noch Urwald wie wir hier<br />
angekommen sind. Der Zug ging damals schon bis <strong>Rolândia</strong>, ganz neu, als wir ankamen, war gerade die<br />
Station eröffnet. Und die Koffer standen auf dem Bahnhof und niemand hat sich an irgendwas vergriffen und<br />
man schlief mit offenen Türen und offenen Fenstern, weil es das einfach nicht gab, dass man überfallen<br />
wurde, oder dass was gestohlen wurde. Gab es nicht.<br />
Rolandia 11
Lied 2 (sehnsuchtsvoller Bossa), bleibt kurz frei stehen, dann steht das Lied bis zum Text<br />
vor dem 17. O-Ton<br />
Erzählerin<br />
Dass <strong>Rolândia</strong> für jüdische Flüchtlinge interessant sein könnte, war als Tipp in deutsch-<br />
jüdischen Zeitungen zu lesen und sprach sich unter Ausreisewilligen schnell herum.<br />
Jüdische Familien konnten in <strong>Rolândia</strong> noch einen Teil ihres von den Nationalsozialisten<br />
gesperrten Geldes verwenden, das ihnen sonst verloren gegangen wäre. Das Geschäft<br />
lief folgendermaßen: Eisenbahnmaterial – Schienen, Waggons, Lokomotiven – deutscher<br />
Produktion, wurde mit dem Sperrkonto-Geld von jüdischen Auswanderungswilligen gekauft<br />
und nach Brasilien verschifft. Im Austausch dafür erhielten die jüdischen Emigranten bei<br />
ihrer Ankunft Land, das allerdings noch gerodet werden musste. Dieses Dreiecksgeschäft<br />
vermittelte die schon 1929 in Berlin gegründete „Gesellschaft für Studien in Übersee“, zu<br />
deren Mitgründern auch Erich Koch-Weser gezählt hatte. Ohne zu ahnen, dass diese<br />
Institution einmal Leben retten würde. Jüdische Flüchtlinge aus Deutschland zählten<br />
zwischen 1933 und 1939 zu den besten Kunden der Gesellschaft. Darunter auch kurz vor<br />
Kriegsbeginn, die Familie Stern.<br />
O-Ton 16 Susanne Behrend Lg. 0:23<br />
Dieses Austauschgeschäft, das war das neunzehnte. Das ganze Material war bereits auf dem Schiff, das<br />
Schiff war aus dem Hafen ausgelaufen - das war im September 1939 und es brach der Krieg aus. Das Schiff<br />
war noch nicht aus der deutschen Hoheitszone raus, da wurde es zurückgerufen.<br />
Erzählerin<br />
Damit hatte die fünfköpfige Familie Stern kein Recht mehr auf Land und verlor ihre Basis<br />
für einen Neuanfang in Brasilien. Das Leben war gerettet, aber um den Preis des sozialen<br />
Abstiegs. Der Traum vom eigenen Land und eigener Wirtschaft war geplatzt.<br />
Insgesamt flüchteten etwa 100 deutsch-jüdische Familien mit Hilfe dieses<br />
Dreieckgeschäfts nach <strong>Rolândia</strong>. Die brasilianische Seite des Dreiecksgeschäft lag in der<br />
Hand der „Paraná Plantations“, einer englischen Siedlungsgesellschaft. Sie hatte der<br />
brasilianischen Regierung eine Fläche halb so groß wie Belgien abgekauft, im Norden des<br />
Bundeslandes Paraná, etwa 500 Kilometer westlich von der Stadt São Paulo. Die<br />
englische Landgesellschaft hatte zuvor im Sudan Baumwollplantagen besessen, musste<br />
aber dort die Geschäfte aufgeben, weil es zu politischen Unruhen gekommen war.<br />
Rolandia 12
Die „Paraná Plantations“ nutzte das im Dreieckshandel erworbene deutsche Material, um<br />
von São Paulo aus eine Eisenbahnlinie in die neuen Gebiete zu bauen. Damit stieg der<br />
Wert des Landes.<br />
Kreuzblende von der Musik, Lied 2, zur Gartenatmo Atmo 8: (Wasser plätschert, der<br />
Garten wird gegossen, leise Straßengeräuschen im Hintergrund) im Garten von Brigitte<br />
Wendel<br />
O-Ton 17 Brigitte Wendel Lg: 0:13<br />
Wir hatten schon in Deutschland einen Riesengarten, und ich liebte den Garten, und seit ich irgend kann,<br />
habe ich einen Garten um mich und vernachlässige mein Haus.<br />
Erzählerin<br />
Brigitte Wendel gießt mit einem Schlauch ihren verwilderten Garten. Sie ist gertenschlank<br />
und trägt selbst bei größter Hitze einen allerdings ärmellosen Rollkragenpullover. Auch<br />
ihre Familie verlor das erhoffte Land wegen des letzten missglückten Dreiecksgeschäfts.<br />
Ihre Mutter und ihre Schwester hatten sich daraufhin als Dienstmägde auf der „Fazenda“<br />
von Irma und Erich Koch-Weser verdingen müssen. Brigitte Wendel, bei der Ankunft in<br />
<strong>Rolândia</strong> 15 Jahre alt, kam zu Geert Koch-Weser, dem ältesten Sohn von Erich Koch-<br />
Weser. Sie musste auf die kleinen Töchter aufpassen. Ursprünglich stammte sie aus<br />
Schneidemühl, dem heutigen Pila in Polen.<br />
Atmo 8: im Garten von Brigitte Wendel, Wasser plätschert, steht ein paar Sekunden frei<br />
O-Ton 18 Brigitte Wendel Lg 0:40<br />
Die Irma Koch-Weser, die kam ganz früh raus und hatten eine wunderbare "Fazenda" und alles, die hat dann<br />
gebürgt, dass wir nach hier kommen, 1939, war es nicht mehr leicht raus zu kommen. Mein Vater hat immer<br />
gesagt, so ein Irrsinn geht nicht lange, wir müssen durchhalten. Und meine Mutter sagte, wir müssen hier<br />
weg. Und er sagte, Marje – Marje war der Kosename meiner Mutter – sowas kann nicht lange gehen, wir<br />
müssen durchhalten. Dann sind die Praxis verboten und dann ist er 1938 noch ins KZ gekommen, und dann<br />
haben wir das alles noch geschafft und dann: nein, der Jude darf nicht mit rein.<br />
Atmo 8: im Garten von Brigitte Wendel, Wasser plätschert, steht ein paar Sekunden frei<br />
Rolandia 13
Erzählerin<br />
Der Kinderarzt Dr. Wasser, Brigitte Wendels Vater, bekam, weil er Jude war, ein großes<br />
rotes J in seinen Pass gestempelt. Daraufhin verweigerte ihm die brasilianische Botschaft<br />
ein Visum und er musste zunächst nach England fliehen. Über weite Umwege erreichte er<br />
erst zehn Jahre später Brasilien. Bei vielen der nach <strong>Rolândia</strong> emigrierten Familien<br />
markierten erst die Verschleppung der Angehörigen in ein KZ oder die deutsche<br />
Pogromnacht am 9. November 1938 den Wendepunkt, der sie zur Flucht bewegte.<br />
Atmo 8: im Garten von Brigitte Wendel, Wasser plrätschert. Atmo Kurz stehen lassen.<br />
Leiser, unter dem folgenden O-Ton Kreuzblende zu Lied 3: Flöten-Gitarrenmusik,<br />
instrumental, bleibt bis nach dem 24. O-Ton.<br />
O-Ton 19 Susanne Behrend Lg. 1:45<br />
Achtunddreißig brannten ja dann im November die Synagogen und es wurde reihenweise verhaftet. Am 9.<br />
November ging das los und bis zum 12. November war der Vater noch nicht verhaftet. Aber der Vater war in<br />
einer derartigen Depression, dass er nicht mehr aufstand. Er lag nur noch im Bett und sprach von dem<br />
Hungertuch, das auf uns zu kam, und wir Kinder haben ihn verspottet, weil uns das eben fremd war, diese<br />
Art von Gedanken. Heute wäre es mir nicht mehr fremd. Am 12. November kam die Gestapo, der Vater kam<br />
ins Gefängnis, wir wussten nicht wohin. Zwei Tage später kam er dann ins KZ Sachsenhausen. Dann war<br />
der Vater auch dabei, wie drei versucht haben zu fliehen. Aber das KZ war ja die ganze Nacht von<br />
Scheinwerfern beleuchtet und sie haben die Kerle gefasst und ans Kreuz genagelt. Das ganze KZ musste<br />
stehen bis sie tot waren. Einen Tag und eine Nacht. Das hat uns der Vater aber erst erzählt, nachdem der<br />
Krieg verloren war. Denn wie er entlassen wurde aus dem KZ, hat man ihm gesagt, 'Unser Arm reicht weit.<br />
Wir finden dich überall, dich und deine Familie und dann seid ihr erledigt'. Darum hat er nie etwas gesagt<br />
solange es nicht sicher war, dass Hitler den Krieg verlieren würde.<br />
Erzählerin<br />
Mutter Stern, die über Kontakte nach Brasilien verfügte, die bis ins Außenministerium<br />
reichten, gelang es, Dauervisa für ihre Familie zu ergattern obwohl man ihnen allen in<br />
Deutschland bereits das rote J in den Pass gestempelt hatten. <strong>Rolândia</strong> war für die<br />
jüdischen Flüchtlinge einerseits ein sicherer Ort, wo ihnen keine Verfolgung mehr drohte.<br />
Andrerseits machten einige der nicht jüdischen deutschen Siedler aus ihrer Sympathie für<br />
die braunen Machthaber in Deutschland keinen Hehl. Zum Beispiel der Tropenlandwirt<br />
Oswald Nixdorf, der aus <strong>Bremen</strong> kam. Er war Ende 1932 von der „Gesellschaft für Studien<br />
in Übersee“ als sogenannter „Kolonieleiter“ nach <strong>Rolândia</strong> geschickt worden. 1933<br />
übernahmen die Nationalsozialisten die Gesellschaft und benannten sie um in<br />
„Gesellschaft für Siedlung im Ausland“, kurz GSA.<br />
Rolandia 14
Die GSA zahlte Oswald Nixdorf das Gehalt. Er pflegte Kontakt zur NSDAP-Auslandszelle<br />
im Bundesstaat Paraná. Diese geheime Zelle war gegründet worden, um im Falle eines<br />
deutschen Sieges für Hitler bereitzustehen. Südbrasilien, so war es geplant, sollte dem<br />
deutschen Reich einverleibt werden. Obwohl längst nachgewiesen ist, dass Oswald<br />
Nixdorf NSDAP-Mitglied war, will man das bis heute in <strong>Rolândia</strong> nicht so recht glauben.<br />
Denn das Alltagsleben in <strong>Rolândia</strong> hatte zu einer Art Zweckgemeinschaft geführt.<br />
O-Ton 20 Susanne Behrend Lg 0:27<br />
Es wurde über ihn geredet. Und es war immer ein Zweifel, war er, war er nicht? Man war sich nicht sicher,<br />
dass er kein Nazi war. Denn zum Beispiel der alte Müller, oder der alte Becker, die ja auch ausgewandert<br />
sind, nicht, weil sie Juden waren, sondern weil sie das System abgelehnt haben, bei denen wusste man<br />
ganz genau, das waren keine Nazis.<br />
Erzählerin<br />
Auch in Brasilien der 30er Jahre herrschte ein Diktator: Getúlio Vargas, der 1937 den<br />
„Neuen Staat“ ausgerufen hatte, für den er das Parlament abschaffte, alle Parteien verbot<br />
und die Presse zensierte. Getúlio Vargas verehrte Hitler und Mussolini. Ab 1937 verbot er<br />
die Einreise von jüdischen Flüchtlingen. Ausnahmen wurden nur gemacht, wenn die<br />
Zuwanderer Vorteile für die brasilianische Wirtschaft versprachen. Doch als 1939 der<br />
zweite Weltkrieg begann, setzten die Alliierten Brasilien, das neutral bleiben wollte, unter<br />
Druck. Erst 1942 schlug Brasilien sich auf die Seite der Alliierten und erklärte alle<br />
Deutschen im Land zu „feindlichen Ausländern“. Dabei war es gleichgültig ob es sich um<br />
jüdische Flüchtlinge handelte oder um Hitler-Sympathisanten. Viele Nazi-Freunde in<br />
Brasilien hatten zwar deutsche Vorfahren, waren aber selbst noch nie in Deutschland<br />
gewesen. Einige von ihnen zogen nun aus den beiden südlichsten brasilianischen<br />
Bundesländern nach <strong>Rolândia</strong>, weil sie dort billig Land erwerben konnten. Viele dieser<br />
deutschstämmigen Landwirte verstanden sich gut mit Landwirtschaftsberater Oswald<br />
Nixdorf, erinnert sich Eta Koch-Weser.<br />
O-Ton 21 Eta Koch-Weser Lg 0:55<br />
Für uns war Nixdorf immer ein sehr netter Kerl, wie sehr er überzeugter Nazi war und wie weit er eben Nazi<br />
war, weil er Deutscher war, oder das Gefühl hatte, das bringt jetzt Deutschland voran, was ja sehr viele<br />
gedacht haben, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sind wir bis zum Schluss mit Nixdorf befreundet gewesen.<br />
Die Juden sind bestimmt nicht zu Herrn Nixdorf gegangen, um sich helfen zu lassen, weil Nixdorf als Nazi<br />
galt, er war natürlich Angestellter der deutschen Regierung, irgendwie. Das hat sehr gut und vernünftig<br />
funktioniert, dass sich beide Seiten irgendwie zurück gehalten haben.<br />
Lied 3: Flöten-Gitarrenmusik, instrumental, ein paar Sekunden frei stehen lassen<br />
Rolandia 15
Erzählerin<br />
Die brasilianische Sicherheitspolizei DOPS hatte die Nazizellen in Südbrasilien im Blick.<br />
Auch Oswald Nixdorf geriet 1942 unter Verdacht, für Nazi-Deutschland zu agitieren und<br />
wurde in der Hauptstadt von Paraná, Curitiba, inhaftiert. Nach einem Jahr konnte er einen<br />
Gefängnisbeamten bestechen und fliehen. Er kehrte nach <strong>Rolândia</strong> zurück.<br />
Lied 3: Flöten-Gitarrenmusik, instrumental, ein paar Sekunden frei stehen lassen<br />
Erzählerin<br />
Nach 1942 war es in <strong>Rolândia</strong> verboten, in der Öffentlichkeit deutsch zu sprechen. Alle<br />
sogenannten „feindlichen Ausländer“, zu denen ohne Unterschied die Nazisympathisanten<br />
wie auch die jüdischen Emigranten gezählt wurden, mussten ihre <strong>Radio</strong>geräte und Waffen<br />
abgeben, benötigten eine Behördenvollmacht, um zu reisen und durften kein Land mehr<br />
erwerben. Bei Zuwiderhandlung drohte die Verhaftung, erzählt Susanne Behrend.<br />
O-Ton 22 Susanne Behrend Lg. 0:55<br />
Mein Vater kam auch ins Gefängnis, weil er deutsch gesprochen hatte auf der Straße. War eine Nacht im<br />
Gefängnis zusammen mit dem alten Koch-Weser. Der war mit meinem Vater auf der Straße und haben<br />
deutsch gesprochen. Das war Anfang 40er Jahre. Und der alte Koch-Weser hat sich furchtbar geschämt,<br />
dass ein deutscher Minister im brasilianischen Gefängnis saß und er hat erzählt wie furchtbar primitiv das<br />
war.<br />
Erzählerin<br />
Viele jüdische Flüchtlinge bangten in der Zeit um das Schicksal ihrer verschollenen<br />
Verwandten. Währenddessen versuchte der evangelische Pastor Hans Zischler in<br />
<strong>Rolândia</strong> junge Männer deutscher Abstammung zu rekrutieren. Sie sollten nach<br />
Deutschland reisen und für Hitler in den Krieg ziehen. Pastor Zischler war der Vorgänger<br />
meines Vaters. Eta Koch-Weser erinnert sich gut an ihn:<br />
O-Ton 23 Eta Koch-Weser Lg. 0:56<br />
Pastor Zischler war jedenfalls kein Nazi, das kann man wohl sagen. Sowohl Pastor Zischler sowie der<br />
Katholische Pfarrer, Padre Herions kriegten vom deutschen Konsulat Fragebögen für die jungen Deutschen<br />
in Roland, die sie sozusagen aufschreiben, registrieren sollten. Das hat ihnen die brasilianische Regierung,<br />
nachdem der Krieg dann anfing, sehr übel genommen und deshalb haben sie, sowohl Pastor Zischler wie<br />
Padre Herions für, nicht sehr lange, festgenommen, weil sie Teil des Nazinetzwerkes oder so was wären,<br />
was keineswegs beide waren, Padre Herions sowieso nicht, der ist der Nazis wegen ausgewandert.<br />
Rolandia 16
Erzählerin<br />
Aus Briefen, die ich im Archiv der evangelisch-lutherischen Gemeinde in <strong>Rolândia</strong> fand,<br />
geht hervor, dass sich nach der Stadtgründung 1932 verschiedene Leute für die Anstellung<br />
eines deutschsprachigen evangelischen Pastors in <strong>Rolândia</strong> eingesetzt hatten. Er sollte<br />
zum Erhalt des „Deutschtums“ beitragen. Die Bemühungen hatten Erfolg und Pastor<br />
Zischler bekam 1936 den Posten. Über ihn kursieren in <strong>Rolândia</strong> unterschiedliche<br />
Erzählungen. Einmal wurde mir empört berichtetet, er habe auf der Kanzel eine<br />
Naziuniform getragen.<br />
O-Ton 24 Eta Koch-Weser Lg. 0:57<br />
Dass Pastor Zischler in Naziuniform gepredigt hat, glaube ich nicht, ich habe es nie gehört, das hätte ich<br />
damals schon gehört. In Roland hatte man sich, ein Teil war Nazis und ein Teil Antinazis, die deshalb<br />
ausgewandert waren, man hatte sich eigentlich in Roland drauf geeinigt, keine Nazisymbole und so weiter<br />
zu tragen und zu führen, um den Frieden in der Kolonie zu erhalten.<br />
Erzählerin<br />
Gleich nach Ende des Krieges bemühten sich die jüdischen Emigranten in <strong>Rolândia</strong><br />
verzweifelt, Auskunft über das Schicksal ihrer Angehörigen und Freunde in Deutschland zu<br />
erhalten. Für viele von ihnen eine furchtbare Zeit, wenn sie erfahren mussten, dass sich<br />
die Spuren der Gesuchten in den deutschen Vernichtungslagern verloren.<br />
Lied 3: Flöten-Gitarrenmusik, instrumental, ein paar Sekunden frei stehen lassen. Dann<br />
Kreuzblende, Lied 3 geht über in Lied 4<br />
Erzählerin<br />
Das Leben in <strong>Rolândia</strong> ging weiter. Die brasilianischen Gesetze, die die Bewegungsfreiheit<br />
der Deutschen hatten, wurden aufgehoben, und der Kaffeeboom brachte Geld in das Haus<br />
vieler jüdischer Flüchtlinge. Brigitte Wendel heiratete, wurde Landwirtin, bekam Kinder und<br />
konnte nach und nach eigenes Land erwerben. Nur wenige Flüchtlinge bewahrten ihre<br />
jüdischen Bräuche. Eine Synagoge konnte zum Beispiel in <strong>Rolândia</strong> nicht unterhalten<br />
werden, weil dafür zehn gläubige Männer erforderlich gewesen wären. Susanne Stern<br />
heiratete Helmut Behrend, auch er ein jüdischer Flüchtling. Es ging dem Ehepaar finanziell<br />
besser als ihren alten Freunden im zerstörten Deutschland, denen sie ab und zu Care-<br />
Pakete zukommen ließen. Die Flüchtlinge gründeten einen Kulturverein mit Namen „Pro<br />
Arte“, der Vorträge, Filme und Lesungen veranstaltete.<br />
Rolandia 17
Es wurde Theater gespielt und musiziert. Einige „Roländer“ verfassten sogar Bücher über<br />
ihre Erlebnisse in den brasilianischen Subtropen. So wie Mathilde „Titi“ Maier, deren Buch<br />
den Titel trägt:„Alle Gärten meines Lebens.“<br />
O-Ton 25 Susanne Behrend Lg. 0:58<br />
Titi Maier war etwas jünger als meine Eltern, hat Biologie studiert und war verheiratet mit dem Anwalt Max<br />
Hermann Maier, eine außergewöhnlich glückliche Ehe. Sie lebten in Frankfurt, sie schreibt, bevor sie nach<br />
Brasilien kommen, schreibt sie von Gärten. Sie war eine reizende Person, furchtbar nett, und zu ihren<br />
Geburtstagen, dann später, bin ich auch hin gegangen, denn da war ich schon verheiratet, und war frei, denn<br />
so lange ich in Stellung war, war natürlich nichts. Da konnte ich nicht plötzlich verschwinden und zu Titi Maier<br />
zum Geburtstag gehen. Und ich hätte ja auch zu Fuß gehen müssen, dann ich hatte ja kein Gefährt. Und der<br />
Helmut hatte ein Pferd und es war noch Geld übrige, davon habe ich meine erste Bettwäsche gekauft und<br />
davon haben wir die charete gekauft. Das waren Karossen, also eine Kutsche mit zwei Rädern und einem<br />
Pferd. Das Auto haben wir erst 1963 gekauft, wie die Wiedergutmachung kam.<br />
Von Lied 4 Blende zu Atmo 9: (eine Kutsche, klappern Pferdehufe, der Kutscher spricht<br />
auf sein Pferd ein, dann Autoverkehr), bleibt ein paar Sekunden frei stehen, dann wieder<br />
leiser, bis zum 27. O-Ton.<br />
Erzählerin<br />
Nicht weit von der Roland-Statue parkt unterhalb der Hauptstraße eine hohe, zweirädrige<br />
Pferdekutsche unter einem knallrosa blühenden Urwaldbaum. Bis vor ein paar Jahren<br />
rollten noch viele dieser Gespanne durch die Straßen <strong>Rolândia</strong>s. Heute sind sie selten<br />
geworden. Nur der Kutscher João de Souza Neves bietet noch seine Dienste an. Nach<br />
seiner Arbeit befragt, geht ein Strahlen über sein zerfurchtes Gesicht.<br />
O-Ton 26 João de Souza Neves Lg. 0:53<br />
Carroceiro. Qualquer serviço que apareça. Só entulho não. Porque é de jogar muito lonje. É uma geladeira,<br />
uma ferramenta. A base de vinte reais. Não é permitido, sabendo andar, o perigo. Eu ando sentado. Pode o<br />
animal atropeçar e você sabe um velho caiu não tem mais concerto. Gente eu não carrego. Gente é<br />
perigoso. Antigamente andava, mas cortaram tudo.<br />
Sprecher 3 (Übersetzung)<br />
Ich bin Kutscher, ich transportiere alles, Kühlschränke, Maschinen, bloß keinen Bauschutt,<br />
da müsste ich zu weit fahren. Es kostet zwanzig Reais, zehn Euro. Wir dürfen nicht mehr<br />
im Stehen fahren, und da ich alt bin, ist es mir ganz lieb, im Sitzen zu kutschieren.<br />
Passagiere dürfen wir auch nicht mehr fahren, das ist verboten. Früher ja, aber die<br />
Stadtverwaltung hat viel verboten.<br />
Rolandia 18
Erzählerin<br />
João de Souza Neves war nicht immer Kutscher. Er arbeitete früher in der Landwirtschaft.<br />
O-Ton 27 João de Souza Neves Lg.1:12<br />
Trabalhei num sítio. Carpir café e tudo. Vão ficando velho e o problema fica acabando com os café, só<br />
plantando soja e cana, aí não tem mais jeito. Não, não aguento mais. As crianças, adulto não carrego, é<br />
muito peso. Quer montar em cima, eu digo não, tem que ter dó do animal. Canta, grita, o dia que está no<br />
chopp, oktoberfest, eu gosto, me paga par ir, aí eu vou. Ganho uns sessenta, cem real. O carroção não é<br />
meu, é da imobiliária. Empresta, o trabalho que eu tenho é só buscar e entregar, é eles que guardam. Cabe<br />
oito, conforme o tamanho. Cabe até doze, comigo também. Tem dois anos que eu não faço eu acho que o<br />
prefeito cortou este negócio por causa do animal.<br />
Sprecher 3 (Übersetzung)<br />
Früher ging ich in die Kaffeeplantagen. Nun bin ich zu alt dafür. Aber das Problem ist auch,<br />
dass es kaum mehr Kaffee gibt. Sie pflanzen jetzt lieber Soja und Zuckerrohr. Deswegen<br />
habe ich diesen Kutscher-Job. Wenn wir hier das Oktoberfest feiern, dann kutschiere ich<br />
auf der großen Parade für eine Immobilienfirma einen großen Wagen mit Kindern. Acht bis<br />
zwölf Kinder sitzen auf dem Wagen. Ich lasse sie aber nicht auf die Pferde, das ist zu<br />
schwer für die Tiere. Damit verdiene ich zwischen sechzig und hundert Reais, so etwa 40<br />
Euro. Die Leute singen, schreien und trinken Bier, es ist nett. Aber schon seit zwei Jahren<br />
werde ich nicht mehr engagiert. Ich weiß nicht, ob der Bürgermeister das jetzt auch<br />
verboten hat.<br />
Blenden von Atmo 9 (Kutsche) zu Atmo 10: (auf einer Veranda, Saft wird in eine Glas<br />
eingeschenkt), bleibt bis zum 30. O-Ton stehen<br />
Erzählerin<br />
Als Kind, so kann ich mich erinnern, bin ich auch einmal auf einem Pferdewagen durch<br />
<strong>Rolândia</strong> gefahren. Meine Schule hatte eine Parade organisiert. Ich stellte die Hexe aus<br />
dem Märchen Hänsel und Gretel dar. Es war ein heißer Tag und ich schwitzte unter<br />
meinem schwarzen Umhang. Auch meine zwei alten Schulfreundinnen Sibylle und Ewelyn<br />
saßen damals auf dem Wagen. Ich besuche die beiden, sie sind Töchter von Brigitte<br />
Wendel. Sibylle Wendel ist heute Übersetzerin, Ewi Wendel Pharmakologin. Beide können<br />
noch sehr gut deutsch, stelle ich fest. Ihren inzwischen erwachsenen Kindern haben sie<br />
ihre Muttersprache nicht beigebracht. Wir erinnern uns, dass wir als Kinder auch an<br />
Aufmärschen zu den Nationalfeiertagen teil nahmen. Auf der Veranda vor Sibylle Wendels<br />
Haus ist es kühl. Wir sitzen auf Schaukelstühlen und trinken frischen Zitronensaft.<br />
Rolandia 19
O-Ton 28 Sibylle Wendel Lg. 0:17<br />
Damals war hier ein Diktatur, und das ist ein Nationalfeiertag, der 7. September, da mussten wir, ich glaube<br />
eine Woche vorher, da mussten wir uns aufstellen, in so einer praça, so ein Platz, da war die brasilianische<br />
Flagge, und auch die Statue von <strong>Bremen</strong>, vom Roland.<br />
O-Ton 29 Ewelyn Wendel Lg. 1:09<br />
Wir mussten auf ein Feuer aufpassen. Und das war genau vor der Statue, vor der Roland-Statue. Dieses<br />
Feuer durfte nicht aus gehen, wir hatten eine Angst, dass das passieren könnte, wir mussten aufpassen, für<br />
ein oder zwei Stunden, dass eben das Feuer am Leben blieb, ne. Das war schwer, so lange stehen zu<br />
bleiben.Wir mussten jeden morgen stramm stehen, die brasilianische Hymne singen und die Flagge wurde<br />
aufgezogen. Ich erinnere, dass da irgendwelche Papiere geschmissen haben, auf der Straße lagen Papiere,<br />
so Anklebbilder, die man an die Fenster kleben konnte, und da haben wir welche aufgehoben, von<br />
irgendwelchen Politikern, da wollten wir die an die Fenster kleben, und meine Mutter sagte, nein, das wirst<br />
du niemals an meine Fenster kleben, in Wirklichkeit war das für uns eine Fest, wir fanden das schön und<br />
bunt, uns interessierte gar nicht, was da drauf stand, aber es war eben der Name von Politikern und meine<br />
Eltern haben wirklich nie gelassen, dass wir das an unsere Fenster kleben, nicht.<br />
O-Ton 30 Sibylle Wendel Lg. 0:46<br />
Vielleicht wollten sie uns einfach nicht sagen, was da los ist, aus der Angst, was da Schlimmeres passieren<br />
konnte, was ihnen damals passierte. Wir sind sehr beschützt aufgewachsen, nicht. Selbst von ihrer eigenen<br />
Geschichte wurde uns nicht viel erzählt. Meine Mutter hat vielleicht mal erzählt, ja der Opa, der war lange<br />
gefangen und so was, aber nie, dass es uns etwas Schreckliches war. Wir waren so beschützt. Und ich<br />
glaube mit 15, 16, als wir angefangen haben, Bücher zu lesen, dass wir dann angefangen haben zu fragen,<br />
und ihr, und wie war das bei Euch. Wir wussten, dass Oma und Opa alles verloren haben, als sie nach<br />
Brasilien gekommen sind, dann wieder zurück gegangen sind. Das war die Geschichte, die man zu Hause<br />
hörte.<br />
Schon unter dem 30. O-Ton Blende von Atmo 10 (auf einer Veranda) zu Lied 4 (Moderner<br />
Bossa). Diese Musik bleibt bis zum Ende des Features stehen<br />
Erzählerin<br />
Die Großeltern von Sibylle und Ewelyn Wendel, das Ehepaar Wasser, kehrte nach<br />
Deutschland zurück. Viele Jahre später zog es auch Eta Koch-Weser und seine Frau<br />
wieder in die Heimat. Sie leben heute in einer bequemen Wohnung im Zentrum von<br />
München. Nach dem Verkauf ihrer "Fazenda" fuhr das Ehepaar noch jahrelang regelmäßig<br />
zu Besuch nach <strong>Rolândia</strong>.<br />
O-Ton 31 Eta Koch-Weser Lg. 0:15<br />
Die in Roland, wenn man zu denen kam, sagten sie, ach, und was gibt es Neues in Deutschland und wenn<br />
wir zu erzählen begannen, was es Neues in Deutschland gab, dann kam furchtbar schnell, übrigens, bei uns<br />
jetzt voriges Jahr ist die Maisernte ganz furchtbar schlecht gewesen.<br />
Rolandia 20
Erzählerin<br />
Die meisten Verbindungen zwischen <strong>Rolândia</strong> und Deutschland, zwischen <strong>Rolândia</strong> und<br />
<strong>Bremen</strong>, sind heute abgebrochen. Die meisten Siedler aus den Anfangszeiten von<br />
<strong>Rolândia</strong> leben nicht mehr. Die Verwandlung einer ursprünglich deutsch geprägten<br />
Siedlung in einen ganz normalen Ort in der Provinz Brasiliens konnte Eta Koch-Weser<br />
schon vor 70 Jahren beobachten.<br />
O-Ton 32 Eta Koch-Weser Lg. 0:17<br />
Die Stadt war höchstens zu, ich glaube 25 ist zu hoch gegriffen, zu 20 Prozent lebten da Deutsche. Der Rest<br />
waren Japaner und Brasilianer eben. 1940 war es bestimmt weitgehend brasilianisch.<br />
Lied 4 (Moderner Bossa) kurz hochziehen, schön wäre hier, eine rhythmische Passage<br />
des Liedes hochkommen zu lassen<br />
Erzählerin<br />
Doch immer noch gibt es in <strong>Rolândia</strong> ein deutsches Honorarkonsulat, das allerdings kaum<br />
mehr jemand aufsucht. Sibylle Wendel war dort für ein paar Jahre angestellt.<br />
O-Ton 33 Sibylle Wendel Lg. 0´47<br />
<strong>Rolândia</strong> hat die Geschichte nicht kultiviert, oder, ich meine, die Deutschen haben die Stadt zwar aufgebaut,<br />
aber viele Deutsche haben aufgehört, darüber zu erzählen, und die weiteren Generationen wollten nicht<br />
mehr deutsch sprechen, die wollten von der Geschichte nichts hören. Als ich auf dem Konsulat gearbeitet<br />
habe, da kamen dann mehrere Leute zu uns und sagten, wir brauchen Material über die Gründung von<br />
<strong>Rolândia</strong>. Niemand hatte was. Die Schulen hatten wenig, die Bibliothek hatte wenig, selbst das Konsulat<br />
hatte wenig, es gibt noch ganz wenig Material dadrüber, geschriebenes Material. Es fängt an, dass ein<br />
bisschen drüber geschrieben wird. Aber als wir in der Schule waren, vor 30 Jahren, 35 Jahren, gab es<br />
darüber noch kaum was.<br />
Musik wieder hochziehen, ein paar Sekunden stehen lassen<br />
Erzählerin<br />
Viele Bremer Kaufleute hatten große Hoffnungen auf <strong>Rolândia</strong> gesetzt. Hoffnungen, die<br />
sich nach dem Ende des Kaffeebooms in den 70er Jahren zerschlagen haben. Den Verein<br />
„Bremer Freunde von <strong>Rolândia</strong>“ gibt es längst nicht mehr. Die allerwichtigste Hoffnung<br />
konnte <strong>Rolândia</strong>, die provinzielle Kleinstadt im Süden Brasiliens, vor über 70 Jahren<br />
allerdings erfüllen: Sie bot jüdischen Flüchtlingen ein neues zu Hause.<br />
Musik wieder hochziehen, ein paar Sekunden stehen lassen<br />
Rolandia 21
Erzählerin<br />
Unberührt von allen Veränderungen steht die Rolandstatue an der Einfahrts- und<br />
Ausfahrtstraße nach <strong>Rolândia</strong>. Sie widersteht den Autoabgasen und dem roten Staub der<br />
Region. Viele Menschen halten den Roland für einen Heiligen, einen „Santo“, sagt Eta<br />
Koch-Weser. Nicht mal er, der Sohn des Stadtgründers, kann sich erinnern, warum die<br />
Statue einst von Bremer Kaufleuten an die Stadt <strong>Rolândia</strong> gespendet wurde:<br />
O-Ton 34 Eta Koch-Weser Lg. 0:44<br />
Wie die Idee, kann ich gar nicht mehr sagen. Irgendwie wurden da Kontakte geknüpft und da kamen die<br />
Bremer auf die Idee, sie wollten uns einen Roland spenden. Und schickten dann den eben rüber.<br />
Ein großes Fest, da war der Senator für Außenhandel aus <strong>Bremen</strong>, Herr, hieß der Helmken, war drüben und<br />
so weiter und so. Drei Tage wurde gefeiert, und so weiter. Ansprachen. Und dann stand er da eben. Für die<br />
Brasilianer war es ein Santo, ja ein bisschen ja, man stellte eben einen Santo auf den Marktplatz.<br />
Lied 4 hoch, klingt aus (darauf kann die Absage laufen).<br />
Musiken:<br />
Lied 1: romatischer Bolero, mit langen Instrumentalpassagen, alte Aufnahme<br />
Titel: "Risque", Sängerin ist Angela Maria, auf einer CD von EMI, Aufnahmen von 1958.<br />
Die LC Nummer ist: 5201642.<br />
Lied 2: ein sehnsuchtsvoller Bossa, mit Klavierbegleitung, Bossa-Rhythmus<br />
Titel: „Longe dos Olhos“, von Nana Caymmi (LC Nummer fehlt noch)<br />
Lied 3: Flöten-Gitarrenmusik, rein instrumental, Titel: „Meia Noite na Floresta“ und „Uru“,<br />
von Celdo Braga, von der CD Imbaúba, Verlag Mãe da Terra, 2008 Manaus<br />
Lied 4: Moderner Bossa, mit Bläserintro<br />
Titel: „Aquele Frevo Axé“, Sängerin ist Gal Costa, auf einer Putumayo CD von 2005, die<br />
LC Nummer ist: PUT 234-2.<br />
Rolandia 22


![Rolândia [PDF, 124 Kb] - Radio Bremen](https://img.yumpu.com/10687317/1/500x640/rolandia-pdf-124-kb-radio-bremen.jpg)



![4. Oktober 2013 [PDF, 10 Kb] - Radio Bremen](https://img.yumpu.com/25643499/1/184x260/4-oktober-2013-pdf-10-kb-radio-bremen.jpg?quality=85)



![22.4. bis 28.4.2013 [PDF, 66 Kb] - Radio Bremen](https://img.yumpu.com/25643473/1/184x260/224-bis-2842013-pdf-66-kb-radio-bremen.jpg?quality=85)
![19.8.2013 bis 25.8.2013 Nordwestradio [PDF, 85 Kb] - Radio Bremen](https://img.yumpu.com/25643471/1/184x260/1982013-bis-2582013-nordwestradio-pdf-85-kb-radio-bremen.jpg?quality=85)
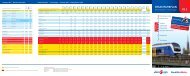

![Drehplan Juli [PDF, 247 Kb] - Radio Bremen](https://img.yumpu.com/25643452/1/190x135/drehplan-juli-pdf-247-kb-radio-bremen.jpg?quality=85)