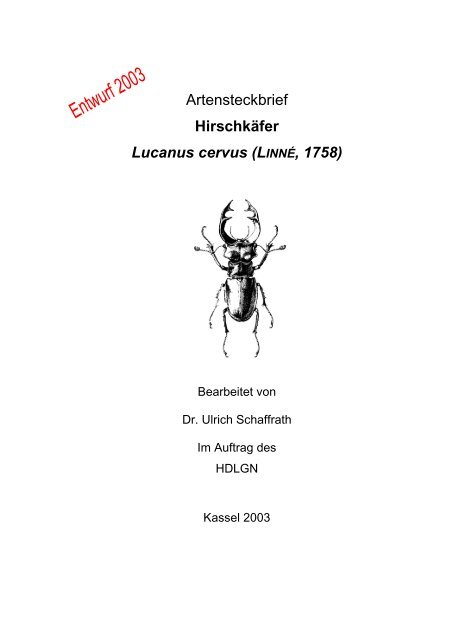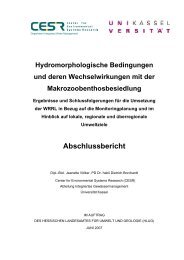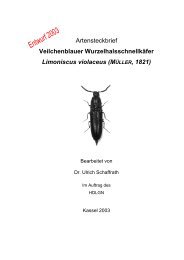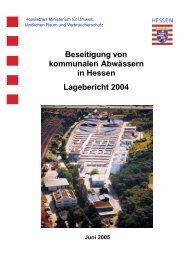Steckbrief - MULV Hessen
Steckbrief - MULV Hessen
Steckbrief - MULV Hessen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Artensteckbrief<br />
Hirschkäfer<br />
Lucanus cervus (LINNÉ, 1758)<br />
Bearbeitet von<br />
Dr. Ulrich Schaffrath<br />
Im Auftrag des<br />
HDLGN<br />
Kassel 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 1<br />
Bildseite<br />
Abb. 1: Lucanus cervus (LINNE, 1758), w Abb. 2: Lucanus cervus (LINNE, 1758), m<br />
Abb. 3: Von Wildschweinen ausgewühlter Eichenstubben,<br />
TK 5917, Kelsterbacher Wald<br />
Abb. 4: Lückige Stieleichenbestände auf Sandböden,<br />
bevorzugter Lebensraum des Hirschkäfers,<br />
Kelsterbacher Wald TK 5917<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 2<br />
Artensteckbrief Hirschkäfer (Lucanus cervus, (Linné)<br />
1. Allgemeines<br />
Name (deutsch): Hirschkäfer, Feuerschröter<br />
Name (wissenschaftlich): Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758)<br />
Synonym: in älterer Literatur wird der Käfer manchmal der Gattung Platycerus (O. F.<br />
MÜLLER) zugeordnet.<br />
Systematische Einordnung<br />
Stamm: Arthropoda, Gliederfüßler<br />
Klasse: Insecta, Insekten<br />
Unterklasse: Pterygota, geflügelte Insekten<br />
Ordnung: Coleoptera, Käfer<br />
Überfamilie: Lucanoidea, Hirschkäferartige (bisweilen auch unter Scarabaeoidea,<br />
Blatthornkäfer, eingeordnet)<br />
Familie: Lucanidae, Hirschkäfer<br />
Gattung: Lucanus SCOPOLI, 1763<br />
Der Hirschkäfer gehört zu den populärsten Käferarten in Deutschland. Seine Beliebtheit bei<br />
den Sammlern im letzten und vorletzten Jahrhundert machten ihn bereits in den 1930er<br />
Jahren zu einem der ersten Zielobjekte im Naturschutz in Deutschland. Das Seltenwerden<br />
der Art hatte jedoch offensichtlich nichts mit dem Sammeln einiger dieser imposanten<br />
Großinsekten zu tun. Vielmehr entzog die Intensivierung der Waldwirtschaft, vor allem der<br />
Gedanke der Forsthygiene, das „Aufräumen“ der Wälder dem Käfer die notwendigen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten. Seit einigen Jahren scheinen sich die Bestände der Art wieder<br />
zu erholen, was einerseits zwar auf Fördermaßnahmen zurückzuführen ist. Andererseits<br />
resultiert diese Erholung aus einem vermehrten Nahrungsangebot durch Kalamitäten wie<br />
Windwurf in Eichenbeständen oder das flächige Kümmern und Absterben alter Eichenwälder<br />
aufgrund der Veränderung der hydrologischen Verhältnisse und anderer<br />
Umweltschädigungen gerade im südhessischen Hauptverbreitungsgebiet des Käfers.<br />
2. Biologie und Ökologie<br />
Die Larven des Hirschkäfers entwickeln sich üblicherweise unter der Erdoberfläche in<br />
vermorschten Wurzelstöcken oder unter herabgefallenen Starkästen im Bodenschluß,<br />
daneben auch an alten Weidepfählen oder holzreichen Komposthaufen (PFAFF 1989), aber<br />
nicht in hohlen, morschen Stämmen (solche Angaben lassen auf Osmoderma- oder<br />
Protaetia-Larven schließen). Als Nahrung wird in Mitteleuropa insbesondere Eichenholz<br />
(Quercus) gerne und vorwiegend angenommen (sowohl Traubeneiche als auch Stieleiche),<br />
jedoch wurden viele weitere Baumarten als Brutholz festgestellt: Neben Laubbäumen wie<br />
Buche (Fagus), Hainbuche (Carpinus), Walnuß (Juglans), Weide (Salix), Linde (Tilia), Esche<br />
(Fraxinus), Birke (Betula), Ahorn (Acer), Ulme (Ulmus), Roßkastanie (Aesculus), Erle<br />
(Alnus), Apfel (Malus), Birne (Pyrus), Kirsche (Cerasus), Pflaume (Prunus) werden auch<br />
Nadelbäume wie Fichte (Picea) und Kiefer (Pinus) als Nahrungspflanzen genannt, jedoch<br />
haben alle diese im Vergleich mit Eichen nur eine untergeordnete Bedeutung. Das Alter der<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 3<br />
Bäume spielt dabei keine Rolle, doch bieten voluminöse Stubben etc. den Larven<br />
natürlicherweise günstigere Bedingungen als Schwachholz. Mit zunehmender Alterung und<br />
dem Verfall des toten Holzes wird dieses nicht mehr angenommen.<br />
Die Entwicklungsdauer vom Ei zum Käfer beträgt in Mitteleuropa (je nach Bedingungen im<br />
Entwicklungshabitat) um ca. 6 Jahre, im Süden (auch <strong>Hessen</strong>s) ist sie wahrscheinlich kürzer.<br />
Es werden drei Larvenstadien durchlaufen. Im Sommer, bevor der Käfer erscheint, erfolgt die<br />
Verpuppung in einem innen geglätteten Kokon in der Erde. Das im Herbst bereits fertig<br />
ausgebildete Insekt liegt in dieser Puppenwiege bis zum kommenden Frühsommer.<br />
Wie für viele andere Holzinsekten scheint auch der Einfluß der Sonne auf das Habitat von<br />
großer Bedeutung zu sein, da die Tiere vor allem solche Bruthabitate beziehen, die eine<br />
sonnenexponierte Lage aufweisen. Sie beziehen daher offenbar lieber einen einzeln<br />
stehenden Eichenpfosten als einen alten Eichenstumpf im Bestand.<br />
Für die Entwicklung der Larven kommen außerdem die Stümpfe von im Winter<br />
abgetriebenen Eichen für längere Zeit nicht in Frage, da der hohe Eichengerbsäuregehalt,<br />
der die Stöcke in dieser Jahreszeit auszeichnet, diese vor Angriffen durch Pilze und damit<br />
vor Fäulnis schützt. Dies hindert aber auch die Käfer an der Besiedlung dieses Habitats (vgl.<br />
TOCHTERMANN 1992).<br />
Die Käfer erscheinen etwa ab Mitte Juni, im Süden <strong>Hessen</strong>s früher (oft schon ab Mai).<br />
Besonders an warmen, schwülen Abenden fliegen sie die Nahrungsbäume, meist "blutende",<br />
saftende Eichen an. Hier finden sich auch die Paare, oft kommt es unter den Männchen zum<br />
Kampf um die Weibchen. Die Lebensdauer der Imagines soll nach KLAUSNITZER (1982) vier<br />
Wochen kaum überschreiten, die Hauptflugzeit liegt also zwischen Mitte Juni (teils Mai) und<br />
Mitte Juli. Demnach sterben die Weibchen kurz nach der Eiablage, die Männchen etwa 8-12<br />
Tage später. In der Praxis finden sich jedoch mit fortschreitendem Sommer mehr (tote)<br />
Weibchen im Gelände als Männchen.<br />
Das Geschlechterverhältnis scheint beim Hirschkäfer deutlich auf Seiten der Männchen zu<br />
liegen, die in der Regel vier- bis sechsmal häufiger angetroffen werden als Weibchen<br />
(KLAUSNITZER 1982), jedoch widerspricht dem TOCHTERMANN (1992) maßgeblich, der ein<br />
Verhältnis von 3 Männchen zu 2 Weibchen angibt.<br />
Bei KLAUSNITZER (1982) findet sich der Hinweis auf sogenannte Rammelbäume, an denen -<br />
bei starken Vorkommen der Art - viele Individuen (bis 100) zusammenkommen, meist an<br />
einer Saftleckstelle.<br />
3. Erfassungsverfahren<br />
Die Erfassung erfolgt während der Hauptflugzeiten der Art. Da der große Käfer für viele<br />
Insektenfresser besonders unter den Vögeln (Baumfalke, Krähenvögel, Eulen) eine attraktive<br />
Beute darstellt, sind in zahlenstarken Hirschkäferquartieren stets die Reste der Käfer-<br />
Imagines aufzufinden. Diese werden meist an exponierten Plätzen getötet und verzehrt,<br />
wobei alle Teile außer dem weichen Hinterleib übrigbleiben. Diese Reste sind durch Suche<br />
an entsprechenden Stellen im Gelände leicht auffindbar und erlauben einen Rückschluß auf<br />
die Stärke der Population. Die Anzahl der pro Jahr auftretenden Imagines ist jedoch mehr<br />
oder weniger starken Schwankungen unterworfen ist, so daß von den Ergebnissen eines<br />
Jahres nicht auf den Gesamtzustand der Population geschlossen werden kann. Diese<br />
Schwankungen können wie bei Maikäfern („Maikäferjahre“) bisweilen erheblich sein.<br />
Auch Sichtbeobachtungen lebender Tiere sind möglich, vor allem, wenn blutende Bäume im<br />
Gelände zu finden sind, an denen sich die Saftlecker vor allem abends einfinden, fressen<br />
und sich paaren.<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 4<br />
Sind Wildschweine im Gebiet, weisen vielfach ausgewühlte Eichenstubben auf die<br />
Anwesenheit von Hirschkäferlarven hin, die sich von morschem Holz im Bodenschluß<br />
ernähren. Gerade in Gebieten, in denen die Eiche (Hauptvorkommen) dominiert, und<br />
insbesondere, wenn es sich um leichte, sandige Böden handelt, erlauben derartige Befunde<br />
ganzjährig Rückschlüsse auf die Anwesenheit der Art, auch wenn ein direkter Nachweis des<br />
Insekts nicht zu führen ist.<br />
In Gebieten, in denen der Hirschkäfer eher selten ist, führen die dargestellten Methoden<br />
nicht in jedem Fall zum Erfolg. In diesen Fällen kann mit Lockstoffen gearbeitet werden, die<br />
die Käfer anziehen sollen. Bewährt haben sich eine Mischung aus Alkohol, Essigsäure,<br />
Glycerin und Wasser (in Tötungsfallen) oder aber gärende Kirschen, durch die jedoch jeweils<br />
nur die männlichen Käfer nachzuweisen sind.<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 5<br />
4. Allgemeine Verbreitung<br />
Karte 1:<br />
Der Hirschkäfer ist in mehreren Rassen über fast ganz Europa mit Ausnahme<br />
Nordskandinaviens und des äußersten Südens verbreitet. Sein Verbreitungsgebiet reicht bis<br />
nach Mittelasien und entspricht auffälligerweise dem der Eichen (Quercus ssp.). In<br />
Deutschland ist ein deutliches Gefälle von Süden nach Norden festzustellen, wo er<br />
zunehmend seltener wird oder gebietsweise bereits ganz fehlt (Schleswig-Holstein).<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 6<br />
5. Bestandssituation in <strong>Hessen</strong><br />
Karte 2:<br />
Die genaue Anzahl verschiedener Hirschkäfervorkommen in <strong>Hessen</strong> bzw. den<br />
Naturräumlichen Einheiten zu benennen, ist nicht möglich, da die Isolierung der<br />
Teilpopulationen in vielen Fällen unscharf ist. Es wird daher die Anzahl der verschiedenen,<br />
die Einheit betreffenden Meßtischblätter angegeben, von denen Funde vorliegen. Dabei<br />
können Vorkommen in einer Naturräumlichen Einheit in der Natur einer Population<br />
angehören, die schon in einer benachbarten gezählt wurde. Insgesamt sind 87<br />
Meßtischblätter mit aktuellen Funden bekannt, die 102 sich aus der angebotenen Tabelle<br />
ergebenden Belegungen enthalten demnach 15 Doppelnennungen.<br />
Im Süden <strong>Hessen</strong>s findet der Käfer weit günstigere klimatische Bedingungen vor als im<br />
Norden, so daß er hier regelmäßig und mancherorts in großer Zahl gefunden wird, was die<br />
Kartendarstellung nach Meßtischblättern nicht darstellen kann.<br />
Schaffrath, 2003
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 7<br />
Tabelle 1:<br />
Anzahl Hirschkäfervorkommen in den Naturräumlichen Einheiten<br />
Naturräumliche Haupteinheit Anzahl bekannter Vorkommen (seit 1980)<br />
D18 Thüringer Becken und Randplatten -<br />
D36 Weser- u. Weser-Leine-Bergland<br />
(Niedersächsisches Bergland)<br />
D38 Bergisches Land, Sauerland 2<br />
D39 Westerwald 8<br />
D40 Lahntal und Limburger Becken -<br />
D41 Taunus 15<br />
D44 Mittelrheingebiet (mit Siebengebirge) -<br />
D46 Westhessisches Bergland 24<br />
D47 Osthessisches Bergland 12<br />
D53 Oberrheinisches Tiefland 28<br />
D55 Odenwald, Spessart u. Südrhön 9<br />
6. Gefährdungsfaktoren und -ursachen<br />
Der Hirschkäfer gilt in Deutschland als stark gefährdete Art (RLD 2, 1998). Auch auf den<br />
bisher bearbeiteten Roten Listen der Länder wird die Art entsprechend geführt (BY; BB; MV;<br />
ST; TH), in Berlin dagegen ist die Art vom Aussterben bedroht (RL BE 1) und in Schleswig-<br />
Holstein ist er bereits ausgestorben (RL SH 0). In <strong>Hessen</strong> ist der Hirschkäfer als gefährdete<br />
Art eingestuft (RL HE 3, SCHAFFRATH 2003).<br />
Natürliche Feinde sind verschiedene Säuger (Marder, Dachs, Waschbär etc.), vor allem aber<br />
Wildschweine, die den Larven nachstellen. Die Käfer werden oft von Vögeln (Falken,<br />
Rabenvögeln, Eulen, Spechten) erbeutet. Eine Gefährdung der Art wird stets in<br />
Zusammenhang gesehen mit der Vernichtung geeigneter Bruthabitate. Größten Anteil hat<br />
daran die Forstwirtschaft: Tiefe Bodenbearbeitung, besonders aber das Roden der Stubben,<br />
an denen die Larven über mehrere Jahre leben müssen, vernichten Habitate und Brut. Auch<br />
der Einschlag der Eichen im Winter ist für den Käfer ungünstig, da der hohe Gerbstoffanteil<br />
in dieser Jahreszeit den verbleibenden Stumpf als Nahrung für die Larven beeinträchtigt<br />
bzw. unbrauchbar macht (wie lange?; vgl. TOCHTERMANN 1992). Die einseitige Aufforstung<br />
mit Nadelhölzern, die lange Zeit propagiert und betrieben wurde, ist ebenfalls ursächlich für<br />
den Rückgang verantwortlich zu machen ebenso wie die Forsthygiene, die Beseitigung alter<br />
anbrüchiger und abgängiger Bäume.<br />
Einige der für den Rückgang der Art zu vermutenden Ursachen sind heute auch bei den<br />
Verantwortlichen im Forst bekannt. Nicht mehr alle dargelegten Beeinträchtigungen sind<br />
daher heute noch ganz aktuell, denn vermehrt verbleiben Stubben und Starkäste im Gebiet,<br />
so daß der Käfer in letzter Zeit wieder häufiger zu werden scheint. Allerdings könnte eine<br />
rein gewinnorientierte Waldwirtschaft diese Entwicklung mancherorts hemmen oder ins<br />
Gegenteil verkehren.<br />
Käferfang durch Sammler spielt für den Bestand der Art keine Rolle.<br />
Schaffrath, 2003<br />
4
Lucanus cervus (LINNE, 1758) 8<br />
7. Grundsätze für Erhaltung- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Der Hirschkäfer gehörte nach KLAUSNITZER (1982) in Deutschland seit 1936 zu den<br />
geschützten Arten (Reichsnaturschutzgesetz, 26.6.1935). In der ehemaligen DDR war er<br />
durch das "Landeskulturgesetz" seit dem 14.5.1970 geschützt. In "Erste<br />
Durchführungsbestimmung zur Naturschutzverordnung" vom 1.10.1984, Anlage 2,<br />
Geschützte Tierarten wird er zusammen mit dem Heldbock unter Abschnitt b: "geschützte<br />
bestandsgefährdete Tierarten" genannt. In der BRD ist der Heldbock seit dem 18.9.1989<br />
durch die Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) geschützt. Auch im Washingtoner<br />
Artenschutzübereinkommen wird er in Anhang II (streng geschützte Tierarten) genannt.<br />
Der Käfer ist in <strong>Hessen</strong> noch weit verbreitet. In den Gebieten seines Vorkommens sollten<br />
auch kränkelnde Bäume und möglichst viel Totholz in Form von Stubben und Starkästen im<br />
Gebiet verbleiben, vor allem aber sollte darauf geachtet werden, daß stets genügend<br />
Brutquartiere (Totholzangebot) im Gebiet verbleiben und Nahrungspflanzen (Hauptbaum:<br />
Eiche) nachwachsen. Falls Eichen eingeschlagen werden, sollte dies aus den oben<br />
genannten Gründen nicht im Winter erfolgen. Freßfeinde (Wildschweine) sollten evtl.<br />
dezimiert werden.<br />
Schaffrath, 2003