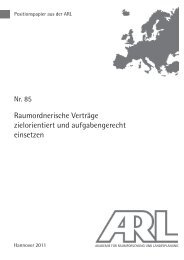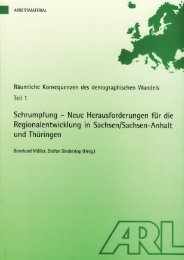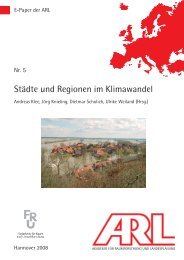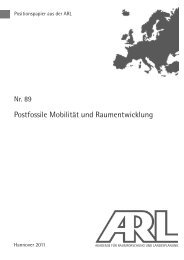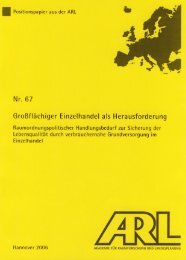Download - Publikationen - ARL
Download - Publikationen - ARL
Download - Publikationen - ARL
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AKADEMIE<br />
FÜR RAUMFORSCHUNG<br />
UND LANDESPLANUNG<br />
LEIBNIZ-FORUM FÜR RAUMWISSENSCHAFTEN<br />
NACHRICHTEN<br />
Die Geschichte der Akademie – ein dunkles Kapitel?<br />
Infrastrukturgroßprojekte: Akzeptanz durch<br />
Raumplanung<br />
Demografischer Wandel in Mitteldeutschland<br />
Planen wir zeitgemäß?<br />
Raumordnung: Normierung oder informelle<br />
Raumentwicklung?<br />
Neues Leitbild der <strong>ARL</strong><br />
Neuerscheinungen<br />
www.arl-net.de<br />
32012 42. Jahrgang
Zur Diskussion<br />
■ Die Geschichte der Akademie – ein dunkles<br />
Kapitel? 1<br />
<strong>ARL</strong>-Forschung<br />
■ Windenergie, aber wo? 4<br />
■ Neues aus der bayerischen Landesplanung 5<br />
■ Demografischer Wandel in Mitteldeutschland 6<br />
■ IIK Regionalplanung legt neue Arbeitshilfen<br />
für die Planungspraxis vor 10<br />
■ Leibniz-Forschungsverbund „Biodiversität“<br />
eingerichtet – Die <strong>ARL</strong> ist mit an Bord 12<br />
<strong>ARL</strong>-Veranstaltungen<br />
■ Infrastrukturgroßprojekte: Akzeptanz durch<br />
Raumplanung<br />
<strong>ARL</strong>-Kongress im Juni 2012 in Leipzig 13<br />
■ Planen wir zeitgemäß?<br />
Jahrestagung des Jungen Forums der <strong>ARL</strong> 18<br />
■ TEMPUS-Projekt RUDECO auf der Zielgeraden 20<br />
■ Raumordnung: Normierung oder informelle<br />
Raumentwicklung? 22<br />
■ Call for Papers für den <strong>ARL</strong>-Kongress 2013<br />
„Regionale Stadtlandschaften“ 23<br />
■ International Summer School 2013<br />
Sustainable Governance of Land and Water 24<br />
<strong>ARL</strong>-Neuerscheinungen 26<br />
<strong>ARL</strong>-Intern<br />
■ Neues Leitbild der <strong>ARL</strong> beschlossen 28<br />
■ Wenn Politik auf Wissenschaft trifft 29<br />
■ Personalien 30<br />
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Zeitschriftenschau 31<br />
Netzwerk 5R<br />
■ Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland 35<br />
■ Armut und soziale Ausgrenzung 35<br />
■ Web-Relaunch des ILS 35<br />
Raumforschung/-entwicklungspolitik<br />
■ 50 Jahre Internationales Planertreffen 36<br />
■ Nachhaltiges Flächenmanagement –<br />
Flächensparen, aber wie? 38<br />
■ Hier war Goethe (nie)<br />
Stadtbaukultur in Weimar und Shanghai 39<br />
■ AESOP Doktorandenworkshop in Izmir 40<br />
■ Otto-Borst-Preis 2013 41<br />
■ Neue Veröffentlichungen aus anderen<br />
Verlagen 42<br />
■ Veranstaltungshinweise 46<br />
FRU<br />
■ Werner-Ernst-Preis 2012<br />
Umgang mit „Wutbürgern“ 48<br />
■ Werner-Ernst-Preis 2013 – Ausschreibung<br />
Regionale Stadtlandschaften 49<br />
■ FRU – Infobörse 51<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 I
II<br />
Kurzprofil / impressum<br />
Impressum<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Über die <strong>ARL</strong><br />
Die Akademie für Raumforschung und Landesplanung (<strong>ARL</strong>) untersucht<br />
die Wirkung menschlichen Handelns auf den Raum und analysiert die<br />
Möglichkeiten einer nachhaltigen Raumentwicklung. Dies geschieht<br />
auf den Feldern Wirtschaft, Soziales, Ökologie und Kultur.<br />
Die <strong>ARL</strong> ist das zentrale, disziplinübergreifende Netzwerk von Expertinnen<br />
und Experten, die in der Raumforschung und Raumplanung<br />
arbeiten. Damit bietet sie die ideale Plattform für den raumwissenschaftlichen<br />
und raumpolitischen Diskurs. Forschungsgegenstand<br />
sind räumliche Ordnung und Entwicklung in Deutschland und Europa.<br />
Die Akademie ist eine selbstständige und unabhängige raumwissenschaftliche<br />
Einrichtung öffentlichen Rechts von überregionaler<br />
Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse.<br />
Sie wird gemeinsam von Bund und Ländern finanziert und gehört der<br />
Leibniz-Gemeinschaft an.<br />
Sie vereint Fachleute aus Wissenschaft und Praxis in ihrem Netzwerk.<br />
Dadurch können Grundlagenforschung und Anwendung eine direkte<br />
Verbindung eingehen – eine wichtige Voraussetzung für eine fundierte<br />
Beratung von Politik und Gesellschaft.<br />
Dank ihrer Netzwerkstruktur und der Arbeitsweise in fachübergreifenden<br />
Gruppen ermöglicht die <strong>ARL</strong> den effizienten Informations- und<br />
Erfahrungsaustausch zwischen allen Akteuren. So sind erfolgreiche<br />
Kommunikation und Wissenstransfer auf allen Ebenen gewährleistet.<br />
Auf der Basis des personellen Netzwerks fungiert die <strong>ARL</strong> als Mittlerin<br />
zwischen Wissenschaft, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit.<br />
Nähere Informationen über die <strong>ARL</strong> finden Sie unter www.arl-net.de.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (<strong>ARL</strong> ® )<br />
Leibniz-Forum für Raumwissenschaften<br />
Hohenzollernstraße 11, 30161 Hannover<br />
Tel.: +49 511 34842-0, Fax: +49 511 34842-41, arl@arl-net.de<br />
Redaktion (V.i.S.d.P.): Michaela Gräfin von Bullion<br />
Tel.: +49 511 34842-56, bullion@arl-net.de<br />
Schlussredaktion: Cornelia Maria Hein<br />
Satz und Layout: Oliver Rose<br />
www.arl-net.de<br />
Druck: BenatzkyMünstermann Druck GmbH, 30559 Hannover<br />
Die Nachrichten der <strong>ARL</strong> erscheinen viermal im Jahr.<br />
Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.<br />
Heft 3, September 2012, 42. Jahrgang<br />
Auflage: 1850<br />
ISSN 1612-3891 (Printausgabe)<br />
ISSN 1612-3905 (Internetausgabe)
Die Geschichte der Akademie –<br />
ein dunkles Kapitel?<br />
Hans Heinrich Blotevogel, Andreas Stefansky<br />
„In Wahrheit haben weder Raumordnung noch Raumforschung<br />
… mit dem Nationalsozialismus auch nur das<br />
geringste zu tun“. Mit diesem Zitat schließt das Kapitel<br />
„Nach 1945: Freispruch für die NS-Planer“ des Katalogs<br />
zur Ausstellung „Wissenschaft – Planung – Vertreibung.<br />
Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten“ der Deutschen<br />
Forschungsgemeinschaft (DFG 2006: 36). Die viel<br />
beachtete und inzwischen auch in Polen gezeigte Ausstellung<br />
befasst sich mit den Vorbereitungen deutscher<br />
Raumwissenschaftler und Raumplaner für die „völkische<br />
Neuordnung Europas“ (ebd.: 6). Die DFG förderte in der<br />
Zeit zwischen 1934 und 1945 zahlreiche Forschungsvorhaben,<br />
die der Expansionspolitik des nationalsozialistischen<br />
Regimes dienten (DFG 2006: 13). Das eingangs angeführte<br />
Zitat entstammt übrigens der Festschrift „Raumforschung<br />
– 25 Jahre Raumforschung in Deutschland“ der <strong>ARL</strong> von<br />
1960 (<strong>ARL</strong> 1960: 3).<br />
Es war nicht zuletzt die Ausstellung der DFG, die der<br />
Akademie einen Anstoß gab, sich mit der eigenen Geschichte<br />
zu beschäftigen. Dieser Artikel soll einen kurzen<br />
Überblick über die bisherigen Aktivitäten sowie einen<br />
Ausblick auf die anstehenden Arbeiten geben.<br />
Zu den Hintergründen: Anfänge der Akademie<br />
Auf ihrer Homepage verweist die <strong>ARL</strong> darauf, dass sie<br />
1946 gegründet wurde. Aber bereits im Jahr 1960 wurde<br />
das 25-jährige Bestehen nicht nur der Raumforschung in<br />
Hannover gefeiert: „Die akademische Institution der deutschen<br />
Raumforschung – die Akademie für Raumforschung<br />
und Landesplanung – feiert ihren 25. Geburtstag“ […]. 1<br />
Ohne Wenn und Aber wird die Akademie von Heinrich<br />
Hunke, von 1949 bis 1954 Generalsekretär und von 1960<br />
bis 1964 Vizepräsident der <strong>ARL</strong>, als „Rechtsnachfolgerin<br />
der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung“<br />
(<strong>ARL</strong> 1961: 10) bezeichnet. Ein (selbst)kritisches Wort zur<br />
politischen Ausrichtung der Reichsarbeitsgemeinschaft<br />
für Raumforschung (RAG) unterblieb ebenso wie zu den<br />
nationalsozialistischen Verstrickungen von Akademiemitgliedern,<br />
von denen viele der RAG angehört hatten und<br />
einige an den Arbeiten zum „Generalplan Ost“ beteiligt<br />
gewesen waren.<br />
Die RAG wurde 1935 gegründet und sollte das wissenschaftliche<br />
Fundament für die im selben Jahr begründete<br />
staatliche Raumordnungspolitik des NS-Staates liefern<br />
1 Eröffnungsworte zur Festsitzung anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von<br />
Raumforschung (und <strong>ARL</strong>) des damaligen Vizepräsidenten der Akademie,<br />
Ministerialdirigent Prof. Dr. H. Hunke (vgl. <strong>ARL</strong> 1961: 9).<br />
Zur Diskussion<br />
Konrad Meyer (r.), der den Aufbau Ost vorstellt<br />
(vgl. Blotevogel 2011: 103). Der erste Leiter (Obmann)<br />
der RAG war Prof. Dr. Konrad Meyer, der ab 1936 auch<br />
die Zeitschrift „Raumforschung und Raumordnung“ herausgab.<br />
Meyer war „die Schlüsselfigur der deutschen<br />
Ostraum- und Germanisierungsplanungen“ und wurde<br />
„im Oktober 1939 zum Chef-Umsiedlungsplaner“ (DFG<br />
2006: 17) berufen. Aus der RAG gingen nach Ende des<br />
Zweiten Weltkrieges die Akademie für Raumforschung<br />
und Landesplanung sowie das Institut für Raumforschung<br />
(IfR) in Bad Godesberg – ein Vorläuferinstitut des BBR in<br />
Bonn – hervor. Konrad Meyer gehörte nicht nur als Ordentliches<br />
Mitglied der Akademie an, sondern war auch<br />
Mitglied im wissenschaftlichen Rat des IfR (DFG 2006:<br />
34; Leendertz 2008: 219 ff.).<br />
Bisherige Behandlung der eigenen<br />
Geschichte<br />
Quelle: Bundesarchiv<br />
An der zuvor erwähnten Ausstellung „Wissenschaft –<br />
Planung – Vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten“<br />
der DFG war die Akademie nicht aktiv<br />
beteiligt; sie war vielmehr (überwiegend in Form ihrer<br />
Vorgängereinrichtung RAG) ein Objekt der Betrachtung.<br />
Eigene Aktivitäten im Hinblick auf eine kritische<br />
Aufarbeitung der eigenen Geschichte entwickelte die<br />
Akademie erst spät. 2 Begründet durch die gemeinsame<br />
Vorgeschichte, führten die <strong>ARL</strong> und das BBR im Juni<br />
2008 eine zweitägige Veranstaltung zur Geschichte von<br />
2 Nachdem die <strong>ARL</strong> noch 1971 Konrad Meyer die Gelegenheit zu einer<br />
geradezu peinlichen Rechtfertigung der RAG gegeben hatte (Meyer 1971),<br />
erfolgten mit der Veröffentlichung von Waldhoff et al. (1994) und Venhoff<br />
(2000) erste Ansätze zu einer kritischen Aufarbeitung der Raumordnungsgeschichte.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 1
2<br />
Zur Diskussion<br />
Raumforschung und Raumplanung im Übergang vom NS-<br />
Staat zur jungen Bundesrepublik durch, die anschließend<br />
dokumentiert wurde: „Die Veröffentlichung ist seitens der<br />
<strong>ARL</strong> und des BBR ein erster gemeinsamer Schritt zur Aufarbeitung<br />
der aus dem NS-Regime heraus bestehenden<br />
Kontinuitäten personeller, institutioneller und konzeptioneller<br />
Art“. 3 Bei der Tagung (und in der Veröffentlichung)<br />
wurden einzelne Personen der Raumplanung bzw. Raumwissenschaft<br />
betrachtet, die beispielhaft für die personelle<br />
Kontinuität stehen; aber auch institutionelle Netzwerke<br />
sowie aus der NS-Zeit stammende und in die Nachkriegszeit<br />
weitergetragene Konzepte der Raumordnung waren<br />
Gegenstand der Betrachtung. Eine umfassende kritische<br />
Aufarbeitung der Institutionengeschichte der Akademie<br />
konnte damit allerdings nicht geleistet werden.<br />
Eine detaillierte ideengeschichtliche Darstellung der<br />
Geschichte der Raumordnung – ausgehend von den<br />
1880er Jahren bis in die 1980er Jahre – legte Ariane Leendertz<br />
mit ihrer Dissertation „Ordnung schaffen. Deutsche<br />
Raumplanung im 20. Jahrhundert“ 2008 vor. In diesem<br />
Rahmen wurden auch wichtige historische Stationen der<br />
RAG wie auch der <strong>ARL</strong> behandelt sowie die für beide<br />
Einrichtungen herausragenden Personen, wie z.B. Konrad<br />
Meyer und Kurt Brüning, und deren Bedeutung für die<br />
Raumwissenschaft kritisch gewürdigt.<br />
Für den Übergang von der RAG zur <strong>ARL</strong> und die Entwicklung<br />
der <strong>ARL</strong> in der frühen Nachkriegszeit kommt Kurt<br />
Brüning eine Schlüsselrolle zu. Auf Initiative des damaligen<br />
Vizepräsidenten der <strong>ARL</strong> Heinrich Mäding beschloss<br />
das Präsidium der <strong>ARL</strong> im Mai 2009, eine biographische<br />
Skizze über Kurt Brüning erstellen zu lassen. Im Juli 2009<br />
wurde ein erster Forschungsauftrag mit dem Thema „Die<br />
Person Kurt Brüning – Leben, Werk, Wirkung“ an den Historiker<br />
Rolf Kohlstedt aus Hannover erteilt. Die Ergebnisse<br />
wurden unter dem Titel „,…produktiv kann man in jedem<br />
Gewand sein´ – eine biographische Skizze zu Leben, Werk<br />
und Wirkung Kurt Brünings“ 2010 dokumentiert.<br />
Der 1897 in Magdeburg geborene Brüning war kurz vor<br />
Kriegsende (1944) als Nachfolger von Paul Ritterbusch<br />
Obmann der RAG geworden. Es ist Brüning zu verdanken,<br />
dass die RAG nach dem Ende des Krieges ihre Tätigkeiten<br />
weiterführen konnte, nachdem er dafür gesorgt hatte,<br />
dass Personal und Akten nach Hannover und Göttingen<br />
verlagert wurden (<strong>ARL</strong> 1961: 10). In der Arbeit von Kohlstedt<br />
wird Brüning vor allem als organisatorisch fähiger,<br />
effektiver Wissenschaftsmanager dargestellt. Es ist unbestritten,<br />
dass es die Akademie ohne Brüning nicht gegeben<br />
hätte. Ariane Leendertz merkt dazu an, dass dies auch ein<br />
Stück weit der persönlichen Einstellung Brünings dem<br />
Bad Godesberger Institut für Raumforschung gegenüber<br />
geschuldet war, indem sie dessen damaligen Direktor<br />
Erich Dittrich zitiert: „Wenn ihm das Institut verlockender<br />
vorgekommen wäre – für seine persönliche Stellung –,<br />
gäbe es heute keine Akademie“ (Leendertz 2008: 235 f.).<br />
3 Vgl. Mäding und Strubelt 2009. Zitat aus dem Vorwort S. VII.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Um das Bild von Kurt Brüning weiter zu vervollständigen,<br />
beschloss das Präsidium im November 2010, einen weiteren<br />
Forschungsauftrag mit dem Titel „Wissenschaftlichkeit<br />
und Ideologie im publizistischen Wirken Kurt Brünings“<br />
an Rolf Kohlstedt zu vergeben. In dieser Arbeit sollte zwei<br />
Aspekten nachgegangen werden:<br />
■ Welchen Stellenwert nahm das wissenschaftliche Wirken<br />
Kurt Brünings in den akademischen Fachdisziplinen<br />
ein (und nimmt gegebenenfalls heute noch ein)?<br />
■ Wie sind der Einfluss politischer Standpunkte, insbesondere<br />
der nationalsozialistischen Ideologie, auf das<br />
Werk Brünings und seine Haltung zum Verhältnis von<br />
Politik und Wissenschaft einzuschätzen?<br />
Der Forschungsauftrag wurde in zwei Teilen von Rolf<br />
Kohlstedt bearbeitet und schließlich im März 2012 abgeschlossen.<br />
Hinsichtlich des Einflusses nationalsozialistischer<br />
Ideologie auf das Werk und Wirken Brünings bleibt<br />
das Bild vage. Brüning war vor 1933 Mitglied der SPD, trat<br />
1935 der NSDAP bei und kehrte nach Kriegsende zur SPD<br />
zurück. Während des NS-Regimes vertrat er in seinen Schriften<br />
nationalsozialistische Positionen, doch ging es ihm<br />
vor allem um die Vermehrung landeskundlichen Wissens<br />
und dessen Nutzen für die Landesplanung. Seine Haltung<br />
gegenüber den jeweils Herrschenden deutet eher auf Opportunismus<br />
denn auf feste ideologische Positionen hin.<br />
Dazu passt auch, dass Brüning während seiner 13-jährigen<br />
(!) Amtszeit als <strong>ARL</strong>-Präsident (von 1946 bis 1959) jegliche öffentliche<br />
Auseinandersetzung mit der NS-Raumforschung<br />
und Raumordnung vermied und offensichtlich keinerlei<br />
Bedenken hatte, politisch kompromittierte Kollegen, wie<br />
zum Beispiel Günther Franz, Heinrich Hunke, Konrad<br />
Meyer und Herbert Morgen, in die Akademie zu holen.<br />
Die vorliegenden Arbeiten zu Kurt Brüning sowie zur<br />
Geschichte der <strong>ARL</strong> werfen einige interessante und aufschlussreiche<br />
Schlaglichter auf den <strong>ARL</strong>-Vorläufer RAG<br />
sowie auf die Gründungs- und Frühzeit der Akademie. Sie<br />
bieten allerdings nur erste Bausteine, denn eine umfassende<br />
Aufarbeitung und Bewertung der <strong>ARL</strong>-Geschichte<br />
nach den Maßstäben der historisch-kritischen Geschichtswissenschaft<br />
steht noch aus.<br />
Neue Optionen<br />
Im Januar 2011 beauftragte das Präsidium eine kleine<br />
Arbeitsgruppe unter der Leitung von Heinrich Mäding,<br />
Vorschläge für eine weiter gehende Beschäftigung mit der<br />
Akademiegeschichte zu erarbeiten. Die im Februar 2012<br />
vorgelegten Vorschläge umfassen drei – untereinander<br />
auch kombinierbare – Optionen:<br />
1. Externer Forschungsauftrag an eine Historikerin oder<br />
einen Historiker zur Erarbeitung einer Akademiegeschichte<br />
(auf der Grundlage von Archivquellen).<br />
Ungeklärt ist dabei vor allem die Finanzierung.<br />
2. Workshop oder Tagung, vorrangig mit eingeladenen<br />
Beiträgen. Eine solche Veranstaltung wäre schneller<br />
machbar und einfacher zu finanzieren; allerdings besteht<br />
Skepsis hinsichtlich des Potenzials qualifizierter<br />
einschlägiger Referate.
3. Arbeitskreis aus Akademie- und externen Mitgliedern.<br />
Fraglich erscheint, inwieweit qualifizierte Externe zu<br />
einer mehrjährigen ehrenamtlichen Mitarbeit bereit<br />
sind und inwiefern in einem solchen Arbeitskreis<br />
Primärforschung geleistet werden kann.<br />
Das Präsidium begrüßte die Vorschläge der Arbeitsgruppe<br />
und bekräftigte seine Absicht, das Thema „Akademiegeschichte“<br />
weiter zu verfolgen. Nach Abwägung der<br />
Stärken und Schwächen entschied es, die Realisierbarkeit<br />
der ersten beiden Optionen näher zu prüfen.<br />
Ein Forschungsauftrag an eine einschlägig qualifizierte<br />
Zeithistorikerin oder einen Zeithistoriker über einen<br />
Zeitraum von 2–3 Jahren würde allerdings Kosten in<br />
Höhe von ca. 150.000 bis 200.000 Euro verursachen<br />
und wäre damit durch die <strong>ARL</strong> keinesfalls finanzierbar.<br />
Es wird deshalb gegenwärtig geprüft, ob ein solches<br />
Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
finanziert werden könnte. Allerdings müsste in diesem<br />
Fall eine einschlägig qualifizierte Zeithistorikerin oder<br />
ein Zeithistoriker für die Antragstellung und Leitung eines<br />
solchen Projekts gewonnen werden. Erste Kontakte mit<br />
dem zuständigen Referenten in der Geschäftsstelle der<br />
DFG und einer möglichen Antragstellerin waren durchaus<br />
vielversprechend. Allerdings wurde dabei zweierlei<br />
deutlich: Zum einen könne ein solches Projekt keine<br />
Institutionengeschichte im engeren Sinne sein, sondern<br />
müsse sich mit der Entwicklung der Raumordnung<br />
bzw. Raumplanung in einem breiteren geschichtlichen<br />
Kontext befassen. Dabei könne der Schlüsselakteur <strong>ARL</strong><br />
durchaus im Fokus stehen, allerdings eingebettet in eine<br />
sozial- und politikgeschichtliche Problemperspektive<br />
von allgemeinerem Interesse. Zum andern erfordere die<br />
Antragstellung nicht unerhebliche Vorarbeiten, die von<br />
der <strong>ARL</strong> finanziert werden müssten.<br />
Der Vorschlag für eine wissenschaftliche Tagung traf<br />
zeitlich zusammen mit einer ähnlichen Initiative unseres<br />
Mitglieds Wendelin Strubelt, der anregte, die <strong>ARL</strong><br />
möge in Zusammenarbeit mit Historikern ein wissenschaftliches<br />
Symposium zur Rolle der Raumplanung in<br />
Staat und Gesellschaft im 20. Jahrhundert organisieren.<br />
Das Präsidium spricht sich dafür aus, beide Vorschläge<br />
zusammenzuführen und eine entsprechende Tagung<br />
vorzubereiten. In einem Gespräch, an dem auf Einladung<br />
von Vizepräsident Blotevogel außer W. Strubelt<br />
auch die Historiker Detlef Briesen und Jürgen Reulecke<br />
teilnahmen, wurde Einigkeit dahingehend erzielt, dass im<br />
Mittelpunkt der geplanten Tagung, die im Winter 2013/14<br />
stattfinden könnte, die Entwicklung der Raumplanung in<br />
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen sollte.<br />
Ein entsprechendes Tagungskonzept befindet sich in<br />
Vorbereitung.<br />
Über die weitere Entwicklung der beiden Vorhaben – das<br />
externe Forschungsprojekt sowie die Fachtagung – werden<br />
wir in einer der nächsten Ausgaben berichten.<br />
Zitierte Literatur<br />
Zur Diskussion<br />
<strong>ARL</strong> – Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
(1960): Raumforschung – 25 Jahre Raumforschung in Deutschland.<br />
Bremen.<br />
<strong>ARL</strong> – Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
(1961): Festsitzung anläßlich des 25jährigen Bestehens der<br />
Raumforschung in Deutschland am 27. Oktober 1960 im Alten<br />
Rathaus zu Hannover. Hannover.<br />
Blotevogel, H. H. (2011): Geschichte der Raumordnung. In:<br />
Klaus Borchard (Hrsg.): Grundriss der Raumordnung und Raumentwicklung.<br />
Hannover, S. 75-168, 182-189.<br />
DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006): Wissenschaft,<br />
Planung, Vertreibung. Der Generalplan Ost der Nationalsozialisten.<br />
Eine Ausstellung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.<br />
Bonn.<br />
Leendertz, A. (2008): Ordnung schaffen. Deutsche Raumplanung<br />
im 20. Jahrhundert. Göttingen.<br />
Mäding, H.; Strubelt, W. (Hrsg.) (2009): Vom Dritten Reich<br />
zur Bundesrepublik. Beiträge einer Tagung zur Geschichte von<br />
Raumforschung und Raumplanung am 12. und 13. Juni 2008 in<br />
Leipzig. Arbeitsmaterial der <strong>ARL</strong> Nr. 346. Hannover.<br />
Meyer, K. (1971): Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung<br />
1935–1945. In: Raumordnung und Landesplanung im 20.<br />
Jahrhundert. Histor. Raumforsch. 10, Forsch.- u. Sitzungsber. Nr.<br />
63. Hannover, S. 103-116.<br />
Venhoff, M. (2000): Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung<br />
(RAG) und die reichsdeutsche Raumplanung seit<br />
ihrer Entstehung bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945.<br />
Arbeitsmaterial der <strong>ARL</strong> Nr. 258. Hannover.<br />
Waldhoff, H.-P.; Fürst, D.; Böcker, R. (1994): Anspruch und<br />
Wirkung der frühen Raumplanung. Zur Entwicklung der niedersächsischen<br />
Landesplanung 1945–1960. Beiträge der <strong>ARL</strong><br />
Nr. 130. Hannover.<br />
Andreas Stefansky 0511 34842-43<br />
stefansky@arl-net<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 3
4<br />
Forschung<br />
Windenergie, aber wo?<br />
Foto: M. Schlote<br />
Die „Energiewende und raumordnerische Implikationen“ war das Schwerpunktthema der 121. Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft<br />
(LAG) Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. Circa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Mitglieder<br />
der LAG sowie Vertreter und Interessierte aus Politik und Planung – kamen am 18. Juni 2012 im Hessischen Ministerium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung in Wiesbaden zusammen und informierten über aktuelle<br />
Entwicklungen zum Thema Energiewende und über Änderungen der Landesentwicklungspläne. Besonders im Fokus<br />
standen dabei Ziele, Herausforderungen und Strategien zur Nutzung von Windenergie.<br />
Die Sitzung leitete Prof. Dr. Ulrike Sailer, Universität<br />
Trier. In der Einführung verwies sie auf die Aktualität<br />
des Themas, indem sie auf eine Rede des Bundespräsidenten<br />
Joachim Gauck und einen aktuellen Leitartikel<br />
der „WirtschaftsWoche“ zur Gestaltung der Energiepolitik<br />
Bezug nahm. Sie unterstrich, dass Energiepolitik einerseits<br />
dezentral und andererseits standortkonzentriert erfolgen<br />
müsse. Als notwendige Maßnahme identifizierte sie eine<br />
Optimierung der Energieeffizienz durch den Umbau zu<br />
einem effizienteren Energiemix. Diese Maßnahme besitzt<br />
allerdings höchste Raumrelevanz und betrifft damit auch<br />
die Raumplanung.<br />
Auf die Identifizierung von geeigneten Räumen für die<br />
Windenergie nahmen die drei Landesvertreter Bezug.<br />
Dr. Natalie Scheck vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft,<br />
Verkehr und Landesentwicklung berichtete über<br />
„Die Berücksichtigung des Ausbaus erneuerbarer Energien<br />
in Raumordnungsplänen in Hessen“. Dr. Gerd Rojahn<br />
vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und<br />
Landesplanung Rheinland-Pfalz referierte zum Thema<br />
„Stand und Ausbauplanung erneuerbarer Energien in<br />
Rheinland-Pfalz“ und Dipl.-Ing. Gerd-Rainer Damm vom<br />
Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes<br />
sprach über „Das Saarland in der Energiewende“.<br />
Schnittstellen zwischen den Ausführungen der Referenten<br />
konnten in der Konkretisierung der Kriterien von<br />
Vorranggebieten gesehen werden, aber auch in den<br />
Zielsetzungen. Die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz<br />
und das Saarland zielen darauf ab, 2 % der Landesfläche<br />
als Vorranggebiete auszuweisen und ihre Energieversorgung<br />
zu 100 % auf erneuerbare Energien umzustellen.<br />
Unterschiede sind jedoch in den von den drei Bundesländern<br />
dafür festgelegten Zeiträumen zu finden: Während<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
die Umstellung auf erneuerbare Energien in Hessen bis<br />
2050 erfolgen soll, plant Rheinland-Pfalz, diese deutlich<br />
schneller, nämlich bis 2030 umzusetzen.<br />
Kritisch betrachtet wurden generell die Umsetzbarkeit<br />
der Landesentwicklungspläne sowie die Adressierung.<br />
Während in Hessen der Landesentwicklungsplan an die<br />
Regionalplanung gerichtet ist und diese sich dann mit<br />
der lokalen Ebene befassen soll, adressiert Rheinland-<br />
Pfalz direkt die lokale Ebene. In Hessen werden damit<br />
Foto: M. Schlote<br />
v. l.: Annette Spellerberg, Martin Orth, Ulrike Sailer, Andrea Hartz<br />
konkret alle Flächen als Vorrang- oder Ausschlussgebiete<br />
ausgewiesen. In Rheinland-Pfalz hingegen bleiben 95 %<br />
der Flächen raumordnerisch ungeregelt. Es ist politisch<br />
gewollt, dass die Kommunen die Ausweisung bestimmter<br />
Gebiete übernehmen. Sie seien schließlich direkt betroffen<br />
und sollten daher auch über Eingriffe entscheiden<br />
können, betonte Rojahn.<br />
Als wichtiges Kriterium eines Vorranggebietes wurde<br />
die Windhöffigkeit hervorgehoben. Grundsätzlich beurteilten<br />
die Teilnehmenden diesen Aspekt jedoch kritisch<br />
und diskutierten die Frage, ob es generell sinnvoll sei,
den Bau und die Effektivität von Anlagen an statischen<br />
Werten festzumachen. Fakt ist, dass grade dort, wo besonders<br />
hohe Windhöffigkeiten erreicht werden – also<br />
auf weithin sichtbaren Kuppen, Hügeln oder Bergen –,<br />
auch das Landschaftsbild durch Windkraftanlagen stark<br />
verändert wird.<br />
Dr. Markus Leibenath vom Leibniz-Institut für ökologische<br />
Raumentwicklung e. V. bereicherte die Sitzung um<br />
neue Denkansätze zum Thema „Diskursive Konstituierung<br />
von Landschaften in Windenergiediskursen. Hinweise<br />
und Konsequenzen für die räumliche Planung“. Dabei<br />
nahm er auf die Akzeptanzproblematik im Energiediskurs<br />
Bezug und kam zu folgenden Ergebnissen: Es könne keine<br />
Blaupause für die Raumplanung geben und es werde immer<br />
mit Opposition zu rechnen sein. Opposition könne<br />
durch Transparenz beim Planungsprozess und die suggestive<br />
Macht von Bildern verringert werden. Außerdem<br />
müsse man auf eine Verringerung der NIMBY-Einstellung<br />
(Not In My Back Yard) hinwirken.<br />
Forschung<br />
Unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuelles aus Wissenschaft<br />
und Praxis“ berichtete Prof. Dr. Jochen Monstadt<br />
von der TU Darmstadt über den neuen Arbeitskreis<br />
„Räumliche Politik und Planung für die Energiewende:<br />
Zwischen Regionalisierung und Rekommunalisierung?“<br />
der <strong>ARL</strong> und stellte sowohl dessen Ziele vor als auch<br />
relevante Fragestellungen. Um besser mit der Komplexität<br />
des Themas umgehen zu können, wurden sechs<br />
Unterarbeitsgruppen gebildet, die sich auf folgende<br />
Punkte konzentrieren: auf die regionale, die lokale, die<br />
sozial-ökologische, die ökonomische und die soziotechnische<br />
Dimension sowie auf implizite räumliche<br />
Leitbilder der Energiewende. Abschließend berichtete<br />
Beate Wojtyniak von der Universität des Saarlandes über<br />
eine empirische Untersuchung der Universität zum Thema<br />
„Wanderungsmotivation Hochqualifizierter: Das Beispiel<br />
des Saarlandes“.<br />
Maike Schlote<br />
Martina Hülz 0511 34842-28<br />
huelz@arl-net.de<br />
Neues aus der bayerischen Landesplanung<br />
Im Zuge der Föderalismusreform I wurde die Rahmengesetzgebungskompetenz<br />
des Bundes im Bereich der<br />
Raumordnung durch die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz<br />
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 Grundgesetz<br />
(GG) ersetzt, wobei den Ländern ein Abweichungsrecht<br />
eingeräumt wurde. Der Freistaat Bayern hat von diesem<br />
Abweichungsrecht Gebrauch gemacht, das Bayerische<br />
Landesplanungsgesetz novelliert und es gleichzeitig als<br />
„Vollgesetz“ konzipiert. Es ersetzt damit das Bundesraumordnungsgesetz<br />
in Bayern. Somit ist weitgehend das<br />
Nebeneinander von Bundes- und Landesrecht im Bereich<br />
der Raumordnung aufgelöst.<br />
Das neue Bayerische Landesplanungsgesetz ist am 1.<br />
Juli 2012 in Kraft getreten. Zuvor fanden intensive Bemühungen<br />
der <strong>ARL</strong> und weiterer Interessensvertretungen<br />
der räumlichen Planung und Entwicklung statt, dem<br />
Gesetz zu noch höherer Qualität zu verhelfen. Der Adhoc-Arbeitskreis<br />
zur Reform der Landes- und Regionalplanung<br />
unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Jacoby<br />
(Universität der Bundeswehr München) hatte bereits im<br />
vergangenen Jahr – gemeinsam mit anderen Institutionen<br />
– eine Stellungnahme erarbeitet, die unter anderem<br />
im Rahmen der sogenannten Verbändeanhörung in das<br />
Verfahren eingeflossen ist. Zudem fand in München im<br />
Beisein vieler Landtagsabgeordneter eine große Veranstaltung<br />
zu diesem Thema statt.<br />
Der Ad-hoc-Arbeitskreis hat in den letzten Wochen<br />
seine Arbeit fortgesetzt. Denn nach der Novelle des<br />
Bayerischen Landesplanungsgesetzes steht nun die Gesamtfortschreibung<br />
des Landesentwicklungsprogramms<br />
Bayern an. Der bayerische Ministerrat hatte im Mai dieses<br />
Jahres einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die<br />
Arbeitsgruppe ist mehrfach zusammengekommen, um<br />
eine Stellungnahme zu erarbeiten. Die Herausforderung<br />
ist groß, hat doch der Entwurf des neuen Landesentwicklungsprogramms<br />
eine neue Struktur, einen deutlich<br />
verringerten Umfang und einen expliziten Bezug zu den<br />
aktuellen Herausforderungen für die räumliche Entwicklung<br />
Bayerns: demografischer Wandel, Klimawandel,<br />
einschließlich des Umbaus der Energieversorgung, verstärkter<br />
räumlicher Wettbewerb. Den Mitgliedern der<br />
Arbeitsgruppe ist bewusst, dass die Gesamtfortschreibung<br />
des Programms nach den Vorgaben „Entbürokratisierung“,<br />
„Deregulierung“ und, soweit möglich, „Kommunalisierung“<br />
der Staatsregierung konzipiert ist. Gleichwohl sehen<br />
sie es als ihre Aufgabe an, auf wesentliche, die zentralen<br />
Steuerungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten betreffende<br />
Inhalte und Instrumente hinzuweisen. Dies<br />
geschieht beispielsweise bei der Ausweisung Zentraler<br />
Orte, beim Ziel der gleichwertigen Lebens- und Arbeitsverhältnisse,<br />
bei der Rolle der prosperierenden Verdichtungsräume,<br />
beim sogenannten Doppelsicherungsverbot<br />
oder bei der landesentwicklungspolitisch begründeten<br />
Priorisierung von Verkehrsprojekten.<br />
Die Stellungnahme des Ad-hoc-Arbeitskreises wird in<br />
Kürze dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft,<br />
Infrastruktur, Verkehr und Technologie zugeleitet.<br />
Andreas Klee 0511 34842-39<br />
klee@arl-net.de<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 5
6<br />
Forschung<br />
Demografischer Wandel in Mitteldeutschland<br />
Insbesondere unter den Bedingungen<br />
des demografischen Wandels<br />
muss die Daseinsvorsorge in den<br />
mitteldeutschen Ländern für die Bürgerinnen<br />
und Bürger auch in Zukunft<br />
sichergestellt werden. So lautete die<br />
Kernthese der Frühjahrstagung der<br />
LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen<br />
im April 2012, die diesmal in<br />
Weimar stattfand und von Dr. Ludwig<br />
Scharmann, Sächsisches Staatsministerium<br />
des Innern und Leiter der<br />
Lenkungsgruppe der LAG, moderiert<br />
wurde. Um die Daseinsvorsorge jedoch<br />
sicherstellen zu können, müssen<br />
die bisherigen Standards der kommunalen<br />
Leistungserbringung an die<br />
demografischen Prozesse angepasst<br />
werden, so der Befund nicht nur von<br />
Prof. Dr. Martin T. W. Rosenfeld, Institut<br />
für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).<br />
Über-Blick über den demografischen<br />
Wandel<br />
Die Präsidentin des Statistischen Landesamtes des<br />
Freistaates Sachsen, Prof. Dr. Irene Schneider-Böttcher,<br />
Kamenz, führte als erste Referentin den Anwesenden faktenreich<br />
die demografische Entwicklung in Mitteldeutschland<br />
vor Augen. So müssen sich die drei Länder trotz<br />
einer wieder leicht ansteigenden Geburtenrate weiter<br />
auf insgesamt rückläufige Bevölkerungszahlen einrichten.<br />
Handlungsbedarf sieht Schneider-Böttcher insbesondere<br />
bei der Beantwortung der Frage, wie qualifizierte Zuwanderer<br />
für die mitteldeutschen Länder gewonnen werden<br />
können, damit es auch in Zukunft eine ausreichende Zahl<br />
von Erwerbsfähigen gibt. Denn eine Geburtenrate zur<br />
Erhaltung des Bevölkerungstandes für z.B. Sachsen von<br />
3,7 ist reichlich unrealistisch.<br />
Mit der Formel „Grauer-Weniger-Bunter-Ver1zelter“<br />
brachte der Präsident der <strong>ARL</strong>, Dr.-Ing. Bernhard Heinrichs,<br />
die Veränderungen der demografischen Situation<br />
auf den Punkt. Er wies darauf hin, dass sich die <strong>ARL</strong> bereits<br />
frühzeitig mit den räumlichen Fragen des demografischen<br />
Wandels auseinandergesetzt hat – was unter anderem<br />
auch die Veröffentlichung der LAG, „Schrumpfung –<br />
Neue Herausforderungen für die Regionalentwicklung<br />
in Sachsen/Sachsen-Anhalt und Thüringen“ (AM der<br />
<strong>ARL</strong> 303, 2003), dokumentiert. Heinrichs betonte, dass<br />
die Angebote der Daseinsvorsorge vorrangig am Zentrale-Orte-Prinzip<br />
ausgerichtet werden sollten, allerdings<br />
unter der Voraussetzung, gesetzliche Vorgaben flexibel<br />
handhaben zu können. Insbesondere der Rückbau von<br />
Infrastrukturen muss als gleichberechtigte Option neben<br />
ihrem Umbau bestehen.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Demografische Entwicklung Mitteldeutschlands im Gesamtdeutschen Vergleich<br />
Rück-Blick auf den demografischen<br />
Wandel in Mitteldeutschland<br />
Prof. Dr. Rainer Winkel, Deutsches Institut für Stadt und<br />
Raum e. V., Berlin, stellte das Projekt „Lommatzscher Pflege“<br />
vor, zu dem zwei Studierendenprojekte in den Jahren 2002<br />
und 2004 den Grundstein gelegt hatten. 2004 wurde das<br />
Projekt als MORO-Vorhaben „Effiziente und integrierte Infrastrukturversorgung<br />
im Ländlichen Raum, Lommatzscher<br />
Pflege“ aufgenommen. Das Projektgebiet ist eine bevölkerungsarme<br />
ländliche Region in Mittelsachsen, die durch die<br />
Kleinstadt Lommatzsch geprägt wird. Die Region stand zu<br />
Quelle: Folie im Vortrag von Rainer Winkel<br />
Quelle: Folie im Vortrag von Irene Schneider-Böttcher
Projektbeginn vor nur schwer beherrschbaren Problemen,<br />
ausgelöst durch die negative Bevölkerungsentwicklung.<br />
Der Projektansatz sah vor, alle wichtigen Infrastrukturbereiche<br />
einer Querschnittsbetrachtung zu unterziehen.<br />
Gerade diese Herangehensweise half den Akteuren aus<br />
den Gemeinden, den Landkreisen, der Regionalplanung<br />
sowie der Landesplanung, die Problematik deutlich sichtbar<br />
zu machen – so z. B. die Tatsache, dass aufgrund der<br />
fehlenden ÖPNV-Verbindung gerade für Unmotorisierte<br />
und für chronisch Kranke eine desolate Gesundheitsversorgung<br />
besteht. Es konnte festgestellt werden, dass<br />
durch den demografischen Wandel in keinem Infrastrukturbereich<br />
Kostenentlastungen zu erwarten sind. Vielmehr<br />
sind durch demografiebedingte Einnahmeverluste weitere<br />
Finanzierungsprobleme zu erwarten. Schon während der<br />
Projektlaufzeit konnte bei den Politikern und der Verwaltung<br />
sowie auch in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für<br />
den dringenden Handlungsbedarf geweckt werden.<br />
Dirk Michaelis, Altmarkkreis Stendal, bedauerte am Ende<br />
seines Vortrages, dass das im Positionspapier Nr. 77 der <strong>ARL</strong><br />
avisierte Programm „Umbau und nachhaltige Entwicklung<br />
von peripheren Regionen“ leider bisher nur ein Vorschlag<br />
ist. Auch die Altmark, über deren bisherige und zukünftige<br />
demografische Entwicklung Michaelis berichtete, ist durch<br />
eine weiterhin abnehmende Bevölkerungsdichte geprägt.<br />
Sein Befund: Durch die existenten fachlichen Handlungsansätze<br />
wird sich die negative Bevölkerungsentwicklung<br />
nicht aufhalten, geschweige denn umkehren lassen. Zwar<br />
lägen zahlreiche Projekterfahrungen, Ideen und Untersuchungen<br />
vor, sie böten jedoch keine umsetzbaren<br />
Lösungsansätze für die Altmark. Michaelis befürwortet<br />
die Bündelung der Förderung auf die Entwicklung der<br />
Siedlungskerne.<br />
Ein-Blick in Stadt, Land und Region<br />
Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung in den<br />
Regionen bis 2025, so lässt sich feststellen, dass in räumlicher,<br />
ökonomischer, sozialer und politischer Hinsicht<br />
Ungleichheiten zunehmen werden, so Dr. Bernd Rittmeier,<br />
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung<br />
(BMVBS). Deshalb müsse über eine Unterscheidung<br />
der Mindestausstattungen bzw. -standards zwischen den<br />
Demografiestrategie des Bundes<br />
Quelle: Folie im Vortrag von Bernd Rittmeier<br />
Forschung<br />
verschiedenen Raumtypen nachgedacht werden. Rittmeier<br />
berichtete u. a. über die am Tag zuvor vom Bund<br />
verabschiedete Demografiestrategie, die einen ressortübergreifenden<br />
Ansatz verfolgt, um den demografischen<br />
Herausforderungen besser gerecht werden zu können.<br />
Ein neuer Aspekt in der Demografiestrategie des Bundes<br />
ist, so Rittmeier, die Erarbeitung eines nationalen Koordinierungsrahmens<br />
zur Sicherung der Daseinsvorsorge.<br />
Offen bleibt allerdings die Frage, wie eine übergreifende,<br />
langfristige Perspektive der Finanzierung der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge aussehen kann/soll.<br />
Wichtige Punkte der Demografiestrategie des Bundes<br />
sind aus Sicht des BMVBS:<br />
■ Fortführung und Weiterentwicklung bisheriger Programme/Vorhaben<br />
■ Weiterentwicklung des Zentrale-Orte-Prinzips und der<br />
Leitbilder der Raumordnung<br />
■ Verstärkung der Aktivitäten zur Sicherung der Mobilität<br />
im ländlichen Raum<br />
■ Berücksichtigung der demografischen Entwicklung im<br />
Bundesverkehrswegeplan<br />
Um auf die Herausforderungen des demografischen<br />
Wandels besser eingehen zu können, hat die Regierung<br />
des Landes Sachsen-Anhalt u. a. einen Demografie-Beirat<br />
und auch einen Demografie-TÜV eingerichtet. Laut Ministerium<br />
für Landesentwicklung und Verkehr des Landes<br />
Sachsen-Anhalt soll der Demografie-TÜV „Prioritätensetzungen<br />
des Landes Sachsen-Anhalt für den Einsatz der EU-<br />
Strukturfonds 2007 bis 2013 möglich machen“. Wilfried<br />
Köhler, Ministerium für Bau und Verkehr Sachsen-Anhalt,<br />
thematisierte neben diesen Maßnahmen in seinem Refe-<br />
Gleichwertige Lebensverhältnisse werden durch ein Handlungskonzept<br />
verfolgt<br />
Quelle: Folien im Vortrag von Wilfried Köhler<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 7
8<br />
Forschung<br />
rat den starken Bevölkerungsrückgang im Land Sachsen-<br />
Anhalt und zog die Bilanz, dass überproportional mehr<br />
Frauen als Männer das Land seit der Wende verlassen<br />
haben. Seine Schlussfolgerung aus der sachsen-anhaltinischen<br />
Bevölkerungsprognose ist, dass es die peripheren<br />
ländlichen Räume sind, die zu Problemregionen werden.<br />
Das von der Landesentwicklung erstellte Handlungskonzept<br />
soll helfen, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen<br />
Teilen des Landes sicherzustellen.<br />
Die demografische Entwicklung im Land Thüringen war<br />
Gegenstand des Vortrages von Kai Philipps, dem Leiter der<br />
Serviceagentur Demografischer Wandel. Ähnlich wie die<br />
beiden anderen mitteldeutschen Länder hat auch Thüringen<br />
Bevölkerungsverluste zu verzeichnen. Mittlerweile ist<br />
außerdem eine Umkehr der Stadt-Land-Wanderung zu<br />
erkennen, so Philipps. Ebenso wie Rittmeier machte er<br />
deutlich, dass die Gestaltung des demografischen Wandels<br />
eine ressortübergreifende Aufgabe ist.<br />
Insbesondere auf die Infrastruktur der Abfall- und<br />
Wasserwirtschaft wird sich die demografische Entwicklung<br />
auswirken, so Prof. Dr.-Ing. Jörg Londong von der<br />
Bauhaus-Universität Weimar. In einer Studie, die vom<br />
„Beauftragten für die Neuen Länder“ beim Bundesministerium<br />
des Innern in Auftrag gegeben wurde, hat er<br />
diese Auswirkungen auf die Wasserversorgungs- und<br />
Abwasserentsorgungsinfrastrukturen in ländlichen Räumen<br />
untersucht und die notwendigen Handlungserfordernisse<br />
aufgearbeitet. Bei der Abfallentsorgung spielen<br />
demografische Veränderungen in Mitteldeutschland eine<br />
eher marginale Rolle. Ganz anders aber sieht es bei den<br />
netzgebundenen Wasserver- und Abwasserentsorgungssystemen<br />
aus. Für die Abwassersysteme ergeben sich z. B.<br />
folgende Auswirkungen:<br />
■ Ökonomisch: Fixkosten werden auf immer weniger<br />
Nutzer umgelegt.<br />
■ Betrieblich: Durch weniger Abwasser sammeln sich<br />
vermehrt Ablagerungen in den Kanälen an; bei den<br />
Kläranlagen kommt es zu Überkapazitäten.<br />
■ Ökologisch: Höhere Konzentration von Arzneimitteln<br />
in den Systemen.<br />
■ Strukturell: Auswirkungen des Fachkräftemangels auf<br />
die Betriebe.<br />
Als Handlungsoptionen sieht Londong neue Organisationsstrukturen<br />
(Fusionen der Verbände), die Mitbehandlung<br />
von Industrieabwässern in öffentlichen Anlagen, den<br />
Rückbau von Siedlungsstrukturen in Außenbereichen<br />
oder auch die Verkleinerung der Kanalquerschnitte.<br />
Zum Schluss: ein übergeordneter Blick<br />
Unter dem Titel „Da sind wir wieder“ berichtete auch DIE<br />
ZEIT (30/2012) über die bisherigen Ergebnisse des Forschungsprojektes<br />
„Re-Turn“, das Dr. Thilo Lang, Leibniz-<br />
Institut für Länderkunde, auf der LAG-Tagung vorstellte.<br />
Die Studie beinhaltet eine Online-Befragung von Aus- und<br />
Rückwanderern, in der u. a. nach den Motiven für die<br />
Abwanderung aus Ostdeutschland, aber auch nach der<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Veränderung der Migrationstheorie<br />
Quelle: Folien im Vortrag von Thilo Lang<br />
Bereitschaft zur Rückkehr gefragt wird. Die bisherigen<br />
Ergebnisse passen zu den Befunden der statistischen<br />
Landesämter in Ostdeutschland, die in 2010 geringere<br />
Ost-West-Wanderungsverluste konstatierten. Die wohl<br />
interessanteste Erkenntnis der Untersuchung ist, dass<br />
sich sehr viele Auswanderer eine Rückkehr vorstellen<br />
können. Dieser Wunsch resultiert aus der Attraktivität der<br />
ursprünglichen Heimat.<br />
„Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass<br />
Unternehmen weit mehr von ihren besten Mitarbeitern<br />
abhängen als die guten Leute von Unternehmen.“ – Dieses<br />
Zitat von Peter F. Drucker stellte Dr. Cornelia Haase-Lerch,<br />
Industrie- und Handelskammer Erfurt, an den Anfang ihres<br />
Referates und hob damit die Bedeutung des in Deutschland<br />
anstehenden Umbruchs hervor. In ihrem Vortrag<br />
widmete sie sich den Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung<br />
auf die Gewinnung von Fachkräften und der<br />
damit zusammenhängenden Sicherung der thüringischen<br />
Wirtschaft. Der Fachkräftebedarf der Zukunft wird allein<br />
durch die Schulabgänger im Land nicht gedeckt werden<br />
können. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken,<br />
bedarf es daher eines umfassenden Handlungsansatzes,<br />
der aus acht Handlungsfeldern besteht:<br />
■ Anzahl der Schulabgänger ohne Abschluss reduzieren<br />
■ Anzahl der Ausbildungsabbrecher reduzieren<br />
■ Anzahl der Studienabbrecher reduzieren<br />
■ Menschen über 65 gewinnen
■ Zuwanderung der Fachkräfte steuern<br />
■ Arbeitszeit Vollbeschäftigter steigern<br />
■ Ausbildung und Qualifizierung verbessern<br />
Der Wettbewerb zwischen den einzelnen Arbeitgebern,<br />
so Haase-Lerch, werde sich in Zukunft noch verstärken.<br />
Mitgliederversammlung<br />
Am zweiten Tag der Frühjahrstagung der LAG wurde wie<br />
immer die Mitgliederversammlung abgehalten. Wesentliche<br />
Punkte waren die Diskussion über die laufenden Untersuchungen<br />
der beiden bestehenden Arbeitsgruppen<br />
sowie die zukünftigen Themen für die LAG. Die Arbeiten<br />
der laufenden AGs stehen vor ihrem inhaltlichen Abschluss<br />
und sollen noch vor Ende des Jahres der externen<br />
Evaluation übergeben werden. Themen neuer Arbeitsgruppen<br />
sollen die „Metropolregion Mitteldeutschland“<br />
sowie die „Regionalentwicklung 2013–2019: neue Wege<br />
im Licht von EU-Strukturfondsreform und Solidarpakt“<br />
sein. Für beide Themen werden noch in diesem Sommer<br />
bzw. Herbst Vorbereitungsgruppen einberufen, die sich<br />
mit der detaillierten Ausrichtung befassen sollen. Im<br />
Anschluss daran wird die Geschäftsstelle der <strong>ARL</strong> einen<br />
„Call for Membership“ durchführen, der von der Lenkungsgruppe<br />
ausgewertet wird.<br />
Die nächste Sitzung der LAG unter dem Oberthema<br />
„Siedlungs- und Regionalentwicklung im Klimawandel“<br />
findet am 19. Oktober in Merseburg statt.<br />
Andreas Stefansky 0511 34842-43<br />
stefansky@arl-net<br />
LAG wählt neues Mitglied<br />
Auf Vorschlag der Lenkungsgruppe wurde auf<br />
der Mitgliederversammlung Dr. Thilo Lang zum<br />
neuen Mitglied der LAG Sachsen/Sachsen-Anhalt/<br />
Thüringen gewählt. Er hat von 1996 bis 2002 in Kaiserslautern<br />
Raum- und Umweltplanung und Stadtplanung<br />
in Hamburg studiert. Während seiner Tätigkeit<br />
am IRS in Erkner hat er über das Thema „Lokale<br />
Wirtschaftsförderung“ promoviert. Seit Ende 2009<br />
ist er am Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig<br />
beschäftigt und arbeitet dort als Abteilungsleiter<br />
„Regionale Geographie Europas“ und als Koordinator<br />
des Forschungsbereichs „Raumproduktionen:<br />
Polarisierung/Peripherisierung“. Daneben ist Thilo<br />
Lang auch (Mit-)Herausgeber des Online-Magazins<br />
„Städte im Umbruch“.<br />
Wissenschaftliche Beiträge<br />
Forschung<br />
Band 70<br />
Heft 2<br />
April 2012<br />
Schwerpunktheft:<br />
Die gesellschaftliche<br />
Konstituierung von<br />
Kulturlandschaft<br />
Papierausgabe:<br />
ISSN 0034-0111<br />
Elektronische Ausgabe:<br />
ISSN 1869-4179<br />
Heiderose Kilper / Stefan Heiland / Markus Leibenath /<br />
Sabine Tzschaschel<br />
Die gesellschaftliche Konstituierung von Kulturlandschaft<br />
Ludger Gailing / Markus Leibenath<br />
Von der Schwierigkeit, „Landschaft“ oder „Kulturlandschaft“<br />
allgemeingültig zu definieren<br />
Monika Micheel<br />
Alltagsweltliche Konstruktionen von Kulturlandschaft<br />
Markus Leibenath / Antje Otto<br />
Diskursive Konstituierung von Kulturlandschaft am Beispiel<br />
politischer Windenergiediskurse in Deutschland<br />
Wera Wojtkiewicz / Stefan Heiland<br />
Landschaftsverständnisse in der Landschaftsplanung.<br />
Eine semantische Analyse der Verwendung des Wortes<br />
„Landschaft“ in kommunalen Landschaftsplänen<br />
Ludger Gailing<br />
Sektorale Institutionensysteme und die Governance<br />
kulturlandschaftlicher Handlungsräume. Eine institutionen-<br />
und steuerungstheoretische Perspektive auf die<br />
Konstruktion von Kulturlandschaft<br />
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen:<br />
Springer Customer Service Center GmbH<br />
Haberstraße 7, 69126 Heidelberg<br />
Tel. (+49-6221) 3454303<br />
Fax (+49-6221) 3454229<br />
E-Mail: subscriptions@springer.com<br />
www.springer.com/geography/human+geography/journal/13147<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 9
10<br />
Forschung<br />
Für ihre 31. Zusammenkunft am 1./2. Juni 2012 hatten<br />
die Mitglieder des Informations- und Initiativkreises<br />
(IIK) Regionalplanung der <strong>ARL</strong> die Hochschule Erfurt<br />
ausgewählt. Begrüßt wurden sie vom Präsidenten der<br />
Fachhochschule Erfurt, Prof. Dr. Heinrich Kill, der den Weg<br />
von der Ingenieurschule für Gartenbau und Bauwesen<br />
zur heutigen Fachhochschule nachzeichnete. Aktuelle<br />
Arbeitsschwerpunkte des IIK sind die Themen „Logistik/<br />
Verkehrsinfrastruktur“ und „Planerischer Steuerungsbedarf<br />
im Außenbereich“.<br />
Logistik/Verkehrsinfrastruktur<br />
Eine Arbeitsgruppe des IIK unter der Leitung von Dirk<br />
Vallée, Aachen, hat einen kompakten Leitfaden mit<br />
wichtigen Kriterien der Eignung von Logistikstandorten,<br />
Akteuren und guten Beispielen erarbeitet. Das Treffen<br />
Logistik<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
IIK Regionalplanung<br />
legt neue Arbeitshilfen<br />
für die Planungspraxis vor<br />
Foto: D. Scholich<br />
Foto: A. Priebs<br />
bot Gelegenheit, den Entwurf der AG zu diskutieren und<br />
einige Ergänzungen vorzunehmen.<br />
Logistik spielt für die regionalen, nationalen und globalen<br />
Verflechtungen in der zunehmend arbeitsteiligen<br />
Wirtschaft eine immer stärkere Rolle. Sie wird wegen<br />
ihrer Funktionen und Potenziale, die diverse Standorte,<br />
Verkehrsträger, Technologien und Branchen umspannen,<br />
jedoch von außen bisher nicht als Aufgabenbereich der<br />
Raumplanung wahrgenommen. Aus raumplanerischen<br />
Gesichtspunkten stellen sich neben Fragen des Standorts<br />
und der Sicherung von geeigneten Flächen (Lage, Größe,<br />
Zuschnitt, Abstände, Erreichbarkeit) zudem Fragen der<br />
Verzahnung einzelner Verkehrsmodi und nach Standorten<br />
für Umschlageinrichtungen sowie nach Korridoren mit<br />
ausreichenden Kapazitäten und Lagegunst. Im Hinblick<br />
auf die Standortplanung besteht zudem Steuerungsbedarf<br />
hinsichtlich umfassender Qualitätsansprüche an<br />
Standorte, Verkehr und deren Versorgung. Diese stehen<br />
in besonderem Spannungsverhältnis zu Wohn- und<br />
Arbeitsplatzstandorten hinsichtlich Ruhebedürfnis und<br />
Nähe sowie zur Landschaft.<br />
Der Leitfaden des IIK stellt in erster Linie die grundlegenden<br />
Zusammenhänge zwischen Logistik und<br />
Raumplanung, die Anforderungen an die Raumplanung<br />
und ihre Handlungsmöglichkeiten auf den Ebenen der<br />
Regional- und Landesplanung dar und bietet Empfehlungen<br />
für den Umgang mit den damit einhergehenden<br />
Herausforderungen. Er gibt insbesondere Planerinnen<br />
und Planern auf diesen Planungsebenen, aber auch der
Bauleitplanung Hilfestellungen in Bezug auf die Fragen,<br />
welche Akteure bei der Planung von Logistikstandorten<br />
und -flächen welche Interessen haben und wie sie in die<br />
Planungsprozesse eingebunden werden können, welche<br />
Datenquellen zur Verfügung stehen bzw. wie aus unterschiedlichen<br />
Primärquellen erforderliche Informationen<br />
zur Abschätzung von Kapazitäten, Flächengrößen und<br />
Verkehrsbelastungen herangezogen werden können,<br />
welche Standortkriterien auf der überörtlichen (Regionalplanung)<br />
und örtlichen Ebene (Bauleitplanung) zum<br />
Einsatz kommen können. Die <strong>ARL</strong> wird den Leitfaden<br />
zum kostenlosen <strong>Download</strong> auf ihre Website einstellen.<br />
Planerischer Steuerungsbedarf<br />
im „Außenbereich“<br />
Eine weitere Arbeitsgruppe des IIK hat eine Diskussionsvorlage<br />
erarbeitet, mit der die planerischen Steuerungsmöglichkeiten<br />
bzw. -defizite privilegierter Vorhaben im<br />
Außenbereich i. S. d. § 35 BauGB thematisiert werden.<br />
Zwar kommt der Außenbereich für die Siedlungstätigkeit<br />
nur bedarfsgerecht und nachgeordnet in Betracht.<br />
Dennoch ist dieser Bereich Interessengebiet unterschiedlichster<br />
Nutzungen, wobei insbesondere Planungs- und<br />
Naturschutzrecht ein breites Instrumentarium zu dessen<br />
Gestaltung bieten. Diese Gestaltungsmöglichkeiten werden<br />
allerdings für Vorhaben stark eingeschränkt, die der<br />
Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert hat.<br />
§ 35 BauGB zeigt, dass die Privilegierung längst nicht<br />
mehr nur (klassische und neuartige) landwirtschaftliche<br />
Vorhaben umfasst, sondern auch Vorhaben zur Erzeugung<br />
und Nutzung erneuerbarer Energien. In beiden Themenfeldern<br />
ist schon heute eine sehr dynamisch verlaufende<br />
Entwicklung der Vorhabendimension auszumachen – und<br />
damit in zahlreichen Fällen auch die Entwicklung der von<br />
einzelnen Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf den<br />
Raum. Hinzu kommen verstärkte Voll- oder Teilaussied-<br />
Foto: Cec-clp, wikipedia<br />
lungen landwirtschaftlicher Hofstellen wegen Immissionskonflikten<br />
und steigender Qualitätsanforderungen sowie<br />
eine verstärkte Nachfrage nach Einrichtungen zur Pferdehaltung<br />
(gerade auch im Umfeld der Agglomerationen).<br />
Im Hinblick auf landwirtschaftliche Betriebsgebäude ist<br />
in diesem Zusammenhang insbesondere die anhaltende<br />
Forschung<br />
Vergrößerung der Kapazität landwirtschaftlicher Tiermastanlagen<br />
(im Rahmen des Privilegierungstatbestandes gem.<br />
§ 35 BauGB) zu nennen.<br />
Bei den erneuerbaren Energien zeichnet sich neben der<br />
Errichtung von Biogasanlagen im Rahmen der Energiewende<br />
auch in Süddeutschland ein starker Ausbau der<br />
Windenergie ab. Bei gleichzeitiger Weiterentwicklung<br />
von Anlagenleistung und -höhe sowie angesichts der<br />
Notwendigkeit weiterer Speicher- und Netzkapazitäten<br />
ist hier eine signifikante Steigerung der baulichen Inanspruchnahme<br />
des Freiraumes absehbar.<br />
Wie Dipl.-Ing. Thomas Kiwitt, Stuttgart, Prof. Dr. Axel<br />
Priebs, Hannover, und Dipl.-Ing. Theophil Weick,<br />
Neustadt/Weinstraße, deutlich machten, bestehen<br />
planungsrechtlich einige Steuerungsmöglichkeiten zur<br />
Koordination der baulichen Entwicklung außerhalb der<br />
Ortslagen. Die AG geht in ihrem Papier im Besonderen<br />
auf die Steuerungsmöglichkeiten für Tiermastanlagen<br />
und Windenergieanlagen ein. Sie zeigt, dass es für die<br />
Außenbereichsnutzungen verschiedene planungsrechtliche<br />
Steuerungsmöglichkeiten gibt, eine Gesamtsteuerung<br />
jedoch weder durch die Bauleitplanung noch durch<br />
die Regionalplanung möglich ist. Angesichts der stark<br />
zunehmenden Dichte von Vorhaben im Außenbereich<br />
sowohl aus der Landwirtschaft als auch zur Umsetzung<br />
der Energiewende wird deshalb diskutiert, welche weitergehenden<br />
Steuerungsmöglichkeiten geschaffen werden<br />
müssten. Die AG wird ihre Empfehlungen in einem<br />
Positionspapier aus der <strong>ARL</strong> darlegen und zur Diskussion<br />
stellen.<br />
Abgerundet wurde das IIK-Treffen durch Berichte von<br />
Prof. Dr.-Ing. Jörg Knieling, Hamburg, zu Empfehlungen<br />
des Beirats für Raumentwicklung zur Öffentlichkeitsbeteiligung,<br />
von Prof. Dr.-Ing. Stefan Siedentop, Stuttgart,<br />
über den derzeit vorbereiteten Modellversuch zur<br />
Einführung handelbarer Flächenzertifikate und von Ltd.<br />
Regierungsdirektor Walter Kufeld, München, zu den sog.<br />
Zugspitz-Thesen „Klimawandel,<br />
Energiewende<br />
und Raumordnung“, die<br />
als Positionspapier Nr. 90<br />
aus der <strong>ARL</strong> veröffentlicht<br />
worden sind.<br />
Landwirtschaftlicher Betrieb<br />
Dietmar Scholich<br />
0511 34842-37<br />
scholich@arl-net.de<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 11
12<br />
Forschung<br />
Leibniz-Forschungsverbund „Biodiversität“<br />
eingerichtet<br />
Die <strong>ARL</strong> ist mit an Bord<br />
Als eine von 21 Leibniz-Einrichtungen ist die Akademie<br />
für Raumforschung und Landesplanung (<strong>ARL</strong>)<br />
am Forschungsverbund „Biodiversität“ beteiligt, den die<br />
Leibniz-Gemeinschaft eingerichtet hat. Er hat eine Laufzeit<br />
von fünf Jahren und wird mit einer Anschubfinanzierung<br />
von 80.000 Euro aus den Mitteln des Impulsfonds des<br />
Leibniz-Präsidiums gefördert. Das Gleiche gilt auch für vier<br />
weitere Leibniz-Forschungsverbünde, die zu den Themen<br />
„Historische Authentizität“, „Nachhaltige Lebensmittelerzeugung<br />
und gesunde Ernährung“, „Nanosicherheit“ und<br />
„Bildungspotentiale“ eingesetzt wurden.<br />
Die Leibniz-Forschungsverbünde sind fächerübergreifende<br />
Zusammenschlüsse von unterschiedlichen<br />
Institutionen, die wissenschaftlich und gesellschaftlich<br />
hochaktuelle Fragestellungen gemeinsam bearbeiten.<br />
Leibniz-Präsident Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer erklärt dazu,<br />
die Leibniz-Gemeinschaft werde „damit in besonderer<br />
Weise der Tatsache gerecht, dass alle großen internationalen<br />
wissenschaftlichen Herausforderungen wie<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Mitglieder des Leibniz-Forschungsverbundes „Biodiversität“<br />
etwa Bildung, Ernährung, Gesundheit und Ressourcenverfügbarkeit<br />
als Querschnittsaufgaben weder von den<br />
Geistes- und Sozialwissenschaften noch von den Natur-,<br />
Lebens- und Ingenieurwissenschaften allein abgedeckt<br />
werden können.“<br />
Der Verbund Biodiversität unterteilt sich in vier Schwerpunktbereiche:<br />
„Erfassung, Monitoring, Prognose“,<br />
„Ökosystemleistungen“, „Innovative Schutz- und Managementstrategien“<br />
sowie „Bürgerwissenschaften.“ Die <strong>ARL</strong><br />
bearbeitet zusammen mit anderen Instituten die beiden<br />
letzteren Schwerpunktbereiche. Sie wird sich u. a. mit<br />
dem Landnutzungswandel und den Wirkungen von unterschiedlichen<br />
Schutz- und Managementstrategien auf die<br />
Vorkommen und die Ausbreitung von Arten beschäftigen.<br />
Ansprechpartner in der <strong>ARL</strong> ist Peter Müller.<br />
Quelle: Antrag zur Einrichtung eines Leibniz-Forschungsverbundes<br />
Björn Kallensee<br />
Peter Müller 0511 34842-22<br />
mueller@arl-net.de
Infrastrukturgroßprojekte:<br />
Akzeptanz durch<br />
Raumplanung<br />
<strong>ARL</strong>-Kongress<br />
am 21. / 22. Juni 2012<br />
in Leipzig<br />
Der <strong>ARL</strong>-Kongress fand in diesem Jahr besonders<br />
großen Zuspruch. Das aktuelle Thema „Infrastrukturgroßprojekte:<br />
Akzeptanz durch Raumplanung“ lockte<br />
im Juni über 200 Gäste nach Leipzig. Im Fokus der Veranstaltung<br />
stand das Akzeptanzdefizit bei Großprojekten.<br />
Man war in Leipzig angetreten die These zu verifizieren,<br />
dass ein verstärkter Einsatz der Raumplanung geeignet<br />
sei, bei Infrastrukturgroßprojekten die Akzeptanz bei<br />
Bürgern, aber auch aufseiten des Staates und der Betreiber<br />
der Anlagen zu steigern. Dabei kam man schnell<br />
überein, dass es nicht um eine „Pro-forma-Akzeptanz“<br />
gehen dürfe, um die Bürger ruhigzustellen, sondern<br />
um ein echtes Mitwirken der Bevölkerung. Tatsächlich<br />
reichten die Vorschläge von einer sinnvoll organisierten<br />
Bürgerbeteiligung in existierenden Verfahren bis hin<br />
zur Volksabstimmung. Viele sprachen sich sogar dafür<br />
aus, die Bürger nicht nur bei Fragen der Ausführung von<br />
Foto: M. von Bullion<br />
Neues Rathaus Leipzig<br />
Quelle: Calson2, wikipedia<br />
Veranstaltungen<br />
Großprojekten – also beim „Wie“ – in die Entscheidung<br />
einzubeziehen, sondern ihnen auch ein Mitspracherecht<br />
beim „Ob“ einzuräumen, also bei der Entscheidung, ob<br />
ein Projekt überhaupt in Angriff genommen werden soll.<br />
„Wutbürger als Aufklärer“<br />
Dr. Heiner Geißler, Bundesminister a. D., brachte die<br />
derzeitige Lage auf den Punkt: „Der Bürgerprotest ist<br />
eine Breitenbewegung geworden. Die Zivilgesellschaft<br />
inszeniert sich, und Politik und politische Parteien<br />
müssen reagieren.“ Dies sei eine Folge der Erfahrung<br />
der Menschen, nicht mehr in der<br />
sozialen Marktwirtschaft, sondern<br />
im Kapitalismus zu leben. „Die<br />
Bürger haben das Vertrauen in die<br />
Wirtschaft und das wirtschaftliche<br />
System verloren und übertragen<br />
dies auf die Politik.“ Mit ihren For-<br />
derungen nach mehr Transparenz<br />
und Beteiligung hätten sich die<br />
„Wutbürger als moderne Aufklärer<br />
entpuppt“, deren Protestverhalten<br />
neue Verfahren notwendig mache.<br />
Foto:<br />
M. v. Bullion<br />
Heiner Geißler spricht<br />
über seine Erfahrungen<br />
mit „Stuttgart 21“<br />
Ein objektives Verfahren ermöglicht die Raumordnung,<br />
„die in der öffentlichen Berichterstattung freilich selten<br />
vorkommt“, beklagte Prof. Dr.-Ing. Klaus Beckmann,<br />
Leiter des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu),<br />
Berlin, und forderte eine Novellierung des Raumordnungsgesetzes.<br />
„Die Raumordnung kann als neutraler Mittler fungieren“,<br />
so die Überzeugung von Prof. Dr. Wilfried Erbguth,<br />
Rostock, dem wissenschaftlichen Leiter des Kongresses.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
13
14<br />
Veranstaltungen<br />
Foto: M. von Bullion<br />
Der wissenschaftliche Leiter des Kongresses, Wilfried Erbguth, und<br />
der Vertreter der Stadt Leipzig, Bürgermeister Martin zur Nedden (v.l.)<br />
„Aber man muss das differenziert betrachten.“ Erbguth will<br />
keine „überschießende Bürgerbeteiligung“, sondern eine<br />
sinnvoll gebündelte. Ihm geht es nicht um mehr Beteiligung,<br />
sondern um qualifiziertere. Der Bürger darf nicht im<br />
Unklaren bleiben, wo er sich beteiligen kann und wo nicht.<br />
Und wenn sich jemand in den Prozess einbringen möchte,<br />
so muss ihm klar sein, welche Rechtswirkung von seinem<br />
Handeln ausgeht. Dies wird in der Öffentlichkeit jedoch<br />
häufig nicht diskutiert, weil das Wissen darüber fehlt.<br />
Was das Verfahren bislang nicht hergibt, das kann<br />
mitunter ein Mediator bewirken. Er kann helfen, die Prozesse<br />
transparenter zu machen und die Kommunikation<br />
zwischen Bürgern, Verwaltungen und Betreibern von<br />
Großprojekten als offenen Dialog gestalten. Erfahrungen<br />
mit dem Frankfurter Flughafen und mit anderen Projekten<br />
haben gezeigt, dass Planungsverfahren sogar kürzer und<br />
billiger werden, wenn der Bürgerprotest schon in einer<br />
frühen Planungsphase in konstruktive Bahnen gelenkt<br />
wird, weiß Henning Banthien von der Kommunikationsberatung<br />
IFOK. Und natürlich müssen alle am Verfahren<br />
Beteiligten auch Bescheid wissen, sprich, ihnen müssen<br />
alle Informationen zugänglich sein. Freilich – so merkte Dr.<br />
Maria Lezzi, Direktorin des<br />
schweizerischen Bundesamtes<br />
für Raumentwicklung<br />
(ARE), Bern, während<br />
der Podiumsdiskussion<br />
an: „Man muss lernen – auf<br />
der Verwaltungsseite – den<br />
Bürger in seiner Sprache zu<br />
informieren.“<br />
Foto: M. von Bullion<br />
Bernhard Heinrichs begrüßt<br />
die Tagungsgäste<br />
Den gemeinsamen Nenner<br />
des <strong>ARL</strong>-Kongresses<br />
2012 fasste <strong>ARL</strong>-Präsident<br />
Dr.-Ing. Bernhard Heinrichs<br />
zusammen: „Die Planung<br />
muss raus aus den Hinterzimmern.<br />
Alle Fakten<br />
gehören auf den Tisch und an diesen Tisch gehören<br />
alle am Verfahren Beteiligten, und zwar auf Augenhöhe.<br />
Dazu brauchen wir eine neue Kommunikationskultur<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
zwischen Verwaltung und Bürgern, die es erlaubt, alle<br />
Argumente gleichberechtigt anzuhören und öffentlich<br />
zu diskutieren.“<br />
Michaela Gräfin von Bullion 0511 34842-56<br />
bullion@arl-net.de<br />
Braunkohlebergbau und<br />
Pumpspeicherkraftwerke –<br />
Akzeptanzsteigerung durch<br />
Raumplanung?<br />
Fühlen sich Menschen an einer Entscheidung, die Auswirkungen<br />
auf ihr Leben hat, beteiligt, wenn sie nur<br />
über das Ergebnis der Entscheidung informiert werden?<br />
Kann von Ergebnisoffenheit gesprochen werden, wenn<br />
das „Ob“ eines Vorhabens im Verfahren nicht mehr zur<br />
Debatte steht? Für welche Akzeptanzsteigerung soll und<br />
kann die Raumplanung sorgen? Eine Arbeitsgruppe ging<br />
unter der Moderation von Prof. Dr. Gerold Janssen, Leibniz-Institut<br />
für ökologische Raumentwicklung, Dresden,<br />
diesen und weiteren spannenden Fragen nach.<br />
Tagebau Nochten<br />
Foto: R. Koch<br />
Dr. Robert Koch vom Regionalen Planungsverband<br />
Oberlausitz-Niederschlesien verdeutlichte am Beispiel<br />
des Braunkohleplanverfahrens Tagebau Nochten, dass sich<br />
die Raumplanung als Vermittlerin zwischen unterschiedlichen<br />
Interessen relativ häufig im Spannungsfeld zwischen<br />
Konfrontation und Kooperation bewegt. Um den Balanceakt<br />
in diesem Spannungsfeld zu bewältigen, wurde im Rahmen<br />
der Planungen für den Tagebau Nochten ein Beirat<br />
gegründet, der sich mit Erstellung und Umsetzung einer<br />
Entwicklungskonzeption für drei Gemeinden beschäftigt,<br />
die von den Auswirkungen des Bergbaus betroffen sind.<br />
Der Beirat bilde ein breites Spektrum überörtlicher und<br />
örtlicher Akteure aus Politik, Verwaltung, Privatwirtschaft<br />
und Zivilgesellschaft ab und biete einen geschützten<br />
Raum, um sich zu informieren, Meinungen auszutauschen<br />
und zu kooperieren, wodurch Vertrauen und Akzeptanz<br />
für das Verfahren entstehen könne, so Koch.<br />
Wie wichtig die Wahrnehmung eines fairen Planungsverfahrens<br />
ist, zeigte Frank Buchholz vom team ewen aus<br />
Darmstadt. Er untersuchte in seinem Vortrag den Einsatz<br />
eines runden Tisches im Rahmen der Planung eines
Pumpspeicherkraftwerks im südlichen Schwarzwald. Zu<br />
den Erfolgsfaktoren eines runden Tisches als Konfliktregulierungsinstrument<br />
zählen nach Buchholz eine faire Prozessgestaltung,<br />
die Einbindung der Entscheidungsträger<br />
und die Ergebnisoffenheit des Beteiligungsverfahrens, die<br />
in dem betrachteten Verfahren de facto nicht ausreichend<br />
gewesen sei. Buchholz plädierte in seinem Fazit u. a. dafür,<br />
informelle Verfahren der Beteiligung frühzeitiger einzusetzen,<br />
um Ergebnisoffenheit zu gewährleisten und formelle<br />
Planungsverfahren sinnvoll zu ergänzen.<br />
In der Diskussion wurde deutlich, dass eine an den<br />
fallspezifischen Kontext angepasste Beteiligung, die bestimmte<br />
Grundvoraussetzungen erfüllt, zur Akzeptanz<br />
von Planungsverfahren beitragen kann. Damit ist aber<br />
nicht unbedingt ein Konsens in der Sache verbunden,<br />
da es bei der Planung von Infrastrukturgroßprojekten<br />
auch in Zukunft vermutlich mehr Win-lose- als Win-win-<br />
Lösungen geben wird. Jedoch kann die Akzeptanz des<br />
Verfahrens zu einer höheren Akzeptanz der Ergebnisse<br />
führen, wenn neben den „Gewinnern“ auch die „Verlierer“<br />
den Entscheidungsprozess als nachvollziehbar und fair<br />
erachten, auch wenn die getroffene Entscheidung nicht<br />
den eigenen Vorstellungen entspricht.<br />
Peter Müller 0511 34842-22<br />
mueller@arl-net.de<br />
Verkehrsinfrastrukturgroß-<br />
projekte – wer treibt wen?<br />
In einer weiteren Arbeitsgruppe beschäftigten sich ca.<br />
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Thema<br />
„Akzeptanzsteigerung durch Raumplanung und Stimulus<br />
für Raumentwicklung: Verkehrsinfrastrukturgroßprojekte“.<br />
Die Moderation hatte Dipl.-Ing. Andreas Wizesarsky vom<br />
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,<br />
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen.<br />
Mit dem Vortrag „Wer treibt wen? – Infrastrukturgroßprojekte<br />
als Stimulus der Raumentwicklung?“ gaben Dr.-Ing.<br />
Wolfgang Jung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),<br />
und Prof. Dr.-Ing. Dirk Engelke, Hochschule für Technik<br />
Rapperswil, Schweiz, eine Einleitung in das Thema. Sie<br />
stellten als Praxisbeispiel das „Karlsruher System“ vor. Hier<br />
wurde seit den 1990er Jahren durch die Verbindung der<br />
Karlsruher Straßenbahn mit dem Eisenbahnnetz des Umlandes<br />
eine metropolitane Region gebildet. Diese umsteigefreie<br />
und damit attraktive Stadt-Umland-Verbindung hat<br />
inzwischen eine starke Veränderung der Siedlungsstruktur<br />
und der Baulandpreise im Umland zur Folge. Ein aktuelles<br />
Großvorhaben in diesem Zusammenhang ist zudem der<br />
Bau eines Stadtbahntunnels unter der Karlsruher Kaiserstraße<br />
und weiterer Parallelstrecken durch die Innenstadt.<br />
In der anschließenden Diskussion wurde auch anhand<br />
anderer ähnlicher Beispiele von koordinierter Siedlungsentwicklungspolitik<br />
entlang des schienengebundenen<br />
Nahverkehrs deutlich (u. a. Regierungsbezirk Düsseldorf,<br />
Karlsruher System: Tunnel und Parallelstrecke<br />
Veranstaltungen<br />
Oberschwabenbahn), dass die Raumordnung durch<br />
vorrausschauende Planung durchaus aktiv entwickeln<br />
kann. Kontrovers wurde allerdings die Frage diskutiert,<br />
ob die Schaffung von Infrastrukturen und Trassen für<br />
eine positive Entwicklung ausreichend sei, oder ob die<br />
organisatorischen und betrieblichen Bedingungen (beim<br />
ÖPNV z. B. die Takte und Tarife), auf die die Raumordnung<br />
i. d. R. keinen Einfluss hat, nicht eine viel größere Wirkung<br />
auf den Raum haben.<br />
Letztlich seien die politische Rückendeckung der Planung<br />
sowie eine frühzeitige und offene Kommunikation<br />
für das Gelingen von Verkehrsinfrastrukturgroßprojekten<br />
erforderlich, so das Fazit des Moderators.<br />
Enke Franck 0511 34842-57<br />
franck@arl-net.de<br />
Erfahrungen mit Infrastrukturprojekten<br />
in Frankreich und<br />
Großbritannien<br />
In der öffentlichen Wahrnehmung sind Infrastrukturgroßprojekte<br />
– vielleicht besonders durch die Proteste<br />
gegen „Stuttgart 21“ – sehr stark in den Fokus gerückt. Doch<br />
natürlich wurden sie auch schon zuvor kritisch diskutiert,<br />
wobei sich die Diskussion um solche Vorhaben keineswegs<br />
allein auf Deutschland<br />
beschränkt. Auch in den<br />
Nachbarstaaten, wie z. B. in<br />
Frankreich und Großbritannien,<br />
stellen solche Projekte<br />
große Herausforderungen<br />
für das politisch-administrative<br />
System dar. Über die<br />
Erfahrungen im Umgang mit<br />
Infrastrukturgroßprojekten<br />
in diesen beiden Ländern<br />
wurde in einer dritten Arbeitsgruppe<br />
des Kongresses<br />
berichtet.<br />
Dr. Dipl.-Ing. Ute Cornec<br />
von der Westfälischen Wilhelms-Universität<br />
in Müns-<br />
Quelle: Engelke, Jung<br />
Ute Cornec<br />
Foto: M. von Bullion<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
15
16<br />
Veranstaltungen<br />
Kreativer Widerstand gegen den Flughafen „Notre-Dame-des-Landes“ Quelle: nantesindimedia; les vertes<br />
ter referierte über die Planung des neuen Großflughafens<br />
„Notre-Dame-des-Landes“ bei Nantes (Frankreich), dessen<br />
Einzugsgebiet bis Rennes, Brest und La Rochelle reichen<br />
soll. Bereits 1963 entstand die Idee zu diesem Flughafen,<br />
die aber bedingt durch die Ölkrise in den 1970er<br />
Jahren nicht weiter verfolgt wurde. Erst im Jahr 2000 kam<br />
es zu einer „Wiederauferstehung“ des Projektes, das 2011<br />
staatlich beschlossen wurde. Trotz guter Gründe für die<br />
Errichtung des Flughafens steht das Vorhaben in starker<br />
Kritik – die seit über zehn Jahren mit sehr kreativen Protesten<br />
begleitet wird. Das Projekt wird unter anderem aus<br />
Gründen des Klima- und Landschaftsschutzes, aber auch<br />
wegen einer fehlenden Alternativenprüfung kritisiert. Die<br />
Frage nach der Realisierung des Vorhabens ist letztendlich<br />
noch ungeklärt, es gilt aber als „bébé“ des neuen französischen<br />
Premierministers Jean-Marc Ayrault.<br />
Quelle: Stefan Preuß<br />
Aktuelle Großprojekte im Übertragungsnetz von Großbritannien<br />
und Wales<br />
Über die Beteiligung der Öffentlichkeit und die Rolle<br />
der Raumplanung bei Energieinfrastrukturgroßprojekten<br />
in Großbritannien berichtete Dr. Stefan Preuß, Strategic<br />
Policy Advisor bei dem Unternehmen National Grid. National<br />
Grid ist der Betreiber des Übertragungsnetzes für<br />
Elektrizität und Gas und steht vor der Aufgabe, den Netzausbau<br />
in Großbritannien vorzunehmen. Der „Planning<br />
Act 2008“ sieht ein neues, integriertes Planungs- und<br />
Genehmigungsverfahren vor, das die Rolle der Öffentlichkeitsbeteiligung<br />
unterstreicht und damit dem Interesse<br />
der Bevölkerung an der Auseinandersetzung mit<br />
Großprojekten der Energieversorgung entgegenkommt.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Die Vorträge sowie die anschließende Diskussion haben<br />
noch einmal deutlich gemacht, dass das Thema „Infrastrukturgroßprojekte“<br />
eine europäische Untersuchung<br />
wert ist – womit die Auffassung der <strong>ARL</strong> bestätigt wurde:<br />
Sie hatte bereits vor dem Kongress beschlossen, sich mit<br />
dem Thema der Höchstspannungsleitungen in einem<br />
europäischen Arbeitskreis zu befassen. Hierzu wird noch<br />
in diesem Jahr ein Expertenworkshop durchgeführt.<br />
Andreas Stefansky 0511 34842-43<br />
stefansky@arl-net<br />
Infrastrukturgroßprojekte<br />
in Russland<br />
Mit gleich sechs spannenden Beiträgen zu Infrastrukturgroßprojekten<br />
in Russland wurden die<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitsgruppe des<br />
deutsch-russischen Workshops auf dem <strong>ARL</strong>-Kongress<br />
in Leipzig in eine für deutsche Planerinnen und Planer<br />
zum Teil doch sehr fremde Welt entführt. Dabei haben<br />
die russischen Gäste nicht nur über methodische<br />
Herangehensweisen zur statistischen Erfassung von<br />
Infrastruktureinrichtungen berichtet, sondern auch ganz<br />
konkrete Einblicke<br />
in die in Umsetzung<br />
befindlichen Vorhaben<br />
gegeben. Zwei<br />
der Beispiele werden<br />
im Folgenden<br />
kurz skizziert, alle<br />
Einzelbeiträge sind<br />
in deutscher Sprache<br />
als <strong>Download</strong><br />
auf der Homepage<br />
der <strong>ARL</strong> vorhanden.<br />
Foto: M. von Bullion<br />
Dolmetscher übersetzen die Vorträge<br />
beim deutsch-russischen Workshop<br />
Prof. Dr. Margarita F. Samjatina von der Russischen<br />
Akademie der Wissenschaften, Institut für Regionalökonomie,<br />
St. Petersburg, fokussierte in ihrem Beitrag auf die<br />
ökologischen Aspekte, die im Zusammenhang mit Infrastrukturgroßprojekten<br />
zu berücksichtigen sind. In einem<br />
von ihr gewählten Beispiel – dem Bau einer Ringautobahn
in St. Petersburg – wurden die Umweltauswirkungen zwar<br />
untersucht, führten aber nicht zu Abweichungen in der<br />
Planung. Einwände der Öffentlichkeit, vor allem aufgrund<br />
der Beeinträchtigung durch Lärm und Luftverschmutzung,<br />
werden vor Gericht geklärt, das Verfahren wurde bislang<br />
aber nicht final abgeschlossen. Es ist zu bezweifeln, so<br />
Samjatina, dass das Problem im Interesse der Anwohner<br />
gelöst wird.<br />
Ein weiteres Beispiel<br />
aus Russland, der Bau<br />
eines Zellstoff- und Papierproduktionswerks<br />
in der Republik Komi,<br />
vergegenwärtigte auf<br />
eindrucksvolle Weise<br />
die Tragweite von Infrastrukturgroßprojekten.<br />
Es wurde vorgetragen<br />
von Dr. Sc. Oec. Prof.<br />
Sergej W. Kusznetsov,<br />
ebenfalls von der Russischen<br />
Akademie der<br />
Wissenschaften, Institut<br />
für Regionalökonomie,<br />
St. Petersburg. Dieses<br />
Bauvorhaben in der<br />
dünn besiedelten Taiga-<br />
und Tundra-Region<br />
Nordwestrusslands ist<br />
eingebettet in die nationaleEntwicklungsstrategie<br />
2020 und stellt<br />
ein Wachstumsmodell<br />
mit einer neuen Sozialpolitik<br />
dar, die zu<br />
einem fünfprozentigen<br />
Wirtschaftswachstum<br />
in der strukturschwachen<br />
Region führen<br />
soll. Der Bau der Fabrik<br />
erfolgte in einem völlig<br />
unerschlossenen<br />
Waldgebiet. Neben<br />
Investitionen in die<br />
Holzindustrie und Produktionsinfrastruktur<br />
(Holzsäge- und Verarbeitungswerk,Zellstoffwerk,<br />
Papierfabrik,<br />
Transport-, Energieinfrastruktur,<br />
Kläranlage<br />
etc.) wurde eine komplett<br />
neue Wohnumfeldinfrastrukturgeschaffen.<br />
Veranstaltungen<br />
An den anschließenden Nachfragen und in der Diskussion<br />
wurde die Kluft zwischen den Paradigmen in<br />
Deutschland und Russland bei der Herangehensweise<br />
und Umsetzung der vorgestellten Projekte mehr als<br />
deutlich.<br />
Martina Hülz 0511 34842-28<br />
huelz@arl-net.de<br />
Investitionen in das Zellstoff- und Papierproduktionswerk Troizko-Petschersk<br />
Geplante Wohnumfeldinfrastruktur<br />
Quellen: S. W. Kusznetsov<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
17
18<br />
Veranstaltungen<br />
Planen wir zeitgemäß?<br />
Jahrestagung des Jungen Forums der <strong>ARL</strong><br />
„Raumentwicklung 3.0 – Gemeinsam die Zukunft der<br />
räumlichen Planung gestalten“ lautete das Thema der<br />
Jahrestagung des Jungen Forums vom 6. bis 8. Juni 2012<br />
in Hannover. Rund 60 Mitglieder hatten sich eingefunden<br />
und diskutierten im Kommunikationszentrum Pavillon in<br />
vier thematischen Arbeitsgruppen Aspekte zukünftiger<br />
Raumentwicklung. Einig waren sich alle darüber, dass<br />
Raumplanung notwendig ist – mehr denn je! Die Herausforderungen<br />
der Energiewende, des Klimawandels<br />
und des demografischen Wandels sind hierbei wichtige<br />
Handlungsbereiche. Als bedeutendste Maßnahmen,<br />
um den Herausforderungen zu begegnen, wurden die<br />
Beteiligung der Bevölkerung und der Einsatz neuer<br />
technologischer Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert.<br />
Zur Eröffnung wurde das diesjährige Organisationsteam<br />
vorgestellt: Dipl.-Ing. Peter Müller, Sara Reimann, M.<br />
Sc., und Dipl.-Geogr. Timm Wiegand aus der Geschäftsstelle<br />
der <strong>ARL</strong>, Dipl.-Ing. Maike Levin-Keitel, Dipl.-Geogr.<br />
Martin Sondermann, Dipl.-Ing. Katja Stock und Dipl.-Ing.<br />
Friederike Maus von der Leibniz Universität Hannover sowie<br />
Dr. Patrick Küpper vom Johann Heinrich von Thünen-<br />
Institut in Braunschweig hatten die jährlich stattfindende<br />
Tagung vorbereitet.<br />
In seinem Begrüßungsvortrag setzte sich Prof. Dr.-Ing.<br />
Dietmar Scholich, Generalsekretär der <strong>ARL</strong>, mit dem<br />
aktuellen Stand, den vielfältigen Herausforderungen und<br />
den Perspektiven der Raumplanung auseinander. Auch<br />
die folgenden Beiträge sowie die Diskussionen in den<br />
Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit Lösungsvorschlägen<br />
zu den von Scholich benannten Herausforderungen.<br />
Anschließend wurde in drei Keynote-Vorträgen ein<br />
thematischer Ausblick in aktuelle Forschungsthemen<br />
und handlungsrelevante Bereiche der Planungspraxis<br />
gegeben:<br />
Prof. Dr.-Ing. Uwe Altrock, Universität Kassel, widmete<br />
sich dem Wandel der Instrumente in der Planung. Anhand<br />
abwechslungsreicher Beispiele identifizierte er Kunst,<br />
Architektur und Grünflächengestaltung als zentrale Elemente<br />
der Raumgestaltung und Planung.<br />
Dr. Sandra Huning von der Technischen Universität<br />
Dortmund nahm Bezug auf soziologische Aspekte der<br />
räumlichen Planung. Ausgehend von der Frage „Wer plant<br />
für wen?“ machte sie deutlich, dass Planung sowohl genderspezifisch<br />
als auch ethnienspezifisch stattfinden muss.<br />
Dr.-Ing. Klaus Habermann-Nieße vom Architektur- und<br />
Stadtplanungsbüro „planzwei“ in Hannover ergänzte die<br />
bisherigen Aspekte um weitere Praxisbeispiele. Er sprach<br />
über aktivierende Bürgerbeteiligung in der Stadt- und<br />
Raumentwicklung und nannte dabei Beispiele wie das<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Blick in die Runde: (v.l.) Uwe Altrock, Sandra Huning,<br />
Dietmar Scholich<br />
„Guerilla gardening“, die Aufstellung von Aktionscontainern<br />
für Jugendliche in Berlin und die Gründung eines<br />
Mehrgenerationenhauses in Düsseldorf. Außerdem<br />
thematisierte er den Prozess der Erstellung eines neuen<br />
regionalen Raumordnungsprogramms der Region<br />
Hannover, der von einer aufwendigen onlinegestützten<br />
Bürgerbeteiligung begleitet wird.<br />
Nach diesen ersten Vorträgen, die Facetten des Tagungsthemas<br />
umrissen und gezieltes Interesse weckten, schloss<br />
der erste Tag der Veranstaltung mit einer Diskussion der<br />
angesprochenen Fragen. Am Abend trafen sich die Teilnehmenden<br />
zu einem gemeinsamen Abendessen in der<br />
hannoverschen Innenstadt.<br />
Diskussionen in den Arbeitsgruppen<br />
Foto: K. Stock<br />
Zusätzlich motiviert von den Keynote-Vorträgen kamen<br />
die Teilnehmer am zweiten Tag im Kommunikationszentrum<br />
Pavillon am Raschplatz in vier themenspezifischen<br />
Arbeitsgruppen zusammen.<br />
Arbeitsgruppen<br />
des Jungen<br />
Forums 2012<br />
Foto: L. Trautmann
Die Arbeitsgruppe „Virtuelle<br />
Räume“ beschäftigte sich mit<br />
der Bedeutung der modernen<br />
Informationstechnologien in<br />
der Regional- und Stadtplanung.<br />
Die Vorteile für eine räumliche<br />
Informationsverteilung und die<br />
Organisation von Abläufen, z. B.<br />
für die medizinische Versorgung<br />
in ländlichen Räumen, sind nicht<br />
von der Hand zu weisen. Vieles<br />
geht schneller und einfacher<br />
mithilfe einer nahezu barrierefreien<br />
Kommunikation über Foto: L. Trautmann<br />
das Internet. Dennoch warf die<br />
Gruppe einige Fragen auf: Kann<br />
politische Aktivität auch im Netz stattfinden? Und bleibt<br />
nicht der zwischenmenschliche Kontakt auf der Strecke?<br />
– Ein Beispiel aus Manchester zeigte das Gegenteil. Dort<br />
existiert eine Internetplattform für junge Unternehmer,<br />
über die sich die Mitglieder zu geschäftlichen Treffen in<br />
der „realen Welt“ verabreden. Als weitere Beispiele der<br />
wachsenden Relevanz virtueller Räume wurden die Einflüsse<br />
auf den Einzelhandel und das Gesundheitswesen<br />
diskutiert.<br />
Die Arbeitsgruppe „Räumliche Planung im (Werte-)<br />
Wandel“ diskutierte die Frage, ob sich die Raumplanung<br />
schon auf dem Weg in die Zukunft befinde. Ein Aspekt<br />
der räumlichen Betrachtung waren die Metropolregionen.<br />
Die Teilnehmenden stellten fest, dass deren effektive<br />
Steuerung eine Schwierigkeit darstellt.<br />
Ein weiterer Fokus wurde auf unternehmerisches Engagement<br />
in der Raumentwicklung gelegt. Man diskutierte<br />
aktuelle Entwicklungen und Perspektiven, insbesondere<br />
die spannende Frage, ob es bei fortschreitender Privatisierung<br />
der Raumplanung auch eine private Verantwortung<br />
für den Raum im Sinne einer „Corporate Spatial Responsibility“<br />
gebe.<br />
Die Arbeitsgruppe „Perspektiven der Partizipation“<br />
setzte sich mit der Relevanz von Bürgerbeteiligung in<br />
der Raumplanung auseinander. Gegenstand der Debatte<br />
waren u. a. Methoden wie der „Runde Tisch“, „Mediation“<br />
und „Vor-Ort-Interventionen“. Die Gruppe sprach<br />
Foto: K. Stock<br />
Vorstellung der AG-Ergebnisse<br />
Gruppenarbeit<br />
Veranstaltungen<br />
sich für das Konzept der „Lernenden Region“ aus, das<br />
davon ausgeht, dass Bürgerinnen und Bürger Beteiligung<br />
erst erlernen und die Planerinnen und Planer Vertrauen<br />
aufbauen müssen. Nur durch Übung und kontinuierliche<br />
Interaktion zwischen beiden beteiligten Seiten kann erreicht<br />
werden, dass sich Bürgerinnen und Bürger aktiv in<br />
den Planungsprozess einbringen.<br />
Um „Klimawandel, Energiewende und Ökosystemdienstleistungen“<br />
ging es in der dritten Arbeitsgruppe,<br />
die ökologische Herausforderungen und die Steuerungsfunktion<br />
der Raumplanung diskutierte. Grundsätzlich<br />
wurde hier die Bedeutung des Planers / der Planerin als<br />
aktivierender Faktor in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern<br />
herausgestellt. Die Gruppe ging auch der<br />
Frage nach, wie Ökosystemdienstleistungen in die Landschaftsplanung<br />
mit einbezogen werden können, um den<br />
Nutzen von Ökosystemen für den Menschen stärker zu<br />
verdeutlichen. Außerdem wurde das Projekt „dynaklim“<br />
als praktisches Beispiel für die Anpassung regionaler<br />
Planungs- und Entwicklungsprozesse an die Herausforderungen<br />
des Klimawandels vorgestellt.<br />
Am Donnerstagnachmittag führten fachlich begleitete<br />
Exkursionen auf dem Fahrrad oder zu Fuß durch verschiedene<br />
Stadtteile Hannovers. Inhaltlich ging es bei den<br />
Touren um „Brachen in der Stadt“, „Konflikte der Stadtentwicklung“,<br />
„Hochwasserproblematik in der Stadt“ und<br />
„Denkmalschutz in historischen Gartenanlagen“.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
19
20<br />
Veranstaltungen<br />
Am letzten Tag wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen<br />
in einem Wandelgang präsentiert und zur Diskussion<br />
gestellt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen, bei<br />
dem Hanne Bangert vom Pavillon Hannover eine Dinner<br />
Speech zur Geschichte des Kommunikationszentrums<br />
hielt, sprachen Prof. Dr. Dietrich Fürst, Hannover, und Prof.<br />
Dr. Axel Priebs, Dezernent der Region Hannover, über<br />
Zukunftsaussichten der Raumplanung. Während sich Fürst<br />
dem Einfluss der Regionalplanung auf die Raumplanung<br />
widmete, nahm Priebs Bezug auf das Wechselspiel von<br />
Deregulierung und öffentlichem Gestaltungsanspruch.<br />
In einem Punkt waren sich beide einig: Raum- und Regionalplanung<br />
müssen sich an neue Umweltbedingungen<br />
anpassen und können nur bei ständiger Selbstreflexion<br />
und Evaluation der angewendeten Konzepte und Instrumente<br />
erfolgreich sein.<br />
Zum Abschluss der Tagung reichte Dietmar Scholich<br />
den Staffelstab an die Vertreter des Organisationsteams<br />
des Jungen Forums 2013 weiter. Stellvertretend für das<br />
Vorbereitungsteam aus Kaiserslautern äußerte Dipl.-Ing.<br />
Martina Hengst, Technische Universität Kaiserslautern,<br />
den Wunsch, viele Mitglieder des Jungen Forums auch<br />
im nächsten Jahr wieder begrüßen zu können.<br />
Maike Schlote<br />
Timm Wiegand 0511 34842-31<br />
wiegand@arl-net.de<br />
Das EU-geförderte Projekt, in dem die <strong>ARL</strong> einer<br />
von 29 Partnern aus sechs Staaten ist, befasst sich<br />
mit dem Aufbau eines Fortbildungssystems und der Erarbeitung<br />
von Fortbildungsbausteinen auf dem Gebiet<br />
der nachhaltigen ökologischen Entwicklung ländlicher<br />
Räume in Russland. Verschiedene Partnerinstitutionen<br />
aus Westeuropa arbeiten darin mit elf agrarwissenschaftlichen<br />
Universitäten zusammen. Es hat zum Ziel, Verwaltungsangestellte<br />
der ländlichen Regionalentwicklung zu<br />
qualifizieren.<br />
In der ersten Juliwoche kamen Vertreterinnen und Vertreter<br />
der Partnerinstitutionen im sibirischen Ulan-Ude<br />
zusammen, um die Entwicklung der Fortbildungsmodule<br />
zu diskutieren, die ersten Erfahrungen mit Fortbildungsseminaren<br />
an verschiedenen russischen Standorten<br />
auszutauschen sowie die für Mitte November terminierte<br />
Abschlusskonferenz des Projekts vorzubereiten.<br />
Zur Zukunft<br />
des Jungen Forums<br />
TEMPUS-Projekt RUDECO<br />
auf der Zielgeraden<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Das Präsidium der <strong>ARL</strong> hat eine neue Geschäftsordnung<br />
für das Junge Forum verabschiedet.<br />
Darin ist festgelegt, dass eine Lenkungsgruppe eingesetzt<br />
wird. Außerdem regelt die Geschäftsordnung<br />
die Finanzierung der Jahrestagung.<br />
Viele Mitglieder des Jungen Forums möchten das<br />
Nachwuchsgremium der <strong>ARL</strong> auch zukünftig attraktiv<br />
und effektiv gestalten. Einige engagierte Mitglieder<br />
aus Nordrhein-Westfalen haben sich zusammengetan,<br />
um erstmals ein Treffen des Jungen Forums auf<br />
Landesebene zu organisieren. In diesem Rahmen<br />
sollen landesspezifische Themen der Raumplanung<br />
diskutiert werden. Die Initiative aus NRW könnte<br />
sich als gutes Beispiel für die Organisation anderer<br />
Landesgruppen erweisen.<br />
Die in Hannover anwesenden Mitglieder beschlossen,<br />
sich künftig intensiver im Internet auszutauschen.<br />
Dazu wollen sie „My<strong>ARL</strong>“, den internen Bereich der<br />
<strong>ARL</strong>-Internetseite, gemeinsam stärker nutzen.<br />
Die 16. Jahrestagung des Jungen Forums wird vom<br />
29.–31. Mai 2013 in Kaiserslautern stattfinden. Dort<br />
wird auch über die Umsetzung des Engagements auf<br />
Landesebene und die Nutzung der internen Kommunikations-<br />
und Diskussionsplattform berichtet.<br />
Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, allen voran Zoya<br />
Yampilowa, hatten in bestens ausgestatteten Räumlichkeiten<br />
für eine gute Arbeitsatmosphäre gesorgt. Selbst<br />
der Präsident der Agrarwissenschaftlichen Akademie<br />
Foto: E. Gustedt<br />
Bibliotheksgebäude, Außenstelle der Akademie
der Republik Burjatien und Gastgeber der Veranstaltung,<br />
Alexander Popow, ließ es sich nicht nehmen, für mehr als<br />
nur Begrüßungsworte an den Sitzungen teilzunehmen: Er<br />
trug russische Volksweisen vor.<br />
Aus verschiedenen Administrationen der Region waren<br />
weitere Gäste zugegen, die mit Interesse die Präsentationen<br />
der verschiedenen Module verfolgten und sich rege<br />
an den Diskussionen beteiligten. Selbst für die Medien<br />
(Zeitung und Funk/Fernsehen) war die Projektkonferenz<br />
von Interesse, sie gingen für Interviews auf verschiedene<br />
Personen aus dem In- und Ausland zu. Die Veranstaltung<br />
fand zum Teil im Hauptgebäude der Akademie in Ulan-<br />
Ude, zum Teil in einer Außenstelle am Ufer des Baikalsees<br />
statt, wo man über eine eigene kleine Bibliothek verfügt.<br />
Die Fortbildungsmodule waren in den Monaten vor der<br />
Konferenz je nach Bearbeitungsstand in ersten Testseminaren<br />
in verschiedenen Modellregionen zur Anwendung<br />
gekommen. Aus diesen Anwendungen zog man nun<br />
Rückschlüsse auf die Praktikabilität der Module, die Fülle<br />
und Präsentation des Lehrinhalts sowie die Dauer einer<br />
Fortbildungseinheit. Daraus resultierten Überarbeitungsprozesse<br />
und Rückkoppelungen zwischen den russischen<br />
und westeuropäischen Partnern. Letztere fungieren gewissermaßen<br />
als Paten für die Erarbeitung der Module.<br />
Das Projektteam diskutierte vor allem über die Dauer<br />
der Fortbildungseinheiten in Verbindung mit dem<br />
jeweils angebotenen Lehrinhalt. Dieser Aspekt ist insbesondere<br />
vor dem Hintergrund von Bedeutung, dass<br />
Verwaltungspersonal Fortbildungen vorweisen können<br />
muss, um innerhalb der Verwaltung bessere Positionen<br />
einnehmen zu können. Alle Anbieter von Fortbildungen,<br />
privatwirtschaftlich organisierte wie auch die russischen<br />
Universitäten und Akademien, müssen bestrebt sein, für<br />
ihre jeweiligen Fortbildungsangebote staatliche Zertifizierungen<br />
zu erhalten. Die westeuropäischen Partner innerhalb<br />
des RUDECO-Projekts wollen deswegen jedoch in<br />
keiner Weise von einem qualitativ anspruchsvollen, dem<br />
jeweiligen Projektthema gerecht werdenden Niveau der<br />
Fortbildung abrücken.<br />
Es handelt sich um elf thematisch unterschiedliche<br />
Module, die sich alle der nachhaltigen ländlichen Regionalentwicklung<br />
zuordnen lassen. Dabei werden, um nur<br />
Konferenzsaal im Hauptgebäude der Akademie<br />
Veranstaltungen<br />
einige Themen herauszugreifen, Fragen von Eco-Labeling,<br />
Setzung und Kontrolle von Standards, Ökotourismus,<br />
Umstellung auf ökologischen Landbau, Lebensmittelsicherheit,<br />
Ökologie und Biodiversität, nachhaltiger<br />
Umgang mit Wasserressourcen und Ähnliches mehr bearbeitet.<br />
Die Website des Projekts gibt näheren Aufschluss:<br />
http://www.tempus-rudeco.ru/en/.<br />
Foto: A. Thomas<br />
Arbeitsergebnisse der Konferenz<br />
Foto: A. Thomas<br />
Bis zum Abschluss des Projekts bleibt noch einiges an<br />
Herausforderungen zu meistern, denn auch die Übersetzungen<br />
der einzelnen Module in die englische Sprache<br />
sind keine leichte Aufgabe. Positiv kann bereits jetzt<br />
vermerkt werden, dass nach den Testseminaren einige<br />
Regionen gegenüber den russischen Partnerinstitutionen<br />
Interesse an weiteren Fortbildungsseminaren geäußert<br />
haben. Nach Projektende sollten alle Module mindestens<br />
von den elf am Projekt beteiligten agrarwissenschaftlichen<br />
Fakultäten für Fortbildungszwecke von Verwaltungspersonal<br />
genutzt werden.<br />
Evelyn Gustedt 0511 34842-29<br />
gustedt@arl-net.de<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
21
22<br />
Veranstaltungen<br />
Raumordnung: Normierung oder<br />
informelle Raumentwicklung?<br />
Die 28. Fortbildungsveranstaltung<br />
für Landes- und Regionalplaner<br />
in Bayern – veranstaltet<br />
von der <strong>ARL</strong> gemeinsam mit dem<br />
Bayerischen Staatsministerium<br />
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr<br />
und Technologie – fand in<br />
diesem Jahr in den Räumen der<br />
Sparkassenakademie in Landshut<br />
statt. Rund 80 Fachleute kamen<br />
am 10. Juli 2012 zusammen, um<br />
zu diskutieren, wie die Zukunft Foto: StMWIVT<br />
der räumlichen Planung aussehen<br />
kann: Welchen Stellenwert haben<br />
künftig die rechtlich normierten Elemente räumlicher<br />
Planung, welchen die informellen Instrumente? Wie viel<br />
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist notwendig,<br />
wie viel ist sinnvoll? Wie positioniert sich die Regionalund<br />
Landesplanung zwischen kaum zu beeinflussenden<br />
gesellschaftlichen Entwicklungen, den Interessen von<br />
Fachplanungen und Kommunen? Wie kann dieser „Spagat“<br />
künftig besser gelingen?<br />
Fragen dieser Art bewegen nicht nur die in der Praxis<br />
tätigen Planerinnen und Planer, sie sind auch Gegenstand<br />
intensiver wissenschaftlicher Diskussionen. So war es<br />
Anliegen der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung,<br />
Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Planungspraxis<br />
und Kommunalpolitik zusammenzubringen, um<br />
eine Positionsbestimmung vorzunehmen. Der Zeitpunkt<br />
dieser Veranstaltung war angesichts der bayerischen Reformen<br />
im Bereich der Landesplanung günstig. Das neue<br />
bayerische Landesplanungsgesetz ist seit 1. Juli 2012 in<br />
Kraft, der Entwurf für die Gesamtfortschreibung des bayerischen<br />
Landesentwicklungsprogramms befindet sich<br />
in der sogenannten Verbändeanhörung, sodass hierauf<br />
immer wieder Bezug genommen werden konnte.<br />
Raumordnung im Spannungsfeld<br />
der Interessen und Erwartungen<br />
Den Einführungsvortrag hielt Prof. Dr. Axel Priebs, Erster<br />
Regionsrat der Region Hannover, zum Thema „Beharrlichkeit<br />
und Beweglichkeit: Raumordnung im Spannungsfeld<br />
der Interessen und Erwartungen“. Priebs erläuterte die Herausforderungen,<br />
die sich aufgrund des übergeordneten<br />
und koordinierenden Charakters der räumlichen Planung<br />
ergeben. Oftmals sei die Planung „eingezwängt“ zwischen<br />
marktwirtschaftlichen Entwicklungen einerseits und staatlicher<br />
Gemeinwohlorientierung andererseits, zwischen<br />
Ordnungsfunktion einerseits und Entwicklungsaufgabe<br />
andererseits, zwischen rechtlich vorgegebenen Abläufen<br />
und Verfahren einerseits und Überzeugungsarbeit<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
v. l.: C. Jacoby, J. Mend, B. Seelbinder, A. Priebs<br />
und Diskussionen andererseits. Kurzum: Der Möglichkeitsraum,<br />
der sich Planerinnen und Planern darstellt, ist<br />
nicht immer groß, nicht immer frei von Reibungen und<br />
vor allem nicht frei von Einflussnahmen vieler Akteure.<br />
Gleichwohl gebe es, und dies machte Priebs an vielen<br />
Beispielen deutlich, genügend raumbedeutsame Entwicklungen<br />
und Konflikte, zu deren Lösung und Befriedung<br />
die räumliche Planung einen Beitrag leisten konnte und<br />
kann. Hierzu zähle unter anderem das Festhalten an den<br />
Prinzipien des Zentrale-Orte-Konzepts, das eine verantwortungsvolle<br />
Ausweisung Zentraler Orte einschließt,<br />
was auch zu einer Attraktivitätssteigerung der Innenstädte<br />
und zur Sicherung der flächendeckenden Nahversorgung<br />
geführt habe. Als Erfolg der Raumordnung könne zudem<br />
die Eindämmung des Siedlungswachstums „in die Fläche“<br />
verbucht werden, nicht zuletzt durch die „Einheit<br />
von Siedlung und Verkehr“, also das Ausweisen von<br />
Siedlungsgebieten an Haltepunkten des Schienenpersonennahverkehrs.<br />
Mit Blick auf die Zukunft gelte es, die<br />
Potenziale der räumlichen Planung zu erkennen, sie zu<br />
kommunizieren und auch gegenüber manchen Interessen<br />
der Fachplanungsträger und Kommunen durchzusetzen.<br />
Priebs‘ Bild von der künftigen Rolle der Raumordnung ist<br />
das eines gesellschaftlichen Dienstleisters. Raumordnung<br />
schaffe Planungssicherheit und damit auch Investitionssicherheit<br />
für Wirtschaft und öffentliche Planungsträger.<br />
Sie ermögliche die Durchsetzung des Gemeinwohls<br />
gegenüber Partikularinteressen, sie sichere die Qualität<br />
des Raums, beispielsweise gegen eine unkontrollierte<br />
Bebauung und Zersiedelung, sie könne Flächen langfristig<br />
sichern und somit Entwicklungsoptionen für künftige<br />
Generationen erhalten. Diese Qualitäten müssten jedoch<br />
besser als bisher vermittelt werden, gerade auch an die<br />
Kommunen. Priebs gab zu, dass Raumordnung nicht<br />
„everybody‘s darling“ sein könne, sie habe jedoch eine<br />
wichtige Funktion als Beratungs- und Moderationsinstanz.<br />
Kann sie sich in diesem Sinne künftig noch stärker<br />
als Dienstleister und Problemlöser positionieren, dürfte
ihre Akzeptanz größer werden – angesichts der zunehmenden<br />
Geschwindigkeit des räumlichen Wandels eine<br />
überfällige Entwicklung.<br />
Podiumsdiskussion<br />
An den Vortrag schloss sich eine Podiumsdiskussion an, an<br />
der neben Priebs Prof. Dr. Uwe Altrock von der Universität<br />
Kassel, Erster Bürgermeister Josef Mend (Erster Vizepräsident<br />
des Bayerischen Gemeindetages), Oberbürgermeisterin<br />
Dr. Birgit Seelbinder (Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses<br />
des Bayerischen Städetags) und Landrat<br />
Hermann Steinmaßl (Sprecher der Arbeitsgemeinschaft<br />
der regionalen Planungsverbände in Bayern) teilnahmen.<br />
Die Moderation hatte Prof. Dr. Christian Jacoby von der<br />
Universität der Bundeswehr München übernommen.<br />
Die These Altrocks lautete, dass es an der rechtlichen<br />
und organisatorischen Konstruktion der Landes- und<br />
Regionalplanung selbst liege, dass über ihre Abschaffung<br />
immer wieder diskutiert wird. Folglich sollte das Planungssystem<br />
insgesamt reformiert und in ein System verwandelt<br />
werden, das es der Landes- und Regionalplanung erlaubt,<br />
mit größeren Kompetenzen und mit eigenen finanziellen<br />
Budgets die räumliche Entwicklung aktiv zu steuern. Erwartungsgemäß<br />
hoben die Vertreterinnen und Vertreter aus<br />
den bayerischen Kommunen deren Rolle und Bedeutung<br />
hervor. Sie forderten von der bayerischen Staatsregierung<br />
klare Vorgaben für die kommunale Entwicklung und stellten<br />
auf das Subsidiaritätsprinzip ab. Teilweise wurde mehr<br />
Vertrauen in die Regional- und Kommunalpolitik seitens<br />
der Landespolitik und -planung gefordert, teilweise für eine<br />
Beraterrolle der Landes- und Regionalplanung plädiert, die<br />
das politische Handeln den gewählten Vertreterinnen und<br />
Vertretern vor Ort überlassen solle.<br />
In der Diskussion wurde das eingangs von Priebs skizzierte<br />
Spannungsfeld der räumlichen Planung sehr deutlich.<br />
Insbesondere Vertreter der Wissenschaft und der Planungspraxis<br />
sehen in der Landes- und Regionalplanung ein<br />
Steuerungsinstrument, das wichtige Dienste leisten kann,<br />
um übergeordnete raumentwicklungspolitische Ziele umzusetzen,<br />
um auch von den Kommunen nicht erwünschte<br />
Entwicklungen einzudämmen und um widerstreitende<br />
Interessen befrieden zu können. Die Vertreterinnen und<br />
Vertreter der Städte und Gemeinden sehen dies etwas<br />
anders und berufen sich auf ihre eigene Kompetenz, die<br />
sie gern gestärkt sähen.<br />
Wie weiter? Auf diese Frage konnten in Landshut selbstverständlich<br />
keine abschließenden Antworten gegeben<br />
werden. Allerdings deuten Überlegungen hinsichtlich<br />
einer verbesserten Organisation der Landes- und Regionalplanung<br />
einschließlich einer möglicherweise geänderten<br />
Aufgabenverteilung zwischen kommunaler, regionaler<br />
und Landesebene, sowie hinsichtlich eines gewandelten<br />
Selbstverständnisses der Raumordnung hin zu einer Stärkung<br />
der Moderations- und Dienstleistungsfunktion in eine<br />
Richtung, die es weiterzudenken gilt.<br />
Andreas Klee 0511 34842-39<br />
klee@arl-net.de<br />
Veranstaltungen<br />
Call for Papers<br />
für den <strong>ARL</strong>-Kongress 2013<br />
„Regionale Stadtlandschaften“<br />
Die in vielen Köpfen vorherrschende Vorstellung „Hier<br />
die Stadt, dort die Landschaft“ spiegelt nicht die Wirklichkeit<br />
und die Vielfalt der Raumstruktur in Deutschland<br />
und Europa wider. Die Grenzen zwischen Stadt und Land/<br />
Landschaft verschwimmen immer mehr und lösen sich zum<br />
Teil sogar auf. Auf der einen Seite verstädtert die Landschaft,<br />
auf der anderen Seite erobert sie Freiräume in der Stadt.<br />
Die Stadtlandschaften, in denen wir leben, wohnen und<br />
arbeiten, verändern sich in rasantem Tempo. Megatrends<br />
wie die Globalisierung, der demografische Wandel, die<br />
Pluralisierung der Lebensstile, der Klimawandel und die<br />
Energiewende prägen die Entwicklung urbaner, suburbaner<br />
und ländlich-peripherer Räume. Diese Raumkategorien können<br />
jedoch nicht mehr unabhängig voneinander betrachtet<br />
werden, da zwischen ihnen zahlreiche Interdependenzen<br />
bestehen. Eine disziplinübergreifende, integrative Sichtweise<br />
– eine regionale Betrachtungsweise – ist erforderlich, um<br />
den Wandel, dem regionale Stadtlandschaften unterworfen<br />
sind, genauer zu analysieren, zu verstehen und zu gestalten.<br />
Der Kongress am 6./7. Juni 2013 in Hamburg setzt sich mit<br />
dem Wandel und der Gestaltung regionaler Stadtlandschaften<br />
auseinander. Neben der bereits angesprochenen Analyse<br />
des Wandels soll ein Austausch darüber stattfinden, wie<br />
Probleme integrativ angegangen werden können, die nicht<br />
an den bestehenden politisch-administrativen Grenzen der<br />
Stadt oder ihres Umlandes haltmachen, sondern die gesamte<br />
Stadtlandschaft mit all ihren Verflechtungen betreffen. Der<br />
Kongress widmet sich aber auch (kultur)landschaftlichen<br />
Qualitäten und Potenzialen urbaner und suburbaner Räume,<br />
die es planerisch in Wert zu setzen gilt.<br />
Sechs Panels zu unterschiedlichen Themenfeldern sollen<br />
dem intensiven Wissensaustausch dienen:<br />
■ Chancen und Risiken der Folgen des Klimawandels und<br />
der Energiewende<br />
■ Räumliche Implikationen der Veränderung von Mobilität<br />
und Arbeit<br />
■ Regionale Stadtnaturen – Stadt in der Natur, Natur in der<br />
Stadt<br />
■ Städtische Infrastrukturlandschaften planen und gestalten<br />
■ Soziales Miteinander vor Ort fördern und gestalten<br />
■ Die Entwicklung regionaler StadtLandschaften integrativ<br />
steuern<br />
Um die Panels des Kongresses mit Leben zu füllen, benötigen<br />
wir Ihre aktive Unterstützung! Alle Interessierten – in<br />
Wissenschaft oder Praxis tätig – sind herzlich eingeladen, sich<br />
mit eigenen Vorträgen in den <strong>ARL</strong>-Kongress 2013 inhaltlich<br />
einzubringen.<br />
Nähere Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten<br />
(Bewerbungsschluss ist der 15. November 2012!) und den<br />
Panels finden Sie unter: www.arl-net.de/arl-kongress-2013.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
23
24<br />
Veranstaltungen<br />
International Summer School 2013<br />
Sustainable Governance<br />
of Land and Water<br />
The theme: Sustainable Governance<br />
of Land and Water<br />
Sustainable governance of land and water is one of<br />
the major challenges of our times. Floods, droughts,<br />
pollution, drink water and cooling water supply, or<br />
subsurface water are merely just challenges for engineers.<br />
As engineering and technical solutions reach its<br />
thresholds, challenges for new modes of governance<br />
of land and water emerge. Environmental constraints<br />
of land and water require particular attention in regional<br />
and local spatial planning. Managing retention<br />
areas for fl oods and droughts, designing of resilient<br />
urban waterfronts, implementing fl oating homes, or<br />
drink water supply and wastewater management in<br />
shrinking cities are just a few examples where spatial<br />
planning steps into the governance arena of water<br />
management.<br />
Water management and spatial planning pursue<br />
different modes of governance. As for example with<br />
respect to land management, water management authorities<br />
tend to acquire land to realize measures (e.g.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
25 to 28 August 2013, Utrecht (The Netherlands)<br />
Six places available!<br />
retention areas, dams, etc.), whereas spatial planning<br />
agencies facilitate land uses by rules and regulations.<br />
Whereas water management is usually equipped with<br />
relatively comfortable budgets, spatial planners are<br />
asked to intervene in spatial developments without<br />
a noteworthy budget. In addition, many institutional<br />
developments ask for innovative governance concepts<br />
in the overlapping fi eld of land and water management.<br />
For example, the European fl ood risk management<br />
directive demands plans that integrate spatial planning<br />
and fl ood risk management. Another example are<br />
claims for extensions of water ways to increase harbour<br />
capacities, which leads to confl icts with spatial planning<br />
authorities, such as at the Elbe in Hamburg or along the<br />
Hedwigepolder, as also along the large water corridors<br />
in Europe – such as Rotterdam-Genua.<br />
New challenges<br />
© Thorsten Bätge - wikipedia<br />
So, in a society that intensifi es and expands the use of<br />
both – land and water – spatial planning and water management<br />
are asked to fi nd innovative and path-break-
ing ideas and approaches for setting up governance<br />
schemes for sustainable cities of the future. What are<br />
the particularities of the governance of land and water?<br />
What is the role of regional and local spatial planning?<br />
What are institutional barriers, where could synergies<br />
be established? In the International Summer School<br />
2013 focusing on such questions, we will discuss on<br />
environmental governance of land and water in depth.<br />
In an intensive seminar, we will search for answers and<br />
solutions to the question how we should manage land<br />
and water, in order to achieve intergenerational justice<br />
and a sustainable use of the natural resources.<br />
The venue: Utrecht University<br />
The International Summer School 2013 of the <strong>ARL</strong> will<br />
be held in cooperation with the Utrecht University. The<br />
Netherlands are a place where one permanently stumbles<br />
into situations where the tension between spatial<br />
planning and water management becomes obvious.<br />
Not only are the Netherlands one of the most densely<br />
settled area in Europe with an enormous economic<br />
capacity, but it is also a country which lies in a delta, and<br />
moreover, to a huge extend below sea level. Nowhere<br />
else in the world the tension between land and water<br />
governance becomes more obvious than here. This<br />
is also a laboratory for innovations in this field: The<br />
Netherlands are famous for their approach to “space<br />
for the rivers”, living on and with the water, and for their<br />
groundwater management.<br />
The city of Utrecht is one of the four large cities that<br />
form the Randstad, the economic centre and the heart<br />
of the Dutch society. Utrecht University, the largest<br />
faculty of Geosciences in the Netherlands, has an<br />
excellent reputation in the field of spatial planning<br />
and environmental governance. We invite you to use<br />
this expertise and study land and water governance<br />
in this exciting environment. Our aim is to stimulate<br />
discussions, develop new ideas, and trigger further<br />
research on this topic. Therefore, we invite young<br />
academics and experienced experts on environmental<br />
governance of land and water to the Urban Research<br />
Centre Utrecht (URU) at the Faculty of Geosciences<br />
of Utrecht University in the Netherlands. Prof. Dr.<br />
Tejo Spit and Dr. Thomas Hartmann are our partners<br />
in Utrecht.<br />
Veranstaltungen<br />
Programme: Intensive and inspiring …<br />
We will have discussion sessions where every participant<br />
will have the chance to present her or his research.<br />
International professors and experts will then provide<br />
individual feedback; in plenary sessions ideas will be<br />
discussed. In special sessions, particular aspects of<br />
land and water governance are addressed. Additional<br />
keynote speeches, small field trips, and common social<br />
activities round off the program. Particularly for young<br />
academics and PhD-students this Summer School provides<br />
a unique opportunity. Don’t miss it!<br />
Application: Six places available!<br />
Besides the six appointed “wild cards” for young academics<br />
from European Universities, the <strong>ARL</strong> sponsors<br />
six further young academics for the Summer School<br />
2013 in Utrecht. This will cover accommodation and<br />
travel costs. A participation fee will not be charged.<br />
As academic institutions, the <strong>ARL</strong> and Utrecht University<br />
encourage scientific publications. The organizers<br />
aim at setting up a special issue of an academic journal<br />
on the theme of the Summer School. So, participants<br />
should be willing and prepared to develop their papers<br />
into articles for academic journals. Contributions for<br />
such a special issue will be selected during the Summer<br />
School. Nonetheless, the organizers do not guarantee<br />
the publication of selected contributions.<br />
Your application should include a convincing motivation<br />
letter, a short CV, and an abstract of not more<br />
than 600 words describing the project you are going<br />
to present and discuss.<br />
Please submit your application until 30 November<br />
2012 to Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
(<strong>ARL</strong>), Dr. Andreas Klee, Hohenzollernstraße<br />
11, 30161 Hannover, Germany, or via e-mail to klee@<br />
arl-net.de. You will receive a notification of acceptance<br />
by March 2013. Applicants may not exceed the age of<br />
35 years.<br />
For further questions, please contact Dr. Andreas<br />
Klee (klee@arl-net.de) or Dr. Thomas Hartmann<br />
(t.hartmann@uu.nl).<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
25
26<br />
NeuerscheiNuNgeN<br />
Strategische Regionalplanung<br />
Dirk Vallee (Hrsg.)<br />
Forschungs- und Sitzungsbericht der <strong>ARL</strong> Nr. 237<br />
Hannover 2012, 201 S.<br />
ISBN: 978-3-88838-066-2<br />
Der Hauptanspruch der Strategischen Regionalplanung<br />
besteht darin, Orientierung zu vermitteln und<br />
eine langfristige Ausrichtung der Regionalentwicklung<br />
zu bewirken. Ein erfolgreicher Planungsprozess bedarf<br />
deswegen mehr denn je<br />
einer neuen und intensiven<br />
Verzahnung von<br />
Leitbildern (Zielen), Konzepten<br />
(Plänen) und daran<br />
orientierten Schritten zu<br />
deren Umsetzung. Strategische<br />
Regionalplanung<br />
als dreistufiger, eng verzahnter<br />
Planungsprozess<br />
stützt sich dabei auf die<br />
Bildung von Netzwerken,<br />
umfassende Partizipation,<br />
die frühzeitige Schaffung<br />
strategischer Partnerschaften<br />
(Allianzen) sowie die<br />
Unterstützung der Akteure bei der Umsetzung der Konzepte,<br />
Pläne und Programme. Grundlage für die Vielzahl<br />
der Aktivitäten sind kontinuierliches Monitoring und<br />
Controlling.<br />
Mit dieser Thematik hat sich eine interdisziplinäre<br />
Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern und Praktikern<br />
beschäftigt. Auf der Basis einer Auswertung nationaler<br />
und internationaler Fallbeispiele legt sie mit diesem<br />
Band grundlegende Beiträge (Module) für ein fachlich<br />
fundiertes, konsistentes Modell einer zukunftsfähigen<br />
Strategischen Regionalplanung vor, das Aspekten der<br />
Regionalentwicklung besondere Bedeutung beimisst und<br />
eine Entwicklungssteuerung gleichermaßen in städtischen<br />
wie in ländlichen Regionen ermöglicht.<br />
❍<br />
Einzelhandel in Nordrhein-<br />
Westfalen planvoll steuern!<br />
Heinz Konze, Michael Wolf (Hrsg.)<br />
Arbeitsberichte der <strong>ARL</strong> Nr. 2<br />
Hannover 2012, 160 S.<br />
ISBN: 978-3-88838-374-8<br />
Einkaufen ist im Leben der Menschen seit vielen Jahren<br />
nicht mehr nur die Versorgung mit Lebensmitteln und<br />
Waren, sondern zugleich ein Freizeiterlebnis. Die Mehrfachqualität<br />
dieser Daseinsgrundfunktion „Versorgung“<br />
ist dadurch ein bestimmender Faktor für die Entwicklung<br />
der örtlichen und überörtlichen Siedlungsstruktur.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Um auch langfristig eine<br />
den Freiraum schonende<br />
und die Funktion<br />
der (Innen-)Städte unterstützende<br />
regionale<br />
Siedlungsentwicklung<br />
zu sichern, bedarf es<br />
für ein konfliktfreieres<br />
Zusammenwirken der<br />
Städte und Gemeinden<br />
in einer Region neuer<br />
rechtssicherer und<br />
effektiver landes- und<br />
regionalplanerischer<br />
Regelungen. Fachübergreifend<br />
werden die für<br />
eine raumordnerische Steuerung des großflächigen Einzelhandels<br />
wesentlichen Themenfelder betrachtet. Der<br />
Arbeitsbericht bietet vielfältige Anregungen und Vorschläge,<br />
wie die Landes- und Regionalplanung flankierend und<br />
unterstützend zur kommunalen Bauleitplanung zu einer<br />
optimalen Versorgung der Bevölkerung beitragen könnte.<br />
❍<br />
Hans-Georg Bächtold,<br />
Karl Heinz Hoffmann-Bohner, Peter Keller<br />
Über Grenzen denken –<br />
Grenzüberschreitende Fragen<br />
der Raumentwicklung<br />
Deutschland-Schweiz<br />
E-Paper der <strong>ARL</strong> Nr. 15<br />
Hannover 2012, 38 S.<br />
ISBN: 978-3-88838-733-3<br />
Raumplanung dient der Vermittlung zwischen verschiedenen<br />
Ansprüchen und Interessen, sie soll Raumnutzungskonflikte<br />
vermeiden oder frühzeitig lösen. Diese<br />
anspruchsvolle Aufgabe ist in Grenzräumen besonders<br />
komplex, da die Probleme, die es planerisch zu lösen<br />
gilt, oft nicht an nationalstaatlichen Grenzen haltmachen<br />
und eine abgestimmte<br />
grenzüberschreitende<br />
Zusammenarbeit<br />
der relevanten Akteure<br />
aus Politik, Verwaltung,<br />
Wissenschaft, Wirtschaft<br />
und Zivilgesellschaft<br />
erfordern.<br />
Aus diesem Grund<br />
hat die Arbeitsgruppe<br />
„Grenzüberschreitende<br />
Fragen der Raumentwicklung<br />
Deutschland-<br />
Schweiz“ der Landesarbeitsgemeinschaft
Baden-Württemberg nicht nur über Grenzen hinweg<br />
gedacht, sondern auch gehandelt. Wissenschaftler und<br />
Praktiker aus Deutschland und der Schweiz haben sich<br />
im interdisziplinären Diskurs mit grenzüberschreitenden<br />
Problemen am Hochrhein kritisch auseinandergesetzt.<br />
In der daraus entstandenen Veröffentlichung werden<br />
Erfahrungen aus der Zusammenarbeit dargestellt und Herausforderungen<br />
aufgezeigt, vor denen Politik und Planung<br />
auf beiden Seiten des Hochrheins stehen und die sich<br />
auch nur gemeinsam adäquat lösen lassen. Fallbeispiele<br />
verdeutlichen dies und öffnen den Blick für Chancen, die<br />
eine noch besser abgestimmte grenzüberschreitende<br />
Raumentwicklung böte. Dazu sind aber auf beiden Seiten<br />
des Hochrheins geeignete Rahmenbedingungen und<br />
Strukturen zu schaffen.<br />
Aus den Ergebnissen der Analyse leiten die Autoren<br />
zehn Thesen ab, mit denen Handlungsempfehlungen für<br />
den deutsch-schweizerischen Grenzraum am Hochrhein<br />
verknüpft sind. Sie machen deutlich, dass Mut zum gemeinsamen<br />
Handeln und die Entwicklung einer gemeinsamen,<br />
grenzüberschreitenden Vision den Menschen<br />
beiderseits des Hochrheins zugutekommen könnte. Die<br />
Publikation soll dazu anregen, den spannenden Prozess<br />
des Denkens über Grenzen hinweg neu zu beleben und<br />
zur kontinuierlichen Verbesserung der Zusammenarbeit<br />
D-CH beizutragen.<br />
Das E-Paper kann von der Website der <strong>ARL</strong> (www.arlnet.de)<br />
unter der Rubrik „<strong>Publikationen</strong>“ heruntergeladen<br />
werden.<br />
Umfangreiche Linksammlung<br />
auf der <strong>ARL</strong>-Website<br />
Die <strong>ARL</strong> bietet in der Rubrik „Netzwerk & Jobs“<br />
ihrer Website (www.arl-net.de) eine umfangreiche<br />
Linksammlung an. Die darin enthaltenen<br />
Themenbereiche richten sich mit ihrer Auswahl<br />
verschiedener Webseiten vor allem an Personen,<br />
die mit raumwissenschaftlichen Fragen und mit der<br />
Praxis räumlicher Planung befasst sind.<br />
Sie finden hier folgende Unterrubriken:<br />
■ Hochschulinstitute in Deutschland und Europa<br />
■ Außeruniversitäre Einrichtungen in Deutschland<br />
und Europa<br />
■ Informationsdienste der Regionalplanungsstellen<br />
in Deutschland und Europa<br />
■ Weitere Behörden und Institutionen in Deutschland<br />
und Europa<br />
■ Bibliotheken, Kataloge, Datenbanken, Fachverlage<br />
■ Raumwissenschaftliche Foren, Portale und Fachzeitschriften<br />
Wissenschaftliche Beiträge<br />
NeuerscheiNuNgeN<br />
Anna Growe<br />
Raummuster unterschiedlicher Wissensformen. Der Einfluss<br />
von Transaktionskosten auf Konzentrationsprozesse<br />
wissensintensiver Dienstleister im deutschen Städtesystem<br />
Stefanie Baasch / Sybille Bauriedl / Simone Hafner /<br />
Sandra Weidlich<br />
Klimaanpassung auf regionaler Ebene: Herausforderungen<br />
einer regionalen Klimawandel-Governance<br />
Sonja Deppisch / Meike Albers<br />
Transnationale Strategien zur Anpassung an Klimawandelfolgen<br />
versus lokalspezifische Anpassungserfordernisse?<br />
Das Beispiel des Ostseeraumes<br />
Berichte aus Forschung und Praxis<br />
Band 70<br />
Heft 3<br />
Juni 2012<br />
Papierausgabe:<br />
ISSN 0034-0111<br />
Elektronische Ausgabe:<br />
ISSN 1869-4179<br />
Christian Langhagen-Rohrbach<br />
Moderne Logistik – Anforderungen an Standorte und<br />
Raumentwicklung<br />
Jean Peyrony / Olivier Denert<br />
Planning for Cross-Border Territories: The Role Played by<br />
Spatial Information<br />
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen:<br />
Springer Customer Service Center GmbH<br />
Haberstraße 7, 69126 Heidelberg<br />
Tel. (+49-6221) 3454303<br />
Fax (+49-6221) 3454229<br />
E-Mail: subscriptions@springer.com<br />
www.springer.com/geography/human+geography/journal/13147<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 27
28<br />
Intern<br />
Neues Leitbild der <strong>ARL</strong> beschlossen<br />
Die Evaluierungen, Audits des Wissenschaftlichen<br />
Beirats und Zielgruppenbefragungen, aber auch die<br />
Nachfrage nach den <strong>ARL</strong>-„Produkten“ belegen, dass die<br />
<strong>ARL</strong> über ein beachtliches Renommee nicht nur in der<br />
raumwissenschaftlichen Szene verfügt. Mit den Zeiten<br />
ändern sich die Rahmenbedingungen für die Forschung.<br />
Es gilt, diese sorgfältig zu beobachten, zu analysieren und<br />
daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunftssicherung<br />
der Akademie zu ziehen, immer wieder neue inhaltliche<br />
Impulse zu setzen und notwendige strukturelle Weiterentwicklungen<br />
vorzunehmen. Die regelmäßige und<br />
umfassende Qualitätssicherung ist dabei oberstes Gebot.<br />
Vor dem Hintergrund überprüfen die verantwortlichen<br />
Gremien in der Akademie regelmäßig das Leitbild der<br />
0. Präambel<br />
Das Leitbild der <strong>ARL</strong> verdeutlicht, wer sie ist, wofür<br />
sie steht, was ihr Handeln bestimmt, was sie erreichen<br />
und wo sie in Zukunft stehen will. Es zeigt ihr Selbstverständnis,<br />
ihr Profil und ihre Besonderheiten. Es dient<br />
als Orientierung und zugleich als Kontrollinstrument<br />
für das wissenschaftliche Tun, die strategische Position<br />
und die künftige Entwicklung.<br />
1. Identität<br />
Die <strong>ARL</strong> versteht sich als Kompetenzzentrum für Fragen<br />
nachhaltiger Raumentwicklung im außeruniversitären<br />
Forschungsbereich, anerkannt wegen ihrer ganzheitlichen<br />
Perspektive auf die komplexen gesellschaftlich<br />
relevanten Herausforderungen von heute und vor<br />
allem auch von morgen. Sie erforscht den Raum als<br />
Bedingung und Ausdruck gesellschaftlicher Praxis. Bei<br />
Problemanalysen und Lösungsvorschlägen werden die<br />
Dimensionen nachhaltiger Entwicklung (sozial, ökologisch,<br />
ökonomisch) miteinander verbunden und in ihren<br />
vielschichtigen Wechselwirkungen betrachtet. Ziel<br />
ist es, neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten für eine<br />
am Leitbild Nachhaltigkeit orientierte Raumforschung<br />
und Planungspraxis zu entwickeln.<br />
Organisiert ist die <strong>ARL</strong> als Netzwerk von Fachleuten<br />
für Fragen der Raumentwicklung. In- und ausländische<br />
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
<strong>ARL</strong> und passen es bei Bedarf an. Das Leitbild ist Führungsmittel<br />
und Kommunikationsinstrument zugleich.<br />
Es hat Orientierungs-, Integrations-, Koordinations- und<br />
Entscheidungsfunktion nach innen und außen und gibt<br />
Antworten auf zentrale Fragen, z. B.: Was und wer ist<br />
die <strong>ARL</strong>, wofür steht sie? Was bestimmt das Handeln<br />
der <strong>ARL</strong>, wie wird in der <strong>ARL</strong> entschieden und kommuniziert?<br />
Was will die <strong>ARL</strong> erreichen, wo will die <strong>ARL</strong> in<br />
Zukunft stehen?<br />
Der aktuelle Prüfprozess ist abgeschlossen. Das Präsidium<br />
der <strong>ARL</strong> hat am 13. August 2012 das neue Leitbild<br />
beschlossen.<br />
Dietmar Scholich 0511 34842-37<br />
scholich@arl-net.de<br />
Leitbild der Akademie für Raumforschung<br />
und Landesplanung<br />
Leibniz-Forum für Raumwissenschaften<br />
forschen und beraten gemeinsam in Gremien der <strong>ARL</strong>.<br />
So hat sich die Akademie als nationales und internationales<br />
Forum für den raumwissenschaftlichen und<br />
raumpolitischen Diskurs etabliert.<br />
2. Mission / Auftrag<br />
Unterschiedliche Interessen- und Nutzergruppen<br />
konkurrieren um die Ressource Raum. Damit Veränderungen<br />
für alle Beteiligten verträglich sind und<br />
Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Generationen<br />
bleiben, werden raumwissenschaftliche Forschung und<br />
Raumplanung benötigt. In der <strong>ARL</strong> wird problemorientierte<br />
Grundlagenforschung mit anwendungsnaher<br />
Wissenschaft und Wirkungsforschung verknüpft. Dazu<br />
werden Erkenntnisse und Perspektiven unterschiedlicher<br />
Disziplinen sowie relevantes Erfahrungswissen<br />
aus der Planungspraxis zu einer neuen inter- bzw.<br />
transdisziplinären Wissensbasis zusammengeführt und<br />
neue fundierte Erkenntnisse generiert. Letztere bilden<br />
die Grundlage nicht nur für weitere Forschungen innerhalb<br />
und außerhalb der <strong>ARL</strong>, sondern auch für eine<br />
überzeugende und unabhängige wissenschaftliche<br />
Beratung sowie für die Aus- und Weiterbildung in Politik,<br />
Verwaltung, Wirtschaft, Medien und Öffentlichkeit.<br />
Die <strong>ARL</strong> trägt damit maßgeblich zur sachorientierten<br />
politischen Entscheidungsfindung und zur öffentlichen<br />
Meinungsbildung bei.
3. Werte / Orientierung / Netzwerkkultur<br />
Wissenschaftliche Qualität, Kommunikation und effizienter<br />
Mitteleinsatz haben in der <strong>ARL</strong> einen hohen<br />
Stellenwert. Deshalb wird bei der Ergänzung des Netzwerks<br />
vor allem auf fachliche Exzellenz geachtet. Die<br />
Gleichstellung von Frauen und Männern und die Nachwuchsförderung<br />
sind dabei wesentliche Anliegen der<br />
Akademie. Im Sinne des Generationenvertrages werden<br />
frühzeitig junge Menschen in die Arbeitsgremien der<br />
<strong>ARL</strong> eingebunden. Die <strong>ARL</strong> orientiert nicht nur ihre<br />
Forschungen, sondern ihr Handeln insgesamt an den<br />
Leitlinien der Nachhaltigkeit. Die Fördermaßnahmen<br />
der <strong>ARL</strong> sind den aktuellen Bedürfnissen angepasst.<br />
Forschung und Beratung werden konsequent an Interund<br />
Transdisziplinarität ausgerichtet. Das bedeutet: Bei<br />
Lösung zentraler Fragen der künftigen Raumentwicklung<br />
arbeiten Wissenschaft und Praxis Hand in Hand. Dank<br />
dieser Orientierung und einer stringenten Qualitätssicherung<br />
bietet die <strong>ARL</strong> exzellente Forschungs- und<br />
Beratungsleistungen an. Damit das Wissen schnell von<br />
der Quelle in die Forschung, Lehre, Praxis und zu allen<br />
anderen Interessierten fließen kann, werden die Arbeitsergebnisse<br />
schnell und frei zur Verfügung gestellt.<br />
Die Mitarbeit in der <strong>ARL</strong> ist ehrenamtlich. Dieser Form<br />
des Engagements verdankt die Akademie ihre Effizienz<br />
und Effektivität. Sich in der und für die <strong>ARL</strong> zu engagieren,<br />
soll sich aber auch „lohnen“. Deshalb pflegt die <strong>ARL</strong><br />
eine partnerschaftliche, integrierende, von Respekt und<br />
Wertschätzung geprägte Atmosphäre. Die <strong>ARL</strong> steht<br />
für faire Behandlung, Verlässlichkeit, Transparenz und<br />
Offenheit. Das ist Voraussetzung für vertrauensvolle,<br />
teamorientierte und erfolgreiche Arbeit in Forschungsgremien<br />
und anderen Vorhaben, die die Akteure aktiv<br />
Intern<br />
mitgestalten und bei denen sie gemeinsam Verantwortung<br />
tragen. So unterstützt die <strong>ARL</strong> die Kreativität,<br />
Innovationskraft und Leistungsbereitschaft aller Mitwirkenden.<br />
Sie pflegt eine offene Kommunikationskultur<br />
und fördert fachliche und soziale Kompetenzen.<br />
4. Vision / Strategische Ziele<br />
Zentrales Ziel ist auch in Zukunft die Sicherung der<br />
fachlichen Exzellenz der Akademie. Dafür entwickelt sie<br />
ihr Selbstverständnis, ihr Profil, ihre Besonderheiten und<br />
vor allem auch ihre Maßnahmen der Qualitätssicherung<br />
kontinuierlich weiter.<br />
In Europa ist die <strong>ARL</strong> Vorreiterin in Sachen Forschung<br />
und Beratung für eine nachhaltige Raumentwicklung.<br />
Auf ihrem Fachgebiet bleibt sie gefragte Impulsgeberin<br />
für Wissenschaft, Politik, Verwaltung und die<br />
Gesellschaft insgesamt. Ihren beratenden Einfluss auf<br />
Politik, Verwaltung und Gesellschaft baut die Akademie<br />
schrittweise aus.<br />
Die <strong>ARL</strong> festigt ihre strategischen Funktionen als Forum,<br />
Dialogplattform und Mittlerin zwischen Wissenschaft<br />
und Anwendern in der Zukunft, baut sie aus und macht<br />
sie noch besser sichtbar. Zudem systematisiert und<br />
professionalisiert die <strong>ARL</strong> ihre Beratungsaktivitäten und<br />
die gezielte Aus- und Weiterbildung auch weiterhin und<br />
intensiviert die Kommunikation nach innen und außen.<br />
Ihre institutionelle Vernetzung treibt die <strong>ARL</strong> voran und<br />
vertieft vor allem auch die internationalen Kontakte. Als<br />
gefragte Kooperationspartnerin verfügt sie über langjährige<br />
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen<br />
Einrichtungen und über umfassende institutionelle Verbindungen<br />
auf nationaler und internationaler Ebene.<br />
Wenn Politik auf Wissenschaft trifft<br />
„Leibniz im Bundestag“ heißt das Programm der Leibniz-<br />
Gemeinschaft, das Abgeordnete aller Bundestagsfraktionen<br />
mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ins<br />
Gespräch bringen will. An zwei Tagen im Juni besuchten<br />
etwa 70 Forscherinnen und Forscher aus den Leibniz-<br />
Einrichtungen fast 80 Mitglieder des Bundestages. Auch<br />
Dr.-Ing. Evelyn Gustedt und Dipl.-Ing. Sebastian Ebert aus<br />
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
(<strong>ARL</strong>) beteiligten sich an den Gesprächen. „Was bringt<br />
der Klimawandel Gemeinden, Städten und Regionen?“<br />
lautete das Informationsangebot der Akademie. Eva<br />
Bulling-Schröter, Abgeordnete der Fraktion „Die Linke“<br />
und Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundesta-<br />
ges, interessierte sich für das Rüstzeug für den Umgang mit<br />
dem Klimawandel, das der Online-Handlungsleitfaden für<br />
die praktische Arbeit in Politik, Unternehmen und Raumplanung<br />
bietet. Das „BalticClimate Toolkit“ wurde im EU-<br />
Projekt BalticClimate für den Ostseeraum entwickelt, lässt<br />
sich jedoch auf nahezu alle anderen Regionen übertragen,<br />
da es Handreichungen für die Steuerung von Prozessen<br />
gibt. Bei diesem Projekt hatte die <strong>ARL</strong> als Lead-Partnerin<br />
fungiert. Zwei Stunden dauerte das Gespräch, in dessen<br />
Folge Eva Bulling-Schröter sich mehrere Exemplare des<br />
Handlungsleitfadens zur Weitergabe an die Mitglieder<br />
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
bestellte.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 29
30<br />
Intern<br />
Personalien<br />
Beigeordneter Ass. jur. Folkert Kiepe, Dezernent Stadtentwicklung,<br />
Bauen, Wohnen und Verkehr beim Deutschen<br />
Städtetag, Köln, Korrespondierendes Mitglied der <strong>ARL</strong><br />
sowie langjähriges Mitglied im Kuratorium und anschließend<br />
im Nutzerbeirat, ist mit Wirkung vom 30.06.2012<br />
wegen Erreichens der Altersgrenze aus den Diensten des<br />
Deutschen Städtetages ausgeschieden. Sein Nachfolger<br />
ist Beigeordneter Hilmar von Lojewski.<br />
† Rudolf Stich<br />
Am 14.06.2012 ist Ministerialrat a. D. Professor Dr. jur.<br />
Rudolf Stich im Alter von 85 Jahren gestorben. Bis<br />
zu seiner Emeritierung hatte er die Professur für<br />
Verwaltungs- und Rechtslehre des Bauwesens, der<br />
Raumplanung und des Umweltschutzes an der<br />
Technischen Universität Kaiserslautern inne, zu deren<br />
Gründungsvätern er Anfang der 1970er Jahre zählte.<br />
Mit der Akademie war der Verstorbene über vier<br />
Jahrzehnte verbunden. Rudolf Stich befasste sich<br />
in dieser Zeit intensiv mit Fragen der Raumplanung<br />
und der Umwelt und hier vor allem mit Rechts- und<br />
Verwaltungsaspekten. Sein fundiertes und vielfältiges<br />
Wissen auf diesen und anderen Gebieten brachte er<br />
in die Arbeit der Akademie ein. So war er Mitglied<br />
z. B. in den Arbeitskreisen „Verhältnis von Theorie<br />
und Praxis in der Stadtplanung“ und „Fortentwicklung<br />
des Raumordnungsrechts“. Rudolf Stich wirkte<br />
schon früh bei verschiedenen Veranstaltungen der<br />
Akademie aktiv mit, so bei der Wissenschaftlichen<br />
Plenarsitzung 1975 zum Thema „Planung unter veränderten<br />
Verhältnissen“ in Duisburg. Sein Wirken für<br />
die <strong>ARL</strong> ist nicht zuletzt durch die Berufung zum Korrespondierenden<br />
Mitglied 1978 anerkannt worden.<br />
Die Akademie verliert mit Rudolf Stich einen<br />
langjährigen und engagierten Mitstreiter und Weggefährten.<br />
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken<br />
bewahren.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
† Jacques Robert<br />
Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist bereits im letzten<br />
Jahr Dipl.-Ing. Jacques Robert, Direktor der Agence<br />
Européenne „Territoires et Synergies“, Strasbourg, im<br />
Alter von 64 Jahren verstorben.<br />
Mit der Akademie war der Verstorbene über drei<br />
Jahrzehnte verbunden. Er befasste sich in dieser Zeit<br />
intensiv mit Fragen der angewandten Raumplanung,<br />
vor allem aus internationaler Sicht. Sein fundiertes<br />
und vielfältiges Wissen auf unterschiedlichen Gebieten<br />
brachte er in die Arbeit der Akademie ein. Jacques<br />
Robert wirkte in verschiedenen Forschungsgremien<br />
und bei wichtigen Veranstaltungen der Akademie<br />
aktiv mit. So war er Mitglied in den Arbeitskreisen<br />
„Probleme einer europäischen Raumordnung“ und<br />
„Staatsgrenzen übergreifende Raumplanung“. Sein<br />
Wirken für die <strong>ARL</strong> ist durch die Berufung zum Korrespondierenden<br />
Mitglied 1996 anerkannt worden.<br />
Jacques Robert hinterlässt in der <strong>ARL</strong> eine große<br />
Lücke. Die Akademie verliert mit ihm einen langjährigen<br />
Freund, Weggefährten und Streiter für das Zusammenwachsen<br />
in Europa. Sie wird Jacques Robert<br />
ein ehrendes Andenken bewahren.<br />
† Hubert Voigtländer<br />
Im Alter von 77 Jahren ist Dr. rer. pol. Dipl.-Volksw. Hubert<br />
Voigtländer verstorben. Bis zu seiner Pensionierung<br />
leitete er das Referat „Föderale Angelegenheiten<br />
der Raumordnung“ im damaligen Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen in Bonn. Anschließend<br />
engagierte er sich als Geschäftsführer im<br />
Karl-Schiller-Symposium e. V.<br />
Mit der Akademie war der Verstorbene seit Mitte<br />
der 1980er Jahre verbunden. Er befasste sich in dieser<br />
Zeit intensiv mit ökonomischen Fragen der Raumentwicklung.<br />
Sein fundiertes und vielfältiges Wissen<br />
brachte er in die Arbeit der Akademie ein und wirkte<br />
in verschiedenen Forschungsgremien und bei wichtigen<br />
Veranstaltungen der Akademie aktiv mit. So war er<br />
Mitglied im Arbeitskreis „Berufliche Weiterbildung als<br />
Faktor der Regionalentwicklung“. Sein Wirken für die<br />
<strong>ARL</strong> ist durch die Berufung zum Korrespondierenden<br />
Mitglied 1998 anerkannt worden. Die Akademie verliert<br />
mit Hubert Voigtländer einen langjährigen Freund<br />
und Weggefährten. Wir werden dem geschätzten<br />
Kollegen ein ehrendes Andenken bewahren.
Ausgewählte<br />
Zeitschriftenbeiträge<br />
Als Informationsservice für die Forschung und zur<br />
Förderung des Trans fers raumwissenschaftlicher<br />
Forschungsergebnisse in die Praxis wird in den <strong>ARL</strong>-<br />
Nachrichten in jedem Heft auf raumrelevante Bei träge<br />
aus national und international bedeutsamen Zeitschriften<br />
hingewiesen. Vollständigkeit wird nicht angestrebt.<br />
Autoren und Leser werden gebeten, die Redaktion auf<br />
erwähnenswerte Arbeiten aufmerksam zu machen.<br />
Die Zeitschriftenschau ist wie folgt gegliedert:<br />
1. Theoretische und methodische Grundlagen<br />
(Theorie der Raumentwicklung, Konzeptionen<br />
der Raumpolitik, Methodenfragen)<br />
2. Raum- und Siedlungsentwicklung<br />
in Deutschland<br />
(alle räumlichen Ebe nen einschl. der Kommunen,<br />
Raum typen be trach tung: Agglomerationsräume,<br />
länd liche Räume; Wohnen)<br />
3. Raum- und Siedlungsentwicklung in Europa<br />
und dem sonstigen Ausland<br />
(al le räumlichen Ebenen einschl. der Kommunen,<br />
Raum typen be trach tung: Agglo merationsräume,<br />
ländliche Räume; Wohnen)<br />
4. Nachhaltige Raumentwicklung<br />
5. Umwelt<br />
6. Wirtschaft<br />
(Öffentliche Finanzen, Arbeitsmarkt, regionale<br />
Wirt schaftspolitik, Agrarpolitik, Tourismus)<br />
7. Soziales<br />
(Bevölkerung, Bildungspolitik, Sozialpolitik,<br />
Lebensstile etc.)<br />
8. Infrastruktur<br />
(Verkehr, Kommunikation, Ver- und Entsorgung,<br />
Bil dung etc.)<br />
9. Raumbezogene Planung<br />
(Planung auf allen Ebenen: Raumordnung,<br />
Landes- und Regio nal planung, Stadt- und<br />
Regionalplanung, Kommunalplanung;<br />
Pla nungs recht; neue Planungsformen;<br />
Arbeitsmittel der räumlichen Pla nung)<br />
10. Grenzüberschreitende Kooperation<br />
und Planung<br />
Die Aufsätze werden nur einmal – nach ihrem<br />
inhaltlichen Schwerpunkt – einer dieser Rubriken<br />
zugeordnet.<br />
Zeitschriftenschau<br />
1. Theoretische und methodische<br />
Grundlagen<br />
Büter, Kai / Pohl, Jürgen: Die performative Herstellung<br />
von Clustern durch Theoretiker und Praktiker im<br />
Akteur-Netzwerk. Geographische Zeitschrift, Bd. 99<br />
(2011), H. 2-3, S. 65-83.<br />
Castro, Sofia B.S.D. / Correia-da-Silva, João / Mossay,<br />
Pascal: The core-periphery model with three regions<br />
and more. Papers in Regional Science, vol. 91 (2012),<br />
no. 2, pp. 401-418.<br />
Friesecke, Frank / Munzinger, Timo: Partizipation in<br />
der Stadtentwicklung. Praxiserfahrungen, Erfolgsbedingungen<br />
und Weiterentwicklungsbedarf.<br />
Flächenmanagement und Bodenordnung, Bd. 74<br />
(2012), H. 2, S. 63-72.<br />
Hamoudi, Hamid / Risueño, Marta: The Effects of Zoning<br />
in Spatial Competition. Journal of Regional Science,<br />
vol. 52 (2012), no. 2, pp. 361-374.<br />
Münzenmaier, Werner: Messung des (im-)materiellen<br />
Wohlstands in Großstädten. Teil 1: Konzeptionelle<br />
Überlegungen. Das Ende des BIP als Wohlstandsindikator?<br />
Stadtforschung und Statistik, H. 1 (2012),<br />
S. 58-60.<br />
Münzenmaier, Werner: Messung des (im-)materiellen<br />
Wohlstands in Großstädten. Teil 2: Erste Ergebnisse.<br />
Das Ende des BIP als Wohlstandsindikator? Stadtforschung<br />
und Statistik, H. 1 (2012), S. 61-66.<br />
Normann, Roger H. / Vasström, Mikaela: Municipalities<br />
as Governance Network Actors in Rural Communities.<br />
European Planning Studies, vol. 20 (2012), no.<br />
6, pp. 941-960.<br />
Olsson, Jan / Hysing, Erik: Theorizing Inside Activism:<br />
Understanding Policymaking and Policy Change from<br />
Below. Planning Theory & Practice, vol. 13 (2012), no.<br />
2, pp. 257-273.<br />
Schmitz, Holger: Volksgesetzgebung: Eine kritische<br />
Analyse am Beispiel des Gesetzes für die vollständige<br />
Offenlegung von Geheimverträgen zur Teilprivatisierung<br />
der Berliner Wasserbetriebe. Deutsches<br />
Verwaltungsblatt, Bd. 127 (2012), H. 12, S. 731-737.<br />
Talvitie, Antti: The problem of trust in planning. Planning<br />
Theory, vol. 11 (2012), no. 3, pp. 257-278.<br />
2. Raum- und Siedlungsentwicklung<br />
in Deutschland<br />
Dierich, Axel: Urbane Landwirtschaft der Zukunft. Es<br />
wächst was auf der Stadt. Planerin, H. 1 (2012), S. 38-40.<br />
Drewes, Sabine: Kommunale Nachhaltigkeit 3.0 – die regenerative<br />
Stadt. Zwei Jahrzehnte Lokale Agenda 21.<br />
Politische Ökologie, Bd. 30 (2012), H. 129, S. 128-131.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 31
32<br />
Zeitschriftenschau<br />
Föbker, Stefanie / Nipper, Josef / Otto, Marius / Pfaffenbach,<br />
Carmella / Temme, Daniela / Thieme, Günter / Weiss,<br />
Günther / Wiegandt, Claus-Christian: Durchgangsstation<br />
oder neue Heimat – ein Beitrag zur Eingliederung<br />
von ausländischen hochqualifizierten Universitätsbeschäftigten<br />
in Aachen, Bonn und Köln. Berichte zur<br />
deutschen Landeskunde, Bd. 85 (2011), H. 4, S. 341-360.<br />
Gatzweiler, Hans-Peter: Regionale Disparitäten in<br />
Deutschland. Herausforderung für die Raumentwicklungspolitik.<br />
Geographische Rundschau, Bd. 64 (2012),<br />
H. 7-8, S. 54-60.<br />
Growe, Anna: Raummuster unterschiedlicher Wissensformen.<br />
Der Einfluss von Transaktionskosten auf Konzentrationsprozesse<br />
wissensintensiver Dienstleister<br />
im deutschen Städtesystem. Raumforschung und<br />
Raumordnung, Bd. 70 (2012), H. 3, S. 175-190.<br />
Liebmann, Heike / Kuder, Thomas: Pathways and Strategies<br />
of Urban Regeneration – Deindustrialized Cities<br />
in Eastern Germany. European Planning Studies, vol.<br />
20 (2012), no. 7, pp. 1155-1172.<br />
Meng, Rüdiger / West, Christina: Sport, Handel und<br />
Stadtentwicklung in Deutschland. Geographische<br />
Rundschau, Bd. 64 (2012), H. 5, S. 12-20.<br />
Rateniek, Ina: Freizeit und Wohnen im Stadtzentrum.<br />
Kreative Lösungen für Nutzungskonflikte. Planerin, H.<br />
1 (2012), S. 57-58.<br />
Rössel, Jörg / Hölscher, Michael: Lebensstile und Wohnstandortwahl.<br />
Kölner Zeitschrift für Soziologie und<br />
Sozialpsychologie, Bd. 64 (2012), H. 2, S. 303-327.<br />
Spangenberger, Volker: Aktuelle Schwerpunkte der<br />
Dorfentwicklung. Flächenmanagement und Bodenordnung,<br />
Bd. 74 (2012), H. 2, S. 72-80.<br />
Wiegandt, Claus-C.: Stadtentwicklung in Deutschland.<br />
Trends zur Polarisierung. Geographische Rundschau,<br />
Bd. 64 (2012), H. 7-8, S. 46-53.<br />
3. Raum- und Siedlungsentwicklung<br />
in Europa und dem sonstigen Ausland<br />
Baker, Ingrid / Peterson, Ann / Brown, Greg / McAlpine,<br />
Clive: Local government response to the impacts of<br />
climate change: An evaluation of local climate adaptation<br />
plans. Landscape and Urban Planning, vol. 107<br />
(2012), no. 2, pp. 127-136.<br />
Braun, Boris / Viehoff, Valerie: London 2012 – Olympische<br />
Spiele als nachhaltiger Impulsgeber für die Stadterneuerung?<br />
Geographische Rundschau, Bd. 64 (2012),<br />
H. 6, S. 4-11.<br />
Heiland, Stefan / Wilke, Christian / Rittel, Katrin: Urbane<br />
Anpassungsstrategien an den Klimawandel.<br />
Methoden- und Verfahrensansätze am Beispiel des<br />
Stadtentwicklungsplans Berlin. UVP-report, Bd. 26<br />
(2012), H. 1, S. 44-49.<br />
Jacob, Klaus / Weiland, Sabine: Die Nachhaltigkeitsprüfung<br />
im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung in<br />
Deutschland. UVP-report, Bd. 26 (2012), H. 1, S. 10-15.<br />
Kamran Asdar, Ali: Women, Work and Public Spaces:<br />
Conflict and Coexistence in Karachi’s Poor Neighbor-<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
hoods. International Journal of Urban and Regional<br />
Research, vol. 36 (2012), no. 3, pp. 585-605.<br />
King, Claire M. / Robinson, J. Steve / Cameron, Ross W.:<br />
Flooding tolerance in four ‘Garrigue’ landscape plants:<br />
Implications for their future use in the urban landscapes<br />
of north-west Europe? Landscape and Urban Planning,<br />
vol. 107 (2012), no. 2, pp. 100-110.<br />
Müller, Angelo / Wehrhahn, Rainer: New migration processes<br />
in contemporary China. The constitution of<br />
African trader network in Guangzhou. Geographische<br />
Zeitschrift, Bd. 99 (2011), H. 2-3, S. 104-122.<br />
Rebelo, Emília M.: Work and settlement locations of<br />
immigrants: how are they connected? The case of<br />
the Oporto Metropolitan Area. European Urban and<br />
Regional Studies, vol. 19 (2012), no. 3, pp. 312-328.<br />
Skaburskis, Andrejs: Gentrification and Toronto’s Changing<br />
Household Characteristics and Income Distribution.<br />
Journal of Planning Education and Research, vol. 32<br />
(2012), no. 2, pp. 191-203.<br />
Viladecans-Marsal, Elisabet / Arauzo-Carod, Josep-Maria:<br />
Can a knowledge-based cluster be created? The case<br />
of the Barcelona 22@ district. Papers in Regional Science,<br />
vol. 91 (2012), no. 2, pp. 377-400.<br />
4. Nachhaltige Raumentwicklung<br />
Armbruster, Jost / Egeling, Robert / Margraf-Mauè, Klaus /<br />
Schäfer, Kai / Späth, Volker: Lebendiger Rhein – Erfolge<br />
von Rheinufer-Revitalisierungen. Natur und Landschaft,<br />
Bd. 87 (2012), H. 6, S. 249-254.<br />
Cohen, Marianne / Baudoin, Raymond / Palibrk, Milena /<br />
Persyn, Nicolas / Rhein, Catherine: Urban biodiversity<br />
and social inequalities in built-up cities: New evidences,<br />
next questions. The example of Paris, France. Landscape<br />
and Urban Planning, vol. 106 (2012), no. 3, pp. 277-287.<br />
Dempe, Holger / Bittner, Torsten / Jaeschke, Anja / Beierkuhnlein,<br />
Carl: Potenzielle Auswirkungen des Klimawandels<br />
auf die Kohärenz von Schutzgebiets-Netzwerken.<br />
Ein Konzept für das Natura-2000-Netzwerk<br />
in Deutschland. Naturschutz und Landschaftsplanung,<br />
Bd. 44 (2012), H. 4, S. 101-107.<br />
Kythreotis, Andrew P. / Jonas, Andrew E. G.: Scaling sustainable<br />
development? How voluntary groups negotiate<br />
spaces of sustainability governance in the United<br />
Kingdom. Environment and Planning D: Society and<br />
Space, vol. 30 (2012), no. 3, pp. 381-399.<br />
Mössner, Ulrich: Die Gier beenden. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell<br />
für Deutschland. Politische Ökologie,<br />
Bd. 30 (2012), H. 129, S. 140-143.<br />
Richert, Britta / Friedmann, Arne: Naturschutzfunktionen<br />
und -potenziale von außerörtlichen Straßenbegleitflächen,<br />
dargestellt am Beispiel des BayernNetz-Natur-<br />
Projekts „Biotopverbund Wertachauen“ im Landkreis<br />
Augsburg. Natur und Landschaft, Bd. 87 (2012), H. 5,<br />
S. 215-223.<br />
Slemp, Christopher / Davenport, Mae A. / Seekamp, Erin<br />
/ Brehm, Joan M. / Schoonover, Jon E. / Williard, Karl<br />
W.J.: “Growing too fast:” Local stakeholders speak out
about growth and its consequences for community<br />
well-being in the urban-rural interface. Landscape<br />
and Urban Planning, vol. 106 (2012), no. 2, pp. 139-148.<br />
5. Umwelt<br />
Ackermann, Werner / Balzer, Sandra / Ellwanger, Götz /<br />
Gnittke, Inka / Kruess, Andreas / May, Rudolf / Riecken,<br />
Uwe / Sachteleben, Jens / Schröder, Eckhard: Hot Spots<br />
der biologischen Vielfalt in Deutschland. Auswahl und<br />
Abgrenzung als Grundlage für das Bundesförderprogramm<br />
zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur<br />
biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft, Bd. 87<br />
(2012), H. 7, S. 289-297.<br />
al-Janabi, Suhel / Heidbrink, Kathrin / Kraft, Friederike:<br />
Den Wert biologischer Vielfalt anschaulich vermitteln:<br />
Vom „Tag der Artenvielfalt“ zum globalen „Aktionstag<br />
für Biodiversität“. Natur und Landschaft, Bd. 87 (2012),<br />
H. 6, S. 259-265.<br />
Baasch, Stefanie / Bauriedl, Sybille / Hafner, Simone /<br />
Weidlich, Sandra: Klimaanpassung auf regionaler Ebene:<br />
Herausforderungen einer regionalen Klimawandel-<br />
Governance. Raumforschung und Raumordnung, Bd.<br />
70 (2012), H. 3, S. 191-201.<br />
Berghausen, Maja: Hamburg – Wege zur klimafreundlichen<br />
und CO -neutralen Großstadt. Wie kann der Stadtum-<br />
2<br />
bau gelingen? Informationen zur Raumentwicklung,<br />
H. 5-6 (2012), S. 217-234.<br />
Čepelová, Barbora / Münzbergová, Zuzana: Factors<br />
determining the plant species diversity and species<br />
composition in a suburban landscape. Landscape and<br />
Urban Planning, vol. 106 (2012), no. 4, pp. 336-346.<br />
Deppisch, Sonja / Albers, Meike: Transnationale Strategien<br />
zur Anpassung an Klimawandelfolgen versus lokalspezifische<br />
Anpassungserfordernisse? Das Beispiel des<br />
Ostseeraumes. Raumforschung und Raumordnung,<br />
Bd. 70 (2012), H. 3, S. 203-216.<br />
Erdmann, Karl-Heinz / Jessel, Beate: Natur- und Umweltschutz<br />
in Deutschland. Geographische Rundschau, Bd.<br />
64 (2012), H. 7-8, S. 68-73.<br />
Frieben, Bettina / Prolingheuer, Ulrich / Wildung, Meike /<br />
Meyerhoff, Eva: Aufwertung der Agrarlandschaft durch<br />
ökologischen Landbau. Eine Möglichkeit der produktionsintegrierten<br />
Kompensation? (Teil 1). Naturschutz<br />
und Landschaftsplanung, Bd. 44 (2012), H. 4, S. 108-114.<br />
Frieben, Bettina / Prolingheuer, Ulrich / Wildung, Meike /<br />
Meyerhoff, Eva: Aufwertung der Agrarlandschaft durch<br />
ökologischen Landbau. Eine Möglichkeit der produktionsintegrierten<br />
Kompensation? (Teil 2). Naturschutz<br />
und Landschaftsplanung, Bd. 44 (2012), H. 5, S. 155-160.<br />
Haag, Martin / Köhler, Babette: Freiburg im Breisgau<br />
– nachhaltige Stadtentwicklung mit Tradition und<br />
Zukunft. Informationen zur Raumentwicklung, H. 5-6<br />
(2012), S. 243-256.<br />
Hagg, Wilfried / Mayer, Christoph / Mayr, Elisabeth /<br />
Heilig, Achim: Climate and glacier fluctuations in the<br />
Bavarian Alps in the past 120 years. Erdkunde – Archive<br />
for Scientific Geography, vol. 66 (2012), no. 2, pp. 121-142.<br />
Zeitschriftenschau<br />
Hegger, Manfred / Hartwig, Joost: Die CO 2 -freie Stadt:<br />
Ziel, Bilanzraum und Übertragbarkeit. Informationen<br />
zur Raumentwicklung, H. 5-6 (2012), S. 213-216.<br />
Hutter von Knorring, Susanne / Illigmann, Klaus: Klimaschutz<br />
in der Landeshauptstadt München. Informationen<br />
zur Raumentwicklung, H. 5-6 (2012), S. 235-241.<br />
Krings, Ivo: Das „Realisieren“ der klimaneutralen Stadt –<br />
Wenn Utopie und Realität kollidieren. Informationen<br />
zur Raumentwicklung, H. 5-6 (2012), S. 193-212.<br />
Maaß, Christian: Landesgesetze zum Klimaschutz: Mehr<br />
Substanz, bitte! Zeitschrift für Umweltrecht, Bd. 23<br />
(2012), H. 5, S. 265-266.<br />
Müller, André / Porsche, Lars / Schön, Karl P.: Auf dem<br />
Weg zur CO 2 -freien Stadt – was wir von der Welt lernen<br />
können und was die Welt von uns wissen mag.<br />
Informationen zur Raumentwicklung, H. 5-6 (2012),<br />
S. 321-337.<br />
Müller, André / Schön, Karl P.: CO 2 -Reduktion – städtische<br />
Herausforderungen und Strategien. Informationen zur<br />
Raumentwicklung, H. 5-6 (2012), S. 183-192.<br />
6. Wirtschaft<br />
Apitzsch, Birgit / Piotti, Geny: Institutions and sectoral<br />
logics in creative industries: the media cluster in Cologne.<br />
Environment and Planning A, vol. 44 (2012), no.<br />
4, pp. 921-936.<br />
Bernzen, Amelie / Dannenberg, Peter: Ein „Visum“ für<br />
Obst. Öffentliche und private Standards als neue<br />
Governance-Formen am Beispiel des internationalen<br />
Lebensmittehandels. Geographische Rundschau, Bd.<br />
64 (2012), H. 3, 44-52.<br />
Birkenholtz, Trevor: Network political ecology: Method<br />
and theory in climate change vulnerability and adaptation<br />
research. Progress in Human Geography, vol. 36<br />
(2012), no. 3, pp. 295-315.<br />
Boom, Anette: Vertikale Entflechtung in der Stromwirtschaft.<br />
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung,<br />
Bd. 81 (2012), H. 1, S. 57-71.<br />
Fornahl, Dirk / Hassink, Robert / Klaerding, Claudia /<br />
Mossig, Ivo / Schröder, Heike: From the Old Path of<br />
Shipbuilding onto the New Path of Offshore Wind<br />
Energy? The Case of Northern Germany. European<br />
Planning Studies, vol. 20 (2012), no. 5, pp. 835-855.<br />
Gericke, Pierre-André / Werth, Stefan / Zemann, Christian:<br />
Sportbezogene Arbeitsmärkte in Deutschland.<br />
Geographische Rundschau, Bd. 64 (2012), H. 5, S. 28-34.<br />
Herrle, Peter / Fokdal, Josefine: Beyond the Urban Informality<br />
Discourse: Negotiating Power, Legitimacy and<br />
Resources. Geographische Zeitschrift, Bd. 99 (2011),<br />
H. 1, S. 3-15.<br />
Huggins, Robert / Kitagawa, Fumi: Regional Policy and<br />
University Knowledge Transfer: Perspectives from<br />
Devolved Regions in the UK. Regional Studies, vol.<br />
46 (2012), no. 6, pp. 817-832.<br />
Niebuhr, Annekatrin / Granato, Nadia / Haas, Anette /<br />
Hamann, Silke: Does Labour Mobility Reduce Dispari-<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 33
34<br />
Zeitschriftenschau<br />
ties between Regional Labour Markets in Germany?<br />
Regional Studies, vol. 46 (2012), no. 7, pp. 841-858.<br />
Okubo, Toshihiro: Antiagglomeration Subsidies with<br />
Heterogeneous Firms. Journal of Regional Science,<br />
vol. 52 (2012), no. 2, pp. 285-299.<br />
Syrett, Stephen / Sepulveda, Leandro: Urban governance<br />
and economic development in the diverse city. European<br />
Urban and Regional Studies, vol. 19 (2012), no.<br />
3, pp. 238-253.<br />
Weche Gelübcke, John P.: Ownership Patterns and Enterprise<br />
Groups in German Structural Business Statistics.<br />
Schmollers Jahrbuch, Bd. 131 (2011), H. 4, S. 635-647.<br />
Wlodarczak, Duncan: Smart growth and urban economic<br />
development: connecting economic development<br />
and land-use planning using the example of high-tech<br />
firms. Environment and Planning A, vol. 44 (2012), no.<br />
5, pp. 1255-1269.<br />
7. Soziales<br />
Jaffe, Rivke / Klaufus, Christien / Colombijn, Freek: Mobilities<br />
and Mobilizations of the Urban Poor. International<br />
Journal of Urban and Regional Research, vol. 36 (2012),<br />
no. 4, pp. 643-654.<br />
Laurila, Hannu: Inter-City migration and policy. Papers<br />
in Regional Science, vol. 91 (2012), no. 2, pp. 343-354.<br />
Laux, Hans D.: Deutschland im demographischen Wandel.<br />
Prozesse, Ursachen, Herausforderungen. Geographische<br />
Rundschau, Bd. 64 (2012), H. 7-8, S. 38-44.<br />
Teney, Celine: Space Matters. The Group Threat Hypothesis<br />
Revisited with Geographically Weighted Regression.<br />
The Case of the NPD 2009 Electoral Success.<br />
Zeitschrift für Soziologie, Bd. 41 (2012), H. 3, S. 207-226.<br />
Vogelpohl, Anne: Zeitpioniere als Raumpioniere – Zur<br />
Relevanz von Zeitlichkeit in urbanen Quartieren.<br />
Berichte zur deutschen Landeskunde, Bd. 85 (2011),<br />
H. 4, S. 379-396.<br />
8. Infrastruktur<br />
Dannenberg, Peter / Kunze, Manuela / Nduru, Gilbert<br />
M.: Isochronal Map of Fresh Fruits and Vegetable<br />
Transportation from the Mt. Kenya Region to Nairobi.<br />
Journal of Maps, vol. 7 (2011), no. 1, pp. 273-279.<br />
Durner, Wolfgang: Vollzugs- und Verfassungsfragen des<br />
NABEG. Natur und Recht, Bd. 34 (2012), H. 6, S. 369-377.<br />
Fuchs, Peter: Nachschub für die imperiale Lebensweise.<br />
Die Rohstoffpolitik Deutschlands und der EU. Politische<br />
Ökologie, Bd. 30 (2012), H. 129, S. 43-47.<br />
Hoffmann, Hartmut: Mehr Kreislauf bitte! Novellierte<br />
Abfallpolitik in Deutschland. Politische Ökologie, Bd.<br />
30 (2012), H. 129, S. 36-42.<br />
Kegler, Harald: Der US-amerikanische Ansatz CO -freier<br />
2<br />
Städte. Informationen zur Raumentwicklung, H. 5-6<br />
(2012), S. 273-286.<br />
Langhagen-Rohrbach, Christian: Moderne Logistik –<br />
Anforderungen an Standorte und Raumentwicklung.<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Raumforschung und Raumordnung, Bd. 70 (2012), H.<br />
3, S. 217-227.<br />
Marsden, Greg / Trapenberg Frick, Karen / May, Anthony<br />
D. / Deakin, Elizabeth: Bounded rationality in policy<br />
learning amongst cities: lessons from the transport<br />
sector. Environment and Planning A, vol. 44 (2012),<br />
no. 4, pp. 905-920.<br />
Steinhäußer, Reimund: Aktuelle Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz<br />
(EEG) und die geplante Reform<br />
der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen<br />
Union (GAP): Konsequenzen für die umweltgerechte<br />
Bereitstellung von Bioenergie. Natur und Recht, Bd.<br />
34 (2012), H. 7, S. 441-448.<br />
Thomas, Henning: Das EEG 2012. Neue Zeitschrift für<br />
Verwaltungsrecht, Bd. 31 (2012), H. 11, S. 670-671.<br />
Wappelhorst, Sandra: Mobilitätsberatung für Neubürger<br />
im suburbanen Raum. Vorschläge zur organisatorischen<br />
Verankerung. RaumPlanung, H. 162 (2012), S.<br />
47-51.<br />
Wulfhorst, Reinhard: Der Bundesverkehrswegeplan und<br />
die Beteiligung der Öffentlichkeit. Deutsches Verwaltungsblatt,<br />
Bd. 127 (2012), H. 8, S. 466-475.<br />
9. Raumbezogene Planung<br />
Dong, Hongwei / Gliebe, John: Assessing the Impacts of<br />
Smart Growth Policies on Home Developers in a Bistate<br />
Metropolitan Area: Evidence from the Portland<br />
Metropolitan Area. Urban Studies, vol. 49 (2012), no.<br />
10, pp. 2219-2235.<br />
Faludi, Andreas: Multi-Level (Territorial) Governance:<br />
Three Criticisms. Planning Theory & Practice, vol. 13<br />
(2012), no. 2, pp. 197-211.<br />
Karuppusamy, Shanthi / Carr, Jered B.: Interjurisdictional<br />
Competition and Local Public Finance: Assessing the<br />
Modifying Effects of Institutional Incentives and Fiscal<br />
Constraints. Urban Studies, vol. 49 (2012), no. 7, pp.<br />
1549-1569.<br />
Lauderbach, Martina: Grenzen von Bewohnerpartizipation<br />
im Stadtumbau. Ergebnisse einer Studie am Beispiel<br />
der Bochumer Großsiedlung Hustadt. Standort, Bd. 36<br />
(2012), H. 2, S. 71-76.<br />
Munro, Moira / Livingston, Mark: Student Impacts on Urban<br />
Neighbourhoods: Policy Approaches, Discourses<br />
and Dilemmas. Urban Studies, vol. 49 (2012), no. 8,<br />
pp. 1679-1694.<br />
Seiß, Reinhard: Good practice der Raumplanung. Aus<br />
dem Baukulturreport: Zarte Pflänzchen guter Praxis.<br />
RAUM, H. 86 (2012), S. 44-49.<br />
10. Grenzüberschreitende Kooperation<br />
und Planung<br />
Peyrony, Jean / Denert, Olivier: Planning for Cross-Border<br />
Territories: The Role Played by Spatial Information.<br />
Raumforschung und Raumordnung, Bd. 70 (2012), H.<br />
3, S. 229-240.
Nationalatlas Bundesrepublik<br />
Deutschland: Jetzt alle zwölf<br />
Bände auf einer DVD<br />
Der zwischen 1999 und 2007 in zwölf Bänden und<br />
auf zwölf einzelnen CD-ROMs erschienene Nationalatlas<br />
Bundesrepublik Deutschland ist jetzt erstmals<br />
komplett auf einer einzigen DVD erhältlich. Das viel gelobte<br />
Atlaswerk zeichnet ein vielschichtiges Gesamtbild<br />
unseres Landes und bietet eine faszinierende Fülle an<br />
geographischem Wissen und breit gefächertem Anschauungsmaterial.<br />
Das unter der Regie des Leibniz-Instituts für<br />
Länderkunde (IfL) entstandene Standardwerk richtet sich<br />
an interessierte Bürger, an Lehrer und Schüler wie auch<br />
an Fachleute in Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft<br />
und Politik. Mehr als 600 Geographen, Wissenschaftler<br />
anderer Disziplinen und Kartographen haben dazu beigetragen,<br />
dieses erste umfassende Portrait des vereinigten<br />
Deutschlands zu erstellen.<br />
Die elektronische Komplettversion vereinigt alle Inhalte<br />
der früheren zwölf CD-ROMs und kombiniert die Eigenschaften<br />
eines interaktiv nutzbaren Atlasses mit denen<br />
eines multimedialen Buches zu Themen der physischen<br />
und Anthropogeographie; im Vordergrund steht dabei<br />
die räumliche Differenzierung sozialer, wirtschaftlicher<br />
und naturräumlicher Strukturen und Prozesse. Vielfältige<br />
Suchfunktionen und ein Programm zum Erstellen<br />
von Deutschlandkarten sind auf der DVD verfügbar.<br />
Zahlreiche Datensätze wurden für diese Ausgabe aktualisiert.<br />
Weitere Informationen: www.nationalatlas.de/<br />
deutscher-nationalatlas.<br />
Armut und soziale<br />
Ausgrenzung<br />
2012 startete das Projekt „Territorial Indicators of Poverty<br />
and Social Exclusion in Europe”, kurz „TIPSE”, im Rahmen<br />
des EU-Programms ESPON 2013 (European Observation<br />
Network for Territorial Development and Cohesion).<br />
Das ESPON-Projekt wird sich bis 2014 mit den Raumentwicklungstrends<br />
und den Charakteristika von Armut<br />
und sozialer Ausgrenzung in Europa beschäftigen. Ziel<br />
des Projekts ist, eine Datenbasis zu Armut und sozialer<br />
Ausgrenzung in Europa zu analysieren. Das ILS – Institut<br />
für Landes- und Stadtentwicklungsforschung ist insbesondere<br />
für die Fallstudienmethodik und die Erarbeitung<br />
einer Ländertypologie verantwortlich und arbeitet dabei<br />
mit Nordregio (Konsortialführer, SE), University of the<br />
Highlands and Islands (UK), Newcastle University (UK),<br />
Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian<br />
Academy of Science (HU) und National Centre for<br />
Social Research (EL) zusammen. Das Projekt wird im ILS<br />
von Stefan Kaup, Isabel Ramos Lobato und Sabine Weck in<br />
Zusammenarbeit des Forschungsfeldes „Sozialraum Stadt“<br />
mit dem Bereich Raumwissenschaftliche Information und<br />
Kommunikation (R.I.K.) bearbeitet.<br />
Raumwissenschaftliches netzweRk<br />
Das Arbeitsprogramm für die nächsten Monate konkretisierte<br />
sich während des zweiten Projekt-Workshops<br />
im Juli 2012 im ILS in Dortmund. Man konzentriert sich<br />
derzeit auf die Entwicklung der analytischen Grundlagen<br />
und der Datenbasis sowie auf die empirischen Untersuchungen<br />
in den<br />
ersten fünf Fallstudienregionen<br />
(Athen, die<br />
Western Islands,<br />
die finnische<br />
Region Pohjois-<br />
Karjala, das<br />
Ruhrgebiet und<br />
die ungarische<br />
Region Nógrá).<br />
Die Fallstudien<br />
beleuchten unterschiedliche<br />
Aspekte von Armut<br />
und sozialer<br />
Ausgrenzung:<br />
Probleme eth-<br />
nischer Minoritäten, städtische Segregation, Arbeitslosigkeit,<br />
Zugang zu relevanten Angeboten und Infrastruktur im<br />
ländlichen Raum sowie Bildungschancen. Ab Januar 2013<br />
schließen sich die empirischen Arbeiten in fünf weiteren<br />
Fallstudienregionen (s. Karte: Schwarze Punkte) an.<br />
Web-Relaunch des ILS<br />
Quelle: ILS<br />
Die 2 x 5 Fallstudien im Rahmen<br />
des ESPON-TIPSE-Projektes<br />
Sabine Weck 0231 9051-184<br />
Sabine.weck@ils-forschung.de<br />
www.ils-forschung.de / www.ils-research.de<br />
Unter der bekannten Domain steht ab sofort die neue<br />
Homepage des ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung<br />
zur Verfügung. Neues Design,<br />
neue Struktur und noch mehr Nutzerfreundlichkeit: Auch<br />
im Internet zeigt sich die wissenschaftliche Ausrichtung<br />
des Instituts ganz im Fokus der neuen Forschungsschwerpunkte<br />
„Stadtentwicklung und Mobilität“ und „Stadtentwicklung<br />
und Städtebau“. Die Navigation bietet Wissenschaftlern,<br />
Politkern und der breiten Fachöffentlichkeit<br />
einen schnellen Zugriff auf alle Informationen über das<br />
ILS: Neues aus der Forschung und den Forschungsprojekten,<br />
Wissenswertes aus Netzwerken und Forschungsverbünden,<br />
Aktuelles wie Veranstaltungshinweise, neue<br />
<strong>Publikationen</strong>. Alle Veröffentlichungen und Vorträge der<br />
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind unter der<br />
neuen Navigation „Wissenstransfer“ gebündelt. Diese<br />
neue Struktur soll den Besuchern der Website helfen,<br />
sich schnell einen Überblick zu verschaffen und gezielt<br />
an die gewünschten Informationen zu gelangen. Mit<br />
dem Relaunch will das ILS seinen fachlichen Austausch<br />
mit Hochschulen und anderen raumwissenschaftlichen<br />
Instituten verbessern und sich als exzellenzorientiertes<br />
außeruniversitäres Forschungsinstitut positionieren.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 35
36<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
50 Jahre Internationales Planertreffen<br />
Luxemburg war Treffpunkt der Delegationen aus den<br />
fünf europäischen Staaten, die seit Anfang der 1960er<br />
Jahre jeweils in der Woche vor Pfingsten zusammenkommen,<br />
um aktuelle Fragen der Raumentwicklung gemeinsam<br />
zu diskutieren, 2012 zum 50. Mal. Deutschland wird<br />
zurzeit durch Ltd. MinRat Dipl.-Ing. Gerd-Rainer Damm,<br />
Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes, Saarbrücken,<br />
Dr.-Ing. Michael Denkel, Albert Speer & Partner,<br />
Frankfurt/M., Verbandsdirektor Karl Heinz Hoffmann,<br />
Waldshut-Tiengen, die Leiterin des Stadtplanungsamtes,<br />
Anne Luise Müller, Köln, <strong>ARL</strong>-Generalsekretär Prof. Dr.-<br />
Ing. Dietmar Scholich, Hannover, und Prof. Julian Wékel,<br />
TU Darmstadt, vertreten.<br />
Raumplanung und Energie<br />
Inhaltlich war das Jubiläumstreffen dem Thema „Raumplanung<br />
und Energie“ gewidmet. Mitglieder aus den<br />
Delegationen stellten grundsätzlich und an konkreten<br />
Beispielen vor, wie auf nationaler, regionaler und lokaler<br />
Ebene mit Energiefragen planerisch umgegangen wird.<br />
Energiewende, Energielandschaft<br />
Veenkolonien<br />
Seitens der niederländischen Delegation berichtete Prof.<br />
Dr. Tejo Spit, Universität Utrecht, über Entwicklungen<br />
bezüglich des Energieverbrauchs und der eingeleiteten<br />
Energiewende, die auch im Nachbarland ein zentrales<br />
Problem darstellt und viel Raum/Fläche benötigt. Jede<br />
Planungsebene ist gefordert. Der Anteil erneuerbarer<br />
Energien (EE) ist derzeit noch gering, auch weil es Defizite<br />
auf der kommunalen Ebene gibt. Jan Hein Boersma, Utrecht,<br />
stellte die Energielandschaft Veenkolonien vor. Es<br />
sind drei Modelle entwickelt worden. Bei Modell 1 wird<br />
EE auf lokaler Ebene selbst produziert. Modell 2 stellt auf<br />
die zentrale Produktion von EE ab, z. B. durch Windparks.<br />
Das dritte Modell ist eine Kombination der beiden ersten<br />
Strategien. Im Kern geht es darum, die Energiebedarfe vor<br />
Quelle: S. Zech<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Ort durch EE zu decken, also autark zu sein. Dieses Ziel<br />
wird nicht einfach zu erreichen sein. Es sind vor allem die<br />
Landwirte daran interessiert, die Bevölkerung ist jedoch<br />
gegen ein solches Vorgehen.<br />
Quelle: L. Bühlmann<br />
Übertragungsleitungen<br />
Energieinfrastruktur und Energiekonzepte<br />
Lukas Bühlmann, Bern, skizzierte in seinem Bericht aus<br />
der Schweiz zunächst die energiepolitische Ausgangslage.<br />
Durch starkes Bevölkerungswachstum und hohe Mobilität<br />
nimmt der Energieverbrauch stetig zu. Die vorhandenen<br />
Energieanlagen sind bezüglich der Produktion und des<br />
Transportes erneuerungsbedürftig. Die Planungshoheit für<br />
Energieanlagen liegt primär bei den Kantonen. Wichtig ist<br />
jetzt, dass auf der regionalen Ebene umfassende, fundierte<br />
Energiekonzepte erarbeitet werden. Im Kanton Uri wurde<br />
dies bereits auf den Weg gebracht.<br />
Raumplanerische<br />
Steuerungsmöglichkeiten<br />
Im ersten Beitrag aus Österreich widmete sich Sibylla<br />
Zech, Wien, vorrangig den Steuerungsmöglichkeiten<br />
der Raumplanung bei energiepolitischen Maßnahmen.<br />
Wasserkraft stellt die wichtigste Sparte der EE dar. Zur<br />
Sicherung von Standorten und Trassen werden Energie-
und Klimaschutzkonzepte, z. B. in der Stadt Graz, oder<br />
Rahmenkonzepte für Windkraftanlagen mit konkreten<br />
Flächenausweisungen, wie in der Energieregion Güssing,<br />
erarbeitet. Die Erweiterung der Energienetze erweist sich<br />
auch in Österreich als erhebliches Problem.<br />
Einbindung<br />
Geothermie<br />
Über die Windenergieentwicklung in Kärnten referierte<br />
Peter Fercher, Klagenfurt. Zur Qualifizierung potenzieller<br />
Standorte wurde ein Kriterienkatalog entwickelt (Sichtbarkeit/Landschaftsbild,<br />
Naturschutz, Siedlungswesen/<br />
Immissionsschutz, Erschließung, Tourismus). Aufgrund<br />
der Ausweisung von Ausschlussgebieten konnte für das<br />
Land Kärnten ein Potenzial von rund 100 Windkraftanlagen<br />
ermittelt werden. Klaus Vatter, Wien, berichtete<br />
anschließend über die Solarpotenzialanalyse der Stadt<br />
Wien auf Basis einer Laserscannerbefliegung und über<br />
das geplante Geothermiezentrum Aspen. Die Analyse<br />
erbrachte ein Dachflächenpotenzial von 51 ha.<br />
Klimapakt<br />
Jean-Marc Staudt, Luxemburg, stellte den „Klimapakt“ vor,<br />
der 2013 starten soll. Wichtige Bestandteile sind eine umfassende<br />
Information und Beratung in den Bereichen EE<br />
und Energieeffizienz. Der Pakt holt Staat und Gemeinden<br />
an einen Tisch, wobei der Staat technische und finanzielle<br />
Unterstützung durch gezielte Förderprogramme bietet,<br />
die die Gemeinden vorrangig für die Umsetzung des<br />
Qualitätsmanagements nutzen, allein oder in regionalen<br />
Verbünden.<br />
Energietrassen, Energieeffizienz<br />
beim Bauen<br />
Seitens der deutschen Delegation bedauerte Gerd-Rainer<br />
Damm zu Beginn seines Statements, dass die Bundes-<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
raumordnung bei der Energiewende bislang weitestgehend<br />
ausgeblendet ist. Das dürfte sich speziell auch<br />
bei der dringlichen Trassierung von Höchstspannungsleitungen<br />
als massives Problem erweisen, da die dafür<br />
herangezogene Bundesnetzagentur über keine raumplanerischen<br />
Erfahrungen<br />
verfügt. Darüber hinaus<br />
fehlt nach wie vor ein<br />
integriertes Konzept zur<br />
Verbesserung der Energieeffizienz.<br />
Im Weiteren<br />
stellte Damm die Überlegungen<br />
und bisherigen<br />
Feststellungen im<br />
Saarland zum Ausbau EE<br />
vor. Anne Luise Müller<br />
ergänzte den deutschen<br />
Input durch Informationen<br />
zum Klimaschutz<br />
in der Stadt Köln. Integrierte<br />
Konzepte zum<br />
Klimaschutz enthalten<br />
Anpassungsmaßnahmen<br />
beispielsweise mit Blick<br />
auf Mobilität und Energieversorgung.Modellvorhaben<br />
unterstützen<br />
nachhaltiges Bauen im<br />
Quelle: M. Kotschan<br />
Quelle: M. Kotschan<br />
Bauwerk Geothermieanlage<br />
Bestand, klima- und energetisch effiziente Sanierungen<br />
von Altbausubstanz, wie in der Naumannsiedlung in<br />
Köln-Riehl.<br />
Abgerundet wurde das Planertreffen durch verschiedene<br />
Fachexkursionen. Besichtigt wurden u. a. die Rekonversionsflächen<br />
von Arbed-Belval und die energetischen<br />
Maßnahmen in der Gemeinde Beckerich. Der Ort hat<br />
sich auf den Weg gemacht, energetisch unabhängig zu<br />
werden.<br />
Dietmar Scholich ✆ 0511 34842-37<br />
scholich@arl-net.de<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
37
38<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Nachhaltiges Flächenmanagement –<br />
Flächensparen, aber wie?<br />
Kompetenzzentrum<br />
für Raumforschung<br />
und Regionalentwicklung<br />
in der Region Hannover<br />
Das 2001 auf Initiative der<br />
<strong>ARL</strong> gegründete Kompetenzzentrum<br />
für Raumforschung<br />
und Regionalentwicklung in der<br />
Region Hannover (KompZ) (www.<br />
kompetenzzentrum-hannover.de)<br />
bündelt mit der Akademie, Instituten<br />
der Leibniz Universität Hannover<br />
und einer Reihe weiterer<br />
außeruniversitärer Einrichtungen<br />
aus Forschung, Verwaltung und<br />
Wirtschaft ein für den norddeutschen<br />
Raum einzigartiges Potenzial<br />
am Wissenschaftsstandort Hannover.<br />
Es bildet ein interdisziplinäres<br />
Netzwerk und Forum für den<br />
Dialog zwischen Wissenschaft,<br />
Praxis und Öffentlichkeit. Ziele<br />
des Netzwerkes sind der wechselseitige Wissenstransfer,<br />
der Austausch von Informationen und Erkenntnissen,<br />
die Erschließung, Bündelung und Nutzbarmachung des<br />
raumwissenschaftlichen und raumentwicklungspolitischen<br />
Know-hows sowie die Zusammenarbeit der beteiligten<br />
Einrichtungen bei gemeinsam interessierenden, aktuellen<br />
und gesellschaftlich relevanten Fragestellungen.<br />
Wichtige Aufgabenfelder des KompZ sind die Forschung,<br />
Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie der regelmäßige<br />
Informations- und Erfahrungsaustausch. Schon<br />
traditionelle Vorhaben sind das jährlich stattfi ndende<br />
Fachforum und die Ringvorlesung im Sommersemester<br />
zu jeweils gesellschaftlich relevanten Fragestellungen<br />
der Raumentwicklung. Die Vorträge der Ringvorlesung<br />
werden in der Schriftenreihe „Stadt und Region als Handlungsfeld“<br />
im Peter Lang Verlag veröffentlicht.<br />
Nachhaltiges Flächenmanagement<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Vorrang der Innen- vor Außenentwicklung<br />
Quelle: Institut Raum & Energie, U. Kinder<br />
Quelle: Ch. van Gemmeren<br />
Das KompZ kann auch 2012 auf eine erfolgreiche Ringvorlesung<br />
mit interessanten, gut besuchten Vorträgen<br />
und intensiven Diskussionen zurückblicken. Für die zwölf<br />
Vorträge konnten namhafte Persönlichkeiten nicht nur<br />
aus der Region Hannover gewonnen werden. Thema war<br />
„Nachhaltiges Flächenmanagement – Flächensparen, aber<br />
wie?“. Denn nach wie vor wird in Teilräumen Deutschlands<br />
zu viel Boden durch Siedlungs- und Verkehrsfl ächen<br />
beansprucht; aktuell sind es täglich mehr 75 ha. Gar nicht<br />
mit berücksichtigt sind dabei die sogenannten indirekten<br />
Flächeninanspruchnahmen z. B. durch Emissionen (Verlärmung,<br />
Verschmutzung etc.) und Zerschneidungen. Nahezu<br />
70 % der Flächeninanspruchnahme fi ndet außerhalb<br />
verdichteter Bereiche statt, also vorwiegend im ländlichen<br />
Raum. Das heißt, das Siedlungsfl ächenwachstum erfolgte<br />
fast ausschließlich auf Kosten der Landwirtschaftsfl ächen,<br />
die oftmals auch für den Naturschutz und für die Kulturlandschaft<br />
wertvolle Wiesen und Weiden waren.<br />
Die Ringvorlesung hat sich der zahlreichen Fragen<br />
angenommen, die aus der Zunahme der Flächeninanspruchnahme<br />
zu Lasten unserer Freiräume erwachsen.<br />
Dazu gehörten allgemeine Fragen nach dem Wie des<br />
Flächensparens mit besonderem Blick auf Niedersachsen:<br />
Worauf ist zu achten, wer ist einzubinden und bei den Diskussionsprozessen<br />
mitzunehmen? Gefragt wurde z. B. auch,<br />
welche raumentwicklungspolitischen Konsequenzen eine<br />
reduzierte Inanspruchnahme von Flächen auf kommunaler,<br />
regionaler und Landesebene mit sich bringt, welche Instrumente<br />
genutzt werden können, ob Flächenzertifi kate ein<br />
gangbarer Weg sind oder wie ein Flächenmonitoring und<br />
die Evaluierung von Regionalplänen gestaltet sein müssen.
Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einer Weltmetropole,<br />
wo Sie in einer der besten Fakultäten des Landes<br />
Stadt-, Verkehrs-, Landschaftsplanung oder Architektur<br />
studieren. In und um diese Weltmetropole scheint alles<br />
möglich – auch komplett neue Städte zu bauen, in denen<br />
bauliche Zitate aus anderen Weltkulturen aufgenommen<br />
und wie selbstverständlich in die eigene Stadtbaukultur<br />
integriert werden. Stellen Sie sich dann vor, Ihr erster Kontakt<br />
mit Deutschland ist das beschauliche Weimar, dessen<br />
Kernstadt man in einem halben Tag zu Fuß erkunden kann,<br />
dessen Stellenwert von einem kulturellen Erbe geprägt<br />
wird, das sich immer wieder auf sich selbst bezieht, wo<br />
jede Entscheidung über bauliche Veränderungen eine<br />
Grundsatzdiskussion über Denkmalpflege auslösen kann.<br />
Sicherlich, diese Gegenüberstellung zwischen Shanghai<br />
und Weimar ist etwas überspitzt. Sie verdeutlicht aber,<br />
welche Gegensätze während des deutsch-chinesischen<br />
Studentenworkshops im Bachelor-Studiengang Urbanistik<br />
an der Bauhaus-Universität aufeinandergestoßen sind:<br />
Dynamik und Bewahrung – und damit die Herausforderung<br />
jeder Stadtbaukultur, eine angemessene Balance zu<br />
finden zwischen dem Interesse, aktuelle Tendenzen und<br />
Trends aufzunehmen, und dem Bestreben, kulturelles<br />
Erbe auch baulich zu vergegenwärtigen.<br />
Die Studenten konnten sich dieser Thematik annähern,<br />
indem sie die Stadtplätze Weimars mit verschiedenen<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Hier war Goethe (nie)<br />
Stadtbaukultur in Weimar und Shanghai<br />
Deutsch-chinesischer Studentenworkshop – Austausch zwischen der Bauhaus-Universität Weimar, Professur Raumplanung<br />
und Raumforschung / Bachelor-Studiengang Urbanistik, und der Tongji University, College of Architecture<br />
& Urban Planning in Shanghai, vom 29.–30. Juni 2012<br />
© Evan Chakroff - flickr.com<br />
Hier war Goethe nie – Goethe-Schiller-Denkmal<br />
in Anting German Town bei Shanghai<br />
Methoden – intuitiv mit Fotografien, analytisch mittels<br />
Plänen, kreativ durch Umgestaltungsideen – in gemischt<br />
deutsch-chinesischen Kleingruppen untersuchten. Die<br />
Auseinandersetzung mit der Sichtweise der chinesischen<br />
Studenten auf den deutschen öffentlichen Raum und seine<br />
umgebende Architektur verdeutlichte beiden Seiten,<br />
was es heißt, Stadtbaukultur in einem anderen Land „lesen<br />
zu lernen“. So konnten die chinesischen Studenten beispielsweise<br />
erfahren, dass nicht jede gotische Fassade auf<br />
eine jahrhundertealte Tradition hinweist, sondern auch<br />
Teil einer historisierenden Baukultur<br />
sein kann, die Deutschland erst im<br />
19. Jahrhundert prägte.<br />
Quelle: Bauhaus-<br />
Universität Weimar<br />
Der tägliche Markt vor dem Rathaus der Stadt mit seiner neogotischen Fassade –<br />
bauliche und gelebte Stadtkultur in Weimar<br />
Stellen Sie sich vor, sie kommen<br />
als Architekt oder Stadtplaner aus<br />
der großen Metropole Shanghai<br />
in das beschauliche Weimar<br />
... dann helfen gut aufbereitete<br />
Hintergrundinformationen, ein<br />
vielfältiger Methodenmix und die<br />
eigene kulturelle Sensibilität, diesen<br />
Kontrast schätzen zu lernen. Die<br />
chinesischen Studenten nahmen<br />
als positive Eindrücke u. a. das rege<br />
öffentliche Leben auf den Stadtplätzen<br />
Weimars, die kurzen Wege und<br />
die entspannte Atmosphäre mit. Im<br />
Übrigen sind von deutschen Städten<br />
inspirierte Ideen auch längst in<br />
China angekommen. In Anting New<br />
Town bei Shanghai kann der Besu-<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
39
40<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
cher sich in einem nach deutschen Vorbildern gebauten<br />
Stadtquartier vor einem Goethe-Schiller-Denkmal – einer<br />
Kopie der Statue in Weimar – fotografieren lassen. Der<br />
Unterschied: Während Weimar eine lebendige Stadt<br />
(ca. 65.000 Einwohner) mit zwei Universitäten ist, ist das<br />
künstliche Stadtbauprojekt (ausgelegt für ca. 30–50.000<br />
Personen, sollten alle Bauabschnitte realisiert werden)<br />
ein Wohnsatellit Shanghais mit Leerständen ohne ausreichende<br />
Nahversorgung (Spiegel-Online 07.10.2011/ Bauwelt<br />
7.2012). Stadtbaukultur wird eben nicht nur durchs<br />
Bauen geprägt, sondern auch durch gelebte Alltagskultur.<br />
Weiterführende Links finden Sie unter: www.arl-net.de/<br />
sara-reimann > Vorträge.<br />
Sara Reimann 0511 34842-52<br />
reimann@arl-net.de<br />
Sara Reimann, Doktorandin in der <strong>ARL</strong>-Geschäftsstelle, begleitete<br />
den Workshop als Gastreferentin. Sie hielt einen Vortrag über die<br />
Herausforderungen von internationalen Vergleichen in der Stadtforschung<br />
und gab für die chinesischen Gäste eine Einführung zum<br />
Stellenwert der Öffentlichkeitsbeteiligung in der deutschen Bauleitplanung.<br />
Ein Dank für die Einladung geht an Prof. Max Welch<br />
Guerra (Inhaber des Lehrstuhls Raumplanung und Raumforschung)<br />
und Elodie Vittu (wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl und<br />
Internationalisierungskoordinatorin des Bachelorstudiengangs<br />
Urbanistik) und für die Begleitung von chinesischer Seite an Zhang<br />
Xuewei (Doctor of Philosophy in Architecture, Lecturer of Architecture<br />
& Design) von der Tongji University Shanghai.<br />
AESOP Doktorandenworkshop in Izmir<br />
Im Juli 2012 fand der jährliche Doktorandenworkshop<br />
der „Association of European Schools of Planning“<br />
(AESOP) in Izmir, Türkei, statt, gemeinsam organisiert<br />
von AESOP, den AESOP Young Academics, der Middle<br />
East Technical University und dem Izmir Institute of High<br />
Technology. Judith Bornhorst, Wissenschaftliche Mitarbeiterin<br />
in der Geschäftsstelle der <strong>ARL</strong>, konnte als eine<br />
von 40 Promovierenden in Planungswissenschaften an<br />
dem internationalen Austausch von Doktorandinnen<br />
und Doktoranden aus ganz Europa teilnehmen. Fachlich<br />
betreut wurde der Workshop von Barrie Needham<br />
(Radboud University of Nijmegen, Niederlande), Michael<br />
Neuman (University of New South Wales, Australien),<br />
Gert de Roo (University of Groningen, Niederlande),<br />
Laura Saija (Universita di Catania, Italien), Piotr Lorens<br />
(Technical University of Gdańsk, Polen).<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Arbeit in Kleingruppen<br />
Quelle: D. Cremer-Schulte<br />
Für die Teilnehmenden war der internationale Austausch<br />
eine bereichernde und motivierende Erfahrung.<br />
Neben der Vorstellung und Diskussion der unterschiedlichen<br />
raumrelevanten Promotionsthemen gab es Vorträge<br />
zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses.<br />
Ein kulturelles Begleitprogramm, das die räumlichen und<br />
soziokulturellen Eigenheiten der dynamischen Küstenregion<br />
Izmir veranschaulichte, ergänzte den fachlichen Teil<br />
des Workshops.<br />
Nach dem viertägigen Austausch ging es für die meisten<br />
Doktorandinnen und Doktoranden nach Ankara zur jährlichen<br />
AESOP Konferenz.<br />
Judith Bornhorst 0511 34842-58<br />
bornhorst@arl-net.de
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
41
42<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Neue Veröffentlichungen aus anderen Verlagen<br />
Stadt und Land im Fluss<br />
Wege in eine zukunftsfähige<br />
Raumentwicklung<br />
Die 2012 erschienene Festschrift ist Professorin<br />
Gerlind Weber als Geburtstags- und Abschiedsgeschenk<br />
gewidmet. Der Sammelband vereint sowohl<br />
fachliche als auch persönlich gefärbte Beiträge ihrer engerenWegbegleiterinnen<br />
und Wegbegleiter.<br />
Das Themenspektrum<br />
reicht von der Regionalentwicklung<br />
über<br />
die Raumordnungspolitik<br />
und ordnungsplanerische<br />
Aspekte der<br />
Raumplanung bis hin zu<br />
Bodenpolitik und Landschaftsschutz.<br />
Die Beiträge<br />
verbinden ein vorsorgeorientiertes<br />
und<br />
verantwortungsvolles<br />
Planungsverständnis,<br />
das Denken in systemischen<br />
Zusammenhängen, das kritische Hinterfragen<br />
vorherrschender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher<br />
Strukturen sowie das Bemühen um eine zukunftsfähige<br />
Entwicklung unseres Lebensraums.<br />
Diese Festschrift ist aber nicht nur eine Momentaufnahme<br />
raum- und planungsrelevanter Themen, sie ist<br />
ganz besonders auch ein Ausdruck der Anerkennung des<br />
Wirkens von Gerlind Weber als Wissenschaftlerin. Seit<br />
vielen Jahren setzt sie sich dafür ein, die Raumplanung als<br />
„Schlüsseldisziplin“ für die Umsetzung einer nachhaltigen<br />
Entwicklung zu etablieren. Es überrascht nicht, dass diese<br />
Forderung auch als inhaltliche Klammer des Sammelbandes<br />
ihren Niederschlag findet. Die Veröffentlichung ist im<br />
Eigenverlag des Instituts für Raumordnung und Ländliche<br />
Neuordnung (IRUB) der Universität für Bodenkultur Wien<br />
erschienen (irub@mail.boku.ac.at).<br />
❍<br />
Große Transformation<br />
Die neueste Ausgabe von RegioPol, der seit 2007<br />
regelmäßig erscheinenden Zeitschrift für Regionalentwicklung,<br />
unter dem Titel „Große Transformation“ befasst<br />
sich mit der Frage, wie wir unser Wohlstandsmodell<br />
– unter den Rahmenbedingungen der großen Krisen und<br />
Umbrüche zu Beginn des 21. Jahrhunderts – wirtschaftlich,<br />
sozial und ökologisch nachhaltig weiterentwickeln<br />
können. Die Weltfinanzkrise, die Verschuldungskrise im<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Euroraum, die Occupy-<br />
Bewegung oder auch die<br />
in Deutschland eingeleitete<br />
Energiewende sind<br />
Anlässe, um sich mit dieser<br />
Fragestellung genauer<br />
auseinanderzusetzen und<br />
die Notwendigkeit tief<br />
greifender wirtschaftlicher<br />
und gesellschaftlicher Veränderungen<br />
zu erörtern.<br />
Welche institutionellen<br />
Veränderungen denkbar<br />
sind und wie eine neue Balance<br />
von Markt und Staat<br />
hergestellt werden kann,<br />
wird in den Beiträgen der Doppelausgabe (1+2/2012) von<br />
RegioPol diskutiert. Dazu konnten namhafte Autorinnen<br />
und Autoren wie die Vorsitzende der Enquetekommission<br />
des Deutschen Bundestages „Wachstum, Wohlstand,<br />
Lebensqualität“, Daniela Kolbe, und der Umweltökonom<br />
Ernst Ulrich von Weizsäcker gewonnen werden. Das Heft<br />
enthält auch die zentralen Aussagen des Positionspapiers<br />
aus der <strong>ARL</strong> Nr. 89, „Postfossile Mobilität und Raumentwicklung“.<br />
RegioPol ist über die Nord/LB (Tel. 0511 361-<br />
4078) zu beziehen.<br />
Umweltrecht<br />
❍<br />
Die 23., neu bearbeitete und im März 2012 erschienene<br />
Auflage des Taschenbuchs mit wichtigen<br />
Gesetzen und Verordnungen zum Schutz der Umwelt<br />
vermittelt in einer einheitlich strukturierten und konzentrierten<br />
Darstellungsweise<br />
Grundkenntnisse über das<br />
Umweltrecht in Deutschland.<br />
Das Buch mit einer Einführung<br />
von Peter-Christoph<br />
Storm beinhaltet<br />
eine Sammlung der Gesetze<br />
und Rechtsverordnungen<br />
des Bundes zum<br />
Schutz der Umwelt und<br />
wendet sich an alle diejenigen,<br />
die an einer ersten<br />
und allgemein verständlichen<br />
Information über die rechtliche Seite des Schutzes<br />
und der Pflege der natürlichen Lebensgrundlagen<br />
interessiert sind. Bereits berücksichtigt sind die jüngsten<br />
Änderungen des Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallrechts<br />
(ISBN 978-3-423-05533-8).
Städtebauliche Instrumente<br />
bei der Konversion von<br />
Militärarealen<br />
Der bereits Ende der 1980er Jahre einsetzende Konversionsprozess<br />
hat durch die jüngste Strukturreform<br />
der Bundeswehr erneut an Bedeutung gewonnen. Bedingt<br />
durch die Veränderung<br />
der globalen sicherheitspolitischen<br />
Lage und den<br />
dadurch verteidigungspolitisch<br />
veranlassten Umbau<br />
der Bundeswehr zu einer<br />
Armee mit weltweitem Interventionsauftrag<br />
werden<br />
zahlreiche Liegenschaften<br />
von den Streitkräften nicht<br />
mehr benötigt. Betroffene<br />
Kommunen stehen damit<br />
vor der Herausforderung,<br />
sinnvolle und finanzierbare<br />
Nachnutzungen für<br />
unterschiedlichste Liegenschaftstypen zu finden, um ein<br />
dauerhaftes Brachfallen der Flächen und damit verbundene<br />
negative städtebauliche Effekte zu vermeiden.<br />
Die 2012 von Eva Koch vorgelegte Untersuchung setzt<br />
sich umfassend mit den einzelnen städtebaulichen Instrumentarien<br />
auseinander, die betroffenen Kommunen<br />
im Rahmen der Konversion zur Verfügung stehen. Einen<br />
ersten Schwerpunkt bildet die Erarbeitung der planungsrechtlichen<br />
Rahmenbedingungen. Unter Berücksichtigung<br />
der Besonderheiten, die aus der militärischen Vornutzung<br />
der Flächen resultieren, werden sodann neben der Bauleitplanung<br />
und den städtebaulichen Gesamtmaßnahmen<br />
insbesondere auch kooperative Entwicklungsmöglichkeiten<br />
durch den Abschluss städtebaulicher Verträge in den<br />
Blick genommen (ISBN 978-3-869 65-198-9).<br />
Stadt – Landschaft – Hybridität<br />
❍<br />
In dem Buch „Stadt –<br />
Landschaft – Hybridität.<br />
Ästhetische Bezüge<br />
im postmodernen Los<br />
Angeles mit seinen modernen<br />
Persistenzen“<br />
von Olaf Kühne werden<br />
die wesentlichen Einflussfaktoren<br />
auf den<br />
Entwicklungspfad des<br />
Großraums Los Angeles<br />
untersucht. Dabei werden<br />
lokale Eigenlogiken<br />
ebenso betrachtet wie<br />
die lokalen Ausprägungen<br />
globaler Einflüsse.<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Besondere Berücksichtigung finden dabei die Fragen, in<br />
welcher Form sich ästhetische Vorstellungen von Raumgestaltung<br />
und in welcher Form sich die Ergebnisse von<br />
durch Angst bedingtem Handeln in den physischen Raum<br />
einschreiben. Die Untersuchung basiert auf der sozialkonstruktivistischen<br />
Landschaftstheorie, die insbesondere<br />
die sozialen Konstruktionsmechanismen von Landschaft<br />
in das Zentrum ihrer Betrachtungen stellt (ISBN 978-3-<br />
531-18661-0).<br />
❍<br />
Smart City in Practice<br />
Smart Cities are<br />
being discussed<br />
all around the<br />
world. Information<br />
and communication<br />
technology<br />
is being implemented<br />
to contribute<br />
to solving<br />
current and future<br />
social challenges<br />
within cities. The<br />
book “Smart City<br />
in Practice. Converting<br />
Innovative<br />
Ideas into Reality” (edited by Lena Hatzelhoffer, Kathrin<br />
Humboldt, Michael Lobeck and Claus-C. Wiegandt)<br />
shows how a Smart City was actually developed over five<br />
years as a Public-Private Partnership between Deutsche<br />
Telekom and the city of Friedrichshafen. The aim of the<br />
project was to enhance the quality of life of the citizens,<br />
to increase the locational advantages for businesses and<br />
to raise the level of interconnection in the urban society.<br />
The idea was put into practice over a five-year period<br />
and was accompanied by social-scientific research. The<br />
authors reveal the impact and purpose of the project,<br />
which provides a concrete contribution to the worldwide<br />
debate about Smart Cities (ISBN 978-3-86859-151-4).<br />
Grenzgänger und Räume<br />
der Grenze<br />
Raumkonstruktionen in der<br />
Großregion SaarLorLux<br />
❍<br />
Das als Band 1 in der neuen Reihe „Luxemburg-Studien<br />
/ Études luxembourgeoises“ erschienene Buch<br />
behandelt auf knapp 400 Seiten das Grenzgängerphänomen<br />
in der Großregion SaarLorLux. In diesem Gebiet, zu<br />
dem das Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen, Luxemburg<br />
und Wallonien zählen, pendeln EU-weit die meisten<br />
Grenzgänger. Christian Wille nimmt die Grenzgänger<br />
weniger als statistische Größen des Arbeitsmarkts in den<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
43
44<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Blick, sondern vielmehr<br />
als Menschen,<br />
die Europa im Alltag leben.<br />
Dabei geht es um<br />
grenzüberschreitende<br />
Lebens- und Erwerbsprojekte,Interkulturalität,<br />
Mehrsprachigkeit,<br />
Stereotype, soziale<br />
Netzwerke und Identitätsfragen.<br />
Daneben<br />
wird das Grenzgängerwesen<br />
historisch aufgearbeitet<br />
und zentrale<br />
Entwicklungen werden<br />
mit den wirtschaftlichen<br />
und sozialen Umbrüchen in dem Vierländereck<br />
verknüpft. Die sozialgeographische Studie zeichnet ein<br />
umfassendes Porträt der grenzüberschreitenden Region<br />
und der regionalpolitischen Kooperationsstrukturen.<br />
Sie gibt erstmalig Einblicke in den Alltag ihrer mobilen<br />
Bewohner (ISBN 978-3-631-63634-3).<br />
Qualifizierungsprozesse<br />
suburbaner Freiräume in<br />
wachsenden Stadtregionen<br />
Erfahrungen, Herausforderungen<br />
und Potentiale am Beispiel<br />
der Region Köln/Bonn<br />
❍<br />
Dynamische Urbanisierungs- und Transformationsprozesse<br />
haben zu neuen Phänomenen stadträumlicher<br />
Realitäten geführt. Während die Qualifizierung der<br />
entstandenen suburbanen Freiräume ein vielfach proklamiertes<br />
Ziel in Planung, Politik und Wissenschaft ist, ist die<br />
Übersetzung dieser Qualifizierungsziele in die Planungspraxis<br />
bislang wenig erforscht. Die Forschungsarbeit geht<br />
von der grundlegenden Annahme aus, dass die Transformationsprozesse<br />
durch eine offensive, entwicklungs- und<br />
umsetzungsorientierte<br />
Strategie gesteuert werden<br />
können. Anhand<br />
der in der Region Köln/<br />
Bonn geplanten Freiraumnetzwerke„RegioGrün“<br />
und „Grünes C“<br />
untersucht die Autorin,<br />
Cornelia Peters, die<br />
Frage, unter welchen<br />
Bedingungen Qualifizierungsprozesse<br />
suburbaner Freiräume<br />
langfristig erfolgreich<br />
sein können. Hierzu<br />
werden für die beiden<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
im Rahmen der Regionale 2010 umgesetzten Projekte<br />
einerseits fördernde und hemmende Prozesswirkungen<br />
identifiziert, andererseits wird die Qualität der Prozess-<br />
und Projektziele untersucht. Letztere werden in den<br />
Kontext aktueller Entwicklungstrends – den festgestellten<br />
„Perspektivenwandel auf Landschaft“ – gestellt und an<br />
diesen bemessen. Dem handlungs- und wirkungsorientierten<br />
Forschungsansatz liegt ein umfassender Qualifizierungsbegriff<br />
zugrunde: Über die materiell-gestalterische<br />
„In-Wertsetzung“ des räumlichen Gegenstands hinaus<br />
bezieht er den Prozess selbst mit ein – mitsamt seiner<br />
Ergebnisse und Wirkungen sowie der in ihm agierenden<br />
Akteure, ihrer Wahrnehmungen, Denk- und Verhaltensmuster<br />
(ISBN 978-3-8440-0785-5).<br />
Urbanismus und Verkehr<br />
Bausteine für Architektur, Stadt-<br />
und Landschaftsplanung<br />
❍<br />
Das Buch von Helmut Holzapfel vermittelt einen<br />
guten Überblick über Zusammenhänge zwischen<br />
Stadt- und Raumentwicklung und Verkehr aus interdisziplinärer<br />
Perspektive. Zwischen all den Autos, die<br />
jahrelang Vorfahrt in der Verkehrsplanung hatten, wird<br />
hier wieder der Mensch sichtbar mit seinen Bedürfnissen<br />
nach Gemeinschaft und<br />
Nahversorgung. Dem<br />
Trend der Globalisierung,<br />
der den Fernverkehr<br />
zum Planungsziel<br />
erhoben hatte, steht die<br />
aktuelle Tendenz zur<br />
Abschottung gegenüber,<br />
die sich in gesicherten<br />
Wohnvierteln oder geschlossenenFerienanlagen<br />
zeigt. Verbunden<br />
sind die Menschen zwar<br />
durch Netzwerke, nicht<br />
aber durch Begegnungen<br />
im Raum. Der wird von<br />
Straßen begrenzt, die den realen Kontakt erschweren.<br />
Das Buch skizziert diese fortschreitende Entwicklung<br />
und ist damit zugleich ein Geschichtsbuch der Stadt- und<br />
Verkehrsentwicklung.<br />
Die Veröffentlichung zeichnet sich durch ihre kritische<br />
und – teilweise neue – fächerübergreifende Betrachtungsweise<br />
aus. Dadurch werden bisher selten thematisierte<br />
– und auch für Architekten interessante – Einblicke in die<br />
Wechselwirkung von Stadtgestaltung, Kommunikation<br />
und Verkehr möglich. Ausdrücklich will der Autor Anregungen<br />
für die Planungspraxis geben, Strategien für<br />
den Umgang mit der „archipelisierten“, fragmentierten<br />
modernen Stadt zu entwickeln. Das Buch ist ein Plädoyer<br />
für die künftige Planung eines neuen Zusammen-Lebens<br />
(ISBN 978-3-8348-1950-5).
Standards in internationalen<br />
Wertschöpfungsketten<br />
Akteure, Ziele und Governance<br />
in der Obst- und Gemüse-<br />
Wertekette Kenia – EU<br />
Im Zuge der Globalisierung nimmt die Bedeutung<br />
internationaler Wertschöpfungsketten zu. Aus wissenschaftlicher<br />
Perspektive stellt sich die Frage, wie solche<br />
Ketten organisiert und gesteuert werden können und<br />
welche Auswirkungen die Einbindung in eine internationale<br />
Kette für die jeweiligen Akteure haben kann.<br />
Der vorliegende<br />
Beitrag zeigt, welche<br />
Partizipationsmöglichkeiten<br />
sich für landwirtschaftlicheProduzenten<br />
in internationalen<br />
Wertschöpfungsketten<br />
ergeben und wie<br />
Bauern und Händler<br />
den auftretenden Herausforderungen<br />
durch<br />
praktische und informelle<br />
Lösungen begegnen.<br />
Als Beispiele<br />
nutzt der Autor Peter<br />
Dannenberg exportorientierte<br />
kenianische Obst- und Gemüsebauern und<br />
ihren Umgang mit dem internationalen Prozessstandard<br />
GlobalGAP.<br />
Konzeptionell bedient sich der Beitrag aktueller Ansätze<br />
zu Wertschöpfungsketten und erweitert diese durch<br />
konzeptionelle Überlegungen zu Standards, Prinzipal-<br />
Agenten-Problemen, Informalität und Vernetzungen in<br />
räumlicher Nähe (ISBN 978-3-643-11736-6).<br />
Raumkonstruktionen<br />
in der Geographie<br />
Eine paradigmenspezifische<br />
Darstellung gesellschaftlicher und<br />
fachspezifischer Konstruktions-,<br />
Rekonstruktions- und Dekonstruktionsprozesse<br />
von „Räumlichkeit“<br />
❍<br />
Seit ihren Anfängen als akademische Disziplin verstand<br />
sich die Geographie als die Wissenschaft vom „Raum”,<br />
von den „räumlichen Strukturen“ und „raumrelevanten<br />
Prozessen“ in Gesellschaft und Natur. Dabei blieb aber<br />
über weite Strecken der Fachgeschichte eine explizite<br />
Thematisierung des „Raumes“ aus: „Raum“ wurde<br />
schlichtweg als ein Element der „Realität“ interpretiert,<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
das einfach „gegeben“<br />
und objektiv<br />
analysierbar ist.<br />
Im Zuge des „spatial<br />
turn”, den die<br />
Sozial- und Kulturwissenschaften<br />
in<br />
den letzten Jahren<br />
durchlaufen haben<br />
und durch den der<br />
„Raum” zum allgemeinenMode-Forschungsgegenstand<br />
avancierte, wandelte<br />
sich dieses „Raumbild“<br />
radikal: „Raum“<br />
wird nun als gesellschaftlich gemachter, interpretierter,<br />
angeeigneter Raum, als ein Produkt von Handlungen,<br />
Symbolen, Zeichen und Diskursen, kurz als ein Konstrukt<br />
der sozialen Praxis interpretiert. „Räume“ und die „Räumlichkeit“<br />
der Gesellschaft sind daher, der gegenwärtigen<br />
Auffassung in der Scientific Community folgend, nur auf<br />
Basis einer konstruktivistischen Perspektive sinnvoll zu<br />
erfassen und wissenschaftlich zu untersuchen.<br />
Diese Perspektive liegt auch der Veröffentlichung von<br />
Marc Michael Seebacher (mit einem Beitrag von Peter<br />
Weichhart) zugrunde, die versucht, die Geographie in<br />
ihrer Rolle als „Raumwissenschaft“ und auf Basis ihrer<br />
vielfältigen Interpretationen und Konzeptionalisierungen<br />
des Verhältnisses von „Gesellschaft und Raum“ konstruktivistisch<br />
zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen die<br />
komplexen „Raumkonstruktionen“ der Geographie, die,<br />
aufbauend auf einer paradigmenspezifischen Zugangsweise,<br />
mit ihren jeweiligen Elementen, Ordnungsstufen<br />
und ontologischen sowie epistemologischen Grundannahmen<br />
dargestellt werden (ISBN 978-3-900830-79-3).<br />
Digitales Baden-Württemberg<br />
Den Herausforderungen<br />
der<br />
Zukunft, seien es die<br />
Sicherung des Lebensstandards,<br />
die Alterung<br />
der Gesellschaft<br />
oder eine nachhaltige<br />
Entwicklung, lässt<br />
sich nur durch Innovationen<br />
begegnen.<br />
Die Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
spielt dabei eine<br />
Schlüsselrolle, weil<br />
sie selbst Gegenstand<br />
ständiger Innovationstätigkeit<br />
ist, aber auch<br />
❍<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
45
46<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
weil sie Innovationen in anderen Technologiefeldern fördert,<br />
ja oft sogar erst möglich macht. Die Untersuchung<br />
„Digitales Baden-Württemberg“ beleuchtet anhand von<br />
Daten der amtlichen Statistik eingehend die Bedeutung<br />
der Informations- und Kommunikationstechnik für die<br />
Innovationstätigkeit im Land. Sie ist in der Reihe Statistische<br />
Analysen 1/2012 unter http://www.statistik-bw.<br />
de/Veroeffentl/803312001.pdf herunterladbar.<br />
Veranstaltungshinweise<br />
9.–10. Oktober in Berlin<br />
Ergebniskonferenz zu dem ExWoSt-Forschungsvorhaben<br />
StadtKlima<br />
Veranstalter: Bundesministerium für Verkehr, Bau und<br />
Stadtentwicklung (BMVBS), Bundesinstitut für Bau-,<br />
Stadt- und Raumforschung (BBSR)<br />
Kontakt: stadtklimaexwost@valentum.de<br />
Weitere Informationen: www.bbsr.bund.de<br />
11.–12. Oktober in Berlin<br />
Internationaler Kongress: Städtische Energien<br />
Veranstalter: Bundesministerium für Verkehr, Bau und<br />
Stadtentwicklung, gemeinsam mit der Bauministerkonferenz<br />
der Länder, dem Deutschen Städtetag und dem<br />
Deutschen Städte- und Gemeindebund<br />
Kontakt: sally below cultural affairs, Schlesische Straße<br />
29-30, 10997 Berlin<br />
Tel. 030 6953708-0, Fax 030 6953708-20<br />
nsp-kongress@sbca.de<br />
Weitere Informationen: www.sbca.de<br />
6. November in Eschborn bei Frankfurt<br />
NASS-Tage: Neue Wasserinfrastrukturkonzepte in der<br />
Stadtplanung<br />
Veranstalter: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V.<br />
Kontakt: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e.V., Sarah Heimann, Theodor-<br />
Heuss-Allee 17, 53773 Hennef<br />
Tel.: 02242 872-192, Fax: 02242 872-135<br />
heimann@dwa.de<br />
Weitere Informationen:<br />
www.saniresch.de/de/aktuelles/dwa-tagung<br />
❍<br />
❍<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
7. November in Salzgitter<br />
Fachtagung: Urbane Renaissance – Zukunft beginnt<br />
JETZT!<br />
Veranstalter: Studiengang Stadt- und Regionalmanagement<br />
der Ostfalia Universität für angewandte Wissenschaften<br />
Kontakt: Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,<br />
Stadt- und Regionalmanagement,<br />
Karl-Scharfenberg-Sraße 55/57, 38229 Salzgitter<br />
Tel.: 05341 875-52210<br />
Weitere Informationen:<br />
www.ostfalia.de/cms/de/fachtagung/srm<br />
❍<br />
13.–14. November in Erfurt<br />
Bauhaus.SOLAR: Technologie – Design – Umwelt<br />
5. Internationaler Kongress<br />
Veranstalter: SolarInput e.V., Bauhaus-Universität<br />
Weimar, Messe Erfurt GmbH<br />
Kontakt: Messe Erfurt GmbH, Gothaer Straße 34,<br />
99094 Erfurt<br />
bauhaus.solar@messe-erfurt.de<br />
Weitere Informationen: www.bauhaus-solar.de<br />
❍<br />
14.–15. November in Offenburg<br />
SRL-Jahrestagung 2012: Klima.Stadt.Wandel. umdenken<br />
– umsteuern – umplanen – umbauen<br />
Veranstalter: SRL – Vereinigung für Stadt-, Regional- und<br />
Landesplanung in Kooperation mit dem IfR und dem<br />
Klimabündnis im Rahmen der ecomobil 2012 der Messe<br />
Offenburg<br />
Kontakt: SRL-Geschäftsstelle, Yorckstr. 82, 10965 Berlin<br />
Tel.: 030 2787468-0<br />
info@srl.de<br />
Weitere Informationen: www.ecomobil-offenburg.de<br />
19.–20. November in Luxemburg-City (Kirchberg)<br />
❍<br />
Europäische Konferenz: Metropolitane Grenzregionen<br />
in Europa<br />
Veranstalter: IMeG, Bundesministerium für Verkehr,<br />
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Bundesinstitut für<br />
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), gemeinsam mit<br />
der luxemburgischen Landesplanung<br />
Weitere Informationen:<br />
www.metropolitane-grenzregionen.eu/veranstaltungen
6.–7. Dezember in Berlin<br />
Der demographische Wandel: Eine Gefahr für Sicherung<br />
gleichwertiger Lebensbedingungen?<br />
Veranstalter: Arbeitskreis „Städte und Regionen“ der<br />
Deutschen Gesellschaft für Demographie gemeinsam<br />
mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung<br />
Bonn (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und<br />
Raumordnung (BBR)<br />
Kontakt: Deutsche Gesellschaft für Demographie<br />
(DGD), Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie,<br />
Lennéstr. 25, 53113 Bonn<br />
mail@demographie-online.de<br />
Weitere Informationen: www.demographie-online.de<br />
13.–15. Februar in Portland, Orgeon, USA<br />
❍<br />
7th International Planning, Law, and Property Rights<br />
Conference: Property Rights and Planning in a Changing<br />
Economy<br />
Veranstalter: International Association on Planning,<br />
Law, and Property Rights<br />
Weitere Informationen: www.plpr2013.org<br />
18.–20. März in Hamburg<br />
European Climate Change Adaptation Conference<br />
(ECCA) 2013<br />
Veranstalter: TuTech Innovation GmbH<br />
Kontakt: Gerlinde Loebkens, TuTech Innovation GmbH,<br />
Harburger Schlossstraße 6-12, 21079 Hamburg<br />
Tel.: 040 76629-6551, Fax: 040 76629-6559<br />
loebkens@tutech.de<br />
Weitere Informationen: www.eccaconf.eu<br />
❍<br />
RaumfoRschung / Raumentwicklungspolitik<br />
Abonnieren Sie den<br />
<strong>ARL</strong>-Newsletter<br />
Mit dem kostenlosen und in unregelmäßiger Folge<br />
erscheinenden Newsletter weist die <strong>ARL</strong> vor<br />
allem auf Neuerscheinungen und Veranstaltungen<br />
der <strong>ARL</strong> hin und berichtet über wichtige Ergebnisse<br />
aus der Gremienarbeit. Der Newsletter führt über<br />
Links zur Website der <strong>ARL</strong>, wo die vollständigen<br />
Beiträge zu finden sind.<br />
Informationen, die aufgrund ihrer Aktualität im<br />
Newsletter publiziert werden, erscheinen in der<br />
Regel nicht mehr in den NACHRICHTEN der <strong>ARL</strong>.<br />
Es lohnt sich also, beides regelmäßig zu beziehen.<br />
Anmeldungen zum Newsletter können Sie über<br />
die <strong>ARL</strong>-Website (www.arl-net.de, Menüpunkt<br />
„Newsletter“) vornehmen. Dort finden Sie alle notwendigen<br />
Hinweise.<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
47
48<br />
Förderkreis Für raum- und umweltForschung<br />
Werner-Ernst-Preis 2012<br />
Umgang mit „Wutbürgern“<br />
Die Förderung des Nachwuchses in raumwissenschaftlicher<br />
Forschung und Planungspraxis ist Ziel<br />
des Werner-Ernst-Preises, den der „Förderkreis für Raumund<br />
Umweltforschung – Vereinigung von Freunden der<br />
<strong>ARL</strong>“ (FRU) alljährlich auslobt. „Infrastrukturgroßprojekte:<br />
Akzeptanz durch Raumplanung“ lautete das Wettbewerbsthema<br />
– in Anlehnung an die Thematik des <strong>ARL</strong>-<br />
Kongresses 2012. Die Jury zeichnete zwei Arbeiten aus:<br />
Martin Kohl erhielt den ersten Preis, dotiert mit 2.000<br />
Euro, und Christine Eismann bekam den zweiten Preis,<br />
dotiert mit 1.500 Euro. Beide konnten die Jury mit ihren<br />
akademischen Abschlussarbeiten überzeugen.<br />
Der Preis, der den Namen des ehemaligen Ehrenpräsidenten<br />
der Akademie für Raumforschung und Landesplanung<br />
(<strong>ARL</strong>) trägt, wurde zum 21. Mal vergeben. Der<br />
Vorsitzende des Förderkreises, Prof. Dr.-Ing. Jörg Knieling,<br />
HafenCity Universität Hamburg, umriss das Themenfeld<br />
wie folgt: „Die Ausschreibung forderte dazu auf, das<br />
Spannungsfeld von Beteiligung und Protest auszuloten.<br />
‚Wutbürger‘, ‚Fortschrittsverweigerer‘ etc. sind Begriffe,<br />
die polemisieren. Ist aber der Protest nicht ebenso<br />
Frühwarnsystem oder Mitwirkung? Ist er nicht Qualitätsmerkmal<br />
einer funktionierenden Demokratie? Die neue<br />
Protestkultur ist kreativ und technologisch innovativ.<br />
– Was bedeutet dies für die Raumplanung? Kann sie die<br />
positive Energie aufgreifen?“<br />
Positiv aufgegriffen hat das Thema Martin Kohl. Er<br />
studiert im Masterstudiengang an der Justus-Liebig-<br />
Universität Gießen Geographie und schrieb am Institut<br />
für regionale und kommunale Planung die Bachelorarbeit<br />
„Planungsprozesse von Windkraftanlagen – Einflussfaktoren<br />
und Akzeptanz“. Darin wird die Ansiedelung<br />
von Windkraftanlagen im Rahmen der Bauleitplanung<br />
untersucht. Die Jury bescheinigt der Arbeit neben sauberer<br />
methodischer Herangehensweise und sprachlicher<br />
Klarheit und Prägnanz „nicht unwesentliche Erkenntnisfortschritte“.<br />
Dieses Lob gab es vor allem dafür, dass Kohl<br />
herausgearbeitet hat, wie „akzeptanzstärkende Modelle<br />
mit finanziellem Nutzen für die Bürger wirken“ und wie<br />
wichtig eine gezielte Einbindung engagierter Akteure<br />
bei kommunalen Planungsprozessen ist“. Der Output sei<br />
„kreativ und innovativ“, so das Urteil der unabhängigen<br />
Jury, der in diesem Jahr neben dem Vereinsvorsitzenden<br />
Jörg Knieling auch Stephanie Külzer (Fraport AG, Frankfurt<br />
am Main) und Prof. Dr. Wilfried Erbguth (Universität<br />
Rostock) angehörten.<br />
Die zweite Preisträgerin, Christine Eismann, studierte an<br />
der Universität Bonn Geographie mit den Nebenfächern<br />
Volkswirtschaftslehre und Politik und arbeitet inzwischen<br />
am Geographischen Institut der Universität Bonn. Als<br />
Wettbewerbsbeitrag reichte sie ihre Diplomarbeit ein,<br />
in der sie „Motive und Organisation bürgerschaftlichen<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
Foto: M. Schlote<br />
Im Leipziger Neuen Rathaus wird der Werner-Ernst-Preis 2012<br />
übergeben: (v.l.) Jörg Knieling, Christine Eismann, Martin Kohl<br />
Engagements in Ahaus im Kontext des Brennelement-<br />
Zwischenlagers“ analysiert hat. Eismann untersuchte<br />
unterschiedliche Gruppierungen, die sich für bzw. gegen<br />
Atomkraft einsetzen, im Hinblick auf die Fragen, wie<br />
bürgerschaftliches Engagement motiviert und organisiert<br />
ist, ob es ein bleibendes Phänomen ist und welche<br />
Auswirkungen der Protest gegen die Anlage in Ahaus<br />
dauerhaft haben kann. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass<br />
bürgerschaftliches Engagement bei den Atomkraftgegnern<br />
in der Regel stärker ausgeprägt ist. Sie haben eine<br />
„konsistentere Einstellung“ gegenüber der Sache und<br />
legen „größere Handlungsbereitschaft“ an den Tag als<br />
die Befürworter. Laudator Jörg Knieling hob außerdem<br />
hervor: „Die Arbeit zeichnet sich durch einen originellen<br />
theoretischen Bezugsrahmen aus und nutzt schlüssig die<br />
Methoden qualitativer Sozialforschung, die teilnehmende<br />
Beobachtung und das problematisierende Interview.“<br />
Michaela v. Bullion 0511 34842-56<br />
bullion@arl-net.de
Werner-Ernst-Preis 2013<br />
22. FRU-Förderpreis-Wettbewerb<br />
Internationale<br />
Ausschreibung<br />
Förderkreis für Raum-<br />
und Umweltforschung e. V.<br />
Thematischer Rahmen des Wettbewerbs<br />
Die in vielen Köpfen vorherrschende Vorstellung „Hier<br />
die Stadt, dort die Landschaft“ spiegelt nicht die Wirklichkeit<br />
und die Vielfalt der Raumstruktur in Deutschland<br />
und Europa wider. Die Grenzen zwischen Stadt<br />
und Land/Landschaft verschwimmen immer mehr und<br />
lösen sich zum Teil auf. Auf der einen Seite verstädtert<br />
die Landschaft, auf der anderen Seite erobert sie Freiräume<br />
in der Stadt.<br />
Die Stadtlandschaften, in denen wir leben, verändern<br />
sich in rasantem Tempo. Megatrends wie Globalisierung,<br />
Pluralisierung der Lebensstile, Klimawandel<br />
und Energiewende prägen die Entwicklung urbaner,<br />
suburbaner und ländlich-peripherer Räume. Diese<br />
Raumkategorien können jedoch nicht mehr unabhängig<br />
voneinander betrachtet werden, da zwischen ihnen<br />
zahlreiche Interdependenzen bestehen. Eine disziplinübergreifende,<br />
integrative und regionale Sichtweise<br />
ist erforderlich, um den Wandel, dem regionale Stadtlandschaften<br />
unterworfen sind, genauer zu analysieren<br />
und zu verstehen.<br />
Der Werner-Ernst-Preis 2013 ruft dazu auf, sich mit<br />
dem Wandel und der Gestaltung regionaler Stadtlandschaften<br />
auseinanderzusetzen. Die Beiträge können<br />
sich aus unterschiedlichen Fachsichtweisen mit dem<br />
Förderkreis Für raum- und umweltForschung<br />
Regionale<br />
Stadtlandschaften<br />
© GordonGrand – Fotolia.com<br />
Themenfeld befassen, sie können theoretisch-konzeptionell<br />
ausgerichtet sein oder sich empirisch auf Fallbeispiele<br />
oder einzelne Projekte beziehen. Mögliche<br />
Fragen könnten beispielsweise sein:<br />
■ Wie kann eine zukunftsfähige Siedlungs- und Freiraumentwicklung<br />
regionaler Stadtlandschaften<br />
aussehen? Welche Leitbilder, Strategien und Instrumente<br />
wären denkbar, um z. B. dem Flächensparziel<br />
von 30 ha näherzukommen und es konsequenter<br />
als bisher umzusetzen?<br />
■ Welche Chancen und Risiken sind in regionalen<br />
Stadtlandschaften mit den Folgen des Klimawandels<br />
und der Energiewende verbunden? Wie kann<br />
politisch-planerisch damit umgegangen werden?<br />
■ Welche räumlichen Implikationen sind mit der Veränderung<br />
von Mobilität und Arbeit verknüpft? Wie<br />
können sich regionale Stadtlandschaften erfolgreich<br />
daran anpassen?<br />
■ Wie könnten regionale Stadtlandschaften in Zeiten<br />
einer „Postwachstumsgesellschaft“ aussehen? Wie<br />
könnte sich eine Umsteuerung in Form von De-<br />
Globalisierung, regionaler Ökonomie, Subsistenz<br />
und Suffi zienz in der stadt-regionalen Entwicklung<br />
niederschlagen?<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012<br />
49
50<br />
Förderkreis Für raum- und umweltForschung<br />
■ In welcher Art und Weise verändern sich die Vorstellungen<br />
über das Verhältnis von städtischem Raum<br />
und Natur? Stadt in der Natur – Natur in der Stadt?<br />
■ Welche unentdeckten (kultur)landschaftlichen Qualitäten<br />
und Potenziale, die es möglicherweise noch<br />
planerisch in Wert zu setzen gilt, besitzen urbane<br />
und suburbane Räume?<br />
■ Wie lässt sich die Entwicklung regionaler Stadtlandschaften<br />
integrativ steuern? Wie lässt sich das dafür<br />
notwendige soziale Miteinander vor Ort fördern<br />
und gestalten?<br />
■ Wie können planerische Probleme integrativ angegangen<br />
werden, die nicht an den bestehenden<br />
administrativen Grenzen der Stadt oder des Stadtumlandes<br />
haltmachen, sondern die gesamte Stadtlandschaft<br />
mit all ihren Verflechtungen betreffen?<br />
■ Welche Rolle spielen verschiedene Arten der öffentlichen<br />
Infrastruktur bei der Entwicklung regionaler<br />
Stadtlandschaften? Wie lassen sich unter den<br />
veränderten Rahmenbedingungen zukunftsfähige<br />
Infrastrukturen planen und gestalten bzw. sichern?<br />
Die hier aufgeworfenen Fragen sollen nur als Anregung<br />
und Inspirationsquelle dienen. Themen der Wettbewerbsbeiträge<br />
können einzelne Fragestellungen mit<br />
Bezug zu diesen inhaltlichen Zusammenhängen sein,<br />
ebenso aber auch weitere Aspekte des Themenfelds<br />
„Regionale Stadtlandschaften“.<br />
Erwartungen an die Wettbewerbs-<br />
beiträge<br />
Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen<br />
und -wissenschaftler (Master-, Promotions-<br />
oder Post Doc-Phase) ebenso wie an Personen,<br />
die sich in ihrer beruflichen Praxis in Verwaltung,<br />
Planungsbüros etc. mit Fragen der Raumentwicklung<br />
beschäftigen. Er ist offen für alle raumrelevanten Disziplinen.<br />
Wissenschaftlich ausgerichtete Beiträge mit<br />
eher theoretischem Ansatz sind ebenso willkommen<br />
wie analytische Arbeiten oder reflektierte Erfahrungsberichte<br />
aus der Praxis mit wissenschaftlicher Fundierung.<br />
Interessierte können gerne zunächst beim Förderkreis<br />
anfragen, ob sich ein vorgesehenes Thema für den<br />
Wettbewerb eignet. Neben eigens für den Werner-<br />
Ernst-Preis 2013 erstellten Beiträgen können auch Arbeiten<br />
eingereicht werden, die auf umfassenderen, bereits<br />
vorliegenden oder in Arbeit befindlichen Studien-,<br />
Projekt- oder Abschlussarbeiten sowie Dissertationen<br />
beruhen.<br />
Preise und Preisverleihung<br />
Der Werner-Ernst-Preis 2013 ist mit insgesamt 4.500 €<br />
dotiert. Vorgesehen ist die Vergabe eines ersten Preises<br />
(2.000 €), eines zweiten Preises (1.500 €) und eines<br />
3/2012 • NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong><br />
dritten Preises (1.000 €). Auf Vorschlag der Jury können<br />
eine Reduzierung der Zahl der Preise und eine andere<br />
Aufteilung der Preissumme erfolgen. Als Anerkennung<br />
für weitere, nicht mit Geldpreisen ausgezeichnete<br />
Wettbewerbsbeiträge stehen wertvolle Buchgeschenke<br />
zur Verfügung.<br />
Die Preise werden im Rahmen des <strong>ARL</strong>-Kongresses am<br />
6./7. Juni 2013 in Hamburg überreicht. Die Verfasserin<br />
bzw. der Verfasser des mit dem ersten Preis ausgezeichneten<br />
Wettbewerbsbeitrages erhält Gelegenheit zur<br />
Vorstellung der Arbeit.<br />
Teilnahmebedingungen<br />
Teilnehmen können Studierende, Absolventinnen und<br />
Absolventen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in<br />
Lehre, Forschung und Praxis aller relevanten Fachbereiche.<br />
Das Höchstalter beträgt 35 Jahre (Stichtag: 15. März<br />
2013). Zugelassen sind auch Arbeiten von Teams aus bis<br />
zu drei Autorinnen/Autoren.<br />
Die eingereichten Arbeiten sind in englischer oder<br />
deutscher Sprache abzufassen und dürfen noch nicht an<br />
anderer Stelle veröffentlicht oder zur Veröffentlichung<br />
angeboten worden sein. Die Arbeiten müssen bis zum<br />
15. März 2013 (Datum des Poststempels) in vierfacher<br />
Druckversion und in elektronischer Version – bevorzugt<br />
auf CD – zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungsbogen<br />
(herunterzuladen von der Website des FRU<br />
unter www.FRU-online.de) bei der Geschäftsstelle des<br />
Förderkreises eingereicht werden. Die Druckversionen<br />
und die elektronische Version müssen identisch sein<br />
und dürfen keinen Hinweis auf die Verfasser enthalten.<br />
Pro Bewerberin/Bewerber kann nur eine Arbeit eingereicht<br />
werden. Über die Preisvergabe entscheidet eine<br />
unabhängige Jury, deren Mitglieder vom FRU bestimmt<br />
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.<br />
Der FRU lädt die Preisträger/Preisträgerinnen zur Teilnahme<br />
am <strong>ARL</strong>-Kongress 2013 in Hamburg ein. Er sorgt<br />
bei Bedarf für Unterkunft und erstattet die Fahrtkosten<br />
nach dem Bundesreisekostengesetz.<br />
Die Preisträger/Preisträgerinnen verpflichten sich zur<br />
unentgeltlichen Übertragung des Rechts zur Veröffentlichung<br />
ihrer eingereichten Arbeiten oder von Teilen<br />
daraus an den FRU bzw. an die <strong>ARL</strong>, sofern in deren<br />
Verlag eine Veröffentlichung erfolgt.<br />
Die Arbeiten sind einzureichen an folgende Adresse:<br />
Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V.<br />
Geschäftsstelle<br />
Jury Werner-Ernst-Preis 2013<br />
<strong>ARL</strong><br />
Hohenzollernstraße 11<br />
30161 Hannover<br />
Auskünfte erteilt Dr. Andreas Klee von der Geschäftsstelle<br />
des FRU, Tel. +49 511 34842-39, Fax +49 511 34842-<br />
41, E-Mail: fru@arl-net.de.
Unter dieser Rubrik erscheinen Hinweise auf kürzlich abgeschlossene<br />
Diplomarbeiten und Dissertationen. Der Förderkreis möchte auf<br />
diese Weise auf Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
aufmerksam machen. Interessenten können die Adressen, an die<br />
Anfragen zu den gemeldeten Arbeiten zu richten sind, über den Förderkreis<br />
erhalten.<br />
Diese Rubrik steht allen inner- und außerhalb des personalen Netzwerks<br />
der <strong>ARL</strong> zur Verfügung; eine Auswahl ist vorbehalten. Informationen<br />
über Arbeiten, die in den folgenden Heften der <strong>ARL</strong>-Nachrichten<br />
veröffentlicht werden können, werden erbeten an:<br />
nfobörse<br />
Nächster Redaktionsschluss: 01.11.2012<br />
Förderkreis Für raum- und umweltForschung<br />
FRU c/o <strong>ARL</strong><br />
Hohenzollernstr. 11<br />
30161 Hannover<br />
Fax: 0511 34842-41<br />
fru@arl-net.de<br />
Diplomarbeiten, Dissertationen etc.<br />
Kürzlich abgeschlossene Arbeiten<br />
HafenCity Universität Hamburg<br />
Department Stadtplanung<br />
■ Matern, Antje<br />
Mehrwert Metropolregion. Erfahrungen von Akteuren<br />
peripherer Räume zur Stadt-Land-Zusammenarbeit in<br />
der Metropolregion Hamburg<br />
(Dissertation, abgeschl. 05/2012)<br />
Universität Heidelberg<br />
Geographisches Institut<br />
■ Claus, Evelyn<br />
Stadtumbau Speyer: Aufgezeigt am Sanierungsgebiet<br />
„Mühlturmstraße/Untere Langgasse“ und der Postgalerie.<br />
Anknüpfung an frühere Zielvorstellungen durch neue<br />
Impulse<br />
(Diplomarbeit, abgeschl. 07/2012)<br />
Wissenschaftliche Beiträge<br />
Band 70<br />
Heft 4<br />
August 2012<br />
Schwerpunktheft:<br />
Vulnerabilität<br />
und Resilienz in<br />
sozio-räumlicher<br />
Perspektive<br />
Papierausgabe:<br />
ISSN 0034-0111<br />
Elektronische Ausgabe:<br />
ISSN 1869-4179<br />
Gabriela B. Christmann / Oliver Ibert<br />
Vulnerability and Resilience in a Socio-Spatial Perspective.<br />
A Social-Scientific Approach<br />
Swen Zehetmair<br />
Societal Aspects of Vulnerability to Natural Hazards<br />
Thilo Lang<br />
How do cities and regions adapt to socio-economic crisis?<br />
Towards an institutionalist approach to urban and regional<br />
resilience<br />
Jörn Birkmann / Claudia Bach / Maike Vollmer<br />
Tools for Resilience Building and Adaptive Spatial Governance.<br />
Challenges for Spatial and Urban Planning in Dealing with<br />
Vulnerability<br />
Tobias Schmidt<br />
Vulnerability Through Resilience? An Example of the<br />
Counterproductive Eects of Spatially Related Governance<br />
in Hamburg-Wilhelmsburg<br />
Marc Wolfram / Rico Vogel<br />
Governance and Design of Urban Infostructures. Analysing<br />
Key Socio-Technical Systems for the Vulnerability and<br />
Resilience of Cities<br />
Thomas Bürk / Manfred Kühn / Hanna Sommer<br />
Stigmatisation of Cities. The Vulnerability of Local Identities<br />
Oliver Ibert / Suntje Schmidt<br />
Acting on Multiple Stages. How Musical Actors Construct<br />
Their Labour-Market Vulnerability and Resilience<br />
Gerd Lintz / Peter Wirth / Jörn Harfst<br />
Regional Structural Change and Resilience. From Lignite<br />
Mining to Tourism in the Lusatian Lakeland<br />
Georg Schiller / Andreas Blum / Martin Behnisch<br />
Resource Eciency of Settlement Structures: Terms,<br />
Conceptual Implications and Connecting Factors to the<br />
Resilience Debate<br />
Bestellungen nimmt der Verlag entgegen:<br />
Springer Customer Service Center GmbH<br />
Haberstraße 7, 69126 Heidelberg<br />
Tel. (+49-6221) 3454303<br />
Fax (+49-6221) 3454229<br />
E-Mail: subscriptions@springer.com<br />
www.springer.com/geography/human+geography/journal/13147<br />
NACHRICHTEN DER <strong>ARL</strong> • 3/2012 51
ISSN 1612-3891<br />
(Printausgabe)<br />
ISSN 1612-3905<br />
(Internetausgabe)<br />
www.arl-net.de Gedruckt auf 100% Recyclingpapier